God and Being / Gott und Sein: The Problem of Ontology in the Philosophical Theology of Paul Tillich / Das Problem der Ontologie in der Philosophischen Theologie Paul Tillichs. Contributions made to the II. International Paul Tillich Symposium held in Frankfurt 1988. [Reprint 2015 ed.] 3110122545, 9783110122541, 9783110853476
Book by Hummel, Gert
187 44 13MB
English, German Pages 282 [280] Year 1989
Polecaj historie
Table of contents :
Vorwort
Möglichkeiten der ontologischen Rede von Gott
Tillichs Kritik des Supranaturalismus
Fables of Identity
Heterology and Ontology in the Thought of Paul Tillich
Passion und Paradox — Der Expressionismus als Verstehenshintergrund der theologischen Anfänge Paul Tillichs. Ein Versuch
Ontologie: Zur Begriffsbestimmung bei Tillich in den zwanziger Jahren
Der Begriff der „Gestalt“ als Schlüssel zur Metaphysik im Frühwerk Paul Tillichs
Gestaltweisen der ontologischen Rede von Gott
Being and History in Paul Tillich’s Theology
Die Wiedervereinigung des Getrennten und das Problem der Zeit
Tillich's Theology of Culture in the Encounter between East and West: Ontology and Utopia
Symbol und göttliches Sein
Open Questions Concerning a Personal God in Paul Tillich's Systematic Theology
Unser Reden von Gott zwischen Theismus und Atheismus
Folgen der ontologischen Rede von Gott
Analytical Philosophy and Tillich's Views on Freedom
Wahrheit und Kairos beim frühen Tillich
Einige Bemerkungen über die Bedeutung des Nichts in Tillichs Religionsverständnis und für die religiöse Erfahrung der Moderne
Paul Tillich, Ontology and Cultural Boundaries
The Limits and Possibilities of Tillich's Ontology for Cross- Cultural and Feminist Theology
Verzeichnis der Autoren
Citation preview
GOD AND BEING / GOTT UND SEIN
w DE
G
GOD AND BEING / GOTT UND SEIN THE PROBLEM OF ONTOLOGY IN THE PHILOSOPHICAL THEOLOGY OF PAUL TILLICH DAS PROBLEM DER ONTOLOGIE IN DER PHILOSOPHISCHEN THEOLOGIE PAUL TILLICHS CONTRIBUTIONS MADE TO THE II. INTERNATIONAL PAUL TILLICH SYMPOSIUM HELD IN FRANKFURT 1988 BEITRÄGE DES II. INTERNATIONALEN PAUL-TILLICH-SYMPOSIONS IN FRANKFURT 1988
EDITED BY / HERAUSGEGEBEN VON
GERT HUMMEL
WALTER DE GRUYTER · BERLIN · NEW YORK 1989
THEOLOGISCHE BIBLIOTHEK TÖPELMANN HERAUSGEGEBEN VON K. ALAND, O. BAYER, W. HÄRLE, H.-P. MÜLLER UND C. H. RATSCHOW 47. BAND
Library of Congress Cataloging in Publication Data "Library of Congress Catalog Current Number 89-48347" ISBN 0-89925-672-4 Walter de Gruyter, Inc., New York
Deutsche Bibliothek Cataloguing in Publication
Data
God and being : the problem of ontology in the philosophical theology of Paul Tillich ; contributions made to the II. International Paul Tillich Symposium held in Frankfurt 1988 = Gott und Sein / ed. by Gert Hummel. — Berlin ; New York : de Gruyter, 1989 (Theologische Bibliothek Töpelmann ; Bd. 47) ISBN 3-11-012254-5 NE: Hummel, Gert [Hrsg.]; Internationales Paul-Tillich-Symposium u einer Seins-Gestalt höherer Ordnung, ζ. B. zu einer Kirche, der die Verwaltung der Gnadensubstanz anvertraut ist." (GW VII, 40) Das supranaturalistische Verständnis des Verhältnisses von Transzendenz und Immanenz betrachtet infolgedessen „das Transzendente als einen zweiten gegenständlichen .Bereich' wunderbarer Geschehnisse und himmlischer Gestalten (einschließlich Gottes) neben der natürlichen Welt der Geschichte" (GW X, 290). Die GottMensch-Beziehung ist bestimmt durch „Unterscheidung zweier Schichten" (STh III, 25), „Weltgeschichte und Heilsgeschichte (werden) als zwei getrennte Bereiche" (STh III, 414) betrachtet. Solcher „Dualismus" (STh III, 137) vollendet sich im „Aufbau ... einer Welt neben oder über der Welt" (GW III, 212), „eine(r) Welt, in welcher das Unbedingte eine räumliche Stelle hat — sei es, daß Gott zu einem jenseitigen Objekt, die Schöpfung zu einem Akt am Anfang der Zeit, oder die Vollendung zu einem zukünftigen Zustand der Dinge gemacht werden" (GW IV, 106). Durch solche Vergegenständlichung der religiösen Inhalte (vgl. GW IX, 56) erweist sich der Supranaturalismus als „rationalistische(r) Irrationalismus" (GW IX, 254) und als ein Spiegelbild des Naturalismus. „... der Supranaturalismus ist nur der auf gleicher Ebene stehende Partner des Naturalismus und umgekehrt. Der eine ruft den anderen auf den Plan, und ihr Kampf ist immer unentschieden. Keiner kann ohne den anderen leben." (GW IX, 104) Indem sich der Supranaturalismus zur Alternative des Naturalismus stilisiert, bestimmt er sich selbst durch den Gegensatz zu diesem und reproduziert auf seine Weise eben jenes, was er mühsam zu verabschieden gedenkt. Er etabliert eine „supranatu-
24
Gunther Wenz
rale Gegenstandssphäre" (GW IX, 57), die durch den von der gesamten humanistischen Gesellschaft rezipierten Protest Nietzsches gegen die ,Hinterwelt' auch aus religiösen Gründen zurecht erledigt worden sei. Denn die supranaturale Verdinglichung des Unbedingten „zu kritisieren, selbst wenn es zu atheistischen Konsequenzen führen sollte, ist religiöser als ein Theismus, der Gott in einen supranaturalen Bereich verbannt, weil (solche Kritik) den unbedingten Charakter des Göttlichen mehr anerkennt als jener" (GW IV, 106). Im übrigen kennzeichnet Tillich den Supranaturalismus mehr oder minder stereotyp als autoritär (GW VI, 72), mittelalterlich (GW III, 212), antiautonom (GW XIII, 119) und antirational (GW VIII, 176), dem protestantischen Prinzip widerstrebend (GW VII, 27), ethisch defizitär (GW III, 70 ff.), ja destruktiv (STh I, 165) usw. Eine Neigung zum Aberglauben (STh II, 119) zeige sich insbesondere im Wunderverständnis (vgl. STh 1,139 ff.). Entscheidend aber sei sein dualistisch-undialektischer Charakter (STh III, 137). In dem Vorwurf, nicht dialektisch zu sein, faßt sich denn auch Tillichs Kritik gegen den angeblichen NeoSupranaturalismus der sog. Dialektischen Theologie zusammen, gegen den mit einem „Panzer heteronome(r) Absolutheitsansprüche" (GW XII, 28) gerüsteten „Barthschen Supranaturalismus" (GW VIII, 214; GW XII, 33; vgl. bes. GW VII, 2 4 7 - 2 6 2 ) . Wie sich diese Etikettierung verhält zu Tillichs Kritik der, wie er sagt, „billigen und plumpen Art, alle Theologen einzuteilen in Naturalisten und Supranaturalisten oder in Liberale und Orthodoxe" (GW VII, 13), braucht hier nicht entschieden zu werden. Immerhin ist es bemerkenswert, daß Tillich nach eigenem Bekunden selbst von Betrachtern der theologischen Szene zum Neosupranaturalisten abgestempelt wurde (GW VII, 13). Daß er dies nach Maßgabe seines eigenen Supranaturalismusbegriffs nicht war, ist klar und bedarf keines weiteren Kommentars. Auch der Hinweis auf die Tatsache, daß sich Tillich in seinen Anfängen durchaus dem theologischen Neuaufbruch der 20er Jahre verbunden wußte, ist in diesem Zusammenhang ohne großen Erkenntniswert; denn bekanntlich hat er sich spätestens dann von Barth abgewandt, als er eingesehen zu haben glaubte, dessen unmittelbares Insistieren auf Gottes absoluter Souveränität und Allmacht mache jede Möglichkeit endlicher Freiheit zunichte. Reizvoller wäre es schon, die These, Tillich sei ein verkappter Neosupranaturalist, gegen ihren ursprünglich beabsichtigten Sinn als Indiz eines bestehenden Zusammenhangs seines Denkens mit jenen
Tillichs Kritik des Supranaturalismus
25
geschichtlichen Supranaturalisten zu werten, die ihren Namen zumal aufgrund der Eigenart ihrer Kantrezeption, namentlich ihrer Verhältnisbestimmung von Religion und Moral erhalten haben. Denn deren Grundthese, daß nämlich die Religion für die Moral von durchaus konstitutiver Bedeutung sei, scheint Tillich unbeschadet aller sonstigen Vorbehalte grundsätzlich zu übernehmen. 33 An seinem Theonomiekonzept sei das skizzenhaft exemplifiziert. Spätestens seit der programmatischen Schrift ,Über die Idee einer Theologie der Kultur' von 1919 prägte der Theonomiebegriff Tillichs Denken bekanntlich in entscheidender Weise. Er bezeichnet näherhin ein religiös fundiertes Kultur- und Gesellschaftsleben, in welchem die selbstgesetzlichen Formen menschlichen Denkens und Handelns nicht durch äußerliche Fremdbestimmung zerbrochen, wohl aber mit transzendentem Gehalt erfüllt werden, so daß sowohl Heteronomie als auch unmittelbar selbstbestimmende Autonomie als überwunden zu gelten haben. Bemerkenswerterweise hat sich der Theonomiebegriff so eng mit Namen und Werk Paul Tillichs verbunden, daß dieser nicht selten als sein Urheber ausgegeben wird. Demgegenüber hat F. W. Graf unlängst in subtiler historischer und lexikographischer Detailarbeit nachgewiesen, daß der Theonomiebegriff keineswegs erst von Tillich in die theologische Diskussion eingeführt wurde, sondern eine Geschichte hat, die weit hinter die Theologie der 20er Jahre unseres Säkulums ins frühe 19. Jahrhundert zurückreicht. Auch wenn sich der Ursprung des Begriffs bisher nicht präzise bezeichnen läßt, so ist doch deutlich, daß er jenen zahlreichen Neologismen zugehört, welche im Zusammenhang der Kontroversen um die Autonomielehre der Kantischen Moraltheorie entstanden sind. 34 Diente der Theonomiebegriff im protestantisch-liberaltheologischen Kantianismus zunächst einer konstruktiven Stärkung vernünftiger Autonomie, so wurde er später von den theologischen Kritikern neuzeitlicher Kultur zu einem Kampfbegriff zur Restriktion moderner Autonomieansprüche umgemünzt (19). Das gilt nach Graf namentlich für die konser-
33
34
Vgl. G. Wenz, Reformatorische Ethik unter neuzeitlichen Bedingungen. Zu Paul Tillichs Moraltheorie, in: Dialog. Mitteilungsblatt der Deutschen Paul-TillichGesellschaft NF 6 (1988), 1 - 6 ; Fortsetzung folgt in Heft 9 (1989). F. W. Graf, Theonomie. Fallstudien zum Integrationsanspruch neuzeitlicher Theologie, Gütersloh 1987, hier bes. 30 ff. Die folgenden Seitenverweise im Text beziehen sich hierauf.
26
Gunther Wenz
vativen Vertreter des konfessionalistischen Luthertums, aber auch für zahlreiche römisch-katholische Theologen, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts den Terminus Theonomie zu einem meist dezidiert autonomiekritisch verwendeten Leitbegriff ihrer Moraltheologie erklären (15). Charakteristisch für die modernitätskritische Verwendung des Theonomiebegriffs ist nach Graf insbesondere die Annahme, daß man die Gottesgesetzgebung materialiter, nämlich im Sinne spezieller religiössittlicher, vernunftunabhängiger bzw. suprarationaler Wertprämissen zu fassen habe. Graf verdeutlicht dies am Beispiel des Erweckungstheologen Julius Müller (77 — 127), sowie am Beispiel des dänischen Lutheraners und Bischofs von Seeland Hans Lassen Martensen (193—230), deren theonomer Antimodernismus gekennzeichnet sei durch eine an der Exklusivität des göttlichen Gesetzes orientierte antipluralistische materiale Ordnungsethik bzw. durch die Tendenz zu einem substantialistisch gefaßten, geschichtstheologisch-eschatologischen Wertkonsens. Demgegenüber sei für den protestantischen Frühliberalismus, als dessen Prototyp Wilhelm Traugott Krug (39—76) vorgestellt wird, gerade die rein formale Bestimmung von Theonomie signifikant, derzufolge der Begriff der Theonomie den der Autonomie inhaltlich nicht überbiete, vielmehr nur für die Notwendigkeit der Anerkennung der der Autonomie eigenen Verbindlichkeit und Willkürbegrenzung stehe. Für dieses liberale Programm scheint auch noch Tillich einzutreten, etwa wenn er in seinem Theonomieartikel in der zweiten Auflage der RGG bündig schreibt: Theonomie „entsteht nicht durch Verzicht auf Autonomie etwa im Sinne des kath. Autoritätsgedankens, sondern nur durch Vertiefung der Autonomie in sich selbst bis zu dem Punkt, wo sie über sich hinausweist. Das Transzendieren der autonomen Formen in Kultur und Gesellschaft, ihr Geprägtsein von einem sie tragenden und zugleich durchbrechenden (nicht zerbrechenden) Prinzip: das ist Th(eonomie)." 35 Theonomie ist in dieser Formel offenbar ein Ausdruck für jene vernünftig autonome Selbstrelativierung, die mit der Erkenntnis eigener Begrenztheit zugleich zur Anerkenntnis der Legitimität und Notwendigkeit eines Positionenpluralismus gelangt, welche die restaurative Idee kirchlich dominierter, theokratischer Einheitskultur ebenso hinter sich läßt wie den revolutionär-anarchischen Terror schrankenloser,
35
P. Tillich, Art. Theonomie, in: RGG 2 , Bd. V, Sp. 1128.
Tillichs Kritik des Supranaturalismus
27
unmittelbar selbstbestimmter Autonomie. Theonomie würde in diesem Sinne nichts anderes als die internen Grenzen des Bewußtseins von Autonomie bezeichnen. Nun kann man freilich fragen, ob Tillichs Theonomiekonzept der 20er Jahre wirklich primär von liberalen Motiven geprägt ist und nicht viel eher ein „Programm einer neuen, sozialistisch geprägten religiösen .Einheitskultur' " 3 6 darstellt. Wie dem auch sei; Faktum ist, daß Tillich in der Religion mehr sah als ein Moment im Realisationszusammenhang autonomer Vernunftmoral. Zweifellos nämlich wies er der Religion eine konstitutive Bedeutung für die Begründung moralischer und kultureller Lebensvollzüge zu und betonte ihre Eigenbedeutung dem autonom Kulturellen und Ethischen gegenüber. Wogegen Tillich sich wendete, war einzig und allein die Annahme, der religiöse Sinngehalt sei mit einer bestimmten kulturell-moralischen Sinnform unmittelbar zu identifizieren. Tillichs gesamte Supranaturalismuskritik ist im Grunde sachlich auf diesen einen Aspekt beschränkt. Supranaturalismus — das bezeichnet für ihn recht eigentlich nicht mehr und nicht weniger als den unstatthaften Versuch einer Verabsolutierung bedingter Sinnformen. Um solche Verabsolutierung zu verhindern, muß Tillich schließlich den unbedingten Sinngehalt auch von allen religiösen Sinnvollzügen abheben und kann der Religion nur eine relative Selbständigkeit zubilligen, welche sie sinnvoll allein dadurch zur Geltung zu bringen vermag, daß sie alle bedingten Sinnformen und Sinngestalten zu permanenter Selbsttranszendenz motiviert. Indes hängt die gesamte Konzeption an der ontologischen Prämisse der Unaufhebbarkeit und absoluten Positivität des unbedingten Sinngrundes und der durch dessen behauptete Unaufhebbarkeit und Positivität begründeten Annahme einer dauerhaften Asymmetrie zwischen unbedingtem Sinngehalt und bedingten Sinnformen. 37 Zwar macht Tillich von diesen Voraussetzungen keinen unmittelbar dogmatischen Gebrauch, setzt sie vielmehr nur funktional, nämlich zu dem Zwecke ein, „die moralisch-kulturelle Lebenswelt dem unabschließbaren Prozeß permanenter Kritik und Konstruktion auszusetzen" 38 . Gleich36 37
38
F. W. Graf, a. a. O. 20. Vgl. im einzelnen: F. Wagner, Absolute Positivität. Das Grundthema der Theologie Paul Tillichs, in: NZSyTh 15 (1973), 1 7 2 - 1 9 1 ; ders., Was ist Religion? Studien zu ihrem Begriff und Thema in Geschichte und Gegenwart, Gütersloh 1986, bes. 379 - 385, 492 - 498. F. Wagner, Religion, 498.
28
Gunther Wenz
wohl bleibt die Prämisse der unaufhebbaren Positivität des unbedingten Sinngrundes eine (für das Funktionieren des Gesamtsystems unentbehrliche) Vorgabe, welche auf ein unvordenkliches, nur durch Offenbarung sich erschließendes Datum verweist, wobei mit Tillichs wichtigstem philosophischen Gewährsmann, dem späten Schelling, hinzuzufügen ist, daß „niemand, der nur weiß, wovon die Rede ist, wenn er von Offenbarung spricht, sich einbilden (wird), als wäre diese etwas a priori zu Begreifendes" 39 . Mit gewissem Recht könnte daher — und zwar sowohl im Blick auf seine These, die Religion sei Grund aller moralischen und kulturellen Sinnvollzüge, als auch hinsichtlich der Durchführung dieser These — der strenge Supranaturalismuskritiker Paul Tillich selbst ein — horribile dictu — Supranaturalist genannt werden. Indes geht es hier nicht um eine pointierte These: Worauf es ankommt, ist vielmehr ein eher schlichtes Ergebnis, das im Grund schon in dem zitierten Lütgertbrief und in dem Dissertations-Gutachten der hallischen Fakultät ausgesprochen ist. Auf begrifflich-spekulativem Gebiet einschließlich der zu jeder gelungenen Systematik gehörenden Gegenwartsanalytik hat Tillich Hervorragendes geleistet; als Historiograph und Theologiegeschichtsschreiber hingegen ist er eher mittelmäßig. Das beweisen am eklatantesten seine ,Vorlesungen über die Geschichte des christlichen Denkens' (EW1/ II); das bestätigt aber auch seine Supranaturalismuskritik über alle Entwicklungsstationen. Einen Eindruck von der differenzierten Debatte im Zusammenhang der theologischen Kantrezeption vermittelt sie nur in sehr bescheidenem Maße, und so trifft sie — theologiehistorisch betrachtet — allenfalls den vorkantischen Supranaturalismus bzw. den kantisch geprägten Supranaturalismus allein insofern, als dieser Kants Kritik der theoretischen Vernunft zur Restitution einer vorkritischen Metaphysik mißbraucht. Die auf Kants praktische Philosophie konzentrierte supranaturalistische These einer konstitutiven Funktion der Religion für die Moral hingegen ist durch Tillichs Einwände im wesentlichen
39
F. W. J. Schelling, Philosophie der Offenbarung, 2. Band, Darmstadt 1983 (unveränderter reprografischer Nachdruck der Ausgabe von 1858), 11; vgl. dazu G. Wenz, Subjekt und Sein. Die Entwicklung der Theologie Paul Tillichs, München 1979, bes. 58—110 sowie ders., Die reformatorische Perspektive: Der Einfluß Martin Kählers auf Tillich, in: H. Fischer (Hg.), Paul Tillich. Studien zu einer Theologie der Moderne, Frankfurt 1989, 6 2 - 8 9 .
Ullichs Kritik des Supranaturalismus
29
nicht berührt; vielmehr gilt, daß der Supranaturalismuskritiker Tillich sich in der Frage der Verhältnisbestimmung von Religion und Moral das Anliegen historischer Supranaturalisten auf seine Weise durchaus zu eigen gemacht hat. Es bleibt also bei Lütgerts Urteil: Tillichs Kritik des Supranaturalismus ist nicht historisch, sondern „rein formal logischdialektisch, lediglich die Kritik eines Begriffes" (EW V, 102) — nicht mehr, freilich auch nicht weniger.
VICTOR NUOVO
Fables of Identity1 I. Paul Tillich concluded the Richard lectures, given at the University o f Virginia in 1 9 5 1 , and published under the title, Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality,2 b y asserting the identity of the G o d of the philosophers and the god o f A b r a h a m , Isaac and J a c o b . 3 His statement reads like a solemn pronouncement, a fateful assertion, a declaration of his o w n historic role in the theological enterprise, a summation n o t only of these lectures but o f his life's w o r k , o f its inevitable tendency and meaning. Yet it is not clear what Tillich meant by this assertion. He meant it as an expression of the ultimate unity or identity o f biblical religion and philosophical theology. But w h e n w e
1
An earlier version of this paper, entitled "Paul Tillich and the God of the Philosophers," was presented in November 1987 at a special symposium at the annual meeting of the American Academy of Religion marking the one-hundredth birthdays of Karl Barth and Paul Tillich. I am grateful to Robert Scharlemann who organized the symposium and invited me to participate, and to my fellow participants, Martin Rumscheid and Alexander McKelway, whose comments were very helpful to me when rewriting the paper. From McKelway, who responded to papers by Rumscheid and me, I had the benefit of a detailed critical analysis. The paper has been rewritten and given a new title for presentation at the Second International Paul Tillich Symposium held in Frankfurt, West Germany in May, 1988. I am grateful to Gert Hummel who invited me to attend the conference and present the paper. The title, "Fables of Identity" is borrowed from Northrup Frye's volume of papers (Fables of Identity, New York, 1963).
2
Biblical religion and the Search for Ultimate Reality, Chicago: University of Chicago Press, 1955. Hereafter, all citations of this work will be given by page number in parentheses in the text. "Against Pascal I say: The God of Abraham, Isaac, and Jacob and the God of the philosophers is the same God." (82)
3
Fables of Identity
31
ask: "What is united, what is the same, and just what is this assertion supposed to say to us?", no clear answers are sounded. If there are answers to these questions, to the question of the meaning of Tillich's assertion, then they must be found in the lectures themselves. Before I begin this exploration, however, I shall present briefly another interpretation of this assertion. It is not one that Tillich would have found acceptable for reasons that, I trust, will become clear. The contrast should help to bring into focus the peculiar features of what I take to be Tillich's interpretation. On this interpretation, the statement, "The God of the Philosophers is the God of Abraham, Isaac and Jacob", is a simple identity statement. The 'is' is the 'is' of identity. What Abraham and his descendents say about God, who has revealed himself to them, is, if true, true also of the God whose nature and being the philosophers have discovered through their physical and metaphysical investigations. And what the philosophers have discovered about God is, if true, true also of the God of Abraham. Also, on this interpretation, we may assume that whoever would make such a statement must believe that much, if not all, that prophets and philosophers say about God is true. He must believe that the prophets and philosophers about whom he speaks know enough about their God to know what they are talking about, that is, to refer, and he may justify this belief by claiming, in the one instance, that God has disclosed himself to the prophets in a special way, and, in the other, that God does not hide himself from philosophers who honestly seek him. Thus, it would seem that the same God who called Abraham from Ur of the Chaldees with promises of greatness for his descendents, who rescued the children of Israel from Egypt, who delivered the Law to Moses on Sinai, who became flesh in order to bring grace and truth to those who believe, and so forth, is the first cause and author of existence, a perfect being whose essence is to be, who is omnipotent, omniscient, immutable, and so forth. Most theologians who subscribe to this assertion, and I believe that this includes, even today, most theologians, understand it in this way. Pascalian theologians, who would deny the claim that the God of Abraham, et al. is the God of the philosophers, would also agree with these logical assumptions. In behalf of Abraham and his natural and supernatural descendents, biblical theologians may deny the assertion because they are certain that when philosophers talk about God they are not talking about the one true God but about a fiction, something
32
Victor Nuovo
o f their o w n making. A n d , they might add, if philosophers, w h e n talking about their G o d , should say something about this fiction that happens to be true of G o d , it w o u l d be a mere coincidence. Or, put referentially, Pascalan theologians might argue that what philosophers claim about G o d is not only mostly false but misleading, in the sense, that anyone w h o believed these things about G o d could not properly refer t o G o d . 4 Likewise, philosophers w h o are advocates of natural religion and enemies of superstition, w o u l d say the same about their biblical theological counterparts. 5 Tillich's interpretation of this identity statement differs fundamentally f r o m this. He asserts not that the G o d o f A b r a h a m , et al., is the same object o r the same being as the G o d o f the philosophers, but that w h a t the descendents of Abraham say about G o d means the same as w h a t the philosophers say about G o d . He asserts n o t the identity of a
4
5
One must make one's apologies to Pascal for this misuse of his name. Pascal does not deny that some philosophers have knowledge of God; rather, he denies that such knowledge if it should occur could be saving. Saving knowledge consists of two parts: a knowledge of God and a knowledge of our ruined condition which prevents us from properly appropriating a knowledge of God. Knowledge of God alone leads to arrogance and despair. Cf., Pascal, Pensees, art. 449, English translation, Penguin Books, p. 168. The Pascalian position which Tillich contradicts is a somewhat unsubtle, that is, rhetorically exaggerrated version of Barthianism, viz. that the knowledge of God comes only through revelation in which reason plays no positive role. The Pascalian denial should also be read, perhaps, as a declaration or solemn pronouncement. It is meant to be exclusionary, and in its broadest scope, it separates two cultures of forms of life. This exclusionary sense implies that theological statements made by philosophers are not false. They may be true, but, true or false, they are about a fictitious object whom philosophers call 'God.' But, suppose both philosophers and prophets assert that there is one and only one God, and suppose this is true. Suppose, also, that the philosophers say nothing about God that, from the standpoint of biblical theology, is true except this, that there is one and only one God. Would the Pascal's declaration apply here? Pragmatically or rhetorically, yes, but I am uncertain whether, semantically, one should answer yes or no. It all depends on how the statement, 'There is one and only one God,' refers. Or suppose philosophers were to enlarge their basic assertion: "The one and only God is impersonal and indifferent to human affairs." (or, "There is one and only one God and he is impersonal and indifferent to human affairs.") From the standpoint of biblical theology, this is false. But from a stricter Pascalian standpoint, when said by a philosopher, it would be true but true of a fiction and not of the one true God.
Fables of Identity
33
being known under different descriptions, but the identity of contrary meanings or trains of thought or of contrary traditions and systems of thought which, in any ordinary sense of the word, have no object. Yet, he cannot mean this literally, for the meanings that he identifies are obviously different. Therefore, if literal and figurative are our only alternatives, then he must mean 'identify' in a figurative sense. Also, the semantical concept of truth that is implied in the previous account is also implicitly denied by Tillich. While Tillich would agree that the claims of honest philosophical theologians and genuine prophets are equally true, the content of their assertions is not representational but expressive, and while it would be mistaken to infer that expressive truths are, unlike representational ones, non-referential, their mode of reference is fundamentally different from the other. How it is different, I shall not attempt to relate until I have given a more detailed account of the reflections that led Tillich to this conclusion. "Reflections" is the right word here, for Tillich's statement of the identity of the God of Abraham and the God of the philosophers is not the conclusion of an argument (although at a decisive point in his reflections he presents an argument) but the summation of the self-reflection of a consciousness filled with the thoughts of prophets and philosophers. Tillich's reflection is not without a method, however. He identifies it as one of analysis and synthesis. The terms denote a deductive method, whose origins can be traced to ancient mathematics.6 Tillich's use of it derives from more recent philosophical adaptations of it and should be characterized as transcendental deductive. The first phase of this method, analysis, is employed when there appears to be no sure principle from which to deduce a desired conclusion. One assumes the conclusion and ascends, or, on Tillich's imagery, descends, in search of what must be the case if the conclusion be true. The search continues until something known, which also has the properties of a first principle, is reached. There, one reverses one's direction and proceeds deductively to the conclusion. Tillich's method of analysis begins with doctrinal conflicts and proceeds inwards to states of consciousness or attitudes whose expressions these opposing doctrines are. It ends when it reaches a point of identity-cum-difference: the identity of attitudes, viz., of ultimate 6
Cf. Morris R. Cohen & I. E. Drabkin, editors, A Source Book in Greek Science, Cambridge, Mass., 1948, pp. 38—41.
34
Victor Nuovo
concerns, which nonetheless, by virtue of their content and even more o f their modality (faith and doubt) appear unalterably opposed. This point of an unavoidable coincidence of opposites in consciousness is his starting point for the synthesis or "deduction" that is to lead to the conclusion that the God of the philosophers is the God o f Abraham. Tillich's argument that a synthesis is necessary, which comes at this turning point, is supposed to compel us, logically, to reverse our course and attitude.
II. A basic assumption that gives direction to Tillich's reflections, is that biblical religion and ontology are not just two historical forms of human spiritual life which are traditionally and not without principle opposed to each other, but are, rather, instances of types or modes of reflexivity or self-consciousness which together constitute the entire field of the life o f the mind everywhere and always. These two modes characterize the two basic classes of the contents of the mind, the concrete-personal and the abstract-impersonal. I f they are unalterably opposed, then the human spirit is unalterably and fundamentally divided. But this cannot be, or, at least, we must not allow it, for this dividedness is not a condition that we can view dispassionately and with detachment as a fault in something not ourselves. It is our own condition, not our nature but the tragic fate of thinking. The analysis that Tillich presents as the first stage of his reflections is supposed to be a descent into our own selves, a plumbing to the deepest metaphysical depths o f our being. Specifically, then, it is assumed that biblical religion is normative for all other religion, because it contains the criterion by which every religious content, including its own, is to be judged, and that ontology as it is represented here is not just one philosophical point of view among others, but is the source and origin of philosophical inquiry as such, a universally human intention that informs all philosophical questioning. It is also assumed that the principles of both are original contents o f consciousness, basic to human thought and experience everywhere and always. As the character of each form is drawn and is comprehended, it should become clear that each intrinsically presupposes the other. This intrinsic fit Tillich depicts as the unity of an antithesis.
Fables o f Identity
35
Biblical religion and ontology are related as faith to doubt, and each is present at the heart of the other. Biblical religion is ontology's faith, ontology is biblical religion's doubt. Faith's doubt, doubt's faith. " T h e philosopher has not and has; the believer has and has not. This is the basis on which ontology and biblical religion find each other." (62) Here the analysis ends. Perfect identity is expressed in the form of a perfect fit, and on this foundation in the soul reconciliation begins and the mind is led on the way to a grand synthesis. The movement of thought that culminates in the assertion of identity goes from surface to depth and from depth to surface again. On the surface are apparent beliefs concerning the proper objects of prophets and philosophers; deep within are the attitude and structure of consciousness. Prima facie, biblical religion and ontology are opposed. They are opposed on the issue of personalism. G o d is personal, being is not. All religion is founded upon an encounter with the holy, a mysterious or numinous presence. Religious consciousness receives or represents this presence and its relation to it as personal. Biblical religion exemplifies this relation in its purest form, and, what is more, through its representation of the divine-human encounter, it discloses the universal norm of personal existence. Because the biblical g o d is personal, and because this god is the proper object of our ultimate concern, personal existence is not only realized in an original and fundamental way, but it is assured. Ontology threatens this blessed assurance, for being, which is the ultimate goal of ontology's quest, is impersonal. The object of religion's ultimate concern is a personal god; the object of ontology's concern, which is no less ultimate, is impersonal being. There seems no resolution of this opposition. Parenthetically, it should be noted that there is an anti-Kantian intent implied in this construction of biblical religion. The relation of the individual to G o d in biblical religion is characterized as primarily moral. One becomes a person in an encounter with G o d and only then are personality, morality, and a moral community of persons established. Thus morality depends upon religion, or, more precisely, upon biblical religion. My reason for noting this is neither to justify nor to dispute this departure from Kant, although if I were called upon to do one or the other, I would choose Kant's side, but to bring to light a further characteristic of the opposition that Tillich is drawing here. The anti-
36
Victor N u o v o
Kantian Tillich still falls back on Kantian constructions. Opposed here are theoretical and practical or moral reason and their a priori constituted objects, or, more vividly put, the two things that fill the Kantian mind. 7 The one involves a person who is autonomous, responsible, disobedient and sinful, penitent, a recipient of grace; the other binds the person to an individual life that is subject to impersonal alien powers, that receives its being only for a time before it loses everything and becomes nothing. But there is something unKantian and speculative about the theoretical mind as Tillich represents it, which adds an additional point of opposition. A personal relationship is one between rational agents, who communicate by speaking, through words that mediate their relationship. Speaking, even when it is theoretical discourse, is inherently moral. The mediated relationship allows concealment and deception. Ontological consciousness, on the other hand, originates in an unmediated awareness of being, in participation (for Tillich, participation is a state that always involves immediacy), in a mystical or intellectual intuition, which, although for the individual consciousness is momentary and finite, expresses infinity and eternity. Biblical personalism and morality require the separation of God and persons, of creation and creator. Whatever unity there is, is one of will and purpose. Ontology is indifferent to this, indeed to all difference and, hence, to every particularity. Thus, an ontological consciousness could not conceive of the possibility that god should be revealed in a uniquely human life which was lived as the climax of a history of a nation chosen to be the bearer of divine justice to the world, whose relation to God is based upon a covenant and promise, nor could it, in its timelessness, conceive of an end of history, of a new being and a new creation. In Chapter VI of the book, 8 Tillich reaches the central and decisive moment of the work. There is a turning inward from the periphery of
7 8
Kant, K d p r V , Werke, V, pp. 161 f. In the published text, Tillich speaks of a different division than the division into chapters actually followed in the book (see p. 21, 43, 63). It seems plausible that these citations of chapter divisions apply to the original lectures which were then further subdivided for publication, but I have been unable to confirm this. A search for the manuscript of the original lectures in the Tillich Archive was unsuccessful.
Fables of Identity
37
content to the center, a deeper analysis. Instead of the objective side of biblical religion and ontology, namely, doctrines and concepts, we are to examine their inner or subjective aspects. We consider the prophet and the philosopher alone with themselves. Unrelieved opposition is still the rule of Tillich's exposition. The Prophet, even in the solitude that his spiritual life requires is the bearer of a community's traditions and values, but the philosopher, in his deepest questioning and respect for truth, finds himself altogether alone, cut off from his most cherished forms of life. 9 Yet this opposition is no longer an external one. The subjective analysis proves to be a self-analysis. The opposition is in ourselves, and, if, for this reason the situation becomes desparate, for the same reason there is also hope, albeit a desparate hope, that it may be resolved in the unity of thought or through the unity or identity or the indifference that underlies thought. At the very least, it should be clear that the opposition of biblical religion and ontology is not for us a matter of indifference. It is our destiny. Tillich writes: Again one may ask: Is it not impossible to unite the solitude of the prophet which binds him to the community with the loneliness of the philosopher which separates him from the community? And does not every one of us, whether bound by biblical religion or driven to radical doubt, experience something of the destiny of the prophet and the philosopher within himself, although perhaps in a less extreme form? ( 4 9 - 5 0 ) Oppositions multiply. Agape confronts eros. Faith, as religious existence, a state of being grasped, as surrender, obedient assent, infinite passion and participation "in the good and the true" 10 [sic] as the
9
10
This suggests that the basic attitudes of faith and doubt are functions of the social situation of thinking. Typically, the prophet, even as thinker, has a duty to a certain community, to its values and traditions and to its future; the philosopher, although not a private person, has obligations to standards that belong to no heritage and that are, or are supposed to be prior to community. Hence, the philosopher, even when she serves the community, as invariably she does, must remain independent from it. The inclusion of an infinite passion for the true and the good among biblical motives seems to be a mistaken transfer; an echo effect spontaneous in a mind disposed to synthesis.
38
Victor Nuovo
presupposition of thinking, is opposed to an attitude of "depersonalized activity", detachment, radical doubt, and the unlimited range of inquiry that belong to ontology, which in principle, has no knowledge of the distortions of sin that necessitate an original faith. The final conflict is between faith and autonomous reason, each claiming for itself an ultimacy that would undermine the proper claims of the other. If a synthesis, which would preserve each, is not possible, then there is no alternative but to choose one and repress the other. The first step towards a synthesis is to show that one is necessary, which Tillich attempts to do by means of the following argument (58): A. The philosopher's doubt is a state of ultimate concern. B. The prophet's faith is a state of an ultimate concern. C. Therefore, both the prophet's faith and the philosopher's doubt are both ultimate concerns and as such are identical (or "equal", to use Tillich's term). This conclusion results by combining A. and B. Later on (62) Tillich asserts that they are "structurally identical", which is to say that they are formally the same, or that they are instances of the same attitude, although, prima facie, at least, with different contents. Here we have identity, but it is not an identity of content. Moreover, by virtue of this identity of structure we might expect no resolution of the conflict, nor the need for one, because the same attitude that governs the opposing thoughts of prophets and philosophers will keep them apart. Each must deny the truth of the other's claim, because the modality and quantity of their claim excludes any other. An additional premise it required to avoid this consequence. D. Neither the prophet nor the philosopher, each with her proper ultimate concern, can avoid appropriating the proper ultimate concern of the other for the two basic ultimate concerns imply each other. It should be clear that an ultimate concern is an imperious or urgent attitude of mind, one that seeks to fill the mind completely, that demands for its content an exclusive right of dominion within the mind. Hence the following premise.
Fables of Identity
39
E. "Two ultimate concerns cannot exist alongside each other." That is, they are incompatible and, hence, cannot exist together, as ultimate concerns, in a single consciousness. I assume that 'cannot' here is supposed to mean logical impossibility. An ultimate concern, whatever its content, is like an infinite being. There can be only one, for if there were more than one, each would be limited by the other, which is impossible. So it is with an ultimate concern. Yet, according to premise D, the impossible is unavoidable. But the mind cannot tolerate the impossible. F. Therefore, a synthesis of faith and radical doubt, that is, of the two basic ultimate concerns, is necessary. The argument is suspect, for if a truly impossible state of affairs should prove to be unavoidable, then one must be at a loss to decide what is needed, especially if this unavoidable impossibility is a necessary state of thought. However, for the moment, I shall set this objection aside. The needed synthesis has already been presented in the figure of an antithesis in which the opposing members fit in a union which we may take to be indissoluble. But we should not allow the charm of this figure to deflect us from a careful examination of what it has accomplished. In our examination, we must determine first of all just what kind of attitude an ultimate concern is. Suppose an ultimate concern were a propositional attitude, viz., unconditional belief, then its content would be one or more propositions and the opposition between two ultimate concerns would be interpreted as contradiction or contrariety. If contradiction, then Tillich would be dealing with a dilemma, and he would require a way out. There are, I think, two or, perhaps, three ways out. (1) Tillich could deny that the two apparently incompatible ultimate concerns must come together in a single consciousness. The contradiction would remain but it would not be intolerable, and it could also be resolved by either party by a simple denial. In sum, Tillich could deny premise D. The argument would then fail and there would be no need for a synthesis. (2) He could argue that the contradiction is only apparent, that the propositional content of the opposing ultimate concerns are, in fact, compatible. The argument succeeds, and a synthesis may be accomplished by adding the contents of the two ultimate concerns, thereby reducing the two to one. This, however, is not the synthesis that Tillich is seeking, for it lacks the tension of opposition. (3) Finally, Tillich could acknowledge the contradiction but deny that
40
Victor N u o v o
it is intolerable, in effect, denying premise E. 1 ' Here again the argument fails. If we interpret the relation between the two ultimate concerns as one of contrariety, similar results follow plus one more: the two opposing ultimate concerns might be replaced by another that includes propositional elements from the first two which are not incompatible. This too is a sort of synthesis, but clearly not the one Tillich wants. If, however, ultimate concerns are not propositional attitudes but expressive attitudes, then premise Ε is false and a synthesis of ultimate concerns is not needed, for opposition of two ultimate concerns in a single consciousness is not only not an intolerable condition of expressive attitudes of mind but a frequent if not constitutive element of it. Nevertheless, intolerable states of opposition, the need for synthesis and synthesis itself, all felt and expressed in an appropriate mood, occur as moments of a narrative sequence that expresses a life and, indeed, a world. Let us take a closer look at Tillich's "synthesis." First, we have noted that the attitude of faith and the attitude of ontological doubt are structurally or formally identical. But why should a mere formal likeness lead to a synthesis of opposing attitudes? A perfect synthesis is possible only of compatible contents. But Tillich's presentation of the two ultimate concerns has them different and opposed. Having presented them so unconiprisingly in opposition, what right does Tillich have to 11
It is not at all obvious that unrelieved opposition, even self-contradiction, is intolerable or even should be, at least in the realm of pure thought. Wittgenstein has suggested that it might not be intolerable, that it is odd that someone should suppose it to be and this supposition is mistaken. "Think of the case of the liar. It is very queer in a way that this should have puzzled anyone — much more extraordinary than you might think. ... Because the thing works like this: if a man says Ί am lying' we say that it follows that he is lying and so on. Well, so what? You can g o on like that until you are black in the face. ... it is just a useless language game, and why should anyone be excited? ... The question is: W h y are people afraid of contradictions? It is easy to understand why they should be afraid of contradictions in orders, descriptions, etc., outside mathematics. The question is: W h y should they be afraid of contradictions inside mathematics? Turing says, 'Because something may go w r o n g with the application.' But nothing need go wrong. A n d if something does g o wrong — if the bridge breaks d o w n — then your mistake was of the kind of using a wrong natural law." Quoted by A n d r e w Hodges in Alan Turing: The Enigma, New York, 1983, p. 154, f r o m lectures 21 & 22 o f Wittgenstein's Lectures on the Foundations of Mathematics, Cambridge 1939, ed. Cora Diamond, London, 1976.
Fables of Identity
41
reverse himself and deny these conflicts? He might reply that the intolerableness of the opposition set him in search of a principle of synthesis and finding one justified his turnabout. He might add that this synthesis does not dissolve the opposition, but has discovered a point of identity or union deeper than the opposition, a level disclosed, as it were, by digging down at the point where the opposing sides meet. This point is the point of the formal identity of the two opposing concerns. This identity, while it doesn't resolve the conflict, does present an opening for each with respect to the contents of the other, and it is by virtue of this opening to each other that a synthesis of content is carried out. Let us imagine a philosopher who, having grown weary of conflict with biblical purists, withdraws to the center of her ultimate concern and who, for a reflective moment, ignores its proper content in order to look towards the content of the prophet's concern and suppose the prophet were to do likewise. Each, then, could be said to be open to the other. And suppose each were to draw from the other's proper content employing each newly appropriated bit of content to refashion or reinterpret her own. Content, after all, is malleable, especially if it is not irreducibly propositional and representational but expressive, and this applies to all content, or, as Tillich might put it, everything is potentially a symbol. If this process were to continue in time there might come about something like an identity not only of form but of content, an identity that might allow for interesting variations. But Tillich would not be satisfied with this synthesis, because it seems arbitrary and accidental. Thus, having reached the point of formal identity, he asserts not only that the prophet and the philosopher are open to each other's content, but that, from the inmost point of their respective ultimate concerns each appears to imply the other. 'Implication' here is not a logical relation, but one that might be characterized roughly as aesthetic, as when two things that fit together are to be said, consequently, to be meant for each other. What is implicit in each, then, becomes explicit when each becomes the interpreter of the other. Ontological doubt, employing the concepts and the categories of that philosophical discipline, then, would be recognized as the proper interpreter of faith, by drawing out of faith what already lies within it, and faith would do the same for ontological doubt. In this way, faith and doubt would be united. It does not seem, however, that a purely
42
Victor Nuovo
formal attitude could imply a particular content. Perhaps the identity of attitudes is not after all purely formal. At the beginning of chapter VII, Tillich states that it is a "structural identity" which holds between faith and doubt, and concludes that this "analogy of structure keeps one side open for the other." (63) "Structural identity" and "analogy of structure" signify form and not content. However, the structure, as Tillich goes on to describe it, does appear to have some content, not accidently but essentially. This content is primarily ontological. (1) Both biblical religion and ontology are motivated by a concern for something that is altogether unconditioned; (2) both affirm the power of being over nothingness; and (3) both rest in a confidence that may be characterized as "an ultimate trust in the power of being." Finally, (4) both biblical faith and ontology require further content which they acquire through participation in some concrete, historical expression (63). (1), (2), and (3) are about being itself or the power of being, that is, they are not about any object but about the being of everything that is. Thus, they govern the manner in which we, who are not only things that are but also specifically things that express our attitude towards being, should express our being. The sum of (1), (2) and (3) can be combined in a single statement about the content and modality of ultimate concern: ultimate concern is a basic attitude; it is one of unqualified trust in the power of being; this trust is justified by a belief that the being of everything that is (which is not itself an object) is unconditioned. The proposition that the being of everything that is is unconditioned is, therefore, the content of every ultimate concern. This means that the philosophical attitude of doubt has an irreducible element of faith, to be sure, vague and abstract and as such the source of doubt about everything concrete; faith also has this content, although faith, that is to say, biblical faith, is preoccupied with its concrete content through which this primal faith is mediated and given positive expression. Thus, doubt is not without faith, but lacks only a concrete expression of it, and faith is not without doubt, but, because of its preoccupation with the concrete, is unaware of it. Moreover, neither faith nor doubt are propositional. Doubt is directed not to the basic propositional content of ultimate concern, but to the concrete expressions of it, which is to say, it is not doubt about the truth of something, but of the validity or fitness of expressions. Likewise, faith is not in its
Fables of Identity
43
concrete content but as assurance that this content is adequate as an expression of ultimacy. In this connection, one may wonder why an ultimately concerned philosopher must seek the concreteness of biblical religion, or whether this necessity is only one of historical circumstance, or whether the philosopher, if bound to a biblical concreteness, must interpret it in the same way as its prophetic advocates. She may use the symbols of concreteness merely to express her doubt, or she may employ them ironically to shape an altogether new cultural creation. But this is to digress. The point to be noted is that ultimate concern as such has a content that is philosophical and procedural, although this content is supposed to be more basic than and to differ from the specific contents of the ultimate concerns of faith and doubt, that is from specific historical philosophies and faiths. Moreover, this basic content is propositional and is representative of the attitude in general of ultimate concern. It represents the character of ultimate concern that gives it its peculiar modality. In the last two chapters of the book the synthesis is brought to completion. Where insuperable conflict was first discerned, analogies of schematized content now appear, in the new spirit of openness that arises from the recognition of the structural identity of faith and philosophy. Biblical religion and philosophy do not have the same content, but analogous contents, which makes each all the more open to the other. In the mutual exchange that this expanded openness allows, biblical faith has the advantage, for although both faith and philosophy have a history and, therefore, concreteness, faith has a richer positive content. And since doubt is a nihilating attitude, its complete, that is to say, positive expression, so far as it implies the answers that faith gives, are to be discovered in the positive assertions of biblical religion. Some examples should suffice to bring this exposition to an end. In chapter VII, Tillich remarks about "a surprising analogy in the history of philosophy" to the biblical doctrine of sin and of the corruption of the intellect which is a consequence of sin. Some of the greatest philosophers have written of the necessity for revelation and conversion if the human intellect is to become once more receptive to the highest truth. (64 f.) This analogy makes biblical faith and philosophy available to each other. Since biblical anthropology is more comprehensive, its philosophical counterpart becomes a "possibility" for it. The other cases
44
Victor Nuovo
presented in this chapter illustrate the mutual availability of biblical religion and ontology. The biblical doctrines of sin and grace mediate between the apparent conflict between the ethical and the ontological attitudes, between difference and identity. An analysis of the biblical ethics of love reveals an underlying ontology of love, and the cogency of ontological categories, in this case, of "participation and individualization" to biblical ethics. The philosopher's loneliness becomes a source of consolation for the prophet, and the prophet's adherence to the community, even when rejected by it, brings to light neglected features of the philosopher's vocation. In the final chapter, Tillich's treatment of theological dogma, in particular the dogmas of creation, christology and last things, shows that ontological concepts are necessary and ontological problems unavoidable in formulating and interpreting dogma, which in turn lead to radical questioning and doubt. For example, the "nothing" that is mentioned in the biblical doctrine of creation out of nothing requires an explanation that scripture does not provide, so that one must cautiously and tentatively fall back on various ontological speculative hypotheses. The historical-eschatological narrative framework of biblical doctrine also raises questions, such as the relation of history to nature, of time to eternity and of the possibility of an end of history, all of which require ontological clarification. On the other hand, because the very name, "Jesus the Christ" implies an ontology, which can now be made explicit, the concrete faith that the universal logos has become flesh, that is, visible or historically discernible, becomes available to everyone who asks the ontological question. Finally, Tillich returns to the concept of God and we find that we have completed the circle. The doctrine of God is "the beginning and end of all theological thought." The conflict between biblical religion and ontology was presented at the outset as one over the validity of the person as a basic theological concept. Biblical religion affirms it, ontology denies it. A successful synthesis must effect a resolution of this conflict. But the resolution that Tillich proposes seems to be no resolution at all. What he says in the final section of the book can be taken in several ways and this is because he makes statements that seem to fit different solutions. One solution, no doubt the dominant one, is as follows: God is not a being and, hence, not a person. Rather the god who is a being or a person, or, better, who is represented as such, "is
Fables of Identity
45
transcended by the God who is being itself, the ground and abyss of every being" and "by the God who is the personal-itself, the ground and abyss of every person." (82 f.) One may assume that "being-itself" and "the personal-itself' are the same "ground and abyss," and it is this potent moment of every moment of being that all talk of God expresses and is about. In the end, then, Tillich does not want to resolve the conflict of faith and philosophy but to affirm it. The resolution matches the principle of the coincidence of the opposite basic attitudes of faith and doubt. We affirm the conflict, not in despair, but in the confidence that it has a resolution, although at a depth of reality that transcends rational discourse. At that level of reality we reach an "ultimate unity in the depths of our own souls and in the depths of the divine life." (85) There, all conflicts are resolved and all meanings become one. The solution, so far as it can be rationally stated is to affirm the conflict. But the confidence of this affirmation has its source in something hinted at, intimated, offered as a mere suggestion, and from these mere but mighty traces, all constructive thought proceeds. This is the solution that Tillich intended: "To live serenely and courageously in these tensions and to discover finally their ultimate unity in the depths of our own souls and in the depth of the divine life is the task and the dignity of human thought."
III. Attentive readers of Tillich's book cannot fail to admire how skillfully he directs their thoughts: to unqualified and persistent opposition, which, because it has its roots in the soul seems also inescapable, to an unexpected discovery of identity amidst the drear of unrelieved oppositions, to a pleasant landscape of differences that dovetail and of accommodating oppositions that try the mind but do not threaten it with dissolution. Yet, on reflection, Tillich's persuasions seem less substantive. One suspects that oppositions that dissolve so easily and so imperceptibly are not real ones. Oppositions are real, or seem so, when speakers who seem to know what they're talking about say opposing things about the same subject. "God is a person" and "God is not a person" cannot both be true if 'God' in both sentences refers
46
Victor Nuovo
to the same being. There is real opposition here. But, of course, Tillich claims that G o d is not a being, and not in any ordinary sense an object of discourse. He is emphatic that the 'is' of " G o d is [exists]" cannot be construed in an ordinary or "popular" sense, and this he tells us implies that G o d is not anything that can be experienced or discovered in the whole of reality. Here again, we recognize a residual Kantianism in Tillich's remarks. But if the existential 'is' (and 'is not') cannot properly be said of G o d , then, it would seem, neither can the 'is' of identity or predication, for these uses imply an object that is or is not, must be or may not be. We customarily deny the identity of objects when the properties that we believe inhere in them would be impossible or very unlikely in the same individual. But if there is no object of theological discourse in the ordinary sense of 'object', then, we must, at the very least, hesitate before drawing ordinary conclusions from attributions of incompatible properties to things that are objects in some indefinable extraordinary sense. From this standpoint, there seems no logical warrant for the opposition and resolution of them that Tillich has led us through. But the exercise may be nonetheless valid as a play of expression. And, although Tillich denies that ' G o d ' refers to an object who can be discovered and experienced in reality, he does not deny that there is religious experience. Indeed, it is just this that this book and all of his books are about. What is religious experience about? Briefly, religious experience is the experience of existing in the world qualified by certain feelings and moods that together with some others constitute our reflective self awareness, and theological discourse is the expression of this experience. Theological discourse, then, is self referential. It is for this reason that the oppositions which Tillich draws so sharply in the opening chapters of his book dissolve once we reach the inmost recesses of the soul. Ultimate concern may be a mere form of self consciousness, but it is the form of a productive power that an anxious self, seeking certainty and security in a world that offers neither, employs to express its moods and its longings. To be sure, there is a further referential step. This productive power and its expressions o f the soul are supposed to be in some indefinite sense expressive, but not representative, of the power of being, which is the ground and origin of the soul's creative power and confidence. O f course, everything that is is an exemplification of being itself or of the power of being, although this seems too trivial to
Fables of Identity
47
mention. But it is a characteristic of our species, although, perhaps not exclusively, that we not only exemplify being but express its meanings, their content and their modality. Tillich's analysis and synthesis of the two opposing theologies illustrates that these meanings are not exclusive of each other but are suitable for a variety of compositions and scenarios, variations on the theme of opposition and reconciliation. In this context we may interpret Tillich's conclusion. It is not to be taken literally or representationally as an assertion of the identity of meanings, but rather as an expression, hyperbolic and figurative of the inventive power of reconciliation. IV. Theological realists, who have been schooled in philosophy and Scripture and who are looking for a refutation of Pascal's non-identity statement will not get much help from Tillich. Of course, from Tillich's standpoint, they're not supposed to receive help, except indirectly, by being set free from the limitations of finite thinking. Nor can we take Tillich's denial of it as asserting a real identity, even an identity meaning. Reciprocity, reconcilability, complementarity and mutual implication of expressive meanings is not identity except in some symbolic and hyperbolic sense. Union, separation, opposition, reconciliation, reunion: these are moments, earthy and airy, of marriage, which fleetingly and also figuratively and hyperbolically can be said to realize identity. On this consideration, one may be persuaded by Tillich, in whose soul, these two traditions, biblical religion and western philosophy, not for the first time, of course, were wed, lived together, struggled against each other, were estranged, sought and finally found each other, and in an intimate embrace became one flesh. Tillich was persuaded by this theological romance. But if anyone of us, having also been persuaded by him or with him, were to ask: "You've persuaded me, but just what am I supposed to believe?" he could give no definitive answer, for this identity of expression warrants beliefs of every shape or form in any number of combinations and modalities, limited only by the power of invention, or, it warrants no belief at all.
CHARLES Ε. WINQUIST
Heterology and Ontology in the Thought of Paul Tillich The name of this infinite and inexhaustible depth and ground of all being is God. That depth is what the word God means. [The Shaking of the Foundations, p. 57] The silent embarrassment of using the divine name can protect us against violating the divine mystery. [The Eternal Now, p. 98] These quotations concerning the divine name from Paul Tillich's sermons mark insights that reveal both a claim and a tension in his theological thinking. The name of God must be both spoken and unspoken in the theological peregrinations that plumb life's mysteries and wander through the labyrinth of life's complexities. The same name functions to disclose and conceal, comes into speech and resists speech, and, giving rise to discursive practices in which the symbol is a symptom, is a donation of meaning that is critically implicated in its own selfemptying. It is this tension, so artfully inscribed along the many boundaries of Tillich's systematic theological explorations, occasional writings and sermons, that I want to consider in assessing his contribution to a theological thinking that can be valenced both in the history of religions and in secular culture. Tillich's method of correlation and correspondent answering theology makes his work continually subject to reformulations of the philosophical problematic and cultural change. To work in the tradition of Tillich's apologetic task is to accept this challenge. Since Tillich's theology is so thoroughly interwoven with philosophical formulations, alterations of
Heterology and Ontology in the Thought of Paul Tillich
49
the philosophical thread in his thinking will change the substance of the fabric of his theology. These changes, although fundamental, extend rather than abandon his theological project. His specific philosophical indebtedness to the ontotheological tradition of nineteenth century German idealism and more general mortgage to the autonomous subject of Cartesianism are allied with a theological exigency in his thinking that subverts and transcends the totalization and exclusivity of these philosophical traditions. The philosophical tradition is strained when it comes to theological articulation. It is along resultant fault lines that cracks and fissures are markings of forces that resist explication and in their alterity are proper concerns for theological interrogation. That is, the theological development of a philosophical tradition can disturb and sometimes uproot that tradition to which it is indebted. Theological thinking is not supplemental to philosophical inquiry but theology is implicated in the formation of discursive practices so that its formal criteria have a quasi-transcendental relationship with the discursive theological achievement. In the first volume of Systematic Theology, Tillich defines two formal criteria for theology. The first formal criterion is: "The object of theology is what concerns us ultimately. Only those propositions are theological which deal with their object in so far as it can become a matter of ultimate concern for us" [12]. This criterion functions as an interrogative demand and implicates theology in existential value decisions. The second formal criterion is descriptive rather than interrogative and is philosophical rather than theological. "Our ultimate concern is that which determines our being or not-being. Only those statements are theological which deal with their object in so far as it can become a matter of being or not-being for us" [14]. The lines of filiation for the second criterion are in the western ontotheological tradition and although it is an elaboration of the first criterion it is neither a condition for it nor the only possible elaboration of it. The status of these criteria differ. The first criterion instantiates a question and defines the scale of inquiry. The second criterion is a strategic implementation of the first criterion in a specific discursive situation. The demands of scale in the first criterion exceed the specific and localized achievement in the articulated working out of the second criterion. What I want to suggest is that, while the second criterion can be formulated without faulting the first criterion, the formulation of
50
Charles Ε. Winquist
the first criterion cannot be contained within the range of articulation of the second criterion and subverts any totalization of the second criterion. This suggestion does not undo any of the achievement of Tillich's systematic theological reflections. It merely marks a tension in that achievement that is important if we seek to direct his thinking outside of the containment of the western ontotheological tradition. This is a desideratum for a contemporary reading of Tillich's theology for two reasons. The first is that the ontotheological tradition has been diagnosed within the tradition as not being in good health. For example, Mark Taylor, in his book Erring: A Postmodern A\theology, notes four losses that confront any postmodern theological inquiry: [1] the death of God, [2] the disappearance or displacement of the self, [3] the end of history, and [4] the closure of the book. The interdependence of the concepts of God, self, history and book means that the death, disappearance, end, or closure of any of these concepts would have implications that can be traced through the dissemination of the others. Although, it was the proclamation of the death of God by Nietzsche's madman sustained throughout the vagaries of twentieth century American theology that has received the most theological attention, the Hegelian achievement and its deconstruction have deracinated the autonomy and force of concepts of self, history and book. Confidence in a categorical agreement with being has been undermined by what remained unthought in its most elaborate philosophical expressions followed by a history of abjection in which what was unthought and unthinkable in social and political life has become commonplace. There has been a shaking of the foundations that demands more than a reconstruction under the aegis of the ontotheological tradition. The second reason why it is desirable to give a priority to Tillich's first formal criterion is the unfulfilled promise in some of his later work toward the development of a theology of the history of religions. In Christianity and the Encounter with World Religions, Tillich defined religion in correlation with the first formal criterion of theology. "Religion is the state of being grasped by an ultimate concern, a concern which qualifies all other concerns as preliminary and which itself contains the answer to the question of the meaning of our life" [4]. He also acknowledges that "revelation" is always received in the context of a finite
Heterology and Ontology in the Thought of Paul Tillich
51
human situation [FR, 81]. This means that religions are always concrete and particular. The "concrete spirit" of religions abides in a tension between their particular manifestations and the qualification of ultimacy. It is the qualification of ultimacy that Tillich can carry over from Christian theology to a theology of the history of religions. However, this is a theological question and not a theological answer; and, it is a question that is unformulated in any meaningful way until it is formulated within the discursive practices of the community in which it is asked. This means that within a theology of the religion of the concrete spirit, the "fight of God against religion within religion" [FR, 88] is a localized affair. He says that "the universal religious basis is the experience of the Holy within the finite" [FR, 86], but this does not give us a universal religion or synthetic mixture of religions. "A mixture of religions destroys in each of them the concreteness which gives it its dynamic power ..." [CWR, 96]. A theology of the history of religions can be no less than an intertextual interlacing of heterogeneities set against a claim or horizon of ultimacy. It is only within the specific discursive practices of a community that criteria for the articulation of an ultimate concern can have any meaning. As Tillich himself suggests, "words are the result of the encounter of the human mind with reality" [ST II, 19]. That is, what comes to mind and what we have in mind in the encounter with reality are words. There is a privileging of the formation of discourse in this suggestion. If the encounter with reality gives us words then words are going to be the markings indexing our experience of the real. A further implication of this suggestion is that criteria governing theological or philosophical thinking are rules for the formation of discursive practices. This does not mean that there is nothing outside textuality but it does mean that our thinking is always textual. Concepts are achievements of the differential interplay of words and have their status in the general textuality of thinking. Discourse is the cultural register for reality. This would suggest that the question of being has no status outside of discourse and if we are to understand Tillich's second criterion for theological thinking we will need to examine his use of the word being in the specificity of his discursive practices. Is his use of the word being such that this use would be invariant across all other specific discourses? Is there a word being or its equivalent in all discursive practices that can function nonsymbolically inside the differential structure of text
52
Charles Ε. Winquist
production as an absolute point of reference? If not, the second criterion is not an exigency of all theological thinking but is a specifically located articulation of the first criterion. There is little question that Tillich thinks that "Being is the basic absolute" [MSA, 81], He means more than the word being but of course his talk is about the word being. He says that there are two concepts of being. One is the result of a radical abstraction and radical negation. Being means "not being anything particular, simply being" [MSA, 81]. This concept is an empty absolute and arrests any clarification beyond its assertion. It would be no more than a null point in any discourse. His other conceptual usage is negatively and positively experiential in its several moments. The negative experience is the shock of nonbeing. He is asserting that non-being is as basic as being and that the awareness of possible non-being is experienced as a state of anxiety [CB, 32, 35]. The shock of non-being can be as simple as the practical experience of having to die [MSA, 82], The economy of death is assimilated by Tillich into the language of being and non-being and interwoven with guilt, condemnation, emptiness and meaninglessness. The positive experience is the experience of eros which Tillich says is the love of being and then likens it to Augustine's amor amoris [love of love] and Spinoza's amor intellectualis [intellectual love] [MSA, 82]. He calls this love "a feeling for the holiness of being as being, whatever it may be" [MSA, 82], This being is an infinitely full but indefinite absolute. Here, the economy of love is assimilated by Tillich into the language of being and interwoven with all particularities without being identified with any of them. We might ask if the language of being and non-being add anything to the textual economies of life and death. Or, do the languages of life and death add anything to the concept of being? As a concept, does being mean anything more as an infinitely full but indefinite absolute than as "not being anything particular, simply being?" It would appear that the concept of being has been filled by its association with love and death but we need at least to suspect that it is the word being that is here referenced in the differential play of specific texts. That is, being is implicated in a play of differences rather than having the play of differences implicated in being. The move through languages of life and death does not draw us closer to an experience of being. For example, the love of love or the anxiety before the awareness of death
Heterology and Ontology in the Thought of Paul Tillich
53
do not witness to being and non-being unless being and non-being are privileged as signifiers that are interchangeable with all other signifiers in chains of signification. It is not the languages of love or death that speak being but it is the possibility for grafting the ontotheological tradition onto to these languages that is witnessed in the philosophical appropriation of these discourses. Tillich does not distinguish the framing of a discourse from its internal economy or external milieu. The framing of Tillich's discourses on religion is philosophical and to understand and assess the applicability of his work outside of the scene of its origination we must account for the frame in its materiality, spacing, thickness and double edged qualities. Frames delineate a contrast between figure and ground, inside and outside. The ambiguity of framing is a trait of its thickness and double edges. From the inside of a discourse the internal edge of the frame is the point of contrast between the figure and ground so that the frame belongs to the ground. The frame is thus naturalized so that its structure appears to be the structure of the ground giving prominence to the specific figures of discourse. From the outside of a discourse the external edge of the frame is the point of contrast between the figure and the ground so that the materiality and structure of the frame appear to be internal to the specific figures of discourse. This means that if the frame of a discourse is the ontotheological tradition, then from the outside it would appear that a specific discourse is implicated in being and non-being without ever being explicitly ontological and from the inside it would appear that the discourse is grounded in the structure of being and non-being without being explicitly ontological. By reciprocally shifting perspectives between inside and outside the thickness of the frame is erased in a double naturalization so that there is the presence of an uncanny trace of what is absent in the actual figures of discourse. Reason must always go outside of itself to incorporate its own frame whether its perspective is from the inside or outside of a particular discursive situation. This is one reading of Tillich's claim that "ecstasy is fulfilled, not denied, rationality" [ST II, 76], The philosophical frame of Tillich's thinking is transcendental. He regards philosophical inquiry as an investigation of "the character of the general structures that make experience possible" [ST I, 19]. These structures are ontological but they are marked on an epistemological
54
Charles Ε. Winquist
register. "Reality as such, or reality as a whole, is not the whole of reality; it is the structure which makes reality a whole and therefore a potential object of knowledge" [ST I, 18] and "subjective reason is the structure of mind which enables it to grasp and shape reality" [ST I, 76]· It is here that we see one of the important tensions in the formulation of Tillich's thought. Subjective reason has an experiential primacy in that it is what grasps and shapes reality but it is reality as such that makes reality a potential object of knowledge. This is a complex dialectic. "Self-relatedness is implied in every experience. There is something that 'has' and something that is 'had,' and the two are one" [ST I, 169]. It is subjective reason that constructs ontological concepts; but, "the truth of all ontological concepts is their power of expressing that which makes the subject-object structure possible. They constitute this structure; they are not controlled by it" [ST I, 169]. Subjective reason constructs the conceptual structure by which it is constituted. It would appear that subjectivity is desplaced by its own achievement and that reason has subverted its autonomy. The paradox of the philosophy of reflection is that the subject can only know itself as an object. This becoming other than itself to know itself leaves a remainder. The mirroring of subjective reflection arrests the mirroring in its objectification so that it cannot include the mirror's mirroring. Subjectivity can only be known in the space of its objective inscription which is other than itself. But, as Tillich notes, it is here that the identity of subjectivity is constituted which means that its identity is deferred and belated. The priority and autonomy of subjectivity are lost in its necessarily impure reflection. What this means is that we cannot privilege an ontological conceptual structure on the basis of a pure reflection of subjectivity because that ontological conceptual structure subverts the priority of the subject by constituting the conditions of its possibility. However we traverse a philosophy of reflection between ontology and epistemology, its inquiry is convoluted by the force of its own transcendental questions. Wherever we begin the inquiry, the determinations of epistemological or ontological identities are in the linguistic register of the other field of inquiry. This is a circle that cannot ground itself and its moments are heterogeneous. Neither epistemological nor ontological concepts are determinate in themselves. Their fundamental concepts have an internal undecidability or incomple-
Heterology and Ontology in the Thought of Paul Tillich
55
teness that resists their universalization or naturalization in a general system. This recognition works against Tillich's confidence that with language we have universale which liberate us from bondage to concrete situations [ST II, 31]. Without a truly autonomous discourse our thinking is always situated. Transcendental philosophy does not have a domain that is proper to itself. It does not resolve itself in epistemological or ontological categories. It is always implicated in alterities that it cannot determine from its own determinate standpoint. It can be a frame for other inquiries but it cannot privilege itself as a universal frame because of the heterogeneity of the alterities in which it is implicated. The philosophical frame of Tillich's theological inquiries is partitioned and marked by its own undecidability. The line of my argument can be summarized by noting two of its implications. The first is that the formation of Tillich's philosophical discourse reciprocally traverses the reladonship between the conflicting primacies of epistemology and ontology and disestablishes the autonomy of any proper domain from which philosophy can assert a universal privilege in the formation of other discursive practices. The second implication is that without a proper domain that has universal meaning, ontology is a heterological supplement to a transcendental interrogation of specific and concrete discourses. This means that philosophy cannot come to closure in its own articulation and, more importantly for our reflections, it does not justify closure in the theological discourses that it frames. The weaving of heterological discourses into theological discourses, even when these discourses approximate expressions of wholeness and totality, should leave traces of their origination in seams and fissures within the fabric of the theological text. That is, there should be fissures in dominant theological figurations revealing lines of force or traces of alterity that cannot be contained within this discursive practice. These fissures will mark strains not only at the periphery of thought and thereby be only a matter of secondary concern. They will mark strains at the center of thought. For example, in Tillich's theology, it is being that "remains the content, the mystery and eternal aporia of thinking" [ST II, 11]. It is being that dominates his theological discourse and it is being that bears the mark of the heterogeneity constitutive of his philosophical discourse.
56
Charles Ε. Winquist
In a rather remarkable and subtle formulation, Tillich makes an incision in being with the question of God that qualifies his understanding of a homogeneous concept of being. He seeks to develop the question of God as the question implied in being [ST I, 166]. This is not the same as saying that the question of God is implied in the question of being. "It is the finitude of being that drives us to the question of God" [ST I, 166], It would appear that the question of God is not contained in the question of being and no simple identity is possible. This statement would seem to be contradicted by Tillich's identification of the being of God with being-itself. He very explicitly says that: "The statement that God is being-itself is a nonsymbolic statement. It does not point beyond itself. It means what it says directly and properly" [ST I, 238]. He also says that "after this has been said, nothing else can be said about God as God which is not symbolic" [ST I, 239]. As soon as we move to the symbolic register, all of Tillich's formulations of God fissure the nonsymbolic statement that "the being of God is beingitself." For example, naming God the "living God" is a denial of God as a pure identity of being as being [ST I, 242], The trinitarian identification of the first principle of the Godhead as the inexhaustible ground of being is a heterological complication of a pure identity with being. In The Dynamics of Faith, Tillich says that "God is a symbol for God" [46]. It is the element of the unconditional that constitutes divinity in the idea of God [DF, 10]. It is always judgment from the priority of the first criterion of theological thinking that gives theological meaning to the second criterion. "The content of absolute faith is the 'God above God'" [CB, 182]. These are all highly dialectical — heterological — concepts. They are not unlike the speculative formulations that Tillich brings to our attention in Boehme [Urgrund], Schopenhauer [will], Nietzsche [will to power], Freud, Hartmann [the unconscious], Bergson [elan vita/], and Scheler, Jung [strife] [ST I, 179]. These are concepts that are not to be taken conceptually [ST I, 179]. This oxymoronic state of affairs denies privilege to the copula of being. This means that we recognize that nonconceptual concepts do not function to establish identities. They function in the symbolic realm. This recognition has not always brought about the radical rethinking of theological strategies that we might have expected from the introduc-
Heterology and Ontology in the Thought of Paul Tillich
57
tion of nonconceptual concepts into our thinking and the consequent move into the symbolic realm. It would appear that the "is" of "being" often functions metaphorically in the symbolic realm following patterns of analogy and establishing likenesses between dissimilars. When metaphor dominates the rhetoric of theology then the articulations of nonconceptual concepts can approximate nonsymbolic statements in their formal expressions while bracketing any literal claims about reality. I would like to suggest that the move toward an exclusively metaphorical understanding of theological formulations is a slippage into a postcritical naivete that is too easily accommodated with a precritical naivete. What is obscured by the copula is is the radically disjunctive and wholly other demand of the "God above God" on any discourse. A discourse is intruded upon and defamiliarized by unconditional formulations and claims of ultimacy. We cannot gain our footing on the familiar ground of nonsymbolic ontological propositions because we have been forced into the symbolic realm by the internal undecidability of those same propositions. Root ontological concepts also function nonconceptually. It appears that all of the dominant concepts in Tillich's theology function so radically that their juxtaposition in discourse is metonymical rather than properly metaphorical. The disenfranchised copula of being does not establish identities but instead marks a space within a discourse for figurations of ultimacy. These nonliteral formulations pressure the discourse and alter its general economy. The discourse is implicated in ultimacy and even if it is not ontological it is theological. Tillich certainly thought that there is a final revelation that has the power of negating its particularity without losing itself. This notion depends on the transparency of the is in nonsymbolic statements or metaphorical configurations. His own radical formulations for God work against this privilege of the is. His use of the is is more closely associated in practice with forcing a metonymical alignment of the ordinary with formulations and qualifications of unconditional and ultimate concern. This is why he could turn to a theology of the concrete spirit. He consistently affirmed that "the ultimate can be actual only through the concrete ..." and: "This is the reason why the idea of God has a history" [ST I, 218], This history has not come to an end. Tillich can continue to speak to this history because his theological practice was denied closure by the first criterion by which it was established. It was the radical claim
58
Charles Ε. Winquist
of his protestant principle that ironically witnesses to both the possibilities for a theology of the history of religions and for a theological voice in secular culture.
Works Consulted Taylor, Mark L. Erring: A Postmodern A/theology. Chicago: University of Chicago Press, 1984. Tillich, Paul. Christianity and the Encounter with World Religions. Chicago: University of Chicago Press, 1963 (CWR) — The Courage to Be. New Haven: Yale University Press, 1952 (CB) — Dynamics of Faith. New York: Harper Torchbooks, 1958 (DF) — The Eternal Now. New York: Charles Scribners and Sons, 1956. — The Future of Religions. Chicago: University of Chicago Press, 1966 (FR) — My Search for Absolutes. New York: Simon and Schuster, 1967 (MSA) — The Shaking of the Foundations. New York: Charles Scribners and Sons, 1948. — Systematic Theology, 3 Volumes. Chicago: University of Chicago Press, 1951, 1957, 1963 (ST)
PETER STEINACKER
Passion und Paradox — Der Expressionismus als Verstehenshintergrund der theologischen Anfange Paul Tillichs. Ein Versuch. I.
Das Denken Paul Tillichs wird mit guten Gründen als Beleg dafür angesehen, daß man auch anders als Karl Barth Theologie treiben kann, ohne der Blasphemie einer selbsternannten „Religion" zu verfallen. Das gilt ganz besonders auch für seine Schriften, die im präfaschistischen Deutschland der zwanziger Jahre einen Kreis Menschen ansprachen, die meist keine Theologen gewesen sind. Diese Schriften gelten mit Barths „Römerbrief' als Dokumente einer Theologie, die das liberale Erbe abzuschütteln im Begriff war und theologisch Neuland betrat, insofern sie alle Kultur, damit auch Geschichte, Kirche und Religion einer radikalen „Krise" durch das Wort Gottes (Barth) bzw. des Unbedingten (Tillich) unterworfen sah. Nun wurden Barth und Tillich im Jahr 1923 zu einer Kontroverse über den Begriff des „Paradoxes" verleitet 1 . Diese Kontroverse scheint zwischen den beiden Gräben aufgerissen zu haben, die nie wieder zugeschüttet wurden, obwohl beide ihre frühen theologischen Wege nicht mehr weitergegangen sind. Diese Diskussion scheint auch die entscheidende Trennungslinie zwischen beiden klar hervortreten zu lassen, die für Barth mit dem markiert wurde, was er unter „natürlicher Theologie" verstehen wollte; also an der Frage, ob es angesichts der 1
Die Texte dieses Streits in den Theologischen Blättern sind in der Ausgabe der Hauptwerke (Mainworks) im Bd. IV, hrsg. J. Clayton 1987 (HW IV), S. 9 1 - 1 1 3 abgedruckt. Vgl. auch die Gesammelten Werke (GW) VII, 2 1 6 - 2 4 6 .
60
Peter Steinacker
radikalen Negation durch das die Welt richtende Wort theologisch zu verantworten sei, von irgendeiner weltlichen „Position" zu reden. Diese Frage scheint von den beiden Kontrahenten unterschiedlich beantwortet zu sein, und dieser Umstand verfolgte sie sachlich wie persönlich trennend ihr Leben lang. Nun läßt sich m. E. zeigen, daß das Barthsche Motiv der „Krise", die das Wort Gottes über die Welt verhängt und der jeder mögliche „Anknüpfungspunkt" zum Opfer fällt, der Anknüpfungspunkt für damalige Theologie schlechthin gewesen ist. Diesen Sachverhalt erhellt eine Analyse des „Römerbriefes" vom Expressionismus her 2 . Zugleich kann die ästhetische Interpretation aber auch zeigen, daß Barth sehr wohl bemerkt, daß die radikale Negation alles Bestehenden dies Bestehende entwirklicht und somit auch dem Glauben jede beschreibbare Gestalt, also jede Lebenswirklichkeit entzieht. Die theologischen Spitzensätze des „Römerbriefes" lassen eine theologisch unbegriffene Leerstelle gerade da, wo die Existenz des glaubenden Menschen, die ja ein unbezweifelbares Faktum ist, positiv beschrieben werden soll. An dieser Stelle verwendet Barth systematisch den aus der Christologie abgeleiteten Begriff des „Paradoxes" und kann über ihn die Definition Gottes als des ganz Anderen auf Mensch und Welt dann doch beziehen. Was das „Paradox" allerdings inhaltlich ist, als raumzeitliches Dasein, kann wiederum nicht anders als paradox, als „ewiger Augenblick" 3 unanschaulich beschrieben werden; d. h. als Stillstand der Geschichte, also als raumzeitliches Nichts, das zugleich das Alles sein soll. Die Vermittlung, die Anerkenntnis des ewigen Ratschlusses Gottes, worin sich Glaube als Glaube ereignet, kann nicht begriffen, sondern nur expressiv Sprache und Leben werden. Nun stellen sich ähnliche Verstehenschwierigkeiten ein, wenn man Tillichs frühe Texte nach dem befragt, was ihre zentralen Begriffe inhaltlich besagen wollen. Was ist „Rechtfertigung des Zweiflers" inhaltlich, was ist „Theonomie", wenn sie existiert, was meint Tillich mit „Gehalt", was heißt „religiöser Sozialismus", was meint „positives Paradox"? 2
3
Dies habe ich zu zeigen versucht: Karl Barths „Römerbrief'. Ein expressionistischer Schrei?, in: Anstöße 34, 1987, S. 1 2 - 2 2 . Römerbrief, 2. Aufl. 1922, l l . A b d r . 1976, 344. Vgl. auch die Formulierung „Wunder des absoluten Moments", S. 350.
Passion und Paradox
61
Meine These ist: Die in sich schwierigen Formulierungen lassen sich als inhaltlich leere Begriffe zeigen, die dennoch nicht nichtssagend sind, sondern dann, wenn sie zu einem „System" konfiguriert sind, auf etwas verweisen, was unter Tillichs Voraussetzungen nicht klar und deutlich gesagt werden kann und darf. Nebenprodukt dieser These, wenn sie sich denn belegen ließe, wäre die Erkenntnis, daß Barth und Tillich in dieser frühen Phase ihres Denkens sich viel näher waren, als sie es ahnten. Oder, wenn sie es denn geahnt haben, dann ließe ihre Kontroverse sich als menschlich, allzumenschlich erklären. Meine These denke ich damit belegen zu können, daß ich Tillich, wie schon Barth, vom Expressionismus her interpretiere. Dazu muß zunächst Verständigung darüber erzielt werden, was unter Expressionismus verstanden werden soll. Das ist nicht einfach, im Gegenteil. Es ist äußerst schwierig, sich seinen kunstgeschichtlichen Begriff „Expressionismus" zu bilden4. Dies hängt mit dieser in sich zerstrittenen und schillernden Bewegung selbst zusammen, aber auch mit meinen unzureichenden kunsthistorischen Informationen. Da aber auch Fachleute selber Schwierigkeiten haben, erlaube ich mir, über die Analyse zweier Kunstwerke so etwas wie eine kleine Phänomenologie des Expressionismus zu erstellen, die als Basis des Versuches hinreichend ist, weil sie wenigstens dazu verhilft, wesentliche Fragestellungen und Antworten jener Bewegung zu sammeln, die seit Wilhelm Worringer mit dem Schlagwort „Expressionismus" versehen wird 5 . Ich wähle mir dazu Max Beckmanns Gemälde „Die Nacht" und dann Georg Trakls Gedichte „Im roten Laubwerk voll Gitarren ..." und „Passion". Thematisch, nicht dem Zeitpunkt
4
Dies belegt M. Schneckenburgers Mühe, die Wandlungen des Expressionismus nachzuzeichnen und Fehldeutungen abzuwehren, ohne positiv zu sagen, was der Begriff wirklich bezeichnen soll, vgl. Propyläen Kunstgeschichte Bd. 12, 1972, 148 ff. Zum Themenbereich des Expr. gehören: Die Erfahrung der Großstadt, der Zerfall des Ich, das Bewußtsein vom Ende der bürgerlichen Welt, Auseinandersetzung mit dem Krieg, die Überzeugung vom „Tod Gottes" und den unterschiedlichen Konsequenzen, „Ekstasen der Zärtlichkeit", die neue Beschäftigung mit Landschaft, Natur, das Pathos vom neuen Menschen. Vgl. die Kapiteleinteilung im beispielhaften Band: Lyrik des Expressionismus, hrsg. S. Vietta, 1976.
5
Vgl. R. März: Vision und Wirklichkeit — Die expressionistische Avantgarde in Deutschland 1905 — 1920, in: Expressionismus. Katalog z. Ausstellung Nationalgalerie Berlin (DDR), 1986, 17.
62
Peter Steinacker
ihres Entstehens nach, gehören diese Kunstwerke in die späte Phase des Expressionismus, also in die Zeit, in der die glühenden Farbexplosionen, die Natur-, Licht- und Liebesträume der frühen „Brücke", des „Blauen Reiters", der Wiener Kreise und anderer Künstlerinnen und Künstler vergangen waren.
II. Max Beckmann (1884-1950) hat dieses Bild 1918/19 gemalt, nach dem Krieg, den er 1914 wie so viele enthusiastisch begrüßt hatte und dessen blutige Realität ihn, wiederum wie so viele andere, körperlich und seelisch so verletzt hatte, daß er nach einem Nervenzusammenbruch als Sanitätssoldat 1915 kriegsuntauglich entlassen worden war. „Die Nacht" ist sicher ein grausiges Bild. Die Szene ist alltäglich, wenn sie auch nicht jedem alle Tage und manchem hoffentlich niemals
Die Nacht 1918-1919. Aus: E. u. B. Göpel: Max Beckmann. Katalog der Gemälde, Bd. II, Bern 1976, Tafel 73
Passion und Paradox
63
widerfährt. Eine Familie wird in einer Dachkammer beim Essen von drei Mördern und Plünderern überrascht. Sie morden den Vater, vergewaltigen die Mutter, rauben das Kind. Unter der Oberfläche eines normalen Familienalltages verbirgt sich der apokalyptische Schrecken, dessen Ausbruch niemand wehren kann. Niemand wehrt sich auf diesem Bild. Nur der Hund jault am Rande links unten unter dem Tisch, aber auch passiv; die gequälte Kreatur. In der Verlängerung des einen der gespreizten Beine der Frau hat Beckmann die Entstehungszeit des Bildes angegeben: August 1918, März 1919. Es ist die Zeit des Zusammenbruchs des Wilhelminismus, die Zeit der Revolution, des Bürgerkrieges. Die Szene macht auf mich einen absolut gewalttätigen Eindruck. Alles ist verdreht, alle Gliedmaßen der Menschen sind verzerrt, verkrampft. Dieses Bild ist eine stumme Explosion. Alle Figuren sind sehr kunstvoll, sowohl in zeichnerischer Ebene wie auch in den Farben, miteinander verbunden. Aber es gibt kein Aktionszentrum, nichts, wo man sagen könnte: hier mußt du in das Bild hineingehen, um es erlebend zu verstehen! Nichts hält diese „Nacht" im Sinne von Ursache und Wirkung irgendwie logisch zusammen. Bestenfalls kommt eine Bewegung aus der Nacht hinter dem Fenster heraus, aus der Nacht, die durch das aufgerissene Fenster ins Zimmer platzt. Aber die Ursache dieser Bewegung, die bis in alle Winkel dieses Bildes geht, ohne wirklich etwas zu bewegen, die Ursache dieser Bewegung bleibt dunkel, schwarz, von der Mondsichel nur lichtlos erhellt. So kann man an jeder Stelle des Bildes einsetzen, ohne das Gefühl zu haben, etwas Vorhergehendes, was zum Verständnis des Bildes unbedingt wichtig ist, übergangen zu haben. Dies ist übrigens ein typisches Zeichen expressionistisch offener Systeme. Man findet es ebenso bei Beckmann, bei Bloch oder bei Barth. Man kann im „Römerbrief' fast jede Seite aufschlagen und ist beim Thema, ohne etwas Vorangehendes, Wichtiges zum Thema vergessen oder übergangen zu haben. Selten werden Themen wirklich auseinander entfaltet, bis zur Konklusio vorbereitet. So gehe ich an dieses Bild heran, um irgendwo einen Einstieg zu finden. Kann ich mich mit irgendeiner Figur identifizieren? Das Mittel der direkten Identifikation mit einer dieser Personen, sowieso ein problematisches Interpretationsverfahren, versagt. Dieses Bild ist nur als Ensemble ein Ich. Ein Ich im Sinne einer für sich bestehenden Person ist in diesem Bild nicht da, und so ist der Versuch der Identifikation mit einer dieser Figuren kein Mittel, es zu verstehen. Dennoch führt der Versuch über die Identifikation mit
64
Peter Steinacker
einer dieser Personen in die Wahrheit des Bildes, daß das Individuum dieser Zeit in viele Ichs dissoziiert nur sich vorfindet. Es ist ein Ensemble der Gefühle, das das betrachtende Ich assoziiert. Und dieses Bild ist so auch nur als Zusammenhang zu verstehen. Der Zusammenhang ist Isolation. Daher ist der erste Eindruck durchaus richtig, dem es scheinen will, als hätten die Figuren gar keinen Zusammenhang. In all diesem Grauen ist von Verbundenheit und Solidarität, von Zusammenhang der verschiedenen Ich-Aspekte nichts zu finden. Niemand schaut sich in diesem Bild in die Augen, weder Täter noch Opfer. Nur Fremdheit, Dissoziation verbindet. So ist dieses Bild Spiegel der Wirklichkeit, die die Individuen in verschiedene Ich-Aspekte leidvoll gespalten und zu Typen vereinzelt und zugleich kollektiviert hat. Dieses Bild ist eine säkularisierte Passion. Der gequälte und entwürdigte Mann auf der linken Seite, sicher eine Selbstdarstellung Beckmanns, zeigt dem Betrachter die gefolterte Rechte. Es ist die Passionshand, die zum traditionellen Inventar der Kreuzesabnahme oder der Beweinung gehört und die Wundmale zeigt. Auch die Kleidung des Mannes ähnelt auffallend dem Gewand des Christus aus Beckmanns Bild „Die große Sünderin" (1917), das ja auch ein Selbstbildnis ist. Auch das Tuch, auf dem der Mann sitzt, assoziiert das Leichentuch der Tradition, in dem der vom Kreuz abgenommene Christus aufbewahrt wird. Christus und der Maler als Opfer, der Mensch als Opfer, das wird herausgeschrien in solch expressiven Farben und Formen. Der vom Kreuz genommene Christus wird hier in säkularer Gestalt des beim Abendessen von der Qual überraschten und getöteten Mannes dargestellt. Beckmann bindet dabei individuelles Geschick, individuelles Leid in den gesellschaftlichen Rahmen, in dem es sich ereignet. Das Individuum schreit in stummer, erstickter Klage sein Geschick als alltägliches Geschick der Menschheit heraus, deren Alltag die sinnlose Passion enthält und verbirgt. Die Passion des Menschen vermischt sich motivisch mit Beckmanns eigener Geschichte. Der Zerfall seiner Familie zur Entstehungszeit dieses Bildes spiegelt sich auch in der Konstellation von Mann und Frau, die in ihrer Fremdheit dennoch aneinander gekettet sind. Beide sind durch die Farbe Rot miteinander verbunden. Die Körperstellen, wo das Leben pulsiert, bei dem Mann am Hals und am Herzen, sind rot. Die Frau trägt rote Strümpfe, das Kind trägt ein rotes Nachthemd. Das Tischbein, das dem Geschlecht der gepeinigten Frau am nächsten kommt, ist rot. Der Trichter des umgefallenen Plattenspie-
Passion und Paradox
65
Christus und die Sünderin 1917. Aus: E. u. B. Göpel: Max Beckmann. Katalog der Gemälde, Bd. II, Bern 1976, Tafel 72
lers, der beide Figuren konstruktionsmäßig aufeinander bezieht, ist von rot geradezu blühend erfüllt. Die Passionshand liegt über dem Geschlechtsteil des Mannes, weist auf den glühenden Trichter, der die Scham der Frau repräsentiert. Rot ist die Farbe des Lebens und der Leidenschaft, aber auch der Passion. Der Plattenspieler verweist zeichenhaft auf zerstörte und geschundene Sexualität; Beckmanns gescheiterte Ehe und das Elend sexueller Beziehung in der Passion der Zeit fließen ineinander. Das Leben allerdings, der runde, endlos kreisförmige Trichter als Lebensrad, wird trotz aller Passion weitergehen, eben weil es weitergeht — nicht weil es mit allem Leid einen Sinn hätte. Das Leben lebt ohne gewußtes Wozu, Warum, Woher, Wohin. Vom Vitalismus kommt kein Trost. So wie die Passion des Mannes kein Wozu kennt,
66
Peter Steinacker
so auch das Leben überhaupt, das immer vom Chaos überfallen wird, das die Menschen selbst produzieren 6 . Die qualvoll weit gespreizten Beine der Frau verklammern die Bildhälften miteinander. Die linke Bildhälfte des gefolterten Mannes, auf die die umgefallene Kerze, sozusagen penibles Symbol erloschener Lebenskraft, zeigt, ist die Todesseite. Die andere Hälfte, in der sich der geraubte Knabe mit seltsam winkender Hand von der Mutter verabschiedet, ist die Lebensseite. Von der Physiognomie her ist sicher Beckmanns Sohn zu erkennen. Beide Hälften werden durch die Frau verbunden; auch dieses Motiv hat Vorbilder in Beckmanns Werk 7 wie in der Tradition der Baubo-Darstellungen, die hier verdeckt zitiert wird 8 . So muß mit dieser gequälten Frau die Magna Mater assoziiert werden, die Tod und Leben gibt. Aber diese Frau strahlt nicht mehr die Souveränität asiatischer Kali-Darstellungen aus, auch nicht mehr die Anregungen und Ängste umfassender vaginal-penibler Sexualität. Kein Trost, der auch vom Anblick der gezeigten Vulva ausgehen kann, kommt mehr von der selber Trostlosen 9 . Sexualität „funktioniert" weiter, wie die Kerze der Lebensseite sinnlos weiterbrennt, obwohl weder Lust noch irgend ein anderer Sinn daran beteiligt sind. Auch die drei Figuren, von denen man den Eindruck haben könnte, sie seien Ursache der Passion, sind selber Opfer. Sie sind nach verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen gekleidet. Der Bürger und der Proletarier, die um Macht ringen — beide vollführen den gleichen Totentanz, mit einer Nuance. Der Bürger, dieser Pfeife Rauchende mit Krawatte, verbreitet nur noch Qual und Qualm um sich. Der Proletarier mit Ballonmütze, wohl ein Detail aus einem Fresco des 14. Jahrhunderts, das die Gegenwart mitassoziiert, der blinde Krüppel, ist zugleich Lenins Portrait. Das Proletariat vollstreckt
6
7 8 9
Die Interpretation folgt weitgehend M. Eberle: Max Beckmann: Die Nacht. Passion ohne Erlösung, 1984. Einen ganz anderen Zusammenhang zwischen diesem Bild und Barths Theologie als Eberle sehe ich allerdings. Beckmanns Forderung, sich preiszugeben, meint etwas ganz anderes als Barths Forderung, sich unter das Gericht zu stellen. Und Barths Formulierung v o m „Christus in uns" hat mit Beckmanns „Imitatio Christi" als Selbsteinsetzung in das Christusbild nichts zu tun, vgl. Eberle, 43—45. M. Beckmann: G r o ß e Sterbeszene (1906); Eberle, a . a . O . , 56. Vgl. G. Devereux: Baubo. Die mythische Vulva, 1981. Devereux, a. a. O., 59. 96 u. ö. weist daraufhin, daß in der griechischen Mythologie Demeter sich über den Verlust Persephones mit Baubo zu trösten suchte.
Passion und Paradox
67
das Gericht. Die Figur geht dabei auf den Schoß der Magna Mater zu, und die brennende Kerze ist dabei zu ihm gewinkelt. Die einzige Bewegung auf das Leben hin kommt in diesem Chaos von dieser Richtung. Aber der Sozialismus selbst geht offenbar unbewußt in die Richtung des Lebens. Der Mann mit der Ballonmütze schaut ganz woanders hin als in die Richtung des Lebens, in die er geht. Das ganze Geschehen spielt sich vor einer Frau im roten Kleid und mit roten Haaren ab, die schreckvoll starr wegsieht. Eberle deutet diese Gestalt als „Vertreterin weiblicher Mystik (...), die sich in einer Mischung aus religiösen und sexuellen Gefühlen an der schon vollzogenen Passion berauscht, die fern in der Vergangenheit liegt und den Blick von den Passionen abwendet, die sich in ihrer unmittelbaren Lebensumgebung abspielen" 10 . Ich sehe darin eher die Religion/Metaphysik, deren Fähigkeit zum glutvollen, liebevollen Leben und zur Passion nicht aktualisiert wird und deren Wegsehen als Verrat an der Welt, als Sünde des Übersehens der Qual gedeutet wird. Daher das Rot der Kleidung, das Rot der Haare (wie in „Christus und die Sünderin", 1917) und das mit großen Augen wissende Wegsehen. So wie die Kirche in allem Chaos des Zusammenbruches des Wilhelminismus ihre Ordnung zu bewahren sucht, so ist diese Frau als einzige Person des Bildes korrekt gekleidet. Die Religion ist potentiell mit dem glutvollen Leben verbunden, hält sich aktuell aus allem heraus und wird dadurch, durch ihre affirmative Rolle, zur Sünderin — ohne Bezug zum erbarmenden, geopferten Christus der Säkularität. Dafür spricht auch Beckmanns Bemerkung, man solle über dem Gegenständlichen in diesem Bild das Metaphysische der „Nacht" nicht vergessen 11 . Eberle deutet den Hund, der links auf der Todesseite unter dem Tisch neben dem umgestürzten Grammophon aus dem Bildrahmen hinausheult, als ironisches Zitat des damals berühmt werdenden Werbezeichens. Die Stimme des Herrn kann nicht mehr gehört werden. Der Plattenspieler ist umgestürzt und zeigt nur noch in die Richtung des sinnlos kreisenden Lebens, das eben weitergeht — auch wenn nichts mehr zusammenpaßt. Die Kreatur ist hoffnungslos dem hereinbrechenden Chaos preisgegeben. Die Religion, die eigentlich glutvoll das Leben gestalten könnte, ist teilnahmslos erstarrt, die Stimme des Herrn verstummt, nur die Kreatur heult ihr 10 11
Eberle, a.a.O., 74. R. Piper: Nachmittag, 1950, 26. zit. b. Eberle, a.a.O., 10.
68
Peter Steinacker
Elend aus dem Bild, aus der Welt in die leere Transzendenz: „Gott ist todt! Gott bleibt todt! Und wir haben ihn getödtet! Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?" 12 Was ergibt diese Analyse für die Erhebung expressionistischer Fragestellungen? 1. Die Kultur kann nicht anders als mit „Passion" beschrieben werden, die alle Bereiche menschlichen Lebens erfaßt hat. Über die Individuen ist der gleiche Bann des Leidens verhängt wie über alle kollektiven Lebensformen. Die Nacht, im Mythos Ursprung und Urschoß, aus dem alles Leben kommt, in der Romantik dann die Quelle allen wirklichen Glücks, die Nacht, aus der Tristan und Isolde höchste Lust zogen — sie ist die Apokalypse des Schreckens. Und die Nacht ist der wahre Tag, das Normale. 2. Im Expressionismus, vor allem nun in seiner späten Phase, herrscht die verzweifelte Einsicht, daß Gott tot ist, jedenfalls der domestizierte Gott der herkömmlichen Religion, der Kirche. Die frommen Bräuche sind ein seelenloses „Spiel mit Brot und Wein" 13 . Nietzsches Selbstverständnis, er komme mit seiner Botschaft vom Tode Gottes zu früh, ist überholt. Die Nacht der Gottlosigkeit und damit die Zerstörung all dessen, was bisher der Welt Halt und Maß gegeben hatte, ist angebrochen. Mit Gott versank die Wahrheit der Kultur, die auf ihn gebaut war, in den Schlachten des Krieges. Darum tritt an die Stelle der Kulturfrömmigkeit des späten 19. Jahrhunderts und des elan vital des 20. Jahrhunderts nun eine bodenlose Skepsis. Dennoch lebt die leidenschaftliche und klagende Absage des Expressionismus an Gott und Religion von dem, was im Tode Gottes verlorenging. Nach einem Wort Wolfgang Hildesheimers bedienen sich expressionistische Texte „auf dem Höhepunkt der Verzweiflung und Desorientierung der Mimikri des Verlorenen" 14 .
12
13
14
F. Nietzsche: Fröhliche Wissenschaft III, 125, Sämtl. Werke (Colli/Montinari) Bd. III, 1980, 481. Hier schon das Bild vom Absturz, das später bei Trakl wichtig wird. G. Trakl: D i e tote Kirche, in: Dichtungen und Briefe, Historisch-kritische Ausgabe, hrsg. W. Killy u. W. Szklenar, Bd. I, 1969, 256. Im folgenden werden Trakls Werke nach dieser Ausgabe zitiert ( D B I bzw. D B II). Thesen zum Sprachgebrauch des deutschen Expressionismus, in: H. Meixner/ S. Vietta (Hrg.): Expressionismus — Sozialer Wandel und künstlerische Erfahrung, 1982, 42.
Passion und Paradox
69
3. Der zentrale expressionistische Deutungsbegriff für die Situation der Gegenwart ist die „Krise". Aber es gibt nur die Beschreibung, ja Beschwörung der Krise, keinen Lösungsweg aus ihr heraus. Keine expressionistische Botschaft, auch nicht das bekannte „Oh, Mensch"Pathos sieht im unausweichlichen Leiden den Weg aus dieser Krise. Die Passion hat keine religiöse Aura mehr, sie ist ohne jede soteriologische Perspektive: Passion ohne Erlösung. Dies Bewußtsein der Krise wirkt sich auf die geschichtliche Perspektive so aus, daß in geschichtlichen Bewegungen kein Sinn, keine Zukunft mehr gesehen werden kann. Alle Bewegung, auch das Grauen dieser Nacht, ist nur Schein. Es bewegt sich nichts, sondern alles Geschehen kreist in sich selber zurück. Der Gang der Dinge, das rollende Rad des Lebens im dreifachen Symbol (Plattentrichter, die beiden Teller) wird nicht lösend gebrochen. Sogar die Bewegung des Proletariats auf den lebenbergenden Schoß der Frau (Symbol von Baubo und Gaia) zu kann das Chaos nicht fruchtbar und schöpferisch befreien. 4. Formal greift der Expressionismus auf den klassischen Fundus der Tradition zurück. Aber er wird formal überdehnt: Alles auf diesem Bild ist verzerrt. Durch die zerbrochene Form teilt sich ein Inhalt über die Form des Materials mit. Dennoch deutet nichts auf einen formalen Bruch hin, etwa eine Entwicklung zur Abstraktion; Beckmann bedient sich der klassischen Tradition religiöser Malerei, ohne noch eine religiöse Position zu setzen. Der Maler entreißt in freier, verwundeter Subjektivität der Geschichte ihre trostlose Wahrheit und teilt sie mittels der ästhetischen Expression demjenigen mit, der noch sehen und hören kann.
III. Wendet man nun diese Phänomenbeschreibung in einem kurzen Seitenblick auf Barths „Römerbrief" an, so läßt sich leicht zeigen, wie sehr die radikale Kritik von Religion und Kultur durch das Wort Gottes in der expressionistischen Zeitanalyse verwurzelt ist. Barth verbindet Gottes Treue, in der er uns als der ganz Andere gegenübertritt, mit der Praedestinatio gemina. Gottes Verborgenheit als der ganz Andere ist nichts anderes als die Verborgenheit dieses Ratschlusses. Von ihm aus ergibt sich der unendlich qualitative Abstand zwischen Gott und Welt,
70
Peter Steinacker
die Abwertung aller Kultur. Geschichte ist die „Nacht, in der wir wandern" 15 . Erkenntnis Gottes, die sich von dem Wahn befreien ließe, von sich aus Gott zu erwählen, wäre das „wissende und willige Erleiden des absoluten Angriffes auf den Menschen, der von der Gerechtigkeit Gottes ausgeht" 16 . Der Glaube, der dies tut, ist nichts anderes als — Passion, Erleiden Gottes. Solchem Glauben erschließt sich der unbekannte Gott „als der ewige, der reine Ursprung all dessen, was ist, als das Nicht-Sein aller Dinge, ihr wahres Sein. Gott ist treu." 17 . Nichts im Vorfindlichen ist unmittelbar auf Gott zu beziehen. Nur im Sinnlosen offenbart sich der Sinn alles Seins: Gottes Gnadenwahl in Jesus Christus. Solche Offenbarung ist die unmögliche Möglichkeit des ewigen Augenblicks im „Wunder des absoluten Momentes". Barth beschreibt das Erscheinen dessen, der nicht ist, im Sein. Das Nicht-Sein aller Dinge enthüllt sich als Sein, ja als eine vor aller Zeit begründete Beziehung zum Seienden. Das wahre Sein der Dinge ist entgegen dem Augenschein Gott, der ganz Andere. Was hat Tillich anderes gesagt? Barth bejaht die Kritik der ästhetischen Avantgarde. Seine Kritik am liberalen Gottesbild eint ihn mit Beckmann. Aber durch die Figur der Überbietung der Kritik bricht er ihr die Spitze ab: Diese Kritik trifft nur den „Götzen", Gott aber ist der ganz Andere. So wird durch die Preisgabe „Gottes" der wahre Gott bewahrt. Daß Gott Gott ist, das ist das durchaus liberale Axiom, das den ganzen Römerbrief trägt 18 . Barth ratifiziert theologisch mit ganz traditionellen Begriffen, aber in völlig neuer Konstellation das Ende der Kultur in ihren höchsten Ausprägungen als Religion, Metaphysik, Geschichte etc. und überbietet diese Kritik, indem er vom Wort Gottes her alles dies total nichtet und gerade darin als gehalten, errettet sieht 19 . Das Nichts birgt das Alles in sich. Aber dies Alles ist nicht positiv gegeben da. Es flüchtet sich als 15 16 17 18
19
Römerbrief, a. a. O., 24. A.a.O., 357. A.a.O., 52. Die Figur der „Selbstimmunisierung durch Radikalisierung" ist typisch für Barth, wie E. Jüngel gezeigt hat, vgl. Die theologischen Anfänge. Beobachtungen, in: Barth-Studien, 1982, 98. Diese Argumentationsstruktur setzt sich in der barthianischen Theologie gerne fort, vgl. die Arbeiten von H.-J. Kraus und auch exemplarisch M. Trowitzsch: Karl Barth. Erinnerung in angefochtener Zeit, in: ZThK Beih. 6, 1986, 1 9 4 - 2 3 9 . Vgl. Jüngel, a.a.O., 93f.
Passion und Paradox
71
Paradox in Sprache und Begriff: Das (der) Unsagbare wird Sprache — Gott hat geredet. Dies schreit der „Römerbrief heraus. Was sich nicht angemessen sagen läßt, weil auch die Sprache kulturelles Gefäß für das Unbedingte ist, das ereignet sich, gewinnt expressiv Gestalt im Gestaltlosen. Aber die Gestalt, die Wirklichkeit dieses Glaubens ist nicht positiv beschreibbar, hat keine Geschichte. Das Erleiden, die Passion, der Nähe Gottes hat den Charakter des Augenblickes, der schon vergangen ist, wenn er in seinem „Was" beschrieben werden soll. Solcher Glaube ist einem Kunstwerk analog, das bis an seine formalen Grenzen vorstößt und durch seine expressive Form einen unbegriffenen Leerraum des Seins eröffnet, der im Kunstwerk zwar mit dem Mittel des Materials eröffnet — aber nur durch das jeweils gelebte Verstehen gefüllt werden kann. Wie das Kunstwerk beschwören Barths Glaubensbegriff und das „Paradox" etwas zu erscheinen, was das Nicht-Sein ist. Solcher Glaube und solche Kunst vereinen sich darin, daß beide von nichts anderem leben, als dem Glauben, das Unmögliche sei bereits da.
IV. Aber ich möchte ja zeigen, daß die frühe Theologie Tillichs bis 1925 auf dieser expressionistischen Folie verstanden werden kann. Dazu möchte ich die Konturen der Phänomenbeschreibung durch Analysen von Gedichten Georg Trakls erweitern und präzisieren. Der unglückliche Dichter Georg Trakl kann unserer Phänomenbeschreibung etwas hinzufügen, was als Motiv in Beckmanns Bild völlig fehlt, nämlich die menschliche Schuld. Trakl lebte in Schüben abgrundtiefer Verzweiflung über den Verfall einer schuldig gewordenen Welt. Sein individuelles Lebensproblem, die inzestuöse Bindung an seine Schwester, wurde ihm zum Gleichnis der Schuldverfallenheit seiner ganzen Epoche. Dieses Erleben hat ihm sein ganzes, kurzes Leben verdüstert und ihn in den Tod durch eine Uberdosis Kokain getrieben. Der Untergang der europäischen Kultur im Ersten Weltkrieg, den er wenige Monate als Sanitätsoffizier im k. u. k.-Heer mitgemacht hat, war für ihn die gesellschaftspolitische Folge der epochalen Schuld, ebenso wie er sein persönliches Unglücklichsein als Folge seiner eigenen Verstrickung erlebte: „Groß ist die Schuld des Geborenen. Weh, ihr goldenen Schauer / Des Todes, / Da die Seele kühlere Blüten träumt", heißt es im Gedicht
72
Peter Steinacker
„Anif" aus der Sammlung „Sebastian im Traum" 20 . Und sein letztes Gedicht „Grodeck" spiegelt den Tod auf den Schlachtfeldern, auf denen unter den Augen eines zürnenden Gottes mit den Menschen auch die Menschlichkeit starb: „Am Abend tönen die herbsdichen Wälder Von tödlichen Waffen, die goldenen Ebenen Und blauen Seen, darüber die Sonne Düstrer hinrollt; umfangt die Nacht Ihre zerbrochenen Münder. Doch stille sammelt im Weidengrund Rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt Das vergoßne Blut sich, mondne Kühle; Alle Straßen münden in schwarze Verwesung." 21
Andererseits brachen in Trakls Leben immer auch dionysische Anteile durch. Selten allerdings erlebte er in seinen Alkohol- und Rauschgiftorgien wirklich gesteigertes Leben, das er sich genießend gönnen konnte. Seine tiefe Sehnsucht nach einem blühenden und schuldlosen Leben trug die Nichtrealisierbarkeit in sich. In dieser psychischen Disposition ist er Tillich verwandt, darum soll gerade Trakl vorgestellt werden. Rollo May hat in seinem Psychogramm Tillichs die diesem eigene Ambivalenz zwischen höchster Lebensbejahung und depressiv-düsterem Schuldgefühl nachgezeichnet. Tillichs Identifikationen mit Hamlet und Faust passen ebenso in dieses Bild wie Mays Bemerkung, seine Emotionalität sei auf der Stufe eines zwölfjährigen Knaben stehengeblieben, so daß seine außergewöhnliche Intellektualität nötig war, „to control his Dionysian emotions" 22 . Trakl mißlang des Leben zwischen dem Apollinischen und dem Dionysischen. Wohl hat er bis zu seinem 23. Lebensjahr an eine Erlösung durch ästhetische Produktion geglaubt. Noch in einem späten, dunklen 20 21 22
DB I, 114. DB I, 167. Paulus. Reminiscenes of Friendship, 1973, 80. Vgl. a. Tillichs autobiographische Bemerkung: „Mit Gestalten wie Hamlet habe ich mich bis an die Gefahrengrenze identifiziert", G W XII, 20. W. u. M. Pauck: Paul Tillich, sein Leben und Denken, 1978, 90 meinen, Tillich sei in seine Schwester Johanna verliebt gewesen. R. Albrecht erklärt dies mit einem Hörfehler Frau Paucks, die den Kosenamen „Wumming" als „woman" mißverstanden habe. Wie dem auch sein, auch wenn Verliebtheit von Geschwistern ebenso häufig ist wie das Gegenteil, mag Frau Albrecht recht haben.
Passion und Paradox
73
A p h o r i s m u s klingt das Thema an, w e n n auch schon resignierend: „ G e fühl in den Augenblicken totenähnlichen Seins: A l l e Menschen sind der Liebe wert. Erwachend fühlst du die Bitterkeit der Welt; darin ist alle deine ungelöste Schuld; dein Gedicht eine u n v o l l k o m m e n e Sühne" 2 3 . E r hat sein Leben als Hölle erlebt, der sich zu entziehen er solange kein Recht gesehen hat, als er noch seelische K r a f t in sich spürte 2 4 . Tillichs Lebenssituation „auf der Grenze" hat es ihm dagegen möglich gemacht, aus dieser inneren Spannung heraus lebenslang schöpferisch tätig zu sein, auch wenn er lange Phasen der Depression durchlebte. A u c h in Trakls W e r k neigen sich, wie schon bei Beckmann, Natur w i e Geschichte dem Verlöschen zu: „ A l l e Straßen münden in schwarze Verwesung." Dies w i r d besonders deutlich an einem Gedicht, dessen herbstlicher A n f a n g zunächst ein Bild des prangenden Herbstes evoziert, u m dann in seinem Fortgang in u m so schlimmere Verzweiflung abzustürzen: Im roten Laubwerk voll Guitarren ... Im roten Laubwerk voll Guitarren Der Mädchen gelbe Haare wehen Am Zaun, wo Sonnenblumen stehen. Durch Wolken fahrt ein goldner Karren.
23
24
Vgl. DB I, 463. Allerdings gibt es auch bei Trakl immer wieder Versuche (wie bei Beckmann und anderen), in einer „Imitatio Christi" die Schuld der Welt auf sich zu nehmen. So ζ. B. in dem Gedicht „Helian" (DB I, 69—73). Selbstverständlich liegt in der ästhetischen Produktion oft auch die Verarbeitung gesellschaftlich tabuisierter Erotik vor. Religiöse Terme wie „Kreuz", „Engel", „Grab", „Auferstehung" und andere sind sexueller Interpretation zugänglich, warum auch nicht? I. Denneler hat darauf hingewiesen, daß eine Reduktion der religiösen Schicht auf das Inzesterlebnis ebenso verfehlt wäre wie die Nichtberücksichtigung ihrer sexualsymbolischen Funktion. Trakl spricht über Religion, aber er spricht auch mittels religiöser Vorstellungen über anderes. Trakl benutzt christliche Religion und antike Mythen zur personalen Selbstdefinition und zur Weltdeutung, vgl. Konstruktion und Expression, 1984, 156. Zum Einfluß O. Weinigers auf Trakl vgl. A. Doppler: G. Trakl und O. Weiniger, in: Peripherie und Zentrum, FS Adalbert Schmidt, 1971, 43 ff. Vgl. die Aufzeichnungen eines Gesprächs zwischen Dallago, Ficker und Trakl, das Januar 1914 stattgefunden hat. Darin der Satz: „Ich habe kein Recht, mich der Hölle zu entziehen", in: O. Basil: Georg Trakl. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt, 1965, 136. Vgl. a. G. Stieg: Georg Trakl und Karl Kraus, in: Trakl-Symposion 1977, hrsg. W. Weiss u. H. Weichselbaum 1978, 58 f.
74
Peter Steinacker In brauner Schatten Ruh verstummen Die Alten, die sich blöd umschlingen. Die Waisen süß zur Vesper singen. In gelben Dünsten Fliegen summen. Am Bache waschen noch die Frauen. Die aufgehängten Linnen wallen. Die Kleine, die mir lang gefallen, Kommt wieder durch das Abendgrauen. Vom lauen Himmel Spatzen stürzen In grüne Löcher voll Verwesung. Dem Hungrigen täuscht vor Genesung Ein D u f t von Brot und herben Würzen. 25
Die Bilder und Motive übersetzen geschichtliche Ereignisse in den Naturvorgang eines Herbsttages, dessen Todesgefülltheit sich dem immer deutlicher hinsehenden Blick offenbart. In der ersten Strophe wird mit dem Rot der Blätter, dem Gelb der Mädchenhaare, den Sonnenblumen und dem goldenen Karren des Helios ein strahlendes Herbstbild gemalt. Die zweite Strophe gibt die Tageszeit an: Es ist Vesperzeit, der Abend naht. Das Leben täuscht noch: Die Alten umschlingen sich „blöd", als gäbe die Liebe noch einen Sinn. Der Gesang der Waisen klingt „süß" — aber in den gelben Dünsten des Fiebers, der Sümpfe, summen schon die Fliegen wie über Aas. Auch die Szene am Bach assoziiert zunächst noch normales Leben eines Waschtages. Aber im „Abendgrauen" ereignet sich ein seltsam ambivalentes Wiedersehen: An der „Kleinen" hängen Erinnerungen, die sich wieder einstellen, als sie wiederkommt. Aber das Gefallen kann nicht mehr Gegenwart werden. Denn mit „Abendgrauen" ist nicht nur einfach eine Tageszeit bezeichnet. Das entgegen dem „Morgengrauen" ungewöhnliche Wort spricht zwar den Übergang des Nachmittages in den Abend an, zugleich damit aber auch das Grauen, das die folgende „Nacht" bringen wird. Das „Abendgrauen" ist die Zeit vor dem Untergang 26 . Dem „Grau" folgt die Strophe, die von Bildern des Absturzes, der Täuschung und der Farbe „grün", hier als Farbe der Verwesung, beherrscht wird. Die Sehnsucht nach prangendem Leben, nach Ernte, also Lebensgenuß, nach 25
26
DB I, 17. Zur Interpretation vgl. E. Bolli: Georg Trakls „dunkler Wohllaut", 1978, 67 f. Auch Trakl kennt das zum Schreckbild verzerrte Motiv der „Nacht", in der Gott unerreichbar geworden ist, vgl. „Die Nacht", DB I, 160.
Passion und Paradox
75
Sattheit und Erfüllung wird bitter enttäuscht. Das verheißungsvolle Bild, das lebendige, liebende und klingende Leben ist schöner Schein. Dieser Herbst führt nicht zur Ernte des Lebens, sondern zum Absturz und zum Untergang. Alles, was sich als Heilungsversprechen darbietet, was sich in glücklichen Augenblicken als mögliche Summe eines gelingenden Weltzusammenhangs darstellen will, ist böse Täuschung. Jahre vor dem furchtbaren Krieg erahnt Trakl die allem „normalen" Leben innewohnende Tendenz zur Katastrophe. Nun ist in diesem frühen Gedicht, es stammt aus dem Jahr 1910, eine Stileigentümlichkeit angedeutet, die beim mittleren und späteren Werk immer stärker hervortritt und die zu erheblichen Kontroversen in der Trakl-Forschung geführt hat: die „offene Sinnstruktur" 27 . Darunter hat man seit Hugo Friedrichs grundlegender Studie die Offenheit moderner Lyrik für Bedeutungen zu verstehen 28 . Die Struktur eines Gedichtes und das Sprachmaterial eröffnen einen durch Chiffrierung offenen Sinnraum, der durch die jeweiligen Deutungsmuster nicht erschöpfend gefüllt wird. Gedichte solcher Art verweigern sich dem direkten Verständnis. Trakls frühe gültige Lyrik geht noch ganz im Klang, im Wortlaut selber auf. Sie hat außer sich keine andere Bedeutung und soll ohne begriffliche Vermittlung unmittelbar auf die Sinne wirken 29 . Aber seine späteren Werke eröffnen wohl immer noch auch über den reinen Klang, aber auch mit Hilfe der Syntax, einen Raum der Bedeutung, auf den
27
28 29
Vgl. W. Killy: Über Georg Trakl, 3. erw. Aufl. 1967, 50. Die Bildkomplexe und einzelnen Zeichen haben keine feststehende Bedeutung. Sie sind auch nicht einfach durch Erinnerung der Tradition zu verstehen, der sie entstammen. Dies zeigt der auffällig schmale Vorrat an Bildern und Adjektiven (Farben) des späten Trakl und die Austauschbarkeit allein aus Gründen des Klangs, vgl. dazu Anm. 33. Die Struktur der modernen Lyrik (1957), erw. Neuausgabe 1967. Vgl. H. Esselborn: Georg Trakl. Die Krise der Erlebenslyrik, 1981, 3 f. In Trakls Werk lassen sich wohl vier Werkphasen unterscheiden: 1.) Das traditionell geprägte Jugendwerk bis 1909. Wörtliches Verständnis noch möglich. 2.) Im frühen gültigen Werk wird das schwieriger (1910—1913); Hauptgattung ist hier das Lied. 3.) Die mittlere (kurze) Zeit zeigt sich durch die szenische Sprache intuitiven und hypothetischen Auslegungen offen, wenn auch noch relativ wenig verrätselt. Das ist die Phase, in der vieles im „Brenner" veröffentlicht wird. 4.) Diese letzte Phase koppelt traditionelle und neue Elemente so, daß Verrätselungen, Entsubjektivierungen und Verdichtungen immer krasser werden; Mai—Okt. 1914. Nach K . Wolfeis Periodisierung, zit. bei Esselborn, a. a. O., 19.
76
Peter Steinacker
hin sich das Gedicht perspektivisch öffnet, der aber durch das Gedicht selber noch nicht geschlossen wird. Dieses vorläufige und durch den neuen Leser wieder neu und anders geschlossene Sinngeflecht ermöglicht eine Ambivalenz des Sinnes, die „eindeutige" Interpretation Traklscher Gedichte nicht zuläßt. Darum ist die Diskussion darüber, ob sein Werk christlich ist oder nicht, müßig 30 , auch wenn vieles darauf hindeutet, daß Trakl an seinen christlichen Glauben stets zweifelnd gebunden blieb. Wichtiger für uns aber ist die strukturelle Öffnung eines Bedeutungsraumes, einer leeren Sinnmitte, die nur perspektivisch gefüllt wird, als Ganzes aber nicht festgelegt wird. In diesem Gedicht würde sich also nicht einfach als Sinn ergeben: „Alles ist eitel", sondern in der Trauer über das Elend meldete sich ein wohl noch nicht beschriebenes Glück, das aber in diesen Zeiten der Versagung verhängt ist. Dieses soll noch an einem längeren Gedicht deutlicher gezeigt werden, das in drei Fassungen vorliegt, die immer knapper werden, je später sie geschrieben wurden. Es ist das Gedicht „Passion", das in seiner ersten Fassung vielleicht Anfang Januar 1914 in Innsbruck geschrieben wurde 31 . Für die hier vorgetragenen Gedanken ist die erste Fassung am hilfreichsten: Passion Wenn silbern Orpheus die Laute führt Beklagend ein Totes im Abendgarten — Wer bist du Ruhendes unter hohen Bäumen? Es rauscht die Klage das herbstliche Rohr, Der blaue Teich. Weh, der schmalen Gestalt des Knaben, Der purpurn erglüht, Schmerzlicher Mutter, in blauem Mantel Verhüllend ihre heilige Schmach.
30
31
A u f mich wirken die betont christlichen Interpretationen, wie ζ. B. die v o n E. Lachmann: Kreuz und Abend, 1954 immer einengend und ängstlich. Gehört die grauenhafte Erfahrung der Abwesenheit Gottes, die Zweifel, Angst und Mißtrauen bewirkt, nicht zum Glauben hinzu? Die 3. (knappste) Fassung wurde als einzige veröffentlicht und zwar in der Gedichtsammlung „Sebastian im Traum" (1914/15, vgl. D B I, 125). Zur Textgeschichte vgl. D B II, 217 ff. Die besprochene erste Fassung gehört zur späten mittleren Werkphase und ist aus dem Nachlaß ediert in D B I, 392 — 394. Für die Interpretation vgl. durchgängig W. Killy, a . a . O . , 21—37.
Passion und Paradox Weh, des Geborenen, daß er stürbe, E h er die glühende Frucht, Die bittere der Schuld genossen. Wen weinst du unter dämmernden Bäumen? Die Schwester, dunkle Liebe Eines wilden Geschlechts, Dem auf goldenen Rädern der Tag davonrauscht. O, daß frömmer die Nacht käme, Kristus. Was schweigst du unter schwarzen Bäumen? Den Sternenfrost des Winters, Gottes Geburt Und die Hirten an der Krippe von Stroh. Blaue Monde Versanken die Augen des Blinden in härener Höhle Ein Leichnam suchest du unter grünenden Bäumen Deine Braut, Die silberne Rose Schwebend über nächtlichen Hügel. Wandelnd an den schwarzen Ufern Des Todes, Purpurn erblüht im Herzen die Höllenblume. Über seufzende Wasser geneigt Sieh dein Gemahl: Antlitz starrend von Aussatz Und ihr Haar flattert wild in der Nacht. Zwei Wölfe im finsteren Wald Mischten wir unser Blut in steinerner Umarmung Und die Sterne unseres Geschlechtes fielen auf uns. O, der Stachel des Todes. Verblichene schauen wir uns am Kreuzweg Und in silbernen Augen Spiegeln sich die schwarzen Schatten unserer Wildnis, Gräßliches Lachen, das unsere Münder zerbrach. Dornige Stufen sinken ins Dunkel, Daß röter von kühlen Füßen Das Blut hinströme auf steinigen Acker. Auf purpurner Flut Schaukelt wachend die silberne Schäferin.
78
Peter Steinacker Jener aber ward ein schneeiger Baum Am Beinerhügel, Ein Wild äugend aus eiternder Wunde, Wieder ein schweigender Stein. O, die sanfte Sternenstunde Dieser kristallnen Ruh, Da in dorniger Kammer Das aussätzige Antlitz von dir fiel. Nächtlich tönt der Seele einsames Saitenspiel Dunkler Verzückung Voll zu den silbernen Füßen der Büßerin Im verlorenen Garten; Und an dorniger Hecke knospet der blaue Frühling. Unter dunklen Olivenbäumen Tritt der rosige Engel Des Morgens aus dem Grab der Liebenden.
Beachtenswert ist der erste, unreflektierte Eindruck, den dieses Gedicht beim Hören hinterläßt: Es ist das Gefühl, man habe verstanden, was dieses Gedicht sagen möchte. Erst bei genauerem Hinhören und schließlich beim analysierenden Hinsehen zeigen sich die enormen Schwierigkeiten. Im Umgang mit Tillichs Texten mache ich die gleiche Erfahrung. Sie leuchten mir unmittelbar ein, und erst genaues Hinterfragen fördert die Verstehensprobleme herauf. Gibt es hinter der dunklen Flut von Klängen und Bildern, die sich unmittelbar verständlich gibt, einen evidenten Zusammenhang? Das Gedicht umfaßt den Zeitraum vom Abend bis zu einem Morgen, in dem vier Personen mit ihrem Schicksal zusammengebunden werden: Der klagende Orpheus, der leidende und auferstehende Christus, der Knabe und die Schwester, die sich lieben. Orpheus, dessen Klage um die Geliebte die Unterwelt in den Bann zog und ihre Herrin Persephone dazu erweichte, Eurydike freizugeben, eröffnet das Gedicht. Sein Gesang klingt in der Natur wieder: „Es rauscht die Klage das herbstliche Rohr / Der blaue Teich" (Z. 5 f.). Mit Orpheus ist das Thema angeschlagen: Passion. Der Leidensweg in den Hades ist Konsequenz der leidenschaftlichen (Passion) Liebe. Aber er war erfolglos. Unergründlich brach Orpheus das Gesetz der Persephone: Niemand darf die Unterirdischen anblicken 32 . So steht hinter seiner Klage schon die Vergeblichkeit des Weges: Passion ohne Erlösung. 32
Vgl. K . Kerenyi: Die Mythologie der Griechen, Bd. II: Die Heroengeschichten, 6. A u f l . 1983, 223.
Passion und Paradox
79
Seltsam ist, daß auf die Bedingung („Wenn Orpheus ...") kein „dann" folgt. Worauf bezieht sich die Klage, wer ist „das Ruhende"? Es bleibt zunächst offen, bis in Z. 26 die Braut, die Schwester, ins Bild rückt. Aber es ist keine einfache Identifikation des Knaben mit Orpheus, der ins Totenreich hinabsteigt, um die bräutliche Schwester zu suchen, gar sie dem Tod zu entreißen. Denn auch der Knabe gehört zu den „Verblichenen" (Z. 40). Beachtet man das oben zur offenen Sinnstruktur Gesagte, dann wird man wohl in den vier Schicksalen Perspektiven der Selbstdarstellung des Dichters und seiner Leser erblicken, die in diesem Gedicht gebündelt werden und dann von den Lesern in den von ihnen eröffneten Freiraum interpretatorisch verlängert werden müssen. Dann bezieht sich die Klage auf alle Opfer der Liebe, die als Leidenschaft auf den Leidensweg des Todes führt. Alle Liebe unter den Bedingungen schuldig werdenden Lebens teilt das Schicksal des Orpheus und des Christus, als deren nichtmythologische Geschwister das Geschwisterpaar erscheint. Die Klage des Orpheus bildet den Rahmen für das Geschick, das über allen Liebenden liegt: Der Tod. „Der Tod ist der Sünde Sold" — dieser paulinische Satz (Rö. 6, 23) regiert die Szene des in die Nacht fallenden Abends, in der die Gestalt des Knaben in den Vordergrund tritt. Diese Gestalt, die im Erwachen der geschlechtlichen Liebe zur Schwester „purpurn erglüht" (Z. 8), beweint „unter dämmernden Bäumen" (Z. 14) „die Schwester, dunkle Liebe eines wilden Geschlechts" (Z. 15 f.). Zweifellos drängt sich hier wieder das traumatische Inzesterlebnis ins Blickfeld, das im Mittelteil des Gedichtes in elementar erotischen Bildern heraufbeschworen wird: „Zwei Wölfe im finsteren Wald / Mischten wir unser Blut in steinerner Umarmung" (Z. 36). Auf dieses traumatische Erlebnis beziehen sich wohl auch die Zeilen 9 und 10, wenn auch in ihnen schon der christologische Teil vorbereitet wird. Die schmerzliche Mutter im blauen Mantel verweist von der Bildqualität her auf das Weib aus Offenbarung 12, das in der kirchlichen Tradition sehr bald auf Maria gedeutet wurde. Das Bild verweist aber auch auf eine biographische Szene, in der die Mutter Zeugin der Geschwisterliebe geworden zu sein scheint 33 . Durch diese Ambiguität werden aber Knabe und Christus 33
So kann man jedenfalls ein Stück aus der Prosadichtung „Traum und Umnachtung" deuten: „Niemand liebte ihn. Sein Haupt verbrannte Lüge und Unzucht in dämmernden Zimmern. Das blaue Rauschen eines Frauengewandes ließ ihn zur
80
Peter Steinacker
aufeinander bezogen. Für den K n a b e n , wie f ü r alles Lebendige, wäre es besser zu sterben, b e v o r er die schuldbringende Frucht gegessen hat. Trakl kennt offenbar nur eine prägenitale, schuldlose Existenz 3 4 . Existieren heißt schuldig werden. Die moralische Schuld und der Zerfall des Ichs und der Welt zeigen diese Verfallenheit n u r an, sind nicht die Ursache. Leben bringt Schuld; sie ist der Preis dafür, daß Leben auch geschlechtliches Lieben heißt. Trakls Anspielungen auf das verlorene Paradies (Z. 1 2 f., Z. 60), knüpfen an die seit den K i r c h e n v ä t e r n christlich übliche Verschlingung v o n Schuld und Sexualität an. D a r u m , weil die Schuld so g r o ß ist, daß nur Tod ihr folgt, müßte die Nacht der Erlösung, die Nacht v o r der A u f e r s t e h u n g „ f r ö m m e r " (Z. 18) kommen. Das ist die Ö k o n o m i e der Erlösung. D a n n aber kann der K n a b e auch auf Orpheus bezogen werden. W i e Orpheus sucht der K n a b e in der Nacht des Todes seine Braut, die als „silberne Rose" über dem nächtlichen Hügel schwebend ins Bild gesetzt
Säule erstarren, und in der Tür stand die nächtige Gestalt seiner Mutter. Zu seinen Häupten erhob sich der Schatten des Bösen. O, ihr Nächte und Sterne", DB I, 148. Typisch ist die Synästhesie „blaues Rauschen", die auch einen „blauen" Mantel mitdenken läßt. Die Farbe blau ist für den späten Trakl die meist benutzte Farbe geworden. In der Romantik war sie die Farbe der Sehnsucht. Ikonographisch gehört sie als göttliche Farbe traditionell zu Maria. Ob sie beim späten Trakl wirklich die Farbe der „Beseelung", der „unaussprechlichen Übereinstimmung von Innen und Außen" ist, wie J. Steiner: Die Farben in der Lyrik von George bis Trakl, behauptet, ist mir zweifelhaft, vgl. Intern. Trakl-Symposion, Albany 1983, hrsg. J. P. Strelka, 1984, 128. Vgl. auch E. Sauermann: Die Widmungen Georg Trakls, in: Trakl-Symposion 1977, a.a.O., 74f. und E. Philipp: Die Funktion des Wortes in den Gedichten Georg Trakls, 1971, 14 und 16, Anm. 50: „daß die Farbwörter nicht gemäß den durch die deskriptive Semantik angebbaren Gebrauchsbedingungen verwendet werden, daß sie zweitens nicht einheitlich von diesen Bedingungen abweichen ..., und daß zum dritten auch der abweichende Gebrauch der Farbwörter nicht unter erkennbar neue und einheitliche Bedingungen tritt, die etwa an ihren unmittelbaren Kontextpartnern abgelesen werden können". Die von Sauermann erwähnte Diss, von L. Pilhak, Innsbruck 1975, war mir leider nicht zugänglich.
34
Die von Steiner erwähnten Bedeutungen der Farbe Blau treffen auf Trakls Sicht seiner Mutter keinesfalls zu. Die Mutter ist „dämonische Richterin", die Angst und Schrecken und Kälte verbreitet, vgl. K. Pfisterer-Bürger: Zeichen und Sterne, 1983, 46. Vgl. P. von Matt: Die Dynamik von Trakls Gedicht. Ich-Dissoziation als Zerrüttung der erotischen Identität, in: H. Meixner/S. Vietta (Hg.) a.a.O. (Anm. 14). S. 5 8 - 7 2 .
Passion und Paradox
81
wird (Z. 28 f.). An den Ufern des Styx erlebt der Knabe noch einmal das Aufglühen der inzestuösen Liebe („Höllenblume", Z. 32), bis er über dem Wasser das vor Aussatz starrende Gesicht der Schwester erblickt (Z. 33 ff.). Die folgenden Zeilen zeigen, daß dieses reflektierende Erkennen nicht nur ein Wiedererkennen der Schwester und der gemeinsamen Geschichte ist, sondern das Wasser des Todes verhilft dem Knaben auch zur Selbsterkenntnis. So wie er zu Orpheus und die Schwester zu Eurydike geworden ist, so erblickt der Knabe, indem er sich „über seufzende Wasser" neigt, sich selber im Bild der Geliebten. So entsteht mittels der Reflexion ein Wir. Darum kann das Liebeserlebnis nun in der ersten Person Plural erzählt werden, und es wird verständlich, daß auch der Knabe bereits gestorben ist (Z. 24 f.). Beide befinden sich im Totenreich als Verblichene am „Kreuzweg", der Stätte der Entscheidung, dem Ort des Abschiedes, dem Weg der Passion, den alle gehen und in dem alle orpheus- und christusförmig werden 35 . Nun aber beginnt der schwierigste Teil der Deutung. Führt der Passionsweg zur Erlösung? Die „dornigen Stufen", die ins Dunkel sinken (Z. 44), assoziieren noch einmal die „silberne Rose" (Z. 28) mit ihren Dornen, den „Stachel des Todes" (Z. 39), verweisen auf die „dornige Kammer" (Z. 55) und die „dornige Hecke" (Z. 61), bringen also schuldbeladene Vergangenheit in ihrer existentialen Bedeutung und Befreiungsbilder zusammen: Der „Aussatz" fällt von der Schwester (und damit von allen) ab und in einem Frühlingsbild tritt der „rosige Engel" des Morgens aus dem Grab der Liebenden (Z. 63 f.). Der Auferstehungsmorgen des Johannes-Evangeliums (Kap. 19) bildet den Motivhintergrund. Maria Magdalena begegnet dem Auferstandenen im Garten, ohne
35
Zum Motiv des Kreuzweges vgl. Vergil: Georg IV, 497—498, zit. bei Killy, a.a.O., 31. Zum Identisch-Werden vgl. Killy, a. a. O., S. 25: „In Liebe, Tod, in Schuld werden sie ein Wir". Dieses Motiv bietet natürlich Anlaß zu psychoanalytischer Interpretation nicht nur dieser Stelle. Für die Freudsche Variante vgl. von Matt, a. a. O., Anm. 34; für die Jungsche, die Bruder und Schwester als Animus and Anima zusammenbringt, vgl. U. Rainer: Trakls Wahrheit, in: Intern. Trakl Symposion 1983, a.a.O. (Anm. 33), 109ff. Daher wird Trakls Formarbeit auch sehr treffend, wenn auch nicht erschöpfend mit Traumarbeit verglichen; so schon K . Simon: Traum und Orpheus, 1955, 27 — 54 und M. Stern: Der Traum in der Dichtung des Expressionismus bei Strindberg, Trakl und Kafka, in: Traum und Träumen, hrsg. Th. Wagner-Simon/G. Benedetti, 1984, 1 2 0 - 1 2 5 .
82
Peter Steinacker
ihn zu erkennen. Im Gedicht werden die Büßerin, Grab, der Engel und der Garten genannt. So bekommt der „verlorene Garten" durch die Bilder, die das Erwachen eines neuen Lebens beschreiben, den Aspekt des wiedergewonnenen Paradieses 36 . Der Prozeß der Veränderung durch das als Sühne verstandene Leiden hindurch offenbart „the sameness of brother and sister", die mit Orpheus, Eurydike und Christus zu einem neuen Wesen verschmolzen sind — dem Engel, der das Grab der Liebenden verläßt 37 . Andererseits aber bleibt der Garten verloren, bleiben die Liebenden tot, verwandelt sich der Knabe in Identifikationen mit Christus wie mit Orpheus am Ende des Passionsweges zur „arbor cruris" an der Schädelstätte („Beinerhügel"), zum verwundeten Wild und schließlich zum schweigenden Stein (Z. 49 —52). Wenn das Saitenspiel „dunkler Verzückung" voll ertönt, dann ist Eurydike, wie alle Menschen, noch nicht erlöst. Vielleicht ist der Tod als einziger Löser der Schuld die traurige Botschaft des Engels, der wissend das Grab der Liebenden verläßt, um diese verzweifelte Botschaft allen mitzuteilen, die im neuen Frühling das rauschende Leben der Liebe beginnen. So wie Eurydike Orpheus aus unbegreiflichen Gründen immer wieder entgleitet, so führt alle Liebe in den steinernen Tod „In der steinernen Stadt", wie es in der Schlußzeile der 3. Fassung heißt! Auch wenn die Nacht voller „dunkler Verzückung" den nie enden wollenden Augenblick der Seele vorspiegelt und die Buße des Passionsweges in die „sanfte Sternenstunde" versetzt, so gibt es dennoch keine Erlösung im Sinne eines je möglichen Lebens ohne Schuld. Die Liebe hat keinen Einwand gegen den Tod, der zwar auch die tödliche Krankheit des Aussatzes als Folge der Schuld abfallen läßt, aber nur frei macht, ohne zu befreien 38 .
36 37 38
Vgl. R. Detsch: G e o r g Trakl's Poetry. Toward a Union of Opposites, 1983, 14. Ders.: a . a . O . , 23. Zitat 24. Für diese Deutung sprechen einige Stellen bei Killy, a. a. O. Außerdem sprechen dafür: 1.) Die 3. Fassung des Gedichtes, die die Strophen radikal verkürzt und deren Schlußstrophe lautet: „Denn immer folgt ein blaues Wild, / Ein Äugendes unter dämmernden Bäumen, / Dieser dunkleren Pfaden / Wachend und bewegt von nächtigem Wohllaut, / Sanftem Wahnsinn; / Oder es tönte dunkler Verzükkung / Voll das Saitenspiel / Zu den kühlen Füßen der Büßerin / In der steinernen Stadt" (DB I, 125). 2.) Einige Stellen aus der etwa gleichzeitig entstandenen Prosadichtung „Traum und Umnachtung" (Anm. 29): „ O des verfluchten Geschlechts. Wenn in befleckten Zimmern jegliches Schicksal vollendet ist, tritt mit
Passion und Paradox
83
Welche Interpretation die zutreffendere ist — das läßt sich nun nicht einfach entscheiden. Denn beide Perspektiven sind im Gedicht, in den Motiven, den Metaphern angelegt. Diese Ambiguität nun ist „kein Mangel an Präzision, sondern das eigentliche Element dieser A r t v o n Rede" 3 9 , der es durch die technischen Mittel „um die Herstellung eines Raumes f ü r jenes letzte Unbegreifbare" 4 0 geht. Trakls dichterische Sprachtechnik ordnet Chiffren, die zunächst nur sie selbst sind und auf nichts verweisen, als Konfiguration zueinander. Erst aus dieser Konfiguration ergibt sich die Perspektive f ü r einen „Sinn". Dieser Sinn entsteht aus der Verbindung v o n „Bedeutung" (also v o n etwas, was „hinter" dem Bild, Motiv etc. liegt), v o n Struktur, v o n Klang, v o n Farbe; d. h. allen sprachlichen Mitteln zusammen mit der Zeit, sowohl derjenigen des Dichters, wie derjenigen der Interpreten: „ A n die Stelle vernünftiger Evidenz, überschaubarer Zusammenhänge ... treten Assoziationen, deren Wirkungsweise schwer zu analysieren ist. Alle Vorstellungen, so isoliert sie sinnlich dastehen, sind in ständigem Übergang begriffen und gegeneinander offen" 4 1 .
39 40 41
modernden Schritten der Tod in das Haus. O, daß draußen Frühling wäre und im blühenden Baum ein lieblicher Vogel sänge. Aber gräulich verdorrt das spärliche Grün an den Fenstern der Nächtlichen und es sinnen die blutenden Herzen noch Böses ... Bitter ist der Tod, die Kost des Schuldbeladenen ... Aber leise sang jener im grünen Schatten des Hollunders, da er aus bösen Träumen erwachte; süßer Gespiele nahte ihm ein rosiger Engel, daß er, ein sanftes Wild zur Nacht hinschlummerte; und er sah das Sternenantlitz der Reinheit" (DB I, 149 f.). Die Szene endet mit einem erneuten Inzest: „Purpurne Wolke umwölkte sein Haupt, daß er schweigend über sein eigenes Blut und Bildnis herfiel, ein mondenes Antlitz; steinern ins Leere hinsank, da in zerbrochenem Spiegel, ein sterbender Jüngling, die Schwester erschien; die Nacht das verfluchte Geschlecht verschlang" (DB I, 150). Killy, a. a. O., 36. Ders.: a.a.O., 37. Ders.: a.a.O., 35. Vgl. dazu auch die Formanalysen, die durch die historisch-kritische Ausgabe möglich geworden sind. Killy, a. a. O., 51 hat darum Trakls Arbeitsweise mit einem Spieler verglichen: „Sein Suchen nach Worten ist das Suchen des Spielers nach dem passenden Zug, nach dem richtigen Stein auf einem unendlichen Felde, der anderen Steinen Widerpart bietet; ist Austausch und Verwandlung von Figuren, je nachdem es die Lage auf diesem Felde fordert. Die Figuren sind vorgefunden, an den Elementen der Welt ist nichts zu ändern. Aber sie können auf unterschiedliche Farben gesetzt werden, immer neue Konstellationen sind möglich ... Das Eigentliche, an das die Figuren erinnern und welches das Spiel eröffnet, kann von
84
Peter Steinacker
Jenseits aller Inhalte geurteilt, verfahrt Trakls formale Technik so, daß seine Texte einen offenen Raum der Bedeutung für das eigentlich nicht Wortfahige erzeugen, der dem Gegenstand dieser Poesie einzig angemessen ist: Dem Unsagbaren und Unbegreifbaren, das verborgen, selbst in der grauenhaftesten Negation aber gemeint ist. Dies Unsagbare kann in solchem todtraurigen Wohlklang umkreist werden. Das Existential der Schuld, für Trakl am Inzest und in anderen Gedichten in der Gewalt der „Feuerschlünde" des Krieges erlitten, kann nicht in seinem Ursprung begriffen werden. Aber seine Unausweichlichkeit kann in den Schreckensbildem der Passion beschrieben werden, und nur damit wird Hoffnung bewahrt. Alle Negation beschwört eine nicht näher sagbare, aber perspektivisch anvisierbare Position. Diese gibt es nur als perspektivische Verlängerung in einen leeren Raum des Sinnes, der ins Wort gebannt ist. Dies beschwört Trakl verzweifelt. Persönliches Schicksal und Geschichte des Materials der Sprache gehen ineinander. Darum ist Trakls Wort auf der Höhe seiner Zeit. Die Schönheit seiner Texte zeigt das Zerbrechen der Schönheit und Reinheit, um die doch alles kreist 42 .
42
ihm nie erreicht werden". K. Simon, a. a. O. 70, hat als Hauptwirkungen dieses lyrischen Stils festgehalten: 1.) Einen „ambivalenten, ausgewogenen Schwebezustand der Aussagen"; 2.) die „Verräumlichung der Zeit, d. h. das Ablösen der Bilder aus ihrem zeitlichen Nacheinander und ihr Zusammenfallen in das räumliche Medium des Augenblicks" und 3.) „die perspektivische Funktion der Bilder, die nie nur sich selbst aussagen, sondern ... den Blick, das gestimmte Mitempfinden in den Bereich hinter den Erscheinungen weiterleiten". Detsch, a. a. O., versucht in den verschiedenen Szenen und Personen Durchgangsstadien eines persönlichen Prozesses zu sehen, der vom Inzest und seinem orgiastischen Nihilismus durch Tod und Sühne zur göttlichen Wiedergeburt führt, S. 24. Vgl. Th. W. Adorno: Ästhetische Theorie, hrsg. G. Adorno u. R. Thiedemann, GS VII, 1970, 159: „Die ästhetischen Bilder stehen unter dem Bilderverbot"; 199: „Wahrheit hat Kunst als Schein des Scheinlosen"; 223: „Material ist auch dann kein Naturmaterial, wenn es den Künstlern als solches sich präsentiert, sondern geschichtlich durch und durch"; 287: „Fortgeschrittenes Bewußtsein versichert sich des Materialstandes, in dem sich Geschichte sedimentiert bis zu dem Augenblick, auf den das Werk antwortet". Bedenkt man dies, so ist A. Muschgs Kritik an Killy wirklich gegenstandslos. Durch Killys Interpretation wird doch Trakls Schicksal nicht getilgt und seine Kunst zum bloßen Formexperiment degradiert, vgl. Von Trakl zu Brecht. Dichter des Expressionismus, 1963, 101 bzw. 114. Mir ist auch fraglich, ob Trakl wirklich durch seinen „Vorstoß ins Schweigen als Grenzphänomen und Existential" dem
Passion und Paradox
85
Trakls Gedichte fügen zur Phänomenologie des Expressionismus noch den Gesichtspunkt der Schuld hinzu. Diese Krise und der Zerfall all dessen, worauf die menschliche Gattung einst ihre Hoffnung setzt: auf Emanzipation der Geschichte, auf Rückkehr zu Natur und Leben als Einkehr in die Einheit des Seins, auf Reinigung durch Schönheit und Kunst, auf Gottes heilende und lösende Gegenwart — dies ist Ergebnis menschlicher Schuld. Beckmann hatte dafür weniger Gespür 43 . Aber bei Trakl wird der Gedanke der Schuld zum Regulativ aller anderen Einsichten. Sodann eröffnet Trakls Umgang mit dem sprachlichen Material eine formale Perspektive, die die Ästhetik als Ort der Metaphysik nach deren Untergang erweist. Metaphysische Ästhetik in der Krise der Zeit aber kann nur noch negativ, in der Eröffnung eines leeren Bedeutungsraumes, das Vergangene beschwören. In diesen Leerraum strömt das Leben und Denken derjenigen ein, die mit dieser Kunst und an dieser Kunst das Unbegreifliche, nicht Wortfahige ihrer eigenen Gegenwart erfahren und zu deuten versuchen. Diese formale Perspektive eignet auch Beckmanns Werk und ist als „parataktische Form" ein Stilelement expressionistischer Kunst überhaupt 44 . V. Damit können wir uns Tillichs Werk zuwenden. Dabei ist Tillichs Deutung des Expressionismus ohne Belang für diesen Versuch. Er fühlte
43
44
Habitus des Mystikers vergleichbar wird, wie H.-G. Kemper meint, vgl. Georg Trakls Entwürfe. Aspekte zu ihrem Verständnis, 1970, 189 und 201 ff. Vgl. ζ. B. jene für Beckmann typische Mischung von Selbstüberschätzung und religiöser Revolte in der Äußerung: „Es wird sich ein neues mystisches Gefühl bilden. Mit der Demut vor Gott ist es vorbei. Meine Religion ist Hochmut vor Gott, Trotz gegen Gott. Trotz, daß er uns so geschaffen hat, daß wir uns nicht lieben können. Ich werfe in meinen Bildern Gott alles vor, was er falsch gemacht hat"; Gespräch mit R. Piper, Juli 1919 in Frankfurt/Main, in: Die Realität der Träume in den Bildern. Aufsätze und Vorträge. Aus Tagebüchern, Briefen, Gesprächen 1 9 0 3 - 1 9 5 0 , hrsg. R. Pillep, 1987, 94. Der Maler Beckmann ist weiter als der religiöse Redner, der ganz im Sinn des liberalen Gottesbildes schwadroniert. K . Simon, a. a. O., 62: „Die unsichtbare Mitte, der Fluchtpunkt, wirft seine abbildlichen Spiegelungen in die Bilder, die um ihn aufgestellt sind; er selbst ist als imaginärer Spiegelraum ,unbetretbar'. Die Mitte selbst, das namenlose .Dahinter' ist ,ineffabile', ist das Wesen, das sich jedem Zugriff entzieht". Bei Simon auch das schöne Bild von G. Benn: Wie bei einer Orange gruppieren sich die Fruchtsek-
86
Peter Steinacker
sich diesem Stil sehr verwandt und sah in ihm ein Paradigma der K u n s t , die er f ü r „religiös" bzw. f ü r „metaphysisch" einschätzte, weil sich hier der „ D u r c h b r u c h des Gehaltes durch die F o r m " ereignete 4 5 . A b e r das soll keine Rolle spielen, auch nicht, ob Tillichs Interpretationen wirklich ein Verständnis dieser K u n s t voraussetzen bzw. eröffnen, was sachkundige Interpreten bestreiten 4 6 . In jedem Fall w a r Tillich viel wacher f ü r die K u n s t seiner Zeit als beispielsweise K a r l Barth. A b e r dieses kann auf sich beruhen. Wichtiger ist, o b sich in Tillichs Theologie Analogien in Themenwahl, Situationsdeutung und in der F o r m zum Expressionismus nachweisen lassen, die ein besseres Verständnis seiner Theologie erlauben. D a h e r soll Tillichs frühe K u l t u r t h e o l o g i e untersucht werden. Die ästhetischen Teile können vernachlässigt werden. Zentrale These der Kulturtheorie ist: A l l e K u l t u r ist auf das Unbedingte bezogen. Darum kann sich der Theologie die A l t e r n a t i v e zwi-
45
46
toren um eine nicht vorhandene Mitte, in: Doppelleben, 1950, 161. Zur parataktischen Form vgl. auch Adorno, a. a. O., 236. Über die Idee einer Theologie der Kultur (1919), GW IX, 22 f.; Theologischer Stil und religiöser Stoff in der bildenden Kunst (1921), a.a.O., 319 f. Die Schriften Tillichs werden bei der ersten Nennung mit vollem Titel und Jahreszahl angegeben, in der Folge jeweils so, daß der Titel kurz erkennbar ist. Die Kürzel (HW u. GW) werden alleine genannt, wenn deutlich ist, welche Schrift gemeint ist. Damit versuche ich dem Umstand Rechnung zu tragen, daß Tillich sein Denken von Schrift zu Schrift mehr oder weniger variiert. Aus Raumgründen wird auf die Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur völlig verzichtet. Die Kunstauffassung des „Systems der Wissenschaften" (1923) ist noch ganz vom Expressionismus geprägt. Darin werden Kunst und Wissenschaft so aufeinander bezogen, daß sie Form und Gehalt unterschiedlich gewichten: „Die Wissenschaft will die Dinge vom Denken, von der reinen Form her erfassen, ohne das Sein, den Gehalt zu verlieren; die Kunst will die Dinge vom Sein, vom reinen Gehalt her erfassen, ohne auf das Denken, die Form zu verzichten" (GW I, 249). Wenn Tillich die Wahrheit der Kunst als das „Ausdrucksmächtige" bestimmt (ebd.) und den „fundierenden Charakter der Metaphysik" betont (250), dann steht ihm der Expressionismus vor Augen. Die Formel vom „Durchbruch des Gehaltes in Form und Farbe" findet sich bei Franz Marc, den Tillich besonders schätzte, vgl. Marc: Briefe aus dem Feld 1948, 75, zit. η. M. Palmer: Paul Tillich's Philosophy of Art, 1983, 14, Anm. 32. Tillich ist von seinem Freund Eckart von Sydow in die moderne Kunst eingeführt worden, vgl. GW, Erg. Bd. V, 150. Die Formel wird von Tillich 1922 auf alles kulturelle, schöpferische Handeln bezogen: „Alles Schaffen kommt aus dem Unmittelbaren des Gehaltes, ist Durchbruch des Gehaltes in die autonome Form" Kairos (1922), HW IV, 66. M. Palmer, a. a. O.
Passion und Paradox
87
sehen Religion und Kultur gar nicht stellen, weil die bedingte Kultur trotz aller Bezogenheit niemals mit dem Unbedingten verschmilzt. Die Theologie richtet sich aber niemals unmittelbar auf das Unbedingte, sondern nur auf dessen Vermittlungen. Das Unmittelbare „ist" nicht. Jeder unbedingte Sinn verwirklicht sich im Bedingten, ohne mit dem Bedingten identisch zu werden: „Den Inbegriff aller möglichen Sinnzusammenhänge nennen wir objektiv gesprochen Welt, subjektiv gesprochen Kultur. Der unbedingte Sinn aber, auf den jeder Sinnakt in schweigendem Glauben gerichtet ist und der das Ganze trägt, ... ist in sich doppelseitig: er trägt den Sinn jedes einzelnen Sinnes sowie den Sinn des Ganzen. Das heißt: er ist der Sinngrund. Aber er ist jedem einzelnen Sinn gegenüber transzendent. Wir können darum von dem Unbedingten zugleich als Sinngrund und als Sinnabgrund reden." 47 Theologie ist immer „Kulturtheologie", weil das Unbedingte sich in seinen geschichtlichen Offenbarungen eine Form gibt, Gestalt wird, das Unbedingte nur im Bedingten ein sinnvolles Sein wird. Weil alle Kultur in Beziehung zum Unbedingten steht, darum steht alle Kultur in Beziehung zur Religion. In dieser Beziehung aber muß die „religiöse Potenz, d. h. eine bestimmte Qualität des Bewußtseins", vom „religiösen Akt" als solchem unterschieden werden 48 . Unter „religiöser Potenz" versteht Tillich das religiöse Prinzip, dasjenige, was in allen Kulturschöpfungen auf das Unbedingte bezogen ist. Demgegenüber ist der „religiöse Akt" ein Sinnakt, der in der speziellen Kultursphäre „Religion" in Mythos, Dogma, Kultus, Heiligung und Kirche geschieht. Dieser Akt ruht auf nichts anderem als der Verbindung, die die „religiöse Potenz" mit anderen außerreligiösen Kulturfunktionen eingeht 49 . Gefährlich für Religion und Kultur wird es dann, wenn sich das „religiöse Prinzip" in den „religiösen Akten" absolutsetzt und den Willen zur Autonomie der nicht unmittelbar religiösen Kulturfunktionen zu unterdrücken versucht, oder 47 48 49
Kirche und Kultur (1924), G W IX, 34. Theologie der Kultur, G W IX, 17. Ebd. Tillich will damit sagen, daß jeder religiöse A k t , auch der, der sich prophetisch gegen die Kultur richtet, auf einer Verbindung mit nicht spezifisch religiösen Elementen beruht. Das läßt sich besonders anschaulich an der atl. Prophetie zeigen, die für das spätere „Protestantische Prinzip" wichtig wird. Aber Tillich ist terminologisch ungenau. Wenn das Religiöse in allen Provinzen des Geistigen aktuell ist, dann auch in der speziell religiösen Sphäre. Dann entfällt die Grundlage der Kritik.
88
Peter Steinacker
neben diesen eine besondere Sphäre des Religiösen zu etablieren bzw. zu verteidigen trachtet. Dadurch entsteht „eine doppelte Wahrheit, eine doppelte Sittlichkeit, ein doppeltes Recht, von denen je eines nicht aus der Gesetzmäßigkeit der betreffenden Kulturfunktionen geboren ist, sondern aus einer fremden Gesetzlichkeit, die die Religion gibt. Diese Doppelheit muß unter allen Umständen aufgehoben werden; sie ist unerträglich, sobald sie ins Bewußtsein tritt, denn sie zerstört das Bewußtsein"50. Demgegenüber ist das Interesse einer Theologie der Kultur darauf gerichtet, Wissenschaft und Dogma, Gesellschaft und Gemeinschaft, Staat und Kirche zu einer komplexen Einheit zu verbinden. Die Kultur, die Tillich offenbar vorschwebt, ist das Gegenteil einer ausdifferenzierten Gesellschaft, deren einzelne Sphären miteinander konkurrierend sich ihre Autonomie zu bewahren trachten, ohne sie einer in ihre Belange eingreifenden Heteronomie zu opfern. Den Zustand der Kultur, in der die Autonomie (Ausdifferenziertheit) sich nicht einem gemeinsamen Einheitspunkt widersetzt, nennt Tillich „Theonomie"51, und deren Folge ist eine sozialistische „Einheitskultur". Darin vollendet sich der Sozialismus, durch die Entdeckung seines religiösen Gehaltes. Dieser Gehalt
50
51
A.a.O., 17 f. Auch diese Bemerkung ist schwierig. Tillich kann nicht kritisieren, daß es innerhalb der speziell-religiösen Kultursphäre Kulturfunktionen gibt, die diese Kultursphäre gestalten. Insofern gehört zur Ausbildung einer speziellen „Religion" natürlich eine „spezielle" Wahrheit. Er meint wohl den Sachverhalt, daß sich innerhalb eines Kulturkreises ζ. B. eine evangelische Ethik bildet, die sich dem Verallgemeinerungsgebot entzieht, also eine Trennung von Religion und Welt vollzieht. A.a.O., 18. Kairos, HW IV, 66 f.: „Es ist jetzt möglich, den Sinn des Kairos eindeutig zu bestimmen: Er ist das Hereinbrechen einer neuen Theonomie auf dem Boden einer autonom gelösten oder aufgelösten Kultur". Die Phase der Auflösung der Autonomie nennt er „Anomie". Dies wichtige Stichwort fehlt in der Fassung des Kairosvortrages in GW VI, 9—28, die eine Überarbeitung dieses Vortrages nach dem 2. Weltkrieg bieten. Diese Fassung ist aufschlußreich für den späten Tillich. Für den frühen aber ist sie ganz unbrauchbar. In der „Überwindung des Religionsbegriffs in der Religionsphilosophie" (1922), HW IV, 88/GW I, 386 sagt er: „Theonom möchte ich eine Geisteslage nennen, in welcher alle Formen des geistigen Lebens Ausdruck des in ihnen durchbrechenden Unbedingt-Wirklichen sind. Es sind Formen, also Gesetze, νόμοι, darum theonom. Aber es sind Formen, deren Sinn nicht in ihnen selbst liegt, es sind Gesetze, die das alles Gesetz Durchbrechende fassen, darum theonom".
Passion und Paradox
89
ist aber gesellschaftlich von entscheidender Bedeutung, weil er „allein die Autonomie des Einzelnen, sowie der einzelnen Kulturfunktionen durch die Theonomie ihrer selbstverzehrenden Vereinzelung entheben kann" 52 . Das Problem, das der Theologie der Kultur gestellt ist, besteht darin, Welt als sinnhaftes Ganzes zu verstehen und doch nicht mit Gott zu identifizieren; d. h. Kulturtheologie arbeitet als „konkret-normative Religionswissenschaft" 53 in einem gesellschaftlichen (kulturellen) Auftrag, nämlich in der Bearbeitung der überwiegend religiösen Kulturelemente und macht damit diese Elemente zu einem Kulturfaktor im gesellschaftlichen Ganzen. Tillichs Kulturtheologie übersetzt in ihrem Ansatz Schellings Kritik an Hegel aus dem idealistischen Gewand in gesellschaftliche Realität. Schelling bestand ja gegen Hegel auf der Freiheit Gottes gegenüber der Welt, die er durch Hegels Dialektikbegriff bedroht sah. Die Welt ist nicht notwendig mit dem Gottesbegriff gegeben, mit Tillichs Worten: das Unbedingte ist vom Bedingten frei; auch wenn es das Bedingte als Ort seiner Realisierung benutzt. Darum ist das Unbedingte (mit Schelling) Grund und Abgrund des Sinns. Die Theologie hat nun die Aufgabe, dieses Bedingte auf seine Kontingenz, sein Geworden-Sein hinzuweisen, also auf die Geschichtlichkeit, und zugleich, diese Kontingenz im Unbedingten, Ungeschichtlichen zu begründen. Gesellschaftliche Folge dieser Aufgabe ist, alle Kultur in ihrer Autonomie als schon religiöse zu bestimmen, eine Religion einerseits als überflüssig, wie dennoch als nötig zu erweisen. Daß es „Religion" als gesonderte Sphäre gibt, ist nicht notwendig (wie die Welt), aber zugleich getragen wie alles andere Bedingte vom Unbedingten. Damit aber stellt sich das Problem, ob Religion als Sondersphäre der Kultur überhaupt noch nötig ist, und wie anders der Gesellschaft dies Wissen um das Unbedingte bei Bewußtsein gehalten werden kann. Dies Problem geht Tillich mit einer Theorie der Religion, der Geschichtsphilosophie des „Kairos" und dem kulturtheologischen Dreischritt „Heteronomie—Autonomie—Theonomie" an. Die Theorie der Religion sichert den Gedanken, daß sich das religiöse Prinzip in der Kultur nur durch die Negation der Kultur hindurch gestaltet: „Religion ist 52 53
Theologie der Kultur, G W IX, 31. A.a.O., 14. Vgl. insgesamt noch „Religionsphilosophie" (1925), HW IV, 117ff., obwohl dort schon einige terminologische Verschiebungen vorliegen.
90
Peter Steinacker
Erfahrung des Unbedingten und das heißt Erfahrung schlechthinniger Realität aufgrund der Erfahrung schlechthinniger Nichtigkeit; es wird erfahren die Nichtigkeit des Seienden, die Nichtigkeit der Werte, die Nichtigkeit des persönlichen Lebens; wo diese Erfahrung zum absoluten, radikalen Nein geführt hat, da schlägt sie um in eine ebenso absolute Erfahrung der Realität, in ein radikales Ja" 54 . Religion ist also zunächst die Erfahrung, der alles, was ist, alle Kultur und Geschichte im Widerfahrnis des Unbedingten (schlechthinnige Realität) zergeht. Vor dem Unbedingten ist alles Bedingte nichts. Darum muß eine Religionsphilosophie, die „nicht vom Bedingten, sondern vom Unbedingten" ausgeht, den traditionellen Begriff der Religion überwinden 55 . Wenn der Religionsbegriff die Religion aus der Selbstgewißheit des Ich oder aus der Weltwirklichkeit oder überhaupt aus der Kultur, aus dem autonomen Geistesleben (im Sinne einer offenbarten Vernunftreligion oder der Religionsgeschichte) begründet, dann bringt er Göttliches und Menschliches auf eine Ebene 56 , gründet das Unbedingte auf das Bedingte. Damit wird der Begriff des Unbedingten zerstört 57 . Tillich versucht dagegen Religion im emphatischen Sinn — gegen die theologische Tradition — von Gott her zu denken, also nicht als „Funktion des menschlichen Geistes" 58 . Dann aber ist Religion der direkte Gegenbegriff zu Kultur, ein „verzehrendes Feuer gegen alle autonomen Geistesfunktionen" 59 . Wenn aus „Religion" Kultur wird, wenn sie also „religiös" wird, dann hat sie sich selber verloren. Wirkliche „Religion" kann nie Kultur werden, weil ihre Absolutheit, das Unbedingte, keine Relativierung verträgt 60 . Offenbarungsgeschichte kann nicht in Kulturgeschichte aufgelöst werden. Von hier aus ist offenkundig, wie sehr Tillich der Barthschen und der expressionistischen Religionskritik verwandt ist. Seine Kulturtheologie 54 55
56 57 58 59 60
Theologie ..., G W IX, 18. Überwindung ..., HW IV, 87/GW I, 384. Ausdrücklich weist Tillich auf „geistige Gemeinschaft ... mit Männern des religiösen Wortes, wie Barth und Gogarten" hin, legt aber Wert darauf, daß seine Ausführungen „Philosophie" seien (a. a. O., 74/367 f.). HW IV, 85/GW I, 382. A. a. O., 74/368. A. a. O., 75/369. Ebd./370. A. a. O., 78 f./374.
Passion und Paradox
91
ruht geradezu auf der radikalen Kritik an der Kultur durch die „Religion" im emphatischen Sinn, also der Religion, die vom Unbedingten her gedacht wird. Das Unbedingte nichtet alles Seiende, alles Bedingte. Und das Unbedingte selber ist nichts Seiendes, nicht Substanz, nicht die Totalität des Seienden, es ist das „Übersehende"61. Ja, die Kultur gewordene Religion, die Kunst wie Geschichte, Moral wie Staat mit religiöser Weihe versieht und selbstverständlich damit rechnet, daß „Gott ist", ist in Wahrheit Gottlosigkeit und „vernichtet ... die Gottheit Gottes"62. Allein die Beschwörung und die Anerkenntnis dieses Urteils über alles Seiende erzeugt nun vom Unbedingten her ein „Ja" als Ergebnis dieser Krisis. Aber dieses „Ja" ist keinesfalls Ergebnis menschlicher Vorbereitung, sondern des „Durchbruchs" des Unbedingt-Wirklichen, einer Handlung des schlechthin jenseitigen Gottes, die nicht anders als mit solchen der Gewalt verschwisterten Vokabeln wiedergegeben werden kann. Diese Gewalt des Unbedingten können die Menschen nur erleiden, passiv an sich geschehen lassen als Verneinung ihres Selbst. Anders sind „Erlösung, Offenbarung, Heil, Wiedergeburt, Leben, Vollendung", also das, was die wahre „Religion" will, nicht zu erreichen63. Einzig die Negation beschwört die Position mitten im Verlorenen. Das hatte Barth ganz genauso gesagt. Ja, hinsichtlich der ontologischen Begriffe ergibt sich eine völlige Übereinstimmung, ausgenommen des Schellingschen Begriffs des „Überseienden", der Barth vielleicht nicht bekannt war. Und solche emphatische Religion hatte der Expressionismus in seiner Religionskritik negativ beschworen. Der Begriff des „Durchbruchs" ist nach Tillich ihm zur maßgebenden Kategorie seines Offenbarungsverständnisses im Zusammenhang mit dem Expressionismus geworden64. Dieser Begriff aus der Deutschen Mystik bezeichnete dort das Eingehen der Seele in Gott aus der Vielheit zur Einheit. Dabei wird keine Form, also kein Leben ^erbrochen, sondern verlassen. Denn Form ist Vielheit und steht der Einheit als Ziel im Wege. Tillich löst 61
62 63 64
Theologie der Kultur, G W IX, 18. Diesen Begriff Schellings nennt Tillich hier „mystisch". Überwindung ..., H W I V , 83/GW I, 379. A. a. O., 85/382. Vgl. „Auf der Grenze", G W XII, 21. Tillich kann sich hier irren. Die Kategorie des Durchbruchs ist eine typisch mystische Formel, die bei Eckhart und Böhme dominiert und die er sicher schon bei Schelling kennengelernt hatte. Tillich interpretiert sie allerdings völlig neu.
92
Peter Steinacker
den Begriff aus seinem mystischen Umfeld und stellt ihn über die Ästhetik in den Dienst der Religionsphilosophie, indem er seine Zielrichtung umkehrt. Zielte er genuin vom Menschen auf Gott, so zielt er bei Tillich nun von Gott auf den Menschen. Dies entspricht der Drehung des Religionsbegriffes überhaupt. Tillich bedient sich also der Sprache der Tradition, aber dreht sie völlig um. Das entspricht den Formexperimenten der Expressionisten. Den Zeitpunkt, in dem sich solcher „Durchbruch" ereignet, in dem sich uns jene religiöse Realität durch die Dinge hindurch aufzwingt 65 , nennt Tillich „Kairos". Er bindet also die religions- und kulturkritische Theorie der Religion in eine Geschichtsphilosophie ein, verbindet sie mit einem „Geschichtsbewußtsein, dessen Wurzeln herabreichen in die Tiefen des Unbedingten" 66 . Durch diese Beziehung erweist sich dieses Bewußtsein als „religiös" im nachkritischen Sinn. Sofern Kulturelles sich auf das Unbedingte bezieht, ist es in seiner Tiefe „religiös", begründet „Religion" die Kultur. Theologie ist Funktion der Kultur, nicht der Kirche als Religionsinstitut. Weil der religiöse Sozialismus „der Deutungs- und Gestaltungsversuch des Sozialismus vom Unbedingten, vom Kairos her" ist, darum ist er die stärkste „kairosbewußte Bewegung" 67 . „Kairoi" sind jene Momente im Verlauf menschlicher Geschichte, in denen sich autonome Kulturen wiederum auf das Unbedingte auszurichten im Begriff sind. Die autonomen Kulturen sind als Gegenbewegungen gegen heteronome entstanden. Diese sind ein Zerfallsprodukt ursprünglich theonomer Kulturen. Die Geschichte besteht also aus der sich immer wiederholenden Bewegung von Theonomie über die Heteronomie und Autonomie, die den Kairos vorbereitet. Auf dem Punkt aber, wo die Autonomie den Kampf gegen die Heteronomie siegreich vollendet hat, gerät sie in ihre entscheidende „Krisis": sie kann entweder in „Anomie" zerfallen, weil die den „Gehalt" (das ist Tillichs ästhetische Chiffre für das Unbedingte) erschöpft und damit die Form zerstört. Oder die „Krisis" richtet die Autonomie so auf das Unbestimmte aus, daß der „Gehalt" in die autonome Form „durchbricht": „Kairos ist der epocheschaffende Zeitmoment, in dem ein autonom gelöstes Zeitalter
65 66 67
Theologie der Kultur, GW IX, 18. Kairos (1922), HW IV, 53. A. a. O., 69.
Passion und Paradox
93
aus drohender oder vollendeter Anomie sich der Theonomie, der neuen Füllung mit unmittelbarem Gehalt des Unbedingten zuwendet" 68 . Nun ist der Begriff der Autonomie von einer eigentümlichen Paradoxic umgeben. Einerseits ist er der Begriff, der die Bewegung der Geschichte als Geschehen überhaupt trägt. Die Autonomie „bringt in die ruhende Festigkeit theonomer Geisteslagen die Bewegung" 69 . Das erzeugt in der Theonomie einen Widerstand, der aber nicht mehr theonom, sondern heteronom verstanden werden muß. Es ist der Versuch, von einem absolut gesetzten Standpunkt alles davon abweichende Andere zu vergewaltigen. Tillich erklärt aber nicht, weshalb die Theonomie überhaupt zerfallen muß, sondern setzt diesen Zerfall als gegeben, ja notwendig voraus. Er ist ihr Verhängnis. Autonomie ist also ein einerseits notwendiges und andererseits schuldhaftes Geschehen! Die Krisis und das in ihr mögliche Heil ruhen neben der Initiative des Unbedingten auf dem schuldhaften Zerstören theonomer Zustände. Die Theonomie, die sich auf der in ihre eigene Krisis geratene, gereifte Autonomie erhebt, ruht auf überwundener, aber unausweichlicher Schuld. Geschichte ist immer Geschichte der Schuld, selbst solche Geschichte, die das Unbedingte in seiner Souveränität zum „Kairos" formt. Tillich verbindet in diesem Gedanken die idealistische Vorstellung von der „felix culpa" mit der im Expressionismus Trakls bestimmenden Einsicht von der vitalen, mit dem Leben als dynamischem Leben selbst gegebenen, transmoralischen Schuldverfallenheit. Diese ambivalente Sicht der Autonomie hallt in Tillichs eigenem Erleben wider. Er hatte sich ein autonomes Leben gegen die Autorität des Vaters hart erkämpfen müssen. In seiner Autobiographie schreibt er: „Die uralte menschliche Erfahrung, daß neue Erkenntnisse nur durch Brechung eines „Tabus" errungen werden kann, daß also autonomes Denken von Schuldbewußtsein gefolgt ist, war und ist eine fundamentale Erfahrung meines persönlichen Lebens" 70 . Die Tragik der Autonomie besteht darin, daß sie 68
69 70
A. a. O., 68. Tillich nennt die „abendländische Entwicklung" die „geschichtlich wirksamste, Menschheitsgeschichte schaffende Form des Kairos". Dies widerspricht allerdings der Grundkonzeption der Geschichtsphilosophie, insofern hier mehr- oder minderwertige Kairoi unterschieden werden. A.a.O., 66. „Auf der Grenze", G W XII, 26. Vgl. auch ein anonymes graphologisches „Gutachten" aus diesen Jahren innerer und äußerer Befreiung: „Er hat viel Schuldgefühl. Viel Angst" in: GW, Erg. Bd. V, 155.
94
Peter Steinacker
als „Form" gesetzlich wird und damit das Leben, das sie gegen die Heteronomie mit Recht verteidigt hat, nun selber tötet. Sie kann selber keinen „einzigen Lebensinhalt schaffen", das ist ihr „Unrecht gegenüber der Theonomie" 71 , die nur da siegt, wo sie als Paradox erlebt wird. Die Paradoxie der Autonomie aber ist nur Ausdruck einer viel weitreichenderen, ontologischen Paradoxie, die in der Beziehung des Unbedingten zum Bedingten, ja im Unbedingten selber gründet. Dieser paradoxen Struktur entspricht dann die paradoxe Struktur der religiösen Grunderfahrung, und diese Entsprechung setzt sich fort in die philosophische Methode, ja ist der Grundcharakter des „Lebens aus Gott": „Anschauen dieser unendlichen Paradoxie ist Denken über Gott, und wenn es methodisch wird, Religionsphilosophie oder Theologie" 72 . Tillichs methodischer Rekurs auf das Paradox hat neben philosophischen auch ästhetische Wurzeln. Was sich philosophisch in der Frage nach der Übereinstimmung von Begriff und Sache, von Denken und Leben problematisiert, das begegnet den Künstlern um die Jahrhundertwende als „Sprachnot", als „Sprachkrise", die jeweils unterschiedlich mit einer gewissen „Hermeneutik des Sinnes" oder einer „Tendenz zur Privatsprache" und speziell in der Lyrik durch die Uberzeugung von der eigentlichen Unaussprechlichkeit des Ich zu begegnen suchten. Trakls Sprachexperimente sind der Versuch, dieser Sprachkrise zu begegnen. Tillichs begriffliche Arbeit, die auf das Paradox zielt, ist die philosophisch-theologische Entsprechung.
VI. Damit ist die Ausgangsthematik wieder erreicht, der Streit um das Paradox. An ihm kann nun die These noch einmal bekräftigt werden. Dabei kann es nicht darum gehen, die historische Debatte und ihre bewußten und unbewußten Mißverständnisse noch einmal vorzustellen. Erwähnenswert aber ist, daß beide Kontrahenten die Schwäche des 71
72
Überwindung ..., HW IV, 89/GW I, 387. In dieser Schrift spricht Tillich von einem Kampf zwischen Autonomie und Theonomie. Die Theonomie bricht nur schicksalsmäßig durch die Form. Anders in Kairos (1922), wo die Autonomie der Theonomie den Boden bereitet. Überwindung .... HW IV, 88/GW I, 386.
Passion und Paradox
95
anderen genau trafen. Tillich ist völlig im Recht, wenn er Barth (und Gogarten) vorhält, sie hätten nur ungenügend reflektiert, daß ihre Negationen philosophisch eine Position voraussetzen, nämlich einen Punkt, an dem das Unbedingte sich zum Bedingten in Beziehung setzt und daß von diesem Gegenstand die theologische Sprache selbst beeinflußt werden muß. Darum müsse man von einem „positiven Paradox" sprechen 73 . Andererseits legt Barth mit gleichem Recht den Finger auf Tillichs Wunde. Das ist wirklich die Christologie, die zum allgemeinen Geistesgeschehen verdampft. Tillichs Theologie löst die Kontingenz des Heilsereignisses auf in eine christologische Grundstruktur aller Geschichte 74 . Aber an der entscheidenden Stelle der Argumentation, nämlich der Bestimmung des Punktes oder der geschichtlichen Stelle, an der das Unbedingte ins Bedingte durchbricht (Tillich), bzw. das Wunder des absoluten Moments, des ewigen Augenblicks (Barth) Gestalt gewinnt, und wie diese Gestalt material beschrieben werden kann, findet sich bei beiden das von Tillich an Barth kritisierte „Loch". Barth übertönt dieses „Loch" durch die Sprachgewalt des „Römerbriefes". Der Glaube, der sich im Erleiden des nichtenden Urteils Gottes als gerettet, gerechtfertigt und auferweckt erfährt 75 , findet keine Sprache, um seine Wirklichkeiten (und nicht nur den glücklichen Augenblick) zu beschreiben, weil diese Wirklichkeiten durch den ewigen Ratschluß Gottes als Wirklichkeiten nur Schein sind. Der ewige Ratschluß Gottes vor aller Zeit entwertet das von Barth an Tillich so vehement verteidigte kontingente Ereignis
73
74
75
Paradox ... (1923), HW IV, 93. Wie genau Tillich getroffen hatte, das zeigt Barths überheblicher und schulmeisterlicher Ton. Umgekehrt zeigt Tillichs gekränkte Entgegnung auch an, wie genau Barths Hieb getroffen hat. Von der Paradoxie des „positiven Paradox", in: Tillich HW IV, 98—101, vgl. bes. 105 f. Bemerkenswert ist, daß Tillich in der schon erwähnten Überarbeitung (Anm. 51) eine Passage einträgt, die offensichtlich Barths Einwände aufnimmt: „Kairos in seinem einzigartigen und universalen Sinn ist für den christlichen Glauben das Erscheinen Jesu als des .Christus'. Kairos in seinem allgemeinen und speziellen Sinn ist für den Geschichtsphilosophen jeder Wendepunkt in der Geschichte, in dem das Ewige das Zeitliche richtet und umwandelt. Kairos in seinem besonderen Sinn für uns, in seinem für unsere augenblickliche Lage entscheidenden Charakter ist das Hereinbrechen einer neuen Theonomie auf dem Boden einer profanierten und entleerten autonomen Kultur", G W VI, 24. Römerbrief, a. a. O., 401.
96
Peter Steinacker
Jesus von Nazareth, weil dieses nur noch die verborgene Aufdeckung der verborgenen, aller Schöpfung vorausgehenden, wahren Wirklichkeit ist. Gleiches aber muß von Tillichs zentralen Begriffen gesagt werden. Was meint denn „Theonomie" materialiter? Was heißt im anderen Zusammenhang „Rechtfertigung des Zweiflers" inhaltlich, wenn nicht damit die Freiheit des wissenschaftlichen Betriebes gemeint sein soll, was Tillich zweifellos nicht meint? Was heißt „Gehalt", wenn damit ausdrücklich jeder „Inhalt" nicht gemeint ist76? Vor der Gewalt des Durchbruches des Gehaltes zerbricht die Form, und der Inhalt schwindet dahin, ja die ganze Beziehung von Form und Inhalt löst sich auf. Die Form wird unmittelbar zum Gehalt, weil in ihr „die religiöse Realität mit ihrem Ja und Nein über die Dinge zum Vorschein" kommt77. Was aber keinen Inhalt hat, ja sogar formlos wird, das ist — nichts! Das Paradox, daß Offenbarung dort geschieht, „wo eine schlechthin neue Wirklichkeit zugleich gesetzt und als niemals setzbar verheißen wird" 78 , kann keine Wirklichkeit werden. Denn Wirklichkeit kann zwar aus und in Widersprüchen existieren, aber nicht von einem schlechthin inhaltlosen und formlosen Gehalt. Nur wo die Gegensätze, die in ihrer Spannung Wirklichkeit ausmachen, überwunden werden, herrscht Theonomie. Tillich hat für die Kennzeichnung der Zeitstruktur dieser wahren Wirklichkeit genau wie Barth und genau wie die Expressionisten nur die Kategorie des Augenblickes zur Verfügung; des Augenblickes, der vorübergeht, der aber einzig die wahre Realität ist. Er ist der Ort des geistesgeschichtlichen Kampfes. Darum kann seine „Realität", gegen Tillichs Versicherung, nie die Realität einer Kultur, einer Religion, einer Kirche, einer Gesellschaft werden. Sie geschieht „nur als Aufhebung jeder endlichen Form, d. h. als Wort vom Kreuz"79. Aber auch dieses „Wort vom Kreuz" ist nun nichts Positives, sondern reinste Formalität, ohne jeden Inhalt. Es bleibt die reine Aufhebung als Vollzug. Was dieses Wort positiv ist, bleibt unbestimmbar. Gemeint ist kein Verweis auf den historischen Jesus, die Kontingenz der Offenbarung oder den Christus, sondern ein strukturell (paradox) beschreibbarer Vorgang. Darum bleibt
76 77 78 79
Vgl. Theologie der Kultur, G W IX, 20. Ebd. Kirche und Kultur, GW IX, 41. A. a. O., 42.
Passion und Paradox
97
die Gemeinde, die sich um die reine Formalität des Aufhebens schart, unsichtbar. Sie wird noch nicht einmal mit vergangenen und zukünftigen theonomen Einheiten von heilig und profan identisch gedacht werden dürfen80. Was aber den Anschein erweckt, Gestalt zu sein und dennoch gestaltlos bleibt, das ist Schein. Das hat Barth mit seinem wirklich törichten Vorwurf, Tillich behaupte direkte Beziehungen von Gott und Welt81, betreibe also so etwas wie „natürliche Theologie", völlig übersehen. Vom Expressionismus her aber kann diese Scheinhaftigkeit als der Versuch erschlossen werden, das Unsagbare sagbar zu machen. Inhaltlich stimmt Tillich mit dem expressionistischen Verständnis der Geschichte und Kultur überein. Vor dem Einbruch des Unbedingten sind sie nichts. Der Gott der Religionen ist ein Götze, ohne Sinn und Erfahrung des Abgrundes. Rettung und Erlösung kann nur beschworen werden durch die schonungslose Offenlegung des Sachverhaltes, daß weder in Religion, noch in der Kunst und Wissenschaft, noch im gelebten Leben selbst beides unmittelbar beschlossen ist. Und daß dies so ist, ist die Tragik des Lebendigen und des zeitlichen Seins. Alles, was ist, ist von Schuld umfangen, denn das Leben zerbricht sich selber immer wieder. Und Schuld kann nicht von Schuldigen überwunden werden. Nichts Kritisches kann auch sich selbst aus der Krise herausführen, in die sich das Seiende durch sich selbst und durch das Nicht-Sein verstrickt. Darauf reagiert die philosophisch-theologische Begrifflichkeit. Wenn sie sich auf das Unbedingte antwortend richtet, zielt jede Aussage über das Unbedingte über sich selbst hinaus. Philosophisch-theologisches Aussagen, Begriffe haben perspektivischen Charakter, ihr Sinn besteht darin, einen Leerraum zu erschließen, ein Nichts an Bedeutung, auf dessen inhaltliche Füllung lediglich perspektivisch verwiesen wird. Diese Uneigentlichkeit solcher Begriffe unterscheidet sie von Begriffen, die etwas über Bedingtes aussagen und der Differenz von Sprache und Sein verfallen sind. Daß Begriffe nicht die Sache selber sind, das ist nicht nur gemeint; denn die Begriffe, die auf das Uneigentliche zielen, beschwören in der Abwesenheit der Sache ihre wirkliche Gegenwart, im Nichts das Alles, im Schein das Scheinlose. Auch wenn beide 80 81
Vgl. ebd. Vgl. Paradoxic (Anm. 74), HW IV, 105. Theologisch hatte Tillich Barth fehlende Schöpfungstheologie vorgeworfen.
98
Peter Steinacker
Begriffsklassen sich dem Schema von Subjekt und Objekt beugen, so benutzen die Aussagen über das Unbedingte zwar diese Form, „aber doch so, daß ihr Unzulängliches offenbar wird, d. h. sie (solche Aussagen über das Unbedingte, d. A.) muß die Form der systematischen Paradoxie tragen" 82 . „Rechtfertigung des Zweiflers", „Gehalt", „Theonomie", „Kairos" — das sind Begriffe, die perspektivisch über sich selbst hinaus auf das Unbedingte verweisen; eben dadurch, daß sie selber inhaltlich leer sind, aber eine Perspektive auf das Unbedingte erschließen und zu einem System konfiguriert werden. Das ist der Sinn eines „systematischen Paradoxes". In diesem Begriff taucht analog das auf, was Killy in Trakls Gedichten als Chiffren bezeichnet hat. Sie dürfen für sich allein genommen nicht interpretiert werden, weil sie für sich allein nichts sind. Erst als Konfigurationen, also im Zusammenhang des Gedichtes, ergeben sie mittels der parataktischen Form eine Leerstelle an, die sie durch ihren Verweisungsüberhang perspektivisch füllen — ohne mit dem Verwiesenen je identisch und deckungsgleich zu werden. Darum dürfen auch Tillichs Begriffe in dieser Zeit seines Denkens nicht so „ernst" genommen werden, weil sie dann ihre Leuchtkraft verlieren. Denn die Leerstelle, auf die sie entsagend verweisen, markiert das existenziell erfahrene Nichts, das zugleich das mögliche Alles ist. Gerade das so oft beklagte Schillern von Tillichs Begriffen erschließt sich der ästhetischen Interpretation als ihre wahre Stärke. Denn die Hörer oder Leser dieser Schriften teilten mit ihm die schreckliche Erfahrung des Unterganges aller Kultur, Werte und Religion in den Schlachtfeldern des Krieges. Angesichts dieses Unterganges ist jede „Position", im Sinne eines wirklich „objektiv" und „positiv" Gegebenen, eines „objektiv" anschaulichen und gegenständlichen Guten eine Gotteslästerung, vergleichbar der Einreihung Gottes in die Gegenstandswelt. Diejenige Theologie bzw. Philosophie ist jener Zeiterfahrung am nächsten, die diesen Untergang nicht vorschnell zur Position ummünzt. Dies war Barths Stärke und — mit Wandel der Zeiten — die Schwäche seiner frühen Theologie, die er bald nach dem „Römerbrief' erkannt hat. Schon seine Antwort auf Tillich spricht von der Kirche als „Voraussetzung der Theologie" und verweist auf die „unauflösliche
82
Überwindung .... HW IV, 81 /GW I, 377.
Passion und Paradox
99
Korrelation des theologischen Wahrheitsbegriffs mit den Begriffen wie Kirche, Kanon, Heiliger Geist" 8 3 . Das ist eine ganz andere Sprache als die des „Römerbriefes". Genau dies aber war auch Tillichs Stärke. Auch seine Begriffe markieren keine wirklich inhaltliche Position, sondern sie beschreiben den Sachverhalt, daß diese abgründige Negation alles Irdischen nicht nur schuldhaftes Verhängnis ist, sondern durch das Unbedingte gewirkt wird um willen einer neu gründenden Bejahung. Diese kann freilich nur eingekreist, umkreist, mehr geahnt als gewußt, mehr bestammelt als beredet werden. Das ist Apologetik, gemeinsames Sein mit den Zeitgenossen, aus dem verständliches Reden folgt. Als diese Geistesgegenwart die sich wandelnde Zeit spürte, änderte sie ihren Wirklichkeitssinn: an die Stelle dieses leeren Raumes treten „Protestantisches Prinzip", „gläubiger Realismus" und die „Gestalt der Gnade". In den Anfängen wird die Leerstelle, die Tillichs Begriffe in ihrer Inhaltslosigkeit eröffnen, gefüllt durch den dies alles mehr als wissenden Lebensvorgang, in dem das Unbedingte sich gnadenhaft vergegenwärtigt. Darum erscheint Tillichs frühe Theologie manchmal vitalisitisch, ohne es aber wirklich zu sein. Auch das Leben selber verfällt ja der Kritik. Der Untergang der Kultur, das Schweigen Gottes in der Religion — das alles ist der Beginn seines neuen Redens. Man muß nur das in diesem Nein verborgene, es begründende J a hören und spüren — dann öffnet sich die Welt als Welt Gottes in allem, was ist.
83
Paradoxie ..., a . a . O . , 109.
ROBERT P. SCHARLEMANN
Ontologie: Zur Begriffsbestimmung bei Tillich in den zwanziger Jahren Die Erneuerung der Seinsfrage in unserem Jahrhundert ist bekanntlich Heidegger zu verdanken. Er weist in seinem „Sein und Zeit" darauf hin, daß die Frage nach dem Sinn vom Sein trotz erneuter Bejahung der Metaphysik in Vergessenheit gekommen sei. Er deutet dabei an, daß die ontologische Frage, die Frage nach dem Sinn vom Sein, etwas andres ist oder sein kann als die metaphysische Seinsfrage. Den Unterschied zwischen jener „metaphysischen" Bejahung der Seinsfrage und der ontologischen Untersuchung Heideggers möchte ich mit Bezug auf Tillichs Schriften aus den zwanziger Jahren verfolgen. Ich beginne aber mit der ontologischen Grundlegung in der „Systematischen Theologie", wo die beiden Seinsbegriffe — der metaphysische und der ontologische — vorhanden zu sein scheinen. „Systematische
Theologie"
In der Begründung der Möglichkeit einer Ontologie, wie sie Tillich im ersten Band seiner „Systematischen Theologie" entfaltet, scheinen diese beiden verschiedenartigen Begriffe von Ontologie am Werk zu sein. Wir können sie in Anlehnung an Heidegger den „metaphysischen" und den „ontologischen" Seins- oder Ontologiebegriff nennen. Der metaphysische Seinsbegriff erscheint in der Frage: „Was ist das Sein selbst?" Der ontologische Seinsbegriff erscheint in der Frage: „Was ist in der Frage nach dem Sein immer schon vorausgesetzt?" Nach dem ersten Begriff ist das Verhältnis vom Sein zum Seienden so etwas wie ein Verhältnis vom Allgemeinsten zum Besonderen. Nach dem zweiten Begriff ist das Verhältnis vom Sein zum Seienden ein Verhältnis von der Denken-Sein-Struktur zum jeweiligen Akt oder zur Verwirklichung dieses auf das Sein gerichteten Denkens.
Ontologie
101
So lesen wir bei Tillich: „Die ontologische Frage lautet: Was ist das Sein selbst? Was ist das, das nicht ein besonderes Seiendes oder eine Gruppe von Seiendem ist, nicht etwas Konkretes oder etwas Abstraktes ...?" Das ist der metaphysische Seinsbegriff. Daneben steht ein anderer. „Philosophie stellt die Frage nach dem Sein als Sein. Sie untersucht den Charakter alles dessen, was ist, sofern es ist. ... Die Antwort, die sie hier gibt, bestimmt die Analyse aller besonderen Formen des Seins. Die Frage nach dem Sein als Sein ist ,Erste Philosophie', oder wenn dieses Wort noch gebraucht werden könnte, .Metaphysik' " (ST 1:163 [deutsch, S. 193]). Das ist der ontologische Seinsbegriff. Zunächst fällt in diesen Zitaten auf, daß Tillich zwischen Metaphysik und Ontologie keinen prinzipiellen Unterschied macht. Es gehe vielmehr nur um das Wort, und das Wort „Ontologie" sei vorzuziehen, weil es nicht so sehr von irreführenden Nebenbedeutungen belastet sei. Das fällt auf, weil in Tillichs „System der Wissenschaften nach Gegenständen und Methoden" (1923) Ontologie und Metaphysik voneinander unterschieden sind, aber auf andere Weise als bei Heidegger. Wichtiger aber als die Frage, ob das eine oder das andere Wort vorzuziehen sei, ist der dahinterstehende Ontologiebegriff selbst. Auf der einen Seite scheint Tillich den Ontologiebegriff, wie er in Heideggers „Sein und Zeit" vorkommt, aufzunehmen, wenn er der Philosophie die Frage zuweist, was das Sein als Sein ist. Auf der anderen Seite jedoch scheint er das Verhältnis des Seins zum Seienden nach dem Gesichtspunkt der Universalität anzusehen. Der Seinsbegriff soll sich von ontologischen Begriffen dadurch unterscheiden, daß er der allgemeinste sei. Der allgemeinste Begriff läßt sich nicht genau definieren, weil er keine Gattung ist, wie andere allgemeine Begriffe das sind. Er läßt sich aber determinieren, weil es Begriffe gibt, die weniger allgemein als der Seinsbegriff und doch allgemeiner als ontische Begriffe sind — d. h. allgemeiner als Begriffe, die nicht Gattungen oder Arten, sondern Regionen oder Sphären des Seienden bezeichnen. Begriffe von solcher Allgemeinheit nennt man Prinzipien oder Kategorien. „Baum" ist ζ. B. ein Gattungsbegriff; „Realität" oder „Substanz" sind Kategorien (im weiteren Sinne als die „Kategorien" des endlichen Seins und Denkens). Diese mittleren Begriffe ermöglichen es uns, eine gegliederte Seinsstruktur auszuarbeiten, um das Sein als solches begrifflich zu definieren. Das Sein ist zwar als Sein jenseits aller Struktur und deshalb genau genommen nicht definierbar, aber die Strukturbegriffe, die dem Sein Gestalt geben, bestimmen
102
Robert P. Scharlemann
das Sein durch die Elemente eines Seinsgefüges. Das Denken ist also nicht darauf beschränkt, einfach tautologisch zu sagen: „Das Sein ist das Sein". Auf die Frage, „Was ist das Sein?" kann man zwar nicht antworten: „Das Sein ist dies oder das" — also das Sein durch einen Begriff definieren. Man kann aber antworten: „Das Sein ist das, was in der ontologischen Struktur begreifbar wird." Die ontologische Struktur ist aber die Subjekt-Objekt- oder Selbst-Welt-Struktur. Sie kann sich zum Sein nicht wie eine Art oder ein Besonderes zur Gattung verhalten. Mit anderen Worten: das Sein, das der allgemeinste Begriff wäre, ist das Sein des Seienden, das dem Denken gegenüber steht, und ist dem Prädikat „Seiendes" gleich — ein Baum, ein Stein, ein Mensch, jeder ist unter anderem „ein Seiendes". Das Sein aber, das in der DenkenSein- oder Selbst-Welt-Struktur implizit enthalten ist, steht nicht dem Denken gegenüber, sondern ist durch das Denken ebenso wie durch jedes Seiende, das Gegenstand des Denkens ist, strukturiert. Das sind, wenn ich mich nicht täusche, die zwei Ontologiebegriffe, die an dieser Stelle in der ST wie auch anderswo bei Tillich ineinanderverflochten sind. Wie ist das zu erklären? Ich möchte nun die These vertreten, daß der Ubergang vom metaphysischen zum ontologischen Ontologiebegriff — von der Frage: „Was ist das Sein des Seienden" zur Frage: „Was ist Sein als Voraussetzung des Denkens an das Sein?" — in dem vermutlich 1928 von Tillich geschriebenen Prolog zu seiner „Gestalt der religiösen Erkenntnis" (1928) stattfindet. Daß dies unter dem Einfluß von Heideggers im April 1927 erschienenen „Sein und Zeit" geschieht, scheint außer Zweifel zu stehen, nicht nur, weil Tillich in seiner Autobiographie „Auf der Grenze" (1936) auf den Eindruck, den Heideggers „theonome Philosophie" auf ihn gemacht hatte, hinweist, sondern auch weil die eigentümliche Begrifflichkeit des Prologs, die sonst nicht vorkommt, den direkten Einfluß von „Sein und Zeit" nahelegt. Das läßt sich erkennen, wenn man den Ontologiebegriff im SdW mit dem in der „Gestalt der religiösen Erkenntnis" vergleicht. Im SdW ist Metaphysik der Oberbegriff; in „Gestalt" ist — wie in den späteren Schriften — Ontologie der Oberbegriff.
Ontologie und Metaphysik im SdW (1923) Im SdW steht Ontologie auf der gleichen Ebene mit Geschichte; sie macht als Seinsmetaphysik den einen Teil der Sinnmetaphysik aus,
Ontologie
103
deren anderer Teil die Geschichtsmetaphysik ist. Sinnmetaphysik ist der Oberbegriff; darunter stehen Seinsmetaphysik und Geschichtsmetaphysik. So schreibt Tillich: „Auf die ... Frage [nach dem Verhältnis des Unbedingten zum Seienden] antwortet die Seinsmetaphysik oder Ontologie" (GW I: 255). Ihre Aufgabe ist es, zu zeigen, „in welcher Weise das Sein als Ganzes, als universale Gestalt, ein Symbol für den unbedingten Sinn ist. ... Sie [hat die Aufgabe], den Aufbau alles Seienden und seine Einheit als Ausdruck des reinen Sinnes zur Darstellung zu bringen." Außer dieser Frage, die das Seiende betrifft, gibt es zwei andere: die Frage nach dem Verhältnis des Unbedingten zum Geistesprozess und die nach der Sinneinheit des Seins- und des Geistesprozesses. „Geschichtsmetaphysik ist Sinndeutung des Geistesprozesses vom unbedingten Sinn her" (I: 255), wie die Ontologie oder Seinsmetaphysik Sinndeutung des Seienden ist. Beide — Ontologie und Geschichtsmetaphysik — gehören zur Sinnmetaphysik, der es immer um die Erfassung der Sinnelemente geht (251) und die man Metaphysik im eminenten Sinne nennen könnte. Es sind also drei Grundfragen, auf die die Metaphysik antwortet. Sie sind alle Sinnfragen und nicht Seinsfragen. Die Frage nach dem Verhältnis vom Unbedingten zum Seienden wird von der Ontologie oder Seinsmetaphysik beantwortet. Die Frage nach dem Verhältnis des Unbedingten zum schöpferischen Geistesprozess wird von der Geschichtsmetaphysik beantwortet. Und die Frage nach der Sinneinheit von Seinsprozeß und Geistesprozeß wird von der „Metaphysik der absoluten Idee" beantwortet. Sein, Geschichte, absolute Idee — das ist der Dreitakt. Nach dem Schema des SdW ist die so verstandene Metaphysik, die Ontologie und Geschichtsmetaphysik in sich schließt, ein Ausdruck der theoretischen Vernunft. Zur theoretischen Vernunft gehören als fundierte Funktionen Wissenschaft und Kunst. Es ist deshalb nötig, den Zusammenhang von Wissenschaft und Kunst in die Betrachtung mit einzubeziehen, um den Metaphysikbegriff des SdW zu klären. Wissenschaft ist dadurch gekennzeichnet, daß sie versucht, die Formen der Wirklichkeit zu ergreifen. Wissenschaft weiß um die Weltwirklichkeit oder um das Sein mittels der Wirklichkeitsformen. Sie ist theoretisch, da sie die Wirklichkeit anschaut. Aber diese Anschauung findet in ganz bestimmter Weise statt. Sie vollzieht sich nämlich als Ergreifen der die Wirklichkeit gestaltenden Formen. Wissenschaft sieht dabei vom Gehalt der Wirklichkeit ab. Wissenschaftliche Erkenntnis ist immer Erkenntnis
104
Robert P. Scharlemann
nach der Form der erkannten Dinge. Dagegen ist die Kunst diejenige fundierte theoretische Funktion, die den Gehalt und nicht die Form in der Wirklichkeit sucht. „Der Seinsgehalt der Dinge, den sie [die Kunst] zu erfassen sucht, ist die Offenbarung des reinen Seins, des unbedingten Gehaltes in den Sonderformen der Dinge" (I: 250). Das reine Sein ist der unbedingte Gehalt; es offenbart sich in den Sonderformen der Dinge, die die Wissenschaft ergreift. Es ist für Tillichs Kunstverständnis kennzeichnend und eigenartig, daß er die Kunst genau so wie die Wissenschaft der theoretischen Vernunft zuweist. Das gilt übrigens nicht nur für das SdW, sondern überhaupt in den Werken Tillichs, auch noch in der ST. Kunst ist Theorie, ist theoretisches Verhältnis zur Wirklichkeit. Sie unterscheidet sich von der Wissenschaft jedoch, indem sie (die Kunst) nicht die Formen der Dinge ergreift, sondern den Seinsgehalt der Dinge zum Ausdruck bringt. Erkennt man ζ. B. ein natürliches Gebilde als „Landschaft", so ist der Begriff „Landschaft" eine Denkform, dadurch die Form und dabei der Inhalt (aber nicht direkt der Gehalt) des wirklich Seienden, das „Landschaft" genannt wird, ergriffen werden. Eine Landschaftsmalerei ist demgegenüber etwas anderes. Das gemalte Bild will nicht die Form ergreifen, die den Inhalt der Landschaft formt. Vielmehr will es den Wirklichkeitsgehalt der betreffenden Landschaft erfassen und zum Ausdruck, zur Anschauung, bringen. Metaphysik, als fundierende und nicht fundierte theoretische Funktion, ist auf Wissenschaft wie auch auf Kunst angewiesen. Sie ist wissenschaftlich, insofern sie sich der selben Begriffsformen bedient wie die Wissenschaft. Sie ist aber auch der Kunst ähnlich, da die Metaphysik die Wissenschaftsformen nicht als solche will, sondern sie verwendet, um den Seinsgehalt in seiner letzten Tiefe auszudrücken. Der Metaphysik und der Wissenschaft ist die Wissenschaftsform gemeinsam; der Metaphysik und der Kunst ist gemeinsam, den Seinsgehalt, die Realität oder den Sinn zum Ausdruck bringen zu wollen. („Das Sein ist der Gehalt, die Realität, der unbedingte Sinn, der jeder Einzelform Realität und Sinn gibt" [I: 227].) Merkwürdig ist bei alledem, daß es im systematischen Schema Tillichs nicht drei, sondern nur zwei Vernunftfunktionen gibt: Theorie und Praxis, und nicht etwa Theorie, Praxis und Poesie. Das Vernehmen ist also nicht theoretisch, praktisch und poietisch, sondern nur theoretisch und praktisch. Im praktischen Bereich steht als Parallele zur Metaphysik die Ethik, denn die Ethik ist Einheit von
105
Ontologie
Rechtsform und Gemeinschaftsgehalt genauso, wie die Metaphysik Wissenschaft und Kunst vereinigt. Ethik verwendet rechtliche Formen, um den Gemeinschaftsgehalt zum Ausdruck zu bringen. Eine poietische Parallele zur Metaphysik und Ethik kann es in diesem systematischen Schema natürlich nicht geben. Ein Nachteil dieses Schemas kommt zum Vorschein, wenn darauf aufmerksam gemacht wird, daß es keinen systematischen Formunterschied zwischen Wissenschaftsformen und Kunstformen geben kann, weil Wissenschaft und Kunst voneinander nur durch verschiedene Intentionen — im einen Fall die Intention auf die Form, im anderen die Intention auf den Gehalt — unterschieden sind. Aber auf diese Frage brauchen wir hier nicht weiter einzugehen.
„Die Gestalt der religiösen
Erkenntnis"
Im Prolog zur „Gestalt" liegen die Dinge anders. (Der Text wird hier zitiert nach John Clayton, „The Concept of Correlation" [Berlin: Walter de Gruyter, 1980], S. 269 ff.) Da ist schon das Sein der umfassende Begriff; Geschichte und Natur sind beide dem Sein untergeordnet. Ontologie als Seinsmetaphysik wird nicht mehr der Geschichtsmetaphysik gegenübergestellt und mit ihr koordiniert. Es gibt nicht mehr drei Grundfragen, sondern zwei: die Frage nach dem Sinn des Seins, mit der sich nunmehr die Ontologie beschäftigt, und die Frage nach dem Jenseits des Seins und des Sinnes, auf die die Theologie antwortet. Zwei Fragen und zwei Antworten, die ontologische und die theologische. Ontologische Theologie wird nun das genannt, was im SdW theonome Metaphysik war. Daran läßt sich im großen Ganzen der Übergangscharakter dieser Schrift erkennen. Ontologie ist von da ab vorwiegend im ontologischen und nicht im metaphysischen Sinne gedacht: sie antwortet nicht auf die Frage: „Was ist das Sein?", als wäre das Sein so etwas wie die Gattung oder Kategorie „Seiendes". Aber im Gegensatz zum systematischen Schema der „Systematischen Theologie" entwickelt Tillich im Prolog aus dem Jahre 1928 nicht nur die Seinsfrage und die theologische Antwort, sondern Seinsfrage und ontologische Antwort wie auch Jenseitsfrage und theologische Antwort. In beiden Fällen ist die Antwort nicht Sache der Wissenschaft, sondern des Zeugnisses. Darüber hinaus ist zu bemerken, daß „der religiös erkennende Mensch" für die Theologie eine methodische Stelle einnimmt, die der Stelle des
106
Robert P. Scharlemann
Daseins in Heideggers „Sein und Zeit" entspricht. Dasein ist Lichtung des Seins; religiöses Erkennen ist Offenbarung des Jenseits. Tillich geht dann weiter und fragt, immer noch in deutlicher Anspielung auf den methodischen Ansatz in Heideggers „Sein und Zeit", aber auch teilweise kontinuierlich mit dem SdW: „Wie kommt im Menschen der Sinn des Seins zur Anschauung seiner selbst? Und was bedeutet es für das menschliche Sein, daß in ihm sich der Sinn des Seins erfüllt? ... Werden [solche Fragen] beantwortet, so spricht in den Antworten das Sein sich selbst aus. Es reflektiert nicht über seine Form, sondern es zeugt von seinem Sinn. Ontologie ist Zeugnis ..., obgleich ihre Form wissenschaftlich ist" (271); sie ist ein „Sich-Aussprechen des Seins über seinen Sinn" (272). Aber dann macht Tillich noch einen Schritt weiter, den Heidegger erst später machte, als er, Heidegger, feststellen mußte, daß man durch eine Analyse und Deutung des Daseins höchstens zum Sinne des Seins des Daseins, aber niemals zum Sinne des Seins des Seins kommen kann. Die sehr umstrittene Kehre bei Heidegger, die Wendung zum poetischen Denken, zum dichterischen Wort, das die späteren Schriften Heideggers kennzeichnet, wird von Tillich in diesem Prolog vorweggenommen, indem er die Frage nach dem Sinn des Seins in Verbindung mit der Frage nach dem Jenseits von Sein und Sinn bringt. „Die Frage nach dem Sinn des Seins, die der Mensch an sein eigenes Sein stellt, treibt sinngemäß zu der Frage nach dem Jenseits von Sein und Sinn. Antwort auf diese Frage wäre die religiöse Erkenntnis; aber solche Antwort liegt nicht im menschlichen Sein, nicht im Sein überhaupt. Sie ist nicht Gegenstand eines ontologischen, sondern, wenn überhaupt, eines prophetischen Zeugnisses. Der Ontologie bleibt die Aufgabe, bis an diesen Punkt heranzuführen, wo möglicherweise prophetisches Zeugnis und damit religiöse Erkenntnis entspringt. Sie soll die Anschauung des vorgegenständlichen menschlichen Seins bis zu der Stelle treiben, an der das menschliche Sein über sich hinausweist, die ontologische Frage zur theologischen wird" (273 f.). In diesem erst in der „Gestalt der religiösen Erkenntnis" dargelegten Ontologiebegriff sind dann folgende Momente enthalten: Erstens: Der Sinn des Seins kommt im Menschen zur Anschauung seiner selbst. Das ist bei Tillich das Gegenstück zu Heidegger, wenn Heidegger vom Dasein als vom Da — der Zeitigung und Erörterung — des Seins spricht, das sich im Seinsverständnis zu verstehen gibt — das
Ontologie
107
Sein des Menschen ist Dasein, das Da des Seins, dadurch das Sein in dem Seienden, das der Mensch ist, anwest. Zweitens: Es bedeutet etwas für das menschliche Sein, daß in ihm der Sinn des Seins zur Anschauung kommt. Frage ist nur, was diese Bedeutung ist. Beide Fragen — die nach dem Sinn des Seins und die nach der Bedeutung des menschlichen Seins — sind beantwortbar. Wenn sie aber beantwortet werden, so ist derjenige, der die Antwort gibt, nicht nur der Mensch, sondern das Sein selbst. Das Sein selbst gibt Antwort, indem es sich in den konkreten Antworten ausspricht. Das Sein des Menschen ist, Zeugnis des Seins zu sein. Drittens: Es gibt so eine Frage nach dem Sinn des Seins. Das ist die ontologische Frage. Es gibt aber auch eine Frage nach dem Jenseits des Seins. Das ist die theologische. Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Seins kann nur das Sein selbst geben, indem es im Menschen zur Anschauung seiner selbst kommt. Antwort auf das Jenseits des Seins kann nur durch prophetisches Zeugnis gegeben werden, an dem religiöse Erkenntnis entspringt. Antwortgebend sind also jeweils das Sein, das sich durch das Zeugnis der Ontologie ausspricht, und das Jenseits des Seins, das sich durch prophetisches Zeugnis zu erkennen gibt. Das Sein des Menschen ist das Zeugnis, in dem das Sein sich selbst ausspricht; das religiöse Erkennen des Menschen ist das prophetische Zeugnis, in dem sich das Jenseits des Seins offenbart. Im Begriff des religiös erkennenden Menschen hat Tillich so eine methodische Parallele zu Heideggers Dasein: Daseinsverständnis ist Zeugnis vom Sinn des Seins, in dem das Sein selbst sich ausspricht. Religiöse Erkenntnis ist darüber hinaus Zeugnis des Jenseits von Sein und Sinn. Das Zeugnis, das das alltägliche und eigentliche Seinsverständnis ist, wird zum prophetischen Zeugnis, das die religiöse Erkenntnis ist. Zeugnis ist anders als Wissenschaft; prophetisches ist anders als ontologisches Zeugnis. Das Sein selbst ist nicht das Jenseits des Seins — ist also nicht das, was religiös „Gott" genannt wird. Aber beide — Sein und Jenseits — sind Fragen wie auch Antworten.
HANNELORE JAHR
Der Begriff der „Gestalt" als Schlüssel zur Metaphysik im Frühwerk Paul Tillichs Das Verhältnis von Gott und Welt steht im Mittelpunkt von Tillichs theologischem Arbeiten. Dabei geht es Tillich von Anfang an darum, das Gottsein Gottes und das Weltsein der Welt zusammenzudenken, ohne das eine in das andere aufzulösen. Ein solches Vorhaben kann nur in einer Theologie der Vermittlung verwirklicht werden, denn der Vermittlungsgedanke ermöglicht es, im Raum der vorfindlichen, bedingten Wirklichkeit so vom Unbedingten zu sprechen, daß dessen Unbedingtheit (traditionell gesprochen: die Aseität Gottes) gewahrt bleibt. 1. „Gestalt" als begriffliches Instrument der Beschreibung des Vermittlungsgeschehens von Gott und Welt In seinen Frühschriften, die vor der Emigration Tillichs im Jahr 1933 entstanden sind, greift er für die Durchführung seines Programms der Vermittlung von Gott und Welt auf einen Begriff zurück, der zuvor vorwiegend in der Kunst- und Naturtheorie vor allem der Klassik und des Idealismus sowie in der Psychologie beheimatet war: den Begriff der Gestalt, der von Tillich jedoch auf ganz eigene Weise verstanden wurde. 1.1. Gestalt als Synthese von Form und Gehalt Für Tillich stellt alles Seiende eine „individuell schöpferische Synthese" von Form und Gehalt dar.1 Dabei bezeichnet die Form die 1
Vgl. Grundlinien des religiösen Sozialismus. Ein systematischer Entwurf. In: Blätter für religiösen Sozialismus 4, 1923, S. 1 - 2 4 ; zit. n. G W II, S. 9 1 - 1 1 9 ; h. S. 95.
„Gestalt" als Schlüssel zur Metaphysik im Frühwerk Paul Tillichs
109
„rationale" Seite. Sie macht das Seiende zu dem, was es ist, verleiht ihm seine je unverwechselbare, es von anderem Seienden unterscheidende Eigenart, kurz: sie ist das principium individuationis des Seienden. Der Gehalt stellt im Gegensatz dazu die „irrationale" Seite des Seienden dar. Während die Form begrenzt, ist er „unendlich". Er verleiht der festen Form Lebendigkeit, ist also das principium vitae des Seienden.2 Die beiden Seiten, Form und Gehalt, stehen immer in einer spannungsreichen Polarität. Darum ist kein Seiendes jemals fertig im Sinn einer abgeschlossenen, in sich ruhenden Gegebenheit. Indem das Seiende als Synthese von Form und Gehalt ist, ist es immer auch im Werden, hat es eine Geschichte.3 Diese dynamische, spannungsreiche Synthese von Form und Gehalt nennt Tillich Gestalt.'' Weder die Form noch der Gehalt kann für sich erscheinen. Da beide in den Gestalten der vorfindlichen Wirklichkeit stets vereinigt sind, kann Tillich ihr Verhältnis auch als „eine Linie" beschreiben, „deren eines Ende die reine Form, deren anderes der reine Gehalt bedeutet." Aber „auf der Linie", sprich: in jeder Gestalt, „sind beide immer in Einheit".5 1.2. Die logischen Äquivalente: Denken und Sein Dieser ontologischen Struktur stellt Tillich eine Analyse der Strukturen des Erkennens zur Seite: Der Form entspricht das Denken, dem Gehalt das Sein.6 Sein (also das Gehaltäquivalent) an sich ist „das Bestimmungslose"; damit überhaupt ein von anderen unterschiedenes Einzelseiendes erkannt werden kann, muß es „mit Denkbestimmungen" (also dem Formäquivalent) versehen werden. Dabei verleiht jedoch
2
3
4 5
6
Vgl. Das System der Wissenschaften nach Gegenständen und Methoden. Ein Entwurf. Göttingen 1923; zit. n. G W I, S. 1 1 1 - 2 9 3 ; h. S. 123. Vgl. Antwort. In: Blätter für religiösen Sozialismus 5, 1924, S. 1 8 - 2 2 ; h. S. 19 (Erwiderung auf den Artikel von C. Mennicke: Zu Tillichs Systematik. In: ebd., S. 17 f.). Vgl. Das System der Wissenschaften, S. 125. Vgl. Über die Idee einer Theologie der Kultur. In: Religionsphilosophie der Kultur. Zwei Entwürfe von Gustav Radbruch und Paul Tillich. Berlin 1919 (Philosophische Vorträge der Kant-Gesellschaft Nr. 24), S. 29 - 52; zit. n. G W IX, S. 1 3 - 3 1 ; h. S. 19. Vgl. Das System der Wissenschaften, S. 123.
110
Hannelore Jahr
das Sein „allen Denkbestimmungen seine individuelle Färbung, seinen eigentümlichen, jeder Bestimmung widerstrebenden ... Charakter". 7 Die Synthese beider ist der Geist, den Tillich daher auch als die „Form des seienden Denkens" definieren kann. Die Gestalt, in der der Geist realisiert ist, nennt Tillich „geisttragende Gestalt". Während in allem übrigen Seienden das Denken nur „als bedingte, begrenzte, unmittelbare Form" verwirklicht ist, reißt es sich in der geisttragenden Gestalt von dieser Bedingtheit und Unmittelbarkeit los und wird sich selbst zur „unbedingten Forderung". 8 So ist die geisttragende Gestalt ausgezeichnet sowohl durch das Bewußtsein ihrer selbst als auch durch die Fähigkeit, sich selbst als geisttragende Gestalt zu bestimmen und den Geist als ihr Telos in sich zu verwirklichen. 1.3. Das Verhältnis von Ontotogie und Erkenntnistheorie:
Sinnerfüllung
Die Entsprechung zwischen Ontologie und Erkenntnistheorie und die Beschreibung der geisttragenden oder besser: geistverwirklichenden Gestalt als Telos beider weist auf einen inneren Zusammenhang hin, der über eine bloße Parallelität hinausgeht. Tillich bestimmt diesen Zusammenhang als ein Verhältnis der Sinnerfüllung. Das heißt: durch das Erkennen wird die Wirklichkeit des Seienden in die Sphäre des Sinnes erhoben. Das bedeutet nicht, daß „eine an sich sinnlose Wirklichkeit" durch irgendwelche geistigen Manipulationen künstlich als sinnvoll hingestellt wird oder daß die geisttragenden Gestalten der vorgeistigen Wirklichkeit einen ihr fremden Sinn aufoktroyieren. Vielmehr verhält es sich so, daß der dem Seienden ... innewohnende Sinn ... in den geistigen Akten zu sich selbst [kommt], der Sinn der Wirklichkeit verwirklicht sich im Geistigen. 9
Von hier aus erweisen sich die ontologischen bzw. logischen Elemente Form/Gehalt bzw. Denken/Sein nunmehr als Sinnelemente. Wo immer sie sich in der Weise des Bewußtseins um sich selbst in ihrer Zusammengehörigkeit, also geistig, auf die Wirklichkeit des Seienden richten (sei es auf ihre eigene oder die von anderem Seienden) konstituieren sie die 7 8 9
Vgl. ebd., S. 135 f. Vgl. ebd., S. 2 1 0 f. Ebd., S. 222.
„Gestalt" als Schlüssel zur Metaphysik im Frühwerk Paul Tillichs
111
Sinnhaftigkeit des Seins. Ihre Doppelheit ist daher „kein Sinnprinzip, sondern das Prinzip des Sinnes selbst." 10 Über den Begriff des Sinnes kommt der Geist nicht mehr hinaus. Es ist unmöglich, ihn „auf einen höheren Begriff zurückzuführen, da jeder höhere Begriff selbst wieder eine Setzung des Sinnes wäre". 11 Den Sinn des Seins verstehen, heißt daher: die „innere Dynamik im Aufbau der Sinnwirklichkeit", das Zusammenspiel von Form und Gehalt zur lebendigen, auf die Verwirklichung von Geist gerichteten Gestalt zu schauen. 12 2. Metaphysik als Beschreibung des alle Sinnerfüllungen fundierenden
Sinns
Damit ist bereits in den Blick gekommen, was Tillich unter „Metaphysik" versteht; denn Metaphysik treiben heißt für ihn zunächst ganz einfach: „vom Sinn her das Unbedingte erfassen wollen". Das bedeutet nicht, wie es das gängige Mißverständnis will, das Unbedingte als ein „Seiendes, ein Objekt neben anderen" oder gar als „mystische Geistsubstanz" im „Hintergrund der Geschichte" zu konstruieren. 13 Beides ist unsinnig, denn was auf diese Weise erfaßt werden könnte, wäre wiederum nur ein Bedingtes. Da der Geist über den Sinn grundsätzlich nicht hinauskommt, kann das Unbedingte kein Etwas neben oder hinter den Sinnelementen sein; es ist vielmehr der „alle Sinnerfüllungen fundierende Sinn". 14 Nun umgreift der Gestaltbegriff jedoch das Zusammenspiel der Sinnelemente in dreifacher Weise: nämlich insofern er das Sein, die Geschichte und die Zusammengehörigkeit beider ausdrückt. Dementsprechend muß nun auch die Metaphysik drei Elemente umfassen. Sie entfaltet sich als Seinsmetaphysik, Geschichtsmetaphysik und Metaphysik der absoluten Idee. — Als Seinsmetaphysik zeigt sie das Zusammenspiel alles Seienden zu einer „universalen Gestalt", die ein „Symbol für den unbedingten Sinn ist." 10 11
12 13 14
Vgl. ebd., S. 234. Vgl. Religionsphilosophie. Berlin 1925 ( = Lehrbuch der Philosophie. Hrsg. v. Max Dessoir. Bd. 2 Die Philosophie in ihren Einzelgebieten.); zit. n. G W I, S. 297 - 364; h. S. 318. Vgl. ebd., S. 313; Herv. v. Autor. Vgl. Das System der Wissenschaften, S. 255. Ebd., S. 253.
112
Hannelore J a h r
— Als Geschichtsmetaphysik beschreibt sie die „Offenbarung des unbedingten Sinnes in einer Deutung des Sinnprozeßes (sie!) der Geschichte". — Beide schließen sich zusammen zur Metaphysik der absoluten Idee, denn „erst die Einheit von beiden schafft das letzte und höchste Symbol für das Unbedingte, die ideale Einheit der Sinnelemente, die zugleich Ziel und Grund alles Seins und alles Werdens ist." 15 Aufgrund dieses Zusammenschlusses ist es möglich, das zentrale Symbol der Seinsmetaphysik, die universale Gestalt, zugleich als Symbol für die „ideale Einheit der Sinnelemente" im Sinne des „Ziels und Grundes alles Seins und Werdens" zu gebrauchen und Tillichs gesamte Metaphysik als Gestaltmetaphysik zu charakterisieren.16 3. Die Metaphysik der absoluten Idee In der „Metaphysik der absoluten Idee" entfaltet Tillich mit den Elementen von Form/Gehalt und Gestalt sein Verständnis des Gottseins Gottes, des Weltseins der Welt und ihrer unauflöslichen Zusammengehörigkeit. Er greift dazu auf ein Modell zurück, das er in seinen beiden Dissertationen anhand der „positiven Philosophie" Schellings entwickelt hat. 3.1. Das Vorbild Schellings Grundlegend für Tillich ist das trinitarische Verständnis des Gottseins Gottes bei Schelling: als Einheit eines subjektiven Prinzips, der Selbstheit, und eines objektiven Prinzips, der Liebe, in einem beide zusammenschließenden dritten Prinzip: dem Geist.17 Der Gegensatz der beiden 15 16
17
Vgl. ebd., S. 255 f. Von den drei Ausfaltungen der Metaphysik sollen im Folgenden nur zwei genauer dargestellt werden: die Metaphysik der absoluten Idee und die Geschichtsmetaphysik. Dies rechtfertigt sich daraus, daß diese beiden Bereiche für Tillich selbst die wichtigsten sind. Vgl. Die religionsgeschichtliche Konstruktion in Schellings positiver Philosophie, ihre Voraussetzungen und Prinzipien. Phil. Diss. Brelau 1 9 1 0 , S. 1 6 — 1 9 ; Mystik und Schuldbewußtsein in Schellings philosophischer Entwicklung. Lie. Diss. Gütersloh 1 9 1 2 (Beiträge zur Förderung christlicher Theologie 16, Nr. 1); zit. n. G W I, S. 1 3 - 1 0 8 ; h. S. 7 9 - 8 3 .
„Gestalt" als Schlüssel zur Metaphysik im Frühwerk Paul Tillichs
113
Elemente, die im Geist zusammengefaßt sind, ist der von Wesen und Widerspruch. Dabei ist das erste, das subjektive oder selbstische Prinzip (so genannt, weil durch seine Erhebung „die Einheit in der Identität zerstört und jedes Ding zu einer Selbstheit wird") 18 der Widerspruch, das zweite, objektive oder das „Prinzip der Liebe" das Wesen, „durch das Gott [zugleich] das Wesen aller Wesen ist." 19 Die Einheit von Wesen und Widerspruch, der Geist, ist gleichbedeutend mit der Freiheit Gottes, denn Freiheit ist nichts anderes als „die Macht, mit sich selbst uneins zu werden". 20 Das bedeutet auch, daß Gottes Gottsein „nicht nur ein ewiges Sein, sondern ein ewiges Werden" 21 ist, denn Wesen und Widerspruch haben ihren Charakter nicht anders, als indem sie ihn realisieren, d. h. der Widerspruch in Gegensatz zum Wesen tritt und dieses sich wiederum im Gegensatz zum Widerspruch wiederherstellt. In diesem Prozeß liegt nun zugleich der Grund für eine Wirklichkeit im Gegenüber zu Gott. In der für Tillichs Theologie entscheidenden Spätphilosophie Schellings ist dies nach Tillichs Verständnis so gedacht, daß das erste Prinzip, die Subjektivität, in sich noch einmal die drei Elemente von Subjektivität, Objektivität und Geist enthält. Der Unterschied zu der übergeordneten Trinität Gottes besteht darin, daß dort die drei Elemente im Geist untrennbar zusammengehören, während sie innerhalb des subjektiven Prinzips in ihre Dreiheit auseinanderfallen. 22 Schelling bezeichnet das die drei Elemente in ihrer Differenz enthaltende Prinzip der Subjektivität mit einem Begriff aus der Theosophie Jakob Böhmes auch als die „Natur in Gott". 23 Aus dieser entsteht die von Gott unterschiedene Wirklichkeit, indem sich das in ihr enthaltene Element der Subjektivität im Gegensatz zu den beiden anderen Elementen auf sich selbst stellt. Die Wirklichkeit, die dadurch zustande kommt, ist die des Chaos. Es entspricht nun jedoch der wesenhaften Zusammengehörigkeit der drei Elemente in der übergeordneten Einheit des Geistes Gottes, daß sie auch innerhalb der
18 19 20 21 22 23
Die religionsgeschichtliche Konstruktion, S. 16*. Vgl. Mystik und Schuldbewußtsein, S. 81. Vgl. Die religionsgeschichtliche Konstruktion, S. 12. Vgl. Mystik und Schuldbewußtsein, S. 79 f. Vgl. Die religionsgeschichtliche Konstruktion, S. 25 f. Vgl. ebd., S. 22.
114
Hannelore Jahr
„Natur in Gott" wieder zu ihrer wesenhaften Einheit drängen. Dies wird dadurch erreicht, daß sich das zweite, rationale Element gegen die Selbsterhebung des ersten durchsetzt und aus dem Chaos die Welt der bedingten Formen schafft. 24 In einem langen Prozeß der Formentstehung kommt schließlich die Zusammengehörigkeit beider zum Bewußtsein ihrer selbst: Es entsteht — bedingter — Geist; er ist verwirklicht im Menschen. 25 Dies ist nicht ohne Bedeutung für das Gottsein Gottes. Es war bereits die Rede davon, daß das Verständnis des Gottseins Gottes als Einheit von Wesen und Widerspruch ein „Werden" Gottes einschließt. Dieses „Werden" ist nun aus der Entstehung des bedingten Geistes im Gegenüber zu Gott als absolutem Geist als Geschichte des Liebe-Werdens des absoluten Geistes zu beschreiben. Es zeigt sich nun, daß der Geist „noch nicht das Höchste" war: „Er ist nur der Geist, oder der Hauch der Liebe. Die Liebe aber ist das Höchste." Daß aus der Gleich-Gültigkeit der Elemente Liebe werde, daß also das zweite den Charakter ihrer Einheit bestimmt, „ist der ewige Sinn des Weltprozesses". 26 Die so beschriebene „Wirklichkeit" ist für Schelling noch nicht außergöttlich. Sie ist reine Ideenwelt mit dem Menschen als „Centraiidee", das heißt: im Menschen kommt alles Seiende zu seinem Telos; er ist daher zugleich mit allem anderen Seienden in unauflöslicher Einheit verbunden. 27 Da die Elemente im Menschen der Idee aber nur in bedingter Einheit stehen, erhebt sich hier wiederum das selbstische Prinzip. Als einzelner, losgerissen von allem anderen Seienden, mit dem er doch als „Centraiidee" wesentlich zusammengehört, will der Mensch Selbstsein und Liebesein in sich vereinigen und verfällt so dem irrationalen Prinzip des Selbstseins. Für Schelling ist dies das Faktum des Falls; und durch ihn entsteht („aus" Gott!) die außergöttliche Wirklichkeit. 28 Wiederum ist es das Prinzip der Liebe, das sich um die Rückholung des gefallenen Seins in die Einheit des göttlichen Lebens bemüht. Es wirkt zunächst so, wie es als bedingtes Element in der „Natur in Gott" enthalten ist, und am Ende eines langen „religionsgeschichtlichen" Prozesses weckt es im Menschen das Bewußtsein seines Gefallenseins, 24 25 26 27 28
Vgl. Vgl. Vgl. Vgl. Vgl.
ebd., S. 37. ebd., S. 43. Mystik und Schuldbewußtsein, S. 98. Die religionsgeschichtliche Konstruktion, S. 45. ebd., S. 4 6 - 4 9 .
„Gestalt" als Schlüssel zur Metaphysik im Frühwerk Paul Tillichs
115
ohne daran jedoch etwas ändern zu können. 29 Erst wenn sich das — übergeordnete — Prinzip der Liebe aus der Einheit des göttlichen Lebens in die gefallene Wirklichkeit begibt und sich dort dem Prinzip der Subjektivität unterwirft, ist eine qualitative Veränderung möglich. Dies geschieht in Jesus Christus, der das Prinzip der Subjektivität am Kreuz opfert und so die Einheit mit der Liebe wiederherstellt, nun aber nicht mehr wie zuvor als Identität, sondern als vollkommene persönliche Gemeinschaft. 30 War Gottes Gottsein im Gegenüber zur Ideenwelt als Liebe zu beschreiben, so läßt es sich jetzt in der von ihm selbst geschenkten Gemeinschaft mit der außergöttlichen Welt als verwirklichte Liebe charakterisieren; und es ist die Dignität der Welt, daß sie an dieser Verwirklichung beteiligt sein darf. 3.2. Die Ausgestaltung
des Schellingschen
Entwurfs bei Tillich
Es ist nun nicht schwer, die Elemente der Schellingschen Konstruktion in Tillichs gestaltmetaphysischem Entwurf wiederzufinden: Tillichs ontologisches Element des Gehalts entspricht Schellings Prinzip der Subjektivität, Tillichs Element der Form Schellings Prinzip der Objektivität. Wo Schelling das Gottsein Gottes trinitarisch als Einheit von subjektivem und objektivem Prinzip im Geist versteht, steht bei Tillich das Verständnis des Gottseins Gottes als Einheit von unbedingtem Gehalt und unbedingter Form im unbedingten Geist. Und wie Tillich in seinen Dissertationen herausgearbeitet hat, daß das Weltsein der Welt auf der Selbsterhebung des subjektiven Prinzips innerhalb der „Natur in Gott" beruht, so ist es in Tillichs Frühschriften das Element des Gehaltes, das — in eigentümlicher Janusköpfigkeit — einerseits die Lebendigkeit und Seinsfülle alles Seienden ausmacht, das andererseits aber zugleich auch das Prinzip des Falls ist: indem nämlich die Sünde auf dem Willen beruht, „die eigene Selbstheit zu füllen mit der Seinsfülle überhaupt", so daß sie sich mit anderem Sein nur so vereinigen kann, daß sie dessen Selbstheit negiert. 31 Es gibt in Tillichs kurz nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen Schriften nun jedoch auch einen deutlichen Unterschied gegenüber dem 29 30 31
Vgl. ebd., S. 7 6 - 7 8 . Vgl. ebd., S. 8 3 - 8 5 ; 88 f. Vgl. Dogmatik. Marburger Vorlesung von 1925. Hrsg. v. Werner Schüßler, Düsseldorf 1986, S. 175 f.
116
Hannelore Jahr
Entwurf aus seinen Schelling-Dissertationen: Während er nämlich dort die Versöhnung der selbstischen Welt an das zweite Prinzip, das Element der Form bzw. der Liebe, gebunden hatte, bindet er es wohl unter dem erschütternden Eindruck der Kriegserfahrung in seinen in den frühen 20er Jahren entstandenen Schriften im Gegensatz dazu an das Element des unbedingten Gehaltes. Dieser vermittelt sich so in die Wirklichkeit der bedingten Formen, daß er diese — selbstischen — Formen zerbricht und so das Entstehen neuer „schöpferischer Synthesen von Form und Gehalt" ermöglicht. Diese sind nicht weniger als der Vorschein der eschatologischen Gottesherrschaft, in der der unbedingte Gehalt in der unbedingten Form verwirklicht sein wird — „gemäß dem Wort, daß ,Gott ist Alles in Allem'." 32 4. Die Geschichtsmetaphysik
(Theologie der
Kultur)
Mit dem Problem der Vermittlung zwischen Gott und Welt, dem Unbedingten und dem Bedingten, ist jedoch bereits der Bereich der „Metaphysik der absoluten Idee" verlassen und der der Geschichtsmetaphysik angesprochen. Hier geht es darum zu zeigen, wie das Ringen um sinnhafte Gestalt im Bereich des Bedingten als Vermittlungsgeschehen zwischen dem Unbedingten und dem Bedingten begriffen werden kann. Da Tillich diese Vermittlung in den Schriften bis etwa 1926 an das Element des unbedingten Gehaltes bindet, kann er da, wo es um die Vermittlung des Unbedingten und des Bedingten geht, in einer gegenüber dem gestaltmetaphysischen Ansatz verkürzten Redeweise das Unbedingte mit dem Element des unbedingten Gehaltes, das Bedingte mit dem der bedingten Form gleichsetzen. So kann Tillich etwa „das Suchen nach Gott" als „Suchen nach dem unbedingten Gehalt" beschreiben, „von dem alle Form zehrt". 33 4.1. Die Kategorien der
Geschichtsmetaphysik
4.1.1. Religion und Kultur Um das Vermittlungsgeschehen selbst genauer beschreiben zu können, unterscheidet Tillich analytisch zwischen der Möglichkeit, daß der 32 33
Vgl. Grundlinien des religiösen Sozialismus, S. 94. Vgl. Religiöse Krisis. In: Vivos v o c o 2, 1922, S. 6 1 6 - 6 2 1 ; zit. n. G W XIII, S. 8 6 - 9 1 ; h. S. 8 8 f .
„Gestalt" als Schlüssel zur Metaphysik im Frühwerk Paul Tillichs
117
menschliche Geist sich dem Unbedingten oder dem Bedingten zuwenden kann. Ersteres nennt er die religiöse Ausrichtung des Geistes, kurz: Religion, letzteres die kulturelle Ausrichtung des Geistes, kurz: Kultur. Dabei ermöglicht ihm die Bindung der Vermittlung zwischen dem Unbedingten und dem Bedingten an das Element des unbedingten Gehaltes, die Religion auch als Richtung des Geistes auf den Gehalt, die Kultur als Richtung auf die bedingten Formen zu beschreiben. Die Trennung zwischen ihnen ist jedoch eine künstliche, eben eine analytische. Weil Form und Gehalt nur in der konkreten Gestalt wirklich sind, gibt es keine Formerfassung (also Kultur), ohne daß zugleich der Gehalt erfaßt wird (also ohne Religion). Umgekehrt ist es nicht möglich, den unbedingten Gehalt (also die Religion) anders zu fassen, als indem er sich in der bedingten Form (also der Kultur) zur Geltung bringt. Kurz: „Im kulturellen Akt ist das Religiöse ... substantiell; im religiösen Akt das Kulturelle formell,"34 Die Religion ist demnach nicht eine Funktion des Geistes neben der Kultur, sondern sie ist „die Wurzelfunktion, diejenige, in der der Geist durch alle seine Formen hindurchbricht bis auf seinen Grund", 35 d. h. bis auf den unbedingten Gehalt, der die Seinsfülle alles Seienden ausmacht. 4.1.2.
Autonomie Religion
und Theonomie als Richtungen innerhalb von Kultur und
Die Zusammengehörigkeit von Form und Gehalt bringt sich nun auch darin zur Geltung, daß innerhalb der Kultur und innerhalb der Religion jeweils durch den Einfluß des anderen Elements eine Doppelheit von Funktionen entsteht, von denen wiederum die eine auf die Form, die andere auf den Gehalt gerichtet ist. Die auf die Form gerichtete Funktion nennt Tillich Autonomie, die auf den Gehalt gerichtete Theonomie. Gerade weil Autonomie und Theonomie Richtungen jeweils innerhalb derselben Funktion des Geistes (also jeweils innerhalb von Kultur bzw. Religion) sind, zeigt sich hier in aller Deutlichkeit das Aufeinander34 35
Vgl. Religionsphilosophie, S. 320; Herv. v. Autor. Vgl. Die Überwindung des Religionsbegriffs in der Religionsphilosophie. In: Kant-Studien 27, 1922, S. 446 —469 (Vortrag in der Berliner Abteilung der KantGesellschaft, 2 5 . 1 . 1 9 2 2 ) ; zit. n. G W I, S. 3 6 7 - 3 8 8 ; h. S. 380.
118
Hannelore J a h r
Angewiesensein beider. Nur wenn sie vereinigt sind, ist Sinnerfüllung möglich: „Autonomie für sich treibt zur leeren, gehaltlosen Form, Theonomie für sich zum formlosen Gehalt". 36 Faktisch zeichnet sich bei Tillich jedoch eine Tendenz ab, die Theonomie mit der Religion, die Autonomie mit der Kultur zu identifizieren. 37 Daß das so ist, hängt damit zusammen, daß die Wirklichkeit als gefallene zu qualifizieren ist. Religion unter den Bedingungen der Existenz (wie Tillich später formuliert) ist gefallene Religion. Prinzip des Falls aber ist das Sich-auf-sich-selbst-Stellen der bedingten Formen. Auf die Religion angewandt, heißt das, daß sie „Formen heiligt und aufrecht erhält, die dem Bewußtsein der Gültigkeit widersprechen". 38 Tillich nennt dieses Phänomen mit einem Begriff, der wie der der Autonomie von Kant entlehnt ist, Heteronomie. Zwar ist das Festhalten an Formen, die einmal adäquater Ausdruck des unbedingten Gehaltes gewesen sind, die Manifestation einer Religion, die „Gott verloren hat"; 39 aber weil sie sich auf das Unbedingte zu berufen vermag, bedeutet dies zugleich eine Vergewaltigung und Unterdrückung der autonomen Geistesentfaltung. Als Reaktion darauf entsteht die „Autonomie für sich", die energische Befreiung des bedingten Geistes von jeder heteronomen Bevormundung. Dieser Sieg ist jedoch teuer erkauft; denn es ist der Sieg der „reinen rationalen Form", die selbst keine lebendige Wirklichkeit zu schaffen vermag 40 und daher immer in der Gefahr steht, nunmehr in ganz neuer Weise der Irrationalität zu verfallen. So wie sich aus dem Umschlagen der Theonomie in die Heteronomie die Entstehung einer von der Religion getrennten autonomen Kultur legitimiert, liegt umgekehrt in der Sinnentleerung der rein autonomen Kultur die Legitimation für das Entstehen eines von der Kultur getrennten Sonderbereichs des Religiösen. Im Unterschied zur Heteronomie bezeichnet Tillich ihn als „Reservatum religiosum", das natürlich seinerseits ein kulturelles Element (das „Obligatum religiosum") enthält. 41 Die Trennung von Kultur und Religion ist jedoch nur solange zu rechtfertigen, wie in beiden Bereichen um deren Aufhebung gekämpft 36 37 38 39 40 41
Vgl. Das System der Wissenschaften, S. 271 f. Vgl. ebd., S. 278. Ebd., S. 272. Vgl. Die Überwindung des Religionsbegriffs, S. 386. Vgl. A n t w o r t , S. 20. Vgl. Grundlinien des religiösen Sozialismus, S. 96.
„Gestalt" als Schlüssel zur Metaphysik im Frühwerk Paul Tillichs
119
wird. Das Medium dieses Kampfes ist das in Religion und Kultur immer auch vorhandene autonome bzw. theonome Element. Ihr Kampf um die wesenhafte Einheit von Kultur und Religion gegen ihre wesenswidrige Trennung ist „der dialektische Stachel der Geschichte", der sich in jedem Augenblick der Geistesgeschichte wie in ihrem historischen Ablauf zur Geltung bringt und sie „nie zur Ruhe kommen läßt." 42 4.1.3. Theonomie und die Überwindung des
Dämonischen
Das Ziel dieses Kampfes, also die wesenhafte Einheit von Kultur und Religion, bezeichnet Tillich nun ebenfalls mit dem Begriff der Theonomie; man könnte um der begrifflichen Klarheit willen hier von Theonomie im übergeordneten oder umfassenden Sinn des Wortes sprechen. Denn während die Theonomie im untergeordneten Wortsinn nur die Richtung des Geistes auf den unbedingten Gehalt bezeichnet, meint Theonomie im übergeordneten Sinn „die Erfülltheit aller Kulturformen mit dem Gehalt des Unbedingten". 43 Synonym damit kann Tillich an einer Stelle auch von der „Religion über der Religion" bzw. der „Kultur über der Kultur" sprechen. 44 Theonomie in diesem Sinn des Wortes ist das „Abbild" der eschatologischen Wirklichkeit, der Synthese von unbedingtem Gehalt und unbedingter Form, in der Gott „alles in allem" ist. Das aber heißt: die Theonomie auch in diesem tieferen Sinn bleibt geschichtliche Gestalt; sie ist nicht das Reich Gottes, „sondern Hinweis darauf, wenn auch als solcher Sinn und Ziel der Geistesgeschichte." 45 Das Entstehen dieser übergeordneten Theonomie ist für Tillich gleichbedeutend mit der Uberwindung des Dämonischen. Mit dem Begriff des Dämonischen kommt die bereits angedeutete grundsätzliche Zweideutigkeit innerhalb des ontologischen Gehaltelementes zum Tragen, die in der Kontinuität des Gehaltbegriffs zu dem „selbstischen Prinzip" bei Schelling begründet ist. Denn von hier aus ist der unbe42 43 44
45
Vgl. Das System der Wissenschaften, S. 272. Vgl. Religionsphilosophie, S. 330. Vgl. Kirche und Kultur. Tübingen 1924 (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte 111) — Vortrag vor dem Tübinger Jugendring im Juli 1924); zit. n. G W IX, S. 32—46; h. S. 37. Vgl. ebd., S. 42.
120
Hannelore J a h r
dingte Gehalt einerseits das lebenspendende Prinzip, andererseits aber auch dasjenige, das, wenn es losgelöst von seiner Einheit mit der unbedingten Form erscheint, also „geistlos" ist, das Leben vernichtet. Tillich spricht von der ersten Weise, in der Gehalt realisiert sein kann, also vom Gehalt, der „gehorsam ist der unbedingten Form" als von dem „Gehalt von oben", von der zweiten Weise, also dem Gehalt, der „in Widerspruch steht zur unbedingten Form", als von dem „Gehalt von unten". 46 Der erste ist göttliche, der zweite dämonische Wirklichkeit. Der „Gehalt von unten" setzt sich da durch, wo das Seiende die Seinsfülle des unbedingten Gehaltes als etwas für sich haben will, wo es die Unendlichkeit des Seins in sich als einzelnem zu verwirklichen sucht. Wo immer das geschieht — und es ist die Voraussetzung der vorfindlichen Existenz, daß das geschieht — verkehrt sich das lebenspendende Element ins Zerstörerische. Das Dämonische hat daher nach Tillich den Charakter des göttlichen Gerichts. Anders gesagt: weil der unbedingte Gehalt, der sich im Dämonischen Bahn bricht, ein Element des göttlichen Lebens ist, hat das Dämonische „alle Ausdrucksformen des Heiligen, aber es hat sie mit dem Vorzeichen des Widerspruchs gegen die unbedingte Form, und es hat sie in der Intention der Zerstörung." 47 Es ist für das Verständnis des Begriffs des Dämonischen überaus wichtig zu sehen, daß der Widerspruch gegen die unbedingte Form nicht den Verlust des Formelementes überhaupt bedeutet. Vielmehr ist die Erhebung des Dämonischen ja unlöslich verbunden mit dem Sichselbst-Setzen der bedingten Einzelform gegen die unbedingte Form. Tillich bezeichnet das Dämonische deshalb auch als „formschaffende Formwidrigkeit" oder als „Einheit von formschöpferischer und formzerbrechender Kraft". 48 Ohne das formschöpferische Element könnte das Dämonische nicht sein-, aber es benutzt das formschöpferische Element zur Formzerstörung. Im Zusammenhang mit der Kategorie des Dämonischen wird nun auch deutlich, warum die Theonomie niemals mit dem Reich Gottes identisch sein kann. Theonomie ist die Synthese von unbedingtem
46 47 48
Vgl. A n t w o r t , S. 21. Religionsphilosophie, S. 338. Vgl. Das Dämonische. Ein Beitrag zur Sinndeutung der Geschichte. Tübingen 1926 (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte 119); zit. n. G W VI, S. 4 2 - 7 1 ; h. S. 4 4 f.
„Gestalt" als Schlüssel zur Metaphysik im Frühwerk Paul Tillichs
121
Gehalt und bedingter Form in einer bestimmten Geschichtslage;49 aber in jeder bedingten Form, also auch in jeder Theonomie, ist immer auch ein Moment des Sich-Setzens gegen die unbedingte Form enthalten, etwas von dem Versuch, den unbedingten Gehalt als Einzelform zu fassen, was dessen dämonisches Wirken freisetzt. Daher kann keine konkrete Synthese von unbedingtem Gehalt und bedingter Form für sich in Anspruch nehmen, die Macht des Dämonischen bereits besiegt zu haben; täte sie es doch, würde sie sich der schlimmsten Heteronomie schuldig machen und erst recht dem Dämonischen verfallen. Daher erhebt sich in jeder Situation der Theonomie stets von neuem der Protest der autonomen Geistverwirklichung und provoziert so den Kampf um eine neue Gestalt der Theonomie, die auf ihre Weise wiederum Überwindung des Dämonischen ist. Dieser Prozeß ist nun auch für das Gottsein Gottes nicht irrelevant, zu dem das Element des unbedingten Gehaltes ja gehört. Die Überwindung der zerstörerischen Seite des unbedingten Gehaltes bedeutet nämlich zugleich einen Schritt auf dem Weg von der absoluten Geistgestalt Gottes zur Gestalt der absoluten Liebe. Das heißt nicht, daß Gott nunmehr von der Welt abhängig gemacht würde; er bleibt der Herr dieses Geschehens: Wie das Dämonische nichts anderes ist als das Sichzur-Geltung-Bringen seines Gerichts, so ist auch die Überwindung des Dämonischen durch die Liebe nur möglich, weil und wo es Gottes Wille ist. 4.2. Die Konkretion der Geschichtsmetaphysik: als Kairos
Tillichs Deutung der Gegenwart
Die Überwindung des Dämonischen kann nur durch die Vermittlung des Unbedingten ins Bedingte geschehen. Diese Vermittlung vollzieht sich nach der Theorie der kurz nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen Schriften Tillichs als Durchbruch des unbedingten Gehaltes durch die in sich selbst erstarrten bedingten Formen. Daß das geschieht, ist Gnade. Und den Moment, in dem es geschieht, nennt Tillich „Kairos". Tillich deutet seine Gegenwart in der Zeit der frühen zwanziger Jahre als einen solchen Kairos, also als Zeitmoment, in dem sich „ein neues
49
Vgl. Religionsphilosophie, S. 330.
122
Hannelore J a h r
Durchbrechen von Gehalt in die Form" vollzieht. 50 Dieser Durchbruch erfolgt in eine Situation hinein, die in Tillichs Augen den Zusammenhang mit dem lebenspendenden unbedingten Gehalt verloren hat. Symptom dieses Verlustes ist die Isolierung einer rein autonom gewordenen Kultur von einer Religion, die zum (heteronomen) Sonderbereich geworden ist. Für Tillich ist dies die Situation der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft der Vorkriegszeit. Da die reine Autonomie keinen Gehalt mehr zu fassen vermag, steht sie in der Gefahr, in einen neuen Irrationalismus zu verfallen, der selbst wiederum eine Gestaltweise des Dämonischen ist. Für Tillich ist dies der Nationalismus, dessen dämonisch-zerstörerische Macht sich im Ausbruch des Ersten Weltkriegs Bahn gebrochen hat. In dem Zusammenbruch des nationalen, bürgerlich-kapitalistischen Systems der Kaiserzeit sieht Tillich — und darin nähert er sich der „dialektischen Theologie" der frühen 20er Jahre — das göttliche Gericht über eine Welt, die sich von Gott losgerissen hat. In diesem Gericht liegt jedoch — und dies ist das eigentliche Charakteristikum seines Kairos-Begriffs im Gegensatz zur „dialektischen Theologie" — zugleich die Chance zu einem Neuanfang, zu einer Weltgestaltung, die die Dämonien der Vergangenheit überwindet und daher den Charakter einer neuen Theonomie trägt, die — vom gegenwärtigen Kairos aus gesehen — den Charakter einer Gott gehorsamen, gerechten Gesellschaftsordnung tragen muß. So gesehen ist der Kairos ein Zeitmoment, in dem nicht nur der unbedingte Gehalt durch die zum Untergang verurteilten Formen des Bedingten hindurchbricht, sondern in dem sich zugleich eine unbedingte Forderung erhebt, die auf die Schaffung der kommenden Theonomie gerichtet ist. Der Kairos ist also immer Gabe und Forderung zugleich. 51 In diesem Zusammenhang findet auch Tillichs Engagement in der Bewegung des religiösen Sozialismus seine systematische Begründung. Er versteht den religiösen Sozialismus als eine „Gemeinschaft von solchen, die sich im Bewußtsein des Kairos verstehen und ... um die Gnade der Theonomie ringen", 52 ja sogar als die „stärkste kairosbewußte 50
51 52
Vgl. Die religiöse und philosophische Weiterbildung des Sozialismus. In: Blätter für religiösen Sozialismus 5, 1924, S. 2 6 - 3 0 ; zit. n. G W II, S. 1 2 1 - 1 3 1 ; h. S. 127. Vgl. ebd., S. 128. Vgl. Grundlinien des religiösen Sozialismus, S. 119.
„Gestalt" als Schlüssel zur Metaphysik im Frühwerk Paul Tillichs
123
Bewegung" der Zeit.53 Daher ist sein Kampf um die kommende theonome Gesellschaftsordnung repräsentativ für alles Gestalten aus dem Ergriffensein von der formdurchbrechenden Macht des unbedingten Gehaltes. Tillich hat seine Beschreibung des Handelns aus dem Bewußtsein des Kairos deshalb weitgehend als Programm des religiösen Sozialismus entworfen. Sucht man nun in seinen Schriften aus den frühen 20er Jahren nach wirklich konkreten Handlungsanweisungen, wird man jedoch bald enttäuscht. Dies ist nicht die Schwäche des theologischen Systematikers, sondern liegt in der Konzeption des Vermittlungsgeschehens des Unbedingten ins Bedingte begründet, genauer in der Bindung dieses Vermittlungsgeschehens an das Element des unbedingten Gehaltes. Diese macht es Tillich nämlich fast unmöglich, zwischen dem Gericht, das der dämonische Gehaltdurchbruch darstellt, und dem gnadenhaften Durchbruch des unbedingten Gehaltes im Kairos deutlich zu unterscheiden. Dies zeigt sich konkret daran, daß für Tillich das der Dämonie des Nationalismus entsprechende Gericht des Ersten Weltkrieges de facto mit dem gnadenhaften Durchbruch des unbedingten Gehaltes identisch ist, der im Kairos geschieht. So schreibt er, daß die Ereignisse, die im Ersten Weltkrieg und in den Nachkriegsjahren „Mitteleuropa und Rußland" erschütterten, einen Durchbruch des unbedingten Gehaltes bedeuten, der für ihn „unser Kriegsgewinn" ist, „der wichtiger ist als das Gewinnen des Krieges oder die Ruhe der Neutralität".54 Erklärlich wird dies aus Tillichs Hoffnung, daß die neue theonome Gesellschaftsordnung in greifbarer Nähe ist, so daß der Zusammenbruch des Alten Garant genug zu sein scheint für das zu erwartende Kommen des Neuen. 5. Ausblick Diese Hoffnung hat sich so nicht erfüllt. In seinem zweiten KairosAufsatz von 1926 konstatiert Tillich: Wenn wir ... auf die Wirklichkeit unserer Tage blicken, müssen wir nicht sagen: Es ist, als ob ein Reif gefallen wäre auf all die Dinge, von denen hier gesprochen ist ... War nicht doch alles Romantik, Rausch, Utopie? ... Der Geist der bürgerlichen
53 54
Vgl. Kairos. In: Die Tat 14, 1922, S. 3 3 0 - 3 5 0 ; h. S. 347. Vgl. Die religiöse und philosophische Weiterbildung des Sozialismus, S. 130.
124
Hannelore Jahr
Gesellschaft ist viel zu stark, als daß er durch Romantik, Sehnsucht und Revolution überwunden werden könnte. Seine dämonische Kraft ist viel zu groß. 5 5
Tillich leitet aus der veränderten Situation zunächst jedoch noch nicht die Notwendigkeit ab, seine Deutung der Gegenwart als Kairos aufzugeben. Statt dessen wandelt sich seine Interpretation des Kairos und zwar in einer Weise, die zugleich auch dem theologischen Anliegen Rechnung trägt, die Zweideutigkeit des Vermittlungsgeschehens von Unbedingtem und Bedingtem zu beseitigen. Wie es schon in seinen Schelling-Dissertationen angelegt war, bindet Tillich die Vermittlung zwischen dem Unbedingten und dem Bedingten, zwischen Gott und Welt, in der Mitte der 20er Jahre an das Element der Form. In den Schriften dieser Zeit ist die Rede von der Vertikalen, die in die Horizontale einbricht, d. h. in ihr neue Form gewinnt. So besteht „die Bedeutung der Kairos-Idee" für Tillich jetzt darin, „daß sie die Linie nach vorn mit der Linie nach oben verbindet." 56 In der Durchführung zeigt es sich jedoch, daß dabei als Konsequenz der Bindung der Vermittlung von Gott und Welt an das Element der Form der nach vorn, auf die Zukunft gerichtete Impetus, der bis dahin für Tillichs Schriften charakteristisch war, hinter die vertikale Linie zurücktritt. So heißt es in der Marburger Dogmatik-Vorlesung von 1925, daß das, was „die Geschichte zur Geschichte" macht, eine Dynamik ist, „die aus dem Transzendenten kommt und ins Transzendente führt". 57
55
56
57
Kairos. Ideen zur Geisteslage der Gegenwart. In: Kairos. Zur Geisteslage und Geisteswendung. Hrsg. v. Paul Tillich. Darmstadt 1926, S. 1 - 2 1 ; zit. n. G W VI, S. 2 9 - 4 1 ; h. S. 41. Vgl. Klassenkampf und religiöser Sozialismus. In: Religiöse Verwirklichung. Berlin 1930; zit. n. G W II, S. 1 7 5 - 1 9 2 ; h. S. 190. Vgl. Marburger Dogmatik-Vorlesung, S. 55. — Daß die Tillich-Forschung in der Frage, ob seine Theologie eher geschichtlich-immanent oder statisch-transzendent ist, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommt, hängt mit dieser Veränderung in Tillichs theologischem System zusammen. So wird die These, daß Tillichs Theologie insgesamt eher statisch-transzendent ist, u. a. vertreten von Sigurd Martin Daecke: Teilhard de Chardin und die evangelische Theologie. Die Weltlichkeit Gottes und die Weltlichkeit der Welt. Göttingen 1967, sowie Paul A. Wee: Space and Time: The Relationship Between Ontology and Eschatology in the Philosophical Theology of Paul Tillich. Phil. Diss. Berlin 1975. - Daß Tillichs Theologie in erster Linie geschichtlich-immanent ist, ist dagegen die Ansicht von Thomas Ulrich: Ontologie, Theologie, gesellschaftliche Praxis. Studien zum religiösen Sozialismus Paul Tillichs und Carl Mennickes. Zürich 1971 sowie Falk
„Gestalt" als Schlüssel zur Metaphysik im Frühwerk Paul Tillichs
125
Insgesamt gesehen war jedoch der auf die Zukunft, auf geschichtliche Gestaltung der Welt gerichtete Impetus für Tillich der stärkere, wobei Weltgestaltung für ihn immer nur aus dem Ergriffensein von der verwandelnden Macht Gottes geschehen kann, wenn sie nicht in gehaltentleerter reiner Autonomie enden soll. Und so kommt es in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre erneut zu einer Veränderung seines Verständnisses der Vermittlung von Gott und Welt. Diese wird nunmehr so konzipiert, daß sie genau dem gestaltmetaphysischen Grundansatz entspricht. Bezeichnenderweise hat sie ihren Kristallisationspunkt in dem Konzept der „Gestalt der Gnade". 58 Es beschreibt eine Vermittlung von Gott und Welt im Zusammenspiel von Form und Gehalt. Aus ihm erwächst die Geschichte (Gehaltelement) immer neuer, das Dämonische überwindender Formen. Auf diese Weise geht die Welt ihrer endgültigen Gestalt entgegen, in der der unbedingte Gehalt in der unbedingten Formeinheit der bedingten Formen gefaßt sein wird. Diese ist als Gemeinschaft alles Seienden analog dem in den Schelling-Dissertationen beschriebenen Konzept der „Centraiidee" zu verstehen, und von ihr gilt, was Paulus in 1 Kor 15,28 verheißt: daß Gott „alles in allem" ist.
58
Wagner: Absolute Positivität. Das Grundthema der Theologie Paul Tillichs. In: NZsTh 15, 1973, S. 1 7 2 - 1 9 1 bzw. ders.: Was ist Religion? Studien zu ihrem Begriff und Thema in Geschichte und Gegenwart. Gütersloh 1986, S. 379 — 385. Zum Begriff der „Gestalt der Gnade" vgl. v. a.: Protestantische Gestaltung. Vortrag, gehalten v o r der Theologenschaft in Münster/W. im Januar 1929. In: Religiöse Verwirklichung, S. 43 — 64 und: Der Protestantismus als kritisches und gestaltendes Prinzip. In: Protestantismus als Kritik und Gestaltung. Zweites Buch des Kairos-Kreises. Hrsg. v. Paul Tillich. Darmstadt 1929, S. 3—37; wiederabgedruckt in: G W VII, S. 2 9 - 5 3 .
Gestaltweisen der ontologischen Rede von Gott
J A C K S. BOOZER f
Being and History in Paul Tillich's Theology Introduction In his introduction to the collection of essays edited by James Luther Adams, The Protestant Era (1948), Tillich speaks of how his discovery of "justification through faith," of "ultimate concern," and of the holy as embracing "both itself and the secular" led him to apply these principles to the interpretation of history. "History became the central problem of my theology and philosophy because of the historical reality as I found it when I returned from the first World War."1 The situation at that time demanded both interpretation and action; interpretation not adequately contained in the excessive individualism of Protestantism nor in the ecclesiastical conservatism of Catholicism, and action engendered neither by Marxian utopianism nor by theological otherworldliness. Tillich found in the German religious-socialist movement a stimulus toward a theonomous interpretation of culture and of history, an interest in "human life as a whole," a perspective within which the "question of wages, of security, is treated in unity with the question of truth, of spiritual security."2 The affiliation with the religious-socialist movement provided him with "an analysis of our situation" and entailed for him a "definitive break with philosophical idealism and theological transcendentalism."3 Henceforth he was to be engaged in a religious
1
2 3
Paul Tillich, The Protestant Era. Chicago: The University of Chicago Press, 1948, p. xvii. Ibid., p. xviii. Cf. Professor Ratschow's comment on that shift by Tillich. "Einmal entdeckt Tillich im Sozialismus das Zusichselbstkommen einer geschichtlichen Entwicklung (GW II, 22), die in der Reformation ihren ersten Anstoß, in Descartes ihre Theorie, in der Aufklärung ihre Universalität und in der Gegenwart ihre Realität empfangt"
130
Jack S. Boozer
interpretation of history with an especially protestant Christian form. In that effort he emphasized the Protestant principle through the concepts of "theonomy," "kairos," the "demonic," and "Gestalt of grace." Many of the essays brought together in The Protestant Era signal that interest, especially the incisive essays on "Kairos" (1922), "Historical and Nonhistorical Interpretations of History: A Comparison" (written in 1939 and published for the first time in TPE), and the essays on the message and formative power of Protestantism originally published in Religiose Verwirklichung in 1929. Tillich never abandons the "Protestant principle," but as he turns toward a systematic theological undertaking in the United States, he eschews typical Protestant suspicions of "natural theology" and of ontology and adopts a dialectic of being and non-being which provides the concept of "correlation" as the determinative method for his Systematic Theology. In general, Catholic theologians welcomed a Protestant theology which embraced a universal ontology alongside the emphasis on justification by faith. Kenneth Hamilton, on the other hand, represents an extreme Protestant suspicion of Tillich's ontological theology when he accuses Tillich of a "metaphysical captivity of the Gospel", and of distorting the Gospel (Kerygma) by subjugating it to the methodological requirements of the System. 4 Tillich's theology is certainly a systematic one as he intentionally combines Logos and Kairos, reason and revelation, unity and separation, essence and existence, guilt and grace, autonomy and theonomy, Being itself (ground of being) and God. In doing this, Tillich acknowledges the difficulty of reconciling the predominantly personal attributes of God in the Bible with an ontological reference to God as Ground of Being. In his lectures at the University of Virginia in 1951 under the title, "Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality," 5 Tillich was frank about the problem.
4
5
("Paul Tillich, 1886—1965" in Martin Greschat, Hrsg., Theologen des Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert II. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1978, S. 310). Kenneth Hamilton, The System and the Gospel. New York: The Macmillan Company, 1963, especially pp. 9 - 3 6 , 1 9 7 - 2 3 9 . Paul Tillich, Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality. Chicago: The University of Chicago Press, 1955.
Being and History in Paul Tillich's Theology
131
The most devasting conflict between biblical religion and ontology appears to be the conflict between reciprocity and participation in the divine-human relationship. ... The problem is present within biblical religion itself in the tension between the unconditional emphasis on God's working in everything, even evil, sin, and death, and human responsibility for good and evil. 6
Even so, the difficulty of Tillich's view for most people is the seeming incompatibility between the ultimate as Ground and Power of Being (impersonal) and the personal God of Abraham, Isaac, and Jacob, of Jesus and Paul. Tillich emphasizes the limitation of understanding God only as a being, a person which leads him to maintain that being and person are not contradictory. "Being includes personal being: it does not deny it. ... Our encounter with God who is a person includes the encounter with the God who is the ground of everything personal and as such not a person."7 He also sees the limitation of ontology. "The correlation of ontology and biblical religion is an infinite task. There is no special ontology which we have to accept in the name of the biblical message. ... There is no saving ontology, but the ontological question is implied in the question of salvation." 8 Understanding crucial categories in Tillich such as estrangement, reunion, reconciliation, being separated from that to which one belongs, the demonic, faith as acceptance of being accepted, the courage to be, and the New Being depends finally on the relation between being and history, the unconditional and the conditional, and ontology and salvation. The meaning of all of these categories seems to turn specifically on the relation between being and history. That relation is both illuminating and perplexing in statements Tillich makes early in the Systematic Theology. Only that which has the power of representing everything particular is absolutely concrete. And only that which has the power of representing everything abstract is absolutely universal. This leads to a point where the absolutely concrete and the absolutely universal are identical. But it is necessary to accept the vision of early Christianity that if Jesus is called the Christ he must represent everything particular and must be the point of identity between the absolutely concrete and the absolutely universal.
6 7 8
Ibid., pp. 7 9 - 8 0 . Ibid., pp. 82 - 83. Ibid., p. 85.
132
Jack S. Boozer
The Logos doctrine as the doctrine of the identity of the absolutely concrete with the absolutely universal is not one theological doctrine among others; it is the only possible foundation of a Christian theology which claims to be the theology.9
How is one to reconcile the claim that in Jesus as the Christ the concrete and the universal are identical with the strong claim that history is the primary category for interpreting reality, that "salvation is the salvation of a community from evil powers in history through history,"10 that telos in the New Testament means the fulfillment of history horizontally, and is of an eschatological, not an ontological character?11 Clarifying this apparent contradiction in Tillich requires a consideration of Being and Time and, finally, of Being and History.
I. Being and Time Tillich understands time along with space, causality, and substance as ontological categories which are present in everything finite. They are "forms of finitude" which express both the being and non-being of everything that exists.12 Even in his earliest discussion of the categories, however, time is the "central quality of finitude." In the later, more general discussions, Tillich emphasizes the tension between time and space as indicative of two contradictory world-views, polytheism and monotheism. The essays, "Historical and Nonhistorical Interpretations of history: A Comparison" in The Protestant Era and "The Struggle Between Time and Space" in Theology of Culture13 (neither previously published) and the 1952 essays in Berlin on "Die Judenfrage — ein christliches und ein deutsches Problem"14 develop the contrast between space and time. In these essays Tillich identifies a spatial orientation which subordinates time to space as pagan polytheism and a temporal 9
10 11 12 13
14
Paul Tillich, Systematic Theology, Vol. I. Chicago: The University of Chicago Press, 1951, pp. 1 6 - 2 1 7 . Paul Tillich, The Protestant Era, pp. 2 6 - 2 7 . Ibid., pp. 2 6 - 2 8 . Paul Tillich, Systematic Theology, Vol. I, p. 192. Paul Tillich, Theology of Culture, Robert C. Kimball, editor. New York: Oxford University Press, 1959. pp. 3 0 - 3 9 . Paul Tillich, Gesammelte Werke, III. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk, 1956, pp. 1 2 8 - 1 7 0 .
Being and History in Paul Tillich's Theology
133
orientation which subordinates space to time as fundamentally monotheistic. 15 Existence for Tillich entails finitude which means to be actual both in time and in space. Given their mutual inseparable presence in history, however, the contrast between them as to which is dominant is one of "the most fundamental tensions of existence." The primary quality of space as "alongsideness" or "beside-each-otherness" becomes "againsteach-otherness" in the competitive struggles of life. People are located in limited "spaces" and their gods have power only in those spatial domains. As there are many peoples, spaces, and gods, a predominantly spatial orientation inevitably stimulates competitiveness and struggle as people attempt to expand their space in the name of their superiority or the superiority of their gods. In a spatial orientation the tendency to absolutize one's race, blood, soil, tribe, or nation is both nurtured and expressed through conquest. There is a special relation between space and nature, however, which places life within the circular limits of birth, growth, decay, and death, limits which are inherent in spatial existence and cannot be overcome or transcended regardless of how much space a people may conquer. Nothing fundamentally new is possible in this circular view, as time is only a way of measuring how long it takes for the cycle to return inevitably to the point of beginning. Time is contained within space, and existence is tragic because the struggle for meaning and security, even when spatial domains and the powers of one's god are extended, carries the seed of its own failure within itself because of the conditioned nature of spatial limits. Human existence cannot be fulfilled without space, but neither can fulfillment come from spatial conquest based on unconditional claims for limited phenomena such as blood, soil, race, tribe, and nation. Tillich attributed to Judaism, indeed, to the Jewish prophets, the accomplishment of a quantum leap from a spatial to a temporal orientation. That decisive shift, described by Eric Voegelin as a "leap in being" 1 6 entails four qualitative shifts in the interpretation of existence:
15
16
It is not cleat why a temporal orientation in itself is inevitably monotheistic, especially if some "times" are more important than others, but this is not the place to argue the point. Eric Voegelin, Order and History, Vol. I, Israel and Revelation. Louisiana State University Press, 1956, pp. 10, 14, 50 f., 116, 123, 194, 235, 402 ff.
134
Jack S. Boozer
the breaking of a cyclical view of time, monotheism, the separation of God, at least in part, from the destiny of a people, and the universal obligation of justice upon all people. On this view, time becomes horizontal, planary, sequential, having a beginning, a center of mid-point, and a goal or an end. The present and the future offer the possibility of something new. They are not bound to the past or determined by the past because time is onedirectional, irreversible, always moving toward a future. Time does not repeat itself. Tillich used a passage from Isaiah for one of his early sermons in which God says: "Behold, I am doing a new thing." 17 Contrary to the Nebeneinander form of the gods of space, an inevitable polytheism, Tillich understands time to be applicable to all spaces but wedded and confined to none. God is one and the same for all time and for all space. That the one God of time could call Abraham to leave his land and go to another, and that God could deliver the Jews from Egyptian bondage and lead them to another "land" with the promise, "I shall be there what I there shall be," 18 is an evidence of how, for Tillich, monotheism is implicity in this view of time. However much the one God is present in Israel for the sake of the whole world or in the whole world for the sake of Israel is distorted and misunderstood, Judaism has held firmly to the Sh'ma: "Hear, Ο Israel: the Lord is our God, the Lord is One!" Tillich understands how confused polytheism and monotheism can become if they are understood in terms of how many gods there are rather than in terms of an inclusive functional relation. The gods of polytheism are gods bound to space. That is their power and that is their limit. It is not the number of gods that characterizes polytheism but their being alongside one another. ... Polytheism is not essentially a plurality of gods, and monotheism does not mean that one god stands against and above many others. Polytheism means that the gods are bound to space, and monotheism means that God is bound to time. As long as the Jewish God stands as God of the Jewish nation against the gods of other nations, the Jewish God is a polytheistic god limited to space like all other polytheistic gods even if the Jewish God is only one God. 1 9
17 18
19
Isaiah 43: 16, 1 8 - 1 9 . Martin Buber's translation of Exodus 3 : 1 4 . Martin Buber, Israel and the World. New York: Schocken Books, 1963, p. 23. "Die Judenfrage," pp. 154, 156 ff.
Being and History in Paul Ullich's Theology
135
There is a corrective to the polytheistic distortion of monotheism in the other two aspects of a temporal view. Both of these find particular expression in the prophets who in the name of God condemn the people for their disobedience and betrayal and for violations of justice and mercy. The gods of spatial nations die with the death of a nation. The God of time nurtures, judges, condemns, and redeems the people if they "turn" back to the ways of righteousness, justice, and mercy. God makes moral demands upon God's people because God's righteousness and justice are demands upon all peoples to the ends of the earth. The will of God is not capricious but inseparably related to justice and mercy among all people, with particularly stringent demands upon those who freely enter covenant with God. For Tillich there is no static ontology. Being and time are internally related, logos is manifest in time. Logos participates in the directedness of time toward the fulfillment of creation, toward a future of blessedness when the lion and the lamb shall lie down together and the kingdoms of this world will become the kingdom of God. To be, therefore, is not only to be in irreversible time with a past and a future, but to participate in a revelatory event which functions to manifest the founding meaning and eschatological purpose of existence, of being in time. For Tillich, "the God of time is the God of history,"20 and a temporal orientation is presupposed by and essential to the more complicated relation between being and history to which we now turn.
II. Being and History Time and history are complex terms. History would have a different meaning were time understood as cyclical. As has been Tillich rejects cyclical time as non-temporal, non-historical, in that in that view dominates and neutralizes the primary meaning of 20
quite seen, space time.
Paul Tillich, Theology of Culture, p. 37. Cf. also an interpretation of New Being by Langdon Gilkey. "Thus does 'Logos' have a Kairos, a 'fate'; it is subject to the deepest presuppositions of its time and place, of its cultural epoch, and it cannot by the powers of abstraction transcend that particular base" (The Thought of Paul Tillich, edited by James Luther Adams, Wilhelm Pauck and Roger L. Shinn. San Francisco: Harper & Row, 1985, p. 326).
136
Jack S. Boozer
He clearly interprets time as horizontal, as direction toward the future. Even within his view of time as horizontal, irreversible, and open to the "new," however, time is not to be equated with history. There is no history without time, but irreversible time is not necessarily history. The distinction between chronos time and kairos time is important for Tillich, and he often speaks of Logos as having a Kairos. To my knowledge, however, he never speaks of Logos as having a chronos, although his theology would seem to require that. He assumes a "philosophy of time" as decisive over a "philosophy of space," but his primary interest is in history, in Kairos, in a philosophy or a theology of history, not in a philosophy or theology of chronos or clock time. He was certainly aware of the difference between Historie and Geschichte, but it was history not "time as such" that became preoccupying for him after World War I. Around 1920 Tillich joined a few others in Berlin who thought the defeat of Germany brought a new opportunity to combine Christianity and socialism in a movement to challenge the destructive powers of capitalism and nationalism and to "shape the life of humanity in terms of justice and liberty, rejecting oppression." 21 Tillich introduced the idea of kairos to the group which came to be known as the Berlin group or as the "kairos Ring," and the concept of Kairos became a continuing theme in all of Tillich's thought. He emphasized Kairos not as formal clock-time, but as "fulfilled time," as the "right time," a special time which is qualitatively decisive in that the creative and living meaning of all "times" is present in it. History is impossible without chronos, but its peculiar meaning is suggested by Kairos as a time of intense spirited meaning, making present the living import of temporality, giving a central orientation to the temporal flow {die Mitte der Geschichte) in which the purpose and substance of the beginning and end of time as well as of all other "significant" times is disclosed. Kairos is a matter of spirit, not of body or nature alone, spirit that manifests the gift and demand of the eternal in the temporal, relating the "element of abstract unlimitedness with an element of concrete limitedness." 22
21
22
Wilhelm and Marion Pauck, Paul Tillich: His Life and Thought, Vol. I. New York: Harper & Row, 1976, pp. 6 8 - 6 9 . Paul Tillich, Systematic Theology, Vol. III. Chicago: The University of Chicago Press, 1963, p. 317.
Being and History in Paul Tillich's Theology
137
Tillich's sense of history enabled him to identify particular characteristics of epochs, to recognize that all things are not possible at all times, suggesting the contingent and non-predictable aspects of history. The eternal and the temporal are present but always in relation to the finite freedom and actions of human agents in a non-deterministic way. The genuinely new, the unexpected, and the unanticipated characterize history, and participation in history always involves venture, risk, concern, and courage. This is not to suggest the termination of the old in an apocalyptic sense. "New Being is not another being, but the Transformation of the old being." 23 In his own sense of history, the end of World War I was a time of hope and confidence in the emergence of a kairos, a significant reordering of all the qualities of human life. The end of World War II he viewed quite differently as a time of more darkness than light, a time of waiting, of a "sacred void," a negative kairos characterized by unfulfilled aspirations. Even though the hope for a kairos after WW I may have been Utopian and despair about a kairos after WW II may have been cynical, in both times there was concern about the relation between the "unconditional" and the "conditional," the demand and promise implicit in an epoch in history which distinguishes that epoch from others. History is the crucible for life, the concrete actuality of being within which essential and eschatological dimensions, logos and the demonic, are present under the conditions of existence. Essential and existential dimensions as such are accessible only in actual history, never by abstraction. From the point of view of systematic structure, it must be added that the existential elements are only one part of the human predicament. They are always combined ambiguously with essential elements; otherwise they would have no being at all. Essential as well as existential elements are always abstractions from the concrete actuality of being, namely "life."24
Actuality in existence and history is the only context where being and non-being, essence and eschatology, the sacred and the profane, logos and finite freedom are accessible to human life. It is impossible to abstract from actual life and be loyal to actual life. If one affirms God as 23 24
Ibid., p. 414. Paul Tillich, Systematic Theology, Vol. II. Chicago: The University of Chicago: The University of Chicago Press, 1957, p. 20.
138
Jack S. Boozer
Unconditional or as the power or ground of being, one makes that claim as a risk within history where being and ground cannot be separated from non-being and actual being. Whatever is claimed as unambiguous is claimed by the human spirit of an individual or a community within the context of ambiguity. Whatever is claimed for God, love, being, justice, reconciliation, or faith is claimed "under the conditions of existence (i. e. in history)." This does not make Tillich an existentialist but it does indicate that affirmations of essence, being, truth, or the Unconditional are made by persons who participate with their whole beings in the ambiguous actuality of history. Tillich uses the words "paradox" and "dialectic" to indicate how two qualitatively different dimensions, the unconditional and the conditional, while not reducible to each other, are present together, each qualifying the other in some way. Existence cannot be deduced from essence because actuality adds something to essence. Neither can essence be inferred from existence because essence separated from the conditions of existence is not the same as essence under the conditions of existence. Tillich's emphasis on correlation as the proper theological method because it "explains the contents of the Christian faith through existential questions and theological answers in mutual interdependence" is related to and reflects the correlation between the divine and the human in actual history. He discusses this fundamental meaning in a striking passage in Volume I of the Systematic Theology. The third meaning of correlation qualifies the divine-human relationship within religious experience. The third use of correlative thinking in theology has evoked the protest of theologians such as Karl Barth, who are afraid that any kind of divine-human correlation makes G o d partly dependent on man. But although God in his abysmal nature is in no way dependent on man, God in his self-manifestation to man is dependent on the way man receives his manifestation. ... The divinehuman relation, and therefore G o d as well as man within this relation, changes with the stages of the history of revelation and with the stages of every personal development. There is a mutual interdependence between "God f o r us" and "we for God." ... The divine-human relation is a correlation. The "divine-human encounter" (Emil Brunner) means something real for both sides. It is an actual correlation. 25
25
Paul Tillich, Systematic Theology, Vol. I, p. 61.
Being and History in Paul Tillich's Theology
139
This passage is consistent with many other themes in Tillich stressing existence and history: man as simul peccator, simulJustus, faith as acceptance of God's acceptance of us in spite of our not deserving to be accepted, spiritual presence, New Being, autonomy and theonomy, love and justice, the Gestalt of Grace as Catholic substance and Protestant principle together, and the Word of God being a Yes and a No. But there are other words in Tillich which suggest, finally, an ideal, essentialist, and even a spatial meaning of his theology. Those most puzzling in the latter category are: unity, the reunion of the separated, Christ as the "point of identity between the absolutely concrete and the absolutely universal," and the extensive use of the word, "essentialization" as God's providential activity in history (especially in Vol. III). Perhaps the passage most different from Tillich's emphasis on history is that mentioned earlier: "The Logos doctrine as the doctrine of the identity of the absolutely concrete with the absolutely universal is not one theological doctrine among others: it is the only possible foundation of a Christian theology which claims to be the theology." How is one to understand Tillich's claim for Jesus as the Christ as the point of identity between the absolutely concrete and the absolutely universal and his claim for the Logos doctrine as entailing the identity of the absolutely concrete and the absolutely universal as the only possible foundation of a Christian theology? What is one to make of these claims alongside his more restrained statement in the preface to Volume I of the Systematic Theology? "I dedicate this book to my students. ... My ardent desire is that they shall find in these pages something of what they expect — a help in answering the questions they are asked by people inside and outside their churches. A help in answering questions: this is exactly the purpose of this theological system." 26 The answer one gives to this apparent contradiction depends on how one interprets Tillich's understanding of "Being and History", or of "Ontology and History." It is clear that he does not embrace a static ontology, nor does he emphasize the aseitj of God in the non-temporal sense of being unaffected internally by existence and history. He reasserts at the end of Volume III that, in his view, "the world process means
26
Ibid., p. viii.
140
Jack S. Boozer
something for God." 27 He also speaks of the "living God" and describes the process of the divine life as having the character of love. "... God is love. And since God is being-itself, one must say that being-itself is love." 28 Further, Tillich often defines love in its most general sense as "the drive toward the unity of the separated," 29 as the reunion of the separated. At the same time, Tillich clearly asserts that "there is no saving ontology," that "there is no special ontology which we have to accept in the name of the biblical message." 30 That may be the case if one restricts ontology to an analysis of being such as that entailed in the ontological polarities, an analysis that is subject to universal nonreligious interpretation. It would seem, however, that Tillich's understanding of being-itself and of Logos as drawn for the Christian Bible, particularly the prologue to the Gospel of John along with repeated references to love, justification, and grace, do, in fact, require a particular kind of ontology. The crucial issue in the relation of Being to History, then, is not whether God "suffers," whether God is in any way affected by persons and events in history, but specifically "how" God is internally related to history (which is not to rule our different kinds of external relations). How difficult that question is for Tillich may be indicated by his Christological claim for a concrete universal and his ontological claim for a process of essentialization. A. Jesus as the Christ as the Point of Identity between the Absolutely Concrete and the Absolutely Universal This claim is usually developed in general theoretical terms which suggest that Jesus as Christ contains all the possibilities of historical concreteness and all the possibilities of universality. On the side of concreteness, what would all the possibilities of actual concrete existence mean in the relation to the specific concreteness of Jesus, that he was male, middle-Eastern (not North European, African, or Oriental),
27 28 29
30
Paul Tillich, Paul Tillich, Paul Tillich, p. 25. Paul Tillich,
Systematic Theology, Vol. I l l , p. 422. Systematic Theology, Vol. I, p. 279. Love, Power, and Justice. New York: Oxford University Press, I960, Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, p. 85.
Being and History in Paul Tillich's Theology
141
Jewish, a teacher, a prophet, one who apparently had no job security or retirement benefits, no health insurance, not a citizen of a NationState, and one whom some followed as the Way or as Lord? Do the specific qualities of Jesus' concreteness make any difference for the claim that absolute universality and absolute concreteness are identical in Christ? If not, then the concreteness is not absolute. If so, the absolute universality of Jesus as the Christ does not include a lot of concrete people. I find this logical form of the claim for Jesus as well as the claim that Jesus as the Christ is the "center of History" to be confusing, to violate the predominantly historical quality of Jewish and Christian faith, and to give support to the absolutizing of specific contingent qualities in Christian history that have not been fair to women, to Jews, to non-Westerners, or to the poor, while discouraging critical questioning of specific conditions in history which structurally demean human life. Four specific persons or groups come to mind whose devotion to Christ led them to a heroic challenge to demonic principalities and powers in history: the White Rose Group in Munich in 1943, Pastor Trochme in a Presbyterian parish in Le Chambon, France, 1940 — 44, Martin Luther King, Jr's challenge to laws supporting racial segregation in the United States in the sixties, and Paul Tillich's own difficult decision in 1933 that loyalty to his Fatherland meant that he must leave Germany. In each case, the decision turned not on the identity of the concrete and the universal, but on the careful, courageous, and concrete challenge of some specific aspects of history by other specific aspects. Devotion to Christ led them not to sanction all the possibilities of concreteness but to challenge some possibilities-actualities on the basis of other concrete possibilities-actualities. The White Rose group of students and one professor in Munich began printing and distributing leaflets throughout Germany denouncing the National Socialist regime for violating the German heritage of arts, letters, morality, and religion. They risked their lives and gave their lives to expose the Nazi violation of the moral and religious qualities of the Kingdom of God. Pastor Trochme and his associates risked their lives to give sanctuary to Jews, including many children, whom the occupying powers were seeking to deport to the death camps for extermination. Philip Hallie tells the Le Chambon story poignantly,
142
Jack S. Boozer
describing Trochme as follows: "In part he was good because he resisted the people who were doing harm and because he helped save the lives of those they were seeking to harm, the refugees. He was good because he diminished evil in the world. The evil he diminished was harmdoing, and the evil he diminished was suffering." 31 Martin Luther King, Jr. risked and gave his life non-violently challenging the structural demeaning of the human entailed in racial segregation supported by law. For him, following Jesus did not mean that everything is contained in Jesus, but that saying yes to Jesus means saying no to the forces of oppression, violence, and death. Tillich faced a similar crisis because the National Socialist authorities took serious exception to what he had written in The Socialist Decision. Officials of the government suppressed distribution of the book and urged Tillich to disavow its contents. Later in 1933, he defended Jews and others who were being attacked by the Brownshirts even in the halls of the University. He was among those on the first list of professors to be dismissed from their posts as enemies of the State in April 1933. He openly challenged the racial and totalitarian crudenesses of the Nazis and was strongly urged by Adorno to leave Germany to save his life and that of his family. An invitation from Union Theological Seminary in New York and Columbia University to join those faculties made that possible. Quite reluctantly, he decided that leaving his Fatherland was the only way, under these circumstances, he could serve it. In all of these instances, the claim that Christ is the point of identity between the absolutely concrete and the absolutely universal sounds extremely abstract and theoretical. For these persons and groups, the concrete and the universal are not related as identical, but in an acute tension requiring a courageous thought-action, a decision-action among a number of limited concrete options none of which was absolutely correct or right. In different ways, their devotion to Christ meant discerning obedience to his words and acts of love, justice, courage, and non-violence, and the use of their powers to serve the Kingdom of God within the ambiguities of history. In their concrete struggles they claimed no identity with the absolute universal nor did they
31
Philip Hallie, Lest Innocent Blood Be Shed. New York: Harper & Row, 1979, p. 279.
Being and History in Paul Tillich's Theology
143
absolutize their decisions and deeds. Indeed, they showed their confidence in the universality of love, justice, and courage by not claiming an identity between their concrete acts and the absolutely universal. B. Essentialization In the last pages of Volume III of the Systematic Theology, Tillich uses the term, essentialization, to describe the activity of "spiritual presence," the providential activity of God in history, the "rhythm both of the Divine Life and of life universal."32 He describes this in somewhat different but similar ways: "From essence through existential estrangement to essentialization"33 and "from essence through existence to essentialization."34 Tillich is obviously indebted to Hegel for this pattern of interpretation, but he is as consistent in rejecting a synthesis as he is in emphasizing the thesis and antithesis dimensions. He wants to maintain the "irrationality" of the transition of essence to existence as well as that from the ambiguities of existence to eternal life, the return of the temporal to the eternal at the end of time. Essentialization for him, therefore, cannot be a simple "elevation into eternity" or a "return to the state of mere essentiality of potentiality,"35 losing thereby everything that is "accidental," actual, and ambiguous under the conditions of existence. In his view there are certainly intimations of the cyclical in self-actualization as a process of self-identity, self-alteration, and return to self, both for the human and for God.36 But Tillich takes existence and history too seriously to suggest either a "return to essence" or a synthesis in history. He finally adopts a spatial figure to suggest, however inadequately, his view. The figure is that of a curved line "which comes from above, moves down as well as ahead, reaches the deepest point which is the nunc existentiale, the 'existential now,' and returns in an analogous way to that from which it came, going ahead as well as going
32
34 35 36 37
Paul Tillich, Systematic Theology, Vol. Ill, p. 421. Ibid. Paul Tillich, Systematic Theology, Vol. Ill, p. 422. Ibid., p. 400. Ibid., p. 30. Ibid., p. 420.
144
Jack S. Boozer
The adequacy of that figure and of the concept of essentialization becomes highly questionable when one looks carefully at what of existence is retained in "what goes back up." Actualization in time and space adds something to essential being, but it is only the "positive" created in every decision and action in time that is retained in the eternal. "In so far as the negative has maintained possession of it, it is exposed in its negativity and excluded from eternal memory. Whereas, in so far as the essential has conquered existential distortion its standing is higher in eternal life." 38 Tillich rejects Origen's notion of the "restitution of all things", but at a considerable cost, the removal of God from the suffering in the creation and the diminished significance of both divine and human acts against historical denials of justice and of love, the poisoning of the creation, the trivialization of humane qualities, and the refusal of grace. Tillich is even more explicit in another passage: This finally answers the question o f the meaning of distorted forms of life. ... The question and the answer are possible only if one understands essentialization or elevation of the positive into Eternal Life as a matter of universal participation: in the essence of the least actualized individual, the essences of other individuals and, indirectly, of all beings are present. Whoever condemns anyone to eternal death condemns himself, because his essence and that of the other cannot be absolutely separated. And he who is estranged f r o m his own essential being and experiences the despair of total self-rejection must be told that his essence participates in the essence of all those who have reached a high degree of fulfillment and that through this participation his being is eternally affirmed. 3 5
Although Tillich here claims the interdependence of all things as well as vicariousness in human relations, his answer is too theoretical and abstract for the abused child, the raped woman, the infant bom with congenital syphilis or with spina-bifida, the psychotic, the young person accidentally killed by an intoxicated driver, or those of any age who die from hunger. Essentialization for Tillich seems to apply to essences only and not to the wholeness of existing persons in history and the "yes" and " n o " decisions persons make in history between oppression and liberation, preservation and destruction, trust and fear, life and death, between genocide and inter-racial confirmation. Such a view also seems to remove God from presence and participation in the tragedies in
38 39
Ibid., p. 401. Ibid., p. 409.
Being and History in Paul Tillich's Theology
145
human existence along with ambiguous human participation under the conditions of existence in the blessedness of the spiritual presence of God, tangibly promised to the pure in heart, the peacemakers, and those who hunger and thirst for righteousness, or, one might add, to those who are "ultimately concerned" about the ultimate within the vicissitudes and ambiguities of history. This is not to suggest a compensatory future without grace in eternal life, but it is very strongly to affirm the significance of the divine and the human "yes" and "no" in history within the ultimate yes of eternal life within God's righteousness, power, and love.
Conclusion 1. Being and history are related in that being as objectively universal is presupposed (ontological elements) in concrete history while history is the determinative context within which there is respect for or violation of being and within which persons as individuals and groups affirm or deny the dialectical relation of the Unconditional to the conditional. 2. It is only in existence that the issues of essence and fulfillment are raised, and these are decided partly by necessity and partly by choice. 3. Universality is affirmed in and by concrete, culturally conditioned individuals and communities. Christian individuals and communities make claims for universality not so much in theoretical statements as in concrete expressions of justice, love, courage, and acts which preserve the goodness of the creation and the dignity-freedom-responsibility of all persons. 4. It is questionable whether Tillich is loyal to himself or to Christianity in his understanding of Jesus as the Christ as the point of identity of the absolutely concrete and the absolutely universal, and as the middle of history. There is more authenticity and comprehensive depth in the notion of dialectic, of correlation, of Yes and No, of a Gestalt of Grace as containing Catholic substance and Protestant protest than in the claim for the identity of the concrete and the universal. 5. It is also questionable whether in the category of essentialization Tillich has been loyal to his foundational understanding of history and existence, that existence adds something to essence, that God and actual, concrete persons are internally related in existence through love, logos,
146
Jack S. Boozer
justice, power, chronos, and kairos. His stressing of essentialization at the end of the Systematic Theology is certainly alarming and must be held somewhat tenuously in order to preserve the persistent priorities in the main body of his theology. However one decides to speak finally and eschatologically about the ultimate in eternal life, an important dimension of Tillich's life and thought for us in the late eighties is the historical responsibility to "stay the hand" of those who demean, pollute, and destroy the creation and all persons in it as a specific and concrete way to negate the negation of love within the absolute conviction about and participation in the ultimacy of love.
GÜNTHER KEIL
Die Wiedervereinigung des Getrennten und das Problem der Zeit Hegel hat es Schelling zum Vorwurf gemacht, das Absolute aus der Pistole zu schießen. Er meinte damit, daß Schelling das Absolute einfach vorausgesetzt habe, ohne dessen Begriff zu klären und inhaltlich zu füllen. Erst die wirkliche Anstrengung des Begriffes, die die begriffliche Einheit durch alle unterschiedlichen Momente durchhält und sie in einer alles Konkrete und Relative als ihren Inhalt einbeziehenden Synthesis inhaltlich füllt, könne nach Hegel die Rede vom Absoluten rechtfertigen. Hegel könnte den gleichen Vorwurf nur hinsichtlich der Begriffe „Sein" und „Sein selbst" dem Schellingschüler Tillich machen: Auch Paul Tillich würde nach Hegel diese Begriffe aus der Pistole schießen, ohne sie zu klären und inhaltlich zu füllen. Weder wird das Zusammenstehen all der widersprüchlichen Momente, die das Sein als ein auch alles Gegensätzliche integrierender Begriff damit notwendig in sich enthält, geklärt, noch wird der Inhalt des Seins in einem Durchgang durch das Seiende Moment für Moment aufgewiesen. Tillich spricht von „Sein" und „Sein selbst", als ob diese Begriffe eo ipso in sich widerspruchsfrei wären und auch von selbst schon immer einen eindeutigen Inhalt bezeichneten. Dagegen könnte freilich Tillich darauf hinweisen, daß er ja die genannten Begriffe nur symbolisch verstünde: Wenn das Symbol nur lebendig sei, bedürfe es nicht wie ein nichtsymbolischer Ausdruck der Anstrengung des Begriffes; und inhaltlich gefüllt sei ein Symbol — im vorliegenden Falle die Symbole „Sein" und „Sein selbst" — durch seine Partizipation am Symbolisierten — im vorliegenden Falle also am „Sein" und am „Sein selbst". Aber ein solcher Hinweis führt zu nichts: Denn wenn der Inhalt von „Sein" und „Sein selbst" widersprüchlich und ungeklärt bleibt, dann mögen seine Symbole noch so sehr an ihm
148
Günther Keil
partizipieren, sie gewinnen dadurch, daß sie an widersprüchlichen und ungeklärten, ev. völlig leeren Inhalten partizipieren, selbst keinen Inhalt. Ferner kann der Basissatz selbst, daß Symbole am Symbolisierten partizipieren, kein symbolischer Satz mehr sein, weil dann die Behauptung der Partizipation nur durch die Behauptung der Partizipation und damit im Zirkel gerechtfertigt werden könnte. Tillich weiß das auch: „ E s erhebt sich die Frage ..., ob es einen Punkt gibt, wo eine nichtsymbolische Aussage über Gott gemacht werden muß. Eine solche Aussage gibt es: Alles, was über Gott gesagt werden kann, ist symbolisch. Diese Behauptung ist eine Aussage über Gott, die selbst nicht symbolisch ist. Sonst würden wir in einen Zirkelschluß geraten." 1 Folglich muß der Basissatz selbst, daß Symbole am Symbolisierten partizipieren, ein unsymbolischer Satz sein und damit das Symbolisierte, in unserem Falle also die Begriffe „Sein" und „Sein selbst" schon immer unsymbolisch und damit direkt und damit der Anstrengung des Begriffes bedürftig in sich enthalten. Damit kommt Tillich aber auf keine Weise davon frei, Begriffe wie „Sein" und „Sein selbst" zu klären und mit Inhalt zu füllen. Freilich deutet er eine Klärung und inhaltliche Füllung wenigstens an: Die „Wiedervereinigung des Getrennten" sei der Inhalt des Seins selbst. Es ist die alte coincidentia oppositorum des Nikolaus von Cues, die hier bei Tillich wieder aufklingt; das wiedervereinigte Getrennte ist dann in der Tat der gesuchte Inhalt des Seinsbegriffes. Diese „Wiedervereinigung des Getrennten" kann damit grundsätzlich den Seinsbegriff klären und inhaltlich füllen, ob nun in der Weise des Cusaners oder Hegels oder anders, denn sie hat das getrennte Seiende zu ihrem Gehalt. Damit ist in der Tat die ontologische Fragestellung in ihrem Grundproblem angesprochen. Doch damit verbindet sich — zumindest seit Heideggers „Sein und Zeit" — ein weiteres Problem, das uns hier besonders interessieren soll: Wenn der Seinsbegriff durch die „Wiedervereinigung des Getrennten" inhaltlich gefüllt werden soll, dann steht damit zugleich die Zeitstruktur dessen zur Debatte, was als Getrenntes wiedervereinigt werden soll. Oder anders und ausführlicher gesagt: Das einzelne getrennte Seiende hat je seinen Standpunkt in der Zeit. Wenn nun alles Getrennte wiedervereinigt werden soll, dann müssen auch die getrennten Zeitpunkte
1
.Systematische Theologie', Band II, Stuttgart 1958, S. 15 — 16.
Die Wiedervereinigung des Getrennten und das Problem der Zeit
149
wiedervereinigt werden; dann aber bedarf nicht nur der Oberbegriff „Sein" seiner inhaltlichen Füllung, sondern auch der Oberbegriff „Zeit", der dann die Allsumme aller einzelnen, getrennten Zeitmomente zu seinem Inhalt erhält. Oder noch anders gesagt: Die Integration alles Seienden zum Sein ist, solange das Seiende zeitlich ist, nur möglich, wenn auch alle einzelnen Zeitmomente zur Zeit selbst integriert werden können. Solange wir nun die Zeit mathematisch als Summe aller einzelnen, sich gleichmäßig hinter- und damit wertmäßig nebeneinanderordnenden Zeitmomente verstehen, scheint die Zeitintegration der Seinsintegration gegenüber parallel zu bleiben: Hier wie dort sind einzelne Momente in ihrem Neben- oder Hintereinander zu einem Ganzen zu integrieren. Und Tillich hat die Zeit auch so gesehen: „Man kann das, was in allen Dimensionen Zeit zur Zeit macht, als das Element des „Nacheinander" bezeichnen: Zeitlichkeit ist das „Nacheinander" in jeder Form von Zeit." 2 Doch sobald die existenzialen Ekstasen der Zeit gesehen werden, sobald es sich also um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft handelt, werden die Probleme einer Zeitintegration weitaus schwieriger. Zwar weiß auch Tillich, daß sich in der „Wiedervereinigung des Getrennten" auch diese drei Formen der Zeit wiedervereinigen müssen. Aber ist er sich der daraus entstehenden Probleme bewußt? Wenn nämlich eine Wiedervereinigung alles Getrennten in der Zeit als ganzer möglich sein soll, dann darf es eigentlich keine Zukunft mehr geben: Zukunft bestimmt sich ja dadurch, daß das Zukünftige noch offen ist, daß mit der Zukunft noch ein freier Raum von Möglichkeiten gegeben ist, daß noch nicht alles definit festliegt. Aber wie soll nun das noch völlig Offene, das in seinen Möglichkeiten noch völlig Unbestimmte, das in keiner Weise Definite und Eindeutige zu einer Allsumme aller Zeit integriert werden können? Eine solche Allsumme wäre jedenfalls selbst noch völlig offen, und das heißt, sie wäre selbst in ihrem Inhalt noch völlig unbestimmt und undefinit. Damit fehlte ihr aber jeder abgeschlossene Inhalt, wodurch noch nicht einmal gesagt werden könnte, ob überhaupt eine solche Allintegration gelinge, ja ob sie überhaupt auch nur möglich sei, denn der noch ausstehende Inhalt könnte sie grundsätzlich unmöglich machen. Ja noch mehr: Es gäbe
2
Ebenda, Band III, Stuttgart 1966, S. 358.
150
Günther Keil
also Inhalte, die noch ausstehen und damit noch außerhalb der Allsumme von Zeit sich befanden, wodurch die Allsumme keine ylÄsumme mehr wäre, weil ihr das noch Ausstehende fehlte. Damit setzt aber jede Wiedervereinigung alles Getrennten im Blick auf die Zeit voraus, wenn sie überhaupt als möglich soll gedacht werden können, daß alle Zukunft ihrer offenen Möglichkeiten beraubt und festgelegt ist, daß sie also aufgehört hat, Zukunft zu sein und zur definit festliegenden Vergangenheit geworden ist, daß also alle Zukunft mit ihren offenen Möglichkeiten aufgebraucht, vergangen ist, daß es also in der Allsumme der Zeit gar keine wirklich offene Zukunft mehr geben kann. Mit anderen Worten: Wenn einmal die Wiedervereinigung alles Getrennten in zeitlicher Hinsicht gelungen sein wird, dann kann es nichts mehr geben, was noch aussteht, was also noch nicht in die Allsumme der Zeit integriert ist, sondern außerhalb ihrer steht; dann gibt es aber auch keine Zukunft mehr. Aber die Sache wird besonders theologisch noch viel bedenklicher, wenn gesehen wird, daß Zukunft Leben bedeutet. Wenn Leben heißt, noch Möglichkeiten haben, Totsein dagegen, daß alle Möglichkeiten aufgebraucht sind, dann muß die Wiedervereinigung alles Getrennten zugleich das Ende alles Lebens bedeuten: Da es in ihr keine offene Zukunft mehr gibt, hat nichts in ihr noch Möglichkeiten vor sich, folglich ist alles in ihr tot: Alles in ihr ist definit geworden, nichts mehr hat noch offene Möglichkeiten zu wachsen, sich zu wandeln, kurzum zu leben. Damit aber würde die Ewigkeit als Summe aller Zeitmomente zugleich den Tod alles Getrennten bedeuten, weil nichts mehr offene Möglichkeiten und damit Leben besäße, und ein Begriff wie ewiges Leben würde %u einem Widerspruch in sich selbst. Mit anderen Worten: Das „Sein selbst", Gott, das ewige Leben würde a priori zur Totenstarre. Wie ist diese Aporie zu lösen? Zunächst müssen wir von Tillichs Definition der Zeitlichkeit Abschied nehmen, die Zeitlichkeit als gleichgeordnetes Hintereinander von Momenten versteht und dem konsequenterweise noch hinzufügt: „Die geschichtliche Zeit beruht auf einer entscheidenden Eigenschaft des Nacheinander, nämlich seiner Unumkehrbarkeit." 3 Diese Definition ist schon in ihrem Moment der Unumkehrbarkeit angesichts der Relativitätstheorie nicht mehr haltbar: In der Zeitdilatation kann der Fluß der
3
Ebenda, Band III, Stuttgart 1966, S. 365.
Die Wiedervereinigung des Getrennten und das Problem der Zeit
151
Zeit gedehnt, in bestimmten Situationen auch umgekehrt werden, so daß die Zeit dem Räume darin gleicht, daß eine Rückkehr grundsätzlich möglich ist. Auch die Mathematik der n-dimensionalen Vektorräume fordert eine Gleichbehandlung von Raum und Zeit und damit die grundsätzlich mögliche Umkehrbarkeit auch der Zeit. Deshalb spricht die moderne Naturwissenschaft auch von einem einheitlichen RaumZeit-Kontinuum. Aber der Begriff der Zeitlichkeit als unumkehrbares und (was jetzt auch zur Debatte stehen soll) gleichwertig nebengeordnetes Hintereinander der Momente widerspricht auch unserer alltäglichen Erfahrung: Ich kann mich etwa in der Erinnerung durchaus in ein früheres Jetzt zurückversetzen, also das Hintereinander der Zeitmomente in der Erinnerung durchaus umkehren: Ich lese heute im Jahre 1988 ein Buch Tillichs — sagen wir — aus dem Jahre 1930, das sich mit einem Buch Schellings aus dem Jahre 1807 beschäftigt. Hier schichten sich deutlich verschiedene Zeitläufe mit verschiedenen nicht gleichgeordneten und umkehrbaren Jetzt-Punkten übereinander: Ich lese jetzt im Jahre 1988, 1988 ist also mein Jetzt-Punkt, hinter dem eine Vergangenheit, ζ. B. das Jahr 1987, und vor dem eine Zukunft, ζ. B. das Jahr 1989 liegt. Was ich aber lese, was ich also im Bewußtsein habe, ist ein Buch von Tillich mit seinem eigenen Jetzt-Punkt und seinem eigenen Zeitlauf, der vom Jetzt-Punkt und Zeitlauf meines Lesens unabhängig ist: Tillich schrieb im Jetzt-Punkt des Jahres 1930 (also nicht 1988 im Jetzt-Punkt meiner Lektüre) und hatte dabei seine Vergangenheit, ζ. B. das Jahr 1929 (und nicht 1987 als Vergangenheit meiner Lektüre) und seine Zukunft, ζ. B. das Jahr 1931 (und nicht 1989 als Zukunft meiner Leselektüre). Aber noch mehr: Ich habe bei meinem Lesen nicht nur Tillichs Buch selbst im Bewußtsein, sondern auch den Inhalt von Tillichs Buch, also Schelling; und dieser hat wieder einen eigenen Jetzt-Punkt und einen eigenen Zeitlauf, der von den beiden anderen Jetzt-Punkten und Zeitläufen unabhängig ist: Schelling schrieb im Jetzt-Punkt des Jahres 1807 (also weder 1988 noch 1930), seine Vergangenheit war ζ. B. das Jahr 1806 (also weder die meine noch die Tillichs), seine Zukunft dagegen war ζ. B. das Jahr 1808 (also weder die meine noch die Tillichs). Auf diese Weise erscheint — wenn wir die Relativität auf die einzelnen Zeitläufe mit ihren Jetzt-Punkten außerachtlassen und nur nach der Zeit als solcher fragen — das Jahr 1930 sowohl als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Für mich ist es Vergangenheit, für Tillich Gegenwart, für
152
Günther Keil
Schelling Zukunft, und das alles zugleich und in ein und demselben Bewußtsein, das ein Buch Tillichs über Schelling liest. Daraus folgt: Die Zeitläufe und fet^t-Punkte, die in einem Bewußtsein liegen können, ordnen sich polyphon einander unter, wobei Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft je in den verschiedenen Zeitläufen je eine andere Bedeutung haben können. Man kann dieser Folgerung nur scheinbar dadurch ausweichen, daß man eine durchaus umkehrbare polyphone Zeit der Erinnerung von der unumkehrbaren realen Zeit unterscheiden zu können meint. Indessen: Die Zeit, die mir als real bewußt werden kann, ist immer schon eine erinnerte Zeit, denn die Zukunft kennt keine festgelegten, keine schon real gewordenen Möglichkeiten und damit überhaupt keine definite Realität. Wie soll uns eine reale Zeit anders als als vergangene und damit erinnerte Zeit bewußt werden können? Damit ist sie aber schon immer eine polyphone Zeit, die in verschiedene Zeitläufe, einen des Erinnerns und einen des Erinnerten, aufgespalten ist. Welches ist nun die reale Zeit? Aber vor allem: Welcher Zeitlauf wäre denn nun der reale, demgegenüber alle anderen Zeitläufe zu fiktiven Zeitläufen würden? Wäre es der Zeitlauf des je eigenen Subjektes, also der Zeitlauf, in dem ich selbst lese, schreibe, erlebe usw.? Aber einmal gäbe es dann soviele Zeitläufe, wie es lesende, schreibende, erlebende usw. Subjekte gäbe, also gerade keinen einen einheitlichen, nichtfiktiven Zeitlauf der Realität. Zum anderen Male würde aber das eigene Subjekt zu etwas mir völlig Ungegebenem: Denn ich selbst brauche Zeit, um mein eigenes Subjekt in meinem Bewußtsein denkend zu konstituieren, also mir bewußt zu machen, damit ist es aber als Schlußpunkt meines zeitlich ablaufenden Denk- und Konstitutionsprozesses bei mir selbst schon zur Vergangenheit geworden. Mit anderen Worten: Ich laufe meiner eigenen Gegenwart immer nach wie die Katze ihrem eigenen Schwänze, denn immer, wenn ich Gegenwart denken und erleben will, ist sie für mich als etwas Gedachtes und Erlebtes schon Vergangenheit geworden. Also kann auch mein eigenes Subjekt, mein eigener Jetzt-Punkt nie der Fixpunkt einer realen Zeit sein, weil er mir als wirklicher und nicht bloß erinnerter Jetzt-Punkt gar nicht gegeben ist. Wenn es ferner eine reale Zeit geben sollte, dann müßte sie eine einzige und damit absolute Zeit sein, die alle anderen Zeitläufe als bloß fiktiv sich unterordnen müßte, denn daß 1988, 1930 und 1807 realiter zugleich Gegenwart sein sollte, widerspricht sich. Da also diese eine
Die Wiedervereinigung des Getrennten und das Problem der Zeit
153
reale absolute Zeit, die alle anderen Zeitläufe als bloß fiktive in sich selbst einordnet, nur eine allumspannende, alle anderen Zeitläufe und Jetzt-Punkte in sich einordnende Zeit sein kann, wenn sie nicht wieder wie oben in die Relativistik aller bloß erinnerten Zeit zurücksinken soll, dann kann sie nur die Zeit des transzendentalen Subjekts, also Gottes oder des Seins selbst sein. Mit anderen Worten: Von einer einheitlichen realen Zeit sprechen, die nicht in die Relativistik bloß erinnerter oder bloß möglicher Zeitläufe zurücksinkt, wäre nur dann sinnvoll, wenn sie die Zeit des transzendentalen Subjektes, Gottes, des Seins selbst wäre. Schon Newton war auf ähnliche Folgerungen gestoßen, als er sich hinsichtlich Raum und Zeit mit dem Problem der Relativität auseinandersetzen mußte. Doch gehen wir dem Gedanken von umkehrbaren polyphonen Zeitläufen unabhängig von der Frage nach einer sogenannten realen Zeit näher nach, ob sie vielleicht unser Problem lösen können, wie eine Wiederbringung alles Getrennten hinsichtlich der Zeit möglich sei, ohne daß alles in Vergangenheit, in Zukunftslosigkeit, in die Starre des bloßen definiten Gewesenseins und damit in die Leblosigkeit zurücksänke. Verzichten wir wie die moderne Physik auf den Begriff einer realen Zeit, oder besser: überlassen wir die reale Zeit Gott und legen sie damit ausschließlich in die wiedervereinigte Summe aller Zeit bei ihm, 4 so ergibt sich für die polyphone Relativistik der einzelnen nunmehr gleichwertigen Zeitläufe: Es gibt kraft ihrer gegenseitigen Überschneidungen (siehe oben) jetzt eine vergangene Zukunft und eine zukünftige Vergangenheit·. Wenn ich jetzt im Jahre 1988 ein Tillich-Buch aus dem Jahre 1930 lese, so weiß ich, daß Tillich vom Jahre 1931 als von der Zukunft spricht, die aber für mich im Jahre 1988 längst Vergangenheit ist, das Jahr 1931 erscheint also in meinem Bewußtsein als vergangene Zukunft. Wenn ich nun gar durch Tillichs Buch hindurch an Schelling denke, der im Jahre 1807 schrieb, so ergibt sich: Für Schelling war das Jahr 1808 noch Zukunft, das für Tillich und mich längst Vergangenheit ist. Das Jahr 1808 ist also vergangene Zukunft. Dasselbe wie mit der vergangenen Zukunft läßt sich dann auch mutatis mutandis mit der zukünftigen Vergangenheit zeigen. Allgemein gesprochen: Im Sinne sich gegenseitig relativierender, polyphoner, gleichwertiger Zeitläufe ist es durchaus sinnvoll, von einer vergangenen Zukunft und einer zukünftigen Vergangenheit zu sprechen. 4
Eingehender abgehandelt habe ich diese Fragen in: ,Grundriß der Ontologie', Meisenheim 1981 (2. Aufl. Marburg 1984) S. 21 ff.
154
Günther Keil
Damit kann es aber durchaus vergangenes Leben, vergangene offene Möglichkeiten geben, weil es vergangene Zukunft gibt: Tillich hatte im Jahre 1930 zukünftige Möglichkeiten, die durchaus offen waren und die im Blick auf ihn o f f e n bleiben, auch wenn sie für uns Vergangenheit und damit definit geworden sind. Daß Tillich etwa vor der Zukunft gezittert hat, ist für uns zwar Vergangenheit, die aber Tillichs Zittern nicht unwahr macht, denn bis in alle Vergangenheit hinein bleibt es definit, daß Tillich vor der Zukunft zitterte, es bleibt also definit, daß Tillich damals offene Möglichkeiten gehabt hat. Definite Offenheit, vergangene Zukunft, und das heißt dann auch: vergangenes Leben, vergangene offene Möglichkeiten sind auch in einer Analyse der Zeit keine Widersprüche in sich. Übertragen wir das nun auf Gott oder das Sein selbst als den Allintegrator aller wiedervereinigten Zeitläufe und Zeitmomente: Auch wenn in einer Wiederbringung aller getrennten Zeit alles zur Vergangenheit werden muß, weil sich nur Definites wiedervereinigen läßt, wenn eine Wiedervereinigung soll abgeschlossen werden können, und nur Vergangenes definit ist, so ermöglicht es doch der Begriff der vergangenen Zukunft, daß die Summe aller Zeiten auch Leben in sich enthalten kann und Leben sein kann, daß es also in ihrer Allsumme der Zeit ewiges Leben geben kann. Oder dasselbe konkreter ausgedrückt: Auch wenn für den Blick Gottes im wiedervereinigten Eschaton alles feststeht, alles definit ist, alles gerichtet werden kann, ist und bleibt es dennoch Leben, das in das ewige Leben eingehen kann, weil jede Angst, die durchzittert wurde, einerseits Angst mit ihrer unbekannten Zukunft bleibt, andererseits aber als Angst ins Definite aufgenommen wird. Weil also alles Leben auch in der Allsumme der Zeit lebendig bleibt, aber als Leben in sie als ein Höheres aufgenommen wird, in dem alles definit und damit angstfrei festliegt, gibt es angstfreies Leben, das wirklich Leben ist und bleibt, das aber in den angstfreien Raum des Seins selbst, Gottes aufgenommen worden ist. Doch das sind bereits Konkretionen. Grundsätzlich gilt: Auch wenn die Wiederbringung alles getrennten Seienden %ur Summe alles Seins, £um Sein selbst, Gott zeitlich gesehen scheinbar alle einzelnen Zeitmomente %ur abgeschlossenen Vergangenheit machen müßte und damit alles auf offene Zukunft ausgerichtete Leben aus sich ausschließen müßte, macht es die Polyphonie der Zeitläufe und die Wiederbringung ihrer aller in Gott dennoch möglich, von einer vergangenen Zukunft und damit von einem definiten Leben und damit von einem ewigen Leben sinnvoll s>u sprechen. Damit ist die Logik der Zeit, wie sie zur
Die Wiedervereinigung des Getrennten und das Problem der Zeit
155
Wiedervereinigung alles getrennten Seienden zum Sein selbst Voraussetzung ist, in ihren ersten zur Lösung unseres Problems notwendigen Grundzügen aufgeklärt. Dazu freilich darf Zeit kein starres Hintereinander der Momente sein wie bei Tillich, keine mathematische Zeit gleichmäßig sich ablösender und einander folgender Zeitpunkte. Dagegen hat schon Heidegger polemisiert und zu zeigen versucht, daß Zeitlichkeit tiefer gründe, nämlich in einer existenzialen Zeit. Aber wie stringent auch immer Heideggers Gedanken zur Zeit sein mögen, auf alle Fälle gilt: Wenn a) eine Allsumme von Zeit möglich sein soll — und nur so ist ein Begriff von Zeitlichkeit als solcher möglich — und wenn b) diese Allsumme von Zeit weder Vergangenheit noch Gegenwart noch Zukunft aus sich ausschließen soll — was hinsichtlich einer y4//summe von Zeit Voraussetzung ist — muß c) Zeit polyphon verstanden werden im Sinne sich einander über- und unterordnender gleichwertiger Zeitläufe und Zeitmomente, die sich untereinander durchaus überschneiden, vertauschen lassen und verändern können, denn nur dann kann die definite Allsumme dennoch auch Gegenwart und Vergangenheit in sich enthalten. Wir befinden uns damit gleichsam in einem großen Spiegelkabinett der Zeit, in dem alle Zeitpunkte und Zeitläufe sich einander bespiegeln, sich ineinander verschränken, einander verzerren und auslegen, und erst das Gleißen und Oszillieren des Spiegelkabinettes als Ganzes ist die Zeit. Ein solcher Zeitbegriff ist auch dem naturwissenschaftlichen Denken der Relativitätstheorie angemessen. Damit hat aber auch das Sein selbst als Integral alles Seienden seinen möglichen Inhalt gefunden auch im Hinblick auf die Zeit: Es ist die Ewigkeit als Wiedervereinigung, als Summe aller getrennten Zeitmomente und ihrer getrennten Zeitläufe, die durchaus deren Leben und damit deren Zukunft nicht ausschließt, sondern als ewig bleibende Zukunft und damit ewiges Leben mit integriert.
GABRIEL VAHANIAN
Tillich's Theology of Culture in the Encounter between East and West: Ontology and Utopia If there is a figure of speech Paul Tillich is particularly fond of, it is that of the vertical line which cuts across the horizontal or has been levelled down to the horizontal. Tillich often refers to it. And, of course, it also comes to mind when he speaks of the religious and the secular or of the ontological and the cosmological as well as — and, given his predilection for the kairos, why not? — the soteriological and the eschatological. It underlies his dialectic of being and the new Creation. But, somehow, it also is what prevents him from construing his ontology in any kind of dialectic relation to Utopia — not in the sense of the perfect society and the final solution, but in the sense of faith as eschatic existence and the quest for a new heaven and a new earth. Though Tillich has on many occasions reflected on the meaning of Utopia, he seems nevertheless to have in the main sought to repress the
significance of it and its particular relevance to the sociotechnological revolution of our present situation, both religious and cultural. All the same, and for odd reasons, the idea of Utopia constellates Tillich's thought in what could be loosely called the German phase of its development as well as in its third and last phase, the encounter with the world religions. Which hopefully explains the title of my contribution to this symposium while at the same time linking it to the core of my argument in the previous symposium. It is about time I stated my purpose. It consists: a) in applying Tillich's own method of correlation to the two areas of his thinking which, at first sight, seem not to have much if anything in common, that is, theology of culture and the history of religions, or Christianity and the major religions, in order: b) to show how the correlation of those two areas harbors, even conceals a typically Tillichian preoccupation or,
Ontology and Utopia
157
should I say even more typically, a Tillichian concern, summed up in the following phrase — the Utopian character of Tillich's ontological dialectic, though this character is one that he usually represses. And he represses it for reasons that only become clear in comparing the respective parameters of the Christian encounter with culture on the one hand and, on the other, with the major religions of the world. I propose, accordingly, to deal with this twofold encounter in the first part and, in the second, to take up the Utopian twist of his ontology even by relying on Tillich's analysis of Utopia or, rather, of the spirit of Utopia. I will then conclude with a brief statement trying to show why Tillich does not fully espouse the utopianism with which his thought yet remains so markedly pervaded. And pervaded it is, perhaps, because of one major factor, namely his method of correlation.
In his Systematic Theology, Tillich writes that correlation means: 1) the correspondence of a series of data (as in statistical charts); 2) the logical interdependence of concepts; and 3) the real interdependence of things (Gestalt). Applied to the realm of theology, these three points, respectively, turn into: 1) the correspondence between the symbol and that which is symbolized; 2) the logical interdependence between divine and human concepts, and 3) the real interdependence between the Ultimate Concern and that about which man is ultimately concerned (God or whatever you consider to be God). And then Tillich summarizes all this by stating that the first level of this threefold correlation refers to the central problem of religious knowledge; the second determines statements about God and the finite; and the third qualifies the distinction between God and man. Left out of this summary or, more precisely, what in it is unsaid is no less important: just as the structure of being harbors tensions, so also conflicts are adumbrated at each of the three levels; conflicts and tensions which are resolved in so far as the question of God is implied in finite being, in so far as God is the ground of being. They are, however, resolved not by virtue of some "Aufhebung" or of some "henosis" of hitherto estranged elements such as vertical and horizontal, religious and cultural, already and not-yet, polytheism and monotheism, the Gods of space and the God of time. They are resolved, to be sure, but only while a switch takes place from an exclusive emphasis on the soteriological to an inclusive, eschatological emphasis, to the kairos, to that which at once is kairotic space of time and kairotic moment of space, the embodiment of time and the transfiguration of space.
158
Gabriel Vahanian I.
A. The encounter of religion with culture In Theology of Culture, Tillich writes that, as ultimate concern, religion is "the meaning-giving substance of culture, and culture is the totality of forms in which the basic concern of religion expresses itself. In abbreviation: religion is the substance of culture, culture is the form of religion" 1 . Indeed, depending on what they mean, religion and culture practically cover the same ground. Limited by time, I shall here dwell only on the formal aspects of Tillich's elaboration of the argument condensed in the formula I have just quoted. The terms are indeed polar opposites. But, regardless of whether the polarity is stressed or the tension, three things stand out: a) "In every cultural creation — a picture, a system, a law, a political movement (however secular it may appear) — an ultimate concern is expressed, and ... it is possible to recognize the unconscious theological character of it" 2 . b) On the other hand, culture, which anyhow tends to be identified with the secular, often is all the more erroneously identified with the secular. This situation will prevail so long as the vertical remains overcome by the horizontal, as is now the case. A reconciliation of the vertical and the horizontal rests, however, on the fact that they share in the same predicament 3 . And, more important: c) The secular is in turn and ultimately identified if not with, at least as the bearer of the eschatological. I realize how inappropriate this may sound. I stick to it if only in order to account for the fact that for Tillich what is fulfilled in the heavenly Jerusalem is less the religious realm than it is the secular realm. What is characteristic of the heavenly Jerusalem is that, in it, there is no secular realm and, for that reason, no religious realm either. Now, overagainst these three points, we must also take account of certain vibrations in Tillich's analysis of culture. Overagainst the religion 1
2 3
Religion and Culture, edited by Robert C. Kimbal; Oxford University Press, New York 1959, p. 42. Ibid., p. 9. Ibid., p. 1 1 , 9.
Ontology and Utopia
159
which is the substance of culture, there also stand quasi religions — at once religious and secular if not more secular than religious. So much so that the basic correlation of religion and culture seems to be operated as well as their dialectic seems to be transcended by the secular since, in keeping with the Protestant principle, there is no religious realm per se but in or, rather, even through the secular. So much so that what is at stake in the confrontation of religion and culture (as the seed bed of quasi religions) is what Tillich would call the horizontal, the cosmic God or, again, the eschatological in contrast to an unbalanced if not overwhelming predominance of the soteriological. The Utopian? Not quite, alas! Tillich denounces the vertical being swallowed by the horizontal: this, one can understand. He also denounces the eschatological being swallowed by the soteriological, and this too one can understand. But that he can do both, one does not understand. Briefly put, and at the risk of an oversimplification: Tillich resists Utopia. Constrained as he is
by his own scheme of the vertical and the horizontal, he writes: "Christianity awaits a consumation of history which emerges out of the vertical dimension, beneath whose judgment every historical epoch stands. This excludes utopianism, disappointment and terror, and creates an attitude in which one always looks upward at the same time that one looks forward" 4 . Not to mention the fact that utopianism need not preclude an attitude in which one looks "upward" as well as "forward", Tillich, though he criticizes the overwhelming of eschatology by soteriology, by an otherworldly understanding of faith, seems unwilling to confront the fact that, perhaps, Christianity is not merely a religion of salvation but is focussed on the kingdom of God, on the call to change the world rather than changing worlds. Instead, he points out 5 the erosion of salvation for various reasons such as progress or the conquest of nature and creativity, and seems to bemoan the scientific and technical conquest of time and space, a conquest considered as the road to the reunion of mankind. Rough as these remarks have been, they could be summed up by saying that, with respect to the encounter of religion with culture (and 4
5
Political Expectations, edited by James L. Adams, Harper & Row, New York 1971, p. 94. Theology of Culture, p. 44.
160
Gabriel Vahanian
in a way with quasi religions), Paul Tillich stresses the ontological nature of their confrontation. Faced with the process of secularization and its implications, he puts the emphasis on the vertical, sacral dimension of this confrontation. B. The encounter of religion with the religions Oddly enough, for all its disfigurement and craving, the secular provides for the dialectic of religion and culture, of religion and the quasi religions; it also provides for the dialectic of religion and the religions. To be sure, for an altogether different set of reasons. By contrast with the quasi religions, religion — Christianity — stresses the vertical. Now, Tillich says, by contrast with the religions, Christianity — religion — stresses the horizontal. Indeed, characteristic of the religiously founded political conservatism of the Lutheran churches as well as of the sacramental conservatism of the Catholic churches (sic), the vertical appears now to Tillich as the hallmark of mysticism. He writes that in each of these cases, "the revolutionary impetus of Christianity is repressed and the longing of all creatures for the 'eternal rest in God, the Lord' approaches indifference towards history"; moreover, he adds, Christianity, in its relation to history "includes more polar tensions than Buddhism, just because it has chosen the horizontal, historical line" 6 . In Buddhism, Tillich asserts, "not transformation of reality but salvation from reality is the basic attitude" 7 , while the converse holds for Christianity in which, not salvation, but the kingdom of God is the basic attitude, namely "the will to transform individual as well as social structures" 8 . Tillich goes even further: "The kingdom of God is a social, political, and personalistic symbol. The symbolic material is taken from the ruler of a realm who establishes a reign of justice and peace. In contrast to it Nirvana is an ontological symbol" 9 . Between Nirvana and the kingdom of God the difference is like that between the mystical and the ethical, between compassion and agape, 6
7 8 9
Christianity in the Encounter with the World Religions, York/London p. 7 3 — 7 4 (italics mine). Ibid., p. 73. Ibid., p. 72. Ibid., p. 64 (italics mine).
1963,
Ontology and Utopia
161
between the experience of the holy as being and the experience of the holy as what ought to be10. It is the difference between "the India-born religions and those born of Israel"11. Not that in Christianity there is no room for salvation. Indeed, "in Paul the kingdom of God is identified with the expectation of God being all in all"12, and thus the cosmic God is a saving God. But there is salvation and salvation. And kingdom of God is the name for that kind of salvation of which there is none outside the church, outside the secular dimension of religion. Only in this light does the kingdom of God, as a symbol, have "a revolutionary character"13. Only in this light does Christianity — religion — show "a revolutionary force directed towards a radical transformation of society"14. In order to achieve such an end, of the two possibilities one consists in considering the ideal as having been fulfilled while the other consists in reflecting upon what can be expected, what can be hoped for on the basis of present reality 15 . As for the difference between these two possibilities, even Paul Tillich, it seems to me, would have a hard time spelling it out: if the first is Utopian in so far as it is consistently worked out, the second, for being dialectical, seems no less Utopian, indeed. Tillich cannot have his cake and eat it too. Nor can religion — whether in its confrontation with culture and the quasi religions or with the religions tout court. If the secular is what religion — from its own standpoint — has in common with culture and if, on the other hand, the secular is again what religion — from its own standpoint — has in common with religions (and the secular appears today in the guise of technology 16 ), then Utopia cannot both legitimate the expectations of the secular realm and be dismissed in the name of the religious realm — except at the cost of an oversight if not of inconsistency. Put differently, the ontological nature of the confrontation of religion with culture has the same roots, the same moorings, the same import as does now the eschatological nature of the confrontation of religion with the religions. To the question raised in either type of confrontation, Ibid., p. 58. Ibid., p. 59. ι 2 Ibid., p. 68. 13 Ibid., p. 72. 14 Ibid., p. 72. 15 Political Expectations, p. 97. 16 Christianity in the Encounter with the World Religions, p. 12. 10 11
162
Gabriel Vahanian
"How to communicate the Gospel?" Paul Tillich gives a strictly identical answer: not by the victory of one religion over the others — ultimately, of one religion among others — but by confronting those to whom the question is addressed with the choice of saying Yes or No. Or else Christianity, or for that matter religion, could not break through its own particularism17. It would trade religion for the religions, the ultimate concern for a final solution, or the spiritual for the material and the material for the spiritual as if, unlike the religious and the secular, they were in each case two separate realms. Even for Tillich, Utopia — as unity, as dialectic of being and meaning, of means and ends, of doing and making, of time and space, of ontology and eschatology — Utopia overcomes the separation of spiritual and material, of religion and culture, of religion and the religions as well as the quasi religions18. Nor is it any wonder that, late in his life, he is reported to have said that his Systematic Theolog) should be re-thought in terms of this new framework. A sketch of this framework can be found, to be sure, in his theology of culture as well as in his approach to the world religions. It also is adumbrated in his analysis of Utopia. II. In The New Being he writes: "The New Creation — this is our ultimate concern; this should be our infinite passion — the infinite passion of every human being. This matters; this alone matters ultimately. In comparison with it everything else, even religion or non-religion, even Christianity or non-Christianity, matters very little — and ultimately nothing"19. In the same vein, he acknowledges in The Political Meaning of Utopia that, "if Utopia is something other than worthless fantasy, it must have a foundation in the structure of man himself, for in the last analysis only that has significance which has a foundation in the structure of man"20. And man is that being which has possibility: there is nothing 17 18 19 20
Ibid., p. 97. Political Expectations, p. 47. The New Being, Scribner, New York 1955, p. 19. Political Expectations, p. 125.
Ontology and Utopia
163
given that man is not able to transcend — in principle; but that he cannot always do so in fact is the problem of his finitude, a problem that stems from the fact that he does not act as a whole person, as a centered person, but that he acts as a tempted person, a person who sees these possibilities not as opportunities for honoring them but as temptations: indeed, freedom is not only a possibility, it also is a temptation. It is a mixture of being and non-being, of anguish and hope, resolved either by the refusal of essence (Sartre, Nietzsche, Barth) or by the refusal of norm, which for Tillich amounts to the same. And for him to eliminate essence is to render Utopia impossible21. Clearly, for Tillich, "the concept of Utopia is dependent upon a distinction between what man essentially should and could be and what he existentially — that is, actually — is"22. And what is it that man could essentially be if not a new man, a new being, a new creation? From this perspective, "the principle of all Utopias is the negation of the negative — the representation of a condition as once present or once again to be present, in which the negative side of existence is negated, in which this negative side was not yet real or is no longer real"23. Now, finitude and estrangement being the two fundamental experiences of this negative side of existence, Utopia is therefore represented: a) as the conquest of death (immortality, reincarnation, resurrection); or b) as the overcoming of estrangement (reunion with nature, salvation, or healing); or again c) as the social Utopia where Utopia consists in denying not the power structure of society but the ruling structure experienced as usurped authority, as exploitation, in other words as denial of love and justice, these two poles of the Christian Utopia, namely of d) the kingdom of God — or the Western, Christian conception of Utopia corresponding "to an essentially different historical consciousness ... a Utopia (as in Augustine, for instance) which brings about the restoration of unity with the ground of being, through the vision of God." It is, Tillich adds, this kind of utopianism which, from the Jewish Prophets to Protestantism, incorporates a and b while correcting c on an important issue. "I believe," he says, "that the prophets with their symbols of peace within nature and peace among men as a unity were more realistic than are the pacifists and 21 22 23
Ibid., p. 138. Ibid., p. 141. Ibid., p. 155.
164
Gabriel Vahanian
socialists who expect peace among men without peace within nature, for man after all is part of nature"24. That man is part of nature means for Tillich simply one thing: there is no strictly religious Utopia. Nor is there any strictly political or economic Utopia. Just as, being part of nature, man transcends man, so also life is transcended by life. And Utopia entails its own transcending — vertically as well as horizontally, through the irruption of the divine in history (apocalypse) or beyond history (union with God). However, "a kingdom of God that is not involved in historical events, in Utopian actualization in time, is not the Kingdom of God at all but at best only a mystical annihilation of everything that can be 'kingdom' — namely, richness, fullness, manifoldness, individuality. And similarly, a kingdom of God that is nothing but the historical process produces a Utopia of endless progress or convulsive revolution whose catastrophic collapse eventuates in metaphysical disillusionment"25.
III. Unlike Barth wo splits faith and religion, Tillich would not keep asunder what God has put together: the religious and the secular. If like Bultmann, on the other hand, Tillich would yield to the need for demythologization, he would consider the latter process in terms, alas, of secularization — instead of desacralization. By contrast with Bultmann, Tillich cuts indeed quite a sacramentarian figure. He writes: "The universe is God's sanctuary. Every workday is a day of the Lord, every supper a Lord's Supper, every work the fulfillment of a divine task, every joy a joy in God". And when he adds that "the religious and the secular are not separated realms ... they are within each other" 26 ,1 think such statements make more sense in terms of the New Being than they do in those of Being; they make sense in terms of the utopianism of the human reality, in terms of the Utopian — ethical — paradigm of religion rather than in terms of the sacral — mystical — paradigm of religion.
24 25 26
Ibid., p. 163. Ibid., p. 179. Theology of Culture, p. 13.
JOACHIM RINGLEBEN
Symbol und göttliches Sein Es sollen hier einige Beobachtungen und kritische Erwägungen zu Tillichs frühem Symbolverständnis mitgeteilt werden, die sich an signifikanten Zitaten aus dem „System der Wissenschaften" (1923) und der „Religionsphilosophie" (1925) orientieren 1 . Das Textmaterial läßt sich unter vier Aspekten ordnen, deren A b f o l g e sukzessive die Problematik der Tillichschen Konzeption enthüllen und in drei kritische Schlußthesen münden wird.
1. Uneigentlichkeit „Die Metaphysik will das Unbedingte erfassen. Sie kann es aber nur erfassen in den Formen des Bedingten. Das ist die tiefe Paradoxie, die ihr innewohnt. ... Nennt man einen Begriff, der etwas anderes ausdrücken soll als seinen eigentlichen, unmittelbaren Sinn, ein Symbol, so müssen sämtliche metaphysischen Begriffe als Symbole bezeichnet werden". (I 254) Die am Beispiel metaphysischer Begriffe aufgedeckte „paradoxe" Verfassung gilt nach Tillich f ü r die Struktur aller Symbole überhaupt,
1
In beiden Schriften (cf. Gesammelte Werke, Band I, 109 ff. und 295 ff.) finden sich die ersten theoretisch grundlegenden Äußerungen zum Symbolbegriff, sieht man von zwei beiläufigen kurzen Erwähnungen 1921 (II 71) und 1922 (VI 9) ab. In Tillichs frühen Schellingarbeiten findet sich der Begriff m. W. nicht. Auf Cassirers großes Werk über die „Philosophie der symbolischen Formen" (1923—29) nimmt er zum ersten Mal 1928 in seinem ersten thematischen Aufsatz „Das religiöse Symbol" Bezug (V 202 ff.). Sucht man nach einer möglichen Herkunft des Begriffs bei Tillich und sieht von allgemeinen Einflüssen, wie sie auf ihn von Kants „Prolegomena" (§ 57) und „Kritik der Urteilskraft" (§ 59 u. ö.), von Hegels „Ästhetik", von de Wette und Fries ausgegangen sein könnten, ab, so scheint es
166
Joachim Ringleben
sofern sie das Unbedingte irgendwie im Bedingten zum Ausdruck bringen. Dabei stellt sich zuerst die Frage nach dem Sinn dieses „in den Formen des Bedingten". Die Wendung suggeriert ein gleichsam räumliches Verhältnis zwischen dem, worin etwas ist („Formen") und dem, was darin sein soll. In der Tat hat Tillich sich ständig des Schemas Form-Gehalt bedient, um das Beisammensein(können) von Bedingtem und Unbedingtem vorstellig zu machen. Bei diesem Schema fallt aber sogleich auf, daß es schon als solches die Ergänzungsbedürftigkeit jedes seiner Terme durch den anderen voraussetzt. D. h. es ist eigens dazu aufgestellt, um zwei Einseitige durch ihren Zusammenhang zu komplettieren. Ob derart undialektisch-äußerlich das Verhältnis des Unbedingten zum Bedingten nicht nur soll vorgestellt, sondern gedacht werden können, erscheint fraglich. Was ist also der sachlich-logische Sinn jenes „in"}2 Das Zitat erlaubt, in dieser Frage ein wenig klarer zu sehen. Tillich notiert am symbolischen Begriff eine Unterscheidung: jeder Begriff drückt zunächst und als solcher seinen eigentlichen, unmittelbaren Sinn aus, und nur, insofern er dabei auch noch etwas anderes ausdrücken „soll", kann er ein Symbol genannt werden3. Es handelt sich dabei um eine aktuelle Koinzidenz: indem der Begriff seinen unmittelbaren Sinn ausdrückt, drückt er zugleich noch einen anderen mit aus. Das aber bedeutet:
mir besonders nahezuliegen, auf Rudolf Ottos Rede von symbolischen „Ideogrammen für ein ineffabile" zu verweisen (cf. Das Heilige, 1917, 1963 35 , 28; auch Ottos hier gebrauchte Beispiele für metaphysische Symbole (Fichte und Schopenhauer) finden sich bei Tillich in diesem Zusammenhang häufig: ζ. Β. I 314, 164). Übrigens nimmt Tillich R. Otto auch ausdrücklich als Vertreter der Symboltheorie in Anspruch (V240)! Er lernte das Buch 1918 kennen und berichtet am 9 . 5 . 1 9 1 8 darüber begeistert und in einschlägiger Weise an E. Hirsch (Ges. Werke, Erg. Bd. VI, 123 ff.). 2
3
Keinesfalls dürften doch die Formen, „in" denen das Unbedingte als solches soll „erfaßt" werden können, sich der Verwechslung aussetzen mit „the mouse-trap": „the thing, wherein Fill catch the conscience of the Ring" (Hamlet III, 2 und II, 2). Auch Ullichs beliebte Formulierung, Religion und Kultur seien Dimensionen, die nicht „nebeneinander", sondern „ineinander" liegen (cf. I 331, schon 380 u. ö.), muß sich der präzisierenden Frage stellen, inwiefern nicht jedes „ineinander)" immer noch (auch) ein „neben(einander)" ist. I 282 spricht er von der Spannung zwischen unmittelbarer „Ausdrucksform" und eigentlich, d. h. hier mittelbar, gemeinter „Intention".
Symbol und göttliches Sein
167
der Sinn-Ausdruck ist an sich selber, d. h. schon formal, zweisinnig 4 . Symbolisch ist er, indem er er selbst nur ist zusammen mit einem Anderen; er hat dies Andere schon an ihm selbst. „Da nun aber das Bewußtsein keine anderen Formen hat als die bedingten, so muß es diese benutzen, um das Unbedingte darin auszudrücken, d. h. es muß die wissenschaftlichen Begriffe symbolisch, nicht eigentlich verwenden." (I 302 f.)
Nach den Klärungen des vorhergehenden Zitates sollte man hier besser lesen: um das Unbedingte „daran" auszudrücken. Das Ausdrükken des Unbedingten am Bedingten, an seinen Formen ist selber nur als Formunterschied bzw. -modifikation begreifbar. Nicht ein Gehalt strömt „in" eine für sich leere Form ein, sondern an vorhandenen Formen manifestiert sich ein Anderes, d. h. als Form. Symbolizität ist ein formaler Selbstunterschied. Insofern gilt die Behauptung am Beginn des Zitates: „keine anderen Formen" — wenn überhaupt! — nur vor und abgesehen von der Manifestation des Unbedingten an ihnen. Freilich könnte man von den Formen, an denen das Unbedingte erscheint, nicht mehr sagen, daß das Bewußtsein sie „hat". Daß auch Tillich mit Symbolhaftigkeit eigentlich eine Formbestimmung meint, zeigt das folgende Zitat, bei dem die zweite Formulierung durch die erste zu interpretieren ist: „Das allgemeine Merkmal der Symbolkräftigkeit ist der ekstatische Charakter, die Erfülltheit mit dem Gehalt des Unbedingten ..." (I 337)
„Ekstase" kann eben nur als eigentümliche Formdialektik und nicht anhand eines Form-Inhalt-Schemas beschrieben werden 5 . Dafür, daß es sich um einen Selbstunterschied der Form, ihr eigenes Anderes an ihr selber, handelt, ist die kürzeste Formulierung Tillichs: „Durchbrechung der Form unter Anerkennung der Form" (I 338)6. 4
5
6
So mit Recht J. Simon: „Seiendes, das seine Identität dadurch erreicht, daß es über sich hinausweist, ist ein Zeichen." (Das Problem der Sprache bei Hegel, 1966, 139). So ist nach Tillich jedes heilige Sein „ein ekstatisches Sein, d. h. ein solches, das aus seiner unmittelbaren Formung heraustritt; es hat ein inneres Transzendieren ..." (I 336). Cf. dasselbe in der Anwendung auf Gott: V 207. Vielleicht noch deutlicher wird das bei der paradoxen Gnade: „sie bricht durch die unmittelbare Form hindurch, aber sie hat keine eigene Form." (I 337) Cf. auch I 335: „der ... die vollendete Weltform durchbricht und doch niemals eine eigene Form neben ihr ist" (cf. 364).
168
Joachim Ringleben
2.
Selbsttransäenden^
Geht es bei der Symbolhaftigkeit um eine dialektische Bestimmtheit an der Form von etwas, so muß die Form an sich selbst ihr Anderes sein, d. h. sie muß sich negieren. „Der heilige Gegenstand ist also nie an sich, sondern nur durch Negation seiner selbst heilig." (I 335 f.)
Heilig ist etwas nur im Selbstunterschied: es weist auf ein Anderes hin, indem es zugleich verneinend auf sich selber verweist. Die Formdialektik des Symbols ist Selbstnegation 7 , diese aber als (indirekter) Verweis auf ein Anderes. Das führt zu der wichtigen Frage, in Kraft wessen solche Selbsttranszendenz als Vergegenwärtigung des Andern möglich ist. Hierzu lassen sich weitere Hinweise einem Text entnehmen, der von dem zentralen kultischen Symbol handelt: „Opfer ist Hingabe des Bedingten an das Unbedingte. Voraussetzung der Vereinigung mit dem Unbedingten ist Selbstentäußerung des Bedingten, Aufhebung der bedingten Formen und ... Relationen. Wo sie geschieht, ermöglicht sie das Erfiilltwerden mit den Kräften des Unbedingten ...". (I 357)
Soll in diesem Zitat die wirkliche Vereinigung von Unbedingtem und Bedingtem begriffen werden und ist — wie wir gesehen haben — die Metapher des „Erfüllens" als ein sich Darstellen an den bedingten Formen zu verstehen, so muß die „Aufhebung der bedingten Formen" bereits die Erscheinung des Unbedingten an ihnen sein, ihre Selbstnegation selber schon die Selbstsetzung des Unbedingten und die „Selbstentäußerung des Bedingten" zugleich auch die des sich daran manifestierenden Unbedingten. Etwas wird zum Symbol, insofern es sich derart negiert, daß diese Selbstnegation die indirekte Präsenz des Positiven ist, inkraft dessen sie allein möglich wird. Selbsttranszendenz des Bedingten ist aktuell identisch mit der Selbstvergegenwärtigung des Unbedingten. Diese hier interpretierend erschlossene, für alles weitere entscheidende Einsicht wird durch die folgenden Zitate verstärkt. Für die Theologie des Paradoxes kommt es darauf an, „in dem eigenen Symbol das Nein des Unbedingten gegen jedes Symbol anzuschauen." (I 346) 7
Daß entsprechend ein Symbol nur als Symbol funktioniert, indem es sich in seiner Unmittelbarkeit selber negiert, sagt ausdrücklich V 243.
Symbol und göttliches Sein
169
Denkt man dieses Zitat mit dem ersten in diesem Abschnitt (I 335 f.) zusammen, so ergibt sich die aktuelle Koinzidenz von Selbstnegation (des symbolischen Gegenstandes) und eigenem Nein des Unbedingten (gegen ihn). Weil das Symbol als Selbstverneinung des Bedingten in seiner Unmittelbarkeit und Selbständigkeit zugleich dessen Negation durch das Unbedingte und so positives Sichsetzen des Unbedingten ist, ist sein Nein zu sich selber nur inkraft der Selbstbejahung des Unbedingten möglich, das als indirekt präsent erfahren wird. Die Selbstnegation des Bedingten ist nur wirklich als Selbstsetzung des Unbedingten an ihm. Daraus folgt: das Symbol ist nichts anderes als Selbstvergegenwärtigung des Unbedingten am Bedingten (bzw. als dessen Selbsttranszendenz) und das Unbedingte ist das Symbol als Symbol (bzw. insofern es wirklich lebendig ist). Ein Symbol ist nie so etwas wie ein Abbild des Unbedingten, sondern das sich aufhebende Medium von dessen aktueller Selbstdarstellung. Das wirkliche Symbol ist permanente Selbsttranszendenz: eine dialektische Einheit von Negation und Position, Uneigentlichkeit und Selbstmächtigkeit, wobei Einheit sich lebendig in Unterscheidung zersetzt und Unterschied sich lebendig in Einheit aufhebt. (Die von Tillich häufig abgelehnte Rede „nur ein Symbol" hat an dieser wesentlichen Indirektheit einen sachlichen Anhalt, insofern ein Symbol eben zum Symbol wird, indem es qua Selbstaufhebung seiner Unmittelbarkeit ein „nur" an sich selber zur Darstellung bringt.) Auch muß wohl die zitierte Formulierung Tillichs gegen Mißverständnisse noch präzisiert werden. Denn das Nein des Unbedingten wird nicht so sehr „in" einem Symbol angeschaut als vielmehr „an" ihm, d. h. als es. Dieses Nein richtet sich daher auch nicht gegen das Symbol, sondern gegen dessen (vor- bzw. außersymbolische) Unmittelbarkeit als Bedingtes. Indem diese negiert wird, ist es gerade als Symbol. Kraft des Nein des Unbedingten gegen das, was am Symbol (noch) nicht Symbol ist, wird gerade ein Symbol zu einem solchen. Entsprechendes gilt für das verwandte Zitat: „Aber es ist die Tiefe der religiösen Gewißheit, daß sie auch die Gewißheit ihrer eigenen Symbole unter das Nein stellt, um keinem Bedingten die Würde der Unbedingtheit zu gewähren." (I 356)
Kein Bedingtes ist als solches ein Symbol. Vielmehr ist die eigentümliche Gewißheit eines Symbols in der Erfahrung seiner als Symbol, d. h. als Vergegenwärtigung unbedingten Neins gegen etwas Bedingtes,
170
Joachim Ringleben
begründet. Solcherart unterscheidet gerade das Symbol die Würde der Unbedingtheit vom bloß Bedingten, indem es jene an diesem zur Geltung kommen läßt. Bereits hier scheint Tillich seine eigene Symbolkonzeption preiszugeben zugunsten der Behauptung einer abstrakten Diastase von Bedingtem und Unbedingtem, die im „Symbol" gerade kritisch vermittelt bzw. konkret ausgetragen werden sollte8.
3. Symbol des
Sjmbolseins
Das Gesagte gilt umsomehr, als Tillich selber mit Symbolen rechnet, die im gesteigerten Sinne Symbol sind, insofern sie an sich selber darstellen, was ein Symbol zum Symbol macht, d. h. das Symbolsein selbst thematisieren. „... ein Symbol, das die religiöse Paradoxie zu vollendetem Ausdruck bringt: das Symbol des göttlichen Mittlers. Das Endliche, Bedingte, das in paradoxer Weise Träger des Unbedingten ist und um deswillen sich selbst als Endliches aufhebt, die Anschauung des menschgewordenen, niedrigen und sterbenden Gottes ist das eigentliche religiöse Mysterium, das kaum einer Religion ganz fehlt ... und im Christentum zu entscheidender religionsgeschichtlicher Würde erhoben ist." (I 345)
Hier ist ein spezifisch theologischer Begriff vom Symbol überhaupt formuliert, insofern das Symbol als sich selbst aufhebender Ort der Kondeszendenz des Unbedingten gedeutet wird9. Das Mittler- bzw. Christus-Symbol ist dasjenige Symbol, das die christologische Struktur jedes Symbols überhaupt zur Anschauung bringt. Im christologischen Symbol — als Symbol des Symbolseins selber — wird ausdrücklich, daß Selbstaufhebung des Bedingten an sich schon die Selbstvergegenwärtigung des Unbedingten ist. 8
9
Eine falsche religiöse Verabsolutierung des Symbol-Stoffes („Dämonisierung") dürfte kaum — wie bei Tillich — durch Rekurs auf eine abstrakte Transzendenz des Unbedingten auch gegenüber jedem Symbol noch — als Symbol ist es doch eben ein sich Negierendes! —, sondern gerade aus der wirklichen Selbstsetzung und -vergegenwärtigung des Unbedingten im Symbol, ja als Symbol, zu erklären sein. Bei Tillich ist dagegen immer wieder ein Schwanken zu beobachten zwischen einer Bejahung des Symbols als Erfahrung wirklicher göttlicher Gegenwart und abstrakter Behauptung von deren Unerreichbarkeit. Cf. den Terminus „Selbstentäußerung" in der oben zitierten Stelle I 357! Zur Bedeutung der „Inkarnation" für die Symboltheorie cf. auch V 242.
Symbol und göttliches Sein
171
Ist derart das zentrale christliche Symbol der Schlüssel zum Verständnis aller religiösen Symbole überhaupt, so scheint Tillich andernorts diese entscheidende systematische Bedeutung des sich selbst thematisierenden Symbols für seine Symboltheorie wieder außer acht zu lassen. „Nur die speziellen Kultformen sind symbolisch ... Aber auch sie, das Gebet um Vergebung der Sünden wie die andächtige Einigung mit dem sich gnadenvoll hingebenden Gott, steht wie alles Handeln und alles Erkennen und alles Wirkliche unter dem Nein des Unbedingten." (I 361)
Würde mit der Erkenntnis ernstgemacht, daß das Mysterium des sich gnadenvoll hingebenden Gottes für eine Vereinigung von Bedingtem und Unbedingtem 10 , d. h. für das funktionierende Symbol, konstitutiv und strukturell notwendig ist, weil es die lebendige Wirklichkeit des Symbols in der Dialektik von Selbstaufhebung des Bedingten im Zuge unbedingter Selbstsetzung Gottes begründet, so könnte eben dieses spezifische Symbol wegen seiner systematischen Auszeichnung (als Symbol der Symbolhaftigkeit überhaupt) nicht so abstrakt negiert werden, wie Tillich es hier tut. Will der zitierte Satz mehr besagen, als daß Gottes subjektive Lebensbewegung — als Bedingung jeder wirklichen Symbolkräftigkeit — an kein einzelnes Symbol als solches gebunden ist, so daß sie darin sich gleichsam erschöpfte, sondern unendlich darüber hinaus sich vollzieht, so ist er als Rückfall in eine undialektisch-subjektive Position zu beurteilen. Die abstrakte Diastase eines Nein des Unbedingten allem Erkennen, Handeln und Wirklichen gegenüber wäre doch in Tillichs eigentlicher Symbolkonzeption gerade vermittelt. Der indifferenten Negativität eines nur unerreichbaren bzw. ungegenwärtigen, also rein jenseitigen Unbedingten entspricht in solchen Formulierungen eine festgehaltene Endlichkeit, zu deren religiöser Uberwindung eben der Symbolbegriff eingeführt worden ist. Jedenfalls machen diese Beobachtungen zu Tillichs These von einem Symbol der Symbole auf die wichtige systematische Frage aufmerksam: inwiefern auch mit Symbolen zu rechnen ist, die das Symbolsein selber thematisieren und was ihr Vorkommen für die Logik der Symbolisierung überhaupt besagt. Es lassen sich von hier aus mindestens drei Desiderate der Tillichschen Symboltheorie formulieren, die sie als Theorie noch zu
10
Cf. zum Terminus „Vereinigung" im Zitat I 357 schon oben im Text!
172
Joachim Ringleben
erfüllen hätte: a) was läßt sich über das Verhältnis des Symbolisierten zum Symbolisierenden vom Symbolisierten selber her sagen, bzw. welche Annahmen über dies Verhältnis sind in Tillichs Aufstellungen zum Symbol immer schon eingegangen? b) Läßt sich die Unterscheidung von Arten, Graden und Stufen des Symbolisierens noch weiter ausarbeiten, d. h. ist eine systematische Entwicklungsgeschichte des Symbols (einschließlich von Thesen über deren Gesetze und Subjekt!) möglich? 11 c) Wie ist die Möglichkeit eines (paradox) absoluten Symbols — für Tillich Christus, der Mittler — zu denken?
4. „Vom Unbedingten her" Die bisherige Erörterung von Tillichs Symbolkonzeption hat zu zeigen versucht, daß das Symbol nur zu verstehen ist, wenn die an ihm aktuelle Selbsttranszendenz zugleich als eine Selbstvergegenwärtigung des Unbedingten am Bedingten begriffen wird, das sich nur selbst negieren kann in kraft jener Präsenz unbedingter Selbstsetzung. Ein Symbol als solches erfahren, heißt danach immer, eine Manifestation unbedingter Selbstdarstellung (Subjektivität) zu erfahren: das Unbedingte erscheint (indirekt) als es selbst, indem das Bedingte selbst sich aufhebt. Die ein Symbol konstituierende Selbstnegation ist die Aktualität unbedingter Negativität und Selbstsetzung selber. „... die vollendete Einheit der Sinnformen, die ... für die Religion aber Symbol [ist], das v o m Unbedingten her zugleich bejaht und verneint wird." (I 329)
Soll ein solcher Satz nicht eine bloß subjektive — und insofern gerade äußerliche — Reflexion über das Verhältnis von zwei objektiven Instanzen (genannt: das Unbedingte und das Bedingte) sein, sondern den Begriff des Unbedingten selbst formulieren, müssen Bejahung und Verneinung als Realisationen des Unbedingten selber und von ihm her begriffen werden. Nicht schon, indem zwei Eigenschaften bloß faktisch einer Instanz zugeordnet werden, sondern erst indem sie als darin sich selber aktiv setzend bzw. vollziehend gedacht wird, wird sie als sie selbst gedacht. 11
Tillichs Typologien der Religionsgeschichte könnten dafür wohl ausgewertet werden.
Symbol und göttliches Sein
173
Das allzu umstandslose Reden „vom Unbedingten her", das K. Barth an Tillich meinte kritisieren zu müssen 12 , impliziert zumindest die Nötigung, dieses, von dem her zu denken möglich sein soll, darum auch als es selbst zu thematisieren. Für ein ausweisbares Reden „von ... her" wird prinzipiell die Frage unabweislich sein, wie (unter welchen Bedingungen) denn zu dem hin zu gelangen ist, damit daraufhin mit Sinn „von ihm her" gedacht werden könne. Kurz gefaßt: kann es, rein logisch schon, ein solches „von ... her" ohne ein es ermöglichendes „hin ... zu" überhaupt geben? Im spezifischen Falle des „Unbedingten" dürfte einleuchtend sein, daß wir überhaupt nur darum „von ihm her" zu reden versuchen können, weil und insofern es selber von sich „her" dies ermöglicht. Eben diese Ermöglichung zu thematisieren, ist aber der theologische Symbolbegriff geeignet. Denn am Symbol ereignet sich die vermittelte Erfahrung vom Unbedingten selbst und dies als die „Negativität des Unbedingten gegen jede Form" (I 347), d. h. selbsttränszendente Formdialektik. Vom Symbol her läßt sich Gottes Subjektivität nur als absolute Form 13 bzw. Formtätigkeit denken, weil unbedingte Subjektivität sich als selbsthafte (indirekte) Manifestation an den bedingten Formen allein darstellen kann. Der zitierte Satz belegt denn auch die Gefahr, statt die selbsthafte Dialektik des Unbedingten selber zu exponieren, nur eine äußerliche Zuschreibung vorzunehmen, wenn man sich — gegen seinen Wort-
12
13
Cf. VII 231 f. Freilich ist bei Barth selber eine ähnliche Unvermitteltheit zu konstatieren, mit der er meint, „von der Offenbarung her" denken und argumentieren zu können (cf. K D 1/2, 309, 316, 328 u. ö.; § 17), so daß die oben geäußerten methodischen Fragen ebenso an ihn zu stellen wären. Die von Barth Tillich a. a. O. vorgeworfene „dogmatische Setzung eines ersten Prinzips" scheint für ihn ähnlich zuzutreffen, so daß Hegels Kritik an einem Denken, das „wie aus der Pistole geschossen" mit dem Absoluten beginnt (Phänomenologie, 26; Logik I 51), beiden Theologen gegenüber in Geltung bleibt. Daß Tillich den Gedanken einer „unbedingten Form" für unvollziehbar widersprüchlich hält (cf. I 319 mit 227, 217 u. ö.), spiegelt nur wider, daß „Form" von ihm immer schon als unselbständige Hälfte, d. h. endlich konzipiert ist. Unbedingt kann die Form nur als sich selber bestimmende, d. h. zugleich endliche und unendliche Tätigkeit, die in der Selbstunterscheidung ihr eigenes Anderes ist und übergreift, gedacht werden. Form ist unbedingt als dialektisch an sich selber; als Subjektivität. Ist die Form unbedingt als sich selbst bewegende (Form als Selbstbewegung schlechthin), so läßt sie sich einem „unbedingten Gehalt" bzw. seiner Abgründigkeit gegenüber nicht einfach nur als Gegensatz fixieren.
174
Joachim Ringleben
laut — klar macht, daß ein Symbol doch gerade in Verneinung und Bejahung „vom Unbedingten her" als Symbol zustandekommt und ist und eben darum nicht selber wieder als Symbol „bejaht und verneint" werden kann. Ähnliche Bedenken gelten auch für den folgenden Text. „Auch die universale Synthesis ist keine Gegebenheit, sondern ein Symbol. Im wahren Symbol wird die Realität erfaßt; aber Symbol ist die uneigentliche Ausdrucksform, die immer da notwendig ist, w o ein eigentlicher Ausdruck wesensmäßig unmöglich ist. Der symbolische Charakter der religiösen Vorstellungen nimmt ihnen also nichts von ihrer Realität, aber er hebt diese Realität aus der bedingten in die unbedingte, d. h. in die religiöse Sphäre." (I 328)
Daß im wahren Symbol als solchen „die Realität erfaßt" wird, kann nach unseren bisherigen Analysen in dieser Konzeption nur darum behauptet werden, weil sie sich an ihm (dem Symbol) selber darstellt. Insofern ist das Symbol wohl auch besser eine indirekte als eine „uneigentliche" Ausdrucksform zu nennen (s. u.). Denn das Symbol ist gerade da ein „eigentlicher Ausdruck", wo ein direkter „wesensmäßig unmöglich" ist: nämlich wo es um das Unbedingte selbst und als ein solches geht (wie bei jedem Selbst als solchem!). Der symbolische Charakter nimmt den religiösen Vorstellungen eben darum nichts von „ihrer" Realität, weil das Unbedingte als es selbst gerade die Bewegung des Sichsetzens im Sichaufheben des Bedingten 14 , d. h. das Symbol als Symbol, ist. In diesem Sinne hat Tillich völlig recht, gegen die Redeweise „nur ein Symbol" zu protestieren 15 , wenngleich manche seiner eigenen Formulierungen, wie daß auch die Symbole noch unter dem Nein des Unbedingten stehen (s. o.), dem selber Vorschub zu leisten scheinen. Das Fazit dieser Überlegungen lautet: nur wenn die Ungegenständlichkeit des Unbedingten auch von ihm selber her zur Geltung gebracht wird, erliegt der „das Unbedingte" Denkende nicht dem Zwang, es trotz erklärter Absicht doch selber wieder zu „vergegenständlichen" 16 . 14
15
16
Man darf daran erinnern, daß das Wort das „Un-bedingte" selber seine positive (eigentliche) Intention nur indirekt (durch Negation vermittelt) ausspricht. Cf. V 220 u. ö. I 254 ist von der Adäquatheit und Gewißheit der metaphysischen Symbole die Rede. Das unbedingt Transzendente ist v o r Vergegenständlichung nicht dadurch schon geschützt, daß es abstrakt-negativ als etwas bestimmt wird, „das in gleicher Weise das Sein-an-sich und das Sein-für-uns überschreitet" (V 206), sondern erst wenn realisiert wird, daß es sein Ansichsein darin überschreitet, daß es sich selber (für
Symbol und göttliches Sein
175
Das aber entscheidet sich daran — und Tiliich scheint selber jener Gefahr nicht immer entgangen zu sein —, ob die Selbsttranszendenz der Symbole als wirkliche Selbstmanifestation des Symbolisierten konsequent gedacht wird. Sagt Tillich (in einem späteren Text) von den religiösen Symbolen: sie „haben einen Gegenstand auszudrücken, der wesensmäßig jede Gegenständlichkeit transzendiert" (V 197) — so wird die kritische Kraft dieser Einsicht nur dann nicht um ihre Wirkung gebracht, wenn das Transzendieren jeder Gegenständlichkeit streng als die Ungegenständlichkeit der Symbole selber begriffen wird 17 , die eben die Aktualität der Sache selbst und als Selbst lebendig darstellen. Nur vom Symbol als solchen her kann darum — unter Tillichs eigenen Bedingungen — die wirkliche Subjektivität Gottes gedacht werden, die nicht in eine leere Indifferenz oder abstrakt-jenseitige Transzendenz entgeht, sondern ein lebendiges sich selbst Setzen als Selbst ist. Entsprechend ist auch Tillichs Reden vom Glauben von Vergegenständlichung bedroht. „Glaube ist Richtung auf das Unbedingte durch Symbole aus dem Bedingten hindurch." (I 332)
Liest man diesen Satz in einem präzisen Sinn, so meint er Glaube als Symbolerfahrung, nämlich als Erfahrung des Verweisens des Bedingten an ihm selbst über sich hinaus bzw. in ihm selbst durch sich hindurch. Die „Richtung auf das Unbedingte" ist das, was ein Symbol zum Symbol macht, nämlich das „Hindurch" an ihm selber. Daraus will Tillich den doppelten Sinn eines jeden Glaubensaktes ableiten: „er richtet sich unmittelbar auf ein heiliges Objekt. Aber er meint nicht das Objekt, sondern das Unbedingte, das in dem Objekt symbolisch ausgedrückt ist. Glaube geht über die Unmittelbarkeit jedes Dinges hinaus zu dem Grund und Abgrund, auf dem es ruht." (ebd.)
17
uns) so darstellt und ein bloßes Fürunssein darin, daß es von ihm selber her sich als für uns seiend (zu uns kommend) darstellt. Cf. Simon (wie o. Anm. 4): „... das Zeichen ist in seiner Funktion ungegenständlich!" (a.a.O. 1 6 6 f . ) — „Das Zeichen konstituiert sich unabhängig von seiner Zeichenfunktion gar nicht als Objekt, es ist Zeichen nur in seiner Funktion, und in dieser tritt lediglich die bezeichnete Bedeutung als Objekt ins Bewußtsein" (ebd. Fu. 56).
176
Joachim Ringleben
Offensichtlich gilt diese Beschreibung nur in einer Außensicht, d. h. für die nicht-religiöse Betrachtung, und ist insofern nicht frei von falscher Vergegenständlichung der Sachverhalte18. Denn insofern der in Rede stehende Akt sich „unmittelbar" auf ein Objekt richtet, das eben darum auch (noch) kein heiliges ist, ist er gerade kein Glaubensakt. Als Glaubensakt eben meint er „eigentlich" das Unbedingte, das sich an dem Objekt (symbolisch) zum Ausdruck bringt. Eben dies Hinausgehen über die Unmittelbarkeit jedes Dinges ist aber so keine bloß subjektive Intention des Glaubens, sondern der Glaube folgt lediglich dem Hinausgehen der Dinge über sich, das sie zum Symbol werden läßt. Glaube ist Erfahrung des Grundes und Abgrundes der Dinge, insofern dieser sich selbst an ihnen darstellt. Darum wendet sich Tillich auch zu Recht gegen ein bloß subjektives Symbolverständnis: als ob eine subjektive Intention auf die Dinge sie zum Symbol machen könnte. „... ein Subjektivismus des Gefühls, der nichts weiß v o n dem Eigengehalt der Dinge und nicht sieht, daß die Dinge nur deswegen zu Symbolen werden können, weil im Gefühl ihr Eigengehalt in geistiger, sinnerfüllender Weise erfaßt wird." (I 250)
Dieser Hinweis auf das Abstrakte bloß subjektiver Symbol-Intention formuliert allerdings eine selber nur subjektive Bedingung der Symbolkonstitution: Sachlichkeit. Die objektive Bedingung des zum Symbol werden Könnens ist eben der Eigengehalt der Dinge, insofern er selbsttranszendierend ist. In der Erfahrung des Symbols als solchem aber wird dieser Eigengehalt der Dinge dialektisch (bzw. existiert als Dialektik) nur im Kraftfeld sich daran manifestierender Subjektivität des Unbedingten selbst. 5. Dialektik Alle bisher geäußerten kritischen Bedenken scheint ein berühmter Textabschnitt aus der „Religionsphilosophie" noch einmal auf sich zu versammeln, der darum abschließend einer dialektischen Gegen-Lektüre unterzogen werden soll. „Aber das Unbedingte ist kein gegenständliches Objekt. Es kann durch Objekte nur symbolisiert, nicht erfaßt werden. Das Glaubensobjekt hat notwendig symboli18
Cf. das Zitat in Anm. 17!
Symbol und göttliches Sein
177
sehen Charakter; es meint mehr, als es ausdrückt. Ob ein heiliger Stein oder ein persönlicher allmächtiger Geist geglaubt wird, immer geht die Glaubensintention über das Glaubensobjekt hinaus. Im Abgrund des Unbedingten verschwindet das eine wie das andere. Nicht der Ungläubige, sondern der Gläubige ist der eigentliche Atheist; und in jedem echten Theismus, in jeder Setzung Gottes als des Unbedingten ist ein Abgrund des Atheismus enthalten, ist die Setzung wieder aufgehoben. „Gott" ist das Symbol für das Unbedingte; aber es ist ein Symbol, genau wie der Glaube als Akt — nicht als Akt-Grund und -Abgrund — ein symbolischer Akt ist. Gott ist nicht nur sein eigener Grund, sondern auch sein eigener Abgrund. — Entsprechend der Gegenwart des unbedingten Sinngehaltes in jedem Sein kann alles Seiende Symbol des Unbedingten werden." (I 333 f.)
Die gerade in der Sicht von Gott selbst her berechtigte Sorge, Gott nicht zu einem „gegenständlichen Objekt" zu machen, enthebt allerdings genau darum nicht der Aufgabe, ihn überhaupt als ihn selbst zu thematisieren, weil sonst kein unbedingter Schutz gegen jene Abgleitung gegeben ist. Bleibt die „Entgegenständlichung" nur subjektiver Denkakt, wird sie dem Unbedingten in subjektiver Reflexion nur angetan, so ist sie selber schon seine Vergegenständlichung — eine Dialektik, der Tillich nicht selten unfreiwillig erliegt. Bereits die reine Transzendenz des Unbedingten ist, wird sie behauptet im abstrakten Gegenüber zu eo ipso sich festhaltender Endlichkeit, schon seine Vergegenständlichung. Nur der lebendige Gott hebt seine eigene Gegenständlichkeit — die von jedem über ihn Reden bzw. ihn intentional Vermeinen unabtrennlich ist! — selber aktuell wieder auf, d. h. er wird im Symbol erfahren. Kann so das Unbedingte freilich „durch Objekte nur symbolisiert werden" (Sperrung von J. R.), so heißt das sachlich gerade: es kann nicht direkt „erfaßt werden" — wenngleich nach Tillich im wahren Symbol doch die Realität soll erfaßt werden können, wie er an anderer Stelle sagt (I 328, o. zitiert) —, eben insofern es sich an symbolischen Objekten selber darstellt und in dieser Vermitteltheit nur indirekt da ist. Den so allein zu begreifenden symbolischen Charakter, d. h. die Selbsttranszendenz des Glaubensobjektes, daß „es (mehr) meint ..., als es ausdrückt", muß es als solche(n), d. h. als dieses Mehr-Meinen, auch an sich noch „ausdrücken"; insofern ist Symbolhaftigkeit selber ein Formcharakter. Von der Gleichheit eines „heiligen Steins" und eines „persönlichen allmächtigen Geistes" im Hinblick auf die Glaubenstranszendenz kann allerdings nur nivellierend und insofern vergegenständlichend die Rede sein. Denn einen persönlichen allmächtigen Gott zu glauben, das könnte
178
Joachim Ringleben
eben gerade thematischer Inbegriff der Symboldialektik sein. D . h. diesen zu glauben, bedeutete (theoretisch und für solches Glauben selbst), die Ermöglichung seiner symbolischen Repräsentanz überhaupt zu intendieren. Insofern Gott als lebendiger Gott geglaubt wird, ist er conditio sine qua non einer theologischen Theorie wirklichen Symbolgeschehens überhaupt 1 9 .
19
Indem Tillich in späteren Arbeiten „Handeln G o t t e s " für ein Symbol erklärt, erliegt er der Dialektik, das religiöse Funktionieren seines eigenen Symbolbegriffs nicht mehr theologisch verständlich machen zu können. D a s läßt sich beispielhaft an einem Aufsatz v o n 1960/61 verdeutlichen. Tillich unterscheidet bei „primären Symbolen" (cf. V 241, auch 206) von einer ersten, auf den transzendenten Seinsgrund selber bezogenen Schicht eine zweite, in der diese Symbole versuchen, „ G o t t als den lebendigen Gott zu erfassen, indem sie sich auf ein göttliches Tun beziehen in Ausdrücken wie „ S c h ö p f u n g " , „Vorsehung", „Inkarnation" und „ E r f ü l l u n g " " (V 242, cf. 207 f.). Tillichs Z u g a n g bleibt hier ganz äußerlich, weil die F r a g e nach dem Woher einer N ö t i g u n g für das religiöse Bewußtsein, von einem lebendigen Gott zu reden, nicht gestellt wird. Kann aber Tillich den G r u n d für einen solchen „Versuch" anders verorten als in der Erfahrung des Symbolgeschehens selber? Muß Tillich nicht zwangsläufig die Symbolerfahrung überhaupt als selber schon in der Erfahrung von einem göttlichen Tun am Endlichen, das dergestalt über sich hinausweist, bestehend begreifen, d. h. göttliches Handeln als (nicht-symbolische) Konstitution von funktionierenden Symbolen? Was Tillich „ S y m b o l " nennt, ist nichts anderes als die Erfahrung von Manifestationen göttlichen Eingreifens in die weltlichen Geschehnisse und Sachverhalte und eines sie Bestimmens oder Bewirkens. Solches Tun Gottes darf freilich nicht in die Vorstellung isolierter einzelner Akte eines für sich ruhenden Supersubjektes verfälscht werden, sondern muß als Gottes lebendiges Sein mit der Welt, als seine sich an ihr darstellende absolute Subjektivität gedacht werden. Insofern würde gerade beim Symbolprozeß Tillichs Unterscheidung zwischen Symbolen für „ G o t t " (selbst) und für „Attribute und Handlungen G o t t e s " (V 219) prinzipiell und theologisch hinfallig. Tillichs a. a. O. folgender Satz „In diesen Symbolen unterwirft die religiöse Phantasie das Transzendente den Kategorien von Raum, Zeit, Substanz und Kausalität" (V 242) hat — abgesehen von dem subjektivistisch vergegenständlichenden Ausdruck „unterwirft" — daher ein nur relatives Recht. D a s lebendige Symbolgeschehen ist in endlichen Kategorien als solchen in der Tat nicht faßbar, — aber eben weil es die real existierende Dialektik von Gottes Subjektivität, die darin erfahrbar wird, ist und nicht ein in Tillichs Sinn unfaßbares, abstraktes „Transzendentes". Aus dieser Kritik folgt, daß der Tillichsche Symbolbegriff theologisch konsistent nur wäre im Rahmen eines Begriffs von Gottes Offenbarungshandeln. D a s ist 1922 noch im Blick: „... das Handeln Gottes ist die Substanz der Religion, ohne die sie nicht sein kann." (I 384, cf. zur Offenbarung: 382!)
Symbol und göttliches Sein
179
Insofern redet Tillich abstrakt vom alles gleichermaßen verschlingenden „Abgrund" des Unbedingten. Zudem ist der Satz darin doppeldeutig, daß nicht klar wird, ob in diesem Abgrund auch solches „Verschwinden" selber noch verschwindet (bzw. schon verschwunden ist) oder ob „Abgrund" nur das Moment des Verschwindens als solches genannt wird. Überhaupt widmet Tillich dem internen Verhältnis von „Grund" und „Abgrund" am Unbedingten zu wenig Aufmerksamkeit. Sind es nur zwei Seiten, die wir dem Unbedingten prädizieren müssen, d. h. lediglich Aspekte subjektiver Reflexion auf es, die sich als solche eigentümlich folgenlos die Waage halten? Von daher würde verständlich, daß es allein der Subjektivität des das Unbedingte Denkenden zuzurechnen ist, daß einmal dieser, ein anderes Mal jener Aspekt des Unbedingten akzentuiert würde. Oder legen jene Begriffe die eigene Dialektik des Unbedingten selbst aus, insofern es eben es selbst ist? Dann müßte nach ihrem Zusammenhang in einer Logik der Selbstdarstellung des Unbedingten gefragt werden können, aus der sie zu begreifen wären. Weiter ist kaum plausibel, den „Gläubigen", d. h. den das Symbol als Symbol sein Lassenden bzw. Erfahrenden, als den eigentlichen Atheisten zu bezeichnen. Soll „Atheismus" hier besagen, einen als bloßes Objekt vorgestellten Gott zu verneinen bzw. überschreiten, so kennzeichnet das eben den an Gott Glaubenden, der als solcher gerade Götze und Gott in kraft des wahren Theismus unterscheidet. Tillichs paradoxem Sprachgebrauch liegt eine Äquivokation von „Theismus" zugrunde. Der Gläubige ist „atheistisch" nur im Namen von wahrhaftem „Theismus", d. h. er ist gerade nicht atheistisch im üblichen Sinne. Wahrer Theismus transzendiert „jede Setzung Gottes" als bloß die seine in Richtung auf Gott selber als den Sich-selbst-Setzenden und angesichts seines Sichsetzens. Darin ist die menschliche „Setzung" Gottes nicht atheistisch negiert, sondern unbedingt „aufgehoben" — was in Tillichs Alternativen systematisch ausgeklammert bleibt. Sein „wieder aufgehoben" spricht vom abstrakten Rückgängigmachen eines schon ebenso abstrakten Subjektivismus. Liest man — hier und auch später häufig 20 —: „Gott" ist das Symbol für das Unbedingte, so wird nicht deutlich, was dabei „Gott" heißt, a) Ist das Wort „Gott" gemeint, so ist der Satz trivial und könnte lauten: „Gott
20
Cf. z.B. V 206 f., 218 f., 241.
180
Joachim Ringleben
ist Symbol für Gott". Als solches hat das symbolische Wort aber auch (irgendwie) teil an der Realität des Symbolisierten, b) Ist unsere Vorstellung von Gott gemeint (Gott als intendierte sprachliche Bedeutung des Wortes „Gott"), so ist der Satz hier nicht relevant, da in diesem Falle nur vom Symbol zu reden ist, wenn diese Vorstellung über sich hinausweist auf Gott selber (die Wortbedeutung auf die gemeinte Sache), d. h. wenn „Gott" gerade etwas nicht bloß von uns Gemeintes ist. Das führt auf eine dritte Möglichkeit, c) Tillich redet von Gott selber, d. h. dem im Wort „Gott" Gemeinten, insofern er aber nicht nur (von uns) gemeint ist. Dann aber muß gegen Tillich gesagt werden: Gott ist das Unbedingte selbst, insofern er (es) sich unserm Wort „Gott" bzw. unserem Meinen seiner Bedeutung (Vorstellung) vernehmlich macht und beides so zu seinem Symbol werden läßt. Gott kann nicht nur Symbol sein — gerade damit es so etwas wie ein „Symbol für das Unbedingte" überhaupt geben kann. Ebenso kann der Glaube, der auf ein Symbol als solches gerichtete Akt, nicht auch selber wieder (und im selben Sinne) „symbolisch" sein. Denn nur als davon Unterschiedener kann er auf ein Symbol gehen. Daß der Glaube selber „ein symbolischer Akt ist", kann nur heißen: er läßt das Symbol als Symbol sein, ist bestimmt durch es und erfüllt von der Erfahrung von ihm; dies muß er aber nicht-symbolisch tun bzw. sein. Der zusammenfassende Satz Tillichs über Gott als seinen eigenen Grund und Abgrund gibt allergrößte Verstehensprobleme auf. Wahrscheinlich ist mit dem sein eigener Abgrund Sein gemeint, daß das Symbol „Gott" (s. o.) — wie jedes Symbol — noch „unter dem Nein des Unbedingten" steht. Insofern aber ein Symbol Selbstvollzug dieses Nein an sich (Selbsttranszendenz) ist, ist Gott als Abgrund des Symbols nach seiner Unmittelbarkeit (d. h. nach seiner „Stofflichkeit") gerade selbsthafter Grund des Symbols als Symbol. Gott ist als Abgrund des von ihm Unterschiedenen — und nicht als im strengen Sinne sein eigener Abgrund 21 — gerade auch dessen Grund als Grund des Symbolseins und so Grund seiner eigenen Präsenz als Symbol. Schließlich fallt der letzte Satz wieder in vergegenständlichendes Sprechen zurück. Denn nicht kann eine substantielle „Gegenwart des unbedingten Sinngehaltes" in jedem Sein als Möglichkeitsbedingung der Symbolhaftigkeit vorausgesetzt werden, weil es solche Gegenwart des 21
Denn was könnte das anderes heißen als progressive Selbstanihilation: ein in sich selber versinkendes Loch oder Nichts?!
Symbol und göttliches Sein
181
Unbedingten nur als Symbol gibt. Dessen Gegenwärtigster^» konstituiert allererst Symbole, die nichts sind als Entdeckungsfelder einer aktuellen Gegenwart des Unbedingten als solchen.
6.
Schlußthesen
Aufgrund der vorangehenden kritischen Erwägungen lassen sich zu Tillichs früher Symboltheorie folgende Thesen formulieren 22 . a) Statt des komplementär-dualen Schemas „Form — Gehalt", das seine (äußerliche) Einheit nur in einem Dritten (denkenden Subjekt) hat, muß — wozu sich bei Tillich nebenher auch Andeutungen finden — ein dialektisches Sichanderswerden gedacht werden: ζ. B. Selbstnegation oder Selbsttranszendenz der „Form" als die Weise, wie an einer bedingten Form sich das Unbedingte manifestiert. (Tillich sagt dafür vergegenständlichend: „Erfüllung" einer bedingten Form mit dem „Gehalt" des Unbedingten. Dieser „Gehalt" ist aber eine dialektische Formbestimmtheit.) b) Vom Unbedingten „selbst" bzw. von ihm „her" kann nicht geredet werden, ohne es auch als es selbst und als unbedingte Subjektivität zu denken, wenn es nicht faktisch nur zum Objekt einer bloß subjektiven Reflexion und zu einem durch seine angebliche Unfaßbarkeit auf subjektive Realisation durch den Denkenden angewiesenen Scheinobjekt verkommen soll. c) Tillich will eine Dialektik des Unbedingten denken, ohne sie als Dialektik von unbedingter Subjektivität (Gottes) zu denken. Da er sie nicht systematisch als Dialektik göttlichen Selbstseins, sondern als eine selbst-lose denkt, wird das Subjekt des endlichen Denkers zum eigentlichen Beweger und wird folgerecht statt wirklicher Dialektik nur deren Vergegenständlichung (objektiv bestehende Komplementarität) gedacht bzw. vorgestellt. 22
Die späteren Aufsätze Tillichs zum Symbol — seit 1950 wendet er sich in den USA dem Thema wieder verstärkt zu — bieten m. E. kein grundsätzlich anderes Bild. Eine analoge Kritik zu der hier unternommenen ließe sich unschwer etwa an dem Aufsatz von 1960/61 „Recht und Bedeutung religiöser Symbole" (V 237 ff.) durchführen. Auch hier ist ein Schwanken zwischen einem aktualistischen und einem bloß instrumenteilen Verständnis genauso wie das zwischen einem offenbarungstheologischen Verständnis und einer falschen Objektivation des Seins Gottes unübersehbar.
HANS SCHWARZ
Open Questions Concerning a Personal God in Paul Tillich's Systematic Theology One might object to questioning Paul Tillich's concept of a personal God in his Systematic Theology, since he points out that the term persona as used in the traditional trinitarian formulas was not thought of as referring to a personal God until the 19th century when ordinary theism under the Kantian influence came to speak of God in such language. 1 Yet Tillich insists that "the symbol 'personal God' is absolutely fundamental because an existential relation is a person to person relation." 2 At the same time he calls "personal God" a "confusing symbol." 3 This seems to indicate that Tillich himself has problems with attaining clarity concerning a personal God. In volume 1 Tillich asserted that "the statement that God is beingitself is a non-symbolic statement. It does not point beyond itself." 4 In his reformulations in the introduction to volume 2, however, he states that the only point at which a non-symbolic assertion about God must be made is with the statement "that everything we say about God is symbolic. Such a statement is an assertion about God which itself is not symbolic." 5 The problem seems to arise from two terms which Tillich employs, being-itself and symbolic. The first one also points to his Lutheran heritage.
1
2
3 4 5
Cf. Wayne W. Mahan, Tillich's System (San Antonio, TX: Trinity University Press, 1974), 27. Paul Tillich, Systematic Theology, Vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 244. Ibid., 245. Ibid., 238. Paul Tillich, Systematic Theology, Vol. 2 (Chicago: University of Chicago Press, 1957), 9.
Open Questions Concerning a Personal G o d
183
1. God as the ground of being and as being-it self In his phenomenological description of what we mean by God Tillich notes that "whatever concerns a man ultimately becomes God for him, and, conversely, it means that a man can be concerned ultimately only about that which is God for him." 6 Echoed here is Luther's statement in his explanation of the First Commandment in his Large Catechism that whatever your heart clings to is your God. Tillich, however, sees this ultimate concern as transcending every preliminary finite and concrete concern, something that ultimately decides about being or nonbeing. When Tillich turns his attention to the actuality of God he defines God as being-itself. God is not a being, not even the highest or most perfect being, but being-itself or the ground of being. 7 Everything finite participates in being-itself and in its infinity which endows the finite with the power of being. This means that being-itself continuously upholds and supports every existent being. Otherwise it would be swallowed up by non-being or would have never emerged out of nonbeing. The whole existent order is always threatened by nothingness. There is no gradation from the finite to the infinite, but there is an absolute break or infinite "jump" between existent being and beingitself. Tillich avoids talking about God as existing, since God is beyond essence and existence and cannot participate in non-being. God as the ground of being is also the ground of the structure of existent being. He is not subject to the structure but conversely it is grounded in him. Yet Tillich also contends that God "is this structure, and it is impossible to speak of him except in terms of this structure. God must be approached cognitively through the structural elements of being-itself."8 The structural elements make him a living God, a God who can be our concern, since we can use these elements as symbols that point to him. Since God is both the ground of being and the ground of the structure of being, he has the power of determining the structure of everything that has being.
6 7 8
Paul Tillich, Systematic Theology, Vol. 1, 211. Ibid., 235. Ibid., 238.
184
Hans Schwarz
Everything that is said about God cannot be said directly but only symbolically. Even if we attempted to find our way to him through the structures of being, we would notice that they do not point to him directly but only symbolically. In talking about God so to speak as the "thing itself' we inevitably resort to symbolic language. This is the point at which the term "personal" in the connotation of a personal God comes into play.
2. God as personal in the face of the
"symbolic'
Tillich points out that we must distinguish between sign and symbol. "While the sign bears no necessary relation to that to which it points, the symbol participates in the reality of that for which it stands. The sign can be changed arbitrarily according to the demands of expediency, but a symbol grows and dies according to the correlation between that which is symbolized and the persons who receive it as a symbol." 9 Tillich leaves no doubt that concrete assertions about God must be symbolic, because we use a segment of finite experience in order to express something about God. While such symbolic expression transcends the content of the finite experience it also includes it. In a symbolic expression a symbol negates its proper meaning through that to which it points. We could use as an the example the use of bread and wine in the eucharistic celebration. Their proper content is thereby negated, since they point to the body and blood of Christ. Tillich goes a step further in asking whether a segment of finite reality can become the foundation for an assertion about that which is infinite and he answers his question affirmatively stating that the infinite is being-itself and in which everything participates. Tillich therewith affirms an analogia entis as the only justification for being able to speak about God. Religious symbols have a twofold direction, toward the infinite which they symbolize and toward the finite for which they symbolize the infinite. They bring the infinite "down" to the finite and open the finite for infinity. Symbols do not carry the connotation of non-reality or weaken a realistic meaning and the seriousness of what
9
Ibid., 239.
Open Questions Concerning a Personal God
185
they symbolize. On the contrary, they allow for the divine transcendence of the finite and for the descent of the infinite. When Tillich addresses the symbols which point to divine life, such as "God as living", he immediately cautions that we can say that God lives only in so far as he is the ground of life. But we cannot speak of God as living in the proper or non-symbolic sense of the word "life", since in God the distinction between potentiality and actuality is bridged. This means that the ontological structure of being supplies the material for the symbols which point to divine life. Tillich insists that the doctrine of God cannot be derived from an ontological system since the fundamental ontological structure is transcended through divine life itself. Yet Tillich realizes that the symbols provided by the ontological elements present numerous problems for the doctrine of God. One must always distinguish between the proper meaning of concepts and their symbolic use. It is also important to balance both sides of the ontological polarity without reducing their symbolic power. This necessity emerges prominently with the symbol "personal God". Of course, God is not a person, even the highest person, who would reside somewhere above the world. There is no evidence for such an existence. According to Tillich, "personal God" means "that God is the ground of everything personal and that he carries within himself the ontological power of personality. He is not a person, but he is not less than personal." 10 God is the principle of participation as well as of individualization, since the divine life participates in every life as its ground and aim. God participates in everything that is and shares in its destiny. This does not imply a spatial or temporal presence, since it is meant symbolically. But Tillich asserts that any active religious communication between God and humanity depends on the symbol of a personal God. Yet where and how can such a God be perceived? Tillich introduces a trinitarian principle and claims that this principle appears "whenever one speaks meaningfully of the living God." 11 Tillich cautions that this trinitarian principle is not synonymous with the Christian doctrine of the trinity but only a preparation for it. He speaks here of God as spirit and that God's life is "life as spirit, and the Ibid., 245. » Ibid., 251.
10
186
Hans Schwarz
trinitarian principles are moments within the process of the divine life." 12 He mentions that the first principle in the foundation of the Godhead is that which makes God God, the root of his majesty, the unapproachable intensity of his being, and the inexhaustable ground of being in which everything has its origin. Then he comes to the second principle, the logos, as the mirror of the divine depth and the principle of God's self-objectification. Finally Tillich arrives at the Spirit as the third principle. While we detect in Tillich's principles some kind of trinitarian motion, similar to inter-trinitarian relationships pointed out by Augustine and others, the self-mediation of the Godhead as a personal God remains unmentioned. God stays basically within himself. Yet Tillich affirms at the same time the significance of relation. " 'Relation' is a basic ontological category," 13 since "if God is said to be in relation, this statement is as symbolic as the statement that God is a living God." While God as being-itself is the presupposition of every relation, there are no relations of God with something or someone else, since these are all inner relations of the divine life. God is the creative basis of everything and of every moment. There is no creaturely independence from which one could derive an external relation between God and the creature. Tillich is correct in affirming that God cannot become an object unless he remains a subject. Yet Tillich concludes that it is impossible to have a relationship with God in the proper sense of the word, since his holiness would mitigate against such divine descent. Similarly, when Tillich elaborates on the meaning of the divine love he affirms that "love is an ontological concept." 14 Since God is love, one must affirm that God as being-itself is love, too. This means that the process of divine life is characterized by love. When Tillich talks about the two main symbols of a person-to-person relationship with God, namely, God as Lord and God as Father, we are again confronted with ontological symbols. " L o r d " must be understood basically as the expression of humanity's relation to the God who is wholly power, while Father is the expression of humanity's relation to the God who is wholly love. While Lord expresses the distance, Father 12 13 14
Ibid., 250. Ibid., 271. Ibid., 279.
Open Questions Concerning a Personal God
187
stands for unity. The latter is foremost the symbol for God as the creative ground of being, of humanity's being. It is also the symbol for God who preserves us by his sustaining creativity and drives us to fulfillment by his directing creativity. The symbol Lord completes the symbol Father, since it shows the infinite distance between God and the creature. It represents the structure of reality in which our existential estrangement appears as the divine law and the expression of God's will. It is also the symbol for God's governing of the whole of reality according to its inner goal of creation. Therefore Lord and Father are the central symbols "for the ego-thou relationship to God." 15 These aforementioned symbols and all other symbolic intimations of divine life and of our relation to it contain two aspects. They are determined by the transcendent reality they express, and they are influenced by the situation of those for whom they point to this reality. Tillich points out that the second part of his system, "Being and God", is followed by a third part, "Existence and the Christ", indicating the transition from essential to existential. We might expect that in this third part Tillich would go beyond the strictly symbolic nature of ontological discourse. Indeed, in his discussion of the Christ as mediator and savior he rejects the notion "that the mediator is an ontological reality besides God and man." 16 According to Tillich the Christ "does not represent man to God but shows what God wants man to be. ... He represents the original image of God embodied in man, but he does so under the conditions of estrangement between God and man." 17
3. Conclusion Most of Paul Tillich's affirmations of God agree with those of classical orthodox Christian doctrine. But his interpretation of these statements is rather novel, especially because he carries his understanding of their symbolic nature to much greater length than theologians have normally done. 18 There is some affinity in procedure between Paul Tillich and 15 16 17 18
Ibid., 289. Paul Tillich, Systematic Theology, Vol. 2, 93. Ibid., 93 f. Cf. J. Heywood Thomas, Paul Tillich: An Appraisal (London: SCM, 1963), 55.
188
Hans Schwarz
Pierre Teilhard de Chardin insofar as both use traditional terminology and then give it a rather novel content. Such method could be potentially misleading for the unsuspecting reader. But Tillich himself seems to have been misled with his own approach. While he insists on the symbol of a personal God for religious encounter, he asserts at the same time that God is more than a person. Yet in his explanation he fails to show how one still can have a personal encounter with something or someone that is more than a person. If God as person is included in the more than a person, why can Tillich not concede that God is a person but also more than a person instead of saying that God is not a person but not less than one? 19 Tillich affirms that the symbol of the personal God is indispensable for a living religion. But what does he mean by using the word "symbol"? Does he not simply point to the fact that there exists in all dissimilarity a certain analogy between God and person? Since Tillich affirms an analogia entis quite vigorously, would this indicate that he is actually talking about an analogy, a resemblance or an affinity? Carl Armbruster convincingly states: "There is abundant textual evidence that Tillich grosso modo equates symbolism and analogy." 20 The biggest question mark and the source of discontent with Tillich does not lie in his emphatically advocated symbolic structure of assertions about God. They also do not arise from Tillich's heavy ontological emphasis that seems to disallow for taking a personal God at face value. The retraction in the introduction to the second volume indicates that while writing volume 1, Tillich thought it possible to talk in a nonsymbolic way about God, as being-itself. Reflecting on volume 2 (christology), Tillich realized that a twofold access to God, non-symbolic and symbolic, is impossible. Therefore he insisted that there are no nonsymbolic assertions about God. Moreover, when Tillich wrote this christology he also had to contemplate Christ as mediator. In his christology he clearly spelled out that the Christ "is essential man who represents not only man to man but God to man." 21 But in his considering God as personal there is only a 19
20 21
Cf. the questions posed by Carl J. Armbruster, The Vision of Paul Tillich (New York: Sheed and Ward, 1967), 153. Ibid., 141. Paul Tillich, Systematic Theology, Vol. 2, 94.
Open Questions Concerning a Personal God
189
faint mention of a trinitarian principle and no mention of a divine representation which we would encounter in the Christ event. This raises the question whether the reality of God can be properly addressed without reference to a mediator between God and humanity. Tillich's strong affirmation of an analogia entis in terms of semblance or analogy instead of "mere" symbolism still faces the issue of how the divine is mediated. By excluding such a mediation the infinite qualitative difference on which Tillich rightly insists remains unbridged and Tillich's God remains the God of the philosophers but not of Abraham, Isaac and Jacob. Parenthetically I would like to support my observation with a 1940 rejoinder by Paul Tillich to Albert Einstein. 22 In his discussion with Albert Einstein Paul Tillich affirms a personal God. He claims that in classical theology the predicate "personal" has only been used for the divine symbolically or analogously or in such a way that it was at the same time affirmed and denied. 23 With this remark Tillich shows that "symbolic" can also stand for "analogical." He also affirms here that the symbol of a personal God is indispensable for a living religion. It is one symbol among others which expresses that our center of personality is grasped through the revelation of the inaccessible ground and abyss of being. 24 We conclude that in talking about God as personal one cannot avoid talking about his self-disclosure unless the symbol "personal" should become devoid of meaning. Yet these considerations Tillich relegated to another volume without showing their essential interconnectedness with his prior discourse.
22
23 24
Paul Ullich, "Das Problem des 'persönlichen Gottes.' Eine Auseinandersetzung mit Albert Einstein," in: Paul Tillich. Gesammelte Werke, Band 12 (Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk, 1971). Ibid., 303. Ibid., 304.
ZDENEK KUCKRA
Unser Reden von Gott zwischen Theismus und Atheismus 1. Der Ort der Theologie: die Grenze Bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am 23. September 1962 hat Paul Tillich seine Festrede unter das Thema der „Grenze" gestellt. Anhand des Symbols der Grenze — das Tillich schon im Jahre 1936 für die Deutung seines Lebenslaufes benützte — wollte er hier eine philosophisch-theologische Darstellung der gespaltenen Welt und ihrer Heilung entwickeln. „Die Grenzsituation" — so Tillich (in: Gesammelte Werke, Bd. XIII., S. 420) - „ist in Wirklichkeit kein Stehen, sondern ein Überschreiten und Zurückkehren ... dessen Ziel es ist, ein Drittes jenseits der begrenzten Gebiete zu schaffen ..., ist der Durchgang ... um zum Frieden zu gelangen." Die ontologische Analyse der Grenzsituation stellt somit eine Gedankenbasis dar, an der Tillich den „Auftrag des Theologen" kulturpolitisch formuliert: „Alles, was ich vom Überschreiten der Grenze gesagt habe, gilt auch für das Überschreiten der Grenze, die heute für die westliche Welt am schwersten zu überschreiten ist, die Grenze nach dem Osten. Es ist falsch, wenn die westlichen Völker durch Erziehung, Literatur und Propaganda davon abgehalten werden, die Grenze mit ihren zahlreichen Mauern ... zu überschreiten. Wir müssen auch sehen, was drüben in der Tiefe vor sich geht und es menschlich — nicht nur polemisch — zu verstehen suchen." (ebenda, S. 423). Der Auftrag des Theologen könnte heute — wir schreiben den Sommer 1988 — den Charakter eines Projektes annehmen, obwohl damals wie heute gilt, daß es „die heilenden Kräfte aus dem Unbegrenzten (sind) ..., die Frieden möglich machen." (ebenda, S. 428). Eine der zahlreichen Mauern, die die Ost-West-Grenze bilden, ist bis heute die ideologische Mauer. Klammern wir alle semanti-
Unser Reden von Gott zwischen Theismus und Atheismus
191
sehen oder geistesgeschichtlichen Fragen, die mit dem Begriff „Ideologie" zusammenhängen aus, und sagen wir mit der Alltagssprache: Diese Mauern versteht man als das Theismus-Atheismus-Problem. Tatsächlich artikulieren die beiden Begriffe nicht nur ein theoretisches Weltbild, sondern auch ein praktisches Verhältnis zur Gesellschaft, Geschichte und Natur. Das Theismus-Atheismus-Problem gründet tief in der Geschichte und gehört zum europäischen Lebenshorizont. In der Situation der Ost-West-Spaltung wird dieses komplizierte Problem vereinfacht und interpretiert als die philosophische Grundlage des christlichen Glaubens auf einer Seite, auf der anderen als die Substanz des Marxismus. Es gibt Ansichten, die dieses Problem verabsolutieren und in ihm das eigentliche punctum saliens der Ost-West-Grenze sehen. Dann gerät man leicht zur Grenze eines „heiligen Krieges", der „die furchtbarste Manifestation der dämonisch-zerstörerischen Kräfte in der Tiefe des Menschen" (ebenda, S. 428) provozieren kann.
2. Der Auftrag der Theologie: das Überschreiten der ideologischen
Grenze
Die Identifikation der ideologischen Ost-West-Grenze mit dem Theismus· Atheismus-Problem hielt der tschechische Theologe J. L. Hromadka für den „Mißbrauch des Christentums". Das theologische Anliegen seiner letzten Lebensjahre kann man als Bemühung um die Entdämonisierung der starren ontologischen, und in ihren Konsequenzen auch politischen Antithesen von Theismus und Atheismus beschreiben. Dies versuchte er in einer für seine situationsbezogene Denkart charakteristischen Weise: Der Atheismus der Kommunisten sei eine geschichtlich verursachte und verständliche Reaktion auf das Versagen der Kirche und der Religion. Von dieser Prämisse her ist es verständlich, wenn Hromadka die Frage stellt, ob das, was wir Atheismus nennen, „nicht geistig und moralisch eine tiefere Erscheinung der Humanität bedeutet, als der Kampf gegen die neue Gesellschaft im Namen Gottes und des traditionellen Christentums" (An der Schwelle des Dialogs, 1964, S. 95). Seine Antwort formuliert Hromadka geistesgeschichtlich so: „Der Atheismus ist ... nur eine Begleitform des radikalen Humanismus ... In diesem radikalen Humanismus kommen in einer saekularisierten Form fast alle ethischen und sozialen Schwerpunkte des lebendigen, mittelalterlich-reformerischen und reformatorischen Christentums zur Gel-
192
Zdenek Kuiera
tung" (ebenda, S. 97). Hromadka will den chrisdich-marxistischen Dialog also auf der anthropologischen Ebene fuhren. „Die Hauptfrage (in unserem Lande) ist nicht eine Rettung des Kirchenbetriebes, sondern das Verständnis des Menschen in seinem inneren und gesellschafdichen Leben" (Warum lebe ich?, 1968; in: Wahrheit und Leben, 1969, S. 109). Die Aufgabe sei — und zwar sowohl für Christen wie für Marxisten — sich von den Resten des alten Denkens zu befreien und „in die Tiefe unserer Sendung hineinzutauchen" (An der Schwelle, S. 102). Es gelte darum, „die rein theoretisch-unverbindliche Beschäftigung zu überholen" und in die Dimension „der menschlichen Tiefe und der menschlichen Kontakte durchzubrechen", in der „die abstrakte Logik ihre Gültigkeit verliert und der geistige Verstand entscheidet" (Warum lebe ich?, S. 114). Hromadka hatte den Mut, die traditionellen ideologischen Grenzen zu überschreiten. Dies geschah auf dem Grunde seiner geschichtlichen Auffassung des Problems und im Sinne seines humanistischen und pastoralen Anliegens. Abgesehen von den akademischen Einflüssen (E. Troeltsch, T. G. Masaryk) ist diese Haltung fraglos ein Resultat der Erfahrungen seiner Generation, die beide Weltkriege erlebte (Hromadka geb. 1889, Tillich und Barth geb. 1886). Diese „lost-generation" hat die traditionellen Grenzen existentiell erlebt und erlitten. Aus diesem Erlebnis stammt die Freiheit gegenüber allen philosophischen oder ideologischen Fesseln. Was diese Generation versuchte zu formulieren, verdankte sich der Erfahrung des Unbegrenzten. Das Überschreiten der traditionellen Grenzen machen wir mit Hromadka dankbar mit. Da jedoch kommt der Punkt, wo wir mit Hromadkas kritischer Intention seinen schriftlichen Nachlaß überschreiten wollen.
3. Das Thema der Theologie heute: Glaube und Wirklichkeit Das Atheismus-Problem artikuliert nicht nur eine kirchen- oder kultur-politische Situation, sondern spiegelt eine Sprach- und Gedankensituation wider. Die kirchen- oder kultur-politische Situation ist nicht nur ein Resultat der historischen Tatsachen und Prozesse, sondern auch eines der Struktur des Denkens und der Rede, durch die sie erfaßt und benannt wird. Deshalb vermag eine gewisse Struktur der Rede und des
Unser Reden von Gott zwischen Theismus und Atheismus
193
Denkens eine Situation tief zu beeinflussen oder sogar zu ändern. Dieses sprachphilosophische Prinzip möchte ich nicht gegen das geschichtsphilosophische Prinzip stellen; beide erfassen vielmehr eine gewisse Dimension der Wirklichkeit. „Gott ist tot", schreibt J. P. Sartre (Situations I., S. 155 u. 159), „er sprach zu uns und nun schweigt er; wir berühren nur noch seinen Leichnam ... Dieses Schweigen des Transzendenten, verbunden mit der Fortdauer des religiösen Bedürfnisses beim modernen Menschen, das ist die große Angelegenheit heute wie gestern." Der Mensch muß sich als das Wesen erkennen, dessen Erscheinen bewirkt, daß es eine Welt gibt. „Denn," so Sartre (L'existentialisme, S. 93), „es gibt kein anderes Universum als das menschliche, das Universum der menschlichen Subjektivität." Für diesen Horizont ist die Verneinung der transzendenten Wirklichkeit typisch, in der die Wirklichkeit unseres Alltages in Wahrheit ihren Grund und ihr Ziel hat. Einzig der Welt, dem Menschen, der Geschichte wird Wirklichkeit zugemessen. Der Mensch hat wahrgenommen, daß er die Geschichte beeinflussen kann. Er versteht sich nicht mehr als ein Schauspieler auf der Bühne der Geschichte, sondern als ihr Regisseur. Wenn aber nur das Universum der menschlichen Subjektivität existiert, dann ist im Grunde jede theologische Rede falsch und jede kirchliche Handlung eine Illusion. Partielle, ζ. B. anthropologische Elemente der Wahrheit in den theologischen Sätzen können die Existenzkrise der Theologie nicht abwehren, wenn ihre ontologische Voraussetzung irrt. Die Theologie wackelt in ihrer Mitte. In dieser Situation schien es im sechsten Dezenium unseres Jahrhunderts die Hauptverpflichtung der Theologen zu sein, den Zeitgenossen klarzumachen, wie die Wirklichkeit Gottes zu verstehen ist und worin die Möglichkeit besteht, davon wahrhaftig zu reden. „Wirklichkeit" fiel zusammen mit „Wahrhaftigkeit." Manche haben seither das sprachliche Gegebensein Gottes mit der Frage nach dem Sein Gottes identifiziert. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ein Reden von Gott ist nicht für theologisch zu halten, weil es verbal der Bibel entspricht, sondern wenn es der existentiellen Situation des Menschen widerspricht und entspricht, das heißt dem konkreten Menschen durch konkretes Versprechen „Glauben, Hoffnung und Liebe gewährt." (G. Ebeling, Dogmatik I., S. 191). In dieser Auffassung ist die Beziehung zur geschichtlichen Situation fundamental, die dem Menschen sprachlich erschlossen wird. Der christliche Glaube ist keinem Menschen fremd; er
194
Zdenek Kucera
bedeutet die wahre sprachliche Existenz. So ist die Beziehung des Glaubens zur geschichtlichen Wirklichkeit und deren Deutung zum Hauptthema der Theologie geworden. Es bleibt freilich offen, wie man die „wahre sprachliche Existenz" dagegen sichert, daß sie nicht in eine reine Subjektivität verfällt. Eine kritische Untersuchung dieser theologischen Lage kann zwei Elemente festhalten: das negative besteht in der Ablehnung der metaphysischen Transzendenz als Grundlage und Ziel der geschichtlichen Auffassung der Wirklichkeit; das positive liegt in der Bejahung der schöpferischen Kräfte des Menschen. Diese Einsicht macht es möglich, der Theologie zwei Fragen zu stellen: 1. Ist es notwendig, den Gehalt des Namens „Gott" — wie wir ihn in der Bibel vorfinden — mit der antik-scholastischen Tradition des metaphysischen Theismus zu verbinden? 2. Ist es möglich — ohne wesentliche Verkürzung, verständlich und existentiell — den Gehalt des Namens „Gott" in den Horizont des kritisch interpretierten zeitgenössischen Selbstverständnisses des Menschen einzubringen?
4. Der traditionelle Theismus der Theologie: Gott als Objekt Es gehört zum Spezifikum der Theologie und der Liturgie, daß eine vergangene denkerische und geistliche Tradition in ihrem gegenwärtigen Leben zur Sprache kommt. Der christliche Glaube wird uns bis heute vermittelt in einer Denkform, die von der antiken eidetischen Gedankenwelt abhängig ist. Diese ist charakterisiert durch die Anschauung einer statischen, durch Ideen geordneten Wirklichkeit. Gott wird darin erkannt als ein Abstraktum und als eine Substanz. Der Mensch „hat" Gott — und er bleibt damit allein. Diese Gegenständlichkeit herrscht bis heute im Denken des Theismus, ohne die Zeitbedingtheit dieser Gottesvorstellung zu durchschauen. Aber ein solcher Gottesbegriff entspricht weder der biblischen Denkart (vergl. C. H. Ratschow, Werden und Wirken, Berlin 1941) noch dem modernen Weltbild (vergl. K. Sauer, Transzendenz als Wirklichkeit, Hamburg 1965). Dieser Einsicht widmete sich die theologische Schule der Hussitischen Kirche in der Tschechoslowakei seit ihren Anfängen unter Zdenek Trtik (1914—1983).
Unser Reden von Gott zwischen Theismus und Atheismus
195
Die Kirche in der Antike und im Mittelalter hatte keine andere philosophische Tradition zur Verfügung als die griechische. So hat sie diese durch ihre Philosophie und Theologie dem vorwissenschaftlichen und dem wissenschaftlichen Denken vermittelt — einschließlich der noetischen Antithesis von Subjekt und Objekt. Auf dem Grund dieses Denkens hat die europäische Wissenschaft und die mit ihr zusammenhängende Technik eine neue Zivilisation gestaltet, deren Söhne und Töchter wir sind. Das neuzeitliche Denken hat die antike Ideenwelt in die Naturgesetze verwandelt und die statische Wirklichkeit des Alltags dem Kausalnexus unterworfen. So ist die Erkenntnislehre der modernen Wissenschaft auf der Basis der Subjekt-Objekt-Beziehung zum letzten Kriterium der Frage geworden, was Realität und was Wahrheit ist. Wirklich sei nur das, was als Gegenstand oder als gegenständlicher Prozeß existiert und geschieht. Die Fraglichkeit dieses Axioms scheint auf, sobald man gewahr wird, daß auch menschliche Subjekte zur Wirklichkeit gehören. Das menschliche Ich oder Subjekt ist ex definitione das Gegenteil vom Objekt und ist dennoch wirklich. Der Mensch in seiner Gesamtheit ist nicht nur ein gegenständlicher Leib, sondern auch ein nichtgegenständliches Subjekt, das der objektiven wissenschaftlichen Sicht verborgen bleibt. Es ist ein elementarer Irrtum, ein Subjekt für einen Gegenstand zu halten. Trotzdem ist die Voraussetzung der wissenschaftlichen Anerkennung, daß ein menschliches Subjekt wirklich existiert, die Lokalisierung dieses Subjekts in der gegenständlichen Seite des Menschen, in seinem Leib. Eben mit dieser Verneinung der Natur des Subjekts hängt die Krise des Menschen in der modernen industriellen Gesellschaft zusammen, denn in der Existenz des Menschen als Subjekt besteht seine eigentliche Tiefe und Würde. Im Unterschied zum gegenständlich aufgefaßten menschlichen Subjekt kann der vergegenständlichte Gott der traditionellen christlichen Lehre wissenschaftlich überhaupt nicht in der gegenständlichen Sphäre der Wirklichkeit festgestellt oder lokalisiert werden. Daraus folgt mit Konsequenz, daß Gott eine Illusion ist. Hier befindet sich die denkerische Hauptwurzel des europäischen Atheismus. Als Verneinung der gegenständlich behaupteten Gottesexistenz ist er sogar theologisch konsequent. Die kritische Untersuchung der philosophisch-theologischen Tradition der Antike und des Mittelaltes, die für das Problem „Gott" entscheidend war, berechtigt uns zur Konklusion, daß die Interpretation
196
Zdenek Kucera
des Namens „Gott" im Rahmen des traditionellen objektiven Theismus ein wichtiges Hindernis für die angemessene Interpretation der Gotteslehre heute bildet.
5. Die andere Alternative der Theologie: Gott als absolutes Subjekt Versuchen wir nun eine Antwort auf die Frage, ob es möglich ist, die biblische Auffassung des Namens „Gott" im kritischen Respekt gegenüber dem geschichtlichen Selbstverständnis des zeitgenössischen Menschen zu deuten. Fangen wir mit der Untersuchung von zwei Fragen an: Können wir in unserer dynamischen Epoche sub specie Dei aeterni die Zeitfrage untersuchen, ohne diese statisch oder zeitlos zu verstehen und dabei eine Veränderung der Welt auszuschließen? Ist es möglich, sich auf Gott zu berufen, ohne die Welt zu hintergehen, oder sich auf die Welt zu berufen, ohne Gott zu hintergehen? Die überkommene Vorstellung hält die Welt für fertig, zweckmäßig und übersichtlich, in der unveränderliche Substanzen sich in einer planmäßigen Ordnung befinden. Die neue geschichtliche Einsicht versteht die Welt als den Raum der Abläufe, Prozesse und Umbrüche, in der alles sich ändert und mit allem zusammenhängt, ohne ein festes Ziel zu haben. Der Mensch lebt im fließenden Lauf der Geschichte, reift und ändert sich in ihm und ist sich seiner geschichtlichen Wirksamkeit bewußt geworden. Will der christliche Glaube diese Tatsachen ernst nehmen, gibt es keinen Zugang zu einem Gott mehr, der als der Unbewegte die Welt bewegt; vielmehr muß er den Namen Gott so aussprechen, daß dieser den Weltprozeß und die menschliche Geschichte nicht aus-, sondern einschließt. Das heißt so zu reden, daß Gott als Akteur sinnvoll im engsten Zusammenhang mit dem Werk des Menschen erscheint. Dann ist es sinnvoll, nicht mehr „über" Gott, sondern „von" Gott zu reden. Unsere theologische Aufgabe ist es, von einem Gott zu reden, der uns betrifft und nicht allein läßt. Ist es überhaupt möglich, von Gott so zu reden, daß er uns nahe und ähnlich, und zugleich fern und fremd scheint? Ist es überhaupt möglich, unsere Begegnung mit Gott auszusagen, ohne zugleich seine Indisponibilität durch uns zu leugnen? Ist es möglich, unsere Begegnung mit Gott zu klären, ohne dabei unsere Aktivität zu negieren?
Unser Reden von Gott zwischen Theismus und Atheismus
197
Die Analyse des biblischen Zeugnisses von der Offenbarung Gottes zeigt, daß Gott sich dem gläubigen Menschen nicht als ein Objekt, sondern als ein Du, als ein freier, heiliger und liebender Wille offenbart und öffnet. Ein Du ist der revelatorische Modus eines Ichs. Das bedeutet, daß Gott, auch wenn er sich immer nur mittels gegenständlicher Medien offenbart, kein Objekt, sondern das ewige, absolute Subjekt ist, das wissenschaftlich unerkennbar bleibt. Das Prinzip der auf die Freiheit Gottes gegründeten Gotteserkenntnis besteht im Verhältnis Ich—Du. Da auch die menschlichen Subjekte nur in der Beziehung Ich—Du einander wirklich erkennen, stehen wir hier vor der Forderung, diese Beziehung als das zweite erkenntnistheoretische Prinzip neben der Beziehung von Subjekt und Objekt anzuerkennen. Im Vergleich mit diesem ist jene personale Beziehung ein Verhältnis sui generis.
6. Die Neuinterpretation
der traditionellen Theologie: Der dreieinige Gott als begegnender Gott
Der Weg zur Überwindung des objektiven Theismus und des nihilistischen Atheismus führt also zur Anerkennung der Beziehung Ich—Du als noetisches Prinzip sui generis. Das bedeutet, daß Gott und Mensch nicht als Objekte, sondern als Subjekte existieren. Darf man deshalb nicht über sie nachdenken und sprechen? Die Subjekte sind keine ontischen Objekte, sagten wir. Sobald wir aber anfangen, über sie nachzudenken, machen wir sie zu Objekten unseres Denkens. Dieses Denken ist jedoch nur dann richtig, wenn es die Erkenntnis vermittelt, daß Subjekte keine Objekte sind und allein in personalen Beziehungen erkannt werden können (Trtik). Eine so gestellte fundamental-theologische Aufgabe kann man dogmatisch durch eine angemessene trinitarische Interpretation der Offenbarung beantworten. Die Aufgabe eines neuen Durchdenkens der trinitarischen Lehre besteht also darin, diese als die personale und geschichtliche Selbstmitteilung Gottes zu interpretieren. Der Gott der Offenbarung ist dem Menschen tief ähnlich, aber zugleich ist er ganz anders als der Mensch. Die ganz andere Person Gottes artikuliert sich in dem theologischen Zeugnis von den drei Existenzmodi der Gottesperson, die in der Bibel symbolisch mit den Namen „Vater, Sohn und Heiliger Geist" zur Sprache kommen. Die drei Existenzmodi des Personseins
198
Zdenek Kucera
Gottes sind identisch und zugleich verschieden. Gottes Personsein ist als der Vater „im Himmel", als Logos und Sohn nicht nur „im Himmel", sondern auch auf Erden in der geschichtlichen Offenbarung, als der Heilige Geist nicht nur „im Himmel" und im Sohn auf der Erde, sondern auch in Gemeinschaft mit den Menschen — und dies jeweils ganz. Gottes Personsein ist, in sich und zu sich als ewige Gemeinschaft zu existieren; deshalb sagt die Bibel, daß er die Liebe ist. Wenn die Philosophie mit Recht sagt, daß der Mensch eine Gewißheit braucht durch das Wort der Bejahung, das von einem anderen Menschen ausgeht, so sagt die Theologie, daß es die Gottesselbstbejahung gegenüber sich und dem Menschen in der immanenten und ökonomischen Trinität ist, die den Menschen und die Welt unwiderruflich in ihrer Existenz hält und dem Menschen die Gewißheit des Glaubens gibt. Der philosophische Hintergrund der trinitarischen Lehre artikuliert das Prinzip von Distanz und Beziehung, dies hält die Philosophie für das Prinzip des Menschlichen. Das biblische Zeugnis sagt, daß Distanz und Beziehung im Verhältnis Gottes zum Menschen gründen und als zwischenmenschliches Prinzip nachfolgen. Primär ist das ewige Du-sein Gottes, sekundär das Du-sein des Menschen. Dies bleibt in Geltung, auch wenn die konkrete Erfahrung einer endlichen Person das Medium für die Gotteserfahrung bildet. Denn Gott öffnet sich uns in einer menschlichen Person, wie er sich uns schon in Christo geöffnet hat. Klassisch spricht Martin Buber von solcher Gottesselbstmitteilung gegenüber dem Menschen unserer Zeit (vgl. Begegnungen, S. 37): „Ich besitze nichts mehr als den Alltag, aus dem ich nie genommen werde. Das Geheimnis tut sich nicht mehr auf, es hat sich entzogen oder es hat hier Wohnung genommen, wo sich alles begibt, wie es sich begibt. Ich kenne keine Fülle mehr als die jeder sterblichen Stunde in Anspruch und Verantwortung. Weit entfernt davon, ihr gewachsen zu sein, weiß ich doch, daß ich im Anspruch angesprochen werde und in der Verantwortung antworten darf, und weiß, wer spricht und Antwort heischt. — Viel mehr weiß ich nicht. Wenn DAS Religion ist, so ist sie einfach ALLES, das schlichte gelebte Alles in seiner Möglichkeit der ZWIESPRACHE." Dies ist Rede von Gott, der weder ein Objekt ist noch eine Illusion, den wir weder manipulieren noch umgehen können. Als Zwiesprache hilft er und bringt zusammen, als Rede vom lebendigen Gott, der nahe ist und zugleich fern. So begegnet uns Gott heute.
Folgen der ontologischen Rede von Gott
WILLIAM L. ROWE
Analytical Philosophy and Tillich's Views on Freedom Philosophers of religion within the analytical tradition have not, on the whole, been seriously interested in the philosophical theology of Paul Tillich. And those few who have taken an interest in Tillich have been mainly critical, at best calling his work unclear — and at worst confused. To a considerable extent, this neglect and negative reaction to Tillich may be viewed as the outcome of factors that have little to do with the true merit of Tillich's work. It is worth noting some of these factors here. Tillich had the misfortune to come along when logical positivism with its verification criterion of meaning was still a dominant force in Anglo-American philosophy. Like so much else in theology and metaphysics, Tillich's work failed to satisfy the positivist's longing for the empirically verifiable. Logical positivism gave way to ordinary language philosophy, a method of thought that viewed with great suspicion the use of ordinary words like 'freedom,' and 'participation' in ways far removed from their ordinary meaning and setting. So ordinary language philosophy was no friendlier to Tillich than logical positivism had been. It is also true that during the fifties and sixties, philosophy in the analytical tradition was piecemeal, rather than systematic. One worked on this philosophical problem, thinking that its solution would be quite independent of whatever other problems and solutions there might be. It was a period of revision, not of vision. Tillich, along with other system builders, naturally suffered from neglect. But this too has passed. Perhaps in reaction to the extravagant claims of positivism and ordinary language philosophy, analytical philosophy has entered a new stage characterized in part by an openness to what in the earlier period would have been rejected as speculative philosophy and old fashioned
202
William L. Rowe
metaphysics. Indeed, the great system builders of the past: Spinoza, Kant, Hegel, and particularly Leibniz, have once again become subjects of serious study within the analytical tradition. But this new interest in systematic philosophy and speculative metaphysics has not kindled among analytical philosophers any really serious interest in Tillich's work. And this suggests that still other factors may contribute to this neglect. In addition to the period of logical positivism and ordinary language philosophy, and the discontent with systematic philosophy, we must also note the rift between analytical philosophy and continental thought. Although the great divide between existentialism and phenomenology on the one hand, and analytical philosophy on the other, is now less wide and less deep than it was a decade or two ago, it is still an important factor. And since a good bit of Tillich's thought appears to spring from continental philosophy, this factor undoubtedly has something to do with the fact that his work has a small and less than sympathetic audience among philosophers of religion who work in the analytical tradition. Finally, I might mention a factor connected with the religious beliefs of analytical philosophers of religion. It has become increasingly apparent over the past decade that many of the philosophers in the analytical tradition who work in the philosophy of religion are themselves Christians. Moreover, these Christian philosophers tend to believe that God is a person, and that in some way quite distinct from the other religions, Christianity is God's way of encountering human life. Tillich's view of the God beyond the God of theism, and his more universalist view of the encounter between man and God, are likely to be somewhat unattractive to these philosophers. For them, the theological systems of Aquinas and Calvin are more appealing objects of serious study than is Tillich's Systematic Theology. For all these reasons, and perhaps others I've not mentioned, the response to Tillich by analytical philosophers of religion has been quite limited and somewhat negative. Moreover, as I noted earlier, some of the reasons occasioning the neglect of Tillich appear to have little to do with whatever intrinsic merit there may be in Tillich's work. It would be a mistake, however, to conclude that the criticisms of Tillich advanced by analytical philosophers of religion should be simply dismissed as somehow the inevitable by-products of philosophical prejudice
Analytical Philosophy and Tillich's Views on Freedom
203
or the fashions of the time. Every piece of intellectual work, including Tillich's Systematic Theology, is the product of predilections, intellectual habits and fashions. So also are the criticisms of Tillich by analytical philosophers of religion. But we need to distinguish between (a) the motivating factors that may lead analytical philosophers to appraise Tillich's work in a certain way and (b) the merit of their appraisals. The merit of an appraisal of Tillich depends only on the correctness of the interpretations of what Tillich says and on the cogency of the arguments for the conclusion the appraisal seeks to establish. With the distinction just made in mind, I now turn to the second aim of this paper: to provide (as a philosopher of religion within the analytical tradition) my own appraisal of Tillich's views about freedom. In developing his own account of freedom, Tillich makes several remarks about the controversy between determinism and indeterminism. I shall discuss three of his remarks concerning this controversy, before examining his own positive account of freedom. The first of these three he puts as follows: The traditional discussion of determinism and indeterminism necessarily is inconclusive because it moves on a level which is secondary to the level on which the polarity of freedom and destiny lies. Both conflicting parties presuppose that there is a thing among other things called "will," which may or may not have the quality of freedom. But by definition a thing as a completely determined object lacks freedom. The freedom of a thing is a contradiction in terms. Therefore, determinism always is right in this kind of discussion; but it is right because, in the last analysis, it expresses the tautology that a thing is a thing. (Systematic Theology, I, p. 183) In one way this passage strikes me as correct, in another way I think it is fundamentally wrong. There has been a tendency to make a substance or a thing out of the will, and there also has been a tendency to attribute freedom directly to the will. Both tendencies must be avoided. For careful philosophers have always thought of the will not as a substance or thing, but as the power or capacity of the mind, soul or person to decide things. The will, therefore, as a power or capacity, is something that a substance may have, but it is not itself a substance. And careful philosophers, in talking about the freedom of the will, have in mind not the question of whether the will itself is free but whether the person
204
William L. Rowe
is free in his Willings. To have free will is to have power over one's will, to have power to will something and power not to will that thing. To lack free will is to be subject to necessity in one's Willings; it is to lack the power not to will what one wills. Once, then, we are clear that the will is not a thing, and that it is the person who is or isn't free with respect to his will, it is difficult to credit Tillich's claim that the controversy between determinism and indeterminism presupposes that the will is a thing and that freedom is a quality that this thing either has or lacks. What is equally puzzling, I think, is Tillich's view that the determinist inevitably wins this debate since by definition a thing "as a completely determined object lacks freedom." The word 'thing' can be used to refer both to something that was causally determined to come into being and to something that came into being but was not causally determined to come into being. The determinist holds that all things are causally determined. This is a substantive thesis, it is not something he proposes to make true by defining the word 'thing' to mean 'causally determined thing.' I conclude, therefore, that there is little of genuine merit in Tillich's first remark about the controversy between determinism and indeterminism. Tillich next turns to expose the fundamental weakness of indeterminism as an account of freedom. Indeterministic freedom is the negation of deterministic necessity. But the negation of necessity never constitutes experienced freedom. It asserts something absolutely contingent, a decision without motivation, an unintelligible accident which is in no way able to do justice to the moral and the cognitive consciousness for the sake of which it is invented. (ST, I, p. 183) What Tillich says here strikes me as exactly right. The determinist holds that our acts of will are causally necessitated by prior events and circumstances. Since these events and circumstances are themselves, on the determinist's view, causally necessitated by yet earlier events and circumstances, it's clear that on the determinist's view our acts of will are causally necessitated by earlier factors that are beyond our control. The person, therefore, lacks the power not to will the things he does will, and hence is not free with respect to his will. The indeterminist endeavors to restore freedom to the agent simply by rejecting the claim that our acts of will are causally necessitated. But in doing no more
Analytical Philosophy and Tillich's Views on Freedom
205
than simply rejecting the determinist's causes of our acts of will, the indeterminist leaves our acts of will as uncaused accidents, random events that merely happen, as it were, "out of the blue." Simple indeterminism provides no account of our sense that we are responsible for our acts of will and the actions that follow from them, that our acts of will are not unintelligible accidents, that we bring them about, and often do so as a result of deliberation. Before turning to Tillich's third remark about determinism and indeterminism, I would like to offer a suggestion as to why the controversy between determinism and indeterminism fails to account for genuine human freedom. The problem is not, as Tillich would have it, that both sides to the controversy view the will as a thing, the problem is that both sides admit only one sort of causation. Both sides share the assumption that ultimately there is only one sort of cause of an event, and that is some other event that occurred earlier and is related by a law of nature to the event which is its effect. The determinist finds the cause of an act of will in some earlier event that transpires in the agent — something like his desiring some end and believing that a certain action will secure that end. (Such causes are often summed up as the agent's "motives and circumstances".) The indeterminist denies that our acts of will are causally necessitated by a chain of earlier events. He denies this because he believes such causation destroys freedom. But since he, no less than the determinist, admits no other kind of causation, our acts of will are left without any cause at all, and thus appear to be accidental, random events. The solution, I suggest, is to return to an older idea of causation — sometimes called 'substance-causation' or 'agent-causation' — and to hold that acts of will that are free are caused by the agent and not caused by any earlier events. By introducing (re-introducing) the idea of agentcausation, we can account for the sense of responsibility for our acts of will that simple indeterminism ignores. We are responsible for our acts of will because we ourselves freely cause them. A view such as I have just briefly described was worked out in some detail by the 18th century Scottish philosopher, Thomas Reid. Reid accepted the determinist's claim that every event has a cause — indeed, he thought the claim to be a necessary truth. But he denied that every event has an event-cause. Our acts of will that are free are events and are, therefore, caused. But, on Reid's theory, they are not caused by prior events, as the believers
206
William L. Rowe
in necessity from Hobbes to Hume maintained. Rather, free acts of will are caused by the agent, the person whose acts they are. Tillich concludes his brief discussion of determinism and indeterminism by arguing that both positions are incoherent: Both determinism and indeterminism are theoretically impossible because by implication they deny their claim to express truth. Truth presupposes a decision for the true against the false. Both determinism and indeterminism make such a decision unintelligible. (ST, I, p. 183) What are we to say of this argument? Perhaps before we say anything about it, we should be clear that we understand its structure. Clearly, the conclusion of the argument is that neither the thesis of determinism nor the thesis of indeterminism can possibly be true. This is an extraordinarily strong conclusion. Tillich is not just saying that as a matter of fact neither determinism nor indeterminism is true. He is saying that neither could possibly be true. They are both, he claims, theoretically impossible. Why so? Because "truth presupposes a decision for the true against the false," and "both determinism and indeterminism make such a decision unintelligible." Let's take these two premises one at a time, starting with the second. Suppose, per impossible (for Tillich), that indeterminism were true. Could there then be a decision for that truth? What is a decision for a truth? Well, we might think of it as a decision to accept or believe that truth. Could there be such a decision or act of will? Well yes, I should think there could be. Indeterminism, as we've seen, does not preclude the occurrence of decisions or acts of will. But, as we've also seen, the decision or act of will would be an accident, a random event "out of the blue." And presumably, it is the second feature here that Tillich is focussing on. The decision would be "unintelligible." But if this is his point — at least so far as indeterminism is concerned — Tillich's argument, as stated, is logically invalid. Truth, he says, presupposes a decision for the true. Suppose we accept this for a moment. What we have just seen is that indeterminism precludes not decision for the true, but only intelligent decision for the true. In which case, it simply won't follow that indeterminism cannot be true. His conclusion will follow only if we take indeterminism to preclude any decision at all, or recast the other premise so that it holds that truth presuppose intelligent decision for the true. But we may be misreading Tillich's claim that determinism
Analytical Philosophy and Tillich's Views on Freedom
207
and indeterminism "make such a decision unintelligible." Perhaps he means that determinism and indeterminism preclude decision for the true altogether. Perhaps he thinks that a decision by its very nature must be neither an accidental happening nor a causally necessitated event. If so, then his argument as stated retains the virtue of logical validity. But his premise that determinism and indeterminism make decision impossible is, I think, at best doubtful. What of the other premise: that truth presupposes a decision for the true and against the false. How are we to understand this claim? Although I may be twisting Tillich's words into a form I can understand, and thus inadvertently misinterpreting his claim, I would take this claim to imply at least that a proposition can be true only if it is possible for someone to decide to accept or believe it. But if this is what his claim means or implies, then I think it is false. For suppose, as I think is the case, that only a conscious being can accept or believe a proposition. Consider the proposition 'No conscious being exists, ever did exist, or ever will exist.' That proposition is of course false. But I take it that it logically might have been true. Of course, I could be wrong about that. If Anselm's ontological argument is correct, God is both a conscious being and a necessarily existing being. And if that were so then it would not be logically possible that no conscious being exists, ever did exist, or ever will exist. But most of us think that this is logically possible. And if it is, then it is not true that a proposition can be true only if it is logically possible for someone to decide to accept or believe it. For it is not logically possible that someone should accept or believe the truth that no conscious being exists, did exist, or ever will exist. From the fact that someone believes the proposition that no conscious beings exists, did exist, or ever will exist, it logically follows that that proposition is false. But that proposition might have been true. So there are propositions that could be true but are such that no one could believe them if they were true. And what this means is that unless we can give a better interpretation of Tillich's remark that truth presupposes a decision for the true and against the false, we will have to judge that his argument is a failure, or at least not cogent for us. I've given a somewhat critical appraisal of Tillich's remarks concerning the controversy between determinism and indeterminism. But what of Tillich's own positive account of human freedom? As is well known, Tillich identifies human freedom with the power of the personal center
208
William L. Rowe
of a human being to act. Unlike the simple indeterminist, Tillich holds that free acts are determined: they are determined by the centered totality of the person. But unlike the determinist, Tillich does not think free acts are determined by any of the particular parts (desires, motives, beliefs, etc.) that are united together into the whole that is the centered self of the person. As he puts it: "... it is impossible to derive the determinacy of the whole, including its nonseparated parts, from the determinacy of isolated parts. Ontologically the whole precedes the parts and gives them their character as parts of this special whole." (ST, I, p. 184) Perhaps Tillich's view is something like this. A centered self is a whole made up of parts which, as isolated from the whole, are causally determined by earlier events and circumstances. These causally determined parts, however, when united into the whole which is the centered person, are subject to the influence of the whole. I take this to mean, in part, that our desires, the strength of various motives, etc. can be modified by the centered self. The centered self, therefore, although limited by whatever desires and motives that come together in the self, is free in that often it can modify their force and outcome. The causally determined parts of the centered self constitute our destiny. But the whole is not simply a function of the causally determined parts. It has a limited power to influence the parts, and in that power resides the freedom of the self. How is Tillich's view different from the view I sketched earlier and attributed to Thomas Reid? There are, I believe, two principle differences. One major difference, so far as I can see, is that Reid takes the person or agent to be a substance that has certain powers and properties; whereas Tillich takes the person to be an organic whole made up of parts which in isolation are causally determined. But freedom for each seems to be a power possessed by the agent (Reid) or the centered self (Tillich). There is a second difference, which brings me to the final point of my appraisal of Tillich's view of freedom. Reid believed that freedom is unique to beings possessed of will and intelligence. Accordingly, he denied that nonhuman animals have freedom. And it would never have occurred to him that anyone would be disposed to attribute freedom to inanimate objects like sticks and stones. Tillich, however, introduces freedom and destiny as ontological elements, as features of anything that
Analytical Philosophy and Tillich's Views on Freedom
209
is. Tillich, therefore, is bound to attribute freedom to anything that is, to sticks and stones, as well as cabbages and kings. It is obvious, however, that sticks and stones have no wills and lack intelligence. Since freedom is a power over one's acts of will, one's decisions, it is equally obvious that sticks and stones lack freedom. Confronted with the obvious, Tillich acknowledges that stones, for example, don't deliberate about what to do, don't make decisions, and aren't responsible for what they do when they, say, fall on someone's head after being thrown in the air. Strictly speaking, therefore, it is false that stones are free. One would think that if one is searching for an ontological element, some feature that is so basic that it is exhibited by whatever has being, that what one would hope to discover is some feature or characteristic that is exhibited by everything that is. And what we've just seen is that freedom is not such a feature. Tillich's way around this difficulty is to hold that even though stones aren't free, there is a feature of the stone that in some way resembles the feature of freedom that is found among humans. What is this feature? He calls it spontaneity. Stones, like humans, are centered wholes that react to the forces that play upon them. Perhaps that is so. But so what? What does this have to do with freedom? Freedom is the capacity to react to the forces that play upon us in ways that are not determined by those forces and the facts about us which are beyond our control. We have no reason to think that anything like this is true of stones. Stones, as centered units, react to the forces that play upon them in ways that are determined by those forces and facts about the stones. Given the nature of acid, for example, it reacts to the force of the presence of zinc by dissolving it. But the acid has no power not to dissolve the zinc in those circumstances. It dissolves the zinc of necessity. And it is precisely this point that enables us to say that the acid does what it does of necessity and not freely. If we like, we might be able to argue that everything that has being is in some way a centered whole with the capacity to react to the forces that play upon it. And if we want to call such a capacity 'spontaneity,' we might be able to say that spontaneity is an ontological element. But spontaneity is not freedom; it lacks the distinguishing feature of freedom. If we then turn things around, as Tillich does, and say that freedom is an ontological element, a feature of everything that has being, we stand the risk of speaking falsely, or of using the word 'freedom' in a way that is very likely to mislead of confuse. And this, I am afraid, is just what Tillich does when
210
William L. Rowe
he tells us: "Therefore, freedom and destiny can be applied to subhuman nature only by way of analogy." (ST, I, p. 185) In this paper I've listed some of the reasons and causes for the relative neglect of, and somewhat negative response to, Tillich's work by analytical philosophers of religion. I've also endeavored to provide a concrete example of an analytical philosopher's critical appraisal of Tillich's view of freedom. But I do not want to suggest that Tillich's work as a whole merits such negative treatment by analytical philosophers of religion. For if one steps back and endeavors to see Tillich's philosophy of religion as a whole, there is, I believe, much to be said in its favor, even by analytical philosophy. Working out of a metaphysical system that resembles neo-Platonism, Tillich succeeded in providing a comprehensive description and explanation of the role of religious symbols in human life, a description and explanation that endeavored to be adequate to the powerful subjective elements in religion, while at the same time preserving its claims to be expressing objective truth. Although we may have doubts about its metaphysical underpinnings, I think Tillich's efforts to see all religious symbols as directed toward the God beyond the God of theism, toward being-itself, provides a philosophically interesting and important account of religion, an account that merits interest on the part of us all, even those who, for better of worse, find ourselves in the camp of analytical philosophy. But that is a story for another time.
JEAN-CLAUDE PETIT
Wahrheit und Kairos beim frühen Tillich Es gibt nicht viele Begriffe, die in der Philosophie einen so zentralen Stellenwert haben wie den Wahrheitsbegriff. Zwar darf die Vielfältigkeit seiner Bedeutungen und manchmal sogar sein Mangel an genau faßbarer Bedeutung nicht außer acht gelassen werden. Aber dessen ungeachtet behauptet doch von Piaton und Aristoteles über Descartes, Kant und Hegel bis zu Heidegger, oder Russell, oder Habermas der Begriff der Wahrheit seinen entscheidenden Platz in der Geschichte der Philosophie. Das gleiche gilt für die Geschichte der Theologie. Vielleicht ist dies weniger sichtbar, solange man sich mit Schultheologie beschäftigt, aber sobald man sich den bedeutenden Texten der Theologiegeschichte zuwendet, ist leicht zu zeigen, daß auch hier der Wahrheitsbegriff einen ebenso zentralen wie entscheidenden Begriff darstellt. Schon in der Bibel erscheint er als ein wesentlicher Ausdruck der Begegnung des Menschen mit Gott und wird zu einem Schlüsselbegriff, mit Hilfe dessen Israel seine religiöse Erfahrung zu deuten sucht. Später spielt er in der johanneischen Tradition seine allgemein bekannte entscheidende Rolle. Und in der ganzen weiteren Entwicklung der aus dieser biblischen Erfahrung entsprungenen theologischen Tradition spielt der Wahrheitsbegriff sowohl für die Organisation der Denksysteme als auch für die Formulierung der Botschaft immerzu eine entscheidende Rolle, selbst wenn ihm unterschiedliche Bedeutungen zugewiesen werden, die mehr sind als einfache Nuancenunterschiede. Augustinus, Anselm von Canterbury, Thomas von Aquin, Luther, Nikolaus von Cues und, in unserer unmittelbaren Nähe, Rudolf Bultmann, Ernst Käsemann, Eberhard Jüngel, wie auch Bernhard Welte und Karl Rahner — alle diese Namen stehen als Zeugen unserer westlichen theologischen Tradition, um uns daran zu erinnern, daß in der Formulierung der Glaubenserfahrung der Wahrheitsbegriff eine fundamentale Stelle einnimmt.
212
Jean-Claude Petit
Wenn man dies alles bedenkt, so ist es sehr erstaunlich, daß man wenigstens auf den ersten Blick feststellen muß, daß in dem doch so umfassenden und so tief in der westlichen Denktradition verankerten Werk Paul Tillichs die Frage nach der Wahrheit nur einen zweitrangigen Platz einnimmt. Wenn man das Werk im Ganzen betrachtet, ist man in der Tat zu der Feststellung gezwungen, daß der Wahrheitsbegriff nur sehr sporadisch und oft wie beiläufig auftaucht, und daß sein Vorkommen keinerlei grundsätzliche oder auch nur im geringsten ausgearbeitete Auseinandersetzung andeutet. Nur eine Ausnahme scheint zu bestehen: es handelt sich um den im Werk Tillichs allerdings sehr wichtigen Text mit dem Titel Kairos und Logos aus dem Jahre 1926.1 Aber selbst hier bleibt der Leser erstaunt. Zwar nimmt der Wahrheitsbegriff in diesem Text in der Tat eine zentrale, ja entscheidende Stellung ein, doch erregt nun ihrerseits die Art und Weise, mit der die Frage angegangen wird, Verwunderung. In der philosophischen Tradition, und zwar bereits bei den Griechen, aber dann in noch viel entscheidenderer Weise im Mittelalter und bis ins 19. Jahrhundert, wird die Frage nach der Wahrheit vor allem im Rahmen einer metaphysischen Theorie der Erkenntnis erörtert, um das Wissen zu sichern, das man in der Übereinstimmung von Vernunft und Sein begründet sieht. Das Wahre ist das Sein selbst, insofern es der Vernunft angeboten ist, die es erkennt. Die Theologie hat diese metaphysische Fragestellung lange geteilt. Wenn sie jedoch ihrem eigenen Ursprung enger verbunden bleibt, entfaltet sie die Frage nach der Wahrheit in einem anderen Gedankengang: nämlich dem der Begegnung mit dem Heil Gottes, das in Jesus Christus angeboten wird. Der Wahrheitsbegriff wird dann vor dem Horizont der Bundestheologie verstanden und bezeichnet gewöhnlich Gott selber in seiner heilbringenden Gegenwart. Nun stellt aber weder die Theorie von der Wahrheit als Entsprechung noch diejenige von der Wahrheit als Gegenwart Gottes den Kern der Tillichschen Überlegungen zur Wahrheit dar. Und doch stellen sie einerseits die Frage nach der Wahrheit im Rahmen einer Überlegung zum Thema der Erkenntnis, und ihre Fragestellung mündet andererseits in die Frage nach unserem Verhältnis zum Göttlichen. Man darf also „Kairos und Logos. Eine Untersuchung zur Metaphysik der Erkenntnis." In: P. Tillich, Philosophie und Schicksal. (Gesammelte Werke, IV) Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart 1961, S. 4 3 - 7 6 . ( = G.W. IV)
Wahrheit und Kairos beim frühen Tillich
213
mit Recht die Frage stellen, was dabei aus der Frage nach der Wahrheit im Werk Tillichs wird. Zwar erlaubt es mir der beschränkte Rahmen dieser Arbeitssitzung nicht, Ihnen eine Analyse vorzulegen, die all das berücksichtigen könnte, was zu einer befriedigenden Antwort auf diese Frage berücksichtigt werden müßte. Meines Wissens gibt es im übrigen keinerlei Untersuchung zum Thema der Wahrheitsfrage bei Tillich. Anstatt Ihnen eine eigenständige Interpretation zu unterbreiten, die ich im beschränkten Rahmen dieses Vortrags nicht zufriedenstellend begründen könnte, erscheint es mir sinnvoller und vielleicht auch weiterführender, so nahe wie möglich am Tillichschen Text zu bleiben. Anhand des Textes Kairos und Logos (1926) möchte ich einige Beobachtungen zur Diskussion stellen, die uns dem nahebringen werden, was mir als der Kern des Tillichschen Denkens erscheint und uns am Ende die deutliche Abwesenheit der Wahrheitsfrage in diesem Werk verständlich machen dürften.
I. Tillich legt in diesem Kairos und Logos betitelten Text eine Interpretation der modernen Philosophiegeschichte vor, in der er grundsätzlich zwei große Strömungen unterscheidet: Eine erste, komplexe, und doch eine Einheit bildende, die im Cartesianischen Discours de la Methode ihre „erste klassische Formulierung" und in Kants Kritiken „ihren machtvollsten Ausdruck" findet. (G. W., IV, 43) Diese erste Hauptlinie ist gekennzeichnet durch ihr Interesse an der Methode und an der methodischen Beherrschung des Ich und der Welt, und sie hat sich im folgenden immer mehr in Wissenschaft und Technik entfaltet. Diese Strömung ist die stärkere, sichtbarste und fruchtbarste, im Hinblick auf die organisierte Lebensgestaltung. Neben dieser ersten Strömung gibt es eine zweite, die am Anfang eher unterirdisch verläuft, in der Zeit der Romantik aber deutlicher sichtbar wird, wo Versuche gemacht werden, sie der erstgenannten Hauptströmung einzugliedern. Für diese zweite Strömung steht stellvertretend der Name Jakob Böhmes, und ihre Wurzeln reichen bis in die Mystik und die Naturphilosophie des ausgehenden Mittelalters und der Renaissance. Tillich ist der Meinung, daß Duns Scotus und Luther in ihr eine bedeutende Rolle gespielt haben, und daß auch der Schelling der Untersu-
214
Jean-Claude Petit
chung über die Freiheit und Hegel wichtige Zeugen dieser Linie sind. Auch Schopenhauer und Nietzsche nennt er als ihre wichtigen Vertreter im XIX. Jahrhundert. Diese zweite Strömung erscheint um die Jahrhundertwende in der Gestalt der Lebensphilosophie, die sich dem methodischen Formalismus der Kantianer entgegenstellt. Nach einer eingehenden Beschreibung der spezifischen Kennzeichen der beiden Strömungen rührt Tillich an den entscheidenden Punkt, in dem sie sich unterscheiden, ja, einander sogar widerstreiten. Er schreibt: „In der zweiten Linie soll die Welt verstanden werden als Schöpfung, Widerstreit und Schicksal. Bei Democrit und bei Plato, bei Spinoza und bei Goethe, bei den Kantianern und bei den Phänomenologen [in der ersten Linie also] ist die ewige Form des Seienden das Erkenntnisziel." (G. W., IV, 46)
Auf der einen Seite also (der ersten Strömung) ein Verständnis der Welt als schon gegebener Wirklichkeit, als Substanz, die immer schon „unter dem ewigen Gesetz der Gestalt" steht. Auf der anderen Seite werden „die gegebenen Formen aus einer Katastrophe abgeleitet; der Zwiespalt der Prinzipien treibt sie empor und löst sie wieder auf. Unmöglich ist es darum, ihre Einheit als ruhenden Kosmos anzuschauen". (G. W., IV, 46) Was Tillich hier in der Gefolgschaft Schellings wiederzuerkennen glaubt, ist eine „geschichtliche Philosophie", und er unterscheidet nun die beiden großen Strömungen im Hinblick auf ihr jeweiliges Zeitverständnis: auf der einen Seite ein statisches Formdenken, für welches die Zeit keine Bedeutung hat und wo Geschichte nur verstanden wird als die Entfaltung der Möglichkeiten und Gesetze, die immer schon in der Gestalt des Menschen angelegt waren und sind; auf der anderen Seite ein „dynamisches Schöpfungsdenken", für welches die Zeit „allentscheidend" ist, nicht eine leere Zeit also, eine Zeit, die einfach abläuft, oder die einfache Dauer ist, sondern „qualitativ erfüllte Zeit", der Augenblick, der Schöpfung und Schicksal ist, der Moment der Entscheidung, den Tillich von nun an „Kairos" nennt. Der Kontrast zwischen den beiden Denkströmungen erreicht hier seine volle Gewichtigkeit und findet seinen Ausdruck im von Tillich als Gegensatz formulierten Begriffspaar von Kairos und Logos. Für Tillich ist es klar — und er sagt es im übrigen ausdrücklich — daß die zweite Denkströmung, trotz ihres verborgeneren, lange Zeit im Untergrund wirkenden und beunruhigenderen Charakters, eher in der
Wahrheit und Kairos beim frühen Tillich
215
Lage ist, dem Reichtum und den Grenzen des menschlichen Daseins gerecht zu werden, als die erste, die im Grunde auf einer Abstraktion beruht: „Es kann ja nicht verborgen bleiben, daß die Betrachtung der Wirklichkeit im Sinne des zeitlosen Logos zum mindesten eine ungeheure Abstraktion ist, die dem in Schicksal und Entscheidung einmalig verlaufenden unmittelbaren Dasein schlechterdings nicht gerecht werden kann." (G. W., IV, 47)
Die bisherigen Ausführungen stecken den Horizont ab, auf dem von Tillich die Frage nach der Wahrheit gestellt wird. Sie wird im Grande durch eine andere Frage eingeleitet, nämlich durch die Frage nach der Erkenntnis, die der ganzen Problematik eine philosophische Grundlage gibt, die aber gleichzeitig auch deutlich macht, wie Tillich von der mittelalterlichen metaphysischen Problematik der Ubereinstimmung von Vernunft und Sein abweicht. Es ist in der Tat von grundlegender Bedeutung für die Beurteilung der beiden Denkströmungen, die folgende Frage mit besonderer Aufmerksamkeit zu behandeln: in welchem Verhältnis zur Wirklichkeit steht jeweils das erkennende Subjekt? Für Tillich steht es außer Zweifel, daß die erste Denkströmung ganz offensichtlich das Subjekt seiner selbst zu enteignen trachtet, um es zu einer „leeren Stelle" zu machen, so daß es in sich selbst die ewigen Formen aufnehmen kann. Sei es in ihrer idealistischen Gestalt oder in ihrer realistischen Tradition, diese Strömung ist gekennzeichnet durch ihren Glauben „an eine absolute, inhaltsleere Stellung des Subjekts. Der Erkennende nimmt das Erkannte einfach in sich auf, sei es, daß er den Abbildern der Dinge in sich Raum gibt, sei es, daß unter Anregung der Einzeldinge die .Erinnerung' an die ewigen Wesenheiten ausgelöst wird". (G. W., IV, 47) Diese Leerstelle, die durch ein in sie wie von außen eindringendes Objekt ausgefüllt wird, formt einen Umkreis, der die Grenzen von Wahrheit und Irrtum, von Glauben und Häresie markiert, (vgl. G. W., IV, 49) Sie unterhält die Illusion einer Wahrheit, die man besitzen und sich verfügbar machen kann, einer Wahrheit, die, ganz wie das entleerte und gleichsam zeitlos gemachte Subjekt (vgl. G. W., IV, 48) selbst begriffen wird, als könne sie der Zeit und der Geschichte entrinnen, ein „abstrakter Wahrheitsgedanke", sagt Tillich, den die Geschichte selbst schließlich ins Wanken gebracht hat. (G. W., IV, 75) Um dahin zu gelangen, muß das Subjekt unaufhörlich gegen das Eindringen der Geschichte kämpfen. Es muß
216
Jean-Claude Petit
selbst gewissermaßen zeitlos und geschichtslos werden, zwar nicht, indem es aus der Zeit heraustritt, sondern durch die Anstrengung der Askese, indem es versucht, sich vor dem, was unvermutet auftaucht, was sich wandelt und uns herausfordert, in Schutz zu bringen, — sozusagen „akairos" zu werden. (G. W., IV, 48) Die Entwicklung des geschichtlichen Denkens in der westlichen Tradition hat die sichere Überzeugung dieses Standpunktes langsam immer mehr ins Wanken gebracht. Dies geschah zunächst gewiß dadurch, daß die Aufmerksamkeit nicht mehr einer Welt galt, die verstanden wurde als schon vorgängig konstituierte Wirklichkeit, die nur in einer ewig gleichen Zeit fortzudauern brauchte; die Aufmerksamkeit galt nun einer Welt, die als in Entwicklung begriffen und fortlaufender Veränderung unterworfen verstanden wurde. Doch war diese Evolution selbst noch in linearer Weise, einfach progressiv aufgefaßt. Dadurch wurde die absolute Stellung des Subjekts nicht wirklich in Frage gestellt, sondern vielmehr einfach verschoben und auf die Menschheit im Ganzen ausgedehnt. Mit anderen Worten, die Geschichte wurde zu einem zusätzlichen Erkenntnisobjekt. Die Erkenntnis selbst aber verstand sich weiterhin als außerhalb der Geschichte stehend. Um diese Illusion zu zerstören, genügt es keineswegs, wie der Gedanke der Entwicklung oder des Fortschritts es nahelegen könnte, die Idee einer Trennung oder eines Zwiespalts zwischen Natur und Ubernatur preiszugeben. Die Illusion von der Möglichkeit einer absoluten Stellung des erkennenden Subjekts kann nur wirklich überwunden werden, wenn man anerkennt, daß der Riß durch die Natur selbst hindurchgeht: „Eine grundsätzliche Einbeziehung des Erkennens, also eine grundsätzliche Aufhebung der absoluten Position des Subjekts, ist nur da möglich, wo der Riß, den das Mittelalter zwischen Natur und Übernatur aufdeckt, in der Natur selbst gefunden und die Übernatur beseitigt wird." (G. W., IV, 50)
Die Anerkennung dieses Sachverhalts stellt keinen neuen Gegenstand für einen Erkenntnisakt dar, der seinerseits davon letztlich unberührt bliebe. Die Tillichsche Interpretation unserer Welterfahrung behauptet umgekehrt, daß diese Welterfahrung eine Erfahrung in der Welt ist, daß sie ihr nicht entrinnen kann, weder durch eine Askese, die vorgeben könnte, sie in ein Jenseits der Welt zu führen, indem sie sie vor der Welt in Sicherheit bringt, noch durch die Durchführung einer
Wahrheit und Kairos beim frühen Tillich
217
methodischen Analyse, die glaubt, sie beherrschen zu können. Das Schicksal des Menschen ist es, sich selbst für dies oder jenes entscheiden zu müssen; inmitten einer Welt, die nicht für sich selbst durchsichtig ist, muß der Mensch diese Entscheidungen fällen, ohne darüber zu verfügen, was ihm begegnet, und ohne sich dieser Welt entziehen zu können, um sie von außen, von einem ewigen Licht her, betrachten zu können. Wie Tillich es in Erinnerung an Nietzsche formuliert: „Man kann nicht zu jeder Zeit jedes denken, und erst recht nicht an jedem Ort der Gesellschaft." (G. W., IV, 54) Es ist bemerkenswert, daß sich hier, in einem Text aus dem Jahre 1926, Akzentsetzungen und Beobachtungen finden, die mehr als dreißig Jahre später, in der philosophischen Hermeneutik Hans-Georg Gadamers beispielsweise, eine für das Verständnis der Wahrheit ganz entscheidende Fragestellung finden. Für Tillich ergibt sich eindeutig aus dem bisher Gesagten, daß die Wahrheit selbst der Geschichte nicht entrinnen kann, daß sie nicht „schicksalslos" ist (G. W., IV, 23), sondern voll und ganz teilhat am Schicksal des Menschen selbst und am Schicksal seiner Welterfahrung, die sich, von elftem historischen und philosophischen Standpunkt aus gesehen, wie ein immer tiefer vordringendes, neues historisches Bewußtsein ausnimmt. Doch ist dieser Weg von einer „schicksalslosen Wahrheit" zu einer ,,schicksalsgebundene[n] Wahrheit" nicht einfach die gleichsam innerweltliche Umkehr des historischen Bewußtseins. Er ist auch, in seinem Kern, die Entfaltung einer anderen Interpretation unseres Verhältnisses zum Unbedingten. Und in der Berücksichtigung dieser anderen Frage findet die Tillichsche Problematik der Wahrheit letztlich ihre volle Bedeutung. II. Was mir hier als erstes bedenkenswert erscheint, ist die folgende Bemerkung Tillichs: „Es sind religiöse Haltungen, die zu einer absoluten Position des erkennenden Subjekts treiben. Es ist eine religiöse Haltung, von der aus die absolute Position des Subjekts angegriffen wird: das Bewußtsein, dem Unbedingten gegenüber in der Sphäre des Zwiespalts und der Entscheidung zu stehen und auch im Erkennen ihr nicht ausweichen zu können." (G. W., IV, 51)
218
Jean-Claude Petit
Diese „religiöse Haltung" bedeutet für Tillich, daß die Stellung des Menschen in seiner Welt gleichermaßen seine Stellung vor dem Unbedingten ist, und daß die Entscheidung, in die er in jedem Augenblick gestellt ist, eine Entscheidung für oder gegen das Unbedingte ist. Dies ist nicht etwa so zu verstehen, daß der Mensch neben den zahlreichen Entscheidungen, die das Leben ihm abverlangt, noch zusätzlich eine weitere Entscheidung zu fällen hätte, nämlich diejenige bezüglich des Unbedingten; es bedeutet auch nicht etwa, daß diese Entscheidung die wichtigste von allen wäre und alle anderen eliminieren müßte. Tillich läßt keinen Zweifel darüber aufkommen — und es wäre leicht zu zeigen, anhand dieses Textes von 1926 bis hin zu seinen letzten Schriften, — daß er in diesem Punkt seine Auffassung nicht im Geringsten geändert hat. Für ihn ist es klar, daß eine Entscheidung in Richtung auf das Unbedingte nicht den Charakter einer Einzelentscheidung haben kann, als sei sie eine Entscheidung wie all die anderen, die wir tagtäglich eine nach der anderen fällen. Wenn dies der Fall wäre, so würden wir aus dem Unbedingten ein Objekt neben all den anderen machen. Die Entscheidung, von der hier die Rede ist, so schreibt Tillich, „kann nur eine verborgene, transzendente Entscheidung sein, die nie anschaubar ist, die aber der innerste Sinn jeder Einzelentscheidung sein kann. Nicht neben, sondern in der Einzelentscheidung kommt die Entscheidung gegenüber dem Unbedingten zum Ausdruck."
Dem fügt Tillich noch eine weitere Bemerkung hinzu, die ebenfalls entscheidend ist für unsere Fragestellung. Er fahrt fort: „ E s ist aber nicht etwa so, daß die konkrete Einzelentscheidung eindeutig wäre, daß in ihr ein J a oder ein Nein zum Ausdruck käme. Der Zwiespalt ist ja nicht aufgehoben, und darum ist jede Entscheidung zweideutig. Das abstrakte Urteil, daß es in der Welt des Zwiespalts keine Entscheidung für Gott geben könne, wird also konkret in dem Urteil, daß jede Entscheidung zweideutig ist. J a , diese Zweideutigkeit ist das eigentliche Merkmal der konkreten Existenz." (G. W., IV, 52)
Diese Interpretation ist deshalb so entscheidend für die Frage nach der Wahrheit bei Tillich, weil für ihn die Erkenntnis kein spezielles Gebiet bildet, das getrennt vom Zentrum der Persönlichkeit betrachtet werden könnte, während jene nicht den Wechselfällen der Geschichte entrinnen könnte. Die Erkenntnis ist für Tillich gerade keine technische Beschäftigung, die „wie alles Technische rein sachlich nach den Formzusammenhängen der Dinge zu erledigen" wäre. (G. W., IV, 53) Jegliche Erkenntnis
Wahrheit und Kairos beim frühen Tillich
219
der Wahrheit ist für den Menschen gleichsam eine Weise, dem Unbedingten gegenüber zu stehen, oder, wie Tillich es ausdrücklich sagt: „alle Erkenntnis der Wahrheit [ist] in einer bestimmten Schicht Gotteserkenntnis". (G. W., IV, 54) Das ist für Tillich deshalb so, weil in jeder Erkenntnis als ein wesentliches Moment ein geistiges Verstehen der Wirklichkeit enthalten ist, oder, wie Tillich es nennt, eine „Wesensdeutung": „In jeder, auch der exaktesten Technik am meisten unterworfenen Erkenntnis sind grundlegende Wesensdeutungen enthalten, die weder der formalen Evidenz noch der materialen Wahrscheinlichkeit zugehören, sondern die ursprüngliche, auf Entscheidungen gegründete Anschauungen sind." (G. W., IV, 56)
Dieser Bestandteil, diese grundlegende Dimension jeglicher Erkenntnis stellt selbstverständlich nicht einen Gegenstand dieser Erkenntnis dar. Niemals kann er zum Objekt der Erkenntnis werden. Er ist vielmehr, was die Erkenntnis zur Erkenntnis werden läßt. Als „geistige Angelegenheit", wie Tillich es formuliert, gehört die Erkenntnis zum Zentrum des menschlichen Daseins und ist so ganz und gar geschichtlich und mit dem Anspruch der Entscheidung konfrontiert. „Die Lehre vom Entscheidungscharakter des Erkennens hat nichts zu tun mit der Lehre vom Primat der praktischen Vernunft. Die Entscheidung, von der hier gesprochen wird, ist keine moralische. Sie ist das so wenig wie eine intellektuelle. Sie liegt in der tieferen Sicht, von der diese beiden abhängig sind und die auch nur undeutlich bezeichnet ist, wenn wir sie religiös nennen. Denn auch nicht um Entscheidung im Sinne einer spezifisch religiösen Haltung handelt es sich. Gemeint ist vielmehr die Stellung zum Unbedingten, die Freiheit und Schicksal zugleich ist, und aus der das Handeln ebenso quillt wie das Erkennen." (G. W., IV, 57) Genauso wenig wie sie zu einem neuen Erkenntnisobjekt werden kann, so wenig kann diese „geistige Angelegenheit" zur Ausarbeitung einer neuen Methode führen. Dies bedeutet jedoch nicht, daß der „Schicksalscharakter der Erkenntnis keinerlei methodische Bedeutung hätte". (G. W., IV, 59) Doch darf diese methodische Bedeutung nicht in der Ausformung einer Technik oder einer „Methode" im engeren Sinn des Wortes gesehen werden, sondern vielmehr als eine, wie Tillich sagt, „methodische Haltung" (G.W., IV, 59) den Dingen der Welt gegenüber. Während in letzter Zeit hauptsächlich dieser technische Aspekt der Methode besondere Beachtung genossen hat und einer gewissen Vollendung zugeführt wurde, kommt es jetzt darauf an, von
220
Jean-Claude Petit
neuem der Bedeutung unserer Haltung den Dingen der Welt gegenüber bewußt zu werden. Diese Haltung findet ihren Ausdruck in einer Veränderung der Bewegung, die auf sie hintreibt. Die sachverständige Anwendung einer Methode, die auf einem technischen Können beruht, setzt voraus, daß unser Zugang zu den Dingen die Beherrschung ist, die wir uns von ihnen versprechen. Für Tillich aber geht es hier nicht um Beherrschen, sondern darum, uns auf dem Weg „zum Inneren der Dinge" zu bewegen. Und dieses „Innere der Dinge" ist für Tillich der Ort, wo sie „im Schicksalszusammenhange, d. h. vor dem Unbedingten, stehen". (G. W., IV, 59) Dieser „Weg, der ins Innere der Dinge führt", muß zweifellos als die Tillichsche Ubersetzung des einzig echten ödös der Methode verstanden werden — als das für Tillich einzig mögliche Verständnis der „Methode", die eine lange Uberlieferung als die technische Meisterung unserer Weltbeherrschung interpretiert hat. Aber während die Vollendung dieser Beherrschung sich selbst als „Wahrheit" bezeichnet, stellt sich hier die Frage, ob es in unserer Macht steht, diesen Weg bis zum Ende zu gehen und ob man mit einer gewissen Zuversicht hoffen darf, bis in dieses Innere der Dinge zu gelangen, zu dem dieser Weg uns führen soll, und dessen Zugang nun seinerseits auch „Wahrheit" heißen soll. Die Veränderung, der Tillich hier die überkommene Idee der Methode unterwirft, ist weit davon entfernt, uns den Weg zu einer vollständigen Beherrschung der Welt zu öffnen. Sie stellt vielmehr eine entscheidende Wahrnehmung der Grenzen der Erkenntnis dar. Ganz offensichtlich darf dieser „Weg" von uns nicht verstanden werden als eine bereits begehbare Straße, die wir mit Hilfe einer guten Straßenkarte finden könnten, und deren Benutzung uns bei guter Ausrüstung leicht möglich wäre. In gewisser Weise sind wir immer schon auf diesem Weg, und er liegt nicht offen vor uns, wie eine schon gebahnte Straße, sondern öffnet sich uns immer nur in dem Maße, in dem wir uns auf die Wirklichkeit hinbewegen, die uns zuwinkt. Wenn wir mit dem Wort „Wahrheit" den Zugang „zum Inneren der Dinge" bezeichnen, dann können wir mit Tillich sagen: „Die Möglichkeit, Wahrheit zu erkennen, ist abhängig von Entscheidung und Schicksal, ist begründet im Kairos." (G.W., IV, 60) Dies bedeutet, wie mir scheint, zweierlei, worauf ich nun zum Abschluß kurz eingehen möchte. Wenn die Möglichkeit, Wahrheit zu erkennen, im Kairos begründet ist, so bedeutet dies zunächst, daß die
Wahrheit und Kairos beim frühen Tillich
221
Erkenntnis weder eine Flucht von der Existenz fort, hin zu ewigen Wesenheiten, noch die Unterordnung einer besonderen Existenz unter ein allgemeines Gesetz darstellt, sondern vielmehr, wie Tillich es ausdrückt, „Schicksal der Idee in der Existenz". Mit anderen Worten, in der Erkenntnis, nach Tillich, erscheint die Sache selbst als das, was sie ist. Die Erkenntnis wäre das Erscheinen der Sache selbst als das, was sie ist, oder, in Tillichs Formulierung, „ein Ausdruck, eine Existenzform ihres Schicksals". (G. W., IV, 73) Das zweite, was mir in der Verbindung von Erkenntnis und „Kairos" implizit zu sein scheint, ist dies: dieses „Erscheinen der Dinge" oder dieser „Zugang zum Inneren der Dinge" ist eine gleichsam unendliche Aufgabe, die nicht vollständig und endgültig gelöst werden kann. Kein Urteil, keine Erkenntnis kann der Zweideutigkeit des Daseins entrinnen: „Ein Urteil, das der Zweideutigkeit enthoben ist, ein Urteil von unbedingter eindeutiger Wahrheit kann nur das fundamentale Urteil über das Verhältnis von Unbedingtem und Bedingtem selbst sein." (G. W., IV, 73)
Ein solches Urteil ist in der Tat das „Urteil schlechthin". An diesem Punkt kann das erkennende Subjekt keinerlei absoluten Anspruch mehr erheben, und das erkannte Objekt erscheint in seiner ganzen Zweideutigkeit: „Dieses Urteil ist somit das Urteil schlechthin, das von jeder seiner Ausdrucksformen, auch von der hier gegebenen, unabhängig ist, das die Wahrheit schlechthin konstituiert. Es gibt nichts, was sich diesem Urteil entziehen könnte. Es selbst aber ist die Voraussetzung alles Urteilens, Fragens, Antwortens. Man hat darum eigentlich kein Recht, es ein Urteil im besonderen Sinne zu nennen, es ist vielmehr der dem Urteilen innewohnende metaphysische Sinn. Wird es wie hier zu einem ausdrücklichen Urteil gemacht, so verliert es als solches die Würde, die ihm als Urteilssinn zukommt. Es begibt sich in den Kontext der Erkenntnis und steht mit ihm unter dem Nein. Der absolute Standpunkt ist also nie ein Standpunkt, auf dem man stehen kann, er ist vielmehr der Wächter, der das Unbedingte schützt, der eine Verletzung der Unbedingtheit durch einen bedingten Standpunkt abwehrt." (G. W., IV, 74)
Dieser Gedanke führt unsere Darlegung einem vorläufigen Abschluß zu. In der Tat finden wir hier wieder, was einer der Leitgedanken des gesamten Tillichschen Denkens zu sein scheint: diese sehr starke Opposition all dem gegenüber, was das Unbedingte im Bedingten einfangen und es so auf sein eigenes Maß einschränken zu können vorgibt. Dies ist der Grund, warum Tillich hier anstatt von einem absoluten
222
Jean-Claude Petit
Standpunkt (und sei er auch als „Wächterstandpunkt" gedacht) lieber von einem dauernden, harten Kampf mit einem ernstzunehmenden Gegner spricht, der sich als unbedingt setzen will. Der Wächter will diesen Anspruch zerstören und den Blick freihalten auf das, was allein unbedingt sein kann. „Damit", so fahrt Tillich fort, „ist für die Wahrheitsfrage durchgeführt, was im Grundprinzip des Protestantismus, dem Prinzip der Rechtfertigung aus dem Glauben, enthalten ist: dieses nämlich, daß im Zusammenhang des Daseins eine anschaubare Verwirklichung des Heiligen nicht vorhanden ist, daß alles Dasein dem Unbedingten gegenüber zweideutig bleibt." (G. W., IV, 75)
Die Wahrheit, auf deren Erreichung die Erkenntnis in dieser Lage hoffen kann, ist eine Wahrheit, die Tillich als „dynamische" beschreibt, d. h. eine Wahrheit, die niemals vollständig erlangt werden kann und die zu jeder Epoche in einer neuen Weise in Erscheinung tritt. Es handelt sich nicht um eine „relative" Wahrheit, da es kein Absolutes gibt, in Hinblick auf das sie als „relativ" bezeichnet werden könnte. Der dynamische Wahrheitsgedanke hebt die Alternative von „absolut" und „relativ" auf: „Denn der Kairos, der Schicksalsmoment des Erkennens, ist absolut, insofern er in diesem Augenblick vor die absolute Entscheidung für oder wider die Wahrheit stellt, und er ist relativ, sofern er weiß, daß diese Entscheidung nur als konkrete Entscheidung, als Zeitschicksal möglich ist." (G. W., IV, 76)
Tillich kommt in der folgenden Ausarbeitung seines Werkes nur noch sehr selten auf den Wahrheitsgedanken zurück. Dies mag verwundern, da doch seine Stellungnahme, die er ausdrücklich als eine Überwindung der Hauptlinie des westlichen Denkens kennzeichnet, das Ergebnis einer ganz selbständigen Analyse des menschlichen Daseins ist, die gewisse Elemente der biblischen Tradition zum Thema der Wahrheit wieder aufnimmt und die schon vorwegnimmt, was die philosophische Hermeneutik dreißig Jahre später ausarbeiten wird. Wir müssen zugeben, daß das Wort „Wahrheit" in der Folge nie wieder ein Schlüsselwort der Tillichschen Theologie ist. Aber der Text Kairos und Logos deutet an, in welche Richtung wir suchen müssen, um die Wirklichkeit zu finden, auf die uns das Wort verweist. Und diese Wirklichkeit, so will mir scheinen, bleibt in der Mitte seiner Reflexion lebendig: es handelt sich um die Frage nach der Art und Weise, auf die das menschliche Dasein als ganzes vom Unbedingten angezogen und getragen ist.
JEAN-CLAUDE PETIT
Einige Bemerkungen über die Bedeutung des Nichts in Tillichs Religionsverständnis und für die religiöse Erfahrung der Moderne Ich habe meinen Ausführungen den Titel gegeben: „Einige Bemerkungen über die Bedeutung des Nichts in Tillichs Religionsverständnis und für die religiöse Erfahrung der Moderne." Betrachten wir unsere Zeit im ganzen, so können wir in der Tat nicht davon sprechen, daß Gott oder das Göttliche sich in ihr auf eine unmittelbare und ganzheitliche Weise zeigt. Es scheint vielmehr eher so, als ob wir in ihr ein „Fehl Gottes" feststellen müßten. Die religiöse Erfahrung in dem Sinne, wie sie von unserer Tradition in den vergangenen Jahrhunderten verstanden wurde, scheint sich zurückgezogen zu haben. Dieser Ausfall der religiösen Erfahrung stellt jedoch offenbar selbst eine Erfahrung dar, wenngleich es sich dabei um eine negative und daher oft unbemerkt gebliebene Erfahrung handelt. Als negative Erfahrung ist diese Erfahrung jedoch im Grunde nur möglich, wenn sie irgendwie an eine positive religiöse Erfahrung gebunden bleibt. Wir würden wohl kaum so viel Aufhebens vom Säkularisierungsprozeß unserer Zeit und dem damit verbundenen Ausfall der religiösen Erfahrung machen, wenn sich dieser Tatbestand nicht abheben würde von anderen Situationen des menschlichen Daseins in der Geschichte, von denen wir wissen, die vielleicht noch in unserem Gedächtnis verankert sind, die wir erst vor kurzem hinter uns gelassen haben und die uns auf jeden Fall nicht gleichgültig lassen. Wir können mehrere bedeutsame Zeugen dieser Erfahrung anführen. Ich denke beispielsweise an Bertolt Brecht. Im letzten Gedicht seiner
224
Jean-Claude Petit
„Hauspostille", das den Titel „Gegen Verführung" trägt, lesen wir in der letzten Strophe: Laßt Euch nicht verführen Zu Frohn und Ausgezehrt Was kann Euch Angst noch rühren: Ihr sterbt mit allen Tieren, Und es kommt nichts nachher.
Wie Bernhard Welte festgestellt hat, ist „das Bemerkenswerte an diesen eindrucksvollen Zeilen dieses, daß die Verführung und die Angst ausdrücklich abgewehrt werden und daß abschließend eine ausdrückliche und scharfe Negation ausgesprochen wird: „Es kommt nichts nachher". Die Strophe ist so ein wichtiges Zeugnis dafür, daß die religiöse Erfahrung ausfällt, und zwar so, daß dieser Ausfall selber eine Erfahrung ist und also etwas, das vom Dichter ausdrücklich bedacht und ausgesprochen werden muß, über das er also nicht einfach hinweggehen kann." 1 Ein anderer Zeuge ist T. S. Eliot in seinen „Four Quartets", vor allem mit den Zeilen, die beginnen mit „O dark, dark, dark. They all go into the dark." Ich denke auch an Paul Celan und sein Gedicht „Mandorla" aus dem Gedichtband „Die Niemandsrose". Wir lesen dort: In der Mandel — was steht in der Mandel? Das Nichts. Es steht das Nichts in der Mandel. Es steht und steht.
In der Ikonographie und der religiösen Bildhauerkunst ist die Mandel der Ort der Erscheinung Gottes und des Göttlichen. Eine Umrandung in Mandelform umgibt die Darstellung Gottes und unterstreicht seine Gegenwart. Der Dichter lenkt seinen Blick auf diese Mandel, aber er sieht dort nur das Nichts. Wo einst Gott war, steht nun das Nichts. Auch Nietzsche ist ein wichtiger Zeuge dieser Erfahrung, ebenso wie Heidegger, der in seinem Werk „Sein und Zeit" entscheidende und höchst bedeutsame Analysen der Erfahrung des Nichts bietet. Mir scheint nun, daß auch Paul Tillich als ein bedeutender Zeuge dieser Erfahrung gelten kann, und es erscheint mir besonders interessant, auf diesen Aspekt hinzuweisen, da wir hier anläßlich seines 100. Geburts-
1
B. Welte, Das Licht des Nichts. Von der Möglichkeit neuer religiöser Erfahrung. Düsseldorf 1980, S. 22.
Bedeutung des Nichts in Tillichs Religionsverständnis
225
tags versammelt sind und es uns eben darum geht, die aktuelle Bedeutung seines Denkens hervorzuheben. Tatsächlich scheint mir gerade im Hinblick auf diese offenbar fundamentale Erfahrung unserer Epoche, daß das Denken des damaligen Nachfolgers auf dem Lehrstuhl des berühmten Max Scheler in Frankfurt an Fruchtbarkeit noch nichts eingebüßt hat, und daß wir also nicht einfach eine Hundertjahrfeier begehen, sondern ein Denken ehren, das noch heute für uns echte Möglichkeiten bereithält. In seinem Text „Über die Idee einer Theologie der Kultur" formuliert Tillich eine Definition der Religion, die im Grunde sehr erstaunlich ist. Wir lesen: „Religion ist Erfahrung des Unbedingten, und das heißt Erfahrung schlechthinniger Realität auf Grund der Erfahrung schlechthinniger Nichtigkeit." Es handelt sich also zunächst um eine Erfahrung, das heißt, weder um ein theoretisches Verhältnis hinsichtlich seiner selbst und der Welt, in dem der Mensch die Initiative behielte, noch um eine Summe von Haltungen oder Verhaltensweisen, die sich von anderen Haltungen unterscheiden ließen und somit einen spezifischen Bereich des menschlichen Handelns kennzeichneten. Vielmehr spricht Tillich von einer Erfahrung und somit also von etwas, das uns begegnet, das nicht in unserer Macht steht, und das uns so weitgehend verwandelt, daß wir am Ende andere sind, als wir vorher waren. Das ist das erste. 2 Als nächstes enthält diese Definition die Idee einer Erfahrung dessen, was Tillich „das Unbedingte" nennt. Wir wissen um den Kampf, den Tillich sein Leben lang gegen jegliche Art von Objektivierung des Unbedingten geführt hat: es darf auf keinen Fall gedacht werden als etwas neben oder über den anderen Dingen unserer Welt. Tillich spricht von „Dimension", oder vom „Sinngrund", oder vom „Grund", der gleichzeitig ein „Abgrund" ist. Man könnte die Meinung vertreten, daß diese Formulierungen auch problematisch sind, aber eins ist gewiß: unter keinen Umständen darf für Tillich dieses Unbedingte als ein Gegenstand verstanden werden. Dies ist in aller wünschenswerten Klarheit in seinem Text von 1925 über die Religionsphilosophie ausgedrückt: 2
Zum Erfahrungsbegriff, vgl. J. C. Petit, „Theologie et experience." [„Theologie und Erfahrung."] In: L'experience comme lieu Theologique. [Die Erfahrung als .locus theologicus'.] Montreal 1983. Hrsg. v. E. Lacelle u. T. Potvin. S. 13—30. Litt.
226
Jean-Claude Petit
„Nun aber kann niemals das Unbedingte als solches Gegenstand sein." (G. W., I, 331) Diese Erfahrung, so fahrt Tillich fort, ereignet sich „auf Grund der Erfahrung schlechthinniger Nichtigkeit". Auch dies scheint mir in Tillichs Definition sehr bemerkenswert. Auf jeden Fall berührt Tillich hier meiner Meinung nach die religiöse Erfahrung, die für unsere Zeit kennzeichnend ist, und auf die ich aufmerksam machen möchte. Die „Nichtigkeit", von der nun die Rede sein soll, darf ihrerseits ebenfalls nicht aufgefaßt werden als etwas neben oder über anderen Dingen unserer Welt, von dem wir wie von einem Gegenstand eine Erfahrung machen könnten. Auch bei diesem Nichts handelt es sich um etwas, das unserer Macht völlig entzogen ist und gleichzeitig alle Dinge unserer Welt und unsere Welt als Ganzes einschließt: „die Nichtigkeit des Seienden, die Nichtigkeit der Werte, die Nichtigkeit des persönlichen Lebens." (G. W., IX, 18) Diese Erfahrung kann uns dann zu dem führen, was Tillich ein „radikales Nein" nennt. Trotz der Bedeutung, die dieser Begriff der Nichtigkeit hier hat, kommt Tillich in diesem Text selbst nicht mehr darauf zurück. Und selbst im Ganzen seines Werkes taucht diese Idee der Nichtigkeit nicht mehr sehr oft auf, zumindest nicht unter den Begriffen von „Nichtigkeit" oder „Nihilismus" oder anderen Bezeichnungen derselben Wortfamilie. Dennoch behält sie in seinem Werk einen entscheidenden Stellenwert, der nur durch den Wandel in der Wortwahl vielleicht verschleiert wurde. Wir müssen sie wiederentdecken, wenn uns das Verständnis dessen gelingen soll, was Tillich im Grunde unverändert mit „Religion" meint. Der Text „Uber die Idee einer Theologie der Kultur" stammt aus dem Jahr 1919, das heißt, aus der Zeit kurz nach der für Tillich entscheidenden Erfahrung des Ersten Weltkrieges. Es ist nicht unerheblich, daß wir eine genaue Erwähnung der gleichen Erfahrung des Nichts in einem Text aus dem Jahre 1948 finden, der im Grunde demselben Thema gewidmet ist wie der Text von 1919, und der wie jener im Schatten einer Katastrophe geschrieben ist: der des Zweiten Weltkrieges. Tillich spricht hier von der „Erfahrung des Endes" als einem entscheidenden Element im Lauf der Geschichte. Diese Erfahrung des Endes nimmt die Form der „Erfahrung der Leere" an. Auch hier verweist diese Erfahrung weder auf eine theoretische Haltung der Welt gegenüber, noch auf eine abstrakte Schlußfolgerung
Bedeutung des Nichts in Tillichs Religionsverständnis
227
einer rationalen Analyse, sondern auf einen „Ernstfall" der Geschichte, in gewisser Weise auf eine Begegnung mit der Zeit seiner Welt, die wir nicht im Griff haben, nicht besitzen, in deren Gewalt wir hingegen stehen und der wir im Grunde angehören. Daß es sich dabei für Tillich wirklich um eine Gestalt unserer Zeit handelt, wird in seinem Text mit aller wünschenswerten Deutlichkeit ausgedrückt. Wir dürfen dabei nicht vergessen, was wir soeben aus dem Text von 1919 zitiert haben. In seinem Text von 1948 lesen wir nun: Ein neues Element ist in das Bild hineingekommen — die Erfahrung des Endes. Etwas davon erschien schon nach dem ersten Weltkrieg, aber wir fühlten es noch nicht in seiner schrecklichen Tiefe und ungeahnten Absolutheit. Wir sahen mehr auf den Anfang des Neuen als auf das Ende des Alten. W i r vergegenwärtigten uns nicht den Preis, den die Menschheit f ü r das Kommen einer neuen Autonomie zu bezahlen hat, wir glaubten noch an Übergänge ohne Katastrophen. Wir sahen nicht die Möglichkeit von Endkatastrophen, wie die wahren Propheten, die Unheilspropheten, sie ankündigten. Deshalb hatte unsere theonome Deutung der Geschichte einen leichten A n f l u g von Romantik, wenn sie auch jeden Utopismus zu vermeiden suchte. Sie ging zu Ende, weil das Ende selbst wie ein Blitzschlag v o r unseren Augen erschien, und nicht nur unter den Ruinen von Mittel- und Osteuropa, sondern auch im Überfluß dieses Landes wurde es gesehen. (G. W., I X , 87)
Die hier angesprochene Erfahrung kennzeichnet für Tillich die Situation einer ganzen Epoche. Sie steht nicht in unserer Macht. Sie kündigt sich an, breitet sich aus, so wie jene, die der Tolle Mensch Nietzsches in der „Fröhlichen Wissenschaft" voraussagt. Es ist bemerkenswert, daß dieser Erfahrung des Endes und der Leere Eigenschaften zugeschrieben werden, die unsere Tradition normalerweise dem Göttlichen vorbehält: sie besitzt, so schreibt Tillich, „eine ungeahnte Absolutheit". Die Leere, die hier erfahren wird, ist sogar eine „heilige Leere". Es handelt sich um „Erfahrung der heiligen Leere", (ebd. 88) Ganz ähnlich lautet es im Text von 1919. Das Nein, von dessen Erfahrung dort die Rede ist, ist ein absolutes Nein, ein Nein also, das überhaupt nichts unbetroffen läßt und das, indem es alles betrifft, alles in radikaler Weise betrifft. Und in diesem Moment ereignet sich ein Umschlag: „Wo diese Erfahrung zum absoluten, radikalen Nein geführt hat, da schlägt sie um in eine ebenso absolute Erfahrung der Realität, in ein radikales Ja." (G. W., IX, 18) Es handelt sich jedoch keineswegs um die Entdeckung einer anderen Wirklichkeit, die neben oder über den Realitäten der Welt bestünde, unterschieden von der Nichtigkeit als
228
Jean-Claude Petit
einer vorgängigen Erfahrung. Es handelt sich nicht einmal um zwei verschiedene Erfahrungen. Die Erfahrung der Nichtigkeit ist keineswegs ein Ausgangspunkt, ein erster Schritt, der dem Menschen anschließend eine Begegnung mit dem „Absoluten" ermöglichen würde. Die Erfahrung der Nichtigkeit ist wohl vielmehr die Gestalt, in der für Tillich, zu einer bestimmten Zeit, die Erfahrung des Absoluten erscheint. Die Erfahrung der Nichtigkeit zu machen, bedeutet nicht, überhaupt keine Erfahrung zu machen. Im Gegenteil, für denjenigen, der dieser Erfahrung nicht ausweicht, ist sie die radikalste Erfahrung, die sich der absoluten Gegenwart öffnet. Wir finden einen besonderen Ausdruck dieses Umschlags in demselben Gedicht Paul Celans, das wir zu Beginn erwähnt haben. Es ist nicht möglich, es hier im einzelnen zu interpretieren. 3 Aber vielleicht genügt es, den Text zu lesen. Wir erinnern uns: in der Mandel steht das Nichts. Und dann fährt der Dichter fort: Im Nichts — wer steht da? Der König. Da steht der König, der König. Da steht er und steht. Judenlocke, wirst nicht grau. Und dein Aug — wohin steht dein Auge? Dein Aug steht der Mandel entgegen. Dein Aug, dem Nichts stehts entgegen. Bs steht zum König, so steht es und steht. Menschenlocke, wirst nicht grau. Leere Mandel königsblau.
Bei Tillich erscheint die Erfahrung des Nichts gebunden an die Nähe bestimmter geschichtlicher Katastrophen, deren tiefe Bedeutung für das Geschick seiner Zeit er zu sehen verstand. Vielleicht erklärt der immer größer werdende zeitliche Abstand von diesen Schlüsselereignissen die Tatsache, daß die entsprechende Begrifflichkeit aus dem Vokabular der Interpretation des Religionsbegriffes in seinem Werk verschwindet. Die Formulierung, die langsam an Gewicht gewinnt, ist jene, die von der Religion spricht als von dem, „was uns unbedingt angeht", (ζ. B. G. W., V, 4 0 - 4 1 ) Diese Formulierung hat verschiedenartige Interpretationen erfahren. Die am weitesten verbreitete scheint jene zu sein, die darin einen Hinweis
3
Vgl. B. Welte, a.a.O., 5 3 - 5 4 .
Bedeutung des Nichts in Tillichs Religionsverständnis
229
sieht auf irgendeinen Gegenstand oder eine Gegebenheit unserer Welt, welche praktisch jeden Menschen auf „absolute" Weise „angeht": Geld, Ehre, Macht, usw. Ich bin eher der Meinung, daß man Tillichs „ultimate concern" verstehen muß im Rahmen der Erfahrung des Nichts und der Leere und ihres Umschlags, von denen wir gesprochen haben. Wenn Tillich von dem spricht, „was uns unbedingt angeht", so spricht er nicht von einer bestimmten einzelnen Gegebenheit neben anderen Gegebenheiten, sondern von dem, was allein uns im Grunde an die äußerste Grenze unserer selbst führen kann, weil es die äußerste Grenze von allem ist: das Nichts, die „heilige Leere", und die Erfahrung ihres Umschlags, das, was uns in Wirklichkeit und wortwörtlich unbedingt angeht.
TERENCE THOMAS
Paul Tillich, Ontology and Cultural Boundaries This paper examines one aspect of Paul Tillich's engagement with Eastern thought, a subject which exercised his mind considerably in his final days. The aspect I wish to look at is his encounter with Hinduism. Tillich had pursued a knowledge of Hinduism intermittently from his earlier days. We know this from his close acquaintance with such friends as Friedrich Spiegelberg who was undoubtedly a main source of knowledge of Hinduism for Tillich. Spiegelberg was closely engaged with Hinduism, especially in the 30s and on his European visit of 1936 Tillich tried to get help for Spiegelberg to travel to India. They met at Ascona, Switzerland on the occasion of that year's Eranos conference. The only lecture apparently attended by Tillich, apart from the one he himself gave, was on serpent symbolism in Greek and Hindu myth. He apparently didn't bother to go to hear Carl Gustav Jung. In a number of late lectures Tillich also mentions a Hindu Brahman he once met with whom he had conversed about religion. This contact will be referred to again, and the fact that this contact was more significant than Tillich appears to have realized. In the late 50s and early sixties when Tillich was engaged in lecturing on encounter and dialogue there are many allusions to India and Hinduism. We can only speculate what his final view of Hinduism would have been if he had been able to make his projected visit to India in 1962, a visit which Spiegelberg did his best to undermine with scare stories of unhygienic condition in India. A letter from Spiegelberg in the Tillich Archives expresses an extreme view of conditions of hygiene in India in the early 60s and warns Tillich in the direst way against visiting the country. The letter hits Tillich at one of his most vulnerable points since it suggests that the ice in his whisky would be from polluted river water. Spiegelberg, or someone who had been as committed as he was to being a student
Paul Tillich, Ontology and Cultural Boundaries
231
of Hinduism and had become disillusioned, informed Tillich of certain alleged effects of the doctrine of karma (the law of just desserts), to wit that this doctrine effectively ruled out the operation of agapeic love in Hinduism. 1 This information is the background to a document in the Tillich Archives in Harvard Divinity School Library which contains extensive notes for two lectures under the general title Christian Thought and Eastern Mysticism. The contents of the proposed lectures, I say proposed since there is no evidence that they were ever delivered, deal with a problem which had exercised Tillich's mind some years earlier in a different context. The original problem concerned the relation between philosophical ontology and the Biblical message. This problem, Tillich recognized, was central to systematic theology and an urgent question in his own theological thought. "The philosophical language I am using in my theological work", he said, "has often been critically contrasted with the concrete imagery of the biblical language." 2 His answer to the question makes up the James W. Richard Lectures at the University of Virginia in 1951, published under the title Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality. In that work Tillich sets out to overcome the dissonance others have experienced in his work at this point, to resolve, as he put it, the "confrontation" 3 between biblical religion and ontology, and to offer a harmony of biblical message and the question of being. In the lectures notes in the archives the question arises in the context of encounter with other religions and the desire for dialogue with representatives of other religions, what Tillich sees as the "confrontation" between biblical religion and eastern mysticism, more particularly Indian mysticism. In facing this new experience, expressed in the introduction to Systematic Theology, Vol. 3 as a kairos, he approaches the problem in exactly the same terms as employed in the Richard Lectures, using the exact same scheme. The sections in the first lecture follow the same pattern as the Richard Lectures. Hindu ontology is faced as was Western ontology with the contrast of Biblical personalism. The contrast is seen again in terms of "confrontation". I will not go into 1
2 3
Tape of unpublished Wesley Lectures delivered at the University of North Carolina, October 1958. Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, Chicago, 1955, p. vii. Ibid. p. 14.
232
Terence Thomas
the details of the earlier lectures, except to say that Tillich does not resolve the conflict between Biblical personalism and impersonal ontology but rather resolves "to live serenely and courageously" in the tensions set up by the confrontation and "to discover finally ... ultimate unity in the depths of our own souls and in the depths of the divine life". 4 Part of my task in this paper is to see if he finds the same result in the confrontation between the Christian religion and Hindu ontology. Before doing that I have to refer to two presuppositions upon which Tillich bases his study of the encounter between Hinduism and Christianity. The first refers to Tillich's typology of religions. According to this typology Hinduism belongs to the mystical type, understood as a form of protest against the distortion of the sacramental base of all religion. In the notes for the second lecture which we are considering he offers a definition of Christian mysticism and a typology of that mysticism. He suggests two meanings to the word mystical. First there is what he calls the "simple negative meaning", or the original meaning of the Greek verb muein, — "everything which is beyond the realm of calculating research". The second meaning he offers prepares the ground for his analysis of Christian mysticism, namely: "The experience of the presence of the divine, which is beyond finite reality, beyond objects and the subject." There follows a typology of mysticism, the first type being the abstract, the main type treated in these lecture notes. (The others are the concrete, such as the type represented in the mystery god, and the mysticism of St. Paul, Origen and Bernard; the sacramental type, such as the Oriental church and its liturgical emphasis and the relation of the aesthetic and the mystical transparence of the icon, the pansacramentalism of Bonaventura; and the psychological type, such as the Spanish mystics, St. John and Santa Theresa, elements of which appear in Luther.) It is to be noted that this typology is of Christian mysticism and the second of these two lectures is an apologia for Christian mysticism as contrasted with Hindu mysticism. He suggests that the historical roots of the abstract type of Christian mysticism lie in Plato, Dionysius and Orphism and the single example given is Eckhart. He also speculates that Orphism has its roots in India, thereby linking the Western roots of Christian abstract mysticism with Eastern
4
Ibid. p. 85.
Paul Tillich, Ontology and Cultural Boundaries
233
abstract mysticism. However, as we shall see, Tillich apprehends a qualitative difference between Christian abstract mysticism and Hindu abstract mysticism and the difference is rooted in contrasting ontologies. The second presupposition that Tillich bases these lectures on is that Hinduism as a religion is exclusively a monistic religion. It is explained purely in terms of Advaita Vedanta, Advaita — non-dualistic or monistic — based on the Vedantic or the late Vedic view of the relation between Brahman and Atman — Ultimate Being and individual being — understood as the expression of the classical statement tat tuam asi — "That (i. e. Brahman) thou (i. e. Atman) art" or "Thou (Joseph Bloggs — never Josephine since women cannot achieve nirvana unless they be reborn as males) art Brahman". The Western interpretation of this is that you should not have any expectations for a self-satisfying hereafter because you are going to be absorbed, annihilated, in the great impersonal cloud of nothingness which constitutes reality. Tillich worked on the presupposition that generations of western scholars have worked on, namely that Hinduism is to be understood as Advaita Vedanta, that Advaita Vedanta is to be understood in the way I have suggested, that this is the highest form of Hinduism and that all else is popular or debased or just simply idolatrous. In this respect Hinduism has suffered by Western hands the same fate as Buddhism and branded as total nihilism. Generations of Western interpreters of Hinduism conspired to distort the image of the religion and Tillich, as a non-specialist with limited knowledge and no opportunity to judge for himself, cannot be overly blamed for accepting this view. There is no record of his having read Rudolf Otto's work Mysticism East and West but it is not inconceivable that he read this work since it belongs to the period just before Tillich and Otto were colleagues and walking companions in Marburg. The title of Otto's book is misleading since it is not an examination of mysticism in East and West, in fact it is simply a comparison of the mysticism of Sankara, the leading exponent of Advaita Vedanta and Meister Eckhart, the example of abstract Christian mysticism in Tillich's typology. As such it is a typical example of the caricature of Eastern religions by Western scholars. Tillich knew something of Sankara since he is referred to in Systematic Theology in the Introduction to Volume 2 in the context of a discussion of the concept of being. He appears to know enough about Sankara to link him with Parmenides as philosophers who do not view being as such as abstraction but rather as the power of being which resists non-being. This is an inter-
234
Terence Thomas
esting evaluation of Sankara which we should bear in mind when we come to look at Tillich's comparison of Christian and Hindu mysticism. Just how much more he knew about Sankara cannot now be established but it is clear that whether he read Otto's work or not he did not seem to know or at least accept certain interpretations of Sankara given by Otto. For instance he seemed to have no awareness of what Otto regards as the theistic side of Sankara. It is from such partial glimpses of Tillich's acquisition of knowledge of Hinduism that we have to try to evaluate Tillich's treatment of the religion. He evaluated the religion as a mystical type. By this Tillich means a religion in which there is a bypassing of the concrete encounter with the divine, which divine in turn is apprehended as impersonal ultimate being or, as Tillich says, transpersonal ultimate being. It is against this background, then that we turn to these lecture notes. Like the Richard Lectures the basis of one side of the equation is the encounter of the holy as personal. All such encounter Tillich views as personal since the holy cannot meet us as anything less than personal. He holds that even in the great mystical religions the holy is met as personal, so he says in the Richard Lectures and one must assume that he holds the same position in these lecture notes. In these particular notes he repeats a familiar formula: "The encounter with the Holy is personal encounter because the holy is that which is of ultimate concern and nothing can be of ultimate concern that is less than we as persons." He then becomes specific: "This is true not only in the old Indian, preVedanta religion, but also in present day Hinduism: Brahma making himself personal for us." (Actually he means Brahman as he correctly says in the Richard Lectures.) Which brings us to the Brahman (priestly class) informant who was the person who told Tillich that "the Brahman (ultimate being) makes itself personal for us". It is Tillich's view that even though the religion may be of a mystical type, nevertheless, the personal is not completely excluded. Of such religions he says: "They have personal gods who are adored, even if one knows that beyond them there is the transpersonal One, the ground and abyss of everything personal." 5 At this point I cannot forebear from commenting on the fact that looked at objectively this statement could stand for Tillich's own theological position in
5
Ibid. p. 26.
Paul Tillich, Ontology and Cultural Boundaries
235
respect of the biblical message, the God of the Bible and the ground of being. Thus there appears to be little difference, some of his critics would say there is no difference, between Tillich's teaching and the teaching of such a religion as Hinduism. 1 must say here parenthetically that for most of his life Tillich refused to engage in discussion of religions of which he only had external knowledge. In his last years he was prepared to do so but with the warning that his discussion was necessarily limited and that his audience should beware of that. Thus anything that is said on this subject should be tempered with the realization that Tillich acknowledged his own limitations in the field. The real problem in dealing with the subject is to know if the outcome of Tillich's discussion was a result of limited knowledge, or the result of failure to cross cultural boundaries, or, as some might conclude given Tillich's own expression of the relation between religion and ontology, a failure to recognize that the cultural boundaries had been breached, that the confrontations or divergences were in reality coincidences and convergences. While he was rejected by some Western scholars he was welcomed, as I was told in India, by some Hindu pandits in Benares. The answer may be a combination of any or all of these explanations, limitation of knowledge, external rather than existential, failure to cross cultural boundaries, failure to recognize convergences, the latter perhaps because of the demands of his vocation as a Christian theologian inhabiting the theological circle. One of the reasons he could not see the convergences of much Hindu thought with his own might have been due to the fact that such a possibility was excluded because of his vocation as a Christian theologian, because of his habitation of the theological circle. He was not looking for the convergences in any substantial way, there were coincidences of form maybe, structural analogies, (a favourite term of Tillich's), but not substantial equivalences. Let me try to demonstrate what I mean. First I must give you an outline of the way in which Tillich saw the confrontation and divergence, not only between his own theology and Hindu religious thought but also between Christian mysticism, which he defends, and Hindu religious thought. He begins, as I have already shown, with a statement of the personalistic roots of both traditions. Soon, however, the divergences appear. In Christianity the encounter with God as in the Biblical account of Abraham is the source of the Biblical concept of personality, the basis of the unconditional
236
Terence Thomas
character of the personal and of the eternal value and the eternal responsibility of the personality. In Hinduism the Brahman-Atman idea (i. e. the relation between Ultimate or Pure Being and individual being) reduces the personal gods to the status of maya (illusion), a status similar to that of human persons. In the divine-human relationship the Christian view is characterized by the Ego-Thou relationship, the Ego acting upon the Thou, and vice versa — the incalculable God and the free man free to cooperate or contradict. In Hinduism the ascent of the mystic is independent of anything that God does. The Absolute is seen as waiting rather than acting. This is seen especially in revelation — understood in Christianity as the word addressing the personal centre and accepted or rejected according to the operation of the will or intellect. In India he finds the magic word, the incantation, the producer of ecstasy. These aspects are summed up as the word as a bearer of meaning versus the word as a bearer of power, the word speaking to the heart in threat and promise versus the word grasping the unconscious. He goes on to contrast the Biblical doctrine of creation with the doctrine of maya — the essential goodness of creation over against the world as fall and resistance. He speaks of Hinduism as a position of substantial identity over against the personal distance between the creator and the creature. There follow sections on incarnation, history and eschatology, as in the Richard Lectures. In each the positive side of Christianity is contrasted with the negative or empty character of Hinduism — the alleged cyclical nature of the Hindu view of history, and the fatalistic interpretation of history in Hinduism symbolized by the wheel of rebirth. The final major section of this first lecture deals with the ethical and the social again to the detriment of Hinduism, much of the latter based on Tillich's interpretation of karma, some of it derived from that friend who became disillusioned with Hinduism. It must be apparent that what is being contrasted here is the scriptural element in Christianity with the philosophical element in Hinduism. It is evident that he is not contrasting like with like, and here I must hint at my conclusion. If he had known or at least taken serious account of other forms of Hinduism, of scriptural Hinduism for instance, his own conclusions might have been very different. The most interesting thing about these lecture notes, one might almost say the most exciting thing about them, are the notes of the second lecture where he continues the attempt to score points in the comparison between
Paul Tillich, Ontology and Cultural Boundaries
237
Christianity and Hinduism but to do this by setting out in systematic form an apologia for Christian mysticism. I have already referred to the definition of mysticism and the typology of mysticism which occur in this part of the document. The second major part of the document is titled 'Criticism and Defence of Christian Mysticism'. Here he first points to the basic problems of all mysticism — identity and Ego-Thou or Ego-It relation, Biblical personalism and the transpersonal character of mysticism, with trans-personalism tending to become subpersonalism. The basic problem he is facing here, however, is the strong transpersonal or impersonal element in mysticism as such and the strong tendency to rub out distinctions or duality in mysticism. His answer to the problem is set out in ten clearly stated points in defence of Christian mysticism but which are implicitly, in the exclusions, also an attack on Hindu mysticism. The 'It' in each case refers to Christian mysticism. a) It excludes the abstract as such and wherever it appears but it includes the concrete. b) It excludes the negation of the finite. But it includes the transparence of the finite. c) It excludes the loss of personality but it includes ecstatic possibilities (love and union). d) It excludes the identification of finitude and sin but it includes the universal tragedy of finitude. e) It excludes the replacement of the word by silence but it includes the way from prayer to contemplation. f) It excludes the meaninglessness of time and history. But it includes the eternal now. g) It excludes the pantheistic depersonalization of God. But it includes a god who is the ground of being. h) It excludes a devaluation of social transformation but it gives no ultimate fulfilment to any social state. i) It excludes any reduction of moral seriousness but it knows the dependence of the ethical on grace and participation. j) It excludes any non-Christological universalism but it includes the cosmic vision of the Christ as representing everything finite. This list of statements is pretty comprehensive and gives a total picture of how he conceives the contrasts between, not only Christian mysticism and Hindu mysticism, but also between Christianity as such and Hindu-
238
Terence Thomas
ism as such. Tillich's interpretation of Christian mysticism given here is also pretty much a cut-down version of Tillich's theology. Christian mysticism as understood by Tillich is not an absolute or pure mysticism though it may be abstract. James Home has given us a clear exposition of this distinction as he sees it in Tillich and as Tillich sees it in others. Tillich rejects pure mysticism for the reasons offered by Home, moral deficiency and extreme rationality. 6 Tillich criticizes abstract mysticism though he is prepared to defend it within Christianity, at least his own interpretation of it, an interpretation which conforms to many of his own views of Christianity as one who was "on the side of the theology of experience and inwardness". 7 As Tillich says, whatever he may think of abstract mysticism as found in Plotinus and Hinduism, implying a negative response, he has to admit that there is a mystical element in every religion, which is a positive response, on condition one assumes that it is understood as "the inward participation in and experience of the presence of the divine". 8 In other words, as he said more than once, mysticism is alright if it is "baptized" into Christianity. So what we have is a situation in which Tillich rejects pure mysticism for the reasons rehearsed by Home and which include "mysticism's advice to seek something near to self-annihilation in the union experience with the Absolute". 9 Tillich gives qualified acceptance to abstract mysticism but rejects such mysticism as it appears in Hinduism. One of our great problems in dealing with the whole topic, however, is that while we may be able to distinguish between "pure" and "abstract" mysticism as Home does and as, by implication Tillich can be expected to do, it is not at all clear that Tillich does so distinguish when he comes to deal with the encounter between Christianity and Hinduism. I have pointed to Tillich's typology of religions based on the conventional Western view of what Hinduism is. The flaws in this assessment are twofold. First the conventional view is not that remote from his own construction of religion. Paul Tillich and Sankara are not that distant from each other. Second, the Hinduism of Sankara is one aspect of Hinduism. Hinduism is no more monolithic than the Christian 6 7 8 9
John J. Carey, ed. Theonomy and Autonomy, Macon, 1984, pp. 158—162. Perspectives on 19th and 20th Century Protestant Theology, London, 1967, p. 21. Ibid. p. 22. Op. cit. p. 158.
Paul Tillich, Ontology and Cultural Boundaries
239
religion is. Further, it is not at all established that the Hinduism of Sankara is normative for Hinduism. Certain Hindus have claimed it as the dominant ideology, most Western interpreters until recently have accepted it as the dominant ideology. Such a position, however, may be no more than the expression of a political hegemony, divorced from the reality of Hindu society. Advaita Vedanta is the pure philosopher's dream come true. It has no kinks, it is perfectly, frighteningly logical, pure like freshly polished stainless steel — and — equally sterile, the supremely ascetic, beautifully laundered mind process, bearing out Tillich's contention that rationality is the 'daughter of mysticism'. Such a rationality is fine, that is, of course, if you ignore ordinary, simple, human desire for relations, community, healing of spirit, forgiveness of sins, rescue by grace and sheer, uncompromising love. In this respect Tillich may be right to condemn Advaita Vedanta as he does in these lecture notes, but then Western critics of Tillich have condemned him in the same vein. They saw Tillich as some kind of sterile philosopher worshipping the Ground of Being. But then we know that Tillich was not that kind of ascetic, sterile mystic. He prayed to the God and Father of the Lord Jesus Christ, he preached acceptance for the unacceptable, he preached grace for the moral sinner and the intellectual doubter. Now I cannot claim that Sankara went that far, but it is true that he prayed to the near and not the far God, he did compose hymns of devotion to the near God. He did, as Otto pointed out at great length, write a commentary on the Bhagavad Gita, one of the classics of Hindu theism. Sankara was aware that all this activity pointed to his bondage to maya, illusion. Sankara recognized his own need to relate to the near God while knowing and desiring that his true life should be attuned to the God beyond God. Now, where have we heard that phrase before? Given Tillich's construction of religion, including his ontology in this respect, we can see why the Hindu pandits in Benares found Tillich a congenial ally from the other side of the Hindu-Christian divide. To illustrate Sankara's position in respect of his ontology I would like to quote a modern Hindu interpreter of his views: "[The] Vedanta of Samkara ... is interested in ... the world of Ultimate Reality, to be clearly demarcated from everything phenomenal, and its relationship to other worlds, the world of commonsense, the religious world, the psychological world, etc. The view of Ultimate Reality it
240
Terence Thomas
puts forth has a certain ambiguity about it. On the one hand it says that the world of Ultimate Reality, the Brahman of the Upanishads, characterized by pure being, consciousness and bliss, is the only Real world, other worlds being illusory. On the other, it puts forth a doctrine of degrees and levels of reality in which Brahman has the highest reality, the world of pragmatic use, like that of commonsense, or the religious world, has a lower degree of reality, while the purely psychological world, like the world of dreams, has an even lower degree of reality (and the world that contradicts ordinary logic and experience, like the son of a barren woman or a flower in the sky, has none at all). If we accept the latter approach we get a multi-levelled universe in which there are different worlds organized on different principles and interests, even though according to Samkara Vedanta it is only the highest level, that of Brahman, which can claim full reality. This, according to me, means that this is the only level which Samkara is interested in exploring from the philosophical point of view." 10 This picture of Sankara and Vedanta is much more complex than Tillich allows. Sankara also has to grapple with the problems of the logic of knowledge of God a se while remaining in the world of phenomena and personal psychology and need for salvation. The interpreter just quoted argues that Sankara is dependent on Buddhism for the view that the world is illusory and that this was not the view of pre-Sankara Hinduism. She also argues that even Sankara given his upbringing in the Hindu tradition could not completely renounce its positivistic and realistic trends. That he does tend to that view, and she suggests that it is only a tendency not an absolute position, she considers unsatisfactory and not true to the Upanishadic view of the relation of Brahman to the world. Scholars, including Hindu scholars, will disagree as to whether Sankara does hold this hard doctrine of the Ultimate as the only Reality. If he does then he has resolved the problem that Tillich faced in a way which is unacceptable to Tillich and Tillich has every right to criticize and, if he wishes to, to exercise a negative judgement on Sankara's Advaita Vedanta. The evidence is not unequivocal but assuming the judgement to be a valid one Tillich has really only rejected the Advaita Vedanta of Sankara. He has not thereby demolished the validity of Hindu 10
Pratima Bowes, Hindu Intellectual Tradition, New Delhi, 1978, p. 56.
Paul Tillich, Ontology and Cultural Boundaries
241
attempts to answer the problem of Ultimate Being and individual being. The truth is other Hindus would agree with Tillich concerning Sankara's Advaita Vedanta and there are other approaches to the problem of ontology and religion in Hinduism. This is where the evidence presented to Tillich by his Brahman informant is significant. Let me remind you again of how Tillich related that event: "An Indian Brahman with whom I had a conversation about this point made it very clear to me that he stood in the transpersonalistic thinking of India's classical tradition but that, as a religious Hindu, he would say that the Brahman power makes itself personal for us. He did not attribute the personal element in religion only to man's subjectivity. He did not call it illusion; he described it as an inner quality of the transpersonal Brahman power." 11 Let us look at one or two terms here. First the term transpersonal (-istic). The term is used descriptively of the Indian classical tradition and of the Brahman power. The Brahman power though transpersonalistic makes itself personal for the individual. The personal is not the result of human subjectivity — it has an objective quality relating to the Brahman power. The personal element is not illusion — not maya — a phenomenon of unreal nature. The personal, on the contrary, is "an inner quality" of the transpersonal Brahman power. It is somewhat surprising that while Tillich makes use of this bit of information more than once in his later lectures, and let us not forget that this information was available to Tillich before 1951, i. e. before he became seriously involved in thoughts of encounter and dialogue during the 50s and 60s, the true import does not seem to have dawned on him. He uses it to demonstrate that even in those religions heavily given to mysticism the holy is encountered as personal. Quite what status this personal element enjoys is never made quite clear for Tillich passes over quickly into a "nevertheless", nevertheless they are essentially transpersonalistic religions and do not approach the divine in the personal way that is done in Christianity. Yet if he had given a moment or two to examine the language used by his Brahman informant, if he had employed his usual
" Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, p. 26.
242
Terence Thomas
semantic approach to vocabulary, he might have discovered something that would challenge his stereotypical view of Hinduism. He would have discovered that for this person, Brahman, Ultimate Being, is both transpersonal and personal, or at least the transpersonal is made available to the adherent in a personal way. This "being available in a personal way" is not seen as something subjective or projected by the adherent, it is perceived as the way in which Ultimate Being "comes down" to the individual being. Moreover, this personal element — and this is most important in the Hindu context — is perceived as real, not perceived as maya, illusion. It is perceived as real because it is "an inner quality of the transpersonal Brahman power", i. e. it is an aspect, mode or manifestation of Ultimate Reality. In other words, looking back to Sankara for whom the personal did exist but had to be transcended, for this person the personal exists and transcendence means the participation of the personal in the personal which is part of the transpersonal. It may not be as logical as Sankara but it would seem to be closer to reality as experienced by ordinary humans and closer to what Tillich is looking for in his search for a solution to his basic theological problem. It should be made clear also that Tillich's informant is not indulging in some personal, unconstructed version of the relation of Ultimate Being to individual being. He is voicing an alternative form of Vedanta associated in particular with Ramanuja, known as Visishta Advaita, and is generally reckoned among the theistic systems of Hinduism. As you will see it is still advaita — non-dualist — but within the non-duality there are distinguishable (visishta) other selves beside Brahman and other physical properties of the universe. It is to be distinguished from dualism where the other selves and properties are separated from Brahman. In Visishta Advaita as in Advaita there is no second to Brahman and other selves and physical properties. "For Ramanuja creation was an expression of the personality of God, of God's primeval need to love and be loved by that which was in some sense other than he. The individual soul, though made out of God's own essence, is never completely identical with him; in the state of highest bliss it is permanently joined to God but is never wholly one with him, and therefore retains some degree of individual selfconsciousness; for if it lost self-consciousness it would cease to exist as an individual soul, and it can never perish, for it is a part of the divine
Paul Tillich, Ontology and Cultural Boundaries
243
essence and shares the eternity of the divine. Thus the emancipated soul is one with God, but yet separate." 12 From Tillich's point of view this version of advaita is much more difficult to dismiss. Much of what it says is reminiscent of Tillich's own position. Let us remind ourselves of what Tillich had to say on the topic: "The God who is a being is transcended by the God who is Being itself, the ground and abyss of every being. And the God who is a person is transcended by the God who is the Personal-Itself, the ground and abyss of every person. In statements like these, religion and ontology meet ... being and person are not contradictory concepts. Being includes personal being; it does not deny it. The ground of being is the ground of personal being, not its negation. The ontological question of being creates not a conflict but a necessary basis for any theoretical dealing with the biblical concept of the personal God ... Religiously speaking, this means that our encounter with the God who is a person includes the encounter with the God who is the ground of everything personal and as such not a person. Religious experience, particularly as expressed in the great religions, exhibits a deep feeling for the tension between the personal and the non-personal element in the encounter between God and man." 13 Apart from the reference to biblical concepts, it seems to me that Ramanuja would agree with almost the whole of that quotation and even the biblical reference could be accommodated probably by reference to some Hindu scripture or devotional literature such as the Bhagavad Gita on which, like Sankara, he wrote a commentary. Of course Ramanuja would put it in the context of advaita — monism — while Tillich has a dualistic structure in mind, that is dualism as between God and the created. It should be added that Hinduism too has its dualistic Vedanta tradition — dvaita — whose leading exponent was Madhva, but it is not nearly as important as Visishtadvaita in the total expression of Hinduism. It must be recognized that whatever the particular form
12
13
A . L. Basham, "Hinduism" in R. C. Zaehner ed. Hutchinson Encyclopedia of Living Faiths, Fourth Edition, London, 1988. Biblical Religion and the Search f o r Ultimate Reality, pp. 82 — 84.
244
Terence Thomas
of Hinduism, advaita in one form or other predominates, and for the majority of Hindus for the past six to eight hundred years it is Visisbtadvaita which has predominated. It has predominated in a variety of ways many of which have been categorized by Westerners as 'popular Hinduism' and therefore dismissed, hence the distorted picture of Hinduism based on the successful projection of a dominant ideology which I referred to earlier. But there is no "popular Hinduism" in the sense used by Western historians. Hinduism is popular, popular Hinduism is just Hinduism. The only Hinduism which is not popular and thus a minority, elitist, form is Advaita Vedanta. From this standpoint Visishtadvaita has been the most popular, quantitatively speaking, though not many Hindus could carry on a discourse on Ramanuja's philosophy or theology. It is popular in that it is the basis of devotional Hinduism — bhakti, which brings us to an important area of Tillich's encounter with Hinduism. On the basis of his understanding of Hinduism as Advaita Vedanta Tillich also evaluates Hinduism as a religion with no ethics, and no love. Since the religious goal appears to be extinction of the self this implies for Tillich that there is no incentive for the self to behave in a moral way. In his view, a view which was reinforced by the friend disillusioned with Hinduism, because of the operation of karma (the law of just desserts) and samsara (the wheel of existence) there is no incentive to moral action, there is no love to overcome alienation or transform society. He is so adamant on this score whenever he talks on the subject. (Some may recognize this as a reflection of Tillich's encounter with Buddhism.) He is much more relaxed when talking about the image worship that takes place in Hinduism, a factor that upsets many other Western Christians. Indeed he is quite warm towards the notion of gods and images. In this sense he appreciates Hinduism as a religion from a phenomenological point of view but condemns it very harshly as a way of salvation from a theological point of view. It is sad that Tillich did not know more of devotional Hinduism. If he had he would have found a religion very congenial to his own way of thinking. If Tillich had discovered devotional Hinduism he would have found a religion which is intensely theistic. Many of the sects which arose from the veneration of medieval saint-poet gurus are intensely monotheistic. They are Hindu in that they maintain belief in karma-samsara, the round of rebirth resulting from the law of just
Paul Tillich, Ontology and Cultural Boundaries
245
desserts, but far from being morally indifferent they are intensely moral in their religious attitudes. These sects, on the whole, are subversive of the traditional Brahman priesthood, abjure Sanskrit as a sacred language having their texts and worship in the vernacular, are theologically opposed to caste, though in practice not so successful, are theologically committed to the equality of women, and in this they are more successful than in dealing with caste, including insistence on the possibility of women achieving liberation without being reborn as males. Indeed, in this form of religion women very often are the gurus, the saviour figures. The concept of guru is very important in these sects. The term itself is complex since it refers to the human guru, the charismatic leader or founder of a sect but also to God. The texts, the compositions of the different gurus use the term in such a way that it is not always possible to determine whether the term refers to the human or to the divine. This is a reflection of the fact that for the devotee there is hardly any difference between the human and the divine. The human speaks the words of the divine — bant, meaning voice, is the word used to describe the texts, and it is the divine voice which speaks according to the devotee. As far as the guru her- or himself is concerned they deny that they have a human guru, all utterance comes directly from the divine. In Western terminology this is revelation. One can see why the distinction between the divine and the human is blurred especially in a culture which knows multiple incarnations. The human guru is the representation of the divine. (In such sects the use of traditional Hindu images of the divine are proscribed.) The human guru is subjected to the kind of veneration usually reserved for the divine. The theology of the guru is analogous to the theology of the logos in the Christian religion. As a logos-type figure the guru is also seen as a vehicle of moksha, liberation, a boat to carry the faithful across the sea of existence into nirvana, so that coming and going, a euphemism for karma-samsara, ceases. The way of the devotee is a way of devotion, praising God, looking to God for his gracious favour, carrying out the will of God in love, compassion and community service. In some sects the call is to work for the welfare and transformation of society, to work for the liberation of the individual in this life. It is such a shame that Tillich did not know of this religion — it is imbued with the power of the Protestant Principle. There are those Westerners who would claim that
246
Terence Thomas
this religion is the result of Christian or Muslim influence. If that is the case the influence is cunningly disguised. Personally, I see no reason why Indians could not come up with this form of religion all on their own. It is only if we think that Advaita Vedanta is normative for Indian religion that we begin to have to search for explanations for the existence of a religion which is so foreign to Advaita. If we see Advaita as just one form which gained a dominant position through the exercise of politics rather than through popular acceptance then we can find in preAdvaita religion the roots of this devotionalism. The truth is that apart from this sectarian form of Hinduism the vast mass of Hindus, the inheritors of an ancient tradition, are devotional in one form or other. They may worship the divine under many different guises, many different guises all at once, but on the whole these divinities, whether minor and local or major and national like Vishnu or Siva, are subservient to the high god referred to as Bhagvan (great possessor of spiritual wealth) or Isvara (Lord, Supreme Being). Both these high gods are personal. In other words, Hinduism for the most part is theistic, acknowledging a personal God or gods, looks for personal salvation somewhere in the succession of births to which all are subject, has its own codes of moral behaviour, some linked to individual caste membership, some linked to the general hope of liberation, and, on the whole, exhibits no more fatalism than one might find in a sample of Christians of various kinds. As religions, Hinduism and Christianity have less in common than Hindu apologists would have us believe, but they have more in common than Christian theorists or apologists would be prepared to admit. Which brings us back to Tillich and his theology, typology and desire for dialogue. His theology raises a question to which I am not sure I have an answer. The question is: To what extent was Tillich's theology in the matter of the doctrine of God based on a philosophy in which the idea of God is understood as Being itself, a philosophy which demanded of a theology of which belief in a personal God is a constituent factor (or a theology of a personal God), a response which was internally coherent and in respect of the philosophical idea of God as Being itself not incoherent; or to what extent is his theology in the matter of the doctrine of God based on a belief that God is Being itself, such belief having to be seen as coherent with belief in a personal God? In other words is the theological problem Tillich faced in the Richard Lectures
Paul Tillich, Ontology and Cultural Boundaries
247
one of reconciling belief with philosophy (of reconciling the biblical message with ontology) or of reconciling two aspects of belief (ontology being part of the structure of belief along with the biblical message)? Tillich's ideal view of the relationship between religion and culture would suggest that it is a matter of reconciling two aspects of belief. This is how I understand the last few pages of the Richard Lectures quoted above and his final words in those Lectures: "To live serenely and courageously in these tensions and to discover finally their ultimate unity in the depths of our own souls and in the depth of the divine life is the task and the dignity of human thought." 14 Ultimate unity in the depths of our souls and in the depths of the divine life sounds to me like reconciliation in terms of belief in both ontology and biblical religion. The question is important, I think, in view of Tillich's search for the basis of dialogue between Hinduism and Christianity. In the Indian context the question does not arise. The question of Brahman as Being itself is not a philosophical question in western terms, it is more a matter of belief than speculation. Ontology is part of the structure of belief in the Hindu context. We must not be misled by the convention in India to discuss the whole of this subject under the term philosophy. The term is constantly used by those engaged in Hindu hermeneutics, the term theology never, but the actual activity often takes on the nature of what we in the West would call theology. The Indian thinker moves constantly between what we would regard as philosophy and what we would regard as theology. I suggest that this is very close to the way Tillich behaves, the ontology is more like a part of his structure of belief than an external, objective discipline which poses the challenge to theology. His method is ostensibly Western but actually, perhaps subliminally, Eastern. Tillich on two occasions faced the problem of ontology and theology based on belief in a personal God. In the one instance it was Western ontology in relation to Christian theology, in the second it was Eastern ontology in relation to Christian theology. Tillich demonstrated, or believed he had demonstrated, a successful outcome to the first and believed he had demonstrated not so much an unsuccessful outcome to the second as a successful demonstration of the inadequacies of Eastern
14
Ibid. p. 85 (italics added).
248
Terence Thomas
ontology. If he had had more information he would have found himself closer certainly to Ramanuja than he would have dreamed, and nearer to Sankara than he would have liked. It is no accident that the Benares pandits enjoyed reading Tillich. It is a fact that the basic material for a greater convergence between their philosophy and Tillich's theology than Tillich knew does exist. Though he might deny it Tillich's implicit programme is very near that of the Indian. Moreover, it is clear, I hope, that the problem that Tillich faced is a very real one but also one that invites more than one solution or if not solution, pragmatic resolution. Sankara offered one, Ramanuja another. The religion of one, Ramanuja, would have been more attractive to Tillich than the religion of the other, Sankara. There is always a danger in presenting an argument that it be overstated. I do not wish for one moment to suggest that there is little difference between the Eastern teacher and Tillich. There are important differences. The one that stands out, of course, is that for Ramanuja as well as for Sankara, the relation between Ultimate Being and individual being is one of non-duality, advaita, even though, importantly, Ramanuja sees distinctions within the non-duality. This resolution of the problem if Tillich had only quizzed his Brabman informant further, would still have posed a wide chasm between himself and Ramanuja and no amount of playing with the evidence would change that. If we use the terms of Hindu thought Ramanuja is non-dualist and Tillich is dualist. Monism is something that Tillich would immediately reject. There is no way, given his base in the biblical religion that Tillich would consciously contemplate such a coalition. There is just one problem that remains, given the force of the ontology which is one of the bases of his theology did Tillich really set himself free of its monistic power? There are those who would say that he didn't. They could well be right. Much of what has been discussed here was, for Tillich, bound up with his typology of religions. In this area of discourse it is a major criticism of Tillich that he allowed his typology to dictate his responses even when his senses were receiving conflicting signals. He sometimes criticized Max Weber for the inflexibility of his 'ideal types'. I'm afraid Tillich never really understood Weber's approach to typology. In any event Tillich's own 'dynamic typology' as he chose to call it was certainly no more flexible than Weber's, indeed I would suggest that it was less flexible. Therefore there was an inhibition which prevented Tillich from
Paul Tillich, Ontology and Cultural Boundaries
249
engaging creatively with the reality of Hinduism, a matter which as I hope I have demonstrated left Tillich and the dialogue with Hinduism the poorer. On the dialogue itself Tillich showed his preparedness to engage in it. He saw the importance of it as a bulwark against the encroachment of secular world views. Today, I think the programme still stands and is in urgent need of people like Tillich to engage in it. However, I think the motivation is different. I may be naive but I think that the secular threat is not nearly as serious as Tillich saw it. I think our greatest threat is from the competing religions themselves. The destruction of our world is still a possibility but it appears more and more likely that it will come from the failure of religions to live harmoniously together. It is unfortunate that given their basic ideologies some forms of religion have a vested interest in speeding up the coming of Armageddon. Tillich recognized a kairos in his time. We still live in that kairos, and the urgency with which Tillich viewed it in his time is in no way diminished today. If Tillich did not have the conceptual tools to deal with it in the way we have today he, nevertheless, showed us the critical nature of the confrontation between religions and the spirit with which he engaged in dialogue is, in the end, the more vital component of the exercise.
MARY ANN STENGER
The Limits and Possibilities of Tillich's Ontology for Cross-Cultural and Feminist Theology Contemporary Christian theology has been challenged by criticisms arising from feminism and the awareness of religious plurality. Although Tillich wrote before these movements were in the forefront of theology, some of his ideas can be considered in dealing with these issues. In this paper, I will focus on the adequacy of Tillich's view of God as beingitself for dealing with feminist and cross-cultural critiques. I will first present some of the issues arising from these critiques and then discuss the applications of Tillich's ontological theology.
A . Major Issues in the Feminist and Cross-cultural
Critiques
1. Language Both feminism and cross-cultural philosophy of religion have criticized traditional Christian God-language. The feminist critique has focussed not only on the patriarchal language about God but also the negative psychological effects of that focus. God as Father or King is seen as asserting power over others, dominating his children and subjects. Exclusively male language for God ceases to be effective symbolism for God and becomes idolatry. And as Tillich has noted (ST, I, 216)1, idolatry can lead to injustice, where non-favored beings are seen
1
References to Paul Tillich, Systematic Theology, 3 vols., (Chicago: University of Chicago Press, Vol. I, 1951; Vol. II, 1957, Vol. Ill, 1963) will be indicated by (ST, volume number, page number).
Limits and Possibilities of Tillich's Ontology
251
as inferior and subject to the dominant power, such as females have been to males. 2 The cross-cultural critique has focussed on the exclusivity and narrowness of Christian God-language. Philosophers of religion working crossculturally have recognized the strongly Western implications of the term "God" and have searched for more neutral terms which both Eastern and Western thinkers could use. For example, both Wilfred Cantwell Smith and John Hick used the term "God" in their early writings on religious pluralism, but more recent essays show a switch to less theistic descriptions, such as "the transcendent" (Smith) or "the Real" (Hick). With these more abstract terms, they hope to include both personal and non-personal understandings of the ultimate. Both the feminist and cross-cultural critiques, then, share a recognition that traditional God-language brings much social and historical baggage with it, baggage which has been associated with patriarchal domination and imperialist missionary efforts. The power of language in defining and structuring thinking and reality cannot be ignored. To the extent that traditional God-language has devalued females, nonwhites, and non-Christians, it needs thorough re-working. To some extent, Tillich's ontology and theology offered such a reconceptualization well-before these critiques became prominent. Tillich's method recognizes historical, cultural relativism and calls for response to the needs of the present situation. His doctrine of symbols works well with the feminist call for new metaphors for God. Also, ontological concepts such as being-itself or ground of being are more neutral than traditional God-language. But we are not in a position to simply posit Tillich's ontological theology as the already-present answer to the feminist and cross-cultural critiques. Rather, we need to investigate more carefully the extent to which Tillich's concepts and symbols solve these issues. We need to look not only at the form of his language but also the content. 2. Content — Feminist Challenge Some feminist theologians have been wary of using abstract images to solve the patriarchy implicit in traditional theology. Rosemary Rue2
For further discussion of this point, see my article, "Male over Female or Female over Male: A Critique of Idolatry," Soundings L X I X , 4 (Winter, 1986): 464 - 478.
252
Mary Ann Stenger
ther calls for inclusive images for God that draw from both males and females, but she warns that "abstractions often conceal androcentric assumptions and prevent the shattering of the male monopoly on Godlanguage, as in 'God is not male. He is Spirit.' " 3 While some feminists have responded to this by focussing on female metaphors as a corrective to the dominant patriarchal symbols, Ruether calls for the use of both female and male metaphors which can liberate us from stereotypic understandings of male/female roles. Similarly, in Models of God, Sallie McFague states that "one of the serious deficiences in contemporary theology is that though theologians have attempted to interpret the faith in new concepts appropriate to our time, the basic metaphors and models have remained relatively constant: they are triumphalist, monarchical, patriarchal." 4 McFague then works to develop metaphors that include and affirm all persons and all creation as interdependent. New language which simply restates or covers over old structures does not answer the feminist or pluralist critiques; rather, new metaphors and symbols which avoid the pitfalls of idolatry, patriarchy, and imperialism are necessary. The emphasis on metaphors in feminist theology is not just a function of doing modern theology, but it also represents a conscious shift away from the popular conceptual identification of the symbol with the reality itself. For too many people, the symbol of God as father is taken literally to refer to God as a dominant male being. Or the maleness of Jesus as the Christ is emphasized. McFague argues that the use of metaphors shows the constructive, relative, non-definitive character of theology. 5 Metaphors suggest and point to possible qualities and aspects of God and Christ rather than describing the way God or Christ is. It is also recognized that people's concepts and symbols of God influence their conceptions of self, other selves, and world. Consequently, feminists search for metaphors which express mutuality and complementarity rather than hierarchy, liberation and self-realization rather than domination, and inclusivity and interdependence rather than
3
4
5
Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-Talk; Toward a Feminist Theology, (Boston: Beacon, 1983), p. 67. Sallie McFague, Models of God; Theology for an Ecological, Nuclear Age, (Philadelphia: Fortress, 1987), p. xi. See also, p. 13. Ibid., p. 35 ff.
Limits and Possibilities of Tillich's Ontology
253
exclusivity. Balance in relationships not only among peoples but also with the plants and animals of our world has been called for as necessary not only for our fulfillment but even for our very survival. 6 The feminist challenge to traditional theology, then, involves not only theological language but also a revision of traditional content. 3. Content — Challenge of Pluralism The pluralist critique includes a rejection of the claim of Christian superiority and calls for a revisioning of theological doctrines. Some thinkers see a parity among religious traditions and recognize spiritual, transforming power and truth in all. Such a view challenges the traditional understandings of God, Christ, and salvation. As with the feminist critique, some pluralist thinkers reject abstractions as the solution. For example, Langdon Gilkey argues that there is neither a unifying universal abstracted from a particular tradition nor a neutral philosophical standpoint above and beyond the different traditions. 7 Rather, he proposes a standpoint of relative absoluteness — commiting oneself to a particular standpoint in a particular tradition but simultaneously and continuously recognizing the relativity of that standpoint. 8 But other thinkers have proposed an abstract concept for the ultimate as a neutral category through which dialogue can occur. John Hick uses
6
7
8
For examples, see Sallie McFague, Models of God; Theology for an Ecological, Nuclear Age, pp. 6 — 17, 59 — 87; Rosemary Radford Ruether, Sexism and GodTalk; Toward a Feminist Theology, pp. 85 — 92; Rosemary Radford Ruether, New Woman New Earth; Sexist Ideologies and Human Liberation, (New York: Seabury, Crossroad, 1975), pp. 1 8 6 - 2 1 1 . Langdon Gilkey, "Plurality and Its Theological Implications," The Myth of Christian Uniqueness; Toward a Pluralistic Theology of Religions, edited by John Hick and Paul F. Knitter. (Matyknoll, NY: Orbis, 1987), p. 41. Ibid., pp. 46—47. Similarly, Gordon Kaufman has argued that there is no universally human position through which we can understand all religious traditions or dialogue about differences. All positions are particular positions, connected to a particular historical, social setting and particular religious beliefs and practices. See Gordon Kaufman, "Religious Diversity, Historical Consciousness, and Christian Theology," The Myth of Christian Uniqueness; Toward a Pluralistic Theology of Religions, edited by John Hick and Paul F. Knitter. (Maryknoll, NY: Orbis, 1987), p. 5.
254
Mary Ann Stenger
"the Real" or "Reality"; Wilfred Cantwell Smith uses "the transcendent". All agree that this ultimate is not totally expressed or experienced in specific religious symbols or actions. But each of these concepts works better philosophically than it may theologically. Each is an attempt to name that toward which religious actions and meanings are directed. And each attempts to encompass the diversity of understandings, including both being and nothingness, and yet not be tied to one specific viewpoint. But it is also recognized that all religious meanings and actions are necessarily concrete, historical, and cultural — directed toward ultimacy but not themselves ultimate. When we focus on the theological content of religious traditions, we recognize important differences that do not nicely disappear after a few dialogues on the meaning of terms. Religious pluralism challenges theology to look at God not only personally but impersonally, not only as being or reality but also as nonbeing and nothingness, not only as incarnate in one human but with many incarnations, not only as totally other but as immanent in all reality. Trinitarian understandings of God complicate these views even further. 9 Such diverse conceptions of the ultimate also impact the Christian view of Christ as the final revelation, as the one incarnation of God, as the perfect human. Hick and Smith have deliberately chosen theocentric approaches for interacting with non-Christian traditions. The traditional Christian view of Christ is a stumbling block in creating a tolerant, pluralist philosophy or theology. Others have tried to solve this issue through a reconceptualization of the Christ which usually focusses on the formal, structural, and more abstract aspects of the Christ-event rather than on the person Jesus who is the Christ. This allows the possibility of other incarnations or manifestations of similar meaning and effect. There are important differences between the Christ and the Buddha and between Krishna and the Christ, but discovering similarities of meaning, effect and function leads to more tolerance, more parity, and important revisions in theological truth claims. Both pluralism and feminism, then, are challenging Christian thought to develop language and content which breaks out of the traditional stance of Christian superiority and male dominance. Although those 9
Gordon Kaufman, "Religious Diversity, Historical Consciousness, and Christian Theology," p. 10.
Limits and Possibilities of Tillich's Ontology
255
were not the primary concerns of Tillich's theological and philosophical system, his awareness of historical relativity and dynamics, his concern to advance beyond traditional language, and his creative effort to interrelate concept and symbol influenced him to develop language and content which may be helpful in meeting these challenges of pluralism and feminism. B. Application
to Tillich's
Ontology
The focus of this discussion will not be primarily what Tillich said concerning non-Christian religions or feminine symbolism (although that may be brought in on occasion) but rather the extent to which ontological ideas of Tillich may be useful in developing feminist, crosscultural theology today. We need theology which can respond to the challenges from both approaches. To what extent can Tillich's theological method and his understanding of God as being-itself, ground of being, and power of being contribute to these present-day efforts in theology? 1. Method of Correlation Tillich's method of correlation allows for response to new questions in the present situation. Today these questions include how to respond to the relativization and critiques of traditional Christian theology by feminism and pluralism. Past theologies not only need development but major revision. Tillich's understanding that theological norms develop out of the interaction of principles and the concrete situation insures dynamic development within theology. 10 With such dynamic development, theology faces the challenge of relativism. But Tillich did develop an epistemology which could handle the relativization of theological doctrines. From his early writings through his final essays, Tillich maintained the ultimacy of the ultimate alone. Only the Unconditioned itself or being-itself or the God above 10
For further analysis of the dynamic character of Tillich's normative theology, see my discussion in "Paul Tillich's Theory of Theological Norms and the Problems of Relativism and Subjectivism," The Journal of Religion LXII, 4 (October, 1982), pp. 3 5 9 - 3 7 5 .
256
Mary A n n Stenger
the God of theism is the ultimate, and all expressions of that ultimacy are finite, conditioned expressions — relative to personal and historical situations. This view grounds his Protestant Principle which critiques all theology, warning of the dangers of idolatry. The relativism implied by the pluralist and feminist critiques is more radical than that which Tillich dealt with. Even that which Tillich accepted as absolute, such as the centering in Christ, has been relativized today. But Tillich's epistemology and critique of idolatry can be used to further the pluralist and feminist critiques today. 11 Tillich's theological method (and the epistemology underlying it) demand ongoing response to the present situation, as well as grounding in the absolute. 2. Theory of symbols Tillich's theory of symbols assumes his dynamic method and includes the possibility of symbols dying as well as new symbols arising. Such an approach can avoid the popular absolutization of particular symbols and allow for creative response to present situations. Although some feminists prefer to use the term "metapher" to describe their theological constructs, Tillich's use of "symbol" seems very close. As mentioned earlier, some feminists have thought that many people forget the distinction between a symbol and the reality and therefore prefer to speak of metaphors. But Tillich's theory includes important distinctions between symbol and that to which the symbol points and also includes a critique of symbols to avoid such idolatry. However, Tillich argues for more of a connection between symbol and that to which it points than the feminist theory of metaphor accepts. For him, the symbol participates in the reality and can only be a true symbol if it does so participate (ST, I, 239). It is that participation which provides their power. Without such a basis, metaphors are simply imaginative constructs, easily changed or rejected. But I think when we are dealing with theological metaphors that an element of subjective response and commitment is important for the metaphors to be effective. 11
See my efforts at applying Tillich's ideas in "The Significance of Tillich's Epistemology for Cross-Cultural Religious Truth," Religion et Culture, edited by M. Desplant, J. Petit, and J . Richard. (Quebec: Les Presses de L'universite Laval, 1987), pp. 589 — 603 and "Male O v e r Female or Female O v e r Male: A Critique of Idolatry," Soundings L X I X , 4 (Winter, 1986): 4 6 4 - 4 7 8 .
Limits and Possibilities of Tillich's Ontology
257
Symbol, understood as Tillich does, can meet the feminist critique of necessary separation and dynamic change. I find it workable within feminist theology, but others may see it as too tied to traditional concepts because of his emphasis on participation in the power of the divine and the connection of his ontology and theology to traditional symbols. In his efforts to deal with religious pluralism, Langdon Gilkey explores several aspects of Tillich's theory of symbols. Because he recognizes our commitment and participation in a particular tradition as well as our openness to non-Christian truth, Gilkey proposes a relative absoluteness, as describing both our praxis with "the absolute as relatively present in the relative" and the necessary structure for theology. 12 He compares this to Tillich's discussion of the true symbol as both relativizing and sacrificing itself while pointing beyond itself to absoluteness and ultimacy. But again he recognizes the root of that criterion in the Christ as final revelation for Tillich. Gilkey also speaks of the danger of demonic possibilities in our pluralistic society and calls for the critique of symbols to avoid such possibilities. 13 Although not directly referring to Tillich, his description of the criterion of symbols is certainly close to Tillich's own: "A symbol or a criterion points beyond itself and criticizes itself if it would not be demonic; but it also points to itself and through itself if it would not be empty, and if we would not be left centerless". 14 But this leads Gilkey to critique even the absoluteness of the Christ as final revelation that Tillich accepted. Rather he accepts Christian symbols as relative and yet transcending themselves, as final and yet not the only symbols. 15 This is a move which Tillich does not make, but it is a possible result of applying Tillich's critique of idolatry to his own theology. 3. Content: Being-itself, Ground of Being, and Power of Being a. Immanence and Transcendence In terms of structure, cross-cultural philosophy of religion stresses transcendence more than immanence although it does not deny the 12 13 14 15
Langdon Gilkey, "Plurality and Its Theological Implications," p. 47. Ibid., pp. 4 8 - 4 9 . Ibid., p. 48. Ibid., p. 49.
258
Mary Ann Stenger
possibility of immanence of the divine across traditions and cultures. For example, both Hick's structure of divine noumenon and human phenomena and Smith's focus on the "transcendent" which is expressed in various cultural and religious forms stress transcendence more than immanence of the ultimate. But in relation to content, the issue is much more complicated for religious pluralism. Whether immanence or transcendence is stressed in content depends on the religious tradition and often the particular part of the tradition that one considers. Several feminist thinkers have stressed the immanence of God over against transcendence because they believe that the emphasis on distance between God and creatures radically devalues human beings and the world. Interestingly, some feminist thinkers have appropriated aspects of Tillich's theology to express God's immanence in human lives. For example, Mary Daly uses the idea of power of being to express nonpatriarchal ultimacy and women's experience of immanence and transcendence as their consciousnesses develop. 16 Also, Sallie McFague makes favorable reference to Tillich's understanding of love as the moving power of life. 17 Tillich calls the being of God "being-itself' to emphasize that God is not a being alongside or above other beings but rather the infinite power and meaning of being (ST, I, 235). Unlike every ordinary being, being-itself does not participate in nonbeing, but being-itself is the ongoing power of being which resists nonbeing in everything that is (ST, I, 236). Tillich maintains this tension in the concept of "beingitself' — unlike all other beings and yet immanently connected to all beings. He speaks of "an absolute break, an infinite 'jump'," and yet "everything participates in the infinite power of being" (ST, I, 237). God as "ground of being" might seem to maintain this tension of transcendence and immanence more than God as "power of being" because "ground" suggests source or cause or origin, all of which imply differentiation or distance. But Tillich collapses the tension when he says not only that God is the ground of the structure of being but also that God "is this structure" (ST, I, 238). The "structure of being" like the "power of being" emphasizes immanence more than transcendence. 16
17
Mary Daly, Beyond God the Father; Toward a Philosophy of Women's Liberation (Boston: Beacon Press, 1973). Sallie McFague, op. cit., 1 0 2 - 1 0 3 .
Limits and Possibilities of Tillich's Ontology
259
Tillich's effort to maintain the tension between immanence and transcendence can be helpful in our effort to balance the feminist emphasis on the powerful immanence of God in feminist experience and the pluralist emphasis on the absolute which transcends and yet empowers ordinary religious phenomena. b. God as Being-itself; Ontology and Theology Yet another tension in Tillich's idea of ultimacy is between the ontological concept of being-itself and the theological symbol of God. There has been much discussion of Tillich's statement that "God is being-itself' is the most unsymbolic statement which is possible (ST, I, 239). Tillich adjusts this claim in the second volume of the Systematic Theology when he says that the non-symbolic statement is that "everything we say about God is symbolic" (ST, II, 9). There he argues that "God is being-itself' is both rational and ecstatic expression, both nonsymbolic and symbolic (ST, II, 10). And in yet another formulation, Tillich says that "the non-symbolic element in all religious knowledge is the experience of the unconditioned as the boundary, ground, and abyss of everything conditioned." 18 Robert Scharlemann has shown that the seeming differences in these approaches are somewhat resolved when placed in the context of Tillich's whole theological system as a theonomous system of meaning. 19 Tillich's statements show his concern to ground his system of symbols in something non-symbolic and yet also retain the ultimacy of the ultimate which is inexpressible. But for our purposes, the tension in the effort to bring together symbol and concept, philosophy and theology, is important since the cross-cultural critique has moved most strongly philosophically and the feminist critique most strongly theologically. The cross-cultural critique has sometimes used the abstract concept to transcend specific symbols or metaphors while the feminist critique prefers new symbols and metaphors grounded in human experience. Tillich's efforts to bridge those differences can be important in formulating links between the two critiques and their resulting theories.
18 19
Paul Tillich, "Symbol and Knowledge," Journal of Liberal Religion p. 203. Robert Scharlemann, Journal of Religion XLVIII, No. 2, (April, 1968), pp. 1 3 6 - 1 4 9 .
260
Mary A n n Stenger
This same tension of ontology and theology comes out in Tillich's effort to show the relationship between the God of Biblical religion and the god of the philosophers in Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality.20 In spite of their seeming opposition, Tillich claims that biblical religion and ontology "have an ultimate unity and a profound interdependence" (BR, 1). Through ontological analysis, the philosopher tries to show "the presence of being and its structures in the different realms of being" or the power of being which resists nonbeing in which things participate (BR, 8). This description of ontology is comparable to the effort of cross-cultural philosophy of religion to show the basis of all religious traditions in the transcendent or ultimate. But biblical religion offers a different approach for answering the ontological search: a personal god, a reality that is personally experienced. Such an approach seems to treat God as a being, albeit a personal being, in contrast to the non-personal being-itself which empowers but yet is beyond all beings (BR, 27—28). This effort is comparable to the feminist emphasis on personal transforming experience. To affirm God as personal is to affirm a living relationship with God, a personal relationship, which like other personal relationships is not totally determined, is subject to change and interaction, is free and intimate (BR, 30, 31). But the ontological concept of being-itself suggests that which is beyond change. On the other hand, the relationship with being-itself is more intimate than the relationship with a personal god: "We speak to somebody, but we participate in something" (BR, 33). Biblical revelation suggests distance between the revealer and the people to whom revelation comes while ontology suggests the immanence of participation and tries to penetrate the power of being (BR, 34). Yet Biblical revelation posits a personal god while the god of ontology is impersonal. "Ontology generalizes, while biblical religion individualizes" (BR, 39). Similarly, cross-cultural philosophy of religion often generalizes ideas while feminist theology often individualizes experiences.
20
Paul Tillich, Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality, (Chicago: University of Chicago Press, 1955). Throughout this paper, references to this work will be in the form of (BR, page number).
Limits and Possibilities of Tillich's Ontology
261
Tillich finds the point of contact between biblical religion and ontology in the subjective side of each, more than the objective, doctrinal side. Both the person searching for ontological truth, threatened by nonbeing, and the believer who takes the risk of faith in the face of doubt share the " N o " of doubt which is taken into the "Yes" of courage (BR, 63). Both experiences involve final trust in the power of being and participation in particular experiences and symbols which give content to their experience, questions and answers (BR, 63). Similarly, both the feminist and the pluralist have doubted traditional theological doctrines but move on to offer new concepts and symbols which cohere with their experience of the world. The person who speaks of ultimate reality ontologically has encountered it existentially, just as the person who speaks of God in faith (BR, 65). "Religiously speaking, this means that our encounter with the God who is a person includes the encounter with the God who is the ground of everything personal and as such not a person." (BR, 83). Tillich concludes that faith includes itself and the doubt of itself. The tensions are not resolved but Tillich argues that when one lives courageously in the midst of these tensions, one discovers "their ultimate unity in the depths of our own souls and the depth of the divine life" (BR, 85). The tension between the abstract formulations and concrete, personal expressions in both pluralism and feminism may have to be handled similarly — recognized and affirmed, lived in courageously but not resolved. Religious pluralism attempts to develop an approach which will take seriously each of the diverse religious traditions but which will also allow for truth more broadly than within one tradition. The persons of the religious traditions and their specific views are valued, but at the same time, we are looking for an approach which includes the variety of such persons and their traditions. Feminism also is caught in this tension as it attempts to keep the ultimacy of God but avoid abstractions which hide patriarchal assumptions. One effort has been the use of metaphors which can be more experimental, imagistic, and pluralistic than traditional symbols. 21
21
See Sallie McFague, Models of God, p. 37. McFague does express appreciation for Tillich's distinction between the symbol God and God as Being-itself but she sees her own metaphorical theology as more open and free than Tillich's.
262
Mary Ann Stenger
Thus, for both pluralism and feminism, we are caught in this same tension which Tillich describes. And perhaps we too are left with affirming and living courageously in the tension between the abstractions and the concrete, personal images. c. The God Above God A similar tension in Tillich's understanding of ultimacy is between the contentless point of the God above God and the concrete symbols of God which can be doubted. Once again, we are confronted with the doubter who yet has faith and the faith which can be doubted. The doubter may doubt specific contents of meaning, such as the God of the divine-human encounter or the patriarchal, imperialist God. But if the doubter accepts meaninglessness and has the courage to face meaninglessness, that is a meaningful act. In The Courage to Be22 Tillich interprets this meaningful act as an experience of meaning, based in the power of being-itself. The power to accept meaninglessness is not rooted in any concrete, meaningful content but rather in the contentless power or ground of being. Tillich calls the acceptance of this power absolute faith (CB, 177). Nonbeing threatens faith through doubt but in absolute faith the power of being overcoming nonbeing is experienced. In The Courage to Be, being is defined as "the negation of the negation of being" (CB, 179). Negation as an active negation implies the character of power in being-itself. Nonbeing negates but has no character in and of itself; rather it gathers its qualities from the being that it negates, such as guilt in relation to moral being (CB, 40—41). In absolute faith, the person experiences the negation of the negation of meaninglessness but it is without content and therefore does not deny the ultimate meaninglessness of concrete meanings. In this sense, being-itself or the power of being is a limit concept as well as a grounding concept for Tillich. That which is experienced as the limit of doubt, that which undergirds doubt and the courage of despair, is also the ground of all forms of courage (CB, 190). Particular
22
Paul Tillich, The Courage to Be, (New Haven, CT: Yale University Press, 1952). Throughout this paper, references to this work will be in the form of (CB, page number).
Limits and Possibilities of Tillich's Ontology
263
forms of courage which affirm more concrete meanings than the absolute faith which faces meaninglessness are rooted in that same absolute faith, in being-itself as the ground and power of being and meaning. Perhaps then we might look at the abstract direction of cross-cultural proposals as expressing limit and grounding concepts of ultimacy, with the traditional expressions as particular examples of contents. Any of the particular contents can be doubted, as we can see when we look at the critiques arising from pluralism and feminism. But both pluralism and feminism have not been content to rest on an abstract point of ultimacy beyond all concrete expressions. Rather, they have affirmed the relativism such a view implies and have moved on to constructing feminist metaphors or pluralist concepts of God and Christ. 4. Content: Ontological Aspects of Tillich's Own Responses to Female Symbolism and Religious Pluralism a. The Ground of Being and Feminist Theology Among particular contents in Tillich's own theology is his use of the ground of being as a symbolic concept for the ultimate. Tillich associates this use of ground of being with feminine aspects of divinity. In his discussion of the Trinity, Tillich notes the high status of the Virgin Mary in Roman Catholic devotion and asks whether there are any elements in Protestant symbolism which transcend the alternative malefemale or which can be developed over against "the one-sided maledetermined symbolism" (ST, III, 293). Tillich suggests that "ground of being" symbolically points to "the mother-quality of giving birth, carrying, and embracing, and at the same time, of calling back, resisting independence of the created, and swallowing it." (ST, III, 294). Tillich sees the rootedness of all in the ground and power of being as helping to balance out the male-dominated (patriarchal) symbols of divinity. The ground and power of being suggests a more intimate relationship between God and creatures than the father-image who demands of his children, where God is one superior person among other persons (ST, III, 294). Tillich has recognized the one-sidedness and implied oppression of the father symbolism that have more recently been critiqued by feminists. This aspect of Tillich's thought has not been ignored by feminists. For example, McFague uses and agrees with Tillich's suggestion that
264
Mary A n n Stenger
the ground of being points to a mother-quality which both gives birth and calls all life back to reunification. 23 She also connects that mother quality with Tillich's emphasis on love as reuniting the separated. But whereas Tillich's discussion of this point almost reads as a divergence in his system, McFague makes these metaphors the center of her theology. The metaphors of God as Mother and Lover unfold more fully the meanings of life-giving and reuniting love expressed in Tillich's "ground of being." b. Being — Nonbeing: Reality — Nothingness Tillich also recognized some of the issues raised by the Christian theologian's encounter with non-Christian religious traditions. Sticking to ontological aspects of Tillich's approach to these issues, we once again find Tillich pointing to the important difference between the personal symbolism of the ultimate in Christianity and the transpersonal expression of the ultimate in Buddhism. 24 Tillich then points to the transpersonal expression of the ultimate as being-itself which indicates its non-identity with particular existing things and thereby helps the Christian to understand the Buddhist expression of 'absolute nothingness.' (EN, 67). On the other hand, Tillich points out that some forms of Buddhism affirm the Buddha-spirit in many personal manifestations. Thus, there may be points of similarity but these do not negate or transcend the important differences among the diverse traditions. It is interesting that Tillich's encounter with diverse religious traditions, especially Japanese Buddhism, does not lead him to deeper discussions of the relation of being and non-being but rather to discussions of typologies of religion, the proposal of a method or attitude of approach to pluralism, and the positing of the religion of the concrete spirit as the ground and goal of religions. But some thinkers coming after Tillich have pursued such questions of Tillich's ontology in relation to Japanese Buddhism. On the Christian side, Langdon Gilkey has discussed the polar dependence and dialectic of being and nonbeing in Tillich's thought 23 24
Sallie McFague, Models of G o d , pp. 1 0 1 - 1 0 3 . Paul Tillich, Christianity and the Encounter o f the World Religions, (New York: Columbia University Press, 1963), pp. 65 — 66. Throughout this paper, reference to this w o r k will be in the form of (EN, page number).
Limits and Possibilities of Tillich's Ontology
265
and has related them to some Buddhist discussions of reality and nothingness. 25 Gilkey points out that nonbeing is not just a minor aspect of Tillich's ontology but an important element of the dynamics of being-itself. Negation, self-sacrifice, and non-being are not only found in Tillich's discussion of humans but also his understanding of God and Christ. On the Buddhist side, Masao Abe has written several articles on Tillich and Buddhist thought which consider Tillich's understanding of being and non-being. Abe is appreciative of the dynamics of Tillich's ontology of affirmation and negation, but finally, he sees Tillich as emphasizing being more than non-being. Such ontological priority for being differs from Abe's Buddhist emphasis which gives priority to nothingness over being, and this remains an unresolved tension. 5. The Christ as New Being Although the focus of this symposium is God and Being in Tillich's ontology, I cannot close without a brief mention of Tillich's ontology of the Christ. I have mentioned earlier that the focus on Christ as male and the focus on Christ as the unique savior, the final, one and only savior have been strongly critiqued by feminism and pluralism, respectively. Just as Tillich's doctrine of God as being-itself opens up possibilities for advancing beyond patriarchal and imperialistic theology, so also does Tillich's doctrine of Christ as New Being. By reducing the traditional emphasis on the historical Jesus of Nazareth and emphasizing the universal content in the Christ, Tillich's symbol of the New Being can be understood without gender and can be applied more broadly than Jesus of Nazareth. Although Tillich does not pursue all the implications of his theology of the New Being, others can and have. Feminist Mary Daly has used the New Being to refer to the healing experiences of women whose consciousnesses have been raised.
25
Langdon Gilkey, "The Theology of Paul Tillich: The Symbol of 'God'", lecture given at the Hope College Centenary Celebration of Tillich's Birth, Hope College, June 9, 1986. Gilkey developed similar points in his paper, "Tillich and the Kyoto School," given at the North American Paul Tillich Society meeting, December 5, 1987. Also see Langdon Gilkey, The Society and the Sacred, (New York: Crossroad, 1981), pp. 1 2 4 f f .
266
Mary A n n Stenger
She keeps Tillich's emphasis on the healing, reconciling aspects of the New Being while rejecting the identification with the male Jesus of Nazareth. Similarly, talk of New Being expressed outside of Christianity opens up truth in non-Christian traditions. But this leads us to distinguish between a philosophy of religious pluralism which may not want to be rooted in a particular religious tradition and a theology of religious pluralism which does continue its rootedness in a particular tradition. Clearly, Tillich's approach to New Being is more helpful for the latter because Tillich continues to affirm the final revelation in Jesus as the Christ, the New Being. But today even that approach is being critiqued as not really universal enough, as ultimately disguising an ongoing religious imperialism. Gilkey's approach which proposes a relative absoluteness for Christian symbols or Hick's Kantian-type distinction between the noumenon and the phenomena avoid the imperialism and still allow for the psychological absoluteness within a tradition. Perhaps New Being could be a neutral enough term that the ontologial significance of reunion, reconciliation, healing, etc. could cut across religious traditions. But that means opening it up far beyond Tillich's focus in the Christ. And even with that openness, one would have to see how such a concept or symbol works in inter-religious dialogue or in feminist discussions, whether it can really be separated from its roots in Jesus as the Christ (or even whether finally it should be). In a discussion of religious pluralism, Tom Driver notes that some aspects of Tillich's own christology could be judged negatively by his critique of idolatry. While Tillich did focus on the "self-emptying ultimacy" of the Christ (apart from specific content), Driver notes that Tillich found such ultimacy only in the crucified Christ, the center for all human history. 26 Of course, this is a most sensitive and complex area of application of the critique of idolatry. C. The Future Where does that leave us in our attempt to critically use Tillich's ideas to help bring together the feminist and pluralist critiques of 26
Tom Driver, "The Case for Pluralism," The Myth of Christian Uniqueness; Toward a Pluralistic Theology of Religions, edited by J o h n Hick and Paul F. Knitter. (Maryknoll, N Y : Orbis, 1987), p. 2 1 5 .
Limits and Possibilities of Tillich's Ontology
267
Christian theology? Tillich's distinction between God and being-itself, between symbols and the unconditional itself, can be helpful for including both feminist and pluralist approaches. Such a distinction points to the relativity and imaginative construction of theological expression. Tillich's concern to provide a non-symbolic basis of symbols and yet to relativize all theological conception in relation to the ultimate causes him difficulty in his discussion of the relation between God and beingitself. But it is supported by the radical relativity demanded by both feminism and pluralism. The lack of recognition of relativity in theological construction has created an idolatry of male expressions which feminism critiques and an idolatry of Christian forms of expression which pluralism critiques. Tillich's distinction between God and being-itself provides the basis for his guardian standpoint of ultimacy. Of course, the self-sacrificing aspects of the Protestant principle as criterion of religious truth is rooted in Tillich's focus on the crucified Jesus as the Christ. But the roots of that are in the guardian standpoint, distinguishing relative human expressions of ultimacy from ultimacy itself — symbols of God from being-itself. But it is also the identification of God as being-itself that makes possible the symbolic expressions of ultimacy. Tillich recognized the importance of the interconnection and relatedness of symbols to that which they symbolize. Tillich's expression of God as the ground of being points to relatedness and yet separation while the power of being points to participation. It is God as ground and power of being that connects not only religious symbols to their object but also the symbol makers to their source and ongoing root. In relation to idolatry, Tillich recognized not only the consequences for religious truth of idolatry but also its destructiveness for human lives. Whether one looks at the oppression of females or the imperialistic put-downs of non-Christians, one can see the destructiveness of idolatry. Tillich's emphasis on the dynamic inter-relation of being and nonbeing can and has lead to substantive dialogues between some Mahayana Buddhists and Tillich's thought. This is a particular application of Tillich's ontology which can be helpful in dialogue but may be too focussed for any overall conclusions about cross-cultural religious truth. Being and nonbeing do not have the same priority in all traditions and not even all parts of the Buddhist and Christian traditions. Yet, the very
268
Mary Ann Stenger
fact of specific substantive dialogue on being and nonbeing points to some differences between Tillich's own thought and the uses of Tillich for today. Present day thinkers may feel free to reinterpret Tillich's views of being and nonbeing, especially the necessary priority of being over nonbeing, while retaining his emphasis on their dynamic relationship. We conclude, then, that Tillich's ontological theology offers many possibilities for helping contemporary theology take account of the feminist and pluralist critiques. But that Tillich's own theology is limited by its ties to specific Christian symbols and events as final revelation. Today, such finality has been radically critiqued, but the symbols and concepts which Tillich used to express his theology may still be helpful in a more radically relativized context and in inter-religious dialogue, where participants affirm their roots in a particular tradition. The creative tensions within Tillich's own theological system continue outside his system in the tensions of pluralism and feminism as we build theology in and for our present situation.
Verzeichnis der Autoren Boozer, Jack S. (f), Prof. Dr., Department of Religion, Emory University, Atlanta, Georgia 30322, USA Fujimoto, Kiyohiko, Prof. Dr., 15 Yamasaki Miyamaki Tanabe-cho, Tsuzuki-gun Kyoto, Japan Hummel, Gert, Prof. Lie. Dr., Universität des Saarlandes, FR 5.2. Evangelische Theologie, Im Stadtwald, 6600 Saarbrücken 11, BRD Jahr, Hannelore, Dr., List-Straße 24/1, 7400 Tübingen, BRD Keil, Günther, Prof. Dr., Alter Kirchhainer Weg 17, 3550 Marburg/ Lahn, BRD Kucera, Zdenek, Prof. Dr., Husova Faculta, Kujbyseva 5, 160 00 Praha 6, CSSR Nuovo, Victor L., Prof. Dr., Department of Philosophy, Middlebury College, Middlebury, Vermont 05753, USA Petit, Jean-Claude, Prof. Dr., 86 rue Hebert, Ville Saint-Laurent, Quebec, Kanada Ringleben, Joachim, Prof. Dr., Dahlmannstr. 24, 3400 Göttingen, BRD Rowe, William L., Prof., Department of Philosophy, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA Scharlemann, Robert P., Prof. Dr., 1529 Rutledge Avenue, Charlottesville, Virginia, USA Schwarz, Hans, Prof. Dr., Universität Regensburg, Institut für Evangelische Theologie, Universitätsstr. 31, 8400 Regensburg, BRD Steinacker, Peter, Prof. Dr., Sanderstraße 192, 5600 Wuppertal 2, BRD Stenger, Mary Ann, Prof. Dr., 7304 Kreisler Way, Louisville, Kentucky 40222, USA Thomas, Terence, Doz. Dr., The Open University in Wales, 24 Cathedral Road, Cardiff, CF1 9SA, Wales, GB Vahanian, Gabriel, Prof. Dr. Dr., 136 Palais universitaire, 67084 Strasbourg, Frankreich Wenz, Gunther, Prof. Dr., Untere Hausbreite 15, 8000 München 45, BRD Winquist, Charles E., Prof. Dr., Dep. of Religion, 501 HL Syracuse University, Syracuse/NY 13 244, USA
SCHLÜSSEL ZUM WERK VON PAUL TILLICH Textgeschichte und Bibliographie sowie Register zu den Gesammelten Werken Gesammelte Werke Band XIV 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage von Renate Albrecht und Werner Schüßler Oktav. 344 Seiten. 1990. Gebunden D M 8 8 , ISBN 3 11 012039 9 Der hier vorgelegte „Schlüssel zum Werk von Paul Tillich" ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für die wissenschaftlich-kritische Beschäftigung mit dem Werk Paul Tillichs. War es das Anliegen der ersten Auflage, mit dem damaligen Titel „Register, Bibliographie und Textgeschichte zu den Gesammelten Werken von Paul Tillich" (GW Band XIV), lediglich die Gesammelten Werke wissenschaftlich zu erschließen und die Geschichte eines Textes vom Erstdruck bis zum Abdruck in den Gesammelten Werken zu rekonstruieren, so weitet die nun vorliegende zweite neubearbeitete und erweiterte Auflage die Frage nach dem authentischen Tillich-Text in einer zweifachen Weise aus: Einmal ist die Entstehungsgeschichte auch auf die Systematische Theologie, die Religiösen Reden, die Ergänzungs- und Nachlaßbände und die Dogmatik von 1925 ausgedehnt; zum anderen wird erstmalig auch die Vorgeschichte der den Gesammelten Werken zugrunde liegenden Erstdrucke dokumentiert. Damit ist der Tillich-Forscher in die Lage versetzt, in den Archiven Textvarianten bis zu etwaigen Handschriften Tillichs nachzuprüfen. Neben der Entstehungsgeschichte ist es vor allem die ausführliche Bibliographie — nun auf dem Stand von 1988 —, die das Werk Tillichs zu erschließen hilft. Preisänderung vorbehalten
W Walter de Gruyter
DE
G
Berlin · New York
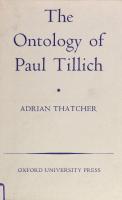
![Being Versus Word in Paul Tillich's Theology/Sein Versus Wort in Paul Tillichs Theologie: Proceedings of the VII. International Paul-Tillich-Symposium held in Frankfurt/Main 1998 / Beiträge des VII. Internationalen Paul-Tillich-Symposions in Frankfurt/Main 1998 [Reprint 2011 ed.]
3110165244, 9783110165241, 9783110809916](https://dokumen.pub/img/200x200/being-versus-word-in-paul-tillichs-theology-sein-versus-wort-in-paul-tillichs-theologie-proceedings-of-the-vii-international-paul-tillich-symposium-held-in-frankfurt-main-1998-beitrge-des-vii-internationalen-paul-tillich-symposions-in-frankfurt-main-1998-reprint-2011nbsped-3110165244-9783110165241-9783110809916.jpg)


![Emanuel Hirsch und Paul Tillich: Theologie und Politik in einer Zeit der Krise [Reprint 2012 ed.]
9783110881493, 9783110129335](https://dokumen.pub/img/200x200/emanuel-hirsch-und-paul-tillich-theologie-und-politik-in-einer-zeit-der-krise-reprint-2012nbsped-9783110881493-9783110129335.jpg)


![Siegfried Katterle (1933–2019): Sein Werk im Lichte der politischen Theologie von Paul Tillich [1 ed.]
9783428558858, 9783428158850](https://dokumen.pub/img/200x200/siegfried-katterle-19332019-sein-werk-im-lichte-der-politischen-theologie-von-paul-tillich-1nbsped-9783428558858-9783428158850.jpg)

![The Concept of Correlation: Paul Tillich and the Possibility of a mediating Theology [Reprint 2012 ed.]
3110079143, 9783110079142, 9783110863994](https://dokumen.pub/img/200x200/the-concept-of-correlation-paul-tillich-and-the-possibility-of-a-mediating-theology-reprint-2012nbsped-3110079143-9783110079142-9783110863994.jpg)
![God and Being / Gott und Sein: The Problem of Ontology in the Philosophical Theology of Paul Tillich / Das Problem der Ontologie in der Philosophischen Theologie Paul Tillichs. Contributions made to the II. International Paul Tillich Symposium held in Frankfurt 1988. [Reprint 2015 ed.]
3110122545, 9783110122541, 9783110853476](https://dokumen.pub/img/200x200/god-and-being-gott-und-sein-the-problem-of-ontology-in-the-philosophical-theology-of-paul-tillich-das-problem-der-ontologie-in-der-philosophischen-theologie-paul-tillichs-contributions-made-to-the-ii-international-paul-tillich-symposium-held-in-frankfurt-1988-reprint-2015nbsped-3110122545-9783110122541-9783110853476.jpg)