Die Straßennamen Lüneburgs: Herausgegeben:Reinecke, Wilhelm; Luntowski, Gustav; Reinhardt, Uta;Mitarbeit:Reinhardt, Uta [5 ed.] 9783767570788, 3767570785
Straßennamen sind ein Stück Stadtgeschichte. Bereits 1914 publizierten Wilhelm Reinecke ein Buch über die Straßennamen L
113 92 10MB
German Pages 289 [294] Year 2007
Polecaj historie
Table of contents :
Cover
Title
Copyright
Inhaltsverzeichnis∗
Vorwort zur 5. Auflage
Citation preview
De Sulte Herausgegeben von Christian Lamschus und Uta Reinhardt
Band 15
Wilhelm Reinecke †/ Gustav Luntowski / Uta Reinhardt Die Straßennamen Lüneburgs
Inh. Dr. Reinhilde Ruprecht e.K.
Mit 26 Abbildungen. Der Umschlag zeigt einen Ausschnitt der Lüneburger Stadtansicht in Braun-Hogenberg (Kupferstich koloriert, um 1585)
Die Herausgeber danken den folgenden Förderern des Buches: Landschaft des Fürstentums Lüneburg, Celle Lüneburgischer Landschaftsverband beim Landkreis Celle, Celle GVK – Gesellschaft für visuelle Kommunikation mbH, Lüneburg
5. Auflage, 2007 Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. ©Edition Ruprecht Inh.Dr.R. Ruprecht e.K. Postfach 1716, 37007 Göttingen – 2007 www.edition-ruprecht.de ©4. Auflage, Deutsches Salzmuseum, 2003 Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlags. Diese ist auch erforderlich bei einer Nutzung für Lehr- und Unterrichtszwecke nach § 52a UrhG. Layout: Dr. Uta Reinhardt Druck: Hubert & Co, Göttingen
ISBN: 978-3-7675-7078-8
Wilhelm Reinecke 1866 – 1952
Die 2. Auflage war gewidmet dem Andenken von Dr. Helmut Reinecke, gefallen am 6. März 1942
Vorwort zur 5. Auflage Nachdem zwischen der 3. und 4. Auflage des vorliegenden Bandes fast vierzig Jahre vergangen sind, hat es bis zur 5. Auflage nur vier Jahre gedauert. Lüneburg empfängt nicht nur jedes Jahr mehr Touristen, die etwas über die Geschichte der Stadt erfahren möchten, sondern ist eine Stadt mit zunehmender Einwohnerschaft. Urlauber wie Neubürger interessieren sich für die oft nicht leicht zu verstehenden Straßennamen an ihrem mehr als 1000 Jahre alten Reiseziel bzw. Wohnort. Möge ihnen auch die 5. Auflage des Buches eine Hilfe bei der Suche nach Erklärungen sein. Im Sommer 2007
Dr. Uta Reinhardt
3
Vorwort zur 4. Auflage Seit Erscheinen der 3. längst vergriffenen Auflage des von Wilhelm Reinecke 1914 erstmals publizierten Werkes sind mehr als 30 Jahre vergangen. Während es 1966 Gustav Luntowskis Anliegen war, die nach der „Entnazifizierung“ etlicher Straßennamen notwendige Neu- oder Wiederbenennung dieser Straßen zu dokumentieren und die neu angelegten Straßen in den ersten nach dem 2. Weltkrieg entstandenen Stadterweiterungen in das Verzeichnis aufzunehmen, müssen nun die durch Gebietsveränderungen und starke Neubautätigkeit erforderlich gewordenen Straßenbenennungen berücksichtigt werden. Schon in der 3. Auflage konnten die ersten Straßennamen der beiden großen Stadterweiterungen der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts aufgenommen werden. Damals wurde Lüneburg mit den Wohngebieten Kaltenmoor und Kreideberg im Osten und im Norden der vorhandenen Bebauung kräftig ausgedehnt. Inzwischen sind auch im Süden und Westen neue Stadtteile hinzugekommen, deren Ausbau noch nicht abgeschlossen ist oder gerade einen neuen Schub bekommen hat. Durch die Autobahnverbindung Lüneburg-Hamburg (A 250) ist die Nachfrage nach Bauland gestiegen und damit auch die Notwendigkeit, neue Baugebiete auszuweisen und Straßen zu bewidmen. Die Konversion von Kasernenanlagen hat in Lüneburg nicht nur eine Campus-Universität sowie neue Wohn- und Gewerbegebiete entstehen lassen, sondern auch zur Ausweisung von Straßen in diesem ehemaligen militärischen Gelände geführt. Eine beträchtliche Veränderung und Erweiterung des Straßennamenverzeichnisses hatte die Gebietsreform des Jahres 1974 zur Folge. Die Stadt Lüneburg verlor ihre Kreisfreiheit und die Nachbargemeinden bzw. Wohngebiete Alt-Hagen, Ebensberg, Häcklingen, Ochtmissen, Oedeme, Pflegerdorf Brockwinkel und Rettmer wurden der Stadt zugeschlagen. Die dort vorhandenen Straßennamen sind jetzt in der 4. Auflage berücksichtigt. Teilweise gab es Doppelbenennungen, die durch Vegabe anderer Namen entweder in der Kernstadt Lüneburg oder den neu hinzugekommenen Gebieten bereinigt wurden. Während früher topographische Besonderheiten, öffentliche Gebäude und Einrichtungen, sowie Gewerbe bei den Straßen namengebend waren, sind es heute vor allem historische Persönlichkeiten oder Bezeichnungen aus Flora und Fauna, sofern nicht die Anknüpfung an einen alten Flurnamen möglich ist. Um die Orientierung auf dem Stadtplan zu erleichtern, werden durch gleichartige Straßennamen etwa nach Widerstandskämpfern, Musikern oder auch Tieren „Quartiere“ geschaffen. Vorschläge für Straßennamen kommen nicht nur aus der Verwaltung, sondern recht häufig auch von Bürgern. Kultur- und Verwaltungsausschuß fassen Beschlüsse über neue Straßennamen, die zur Grundlage des Ratsbeschlusses werden, mit dem der Name endgültig festgelegt wird. Im Text erscheint dieser Ratsbeschluß direkt unter dem Straßennamen. Auch das Fehlen eines Ratsbeschlusses, z. B. wegen hohen Alters des Straßennamens, wird mitgeteilt. Im Gegensatz zu den ersten drei Auflagen werden die Straßennamen nun nicht mehr alphabetisch nach dem Bestimmungswort gereiht, sondern streng nach dem Alphabet der Anfangsbuchstaben. Die Schreibweise ist die offizielle, wodurch sich gelegentlich Änderungen gegenüber den Reineckeschen Lesarten ergeben. 4
Damit soll die Orientierung erleichtert und der Bezug zum Stadtplan deutlicher werden. Was Reinecke zu seinem Leidwesen unterlassen mußte, ist in der 4. Auflage möglich geworden: die Aufnahme von zahlreichen Abbildungen zur Veranschaulichung der Straßen und ihrer Namen. Im übrigen sind die Textfassungen Reineckes und Luntowskis unverändert geblieben, wodurch eine gewisse sprachliche Ungleichmäßigkeit in Kauf genommen werden mußte. Darüber hinaus wurden lediglich offenkundige Versehen und Druckfehler korrigiert. Im Sommer 2003
Uta Reinhardt
5
Vorwort zur 3. Auflage Am 6. November 1966 jährt sich zum hundertsten Male der Geburtstag Professor Dr. Wilhelm Reineckes, Antiquars, Archivars und Bibliothekars des Museumsvereins für das Fürstentum Lüneburg bzw. der Stadt Lüneburg, dessen langjährigem Wirken die drei wissenschaftlichen Institute Lüneburgs, nämlich Museum, Stadtarchiv und Ratsbücherei, ihre grundlegende Gestaltung und Ausrichtung verdanken, der darüber hinaus aber auch die Lüneburger Stadtgeschichtsforschung in höchstem Maße befruchtete und durch zahlreiche eigene Arbeiten bereicherte. Zu den bekanntesten Werken Reineckes gehört zweifellos das Buch über die Straßennamen Lüneburgs, das nun aus Anlaß des hundertsten Geburtstages des Autors – auf Anregung des Rates der Stadt Lüneburg – seine 3. Auflage erhält. Die vorliegende neue Auflage, die vor allem das inzwischen vergriffene Buch wieder zugänglich machen soll, beschränkt sich im wesentlichen darauf, die Reineckesche Arbeit unter Berücksichtigung der Straßenumbenennungen und –neubenennungen seit der Zweitauflage von 1942 dem gegenwärtigen Bestand der Straßen und Wohnplätze der Stadt Lüneburg anzugleichen. Alle anderen Ergänzungen im Text, die gegenüber jener noch von Reinecke selbst besorgten Zweitauflage vorgenommen wurden, gehen fast auschließlich auf Reineckes eigenhändige Nachträge zurück, die er in seinem Handexemplar des Straßennamenbuches und vereinzelt auch an anderem Ort vermerkt hat. So kann man auch diese 3. Auflage wohl uneingeschränkt als das Werk Reineckes bezeichnen, das einst aus seiner so fruchtbaren Tätigkeit für die Stadt Lüneburg geflossen ist und nun in ehrendem Gedenken des Verfassers aufs neue vorgelegt wird. Besonderer Dank gilt dem Verlag August Lax, Hildesheim, der diese Auflage wieder in seine bewährte Obhut nahm, und dem Historischen Verein für Niedersachsen, der durch die erneute Aufnahme in sein Publikationsprogramm die Bedeutung dieser Reineckeschen Arbeit für die Landesgeschichtsforschung zum Ausdruck brachte. Lüneburg im April 1966 G. Luntowski
6
Vorwort zur 2. Auflage Die reiche Fülle der Lüneburger Straßennamen hat schon die heimischen Gelehrten des Siebzehnhunderts gefesselt und zu eingehenden Forschungen angeregt. Im literarischen Nachlasse des Stadtsekretärs Büttner († 1746) fand sich unter zahlreichen anderen Handschriften seiner eigenen Feder ein kleiner schlichter Pappband, bezeichnet Plateae civitatis Luneburgensis, quarum quidem in documentis antiquioribus fit mentio – ut et aedificia nonnulla specialia, et publica et privata (Straßen der Stadt Lüneburg, deren in älteren Schriftstücken Erwähnung geschieht – dazu einige hervorragende Gebäude, öffentliche und private). Auf 217, je in zwei Spalten beschriebenen Quartblättern hat Büttner in diesem Werke, in willkürlicher Folge, aus Urkunden und Rechnungen eine große Menge von Auszügen zusammengetragen, die nach dem Stichworte des jeweilig erwähnten Straßennamens geordnet und durch ein alphabetisches Register nutzbar gemacht sind. Das begehrenswerte Büchlein wurde, obschon es durch die Stadtmarke als Eigentum des Rates gekennzeichnet ist, seinem Stammsitze entfremdet und ist auf dem Umwege Frankfurt a. M. – Hannover erst zu Beginn dieses Jahrhunderts – dank der freundlichen Fürsorge des Stadtarchivars Dr. Jürgens zu Hannover – in die Obhut des Lüneburger Archivs zurückgelangt. Da die von Büttner benutzten Quellen mit verschwindenden Ausnahmen noch erhalten und für die vorliegende Ausgabe in Urschrift herangezogen sind, so konnten seine Aufzeichnungen in unserem Falle nur als Prüfstein dienen; als solcher aber haben sie ihren Dienst in der zuverlässigen Weise geleistet, wie sie in allen Forschungen Büttners eignet: sein Name muß daher vorweg mit Dank genannt werden. Der Lehrer an der Ritterakademie Ludwig Albrecht Gebhardi hat sich in seinem historiographischen Sammeleifer mit den Straßennamen gleichfalls liebevoll beschäftigt. Der 13. Band seiner im Besitz der Landesbibliothek zu Hannover befindlichen, unerschöpflichen Collectaneen enthält Seite 418 – 420 ein im Jahre 1795 aufgestelltes „Verzeichnis der Straßen zu Lüneburg nach ihren Vierteilen“. Es ist dem Entwurfe einer verbesserten Armenanstalt von 1777 entnommen und aus anderen Quellen ergänzt, zumal aus einem handschriftlichen, inzwischen verschollenen Straßenregister. Wertvoller als diese Namenliste ist Gebhardis Beigabe, ein nach einem Riß des Ingenieurkapitäns C. L. Balsleben von 1731 von ihm selber angelegter, „mit Ketten und Instrumenten“ nachgemessener und vielfach berichtigter Grundriß der Stadt, „1794 am 18. September vollendet, noch verbessert bis im September 1795“. Auch Urban Friedrich Christoph Manecke, dem bekannten Verfasser der topographisch-historischen Beschreibungen der Städte, Ämter usw. im Fürstentum Lüneburg, lag die Beschäftigung mit den Straßennamen nahe. Der zweite Band seiner handschriftlichen Sammlungen führt den Titel „der Stadt Lüneburg Tore, Straßen, Häuser, Höfe und Gärten“ ... und bringt u. a. eine Betrachtung des Bürgermeisters J. Ph. Manecke über die Lage der „Judenstraße“ und der mittelalterlichen Synagoge. Ergiebiger als diese Handschrift ist das erwähnte gedruckte Buch „Topographisch-historische Beschreibungen“ (Celle 1858), das in 7
seinem, schon 1816 gesondert erschienenen Abschnitte über die Stadt Lüneburg den hier zu behandelnden Gegenstand vielfach beleuchtet. Hammersteins mustergültige Beschreibung des Bardengaus ist für die älteste Geschichte Lüneburgs nach allen Richtungen so grundlegend, daß sie auch in unserem Zusammenhange wiederholt zu Rate gezogen werden mußte. Von Wilh. Friedr. Volgers Werken kommen außer dem Urkundenbuche seine beiden Aufsätze „Origines Luneburgicae, der Ursprung und der älteste Zustand der Stadt Lüneburg, ein Versuch“ (1855), sowie das „Neujahrs-“ und „Osterblatt“ von 1860 in Betracht unter dem Titel „Die Umgegend Lüneburgs“; ferner allerlei Notizen der Hinterlassenschaft, zumal eine handschriftliche Chronik. Manche schätzbare Angaben fanden sich auch in dem von Goerges und Monthans verfaßten, 1889 veröffentlichen „Gang durch das alte Lüneburg“, und O. Jürgens hat die ihm bekannt gewordenen älteren Daten auf S. 28 f. seiner Geschichte der Stadt (1891)
behandelt.
Keiner der Genannten hat sich, von vereinzelten Fragen abgesehen, an einer Deutung der Straßennamen versucht. In dieser Hinsicht hat die jüngste der hier aufzuführenden Schriften, die als Jahresbericht der Johanneums Ostern 1909 (Progr. Nr. 418) herausgegebene Abhandlung über die Frage „Was bedeutet der Name Lüneburg?“ von Professor Ludwig Bückmann unserem Gegenstande mannigfach vorgearbeitet. Die Deutung des Namens Hliuni, „Lüne“, als „Schutzort, Zufluchtsort“ und des Namens „Lüneburg“ als „Schirmburg“ ist von allen bisher abgegebenen Erklärungen die einleuchtendste und am besten begründete, und die kundigen Ausblicke, die der Verfasser auch einigen Lüneburger Straßennamen widmet, werden uns des öfteren Gelegenheit geben, auf ihn Bezug zu nehmen. Von den mit Straßennamen versehenen Plänen der Stadt sind folgende herangezogen: 1. Brunnenabriß der Ratskunst von M. Henrich Clausen, dem Kunstmeister Hermann Clausen und Moritz Gödeke 1652, Original des Stadtarchivs. 2. Plan Matthias Seutters, kolorierter Kupferstich mit handschriftlichen Zusätzen der Mitte des Siebzehnhunderts, Stadtarchiv. 3. Plan um 1765 von einem Unbekannten gezeichnet und leicht getönt, Stadtarchiv. 4. Gebhardis Plan aus den Jahren 1794 und 1795 in der Landesbibliothek, Hannover. 5. „Grundriß der Stadt Lüneburg“, angefertigt vom Ingenieurfähnrich Appuhn 1802. Original des Stadtarchivs. Geht von den Nummern 1 – 4 kein Blatt über das Maß 50 : 70 cm hinaus, so ist der zuletzt erwähnte Plan von außergewöhnlicher Größe, nämlich 1,90 hoch und 2,17 m breit. Der Maßstab beträgt nach freundlicher Berechnung des in solchen Fragen stets hilfsbereiten Technikers Fr. Bicher 1 : 1154. Wegen der Sorgfalt seiner 8
zeichnerischen Ausführung hätten wir diesen Plan im verkleinerten Maßstabe von 1 : 4000 wie der ersten, so auch dieser zweiten Auflage unseres Buches gern als Anhang beigefügt – die Absicht ließ sich während des Krieges leider nicht ausführen. Auch die schon vorbereitete Belebung des Textes durch angemessenen Bildschmuck mußte bedauerlicherweise in letzter Stunde aufgegeben werden. Einige Anmerkungen über die Entstehung erwähnten Originalplanes werden gleichwohl willkommen sein. Im Frühling 1801 bestand das von seiten der Kurfürstlichen Regierung zu Hannover unterstützte Projekt, die Ilmenau oberhalb Lüneburgs mit dem unteren Flußlaufe durch einen die Mühlen umgehenden, schiffbaren Kanal zu verbinden. Zu diesem Zwecke war „eine genaue Vermessung und ein sorgfältiges Nivellement des Auestromes mit allen seinen Armen und Ableitungen von der Altenbrücker Bleiche ab, wo der Lösegraben aus dem Auestrom abfließt, bis da, wo solcher bei Lüne wieder einfließt, mit Hinzufügung der anbelegenen Gegenden und des Teils der Stadt Lüneburg, welchen selbiger berührt, unumgänglich erforderlich“. Der Ingenieurhauptmann Dinglinger erhielt am 27. März des Jahres einen entsprechenden Auftrag und übernahm die Arbeit mit einem jungen, fachmännisch geschulten Gehilfen, dem Ingenieurfähnrich Carl Ernst Appuhn, der unter Leitung seines Vorgesetzten die Aufgabe in der Hauptsache zu lösen hatte. Die Gelegenheit war in hohem Maße dazu geeignet, die ganze Stadt mit gleicher Genauigkeit, wie denjenigen Teil, welcher für die Kanalfahrt in Betracht kam, aufzumessen, und Hauptmann Dinglinger sprach am 13. April 1801 dem Lüneburger Rate die Absicht aus, da er ohnehin die Gegend der Saline, des Roten, des Altenbrücker-, des Lünerund des Bardewikertores mit berücksichtigen müsse, diese Arbeit auch zur Grundlage eines genauen Risses der ganzen Stadt dienen zu lassen und deshalb einige Punkte und Grenzen des Kalkberges, des neuen Tores und des Michaelisklosters festzulegen. Leider ist dieser in seiner ganzen Tragweite nicht zur Ausführung gelangt, anscheinend, weil die unerläßliche, finanzielle Förderung durch die Kämmereikasse ausblieb, und so müssen wir im besonderen darauf verzichten, die einzelnen Grundstücksgrenzen in den Häuserblocks der Innenstadt eingezeichnet zu sehen. Die Kosten der Karte betrugen nach einer Aufstellung des Königlichen Staatsministeriums 792 Taler 5 gute Groschen; die Aufnahme muß im November 1802 vollendet gewesen sein. Die eigentlichen Quellen unserer Arbeit entspringen der Handschriften- und der Urkundenabteilung des Stadtarchivs. Von den rund 20000 Originalurkunden sind viele aus dem städtischen Liegenschaftsverkehr hervorgegangen und für die Erkenntnis der Straßennamen bedeutsam. Wichtiger noch sind in dieser Beziehung die Kopialbücher, die in stark überwiegendem Maße den Verkauf und die Belastung städtischer Grundstücke (und der Salingüter) behandeln. Sechs starke Folianten, für die vorliegende Aufgabe erschöpfend verwertet, umfassen den Zeitraum von 1346 bis 1682. Über den Endtermin der Kopialbücher hinaus, bis ins Achtzehnhundert, sind die Hausbriefe lateinisch abgefaßt, eine bürokratische Gepflogenheit, die unseren Zweck wenig stört, weil mitten im lateinischen Texte gerade der Straßenname gern in deutscher Fassung vermerkt ist. Wenn nur die Straße in jedem Falle überhaupt genannt wäre! Leider sind Eintragungen ohne zureichenden Hinweis nichts Seltenes. Es heißt da etwa: 9
Der Bürger A verkauft dem Bürger B eine Rente „aus seinem Haus und Grundstück“; Magister C behält sich bei Veräußerung seines Hauses eine Jahresrente vor; Der Bäcker D verkauft sein Haus „gegenüber dem Burmeister“; Bürger X vergibt das Haus „zwischen den Häusern der Bürger Y und Z“ – alles Angaben, die hinsichtlich ihrer Lokalität durch Vermittlung der Schoßrollen einigen Wert erhalten können, für die Entwicklung der Straßennamen ganz versagen. Die Schoßrollen, seit 1426 in einer fast vollständigen Reihe von Jahrgängen überliefert, buchen die Listen der Steuerpflichtigen, und zwar in einer bestimmten Folge nach den Grundstücken und Wohnungen innerhalb der Stadt. Mit Straßennamen sind sie bedauerlich sparsam. Die Einteilung geschieht nach den vier Stadtvierteln. Den Anfang macht das Marktviertel (pars fori, dat marcktferndel 1493), den Beschluß, das Sülzviertel (pars saline, dat zulteferndel), an zweiter Stelle steht das Wasserviertel (pars aque, dat waterferndel), an dritter das Sandviertel (pars arene, dat sandtferndel)∗. Markt-, Wasser-, Sand-, Sülzviertel werden durch Buchstaben A, B, C, D gekennzeichnet, in den Schoßrollen vom Ausgange des Vierzehnhunderts auch durch folgende Marken: Marktviertel
1494-96,
Wasserviertel
1495-1500
Sandviertel
1495-97,
Sülzviertel
1495-1501.
1498,
1499 und 1500
1498-1501
Am Schlusse jedes Viertels werden unter der Rubrik „in turribus“ die Insassen der städtischen Wohntürme aufgezählt, oftmals ausgediente Kunsthandwerker, die sich von ihrer Hände Arbeit nicht mehr ernähren konnten. Die Einteilung in Viertel hat ihre Bedeutung auf dem Gebiete der Gesundheitspflege, Waisenfürsorge und zumal für die Wahlen der Bürgervorsteher bis in die Neuzeit behauptet; wann sie entstanden ist, läßt sich schwer sagen; nachweisbar ist sie aus Bruchstücken von Schoßrollen schon um 1370. Von den beiden merkwürdig abspringenden Schnittlinien, welche die vier Viertel trennen, läuft die eine vom Ausgange der Conventstraße an der Ilmenau diese Straße hinauf, auf dem Berge bis zur Ecke der Zollstraße, dort hinauf zur Bäckerstraße, hier bis an die Schrangenstraße, diese hinauf bis zur Kuhstraße und nun in südlicher Richtung über Enge-, Racker- und Gumma- zur Wallstraße; die andere vom Bardewikertore nach Süden bis an die Ecke der Schrangenstraße, hier hinauf bis zu den Vierorten und die Altstadt verfolgend zum Neuentore.
∗
So ist’s fester Brauch; im Ausnahmefalle vertauscht das Wasserviertel seinen Platz mit dem Sandviertel. Eine durchaus abweichende Anordnung (Sand-, Sülz-, Markt-, Wasserviertel) hat, auffallend genug, der älteste Jahrgang von 1426. 10
Nummern oder Artikel führt das Schoßregister vom Jahre 1687 ein. Hausnummern, folgerichtig aus Buchstaben und Zahl zusammengesetzt, sind nachweisbar seit 1819 (A 17, C 5 und entspr.); eine Ordnung der Hausnummern nach Straßen ist erst 1866 geschehen. Im Juni 1867 wurde nach Volgers handschriftlicher Chronik eine neue Nummernbezeichnung der Häuser vorgenommen. Von sonstigen Stadtbüchern, die für die Beschaffung unseres Stoffes dienlich gewesen sind, sei neben den Kämmereirechnungen (1433 ff.) nur das Ratsdenkelbok aus dem Vierzehnhundert und ein Baubuch (1409 bis 1499) hervorgehoben. Halten wir über das bunte Volk der Lüneburger Straßennamen eine schnelle Umschau, so sind bestimmte Gruppen leicht zu unterscheiden. Ihre Art ist für die Entstehung der Namen lehrreich. Da ist es zuerst die natürliche Bodenbeschaffenheit, die Hebung oder Senkung des Geländes, ein Wasserlauf oder eine auffallende Pflanze, Feld, Garten, Wiese, Weide, die namenbildend geworden sind. Wir weisen hin auf die Straßen „am Sande“, „uppe dem hore“ (Harz), „in der Marsch“, „Wülschenbrok“; „am Berge“, „beim Kalk-“, „am Kreide-“, „Schwalben-“ „am Windberge“, „auf dem Brink“; „Ilmenau-“ und „Gummastraße“, „zur Rotenschleuse“, „Pferdetränke“, „am Werder“, „Vickenteich“, „Wiepkenloch“; „Lindenstraße“, „Hole Ek“, „hinter dem Strunk“, „am Iflock“, „Blümchensaal“; „Feldstraße“, „Grasweg“, „Garten- “ und “Kohlstraße“, „auf der Breitenwiese“, „in der Weide“. Straßen, wie die „Enge“ und „Kurze“, „Hokel“, „an den Vierorten“ und andere, mit volkstümlicher Anschaulichkeit oder gutmütigem Spott derber bezeichnete, die nach ihrer natürlichen Beschaffenheit charakterisiert sind, gesellen sich hinzu: „Arskerve“, „Gold-“ und „Katzenstraße“, „langes Elend“ und „langer Jammer“, „Schietwinkel“, „im Timpen“. Die zweite Gruppe ist die stärkste von allen, wenn wir darin die Namen zusammenfassen, die auf ein öffentliches Gebäude, zumal die Kirchen mit ihren Friedhöfen, die Klöster und Stifte Bezug nehmen. Da sind die alten Pfarrkirchen und Kapellen der Stadt, ob sie gleich längst dahingesunken, ausnahmslos vertreten: St. Johannis und St. Cyriak, St. Michaelis und St. Lamberti, St. Andreae, St. Nicolai, Unserliebenfrau, St. Gertruden, St. Antoni, der Kleine und Große Hl. Geist, St. Benedikt und die Marienkapelle im Langenhof. „Convent-“, „Gral-“, „Johannis-“ und „Kalandstraße“, „Klostergang“ und „Klosterhof“, „Lamberti-“ und „Marienplatz“ gehören in diesen Zusammenhang. Eine ansehnliche Reihe von Profanbauten – altehrwürdige und modernste, in verträglicher Mischung – schließt sich daran an: die Abst-, Lüner- und Ratsmühle, Altenbrücker- und Neuer Ziegelhof, Apotheke, Bahnhof, die Burg, Kaufhaus, Münze, Saline (Sülze), das Schlachthaus, die Wage – und wie viele Namen erinnern an die mächtigen Befestigungswerke der Stadt, die Mauern, Wälle, Türme, Tore, Dämme, Sperrvorrichtungen („Baumstraße“) und den Landwehrgürtel. Auf ihr Richtungsziel deuten die Namen: „Bardowicker-“, „Bilmer-“, „Bleckeder-“, „Dahlenburger-“, „Lübecker-“, „Lüner-“, „Rotestraße“, „Ochtmisser-“, „Schnellenberger-“, „Bienenbütteler-“, „Wülschenbrucherweg“, „Soltauer Chaussee“, „Uelzenerstraße“.
11
Ihre bis zur Gegenwart festgehaltene oder vormalige Bestimmung verraten die Namen einer vierten Gruppe: „auf der Hude“ und „Holzberg“, „Schießgrabenstr.“ und „Schützenplatz“, „Kuh-“, „Korn-“, „Salzstraße“ und „Salzstraße am Wasser“, „An den Brodbänken“, „Markt“ – insonderheit „Fisch-“, „Ochsen-“, „Schweine-“, „Stint-“ und „Ziegenmarkt“ – „Wandrahmstraße“, „Mönchs-“ und „Tiergarten“. Von nicht minderem Interesse sind die Gewerbenamen, entstanden in einer Zeit, als die Genossen des Handwerks an einer Straße zusammenwohnten oder an einem festgelegten Platze ihre Verkaufs- und Arbeitsstände hatten, in Lüneburg die Bäcker, Böttcher, Glocken- und Grapengießer, die Gerber, Kammacher, Kuhlengräber, die Kramer, Kupferschläger, Scherenschleifer, Schlachter, Schneider, Snitker, Wandfärber und Weber. Nahe damit verwandt sind die Namen „Papen-“ und „Reitendedienerstraße“, „Judenstraße“, „im Wendischen Dorfe“ und „Wendische Straße“, aber auch „Büttel-“, „Burmester-“, „Jäger-“ und „Rackerstraße“. Vom Werden und Wachsen des Gemeinwesens sprechen „Alt-“ und „Neustadt“, „Alte“ und „Neue Brücke“, „Neue-“ und „Ohlinger Straße“, „Neue Sülze“, „auf dem Wüstenorte“, „Grenzstraße“, während von einem bestimmten geschichtlichen Vorgange andere Namen zu erzählen wissen: „Zeltberg“, „Zollstraße“, „Ritterstraße“, „Stammersbrücke“, „Friedenstraße“. Häufig ist die Ableitung des Straßennamens von einem Anwohner oder dem Eigentümer eines beherrschenden Eckhauses. So erklären sich „Finx-“, „Koltmann-“, „Titersche Straße“, „Pannings Garten“, „Visculenhof“ und die große Masse anderer „Höfe“ und „Gänge“, die im Laufe der Jahrhunderte, wie die Wohntürme in den Stadtmauern, ihre Bezeichnung ungezähltemal gewechselt haben. Im Achtzehnhundert, in Lüneburg erst in dessen letztem Viertel, ist der sinnige Brauch aufgekommen, verdiente Männer und Frauen dadurch auszuzeichnen, daß man ihre Namen der ehrwürdigen Urkunde des Straßenbildes für alle Zeiten einprägt. Mit gutem Grunde ist in den meisten Fällen auf eine lebendige Beziehung zur Salz- und Heidestadt Wert gelegt. Die vornehmste Gruppe ist hier die der klangvollen Patrizier- und Bürgermeisternamen: Elver, Garlop, Schomaker, Töbing als Künder einer rühmlichen Vergangenheit; Barckhausen, Fromme, Keferstein, Lauenstein als Träger einer neuen Blüte. Unlöslich gehören dazu Gravenhorst und Volger. Bögel, Egersdorff, Görges, Haage und Reichenbach, fünf Namen und ebensoviel Zeugnisse eines segensreichen, gemeinnützigen Wirkens innerhalb und außerhalb der Berufspflicht. An unfriedlichere Betätigung, zugleich an die stürmischen Apriltage von 1813 mahnen die „Dörnberg-“, „Gellers-“, „Henning-“, „Johanna Stegen-“ und „Spangenberg Straße“. Um die Zeit, als die Garnison für Lüneburg Bedeutung gewann, sind die großen Heerführer Blücher, Gneisenau, Hindenburg, York ausgezeichnet. Aus dem Kreise der Lüneburger Gelehrtenwelt sind Büttner und Wedekind aufgerufen, und aus dem Dichterkranze ist das Gedächtnis an Dietrich Speckmann und Julius Wolff festgehalten. Wurde bei dem Namen dieser siebenten und letzten Abteilung ohne Ausnahme das Grundwort „Straße“ verwandt, so fällt im übrigen, sowohl bei den altüberlieferten, als auch bei den neuesten Straßennamen, die Mannigfaltigkeit der äußeren Form angenehm auf. Die ständige Wiederholung des Wortes „Straße“ wirkt ermüdend und ist, soweit möglich, bei der modernen Namengebung mit Bewußtsein vermieden, wie das in der Vergangenheit, sicherlich unbewußt, geschehen ist. In den 12
mittelalterlichen niederdeutschen Straßenbezeichnungen fehlt ein Grundwort sehr häufig ganz: achter der wedeme, achter deme krane, bi dem spiker, bij der rackerige, by dem waterstaven, by dem teygelhave, tegen der scriverie, jegen der logenbank over, solthus over, in den scharren, uppe der wusten word, up dem dike, in dem observantenkloster, twischen beiden diken, bi der muren, up dem nigenlande – und was dergleichen Beispiele sich mehr bieten. Statt des neueren Wortes „Platz“ („Lamberti“, „Marien-“, „Schrangen-“ usw. platz) gebrauchen die älteren Quellen „Markt“ (s. oben), „Hude“, „Plan“ (uppe deme plane), „Schild“ – dieser dreiseitig begrenzt – und stade für das gepflasterte Ufer (stintstade). Von der „Straße“ (strate, platea) werden unterschieden schmalere „Twite“ (vicus, in Hamburg, Stade, Braunschweig häufig, in Lübeck, Rostock, Wismar, Stralsund nicht anzutreffen; in Lüneburg u. a. die brotlose-, „Glahns-“, „Kammacher-“, siegertwite, twite de upgeit to der nien sulten wort), der „Steg“ oder „Stieg“ (heringssteg, „Jungfernstieg“), der „Gang“, meist zu Anfang oder Ende überdeckt, der ort, die Ecke (uppe der pewler orde, „Bullenort“, „Ziegenort“, uppe den veer orden, wo zwei Straßenzüge sich kreuzen), der (ungepflasterte) „Weg“. „Grube“ („in der Wolfsgrube“) und „Kule“ („Aschen-“, „Baum-“, „Kreide-“, „Lachs-“, „Löwenkule“) sind in Lüneburg bekannt, aber nicht als Straßennamen; der einzige Ausnahmefall „Rübekule“, ist von einem Wirtshausnamen abzuleiten. – Mehr und nähere Nachweise zu den vorstehenden Andeutungen sind dem abschließenden Register vorbehalten. Die Sichtung und Auswahl des übergroßen Quellenstoffes ist in der Weise erfolgt, daß die heute noch lebendigen Straßennamen in alphabetischer Ordnung behandelt und jedem Artikel die zugehörigen älteren Bezeichnungen eingefügt sind. Einige Ergänzungen aus allerneuester Zeit bringt schon das Register. Die durch Verwendung der Antiqua (Anm.: In der vorliegenden 4. Auflage kursiv) als buchstabengetreu charakterisierten Auszüge aus den Handschriften des Archivs und auch jüngere Lesarten sind chronologisch aneinander gereiht; es ist Sorgfalt darauf verwandt, das älteste Vorkommen jedes Namens festzustellen. Die Zitate sind im Interesse der Lesbarkeit im einzelnen auf ihren Ursprung nicht zurückgeführt, und es wird genügen, daß die dem Archiv einverleibte Materialsammlung mit genauen Belegen dem Forscher jederzeit zur Verfügung steht. Einige Benennungen, die entweder örtlich nicht recht unterzubringen sind oder eine weiter ausholende gesonderte Darlegung erforderten, sind unter eigenem, in kleinerer Type (Anm.: In der vorliegenden 4. Auflage in Sperrdruck) gesetztem Kennworte („Judenstraße“, „am Linderbergertore“ u. a.) gegebenen Ortes eingereiht. Als Anhang sind die Namen der 54 Siedehütten der alten Saline zusammengestellt, ferner sonstige Hausnamen, zumal von Brauhäusern und Herbergen; in einem dritten Abschnitte die Tore, Türme und Wälle der Stadt. Die Hinweise auf Analogien in anderen, ausschließlich norddeutschen Städten stützen sich auf persönliche Ortskenntnis bzw. auf folgende Literatur: Wittpenning, Historisch-topographische Nachrichten von Stade und Umgegend. (Archiv des Vereins f. Gesch... zu Stade, 6. 1877. S. 425 ff.) Francke, Die Stralsunder Straßennamen (Hansische Geschichtsbl., IX. Jahrgang 1879. S. XXX ff.) Brehmer, Die Lübecker Straßennamen (Hans. Geschichtsbl. Jahrg. 1880/81. S. XX ff.). 13
Brehmer, Die Straßennamen in der Stadt Lübeck und deren Vorstädten (Zeitschrift des Vereins f. Lübeckische Gesch. und Altertumskunde Bd. 6. 1892). Doebner, Hildesheims alte Straßennamen (Studien zur Hildesheimischen Geschichte 1902). Buhlers, Hildesheimer Straßennamen (Sonderabdruck aus dem Familienblatt der Hildesh. Allg. Zeitg. 1906). Koppmann, Die Straßennamen Rostocks (Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock, Bd. III Heft 3. 1902). Meier, Heinrich, Die Straßennamen der Stadt Braunschweig (Quellen und Forschungen z. Braunschweigischen Gesch. Bd. I. 1904). Jürgens, Die älteren Straßennamen der Stadt Hannover (Hannoversche Geschichtsblätter 8. Jahrg. 1905; z. vgl. 10. Jahrg. 1907, 11. Jahrg. 1908, 17. Jahrg. 1914). Techen, Die Straßennamen Wismars (Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins f. Meckl. Gesch. 66. Jahrg. 1901). Stephan, Die Straßennamen Danzigs (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreußens. 7. 1911). Joachim, Hermann, Hamburgische Straßennamen (Kulturgeschichtliche Studien u. Skizzen, Festschrift zur 400 Jahrfeier der Gelehrtenschule des Johanneums zu Hamburg, 1929). Die erste Auflage dieses Buches wurde den beiden Vereinen für hansische Geschichte und niederdeutsche Sprachforschung anläßlich ihrer zweiten Lüneburger Tagung in der Pfingstwoche des Jahres 1914 dargeboten. Sie war schnell vergriffen. Die Anordnung des Stoffes ist in der zweiten Auflage unverändert geblieben, der Umfang des Werkes, von den hinzugekommenen Straßennamen ganz abgesehen, auf Grund neu erschlossener Quellen nicht unerheblich gewachsen. Dank gebührt Herrn Oberbürgermeister Wilhelm Wetzel, der namens der Stadtverwaltung eine wesentliche Beihilfe für die Druckkosten bewilligte. Dank nicht zuletzt auch Herrn Dr. August Lax, Hildesheim, der die Drucklegung des Buches allen Schwierigkeiten der Kriegszeit zum Trotz ermöglicht hat.
14
Inhaltsverzeichnis∗ Vorwort zur 5. Auflage Vorwort zur 4. Auflage Vorwort zur 3. Auflage Vorwort zur 2. Auflage Adolf-Reichwein-Straße Adolph-Kolping Straße Ahornweg Akazienweg Alec-Moore-Straße Alfred-Delp-Straße Allensteiner Straße Altenbrückerdamm Altenbrückermauer Altenbrückertorstraße Alter Hessenweg Alter Schulsteig Alt Hagen Am Altenbrücker Ziegelhof Am Alten Eisenwerk Am Alten Werk Am Bäckfeld Am Bahnhof Am Bahnhof Rettmer Am Bargenturm Am Berge Am Bergfeld Am Blauen Camp Am Bleckeder Bahnhof Am Butterberg Am Domänenhof Am Dorfplatz Am Dornbusch Am Ebensberg Am Eichenwald Am Eiskeller Am Elsenbruch Am Fischmarkt Am Galgenberg Am Graalwall Am Graben Am Grasweg Am Hang Am Heidebusch Am Iflock Am Jägerteich Am Kaltenmoor Am Klostergarten
35
3 4 6 7 31 31 31 31 31 31 32 32 32 33 3 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 41 42 43 44 44 44 44 44 44 45
∗
Da seit 1966 sehr viele neue Straßennamen hinzugekommen sind, wurde für die Schreibweise durchgängig die heute gültige Form gewählt. 15
Am Klosterteich Am Kreideberg Am Lembarg Am Lindenbergertore Am Marienplatz Am Markt Am Neuen Felde Am Ochsenmarkt Am Oelzepark Am Plaggenschlag Am Sande Am Schierbrunnen Am Schifferwall Am Schlachthof Am Schlehbusch Am Schützenplatz Am Schwalbenberg Amselweg Am Springintgut Am Stintmarkt Am Sülzwall Am Teich Am Urnenfeld Am Venusberg Am Wacholderbusch Am Weiher Am Weißen Berge Am Weißen Turm Am Werder Am Wienebütteler Weg Am Wiesenhof Am Wischfeld Am Ziegeleiteich An den Brodbänken An den Krummstücken An den Reeperbahnen An den Vierorten An der Beeke An der Buchholzer Bahn An der Feuerwehr An der Hauskoppel An der Münze An der Ratsforst An der Roten Bleiche An der Schule An der Wittenberger Bahn Apfelallee Apothekenstraße Arenskule Arthur-Illies-Weg Artlenburger Landstraße 16
45 45 45 46 46 47 50 50 51 51 51 52 53 53 53 53 53 53 54 54 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 57 58 58 59 59 59 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 62 62
Auenweg Auf dem Harz Auf dem Kauf Auf dem Kirchstieg Auf dem Klosterhof Auf dem Knieberg Auf dem Meere Auf dem Michaeliskloster Auf dem Schmaarkamp Auf dem Wüstenort Auf den Blöcken Auf den Sandbergen Auf der Altstadt Auf der Höhe Auf der Hude Auf der Rübekuhle Auf der Saline August-Horch-Straße August-Wellenkamp-Straße
62 62 63 63 64 64 64 65 66 66 67 67 67 69 69 70 70 71 71
Bachstraße Backsteinhof Bahnhofstraße Barckhausenstraße Bardenweg Bardowicker Straße Bardowicker Wasserweg Bastionstrasse Baumstraße Bei der Abtsmühle Bei der Abtspferdetränke Bei der Lüner Mühle Bei der Michaeliskirche Bei der Pferdehütte Bei der Ratsmühle Bei der St. Johanniskirche Bei der St. Lambertikirche Bei der St. Nicolaikirche Beim Benedikt Beim Bockelsberg Beim Holzberg Beim Kalkberg Bei Mönchsgarten Beim Ratskeller Bellmannskamp Bennigsenstraße Bergstraße Berliner Straße Bernhard-Letterhaus-Straße Bernhard-Riemann-Straße Bernsteinstraße
72 72 72 72 72 72 74 74 74 76 77 77 78 78 78 80 82 83 83 84 84 84 85 85 85 85 85 86 86 86 86 17
Bertha-von-Suttner-Straße Bessemerstraße Beußweg Billungweg Bilmer Straße Bilmer Strauch Birkenhof Birkenweg Bleckeder Landstraße Bleckengrund Blücherstraße Blümchensaal Blumenstraße Bockelmannstraße Bodelschwinghweg Bodestraße Boecklerstraße Bögelstraße Böhmsholz Böttcherstraße Boizenburger Straße Borsigstraße Brambusch Brandenburger Straße Brandheider Weg Brauerweg Breite Wiese Breslauer Straße Brockwinkler Weg Bromberger Straße Brückensteig Brüder-Grimm-Straße Brunnenweg Buchenweg Buchweizenkamp Bülows Kamp Bülowstraße Bürgergarten Büttnerstraße Bunsenstraße Buntenburger Weg Bunzlauer Straße Burmeisterstraße Bussardweg Busseweg Butenkaben
86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 93 93 94 94 94
Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße Carl-Peters-Straße Carl-von-Ossietzky-Straße Chamissostraße
94 94 94 94
18
Christel-Rebbin-Straße Christian-Herbst-Straße Christianiweg Christian-Lindemann-Straße Clamat-Park Claudiusweg Conventstraße Curiostraße
95 95 95 95 95 95 95 96
Dachssteig Dahlenburger Landstraße Daimlerstraße Dammstraße Danziger Straße Dasselkamp Dehmelweg Dempwolfstraße Dessauer Straße Deutsch-Evern-Weg Dieselstraße Dietrich-Bonhoeffer-Straße Dömitzer Straße Dörnbergstraße Dr.-Lilo-Gloeden-Straße Dorfsfeld Douglas-Lister-Straße Drögenkamp Drosselweg Droste-Hülshoff-Straße Düvelsbrook Düvelsbrooker Weg
96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99
Ebelingweg Eckermannstraße Edgar-Schaub-Platz Egersdorffstraße Eichenbrücker Straße Eichendorffstraße Eichenhain Eichenkamp Eichenweg Eichhornweg Eisenbahnweg Elbinger Straße Elsa-Brandström-Straße Elso-Klöver-Straße Elsterallee Elversstraße Emmy-Noether-Straße Enge Straße Erbstorfer Landstraße
99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 102 19
Erfurter Straße Erlengrund Ernst-Braune-Straße Ernst-Ehlers-Straße Erwin-von-Witzleben-Straße Eulenweg
103 103 103 103 103 103
Fährsteg Falkenhorst Fasanenweg Feldstraße Fichtenweg Finkenberg Finkenhütte Finkenweg Finkstraße Fliederstraße Flörekeweg Föhrenweg Fontanestraße Franz-Anker-Straße Fraunhoferstraße Friedenstraße Friedrich-Ebert-Brücke Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße Friedrich-Penseler-Straße Fritz-Reuter-Straße Frommestraße Fuchsweg
103 103 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 106 106 106 106 106 106 107 107
Garlopstraße Gartenstraße Gartenweg Gaußstraße Gebhardiweg Gebrüder-Heyn-Straße Geibelweg Gellersstraße Georg-Böhm-Straße Georg-König-Straße Georg-Leppien-Straße Gerberstraße Gerhart-Hauptmann-Straße Gerstenkamp Ginsterweg Gleiwitzer Straße Glockenstraße Glogauer Straße Gneisenaustraße Goebelstraße Görgesstraße
107 107 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 110 110 110 111 111 111 111
20
Görlitzer Straße Goethestraße Göxer Weg Gorch-Fock-Straße Goseburg Goseburgstraße Gottfried-Keller-Straße Grabenweg Grabower Straße Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße Graf-von-Moltke-Straße Grapengießerstraße Graudenzer Straße Gravenhorststraße Greifswalder Straße Grenzstraße Große Bäckerstraße Großer Garten Grünberger Straße Grüner Brink Grundweg Guerickestraße Gumbinner Straße Gummastraße Gungelsbrunnen Gut Schnellenberg Gut Wienebüttel
112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 114 115 115 115 115 117 117 117 117 117 117 117 118 118 118
Haagestraße Habichtsweg Häcklinger Weg Hagemannsweg Hallesche Straße Hamburger Straße Handwerkerplatz Hangweg Hans-Steffens-Weg Hans-Stern-Straße Hans-Tönjes-Ring Haselhorst Hasenburg Hasenburger Berg Hasenburger Ring Hasenburger Weg Hasengasse Hasenwinkel Hasselberg Hauptstraße Hebbelstraße Heidbergstraße Heidkamp
118 119 119 119 119 119 119 119 119 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 122 21
Heidkoppelweg Heidschnuckenweg Heiligengeiststraße Heiligenthaler Straße Heinrich-Böll-Straße Heinrich-Heine-Straße Heinrich-Thiede-Straße Helene-Lange-Straße Hellmannweg Helmholtzstraße Henningstraße Herderstraße Hermann-Löns-Straße Hermann-Niemann-Straße Hermann-Schmidt-Straße Hermann-Wagner-Straße Hermann-Wrede-Weg Hindenburgstraße Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße Hinter dem Brunnen Hinter dem Saal Hinter dem Sportplatz Hinter den Scheibenständen Hinter der Bardowicker Mauer Hinter der Saline Hinter der Sülzmauer Hirschberger Straße Hirtenweg Hölderlinstraße Hohe Luft Hohenhorststraße Hokel Holeek Hopfengarten Horst-Nickel-Straße Hügelstraße Husanusstraße Huskamp Huskater Bruch
122 122 122 123 123 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 128 128 128 128 128 128 129 129 129 129 129 130 130 130 130
Igelweg Ilmenaustraße Im Allerbruch Im Dorf Im Grimm Im Häcklinger Dorfe Im Hegen Im Hohen Garten Im Kamp Im Karnapp Imkerstieg
130 130 131 131 131 133 133 133 133 133 134
22
Im Redder Im Roten Felde Im Sandfeld Im Schießgraben Im Tiefen Tal Im Tiergarten Im Timpen Im Verdener Hof Im Wendischen Dorfe Im Winkel In den Birken In den Kämpen In den Stuken In der Kemnau In der Lau In der Marsch In der Süßen Heide In der Techt In der Weide
134 134 134 134 135 135 135 136 136 137 137 137 137 137 137 137 137 137 138
Jägerstraße Jakob-Kaiser-Straße Johanna-Kirchner-Straße Johanna-Stegen-Straße Johannes-Gutenberg-Straße Johannes-Lopau-Weg Johannisburger Straße Johannisstraße Johann-Sebastian-Bach-Platz Judenstraße Jürgen-Backhaus-Straße Jüttkenmoor Julius-Kallmeyer-Straße Julius-Leber-Straße Julius-Wolff-Straße
138 139 139 139 139 139 139 140 140 140 141 141 141 142 142
Käthe-Kollwitz-Straße Käthe-Krüger-Straße Kalandstraße Kampferweg Kantstraße Kastanienallee Katzenstraße Kaufhausstraße Kefersteinstraße Keplerstraße Kiebitzweg Kiefernring Kieselweg Klaus-Groth-Straße Kleine Bäckerstraße
142 142 142 143 143 143 144 144 145 145 145 145 145 146 146 23
Kleverstücke Klopstockstraße Klostergang Klosterkamp Kloster Lüne Klosterweg Kluskamp Knotterkamp Königsberger Straße Köppelweg Kösliner Straße Köthener Straße Kolberger Straße Koltmannstraße Konrad-Adenauer-Straße Konrad-Zuse-Allee Kopernikusstraße Korb Korbmacherstraße Kossenweg Krähornsberg Kramerstrate Krötenkamp Kronskamp Krügerstraße Kuckucksweg Kuhstraße Kulmbacher Straße Kunkelberg Kurt-Höbold-Straße Kurt-Huber-Straße Kurt-Schumacher-Straße Kurze Straße
146 146 146 146 146 147 147 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150 150 151 151
Laffertstraße Lambertiplatz Landrat-Albrecht-Straße Landwehrweg Lange Berge Langenstraße Langenstücken Langer Jammer Lauensteinstraße Leipziger Straße Lenaustraße Lerchenweg Lessingstraße Liegnitzer Straße Lilienthalstraße Lindenstraße Lise-Meitner-Straße
151 151 151 151 151 151 152 152 152 152 153 153 153 153 153 153 153
24
Lossiusstraße Ludwig-Beck-Straße Ludwigstraße Lüneburger Straße Lüner Damm Lüner Kirchweg Lüner Rennbahn Lüner Straße Lünertorstraße Lüner Weg Lupmerfeld
153 154 154 154 154 154 155 155 155 157 157
Magdeburger Straße Maneckeweg Marcus-Heinemann-Straße Marderweg Margeritenweg Maria-Terwiel-Straße Marie-Curie-Straße Marienburger Straße Max-Jenne-Straße Medebekskamp Mehlbachstrift Meinekenhop Meisterweg Melkberg Memeler Straße Memeler Weg Milchbergweg Mittelfeld Mittelweg Mörekesiedlung Moldenweg Moorweg Moorweide Mühlenkamp Münzstraße Munstermannskamp
157 157 157 158 158 158 158 158 158 159 159 159 159 159 159 159 160 160 160 160 160 160 160 160 160 161
Nachtigallenweg Naruto-Platz Naruto-Straße Nelly-Sachs-Straße Neue Straße Neue Sülze Neuetorstraße Neu-Häcklingen Neuhauser Straße Nicolaihof vor Bardowick Novalisstraße Nutzfelder Weg
161 161 161 162 162 163 164 165 165 165 165 165 25
Obere Ohlingerstraße Obere Schrangenstraße Ochtmisser Kirchsteig Ochtmisser Straße Oedemer Weg Olof-Palme-Hain Oltrogge-Platz Ortelsburger Straße Osterfeld Osterwiese Ostlandring Ostpreußenring Otto-Brenner-Straße Otto-Fuhrhop-Weg Otto-Snell-Straße Ovelgönne Ovelgönner Weg
165 166 167 168 168 168 168 168 168 168 169 169 169 169 169 169 170
Pannings Garten Papenburg Papenburger Weg Papenstraße Parkstraße Peter-Schulz-Straße Pfarrer-Kneipp-Weg Philipp-Reis-Straße Philipp-Spitta-Platz Pieperweg Pilgerpfad Pirolweg Planckstraße Posener Straße Posten 90 Postweg Pulverweg
170 170 170 170 172 172 172 172 172 173 173 173 173 173 173 173 173
Quellenweg Querkamp Quickbaumweg
174 174 174
Rabensteinstraße Rackerstraße Rehhagen Rehrweg Reichenbachplatz Reichenbachstraße Reiherstieg Reitende-Diener-Straße Rethgraben Rettmers Höhe
174 174 174 174 175 175 175 175 176 176
26
Richard-Brauer-Straße Richard-Hölscher-Straße Rigaer Straße Rilkestraße Ringstraße Ritterstraße Robert-Brendel-Straße Robert-Koch-Straße Robert-Stolz-Platz Röntgenstraße Roggenkamp Rosenstraße Rostocker Straße Rotehahnstraße Rotemauer Rotenbleicher Weg Rotenburger Straße Rote Schleuse Rote Straße Rückertstraße
177 177 177 177 177 177 178 178 178 178 179 179 180 180 181 181 181 182 182 183
Saatkamp Sachsenweg Salzbrückerstraße Salzstraße Salzstraße am Wasser Salzwedeler Straße Sandwehe St. Lambertiplatz St.-Stephanus-Platz Sattlerstraße Schanzenweg Schaperdrift Scharnhorststraße Scheffelstraße Scherenschleiferstraße Schießgrabenstraße Schildsteinweg Schillerstraße Schlägertwiete Schlegelweg Schlöbckeweg Schmiedestraße Schneidemühler Straße Schnellenberger Camp Schnellenberger Weg Schnepfenwinkel Schomakerstraße Schröderhof Schröderstraße Schützenstraße
183 183 183 185 186 187 187 187 187 187 187 188 188 188 188 188 188 189 189 189 189 190 190 190 190 191 191 191 191 192 27
Schulstraße Schweidnitzer Straße Scunthorpeplatz Siemensstraße Soltauer Allee Soltauer Straße Sonnenhang Sonnenzeile Sonninstraße Sophia-von-Bodendike-Platz Spangenbergstraße Spechtsweg Speckmannweg Sperberweg Spillbrunnenweg Spitzer Ort Stadtkoppel Stehrstraße Steinweg Stellmacherstraße Stendaler Straße Sternkamp Stettiner Straße Stöteroggestraße Stralsunder Straße Streitmoor Stresemannstraße Sülfmeisterstraße Sültenweg Sülztorstraße Sülzwallstraße Sülzwiese
192 192 192 192 193 193 193 193 193 193 193 194 194 194 194 194 194 194 194 195 195 195 195 195 195 196 196 196 196 196 197 197
Tangerwiese Tannenweg Teichwiesenweg Teigelhus Teilfeld Theodor-Haubach-Straße Theodor-Heuss-Straße Theodor-Marwitz-Straße Theodor-Storm-Straße Thorner Straße Tilsiter Straße Tobakskamp Töbingstraße Töpferstraße Triftweg Tüner Berg
197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 199 199 200 200 200
Uelzener Straße
200
28
Uhlandstraße Ulmenweg Unter der Burg Untere Ohlingerstraße Untere Schrangenstraße
200 200 200 201 201
Van-der-Mölen-Straße Vickenteich Virchowstraße Viskulenhof Vögelser Straße Volgershall Volgerstraße Von-Dassel-Straße Von-Döring-Weg Von-Kleist-Straße Vor dem Bardowicker Tore Vor dem Neuen Tore Vor dem Roten Tore Vor dem Weißen Berge Vor der Heide Vor der Sülze Vor Mönchsgarten Vrestorfer Weg
201 201 202 202 202 202 202 203 203 203 203 204 205 207 207 207 208 209
Waagestraße Wacholderweg Waldweg Wallstraße Walter-Bötcher-Straße Wandfärberstraße Wandrahmstraße Weberstraße Wedekindstraße Wendische Straße Werner-Jansen-Weg Werner-von-Meding-Straße Westädt’s Garten Wichernstraße Wielandstraße Wiesengrund Wiesenstraße Wiesenweg Wildgraben Wilhelm-Busch-Weg Wilhelm-Fressel-Straße Wilhelm-Hänel-Weg Wilhelm-Hillmer-Straße Wilhelm-Leuschner-Straße Wilhelm-Reinecke-Straße William-Watt-Straße
209 210 210 210 210 211 211 212 212 212 212 212 213 213 213 213 213 213 213 213 214 214 214 214 215 215 29
Willy-Brandt-Straße Wilschenbruch Wilschenbrucher Weg Winkelweg Wittenkamp Witzendorffstraße Wulf-Werum-Weg
215 215 216 216 216 216 217
Yorckstraße
217
Zechlinstraße Zeltberg Zeppelinstraße Ziegelei Ziegelkamp Zollstraße Zum Elfenbruch Zum Gänsebruch Zum Moorbruch Zur Ohe
217 217 218 218 218 218 218 218 219 219
Anhang: Namen der Lüneburger Sülzhäuser Sonstige Hausnamen Tore, Türme, Wälle
220 222 226
Register mit Hinweis auf Straße und Seite
232
Fotonachweis
264
30
Adolf–Reichwein–Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Adolf Reichwein (1898-1944) arbeitete ab 1920 im preußischen Kultusministerium und wurde 1930 Professor für Geschichte und Staatsbürgerkunde in Halle/Saale. Ab 1933 bekannte er sich zur SPD und hatte später Verbindung zum Kreisauer Kreis. Am 4. Juli 1944 wurde der Widerstandskämpfer verhaftet und am 20.10.1944 hingerichtet. Adolph-Kolping-Straße Ratsbeschluß vom 23.3.2000. Als Kind eines armen Schäfers hat der Namengeber (1813-1865) der Straße auf dem Gelände der ehemaligen Schlieffenkaserne als Schuhmachergeselle seinen beruflichen Weg begonnen und dabei das Elend der kleinen Handwerker kennengelernt. Er studierte Theologie und kam 1845 als Kaplan und Religionslehrer nach Elberfeld. Bereits 1847 wurde er dort Präses des Vereins für junge Gesellen. 1849 wechselte er als Domvikar nach Köln und gründete dort den Kölner Gesellenverein. 1850 wurde er zum Apostolischen Notar ernannt. 1853 entstand in Köln das erste Gesellenhaus und mit den Rheinischen Volksblättern hatte Kolping 1854 eine eigene Wochenzeitung, in der er wie in seinen Volkskalendern seine sozialen Ideen verbreiten konnte. 1842 wurde er Rektor der Minoritenkirche, in der er auch begraben ist, und päpstlicher Geheimkämmerer. Das seinen Ideen verpflichtete Kolpingwerk ist heute in 30 Ländern mit über 350.000 Mitgliedern vertreten. 1991 wurde Adolph Kolping selig gesprochen. In Köln erinnert seit 1903 ein Denkmal an diesen großen Sozialreformer. Ahornweg Ratsbeschluß vom 30.4.1959. Die Familie der Ahornbäume und Sträucher ist in Europa, Asien und Nordamerika verbreitet und bringt wertvolles Nutzholz. Akazienweg Ratsbeschluß vom 28.11.1951. Die echte Akazie gehört zur Familie der Hülsenfrüchter und ist vor allem in Afrika und Australien mit zahlreichen Arten verbreitet. Alec-Moore-Straße Ratsbeschluß vom 25.1.1979. Benannt nach dem Mitbegründer der Partnerschaft Lüneburg-Scunthorpe und dem Bürgermeister der Stadt Scunthorpe, Alec Moore. Alfred-Delp-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Alfred Delp (1907-1945) schloß sich nach seinem Übertritt von der evangelischen zur katholischen Kirche der Societas Jesu an. Als Mitglied des Kreisauer Kreises
31
arbeitete er am Entwurf einer christlichen Sozialordnung. Ende Juli 1944 verhaftet, wurde er vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und hingerichtet Allensteiner Straße Ratsbeschluß vom 26.9.1974. Im 1974 eingemeindeten Stadtteil Ebensberg sind die Straßen nach Orten in ehemals zu Deutschland gehörenden Ostgebieten benannt. Wegen einer gleichnamigen Straße auf dem Kreideberg wurde die ehemalige Thorner Straße nach Allenstein/Ostpreußen benannt. Dort besaß das ermländische Domkapitel eine mächtige Burg. Altenbrückerdamm Kein Ratsbeschluß. In den Schoßrollen findet sich diese Bezeichnung noch nicht, wohl aber im ältesten Adreßbuche (1860), und zwar mit dem Zusatze vom Lünertore rechts. In der Linie des Eisenbahndamms der Berliner Bahn wurde die Straße ehemals vom Lösegraben östlich begrenzt; an dessen rechtem Ufer entlang zog sich eine Reperbahn, wohl seit 1660. Der die Gärten des Altenbrückerdammes westlich bespülende, jetzt sog. Lösegraben ist der alte Stadtgraben; Garten twischen der Oldenbrugge und dem Luneren dare ahm graven vor Luneborg belegen 1563; prope civitatis fossam 1615. Im Jahre 1860 kaufte der Fabrikant Heinr. Heyn von den Erben des Apothekers Dempwolff den vom ehemaligen Bürgermeister Schütz angelegten Garten des weil. Obersyndikus Kraut am Altenbrückerdamm, ließ das Haus im Sommer abbrechen und baute ein ganz neues Wohnhaus (Nr. 5). Der Wirt Clausen auf dem bisherigen Wanderschen Garten (Nr. 7/8) baute 1864 für die Offiziersmesse einen Eßsaal neben seinem Hause. Der ursprüngliche Lösegraben wurde nach Volgers Chronik 1873 ausgefüllt, unter Wegräumung der östlichen Stadtwälle; 700 der kräftigsten Linden kamen am 9. Februar 1874 zum Verkauf für 2380 Rth. Im April 1875 wurde von der Kämmerei die Lösegrabenbrücke vor dem Altenbrückentore (Inschrift außen am Gewölbe: „pax intrantibus, salus exeuntibus“) abgebrochen. Z. vgl. Lindenstraße. Altenbrückermauer Die bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts noch sehr stark bebaute Straße dieses Namens war bis zum Jahre 1938 auf 10 Wohnungen zusammengeschmolzen, weil die durchweg kleinen, in ihrer Belegenheit außerordentlich malerischen Häuschen aus gesundheitspolizeilichen Gründen abgebrochen worden sind. 1951 wurden die restlichen Grundstücke der Ilmenaustraße zugelegt. Die frühere Bezeichnung ist achter oldenbrugger muhr 1794, Alte Brücker Mauer (1832) oder gegen der AltBrücker Mauer am Ilmenau Fluß (1833). Von den Gängen, deren einige vom Fluß auf den Chor der Johanniskirche zuführten und reizvolle Durchblicke auf das gewaltige Gotteshaus umrahmten, sind zum Teil noch erhalten der G a g e l m a n n s g a n g , genannt nach einem 1790 zuerst nachweisbaren Eigentümer Malachias Gagelmann, und der Rodengang (Manecke) oder Rotergang (1863), wohl von der farbigen Gesamtwirkung der langen Häuserzeile; dieser Rote Gang umfaßte seit 1763 die bis dahin weiter südlich 32
gelegenen, von der Kalands-Brüderschaft gestifteten Freiwohnungen für arme Leute, den K a l a n d s h o f oder das kleine Kalandshaus. Der K r o n e n h o f mit den zu eines Carsten Ziehens Testament gehörigen Wohnungen, so genannt nach dem Anwohner Albert Krone (1632/50), ist 1913 ff. abgebrochen. Ein altes Militärhospital hinter der Altenbrückenmauer wurde 1828 als Kochanstalt für Arme benutzt. Zwischen dem Gagelmanns- und Rotengang lag bis Ausgang des vorigen Jahrhunderts C l a s i n g s – oder S a s s e n g a n g ; dort hatte gegen 1832 der Holzhändler Friedr. Wilh. Sasse auf dem vormals zweiten Konsulatswerder 23 Wohnungen und sog. Säle errichtet, die vorzugsweise von ärmeren Leuten bewohnt waren. K r ü g e r s H o f bis 1906 zwischen dem Kalands- und Kronenhof, hieß nach seinem Eigentümer, dem Brauer Heinr. Carl Krüger, hinter dem Johanniskirchhofe; W e s e l o w s H o f lag etwa inmitten der Scheerenschleiferund Conventstraße. Am Flußufer entlang befanden sich nach der Altenbrücke zu Loh- und Weißgerbereien, nach Norden schlossen sich M e i n k e n W e r d e r und M o t h s W e r d e r (nicht Molks Werder) an. Zwischen Häringssteg und Altenbrückertor soll nach Manecke das Kloster Isenhagen um 1566 einen Hof besessen haben. Die Bezeichnung des Plans von 1802 hinter der Bardowicker Mauer beruht auf einem Versehen. In den ältesten Adreßbüchern, bis 1866, wurde die Straße Altenbrückermauer geschieden durch die Unterbezeichnungen vom Schwibbogen rechts und vom Schwibbogen links, von 1869-83 heißt es vom Schwibbogen rechts und von der Altenbrückertorstraße rechts. Dieser S c h w i b – b o g e n , eine überdeckte Durchfahrt, verband einen Turm der Altenbrückermauer – den torn achter den convente 1500, auch Conventsturm genannt – mit dem noch erhaltenen südlichen Eckhause der Conventstraße. Neuer Quellbrunnen am Schwibbogen 1868. Altenbrückertorstraße Kein Ratsbeschluß. Der Alten Brücke, auf welche die Straßenbezeichnungen Altenbrückerdamm, Altenbrückermauer, Altenbrückertorstraße zurückzuführen sind, hat man mit gutem Rechte von jeher eine hohe Bedeutung beigemessen für die Anfänge der Stadt. Mitten auf der Brücke wurde coram populo terrae, vor deme gho das Gericht des Gohes Modestorpe abgehalten (Hammerst., Bardengau), der danach auch den Namen tor olden brugge führte, und daß die um 1200 mit Lüneburg verschmolzene Ortschaft Modesdorf zum Sitz des Archidiakons ausersehen wurde, ist fraglos ihrer günstigen Belegenheit an der alten Gerichtsstätte mit dem wichtigen Flußübergange zuzuschreiben. Ein Brückengeld, das nach Aufzeichnung des Memorialbuches von 1530 nicht geringe Erträge abgeworfen haben muß, befand sich im Lehnsbesitz der Familie von Wittorf – daher die Wittorffer Brücke in einem Schreiben Herzog Wilhelm des Jüngeren an den Lüneburger Rat von 1582 -, die ihrerseits verpflichtet war, die Brücke instand zu halten. Das verursachte manche Auseinandersetzungen mit der Stadtobrigkeit, die im Sommer 1538 der Herstellung der baufällig gewordenen Brücke twischen den oldenbrugger dhoren aver de Elvenow übernahm und von dem Vertreter der genannten Burgmannenfamilie, Geverdt van Wittorpe auf Lüdersburg, das Versprechen erhielt, durch Holzlieferungen entschädigt zu werden. Im Jahre 1581 erwarb der Rat die Brücke samt dem Wegegelde und der Unterhaltungspflicht von Herzog Wilhelm dem Jüngeren als Eigentum. Das Wegegeld war fixiert insonderheit für die Nürnberger, Artlenburger, Magdeburger, die Märkischen und 33
Blich nach Westen in die Altenbrückertorstraße
Mecklenburgischen Wagen, Westfälischen Karren.
sowie
für
die Fränkischen,
Thüringischen und
Die Alte Brücke schlechthin, vielfach gleichbedeutend mit dem zugehörigen Tore, wurde gern als Ortsbezeichnung verwandt. Ante antiquum pontem intra muros 1327; ein slachdor ad antiquum pontem wird beschafft 1328; In domo ... contiguis antiquo ponti et valve antiqui pontis 1354; Joh. Volcmari, gen. bi der Brucghe prope pontem antiquum 1357; der Ratmann Joh. van der Brugge verfügt über zwei Häuser mit einer Bude de vor der olden bruggen lighen 1386; eine Schlammkiste, modekiste, wird gebaut buten der oldenbrugghe 1411; vor dat vrowenmak und vorsettinge to vorpalende und de wasschesteghe to makende vor der olden brugghe 1429; to dem berchfrede und gemake up der Elmenowe; den steynbruggeren den wech to makende vor der oldenbrugge to dem ghemake 1434; möglich, daß dies Gemach, ein öffentlicher Abort, identisch ist mit dem make by dem spiker, das schon 1416 erwähnt wird – oder ist dieser Speicher unterhalb der Abtsmühle zu suchen? – de spiiker de up dem water steyt, dar Ekermann uppe wanet 1421; Brau Eckhaus Eggerd Schomakers by dem watere jegen deme spikere aver 1421; die Kämmerei verkaufte 1706 für 1000 M das Fischmenger Haus auf dem Plan, vulgo der Spiiker. Hinrik Brunsouwen husfrouwe des stovers antiqui pontis 1426. Der Burmester läßt den Dreck vor der olden brugghe wegschaffen 1444; stovenshus belegen vor der oldenbrugghe 1450; eine brugge vor der olden brugge de dar gheyt up den wall na der walkemolen wird vereinzelt erwähnt 1461, ante antiquam valvam 1464; vor dem Oldenbrugger dare beneffen dem staven aver 1497; Peter Hoyers Brauhaus vor der olden bruggen bewohnt von der Lampeschen 1510; buten sunte Johanses brugge, vereinzelt 1533; der Bürger Scheide kauft 1540 thermas aut stubam vel balnei domum, curiam et aream zwischen einem Wohnhause und der Stadtmauer in acie ante valvam pontis antiqui; ein Zeughaus über der alten Brügken 1602; platea pontis veteris 1670. Im Turm vor der Alten Brücke hatte ein Polizeiknecht nach 1700 seine Dienstwohnung; im Tore selber wohnten Zollaufseher und Torwächter; zwei Wohnungen im äußersten Tore waren an arme Witwen vergeben, die das Tor sauberhalten mußten. Bau der Brücke vor dem Altenbrückertore 1823/4, mit behauenen Steinen gepflastert 1827; die neue alte Brücke, begonnen im Juli 1875, im Sommer 1876 vollendet; die alte Brücke lag nördlich der neuen. Die, wie sogleich auszuführen, altübliche Benennung vor dem Altenbrückertore ist erst im Adreßbuche von 1860 endgültig verdrängt durch Altenbrückertorstraße, deren nördliche und südliche Häuserzeile durch die Untertitel vom Johanniskirchhofe links und von der Brücke bis zum Ziegenmarkt, seit 1869 vom Altenbrückertore bzw. vom Johanniskirchhofe rechts unterschieden wurden. Zwei Häuser am rechten Ilmenauufer, die sich im städtischen Eigentum befanden, das eine am Walle, am Altenbrückerwalle, bewohnt von einem Lohgerbermeister, das andere am Tore von einem Torschreiber oder Licentdiener, trugen bis 1869 die Bezeichnung a m A l t e n b r ü c k e r t o r e. Schon 1354 heißt es von einem kleinen Hause und Hofe des Arnold van der Brugge, daß das Wohnwesen anstieß an die Altebrücke und das zugehörige Tor, contiguis antiquo ponti et valvae antiqui pontis. Brücke und Tor wurden auch identifiziert; ante valvam vulgariter de olde brugge dictam 1447; ame orde hard vore deme olden bruggere dare durfte Clawes Balhorn hinter seinem Wohnhause einen Backofen bauen 1490; unterhalb der Brücke, am rechten Ufer des Flusses, lag der Gerber- oder Gehrhof, area coriariorum versus murum iuxta pontis antiqui portam 1605; aedes ad depilandas pelles aptatas 35
vulgo den gehrhof appellatas ante portam antiqui pontis 1629. Einzig ist die Bezeichnung vor dem alten Tore, ante antiquam valvam 1415, sowie buthen sunte Johanses brugge, wo Vikar Berndt van Rade einen Garten kaufte 1535. Das ganze Mittelalter hindurch und weit darüber hinaus, in den Schoßrollen noch bis 1861 einschließlich, wurde die Wendung „ v o r “ dem Tore, „ v o r “ der Brücke usw., vom Rathause aus gedacht, logischerweise für eine Belegenheit im Innern der Stadt angewandt; was draußen lag hieß unzweideutig buten der brügge, außerhalb des Tores. Erst in den Adreßbüchern 1860 ff. wurden unter dem Gesamtnamen v o r d e m A l t e n b r ü c k e r t o r e der A l t e n b r ü c k e r Z i e g e l h o f (bis 1902), die im Jahre 1872 an die Dömitz-Lüneburger Eisenbahn verkaufte A l t e n b r ü c k e r B l e i c h e , die B a d e a n s t a l t (bis 1869) und der B l ü m c h e n s a a l (bis 1902) zusammengefaßt. Extra portam pontis antiqui, 1665, lagen eine zur Ratsmühle gehörige Wiese, eine Linnenbleiche und Gärten. Wo auf dem Plan von 1802 das chafot eingezeichnet ist, lag der köpkenberg oder rabenstein (1725); im Jahre 1589 wurde die verordnete Richtestaht vor dem Altenbruggerthore erbaut; die erste Hinrichtung mit dem Schwerte geschah dort durch den Nachrichter M. Borchardt auf Grund eines Urteils, ergangen in eines Rats peinlichem Halsgerichte Juni 1590. Durch umfassende Erdbewegungen ist das Gelände völlig verändert (z. vgl. Am Galgenberg). Alter Hessenweg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Benannt nach einer mittelalterlichen Fernverbindung von Frankfurt/Main nach Nürnberg und nach dem Hessenkarrenweg von Lüneburg Richtung Braunschweig. Alter Schulsteig Ratsbeschluß vom 27.1.1977. Der Name soll an die ehemals in Oedeme vorhandene Schule erinnern. Alt Hagen Es handelt sich um die Lagebezeichnung für die ehemals selbständige Dorfschaft Hagen, nicht um einen Straßennamen. Am Altenbrücker Ziegelhof Kein Ratsbeschluß. Bis 1902 Altenbrücker Ziegelhof mit dem Zusatze vor dem Altenbrückertore, der, auffallend genug, entgegen dem sonst üblichen Brauch schon in den ältesten Rechnungsbüchern des teigelhoves (1531 ff.) ständig angewandt wird statt außerhalb des Tores. Der Altenbrücker Ziegelhof gehörte der Stadt. Schon der älteste Ratsziegelhof domus laterum 1282, wird an dem späteren Platze der Ratsziegelei gestanden haben und auf eben jene Belegenheit die Nachricht zu beziehen sein, daß in den Jahren 1409 und 10 vor dat teygelhus to buwende, sowie für die Anlage eines neuen Ziegelofens eine größere Aufwendung der Kämmerei nötig wurde. Seit Anfang des Siebzehnhunderts, aber auch schon im Mittelalter, wurde der Ratsziegelhof verpachtet, im Jahre 1799 zur einen Hälfte verkauft, zur anderen in Erbenzins ausgetan; der Ziegeleibetrieb ist um Anfang der 1870er Jahre 36
eingestellt. Um 1425 heißt es unse dre teylhuse buten der Oldenbruggen belegen; es werden erwähnt Ziegelöfen und Ziegelhäuser mit tradekisten und waterkisten. Auf den Altenbrücker Ziegelhoff kamen am 15. Oktober 1733 unter dem Geleit eines Kommissars 22 Salzburger Emigranten; sie wurden dort auf Kosten des Rates gastlich bewirtet und am anderen Morgen festlich eingeholt in die Stadt. 1873 eröffnete Braskamp eine neue Wirtschaft auf dem Altenbrücker Ziegelhofe, dessen Nebengebäude für Freimaurer ausgebaut war. In einer Zeit ungewöhnlichen Bedarfs für die Pfarrkirche von St. Johannis unterhielt der Rat vorübergehend eine zweite Ziegelei im Rotenfelde, es war in den Jahren 1421 ff. Am Alten Eisenwerk Ratsbeschluß vom 27.1.1977. Der Name nimmt Bezug auf das 1843 von Meese und Wellenkamp gegründete Unternehmen. Am Alten Werk Ratsbeschluß vom 2.8.2002 In der Samtgemeinde Ilmenau wurde eine Straße nach dem inzwischen aufgegebenen Norsk-Hydro-Werk benannt. Ihre Fortführung auf Häcklinger Gebiet erhielt die gleiche Bezeichnung. Am Bäckfeld Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Die Namensgebung knüpft an einen alten Flurnamen an. Am Bahnhof Ratsbeschluß von 1906. Die Verbindung zwischen Lünertor und Bleckeder Landstraße. Am Bahnhof Rettmer Kein Ratsbeschluß. Die Straße hieß bis zur Eingemeindung Rettmers 1974 Am Bahnhof und mußte dann wegen einer gleichnamigen Bezeichnung in Lüneburg umbenannt werden. Am Bargenturm Ratsbeschluß vom 23.5.1985. Der Bargenturm war einer der fünf hohen Türme (Weißer Turm, Seggerturm, Bargenturm, Barningesturm und Barbaraturm) der inneren Sülzmauer. Er stand bis zu seinem Abbruch im Jahre 1765 im Bereich der jetzt nach ihm benannten Straße. Am Berge 37
Kein Ratsbeschluß. Die älteren Adreßbücher unterscheiden nördlich, vom Kauf rechts; östlich von der Abts-Pferdetränke links bis zum Sande; westlich von der Rosenstraße bis zum Sande. Die ursprüngliche, nach dem Gelände für den mittleren Teil der Straße zutreffendere Bezeichnung ist auf dem Berge. Supra montem 1313; platea dicta vulgariter uppe dem berghe; ein Garten achter deme berge 1443; up dem berge versus aquam Elmenow 1450; in monte 1465; in platea que adversus montem dicitur 1513; pl. montana 1612; in acumine montis 1660; in fine montis 1668. Den größten Teil des Baublocks zwischen der Straße am Berge, der Convent-, Wandfärber- und Papenstraße nahm das Prämonstratenserkloster Heiligental ein. Das Kloster siedelte 1382 vom Dorfe Heiligental im Landkreise Lüneburg in die Stadt über und bestand bis zum Jahre 1530, wo es durch gütliche Vereinbarung mit dem Rate aufgelöst wurde. Das zur Einrichtung des Klosters erforderliche Baugelände befand sich als Vermächtnis des um 1354 verstorbenen Propstes Hinrik van Bücken zum Teil im Besitz des Konvents, zum Teil wurde es gegen Zahlung von 2000 M-Pf. seitens der Stadt abgetreten; dieser fiel in der Reformationszeit das gesamte, allerdings stark verschuldete Gut des Klosters innerhalb der Landwehr zu. Die den Hl. Andreas und Laurentius geweihte Klosterkirche, zuletzt als Salzspeicher benutzt und verwahrlost, ist zu Beginn des Achtzehnhunderts abgebrochen; ihre Westfassade lag hart an der Straße. Ex opposito monasterii in Hilghendale lag eine zusammenhängende Reihe von Katen, drei davon viciniores platee cerdonum 1388; prope mon. in Hilgh. 1390; prope ecclesiam mon. Hilgh. versus austrum in loco nunc eiusdem eccl. cimiterium consecratum existit 1391; retro Hilgendal 1426; Hilgendal Schoßrolle 1431; bij deme Hilgendale 1444; twischen dem Kerkhove tom Hilgendale 1450; Eckhaus Hinrik Gronhagen bij dem berge 1450; Eckhaus Hinrik Elers 1451; in opp. eccl. s. Andreae canonicorum regularium ordinis Praemonstratensis 1471; uppe deme Hilligendaler kerkhove 1467; der Vikar Johan Winter hat ein Wohnhaus errichtet in der twiten achter der heren vame Hilgendale kokene 1473; Wohnhaus Voget by deme Hilligendale negest deme kerckhove hard an Alheyden Wichtenbeken lutken husze 1486; prope cim. eccl. s. vallis 1486; ein Anbau am Vorwerke des Klosters belegen twischen dessulven vorewerckes dorwege und eyneme der stadtmuren torne by deme Blauwen convente 1491; bi dem Hilligendale, achter dem Hilligendale 1501; ein zum Kloster gehöriger partekenkrog (wo Armen ein Almosen verabfolgt wurde?) wird 1510 erwähnt; ex. opp. cimiterii s. vallis in acie areae desertae 1539. An die Existenz des Klosters erinnert der Name i m s o g . H e i l i g e n t a l für den Hof, der zwischen Nr. 29 und 33 vom Berge ab in östlicher Richtung den Baublock durchschneidet. Das vom Museumsverein 1936 vor dem Abbruch bewahrte, südwestliche Eckhaus der Conventstraße galt lange als ehemalige Propstei des Klosters, ist aber vielmehr das von 1406-09 erbaute Stammhaus der Sülfmeisterfamilie von Brömbse. Die Hausnummern 41-43 werden seit 1885 als R i c k s h o f zusammengefaßt, nach dem Eigentümer Schlachtermeister Rick, vorher U l r i c h s h o f , 1802 H a m m e r i c h s h o f ; er enthält dreizehn Wohnungen und Säle für Witwen und arme Leute, ist als Durchgang zu benutzen und bildete bis ins Achtzehnhundert die nördlichste Verbindung der Straße am Berge mit der Ilmenau, denn die jetzige Ilmenaustraße war in der Nähe der Abtspferdetränke zugebaut. Gebhardis Plan nennt hier die sonst nirgends begegnende W a l k e r s t r a ß e . Ein Paralleldurchgang mitten zwischen Rickshof und Conventstraße hieß L o p a u s
38
D u r c h g a n g 1802. Die Häuser 21-24 an der Nordecke der Glockenstraße am Berge gehörten bis 1796 dem Kloster Medingen; die Kämmerei erwarb den Besitz zwecks Erweiterung des Stadtbauhofes; vier Nebenhäuser an der Glockenstraße wurden wieder verkauft, desgl. das am Berge gelegene Klosterwohnhaus, dieses an den Zimmermeister Tegtmeyer, der vier kleine Wohnungen daraus einrichtete. Das Kloster verkaufte 1318 eine curia in civitate, früher Eigentum Ludolfs von Bernowe, für 250 M an das Kloster Lüne, behielt sich nur ein eingezäuntes spatium vor; curia Meding 1381; ein Eckhaus der Propstei Isenhagen supra montem kaufte 1468 Johan vame Lo. Ein Haus der van der Molen hieß 1374 g u l d e n e t r e p p e ; vulgariter to der ghüldenen treppen 1377; es wurde 1392 als de ghülde treppe von einem Bäcker angekauft und wird 1443 bezeichnet als Eckhaus tor guldenen treppen uppe dem berghe; circa aureum gradum prope aquam Elmenowe 1437; in dem backhause zur gülden treppen 1642; die platzartige Verbreiterung der Straße an ihrem Nordende wird gelegentlich als S c h i l d bezeichnet, item de schild vor hern Hinrick Beren dhore schullet de nabure reyne holden went uppe de rennen unde vordan daele went to der gulden treppen gegen 1450; up dem schilde hieß eine Straße Anfang des Vierzehnhunderts auch in Göttingen. Die Bauherren lassen an der Straße vor der gülden treppen pflastern 1461; Buden werden verkauft zwischen einer Bude et domum pastoralem [statt pistoralem] retro auream scalam, vulgariter achter der gülden treppen 1522; das Backhaus ad aureos gradus supra montem geht vom Bürger Sengestake an Bredthovet über. Der Name zur goldenen Treppe ist verschollen, aber noch befindet sich in dem gemeinten Eckhause mit dem schönen Schneckengiebel eine Bäckerei (Nr. 1). Der Tapetenfabrikant Penseler ließ 1873 an dem ehemaligen Hausplatze des Senators Scharnbeck einen großartigen Bau erstehen (Eckhaus Nr. 8). Bau eines Siels am Berge, hinaufgeführt bis nach dem Meere, 1855 ff. Auf dem Stadtplane von 1765 wird der nördliche Teil der Straße auf dem Berge genannt, der südliche, in Höhe der Zollstraße bis zum Sande vorn Berge; der Stadtplan von 1802 unterscheidet von Norden nach Süden auf dem Berge (bis zur Münzstraße), vor dem Berge (bis Wüstenort), beim Heiligental (bis Conventstraße) und vor dem Sande. Zu vgl. Conventstraße. Eine Straße auf dem Berge, supra montem gab es auch in Bardewik; nach Hammersteins Bardengau lag daran ein Meierhof des Klosters Kemnade 1333. Am Bergfeld Ratsbeschluß vom 23.7.1998. Der Straßenname in einem Neubaugebiet in Rettmer westlich der Straße nach Lüneburg nimmt den Charakter der Landschaft auf. Am Blauen Camp Ratsbeschluß vom 30.11.2000. Der Straßenname greift auf einen überlieferten Flurnamen zurück, wobei Camp soviel wie eingefriedetes Feld-, Acker- oder Weideland bedeutet. Am Bleckeder Bahnhof Kein Ratsbeschluß.
39
Seit Eröffnung der Eisenbahn Lüneburg-Bleckede im Jahre 1904, im Adreßbuche zuerst 1916. Am Butterberg Ratsbeschluß vom 29.2.1996. Eine alte Flurbezeichnung in Oedeme liegt dem Namen zu Grunde. Am Domänenhof Ratsbeschluß vom 23.8.1950. Der Name des Zufahrtswegs erinnert an die Gebäude der 1937 aufgelösten Domäne Lüne. Vgl. auch Kloster Lüne. Am Dorfplatz Ratsbeschluß vom 16.10.1998. Der Name wurde gewählt, um den ländlichen Charakter des Ortsteils Häcklingen zu betonen. Am Dornbusch Ratsbeschluß vom 16.10.1998. Die Straßenbezeichnung greift einen alten Häcklinger Flurnamen auf. Am Ebensberg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Der Straßenname greift einen alten Flurnamen auf. Am Eichenwald Ratsbeschluß vom 16.12.1999. Die Benennung der Straße Eichenbestand.
erfolgte
nach
dem
dort
vorhandenen
alten
Am Eiskeller Ratsbeschluß vom 30.11.2000. In Eiskellern wurden in der warmen Jahreszeit Eisblöcke aufbewahrt, die man im Winter aus zugefrorenen Teichen gewonnen hatte. Ein solcher befand sich in der Nähe der Straße. Am Elsenbruch Ratsbeschluß vom 18.5.1955. Der Name greift eine überlieferte Flurbezeichnung auf. Am Fischmarkt Kein Ratsbeschluß. 40
Gab es Verkaufsstellen für Fische, sog. F i s c h b ä n k e , in der Altstadt, auf dem Marktplatze und auf dem Sande, so lag der eigentliche Fischmarkt, wie der davon abgezweigte Stintmarkt und eine Reihe von Fischbuden, auf dem Häringsteg, begreiflicherweise in unmittelbarer Nähe des Flusses. Die Stadt verpachtete die Fischerei einmal auf der oberen Ilmenau von den Mühlen bis hinauf nach Medingen, seit 1701 auf Grund eines Vergleichs mit dem Michaeliskloster nur bis an die sog. Große Kule zwischen Melbeck und Grünhagen; zum anderen auf der unteren Ilmenau bis zur Elbe; zum dritten das Recht einer Fischwehre beim Krauel auf der Elbe, später aufgegeben; zum vierten die Fischerei in den Stadtgräben, aufgeteilt in fünf Abschnitte – ausgenommen der je zur Hälfte dem Kalkberg und dem Sodmeister zuständige „Karutschenteich“ hinter der Sülze; zum fünften im Karpfenteich beim Vögelser Schlagbaum; zum sechsten in den Teichen zur Hasenburg, bei der Mittleren oder Kleinen Schleuse, bei Kaltenmoor, beim Ziegelhofe, schließlich im Lösegraben. 1410 by deme vischmarcke; 1411 wird beim Kran, bij dem vischmarkede und beim Kaufhause gepflastert; uppe der brugge by deme krane by deme heringhus alumme hatten die städtischen dregere die Straße zu reinigen, um 1430; 1480 bij deme vischmarkede; 1527 Eckhaus nebst fünf Buden nach der Stadtmauer hin, gegenüber der Lüner Mühle apud forum piscatorum; 1551 in foro piscatorio; 1552 apud forum piscatorum; 1581 in foro piscium e regione des kranes; 1611 in piscatoria; 1659 in foro vendendis piscium destinato; Plan von 1765 Fischmarkt; 1802 am Fischmarkte. Eine konkurrierende Bezeichnung ist in alten Schoßrollen a c h t e r d e m e k r a n e 1484, oder bei der Abtskunst, d. h. Abtswasserturm, 1794. Mit dem Fischmarkte vermutlich identisch ist der H ä r i n g m a r k t , wurde doch das daran gelegene Kaufhaus auch „Häringehaus“ genannt. Im Jahre 1601 erhob die Kämmerei ein Strafgeld von zwei Männern, die etzliche pfannenstein in die stadt ohne vorloff gefort und auf den heringmarcket gesetzet. Die eigentliche Bereitungs- und Verkaufsstelle für den in Lüneburg beliebtesten und sicherlich gängigsten Fisch war der „ H ä r i n g s t e g “ oder „Heringstegel“, eine mit bewohnten Pfahlbauten einseitig besetzte, nach Gebhardi nur 4 Schuh breite Laufbrücke aus Holz zur Verbindung des linken Ilmenauufers mit dem Werder, auf welchem der Abtswasserturm errichtet wurde, und von dort sich fortsetzend bis zum rechten Ufer des Flusses, um in der Südecke des Fischmarktes an einem der städtischen Wohntürme zu enden. Auch jene Pfahlbauten befanden sich in städtischem Besitz; es waren zum Teil Verkaufsbuden – schon 1302 fällt de qualibet casa in qua abluitur allec eine Jahresabgabe von 4 s. an die Kämmerei, 1330 werden 4 M 10 s. de macellis allecum erhoben – zum Teil wurden sie als Dienstwohnungen vergeben und nach ihrer Belegenheit auf dem Mühlenteiche bezeichnet up dem dike, auch bi der Luneren molen; up deme dike wohnte 1453 Hans Bummerd, lagen 1466 Cord Fribussches und der spellude husere; noch nach 1700 heißt es des Musicanten Haus auf dem sog. Mühlenteich bey der Abtsmühlen, bewohnt vom Musicus Voigt. Dort erhielt der reitende Diener Hertzeveld ein Haus, das vorher der Büchsengießer Meister Ulrick und ein Büchsenschütz bewohnt hatten, 1490. Den Pelzern wird 1421 gestattet, dat se waschen uppe den uthersten veer heringboden boven des provestes van Lune molen, so lange alse deme rade dat even duncket weszen; 1431 werden etliche Häringbuden fertig gemacht und under de heringsteghe wird Revelholz genagelt; 1434 arbeiten Zimmerleute, Maurer und Steinbrügge an den Häringbuden. Die heringessteghe litten durch Überschwemmung 1444 und 64, die 41
Blick nach Norden in die Straße Am Fischmarkt
Planken by den heringhsteghen werden ausgebessert 1461; auch 1482 wurde an den heringesstegen achter dem konvente gebaut und Revel davor genagelt. Im letzten Jahrzehnt des Sechzehnhunderts wurden die Fischbuden zum großen Teil durch eine Sturmflut weggerissen, nachdem schon 1677 einige Stockfischbuden, für die das Amt der Vollhaken einen Zins zahlte, oberhalb der Lüner Mühle durch Hochwasser mitgenommen und bis 1736 nicht wieder gebaut waren; eine Stockfischbude wurde 1726 in ein Wohnhaus verwandelt. Der Hering-Stegel und die davor stehenden Rotscher Buden 1784; die zu Wohnungen eingerichteten am Heringstegel belegenen Fischbuden nebst freiem Platz wurden seitens der Kämmerei 1799 verkauft; 1828 wurde der sog. Häringsstegel ganz neu gemacht; 1830 mußte infolge Überschwemmung das Haus des Dr. Schirges am Häringstegel abgetragen werden. 1876 werden drei Häuser (Nr. 3, 4, 5) am Heringstegel auf Abbruch meistbietend verkauft im Auftrage des Magistrats; 1876 Jan. heißt es, daß die Häuser 1 u. 2 am Heringsstegel ganz auf festem Lande standen, auch diese Wohnungen wurden 1893 den Mietern magistratsseitig gekündigt und im Sommer genannten Jahres abgebrochen zwecks Herstellung der neuen Verbindungsstraße von der Altenbrücker Mauer bis zur Abtspferdetränke. Eine Aufzeichnung Büttners beschreibt die Häringstegel nach dem Vollhaken Amtsbuche wie folgt: dusse boden syn belegen up den stägen, als men geidt von dem kaventhkloster dael na des burmesters huse, syn soven hele und dre halve boden; vordan van der spellude huse an wente na deme vischmarkede up den stegen syn viff hele und viff halve boden ... und isz ock wondelick, dat ein jeder up der boden dar he woket sin marck dat he up syner wahre voret baven an de dören anteken lete. Die Miete von 1499 bis 1679 erbrachte jährlich 8 M 8 s für die Kämmerei. Der Spielleute Haus, 1736 Rats-Musikanten Haus, auch des Zinkenbläsers Haus genannt, lag am rechten Ilmenau-Ufer unmittelbar am Häringstegel. Manecke schreibt die Heringstegel. Unmittelbar beim Heringstegel 1861 lag der Bürgermeisterwerder. Die Bezeichnung am Heringsstegel verschwindet aus dem Adreßbuche erst 1894. – Ein „Fischmarkt“ auch in Danzig und HamburgAltstadt. Am Galgenberg Ratsbeschluß vom 28.11.1951. Seit 1925. Im Osten der Stadt, aus weiter Ferne zu erkennen, erhob sich einst das Hochgericht, mit einem Galgen, wie wohl so leicht kein zweiter im Hl. Römischen Reiche zu finden war. Vier runde aufgemauerte Pfeiler, einige Fuß dick, über 20 Fuß hoch, unten durch eine 7 Fuß hohe kreisrunde Mauer, oben durch Balken verbunden, schlossen einen Platz von mindestens 20 Fuß Durchmesser ein und verkündigten, meilenweit sichtbar, Lüneburgs peinliche Gerichtsbarkeit ... der ganzen Umgegend (Volger). Der Galgen wird frühestens erwähnt in der Bauamtsrechnung von 1425: van dessem bokeden kalke sende wi van des rades hete 24 wispel to deme galgen; der steine galgen aus dem Lünertor wurde 1720 ausgebessert, nachdem er 1691 zuletzt in Gebrauch genommen war, dann wieder im August 1770, als ein berüchtigter Dieb gehängt wurde. Später hat nach Volger dort keine Hinrichtung stattgefunden. Vom Stadtgericht ist zu unterscheiden das alljährlich öffentlich gehegte Oldenbrügger Gogericht, das nach Hammerstein bald auf dem Hofe zu Lüne, bald auf dem sog. Goheberge vor dem Altenbrückertore abgehalten wurde. 43
Der Ratsbeschluß betrifft eine 1951 erfolgte Straßenverlängerung. Am Graalwall (G r a l s t r a ß e) Kein Ratsbeschluß. Gral, im Mittelniederdeutschen gleichbedeutend mit Lärm, auch für eine lärmende Fröhlichkeit, eine Festlichkeit im Freien gebraucht, bezeichnet in mehreren Städten Niederdeutschlands die Örtlichkeit, die ehemals als Spiel- und Festplatz diente (z. vgl. Niederdeutsche Zeitschr. f. Volkskunde V. 4, S. 212 f.). In diesem Sinne sind die ältesten Belegstellen aufzufassen, die für den Namen Gralstraße (s. Egersdorff Straße), Gralwall in Betracht kommen. Schoßrolle von 1431 bi deme grale, 1454 in dem grale; 1471 erhält der Verdener Dekan eyne stede in deme grale achter des bisschoppes have, um ein Wohnhaus darauf zu bauen, das nach seinem Tode an die Stadt fällt; ein Zaun wird in deme grale gebaut 1476; 1480 gibt der Rat gegen einen ewigen Rekognitionszins dem Bürger Clentzemanne eine stede zum Bebauen, veftich vothe lanck und sostich vothe breth, belegen in dem grale achter sunte Michaelis closter, unde schud uppe sodanen eigendom alze dat capittel van Verden darsulvest heft; 1491 verkaufte der Verdener Dekan einem Bürger ein von ihm erbautes Haus beim Verdener Hof in loco qui dicitur de grael; im nämlichen Jahre errichtete der Rat in deme grale ein Holzlager, das nur im Falle äußerster Not angegriffen werden sollte; 1496 wird das Haus des Dekans bezeichnet prope dominorum capituli ecclesie Verdensis, ex opposito casarum Frederici von dem Berge, in loco dicto de grael; 1498 uppe dem walle twysken den muren, van deme hogen torne in deme Grale wente an de Elmenowe, hatten 2 Wächter zu wachen. 1519 überläßt Erzbischof Cristoffer zu Bremen, Administrator von Verden, seinen Stiftshof tegen unszer leven frowen kloster beleghen, auf Lebenszeit dem Ehepaare Schelpeper, wie ihn zuvor Did. v. Barem besessen hatte; ein von denen v. Wustrow und v. Hitzacker ererbtes Haus geht durch Kauf an Christoffer von Kleinow und dessen Ehefrau Christine geb. v. Anefelt - es liegt zwischen Mareigenkirchen und der von dem Berge hausze 1531; oder achter unser leven fruwen karcken iegen des bisschoppen van Bremens hove 1539; oder teigen des bisschoppes van Verden und twischen des erbarn rades to L. und der van dem Berge huseren oder in platea qua itur ad domum misericordie ex opposito curie episcopi Verdensis inter relicte Theoderici de Monte et nostri syndicatus domos 1546; im letztgenannten Jahre geht das Besitztum an den Gral über; 1533 retro templum s. Michaelis in loco quem vulgariter den grall nominant; beym grael lag der Turm Springintgud, achter dem gral der neue Wall 1534; 1543 geht das Eckhaus der Wwe. des Hermann Kusels für 200 M in das Eigentum des Gralstifts über; seine Lage: prope domum capituli Verdensis ex opposito casarum nobilis viri Frederici de Monte in acie loci qui vulgariter dicitur de Grall; im gral befand sich das Prioratshaus des Michaelisklosters 1617 und auch eine Dienstwohnung des städtischen Bauschreibers 1651; eine Constabelwohnung bei der wallpforte am gral wird 1740 erwähnt, gleichzeitig wird ein mit erheblichen Kosten unlängst zuvor erbauter allgemeiner Abtritt unweit der sog. gralporte auf Abbruch verkauft. – Im Gral wurde um 1500 ein Stift errichtet für arme, kranke, elende Leute, gen. dat hüsz der barmeherticheit 1501. Zur Unterscheidung von ähnlichen Anstalten wurde die Belegenheit des neuen Hauses regelmäßig hinzugefügt, bis die Ortsbezeichnung zum Namen des Stiftes wurde und dieses schlechthin der Gral hieß, nachweisbar 1595. Das Gralhospital (Kunstdenkm. 188 ff.) hat i. J. 1904/5 als
44
Damenstift einen stattlichen Neubau im Süden der Stadt erhalten, der alte Name ist geblieben. Die Gralstraße (jetzt Egersdorff Str.) führte zum Gral. Im Jahre 1546 verkaufte der edle Christoph Klenowe des Provisoren des Hauses der Barmherzigkeit sein Haus in platea qua itur ad domum misericordiae ex opposito curie episcopi Verdensis, zwischen dem Syndikatshause und dem Hause der Witwe Dietrichs vom Berge. Die Knappen v. Hitzacker verkauften 1514 der Ehefrau des Knappen Hans v. Wustrouw ihren Erbhof zwischen dem Wohnhause des Protonotars Johan Koller und der duchtigen de vam Berge genant, neben Haus und Offizialat des Verdener Bischofs. Das i. J. 1594 neu erbaute Haus des Blekeder Hauptmanns Fritz vom Berge wird bezeichnet zunächst unserer schafferey wohnung ... nach dem grahl zwischen den Vehrder höfen und der stadt walle; 1600: Friedrich Tratziger erhält als Dienstwohnung die verordnete schafferey bei dem Syndikatshause. Im Jahre 1827 wurde die Gralstraße, die im Laufe der Jahrhunderte wiederholt aufgehöht worden ist (vgl. Krüger, Mauerreste in der Gralstraße, Lün. Mus.-Bl. Heft 5 S. 92 f.), von 14 auf 30 Fuß verbreitert. Gebhardis Plan zeichnet an der Südseite der Straße v. Möllers Hof (Zusatz Hauptmann Schulz), an der Nordseite v. Meding Hof. Der Plan von 1802 sagt statt Gralstraße hinter Saint Marien Kirche. Schoßrolle von 1832 Neue Grahlstraße und am Orte gegen den Grahlwall. Das Adreßbuch von 1860 unterscheidet in der Grahlstraße (seit 1869 Graalstraße) vom Marienplatze rechts und vom Grahlwalle rechts. Der hochgelegene östliche Teil der Gralstraße führte bis Ausgang des vorigen Jahrhunderts die Bezeichnung a m W i n d b e r g e ; sie ist aufgehoben durch Beschluß der städtischen Kollegien vom 10. Juli 1900, indem das einzige dort gelegene Haus zur Gralstraße gelegt wurde. Der Name ist erst im 1800 nachweisbar (1850). Bei der nach Süden gerichteten Lage des Grundstückes möchte man glauben, daß Windberg aus winberg (Weinberg) entstanden sein könne (in Lübeck heißt die Weinbergstraße nach einem Wirtshause des Namens Weinberg, in Wismar wird 1518 die wyntstrate genannt); wahrscheinlicher ist wohl die Ableitung von wintberch, einem technischen Ausdruck, der im Snitkerhandwerk die Bekrönung von Pannelen und Möbeln bezeichnet, aber auch der Architektur geläufig ist und die Eigenart eines Vorläufers jenes Hauses charakterisiert haben mag. Die Bezeichnung a m G r a l w a l l e erklärt sich aus dem vorstehenden Abschnitte. Der Gralwall begrenzte den ehemaligen Spielplatz im Norden. Der Turnplatz des Johanneums befand sich seit 1837 einige Jahre auf einem Acker unmittelbar am Garten von Kaltenmoor; nachher wurde er auf die ehemalige Klosterreitbahn beim Gral verlegt. 1846 neue Reitbahn am Gralwalle; der ganze Platz mit Bäumen (Kastanien) bepflanzt; 1851 Erbohrung einer Salzquelle am Gralwalle. Am Graalwalle lag bis 1880 das Hospital zum Gral, das gen. Jahres an die Justizverwaltung auf Abbruch verkauft wurde. Dem Strafgerichtsgebäude gegenüber entstand 1890 die Bürgerschule (Mittelschule, wegen Senkungserscheinungen abgerissen 1962), nachdem der Wall vor 1889 abgetragen war. Plan von 1765 beym Grahl, 1794 achtern grahl. Am Graben 45
Kein Ratsbeschluß. Auf Grund alter Flurbezeichnung eingeführt, als Straßenname zuerst belegt 1928. Am Grasweg Kein Ratsbeschluß. Südliche Fortsetzung des Schnellenberger Weges entlang der Butterwiese und ehemals der Pieperschen Düngekalkfabrik; Straßenbezeichnung seit 1899. Am Hang Ratsbeschluß vom 26.3.1959. Der Name greift die topographische Beschaffenheit auf. Am Heidebusch Ratsbeschluß vom 28.8.1975. Die Straßenbezeichnung greift einen Flurnamen auf. Am Iflock Kein Ratsbeschluß. Der Name ist entstanden aus iwlôf und bedeutet Epheu, wenn nicht Eibenlaub. Er ist spät belegt. Zimmerleute des Stadtbauamtes verfertigen 1643 ein stücke schlenges in dem ifflofe; 1666 wird erwähnt, daß an der Ecke der Eybenlauben eine Kette hing, während der zugehörige Pfahl mit Krampe und Schloß am gegenüberliegenden Wittorfer Hofe (dieser erwähnt schon in der Schoßrolle von 1431) fehlte; Pläne von 1765 und 94 achtern Nieflock; 1802 hinter den Iflock. Manecke, top.-hist. Beschr., führt unter den dingfreien, d. h. der Bürgerpflicht nicht unterworfenen Häusern, den adelig freien, doch nicht landtagsfähigen Hof am Niflock auf, nacheinander im Besitz der v. Stöckheim, v. Wittorf, v. Post, Barteldes, von Spörcken, Ribock, v. Meding; die von ihm hypothetisch angeführte Lesart hinterm Nienlok ist bisher nicht belegt und die daran geknüpfte Beziehung auf einen Erdfall offenbar hinfällig; Manecke selber führt aus städtischen Schriften an: Niflock = porticus deraceus, Epheulaube. Gebhardi leitet den Namen ab von einer Eibenlauben gegen Posten Hof über. Am Jägerteich Ratsbeschluß vom 27.1.1977. Die Umbenennung eines Teils der Straße Im Grimm soll auf den angrenzenden Teich verweisen. Am Kaltenmoor Ratsbeschluß vom 4.4.1944. Die Straße führt südlich der Dahlenburger Landstraße zum Gut Kaltenmoor. Um 1495 war Kaltenmoor ein der Stadt schoßpflichtiger Garten mit einer Bienenzucht; als Besitzer wird Ludeke Smedeke genannt. 1530 erwarb dieses Anwesen der Lüneburger Bürgermeister Hieronymus Witzendorff, dessen Sohn Franz den Besitz erweiterte und dort einen Gutshof anlegte. Unter den patrizischen 46
Sommersitzen, die um diese Zeit rings um Lüneburg entstanden, war er nach dem Urteil des bekannten zeitgenössischen Poeten Lucas Lossius der schönste. Lossius beschreibt ihn als schloßähnlichen Wohnsitz auf einer Insel inmitten eines Teiches. Im Jahre 1803 verkauften die Witzendorff Gut Kaltenmoor an Karl von Bülow. Das Schloßgebäude wurde 1836 durch einen Orkan zerstört und, wieder aufgebaut, 1912 durch einen Blitzschlag eingeäschert. In dem hernach aufgeführten Wohnhaus erinnert lediglich noch ein Balken mit der eingeschnitzten Jahreszahl 1707 an das ältere Gutsgebäude mit seinem großen Tanzsaal. Am 1.3.1965 übernahm die Stadt Lüneburg das Eigentum sämtlicher zu dem Gut gehörender Ländereien mit Ausnahme des engeren Gutsbezirks. Am Klostergarten Ratsbeschluß vom 30.5.1963. Der Name bezieht sich auf den Garten des Klosters Lüne. Am Klosterteich Ratsbeschluß vom 30.5.1963. Gemeint ist der sog. Mühlenteich beim Kloster Lüne. Am Kreideberg Kein Ratsbeschluß. Straßenbezeichnung seit 23. September 1884 für den Weg, der von Fuchs, d. h. hinter dem Eckhaus der Straße vor dem Bardowickertore, zu den Kalkbrüchen führte. Der krytenberch wird zuerst erwähnt 1398; im Jahre 1408 verkaufte das Michaeliskloster dem Bgm. Viskule zwei Stück Land by dem kritenberghe ... mit den kritenkulen de daruppe ligget, myd grund und myt allem rechte. Das Stadtbauamt läßt 1424 den kritenberch dar me den betekalk ut brickt aufräumen, dat critenhus in Ordnung bringen 1451 und löst 1461 den kriten berg myt deme huse dar me de kriten ynne brent, den kritenberch, dede horet thom buwampte, und der vom Rate an Bromes verpfändet gewesen war, für 600 M wieder ein. Garten mit Wiese retro montem cretosum in orienti 1612; extra portam Bardovicensem fodinae cretariae adiacentem 1644. Vor dem Bardowickertor bey dem Kreitenbruch besaß die Kämmerei drei vermietete Gärten; sie wurden zu dem Ende beibehalten, daß man erforderlichenfalls den Kreitenbruch extendieren könne (nach 1700). Die Kreidenkule vor dem Bardowickertore war zu Maneckes Zeit eine mit einem Bethkalkbruch verbundene städtische Kalkbrennerei, während im Schildstein sowie vom Kalkberge in der weithin sichtbaren städtischen Windmühle Gipskalk gebrochen und gemahlen wurde. Die Gipswindmühle, 1841 abgebrochen und durch Baumeister Sprengel wieder aufgebaut, brannte 1864 ab und wurde ganz beseitigt 1873. Der Name Schildstein entspringt wohl der ursprünglichen Form des Berges, während die gleichnamige Ratsfamilie eben diesen Berg nutzte. 1328 zahlten die Kämmerer Frau Hanne Schiltstenes 30 M für 5 pram cementi. Am Lembarg 47
Ratsbeschluß vom 29.8.1996. Der Straßenname greift eine alte Flurbezeichnung in Rettmer auf und benutzt die niederdeutsche Form des Hinweises auf Tonerdevorkommen. Am Lindenbergertore Das Lindenbergertor, das zum Lindenberge führte, vermutlich einem Festplatze der Stadt, der, wie der Lindenberg in Braunschweig (1355), ganz nahe der Wallbefestigung gelegen haben muß und wohl einen Teil der jetzigen Bastion bildete, ist gleich dem Grimmertore eingegangen nach Anlage des neues Tores, wird aber in Ortsbezeichnungen bis in das Vierzehnhundert hinein gern und oft herangezogen. Ein Haus apud valvam Lindenberghe zahlt 1302 eine Abgabe an die Stadt; Gartenhaus eines v. Oedeme extra valvam Lindenberge 1313; die Kämmerer machen eine Zahlung an einen Zimmermann für ein slachdor ad valvam Lindenberch, ferner pro asseribus ad novum berghvredhe et valvam Lindenbergh 1328; eine Kate der Groten extra valvam Lindenberghe ante civitatem L. bei einem Grundstück des Abts von St. Mich. 1337; curia olerum der Schwerin ante valvam que Lindenberghere dor communiter appellatur 1344; Hof eines Gir vor dem Lindenberger dore 1344; daselbst kaufen St. Cyriak und der Rat von Seghebant vom Berge einen Hof 1347; im selben Jahre verzichtet der Knappe Joh. gen. Beme auf einen Weg und Durchgang que est inter murum civitatis et curiam meam sitam prope dotem eccl. s. Cyr. in Antiqua civitate ad partem valve Lindenberge; Huner van der Oedeme verkauft dem Rat Haus und Hof buten deme Lindenbergheren doere zur vorderen Hand, wenn man aus dem Tore hinausgeht, zwischen dem Cyriaks- und der v. Estorff Hofe 1356; die von Estorff verkauften dem Rate ihren Hof bi der stad graven buten deme Lindenbergheren dore 1361; die Kirchengeschworenen von St. Cyriak verpachten eine Badstube, stupam circa Lindenbergher dör 1364; der Knappe v. Odeme all seine Katen buten deme Lindenberghere dore, ante valvam que dicitur dat Lindenbergher dor 1362 und 1364; Hof der v. Meding by deme Lindenberghe 1366; Herzog Wilhelm macht dem Rate 1365 Nov. 29 das Zugeständnis: wel ok dhe raad dat Grimmer unde Lindenbergher doer verghan laten unde en ander doer dar entwischen wedder maken laten, des schollen se maght hebben; die Herzöge Wenzel und Albrecht erteilen 1371 Jan. 6 Rat und Bürgern die Vollmacht dat se alle hus und buwe vor der stad mogen afbreken odir verbernen de gelegen sint in dem Grimme, vor dem Lindenbergeren dore und vor dem Sulten dore, also dat dar nenerleye hues noch woninge bliven scal, den de rad dar sunderleken hebben wil. Im Jahre 1388 läßt das Bauamt Zäune anfertigen twischen deme Lindenberger dore und deme Bardewiker dore; 1414 wird der Wall ausgebessert de ingevallen was by dem Lindenberge in dem stadtgraven, die Mauer wird wiederhergestellt und eine Kule in den garden darby gefüllt; im selben Jahre werden de treppen von dem Bardewikeren dore wente to deme Lindenbergher dore ausgebessert; durch die Stadtmauer wird in den graven by dem Lindenberghe ein Siel gelegt 1415; ene brugghe to makende by dem Lindenberghe 1416; verbuwet an dem graven an dem Lindenberghe 1445; die Gärten beim Lindenberge zahlen eine Abgabe an die Mühlenherren 1488; ein Baum bij dem Lindenberghe wurde (nachts) verschlossen gehalten, 1520 und 1530. Gegen die Mitte des Vierzehnhunderts bildete der Lindenberg das Ziel einer Prozession der Sülzknechte, die aus diesem Anlaß vom ältesten Barmeister ein Entgelt empfingen wan men myt den hilghen umme de sulten gheit unde vort over den Lindenberch. Am Marienplatz 48
Kein Ratsbeschluß. Der Name bewahrt die Erinnerung an die im Jahre 1818 abgebrochene, von einem Friedhofe umgebene Kirche des Franziskanerklosters an der Westseite des Rathauses. In cimiterio (fratrum minorum) 1297, in angulo plateae ex opposito eccl. fratrum minorum 1351; prope fratres minores 1352; iuxta cymiterium fratrum minorum 1355; prope cym. b. Marie virginis 1369; iuxta cim. mon. fratrum minorum versus orientem 1393; by unser leven frouwen kerckhove den kerckhoff alumme went uppe de ronnen sollten die Mönche die Straße rein halten (um 1430); retro eccl. fratrum minorum b. Mar. virg. in opposito curie episcopalis Verdensis 1438; bi unser leven vrouwen bi dem olden Meineken Tobinge wurde 1437 und 1438 ein neues stattliches Haus gebaut, nach Büttner das Syndikatshaus; das erste Syndikatshaus (neben dem alten Fürstenhause) wurde von Herzog Georg Wilhelm angekauft und 1694 abgebrochen, nebst dem Brömseschen und Braunschweigschen Hause; die vormalige Wohnung des jüngsten Syndici lag nach Maneckes hs. Sammlungen an der Wagestraßen Ecke. By deme slachbome by unser leven frouwen kerke wurde heftig gekämpft in der Ursulanacht (Schomaker). Für einen Besuch des Königs von Dänemark im Jahre 1487 wurde je eine Beleuchtungspfanne vorgesehen by unser leven frouwen by dem molensteyn tegen der scryverie und tegen des doctors husz unde hern Hartwichs Stoteroggen huse by dem kerckhove; van dem borne by unser leven frouwen trug der Rat 1489 in sein Denkelbok ein, daß ehemals eyn post und borne innerhalb des Klosters sich befunden habe, der nun buten closters an Hinrick Kurckes woninge nicht verne van deme kerckhove gesettet unde hengelecht ist, auf Wunsch aber zurückverlegt werden müsse; Eckhaus des Rm.‘s Töbing gegenüber dem Rm. Stoterogge prope cim. mon. b. Marie virg. 1497. Des Protonotars Dienstwohnung lag 1512 by deme observantenkloster und wurde als Secretariat Haus by St. Marien 1695 von der Stadt veräußert; als gegen St. Marien Kirchen über gelegen wird der Verdener Stiftshof (sog. Rotenburgischer Hof) bezeichnet, der 1638 an Hans Friedrich von Wittorf gelangte (der Kleine Wittorfer Hof). Plan von 1794 bey St. Marien Kirchhof; 1802 bei St. Marien Kirche; Marien Kirchhof 1819; auf St. Marien Kirchhof 1850; am Marienplatze 1860 mit Unterscheidung der drei Häuserzeilen vom Meere bis zur Gralstraße, von der Gralstraße bis zum Ochsenmarkte, von der Wagestraße bis zum Ochsenmarkte. – Eine Marienkapelle besaß auch der zu Beginn des Achtzehnhunderts eingegangene Lange Hof an der Salzbrückerstraße, Südecke der Techt, und zwar als Stiftung des Bürgermeisters Leonhard Elver, † 1511. Ein Eckhaus nebst vier Buden und Holzhof heißt 1542 gegenüber der Marienkapelle, ex opp. cap. Marie virg. versus murum ex opp. hospitalis longe curie. Zu vgl. Salzbrückerstraße. Am Markt Kein Ratsbeschluß. Wo der älteste Marktplatz gelegen haben mag – ein Lüneburger Marktzoll wird bereits 965 erwähnt - entzieht sich sicherer Kenntnis. Der jetzige Marktplatz erscheint in frühen Quellen, ja noch 1514 als Neumarkt∗, und die Rathauskapelle zum Hl. Geiste behielt die Bezeichnung nach dieser ihrer Belegenheit bis an ihr Ende, zur Unterscheidung von der ebenfalls dem Hl. Geiste geweihten Kapelle des Hospitals bei der Saline. Ein Johann Niemarket war Mitglied des Rates schon 1244; im Hause eines Schmiedes de novo foro wurde eingebrochen 1279; in novo foro 1288; von ∗
Eine „Neustadt“ wird nur ein einziges Mal ausdrücklich genannt und zwar 1352, als ein Hof Segebands von Wittorf in nova civitate prope fratres den Gebrüdern Dyse vermacht wird. 49
Am Markt, Blick nach Westen auf das Rathaus
Haus und Erbe daselbst wird eine Abgabe von 21 M an die Kämmerei entrichtet 1302; die Kämmerer legen einen Fußsteig an und lassen Sand abfahren – ad deportationem arene de novo foro, via lapidea in novo foro 1321; capella s. spir. novi 1335; prope novum forum 1347; hinfällige Schenkung eines Hauses am Neumarkt an das Kloster Arendsee 1351; super novum forum 1357; in novo foro Luneborch ex opp. cap. s. spir. 1365; uppe deme nygen markede 1369; super novum forum iuxta valvam domus curie 1372; uppe dem markede 1373; in novo foro circa scampna piscatorum (Fischschrangen, Verkaufsstände der Fischer) 1375; apud novum forum 1379; versus forum Luneborch 1383; in australi angulo prope forum et in duabus casis lapideis prope dictam domum versus forum; in orientali angulo prope novum forum 1384; iuxta novum forum 1399; de kosteryghe (tom hilgen geste) uppe dem markede 1417; ex opposito novi fori ein Eckhaus 1420; in cornu ex opp. novi fori 1435; an deme zeygertorne uppe dem markede 1445 – dieser Uhrturm inmitten der Rathausfront wird gern und häufig auch Marktturm genannt; Eckhaus Hans Schele bij dem markede 1450; Hans Doring zw. Rm. Bertold Lange und Fluwerks Erben und Marquard Mildehoft iuxta novum forum in parte meridionali 1459; Eckhaus des Ratmanns vame Rijpe circa domum monete in acie pl. wagestrate nuncupate prope novum forum 1466; in opp. domus nostre consularis 1467; Haus Witzendorff, Sankenstede zwischen Winsen und Eckhaus Witzendorff ex opp. cap. s. spir. in novo foro 1492; geplante Anlage einer Wasserleitung van der Luthmer in die Stadt beth an des schüttinges ort by dem nyen markede 1497; am marckede 1500; Haus Stöterogge zwischen Witzendorff und Schomaker up dem nijgen markede bzw. up deme markede 1514; ex adverso domus pannicidarum, d. h. gegenüber dem Gewandhause, das die beiden Stockwerke des Rathauses unter dem Fürstensaale einnahm, 1530; der Ratmann Grönhagen kaufte 1533 ein Haus zwischen seinem eigenen Wohnhause und dem des Stadthauptmanns apud forum ex adverso domus nostre consularis; des hovetmannes hus wird erwähnt bereits 1425, zwei Jahre später wird bij des hovetmanns huse ein neuer Steinweg angelegt, das Haus ersteht 1460 nach einem Brande in einem Neubau. Ein waterkum bi dem richtehuse erbaut 1454 auf Kosten der Barmeister; Elis. v. Dassel brachte zu ihrer Vermählung mit Jeron. Töbing ein Wohnhaus mit jegen dem rathusse aver belegen, by des hovetmans husze, ehemals bewohnt von der Wittische, 1567. Ein Franz Düsterhop vermachte 1600 das von ihm bewohnte Haus auf dem markede im Werte von 7000 M seinem Sohne Ernst. Haus des † Jürgen Könnigs Am Markte hatte der † Goldschmied Nic. Meyer inne gehabt 1697. Schon die von uns herangezogenen Quellenstellen, die leicht durch viele andere ergänzt werden könnten, zeigen, daß die Häuser am Markte in unmittelbarer Nähe des Rathauses zumeist von den Ratsfamilien bewohnt wurden; Eckhaus MarktMünze (Ratsschänke) seit 1927 Städtische Sparkasse, gehörte bis 1847 der Familie v. Dassel; eine Tochter des Barmeisters v. D. verkaufte es im gen. Jahre an den Club zur Harmonie; der nachmalige Eigentümer Gohde baute es 1873 nach neuerem Geschmacke aus, ohne jedoch den alten Giebel wesentlich zu verändern. Das Nachbarhaus Nr. 2 wurde im Sommer 1873 abgebrochen; es war bewohnt vom Barmeister v. Dassel, dessen Tochter, die Oberstlieutnantin v. Gruben, es an einen Kupferschmied verkaufte, von dessen Erben es an den Tischler Größner überging – dieser ließ die ganze Front niederreißen, ein Verlust für die Stadt wegen des Renaissancegiebels (Volgers Chr.). Volger z. J. 1860: das letzte Patrizierhaus (der Tochter des Barmeisters v. Dassel) am Markte (A. Nr. 34) an den Kupferschmied Fölsch verkauft.
51
Erst in den Jahren 1695/8 entstand an der Nordseite des Marktplatzes das herzogliche Schloß als Witwensitz für die Herzogin Eleonore d’Olbreuse † 1718, nachdem Georg Wilhelm die zuvor dort belegenen Patrizierhäuser angekauft hatte; es waren die Privathäuser Georg v. Dassels Erben, Statius Friedr. v. Witzendorff Erben, D. Dölffern, Hans Westphalen u. Joh. Schillern, die sämtlich niedergerissen wurden; 1698 kaufte der Herzog noch hinzu die Häuser Nicolaus Grellen, Hans Pichts u. Jürgen Wizendorfs auf der Bard.straße. Der Schloßplatz war nach Gebhardi königlich. Das Schloß wurde 1868 zur Kaserne eingerichtet, nach dem Weltkriege Finanzamt, 1925 zum Landgericht umgebaut, erweitert nach Abbruch des Witzendorff Hauses an der Bardowickerstraße 1936 ff. Das Rathaus bildete von jeher einen Häuserblock für sich; an seiner Südostecke lag die Waage (z. vgl. Wagestraße), daneben die Wache corps de guarde 1723, mitten in der Hauptfront das doppelgeschossige, schon erwähnte Gewandhaus, nahe der Kämmerei das Eichamt, der Amehof. In dem amehofe 1397; ex opp. curie in vulgo dicte amehoff 1400; ein Sod im Amehofe 1410; vor dat nige hus an dem amhove to voderende myt ener bank 1411; ein Steinweg in des rades hove by Koltzen huse wird angelegt 1413. Alte Stadtpläne zeigen auf dem Marktplatze selber den Lunabrunnen, errichtet wohl 1530 bei Anlage der Abtswasserkunst, einen Freibrunnen, die Verkaufsbänke – von Sivert van Salder heißt es im Volksliede von der Ursulanacht: wo grade he up de vischbenke sprank -, ferner, unweit der noch wohl erhaltenen Gerichtsstätte an der Nordostecke der Rathausfront, den hölzernen Esel sowie den Schandpfahl oder Kak, der schon 1283 erwähnt wird – Weggedef ... positus fuit supra kac. Bi dem Kake wurde in der Ursulanacht 1371 auf ritterlicher Seite Hartig Sabels Sohn erschlagen. Der Kak wurde 1691 in großen Verhältnissen erneuert, da der alte Kak trotz eines neuen Fußes (1655) durch Sturmwind gefährdet war, und erhielt nach seinem ersten Insassen den Namen bunter David, mußte aber 1764 abgetragen werden, da er die freie Aussicht aus den Fenstern des Schlosses störte. Zwei im Pflaster nebeneinander liegende rechteckige Granitblöcke südlich vom Springbrunnen bezeichnen die Stelle, wo am 9. Juni 1458 zwei Rädelsführer des Prälatenkrieges enthauptet wurden. Im Jahre 1725 wurde auf dem Marktplatze eine Justiz errichtet, ein Galgen für die Soldaten, bei dessen Anfertigung einer der Gerichtsherren des Rates den ersten Hieb tun mußte. Frei auf dem Platze scheint ein Garbraterhaus gelegen zu haben, das schon 1409 abgebrochen wurde – den plan by deme zode dar dat ghaerbrader hus by unde uppe stan hadde! Der Hauptmarkttag für den Wocheneinkauf der Konsumenten ist von alters der Mittwoch: des middewekens scall nemant kopen dewile de banre das Marktbanner steit dat he vort vorkopen wille c. 1455, waren doch de middewekene eyn vrijg dagh van kopenschopp 1468. Die Verbindung von Mittwochs- und Sonnabendmarkt begegnet 1570 in folgender Verordnung des Rates: wanner de waren so vorgemelt in de stadt kamen, so mag ein ider borger und inwaner kopen, averst des dinxstages von twolf slegen und beth up den mittweken tho twolf slegen, desgleichen des frigdages tho twolf slegen beth des sonnavendes tho twolf slegen, welche dage und tidt de fane am markede soll upgerichtet werden, schall nemandes up vorkop, sinen gewinn darmit to dreven, etwas upkopen. Mydden uppe dem markede war für festliche Gelegenheit eine stehende Beleuchtungspfanne vorgesehen 1487. Nach Verordnung von 1491 durfte der, welcher mit minderwertigem Fisch zu Markte kam, einen Markttag damit feilhalten, aber in eyner sunderigen stede nomptliken by deme 52
borne neffen deme richtehusze. Das Marckt 1765; Markt 1819; am Markte 1860. Zu vgl. Ochsenmarkt, Wage- und Bardowiekerstraße. Am Neuen Felde Kein Ratsbeschluß. Auf Grund alter Flurbezeichnung seit 1924. Am Ochsenmarkt Kein Ratsbeschluß. An den drei oder vier ersten Tagen der Galluswoche (St. Gallentag am 16. Oktober) und der drei nächstfolgenden Wochen fand in Lüneburg Ochsenmarkt statt, an welcher Stätte, besagt der Straßenname. Dieser kommt in mittelalterlichen Quellen nicht vor, Ochsenmarkt und Markt werden vielmehr einheitlich als Neumarkt bezeichnet, und wenn das Fürstenhaus an der Westecke des heutigen Regierungsgrundstückes erwähnt wird, heißt es in der Schoßrolle 1433 an erster Stelle des Marktviertels: Clawes Grawerock in domo ducum oder etwa 1524 (Haus Winsen-Kopken zwischen van der Mölen) necnon ill. principum nostrorum domos ex adverso cancellarie nostre; selbst Büttner hat den Ochsenmarkt noch nicht mit aufgeführt. Das Fürstenhaus entstand 1381, vorher Haus der Marg., Wwe. v. Lübecke, vergrößert durch Herzog Christian Ludwig nach Ankauf des daneben gelegenen Elver- u. letztlich Grabowischen Hauses. Die Schoßrolle von 1615 bemerkt dazu: des herzogen hus ist vormals ein borgerhaus gewesen und der herschop von einer Witwen de von Lübeg geheissen, gegeben worden; derhalven hertzog Heinrich des Elteren vogt Pawel Grip jahrlich 1 Liespfund gebacken krude zu einer verehrung uf die schott tafel uberantwortet. Herzog Georg Wilhelm ließ das Fürstenhaus nebst dem dazu gekauften ersten Syndicat- wie auch Brömsisch und Braunschweichischen Hause ao. 1694 abbrechen u. den Anfang zu Anlegung eines neuen Palatii auf derselben Stelle machen – 1695 neuer Bauplatz am Markte. Die Stadt erwarb Gebäude und Bauplatz gegen dortigem stadtrathause über auf dem Ochsenmarkte 1698; sie verzichtete dafür auf alle Ansprüche an die vom Herzoge angekauften bürgerlichen Häuser. Ad boarium forum 1614; Bürgermeister Elver wohnte zwischen Fürstenhaus (Ecke der Reitendendienerstraße, später Spritzenhaus) und Häusern des Senats in foro boario 1617; eine steinerne Auslucht an der Bürgermeisterstube am Ochsenmarkt war schadhaft 1694. Auf den Ochsen Marckt 1765; der Ochsenmarkt Plan von 1802, wo an der Rathausseite je ein Platz für das Halseisen und eine Straftafel vermerkt ist; am Ochsenmarkt 1850. Auf dem Plan von 1802 ist gegenüber der Nordfront des Rathauses eine vom Eckhause der Burmesterstraße (Nr. 1, vormals Haus der Lange und v. Witzendorff) bis zur Stadtbibliothek reichende, stattliche Lindenreihe eingetragen und dazu der Name auf dem Jungfernsteige. Dieser Jungfernsteig ist schon 1729 zu belegen, als der Rat Georg dem Zweiten zu Ehren eine Illumination veranstaltete auf dem Rathause und der Schreiberei, bey der jungfernstiege und auf der Bibliothek. Auf dem Markte beim Jungfernstieg fütterten die Franzosen 1757 ihre Pferde; Marschall Richelieu forderte den großen Garten am Ochsenmarkt bei dem Jungfernstieg als 53
Begräbnisplatz. Wo jetzt das Regierungsgebäude steht, lag Ende des Siebzehnhunderts der Clubgarten. Regierungsgebäude (zunächst ohne Dienstwohnung des Drosten) erbaut 1849. Wohnung im Regierungsgebäude bezogen Mich. 1863 (Landdrost v. Issendorf). Ein Ochsenmarkt auch in Danzig. Ein Jungfernstieg in Braunschweig 1706, Jungfrauenstieg in Hannover um 1750, in Lübeck Jungfernstieg seit der Anpflanzung von Bäumen 1834. Am Oelzepark Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Die Straße ist nach dem Bremer Kaufmann Oelze benannt, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Villa mit großem Park in Häcklingen erbauen ließ. Am Plaggenschlag Ratsbeschluß vom 27.8.1981. Bei dem Straßennamen handelt es sich um eine alte Flurbezeichnung der Gemarkung Ochtmissen im Bereich des Lerchenberges. Am Sande Kein Ratsbeschluß. Schon in der ältesten Originalurkunde des Stadtarchivs (1229) werden unter den Vertretern der Bürgerschaft ein Arnoldus, magister civium in harena und ein Jacobus de harena genannt. Beide haben auf dem Sande offenbar ihr Wohnhaus gehabt, und einer von ihnen oder beide werden Geschlechtsgenossen der bereits im Vierzehnhundert erloschenen Patrizierfamilie van deme Sande gewesen sein. Sand ist der große, ungepflasterte Platz der Stadt auf sandigem Boden; einen Sand gibt es auch in Bardewik, Breslau, Danzig, Hamburg, Harburg, Hof (Bayern), Lübeck, Stade, Uelzen. Merian nennt in seiner Topographie Obersachsens und Thüringens etc.: Warmbahdt zu Unse L. Frawen auf dem Sandt. Die Generalstabskarte 262 führt nw. von Winsen a. d. A., nördl. vom Winser Moor, die Bezeichnung Auf dem Sande. In arena vor dem Rotentore 1288; super arenam 1293; der Bürger Hermann vom Sande erwarb vom Bischof und Domkapitel zu Verden ein Erbe apud eccl. s. Joh. bapt. in Modestorp iuxta arenam 1303; prope pl. que super arenam appellatur 1343; supra arenam 1344; Haus des Joh. v. Netze supra arenam bzw. in angulo pl. que super arenam dicitur 1349; in arena pl. sic nominata 1351; boven dem sande 1382; super finem arene 1389; upp dem sande 1389. Eckhaus Rademaker in superiori parte arene versus occidentem 1426; bi der kostery 1431; Holzkauf up deme Zande; super arenam in parte aquilonari 1449; bij sunte Johannis Kerkhove nedden dem Sande 1451; by Rolevestorp des beckers ordhusze boven deme zande 1466; versus plagam meridionalem supra arenam 1510; am Sande auf der Rodenstraten ordte Haus Stoketo-Elvers-Semmelbecker 1521-1531. Vor der Johanniskirche standen Fischbänke, die vom Bauamte unterhalten wurden, de vysbencke vor sunte Johanse to makende 1422; under den bencken by deme borne bis mitten auf die Straße hatte der Burmester rein zu halten, vom Born bis mitten auf die Straße Loffhagghen (um 1430); infra (citra) arenam in opp. 54
scampnarum piscium 1467 und 1470. Ein Haus der Johanniskirche inter custodiam eiusdem eccl.... supra arenam wurde 1553 verkauft. Ein kunstvoller Brunnen, de borne de up deme sande steit, wurde mit einem Aufwande von 2134 M 6 s 4 d in den Jahren 1472/75 durch den Sodmeister errichtet; er ist leider nicht einmal im Bilde erhalten, soll aber im unteren Teile de Sandes gestanden haben, vermutlich da, wo auf dem Plan von 1802 ein einfacher Brunnenpfosten angedeutet ist. 1858 Neuer Springbrunnen auf dem Sande. Ein Brunnen stand bis dahin der Kl. Bäckerstr. gerade gegenüber, hinter demselben ein großer steinerner Wasserbehälter, und an diesen schloß sich eine runde etwa 5 Fuß hohe, steinerne Mauereinfassung, in deren Mitte eine Linde wuchs. Es war hier der gewöhnliche Aufenthalt der Kornmesser, deren Amt 1861 aufgehoben wurde. 1869 Wegräumung des Brunnens unten am Sande; die hölzerne Brunnensäule und der steinerne Wasserbehälter wurden beseitigt und durch eine eiserne ersetzt. Von urkundlichen Belegstellen, die auf bemerkenswertere Häuser am Sande hinweisen, seien noch folgende aufgeführt: domus pistorum apud arenam in angulo sita (eine Rente daraus an St. Nic.) um 1520; der Bürger v. Cölln erwarb 1616 diversorium aquila nigra nuncupatum in arena (Nr. 52?); Hans und Heinrich Sterne kauften das Haus der Witwe Elvers in inferiori parte arenae 1629; Haus CaluntsKrämer Meier ad aciem superioris partis arenae iuxta aedes braxatorias Joannis Kloppenburgs (Nr. 1) 1631, erbaut als Doppelhaus von Hermann Kloppenburg und in dessen Testament 1581 erwähnt. Das Haus Nr. 53 mit einem der ältesten Giebel der Stadt ist der alte Sandkeller, ein vom Rate verpachteter Ausschank von Hamburger Bier. Als 1580 der Nachbar Ribenitz einen Neubau errichtete, wurde der Sandkeller schwer in Mitleidenschaft gezogen; er gelangte 1731 in Privatbesitz (Wedemann). Senatus albilatorium 1620; Nr. 45 (und 46?) war die Weißladerei, die eine der beiden Verkaufsstellen für Salz, domus collegio salinatorum propria, vulgo die weissladerey 1446; Haus Heinrichs-Krüger in superiore [sic] parte arenae ad aciem sita domuique nostrae publicae ubi in dies sal venditur vulgo der weisladerei dictae vicina 1661. Ein Wirtshaus zwischen der Propstei und Vantzken Haus (Hamburger Hof) hieß zum Goldnen Engel, diversorium sub signo aurei angeli, es war zeitweise die Herberge der Färber, Gelbgießer, Handschuhmacher, Kupferschmiede, Tuchmacher, Weißgerber und Zinngießer. Nr. 1, irreführend zeitweise Schütting genannt, beherbergte die Drechsler, Korbmacher, und Maurer. Das Wellenkampsche Haus am Sande, einige Jahre unbewohnt gewesen, erhielt seine neue Front 1858; Engels Buchhandlung daselbst Ostern 1859-Oktober 1861, dann in der Bäckerstr. (Kfm. Ohlert); Gasthof seit Sommer 1861 (oder schon Mich. 1859 eröffnet?); das Munstermannsche Haus am Sande erhielt 1860 eine ganz neue Front; Senator Fressel baute 1863 ein sehr ansehnliches 3 Treppen hohes Nebenhaus. Die Lesart auf dem Sande hat schon ein Stadtplan von 1652; der Plan von 1902 unterscheidet der Sand und vor dem Sande für die östliche Häuserzeile; er bezeichnet besonders die Einhornapotheke als Dämpwolfs Apotheke (neuer Giebel 1876), den schwarzen Adler, die Rose an der nördlichen, den Goldnen Adler, das Kgl. Postamt und die Traube an der südlichen Längsseite. Grapengießerstraße 3 (und 2 oder 4?) lagen nach Gebhardi nebeneinander der schwarze Bär (Herbergsschild im Museum) und das weiße Roß. Am Schierbrunnen Ratsbeschluß vom 30.4.1959, für die Verlängerung vom 30.5.1963.
55
Benannt nach dem dort belegenen Schierbrunnen, der nachweislich seit 1386 zur Wasserversorgung Lüneburgs benutzt wurde und von dem eine der ältesten Wasserleitungen Lüneburgs in die Stadt führte. Am Schifferwall Kein Ratsbeschluß. Die Straße ist angelegt zu Beginn der 90er Jahre, ihr Name begegnet zuerst 1892. Der Schifferwall, auch Oldekop Wall genannt (wohl nach dem anliegenden Gartengrundstück eines Bürgermeisters) reichte vom Lünertore bis an den Hafen; an seiner Außenseite verbreiterte sich der Stadtgraben zu einem Winterhafen. Am Schlachthof Ratsbeschluß vom 24.4.1969. Die im Gewerbegebiet Lüner Heide befindliche Straße verweist in ihrem Namen auf den dort angesiedelten Versandschlachthof. Am Schlehbusch Ratsbeschluß vom 28.11.1951. Die Straßenbezeichnung greift einen alten Flurnamen auf. Am Schützenplatz Kein Ratsbeschluß. Als Straßenbezeichnung (auf dem Schützenplatze) erst seit Ausgang der 1870er Jahre nachweisbar, wohl als das Haus der Schützengesellschaft dort errichtet wurde. Als Tummelplatz für das Schützenfest seit Jahrhunderten in Gebrauch, berichtet doch Reinbecks Chronik schon zu den Jahren 1655 und 1670 vom Scheibenschießen auf dem Holzberge vor dem Lunertor. Vorübergehend ein Wohnplatz gleicher Bezeichnung (Baracken), der aber am 11.2.1964 aufgehoben wurde. Am Schwalbenberg Kollegienbeschluß vom 4. Nov. 1902. Auf Grund der im Volksmunde lebenden Bezeichnung, für die sich urkundlich nur ein einziger Anhaltspunkt bietet. Nach der Sodmeisterrechnung von 1485 nämlich wurden 42 M verausgabt de schütze tor swalkenborg nye to gründende – es mag sich um die Herstellung eines Schotts beim Schierbrunnen handeln. Swalkenborg ist Schwalbenburg, ein anschaulicher Name für einen jener um Lüneburg mehrfach zu findenden, senkrecht abfallenden, sandigen Hänge, die unter der Heidekrume mit ungezählten Nestern und Fluglöchern der Haus-, Rauch- und Seglerschwalbe durchsetzt sind. Amselweg Ratsbeschluß vom 4.4.1944. Der vom Ilmenaugarten bis zur Gastwirtschaft Wilschenbrook führende Weg gehört zum „Vogelquartier“. 56
Am Springintgut Kein Ratsbeschluß. Der Springintgud Turm, auf allen alten Stadtansichten auffallend durch seine hochragende Gestalt mit dem durch zahlreiche Dacherker charakterisierten Spitzhelm, wurde erstmals vor einem Jahrhundert in seinen Grundmauern aufgedeckt; ein Bericht von 1765 sagt, daß er in der Runde 118 Fuß, im Durchschnitt 30 Fuß gemessen habe. Er stand der Nordwestecke des nachherigen Hauptmeldeamtes des Kgl. Bezirkskommandos gegenüber, linker Hand, wenn man zum Rest des Gralwalles hinaufgeht. In der Leidenschaft des Prälatenkrieges schickte der neue Rat den abgesetzten Bürgermeister Johann Springintgud als Gefangenen in eben diesen Turm, der vielleicht sein eigenes Werk war – he moste ghan in den groten torn achter sünte Michaele (Langes Chronik), in den vangentorne achter s. Michel in dem grale (Schomaker). Aus dem großen oder hohen Turm wurde der Springintgud Turm, schlechthin Springintgud, als der Bürgermeister kläglich darin umgekommen war (1455). An den Fenstern to dem hogen torn wurde gearbeitet 1458; ein Gang by dem hogen torne hergestellt 1485; eine Planke gezogen achter dem hogen torne in dem grale 1499; Springintgudes torn zuerst 1528; der Rezeß vom 1. Mai 1639 stellt von dem Turme sprinckinszgutt genennet fest, daß er zu aptieren sei; im Jahre 1651 wurde er abgebrochen bis auf der rudera, die zu Büttners Zeit noch dastanden. Die Straßenbezeichnung datiert vom 1. August 1893. Am Stintmarkt Kein Ratsbeschluß. Der Stint ist in gebratener Form bis auf den heutigen Tag in Lüneburg ein beliebtes Volksnahrungsmittel, wenn das zierliche Fischlein auch keinen besonderen Marktoder Anlegeplatz (stade) mehr für sich in Anspruch nimmt. Eckhaus BasedowNymans apud aquas ... prope locum vulg. dictum styntstade 1390; iuxta fluvium Elmenow prope locum qui vulg. styntstat vocatur 1392; vor dat stad to buwende vor der Stutesschen dore unde to wordende [aufzuwerfen] by deme vischmarke unde vor dat stad to verdegende [herzurichten] benedden deme heringhuse 1410 (der Hinweis auf das Haus Stute macht es wahrscheinlich, daß hier unter Fischmarkt der Stintmarkt zu verstehen ist); den stenbruggeren vor der Stuteschen dore den stintmarket to bruggende 1411; styntmarked 1431; hierher gehört wohl auch versus ripam esocialem 1458; teghen deme stintstade bij deme watere 1466; circa forum gubii 1468. Die Anwohner des Stintmarktes hatten Anspruch auf eine (Miets-) Abgabe der Fisch-, hier zweifellos auch Häringshändler – dat de lude dede wonen neven deme stintmarckede malk ere werve maken laten schullen unde nemen van jewelker tunnen heringes de dar upgestaket werd 1 d ... 1470; in foro gubeorum circa aquam 1473. Ein namenloses Gäßchen, das die Straße auf dem Kauf mit dem Stintmarkt verbindet, muß zur Feststellung der Belegenheit dienen 1476: Haus Bottermann-Brekefelt zwischen dem Hause des Lüner Klosters und der Witwe von Notzsche ex opposito parve platee qua itur ad forum gubeorum; Wohnhaus des Ludeke Hoppensteden negest dem Wohnhause der Wwe. des Tydeke Gerleges am orde neffen deme Styntmarckede over 1489; circa forum gubeorum 1492; Wohnhaus 57
und Salzräume uppe des Stindtmerkedes orde 1496; Haus Hesse-Roggenbuck in acie fori gobiorum vulgariter des styntmarckedes 1521; Bürgermeister Töbing verkauft dem Bürger Tegeder ein Haus in acie fori gobiorum post domum monasterii Lune et duas casas ex adverso eiusdem domus in fronte pontis Lunensis 1530; eine Badestube (stuba vel domus balnei) lag zwischen der Abtsmühle und dem Brauhause Ratken in platea qua itur ad forum gobeorum 1542; der in älteren Urkunden erwähnte waterstoven ist wohl immer der am Altenbrückertore. Prope forum spirinchorum 1594; domus aceticocteria in angulo ad forum spirinchorum 1621; das stindt markt 1652; pl. spiringiorum 1659; in foro sardarum 1661; ante portam Lunensem in foro sardorum 1662; auf den stindtmarckt 1765; der Stintmarkt 1802. Am Sülzwall Kein Ratsbeschluß. Sülzwall hieß der in einem Reste noch erhaltene Wall zwischen Kalkberg und Saline. Die anliegende, einseitig bebaute Straße wird 1850 hinter dem Sülzwall (unterschieden von am Sülztorwall) genannt, 1860 am Sülzwall, d. h. die Strecke von der Sülzwallstraße rechts. Am Teich Ratsbeschluß vom 27.1.1977. Der Name nimmt die Lage der Straße an einem Teichgewässer auf. Am Urnenfeld Ratsbeschluß vom 30.11.2000. In der Nähe befindet sich ein vorgeschichtliches Gräberfeld aus der jüngeren Kaiserzeit (Mitte 2. Jh. bis Anfang 6. Jh. nach Chr.), an das mit dem Straßennamen erinnert werden soll. Am Venusberg Ratsbeschluß vom 30.5.1963. Alte, seit 1348 belegbare Flurbezeichnung (Viningeborg, vgl. S. 215). Am Wacholderbusch Ratsbeschluß vom 16.10.1998. Der Name greift eine Besonderheit der Flora in Häcklingen auf. Am Weiher Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Die Übernahme des Straßennamens beruht auf einer historischen Flurbezeichnung in Ochtmissen. Im Zusammenhang mit der Eingemeindung nach Lüneburg hatte der Gemeinderat von Ochtmissen den dortigen Amselweg in Am Weiher umbenannt, da es in Lüneburg bereits einen Amselweg gab.
58
Am Weißen Berge Ratsbeschluß vom 29.8.1991. Die Flurbezeichnung „Weißer Berg“ wird mit dem Straßennamen tradiert. Am Weißen Turm Ratsbeschluß vom 21.8.1969. Der weiße Turm war einer der 5 hohen Türme der inneren Sülzmauer im Bereich der jetzigen Straße, dessen Gedächtnis der Name bewahren soll. Am Werder Kollegienbeschluß vom 24.9.1895. Werder ist eine Insel, zumal die Insel im Fluß, deren es von der Einmündung der Ilmenau in die Stadt bis zur Warburg mehrere gab, ganz abgesehen vom Stadtgraben und Lösegraben. Oberhalb der Abtsmühle am Häringssteg lag der als Garten eingerichtete Werder für den dritten Bürgermeister, weiter oberhalb hinter St. Johannis ein Werder mit Garten, Gartenhaus und Wagenschauer für den zweiten Bürgermeister, alles Eigentum des Rates – dat werder buten Luneborgh twisschen beiden molen beneven den heringboden ... kumpt ... to dem rade – c. 1415, noch jetzt an dem wie eine Halbinsel vorspringenden linken Ufer wohl kenntlich. Von dort floß der Fluß in mehreren Ableitungen durch das Getriebe der Mühlen hindurch, umschloß aber in einem besonderen, am Schützenhause abzweigenden Arme (um die Mitte des Achtzehnhunderts angeblich Judengraben genannt) das ganze Gelände von der Lüner Mühle bis zum sog. Aalfang unterhalb des Kaufhauses, einschließlich der beiden Häuserblocks, die durch die Lünertorstraße voneinander geschieden sind. Der Herbergierer Joh. Georg Schultz im Schießgraben erhielt 1795 vom Rate die Erlaubnis über die Ilmenau, und zwar über den Ahlkistengraben, zwischen seinem Hause und dem Kaufhaus-Sprützenturm, auf seine Kosten eine Fußgängerbrücke anzulegen und zu unterhalten (1865 erneuert); 1712 war dem Bürger und Gastwirt im Schießgraben Adrian Gottfried Hahn ein entsprechendes Gesuch eines im Schießgraben anzulegenden Steges nach der Färberey über den alda vorhandenen Graben abgeschlagen. Das innere Ufer dieses Flußarmes war durch eine Mauer verstärkt, die Häuser an der nur einseitig bebauten Gasse hießen hinter der Lüner Mauer, bis am 24. September 1895 die städtischen Kollegien den zuvor im beschränkteren Sinne gebrauchten Namen am Werder dafür einsetzten. Prope murum portae Luhnensis 1674; achter Lünertor 1765; Schulzenwerder 1756 und achtern Lünertore 1794; hinter dem Lünertore 1802; am werder beim Aalfang 1850. Das zunächst der Stadt gehörige Schützenhaus wurde zu Johannis 1736 Eigentum der Schützengesellschaft. Adreßbuch von 1860: hinter der Lünermauer mit Unterscheidung vom Werder bis zur Lünertorstraße r., von der Lünertorstraße bis zum Lünermühlenhofe r. und am Lünermühlenhofe; Adreßbuch von 1862/63 ff. am Werder (beim Kaufhause). Der sog. Theerhof, ein alter Schuppen zwischen der Straße und dem Mühlenkanale, wurde 1873 weggeräumt. Am Wienebütteler Weg Kein Ratsbeschluß. Wienebüttel wird von Hammerstein als altes unmittelbares Besitztum der Herzöge aufgeführt, als nächstes zur Lüneburg auf dem Kalkberge gehöriges Haushaltsgut, das die Eigentümer erst nach der Zerstörung der Burg für 320 Lün. M veräußerten – 59
Blick nach Südwesten in die Straße Am Werder
unsen hof to Wynenbuttele de vor Luneborg beleghen is 1386; Bürgermeister Hoyke vergab den hof to Wynebutle 1397 an das Michaeliskloster. Der Ortsname Wienebüttel weist wohl auf den langobardischen Personennamen Wino (zu vgl. Bückmann S. 14), die Endung büttel (botle der Haushaltshof), im Bardengau nicht häufig, deutet auf sächsischen Ursprung (Hammerstein 547). Als Straßenname geläufig erst seit Erbauung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt 1898, ist die Bezeichnung schon im Jahre 1345 als via itur in Winebutle und via Winebutle urkundlich belegt. Inmitten der genannten Provinzialanstalt ist eine ehemalige Baumschule, die sog. O b s t b a u m p l a n t a g e , an altem Baumwuchs kenntlich; sie war bis 1897 Privateigentum, die entsprechende Straßenbezeichnung, nachweisbar seit 1860, ist 1905 verschwunden. Nur in den beiden ältesten Adreßbüchern (1860/62) findet sich die Benennung i n d e r B a u m s c h u l e. Das Grundstück, auf welchem die Heil- und Pflegeanstalt errichtet wurde, hieß auch der Lerchenberg und war bis in das Jahr des Baubeginns eine Niststätte unzähliger Lerchen. Eine Wegbesserung by deme lerkesberghe wurde seitens des Stadtbauamtes im Jahre 1415 vorgenommen. Eine zur Landes-Heil- und Pflegeanstalt gehörige Siedlung, fast auschließlich bewohnt von Pflegern der Anstalt, ist auf Reppenstedter Boden erbaut und heißt seit 1921 a m B r o c k w i n k l e r w e g e. Am Wiesenhof Ratsbeschluß vom 30.1.1973. Die Namenwahl erfolgte nach einer historischen Flurbezeichnung. Am Wischfeld Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Der Straßenname weist auf eine historische Flurbezeichnung hin, wobei mnd. wisch soviel wie „Wiese“ bedeutet. Am Ziegeleiteich Ratsbeschluß vom 29.9.1986. Die Benennung weist auf einen nahegelegenen Teich hin, der einmal zu einer Ziegelei gehörte und durch Tongewinnung entstand. An den Brodbänken Kein Ratsbeschluß. Die Brodbänke, Verkaufsstände der Bäcker, die sich nach alten Photographien an der südlichen Häuserreihe hinzogen, haben erst um 1870 aufgehört zu bestehen. Die nach ihnen benannte Straße, hier und da gleich der östlichen Fortsetzung auch als Rosenstraße bezeichnet, scheint vor dem Dreizehnhundert in Urkunden noch nicht vorzukommen. Apud scampna 1306; apud scampna pistorum 1358; prope scampna panum in angulo 1384; brodschrangen 1431; uppe deme orde bij den brotschrangen Haus Molne 1432; Eckhaus Heytmann iegen den brodschrangen over bij deme 61
markede 1439; platea per quam descendit a foro versus aquam Elmenow 1446; by den brodbencken hatte der Gastmeister vom Hl. Geist die Straße reinigen zu lassen (um 1430); benedden den brodscrangen na der perdebornige 1450; Eler Swertfeger zwischen Hermen Ties und dem vronen alse me dale geit van dem markede na des abbetes molen 1451; in platea qua a foro descenditur versus aquam Elmenowe 1464; Cord Stoterogge wohnte 1454 in opposito macellorum panis; prope macellum panum circa forum in acie 1590; dasselbe Haus wird vier Jahre später beschrieben in acie rosarum plateae prope forum et panariorum tabernam, welch letzterer Ausdruck auf eine Herberge der Brotbäcker hinweist, die in der Nähe der Verkaufsbuden gelegen haben mag; infra panaria in platea rosarum 1607; apud panistra 1627; zwei Wohnbuden cum cella heißen 1651 penes tabulas panarias, nostratibus [= vulgariter] den brodtbäncken sitas; in acie pennarii 1657; prope forum panum 1667. An der Nordseite der Brodbänke schlossen sich unmittelbar an das Eckhaus am Markte, den sog. Schütting (s. Seite 73), drei kleine städtische Häuser an, die, als Dienstwohnungen für die Rathausdienerschaft benutzt, im Jahre 1731 auf Betreiben der Regierung verkauft wurden; sie waren erbaut 1466 achter dem schütting; 1483 domunculae ad domum schuttinge pertinentes in platea qua descenditur a foro versus aquam. Zu vergl. Rosenstraße. Der Plan von 1765 bezeichnet beym Brodbänken die Straße vom Markt bis zur Ecke der Rotenhahnstraße. In Danzig Brotbänkengasse und Brotbänkenbrücke; Brodschrangen in der Altstadt Hamburg; in Rostock by den brotscharen 1483, apud macellos panum 1274. An den Krummstücken Ratsbeschluß vom 27.8.1981. Bei dem Straßennamen handelt es sich um eine alte Flurbezeichnung der Gemarkung Ochtmissen im Bereich des Lerchenberges. An den Reeperbahnen Kein Ratsbeschluß. Seit Juni 1914 für den Verbindungsweg zwischen der Lindenstraße und Wallstraße, an welchem 1913 das Evangelische Gemeindehaus errichtet worden ist. Zu vergl. unten Lindenstraße. An der Nordseite der Straße, gegenüber dem Eingange zur Volgerstraße, lagen bis 1909 die Reeperbuden mit der nördlich sich daran anschließenden Reeperbahn. Den dazugehörigen Platz dede light vor unser stad buten dem roden dore by sunte Ghertruden capellen erwarb der Rat 1430 vom Pfarrer der Johanniskirche; das Bauamt bezog wegen der reperboden uffm sültzkampf jährlich eine Abgabe. Reifferbahn vor dem Roten tor im Sechzehnhundert. Auf einem benachbarten, an das Hospital zum Großen Hl. Geist verpachteten Anger exerzierte im Frühjahr und Herbst fast täglich die Miliz und zertrat das Gras (nach 1700). Es gab acht Reepschläger in Lüneburg und ebensoviele Buden, 1660 wurde um eine neue Bude vor dem Lünertore nachgesucht, tatsächlich bestand auch dort, östlich vom Altenbrückerdamm, bis zur Erbauung der Schienenstraßen eine Reeperbahn. In Danzig bildeten die Reeperbahnen einen der ältesten Teile der Niederstadt, W. Stephan weist mit Recht darauf hin, daß das Amt der Reeper, die auch Schiffstaue 62
herstellten, in keiner Hafenstadt fehlte; pl. funificum sive reperstrate daselbst 1357; jetzt Röpergasse; in Hannover die Zelewinderstraße 1441, in Lübeck by den repermuren 1572. An den Vierorten Neuerdings nur noch zur Unterscheidung der einen Salzstraße von der andern in Gebrauch; bis 1866 selbständiger Straßenname, zuletzt außer für die vier Eckhäuser am Schnittpunkte der Grapengießer-, Altstadt, Salzstraße und Neuen Sülze gültig auch für die von dort ausgehenden beiden Häuserreihen der Neuen Sülze bis zur Schrangenstraße, während die Stadtpläne von 1765, 1794 und 1802 vielmehr dem unteren Teile der Altstadt (östlich dem Eingange zur Rübekule) die Bezeichnung auf den 4 orten (up den veer ören) zuerkennen. Ort ist der Winkel, die Ecke, wo sich zwei Straßen ohne platzartige Verbreiterung kreuzen (orthûs, Eckhaus) – ein in neueren Stadtteilen sehr häufiger Fall, in der Altstadt Lüneburg etwas Besonderes, da die Straßen sonst auf eine Häuserreihe münden oder sich in einer schmalen Gasse fortsetzen. Eckhaus Pattensen-Brunes super quatuor angulos vulgariter uppe den veer orden nuncupatos ... in platea salis versus s. Lambertum 1452; dat Roggelandes husz ichteswanne genomed by den ver orden 1461; der Knappe Bodendorf verkaufte Haus und Buden apud quatuor angulos 1461; in der yodenstrate by den veer orden 1468; uppe den veer orden Verkauf von schonroggen durch einen Hausbecker verboten 1470; etliche Bürger wohnten uppe und by den veer orden und unterhielten gemeinsam einen Brunnen (born) daselbst 1473; prope quatuor angulos vulg. nuncupatos de veer örde 1474; ein Wohnhaus uppe de ver orden in der Soltstraten 1484; in der Soltstrate by den veer orden 1486; prope quatuor acies in platea salinari 1488; uppe de orde wurde 1488 ein Ratserlaß über die Tracht der losen Frauen angeschlagen 1488; Haus des Tile Luders zw. Henning Hugh dem Jüngeren u. Hans Bartolomeus boven den veer orden alsze men uppewart gheyt na sunte Michaele 1489; eine neu erbaute Bude boven den veer orden uppe der Oldenstadt 1492; platea iudeorum prope quatuor acies 1498; Mester Andreas Schatten barberer bode by den veer orden, baven den veer orden 1508; dat hus uppe den veer orden wurde von den Barmestern verliehen 1535; eine wüste Stätte uppe den veer orden tiegen de Rövekulen bolegen; auf den vier orthen 1585; in quadrivio adversus macellarem plateam 1625; pl. quadrivium nominata 1656; ad plateam quatuor huius civitatis angulorum 1663; in quadrivio 1679; uf den 4 örten in Steckers Hause hatte der † Angerstein gewohnt, ein Goldschmied 1697; ebendort in des † Schusters Tiesz Meyers Hause wohnte 1697 der Goldschmied Christof Julius Koch. Die Vierorte sind wohl auch gemeint, wenn es heißt, daß der Rat seine Anschläge uppe de orde anschlagen ließ 1491. Zu vgl. auf der Rübekule. An der Beeke Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Der Name weist auf einen kleinen Bach in der Nähe der Straße hin (mnd. beke = Bach). An der Buchholzer Bahn Kein Ratsbeschluß.
63
Die Straße verläuft parallel zur eingleisigen Bahnlinie Lüneburg – Buchholz und wurde nach diesem Verkehrsweg benannt. Der Name wurde nach der Eingemeindung Ochtmissens übernommen. An der Feuerwehr Ratsbeschluß vom 29.11.1984. Der Name erinnert an das an dieser Straße befindliche Feuerwehrgerätehaus von Häcklingen. An der Hauskoppel Ratsbeschluß vom 29.10.1982. Der Straßenname greift eine alte Flurbezeichnung auf. An der Münze Kein Ratsbeschluß. Inmitten der Ostseite der Straße fällt ein mit bunt glasierten Köpfen geschmücktes Reihenhaus des Fünfzehnhunderts auf, lange Zeit angesprochen als städtische Münze, die dem jetzigen Straßennamen zwar seine Entstehung gegeben hat, jedoch gegenüber lag im Hause Nr. 3. Das Haus Nr. 6 war die Apotheke Radbrocks, Vaters des letzten Scharnebecker Abtes. Ein Leonhard de münter (der herzoglichen Münze) war Mitglied des Rates schon 1219; Erwerbung der Münze durch die Stadt 1293. Zimmerleute und ein Mauermann arbeiten uppe der munte 1438 und 1446; ein Sod wird daselbst gebaut 1444; inter domum habitationis Meyneken Sanckensteden et monetariam nostre civitatis in platea sartorum 1445; eine größere Summe wurde 1465 verbaut an mester Godderdes huse up der münte an enem nigen müntehus; uppe der munte husz wurde in kritischer Zeit eine besondere Wache unterhalten 1487; Elisabeth Bromsen kaufte ein Haus inter domum monetalem et stateram nostrae civ. in platea sartorum 1569; ein stadlich hausz bey der münz gehörte zum Vermögen des Steffen Loitzen 1576; in platea monetaria 1677; das Münzhaus, um 1500 und 1640/1 nachweislich vom Münzmeister auch bewohnt, wurde 1732 als Ratshaus an J. Chr. G. Gakenholz aufgelassen und erhielt 1794 acht Freijahre wegen Hausbaus; das Gebäude der Bürgerschule an der Südwestecke kaufte die Stadt 1856 vom Justizbürgermeister v. Dassel für 8000 Reichstaler. Auf der neuen Münze 1765, 94 und 1802; Münze 1819; auf der Münze 1850. An der Ratsforst Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Der Name greift eine alte Flurbezeichnung auf. An der Roten Bleiche Kein Ratsbeschluß. Das rot dieser und aller entsprechenden Straßenbezeichnungen hat mit dem Ziegelrot der Häuser oder des einstigen Tores nichts zu tun, noch weniger mit dem roten Blute, das in der Ursulanacht den Boden ringsum gefärbt haben soll. Roden ist der bekannte Ausdruck für urbar machen, das Rote Tor führte hinaus zur Ackerflur des Rotenfeldes, und an dieses schlossen sich, nach dem in zahlreichen Windungen 64
dahingleitenden Flusse zu, ausgedehnte Gärten und Wiesen. Nach Volger wurde die Rote Bleiche vor 1700 angelegt, d. h. wohl erneuert, durch Bgm. Reinbeck 1797 an die Stadt verkauft, gelangte aber um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wieder in Privatbesitz (Gerstenkorn-Fehlhaber). Gelegentlich der großen Wäsche zogen früher die Frauen der einzelnen Lüneburger Haushaltungen mit Mundvorrat zu einer der Bleichen hinaus, um den ganzen Tag draußen zu bleiben. Haus, Hof und Scheune am Blekerwege 1585; extra portam rubram prope insolatorium 1632; extra portam rubram e regione fulluniae rubrae 1641. Das Adreßbuch zitiert den Namen an der Rotenbleiche seit 1869. An der Schule Ratsbeschluß vom 30.11.2000. Mit dem Straßennamen wird an das nahegelegene Schulzentrum Oedeme erinnert. An der Wittenberger Bahn Ratsbeschluß vom 29.11.1984. Mit der Benennung soll sowohl auf eine historische Verbindung des Streckennetzes der Deutschen Reichsbahn in der DDR und der Bundesbahn hingewiesen werden als auch auf eine nicht nur im Zonenrandgebiet besondere Prägung innerdeutscher Beziehungen verkehrsgeografischer Art zwischen Lüneburg und Wittenberge. Die Bezeichnung trägt auch der geschichtlichen Entwicklung des Eisenbahnnetzes Rechnung. Sie erinnert daran, daß die heutige Bezirkshauptstadt Lüneburg schon vor mehr als hundert Jahren auf dem Schienenwege direkt mit der damaligen Reichshauptstadt Berlin verbunden war. Apfelallee Ratsbeschluß vom 16.12.1982. Nachdem die Verbindung von Kaltenmoor und Hagen bereits im Volksmund „Apfelallee“ genannt wurde, erhielt sie auch offiziell diesen Namen. Apothekenstraße Kein Ratsbeschluß. Der Name Apothekenstraße kommt in mittelalterlichen Quellen Lüneburgs noch nicht vor - in den Schoßrollen von 1462 ist die entsprechende Bezeichnung a c h t e r (Hinrik) H o y e m a n n e -; er konnte in seiner jetzigen Bedeutung erst aufkommen, als die Ratsapotheke von einem anderen Hause der Großen Bäckerstraße (Nr. 5) an ihren heutigen Platz verlegt wurde. Das geschah gegen 1525, und die Ableitung des Straßennamens mag sich schnell gebildet haben, zumal als das gegenwärtige, monumentale Apothekengebäude im Jahre 1598 erstanden war. Pharmacopolae platea 1630; platea apothecae 1636; platea apothecaria 1649; die Apoteken Straß 1632; platea pharmacopolio adiecta, pharmacopolii nostri 1661. Arenskule Ratsbeschluß vom 4.4.1944. Alte Flurbezeichnung, von Gebhardi 1794 aufgeführt. 65
Arthur-Illies-Weg Ratsbeschluß vom 23.11.1989. Mit dem Straßennamen soll der Maler Arthur Illies (1870-1952) geehrt werden, der seit 1934 in Lüneburg lebte und einen nicht unwesentlichen Teil seines Schaffens Lüneburg widmete. Artlenburger Landstraße Ratsbeschluß vom 4.4.1944. Die Verlängerung des Lüner Weges von der Abzweigung der Erbstorfer Landstraße wurde nach der Eingemeindung des Ortsteiles Lüne so benannt. Auenweg Ratsbeschluß vom 30.11.2000. Aue meint ein Gewässer oder ein von Wasser begrenztes Gelände. Der Name greift die Nähe des Hasenburger Baches auf. Auf dem Harz Kein Ratsbeschluß. Die zugrunde liegende Lesart ist auf dem Hare. Hâr, hôr (Harburg und, tautologisch gebildet, Dreckharburg) ist die mittelniederdeutsche Bezeichnung für Schmutz, Schlamm, wie er sich in unmittelbarer Nähe der Saline infolge des lebhaften Wagenverkehrs reichlich genug entwickeln mochte. Im Fünfzehnhundert finden wir den Familiennamen uppem Drecke. Auf dem Hare fand in den ältesten Zeiten der Verkauf des frisch gesottenen Salzes statt, hier wurde an der Gerichtsstätte bei den Steinen vom herzoglichen Vogte die Gerichtsbarkeit über den Salingüterverkehr ausgeübt. Coram nobis ad lapides, ad lapides secundum loci consuetudines 1282. Die Benennung bei den Steinen könnte darauf hindeuten, daß der Teil des Platzes, der als Gerichtsstätte diente, gepflastert war; so hieß in Hildesheim ein ganzer Stadtbezirk auf den Steinen – wahrscheinlicher, daß die Gerichtsstätte als solche durch aufgerichtete Steine gekennzeichnet wurde. Andere Steine sind wohl gemeint, wenn es um 1430 im Barmeisterbuche heißt: die Sülfmeister, die Holz kaufen wollen, sollen stehen bij den steynen, dede ligghen bij dem orthuse, alse men gheid ute dem sultedore to der vorderen hant. Ein Haus bi der sulten up dem Hore wurde verkauft 1414. Im Jahre 1454 ließen die Barmeister anfertigen den blok uppe deme hore mit der isernen mate to der lenghe des vatmen holtes. 1456 hatten die Sülfmeister dat schur baven der bank vor einem Hause up dem hore über dreißig Jahre in Besitz und Besserung erhalten, so daß ihnen dieses Vorrecht weiterhin zugestanden wurde – na deme schure unde benke nemand maken mod sunder orlof des rades; im gleichen Jahre bauten die Barmeister der sulfmester hus up dem hore; hier handelte sich’s um den Ausbau eines gekauften Hauses; ein Steinweg wente to deme dare alse men uppe dat hare vardt wurde ebenfalls durch die Barmeister angelegt 1490, dsgl. ein Steinweg van deme darhare alsze men uppe de zulten geyt wente to deme grave des huses Denckqwering. Das Barmeister Haus uppe dem hare, für das die neuen Sülfmeister zu zahlen hatten, wurde als sehr baufällig 1518 veräußert.
66
Für die dhore uppem hare wurde 1487, als man den Besuch des dänischen Königs erwartete, vom Rate angeordnet, daß sie dach unde nacht tostan sollten; die Provisoren der Lambertialmosen verkauften ein Haus mit 4 Buden infra casam der barmestere et casam Hinrici Tobinges iun. uppe dem hare 1493; up dem här 1501; Meyneke Schellepeper kaufte 5 Buden uppe deme hare prope salinam 1500. Von alters bestand die Gewohnheit, täglich uppe dem hare vor der zulten den Kauf des Lün. Salzes zu setzen, d. h. den Preis zu bestimmen. Up dem haer ante portam salinarem 1530; ante valvam salinarem in platea que vulgariter up dem hare appellatur 1538; auf (uf) dem haar 1609; auf den haart 1794; der Harz 1802. Ist die Benennung auf dem Harz wohl eine unabsichtliche Verballhornisierung des nicht mehr verstandenen Grundwortes, so scheint eine absichtliche Verschleierung vorzuliegen beim Namen H a r z k e h r , der sich noch in den Adreßbüchern 18621866 findet. Er galt für ein sehr schmales Gäßlein, das sich hinter dem Harz an der Sülzmauer versteckte. Gebhardis Plan und auch unser Plan von 1802 führen noch den älteren Namen, und dieser zeichnet die Belegenheit mit derber Anschaulichkeit als arskerwe oder arskarbe – in urwüchsiger Übereinstimmung mit verwandten Städten (Stralsund: erschkerne später Kernestraße; Rostock: erskerne jetzt Kronnenstraße; Wismar: in der erskernen 1446, mit einer Ausbuchtung gen. hasenleger, auch Arnstcarbestraße, im Düstern; Lübeck: arschkerbe, (amtlich Kronstraße). Auf dem Kauf Kein Ratsbeschluß. Plan von 1765 und 1794 im koop; 1802 auf dem Kauf; Schoßrolle von 1819 am Kauf; 1850 auf dem Kauf. Die Erklärung des Namens führt Gebhardi wohl mit Recht auf den Salzverkauf des Weißladers am Wasser zurück; sommergoßen Salz sollte nicht zu Lande versandt werden idt en sy denne by deme Kope gekofft 1504; Salz nach Bremen und Verden uth neynen rumen to stotende sunder idt zy vam Kope genamen und nicht anders 1519. Der koopbarg in Lübeck kann hier nicht herangezogen werden, da er ursprünglich koberg heißt. Das Adreßbuch 1860 unterscheidet von der Lünerstr. bis zum Berge l. und r. Das westliche große Eckhaus an der Lünerstraße gehörte bis in die dreißiger Jahre des Achtzehnhunderts dem Kloster Lüne, und zwar seit 1356; die Kaufurkunde dieses Jahres bezeichnet das Grundstück ex opposito domus Joh. de Pentze bzw. ex opp. novi pontis, Käufer waren Propst, Priorin und der ganze Klosterkonvent, Verkäufer Hinrik Viscule bzw. der Rat; in domo prepositi in Lune 1437. Nach einer Originalurkunde des Museums von 1577 verfügte Herzog Wilhelm über das Lüner Haus, ehemals im Besitz des Lüner Propstes Joh. Lorber, als über ein Erbmannlehen der Zöllnerfamilie Lutterlo, zu vgl. auch Museumsurkunden von 1637 und 1677. Das Lünische Haus wurde 1749 vom Kloster in Erbenzins gegeben an Jacob Albers. Ein anderer Lüner Hof lag neben einem Medinger Klosterhofe; er wurde von diesem abgetrennt 1318 und (oder ein dritter?) 1330 wieder veräußert. Der Plan von 1802 notiert auf der Westseite der Straße die (Herbergen) weißes Roß und im (schwarzen) Elephanten. V o l g e r s H o f und der nahe C o r d e s Hof sind nach ihren Eigentümern im dritten Viertel des vorigen Jahrhunderts so bezeichnet. Auf dem Kirchstieg Ratsbeschluß vom 30.11.2000. 67
Auf dem Kauf Nr. 13
Kirchlich gehörte das Dorf Oedeme zu St. Michaelis/Lüneburg. Der Name erinnert an den Weg vom Dorf zur Pfarrkirche. Auf dem Klosterhof Kein Ratsbeschluß. Der Klosterhof bezeichnet eine Belegenheit des ehemaligen Marienklosters. Dieses wurde durch Herzog Otto das Kind auf dem Gösebrink, angeblich einer unwegsamen, rings von schlammigem Wasser umgebenen Erhebung noch außerhalb der Stadt, begründet (1229), extra muros, mons pervius undique aqua lutosa circumdatus in qua aqua natabant auce et aucte ceteraque volatilia terre; ob it locus iste vulgari vocabulo et nomine nominabatur de gösebrink. Auf alle Fälle gewann dieser Gänsehügel infolge der Entstehung der Neustadt mit dem Neuen Markte in unmittelbarer Nähe des Rathauses eine sehr bevorzugte Lage. Klostergebäude und zugehöriger Platz fielen in der Reformationszeit an die Stadt, die von den letzten Mönchen erst im Jahre 1554 verlassen wurde. Der Rat benutzte die Klosterbaulichkeiten zur Unterbringung seiner Bücherei und als Witwenwohnungen. Nach einem Vermächtnis der Familie von Stöterogge wurden 90 M ausgesetzt to underholdunge eyner christlichen tuchtscholen szampt deme gebuwte im Franziskaner closter, sie wurden ausgezahlt an die Vorsteher Ulfrauenkloster 1557; Armenhaus 1675; Zucht- und Waisenhaus 1700. Abkündigung wegen des nunmehr zum Stand gebrachten Werckhauses (auf dem Klosterhofe, zur Annahme von Bettlern sowie mutwilliger und müßiggehender Jugend) 1676; die Witwe eines Glasers wohnte 1678 auf dem closterhofe. Im Siebenjährigen Kriege wurde in den Häusern des Klosterhofes ein französisches Hospital eingerichtet, 1811-1813 befand sich dort ein Korrektionshaus für das Departement der Elbmündung. Ältere Bezeichnung Zuchthof (1819-1850). Ein Haus des letzten katholischen Propstes von St. Johannis, Joh. Koller, lag 1529 prope fratres minores. Plan von 1794 Klosterhof, 1802 auf dem Klosterhof; an dessen Eingang mit dem Rücken gegen den Giebel der Stadtbibliothek ist dort eine Bürgerwache eingetragen. Nicht sicher unterzubringen ist die Benennung auf dem Brinck. Nach den Bauamtsrechnungen von 1641 und 1643 vermietete die Stadt Wohnungen beim Marstall und auf dem Brinck; uffm Brinck lag auch ein vom Steinhauer bewohnter Turm. Gebhardi nennt den Brinkplatz beim Marstall. Auf dem Knieberg Ratsbeschluß vom 30.11.2000. Der Straßenname übernimmt einen überlieferten Flurnamen, der auch schon für die Benennung einer benachbarten Schule herangezogen wurde. Auf dem Meere Kein Ratsbeschluß. Der Name der Straße wird seit langem mit einem von den Quedlinburger Annalen sowie von Thietmar von Merseburg zum Jahre 1013 überlieferten Erdrutsch in Verbindung gebracht; er könnte freilich auch aus der bloßen Erfahrung entstanden sein, daß jene Gegend vor Durchführung der Kanalisation nach heftigen 69
Regengüssen allemal lange Zeit unter Wasser zu stehen pflegte; ein nur mit Brettern bedecktes Siel, das in der Höhe der Post das Wasser über Wagestraße und Markt unterirdisch abführte, war unzulänglich. Gebhardi erklärt die über das Meer aufgedämmete Straße, er bringt aber irrigerweise die Straße Am Iflock damit in Zusammenhang mit den Worten nördlicher ist eine andere Gasse, die das Neue Loch heißt. In mari 1303; das Michaeliskloster kauft 1304 einen Hof in vico qui mare dicitur; die v. Meding verkaufen einen Bauplatz in una platea que vulgo dicitur uppe deme mere 1338; das gen. Kloster erwirbt zwei auch ferner der Stadt pflichtige Häuser in platea que mare vulgariter appellatur 1343; Hermann v. Meding verkauft einen halben Hof supra mare 1349; Häuser des Klosters Scharnebeck liegen versus antiquam civitatem in platea que mare dicitur, cum itur de cymiterio b. virg. Marie ad sinistram manum 1355; supra mare prope domos dominorum de Schermbeke 1358 und 1389; platea quae dicitur supra mare iuxta mon. s. Mych. de novo construendum 1377; in mari 1381; super mare neben dem Scharnebecker Hof 1388 (iuxta curiam monachorum de Schermbeke versus orientem 1386), Diderick Raven durfte in seiner Bude uppe deme Mere bei dem von der Stadt Burmester bewohnten Hause des Rates eine Esse anlegen 1453; platea maris 1473; Lindemanns Hof uppe deme Mere 1476; ein Wohnhaus uppe deme Mere am Orde by mester Gobelen wonhuse und des Bischofs von Verden Hof 1489; twysken der koke to L. und aver der straten Hans Paelden huseren up deme mere 1523; in acie maris ex adverso eccl. dive virginis 1530; uffm Meer 1611; in mari adversus locum qui dicitur stegen [steiler Weg, Treppe] et scholam s. Mich. 1618; Brauhaus Radeke und zugehörige 6 Buden auf dem Meer an der Ecken der Altenewen strassen 1623; prope monasterii Michaelitanae portam in superiori maris parte 1672. Die sog. Neue Apotheke auf dem Meer, zuletzt vermietet an David Johan Heydahl, wurde 1737 seitens der Stadt verkauft. Volger erwähnt das Haus der Amtmannin Meyer, erbaut 1855 (Nr. 5), das Eckhaus gegenüber St. Michaelis 1866, und nennt auffallend das 1869 erbaute Haus des Maurermeisters Schorch (Nr. 41), welches in Spitzen Winkel ausläuft. Auf den Meer Plan von 1765; Meer mit Clubhaus an Stelle der heutigen Post, v. Töbings Hof an derselben Seite und der Kuhle diesem Hof gegenüber 1794; 1802 auf dem Meere; am Meere 1850; auf dem Meere 1860. Zu vgl. Hinter dem Brunnen. In Danzig schwarzes Meer 1695. Auf dem Michaeliskloster Kein Ratsbeschluß. Einer zu Ehren des Apostels Matthaeus, des Cosmas und Damianus errichteten Vikarie in concigno monasterii ac cimiterii nostri ad austrum tut der Michaelisabt 1346 Erwähnung; hier ist natürlich das alte Kloster auf halber Höhe des Kalkberges gemeint, das dem Ansturm des Erbfolgekrieges im Jahre 1371 zum Opfer fiel. Die jüngeren Quellen beziehen sich auf den Neubau im Innern der Stadt. Citra (iuxta, prope) locum illum in quo nunc monasterium s. Michaelis construitur, debet construi 1376 und 1377; iuxta mon. s. Mich. de novo construendum 1377; prope mon. s. Mich. 1398. Von den neuen Baulichkeiten stehen der abbedye vorwerk unde itlich ander buw des . closters auf einem alten Burgmannengrundstück 1401; ein Bretterzaun um den Klosterhof herum, dede geyt umme eres closters hoff unde ereme badehusze an by der stadt muren, wurde 1422 angelegt; er sollte auf Begehren des Rates durch eine Mauer ersetzt werden; ex opposito domus prioratus s. Mich. iuxta murum 1433; Wasmod v. Meding verkauft dem Erbauer des 70
Kirchturms, Abt Boldewin von Wenden, dat achterste buw dar de thorne ynne licht myt deme rume dat dar schutt in synen hof by syneme vorwerke und gehoret heft to myneme wonhuse . vor deme nygen dore 1436. Auf dem St. Michaeliskloster 1860. Eine Töpferei hinter dem Kloster wurde 1453 angelegt; de rad orlovede Ludeken Groper, dat he by der van sunte Michelen priveten hinder deme closter mochte eyn rum betunen, darinne he putte mochte maken unde bernen; uppe dem Tymmerhave to sunte Michel sollten jährlich zweimal Armenspenden verteilt werden (1499 Test. des Meyneke Snewerdinge). Zu der aus dem Michaeliskloster erwachsenen Ritterschule gehörten nach Manecke ff. Wohngebäude: Organisten-, Pförtner- und Ofenheizerwohnung, Abtei als Wohnung des Landschaftsdirektors, Ausreiterwohnung – am 4. Aug. 1872 starb der letzte Ausreuter des Klosters, Otto v. Bülow, der bis dahin seine alte Dienstwohnung bewohnte -, Reithaus nebst Bereuterwohnung, die Wohnungen für den Inspektor, die Hofmeister, die Schüler, den Koch, die Tafeldecker und den Küchschreiber, alles mit einander in Verbindung, endlich die Wohnung für den Gerichtsdiener im Fuß des Kirchturms (Amtsgerichtsstube). Auf Gebhardis Plan ist westlich des Reithauses jenseits der Straße achter der abtey eine Reitbahn eingetragen und westlich daran anstoßend ein Stuccadeurofen. Bau des Reithauses am Kloster 1824/6; Amtsgerichtsgbäude 1857/62, Ostern 1862 bezogen. Die nach Aufhebung der Ritterakademie (1850) für ein Schullehrer-Seminar eingerichteten Gebäude wurden 1916 abgebrochen. In den Bauamtsrechnungen geschieht im Vierzehnhundert wiederholt eines Mönchsganges Erwähnung, der von Wächtern begangen wurde und dem Michaeliskloster nahe gelegen haben muß. 4 M den wechteren up der moneke ghanghe van dem 8. unde dem 9. iare 1409; item 24 ½ s. kostede de wech to beterende dar de wachter inne ghad van der monnekeghanghe wente vor dat Bardewiker dor 1424; item 21 s. ghewe wy vor enen bone wedder to makende de invallen was in dem torne up der monekeganghe van sunte Mychahele 1425. Auf dem Schmaarkamp Kein Ratsbeschluß. Seit 1922 unter Aufnahme einer alten Flurbezeichnng. Das Wort schmar (smeri, smer) bedeutet fetten Boden. Auf dem Wüstenort Kein Ratsbeschluß. Ort ist hier nicht = Ecke, sondern verstümmelt aus wort = Platz, Bauplatz; wûste, wôste ist wüst, verlassen unbebaut; letztere Bedeutung scheint darauf hinzuweisen, daß hier inmitten der Stadt, d. h. zwischen Altstadt, Neustadt und Modestorpe, am längsten unbebautes Gelände zur Verfügung stand. Ein Wohnhaus lag in vico qui dicitur wuste wurd 1419; super deserta area 1428; wusteword 1431; ein Einwohner verkaufte einem Bürger eine Bude in loco vulgariter dicto de wüste word 1442 (entspr. Haus mit dreizehn Buden 1445); uppe den sponen 1480 im Wasserviertel; Wohnungen, Höfe des Bürgers van der Mölen uppe den sponen genomet, angande by dem Hilgendal wente uppe de wusten wurd an der sydersiden 1490; Bude zwischen Buden in area deserta vulgariter der woesten worth 1527; Cordt von Jettebrocke verkaufte seine ererbte Bude nunptlick de wüste worth bolegen by deme 71
Hilligendale 1528; derselbe, Präfekt in Uelzen, verkaufte sein Haus samt vierzehn Buden zwischen einer Bude und einem Hause der Johanniskirche in acie der wöesten worth ex adverso monasterii Hilghendal 1529; zwei Buden in platea que area desolata vulgariter de wüse wort appellatur 1538; in wustenworth 1636; auf der wusten wordt 1651; in loco vulgo wustenworth dicto non procul a porta postica aedum dominae in Meding 1674, vgl. S. 74 ff.; Auf dem Wüstenwordt 1765; wöste wohrd 1794; auf dem Wüstenort 1802; das Adreßbuch 1862/63 fügt hinzu vom Stadtbauhof bis zur Münzstraße r., von der Münzstraße bis zur Zollstraße l.: 1869 wird der S t a d t b a u h o f (1860 auf dem Stadt-Bauhof) gesondert aufgeführt und die Straße vom Bauhofe bis zum Berge r. bzw. vom Berge r., die auf dem Plan von 1802 beim Bauhof heißt, zur Straße auf dem Wüstenort hinzugenommen, während die Adreßbücher bis dahin unterscheiden auf dem Wüstenort und nach dem Wüstenort. In Braunschweig by der wosten word 1401. Auf den Blöcken Ratsbeschluß vom 29.8.1996. Die Bezeichnung für die Straße im Industriegebiet Hagen nutzt eine alte Flurbezeichnung. Auf den Sandbergen Ratsbeschluß vom 21.2.1951. Alte Flurbezeichnung in der Neuhagener Gemarkung, südlich der Bundesstraße 216. Auf der Altstadt Kein Ratsbeschluß. Der Begriff Altstadt, seit Jahrhunderten geläufig für den Straßenzug von den Vierorten bis bei der Michaeliskirche, läßt seinen ursprünglichen, weiteren Sinn in alten Urkunden noch wohl erkennen. Der Pfarrer von St. Cyriak hieß plebanus veteris civitatis 1310, und es gab eine Mariengilde in der Altstadt, congregatio sancte Marie in antiqua civitate, c. 1360 – natürlich war weder der Geistliche in seinen Befugnissen, noch die Gilde auf eine einzelne Straße angewiesen. Die Alte Stadt lag hart am Fuße des Kalkberges, nach Osten hin. In einem der Privilegien, welche der Lüneburger Rat vor seinem Anschlage gegen das Bergschloß von den Herzögen Wenzel und Albrecht von Sachsen erwirkte, heißt es (1371 Januar 6), die Ratmannen und Bürger sollten befugt sein, zwischen der Burg und der Stadt soviel, als ihnen gut dünke, van der olden stad durch Mauern und Gräben abzutrennen und die ausgeschiedenen Baulichkeiten niederzubrechen. Wenige Jahre später (1373 Nov.) wird berichtet, daß inzwischen der größte Teil der Altstadt zerstört worden war, so daß die erwähnte älteste Pfarrkirche, St. Cyriak, die nun außerhalb der Mauern lag, ihre Gemeinde fast eingebüßt hatte. Ein Hof der Burgmannenfamilie Kind, der im Jahre 1368 an das Michaeliskloster gelangte, lag damals by sunte Cyriakes kerchove in der olden stad to Luneborch; auch der Lange Hof, an der Ecke Techt- und Salzbrückerstraße, lag bei seiner Gründung (1382) in antiqua civitate. Es folgt daraus, daß alle Quellenstellen, welche die Ortsbezeichnung Altstadt anwenden, mindestens das ganze Dreizehnhundert hindurch nicht ohne weiteres auf die jetzt also genannte Straße beschränkt werden dürfen; der Begriff ist einerseits 72
umfassender, andererseits enger, insofern der untere Teil der Straße auf der Altstadt seinen heutigen Namen erst im Fünfzehnhundert angenommen hat (vgl. Judenstraße). Nach Jürgens ist die Altstadt schon 1250 als solche bezeichnet. Zur Ergänzung des Vorstehenden folgende Belege. Ein Einwohner von 1291, ein Ratmann von 1297/99, ein Neubürger des Jahres 1320 u. a. führen den Zunamen de antiqua civitate; antiqua civitas oder oldestad schlechthin hießen Neubürger von 1308 und 1380. Die Witwe des Ratmanns Verdeward vermachte 1307 ihr Wohnwesen in antiqua civitate dem Michaeliskloster; in der Nachbarschaft lag ein Hof des Ritters und Burgmannen Johannes Ursi. Der Knappe Gyr verkauft seinen Hof in ant. civ. an den Knappen vom Berge 1346; zwei vom Berge verzichten auf ihren Anspruch super via et transitu que est inter murum civitatis et curiam in ant. civ. 1347; zwei Brüder Grevingh, Knappen, verkaufen 1356 ihren Hof in antiqua civitate dem Prior desselben Klosters. Das Kloster Wienhausen soll nach Manecke auf der Altstadt ein Haus besessen haben. Erläuternde Zusätze zu der Bezeichnung in antiqua civitate sind zwischen einer Badstube und einer Gasse, gen. de hole ek 1356; prope truncum S. Georgii 1358, ex opposito trunci s. Georgii 1361 – es war wohl ein Standbild des Heiligen in Verbindung mit einem Opferstock, der ursprünglich vielleicht milde Gaben zur Bekämpfung der Heiden aufnahm; ähnlich 1384 prope truncum sancti Georgii in veteri nostra civitate; beim St. Jürgensblock in der Altstadt fielen in der Ursulanacht ein Sülfmeister und zwei andere Bürger. In der Altstadt standen Fischerschrangen, in angulo prope scampna piscatorum 1354. Eine um 1360 ergangene Marktordnung regelte die Verkaufsplätze für den Michaelismarkt, der in jener Zeit im oberen Teile der Altstadt sich entfaltete, u. a. boten die Lüneburger Bürger, die grobes Tuch schneiden wollten, feil byd tho der stegelen alzo me geyt in sunte Cyriakes kerken; die Händler mit englischem Tuch stunden van dem orde, dar Vridach ynne was, by der strate de se Teche het, vortan in beyden siden der strate bet to Johan Roggen hus; in antiqua civ. prope teghthe 1356; prope puteum 1360; in veteri civ. versus valvam 1385; in veteri civ. prope puteum situm ante novum manasterium s. Mich. 1398. Die deutsche Ortsbezeichnung uppe der oldenstat finden wir zuerst 1347; in loco nostre civ. nuncupato de oldestat 1391; by der oldenstadt 1395. Vom vorerwähnten St. Jürgensblock wird auch ausgesagt, daß er vor der Altstadt gestanden habe prope truncum s. Georgii ante antiquam civ. 1356; by sunte Jurgens blocke vor der oldenstat 1394 und 97. Ante (prope, circa) ant. civ. kommt von 1350-56 häufig vor – dort wohnte neben einem Messerschmied ein Schwertfeger Hinrik von Zalsa und ein Magister Johannes. Häuser des Klosters Scharnebeck auf dem Meere lagen vom Marienkirchhofe aus linker Hand versus ant. civ. 1355, desgl. ein Haus nahe dem Sande 1382. Ein steenweg uppe der oldenstadt (1402) wurde von den Wandschneidern unterhalten. In superiori parte civ. que dicitur antiqua civ. 1425; supra (super) ant. civitatem lag eine Badestube 1438; bij der joden schole uppe der oldenstadt 1450; uppe der jodenstraten orde Clawes Schutte 1451; die Judenstraße mit der Synagoge 1474. Uppe der oldenstad sollten die Mönche von St. Michaelis die Straße reinhalten jegen Hemeslingens dore, by ereme kerkhove und by erer schole (um 1430); jegen sunte Micheliskerckove over up der Oldenstad 1449; unser leven frowen gilde, de me up der oldenstad plecht to holdende 1451; Wohnhaus uppe der Oldenstad uppe deme orde neffen sunte Michelisschole over 1481; in platea vulgariter dicta de Oldestadt 1486; uppe der Oldenstadt uppe dem orde neffen sunte Michaelisschole 1493; in antique civitatis platea qua itur ad novam portam 1513. Oben auf der Altstadt, vom Rathause aus gedacht, lag auch ein Eckhaus gegenüber der Rübekule. Das mestershues der Herren von St. Michaelis upper oldenstadt 1517; 73
uppe der oldenstadt neffen der rövekulen over gehörte bis 1520 eine wüste Stätte dem Kapitel zu Ramelsloh; in antiqua regione 1610; antiqua platea 1612; in ant. civ. ad apicem prope scholam s. Mich. 1628; in urbe veteri 1680. Die Pläne von 1794 und 1802 beschränken den Namen up der olen – auf der Altstadt – auf die Strecke von der Ohlingerstraße bis zur Michaeliskirche. Auf der Höhe Kein Ratsbeschluß. Seit Ausgang 1924 für die beherrschende, im neuen Wohnviertel damals angelegte, in der Richtung Schnellenberg führende Straße. Auf der Hude Kein Ratsbeschluß. Die Hude in der Nähe des Außenhafens am linken Ilmenauufer ist auf allen älteren Stadtplänen als Holzlagerplatz (de holthude) deutlich gekennzeichnet. Sie befand sich im Eigentum der Stadt, die auf eine ständige Einnahme daraus rechnen konnte, und nahm vornehmlich das Holz auf, das auf der Wasserstraße herangebracht wurde; item locus holthude dictus 6 M (1302); entsprechend wird in der Kämmereirechnung von 1330 eine Einnahme de hude angeführt. 1400 lagerten up der hude 3870 Faden Holz; 1410 buchen die Bauherren eine Ausgabe vor de holthude und bune uppe der Elmenow to beterende; 1411 wird in ihrer Rechnung eine Einnahme van der hude buten dem Bardewickeren dore vermerkt (Denkbuch zu 1424 zu vgl.), und es heißt, daß der holtlegger, d. i. wohl der Aufseher des Platzes, außerdem 4 M an den Uhrmacher zu zahlen hatte vor den seygher to stellende; 1412 wird ein Graben vor der holthude aufgeworfen und uppe der holthude vor dem Bardewikeren dore ein betekalkeshus errichtet; uppe der hude 1437; 1448 wird an dem manhuse up der holthude buten ... gebaut; 1463 an dem kritenhuse up der hude. Ein Jahr zuvor geschieht einer neuen Hude Erwähnung up der holthude an dem slenge to makende dar me plach dreck up de niggen hude to vorende umme vorhogendes willen; van den beiden holthuden buten dem Bardewikern dore floß eine Einnahme in die Kasse der Bauherren (Büttner, o. J.); 1472 ff. wurden an der Hude Uferbefestigungen ausgeführt; 1476 leistete der Sodmeister eine beträchtliche Zahlung für Kalk, Steine und Arbeitslohn to deme torne de by der holthude steit∗; uppe der hude wurden zwei außerordentliche Wächter angestellt für kritische Tage (1487); der ordentliche Aufseher bewohnte die noch erhaltene, am Flusse malerisch gelegene warborch (aus dem Fünfzehnhundert), wo die Ílmenau während der Nacht durch eine Kette gesperrt wurde (vgl. Baumstraße); auf Gebhardis Plan von 1794 finden sich auf der Salzcomtoirs Holzhude die Vermerke Weidenplantage der Bötticher, Schiffbauerwerft mit einem Kanal, um Schiffbauholtz unter Wasser zu verwahren und, weiter flußabwärts, einem Hudenwechterhaus. Vom Hudeinspektor Maximilian Clement wurde nach 1627 ein Teil der Holzhude, später mit Weiden bepflanzt, zur Wiese gemacht – die Max-Wiesche. Von der Holzhude wurde die Kalkhude unterschieden 1418. Das Kaufhausschauer auf der Hude, jetzt Außenkaufhaus genannt, wurde 1739 errichtet, um für die Zeit, in welcher das Kaufhaus beim Kran in einem Neubau entstand, als Ersatz zu dienen, daher auch Interimskaufhaus. Der Plan von 1802 scheidet von der Holz- die ∗
Dieser wurde errichtet zur Sicherung der Ilmenauschiffahrt und Herzöge bei Lüne einen neuen Zoll errichten wollen.
74
Stürlüne
genannt, weil die
Schiffhude und zeigt neben der Warteburg drei sog. interimistische Kaufhäuser, zwei Salz- und einen Kalkschuppen; nördlich vom Antonifriedhof ist eine Bethkalkbrennerei eingetragen, von Gebhardi bezeichnet als Kreitenbruchsofen mit Kreitenniederlage. Vgl. beim Holzberge. In Rostock huda lignorum 1305. Auf der Rübekuhle Kein Ratsbeschluß. Neben den beiden von zwei Mitgliedern des Rates verwalteten Hamburger Bierkellern an den Brodbänken (Schütting) und am Sande (Sandkeller) wurde Michaelis 1486 ein dritter eingerichtet auf den Vierorten – to sunte Michaelis dage lede wy den dorden keller to up den veer orden. Nach seinem Pächter wurde dieser zuerst Hans Bars keller genannt, aber bald taucht für eben diesen Keller (Altstadt 50) der Name rovekule auf, ein Ausdruck volkstümlichen Humors, der sich allmählich für die ganze, an jenem Keller in die Altstadt einmündende Straße, die bisherige Papentwite, zunächst auch achter dem Hamborger kelre 1501, einbürgerte. Der Rm. Garlop kaufte 1525 ein Haus in antiqua civitate ex adverso fovee raparum; der Bürger Schmedenstede eine Bude super antiqua civitate in acie ex adverso fosse raparum 1526; der Bürger Konynck ein Haus super antiqua civ. apud quatuor acies ex adverso taberne cerevisiarie quam fossam raparum appellitant 1526; der Bürger Lorber ein Haus ex opposito tabernae . foveae raparum vulg. nuncupate iuxta quatuor acies 1540. Der Rat hatte den Keller gemietet; die Bierherren zahlten 40 M tor hure vor de rovekulen 1575; auf dem Riebekull 1578; in quadrivio ex opp. fossae raparum 1622; prope tabernam Hammonicam vulgo raparum foveam 1626; ex adverso cellae publicae cerevisiariae vulgo die Rövekuhle 1653; das Haus der Wwe. Düsterhop fossa raparum dicta fällt Leonh. v. Zerstede zu hodierno cellarum cerevisiarum publicarum directori 1659; prope raparum fossam aedes inter Floren braxatorias et pastoratui ad s. Lambertum dicatas 1674. Im Jahre 1730 gelangte die Rövekuhl, deren Boden zur Kornlagerung benutzt wurde, aus der Hand des Rates an Peter Jürgen Schröder. Um 1870 Ausbau (durch Bierbrauer Drühl) des sehr alten Hauses an den Vierorten (Nr. 50). Dieses Haus hatte einen Eingang, der so tief hinabführte, daß die Fenster der vorderen Zimmer kaum 1 Fuß höher waren als das Straßenpflaster. Es hat der Straße den Namen Rübekuhle gegeben u. war vormals ein öffentliches Bierhaus dieses Namens (Volger). Achtern Röbekuhlen 1765; achter de rövekuhl, mit Ebstorfer Hof und Wilkens Gang 1794; das Lambertipfarrhaus ist hier so eingetragen, daß es damals sowohl an der Salzbrückerstraße neben dem Pastorat von St. Michael, wie an der Oberen Ohlinger Str. neben Reimers Hof gelegen haben kann; Rübekuhle 1819, auf der Rübekuhle 1860. Auf der Saline Kein Ratsbeschluß. Die einschneidenden äußeren Veränderungen des Salinhofes gelegentlich der völligen Umgestaltung des Salinbetriebes gegen Ausgang des Siebzehnhunderts faßt Manecke folgendermaßen zusammen: der neue Fabrikhof ist auf dem alten Hofe (die alte Sülze) wieder angelegt, doch dadurch um ein großes vergrößert worden, daß die alte Befriedigungsmauer, die zugleich Stadtmauer war, bis an das Sülztor, dies mit eingeschlossen, abgebrochen, der dahinter gelegene Wall beinahe ganz in den Stadtgraben geworfen, und die Strecke Landes daran schließend, mit in den 75
Blick auf die Siedehäuser der Saline
Fabrikhof gezogen worden ist ... Das Sieden des Salzes geschieht in sechs Häusern, welche ... alle massiv gebaut sind. Der Plan von 1802 gibt von dieser Neuen Saline ein anschauliches Bild. Vordem war der Betrieb wesentlich komplizierter gewesen, charakteristisch ist auf allen älteren Ansichten der Stadt die gewaltige Rauchwolke, die aus den um den Sod herumgelagerten 54 Siedehütten emporsteigt. Von den Betriebsgebäuden auf der Saline wird am häufigsten die Bare genannt, das Gießhaus für die bleiernen Pfannen, im Jahre 1464 twischen de plancken in die Nordwestecke des Sülzhofes verlegt; van der Elmenowe na deme Roden dore, Sulte dore wente an de holten planken by deme nyen walle 6 Wächter, item van der holten planken uppe deme nyen walle wente an dat blockhusz hinder sunte Cyriacus 2 Wächter 1498. Wirtschafts- und Wohngebäude lagen rings um die Siedehäuser herum, ein Spritzenhaus, Wassertonnen- und Geräteschuppen, je ein Sarghaus für die Sodleute und Sülzer, Sammelsalzhütten für das Hl. Geisthospital und Nicolaihof, Wohnungen für den Kunstwärter, die Aufseher, den Oekonomieschreiber, Salzschreiber, Salineninspektor, die Siedemeister, den Pfannenschmidt. Nur das Wohnhaus des Salineninspektors, das einstige Oberseggerhaus, ist von den alten Gebäuden geblieben. Inmitten der südlichen Mauerstrecke erhob sich der weiße Turm, vielleicht identisch mit dem Barninger torn uf der alten sulzen an der stadtmauer, der 1611 neu gedeckt wurde; ein turm baven der sulten wird neu aufgebaut 1412. Die früheste urkundliche Erwähnung der Saline ist von 956 August 13, als der Zoll qui ex salinis emitur von König Otto I. dem Michaeliskloster zum Geschenk gemacht wird. Die Bare wurde 1269 von Herzog Johann den Sülzberechtigten abgetreten, und zwar mit ff. Worten: in veteri salina apud beatum Lambertum ... domum in qua funduntur sartagines que bora vulgari nomine nuncupatur cum area et domo atque edifii cis que iuxta boram edificata noscuntur. Eine neue Bare unde dat slengh wurde 1456 vom Sodmeister erbaut und zugleich ein Steinweg angelegt vom Sülzhause Kempinge nach Egbertinge; vor der zulten hing eine luchte 1463. Wenn super salinam prope domum vulg. de bare nuncupatam Privathäuser erwähnt werden. 1477 und ähnlich das Eckhaus Rethem-Nigestadt, 1478 das Haus des Ratmanns Hinrik Erpensen, so ist das super als nahe bei, gegenüber aufzufassen; bi der bare na sunte Lamberde wart jegen der sulte over 1439; so wird eine Wohnbude erwähnt twischen unde achter deme hogen trede unde Hinrik Brunes wonhusze by der bare by der sulten 1491. Die Mauer, welche die Saline umschloß, de mure umme de sulten, verursachte 1484 eine Ausgabe von 415 M, doch hatte schwerlich die Plankenumzäunung bis dahin genügt. Daß ursprünglich auch die Stadt nur durch Planken geschützt war, beweist eine Notiz des Stadtbuches zum Jahre 1274 quia scandebat ultra planckas. Infra muros civitatis heißt es zuerst 1297. August-Horch-Straße Ratsbeschluß vom 23.7.1998. Die Straße ist nach dem Automobilpionier und Gründer der Horchwerke (nachmals Auto-Union -Audi-) August Horch (1868-1951) benannt. August-Wellenkamp-Straße Ratsbeschluß vom 29.8.1996.
77
Der Salinbaukondukteur und Mitbegründer des Lüneburger Eisenwerks August Wellenkamp (ca. 1815-1880)∗ war der Namengeber für diese Straße. Bachstraße Ratsbeschluß vom 27.1.1954. Die Straße ist nach Joh. Sebastian Bach (s. Johann-Sebastian-Bach-Platz) benannt. Backsteinhof Kein Ratsbeschluß. Die Straße liegt im Ortsteil Ochtmissen; der Name wurde nach der Eingemeindung 1974 übernommen. Bahnhofstraße Kein Ratsbeschluß. Adreßbuch 1860 Bahnhof, seit 1862 Bahnhofstraße inkl. Bahnhof. Die Bahnverbindung von Hamburg über Lüneburg nach Hannover ist i. J. 1847 eröffnet; Vergrößerung des Bahnhofsgebäudes durch einen südlichen Anbau 1863; Umgestaltung der Bahnhofshalle 1940. Die Anlage der Eisenbahn LüneburgWittenberge-Buchholz hatte im Stadtbereich so einschneidende Bodenbewegungen zur Folge, daß Volger den Ausspruch wagt: „das Jahr 1874 ist das merkwürdigste in der Baugeschichte der Stadt“. Kleinbahn Lüneburg-Bleckede 1904, Lüneburg-Soltau 1914. Barckhausenstraße Kein Ratsbeschluß. Gegen 1880 benannt nach dem um Stadt und Land hochverdienten Oberbürgermeister Wilhelm Barckhausen, geb. 17. Juli 1810, gestorben noch nicht 50jährig am 13. Oktober 1859. Barckhausens Grabdenkmal, gestiftet von Mitbürgern und Freunden, befand sich unweit des Einganges zur Barckhausenstraße auf dem Gertrudenkirchhofe (danach in den Anlagen beim Johanneum). An der Barckhausenstraße das Kinderhospital, erbaut 1875/76. Bardenweg Kein Ratsbeschluß. Der Straßenname wurde mit der Eingemeindung Ochtmissens 1974 übernommen. Er soll an die völkerwanderungszeitlichen Siedler in der Region erinnern. Bardowicker Straße Kein Ratsbeschluß. In Urkunden des Dreizehnhunderts noch nicht genannt. Man behalf sich mit dem Hinweis nahe oder vor dem Bardewikertore, d. h. auf der Stadtseite desselben. Prope valvam Bardewich 1361; vor dem Bardewikeren dore 1367; prope (ante, circa, iuxta) valvam Bardewicensem 1381; Eckhaus Stenbeke vor dem Bardewikeren dore ∗
Genauere Lebensdaten waren nicht feststellbar.
78
alsze men in de stad gheyt to der vorderen hand 1412; dasselbe bij dem Bardewikerdore; vor deme Bardewikeren dare lagen fünf dem Rate gehörige Mühlsteine 1466; Eckhaus Elrendorp-Mörsz inter donum custodis capelle s. Nicolai et murum civitatis prope valvam Bard. 1471; Eckschmiede Kerstens-Bodenstede prope valvam Bard. 1480; 1511 wird über eine Rente verfügt uthe Heynen Graszmans smedeshuse ... by den Bardewiker dare up dem orde (Nr. 25). Erst spät, 1438, taucht der Name Bardewiker Straße auf in platea Bardewicensi; in pl. dicta vulg. de Bardewijker strate in latere orientali 1454; in der Bardewijker straten 1462; die Juraten der Nicolaikirche verkaufen ein Backhaus e regione domus canonicorum Bardewicensium in pl. Bard. 1536. Das hier erwähnte Wohnwesen der Bardewiker Domherren, der domherren hus van Bardewijk 1452, domus canonicorum Bard. prope valvam Bard. 1457, lag an der Westseite der Straße, Nr. 30 und 31, seit 1442 (vorher Bürgerhaus Schomaker-Kruse vor dem Bardewicher dore), und wird, als frei vom Hausschoß (seit 1522), noch in den jüngsten Schoßrollen aufgeführt als erstes und zweites Haus des Domkapitels zu Bardewik, obschon es nach Manecke bereits 1764 wieder verkauft worden ist. Das Grundstück erstreckte sich durch die ganze Tiefe des Blocks bis zur Burmesterstraße, dort lagen das Backhaus – 1491 wird ein Bäcker erwähnt dede wonet in der dhomheren woninge van Bardewijk; er backt für die Domherren Roggenbrot – und Böttcherhaus des Kapitels, verkauft 1774 bzw. 1790. Das Renaissancegebäude Bardewikerstraße 32, abgebrochen 1936, um dem Landgerichtsgebäude zu weichen, gehörte ursprünglich der Familie von Witzendorff. Dem Ausgange der Lünerstraße gegenüber lag nach Gebhardis Plan von 1794 die Bäcker und Perruquiers Herberge. Ein Haus zum weißen Schwan, cygnus albus, wird 1627 erwähnt. 1855 kaufte der Bürger A. H. Schröder, geb. i. L. 1823 als Sohn des Oekonomen Joh. Jürgen S., das Haus des Brauers Georg Schlüter aus dessen Konkurse; von jeher war eine Gast- und Schankwirtschaft darin ausgeübt. Der Käufer erhielt die Erlaubnis, Gast- und Ausspannwirtschaft zu betreiben, unter gewissen Beschränkungen. Er durfte nämlich Reisende beherbergen und bewirten, namentlich eine H e r b e r g e f ü r M a l e r -, K l e m p n e r -, S c h l a c h t e r - u n d B a r b i e r g e s e l l e n halten, hatte aber nicht die eigentliche Schankwirtschaft, d. h. das Ausschänken an sitzende Gäste. Es ist das Haus Nr. 29, vorher A 11. Schröder unterstützte sein Gesuch durch den Hinweis, daß in der Bardowickerstraße wohl unserer frequentesten Str. bereits eine Gastwirtschaft, die vormals Ebelingsche, und außerdem noch 3 andere, die vorm. Scheevesche und 2 Breitensteinsche in den letzten Jahren eingegangen seien. Die Rathausfront gegenüber wurde die Ecke Bardewiker Straße-Brodbänken vom „ S c h ü t t i n g “ eingenommen, einem der drei Hamburger Bierkeller des Rates, von 1466-1731 im Eigentum der Stadt, zuletzt, da das Hamburger Bier in Abgang geraten, verpachtet, zur Wirtschaft aptiert und vermietet an einen Traiteur. Die Bauamtsrechnung führt zum erstgenannten Jahre eine namhafte Summe auf, die verbaut wurde an dem Hause dat de rad heft gekoft van Curd Snytteker to enem schütting und des rades ber dar to tappende, das Haus des † Bertelt Heidman dat nu genomet wert de Schütting 1477; ein Ratmann zahlte als Bierherr eine Rente uth deme huse geheten de Schutting 1486; dat hus dat nu uns tokumpt unde werdt genometh de schüttingh 1495. Im Februar 1572 heißt es, daß die grüne Stube im Schütting den Ämtern eingetan sein. Ein Festsaal des Schüttings, vermutlich mit einem Erker geschmückt, hieß das v i n k e n b u r ; dort wurde seitens des Rates das Gefolge vornehmster Gäste bewirtet, wenn gegenüber der Fürstensaal nicht ausreichte, von dort erklangen Fanfaren bei der Durchfahrt fürstlicher Personen. Reste, die auswärts auf Tagfahrten übrigblieben, an Butter, Fisch oder Fleisch, 79
sollten up dem Schuttinge zur üblichen Kollation des Hauptmanns und der Stallbrüder verwandt werden 1555. Noch 1829 bewirtete der Magistrat auf dem Schütting die Lehrer des Johanneums, in Anlaß der Vollendung des neuen Schulgebäudes. Auf dem Finkenbauer im Schütting hielten die Kagelbrüder ihre Versammlung und Kollationen, dort fand das Festmahl des jungen Sülfmeisters statt, und eine Collatie der Büchsenschützen ist von 1529 bis 1532 dort nachweisbar. Von der Versteigerung des Schüttings wurden die im und am Hause aufgehängten Scheiben der Schützengesellschaft ausgenommen. Ufm Schütting 1697. Nicht lange vor seiner Auflösung erhielt der Schütting den Charakter eines feinen Traiteur- und Herbergierhauses 1717. 1857 erfuhr der Schütting durch Hammerschlag u. Co. eine gänzliche Umwandlung; die Gastwirtschaft des Schüttings war ein Jahr zuvor eingegangen. Von 1459-62 haftete nach Ausweis der Schoßrollen der Name Schütting am Hause Gr. Bäckerstraße 16, de schuttinge hus, dat hus tome schuttinge, de schutting, der schuttinge hus. Das Wort Schütting (von schutten) bedeutet Gesellschafts-, Gildehaus. Platea Bardovicorum 1630; pl. Bardovicensium 1661; am Bardowicker Walle wurden bis 1866 die beiden Häuser an den Nordecken der Straße bezeichnet. Bardowicker Wasserweg Kein Ratsbeschluß. Zuerst nachweisbar im Adreßbuche von 1925, wohl im Volksmunde entstanden im Gegensatz zur Bardowicker Landstraße. Bastionstraße Kollegienbeschluß vom 1.8.1893. Sie ist angelegt 1893 und führt ihren Namen (von der Straße Am Gralwalle bis zur Garten- jetzt Hindenburgstraße) von der gegenüberliegenden Bastion, die sich in ihrer ganzen Ausdehnung als ein imposantes, wenn auch erst der Mitte des Sechzehnhunderts entstammendes Denkmal der Stadtbefestigung erhalten hat. Grabenleute arbeiten an dem rundel uf der aschenkuhl, an dem hohen rundel und an der brustwehre uf der aschenkul 1651 – das hohe Rundel ist eben die Bastion, im Siebenzehnhundert mit einem heizbaren Bürgerwachthause (1729), genannt die Aschenkule 1740, vorübergehend mit einem Gießhause des Glockengießers Hautsch besetzt. Die A s c h e n k u l e hieß auch Löwenkule, vielleicht in Erinnerung an den einstigen Wildgraben. Hinter der sog. Löwenkule zwischen dem Bardowicker und Neuentore ein wüster Teich (nach 1700). Baumstraße Kein Ratsbeschluß. Seit 1894 den östlichen Teil der Straße hinter der Bardowickermauer bezeichnend, erinnert sie mit ihrem Namen daran, daß, genau in östlicher Verlängerung ihrer Fluchtlinie, der Innenhafen der Stadt für die Nachtzeit durch einen Baum verschlossen wurde – ursprünglich eine verstärkte Sicherung gegen feindlichen Überfall, später, damit vom Kaufhause kein Schiff heimlich wegkonnte. Die Sperre wird beschrieben als ein Pfahlwerk, dessen breite Durchfahrt in der Mitte durch einen 80
im Wasser schwimmenden, oben mit eisernen Spitzen besetzten, an Ketten befestigten Baum geschlossen werden konnte. Ein Baumhaus unten am Wall, nach 1700 hinter dem Kaufhause an der Ellmenau, diente dem zuständigen Beamten als Dienstwohnung; es schloß die Salzstraße a. W. im Norden ab und griff etwas über das Flußbett hinüber; Büttner nennt des Baumschreibers Haus, olim des Aumeisters Haus, nach 1700 bewohnt vom Kgl. Licentvisitator. Der Schlüssel für den bom in der ouwe mußte abends im Hause eines Bürgermeisters abgeliefert und morgens wieder abgeholt werden. Für den bom in dem watere 1412, vor der Elmenow 1427, an dem prambome dar de stad mede sloten werd by dem water 1453 und sonst des öfteren finden sich in den Kämmereirechnungen Ausgaben verzeichnet, z. B. 1455 den arbeidesluden dede rededen de sluse vor dem yse by dem bome; eine regelmäßige Besoldung vor den bom to slutende by dem watere bezog der bomsluter. Anno 1429 ... wart Hans Arndes lenet de waterbom to vorwarende. Das Flußbecken nahe dem Baume, wo der östliche Ilmenauarm wieder einmündet, hieß die B a u m k u l e . Aus einem Turm by der bomkulen entwich 1373 Manegolt von Estorff; dort wurde nach dem Chronisten Schomaker 1444 der große Wall gebaut, d. h. der Bardewikeroder Kastanienwall; 4 Wächter wachten van der Bomkulen wente an de Elmenowe beneffen hern Johann Semmelbeckers garden 1498; 1536 wurde de grote syde torn (Seitenturm) in dem walle by der bomkulen durch eine Explosion des darin bereiteten und verwahrten Pulvers gesprengt, dat man de stede kume kende also dat dar ein torne gestanden; im folgenden Jahre wurde dat grote rundel in der ouwe by der bomkulen gebaut (Plan von 1802), 1656 an der Baumkule eine Justitz, ein Galgen, errichtet. Am Wehr unterhalb des Kaufhauses zeigt der Plan von 1802 den Aalfang, samt der zugehörigen Schleuse Aalkiste genannt, wie es deren je eine auch an der Ratsmühle, bei der Papiermühle zur Hasenburg und bey dem untersten teiche in der landwehre gab 1730. Unterhalb der Baumkule führte eine Fußgängerbrücke, die Baum-Kuhl-Brücke (1765), über den Fluß; sie war im Sommer 1827 neu, nach Art der gewöhnlichen Zugbrücken, angelegt; erbaut wurde sie als Baumbrücke, abgebrochen bei Anlage der jetzigen Fahrbrücke, nach 1890. Zu vergl. Salzstr. a. W. Die Aufgabe des Namens hinter der Bardowickermauer geschah auf Antrag der Hauseigentümer der Straße unter der Begründung, daß besser situierte Familien nicht hinter der Mauer wohnen wollten. Bis in die Mitte des Sechszehnhunderts hieß die heutige Baumstraße B ö t t c h e rs t r a ß e , und es ist bei der hohen Blüte, deren sich in der Stadt der Saline und ihrer Sülfmeister das ehrsame Böttcherhandwerk von je erfreute, zu bedauern, daß der Name fast spurlos verschwunden ist. Die Faßfabrik von L. Reichenbach füllte noch die ganze Tiefe des Grundstückes von der Lünerstraße 14 bis zur Bardewikermauer; sie wurde am 27. Juni 1889 durch einen großen Brand vernichtet und alsdann nach der Breitenwiese verlegt. Zur nahegelegenen Nicolaikirche standen Meister und Gesellen des Böttcheramtes in innigsten Beziehungen (vgl. Kunstdenkmäler). In der botekerstraten wütete 1423 ein großer Brand; 1431 de bodeker strate; 1469 verkaufte Bürgermeister Schomaker ein Haus in pl. doliatorum; 1506 in der bodekerstrate; 1637 pl. vietorum vulgo der bötticher. Wenn 1641 erwähnt wird, daß der Mühlenmeister etliche Jahre hindurch Kumbholz in der bötticherstraßen neben der Fronerey hatte lagern lassen, so scheint eine Verwechslung mit der schnitticherstraßen vorzuliegen. Auch die S t r a ß e d e r R e i c h e n , die rikenstrate, ist zwischen Bardewikertor und Ilmenau zu suchen. So wird 1490 je eine Wohnbude erwähnt twischen des 81
closters van Schermbeke muren und neffen der stadtmuren in der rikenstrate; von einem Eckhause der Dassel heißt es 1503, daß es zwischen einem Wohnhause und dem Schifferhause lag, hinter dem Viskulenhofe in pl. divitum; 1605 pl. divitum zwischen Scharnebecker Hof und der Wohnung des Henneke Rikens. Ein Zusammenhang des Straßennamens mit einem Besitz der Lüneburger Bürgerfamilie Rike ist nicht ganz ausgeschlossen, wahrscheinlicher, daß die Schmalheit des Gäßchens, an welchem offenbar nur die Werkhöfe, schwerlich die Wohnhäuser der wohlhabenden Böttchermeister lagen, gutmütigen Spott herausforderte. Eine Wohnbude zwischen andern Buden achter der hern vam Schermbeke have by der stad muren 1499. Schifferbuden apud murum post curiam Schermbeke 1531; das der Stadt gehörige, reich geschnitzte Fachwerkhaus Baumstraße 8 bildete einen Bestandteil dieses Scharnebecker Hofes, der bis an den Nicolaikirchhof reichte. Nach mündlicher Überlieferung befand sich in der Nähe des bezeichneten Fachwerkhauses eine Zehntscheune, techteschün – das figürliche Schnitzwerk scheint darauf hinzudeuten. Bei der Abtsmühle Kein Ratsbeschluß. Die Abtsmühle an der unteren Ilmenau, um 1800 eine Kornmühle von fünf Grindeln, seit 1802 in Erbenzins, ist am 1. November 1147 als Geschenk Herzog Heinrich des Löwen an das Benediktinerkloster gelangt. Abt ist hier und in allen entsprechenden Fällen (Abtshof, Abtsholz, Abtsobstgarten [in pomerio abbatis 1249], Abtspferdetränke, Abtstor) d e r Abt Lüneburgs, (d. h. der Vorsteher von St. Michaelis, des vornehmsten Klosters im Lande). Von den beiden anderen Klöstern der Stadt unterstand das der Franziskaner einem Gardian, das der Prämonstratenser einem Propste. Der Betrieb der Abtsmühle, auch Niedermühle genannt, geschah lange Zeit durch Mitglieder der Ratsfamilie van der Molen, ein Bürger Johannes de Molendino begegnet bereits 1216; der Bürger Vicke Melbeke führte 1351 den Zunamen de molendino abbatis. Ein torn boven der neddersten molen enthielt das Gefängnis für Ritterbürtige 1334; Herzog Wilhelm erneuerte 1365 die Freiheiten in der nedderen molen bi dem watere; Eckhaus Viskule-Rogge prope aquam Elmenowe ex opposito molendinorum abbatis versus occidentem 1411; by des abbetes molen 1429; Eckhaus Brunswic-Gronehagen ex opp. molendini mon. s. Mich. 1434; bey des abbetes molen wente to deme stoven hatte der Müller die Straße zu reinigen (um 1430); prope molam abbatis s. Mich. in platea molari 1546; retro molendinum abbatiae 1655. Im selben Jahre wurde das Kloster in eine Ritterschule umgewandelt, daher non procul a molendino domini olim abbatis iam collegii nobilium ad s. Mich. 1660. Der Stadtplan von 1802 unterscheidet die Abtsmühle im engeren Sinne von einer östlich davon gelegenen Schneidemühle mit dem Abtsmühlenhofe. Es heißt zum gleichen Jahre, daß die drei Häuser auf dem Abtsmühlen-Hofe, die vordem die Eisschollen aufgehalten, weggebrochen seien, und daß man die sog. Kleine Abtsmühle in eine schwach gebaute Sägemühle verwandelt habe. Der Mühlenteich unterhalb der Abtsmühle hieß die L a c h s k u l e , laskule 1389; der Sodmeister zahlte 1476 vor de laszkulen to der stad behof 1403 M. Die A b t s w a s s e r k u n s t ist i. J. 1530 angelegt, und zwar auf gemeinsame Kosten des Michaelisklosters und der Brauergesellschaft durch Meister Klaus Möller; zur selben Zeit ist der Abtswasserturm entstanden (renovatum 1632-34), einer der 82
ältesten in Deutschland, dessen innere Einrichtung 1837 durch ein leistungsfähigeres Druckwerk ersetzt wurde. Der Durchgang durch das Untergeschoß des Turmes stammt von 1904, bis dahin war die Brücke am Mühlenwehr von der inneren Stadt zugänglich nur auf dem schmalen Steg, der noch jetzt um die nördliche Hälfte des Wasserturmes herumführt. Der Abtswasserturm enthielt ehemals die Wohnung des Kunstwärters und wird unter dem Kennwort Abts-Wasserkunst in den Adreßbüchern von 1860-66 gesondert aufgeführt, später zur Straße bei der Abtsmühle gehörig; 1794 bey der abtskunst. Bei der Abtspferdetränke Kein Ratsbeschluß. Die kurze Verbindung zwischen Rosenstraße und Bei der Abtsmühle führt ihren Namen von einer Tränke, die unmittelbar oberhalb der Abtsmühle, wo sich das Flußbett nach Westen hin verbreitert, eingerichtet war. By der perdebornynghe nach 1389. Alte Bauamtsrechnungen buchen wiederholt Ausgaben für die Herstellung der Tränke; de bornynghe by dem water 1421; de borninge by des abbetes molen 1429; bij der drenke 1450; an der perdedrencke 1461; prope viam ubi equi adaquantur (wo die Pferde an das Wasser geführt werden) 1481; platea adaquationis equorum 1504; Brauhaus Schütten prope die perdeborne 1591; Brauhaus Meyer inter equorum piscinam ... iuxta montem 1609; an der Pferdeborn in Dörrings Hause hatte der † Goldschmied Nic. Siemßen gewohnt nachgehendts ufm Schütting; ebendort der † Goldschmied Daniel Zacharias (1697); bei der Pferde-Schwemme 1802; der Schmied Galenbeck baute 1845 das ehemal. Bünstorfsche Brauhaus am Pferdeborn, der bereits eingegangen war, zu einem ansehnlichen Gebäude aus (Nr. 2). Die Schoßrollen führen die Straße bis 1861 unter dem Namen bei der Pferde Träncke, das älteste Adreßbuch druckt bei der Abts-Pferdetränke. Eine zweite Pferdetränke ist flußabwärts oberhalb der Holzhude zu suchen. Baven der holthude in der perdeborningh, dar se overreden, 1472; by der Elmenow lanck her bit an de perdeborninge wird das Ufer durch schlenge befestigt 1489. Auf eine dritte, wohl mit dem südlichen Teile des Stadtgrabens verbundene Tränke weist eine Notiz von 1423, als Bauherren Planken anbringen ließen, van des rades molen wente in de bornynge vor dem roden dore. Z. vgl. Am Berge. Eine perdedrenke 1397 auch in Braunschweig. Bei der Lüner Mühle Kein Ratsbeschluß. Manecke erklärt eine Kornmühle von drei Grindeln nebst Oelschlage an der Aue, die Lünermühle genannt, weil die Pacht davon zu den Aufkünften des Amts Lüne gehöret. Erste Erwähnung der Lüner Klostermühle in den Quellen des Stadtarchivs 1391, als die Priorin dem Klosterpropste zwei Chor Roggen schenkte de molendino suo in L.; boven des provestes van Lune molen 1421; trans aquam Elmenowe ex opp. molendini mon. in Lune 1423; jegen des provestes molen van Lune wird Hoborges torn, nach seinem Bewohner so genannt, gedeckt 1426; by der Luner mölen Pennekendorppes torn 1471; ex adverso molendinis prepositi in Lune 1527;
83
ex opposito molae Lunensis 1552. Am Lüner Mühlenhofe 1850, bei der Lüner-Mühle 1869. Bei der Michaeliskirche Kein Ratsbeschluß. Versus monasterium s. Michaelis 1382; prope cimiterium s. Mich. 1415; ex. opp. scole s. Mich. versus orientem 1421; Eckhaus der Marg. v. Doren ad partem occidentalem citra cim. s. Mich. 1419; der Rat erlaubte dem Kloster to makende [auszubessern] den bredthun, dede geyt umme eres klosters hoff unde ereme badehusze an by der stadt muren – auf Wunsch des Rates mußte der Zaun ersetzt werden durch eine Mauer (s. ff. S.) 1422; by der schole to sunte Michele 1462; retro templum s. Mich. in loco quem vulg. den Grall nominant 1533; neffen sancti Michaelis porten 1543 (anscheinend des klosters schneiderpforte 1737, die ihren jüngeren Namen wohl nur ihrer Schmalheit verdankt); auf dem Meere an der Ecke bei s. Michaelis stiegelen 1577; neben dem Schulrektor (d. h. gegenüber dem Hauptportale der Kirche) wohnte ein faber lignarius ex oppos. coem. ad s. Mich. in antiqua civitate 1596; Hinter St. Michael 1794; bei Michael. Kirchhoff 1819; gegen St. Michaeliskirche 1850; bei der Michaeliskirche (von der Altstadt bis zur Techt bzw. bis zum Meere) 1860. An der Südseite der Kirche lag die im Jahre 1818 aufgehobene Michaelisschule, deren Rektorat vorstehend schon erwähnt wurde. Seit 1955 Johann-Sebastian-Bach-Platz (s. das.). Bei der Pferdehütte Ratsbeschluß vom 30.4.1959. Dort befand sich die Wohnung des städtischen Pferdehirten einschließlich Stallungen (Pferdehütte). Bei der Ratsmühle Kein Ratsbeschluß. Die Mühlen an der oberen Ilmenau, zu Maneckes Zeit acht Mahl- und Graupengänge und Oelschläge, sind im Jahre 1332 aus herzoglichem Besitz in die Hand der Ratsfamilie van der Mölen übergegangen, von dieser 1407 an den Rat gelangt und im Achtzehnhundert abermals an Private veräußert. Die Wollweber erhielten 1420 den berghuede, de dar steyt by der walkemolen uppe dem dike darto, dat de walker darinne wonen moge. Um 1425 verpachteten Bürgermeister und Ratmannen einem Ungenannten ihre Mühlen. Es werden unterschieden de overmole; Mühlenhaus, Zaun und Brettzaun, Planken (die der Rat im Bau erhalten muß), vortsettelse vor de demme, Walkmühle, Ölmühle negest der stadtmuren belegen; zugehöriger Garten, Wiesen, Kohlgarten van dar an bette an de heringstege; die Mühlenfischerei; ferner der molenkamp zwischen der Feldmühle und dem Ziegelhause; der Garten beim Schlagbaume beim Lindenberge vor dem Bard. Tore; zwei Grundwerke bynnen den plancken und dem berchfrede edder des gruntwerkes dat de frige ghote geheten is. 1455 wurde die Ratsmühle Herrn Hinrich Visculen genommen und zweien von den 60ern gegeben: al wer hyr wat kunde ersnappen, de kam darher getrappen. Zum Ratsmühlenhofe – in der Schoßrolle von 1480 twischen beyden dyken, d. h. dem oberen und unteren Mühlenteiche – gehörten 1740 zwei Kornmühlengebäude mit neun Grindeln, je eine Loh-, Walk- und Beutlermühle, im Vierzehnhundert auch 84
Bei der Ratsmühle aus der Vogelschau
eine Papier- und Oel-, im 1500 eine Schleifmühle, ferner die Wohnung des Mühlenmeisters, das Zimmerschauer, Pferde- und Schweineställe, die Mühlenbrücken, die Wasserbäume unter der Stammersbrücke. Je ein Mühlenrad trieb die Ratswasserkunst und das von Sonnin im Jahre 1782 eingerichtete Sülzgestänge zur Förderung der Sole (s. Plan von 1802). Der Turm der Ratswasserkunst wurde 1874 um ein Stockwerk erhöht und mit einem burgähnlichen Dach versehen. Das Quellwasser von der Roten Bleiche, statt des alten Mühlenrades durch eine Turbine gehoben, wurde am 22. Februar 1875 zuerst in die Röhren geleitet; neues Haus der Verwaltung der Wasserkunst mit Treppengiebel. Ein Mühlenhof, den wir wohl in der Nähe der Ratsmühle suchen müssen, wurde vom herzoglichen Vogte bewohnt; zwischen den Stadtmauern und dieser curia molendini befanden sich Pforte und Weg, porta et via, der Stadt zuständig 1331. Zwischen den Ratsmühlen und dem Altenbrückertore lag eine Badestube, der sog. waterstaven; use (des Herzogs) molen dhe boven des abbetes molen lighet 1332; stupa prope molendinum quod olim pertinebat Johanni de Molendino 1356; in deme stoven bi der molen 1374; prope molendinum 1381; in der overen molen 1395; by der molen negest deme waterstoven 1411; Mathias Ratzeborg up der walkenmolen, in turribus 1433; twischen der molen und dem stoven bij der olden brugge 1435; by dem husze dat to des rades molen horet, alsze men geyt na der stad muren in der klenen straten sind Mühlsteine begraben 1438; by des rades molen lagen Dielen, und der Rat gibt Johann van der Molen 100 M to hulpe to des rades molen 1443; 400 M werden zwei Jahre später verausgabt to dem buwe der radesmolen; die Bauherren bauen an der walkmolen dede licht by der pappires molen uppe dem dike; de vrygote twischen dem bolwerke unde der poppyrsmolen wedder to makende 1458; an der brugge vor der olden brugge de dar gheit up den wall na der walkenmolen 1461; dat pael- und schlengwerk by der poppires molen und den olden berchfrede [Dachreiter?] dael to nemende 1464; an der nigen walkenmolen ut den grunt by des rades molen 1467; an der walkemolen und slenge darsulves by der poppiresmolen 1471; vorbuwed an der olyemolen de wert upgraven umme des siles willen de ut dem graven geit 1475; dat gruntwerk nye ute der grund to makende by der poppirsmolen offte walkmolen 1479; vorbuwet an des rades molen und up der poppires molen, die Walkmühle neu gedeckt 1481; die Mühlenherren buchen ihre Einnahme ut der olyemolen 1482, zahlen dem Abte zu Scharnebeck 60 M ut der walckmolen 1482 und 1483, empfangen aus der Papiermühle van den boden einen Zins. Die Schoßrolle von 1480 hat die Straßenbezeichnung uppe der poppirsmolen. Der Graben umme de popiresmolen wird gesäubert 1484; der berchfrede up der poppiersmolen, der umzufallen droht, wiederhergestellt 1485 und 1486; van der olden walckmolen de up der poppires molen stund 1495. Büttner bemerkt, daß nach 1494 der Papiermühle keine Erwähnung mehr geschehe oder doch nur eines Gartens apud molendinum papyri. Von der stampemolen oder lomolen zahlen die Schuhmacher den Mühlenherren einen Zins 1483 ff.; die Bauherren zahlen 1496 mehr als 312 M Lohn to den pütlermolen und waschesteghen de ik maken led vor der oldenbrugge achter dem walle; zur Walk- und Lohmühle werden Dielen und Schüttenbretter angeschafft 1501. Eine neue Schleifmühle wurde durch die Bauherren angelegt 1498, die Mühlenherren bezogen auch daraus eine Einnahme, z. B. van Lutken Stangen dem mestmaker wegen der slipmolen 1508 und 1509; eine Poliermühle war damit verbunden 1509 ff., van Lenert dem platensleger van den poleermolen, van der pulgermolen. Ob mit der schon oben erwähnten Feldmühle eine Windmühle gemeint ist? Vor steen to der veltmolen 1409; Ludeken up der veltmolen to dem nyen buwe dat he dar makede 1439; verbuwet an dem brake up dem overen dike und an den 86
planken bi der veltmolen 1440. An der Stadtmauer hinter der Mühle lagen drei Freiwohnhäuser für die Totengräber. Gelegentlich hielt der Rat uppe der molen eine Sitzung ab (1497), und so heißt es in einer Akte von 1585, daß allemal der älteste der Hausdiener den Garten an dem alten rathause bey eines erb. rades molen zu beanspruchen hatte. Die Fußgängerbrücke oberhalb der Ratsmühlen ist von dem schwedischen Oberst Stammers angelegt, der vom 14. August 1636 bis 7. September 1637 den Kalkberg besetzt hielt und zur Strafe für seine Kapitulation vor den Truppen des Herzogs Georg am 17. Dezember letztgenannten Jahres in Wismar erschossen wurde. 1655 heißt es: die Aue bei dem Altenbrückertor hinter der Stammers brugke ist durch Bäume gegen Eisgang geschützt, die Mühlenherren haben für Instandhaltung zu sorgen. Der erste oder äußerste Baum liegt zw. Herrn Franz Witzendorffs Garten und dem Wandtrahm, der mittlere zw. Herrn Hans Gretzen und des Mühlenmeisters Garten, der 3. und letzte unter der Stammersbrugke. Im Jahre 1709 wurde die S t a m m e r s b r ü c k e einmal ganz weggeschwemmt. Der Besitzer der Ratsmühle kaufte 1861 die Walkmühle und legte in solcher eine Turbine an zur Mahlmühle. Turbine und das neue Mühlengebäude an der Stelle der alten Walkmühle im Frühjahr 1862 beendigt und benutzt (Mühlenbesitzer Findorf). Bei der Ratsmühle 1819; desgl. mit Zusatz gegen die Altenbrücker Mauer, Ratsmühlenhof und vor dem Mühlenhofe 1850; zehn Jahre später wird getrennt Ratsmühle und vor der Ratsmühle, letztere Bezeichnung für die Häuserreihe von der Altenbrückertorstraße bis zur Ratsmühle oder von der Ratsmühle bis zum Ziegenmarkt 1860; bei der Ratsmühle 1869. Bei der St. Johanniskirche Kein Ratsbeschluß. Seit spätestens 1876, bis dahin am St. Johannis-Kirchhofe oder hinter Joh.-Kirchhof (1832), mit Unterscheidung der drei Häuserreihen von der Kalandstraße bis zum Sande, von der Scheerenschleiferstraße bis zur Altenbrückertorstraße links, vom Ziegenmarkt bis zur Kalandstraße links. Dieser Kirchhof, schon im Jahre 1297 erweitert, findet sich mit der Hauptpfarrkirche in den Straßenbezeichnungen häufig erwähnt. Retro finitorium s. Joh. 1350; iuxta cimiterium s. Joh. in Modestorpe 1352; retro chorum eccl. s. Joh. 1356; ortus olerum aut arborum iuxta cimiterium s. Joh. 1362; non longe a cymiterio eccl. s. Joh. 1366; prope cym. eccl. s. Joh. ex opp. chori 1370; achter sunte Johannis kerken 1408; citra cim. eccl. s. Joh. prope stubam 1419; achter sunte Johannis kore 1440; achter sunte Johansze van Rockswalen hůs went uppe den ort; van der stegelen vor Cord Dregeres doer wente to des kosters hůs mußten die Kirchgeschworenen reinhalten bis mitten auf die Straße (um 1430); versus cim. s. Joh. bapt. prope arenam 1452; Eckhaus ex opp. domus molendinaris et eccl. s. Joh. 1480. Wenn 1499 berichtet wird, daß vor dem kerkhove, wie auf dem Markte, Käse feilgeboten wurde, so kann wohl nur der untere Teil des Sandes vor dem Johanniskirchhofe gemeint sein; Haus Kule-Luneborch inter prepositure s. Joh. et Matke civis domos ex opp. eiusdem s. Joh. eccl. cimiterii 1517; retro scholam et penes cim. templi s. Joh. 1601; e regione coem. ad s. Joannem inter praepositurae pomarium und Brauhaus Schröder 1614; retro coemiterium ad s. Joh. in angulo prope Medingenses aedes 1621 (vgl. S. 38); domus quae per multos annos ad mon. 87
Isenhagene spectavit et retro aedem s. Johannis intra aedes praefecturae Oldenstadensis und Garten 1661. In der Nähe der Kirche ist gewiß auch das Haus des Küsters und des Glöckners zu suchen. Iuxta domum custodis et campanarii eccl. s. Joh. 1358; parva lapidea boda sita apud domum camp. s. Joh. 1380; una casa longe domus site iuxta habitationem camp. eccl. (s. Joh.) 1383; bi der kosterye 1431. Auf dem Grundstück am Sande 27 (Sandkrug) scheint das alte Pfarrhaus von St. Johannis gestanden zu haben, die wedeme oder der wedemehof. Up de wedeme kamen 1411 zu einem Neubau 12000 Mauer- und 5000 Dachsteine; 1439 wurden vier Türme achter der wedeme wiederhergestellt; 1444 kam ein (bemaltes) Glasfenster up de wedemen to sunte Johanse. 1602 kaufte der Rat Hoburgs Hausz bei S. Johannis Kirchhofe von den Gläubigern; er ließ es niederbrechen, den Platz zum Kirchhof legen. Die jetzigen drei Predigerhäuser nehmen das Grundstück der ehemaligen Propstei ein. Der Johanniskirchhof als solcher ist aufgehoben und geebnet 1814; er wurde mit Bäumen umpflanzt 1820, nachdem die alte Mauer abgerissen und statt ihrer gepflasterte Stufen angelegt waren. Das Haus der Wwe. Heeschen neben dem Kalande (Nr. 5) kaufte der Schlachter Radel und baute an dessen Stelle ein neues Haus 1863; Müller Findorf begann 1866 den Bau eines Hauses an dem wüsten Platze der einige Jahre zuvor abgebrochenen Vikariatshäuser im Süden der Joh. Kirche; im Herbste vollendet, im Laufe des Winters bezogen (Nr. 6). Der Plan von 1765 unterscheidet bey der Johannis Kirche und achtern Johanns Kirche, der von 1794 bey S. Joh. Kirchhof und hinter S. Joh. Kirche. Die einseitig bebaute Straße hinter dem Chor der Johannisstraße hieß lange Zeit die G e r b e r s t r a ß e . Wegen der unmittelbaren Nähe des Flusses lag sie günstig für die Werkstätten und Wohnungen der Lohgerber, und das Haus Nr. 12 war bis gegen 1942 im Eigentum einer Lohgerberei. Die Lüneburger Gerber bildeten schon um 1300 ein besonderes Amt, dem, wie sie selber sich rühmen konnten, vorwärts gekommene und reiche Leute angehörten. Platea cerdonum que vulgariter u p d e m o l d e n l a n d e nuncupatur 1347; inter cerdones 1350; ein Gerber belastet sein Wohnhaus iuxta cym. s. Joh. in Modestorpe 1352. Nova terra, Neuland hieß 1315 die Gegend hinter der Johanniskirche; in loco qui dicitur u p p e d e m n i e n l a n d e iuxta domum et curiam abbatis et conventus in Antiquo-Ullessen in civitate L. kaufte der Rat 1351 ein Haus, es scheint identisch zu sein mit einem steinernen Hause, das er 1355 in platea cerdonum que vulg. up deme nyen lande dicitur, zwischen dem Alt-Uelzener Klosterhofe und dem Hause eines Gerbers, an einen Bard. Domherrn wieder veräußerte; ein Haus, früher dem pellifex Lutbert gehörig, in pl. pellipariorum 1354; ein Gerber wohnte retro chorum eccl. s. Joh. 1356; in pl. serdonum lag ein Haus der Predigermöche von Hamburg 1357; der Uelzener Propst verkaufte dem Ratmann Springintgud ein Haus prope domum ac curiam mon. in Antiqua Ulsen 1363; in der gherwern 1378; drei Katen gegenüber dem Heiligentaler Kloster viciniores platee cerdonum 1388; an der gerwerstraten 1390; in der gerwerstrate achter sunte Johannis kerken 1408; by den Peweleren 1421; den zijll achter den gherweren durfte Herr Joh. van der Molen durch die Stadtmauer leiten achter sineme hove by des closters hove van Medinge 1429; Eckhaus Eddewen bij dem huse dar de terminarii der pewelere inne woned in der gerwerstrate 1437; 88
mangk den gerweren bij sunte Johannis kerkhove 1440; pl. cerdonum retro cim. eccl. s. Joh. bapt.; bij dem huse der terminarii efte peweler to sunte Johannis kerkhove werd in der gerwerstraten 1452; up dem ende to sunte Johanse wardt als men ut der klokkenstrate na den gerweren dale geit 1471; beim Medinger Klosterhaus (curia Meding bereits 1431) retro s. Joh. in pl. cerdonum 1476; achter sunte Johansze by der peweler wonhusze 1502; retro chorum eccl. s. Joh. in pl. cerdonum 1539; retro cim. ad divum Joh. in coriariorum pl. 1604; ad aciem superioris cerdonum pl. – hier muß die Wandfärberstraße gemeint sein – beim Medinger Klosterhause 1669; in der Gärberstraße hinter St. Johannis gegen der Schreib-Schulen über Anfang 1700. Plan von 1794 Kaland-, von 1802 Kalanderstraße nach dem sog. Kleinen Kaland; z. vgl. Altenbrückermauer. In Danzig pl. cerdonum 1357, desgl. in Wismar 1272. Bei der St. Lambertikirche Kein Ratsbeschluß. Die Sülzkapelle, spätere Taufkirche von St. Lamberti, ist abgebrochen 1860/61; sie lag mit dem zugehörigen Friedhofe auf dem jetzt freien Platze, dem Lambertiplatz, nordöstlich der alten Saline. Auf der penningbank wurde der Salzkauf getätigt, und zwar bis 1481, dann wurde er verlegt vor die Salzbude. Ex opposito chori s. Lamberti 1301; ex opp. ecclesie s. Lamb. prope salinam 1354; Ebstorfer Hof ex opp. dotis capelle s. Lamb. 1355; prope cymiterium s. Lamberti 1357; iuxta curiam rectoris s. Lamb.; prope s. Lambertum 1381; retro cap. b. Lamb. 1388. Zahlbank für die Sülfmeister uppe sunte Lambertes hove 1400; hier war das Entgelt für die Fluten zu entrichten; einer Lambertistraße, platea s. Lamberti, geschieht 1416 und 1419 Erwähnung; sie ist wohl identisch mit der Salzbrückerstraße, die auch gemeint sein könnte mit dem Hinweis gegenüber dem Abtshof bei der Stadtmauer in vico quo a nova valva descenditur ad capellam s. Lamb. 1421; ex opp. turris s. Lamb.; zwischen einer Schmiede und einer Bäckerei ex opp. cap. s. Lamb. versus orientem; bij. sunte Lambertes kerkhove to deme sultedore ward 1423; der Ratmann Duckel wohnte tegen des prouestes houe van Ebbekestorppe 1423; inter curiam monasterii in Ebbekestorpe (Ebstorfer Hof) et domum Joh. Elvers iuxta s. Lamb. 1428; der Ebstorfer Hof heißt sunte Mauriciesz hof 1478, als der Klosterpropst dort einkehrte. By sunte Lamberte stand das solthus, für dessen geordneten Verkaufsbetrieb der Salzmesser verantwortlich war, 1437; der Plan von 1802 zeigt die Salzbude (jegen de soltboden 1490) dem Ausgange der Salzstraße genau gegenüber. Solthus over ist die älteste Straßenbezeichnung der Schoßrollen, 1426; dat huseken vor der zulten dar de zultewarer unde wechters ynne sitten wurde von den Barmeistern erbaut 1473, die 1516 etliche Steinwege fertigen ließen; by sunte Lambertes kerckhove van der stegelen vor Helmeken Beckers dore wente to der anderen stegelen wente an den kerckhoff hatten die Nachbarn die Straßen zu reinigen; dar de kosterye steyt unde under den bencken der Gastmeister, van den bencken went to her Empsen stegelen wente an de kerckhoves muren wieder die Nachbarn (um 1430); Eckhaus Vroling-Engelbrechtes ex opp. case theolonii prope s. Lamb. 1462; tyegen sunte Lamberde 1462; penes cap. b. Lamb. 1464; zu behuef eines privets auf S. Lamberti Kirchhofe hinder der Salzbueden zu rhur an der Kirchhofmauern wird ein Turm aus der Erde aufgemauert, aber mit einem Gewölbe unbenutzt geschlossen, da man wider Erwarten auf Begräbnisstätten gestoßen ist 1607; prope eccl. Lambertinam 1667; Schmiede ante portam salinarem angularem e coemiterio divi Lamb. 1670; by Lamberts Kirche 1765; bei Lammers kerk 1794; bei St. Lamberti 89
Kirche 1802; das Adreßbuch von 1860 fügt hinzu: vom Heiligengeisthospital bis zur Ritterstraße links, von der Salzbrückerstraße bis zur Salzstraße links. Das Haus Nr. 11 (Lamberti Bierhalle) war in neuerer Zeit die Herberge für Tischler und Zimmerleute. Der Platz der ehemaligen Lambertikirche wurde nach dem Abbruch des Gotteshauses geebnet und größtenteils zum Rasenplatze gemacht. Bei der St. Nicolaikirche Kein Ratsbeschluß. Die Nikolaikirche, erbaut 1409 für das Wasserviertel, ist erst in der Reformationszeit Pfarrkirche geworden, als weitaus die jüngste der drei städtischen Pfarrkirchen. Ex opposito cimiterii s. Nicolai 1412; ex opp. capelle s. Nic. 1417; schon bei der Lünerstraße begegnete der Hinweis prope (iuxta) capellam s. Nicolai 1420; Bude cum transitu in curiam Raven ex opp. cim. s. Nicolai 1445; bij sunte Niclawesz 1449; das Gildehaus der Böttcher by sunte Nicolawesze 1479 bzw. jegen s. Nicolai kerken 1553 (s. unten Lünerstraße); Wohnhaus des Bernd vom Rode uppe bullenorde 1483; by dem bullenorde unde der schiplude backhuse 1496; geplante Anlage einer Wasserleitung ane sunte Nicolai straten dal beth tegen den bullenort 1497; ein Eckhaus und drei Buden zwischen dem Böttchergildehaus und Grabows Wohnhaus kaufte Rike ex opposito capelle s. Nic. 1513; in platea s. Nic. ex opposito domus monasterii Lune 1531; in acie platee que vocatur die Voigt Strasse e regione coemiterii d. Nic. inter Snitkers et der bötticher gildehausz 1585; in acie cemiterii templi ad s. Nic. prope portam Bardovicensem 1602; e regione aedis divi Nicolai domos inter vietorum communem [Böttchergildehaus] et Koltmanni heredum habitatoriam exstructam 1653; Brauhaus Burmeister-Schröter prope templum Nicolaitanum in medio aedium Scharnbeccianarum und Haus Arents 1670. Gebhardis Plan zeigt an der Nordwestecke der Rotenhahnstraße das Schifferhaus und westlich davon den Gildehof, Eigentum der Salztonnenböttcher; der Plan von 1802 führt die Bezeichnung bei St. Nicolai Kirche noch südlich des Gotteshauses, an der Nordseite macht er die Belegenheit des ehemaligen Scharnebecker Hofes gut kenntlich; Nicolai Kirchhof 1819; bei St. Nicolai Kirche bzw. gegen St. Nicolai Kirche 1850; bei der St. Nicolai Kirche mit dem Zusatz nördlich 1860. Zu vgl. Lünerstraße. Beim Benedikt Kein Ratsbeschluß. Bis 1903 beim St. Benedikt, in den älteren Adreßbüchern mit dem Zusatze vom westlichen Ende der Neuentorstraße links, reicht bis zur Mündung der Techt und tritt als Straßenbezeichnung im Siebenzehnhundert auf, hier jedoch in der Form hinter St. Benedicti-Kapelle für die Häuserreihe an der Mauer entlang, vom Benedikthospital bis zur Ecke der Wendischen Straße. Die nördliche Verlängerung, bis zur Ecke am Gralwall, heißt auf einem Plan von 1772 B e i m R e i t p l a t z , 1802 hinter dem Reitplatz – das Reithaus der Ritterakademie mit dem Bereitershofe lag bis 1790 auf dem jetzt unbebauten Gelände zwischen den Häusern 7 und 8 beim Benedikt. Auf dem nächsten unbebauten Platze an derselben Straße nach Süden hin lag das vom Abte Boldewin von Wenden gegen 1430 erbaute Hospital zum Hl. Benedikt, das von seiten des Landschaftsdirektors von Bülow im Jahre 1787 durch den gegenwärtigen, gegenüberliegenden Bau ersetzt worden ist (Kunstdenkmäler S. 180 ff.). Die Lage der ältesten, schon 1157 eingeweihten Benediktkapelle wird bezeichnet zur Seite der Burg, iuxta capitolium, das zugehörige Hospital 1282 unter 90
der Burg, sub castro. Luneborch contra hospitale eccl. s. Mich., 1315 apud hospitale monasterii sub castro Luneborch, 1345 prope castrum; Abt Boldewin kaufte 1433 ein Haus ad usum hospitalis s. Benedicti in cornu ex opposito dicti hospitalis; 1476 achter sunte Benedictes; 1501 wurde ein Steinweg angelegt by sunte Benedictus; an dem b r i n c k h o f f des Klosters St. Michaeliswohnung hangt eine Kette und wird geschlossen an Benediktkapellen an den Pfahl (brink = Rand). Beim Bockelsberg Kein Ratsbeschluß. Belegenheit des vom Verschönerungsverein im Jahre 1895 erbauten Fischerhäuschens, aber in gleicher Fassung gebraucht schon in einer Bauamtsrechnung von 1437, als ein Pram by dem bokesberge aus dem Wasser geholt und in den neuen (Stadt-)Graben gebracht wurde; am Bockelsberge neben Wülschen Brock über 1560. Der Name Bockelsberg, bokesberg, ist wohl vom bôk, der Frucht der Buche, abzuleiten, wennschon dieser Baum auf dortiger Höhe längst dem Nadelholz hat weichen müssen. Beim Holzberg Kein Ratsbeschluß. Der Holzberg (Adreßbuch 1860 Holzberg, seit 1869 beim Holzberge), nördlich der Bleckeder Landstraße und ehemals durchquert von einer Straße nach Scharnebeck, diente als Holzlagerplatz; up der hude efte up dem berge vor L. war Holzverkauf üblich 1538. Auf dem Holzberge vor dem Lüner- und Altenbrückertor ist ein Haus mit einem Zaun und kleinen Garten umgeben, worinnen die beyten Holzsetzer wohnen, weil sie zugleich auf das daselbst aufgesetzte Holz Achtung geben müssen (gegen 1720). Ein Holzmarkt unter anderem in Danzig, Hannover und Lübeck. Beim Kalkberg Kein Ratsbeschluß. Beim Kalkberge außerhalb des Neuentores (Zusatz seit 1869) hieß die Belegenheit der Wohngebäude der Kgl. Berginspektion, insonderheit der Dienstwohnung des Bergwerksdirektors; ehemals Kalkhof, Kalkgrube genannt (1765). Das Wort Kalk ist dem lateinischen calx entnommen und deutet hier auf den Kalkstein, genauer wäre zu sagen Gipsstein, aus dem der Berg sich aufbaut. Als der Kalkberg gelegentlich des Erdrutsches von 1013 in den Quedlinburger Annalen (SS. III. 82) zum ersten Male erwähnt wird, heißt es schlechthin in monte Luniburgensi; natürlich ist auch der Kalkberg mit seiner Lüneburg gemeint, wenn in einer Urkunde aus der Zeit Otto IV. als Ausstellungsort genannt wird Luneborch ad imperialis aulae curiam 1203. Später ist die lateinische Bezeichnung mons sementi – de monte sementi super quod dudum castrum Luneburg erat situatum 1385. Nach Schomaker wurde 1398 dem neu erwählten Bürgermeister Otto Garlop de torne up dem Kalckberge, d. h. seine Obhut, abgenommen und einem Ratmanne übertragen. Bei der Zerstörung der Burg und des Klosters auf dem Kalkberge wurde der Wachtturm geschont, erneuert 1491; er befand sich unter der Obhut eines vereidigten Wächters, der bei Nacht den Berg niemals verlassen durfte: dat ick den torn unde bergh vor Luneborg, dare dat slott uppe gelegen heft, ... wohl vorwaren wille ... unde dar nicht affgan er der sunnen upgange, unde ift ick des namiddages 91
affginge, dat ick ehr der sunnen undergange wedder uppe den torn gan wille, unde dat ick nicht affgan wille wan ick alleyne daruppe byn, unde dat ick dar nemande uplaten wille ane der borgermestere unde kemerere willen efte orloff – dat my Godt szo helpe und syne hilligen 1456 Dez. In Zeiten der Gefahr war die Bewachung des Kalkberges ein Vorrecht der Knochenhauer. An dem torne uppe dem kalckberge wurde 1444 gebaut, ein mit einem Horne ausgerüsteter torneman, der im selben Jahre uppe den kalckberch kam, entlief. Der Kalkberg gehörte von 1371-1637 der Stadt und wurde ihr verliehen seitens der Herzöge Wenzel und Albrecht am 6. Januar erstgenannten Jahres: so geve wy den borgermesteren und dem rade der stad to Lunemborch und eren nakomelingen den kalkberch, dar dat hus edir de borch up gebuwet is, de stad mede to vestende unde vortmer met dem berge und met deme kalke to donde und to latende wat se willen unde en nutte unde gut dunket wesen. Der Kalkpreis wurde 1487 seitens des Rates erhöht, nadememale deme kalkberge in kortten jaren zere affgebraken is unde vaste vorminret werd; ante portam novam retro montem calcis 1634. Nach dem dreißigjährigen Kriege erhielt der Berg neue Festungswerke mit allem Zubehör an Brücken, Toren, Türmen, Wachten, einem Stockhause, Wohn- und Wirtschaftsgebäuden für den Kommandanten, einer Garnisonskirche, Schmiede, Backhaus, Baracken und einem großen Brunnenwerk. Eine krumm angelegte gewölbte Durchfahrt hieß das dunkle Tor, eine der Constabelbaracken im Kessel, eine andere in der Wolfsgrube. Entfestigt wurde der Berg nach dem Siebenjährigen Kriege. Bei Mönchsgarten Kein Ratsbeschluß. St. Michaelis closter möncke garten 1727; Mönchsgarten mit Vorwerk 1794. Nach Volger ehemals Sommersitz des Abtes von St. Michaelis; Parkanlage durch den Landschaftsdirektor v. Bülow Ende des Siebzehnhunderts. Beim Ratskeller Kein Ratsbeschluß. Bei der Eingemeindung Ochtmissens 1974 übernommen. Bellmanskamp Kein Ratsbeschluß. Nach einem ehemaligen Eigentümer, im amtlichen Gebrauch zuerst nachweisbar im Einwohnerbuche von 1928. Unter den Bürgern der Stadt begegnet der Name Bellmann erst im Siebzehnhundert; der älteste Träger war ein Schreib- und Rechenmeister. Bennigsenstraße Ratsbeschluß vom 16.6.1960. Hannoversche Adelsfamilie, welcher der liberale Politiker, Gründer und Leiter des Deutschen Nationalvereins Karl Wilhelm Rudolf von B. angehörte. Rudolf von B. wurde 1824 in Lüneburg geboren (gest. 1902 in Bennigsen, Kr. Springe).
92
Bergstraße Kein Ratsbeschluß. Die Straße gehört zum Ortsteil Oedeme und wurde bei der Eingemeindung Oedemes 1974 übernommen. Berliner Straße Ratsbeschluß vom 28.5.1959. Die von der Uelzener Straße bis zur Altenbrückertorstraße (unter Einbeziehung des nord-süd verlaufenen Teiles der Wandrahmstraße) angelegte Entlastungsstraße wurde mit dem Namen der ehemaligen Reichshauptstadt bewidmet. Bernhard-Letterhaus-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Die Straße liegt in Kaltenmoor, einem Neubaugebiet der späten 60er Jahre, in dem vor allem Widerstandskämpfer mit Straßennamen geehrt wurden. B. Letterhaus (1894-1944) war als Mitglied einer neuen Regierung vorgesehen, wurde nach dem 20. Juli 1944 verhaftet und später hingerichtet. Bernhard-Riemann-Straße Ratsbeschluß vom 18.10.1956. Nach dem Göttinger Mathematiker Bernhard Riemann benannt (1826-1866), der Abiturient des Lüneburger Johanneums des Jahrgangs 1846 war. Bernsteinstraße Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Der Name, mit dem der Gemeinderat Ochtmissen am 26.2.1974 den ehemaligen Bardowicker Weg bewidmete, wurde von der Stadt Lüneburg übernommen. Bertha-von-Suttner-Straße Ratsbeschluß vom 29.8.1995. Bertha von Suttner (1843-1914) gründete 1891 die „Gesellschaft der modernen Friedensbewegung“ und erhielt 1905 den Friedens-Nobelpreis. Bessemerstraße Ratsbeschluß vom 30.4.1959. Sir Henry Bessemer (1813-1898) Massenerzeugung von Flußstahl.
erfand
den
Bessemerprozeß
zur
Beußweg Ratsbeschluß vom 29.1.1976. August Beuß gründete 1909 die erste Tanzschule in Wellenkamps Hotel. Die Tanzschule Beuss gibt es noch heute in Lüneburg.
93
Billungweg Kein Ratsbeschluß. Laut Beschluß des Gemeinderates von Ochtmissen am 26.2.1974 wurde die Straße „Eichenweg“ in „Billungweg“ umbenannt und nach der Eingemeindung von der Stadt Lüneburg übernommen. Bilmer Straße Kein Ratsbeschluß. Die Bilmerstraße, angelegt 1893, läuft parallel zur Bleckeder Landstraße, in der Richtung von Westen nach Osten. Der Name ist entlehnt von der ehemaligen Dorfschaft - villa Bilne 1262 -, später zu Lüne gehörigen Schäferei Bilm, die, etwa zwei Kilometer von Lüneburg entfernt, an jener Landstraße gelegen war und der nahen Waldung B i l m e r S t r a u c h den Namen gegeben hat. Der Biller struck (1564) gehörte mit zum städtischen Weidegebiete. Bückmann leitet Bilm vom langobardischen Personennamen Billo ab. Bilmer Strauch Kein Ratsbeschluß. Das Gelände gehörte (s. Bilmerstraße) ursprünglich zur Domäne Lüne, die 1937 im Zusammenhang des Flugplatzbaues aufgelöst wurde. 1943 mit dem Ortsteil Lüne in den Stadtkreis Lüneburg einbezogen. Birkenhof Ratsbeschluß vom 23.11.1989. Eine Anpflanzung von Birken soll dem Privatweg in einem Neubaugebiet Am Grasweg den Namen geben. Birkenweg Ratsbeschluß von 1939. Der Weg liegt in einem Gebiet mit Straßennamen von Heidepflanzen. Bleckeder Landstraße Kein Ratsbeschluß. Der Name bedarf keiner Erklärung, die Straßenbezeichnung findet sich zuerst im Adreßbuche von 1877. Die Bleckeder Heerstraße, von Lüneburg ab bis vor Bleckede auf den Damm an die kleine Brücke zum ehemaligen Gerichte des Vogtes zu Bienenbüttel gehörig, lag ganz im Goh Oldenbrügge (v. Hammerstein S. 300 nach dem Lagerbuche des Amtes Winsen a. L.). Von 1939 bis 1945 Legion-CondorStraße. Bleckengrund Kein Ratsbeschluß. Der Straßenbezeichnung liegt ein Flurnamen zugrunde. Sie wurde mit der Eingemeindung Oedemes 1974 übernommen. 94
Blücherstraße Kein Ratsbeschluß. Seit März 1936. Der preußische Feldherr Gebhard Leberecht v. Blücher, ein Rostocker von Geburt, erblickte das Licht der Welt am 16. Dezember 1742; der Marschall Vorwärts, eine jener echten historischen Größen, die bei jeder näheren Kenntnis gewinnen, starb auf seinem schlesischen Gute Krieblowitz am 12. September 1819. Blümchensaal∗ Kein Ratsbeschluß. Die sinnige Bezeichnung für ein Wohnwesen außerhalb der Stadt („sal“ ist in altem Sinne Wohnsitz, Aufenthalt, „blömchen“, nach Otto Goebel ursprünglich ertragreiches Ackerland, ist später wohl als blümchen verstanden), von Büttner, Manecke und Volger nicht erwähnt, findet sich zuerst im Lagerbuche der Stadt auf einem Kroki von 1731, und zwar in niederdeutscher Form als Blömkensahl. Damals städtisch, gelangte der Besitz später in Privathände und wird 1860 als Eigentum eines Gartenmanns aufgeführt. Blumenstraße Kein Ratsbeschluß. Übernommen aus dem 1943 eingemeindeten Ortsteil Hagen. Bockelmannstraße Ratsbeschluß vom 19.7.1968. Mit der Benennung nach Dr. h. c. Werner Bockelmann (1907-1968) wurde der erste Oberbürgermeister und der erste Oberstadtdirektor Lüneburgs (1945-1955) nach dem Zweiten Weltkrieg geehrt. Er fiel als Oberbürgermeister Frankfurts am Main einem Autounfall zum Opfer. Bodelschwinghweg Ratsbeschluß vom 18.5.1955. Nach dem Begründer der Betheler Anstalten der Inneren Mission, Friedrich von Bodelschwingh (1831-1910), benannt. Bodestraße Ratsbeschluß vom 16.6.1960. Benannt nach dem Seminaroberlehrer Wilhelm Bode (1825-1900), der an der Lüneburger Präparanden-Anstalt wirkte. Er wurde scherzhaft der „Papst von Lüneburg“ genannt.
∗
Bremen = Blömen = stauendes Gewässer? Vgl. in Hann. Münden den Stadtteil Blume (Stau der Fulda?), in Hildesheim das „Blümchental“ entlang der Innerste, in Celle den Stadtteil Blumlage (= früher Name der jetzigen Bergstraße). 95
Oberbürgermeister, später Oberstadtdirektor Werner Bockelmann (1907-1968) mit dem Stadtkämmerer und nachmaligen Oberstadtdirektor Dr. Bötcher
Boecklerstraße Ratsbeschluß vom 30.4.1959. Nach dem Gewerkschaftsführer Hans Boeckler (1875 bis 1951) benannt. Bögelstraße Kollegienbeschluß vom 4. 9.1900. Die Zufuhrstraße zum städtischen Krankenhaus. Dessen Lage draußen auf luftiger Höhe ist der Anregung des Lüneburger Arztes Geh. Sanitätsrat Dr. Bögel zuzuschreiben, welcher der Errichtung des gemeinnützigen Instituts von Anfang an lebhaftes Interesse entgegenbrachte. Gustav Bögel, eine in Lüneburg populäre Persönlichkeit, geboren am 22. Februar 1829 in Bederkesa, war Militärarzt beim 5. Hannov. Inf.-Regt.; er nahm im Dezember 1866 seinen Abschied, um in Lüneburg weiterhin als Arzt zu wirken. Er starb am 24. Februar 1910. Böhmsholz Kein Ratsbeschluß. Die langjährige Wohnung des Holzaufsehers, seit 1910 eines Gastwirts in der zum Großen Heiligengeisthospital gehörigen Waldung, ursprünglich Stätte einer Wasserburg mit festem Turm, dessen Spuren der Erforscher des Bardengaues v. Hammerstein noch erkennen zu können glaubte. Stammsitz der mit der Burgmannenfamilie von Dören nahe verwandten, vielleicht identischen Familie von Benesholte, um 1400 im Besitz der v. Meding, die am 4. Mai 1410 den Hof to den benesholte, de nu wuste is mit Äckern, Wiesen, Weiden, Wasser, mit dem Gehölz und allem sonstigen Zubehör für 900 M-Pfennige verkauften, und zwar an die beiden Bürgermeistervorsteher des oben schon erwähnten Hospitals zum Heiligengeiste. Bei Anlage der Landwehr, vier Jahre zuvor, hatten sich Bürgermeister und Ratmannen gegenüber den Knappen Wasmod und Jorden v. Meding verpflichten müssen, einen alten Weg, der over den croneskamp na dem benesholte führte, wiederherzustellen. Die Stammsilbe des Wortes benesholt ist vom langobardischen Personennamen Benno abzuleiten. Uth dem beneszholte wurde 1541 Holz zum Grundwerk der Ratsmühle angefahren. Böttcherstraße Ratsbeschluß vom 10.12.2001. Im Neubaugebiet Oedeme-Süd soll ein Quartier mit Straßenbezeichnungen nach alten Handwerksberufen entstehen, um an die in Oedeme einst zahlreich ansässigen Landhandwerker zu erinnern. Als Zulieferer für die Saline spielten auch die (Salztonnen-) Böttcher in Lüneburg eine ganz besondere Rolle. Boizenburger Straße Ratsbeschluß vom 25. 8.1960. Benennung nach Boizenburg a. d. Elbe. Borsigstraße 97
Ratsbeschluß vom 27.1.1966. Nach August Borsig (1804-1854) benannt, der 1837 eine Fabrik für Maschinen und Lokomotiven gründete, aus der sich die Weltfirma Borsig AG entwickelte. Brambusch Ratsbeschluß vom 26.3.1959. Heidepflanze, beschrieben im Braunen Buch von Hermann Löns. Brandenburger Straße Ratsbeschluß vom 25.9.1960. Benennung nach dem Nachbarterritorium, dem die Hansestadt Lüneburg eng verbunden war. Brandheider Weg Kein Ratsbeschluß. Nach einem alten Flurnamen. Der Brandheider Weg war ursprünglich ein Verbindungsweg zwischen der Dahlenburger Landstraße und der Bleckeder Landstraße am Westrand des Staatsforstes Bilmer Strauch. Der Flugplatzbau im Jahre 1938 erforderte den Abbruch von sechs dort belegenen Wohnhäusern. Die Neuansiedlung erfolgte nördlich der Erbstorfer Landstraße. Brauerweg Kein Ratsbeschluß. Mit der neuen Siedlung der Lüneburger Kronenbrauerei seit März 1939. Breite Wiese Kein Ratsbeschluß. Als Straßenbezeichnung mit dem Industrieviertel der Stadt zu Ehren gelangt seit etwa 1866 (auf der Breitenwiese), diente die Breite Wiese bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts vornehmlich als Weideplatz. Endgültiger Name Breitewiese seit März 1939, jetzt Breite Wiese. Nach der Akziserechnung von 1428 hatte der Burmester eine nicht unerhebliche Summe von den Bürgern gesammelt van der breden wisch wegen, doch wohl als Gebühr für Weidezwecke. Die Breitewiese war durch Schlingwerk (schlenge 1581) abgesperrt, damit nicht auch die Ochtmisser in Versuchung kämen, die Weide zu benutzen. Eine gewisse Berühmtheit hat die Breitewiese erlangt durch die Einrichtung eines städtischen Irrenhauses, das an Stelle eines 1565 erbauten Lazaretts für Pestkranke (dat pestilentzen hus nevenst Lüne in der breden wische) trat und gegenüber dem Amtshause des Klosters Lüne an der südwestlichen Ecke der Wiese gelegen war. Das Lazarett auf der Breitenwiese, auch schlechthin die Breitewiese genannt, abgebrochen 1818, nimmt in der nicht eben langen Geschichte der Heil- und Pflegeanstalten einen ausgezeichneten Platz ein. Breslauer Straße Ratsbeschluß vom 17.12.1981.
98
Die Straße befindet sich im Stadtteil Lüneburg-Ebensberg. Dort erfolgte die Vergabe von Straßennamen nach Orten in den ehemaligen Ostgebieten Deutschlands. Die Stadt Breslau/Wrocław liegt in Schlesien an der Oder. Brockwinkler Weg Kein Ratsbeschluß. Das Wohnviertel der Pfleger der zu Anfang unseres Jahrhunderts erbauten LandesHeil- und Pflegeanstalt (Nieders. Landes-Krankenhaus) liegt am Wege nach dem nahen Gutshofe Brockwinkel. Brechwinkel (1338). Brekwinkele (vor 1395), Brekwinkel im gho tor Oldenburgge (Landesschatzregister von 1450). Die Stammsilbe brock gehört nach Bückmann zu brake, umgebrochenes Land, oder zu brake, Stubbenwald. Bromberger Straße Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Die Bromberger Straße befindet sich im Stadtteil Lüneburg-Ebensberg. Dort erfolgt die Vergabe von Straßennamen nach Orten in den ehemaligen Ostgebieten Deutschlands. Die Stadt Bromberg/Bydgoszcz befindet sich im heutigen Polen. Brückensteig Kein Ratsbeschluß. Die Straße im Ortsteil Ochtmissen läßt in ihrem Namen die wichtige NordSüdverbindung der ostwestlich verlaufenden Straßen des Orts erkennen. Sie wurde mit der Eingemeindung Ochtmissens 1974 übernommen. Brüder-Grimm-Straße Ratsbeschluß vom 28.1.1960. Benannt nach den Brüdern Jakob und Wilhelm Grimm (1785-1863 bzw. 1786-1859), Sprachforscher und Herausgeber der Kinder- und Hausmärchen. Brunnenweg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Die Straße in Rettmer erinnert an einen Brunnen in einem Trockengebiet (Drögenkamp). Buchenweg Kein Ratsbeschluß. Der Straßenname in Ochtmissen wurde mit der Eingemeindung des Ortes nach Lüneburg 1974 übernommen. Buchweizenkamp Ratsbeschluß vom 28.8.1975. Der Straßenname in Häcklingen ruft ein Knöterichgewächs in Erinnerung, das zur Mehlgewinnung genutzt wird. 99
Bülows Kamp Ratsbeschluß vom 21.7.1994. Die Namensgebung erfolgte zur Würdigung der Familie von Bülow, die in diesem Bereich umfangreichen Grundbesitz hatte. Bülowstraße Ratsbeschluß vom 30.5.1964. Benannt nach Friedrich Ernst von Bülow (1736-1802), Landschaftsdirektor und Abt am Kloster St. Michaelis zu Lüneburg, Reorganisator der Lüneburger Saline. Frühere Bezeichnung der noch unbebauten Straße: Am Schäferfeld (Flurname). Bürgergarten Kein Ratsbeschluß. Im Volksmunde üblich statt des Namens Bellevue, als Straßenbezeichnung eingeführt 1937. Büttnerstraße Kein Ratsbeschluß. Johann Henrich Büttner aus Greiz in der Grafschaft Reuß, Kantor am Johanneum seit dem 14. November 1694, wurde im Juli 1709 zum Stadtsekretär ernannt, nahm seinen Abschied im Jahre 1745 und starb 83jährig am 30. April des folgenden Jahres. Mit eisernem Fleiß hat er seine vielseitige Begabung ein halbes Jahrhundert hindurch in den Dienst der Stadt gestellt, und vor allem sind es seine geschichtlichen Forschungen, die seinem Namen ein bleibendes, ehrenvolles Gedächtnis sichern. Die Ergebnisse seiner Studien sind zumeist als Handschrift im Stadtarchiv niedergelegt, so auch das in der Einleitung nach Gebühr gewürdigte Büchlein plateae civitatis Luneburgensis, das der vorliegenden Untersuchung nicht unwesentlich vorgearbeitet hat. Von seinen Druckwerken ist das berühmteste, Genealogie, oder Stamm- und Geschlecht-Register der vornehmsten Lüneburgischen adelichen Patriciengeschlechter 1704, noch heute ein unentbehrliches Hilfsmittel für die Geschichte der Stadt Lüneburg und der führenden Ratsfamilien. Im Jahre 1903 sind die Verdienste des ehrenwerten Mannes dadurch anerkannt, daß der vierten Straße der Name Büttner Straße verliehen worden ist. Bunsenstraße Ratsbeschluß vom 18.5.1955. Benannt nach dem Chemiker, Naturforscher und Erfinder Robert Bunsen (18111899). Buntenburger Weg Kein Ratsbeschluß. Der Name des weit draußen an der städtischen Landwehr liegenden Gehöftes wird entstanden sein aus Butenburg, Außenburg – eine solche gab es auch in Osnabrück. In mittelalterlichen Quellen hat sich die Bezeichnung bisher nicht gefunden; erste 100
Erwähnung buntenborg 1715. Damals gehörte sie nicht der Stadt, wohl aber lag sie noch innerhalb der Landwehr, inmitten städtischer Ländereien, auch das ist für ihren Namen bezeichnend. Straßenbezeichnung Buntenburger Weg seit 1921. Bunzlauer Straße Ratsbeschluß vom 26.9.1974. Mit der Eingemeindung des Ortsteils Ebensberg mußte die dortige Liegnitzer Straße umbenannt werden, da es eine solche in Lüneburg schon gab. Bunzlau in Niederschlesien ist die Geburtsstadt des Dichters Martin Opitz und wurde durch die Produktion von Steinzeug bekannt. Burmeisterstraße Kein Ratsbeschluß. Das nördliche Eckgrundstück an der Westseite der Burmeisterstraße barg schon in der Zeit des Lüneburger Erbfolgekrieges den Ratsmarstall. An der gegenüberliegenden Seite stieß das Wohnwesen der Bardewiker Domherren bis an die Burmeisterstraße heran. So erklären sich die älteren hierhergehörigen Urkundenstellen. Mit der Selbständigkeit der Stadt verlor der Ratsmarstall seine Bedeutung und wurde am 12. Oktober 1784 für 2000 M neu 2/3 an Jacob Wilhelm Volger aufgelassen. Schon früher mag der Name Burmeisterstraße, nachzuweisen zuerst auf dem Stadtplane von 1765, sich eingebürgert haben. Er verdankt seinen Ursprung der Dienstwohnung des städtischen Burmesters, der mit Gefängnissen versehenen Gerichtsburmesterey im Hause Nr. 5, die 1853 von der Stadt veräußert worden ist und bis 1682 zurückverfolgt werden kann. Ein burmesters hus lag nach der Schoßrolle von 1427 bereits im Marktviertel; es ist schwerlich identisch mit erwähnter Burmeisterei, zumal der Burmester 1453 ein städtisches Haus auf dem Meere bewohnte. Burmeisterstraße zuerst 1856. Einen Burmestergarten gab es schon im Dreizehnhundert, der Rat verkaufte ihn 1394 an die Witwe des Burmesters Ludolf als curiam extra rubeam valvam prope flumen Elmenow in vulgo dictam burmesters gharde; ein Zins van deme burmestergarden wurde durch die Kämmerer noch 1475 erhoben; burmesters thun buten dem roden dore 1393. Von älteren Quellen gehören folgende hierher: Prope nostrum stabulum circa murum civitatis Haus des Bardewiker Domherrn vom Berge 1369; des rades stal wird gedeckt 1410; in dem hove dar de marstall is eine vermietete städtische Wohnung 1431; b y d e r h e r e n s t a l l e 1462; ex oposito nostri marstalli 1464; neven der heren stalle, in opp. stabuli consulatus inter cap. Bard. et Niendorpes domos 1472; inter domos dominorum capitularium in Bardewijg et domini . in opp. domus et curie nostre que vulgo nuncupatur de marstall kauft Bürgermeister Stöterogge von den Kirchgeschworenen zu St. Johannis ein Haus 1473; dyt is in der strate b y d e m e m a r s t a l l e , Schoßrolle 1486; Marstall neu erbaut 1499; by deme marstalle 1500; prope amplissimi senatus marestallum 1640; inter posticas. capituli Bard. et e regione ampl. sen. equilis publici 1652; e regione stabuli publici 1658; prope murum et equile senatus 1674. Im Achtzehnhundert auch Marstallstraße. In Wismar ex opposito stabuli civitatis 1294, bey der hern stall 1412. 101
Bussardweg Ratsbeschluß vom 23.10.1958. Der Name erinnert an den häufigsten deutschen Greifvogel. Busseweg Ratsbeschluß vom 4.4.1944. Der Oberförster Hermann Busse (1828-1901) war Schöpfer der Bockelsberganlagen. Dort befindet sich auch noch sein Gedenkstein. Butenkaben Ratsbeschluß vom 31.8.1995. Im Baugebiet Langenstückenfeld des Ortsteiles Häcklingen erinnert der Straßenname an einen Flurnamen. Ursprünglich meint Butenkaben einen außerhalb des Dorfes erbauten Schafstall. Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Im Neubaugebiet Kaltenmoor erhielten die Straßen Namen von Widerstandskämpfern gegen das NS-Regime. Carl Friedrich Goerdeler (1884-1945), ehemals Oberbürgermeister von Leipzig und Reichskommissar zur Preisüberwachung, war nach dem Sturz Hitlers als Reichskanzler vorgesehen. Nach dem 20.7.1944 verhaftet und hingerichtet. Carl-Peters-Straße Kein Ratsbeschluß. Die Straße ist 1937 nach dem Gründer des Schutzgebietes Deutsch-Ostafrika benannt (1856-1918), der zeitweise das Johanneum in Lüneburg besucht hat. Sein Wirken war schon zu Lebzeiten sehr umstritten und ist es bis heute geblieben. Carl-von-Ossietzky-Straße Ratsbeschluß vom 29.8.1995. Der Schriftsteller (1889-1938) war Sekretär der Deutschen Friedensgesellschaft und Chefredakteur der „Weltbühne“. Nach 1933 mehrfach in Konzentrationslagern. 1935 erhielt er den Friedens-Nobelpreis, worauf ihm und danach auch allen Reichsangehörigen von der NS-Regierung die Annahme von Nobelpreisen verboten wurde. Chamissostraße Ratsbeschluß vom 10.11.1954. Namengeber war Adalbert von Chamisso (1781-1838), französisch-deutscher Schriftsteller und Naturforscher, der u. a. als Mitherausgeber des „Grünen Musenalmanach“ sowie als Verfasser des „Peter Schlemihl“ und des Lyrikzyklus „Frauenliebe- und leben“ literarischen Ruhm errang. 102
Christel-Rebbin-Straße Ratsbeschluß vom 29.9.1994. Christel Rebbin (1920-1993) war die erste Rektorin der Orientierungsstufe Kaltenmoor und hat sich um diese Schule Verdienste erworben. Christian-Herbst-Sraße Ratsbeschluß vom 23.7.1998. Der Namengeber der Straße (1905-1961) war Inhaber einer bedeutenden Holzhandlung und in den 50er Jahren Sprecher des Berufsverbandes der Deutschen Holzindustrie. Christianiweg Ratsbeschluß vom 25.8.1954. Christian Johann Rudolf Christiani (1761-1841), deutscher Hofprediger in Kopenhagen und später Superintendent in Lüneburg, begründete als solcher 1816 die erste Volksschule in Lüneburg. Sein Sohn Dr. Rudolf Chr. (gest. 1858) war ein bekannter liberaler Parlamentarier im hannoverschen Landtag und persönlicher Freund Heinrich Heines. Christian-Lindemann-Straße Ratsbeschluß vom 22.11.1962. Dr. Christian Lindemann (1798-1867), Syndikus, dann Oberbürgermeister der Stadt Lüneburg 1846-1850, Innenminister des Königreichs Hannover 1850-1851 und 18521859 Präsident des neu gebildeten Obergerichts Lüneburg. Lindemann wurde 1862 zum Bürgervorsteher gewählt. Clamart-Park Ratsbeschluß vom 21.3.1985. 1985 wurde das zehnjährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen Lüneburg und Clarmart gefeiert, die mit der Namengebung gewürdigt wurde. Claudiusweg Ratsbeschluß vom 18.1.1960. Benannt nach Matthias Claudius (1740-1815), dem bekannten Liederdichter und Herausgeber des Wandsbecker Boten. Sein Urenkel ist der in Gröhnwohld lebende niederdeutsche Schriftsteller Hermann Claudius. Conventstraße Kein Ratsbeschluß. Die Conventstraße führt ihren Namen mit zwiefachem Rechte. Von den beiden Eckgrundstücken nach dem Flusse zu war das nördliche vom Zwölfhundert bis über die Reformation hinaus im Besitze des sog. blauen Convents, einer Vereinigung von Beginen, das andere war von einem Bagutenkonvente eingenommen, der freilich 103
Oberbürgermeister Dr. Christian Wilhelm Lindemann (1798-1861)
schon im Jahre 1370 aufgelöst wurde (z. vgl. Kunstdenkmäler S. 179). Auch das Kloster Distorf soll nach Manecke an der Conventstraße ein Haus besessen haben. Der blaue Convent, eine klosterähnliche Zufluchtsstätte angesehener Bürgertöchter, erfreute sich der besonderen Gunst der Patrizierfamilie van der Mölen. Im Jahre 1568 wurde der ganze Besitz – das Hauptwohngebäude war bereits zusammengestürzt – vom Rate verkauft an den Bürger Albert Musseltin, der seinem stolzen Neubau die Front nach dem Berge hin gab (Nr. 37); die Quellenstelle lautet: den platz darup etwan der Blaw Convent gestanden mit sinen gebuweten, so itzt aldar noch vorhanden, by der Distorper huse am Berge bet an de heringstette; das nördliche Eckhaus am Berge, in monte . et in acie plateae conventus, wurde von Musseltin dem Jüngeren hinzuerworben 1589, und zwar aus zweiter Hand vom Kurfürsten von Brandenburg. Das südliche Eckhaus Nr. 35, erbaut 1406/09, ist wie oben schon erwähnt, das Stammhaus der Sülfmeisterfamilie von Brömbse, daher de strate by deme convente, alsze Bromes erve langh is, scall Bromes unde de bagginen vegen laten (um 1430). In conventu begwinarum iuxta aquam 1358; in opposito conventus baghutarum 1381; Eckhaus Sodmester-Basedow nach Westen hin ex opposito blavei conventus 1419; Lagerplatz für Dachsteine by dem torne achter den bagynen 1427; in blaveo conventu situ ad latus aquilonare apud monasterium Hilgendal 1439; jegen dem blawen convente aver; Bau einer Schlammkiste by dem convente 1461; die Häringstege achter dem konvente 1482; bi den bagghunen 1501; ad angulum der conventsstraßen in monte 1624; Backhaus Elver-Töbing (nebst fünf Buden) in conventu 1633. Ein Turm in der Stadtmauer zu Ende der Conventstraße diente nach 1700 als Witwenwohnung. Plan von 1765 Convent Straße; 1794 Blaue Conventstraße. Curiostraße Ratsbeschluß vom 16.6.1960. Dr. Georg Curio (1498-1556) war Stadtphysikus in Lüneburg und zeitweilig Hofmedicus in Wittenberg, wo er auch Martin Luther behandelte. Dachssteig Ratsbeschluß vom 12.3.1945. Die Straße liegt in einem Quartier mit Namen aus der heimischen Tierwelt. Der Dachs ist der größte in Deutschland lebende Marder. Dahlenburger Landstraße Kein Ratsbeschluß. Die alte Dannenberger Heerstraße, seit 1893 bebaut. Auf einem Hügel unweit des Altenbrückertores, der jetzt von der Straße durchschnitten wird, erhob sich ehemals das landesherrliche Hochgericht, dessen Verlegung vom Amte Lüne in einem Rezeß von 1768 zugesichert wurde. Via Dalenborg schon 1295. Nach Eingemeindung des Ortsteils Hagen wurde die Dahlenburger Landstraße um die dort befindliche Hagener Landstraße verlängert (4.4.1944). Daimlerstraße Ratsbeschluß vom 26.3.1959.
105
Benannt nach Gottlieb Automobilwesens.
Daimler
(1834-1900),
einem
der
Begründer
des
Dammstraße Kein Ratsbeschluß. Erst 1892 angelegt; sie führt ihren Namen wohl wegen der hohen Lage parallel der Schienenstraße, die hier freilich kaum als Eisenbahndamm anzusprechen ist. Danziger Straße Ratsbeschluß vom 25.8.1954. Die Straße liegt in einem Quartier mit Straßennamen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Die alte Hansestadt Danzig/Gdańsk liegt in der Weichselniederung an der Ostsee. Dasselkamp Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Umbenennung eines Teilstückes der Straße „Im Tiefen Tal“ nach einer ehemals dort befindlichen Wiese des Justizbürgermeisters Johann von Dassel, mit dem 1852 das letzte Lüneburger Patriziergeschlecht ausstarb. Dehmelweg Ratsbeschluß vom 18.5.1955. Benannt nach dem Schriftsteller Richard Dehmel (1863-1920). Dempwolfstraße Ratsbeschluß vom 16.6.1960. Dr. August Rudolf Dempwolf (1802-1876) war von 1846-1876 Senator der Stadt Lüneburg. Dessauer Straße Ratsbeschluß vom 25.11.1966. Die Straße liegt im Gebiet Kreideberg-Nord. Dort wurden Straßennamen aus dem mittel- und ostdeutschen Raum gewählt. Deutsch-Evern-Weg Ratsbeschluß vom 4.4.1944. Verlängerung der Straße Blümchensaal in Richtung Deutsch Evern. Dieselstraße Ratsbeschluß vom 18.5.1955. Benannt nach Rudolf Diesel (1858-1913), dem Erfinder des Dieselmotors.
106
Dietrich-Bonhoeffer-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Der evangelische Theologe (1906-1945) schloß sich der Bekennenden Kirche an, wurde 1943 verhaftet und kurz vor Kriegsende im KZ Flossenbürg ermordet. Dömitzer Straße Ratsbeschluß vom 25.8.1960. Benannt nach der Stadt und ehemaligen Festung Dömitz a. d. Elbe in Mecklenburg. Dörnbergstraße Kein Ratsbeschluß. Auf dem Gelände vor dem Neuentore, wo der Entscheidungskampf in dem ruhmvollen Gefechte von Lüneburg am 2. April 1813 sich vollzog, hat man dem kühnen Führer der gegen die Franzosen verbündeten Truppen, Wilhelm Freiherrn von Dörnberg, ein Denkmal gesetzt, indem die dort angelegte Straße im Jahre 1884 nach ihm benannt wurde. Von Dörnberg, am Tage der Schlacht Befehlshaber eines Kaiserlich russischen und eines Königlich preußischen Korps, dem militärischen Range nach Kgl. Großbritannischer Generalmajor, ist 1768 in Hausen bei Hersfeld geboren; nach den Freiheitskriegen wurde er hannoverscher General, später Gesandter in Petersburg und starb 1850. Dr.-Lilo-Gloeden-Straße Ratsbeschluß vom 14.9.1972. Die Juristin Dr. Lilo Gloeden (1903-1944) gehörte dem Widerstand an und wurde deswegen ermordet. Dorfsfeld Ratsbeschluß vom 30.5.1980. Der Straßenname im Ortsteil Häcklingen knüpft an einen älteren Flurnamen an. Er ersetzte die Bezeichnung Gerstenkamp von 1975 in einem Teil der Straßenführung. Douglas-Lister-Straße Ratsbeschluß vom 30.5.1991. Der schottische Geistliche Reverend Lister (1919- ), der als britischer Militärpfarrer nach Lüneburg kam, hat in den Nachkriegsjahren der Zivilbevölkerung Lüneburgs große Hilfe geleistet. Er rief zu einer privaten Spendenaktion in Schottland auf. Hunderte von Paketen gingen daraufhin bei ihm ein und wurden an die notleidende Bevölkerung verteilt. Angesichts seiner Verdienste wurde noch zu seinen Lebzeiten eine Straße nach ihm benannt. Drögenkamp Kein Ratsbeschluß. Noch vor der Eingemeindung nach Lüneburg hatte der Häcklinger Gemeinderat die Straße „Auf der Höhe“ am 1.3.1974 in Drögenkamp umbenannt, da der alte Name in Lüneburg bereits vorhanden war. 107
Drögenkamp nimmt einen Flurnamen auf. Drosselweg Ratsbeschluß vom 23.10.1958. Die Straße liegt in einem Quartier (Wilschenbruch), wo Namen heimischer Vögel als Straßennamen herangezogen wurden. Droste-Hülshoff-Straße Ratsbeschluß vom 18.5.1955. Benannt nach Annette Freiin v. Droste-Hülshoff (1797-1848), der bedeutendsten deutschen Dichterin des 19. Jahrhunderts. Düvelsbrook Kein Ratsbeschluß. Düvelsbrook – Teufelsbruch, drastische Bezeichnung für eine sumpfige Buschniederung, in die hineinzukommen vermutlich leichter war als wieder herauszufinden (Düvelstrate, platea diaboli in Lübeck 1293). Nahe liegt auch die Bildung des Wortes analog dem benachbarten Wülschenbrok, denn es gab mehrere bürgerliche Familien des Namens Duvel in Lüneburg (so auch Gr. und Kl. Düvelstraße in Hannover), u. a. einen Schmied Dietrich Duvel schon zur Zeit des Erbfolgekrieges; ein Schuster Düvelshof wird Bürger 1438. Düvelsbrok ist als Sommersitz der Patrizierfamilie Semmelbecker im Vierzehnhundert nachzuweisen, später gehörte es den Töbing und Düsterhop; Mitte des vorigen Jahrhunderts ist es ein Pachthof der Stadt geworden. Pratum in dumeto ut vocant des teufels bruche 1462; Zimmerleute bessern am düvelsbrock an dem slenge 1644; Stadtweide, Teufelsbruch genannt 1731; Düvels-Brok 1748. Düvelsbrooker Weg Ratsbeschluß vom 10.11.1954. Die Straße führt im Wohngebiet Bockelsberg von der Uelzener Straße zur Gartenkolonie Düvelsbrook. Ebelingweg Ratsbeschluß vom 27.5.1982. Benannt nach Johann Georg Ebeling (1637-1676). Er besuchte das Johanneum und war musikalisch sehr begabt. Sein bedeutendstes Werk ist wohl die Vertonung der Geistlichen Andachten von Paul Gerhard. Ein Teil der 120 Kirchenlieder findet sich heute noch im Evangelischen Kirchengesangbuch. Eckermannstraße Ratsbeschluß vom 24.5.1956. Benannt nach dem aus Winsen a. d. Luhe gebürtigen Privatsekretär Goethes Johann Peter Eckermann (1792-1854), der vier Jahre das Lüneburger Johanneum besuchte.
108
Edgar-Schaub-Platz Ratsbeschluß vom 21.7.1994. Mit der Namensgebung wurde Edgar Herbert Schaub (1910-1988), der langjährige Bürgermeister und Ortsbürgermeister der Gemeinde Ochtmissen (1960-1984), gewürdigt. Als Ratsherr der Stadt Lüneburg (1974-1986) hat er vor allem im Sportausschuß mitgearbeitet. Egersdorffstraße Kein Ratsbeschluß. Justizrat Georg Egersdorff, geboren in Lüneburg am 21. Januar 1858, gestorben daselbst am 30. Mai 1930, langjähriger Sekretär und Syndikus der Handelskammer, wurde 1913 Worthalter der Bürgervorsteher und hat sich in vielen gemeinnützigen Bestrebungen um seine Vaterstadt verdient gemacht. Die Gralstraße wurde nach seinem Tode nach ihm benannt. Eichenbrücker Straße Ratsbeschluß vom 22.10.1986. Die Straßenbenennung im OT Ebensberg würdigt die Tatsache, daß 1945 eine große Zahl von Bewohnern des Kreises Wongrowitz, seit 1942 Eichenbrück, in den Landkreis Lüneburg kamen. Eichendorffstraße Ratsbeschluß vom 10.11.1954. Benannt nach Joseph Freiherr von Eichendorff (1788-1857), einem bedeutenden deutschen Lyriker der Romantik. Eichenhain Ratsbeschluß vom 28.8.1975. Benannt nach einem kleinen Eichenbestand, an dem die Straße vorbeiführt. Eichenkamp Ratsbeschluß vom 28.6.1990. Die Straßenbenennung in Neu-Oedeme ist eine Zusammensetzung des niedersächsischen Charakterbaumes mit dem nddt. Wort für eingefriedetes Landstück. Eichenweg Ratsbeschluß vom 4.4.1944. Der von der Abzweigung der Erbstorfer und Artlenburger Landstraße nach der ehemaligen Lüner Rennbahn führende Weg erhielt diese Bezeichnung. Eichhornweg Ratsbeschluß vom 26.2.1959. 109
Namensgeber war der Land- und Amtsgerichtsrat Alfred Eichhorn, der 1925 eine Geschichte des Lüneburger Landgerichts publizierte. Eisenbahnweg Mit Bekanntmachung vom 4.4.1944 erhielt der Weg längs der Eisenbahn in Lüne diese Bezeichnung. Elbinger Straße Ratsbeschluß vom 25.8.1960. Benannt nach der Stadt Elbing in Westpreußen. Elsa-Brandström-Straße Ratsbeschluß vom 29.9.1994. Elsa Brandström (1888-1948) war die Gründerin eines Hilfswerkes für Gefangene und wurde als „Engel der Gefangenen“ verehrt. Elso-Klöver-Straße Ratsbeschluß vom 26.4.1973. Dr. rer. pol. Elso Hinrich Klöver (1893-1984) war seit 1921 wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit 1932 Syndikus bzw. Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg. Von 1948 bis 1961 leitete er die Geschäfte der IHK Lüneburg und förderte insbesondere den Plan eines Nord-Süd-Kanals. Elsterallee Ratsbeschluß vom 10.11.1954. Benannt nach einem heimischen Vogel aus der Familie der Raben. Elversstraße Kein Ratsbeschluß. Gegen 1890 angelegt hieß die Straße zuerst beim Hohengarten; Arbeiterwohnungen am Lindenberge beim Hohen Garten wurden schon 1873 erbaut. Seit 1890 Sechste Straße. Die neue Bezeichnung ist 1903 eingeführt zu Ehren der im Jahre 1701 in Lüneburg ausgestorbenen Ratsfamilie Elvers. Der Erste des Geschlechts, Elver von Wittingen, gelangte in den Rat 1264, er wurde Bürgermeister, und die gleiche Würde bekleideten fünf seiner Nachkommen. Leonhard IV. Elvers, † 1631, hat sich auch als Chronist betätigt. Emmy-Noether-Straße Ratsbeschluß vom 28.1.1999. Emmy Noether (1882-1935), Tochter eines Mathematikers und ebenfalls bedeutende Mathematikerin, hat die moderne Algebra grundlegend gefördert. Enge Straße 110
Kein Ratsbeschluß. Der gegenwärtige Name der schmalen Verbindungsgasse zwischen Racker- und Kuhstraße bedarf keiner Erläuterung. Die Ostseite hat wohl niemals ein selbständiges Wohnhaus besessen, und die Wohnbuden an der Westseite bildeten zu einem Teile, dem Gildehofe (1802, T a t e r g a n g 1794, Adreßbücher bis 1866 A c k e n h a u s e n g a n g) ein Zubehör des Eckhauses Grapengießerstraße 44, des alten Brauergildehauses. In platea transversali intra plateas ollifusorum et textorum 1482; Wohnhaus Hans Dithmers, Buden, Hof, Wurd in der klenen straten zwischen der Multer Gildehause und Hans Arndes, neben dem Pferdestalle des † Bürgermeisters Hinrick Tobing 1505; in der kleinen straten bi der fulen ouw twischen der bruwer gildehus und Jürgen Bruns backhuse 1580; platea angusta inter cerevisiariorum tribunitiam domum et pistrinam 1636; Engestraße 1794. Der Plan von 1765 führt für die Engestraße und ihre Verlängerung nach Süden den einheitlichen Namen Rackerstraße, ältere Quellen gebrauchen in der gleichen zusammenfassenden Weise Jahrhunderte hindurch die unerfreuliche Benennung F a u l e A u. Inmitten der Straße zog sich eine breite offene Rinne hin, eine sog. vrigote, die das Regen- und Schmutzwasser dieses Stadtteils aufnahm und es am Südende der Straße in die Gumma leitete. Au ist jedes fließende Wasser, vûl heißt schmutzig, stinkend; die Wirkung des Bächleins auf feinere Nasen mag danach übel genug gewesen sein. Ähnliche topographische Bezeichnungen sind in alten Städten nichts Ungewöhnliches. In Danzig gibt es neben einer Faulengasse einen Faulgraben, in Stade und Rostock eine Faule Straße, in Wismar eine Faule Grube usw. – In der wulen ouwe 1372; by der vulen owe wird vom Bauamt eine Schlammkiste gebaut 1411; achter der fulen ouwe ersteht ein Turm 1425; in der vulen ouwe by des rachersz hus hatte der Gastmeister die Straße sauberzuhalten (um 1430); up dem orde bij der vulen ouwe in dat osten ward 1435; Reinigung von Kisten bij der vulen auwe 1448; die Schoßrolle von 1452 unterscheidet unter dem Titel bij dem graven achter her Wangelouwen und bij der fulen ouwen; 1455 wird gesondert bij deme graven na sunte Johanse wart und na der vulen owe ward; in der vrigoten in der vulen ouwe dar de stadtmure was gevallen erfolgte eine städtische Lohnzahlung 1464; Haus Raven uppe der vulen ouwen orde 1476; Eckhaus HoyerStoterogge beim Hause Töbing et plateam vulg. nuncup. de vule ouwe, Haus Vlotwedel-Snewerding in acie plateae vulg. nunc. de vule ouwe 1492; in de wullenveverstraten up deme orde alsze men na der vulenouwe geyt 1510; Haus Dithmers zwischen dem Mültergildehause und Haus Bruns Häusern in der straten jegen der fulen ouwe 1537; Eckhaus Bunemann in acie qua itur na de vulen ouwe in pl. s. spiritus 1547; Brauns kauft ein Backhaus in acie et solarium sive einen sael apud der vulen ouwe 1587; sechs Wohnbuden penes der faulen owe 1647; auf der faulen ow retro domum cerevisiariorum communem 1650. Nach Schomaker nahmen die fliehenden Feinde, die vom Roten Tor dem Sülztore zustrebten, in der Ursulanacht ihren Weg by der muren wech dorch dat vule loch; by dem vulen locke an dem torne Van baven fiel der Ratmann Hinrik vam Sande. Vgl. Gumma- und Rackerstraße. Erbstorfer Landstraße Kein Ratsbeschluß. Nach der Eingemeindung des Ortsteils Lüne erhielt die von der Artlenburger Landstraße abzweigende Chaussee nach Erbstorf diese Bezeichnung. Bekanntmachung vom 4.4.1944. 111
Erfurter Straße Ratsbeschluß vom 25.8.1960. Benennung nach der heutigen Hauptstadt des Landes Thüringen. Erlengrund Ratsbeschluß vom 9.5.1990. Die Straße in der Nähe des Hasenburger feuchtigkeitsliebenden Birkenart benannt.
Baches
ist
nach
einer
Ernst-Braune-Straße Ratsbeschluß vom 28.5.1959. Umbenennung der 1924 angelegten Straße Mittelfeld (alter Flurname). Ernst Braune, geb. 1879, gest. 1954, war Oberbürgermeister der Stadt Lüneburg von 1946 bis 1949 und Mitglied des Niedersächsischen Landtages von 1946 bis 1954. Ernst-Ehlers-Straße Ratsbeschluß vom 18.10.1956. Benannt nach dem aus Lüneburg gebürtigen Zoologen und Universitätsprofessor in Göttingen (1835-1926). Erwin-von-Witzleben-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Der Generalfeldmarschall (1881-1944) war einer der Hauptbeteiligten am HitlerAttentat vom 20.7.1944 und bis 1942 Oberbefehlshaber West in Frankreich. Am 8.8.1944 wurde er vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am 9.8.1944 hingerichtet. Eulenweg Kein Ratsbeschluß. Durch Bekanntmachung vom 4.4.1944 erhielt der Weg von der Eisenbahnüberführung der Wittenberger Bahn bis zum Forsthaus Tiergarten diese Bezeichnung. Fährsteg Ratsbeschluß vom 28.11.1968. Der Weg zur ehemaligen Kaserne des Bundesgrenzschutzes erinnert an die dort einst betriebene Fähre über die Ilmenau. Falkenhorst Ratsbeschluß vom 24.4.1964. Benannt nach der Bezeichnung für eine Greifvogelbehausung.
112
Oberbürgermeister Ernst Braune (1879-1954)
Fasanenweg Kein Ratsbeschluß. Bezeichnung für die Verbindung Bekanntmachung vom 4.4.1944.
des
Reiherstiegs
mit
dem
Sperberweg.
Feldstraße Kein Ratsbeschluß. In ihrer älteren, westlichen Hälfte, von der Braunschweiger Chaussee bis zur Volgerstraße, angelegt nach 1875, blieb die Feldstraße etwa zwei Jahrzehnte hindurch einseitig bebaut, die Häuser hatten daher freien Ausblick auf das Feld, das damals als Garten- und Ackerland bewirtschaftete Rote Feld, d. h. die aus Wald und Heide gerodete Ackerflur. Mit dem 20. Jahrhundert hat die Feldstraße ihre freie Belegenheit eingebüßt, dafür hat sie erhöhte Bedeutung gewonnen durch die Monumentalbauten des Gralstifts (1905) und der Höheren Mädchenschule (1908). Fichtenweg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Da in Lüneburg bereits die Bezeichnung „Am Sande“ vorhanden war, wurde die Straße durch Beschluß des Ochtmisser Gemeinderates vom 26.2.1974 nach der Eingemeindung des Ortes nach Lüneburg in Fichtenweg umbenannt und dann offiziell von der Stadt übernommen. Finkenberg Kein Ratsbeschluß. Seit Mai 1925 festgelegt auf Grund alter Flurbezeichnung. Von 1933 bis 1945 HorstWessel-Straße, während zu gleicher Zeit ein Teil der Bögelstraße, von der Höhe bis zum Grasweg, Finkenberg hieß (vgl. S. 89). Finkenhütte Kein Ratsbeschluß. Die Namensgebung in Oedeme erfolgte nach einer alten Flurbezeichnung. Finkenweg Ratsbeschluß vom 23.10.1958. In Wilschenbruch wurden einheimische Vögel als Namengeber für Straßen bevorzugt. Finkstraße Kein Ratsbeschluß. Die schmale Verbindungsstraße zwischen den Brodbänken oder der Rosen- und der Münzstraße, die heutige Finkstraße, hieß ehemals mit humorvollem Doppelsinn die b r o t l o s e t w i t e. Brodbänke gab es dort nicht mehr, und den ärmlichen Anwohnern mochte der Kampf um das tägliche Brot schwer genug fallen. Platea dicta de brotlose twite 1420; in der broetlosen twyten (straten) 1486, 1500 und 1502; 114
Johann Töbing kaufte 1574 ein Haus in acie platee que vocatur de brothlose twijte und muntestraße; genauer sagt eine andere Urkunde desselben Jahres: zwei bisher vom Prediger Jodocus Matthias und dem Schreibmeister Hinrich Berchmann bewohnte Häuser samt einem Platze am orde der brottloszen twiten und am ende der Muntestraten jegen der Wostenwort aver. Zwei Jahre zuvor erstand der Bürger Heino Finx ein Brauhaus in platea que vocatur die rosenstraße in acie der brothlosen twiten. Mit dieser Nachricht ist der Wechsel des Namens erklärt, denn das Eckhaus Rosenstraße/Brotlose Twite (Rosenstraße 1) blieb vier Generationen hindurch in Händen der Brauerfamilie Vinckes (Vincks, Finckes, Fincks, Vinx, Finx). Pfingststraße 1765 und 1802; in den Schoßrollen von 1833 ff. führt erwähntes Eckhaus die Bezeichnung Rosenstraße, am Orte Finkstraße; 1832 vereinzelt (und unrichtig) Titter- oder Finkstraße. Das Haus an der Südwestecke war nach Gebhardis Plan die Herberge für Leinweber und Böttcher. Die Brotlose Twite begegnet noch 1671 als platea rosarum ad aciem dictae brodtlohsen twiten.∗ Fliederstraße Kein Ratsbeschluß. Übernommen aus dem 1943 eingemeindeten Ortsteil Hagen. Flörekeweg Ratsbeschluß vom 25.8.1954. Benannt nach Nikolaus Flöreke, Lüneburger Ratsnotar und Stadtchronist, gestorben 1378. Föhrenweg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Da in Lüneburg bereits ein „Kiefernring“ vorhanden war, wurde die Straße in Ochtmissen nach der Eingemeindung durch Gemeinderatsbeschluß vom 26.2.1974 in „Föhrenweg“ umbenannt und so von der Stadt offiziell übernommen. Fontanestraße Ratsbeschluß vom 28.1.1960. Benannt nach dem deutschen Dichter und Journalisten Theodor Fontane (1819-
1898).
Franz-Anker-Straße Ratsbeschluß vom 28. Februar 2002.
∗
Sollte nicht auch die „Brocklosengasse“ in Danzig, deren Deutung dem Bearbeiter der Danziger Straßennamen Schwierigkeiten bietet, in gleicher Weise zu erklären sein, wie oben? Stephan hat allerdings an älteren Lesarten nur „Broklosegasse“ 1415 und „Bruchlozegasse“ 1416, erst Ende des 18. Jahrhunderts trifft er auch „die verderbte Form Brodlosegasse“; er versteht daher „brôk“ als sumpfige Niederung, „lôs“ als zwickelförmigen Streifen, aber ganz wie in Lüneburg läuft auch in Danzig die „Brocklosengasse“ im rechten Winkel auf die „Brodbänkengasse“ zu. Der Ortsname Brocklosenborstel bei Stade ist ebenfalls hier heranzuziehen, denn seine älteste Lesart ist „Brotlosenborstelde“. 115
Der Namenspatron (1905-1994) der Straße kam 1945/46 mit seiner Familie als Flüchtling aus Ostpreußen nach Hameln, wo er ein Fuhrunternehmen aufbaute. 1953 kam Franz Anker nach Lüneburg und war jahrzehntelang hier als Ford-Haupthändler tätig. Als Unternehmer aus den ehemaligen Ostgebieten des deutschen Reiches spielte er eine wichtige Rolle beim wirtschaftlichen Wiederaufbau Lüneburgs. Fraunhoferstraße Ratsbeschluß vom 26.3.1959. Benannt nach dem Physiker Joseph von Fraunhofer (1787-1826). Friedenstraße Ratsbeschluß vom 29.6.1949. Die nach Niederlegung des Rotenwalles und Zuschüttung des Stadtgrabens im Jahre 1860 (Wohnhaus Leppien) angelegte Straße hieß bis 1887 v o r d e m R o t e n – t o r e und erhielt ihren späteren Namen zur Erinnerung an den Frankfurter Frieden. Die Schaffung der Anlagen folgte 1874, der Rest des Rotenwalles zugänglich seit 1875. Von 1939 bis 1945 zusammen mit der Haagestraße (vgl. S. 118) GauleiterTelschow-Wall benannt, durch Verfügung der Militärregierung vom 20.6.1945 geändert in Roter Wall, seit 1949 wieder Friedenstraße. Friedenstraße 7 a neue katholische Kirche St. Marien, geweiht 5.5.1963. Friedrich-Ebert-Brücke Ratsbeschluß vom 29.1.1976. Mit der Benennung der Brücke nach Kaltenmoor wurde der sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert (1871-1925) gewürdigt. Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße Kein Ratsbeschluß. Seit 1936 statt der Bezeichnung i m R o t e n F e l d e. Der Vater der Turnkunst – er hat auch den Namen gegeben – ist als Sohn eines evangelischen Landpfarrers am 11. August 1778 geboren in Lanz bei Lenzen in der Priegnitz. Auf einer seiner Wanderfahrten schrieb er in Lüneburg 1813 seine Runenblätter (Gedenktafel am Hause Lünertorstraße 19). Sein Hauptwerk Deutsches Volkstum erschien 1810, sein Buch über die deutsche Turnkunst 1816. Nach dem Wiener Kongreß, zumal nach dem Wartburgfest 1817, als das Turnen verboten war, gelangte er, hochverräterischer Umtriebe verdächtigt, in Festungshaft, um erst 1825 freigesprochen zu werden. Mitglied der Frankfurter National-Versammlung 1848. Gestorben in Freyburg an der Unstrut am 15. Oktober 1852. Friedrich-Penseler-Straße Ratsbeschluß vom 29.8.1996 und 20.1.2000. Die Straße „Querkamp“ und eine Verbindungsstraße zu ihr erhielten den Namen des Begründers einer Tapetenfabrik in Lüneburg (1821).
116
Fritz-Reuter-Straße Ratsbeschluß vom 21.2.1951. Benannt nach dem nddt. Schriftsteller und Sozialrevolutionär (1810-1874). Fromme Straße Kein Ratsbeschluß. Seit 1893 für die Verbindung der Bastionstraße und Am Springintgud; Verleihung des Namens am 1. August gen. J. zu Ehren des Lüneburger Oberbürgermeisters Ludolph Ulrich Fromme. Geboren in Sievershausen, wurde F. am 28. Dezember 1859 als Amtmann zu Dannenberg an die Spitze der Lüneburger Stadtverwaltung berufen. Eingeführt am 1. Februar 1860, hat er in der schwierigen Zeit nachhaltiger politischer Umwälzungen mit großer Hingebung und Pflichttreue seines Amtes gewaltet, bis die Rücksicht auf seine leidende Gesundheit ihn nötigte, zum 1. Januar 1881 seinen Abschied zu nehmen. Er starb fast 83jährig am 12. Mai 1896. Fuchsweg Kein Ratsbeschluß. Diesen Namen erhielt mit dem 4.4.1944 die bisherige Weststraße vor dem Flugplatz. Garlopstraße Kein Ratsbeschluß. Verlängerung der durch die Garlopenwohnungen charakteristischen Reitendendienerstraße nach Norden hin. Die Benennung wurde notwendig nach Herstellung des Walldurchbruchs i. J. 1910. Eine Verbindungsfahrbrücke über den alten Stadtgraben ist 1940 wieder gesprengt. Die Patrizierfamilie Garlop, im Rate seit 1272, im Mannesstamme erloschen 1558, hat sich in der Geschichte der Stadt einen Ehrenplatz gesichert. Der Ratmann Clawes Garlop fiel als eines der ersten Opfer der Ursulanacht 1371; er erhielt am Turme V r e d e k e zwischen Kalkberg und Sülze, wo der Tod ihn ereilte, ein Denkmal aus Stein, das im Siebzehnhundert noch an der alten Stelle stand. Fünf Bürgermeister sind aus der Familie hervorgegangen. Der letzte von ihnen, Bürgermeister Hinrik Garlop, stiftete testamentarisch ein aus 6 Wohnungen bestehendes Gebäude, das nach Ermessen des Rates den Stallbrüdern oder Reitendendienern überwiesen werden sollte. Der gleichnamige Sohn des Stifters, der letzte des Geschlechts, brachte mit seinem Schwager Franz v. Witzendorff das Vermächtnis in erweitertem Maße zur Ausführung (zu vgl. Kunstdenkmäler 307 ff.). Gartenstraße Eingeführt im Jahre 1884 für den Weg nach Westedts Garten statt des allgemeineren vor dem Bardewikertore, war der Name insofern an seinem Platze, als sich in dem Gelände nördlich des Bardewikerwalles von alters weite Gartenanlagen erstreckten, wie in beschränkterem Maße noch gegenwärtig zu erkennen ist. Das Kloster Heiligenthal verpachtete einen Garten vor dem Bardewikertore bij deme rosenplane an den Apotheker Mathies van der Most 1469; dasselbe Kloster überließ dem Bürgermeister Sankenstede einen Garten mit Zäunen, Graben und Zubehör beleghen buten deme Bardewikeren dore by deme Rosengharden unde by des apothekers gharden 1484. Die Umzäunung (slenges) um den R o s e n k a m p 117
des Rates buten dem Bardewiker dare wurde 1585 erneuert; Garten bei dem Rosenpole, beim Rosenpfuel furm Bardwicker Thor 1603; Gärten, u. a. des Pastors von St. Nicolai, ante portam Bardovicensem prope lacum rosarum 1628, der Bürgermeisterwitwe Elvers und des Apothekers extra portam Bard. in fine paludis rosarum apud hagepiscinam 1632; rasenpool oder Böttcherteich südlich vom Ratsapothekengarten, auf Gebhardis Plan an der Chaussee nach Harburg, aus dem 1700. Städtisch waren i. J. 1731 noch der Guldische Garte oder Güldengarten an der Ecke nach der Bardewiker Landstraße – er trug seinen Namen vom Acciseeinnehmer Gülden, dem i. J. 1693 die Anlage eines Kruges gestattet wurde -, ferner der olim Finx Garte, ein Bürgermeistergarten südlich der Kreitenkule und der v. Ditmers-Garten; in der Nähe lag der Ratsapothekergarten und der Papengarten, letzterer vielleicht identisch mit einem ehemaligen Grundstück des Klosters Heiligenthal. Die Namen Westäds (früher Trammans) Garten und Hedemanns Garten, ebenfalls mit einem Teich, sind noch heute alten Lüneburgern wohl vertraut. Zur Gartenstraße gehört seit 1894 auch ihre westliche Verlängerung, die i. J. 1890 bebaute, an Hedemanns Garten beginnende, zunächst sog. D r i t t e S t r a ß e , im Volksmunde als Langer Jammer bezeichnet. Z. vgl. Hindenburg Straße. Gartenweg Kein Ratsbeschluß. Bei der Eingemeindung Oedemes im Jahre 1974 wurde die Straßenbezeichnung übernommen. Gaußstraße Ratsbeschluß vom 25.3.1953. Benannt nach dem Göttinger Mathematiker und Astronomen Karl Friedrich Gauß (1777-1855). Gebhardiweg Ratsbeschluß vom 25.3.1955. Johann Ludwig Levin Gebhardi (1699-1764), Historiker und Professor an der Ritterakademie in Lüneburg. Dessen Sohn Ludwig Albrecht Gebhardi (1735-1802) folgte seinem Vater im Lehramt an der Lüneburger Ritterakademie und war dann seit 1799 Archivar, Bibliothekar und Hofhistoriograph in Hannover. Gebrüder-Heyn-Straße Ratsbeschluß vom 22.6.1976. Benannt nach der im 19. Jahrhundert in Lüneburg bedeutenden Unternehmerfamilie Heyn. Geibelweg Ratsbeschluß vom 18.5.1955. Nach dem Lübecker Lyriker Emanuel Geibel (1815-1884) benannt. Gellersstraße 118
Kollegienbeschluß vom 8.10.1901. Der Lüneburger Einwohner Christian Ludwig Gellers nahm an der kriegerischen Erhebung der Stadt gegen die Franzosen zu Beginn der großen Befreiungskämpfe tätigen Anteil und wurde nach Rückkehr der Truppen Morands auf seinem Posten im Altenbrückertore mit den Waffen in der Hand ergriffen. Am 1. April 1813 fand draußen vor genanntem Tore seine Erschießung statt. Fünfzig Jahre später wurde ihm und seinem Leidensgefährten, dem Bürger Spangenberg, an der Dahlenburger Landstraße, nahe dem Platze, wo der traurige Akte vollzogen war, ein Denkstein errichtet. Georg-Böhm-Straße Ratsbeschluß vom 3.4.1947. Georg Böhm, bekanntester Vertreter des sog. norddeutschen Musikbarock in Lüneburg, war von 1698 bis 1733 Organist an der St.-Johanniskirche. Die 1939 im Ortsteil Hagen angelegte Straße führte zunächst die Bezeichnung Bülowstraße und wurde dann umbenannt. Georg-König-Straße Ratsbeschluß vom 18.10.1956. Georg König (1861-1938) wurde Senator der Stadt Lüneburg 1889, Syndikus 1894 und war Oberbürgermeister von 1901-1919. Georg-Leppien-Straße Ratsbeschluß vom 29.8.1996. Georg Leppien (ca. 1780-1850)∗ gründete 1837 eine Roßhaarspinnerei und Haartuchfabrik in Lüneburg und gehörte zu den bedeutendsten Unternehmern der Stadt. Gerberstraße Ratsbeschluß vom 10.12.2001. Im Neubaugebiet Oedeme-Süd soll ein Quartier mit Straßenbezeichnungen nach alten Handwerksberufen entstehen. Gerber gab es in Lüneburg schon im 14. Jahrhundert in enger Verbindung mit dem Amt der Schuhmacher. Gerhart-Hauptmann-Straße Ratsbeschluß vom 18.5.1955 und vom 28.1.1960. Benannt nach dem Nobelpreisträger für Literatur und Bühnendichter (1862-1946). Gerstenkamp Ratsbeschluß vom 28.8.1975. Die Straße liegt in Häcklingen in einem Quartier mit Benennungen nach Getreidesorten.
∗
Genauere Lebensdaten nicht feststellbar. 119
Ginsterweg Ratsbeschluß vom 29.6.1949. Die Straße wurde nach einer Gruppe von Schmetterlingsblütlern benannt, von denen einige Heidegebiete bevorzugen. Gleiwitzer Straße Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Im Wohngebiet Ebensberg erfolgte die Vergabe von Straßennamen nach Orten in den ehemaligen Ostgebieten Deutschlands. Die Stadt Gleiwitz/Gliwice (Oberschlesien) liegt heute in Polen. Glockenstraße Kein Ratsbeschluß. Das zu den ältesten Profanbauten der Stadt gehörende imposante Gebäude, welches an der Nordseite den größten Teil der Glockenstraße einnimmt und als Glockenhaus lange Zeit die Volksküche beherbergte, hat mit dem Namen der Straße nur einen indirekten Zusammenhang. Es wurde im Jahre 1483 als städtisches bussenhusz errichtet und hieß noch 1526 domus bombardarum, während die Glockenstraße schon an die 100, die Glockengießerstraße 50 Jahre früher begegnet. Das Büchsen- oder Zeughaus erstand jedoch an eben derjenigen Straße, wo schon vorher ein Glockenhaus gestanden hatte und von alters die Glockengießer ihr kunstvolles Handwerk ausübten. Übrigens wird das Büchsenhaus schon 1483 auch klockenhus genannt; der Doppelname ist um so natürlicher, als den Glockengießern vielfach auch der Guß von Geschützen oblag, und es umgekehrt nichts Auffallendes hatte, daß die städtischen Büchsenmeister, welche die Schlangen und Bombarden anfertigten, auch den Guß von Kirchenglocken besorgten. In dem klokkenhove war ein Wächter angestellt 1410; in dem klokkenhuse und hove lagerte Zimmerholz, denn eben dieser Hof wurde auch als Ratsbauhof wie bis in die 2. Hälfte des 20. Jh. so schon im 1400 benutzt; der Ratszimmermeister hatte Anspruch auf alle Spöne, uthbescheden des rades buwhoff bey deme clockenhuse, 1415; in dem klokkenhave standen nach der Bauamtsrechnung von 1427 dreitausend Dachpfannen (dakes), fünftausend Pfannen wurden verwandt, dat kornehus daselbst zu decken; bi dem klokhus 1431; iuxta plateam vulgariter dictam de clockenstrate 1445; in der kokenstrate Schoßrolle 1462 und 1463, wohl versehentlich statt klockenstrate, wie jüngere Rollen des Jahrhunderts schreiben; in angulo platee campanaris et minoris platee pistorum ubi fons communis adiri solet – noch ist an der äußeren Längseite des Hauses Kleine Bäckerstraße 19 die Stelle zu sehen, wo das Brunnenrohr auf die Straße mündete. Eckhaus Nyeman-Meyger in pl. fusorum campanarum 1472; pl. campanarum 1478; Haus Lampe-Usseler in acie pl. campanarum et min pl. pist. 1491; Haus Mutzeltin-Glöden in angulo vel acie pl. campanalis ex opposito monasterii sacre vallis 1516; Brauhaus Albrecht-Kroger in acie pl. campanarum ex adverso auree platee 1524; Haus Wackerhagen-Struwen in pl. pist. ac acie pl. campanarum 1526, es reicht mit Zubehör usque ad domum bombardarum; im Jahre 1600 vermachte Franz Düsterhop sein Haus bei dem Heiligenthal an der Klockenstraße mit Backhaus und allem Zubehör im Werte von 6000 M dem Bewohner, seinem Sohne Hieronymus; Klokkenstraße 1765, 94 und 1802. Die Straßenerweiterung am Ostende der Glockenstraße hieß nach Gebhardi-Manecke ehemals der Plan. 120
In Lübeck platea campanariorum 1285, in Hamburg Glockengießerwall. Glogauer Straße Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Im Wohngebiet Ebensberg erfolgt die Vergabe von Straßennamen nach Orten in den ehemaligen Ostgebieten Deutschlands. Glogau/Glogów (Niederschlesien) liegt an der Oder und hat eine lange Geschichte als Festungs- und Hafenstadt. Es gehört heute zu Polen. Gneisenaustraße Kein Ratsbeschluß. Seit März 1936. Als Offizierssohn am 27. Okt. 1760 in Schildau geboren, starb Generalfeldmarschall Graf August Neithardt von Gneisenau am 24. August 1831 in Posen. Er gehörte zu den preußischen Reformern um Stein und Scharnhorst. Goebelstraße Ratsbeschluß vom 30.4.1959. Benannt nach Hermann Goebel (1818-1893), dem Erfinder der elektrischen Glühlampe. Görgesstraße Kein Ratsbeschluß. Seit dem 1. Januar 1909 auf Anregung der Bürgervorsteher statt Untere Neuetorstraße. Auszeichnung, übermittelt zum 70. Geburtstage des nach fast 45jähriger Tätigkeit am Johanneum zu Ostern 1908 in den Ruhestand getretenen Oberlehrers Professor Wilhelm Görges, geb. in Lüneburg am 24. April 1838, Stadtbibliothekars von 1879-1922, gest. am 23. März 1925; zugleich eine Ehrung für dessen Vater, verehrten Pastor an der nahen Michaeliskirche, an der er 57 Jahre gepredigt hat. Senior Görges, Sohn eines Professors an der Ritterakademie, ist geboren am 25. Januar 1803, gestorben am 1. Dezember 1893. Die Untere Neue Torstraße führt auf dem Plan von 1765 und entsprechend in älteren Quellen den Namen vor dem neuen Thor (vom unteren Ende des Michaelisfriedhofes ab), der Plan von 1802 vermerkt vor der St. Michaeliskirche. Das Eckhaus Nr. 19, ein alter Besitz der v. Meding, war zu Gebhardis Zeit zweites Pfarrhaus von St. Michaelis, Nr. 1 gegenüber war die Amtsschreiberwohnung. Im Hause Nr. 3 wohnte im Frühling 1813 Johanna Stegen; vom Portal dieses Hauses reichte sie am Morgen des Gefechtstages den durchziehenden Verbündeten eine Erfrischung. Am westlichen Ausgange der Görgesstraße stand im heutigen Seminargarten (nach Manecke dem Kloster St. Michaelis gegenüber, da wo jetzt die Heerstraße zum Neuentore hinausgeht) die Cyriakskirche, die Pfarrkirche der Altstadt. Sie hatte infolge der tiefgreifenden Umwälzungen der Stadtbefestigung i. J. 1371 das Mißgeschick, vom Mauerringe ausgeschlossen zu werden, verlor dadurch sehr an Bedeutung und ist 1639, der Rest 1651 abgebrochen; der zugehörige Friedhof wurde auf das Gelände östlich vom Mönchsgarten (Neuer Friedhof) verlegt. Erste 121
Prof. Wilhelm Görges (1838-1925)
Begräbnisse dort 1876. Diesemnach hieß der Platz die Cyriakswiese bis dahin, daß er bei Umlegung des Neuentores in Gartenland und Heerstraße umgeschaffen wurde (Manecke). Auf den Cyriaksfriedhof ist es wohl zu beziehen, wenn ein Mitglied des Rates 1247 nach seiner Wohnung iuxta cimiterium heißt; iuxta cim. s. Ciriaci lag das Haus eines Apothekers 1294; zwei Häuser des Ritters Wasmod apud s. Cyriacum 1295; Bischof Johann von Lübeck schenkte der Kirche seinen Erbhof iuxta dotem eccl. parochialis s. Ciriaci in Luneborch 1348; ex opp. cymiterii s. Cyriaci 1357; ein Hof der Burgmannenfamilie Kind by sunthe Cyriakes kerchove ging an das Michaeliskloster über 1368; eccl. s. Cir. olim intra muros nunc vero extra muros situata 1373 Nov. 25; neues Tor by sunte Ciriacus 1467. Görlitzer Straße Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Am o. a. Ratsbeschlußdatum erfolgte die Widmung der Straße. Im Wohngebiet Ebensberg werden die Straßennamen nach ehemaligen Orten in den deutschen Ostgebieten und in Mitteldeutschland vergeben. Die Stadt Görlitz liegt an der Neiße in Brandenburg. Ihr östliches Stadtgebiet (Zgorzelec) gehört heute zu Polen. Goethestraße Kein Ratsbeschluß. Der 1938 als Kurhausallee angelegte Straßenzug wurde 1951 in seinem westlichen Teil (Hs. 18) in Goethestraße umbenannt. Namengebend war der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Göxer Weg Kein Ratsbeschluß. Bezeichnung seit April 1944 für den nach Göxe führenden Weg. Gorch-Fock-Straße Ratsbeschluß vom 10.11.1954. Die Straße wurde nach dem Erzähler Johann Kinau (1880-1916) benannt, der unter dem Namen Gorch Fock publizierte. Goseburg Gänseburg, an der unteren Ilmenau nahe der städtischen Weide, auf nicht städtischem Boden, ein Gehöft, auf dem nach altem Herkommen keine Kühe gehalten werden durften, damit der gemeinen Weide kein Abbruch geschähe; erste Erwähnung der Goseburg 1616. Goseburgstraße Kollegienbeschluß vom 6.5.1902. In der Breitenwiese, erst 1902 entstanden, infolge Anlage der Lüneburger Tapetenfabrik von F. Enckhausen sowie der chemischen Fabrik von Kausch und Kretzer; die Straße führt nördlich der Eisenbahn in ungefährer Süd-Nord-Richtung auf die vorstehend erwähnte Goseburg zu. 123
Gottfried-Keller-Straße Ratsbeschluß vom 28.10.1960. Benannt nach dem ersten Staatsschreiber und schweizerischen Schriftsteller (18191890), der wesentliche Prägung in Berlin erfuhr. Grabenweg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Der Name knüpft an die Belegenheit in der Nähe eines kleines Baches an. Grabower Straße Ratsbeschluß vom 25.8.1960. Nach der Stadt Grabow in Mecklenburg benannt. Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Oberst Claus Graf Schenk von Stauffenberg (1907-1944) war Stabschef einer Panzerdivision in Afrika und nach schwerer Verwundung beim Befehlshaber des Ersatzheeres. Er gehörte seit 1943 zum Widerstand gegen Hitler und legte am 20.7.1944 die Bombe im Hauptquartier Hitlers in Rastenburg. Die Tat hatte keinen Erfolg; Graf Schenk von Stauffenberg wurde verhaftet, standrechtlich zum Tode verurteilt und sofort erschossen. Graf-von-Moltke-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Helmut James Graf von Moltke (1907-1945) sammelte auf dem elterlichen Gut Kreisau (Schlesien) Gegner des Nazi-Regimes um sich. Er wurde am 20.7.1944 verhaftet und am 23.1.1945 in Berlin hingerichtet. Grapengießerstraße Kein Ratsbeschluß. Der dreifüßige Grapen ist der Kochtopf des mittelalterlichen Haushaltes. Er gehörte zum unentbehrlichen Wirtschaftsgerät, war oft durch eine Hausmarke gekennzeichnet und geschützt, über seinen Besitz wird in den Testamenten gern ausdrücklich verfügt. Die Gediegenheit der metallenen Grapen wurde nach dem Vorgange Lübecks durch eine Ratsverfügung des Jahres 1444 van menginge der grapenspysze gewährleistet. Zu einer eigenen Innung scheinen die Lüneburger Grapengießer es nicht gebracht zu haben. Für die Entstehung des Straßennamens ist es von Interesse, daß nach Ausweis der Schoßlisten die Grapengießerstraße noch im Vierzehnhundert bewohnt wurde von den Erzgießern Heyno Gropengheter, Jacob Apengeter, Johannes Hesse, Hinrik, Gerbert und Hans Konouw, Hinrik Ridder, Hinrik Wijchel, Carsten Ribbeken, Hans Apengeiter. Das Eckhaus Nr. 16 an der Kuhstraße besaß 1430-61 Mester Helmed Reker, ein Büchsenschütz, mit ihm, seit 1460, und nach ihm der Grapengießer Bartelt van der Rijt und 1506/36 (dessen Sohn) Hinrik van der Lijt. Haus Nr. 26 gehörte nacheinander den Glockengießern 124
Hans Meyer (bis 1587), Andreas Heineke (bis 1601) und der Glockengießerfamilie Voß (1602-1733). Von Kupferschmieden wurde die Straße bis in die jüngere Zeit hinein bevorzugt. Platea que gropengheterstrate dicitur 1347; pl. dicta gropengeterestrate 1348; pl. ollifusorum 1356; an der gropengheterstrate besaß Henneke, der Sohn des Gereke Gropengheters, Grundstücke 1363; pl. ollificum 1385; ein Notstall vor dem Hause eines Schmiedes mußte von der Grapengießerstraße weggenommen werden für die vierzehn Tage des Michaelismarktes 1411; Hans Reynstorp erhielt vom Rate die Erlaubnis zum Bau eines Notstalls vor seiner Tür in der gropengeterstrate 1439, desgl. Bernd Voltzeke 1442; der Bürger Hans Kunow verkaufte das Haus seines verstorbenen Vaters in platea ollifusorum zwischen Gerbert Kunow und Hinrik Ridder ollifusor 1474; 1475 bewohnte Hans Mors in der Grapengießerstraße ein Haus uppe deme orde beneven hern Hinrickes husze van der Molen aver; vor der Tür ein Notstall und in dem kleinen Hause eine Esse für einen Schmied; in der gropengheterstrate neffen der slegertwyten over 1482; die Wwe. des Bürgermeisters Töbing bewohnte 1511 ein Brauhaus in der grapengheterstrate bet in de wullenweverstraten; in superiori pl. aeramentariorum fusorum 1601 und 13; pl. fusorum aeris 1630: pl. fusorum lebetum 1633; pl. aeneorum fusorum 1635; pl. quae vulgo dicitur der grapengieszer 1643, platea aeraria 1672; pl. aeramentariorum 1676; an der Grapengießerstraßen in Trosten Hause wohnte der Goldschmied Frantz Krahmer (Nachricht von 1697); der Losbäcker Franz Bielenberg erhandelte sein Backhaus in der Grapengieserstraße von der Kämmerei 1716; Grapengießerstrate 1765; noch der Plan von 1802 unterscheidet Obere und Untere Grapengießerstraße. An der Grapengießerstraße lag das Brauergildehaus (Westecke der Engen Straße), vordem ein Schmiedehaus, 1477 gekauft und 1502 neu gebaut; der Rat gab dazu 8 Wispel Kalk und 6000 Mauersteine. Das Gildehaus der Mülter und Brauer uppe deme orde neffen Berteldes van der Lyte wonehusze soll jährlich einmal armen Leuten eingeräumt werden zu einem Gastmahle 1485. An derselben Straße lag ferner das Haus der Katharinengilde (Nr. 40?), bezeichnet 1608 als Gildehaus der Zimmerer und Maurer, domus fabrorum lignariorum et murariorum. Die Bäckerei Nr. 41 ist als Backhaus bis in das Vierzehnhundert zurück nachzuweisen. Der architektonisch bemerkenswerte Bau an der Ostecke der Engen Straße ist ein altes Patrizierhaus, bewohnt 1482 von van der Molen; Flügelbau des Bürgermeisters von Witzendorff 1620. Nr. 12 war das Brauhaus des reichen Hinrik Kröger. Nr. 48 (Heßling) war früher die Herberge der Büchsenmacher, Messerschmiede, Riemer und Sattler, der Schlosser und Tapezierer. 1834 August 30 vernichtete eine Feuersbrunst, ausgehend von einem Stalle des Brauers Behn auf dem Sande, 3 Häuser an der Grap.straße (Riemer Buchholz, Böttcher Hargus und Papiermacher Kohlmeyer), sowie ein Haus an der Hl. Geiststraße (Tischler Ließ), dazu einige Ställe. In Lübeck fossa figulorum 1262, gropengrove 1307, jetzt Große und Kleine Gröpelgrube; eine Grapengießerstraße auch in Rostock. Graudenzer Straße Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Der Namensgebung der Straße im Stadtteil Ebensberg liegt die Stadt Graudenz/Grudziądz an der Weichsel zu Grunde. Sie gehörte zum Kulmer Land und ist jetzt Kreisstadt in der Woiwodschaft Bromberg/Polen. 125
Gravenhorststraße Kein Ratsbeschluß. Angelegt während der Erbauung der neuen Höheren Mädchenschule an der Feldstraße 1907; so benannt in Anlaß des 70. Geburtstages des damaligen Bürgervorsteherworthalters. Geh. Justizrat Karl Gravenhorst, geboren 27. Januar 1837 in Carrenzien (Kreis Bleckede), hat seine Schulbildung auf dem Johanneum zu Lüneburg genossen und eben diese Stadt als Stätte seiner Wirksamkeit erwählt für ein ganzes, reiches Mannesleben. Neben der ausgedehnten Praxis des Rechtsanwalts war es das kommunale Arbeitsfeld in allen seinen Verzweigungen, das den bis in die letzten Lebenstage unermüdlich Tätigen gefangennahm. Gravenhorst hat 46 Jahre als Bürgervorsteher gewirkt, 38 als deren Wortführer. Seine außerordentlichen Verdienste um das Wohl der Stadt wurden im Jahre 1900 durch die Verleihung des Ehrenbürgerbriefes anerkannt. Auf Gravenhorsts eigene Anregung wurde für die Straße zwischen dem Gralgebäude und dem Lyzeum im Schillergedächtnisjahre 1905 zunächst der Name Schillerstraße (zu vgl.) in Aussicht genommen, die Änderung in Gravenhorst Straße erfolgte auf Wunsch der Bürgervorsteher. Karl Gravenhorst ist gestorben am 4. August 1913. Greifswalder Straße Ratsbeschluß vom 25.8.1960. Benannt nach der Hansestadt an der Ostsee (Vorpommern). Grenzstraße Kollegienbeschluß vom 10. Juni 1910. Name für die neue Straße von der Dammstraße (zwischen Nr. 11 und dem Neubau des Beamtenwohnungsvereins) nach Norden, parallel der nahen Grenze des Stadtgebietes. Große und Kleine Bäckerstraße Kein Ratsbeschluß. Die Hauptgeschäftsstraße der Stadt, die seit langer Zeit keinen einzigen Bäckerladen aufzuweisen hat, wird ihren Namen dennoch darauf zurückführen, daß sich die Bäcker in größerer Zahl dort angesiedelt hatten. Nach einer Urkunde von 1352 bewohnte ein Eckhaus der Straße (am Brunnen, vielleicht Nr. 15) der Bäcker Fredericus de Cellario; ebenfalls an der Bäckerstraße wohnte gleichzeitig, wie es scheint, Bäcker Betmann; im Hause der Konditorei Möller (Nr. 21) haben sich 1902 Reste eines alten Backofenbetriebes gefunden, und auch im Hause Nr. 2, dessen Giebel die Halbfigur des tapferen Bäckergesellen aus der Ursulanacht ziert, wird sich ehemals eine Bäckerei (1866 Webers Konditorei) befunden haben; Nr. 13, seit 1907 Raunos Konditorei, war schon als „Stadt Hamburg“ mit einer Konditorei ausgestattet gewesen. Bürgermeister Hinrik Lange, Gr. Bäckerstraße 29, spricht von seinem naber, dem Bäcker Engelke, dem er für den Nikolaihof vier Schweine abkaufte (1457). Im Fünfzehnhundert und früher wurde die Bäckerstraße von den 126
vornehmsten Familien der Stadt bevorzugt. Eine Durchsicht der Schoßregister ergibt, daß in jener Zeit außer den Langes die Borcholt (Nr. 29), Bromes (27/28), Dassel (Nr. 5, 24/26), Düsterhop, Elvers (22), Mutzeltin (30), Schellepeper, Witzendorff (31) dort ansässig waren. Der Chronist Hammenstede rühmt den auf früher SchellepeperSpringintgud- Zerstedeschem Grundstück um 1509 errichteten Neubau des großen Bürgermeisters Lutke von Dassel, in dessen Hause erlauchte Fürstlichkeiten ein- und ausgingen und 1586 Kurfürst Johann Georg von Brandenburg mit seinem Sohne Joachim Friedrich Wohnung nahm (Nr. 26); ein Teil des alten Portalschmuckes bildet jetzt eine Zierde des Lüneburger Museums. Seit 1629 gehörte das Wohnwesen als Zufluchtsort für kriegerische Tage dem Kloster Lüne, im Siebenzehn- und Achtzehnhundert diente es als Kgl. Reithaus und Cavalleriekaserne; es wurde von der Kriegskanzlei 1829 verkauft an den Vollhaken Kronberg, der es ausbauen ließ nach Aufführung einer neuen Front. Das Hintergebäude, sog. Cavallerie Ordonnanzhaus, diente 1769 der Seylerschen Theatergruppe als Schauplatz. Gegenüber lag das Gildehaus der Junker (Nr. 6), das im Jahre 1484 seitens der Provisoren nove societatis domicellorum von dem Bürger Johann von Wynten angekauft wurde. Es hieß dat selschoppes husz, convivalis domus societatis domicellorum, die Gesellschaft, und wurde im Jahre 1485 ausgebaut (Haus Hoymann uppe dem orde unde by der selschop 1499); seit 1592 im Besitz des Rates und als Physikatshaus benutzt, 1740 für 2750 M an den Gewandschneider Schilling veräußert; es wurde in kritischen Zeiten (1487) mit einer besonderen Wache belegt. Daneben, Nr. 5, lag die alte Ratsapotheke (Laurentius de apteker in der Bäckerstraße 1421), die im Jahre 1524 von den Apothekenherren an den Bürger Frederik Hammenstede, den Vater des Chronisten, verkauft wurde; der letztere erblickte im selben Jahre in der Bäckerstraße das Licht der Welt, und zwar im Nachbarhause der heutigen Ratsapotheke, Nr. 10. Das Eckhaus Nr. 20 an der Zollstraße war das Zollhaus, das von alters, nachweisbar von 1358-1750, vom herzoglichen Zöllner bewohnt wurde; vor seiner Tür wurde ein Transitzoll erhoben. Ein Eckhaus des Bürgers Heyne Elvers wird 1490 bezeichnet ame orde by der tollenboden in der groten beckerstrate. Der nördliche Teil der Hofweinhandlung Joh. Frederich, 1871/2 als Neubau erstanden, Nr. 27/28, hatte Anfang des Achtzehnhunderts Hotelbetrieb und hieß „Goldener Löwe“ (Klepper); ebenfalls an der Bäckerstraße lag das vom ältesten Physikus bewohnte Physikat-Haus, nach 1700, sowie die „guldne Krone“ 1794. Das südliche Eckhaus Kl. Bäcker-Glockenstraße wurde gänzlich umgewandelt 1857, das Haus gegenüber an der Nordseite der Glockenstraße, 1589 bewohnt vom Senator Lucas Danning, später von Herrn Georg Biehl, erhielt 1861 eine neue Front. Platea pistorum 1306; in cono pl. pist. iuxta puteum 1352; in pl. pist. in domo lignea 1355; in pl. pist. iuxta domum thelonariorum 1358; in pl. quae dicitur pistorum 1360; pl. quae dicitur beckerstrate 1363; in pl. pist. versus forum 1388; Große und Kleine Bäckerstraße werden unterschieden zuerst 1431; in der becker strate Eckhaus Hinrik Visker bei Hinrik Nigenkerken 1450; Eckhaus Hans Witting in der Kl. Bäckerstraße 1450; Eckbude des Bürgers Clemens Graal in der Kl. Bäckerstraße gegenüber Gerdken Stuvers Haus 1451; in der lutken bekkerstrate; in parva pl. pist 1453; in pl. pist. minori 1461; in magna pl. pist. 1467; an dem orde der lutken beckerstraten 1491; in pl. pist. maiori 1524; in pl. pistorali minori 1545. Urkundlich bis weit in das Sechzehnhundert hinein und im Sprachgebrauche bis auf die Gegenwart hat sich daneben die ältere Bezeichnung erhalten, Bäckerstraße schlechthin. Bäcker- und Bardowickerstraße erhielten 1845 ein neues Trottoir.
127
In Braunschweig uppe deme beckerklinte 1397; große und kleine Bäckerstraße auch in der Altstadt Hamburg und in Rostock; in Lübeck fossa pistorum 1227; in Stade platea pistorum 1290. Großer Garten Ratsbeschluß vom 29.2.1996. Die Namensgebung orientiert sich an einem alten Flurnamen in Oedeme. Grünberger Straße Ratsbeschluß vom 26.9.1974. Mit der Eingemeindung des Stadtteils Ebensberg 1974 wurde die Umbenennung des Moorweges erforderlich, da ein solcher im Stadtgebiet von Lüneburg bereits vorhanden war. Namengebend wurde Grünberg/Zielona Gora, ehemals Kreisstadt in Niederschlesien und seit 1950 Hauptstadt der gleichnamigen Wojwodschaft in Polen. Grüner Brink Ratsbeschluß vom 26.3.1959. Flurbezeichnung nach Hermann Löns. Grundweg Kein Ratsbeschluß. Übernommen mit der Eingemeindung von Oedeme 1974. Guerickestraße Ratsbeschluß vom 18.5.1955. Nach dem Magdeburger Bürgermeister und Physiker Otto von Guericke (1602-1686) benannt. Gumbinner Straße Ratsbeschluß vom 26.9.1974 / 17.12.1981. Die Umbenennung der Königsberger Straße wurde mit der Eingemeindung von Ebensberg erforderlich, da eine solche schon im Lüneburger Stadtgebiet vorhanden war. Gumbinnen war die Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirks in Ostpreußen und befindet sich seit 1945 unter sowjet./russ. Verwaltung (Gussew, Gebiet Kaliningrad). Gummastraße Kein Ratsbeschluß. Die Gumma, auch faule Fahrt genannt 1659, war ein Graben, der dazu diente, aus dem südwestlichen Teile der Stadt das Regen- und Schmutzwasser und von der Saline die faule Sole abzuführen. Die Gumma, 1794 Gumme, nahm ihren Ursprung in der wendischen Straße mitten zwischen Kalkberg und Sülze, am Wipkenloch 1652 (Wiebkenloch 1659; Wibeke begegnet im Dreizehnhundert als weiblicher Personenname); sie floß von dort, durch Gärten von der Innenmauer getrennt, am 128
Fuße der inneren Wallböschung entlang, außen um die Sülze herum, unter dem Sülztor und Rotentor hindurch, trat in einem Garten (1751 Wächter Brandts Garten) oberhalb der Kuhlengräberhäuser in ein Siel und wurde in diesem über den Leimsiederhof am Mühlenhof entlang in die Ilmenau geleitet. An der Einmündung der Rackerstraße, deren nach Abtragung des Walles entstandene Verlängerung im Adreßbuche erst 1905 als Gummastraße bezeichnet wird, vereinigte sich das Wässerlein mit der Faulen Au. Über der Gumma lag unmittelbar östlich am Sülztore ein allgemeines Privet, auch das Hl. Geist Privaet (1751) griff über die Gumma hinüber. Der recht fremd anmutende Ausdruck „Gumma“ klingt an einen Lüneburger Familiennamen an, der im ältesten Stadtbuche 1292 einmal begegnet Thidericus dictus Gummer und von Bückmann in Verbindung mit dem langobardischen Personennamen Gumulfus, Gummolfus gebracht wird. So erklärt Bückmann plausiblerweise Gumma als Gumin-aha, d. h. etwa: von Gummo angelegte Au, Abflußleitung. Volger bemerkt in seiner Chronik zum Jahre 1863: Hauptverbesserung der Wasserleitung in der Engen und Ritterstraße. Dort floß das Wasser der Gossen bis zum Fuße des Sülzwalles und wurde von dort durch einen tiefen Graben längs des Sülzwalles, die sog. Gumma, bis an den Kanal geführt, der das Wasser vom Lambertikirchhofe in den alten Stadtgraben leitet. Im Herbst wurde durch beide Straßen ein Siel gelegt, dieses in gerader Richtung durch den abgetragenen Sülzwall in den Salinkanal verlängert. Die Gumma ging demzufolge ganz ein. 1867 entstand an der Wallstraße, dem Timpen gegenüber, durch Zuschüttung der Gumma ein freier Platz. (Zu vgl. Rackerstraße.) Gungelsbrunnen Ratsbeschluß vom 23.3.1972. Benannt nach einem in unmittelbarer Nähe befindlich gewesenen, weithin bekannten Heilbrunnen des Spätmittelalters. Gut Schnellenberg Kein Ratsbeschluß. s. Schnellenberger Weg. Gut Wienebüttel Kein Ratsbeschluß. s. Am Wienebütteler Weg. Haagestraße Ratsbeschluß vom 29.6.1949. Die nach Abtragung des Roten Walles entstandene, nur einseitig bebaute Straße, welche in Verlängerung der Wallstraße auf das 1869/70 vom Stadtbaumeister Maske erbaute Johanneum zuführt, trug bis 1906 den Namen S c h u l s t r a ß e , wurde aber gelegentlich der 500jährigen Jubelfeier der Lehranstalt durch Beschluß der städtischen Kollegien neu benannt zu Ehren der beiden Direktoren des Johanneums Karl Haage (1834-1842) und seines Sohnes Rudolf Haage (1869-1901, † 17. April 1911). Vgl. über die Verdienste der beiden Männer die Festschrift des Johanneums 129
Abbildung des Gungelsbrunnens nach Wilhelm Schwan 1646
von 1906 S. 84-106, 119-121. Von 1939 bis 1945 zusammen mit der Friedenstraße (vgl. S. 106) Gauleiter-Telschow-Wall benannt, durch Verfügung der Militärregierung vom 20.6.1945 geändert in Roter Wall, seit 29.6.1949 wieder Haagestraße. Von 1939 bis 1949 trug der von Osten nach Westen verlaufene Teil der Wandrahmstraße (heute noch verbliebener Rest der Wandrahmstraße) die Bezeichnung Haagestraße. Habichtsweg Kein Ratsbeschluß. Seit 1944 Bezeichnung für den vom Gasthaus Wilschenbrook ostwärts verlaufenden Weg. Häcklinger Weg Ratsbeschluß vom 10.12.2001. Der Name gehört zu den richtungsweisenden Bezeichnungen und charakterisiert eine Straße in einem Oedemer Neubaugebiet. Hagemannsweg Kein Ratsbeschluß. Übernahme einer volkstümlichen Bezeichnung nach einem der zahlreichen, seit Mitte des 14. Jahrhunderts belegten Lüneburger Bürger Hagemann. Hallesche Straße Ratsbeschluß vom 25.8.1960. Benannt nach der Salz- und Universitätsstadt Halle a. d. Saale. Hamburger Straße Ratsbeschluß vom 24.8.1949. Die Straße führt von Lüneburg nach Norden in Richtung Hamburg. Handwerkerplatz Ratsbeschluß vom 29.8.1996. Die belebte Kreuzung Linden-, Rote, Barckhausen- und Stresemannstraße wurde zum 75jährigen Bestehen der Kreishandwerkerschaft Lüneburg, die in der Nachbarschaft angesiedelt ist, bewidmet. Hangweg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Die Namensgebung nimmt eine Lagebesonderheit in Oedeme auf. Hans-Steffens-Weg Ratsbeschluß vom 3.4.1947.
131
Johann(es) Steffens war Madrigalkomponist und Organist an der St. Johanniskriche zu Lüneburg von 1589-1616. Nach ihm wurde am 3.4.1947 die 1939 im Ortsteil Hagen angelegte Ludendorffstraße umbenannt. Hans-Stern-Straße Ratsbeschluß vom 16.6.1960. Das erste (seit 1580) in Lüneburg ansässige Glied der bekannten Verleger- und Buchdrucker-Familie von Stern gab die Straßenbezeichnung. Hans-Tönjes-Ring Ratsbeschluß vom 19.11.1973. Benannt nach dem langjährigen (1952-1967) SPD-Ratsherrn und Senator Hans Tönjes (1908-1967), der sich vor allem um sozialen Wohnungsbau und Siedlungswesen kümmerte. Haselhorst Ratsbeschluß vom 29.8.1996. Der Straßenname im Ortsteil Rettmer soll den ländlichen Charakter der Siedlung hervorheben. Hasenburg Früheste Erwähnung 1484, als der Sodmeister auf Geheiß des Rates den torn tor Hasenborg uth der grünt nye gebüwet. Der Turm verstärkte die Landwehr an der Stelle, wo eine der wichtigsten Verkehrsstraßen hindurchführte. Im Jahre 1513 sicherten die Bürgermeister dem Zimmermann Hans Wulve auf Lebenszeit ein Jahresgehalt, insbesondere van wegen etliker woldaet szo he dem erszamen rade an etliken gebuwten tor Hasenborch ertegeth. Jene Landstraße südwärts durch die Heide wurde alle sieben Jahre benutzt auch von den Pilgerscharen, die nach Aachen wanderten. Dann wurden auf Grund frommer Stiftungen an der Hasenburg Almosen ausgeteilt; provisores elemosinarum que per septennia apud arcem leporinam peregrinantibus Aquisgranum ministrari solent 1522. Bei Hasenburg, auf dem Gelände der späteren Brauerei, befand sich eine Papiermühle. Eine neue Papierfabrik wurde 1857 angelegt, ging jedoch 1871 wieder ein. Vor Weihnachten 1873 geschah die Eröffnung der Benkendorf Brauerei auf der Hasenburg. Gründung eines Kinder- und Versorgungsheims Mitte der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Hasenburger Berg Ratsbeschluß vom 23.8.1950. Vgl. Hasenburg. Hasenburger Ring Kein Ratsbeschluß. Mit der Eingemeindung Rettmers und Häcklingens im Jahr 1974 wurde der Straßenname übernommen. 132
Hasenburger Weg Ratsbeschluß vom 12.8.1965. Vgl. Hasenburg. Hasengasse Kein Ratsbeschluß. Straßenbezeichnung seit 12.3.1945 in einem Quartier mit heimischen Wildtieren. Hasenwinkel Kein Ratsbeschluß. Sommersitz patrizischer Familien, im 1500 der Glöden, im 1600 der v. Dassel, um 1860 Kaffeegarten. Der Platz um den Hasenwinkel gehörte zur gemeinen Weide, für einen daselbst befindlichen Bienenzaun mußte der Kämmerei ein Jahrgeld entrichtet werden, 1556; Syndikus Lüders kaufte hortum et apiarium der Hasenwinkel dictum – in den Schoßrollen (fori) 1548 ff. erwähnt im Hasenwinckell, de Warborg genannt – ante portam novam versus territorium Repenstet 1665. Der idyllische Name Hasenwinkel für einen versteckten Landsitz findet sich im nördlichen Deutschland außerordentlich häufig; bei einer im Innern der Stadt von den hasen abgeleiteten Ortsbezeichnung ist regelmäßig nicht an Meister Lampe zu denken, sondern an Hosen, die Beinbekleidung. So wurden an der Hasenporte in Lübeck nach Brehmer Strumpfwaren verkauft; die hasennegergasse in Danzig ist die Hosennähergasse; z. vergl. auch das hasenleger nahe der arskerve (S. 63). Die Straße schneidet die Gemarkungsgrenze zwischen Lüneburg und Reppenstedt. Hasselberg Ratsbeschluß vom 23.3.1972. Der Name greift eine überkommene Flurbezeichnung auf. Hauptstraße Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Die Bezeichnung erinnert an die Funktion der Straße in Häcklingen und als Verbindung zwischen Häcklingen und Neu-Häcklingen. Hebbelstraße Kein Ratsbeschluß. 1954 Hebbelweg, seit 1955 Hebbelstraße, benannt nach dem Dichter Friedrich Hebbel (1813-1863). Heidbergstraße Kein Ratsbeschluß. Der Straßenname ist mit der Eingemeindung Oedemes im Jahre 1974 übernommen worden. 133
Heidkamp Ratsbeschluß vom 12.3.1944. Der aus Behelfsheimbauten entstandene Straßenzug gehörte bis 1.1.1963 politisch zur Gemeinde Oedeme und unterlag bis dahin lediglich der Verwaltung der Stadt Lüneburg. Der Straßenname geht auf eine Flurbezeichnung zurück. Heidkoppelweg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Der Straßenname im Ortsteil Ebensberg bezieht sich auf eine gemeinschaftliche Weide im Heidegebiet. Heidschnuckenweg Ratsbeschluß vom 26.3.1959. Heidschnucken sind eine sehr alte, in der Lüneburger Heide heimische Schafrasse. Heiligengeiststraße Kein Ratsbeschluß. Der wichtige Straßenzug, der die Sülze mit dem verkehrsreichsten Platze der Stadt, dem Sande, unmittelbar verbindet, konnte seinen gegenwärtigen Namen erst nach Errichtung des Hl. Geisthospitals im ersten Viertel des Dreizehnhunderts annehmen; es hat aber Jahrhunderte gedauert, bis der ältere gelegentlich bereits erwähnte Name W o l l w e b e r s t r a ß e ganz verdrängt wurde. Das Nähere ergibt sich aus unseren Belegstellen. Haus des Longus Deghenardus in angulo platee ex opposito hospitalis s. spiritus prope salinam 1349; prope (iuxta) domum (ex opposito domus) (infirmorum) s. spiritus prope salinam 1350; platea lanificum 1359; kleines Haus intra cymiterium capelle s. spir. 1363; van dem zande wente to dem nyen hilghen gheeste 1371; circa cimiterium novi s. spir. 1375; prope novum s. spir. 1382; circa valvam curie s. spir. prope salinam 1421; im Jahre 1424 wohnte der Bürger Bisping neben Elringdorp in dat westen boven dem sande alse men ersten kumpt in de wullenwewerstraten; in der wullenweverstrate wurde vor der Tür des Arnd van Minden ein Notstall gestattet 1438; ex opposito cimiterii hospitalis s. spir. prope salinam 1445; jegen deme groten hilgen geiste 1451; platea dicta vulgariter de wullenweverstrate prope s. spir. 1454; in parva platea transversali infra plateas ollifusorum et textorum 1482; platea s. spir. 1486 und 1491; Haus des Hinr. Stoterogge uppe deme orde an der fulen ouwe, dar Hans Sneverdingk uppe deme anderen orde wonet in der wullenweverstrate 1492. Ein neues Kornhaus an der Wollweberstraße wird erwähnt 1500 infra . . . et novam domum frumentariam prope hospitale s. spir. in platea lanificum; Haus Schulte (Bäckerei) vor dem Roden dare up dem orde na der Wullenweverstrate (am Sande 3?); Wohnhaus der Witwe des Hans Gerleges zwischen dem Hause des † Hinrick Stoterogge und Hans Lidermann in der wullenweverstraten upp deme orde alsze man na der vulenouwe geyt 1510; 1525 heißt dasselbe Haus bi der fulen ouwe; platea textorum sive lanificum in opposito ad ecclesiam hosp. s. spir. 1512; platea fullonum seu lanificum 1513; platea lanificum et in acie platee der fulen owe vulgariter nunc.; platea s. spir. sive lanificum 1528; in der wullenweferstraten 1544; Johan van Kollen erhält 1555 vom Rate die Erlaubnis, aus seinem Wohnhause zwischen Jürgen Hammenstede [dem 134
Chronisten] und Claus Meiger in der wulleweverstraten bolegen einen dorweg hinter der muren tho makende; in lanificorum pl. maiori 1609; in angulo superioris laniorum plateae ex opp. laniatoriarum tabernarum 1610; 1611 in platea s. spir. maioris; in inferiori laniorum platea (1616); in pl. lanificum (1632). Im Jahre 1678 erwarb der Hauptmann Heinrich Maneke domum vel diversorium vulgo cervus ruber [Roter Hirsch] nominatum in platea spir. sancti, ein Jahr darauf Christoph Manecke ein Haus quae vulgo aurea stella nominatur in majori spiritus sancti platea; die Herberge (diversorium) Zum goldenen Stern wird erwähnt bereits 1630; eine Kette, die von diesem Hause zu Bukfischs Haus hinüberführte (1666), konnte die Straße sperren; Brauhaus an der Hl. Geiststraße inter Hansonis Mejeri et horreum ad xenodochium in hon. spir. s. constructum 1673; Heil. Geist Str. 1765; der Plan von 1802 unterscheidet Obere Hl. Geist- oder Wollenweber- und Niedere Hl. Geiststraße. Gebhardis Plan von 1794 führt an der Südseite der Straße ff. Gasthäuser auf (vom Sande ab): Römer, im goldnen Stern, im goldnen Mond mit Durchgang nach der Stadtmauer (Schmidt Hof), in der guldenen Sonne, eine Grobschmiede- und Riemergesellenherberge, im springenden Hirsch (Eckhaus der Rackerstr.). Gleichfalls als Hl. Geist-, vielmehr als Wollenweberstraße ist auch die platea linteariorum anzusprechen, erwähnt 1625. 1866 Okt. Anfang des Baues des Hl. Geistschulgebäudes. Eine platea s. spir. auch in Danzig 1336, Heiligengeistbrücke und –Kirchhof in Hamburg, fossa s. spir. 1289 in Wismar; eine pl. lanificum 1347 in Danzig, eine pl. textorum 1302 in Lübeck, 1273 in Wismar. Im Anschluß an das im Jahre 1500 angeführte Kornhaus beim Hl. Geisthospital sei an dieser Stelle die (K o r n s t r a ß e) eingefügt. Sie wird nur ein einziges Mal erwähnt, als ein Bürger einem anderen eine Bude zwischen Buden verkauft in platea frumenti 1439. Der Name ist seither verschollen, und es ist nichts darüber zu sagen, als daß die Getreide- oder Kornstraße im Sandviertel gelegen haben muß. Eine Eintragung des Denkelbuches von 1570, averst dat korne, so by voderen heringebracht, schall nicht eher alsz wanner idt den marcket edder sandt erreket gekoft werden, beweist, daß ein Kornmarkt sowohl auf dem Marktplatze als auch auf dem Sande stattfand. Ein Kornhaus, domus frumentaria, befand sich auch auf dem Glockenhofe, und so käme unter der Lesart platea frumenti allerdings auch die Glockenstraße in Betracht. In Hannover ist 1845 die Kornstraße so benannt, weil man erst durch ein Kornfeld zu ihr gelangte. Heiligenthaler Straße Kein Ratsbeschluß. Mit der Eingemeindung Rettmers nach Lüneburg mußte die Straßenbezeichnung Grasweg ersetzt werden, da sie bereits im Kerngebiet Lüneburg vorhanden war. Da die Straße von Rettmer nach Heiligenthal führt, wurde der richtungweisende Name gewählt. Heinrich-Böll-Straße Ratsbeschluß vom 29.8.1995.
135
Der Nobelpreisträger Heinrich Böll (1917-1985) für Literatur des Jahres 1972 ist einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Heinrich-Heine-Straße Ratsbeschluß vom 25.7.1951. Heinrich Heine (1797-1856), dessen Eltern von 1822-1828 Am Ochsenmarkt 2 (Heine-Haus) und Am Markt 2 wohnten, weilte in diesen Jahren sehr häufig in Lüneburg. Hier entstanden auch einige seiner bekanntesten Lieder. Eine enge Freundschaft verband ihn mit dem Lüneburger Stadtsekretär Dr. Rudolf Christiani (vgl. auch Christianiweg). Heinrich-Thiede-Straße Ratsbeschluß vom 29.5.1975. Heinrich Thiede (1891-1964) gehörte über 50 Jahre der Freiwilligen Feuerwehr an und war 20 Jahre lang Kreisbrandmeister in Lüneburg. Helene-Lange-Straße Ratsbeschluß vom 29.9.1994. Mit der Benennung wurde eine herausragende Repräsentantin (1848-1930) der bürgerlichen Frauenbewegung gewürdigt. Hellmannweg Ratsbeschluß vom 22.9.1983. Benannt nach dem Ehepaar Bruno und Paula Hellmann (1889-1974, 1892-1980). Es hinterließ der Stadt Lüneburg eine Erbschaft, die den Grundstock zum Bau der Seniorenwohnanlage Westädt’s Garten bildete. Helmholtzstraße Ratsbeschluß vom 26.3.1959. Nach dem Physiker und Physiologen Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) benannt, der ab 1888 die neugegründete Technisch-Physikalische Reichsanstalt leitete. Henningstraße Kollegienbeschluß vom 4.3.1913. D. H. Henning war der erste Freiwillige, der im Husaren-Regiment des Oberstleutnants Albrecht v. Estorff Aufnahme fand; er zeichnete sich, unterstützt durch genaue Ortskenntnis, in jenen Tagen der kriegerischen Erhebung so aus, daß er noch während des Gefechts von Lüneburg zum Wachtmeister befördert wurde. Henning kehrte glücklich aus den Freiheitskriegen zurück und bekleidete fünfzig Jahre später eine angesehene Stellung als Kgl. Hof-Asphaltfabrikant in Hannover. Mit seinem Namen wurde eine neue von der Bleckeder Landstraße nach Norden führende Straße belegt
136
Herderstraße Ratsbeschluß vom 24.10.1951. Benannt nach Johann Gottfried von Herder (1744-1803), Sprach- und Literaturwissenschaftler, Historiker und Theologe zwischen Aufklärung und Sturm und Drang, Freund Goethes. Hermann-Löns-Straße Kein Ratsbeschluß. Nach dem Heidedichter und Journalisten Hermann Löns (1866-1914). Von 1944 bis 1951 Moorfeld. Hermann-Niemann-Straße Ratsbeschluß vom 14.9.1972. Benannt nach dem am 8.12.1882 in Lüneburg geborenen Schuhmacher, der beim Verteilen von anti-faschistischem Material 1933 gefaßt und laut Urteil vom 8.10.1935 zu 2 Jahren Zuchthaus und 3 Jahren Ehrenverlust wegen Landesverrats verurteilt wurde. Hermann-Schmidt-Straße Ratsbeschluß vom 29.5.1975. Dr. jur. Hermann Schmidt (1877-1963), gebürtiger Pommer, war von 1919 bis 1936 Oberbürgermeister der Stadt Lüneburg. Hermann-Wagner-Straße Ratsbeschluß vom 19.11.1973. Prof. Dr. Hermann Wagner (1879-1960), genannt „Bullerjahn“, unterrichtete von 1904 bis zu seiner Pensionierung am Johanneum Geographie, war Protektor des SchülerRudervereins und 30 Jahre lang Vorsitzender des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg e. V. Als solcher begründete er das „Heidemuseum“ in den ehemaligen Räumen der Loge „Selene zu den drei Thürmen“. Hermann-Wrede-Weg Ratsbeschluß vom 29.1.1976. Hermann Wrede (1868-1936) errang als Gärtner besondere Erfolge mit seinen Stiefmütterchenzüchtungen. Noch bekannter wurde er durch seine Forschungen über die Glocken in Stadt und Landkreis Lüneburg. Seinen Bemühungen ist es zu verdanken, daß St. Michaelis wieder ein Glockenspiel erhielt, dessen Vollendung (1939) er nicht mehr erlebte. Hindenburgstraße Kein Ratsbeschluß. Durch Beschluß vom 8. April 1933, in Umwandlung des Namens Gartenstraße (s. das.). Am 3.4.1947 zurückbenannt in Gartenstraße, seit 10.12.1952 wieder Hindenburgstraße. 137
Paul von Beneckendorff und von Hindenburg (1847-1934) nahm an den Kriegen von 1866 und 1870/71 als Führungsoffizier teil und hatte im 1. Weltkrieg zusammen mit Ludendorff die oberste Heeresleitung. 1925 wurde er zum Reichspräsidenten gewählt und hatte als solcher die verhängnisvolle Beauftragung Hitlers mit der Regierungsbildung im Jahr 1933 zu verantworten. Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Hinrich Wilhelm Kopf (1893-1961) studierte Rechtswissenschaften in Göttingen und trat dann in die preußische Verwaltung ein, aus der er 1933 wegen seiner SPDMitgliedschaft entfernt wurde. 1945 wurde er Regierungspräsident und Oberpräsident von Hannover und 1946 erster Ministerpräsident des Landes Niedersachsen (1945-1955, 1957-1961). Hinter dem Brunnen Kein Ratsbeschluß. Der gemeinte Brunnen, ein Doppelbrunnen mit hartem Quell- und weichem Leitungswasser, erhob sich da, wo das östliche Eckhaus auf dem Meere mit seiner Längsfront in auffälliger Weise zurückweicht und neuerdings ein städtischer Hydrant seinen Platz gefunden hat. Vielleicht ist hier einzureihen in opposito fontis lapidei (Eckhaus Engelbrecht-Brodermann, 1469). Prope puteum lag 1594 das Wohnhaus eines geistlichen Herrn Lambert Witfelt, zwischen diesem und einem Eckbackhaus das Eckhaus nebst zwei Buden des Baumeisters Georg Paris; in mari ad aciem penes fontem 1652; hintern Brunnen 1765; achtern born 1794; hinter dem Brunnen 1802; beim Brunnen, auch mit dem Zusatz am Ifloock oder zusammengefaßt und Iflock; die Schoßrolle von 1850 sondert die Bezeichnung am Meere durch den Zusatz am Orte des Brunnens. Hinter dem Saal Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Die Straßenbenennung greift einen alten Flurnamen auf. Hinter dem Sportplatz Ratsbeschluß vom 16.12.1982. Die Straßenbezeichnung greift eine geläufige volkstümliche Benennung der Straße bei den Sportplätzen an der Hasenburg auf. Hinter den Scheibenständen Kein Ratsbeschluß. Der Name erklärt sich selber (zu vgl. Am Schützenplatze); er ist eingeführt im September 1940.
Hinter der Bardowicker Mauer 138
Blich nach Westen in die Straße Hinter der Bardowicker Mauer
Kein Ratsbeschluß. Dem älteren Sprachgebrauche zuwiderlaufend und älteren urkundlichen Quellen unbekannt, begegnet uns der Name zuerst nach 1700, als es heißt hinter der Bardowicker Mauer bis an die Ellmenau hat das Publicum 66 Salzräume, welche preter propter 2843 Chor oder Wispel Salzes fassen, und da itzigen Läuften nach vor den Wispel jährlich 4 Schilling Raummiete bezahlet werden, bringet es eine summam von 710 M 12 s. Über diesen Salzräumen befanden sich sieben Buden, auf welchen die Salztonnenböttcher ihren Tonnenvorrat und Stabholz verwahrten. Im Plan von 1794 und 1802 wird der Name hinter der Bardowickermauer angewandt für die Mauergasse, die sich vom Bardewikertore bis an den Fluß erstreckte, die heutige Baumstraße. Die Verlängerung nach Westen hin, von der Bardewiker- bis zur Mündung in die Gralstraße, heute hinter der Bardowickermauer genannt, ist unter solchem Kennwort nachzuweisen in einem Grundriß von 1856, aber schon die Schoßrolle von 1832 faßt den ganzen Straßenzug von der Ilmenau an der inneren Stadtmauer entlang bis zur Gralstraße als Bardowicker Mauer. Diese Benennung hat sich bis in das letzte Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts erhalten; das Adreßbuch von 1883 hat unter dem Titel Hinter der Bardowickermauer die Unterabschnitte von der Bardowickerstraße in westlicher Richtung rechts, vom Gralwalle bis zur Bardowickerstraße rechts, von der Bardowickerstraße bis zur Salzstraße a. W. rechts, endlich von der Salzstraße a. W. bis zur Bardowickerstraße rechts. Die östliche Hälfte der Bardewiker Mauer ist verschwunden mit der Abtragung des zugehörigen Bardewiker- oder Kastanienwalles nach 1889, die westliche Hälfte, durchbrochen 1910, ist noch jetzt ein ansehnliches Denkmal der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Eine Sonderbezeichnung gab es ehemals für die Strecke von der Gral- bis zur Reitenden Diener- bzw. Burmesterstraße und weiterhin bis zum Bardewikertore, nämlich h i n t e r d e m G e w a n d h a u s e bzw. K a n i n c h e n b e r g (Plan von 1802). Das Wandhaus der städtischen Kämmerei, im Januar 1738 einem Bürger aufgelassen, lag neben dem Stadtgefängnisse, der stad hechte 1334, und der Wohnung für die Gerichtsknechte; es war eine Tuchfabrik, nicht wie Manecke annimmt, das Gefangenenhaus selber, auch nicht in der Vorzeit eine Stätte für die Rahmen der Tuchmaler. Nach 1700 brachten die sog. Marstalls- oder itzo Wandhauses Wohnungen, 9 an der Zahl einen Mietzins ein. Achtern Wandhausz ist auf dem Plan von 1765 ausgedehnt auf die Verlängerung der Straße nach dem Gral hin; Zuckerfabrik olim Wandschauer 1832. Der Kaninchenberg ist 1487 zuerst belegt; platea vulgariter nuncupata de kaninikenbergh; 1524 verkauften die Älterleute des Böttcheramtes ein Haus apud montem cuniculorum ex adverso muri civitatis; 1532 in monte cuniculorum; 1588 platea quae vocatur kanikenbergen; 1595 auf dem Kaninchenberge die Wohnung des sculteti der Stadt; vulgariter auf dem caninikenberge 1603; in monte vulgo der caninichen 1653; nach 1772 Kaninchenberg; Grundriß 1856 auf dem Kanienchenberge; Adreßbuch von 1866 am Kaninchenberge. Die Strecke von der Ecke der Reitenden Dienerstraße nach Westen hin ist wohl gemeint mit achter den barveten broderen 1387. Topographisch zweifelhaft sind penes murum Bardovicensem 1645 und retro murum portae Bardovicensis 1649. Zu vergl. Baumstraße.
140
Hinter der Saline Ratsbeschluß vom 21.8.1969/29.11.1984. Der Abzweig von der Soltauer Straße Richtung Saline erhielt die Bezeichnung „Hinter der Saline“ bereits 1969. Mit dem Ausbau des Gebietes westlich der ehemaligen Saline wurde auch die Verlängerung bis zur Straße Am Bargenturm mit diesem Namen belegt. Der Name begegnet bereits 1453, als die Kämmerer eine Zahlung veranlassen den arbeidesluden uppe deme kusele (Kreisförmiger Platz) achter der zulten.
Hinter der Sülzmauer Kein Ratsbeschluß. Von Büttner nicht aufgeführt; ältester Hinweis 1421 ex opposito domus que des abbetes hof vulgariter dicitur prope murum nostre civ. in vico quo a nova valva descenditur ad capellam s. Lamberti. Auf dem Stadtplan von 1802 beschränkt sich der Name auf die Strecke südlich der Wendischen Straße, während die Fortsetzung nach Norden hin, einschließlich der Straße Am Sülzwall, mit h i n t e r S t. B e – n e d i c t i C a p e l l e bezeichnet wird. Die von der Straße abzweigenden Krögers- oder Thielen-gang und Sassenhof hießen 1794 Engelshof und Berghauer Gang. Die Schoßrolle von 1850 gebraucht den Namen Sülzmauer auch für die entsprechende Strecke östlich der Saline bis zur Rackerstraße – so ist gemeint am Orte der Sülzmauer am Wall; die nördliche Strecke heißt gegen die Sülzmauer und hinter der Sülzmauer, das Adreßbuch von 1860 hat den Zusatz von der Sülzwallstr. 1. Hirschberger Straße Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Im Ortsteil Ebensberg erfolgte die Vergabe von Straßennamen nach Orten in den ehemaligen Ostgebieten Deutschlands. Hirschberg/Jelenia Góra im Riesengebirge war eine Kreisstadt in Niederschlesien und gehört heute zur Wojwodschaft Wrocław/Polen. Hirtenweg Kein Ratsbeschluß. Bei der Namensvergabe griff man auf eine alte Flurbezeichnung „Hirtenstücke“ zurück. Mit der Eingemeindung Oedemes 1974 wurde der Name übernommen. Hölderlinstraße Ratsbeschluß vom 10.11.1954. Namengeber war der Dichter Friedrich Hölderlin (1770-1843), den vor allem seine Lyrik unsterblich machte.
Hohe Luft 141
Kein Ratsbeschluß. Im Jahre 1925 amtlich gutgeheißen, in Anknüpfung an die im Volksmunde entstandene Bezeichnung einer Gastwirtschaft an der Ecke der nahen Henningstraße. Hohenhorststraße Ratsbeschluß vom 9.11.1978. Die Straße im Industriegebiet Lüneburger Hafen wurde nach dem Schiff benannt, das als erstes den Elbe-Seitenkanal nach seiner offiziellen Eröffnung befuhr. Hokel Holck oder Hokel hießen sowohl ein Haus und zwei Buden, wie der nach seiner Belegenheit bisher nicht bestimmte Platz, an welchem sie lagen. Nur zwei Belegstellen haben sich bisher gefunden, beide in Verschreibungen für den Wilhadi Altar zu St. Cyriak. Im Jahre 1335 erhält der Altar ein Haus nebst zwei Buden holck vulgariter nominatis, 1366 desgl. duas casas dictas hokell sitas in Luneborg in vico dicto hokell. Die Deutung des Wortes führt entweder auf hôk, huk m. = Winkel, Ecke (hokelik, winklig) oder auf holk m., ein Lastschiff und könnte im letzteren Falle einem Abzeichen des Hauses entnommen sein. In Lübeck gab es Ende des Dreizehnhunderts eine Gasse de holk, so genannt nach einer Schenke. Holeek Hohle Eiche, Bezeichnung des dem Michaeliskloster zu seinem Neubau zur Verfügung gestellten, zur Zeit des Erbfolgekrieges noch unbebauten oder doch wenig bebauten Platzes. 1356 verkauften zwei Knappen Grevingh dem Prior genannten Klosters ihren Hof in der Altstadt inter stupam . et inter vicum qui vulgo dicitur de hole ek; nach einer Urkunde von 1375 Aug. 10 war der Platz bis dahin im Miteigentum des Landesherrn, denn es heißt, daß die Herzöge Wenzel und Albrecht gemeinsam mit dem Lüneburger Rate das Baugelände für das Benediktinerkloster, locum qui vulgariter de holeek nominatur cum suis ampliationibus, anwiesen; 1376 locum intra muros opidi . wulgariter de hole eck nominatum prout circumquaque in longum et latum extenditur ac prout ipsum continget ampliari. Eine hs. chronikalische Nachricht des Fünfzehnhunderts sagt darüber: 1371 in die Magni domini [Aug. 19] monachis de castro assignatus fuit locus in civitate ubi deberent edificare mon. s. Mich. e converso, et fuit meretrices morabantur tunc temporis, que platea vocatur holec, quia nolebant alium locum habere propter fundamentum, et domini consules dederunt illis locum illum. Hopfengarten Kollegienbeschluß vom Mai 1925. Die Straße erschließt einen ehemaligen Hopfengarten. Horst-Nickel-Straße Ratsbeschluß vom 23.3.2000. Der Namengeber (1918-1987) der Straße kam nach dem 2. Weltkrieg auf dem Umweg über Rudolstadt, wo er die örtliche CDU mit begründete, aus Elbing nach 142
Lüneburg. Nach einiger Zeit konnte er auch wieder als Lehrer tätig werden und wurde später Rektor einer Grundschule. Ab 1960 war Horst Nickel Mitglied des Lüneburger Rates und hatte 1964 bis 1972 das Amt des Bürgermeisters inne. Von 1970 bis 1982 saß er im Niedersächsischen Landtag und war von 1981 bis zu seinem Tode ehrenamtlicher Oberbürgermeister der Stadt Lüneburg. Für seine Verdienste wurde Horst Nickel mit dem silbernen Ehrenring der Stadt und mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Hügelstraße Kollegienbeschluß vom Mai 1925. Die parallel zur Henningstraße im östlichen Stadtteile angelegte Straße erhielt ihren Namen nach der topographischen Belegenheit. Husanusstraße Ratsbeschluß vom 16.6.1960. Benannt nach Heinrich Husanus (1536-1587), herzoglich sächsischer Rat, mecklenburgischer Kanzler und seit 1574 Syndikus der Stadt Lüneburg. Er war der Verfasser des reformierten Lüneburger Stadtrechts von 1581. Huskamp Ratsbeschluß vom 24.11.1988. Straßenbenennung in Anlehnung an eine frühere Flurbezeichnung. Huskater Bruch Ratsbeschluß vom 29.8.1995. Namengebend war ein überlieferter Flurname in Häcklingen. Igelweg Ratsbeschluß vom 26.2.1959. Benannt nach dem in Europa, Asien und Afrika verbreiteten Stacheltier. Die Straße liegt in einem Quartier mit Bezeichnungen aus der heimischen Tierwelt. Ilmenaustraße Kein Ratsbeschluß. Seit November 1895, zunächst nur für den nördlichen Abschnitt der Straße zwischen Abtsmühle und Conventstraße, nachdem dort ein Wohnhaus errichtet worden war. Wo in älteren Ortsbezeichnungen der Ilmenau (auch, wie in Rostock die Warnow, schlechthin das Wasser und noch zu Maneckes Zeit gemeiniglich die Aue genannt) Erwähnung geschieht, kommt vorzugsweise die Strecke unterhalb der Abtsmühle in Betracht. Von dieser Mühle heißt es, daß sie iuxta aquam in civitate Luneborg lag, 1234; ultra Elmenoue (elm nach Bückmann eine in der Heide heimische Ulmenart, ulmus campestris) erwarb der Rat mit Genehmigung des Michaelisabtes vom Vogte Segeband einige Ländereien 1244, um ein Grundstück inter aquam et plancas civitatis wieder zu veräußern 1254; apud aquam 1304; prope aquam, ultra aquam 143
Elmenow iuxta cran civitatis 1347; Eckgrundstück mit zwei Speichern iuxta aquam ex adverso pontis cum itur de ponte ad civitatem ad sinistram manum versus austrum 1348; ultra aquam Elmenowe iuxta valvam Nienbruche 1348; prope plateam que transit ad aquam Elmenowe ultra aquam Elmenow in novis edificiis 1350; in cono platee quo itur aqua Elm. 1353; ultra aquam Elm. ante valvam novi pontis; iuxta aquam Elm. prope mol. partem ad orientalem 1354; in domo noviter constructa super Elmenow 1357; Badstube prope aquam Elm. 1359; prope aquam Elm. versus murum civ. 1360; prope aquam fluvialem que Elmenov dicitur ex opp. ipsius instrumenti quod cran nominatur; prope Elmenouwe ex opp. cran 1361; bi dem watere; prope Elm. circa krane 1367; apud Elmenowe; apud aquas 1368; neun Salzräume prope aquam Elm. in angulo vici 1390; iuxta fluvium Elm. 1392; citra aquam Elm. prope domum allecialem 1400 ... ex opp. domus allecialis versus orientem 1401; trans flumen Elmenouwe retro domum mercatorum 1410; Hans in dem waterstoven 1426; ein Salzraum neffen der Elmenowe zwischen dem Wohnhaus des Hinr. Viscule und dem Salzraume des Hinr. Wiitick by dem watere up deme orde 1454; penes aquam 1464; prope aquam cum itur ad pontem 1471. Als ein Haus by dem waterstaven oder by deme watere abgebrannt war, verfügte der Rat am 1. Dez. 1478 den Beginn des Wiederaufbaues bis Pfingsten des folgenden Jahres, damit es vor Eintritt des Winters fertiggestellt würde; in dem waterstoven wohnte 1493 der Bürger Hans Meideborg, Vater der Metteke Stovers; als die Verfügung keinen Erfolg versprach, ließ sich der Rat den Bauplatz kostenlos abtreten. Dat Rodenborger husz bzw. das huesz der Rodenborgers genant by dem water besaß 1555 Hauptmann Töbing, dem vorübergehend die Einrichtung eines Backhauses gestattet wurde. Am Wasser lag die eine der beiden Weißladereien, und zwar hart an der Kaufhausbrücke, nördlich sich anschließend, stark über das Flußbett ausgreifend (z. vgl. Büttners Plan, Kaufhaussachen 26), zu Anfang des Achtzehnhunderts als Impoststube verwandt. Zu vgl. Stinmarkt. Über die Teilung des Flußbettes der Ilmenau im Innern der Stadt, über den Stadtgraben mit dem Winterhafen und der Kleinen Schleuse, auch über den Lösegraben, der bei Lüne wieder in den Fluß mündete, gibt der Plan von 1802 eine anschauliche Übersicht. Der L ö s e g r a b e n war zum Schutz gegen Überschwemmungen angelegt und gehört nach einer Erklärung des Lüner Klosters von 1299 schon der Stadt. Im Allerbruch Kein Ratsbeschluß. Die Bezeichnung greift einen Flurnamen in Oedeme auf, der nasses Uferland mit Ellerbäumen bedeutet. Sie wurde 1974 bei der Gebietsreform übernommen. Im Dorf Ratsbeschluß vom 27.1.1977. Die Straße liegt in Alt-Oedeme und setzt den von Lüneburg kommenden Oedemer Weg Richtung Heiligenthal fort. Im Grimm Kein Ratsbeschluß.
144
Alte Bezeichnung der Vorstadt an der Westseite des Kalkberges. Sämtliche Wege, die vom Grimm zum Michaeliskloster und weiter zur Burg wiesen, führten steil aufwärts, und da es in der sonst ebenen, oder doch nur hügeligen Landschaft keine Berge zu ersteigen gibt, so mochte sich der Begriff des ständigen Hinauf und wieder Herunter den Bewohnern des Grimms besonders anschaulich einprägen – ob nicht das Wort Grimm zusammenhängt mit grimmen = „klimmen“, d. h. „hinauf und hinab steigen“? Bückmann leitet die Bezeichnung ab vom langobardischen Personennamen Grimmo (Grimoald), und würde als Beleg eine Rostocker Urkunde von 1509 anführen können: tusschen Grymmen und der stadt muren vor dem heringdore – eine einwandsfreie Deutung bedarf wohl der Berücksichtigung aller Belegenheiten, welche sonst Grimm genannt werden. Auch in Hamburg gibt es eine Straße des Namens Grimm, desgl. im benachbarten Bardewik, doch ist es hier zweifelhaft, ob die Benennung nicht in neuerer Zeit von Lüneburg entlehnt ist. Hammerstein schreibt in seinem Bardengau: Der Grimm war offenbar der Hauptwohnsitz der Burgmannen für die Burg Lüneburg, und sein kriegerischer Zweck wird ihm den Namen gegeben haben; es darf nicht unbeachtet bleiben, daß neben den Burgen zu Hamburg, Dannenberg und Bleckede es ebenfalls, anscheinend zu gleichem Zweck dienende Plätze gab, welche der Grimm hießen. Ein Grimmer Tor wird schon 1273 erwähnt, supra valvam in Grimme; dabei lag ein der Stadt zinspflichtiger Bauplatz, area domus apud valv. de Grimmone 1302. Der Grimm lag außerhalb der Stadtmauer; in Grimmone sub castro extra muros civitatis erwarb das Michaeliskloster von Segeband vom Berge ein Grundstück 1291; eine area des Ritters Scacken lag 1303 in Grimmone ultra locum qui vocatur Reygerbeke; Allod des Michaelisklosters in Grimme Luneborch; drei Grundstücke der vom Berge in Grimme, zwei davon vor dem Tore, wo ehemals ein Stall Heinrichs vom Berge gestanden hatte, 1323; die Kämmerer zahlten 1328 eine Summe pro vectura de Schiltsten et de Grimme, wohl für Kalkfuhren, und ließen ein slachdor ad valvam Grimmonis errichten; die Schwerin verkauften ein Kate in Grimmone, darunter eine mit ihrem Zubehör in qua pulcre mulieres seu publicae antea habitant cum omni iure, desgl. erkannten sie das Eigentumsrecht der Stadt an auf den wal de se licht bi dersulven stad graven buten dem Grimeren dore 1343; dieselben verkauften einen Hof in Grimmone in platea que Repenstedere strate (Repenstedinghe strate 1374) vulgariter appellatur 1344; endlich einen Hof in Grimmone vor dem Grimmeren dore 1350; ein villicus in Grimmone kommt 1351 vor; en vryg hus in deme Grymme 1355; die Groten veräußerten zu freiem Eigen an einen Bürger twe koten de dar ligghed in deme Grymme up deme depen dale 1359; kote in deme Grymme de beleghen is vor der Vyninghe 1369 (ebenda der Garten eines Bürgers 1409); Hof und Wiese uppe deme Reygherbeke in deme Grim vor der stad to Luneborgh 1374; Verkauf eines Estorffer Hofes vor dem Grymmeren dore by dem wege an einen Bürger 1379; die vom Berge verpfändeten einem Hamburger Bürger alle ihre Höfe und Grundstücke in deme Grymme vor Luneborg 1391; einem Lüneburger Bürger zwölf Wurde in dem Grymme, ferner drei Höfe bi dem ezeldyke (egeldik 1374), bi der Repenstederstrate bzw. boven dem dependale, endlich eine Wiese de lecht twisschen dem vorscrevenen ezeldike unde der sultewisch von Luneborg 1402; dem Michaeliskloster sechs Gärten in dem Grymme vor Luneborg belegen in der Repensteder strate sowie einen Garten uppe dem berge boven dem dempendale; Abt Ludolf von St. Mich. überließ einen Garten im Grimm einem Ehepaare auf Lebenszeit, bedingte sich aber einen Jahreszins aus dewile se beyde leven na Grymer rechte 1441; Herzog Friedrich zu Braunschweig und Lüneburg verpfändete den Grym unter dem Kalkberge von Lüneburg mit Gärten, Kempen, Äckern, 145
Wassern, Wiesen, Weiden an den Lüneb. Rat. Ausgenommen wurde der Berggarten unter dem Kalkberge mit einem anderen Garten, sowie zwei näher bezeichnete Kempe und eine Wiese unter dem Schildsteine, die bis an seinen Tod der Stadtvogt Paul Grijff zu Lehn besaß, 1471; die Kämmerer verpachteten den Grym vor deme Nyendore achter deme Kalkberge an den Stadtvogt Pauwel Gryp; der Rat sollte das Gericht über Sachen, die den Grimm betrafen, in Lüneburg halten, der Vogt den vierten Teil der Brüche einziehen 1476; die Witwe eines Bürgers verkaufte einen Garten extra et prope nostre civ. muros in campo qui Grymme appellatur ex opposito turris alte situatum 1513; die Herzöge Heinrich und Wilhelm zu Braunschw. u. Lüneb. verkauften den von ihren Vorfahren verpfändeten Grym under dem Kalckberge und vor unser statt Lunenburg belegen an den Rat zu erblichem Eigentum 1562. Ein um den Grimm gelegter, äußerster Zaun mußte noch im Siebzehnhundert von der Kämmerei, die damals im Grimm vor dem Neuentor über 59 Gärten, auch über eine Wiese, die sog. Butterwiese, verfügte, unterhalten werden. Im Grimm lag westlich der Jägerstraße der zum Michaeliskloster gehörige Neue Ziegelhof, in den Adreßbüchern 1860-66 besonders aufgeführt. Im Häcklinger Dorfe Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Der Straßenname „Im Dorfe“, der fast gleichlautend auch in Oedeme vorhanden war, wurde durch die genauere Lagebezeichnung ersetzt. Im Hegen Ratsbeschluß vom 29.8.1995. Der Straßenname greift eine alte Flurbezeichnung in Häcklingen auf. Im Hohen Garten Ratsbeschluß vom 30.8.1962. In Anlehnung an die frühere Gartenstraße (s. das.) und ein altes Gartengelände. Im Kamp Kein Ratsbeschluß. Die Wahl des Namens erfolgte nach einer alten Flurbezeichnung „Kamp“ und wurde mit der Eingemeindung Oedemes 1974 übernommen. Kamp meint eingefriedetes Acker-, Wald- oder Wiesenland. Im Karnapp Bezeichnung einer Ausbuchtung der Wendischen Straße. Das Wort karnap bedeutet einen Vorsprung am Hause, eine Utlucht, und wird hier im Hinblick auf die kleinen Verhältnisse des Platzes angewandt sein. Fünf Buden in karnappe uti vulgari vocabulo vocant 1591; drei Buden in vico vulgo exedra [halbrund geschlossener Saal, Sprechhalle] vel carnap nuncupato prope tepidarium salinare [Sülzbadestube] 1596; Bude in exedra, vulgariter im karnap nuncupata iuxta balneum salinare 1600; im carnab retro balneum salinare 1625; platea carnap dicta 1657; Bude zwischen Buden im karnap 1676; knap 1794; im knapp Plan von 1802 und Adreßbuch 1860; im Karnapp (1869). 146
Ein Karnapp (exedra) ist auch in Gifhorn und Harburg nachzuweisen; in Lübeck Bezeichnung eines nur über eine steile Bodentreppe zugänglichen Gemachs mit weiter Aussicht, auf dem Hause der Krämerkompanie. Imkerstieg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Schon der Gemeinderat Ochtmissen hatte mit Beschluß vom 26.2.1974 im Zuge der Eingemeindung den Straßennamen „Am Lerchenberg“ durch Imkerstieg ersetzt, da es in Lüneburg bereits einen Lerchenweg gab. Im Redder Ratsbeschluß vom 12.12.1985. Die Straßenbenennung greift einen überlieferten Flurnamen in Ochtmissen auf. Im Roten Felde Straßenname seit 1926, unten unter Rotenbleiche erklärt, alte Gesamtbezeichnung für das noch unbebaute Ackerfeld zwischen dem Rotentore und dem Bockelsberg. Im Sandfeld Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Der Straßenname erinnert an die sandige Beschaffenheit des Bodens in dieser Gegend. Im Schießgraben Kein Ratsbeschluß. Am rechten Ilmenauufer unterhalb des an das Rademacherhaus am Altenbrückertore grenzenden Gehrhofes – dieser ist wohl identisch mit dem 1409 und 1416 erwähnten lohuse – befanden sich die von hohen Baumreihen eingefaßten Schießstände der städtischen Schützen, im Schießgraben. Es gehörten dazu, nach einem Abriß von 1781, das Haus der Schützengesellschaft, zwischen diesem und einer als Kugelfang dienenden, wallartigen Blende eine Kegelbahn und als Abschluß nach dem Gehrhofe hin das Scheibenschauer nahe dem Scheibenweiser Haus. In den Gesetzen der Schützengesellschaft von 1589 wird bereits eines Schützenhauses gedacht; vom Montag nach Ostern bis Michaelis sollte aus dem Schützenhause im Schießgraben 22mal nach der Scheibe geschossen werden. Im schedthuse edder im schütting durfte nach einer Verordnung des Rates von 1597 niemand Würfel spielen; 1708 erhielt das Schießhaus zur Bestreitung der von der Schützengesellschaft im Jahre 1704 verausgabten Kosten für einen Neubau von Grund auf die Schankgerechtsame für fremde Biere. Das sog. Schützen Haus im Schießgraben hat die Cämmerei auf Gutbefinden eines erbaren Rats cum commodo et incommodo für 1640 Rst. angenommen, um es zu verpachten 1718. Eine der Stadt gehörige Färberei im Schießgraben, gemäß Vertrag unentgeltlich gebraucht von denen Juden so die Lakenfabriquen haben, wurde 1731 an Wedemann verkauft.
147
Im Schießgraben mit gasthof Wilhelm Kofahl „Zum Schießgraben“
Der von den Gerbern und Schustern benutzte, mehrfach erwähnte Gehrhof wurde 1652 seitens des Bauamtes bey den schiessgraben mit einer Vorsetzung∗ verwahrt; das Amt der Schuster zahlte für eine jedwede Gärbekuhle auf dem vor dem Altenbrückertor befindlichen Gärbehof eine Abgabe. Im Schießgraben 1802. Im Tiefen Tal Kollegienbeschluß vom 1.1.1910. Die Bewidmung nimmt eine der ältesten Ortsbezeichnungen Lüneburgs (vgl. oben I m G r i m m) wieder auf. Von drei Hufen, die Gebhard vom Berge 1374 im Grimm verkaufte, lag die eine boven deme depen dale; uppe deme dependale in deme Grymme by der stad to L. kaufte das Michaeliskloster 1383 einen Garten. In Hannover dependal 1517. Im Tiergarten Kein Ratsbeschluß. Der Tiergarten, ursprünglich herzogliches Jagdgebiet, wird zuerst erwähnt 1272: apud ortum ferarum. Die Bauherren hatten das Recht, das zum Bau eines auf der oberen Ilmenau unterhaltenen Prams erforderliche, gebogene Krummholz (de wrangen) in deme dergharden edder an der heren holte hauen zu lassen 1410. Am 21. Mai 1493 verpfändete Herzog Hinrick seinen deergarden vor Lüneburg für 2000 rhein. Gulden an den Großen Hl. Geist; ein Frühlingsfest des Johanneums, das alljährlich im deregarden (1505) stattfand, wird von Lucas Lossius (hortus ferarum 1566) besungen. Ein Claus Eggers erklärte 1727 gelegentlich eines Zeugenverhörs, er sei auf dem Immenzaun in dem ohnweit dieser Stadt belegenen Tiergarten geboren. Das Adreßbuch seit 1860 führt die Bezeichnung im Tiergarten für das Haus des Stadtförsters (bzw. Forstwärters) und das eines Bahnwärters. Im Timpen Kein Ratsbeschluß. Timpen ist das in eine Spitze auslaufende Ende eines Dinges, insbesondere einer in Lüneburg beliebten kapuzenartigen Kopfbedeckung, der kogel, von welcher die Kaufleute ihren Namen kagelbroder führten. Denkt man sich den Platz im Timpen wie von alters durch den Wall geschlossen, so ist die gemeinte Ähnlichkeit unverkennbar, und Timpen ist in der Tat verkürzt aus Kageltimpen. In dem kogheltympen 1451. Die Provisoren der Lambertialmosen verkauften 1544 eine Bude zwischen einer Bude und einem Hofe versus murum, vulgo im kageltimpen prope valvam salinarem; desgl. die Provisoren von Nicolaihof 1587 in platea quae vocatur die kageltimpe ante portam salinarem; zwei Buden in regione vulgo kageltimpen nuncupata versus moenia 1604; retro salinae fontem im timpen loco ita indigitato 1647; in loco vulgo vocatur kageltimpe 1651; ante portam salinarem im kageltimpen (kegeltimpen) 1674; im timpen 1676; achter in den timpen 1794. Der freie Platz vor dem Timpen wurde 1869 mit Bäumen eingefaßt. In Danzig kageltympe nach 1415; dann kagelczippel, in Stade kageltympe 1530. ∗
D. h. einem Bollwerk. Einige Salzräume in der Nähe der Kaufhausbrücke heißen in den Schoßrollen von 1835 ff. am Vorsetzen. 149
Im Verdener Hof Kein Ratsbeschluß. Der Verdener Hof nahm die ganze Westseite des Klosterganges ein und umfaßte das Absteigequartier sowohl des Bischofs wie des Domkapitels von Verden. Er gelangte, wie Manecke zusammenstellt, nach Säkularisierung des Stiftes zunächst an die Krone Schweden, dann an das Herzogshaus Braunschweig-Lüneburg (1679) und zwar so, daß die Celler Linie den Bischofshof erhielt, die Wolfenbütteler den Kapitelshof. Beide Höfe gelangten in raschem Wechsel sodann in Besitz der Stechinelli, v. Schwichelt (1755), des Magistrats (1758) und zuletzt in Bürgerhände (1763). Auch der Nachbarhof, gen. R o t e n b u r g e r H o f , gehörte dem Bischof, an dessen Amt Rotenburg; er wurde 1762 Eigentum des Magistrats, nachdem er zuvor im Besitz der Wwe. des Inspektors der Ritterschule Mechow, von 1687/1712 und schon in früherer Zeit der v. Wittorf (Großer Wittorfer Hof), dann der v. Post (bis 1743) und Kelp gewesen war. Der V e r d e n e r H o f , die curia episcopalis, ist der Ausstellungsort zahlreicher Urkunden des Bischofs wie seines Offizials; der Ratmann van der Mölen verkaufte 1438 sein Haus retro ecclesiam fratrum minorum b. Mar virg. in oppositum curie episcopalis Verdensis; Aleke in des bisscopes kellere 1460. Das Adreßbuch führt die Bezeichnung am Verdener Hof seit 1869 selbständig, bis 1866 unter der Straße Am Iflock. Im Wendischen Dorfe Kein Ratsbeschluß. Die auf den Namen sich stützende Vermutung, daß an der unteren Ilmenau ursprünglich eine selbständige wendische Niederlassung bestanden habe, die erst nach Ausdehnung der Stadt bis zum Ufer des Flusses mit Lüneburg verschmolzen sei, ist schon von Manecke (S. 82) hinlänglich widerlegt. Der Name ist späten Ursprungs, er entstand im Hinblick auf die wendischen Schiffsknechte, die in den Wohnbuden nahe dem Hafen zusammenwohnten. Manecke berichtet, daß ein Brauer auf seinem großen Hofe achtzehn solcher kleinen Wohnungen habe erbauen lassen, von denen die von der Straße ab zugänglichen sieben bis 1803 im Besitz der Eichenschiffer gewesen seien. Nach den lateinischen Belegstellen würde man statt Wendisch Dorf eher im wendischen Goh erwarten. In deme wendesschen dorppe Schoßrolle von 1500; Schifferwohnhaus in pago wandalico post curiam monasterii de Scharmbeke 1532; Brauhaus Schröder una cum domo pistorali casisque in dicta curia sitis vulgariter pagus wandalinus nuncupatus ... inter curiam conventus monasterii de Schermbeke ... prope capellam s. Nicolai in platea praefecti 1542; prope pagum wandalicum et ex opposito muri portae Bardewicensis 1569; im wendischen dorpe 1572; Wendisch Dorf Straße 1765; im Wendischen dörp 1794; im Wendischen Dorfe 1802. Die Schoßrolle von 1850 unterscheidet noch Wendisch Dorf und Am Wendischen Dorfe. Die Belegenheit des eigentlichen Wendischen Dorfes erweist S o e t b e h r s H o f (wohl nach der im Jahre 1616 eingewanderten Mülterfamilie Soteber; ein Soetbeer kauft die erwähnten sieben Wohnungen 1803). Der mit Soetbehrs Hof bis gegen 1890 verbundene Hof des Hauses Lünerstraße 13 war im Gegensatz zu den sonstigen Lüneburger Höfen nicht langgestreckt, sondern rund gebaut – vielleicht hat diese auffallende Erscheinung an den Grundriß eines Wendendorfes erinnert und die Namenbildung gefördert. Nach Gebhardi bestand das Wendische Dorf aus fünf kleinen Tweten mit Ausgang auf die Wendische Straße und durch Brauer Zeins Hof. 150
Im Winkel Ratsbeschluß vom 26.2.1959. Da die Straße eine Sackgasse bildet, erklärt sich der Name von selbst. In den Birken Ratsbeschluß vom 16.12.1982. Die Straßenbezeichnung orientiert sich an einer alten Flurbezeichnung. In den Kämpen Ratsbeschluß vom 15.12.1978. Die Straßenbezeichnung nimmt einen alten Flurnamen auf. In den Stuken Ratsbeschluß vom 26.3.1959. Nach einer Flurbezeichnung aus dem Braunen Buch von Hermann Löns. Bedeutet abgeholztes Gelände. In der Kemnau Ratsbeschluß vom 26.5.1988. Bei der Namensgebung wurde auf eine historische Flurbezeichnung zurückgegriffen. In der Lau Ratsbeschluß vom 29.8.1995. Der Straßenname greift eine alte Flurbezeichnung in Häcklingen auf. In der Marsch Kollegienbeschluß vom 10. Januar 1911. Der Name gilt für den Koppelweg von der verlängerten Goseburgstraße nach der Ilmenau. – In Göttingen Obere und Untere Maschstraße, in Hamburg-Großborstel die Masch. In der Süßen Heide Kein Ratsbeschluß. Der Name wurde bei der Eingemeindung Häcklingens 1974 übernommen. Er geht auf eine überlieferte Flurbezeichnung zurück. In der Techt Kein Ratsbeschluß. Das Wort Techt ist entstanden aus tegede, der Zehnte, der vermutlich an dieser Straße an das Michaeliskloster eingeliefert und dort in einer Zehntenscheune verwahrt wurde. Die herzogliche Vogtei Amelinghausen wurde von Lüneburg aus 151
verwaltet, als Sondergut, mit Special-Rechten eines besonderen Landesteils: vogedie to Amelinghusen uppe der Teche. Der Sitz auf der Techt, einer Lün. Straße, gab ihr den Namen. Scult supra Teche schon 1290-1300 in der Lehnsrolle der Grafen v. Schwerin, also hieß die Vogtei Amelinghausen schon vor Übersiedlung der Verwaltung des castri L. nach Winsen die Vogtei auf der Techt (Hammerstein, Bardengau). Durch die Techt ging der Straßenkampf der Ursulanacht; Schomaker bezeichnet sie als die kleyne strate vor dem Wittorper have, d. h. vor dem späteren Langen Hof. Iuxta plateam quae vulgariter Tetche dicitur 1347; in antiqua civitate prope Teghche 1356; die Erlaubnis zur Anlage einer Schmiede neven der tecche erteilte der Rat 1453; Eckhaus Hemelsingh prope vicum teche vulg. dictum versus portam novam in antiqua civitate; Holzhof neffen der ghassen alsze men van sunte Michaele twischen dem Langenhove unde sunte Benedictes hove dale gheit 1461; Haus Otte in acie pl. vulg. de Thechchen nun. ex opp. domus acialis validi Werneri de Medinge prope s. Mich. 1496; am orde by der Techchen beneffen Jorden Marschalkes des elderen wonhuse over, up der Oldenstad by sunte Michaele, Anschluß an die Wasserleitung 1497; ein tot geb. Kind wurde in eine Teche hinder S. Michael getragen und daselbst in ein heimliches Gemach geworfen, in ein privet in der Techen achter S. Michael 1574; Brauhaus Westermann-Bruwel in veteri platea in aditu angiporti [Twite] vulgo der techeter twiten nominati zwischen Buden des Abtes und der Wohnung des Albert Schröder, figuli, 1600; gerade gegen der techt über 1619; non multum a pl. der techte 1657; Brauhaus ante portam novam ad aciem angiportus (der techte) 1671; in der decht 1765; in der techt 1819; die Techt 1802, 1860/66; in der Techt 1869. Zu vgl. Neuetorstraße. Nach Abbruch des alten Schulgebäudes am Michaeliskirchhofe wurde 1791 die Michaelisschule nach der Techt verlegt, und zwar in die vormalige Offizialwohnung des zweiten Klosterbeamten; die im Jahre 1809 eingerichtete Dienstwohnung für den Conrektor hatte seit 1661 dem Kloster Isenhagen gehört. In der Weide Kein Ratsbeschluß. Seit November 1913 in Anlehnung an die großen Weidegebiete an der Ilmenau. Am Westrande der Breitenwiese lag (nach Volger) eine Pferdehütte, die städtische Dienstwohnung für den ehemaligen Pferdehirten. Zur Pferdehütte 1860-1866. Jägerstraße Kollegienbeschluß vom 10. Oktober 1899. Benennung für den Straßenzug, der von der Reppenstedter Landstraße oberhalb des Jägerhauses in südlicher Richtung abzweigt und auf den Jägerteich zuführt. Das Jägerhaus (Vor dem Neuentore 25), noch zuletzt kenntlich an einem auf dem Westende des Dachfirstes angebrachten Hirschgeweih, ist 1902 abgebrochen; es war ein Vorwerk des Michaelisklosters und ehemals wohl bewohnt vom Klosterjäger der Benediktinermönche; zur Obhut des Jägerhauses wird der künstlich angelegte Jägerteich (der monneke dyk im Vierzehnhundert, Klosterdeich mit schwimmendem Badehaus bei Gebhardi) gehört haben.
152
Jakob-Kaiser-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Der christliche Gewerkschafter (1888-1961) leitete die gewerkschaftliche Gruppe des Widerstands mit M. Habermann und W. Leuschner. 1945 war er Mitbegründer der CDU in Berlin und der SBZ und wurde 1947 durch die sowjetische Besatzungsmacht seines Amtes enthoben. Später war er Bundestagsabgeordneter, Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen und Leiter der Bewegung „Unteilbares Deutschland“. Johanna-Kirchner-Straße Ratsbeschluß vom 14.9.1972. Aus alter sozialdemokratischer Familie in Frankfurt/Main stammend, engagierte sich Johanna Kirchner (1889-1944) seit ihrem 14. Lebensjahr in Partei und Gewerkschaft. Einem Haftbefehl entging sie 1933 durch Flucht ins Saargebiet und dann nach Frankreich. Bei Kriegsbeginn wurde sie interniert und von der Vichy-Regierung nach Deutschland ausgeliefert. 1942 zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt, folgten 1944 Todesstrafe und Hinrichtung in Berlin-Plötzensee. Johanna-Stegen-Straße Kein Ratsbeschluß Östlich vom früheren Jägerhause, bis gegen 1912 Ackerland. Das Gefecht vom 2. April 1813, in welchem das Mädchen von Lüneburg sich rühmlich hervortat, zog jenes Gelände mit in seinen Bereich. Johanna Stegen, am 11. Januar 1793 in Lüneburg geboren, hat ihre Vaterstadt im Herbst 1813 verlassen, um nicht wieder dahin zurückzukehren. Sie war fast 25 Jahre vermählt mit dem Oberdrucker im Kriegsministerium Wilhelm Hindersin in Berlin und starb dort am 12. Januar 1842. Ihre eigenhändig geschriebenen Erinnerungen werden mit anderen Andenken im Lüneburger Museum verwahrt. Johannes-Gutenberg-Straße Ratsbeschluß vom 28.1.1999. Johannes Gensfleisch, nach dem väterlichen Besitz in Mainz „zum Gutenberg“ genannt (um 1397-1468), erfand den Buchdruck mit gegossenen beweglichen Bleilettern und revolutionierte damit die Herstellung von Büchern und anderen Druckwerken. Johannes-Lopau-Weg Ratsbeschluß vom 28.9.1979. Benannt nach dem ehemaligen Senator Johannes Lopau (1876-1933). Er hatte das Maurerhandwerk erlernt und sich früh für die SPD und die Gewerkschaft eingesetzt. Von 1919 bis 1933 gehörte er dem Magistrat an. Bekannt wurde er vor allem als Geschäftsführer des „Volkshauses“ und als Redakteur des „Volksblatt“. Im aufkommenden Nationalsozialismus immer stärkeren Pressionen ausgesetzt, machte er wenige Wochen nach der „Machtergreifung“ seinem Leben selbst ein Ende. Johannisburger Straße Ratsbeschluß vom 17.12.1981. 153
Benannt nach der ostpreußischen Kreisstadt, die in einem großen Heide- und Waldgebiet liegt. Der Ort Pisc (Woiwodschaft Olsztyn) gehört heute zu Polen. Johannisstraße Kollegienbeschluß vom 18.6.1895. Bis 1895 im Volksmunde Glahnstwite, nach einem originellen Anwohner; amtlich vor dem Roten Tore; der neue Name wurde auf Wunsch der Anlieger, da die Straße sich doch so nahe der Johanniskirche und dem Johanneum befinde, auch sehr viel von den Schülern des Johanneums benutzt werde, zugestanden am 18. Juni 1895. Vereinzelt wird eine vom Meer abzweigende Johannisstraße genannt, vermutlich weil dortige Häuser der Pfarrkirche am Sande gehörten; Schoßrolle von 1458 in sunte Johanses strate (Marktviertel); Eckhaus Höpfner in mari ad angulum plateae s. Joh. 1646. Johann-Sebastian-Bach-Platz Ratsbeschluß vom 24.5.1955. Umbenannt aus Bei der Michaeliskirche. Bach war von 1700 bis 1702 Chorschüler an der Lüneburger Michaelisschule. Judenstraße So hieß über das Jahr der auch in Lüneburg nachweisbaren Judenverfolgung, 1350, hinaus der untere Teil der Altstadt, ursprünglich wohl nur von Juden bewohnt. Auf dem Grundstück Nr. 48, wo das Wohnhaus auffallend zurückliegt, mag die Synagoge oder Judenschule gelegen haben. Platea iudeorum 1288 (nach Büttner); Hermannus de Odeme apud judeos wurde Bürger 1309; prope Judeos 1325; Albert Clüvers Wohnwesen in pl. iud. quasi in opposito domus iudei Davidis 1339; iuxta pl. iud. 1347; Peter v. Reinstorf kaufte ein Haus in capite platee iud. iuxta domum Conradi pergamentarii 1348; desgl. der Bader Hinrik Voos ein Haus cum stupa in pl. iud. 1350; der Bäcker Heinr. v. Scherembeke wohnte in angulo platee quae dicitur iud. 1352; die Frau des Bürgers Joh. v. Seltzinge kaufte ein Haus in angulo platee iud. 1353; in pl. iud. prope valvam quondam Meygers iudei 1356 und 84; in pl. iud. prope stupam ipsorum 1356; der Bürger Nic. Solsenshusen kaufte ein Haus circa medium pl. iud. cum stupa adiacente und drei zugehörige Buden 1358; zwei Brüder gen. von Hansen wohnten in angulo pl. iud. et circa 1358; circa pl. iud. 1359; prope pl. iud. 1363; in angulo pl. iud. versus antiquam civitatem 1366 (vormals Joh. v. Seltzinge); die Herzöge Wenzel und Albrecht überließen dem Rate alle huz mid eren tobehoringhen dar de joden inne ghewonet hebben in der jodenstrate und de der heerschop tohoren dat se darmede don unde laten wat se willen 1371; i. pl. iud. versus mon. s. Mich. 1382; in der jodenstrate 1383; up der iodenstrate 1387; der Rm. Grabow verkaufte Joh. Cluvere lapicide ein Haus i. pl. iud. prope scolas iudeorum 1387; Witwe Querendorpes wohnte in pl. iud. in introitu nove platee versus occidentem 1389 – die Himmelsrichtungen, die in Verbindung mit der Judenstraße genannt werden, sind stets Osten und Westen. Eckhaus nove platee versus pl. iud. 1390; in pl. iud. in opp. stupe eiusdem pl. 1392; iuxta stupam in pl. iud. 1393; an der jodenstraten 1401; Hinrik Rubow kaufte von den Erben Ludolfs vom Haghen scholam iudeorum cum duabus casis 1411; der Bürger Rybe, linifex, wohnte an der Judenstraße inter scolam in iudeorum et domum Sprutenschen; Lodewich und Gheseke ... im Ganzen 7 Personen in der Jodenschole, in scola judeorum et prope 154
1426; der Ratmann Hinrik Rubowe verkaufte einem Bürger scholam iudeorum cum duabus casis adjacentibus cum meatu aquarum, qui transit per domum Joh. Arndes ac domum, curiam et aream cum omnibus earum pertinenciis prope eandem scholam versus occidentem 1426; in vico per quem a pl. iud. itur ad stubam saline 1427; teghen der jodenschole uppe der oldenstad 1466; Bude zwischen zwei Wohnhäusern in der yodenstrate by den veer orden 1468; Eckbude zwischen Eckhaus Rodenborg et stubam communem n pl. iud. 1469; der Ratmann Erpensen kaufte domum istam que sinagoga nuncupatur ... super ant. civ. 1474; seine Erben lösten Ansprüche in de godenschole durch einen Vergleich ab 1491; die Testamentare verkauften die Synagoge cum pistrina in curia et duobus casis adiacentibus 1497; der Ratmann Tzerstede verkaufte sein Haus an Drewes Walen, es lag zwischen des letzteren Eckwohnhaus et domum dictam synagogam in pl. iud. 1489; Brunnenanlage im Hause des Drewes Wale am orde up der Oldenstat in der Jodenstrate 1496; desgl. am orde up der Oldenstadt beneffen Drewes Walen wonhuse over in der Jodenstrate 1497; super ant. civ. in pl. iud. 1495; in pl. iud. supra (prope) quatuor acies 1491 und 1498; uppe der Oldenstadt iegen der jodenschole 1499; eine Schmiede in der jodenstrate beneffen deme Hamborger Keller 1503; in der jodenstrate up der oldenstadt 1512; by dem orthuse, dar ein ersam radt Hamborger ber inne tappen leth, baven den veher orden in der Godenstraten 1521. Eine Erwähnung bei Manecke (top.-hist. Beschr. S. 112), wonach die Juden die nach ihnen benannte Straße, jetzt die alte Judenstraße auf der Altstadt, bewohnt haben, beweist, daß die Tradition des Namens sich mindestens bis um 1800 erhalten hatte; die alte Synagoge ist nach Manecke Petersens Backhaus. Aus den Urkunden verschwindet die Judenstraße in der ersten Hälfte des Sechzehnhunderts. In Braunschweig jodenstrate 1320, in Göttingen Jüdenstraße, in Hildesheim Judenstraße, in Wismar platea iudeorum 1342. Jürgen-Backhaus-Straße Ratsbeschluß vom 29.9.1994. Die Straße wurde nach Jürgen Backhaus (1928-1993) benannt, der von 1976 bis 1986 und 1991-1993 für die SPD dem Rat der Stadt Lüneburg angehörte. Jüttkenmoor Ratsbeschluß vom 23.3.1972. Die Straßenbezeichnung greift einen alten Flurnamen auf, der auf die sumpfige Beschaffenheit der Gegend hinweist. Dort lag seit 1441 der Ziegelhof des Michaelisklosters. Julius-Kallmeyer-Straße Ratsbeschluß vom 29.8.1996. Georg Heinrich Julius Kallmeyer (1777-1842) gründete 1806 im Haus Grapengießerstraße 2 einen Handel mit Kolonial- und Eisenwaren und eine Speditionsfirma, die vor allem Beziehungen nach Mitteldeutschland pflegte. 1821 kam eine Agentur der Gothaer Feuerversicherung hinzu.
155
Unter den 100 Bürgern der Stadt Lüneburg, die General Montbrun am 6. April 1813 gefangen nehmen ließ, um dann jeden zehnten erschließen zu lassen, befand sich auch Julius Kallmeyer. Der Plan kam durch das Eingreifen General Dörnbergs übrigens nicht zur Ausführung. Julius-Leber-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Julius Leber (1891-1945) war seit 1921 Chefredakteur des „Lübecker Volksboten“ und wurde 1924 für die SPD in den Reichstag gewählt, dem er als wehrpolitischer Fraktionssprecher bis 1933 angehörte. 1933-1937 war er im KZ Sachsenhausen eingesperrt. Danach schlug er sich in Berlin als Kohlenhändler durch und fand Anschluß an den Kreisauer Kreis und an die Gruppe von Anton Saefkow. Von einem Gestapo-Spitzel denunziert wurde Leber vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und hingerichtet. Julius-Wolff-Straße Kollegienbeschluß vom 5. Juli 1910. Die neu angelegte Straße unterhalb der Bastion, von der Hindenburgstraße ab in östlicher Richtung zu den Anlagen in der Niederung erhielt den Namen des in gen. Jahre am 3. Juni zu Charlottenburg entschlafenen, um Lüneburg verdienten Dichters des Romans „Der Sülfmeister“, erschienen 1883. Der Lüneburg-Roman des „Butzenscheibendichters“ (1834-1910) ist in zahllosen Auflagen verbreitet. Käthe-Kollwitz-Straße Ratsbeschluß vom 29.9.1994. Die Malerin, Grafikerin und Bildhauerin (1867-1945) war Mitglied der Berliner Akademie der Künste. Ihre Darstellungen waren durchdrungen von ihrem Pazifismus und vom Glauben an die Würde eines jeden Menschen. Käthe-Krüger-Straße Ratsbeschluß vom 29.9.1994. Die Tochter (1901-1984) Johannes Lopaus war wie der Vater für die SPD Mitglied des Rates und Senatorin (1956-1972). Als Vorsitzende des AWO-Kreisausschusses und des Hilfswerkes freier Wohlfahrtsverbände war sie über Jahrzehnte ehrenamtlich im sozialen Bereich als Armenpflegerin und dann Fürsorgehelferin der Stadtverwaltung tätig, wofür sie mit dem Ehrenring der Stadt und dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde. Kalandstraße Kein Ratsbeschluß. Das Kalandshaus, das der Straße ihren Namen gegeben hat, ein Gesellschaftshaus der Kalandsbrüderschaft (z. vgl. W. Reinecke, Geschichte des Lün. Kalands, Jhrb. des Museumsvereins 1891/5), nach deren Aufhebung Dienstwohnung des Rektors Johannei, wird erwähnt bereits 1437 als des kalandes hus; von einem Kalandshause achter sunte Johannis Kerken heißt es 1487, daß es früher Eigentum des Herrn Joh. vame Lo gewesen sei; der ältere Ratsherr dieses Namens starb 1471, der jüngere 156
Kalandgebäude nach dem Umbau von 1896
1482. In seiner überlieferten Gestalt ist das Kalandshaus wohl im Jahre 1491 entstanden. Zu vergl. eine Notiz der Mühlenrechnung gen. J.: 2 M kostete de dreck wech to vorende de by der müren lach, do de kalenheren or husz wolden buwen, und de molenkaren musten by der müren henne varen up de tyd (nach Büttner). 1874 wurde das alte Kalandsgebäude im Innern zur Turnhalle ausgebaut und die Kalandstraße verbreitert; oben erhielt der Türmer, dessen Wohnung an der Kalandstraße abgebrochen war, seine Behausung. Die Bezeichnung Calandsstraße findet sich in der Schoßrolle von 1850; sie wurde im November 1895 ausgedehnt auf die Verlängerung bis zur Roten Straße, bis dahin hinter der Roten Mauer. Zum Grundwerk der Ratsmühlen wurde 1541 Holz u. a. auch uth dem kalandesholte beschafft. Zu vgl. Rotenmauer. H i n t e r d e m K a l a n d, seit 1869 vor der Ratsmühle, wohnten auf städtischem Eigentum bis gegen 1890 drei Toten- oder Kuhlengräber, der Plan von 1794 entnimmt daher die Bezeichnung K u h l e n g r ä b e r S t r a ß e, setzt aber für das östliche Drittel der Kalandstraße auffallenderweise Rosenstraße ein. 1864 leitete ein Kanal den Rest des ehemaligen Sülztorfkanals vom Rotentore über den Platz des ehemaligen Rotenwalles in die Stadt, und zwar durch die Kalands-(Perl)straße in den Hauptkanal am Joh. Kirchhofe. Eine platzartige Ausbuchtung der Straße östlich vom Kalandsgebäude bis an den Fuß des neuen Wasserturmes, bis um 1860 besetzt von drei seitens des Klosters Reinfeld, später vom dänischen Könige verliehenen Vikariatswohnungen („Reinfelder“, auch „Leimsiederhof“), hieß der Z i e g e n m a r k t. Mehr als zwanzig im Jahre 1438 vergrabene Mühlensteine lagen by dem husze dat to des rades molen horet alsze men geyt na der stad muren in der klenen straten 1466, auch zwischen eines ehrb. rats mühlenhaus und der hölzernen planken in dem gange da man gehet von dem zegenmarckede achter des Calandes huse 1551; die noch jetzt bestehende Schmiede Altenbrückertorstraße 1 scheint gemeint zu sein 1676: ante veteris pontis portam in foro caprario. Die Bezeichnung am Ziegenmarkte hielt sich in den Adreßbüchern bis 1872. Zu vgl. Ohlingerstraße. Ein Ziegenmarkt auch in Braunschweig, Rostock und Wismar, eine platea caprarum in Danzig. Kampferweg Kein Ratsbeschluß. Der Straßenname in Oedeme wurde 1974 bei der Eingemeindung übernommen und erinnert an den in Südostasien heimischen Kampferbaum. Kantstraße Ratsbeschluß vom 25.7.1951. Mit der Benennung wurde der Philosoph Immanuel Kant (1724-1804) geehrt, der in Königsberg/Ostpreußen geboren ist und an der dortigen Universität lehrte. Ihm gelang der Anschluß an die westeuropäische Aufklärungsphilosophie und ihre Weiterführung. Kastanienallee 158
Kein Ratsbeschluß. Übernommen aus dem Ortsteil Hagen (Eingemeindung 1943). Katzenstraße Kein Ratsbeschluß. Die Bedeutung des Namens der schmalen Seitengasse ist wohl die eines Schleichpfades. So hat auch Rostock seinen Großen und Kleinen Katthagen, dazu den Katerstieg, Danzig seine Katergasse, Hamburg und Braunschweig haben ihre Kattreppen und Kattrepelsbrücke, Stade hat die kattekenstrate 1374, Wismar den Katersteig. Platea die kattenstrate vulgariter nuncupata 1612; Eckhäuser Elver und Ebeling in der katzenplatea 1624; platea quae dicitur felium 1644; katzenstraß 1652; Haus Düsterhop in nova salina ad aciem plateae quae dicitur die katzenstraße 1654; am Brauhaus der Wwe. Ebelinges, Ecke der Katzenstraße, hing 1666 eine Kette, anschließend an die Torwegmauer von Witzendorffs Erben; uf der Kattenstraßen Ecken in Herrn Braunschweigs Hause hatte der verstorbene Goldschmied Daniel Zacharias seine Esse gehabt, seine Witwe wohnte noch dort 1697; kattenstrate 1794. Ältere Umschreibung: in der twyten de ... upgheit to der nien zulten wort 1390. Kaufhausstraße Bis um 1866 beym oder hinterm Kaufhause. Die älteste Erwähnung des Kaufhauses, damals Häringehaus genannt, ist von 1302 item solvit domus allecium extra novum pontem quolibet anno 16 M den. Zugehörig war der Kran, von welchem, de krane et de macellis allecum, Werneke von Bardvik 1330 eine Abgabe zahlte; 1372 verschreibt der Rat für die Erhebung eines Zinses use haringhus unde usen kran; prope domum mercimoniorum ... versus portam aquarum 1389; prope domum allecialem 1400; der Bau einer Schleuse beneben dem heringhuse erfolgte 1409, zugleich eine Vertiefung des Grabens, bauliche Verbesserungen der sluse achter dem heringhuse wurden 1415 und 17 vorgenommen, eine Erneuerung und to vorpalende by der slüse wente an dat Luner dor geschah 1429 ff. Im Jahre 1410 nimmt der Rat 300 M auf to wedderlosinge des kranes und des kophuses anders geheten haringhus gelegen binnen unser stadt; Ausgabe vor dat stad to verdegende nedden deme heringhuse 1410; Stenbrügger arbeiten 1411 by dem krane und by dem vischmarkede unde by dem heringhuse; iuxta domum angularem ex opposito des cranes 1416; 120 gehauene Steine liegen by dem krane 1430; achter deme cophuse 1435; bij dem Kophuse 1437; 1438 machen Arbeiter dat werff by dem crane, sie bessern ihn mit 4 Knien und pflastern umme den cran her; an de syde by dem kophuse de to water ward is werden neue Pfähle gesetzt und Pfeiler wieder aufgemauert 1452; uppe dem plane achter dem kophuse lagert Tonnenholz der Böttcher 1455; des trumpers waninge achter deme Kophuse gebaut 1465; zwei ord boden achter deme kophusze 1469; trans flumen Elmenouwe retro domum mercatorum 1471; Eckhaus des Titke Brandt e regione geranii nostri 1593; in angulo post geranium 1611; retro emporium penes muros civ. 1628. Die Brücke, die zum Kaufhause führt (z. vgl. Lünertorstraße), heißt die Neue Brücke 1289; iuxta novum pontem, vgl. oben, 1302; prope novum pontem 1359 und 1385; buten der nyenbrügge vor Luneborgh 1390; später wird sie nach dem Kaufhause benannt – brugge bij dem kophuse 1445; de brugge vor dem kophuse to makende 1452; sie wird gepflastert und geteert 1483; vereinzelt 1508 uppe der Lunebrugge. Ein Turm hinter dem Kaufhause wurde nach 1700 bewohnt vom Visitirer am Kaufhause. Auf
159
dem Werder hinter dem Kaufhause befand sich eine Aalkiste, ferner ein Garten mit Gartenhaus für den ältesten Bürgermeister, verkauft 1766. Im Februar 1795 riß eine Überschwemmung nebst der Stammers- und Baumkuhlenbrücke auch zwei Bögen der Kaufhausbrücke weg und machte einen neuen Brückenbau unvermeidlich; zu diesem Zweck wurde das an der Wasserseite beschädigte Wulkowische Bürgerhaus von der Kämmerei angekauft und mit dem Weisladergebäude abgebrochen. Grundstein mit dem Rathsmarck am 14. Aug. 1795; der Bau geschah nach einem Entwurf des Landbaumeisters Joh. Friedr. Laves. Erneuerung der Brücke, deren Holzwerk nicht mit Vorsicht ausgewählt und verfault war, schon 1828. Ein Stadtplan von 1730/40 unterscheidet vom alten Kaufhause nördlich des Krans ein neues, südlich davon, das Kaufhaus bei der Lünermühle, das keine Spur hinterlassen hat. Zu vgl. Ilmenaustraße. Kefersteinstraße Kollegienbeschluß vom 13.6.1905. Zur Erinnerung an die verdienstvolle und segensreiche Tätigkeit des allverehrten Oberbürgermeisters Georg Keferstein wurde die damals im Entstehen begriffene Straße nach ihm benannt. Georg Keferstein, in Lüneburg geboren am 1. Januar 1831, wurde daselbst 1859 Stadtsekretär, 1876 besoldeter Senator, 1881 Syndikus, am 18. Februar 1894 Oberbürgermeister (eingeführt am 22. April) und trat mit seinem 70. Geburtstage in den Ruhestand. Er starb in Lüneburg am 28. Mai 1907. Keplerstraße Ratsbeschluß vom 26.3.1959. Der Astronom Johannes Kepler (1571-1630) war zunächst Lehrer an der evangelischen Stadtschule in Graz und wurde nach dem Tode Tycho Brahes kaiserlicher Mathematiker und Hofastronom Rudolfs II. in Prag. Nach dessen Tod trat er in die Dienste der Stände ob der Enns in Linz und zuletzt (1628) in die Wallensteins in Sagan. In Fortführung der Erkenntnisse von Kopernikus und Newton fand er die Gesetze, denen die Körper des Planetensystems unterworfen sind. Kiebitzweg Ratsbeschluß vom 1.2.1950. Der Kiebitz ist ein mit den Regenpfeifern verwandter Watvogel, der sumpfige Wiesen gemäßigter Zonen in Europa und Asien als Lebensraum schätzt. Kiefernring Ratsbeschluß vom 24.8.1949. Die neuangelegte Straße im Bereich ehemaliger Dünen erinnert an einen Charakterbaum der Heide.
160
Kieselweg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. In der Nähe des Hasenburger Baches soll der Name wohl an durch Wasser abgerundete kleine Steine erinnern. Klaus-Groth-Straße Ratsbeschluß vom 10.11.1954. Nach dem niederdeutschen Dichter Klaus Groth (1819-1899) benannt. Kleine Bäckerstraße s. Große Bäckerstraße Kleverstücke Ratsbeschluß vom 27.8.1981. Der Straßennamen nimmt eine alte Flurbezeichnung der Gemarkung Ochtmissen im Bereich des Lerchenberges wieder auf. Klopstockstraße Ratsbeschluß vom 27.1.1954. Der Name erinnert an den Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), dessen Messias ein Hauptwerk der Empfindsamkeit war und den Sturm und Drang vorbereitete. Klostergang Kein Ratsbeschluß. Seit 1860. Vorher Kloster Mauer 1819; gegen St. Michaelis Klostermauer 1850. Der Name erklärt sich aus der letztangeführten Lesart von selber: es ist das Benediktinerkloster, das hier allein gemeint sein kann. Auf den Plänen von 1765 und 1802 ist der Klostergang zum Iflock gezogen. Das ehemals Westphal’sche, dann Heyn’sche Wohnhaus am Klostergange wurde zum Krankenhaus umgebaut und bezogen im April 1869. Klosterkamp Ratsbeschluß vom 21.8.1969. Die Straßenbenennung greift eine alte Flurbezeichnung auf, die an Besitz des Klosters St. Michaelis in dieser Gegend erinnert. Kloster Lüne Ratsbeschluß vom 23.8.1950. Das im Jahre 1172 gegründete Benediktinerinnen-Kloster Lüne wurde 1711 in ein adeliges Damenstift umgewandelt und 1943 mit dem Ortsteil Lüne in den Stadtkreis Lüneburg einbezogen. 1950 traten an die Stelle der bisherigen Bezeichnung Am Kloster Lüne die Straßen- bzw. Wohnplatzbenennungen Am Domänenhof, Lüner Kirchweg sowie Kloster Lüne. 161
Klosterweg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Vermutlich wegen der nicht allzu weit entfernten Straße Im Häcklinger Dorfe wurde die Straße Im Dorfe in Rettmer in Klosterweg umbenannt. Kluskamp Ratsbeschluß vom 26.4.1950. Der Straßenname erinnert an eine überlieferte Flurbezeichnung, wobei Klus Spalte oder Engpaß bedeutet. Knotterkamp Ratsbeschluß vom 29.8.1996. Die Straße in Rettmer erinnert an einen alten Flurnamen, der auf die Samenkapseln von Flachs hinweisen könnte. Königsberger Straße Kein Ratsbeschluß. Von 1938 bis 1951 hieß diese Straße Kreuzkamp nach einem alten Flurnamen des dortigen Zeltberggeländes. Sie wurde nach der ehemaligen Hauptstadt der Provinz Ostpreußen umbenannt. Heute Kaliningrad, Hauptstadt des gleichnamigen Oblast in Rußland. Köppelweg Kein Ratsbeschluß. Seit Mai 1924 in Erinnerung an den ehemaligen Galgen- oder Köpkenberg. Zu vgl. oben S. 35 und S. 41 f. Kösliner Straße Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Die Straße in Ebensberg erinnert an die ehemalige Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirkes in Pommern, die seit 1950 Hauptstadt der Wojwodschaft Koszalin in Polen ist. Köthener Straße Ratsbeschluß vom 29.8.1991. Nach der Wiedervereinigung 1990 ging Lüneburg eine Partnerschaft mit der Kreisstadt in Sachsen-Anhalt ein. Kolberger Straße Ratsbeschluß vom 28.11.1963. Benannt nach der Kreisstadt an der Ostsee. Seit 1950 gehört die pommersche Stadt (Kołobrzeg) zur Wojwodschaft Koszalin/Polen. 162
Koltmannstraße Kein Ratsbeschluß. Das Brauhaus an der Westecke der Lünerstraße befand sich durch Generationen (1526-1665) im Besitz der Familie Koltmann. Bis um die Mitte des Sechzehnhunderts hieß die Straße die Tittersche strate. Auch dieser Name weist auf eine Anwohnerin zurück, vermutlich Alheyd Tittersche, die im Jahre 1317 Bürgerin wurde. Platea dicta Tytterschen 1380; Joh. van der Molen verkauft 1386 Joh. Westphalen ein Haus in angulo platee dicte Tittersche strate; gegenüber in angulo pl. vulgariter dicte der Tytterschen strate wohnte Eberhard von Brekwinkele 1387; in der Tutersche strate 1414; in der Titterstrate 1451; in der Detterdestraten 1453; in der Tittentastersschenstraten 1455; de Titbersche strate 1458 (neues Gebäude des Fabrikanten Brauer 1872); (in Lübeck und Wismar die tittentasterstrate); der Rm. Töbingk kaufte 1489 von Hans Vischker das Eckhaus Rosenstraße 11 in acie pl. de Titersche strate vulg. nuncupate prope domum bedilli; in der Tyttentasterstraten by sunte Nicolawesze 1490; 1515 verkaufte Konrad v. Dassel dem Peter Kopken ein Eckhaus zwischen seinem anderen Hause und dem Eckhause des Gottschalk Konow intermediante pl. vulg. de Tittersche strate; in der Ditter Straßen 1607; pl. der titer (Titerorum) 1629; pl. Coltmanniana seu (sive ut vocant) Titerana 1656; prope domum Koltmannianum 1658; das Brauhaus des Pastors zu St. Nic. Hieronymus Coltmann lag e regione iam dictae aedis Nicolaitanae 1661; eine Kette an Claus Timmermanns (vormals Koltmanns) Brauhause an der Ecke der Koltmanns Straßen schloß sich an Johan Schwertfegers Eckhaus 1666; pl. Koltmanniana 1674 und 1680; Goldmannsstraße Plan von 1765; Koltmannstraße 1802. Der Name Koltemann tritt unter den Bürgerfamilien der Stadt 1525 auf (Hinrick, † 1549 als Kirchgeschworener von St. Nikolai); Hans K. war von 1610-1615 Mitglied des Rates, Jeronimus um 1630 wiederholt Brauerältermann; dem geistlichen Ministerium gehörten drei Generationen der Familie an, der schon oben erwähnte Hieronymus K. (1654 ff.), dessen Sohn Friedrich Georg (1680 ff.) und der Enkel Johann Georg (1721 ff.), letzterer im Besitze einer hervorragenden Bibliothek. Konrad-Adenauer-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Der Straßenname würdigt den ersten deutschen Bundeskanzler (1949-1963) Konrad Adenauer (1876-1967). Er war 1917-1933 Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Köln, 1917/18 Mitglied des preußischen Herrenhauses und 1930-32 Präsident des preußischen Staatsrates. Früher Mitglied der Zentrumspartei wurde er 1945 Mitbegründer der CDU und 1946 ihr Vorsitzender zunächst in der britischen Zone, seit 1949 der Gesamtpartei. Kurzfristig war er 1945 noch einmal OB von Köln, bevor er als Präsident des Parlamentarischen Rates maßgeblich an der Gründung der Bundesrepublik Deutschland mitwirkte, zu deren erstem Regierungschef er schließlich gewählt wurde. Konrad-Zuse-Allee Ratsbeschluß vom 28.1.1999. Konrad Zuse (1910-1955) war der Konstrukteur der ersten programmgesteuerten Rechenmaschine, die zur Basis für elektronische Computer wurde.
163
Kopernikusstraße Ratsbeschluß vom 26.3.1959. Nach dem Thorner Astronomen Nikolaus Kopernikus (1473-1543), dem Begründer des heliozentrischen Weltbildes benannt. Korb Kein Ratsbeschluß. Straßenbezeichnung seit 1941, in Erinnerung an die zum Hl. Geist-Hospitale gehörige, einstige Schäferei Zum Korbe. Diese wird schon 1397 erwähnt: buten dem sultedore achter dem korve by dem lehmkampe; 1431 wurde ein Steinweg angelegt by dem korve vor dem sultedore; Hammerstein berichtet, daß Bürgermeister Heinrich Töbing ein Jahr vor seinem Tode [† 1586] de scheperie vorm sultedor im Korve geheten baulich erneuern ließ; er war Provisor vom Gr. Hl. Geist. Die Gebäude der Schäferei lagen im Winkel der Landstraßen nach Hannover und Soltau. Holzlager und Verkauf bi dem Korve 1432. Korbmacherstraße Ratssitzung vom 10.12.2001. In einem Neubaugebiet in Oedeme sollten alte Handwerke als Namengeber für Straßenbezeichnungen herangezogen werden. Korbmacher produzierten jahrhundertelang vielfältige Transport- und Aufbewahrungsbehälter. Kossenweg Kein Ratsbeschluß. Zur Vermeidung von Verwechslungen mit dem Lüneburger Straßennamen Zeltberg wurde der Ochtmisser Straßenname Vor dem Zeltberg 1974 bei der Eingemeindung des Ortes nach Lüneburg umbenannt. Krähornsberg Ratsbeschluß vom 12.12.1985. Der Straßenname greift eine überlieferte Flurbezeichnung in Ochtmissen auf. Kramerstrate Sie wird in den Quellen nur ein einziges Mal erwähnt, und zwar 1513, als Cord Usseler ein von Joachim Schulte bewohntes Haus in der Kramerstrate zu eigen besitzt. Die Belegenheit ist unbekannt, nur das Sandviertel scheint in Frage zu kommen. Krötenkamp Ratsbeschluß vom 29.8.1996. Mit dem Namen soll der ländliche Charakter von Rettmer hervorgehoben werden. Kronskamp 164
Architekt Dr. h.c. Franz Krüger (1873-1936)
Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Ein alter Flurname ist als Basis der Straßenbezeichnung gewählt worden. Krügerstraße Ratsbeschluß vom 16.6.1960. Nach dem Lüneburger Architekten Franz Krüger (1873-1936) benannt, auf dessen Entwürfe die Heil- und Pflegeanstalt (jetzt Niedersächsisches Landeskrankenhaus), der neue Wasserturm und andere öffentliche sowie zahlreiche private Gebäude in Lüneburg zurückgehen. Kuckucksweg Ratsbeschluß vom 28.6.1973. Die Straße liegt im Wilschenbrucher „Vogelquartier“. Der Zugvogel ist ein Brutparasit und gilt als Frühlings-, aber auch als Unheilkünder. Kuhstraße Kein Ratsbeschluß. Als platea vaccarum zuerst belegt 1615; kuhstraß 1652; platea vulgo die Kuhstraße 1678; Plan von 1765 kohestraße; 1794 kohstrate; Schoßrolle 1819 Kuhstraße. Ältere Umschreibung cum itur a macellis ad plateam dictam der gropengetere ad dextram manum in eiusdem platee introitu 1382. Wie in Danzig liegt die Kuhstraße in unmittelbarer Nähe der Fleischschrangen; wie es dort durch W. Stephan geschehen ist, wird also auch hier der Name auf Stallungen zurückzuführen sein, die sich in der Straße befunden haben. In Braunschweig kostrate 1390, in Danzig Kuhgasse, in Rostock Kuhstraße. Kulmbacher Straße Ratsbeschluß vom 12.12.1985. Der Straßenname würdigt die freundschaftlichen Beziehungen Lüneburgs zu der Bierstadt in Oberfranken. Kunkelberg Kein Ratsbeschluß. Der Gemeinderat von Oedeme griff bei der Namensgebung am 14.11.1967 auf einen Flurnamen zurück, der nach der Eingemeindung nach Lüneburg übernommen wurde. Kurt-Höbold-Straße Ratsbeschluß vom 26.4.1973. Der langjährige Salinendirektor Dr. Kurt Höbold (1886-1963) wurde mit dem Straßennamen vor allem für seine Tätigkeit als Präsident des Nord-Süd-Kanalvereins geehrt.
166
Kurt-Huber-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Der Philosoph und Musikwissenschaftler (1893-1943) lehrte in München und Berlin. Seine Verbindung zur Weißen Rose führten zur Verurteilung durch den Volksgerichtshof und Hinrichtung in München-Stadelheim. Kurt-Schumacher-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Dr. rer. pol. Kurt Schumacher (1895-1952) trat 1918 der SPD bei und gehörte 1924 zu den Mitbegründern des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Im gleichen Jahr wurde er in den württembergischen Landtag gewählt und 1930 in den Reichstag. 1933-1943 war er in KZs inhaftiert und erneut August/September 1944 in Neuengamme. Ab Frühjahr 1945 bereitete er in Hannover die Wiedergründung der SPD vor, wurde im Mai 1946 zu ihrem Vorsitzenden gewählt und war seit 1949 einflußreiches Mitglied des Bundestages. Kurze Straße Kollegienbeschluß vom 4.11.1902. Die Verbindung vom Hohengarten (der jetzigen Lauensteinstraße) bis zur Hindenburg Straße erklärt durch ihr Ausmaß den Namen selbst. Laffertstraße Ratsbeschluß vom 25.7.1951. Benannt nach einem alten, seit 1536 in Lüneburg nachweisbaren Patriziergechlecht, das mehrere Bürgermeister stellte. Lambertiplatz s. Bei der St. Lambertikirche. Landrat-Albrecht-Straße Ratsbeschluß vom 11.9.1964. Benannt nach Wilhelm Albrecht (1875-1945), Landrat des Landkreises Lüneburg von 1917 bis 1945. Landwehrweg Kein Ratsbeschluß. Im Zuge der Eingemeindung wurde die Straße „An der Buntenburg“ in Ochtmissen aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses vom 26.2.1974 umbenannt. Die Namen beziehen sich auf die sogenannte Akte Landwehr bzw. auf ein Bauwerk nördlich der Papenburg im Inneren des Landwehrringes. Lange Berge Flurname, als Bezeichnung für den Weg nach Wendisch-Evern seit 4.4.1944.
167
Langenstraße Ratsbeschluß vom 25.7.1951. Die Lange waren eines der bedeutendsten Patriziergeschlechter des mittelalterlichen Lüneburg. Bekannt ist vor allem der 1446 zum Bürgermeister gewählte Hinrik Lange (Hauptfigur des Romans Auf der alten Salzstraße von Magdalene Stange), der im wesentlichen die Stadt aus den Schwierigkeiten des Prälatenkrieges wieder herausgeführt hatte. Hinriks Sohn, Cord Lange, ist einer der vier Bürgermeister vom Jahre 1491, die in den Glasmalereien der Körkammerfenster des Rathauses dargestellt sind. Die genannte Familie Lange war 1360 aus Helmstedt zugezogen. Daneben gab es noch eine andere Ratsfamilie des gleichen Namens, die schon 1225 in Lüneburg nachweisbar ist. Beide Familien, die jüngere wie die ältere, erloschen bereits im 16. Jahrhundert bzw. sind von der Zeit an von den zahlreichen bürgerlichen Trägern dieses Namens nicht mehr zu trennen. Langenstücken Ratsbeschluß vom 29.8.1995. Der Straßenname basiert auf einer Flurbezeichnung in Häcklingen. Langer Jammer Kein Ratsbeschluß. s. G a r t e n s t r a ß e. Lauensteinstraße Kollegienbeschluß vom 13.6.1905. In Erinnerung an die großen Verdienste des Oberbürgermeister Otto Lauenstein beschlossen die städtischen Kollegien der Straße Hohengarten mit dem Jahre 1906 den Namen Lauenstein Straße beizulegen. Der Hohegarten gehörte zum Michaeliskloster, St. Michaelis hohe garten 1727. In den Adreßbüchern schwanken die Bezeichnungen auf dem Hohengarten (bis 1890), am Hohengarten (bis 1894), beim Hohengarten (1895), Hohengarten. – Otto Lauenstein, geb. am 17. Januar 1829 als Sohn eines Pastors in Aerzen bei Hameln, ließ sich 1853 in Lüneburg als Advokat nieder und wurde 1863 Obergerichtsanwalt. Seit 1858 Bürgervorsteher, 1863 Worthalter, wurde er 1865 zum Stadtsyndikus, 1881 zum Oberbürgermeister ernannt und bekleidete dieses Amt bis zum 1. April 1894. L. war 1865 und 1866 Mitglied der 2. Kammer der hannoverschen Ständeversammlung, später eine Reihe von Jahren Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Er starb am 24. Februar 1902. Leipziger Straße Ratsbeschluß vom 25.8.1963. Benannt nach der Universitäts- und Messestadt, wo J. S. Bach als Thomaskantor wirkte und die Deutsche Bücherei sämtliche in Deutschland publizierten Druckwerke sammelte. Die Stadt war der bedeutendste Industriestandort Sachsens und einer der wichtigsten Deutschlands. 168
Lenaustraße Ratsbeschluß vom 18.5.1955. Nach dem ungarischen Dichter Nikolaus Lenau (1802 bis 1850) benannt. Der „deutsche Byron“ war bei den schwäbischen Romantikern um Justinus Kerner hochgeschätzt und gehört zu den meistvertonten deutschen Lyrikern. Lerchenweg Kein Ratsbeschluß. Seit 1935, nach dem in der Nachbarschaft befindlichen Lerchenberg benannt. Lessingstraße Kein Ratsbeschluß. Der 1938 als Kurhausallee angelegte Straßenzug wurde 1951 in seinem östlichen Teil (Hs. 2 u. 4) nach dem Kritiker, Dichter und Philosophen der deutschen Aufklärung, Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), benannt, der von 1770 bis 1781 als Bibliothekar in Wolfenbüttel wirkte. Liegnitzer Straße Ratsbeschluß vom 24.1.1951. Benannt nach der ehemaligen Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirks und des Landkreises in Niederschlesien. Seit 1945 gehört Legnica zur Wojwodschaft Wrocław. Lilienthalstraße Ratsbeschluß vom 30.5.1980. Die Straße im Gebiet des ehemaligen Flugplatzes wurde nach Otto Lilienthal (18481896), dem ersten deutschen Flieger (1891) und Vorgänger der Gebrüder Wright benannt. Lindenstraße Kein Ratsbeschluß. Bis 1880 hieß die gegen Mitte der 70er Jahre vorigen Jahrhunderts bebaute Straße Im Rotenfelde. An ihrer Nordseite, gegenüber der Volgerstraße, lagen bis etwa 1909 die Reeperbuden mit der sich nördlich anschließenden Reeperbahn. Vom 8.4.1933 bis 20.6.1945 Adolf-Hitler-Straße. Lise-Meitner-Straße Ratsbeschluß vom 28.1.1999. Lise Meitner (1878-1968) war Physikerin und arbeitete auf dem Gebiet der Kernphysik und Radiochemie u. a. zusammen mit Otto Hahn am Kaiser-WilhelmInstitut in Berlin. 1938 emigrierte sie und war Mitglied der Schwedischen Akademie und Leiterin eines Forschungsinstituts.
169
Lossiusstraße Ratsbeschluß vom 23.8.1950. Lucas Lossius (gestorben 1582) war Lehrer und Konrektor am Lüneburger Johanneum. Bekannt ist sein großes Versepos Lunaeburga Saxoniae. Ludwig-Beck-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Der Namensgeber (1880-1944) der Straße in Kaltenmoor wurde im 1. Weltkrieg Generalstabsoffizier, 1933 Chef des Truppenamtes und 1935 Chef des Generalstabes des Heeres. Von diesem Amt trat er 1938 während der Sudentenkrise zurück und bekämpfte hinfort Hitlers Kriegspläne. Im 2. Weltkrieg war er das Haupt des militärischen Widerstandes und nach dem Sturz Hitlers als Staatspräsident vorgesehen. Nach dem Scheitern des 20.7.1944 nahm sich Ludwig Beck das Leben. Ludwigstraße Kein Ratsbeschluß. Der im Jahre 1855 hergestellte Durchbruch zwischen Hl. Geist- und Ritterstraße verdankt seinen Namen einem Scherz. In der Magistratssitzung, in welcher die Benennung erfolgen sollte, erfuhr man, daß just dem Senator Bornemann ein Sohn geboren sei, und auf Vorschlag des Stadtsyndikus Lauenstein erhielt die Straße den Namen dieses jugendlichen Lüneburgers Ludwig. Dr. Ludwig Bornemann wirkte später als Prorektor des Lehrerseminars in Essen a. d. Ruhr. Lüneburger Straße Kein Ratsbeschluß. Mit der Eingemeindung von Rettmer wurde dieser Straßenname übernommen. Lüner Damm Kein Ratsbeschluß. Erst im Sechzehnhundert nachweisbar. Ad aggerem Lunensem liegen Gärten 1632; in aggere molae Lunensis eine Bude 1634; coram porta Lunensi in acie aggeris 1664. Lünerdamm 1860, bis dahin, soweit eine Bebauung überhaupt stattgefunden hatte, außer dem Lüner Tor 1811, auch schlechthin außer der Stadt 1850. Der Fabrikant Ferd. Heyn erwarb 1862 die Gärten des Böttcheramtes am Lünerdamme und erbaute dort ein Wohnhaus. Der Bürger Rehbehn kaufte 1863 den an der Ecke des Lünerdammes belegenen Garten des Obergerichtsrats Langrehr und legte dort ein Kaffeehaus an mit dem Namen Bellevue. 1868/9 baute der Bürger Rackmann am Lünerdamme ein ansehnliches Haus; daneben 1870 Hoftischler Meinshausen (Nr. 7). Eine Lüner Bleiche westlich des Dammes im Süden der hannoverschen Kavalleriekaserne ging bald nach deren Erbauung ein; das Bleicherhaus gegenüber der Warburg ist stehen geblieben. Lüner Kirchweg Ratsbeschluß vom 23.8.1950.
170
Bezeichnung für den schmalen Weg an der Nordseite der Lüner Klosterkirche, wo sich der Eingang für die Kirchengemeinde befindet. Vgl. auch Kloster Lüne. Lüner Rennbahn Ratsbeschluß vom 24.4.1969. Der 1900 gegründete Lüneburger Rennverein veranstaltete am 12.5.1901 erstmals Flach-, Jagd- und Hürdenrennen auf der eigens angelegten Bahn in der Lüner Heide. Die Lüner Rennbahn ging ebenso wie der Trägerverein nach dem 1. Weltkrieg ein. 1936 erfolgte die Neugründung des Vereins, der nun auch Springturniere auf der Lüner Rennbahn durchführte. Beide Vereine pflegten enge Verbindung zu den Lüneburger Kavalleristen. Das Ende des 2. Weltkrieges bedeutete auch das Ende dieser Lüneburger Renntradition. Lüner Straße Kein Ratsbeschluß. Der Name hat sich erst im Achtzehnhundert durchgesetzt an Stelle der älteren Bezeichnung Vogtstraße. Vogt ist hier nicht die Amtsbezeichnung, sondern wie sich aus den Belegstellen ergibt, der Familienname eines Anwohners, dessen Besitz sich weit in die Rotehahnstraße hinein erstreckt haben wird, wenn nicht, wie es nach der Erwähnung des Hauses Zur goldenen Treppe scheinen könnte, ursprünglich unterschieden wurde zwischen einer Straße des Heyne und des Johan Voged – die erstere würde dann die Rotehahnstraße (Abtspferdetränke?) sein. Prope domum vulgariter dictam Ghüldene treppe versus aquilonem in platea Heynen Vogedes 1412; pl. Joh. Vogedes prope capellam s. Nic. 1420; die Witwe des Heyno Vogedes verkaufte ein Haus iuxta capellam s. Nicolai 1424; de Vogedes strate 1441; pl. advocatorum 1443; vor des provestes molen van Lune (um 1430); pl. praefectorum 1478; in des vagedes strate 1488; Wohnhaus der Geszeke Henninges ame orde twischen des provestes van Lune und der bodekere gildehusze by sunte Nicolawesze 1491; Haus des Bürgers Hinrick Krumstro by des olden Hermen Baremes unde der bodeker ghildehuse in der vogede strate beneffen sunte Nicolawesze 1501; jegen der Lünre husze aver in der Vogede straten 1519; Haus der Cecilie Ryken twischen der boddekere gyldhuse und der Lüner huse up dem orde jegen s. Nicolaesz kerckhave in der Vogedes straten 1535; prope capellam s. Nic. in pl. praefecti 1542; ex opposito cimiterii s. Nic. i. pl. prefecti 1545; Brauhaus Bergmann-Arents non procul ab aede d. Nicolai e regione loci qui dicitur Voigtstraszen 1621. Eine Kette war 1666 am Lüner sog. Rauchhause angebracht und an Hans Meyers Brauhaus (1794 Brauer Schulzen) Ecke in der Voigtstrassen inter xenodochium rubri galli et Petri Wigels aedes braxatorias 1676. Der Plan von 1765 hat schon Lüner Straße, während die Schoßrolle von 1861 noch aufführt (Rote Hahnstr. am Orte der) Voigts- oder Lünerstraße. Zu vgl. Am Berge und Rotehahnstraße. Im Anschluß an die Voged strate, vor dem Namen by der muren, führt die Schoßrolle von 1462 die Bezeichnung in deme vinckensteyne, Name und Belegenheit sind noch dunkel; von 1372-1404 geht ein Haus mit Grundstück und Hof que dicuntur vinkensteen viermal in die Hände eines neuen Käufers über, auffallenderweise ist der Verkäufer dreimal derselbe, der Ratmann Johann Grabow; 1419 wird de vinckensteyn belastet und hier hinzugefügt prope aquam.
171
Lünertorstraße Nr. 4
Lünertorstraße Kollegienbeschluß v. 3.7.1896. Die ganze Straßenstrecke von der Kaufhausbrücke bis zum Lüner- bzw. Altenbrückerdamm erhielt den Namen Lünertorstraße. Das Lünertor hieß ursprünglich Neubrücker- im Gegensatz zum Altenbrückertor, auch wohl Wassertor, entsprechend der Straßenbezeichnung am Wasser. So heißt das Kaufhaus im Jahre 1302 domus allecium extra novum pontem; ein slachdor ad novum pontem wird errichtet 1328; die Häuser jenseits der Ilmenau am Stadtkran et apud valvam novi pontis sollten nach einer Ratsverfügung von 1346 nicht als Salz- oder Häringspeicher verwandt werden dürfen; prope (iuxta, apud, ante) valvam novi pontis 1360 ff.; Verpfändung eines zur Aufbewahrung von Salzscheffeln benutzten Ratsturms beim Tore der Neuen Brücke 1376; prope novum pontem 1385; prope domum mercimoniorum versus portam aquarum 1389; in angulo prope valvam novi pontis 1390; buten deme nyenbrugger dore to Lüne wart dar de porte up gheyt neghest deme garden 1392; Eckhaus Hildensem-Blome prope valvam novi pontis ... versus aquilonem 1397; die Stadtmauer vor der nygen brügge wird erhöht und ausgebessert 1411; prope valvam Lunensem cum civitas exitur versus dextram 1413; Eckhaus des Salzmessers Düsterhop beim Eckhause Vicken versus valvam Lunensem 1423; neven der nygen brugghe by dem water 1440; ante valvam qua itur ad monasterium Lune 1444. Auf dem Lünertor wohnte nach 1700 der Torwärter, im Tore selbst der Zollaufseher, über dem Tor ein Constabel. Nach einem Einsturz erstand die Lüner Brücke 1467/77 in einem Neubau, zu welchem fünfhundert Ellen Haustein verwandt wurden – vorbuwet an der Lüneren brugge, de vel in des midwekens Jubilate by dem kophuse 1467. In der Nähe der Lünerbrücke stand eine Bank, die den charakteristischen Namen Lügenbank trug; vorbuwet an der brugghe vor dem Lunren dore ... und an der loghenbank by der brugghe 1445; eine Bude jegen der logenbancke over 1477; Hans Arndes kaufte zwei gardenbleke vor dem Lünertore twischen dem stenwege und dem Lunerkampe tor stad ward zwischen dem Garten Unser lieben Frau und dem Böttchergarten 1468; das Franziskanerkloster verkaufte unter Vorbehalt eines Wurtzinses eyn gardenblek . buten deme Lunerendore by deme slachbome in der halve to Lune wert 1481; dem Brauer Hans Meiger wurde erlaubt, einen watergank in sein Haus zu legen in dat Lunere dhare 1485. Vor deme Luneren dhare 1502; Garten, belegen twisschen der heren vam Hilligendale gharden unde der ghemeynen schiplude ghange uppe de buwstede vor deme Luneren dhare vor Luneborgh 1503; zwei halbe Gartenstücke buthen dem Lunerdore twiscken Unser leven fruwen und der bodeker ghardenbleken ... in der twyten an der forderen syde oder vor dem Luneren dhore an dem nyegen stadtgraven buten L. 1531; prope muros ante valvam Lunarem retro domum mercimonialem 1543; inter domum mercimonialem et ... domum in pl. qua itur recta via ad valvam Lunarem; ante portam q u a e a l u n a n o m e n h a b e t 1629. Die Übersetzung des Namens Lünertor mit valva Lunaris im Jahre 1543 ist der älteste urkundliche Beleg dafür, daß man den Namen der Stadt von der Mondgöttin Luna ableitete. Ein Garten wird 1659 bezeichnet non procul a porta Lunensi ita situm est ut fossa civitatem cingens ab una, (hortus) ab altera parte eum tangat. Der Rat erwarb vom Michaeliskloster einen Garten allernächst vorm Lünertore am Stadtgraben und Steinwege 1662. Im Jahre 1680 wurde auf dem Berge vor dem Lünertore seitens der Kämmerei eine Hude angelegt, vornehmlich für sog. Bauerholz. Eine Hude vor dem Rotentore an der Ilmenau für Medinger und Seedorfer Holz war schon 1580 eingegangen. 173
Erhebliche Ausgaben verursachte im Vierzehnhundert die Anlage und Unterhaltung von Ilmenauschleusen; de sluse in dem graven vor dem Luneren dore 1413 und 1447; de slüse also men to Lune geit 1423; de sluse buten dem Luneren dore in dem graven de na Lune lopt 1472, d. h. in dem Lösegraben, auch der große Lösegraben genannt zum Unterschied vom Kleinen Lösegraben oder Lüner Mühlenkanal, der den Werder mit dem Kaufhause umfloß. Nicht mit Genauigkeit belegt ist eine F r a n z o s e n b r ü c k e , die z. Z. der französischen Invasion 1757 am Lünertor geschlagen war zum Herüberreiten der Pferde nach dem großen Stall; ihr Abbruch wurde erwogen 1768. Der Plan von 1765 bezeichnet die Gasse östlich des Grundstücks Lünertorstraße 18 achter Lünerthor; Plan von 1794 vor dem bzw. achtern Lünerthore; 1802 Lüner Thor mit Bezeichnung der Torwache und des gegenüberliegenden Torschreiberhauses; 1850 Am Lünertor. Die Adreßbücher von 1860-1866 unterscheiden am Lünertore (nördlich und südlich) und Lünertorstraße (nördlich und südlich) mit Unterbezeichnung am Schifferwalle und am Walle 1862/3. Lüner Weg Kein Ratsbeschluß. In via qua itur Lune 1282; 24½ Gärten extra novum pontem cum itur Lune ad manum sinistram zahlen eine Abgabe an die Kämmerei 1302. Von 1910 bis 1944 (4. April) hieß der zum Lüneburger Stadtbezirk gehörende Teil des Lünerweges Lübecker Straße (Lübecker Heerstraße bei Gebhardi 1795). Lupmerfeld Ratsbeschluß vom 12.12.1985. Auf Vorschlag des Ortsrates Ochtmissen wurde bei der Straßenbenennung auf den historischen Flurnamen zurückgegriffen. Z. vgl. Vickenteich. Magdeburger Straße Ratsbeschluß vom 25.11.1966. Benannt nach der heutigen Hauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt. Ihre Geschichte beginnt als Sitz eines fränkischen Grafen 805. Unter den Ottonen entfaltete sich die Stadt und wurde Sitz eines Erzbistums. Sie gehörte zur Hanse und ihr Stadtrecht verbreitete sich weit in den Osten Europas. Außerdem war Magdeburg bis 1912 Festung. Im 2. Weltkrieg schwer zerstört und seit 1952 Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks, gelangte die Stadt nach der Wiedervereinigung in die jetzige Position. Maneckeweg Ratsbeschluß vom 25.3.1953. Urban Friedrich Christoph Manecke (1745-1827) war in Lüneburg höherer Beamter der landesherrlichen Zollverwaltung. Er wurde bekannt als Sammler und Historiker.
174
Marcus-Heinemann-Straße Kein Ratsbeschluß. Früher Schlageter Straße (seit 1933), am 20.6.1945 umbenannt in MarcusHeinemann-Straße. Bankier Heinemann (1819-1908) war Vorsteher der Lüneburger Synagogengemeinde und wesentlicher Finanzier des Synagogenbaus, Mitbegründer und Förderer der Gemeinnützigen Baugesellschaft sowie des neuen Bürgervereins. Marderweg Ratsbeschluß vom 12.3.1945. Die Straße liegt in einem Quartier mit Benennungen nach heimischen Tierarten. Als Vertreter der Familie Marder finden sich in der Lüneburger Heide Dachs, Iltis, Otter, Baum- und Steinmarder. Margeritenweg Kein Ratsbeschluß. Nach der Eingemeindung Rettmers nach Lüneburg 1974 wurde die Straße Am Berge umbenannt, da ein solcher Name in Lüneburg schon vorhanden war. Die Bezugnahme auf eine Wiesenblume sollte den ländlichen Charakter des neuen Stadtteils hervorheben. Maria-Terwiel-Straße Ratsbeschluß vom 28.1.1993. Als überzeugte Katholikin und „Halbjüdin“ hatte Maria Terwiel (1910-1943) keine Chance, ihr Jurastudium mit dem Referendarexamen zu beenden. Durch ihren Verlobten kam sie mit der „Roten Kapelle“ in Verbindung, die 1942/43 von der Gestapo enttarnt wurde. Maria Terwiel und ihr Verlobter wurden zum Tode verurteilt und am 5.8.1943 hingerichtet. Marie-Curie-Straße Ratsbeschluß vom 28.1.1999. Die Chemikerin und Physikerin entdeckte 1898 die radioaktiven Elemente Radium und Polonium und erhielt 1903 zusammen mit ihrem Lehrer Becquerel und ihrem Ehemann Pierre Curie den Nobelpreis für Physik. Den Nobelreis für Chemie erhielt sie 1911 für die Reindarstellung des Radiums. Marienburger Straße Ratsbeschluß vom 14.2.1951. Benannt nach der Hauptstadt des Regierungsbezirkes Marienwerder, der Stadt Marienburg i. Westpreußen, an der Nogat gelegen. Bekannt wurde der Ort vor allem wegen des Deutschordensschlosses, das seit 1309 Sitz des Hochmeisters war (bis 1459). 1466 bis 1722 war die Marienburg in polnischem Besitz. Im 2. Weltkrieg stark zerstört, wurde das Schloß von der polnischen Denkmalpflege weitgehend wiederhergestellt. Seit 1945 Malbork, Wojwodschaft Gdánsk. Max-Jenne-Straße 175
Ratsbeschluß vom 31.8.1995. Der Namengeber (1848-1921) erhielt 1879 für seine Sonnen-Apotheke in Lübeck die Großhandelserlaubnis. Diese Arzneimittelgroßhandlung ist schon seit 1924 in Lüneburg vertreten, seit 1927 mit einem Auslieferungslager, das seither kontinuierlich ausgebaut und 1951 als Niederlassung eingetragen wurde. Medebekskamp Kein Ratsbeschluß. Alte Flurbezeichnung, Straßenname seit 1938. Mede als Weide, Heuland zu deuten? Mehlbachstrift Kein Ratsbeschluß. Seit Ende 1924. Alter Flurname, wohl auf einen Personennamen zurückzuführen. Meinekenhop Kein Ratsbeschluß. Einst ein Wäldchen zwischen dem Schildstein und der Straße Auf der Höhe, erwähnt als Meynwerdes hop schon 1360; zu vgl. unten Schnellenberger Weg. Der Straßenname seit Ende 1924. Meisterweg Kein Ratsbeschluß. Übernommen aus dem 1943 eingemeindeten Ortsteil Lüne. Vor dem Bau der Schlieffenkaserne verband er die Erbstorfer- mit der Bleckeder Landstraße. Melkberg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Grundlage des Straßennamens ist eine überlieferte Flurbezeichnung. Mit dem genannten Datum wurde der Straßenname in Ochtmissen offiziell übernommen. Memeler Straße Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Mit der Eingemeindung von Ebensberg wurde die Danziger Straße durch die Memeler Straße ersetzt, da es den ersten Straßennamen in Lüneburg bereits gab. Die offizielle Bewidmung erfolgte 1981. Grundlage des Namens ist die Hauptstadt des ehemaligen Memelgebietes in Ostpreußen (1924-1939), die 1253 vom livländischen Schwertbrüderorden und Bischof Heinrich von Kurland gegründet wurde. Nach dem 2. Weltkrieg gehörte die Stadt zur Litauischen Sowjetrepublik, seit 1990 zur Litauischen Republik (Klaipeda). Memeler Weg Ratsbeschluß vom 25.8.1954.
176
Es handelte sich um einen unbebauten Verbindungsweg zwischen Auf dem Schmaarkamp und Carl-Peters-Straße. Der Name wurde nach 1967 aufgegeben. Milchbergweg Kein Ratsbeschluß. Mit der Eingemeindung von Ebensberg 1974 wurde der Straßenname übernommen . Er beruht auf einem Flurnamen. Mittelfeld Ratsbeschluß vom 30.5.1991. Der seit 1924 bestehende Straßenname wurde 1959 durch den Namen ErnstBraune-Straße ersetzt. Am Rande der Gartenkolonie gleichen Namens wurde zum o. g. Datum der Straßenname erneut vergeben. Er basiert auf einer alten Flurbezeichnung. Mittelweg Kein Ratsbeschluß. Der Name wurde 1974 mit der Eingemeindung Häcklingens übernommen und beschreibt den Tatbestand, daß die Straße den Hasenburger Ring durchschneidet. Mörekesiedlung Kein Ratsbeschluß. Benannt nach dem Erbauer des Lüneburger Flugplatzes 1936/1937, auf dessen Initiative die an der Erbstorfer Landstraße belegene Siedlung entstand. 1943 mit dem Ortsteil Lüne in den Stadtkreis Lüneburg einbezogen. Moldenweg Ratsbeschluß vom 25.8.1960. Der Name basiert auf einer Flurbezeichnung. Moorweg Kein Ratsbeschluß. Übernommen mit dem 1943 eingemeindeten Ortsteil Lüne. Moorweide Kein Ratsbeschluß. Seit März 1939 unter Aufnahme einer alten Flurbezeichnung. Mühlenkamp Ratsbeschluß vom 24.8.1949. Benannt nach einer alten Flurbezeichnung.
177
Münzstraße Kein Ratsbeschluß. Der Name ist wohl so zu erklären, daß der städtische Münzer einmal sein Wohnhaus dort gehabt hat; der einzige urkundliche Anhaltspunkt dafür ist von 1383, domus monetarii in Luneborgh in platea pistorum in qua quondam Swarte Beneke inhabitabat - gemeint ist doch wohl eines der beiden Eckhäuser am Eingange der Münzstraße. Die Lesart Münzerstraße ist jünger. In der muntestrate nach Osten hin 1410; der Rm. Töbing kauft 1424 ein Haus in platea de müntestrate vulgariter dicta in latere australi circa medium eiusdem platee; dsgl. Bgm. Johann Springintgud vom Bgm. Schellepeper ein Haus cum stuba sitis in platea vulgariter dicta de muntstrate et cum omnibus casis sive domunculis eiusdem platee in eadem linea versus mon. Hilgendal descendendo usque ad valvam curie dicte domus in platea pistorum (zwischen Kersten und Herseveld) 1445; zwei Jahre später kaufte er das Eckhaus Kerstens hinzu; die Kämmerer lassen bauen an dem zode in der munterstrate 1480; platea monetariorum 1513; Bgm. Ludolf von Dassel kaufte von den Erben des Rm.s Tzerstede das südliche Eckhaus an der Bäckerstraße una cum thermis, stufa seu balneo et casis adiacentibus omnibus in angulo platee que monetariorum appellatur 1516, es ist das frühere Besitztum Johann Springintguds, das Bgm. von Dassel in schönerer Gestalt neu aufbaute; platea monetaria 1635; in platea monetali 1657; in pl. monetaria ... balnearium publicum 1677. Der Münzstaven (Nr. 3 und 4) ging 1715 aus dem Besitz der Kämmerei, die ihn 1632 erworben hatte, in Privathände über. Weinhändler Frederich baute ein großes Weinlager in der Münzstraße, nachdem er sämtliche Häuser der Nordseite angekauft und abgebrochen hatte, 1859. Durch Ankauf der beiden Eckhäuser an der Bäcker- und Finkstraße wurde Frederich Besitzer der ganzen Nordseite der Münzstraße; 1865 erbaute er ein großartiges Lagerhaus; 1871 ließ er das nördliche Eckhaus an der Münzstraße abbrechen und vergrößerte sein Wohnhaus durch einen eleganten Anbau. Müntzstraße 1765; das Adreßbuch von 1860 unterscheidet von der Finkstraße bis zur Bäckerstraße und von der Bäckerstraße bis zum Berge r. In Hamburg-St. Georg Münzplatz, Münzstraße und Münzweg. Munstermannskamp Kein Ratsbeschluß. Mit dem Berliner Erholungsheim. Der Straßenname, auf Grund einer alten Flurbezeichnung eingeführt 1928. Ein Ludolf Munstermann wurde Bürger 1424, im Siebzehnhundert waren mehrere Träger des Namens Brauer und Herbergierer. Nachtigallenweg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Der Straßenname wurde bei der Eingemeindung Ochtmissens übernommen und zum genannten Zeitpunkt bestätigt. Naruto-Platz Ratsbeschluß vom 12.12.1985. Der Name wurde gewählt, um die langjährige Partnerschaft mit der japanischen Stadt auf der Insel Shikoku zu würdigen.
178
Naruto-Straße Ratsbeschluß vom 12.12.1985. s. Naruto-Platz. Nelly-Sachs-Straße Ratsbeschluß vom 20.08.1995. Nelly Sachs (1891-1970) schilderte in ihrer reimlosen Lyrik auf der Grundlage der jüdischen und christlichen Mystik und erschüttert vom Untergang des europäischen Judentums die Unbehaustheit des Menschen. Mit der Hilfe Selma Lagerlöfs floh sie 1940 nach Schweden. 1961 wurde sie Patin und erste Trägerin des nach ihr benannten Kulturpreises der Stadt Dortmund und erhielt 1965 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Ihr Werk, zu dem auch Übersetzungen schwedischer Lyrik gehören, wurde 1966 mit dem Nobelpreis gewürdigt. Neue Straße Kein Ratsbeschluß. Unter den Begriff Neue Straße fallen in den Belegstellen die Alte neue Straße (Obere und Untere O h l i n g e r s t r a ß e ; zu vgl.), die Verbindungsgasse zwischen Altstadt und Meer und eine mit Bestimmtheit nicht festzulegende Gasse in der Nähe der Saline. Die zweiterwähnte jetzt sogenannte Neue Straße ist 1375 entstanden. Sie enthielt das der Stadt gehörige Frauenhaus (de vrowenbude sind vrig dem rade 1410), dessen Bewohnerinnen eine jährliche Abgabe an die Bauherren zu entrichten hatten. Dieses Gebäude, zusammengesetzt aus neun Häuschen mit je zwei übereinanderliegenden Einzimmerwohnungen, je einer Diele und spitzbogigem Portal ist im Jahre 1910 abgebrochen, bedauerlicherweise, denn es stellte einen nur selten noch erhaltenen, zusammenhängenden gotischen Straßenzug dar (Jhrb. des Museumsvereins 1896/8). Die ursprüngliche Bezeichnung der unkeuschen Belegenheit war Wonnekenbruk. Brok ist hier trotz einer unserer Belegstellen schwerlich als Neutrum, im Sinne von Bruch, sumpfigem Gehölz, zu verstehen, es ist vielmehr an brok, Masculinum, zu denken, an die Geldbuße, die der Obrigkeit gezahlt werden mußte; Wunneke, im Stammwort auf wunna, Wonne zurückgeführt, begegnet in Lüneburg als weiblicher Personenname (1323 und 88), aber fast scheint es, als ob der Wortklang dazu herausgefordert habe, ihn in allgemeinerem Sinne auf suverlike vrouwen anzuwenden. Ein wunnekenbrok bei Oldesloe wird 1482 erwähnt. Im Jahre 1409 zahlte das Bauamt 15 M vor enen hoff in dem Wonnekenbruke und 11 M 7 s. vor enen brettun dor dat Wunnekenbruk unde arbeydesluden de strate dor to brekende. Eintragungen wie: van den vrowen in dem Wonekenbruke vor hure, van hure in deme Wunekenbruke, finden sich Jahr für Jahr in den Bauamtsrechnungen 1409-1434, später heißt es einfach: van den boden in der nyen straten oder noch kürzer van der nigen straten, nachweisbar bis 1499; vereinzelt lesen wir 1459 van der frouwenstrate; 1410 wurden Dach- und Mauersteine gebraucht to deme Wunekenbruke, und der Rat hatte Anspruch auf dat rum twischen den vrowenhuse unde Gleydinges huse in dem Wunnekenbruke, 34 vote langh unde so wijt alzo dat vrowenhaus is; 1414 ff. verursachte dat Wunekenbrok Dachdeckerausgaben und ein sodamber (Brunneneimer) wurde beschafft; in deme Wunekenbroke dar de vrowen wonet werden Ausbesserungsarbeiten vorgenommen; de den tyns sammelet van den suverliken vrowen erhält 1 M 1415; de wosten stede to ennest deme 179
Wunnekenbroke dar de vrouwen wonet kaufte Hans von Munderen 1425. Nach 1434 verschwindet der Ausdruck Wunnekenbrok. – Der älteste Hinweis auf den Durchbruch der Neuen Straße begegnet, wie oben erwähnt, schon erheblich früher; am 27. Februar 1376 erklärt der Rat, Henneken Gherwens van Rottorpe und dessen Erben 105 M Lün. Pf. zu schulden pro quadam domo, curia et area situatis in platea que supra mare dicitur, et circa eandem domum, curiam et aream nova platea nunc est facta, ita quod magna pars de illa curia ad illam novam plateam iam transit et devenit; item 8 M geldes ... vor 20 M und 100 M, darvore de rad van hern Corde Huppen vicariese ... en hus afkoften, dar se de nyen straten makeden anno domini 1408; in nova pl. retro curiam edificii consulum apud curiam Hermanni Snitkers lag ein Garten 1410; Buden in der nyen strate 1413; Haus Blanke uppe der neyenstraten orde: tho unser vrowen werd 1427; Haus v. Barem in cornu nove platee supra mare iuxta domum Livini pitoris 1434. In angulo nove platee supra mare iuxta domum Livini pictoris 1434. In angulo nove platee supra mare 1470; uppe der nijgen straten in des erszamen rades hus 1508. Neue Straße 1765; mit v. Dassel Gang 1794, Beckersgang 1862/3. – Nicht die jetzt sog. Neue Straße kann gemeint sein 1469 und 1470, als eine Planke in der nyen strate by der bare gezogen und de nye strate by der bare gepflastert wird; die Bare war das auf der Saline gelegene Gebäude, in welchem die Sülzpfannen gegossen wurden; gegenüber der Sülze prope domum vulgariter de bare nuncupatam 1486. Die Neue Torstraße ist wohl gemeint 1619, als der Michaelisabt seinem Mundkoch Haus, Hof, Bude und Stall verkaufte an der neuen Strassen zwischen dem Hause darinnen der Cantor wohnet und auf der forderen Seite dem Thorweg so auf unsern den Künnekenhof gehet, gerade gegen der Techt über; am Eingange des sog. Künneckenhofes an der Südseite der Michaeliskirche 1719. Neue Sülze Kein Ratsbeschluß. Die Bezeichnung in veteri salina apud s. Lambertum 1269 setzt das Vorhandensein einer neuen Sülze voraus. Diese neue Sülze wird ausdrücklich genannt in jenem vielberufenen Privileg vom 15. Juni 1273, in welchem Herzog Johann eben diese, von ihm selber innerhalb seiner Erbstadt Lüneburg angelegte Sülze, puteum salis sive novam salinam, den Begüterten der alten Saline verkaufte. Der neue Sod lag auf dem durch einen Vorgarten ausgezeichneten Grundstück Nr. 4 a; das im Jahre 1910 abgebrochene südliche Nachbarhaus Nr. 5 war der zur Saline gehörige Fahrtmeisterhof, auf dem Plan von 1802, wo auch die Quelle angegeben ist, (Sülz-)Bauhof genannt∗. Fleischbänke auf der Neuen Sülze werden 1294 erwähnt. Ein Sülzbetrieb soll auf der neuen Saline seit 1273 nur in den Jahren 1382/8 stattgefunden haben. Nach Gebhardi legte der Rat 1382 neue Siedehäuser auf der Neuen Sülze an, brach sie aber Weihnachten 1388 wieder ab. Das Salinverwaltungsgebäude gegenüber, Nr. 26, ist vom Bürgermeister v. Witzendorff im Jahre 1706 erbaut; das durch seine Ziegelterrakotten bemerkenswerte Haus Nr. 8 (abgebrochen 1961) war ein Bau des Bürgermeisters Hinrik Garlop (†1553). Ein ehemaliges Haus des Bardewiker Domkapitels lag in loco qui vulg. nova salina dicitur 1346; Hoyer v. Geldersen kaufte ein Haus ex opp. nove saline in quodam angulo 1349; iuxta novam salinam 1384; prope novam sal. 1391; platea nove saline 1424; Haus des Bürgers Tzerstede nebst Buden in cornu (Nr. 27) neben Bgm. Rese versus ∗
Zu vergl. Krüger, Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen 1913, Heft 5.
180
Neue Sülze Nr. 27 vor 1972
aquilonem ex opp. nove sal. 1428; by der nygen sulten, vom Hause Raven bis zum Hause des Herrn Olen bis mitten auf die Straße hatte der Sodmeister die Straße reinigen zu lassen. Haus van der Mölen-Garlop zwischen Eckhaus Tzerstede und Wohnhaus Nindorp in opp. nove sal. 1468; by deme korehuse (wurde dort der Sodmeister gewählt?) 1475; Haus Wangelouw zwischen Joh. Garlop und deme korehusze by der Nyen sulten 1480, Haus Bolten neffen der Nyen sulten over zwischen dem Rm. Ludeke Garlop und dem Arzte Mester Hermen van der Molen 1481; gelegentlich der Anlage des Spillwasserbrunnens wird dem Ratmann Tzerstede gestattet, einen Brunnen aus der Kleinen Bäckerstraße wegzunehmen unde wedder in synen hof synes ordthuses neven der nygen sulten over belegen to leggende 1495; Haus der Vincentii Kommende zu St. Joh. bey der nigen sulten unde nigen korhuse in dat suden 1498; ex opp. nove sal. in pl. salinari 1503; Eckhaus Garlop in pl. nove sal. et in acie pl. macellorum 1527; Franz Düsterhop vermachte sein Haus mit Beihaus und Bude bei der Neuen Sultzen im Werte von 5000 M seinem Sohne Franz; Haus Töbing quae vulgo dicitur Garlopiorum et penes novam sal. exstructa 1652; (domum) non procul a quatuor angelis interpositum aedibus Garlopianis maioribus 1661; Eckhaus Stöterogge, später Gastwirtschaft Albers mit Tanzsaal, Postamt seit 1889/90 (abgerissen wegen Senkungsschäden 1971), in nova sal. versus coemiterium d. Marie virg. 1676. Auf dem neuen Sültze 1765. Das Eckhaus Neue Sülze-Wagestraße verkaufte Oberst v. Lösecke, durch seine Frau der Erbe des Camerarius von Dassel, 1873 an die Vorsteherinnen des Kindergartens. Im Dezember 1843 mußte die Landdrostei das Schloß räumen und ihre Geschäftslokale im Salingebäude a. d. Neuen Sülze einrichten; der wüste Salinhof gegenüber war 1840 bepflanzt und von der Straße durch ein schönes eisernes Gitter (statt der Ständermauer) getrennt. Im Garten des Hauses Nr. 78 der Neuen Sülze Anlage einer Zementfabrik von Müller u. Dremel, 1863, eingegangen 1869 (so Volger!). An der Westseite, etwa in der Mitte zwischen Katzen- und Schrangenstraße ist auf Gebhardis Plan ein v. Sternscher Garten mit Terrasse und Hecken hervorgehoben. Neuetorstraße Kein Ratsbeschluß. Früher vor dem neuen Tore (zu vergl.) Neue Thor 1819, Neue Torstraße 1850; der westliche Teil der Neuentorstraße, beginnend mit der Strafanstalt, hieß seit 1884 Obere Neuetorstraße (Beschluß der städt. Kollegien vom 23. Sept.), seit 1. Januar 1909 wird er Neuetorstraße genannt, da die Untere Neuetorstraße den Namen Görges Straße (zu vgl.) erhielt. 1486 ist dat inwendige Nie daer gahr in grunt gesunken. Plan von 1794 Repenstedter oder Harburger Straße. Vor dem Neuentor lag nach 1700 die Wohnung des Zoll-Aufwärters oder –Aufsehers. Außerhalb des Tores lagen vier frei zu geniessende Bürgermeistergärten. Außerhalb des Neuentores linker Hand (jetzt das westliche Eckgrundstück an der Jägerstraße), lag das Abtsziegelhaus, angelegt wohl erst gelegentlich der Erbauung des Michaeliskirchturmes im Vierzehnhundert. Erste Erwähnung 1441, als die vom Berge dem Abte zwei Äcker verkaufen dede beleghen synd vor L. bynnen den thünen dar desulve her nu ter tiyd syn teygelhus hefft; vier Stücke Land hat der Knappe v. Berge geerbt belegen in deme Grymme to der vorderen hant vor deme nygen dare alze men utgheyt ute der stad L. 1468; extra urbis huius moenia circa primum viae publicae pagulum ante portam novam versus laterariam surburbanam 1646. By dem teygelhave up dem Jüttkenmoor unterhielten die Klosterherren einen Finkenherd, der 1594 als auf gemeiner Weide befindlich niedergerissen wurde. 182
Wohnhaus des Gärtners Wrede sen. vor dem Neuentore 1865. Der Wirt Meyer vor dem Neuentore (ehemals Cohrs Garten) hatte 1863 sein Haus durch Anbau eines östlichen Flügels vergrößert, Herbst 1865 Saal an der Ostseite. Neu-Häcklingen Kein Ratsbeschluß. Mit der Eingemeindung Häcklingens nach Lüneburg 1974 wurde der sich selbst erklärende Straßenname übernommen. Neuhauser Straße Ratsbeschluß vom 25.8.1960. Nach der mit der Zonengrenzziehung von 1945 vom Regierungsbezirk Lüneburg abgetrennten Stadt und dem ehemaligen Amt Neuhaus a. d. Elbe benannt, die nach der Wiedervereinigung 1993 zum Landkreis Lüneburg zurückkehrten. Nicolaihof vor Bardowick Nicht zum Gemeindeverbande von Lüneburg, sondern zu Bardewik gehört das in den Adreßbüchern seit 1903 unter obigem Stichwort eingereihte, im Eigentum der Stadt Lüneburg befindliche Hospital zum Hl. Nikolaus, ehemals ein Leprosenhaus, seit Erlöschen des Aussatzes in der ersten Hälfte des Vierzehnhunderts ein Stift für ältere Männer und Frauen. Die Leprosenhäuser waren in der Regel Sankt Jürgen geweiht. Novalisstraße Ratsbeschluß vom 28.1.1960. Die Bezeichnung erinnert an den Dichternamen des Freiherrn Friedrich von Hardenberg (1772-1801), der u. a. 1796/97 als Salinen-Auditor und seit 1799 als Salinen-Assessor in Weißenfels arbeitete. Mit seinem „magischen Idealismus“ verkörperte er die tiefsinnige, geradezu mystische Seite der Frühromantik, deren Symbol die „Blaue Blume“ wurde. Nutzfelder Weg Kein Ratsbeschluß. Der Nutzfelder Weg befindet sich am Rande des Stadtteils Ebensberg und ist mit dessen Eingemeindung nach Lüneburg 1974 übernommen worden. Der Name hat wegweisenden Charakter und findet darin seine Begründung. Obere Ohlingerstraße Kein Ratsbeschluß. Die Erklärung des Namens ergibt sich einwandfrei aus den Quellen. Die Ohlinger- ist nichts anderes als die Ole nye, die Alte neue Straße, vor Anlage einer noch neueren schlechthin die Neue Straße genannt, seit 1376 zumeist mit unterscheidendem Zusatz. Nova platea iuxta plateam iudeorum 1376; pl. nova directa inter pl. iud. et pontem saline, in angulo prope novam plateam 1389; Eckhaus nove platee versus plateam iud.; nova platea 1390; Eckhaus nove pl. versus mon. s. Mich. 1404; Heyno 183
der Schwen wohnt in nova platea 1413; in platea que dicitur de olde nie strate 1420; in der olden nyen straten 1425; in antiqua nova platea 1431; pl. dicta antiqua nova platea 1438; pl. vulg. de oldenigestrate 1440; ein Sod wird vom Bauamt unterhalten in der oldennighenstraten 1450; Eckhaus Frohnleichnamsgilde-Balehorn bei Buden Töbings super antiquam novam plateam 1476; die Barmeister ließen ein Haus in der olden nygen strate in Ordnung bringen 1537 und ebendort de sos boden neu gründen 1541; des organisten hus to S. Lamberte, gelegen in der olden nygen straten 1544; ein Holzhof des Ratmanns Laffert nebst fünf Buden lag in vico vulg. in dem Brilen in antiqua nova platea 1552. Schon aus dem Jahre 1478 wird berichtet, daß das Haus Cord Snitkers dat bei den Brijlen steyt zusammengebrochen sei. Die Brilen waren ein altes Bürgergeschlecht. Joh. Brilen wohnte 1438 an der Sülzstraße, wohl in dem korrespondierenden Vorderhause, die Ableitung von „brühl“ = sumpfiges Gehölz kommt also nicht in Betracht. Zehn Buden werden 1594 erwähnt in antiqua nova platea in area caprarum (auf dem Ziegenplatz, entsprechend 1622); ebenso vereinzelt kommt vor Bude zwischen Buden jegen dem sultestaven in der kaelstraten 1541; antiqua nova pl. alias die koelstrate 1604; in ant. nova platea inter barimagistros ... domicilia 1613; curia borenhof, für Barbediente, schon 1432; area baromagistri et collegii salinatorum in ipsorum angiportu zw. habitaculum ... et baromagistrorum casam in platea oleris 1636; in platea olerum in angiporto quod vulgo der Bahrmeister gang dicitur 1649; im bahrhofsgange an der Westseite der andern ohlingstr. 1735; Baar Hof 1802; in pl. vulgo dicta Alten newenstrassen 1639; in pl. vetera nova superiori 1669; in veteri nova pl. inter aedes ad s. Lamb. templum et barimagistros spectantes 1682; in der Olingstrassen 1692; 1705 kauft der Maler Joachim Burmester von der Stadt drei baufällige Wohnungen in der Alten Neuen Straße. Oldinger Straße 1765; Obere und Nidere Ohlingerstr., letztere mit Meiers Gang 1802; Ohlingstraße 1819; Alt Neue Straße 1850; Obere und untere Ohlingerstraße 1860, mit Reimersgang (s. Plan von 1802, als Reimershof schon 1794), bzw. Neumannsgang und Lohstödtersgang 1862/3. Zu vgl. Judenstraße und Neue Straße. Obere Schrangenstraße Kein Ratsbeschluß. Am Südausgange der Schröderstraße liegt der Schrangenplatz. Dort befanden sich die Verkaufsbuden der Schlachter (knakenhouwer), im Jahre 1302 neunzehn an der Zahl. Die Kämmerei erhob eines Zins daraus, und jeder Käufer einer Schrangenbude mußte vom Rate die Belehnung einholen. Um ein Beispiel aus dem Jahre 1414 anzuführen: N. N. bekennt, da he syne boden in den veleschkscrangen vorkoft hedde Hansze Stormere, unde de vorleth he in jegenwardicheyd siner sons vor deme rade, unde de rad lenede desulven bode do Hansze Stormere wedder alsze dat wontlik is. Die vom Rate beabsichtigte Einführung einer bedingten Sonntagsruhe scheiterte 1467 am Widerstand der Fleischer. Nach 1700 standen nur noch zwei Verkäufer aus. Der Schrangenplatz mit seinen Buden (scharne, schrange, die Verkaufsbank, auch der für solche Bänke abgegrenzte Platz) hat der von Westen nach Osten an ihm entlang führenden Straße den Namen gegeben. In domo sita inter macellas 1291; in macellis 1292, 19 case macellorum solvunt 19 M 1302; iuxta macellos 1335; der Rat verlieh eine Bude in macellis carnificum als Heiratsgut 1347; pl. carnificum 1347; prope macellum carnificum 1349; der lapicida Nicolaus von Bremen verkaufte sein 184
Haus in pl. carnificum an einen Schlachter 1352; die Provisoren vom Hl. Geist verkauften einem Schlachter ein Haus retro casas macellorum 1356; iuxta macellum sive casas carnificum 1357; ex opp. macellorum 1358; in den schranghen 1371; superius macellos versus salinam 1382; bi den scharren 1386; in den vlisschrangen 1395; boven den scrangen 1397; das Bauamt machte eine Zahlung den stenbrüggeren by den schrangen 1411. Finniges Fleisch mußten die Knochenhauer auf einem Tische feilhalten bei geschlossenem Lid, und zwar vor deme torne 1413 – welcher Turm gemeint ist, bleibt dahingestellt; in pl. transversali per quam ex pl. pistorum directe ascenditur versus macellum 1425; pl. quae dicitur schrangenstrate 1432; in superiore parte pl. macellorum versus occidentem 1449; in der knokenhower strate 1450; ein Scharnebecker Conventshaus in pl. carnificum 1460; pl. macellorum 1466; pl. macellinaria 1483; mydtweges in der scrangenstrate – so beginnt ein Verzeichnis der zum Wordzins Verpflichteten 1497; in eben diesem Jahre wurde die Zahl der Schrangenbuden von 40 auf 30 herabgesetzt, ausschließlich der amptesbode; selbständige Knochenhaueramtsmeister (sulvesheren) gab es damals 21. Wohnhaus des Bürgers Wernebom by den schrangen zwischen den Häusern Bertoldes van der Ryte und der Kinder des † Ludeke Nygebur 1502; up dem orde achter dem flesschrangen 1513; Eckhaus des Bürgermeisters Garlop in pl. nove saline et in acie pl. macellorum 1527; in pl. macellari 1533; Haus Wyneken in acie pl. macellaris in pl. pistorali minori 1545; pl. sacellaris 1565 und 1567 ist wohl verschrieben statt pl. macellaris; domum macellarem ... in pl. macellari retro macellum 1618; prope macellum carnarium 1627; pl. cui nomen a macello antiquitus attributum 1628; apud carnificinam 1632; schrangenstrassen 1636; schrankenstrass 1652; in pl. marcellari minori 1668; das Bauamt erwarb ein Haus an der Unteren Schrangenstraße vom Nikolaihof, um es an den Schmied Reitinger wieder zu veräußern 1678. Im Dez. 1827 wurde das alte Schrangengebäude abgebrochen, die Schrangenstraße dadurch erweitert; 1845 baute der Hoftischler Meinshausen in der oberen Schrangenstraße ein neues geschmackvolles Haus, 1847 der Holzhändler Sasse das größte Privathaus der Stadt, an der Ecke der Salz- und Oberen Schrangenstraße, 1856 baute Schlachter Kronacher Schrangenstraße 1765; Niedere und Obere Schrangenstr. mit Oppermanns Seifensiederei (Nr. 5) 1794; Untere und Obere Schrangenstraße 1802. Zu vgl. Schröderstraße. In Braunschweig Scharrnstraße, in Lübeck macella carnium 1293, in Wismar apud antiquos macellos carnium 1272. Ochtmisser Kirchsteig Kein Ratsbeschluß. Als Ochtmisser Weg erwähnt 1345, als das Michaeliskloster einem Bürger an sechs Stiegen Land verpachtet, einen Teil davon prope viam Ochmissen, andere Felder que vadunt de via Ochmissen et pertingunt ad viam Winebutle. Das Dorf Ochtmissen, ursprünglich Billingsches Gut, wird schon in einer Urkunde König Heinrichs von 1004 genannt als Hotmannessun; Ohtmannessun, Ohtmannishûsun, weist auf den Personennamen Othmann (Bückmann S. 13). Straßenbezeichnung seit 1935. Infolge der Eingemeindung Ochtmissens nach Lüneburg im Jahr 1974 erhielt der dortige Straßenname Kirchsteig als Verlängerung des in Lüneburg gelegenen Ochtmisser Kirchsteigs den richtungsweisenden Zusatz. 185
Ochtmisser Straße Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Nach der Eingemeindung Ochtmissens nach Lüneburg wurde die dortige Lüneburger Straße in Ochtmisser Straße umbenannt und unter dem obigen Datum offiziell bewidmet. Oedemer Weg Kein Ratsbeschluß. Nach seinem Richtungsziel als Straßenname aufgenommen 1922. Das Wort Ödeme erklärt Bückmann als Bachnamen (wahrscheinlich = Odimana). Die reichbegüterten herzoglichen Ministerialen v. Oedeme gehörten zu den Lüneburger Burgmannen. Olof-Palme-Hain Ratsbeschluß vom 25.6.1987. International bekannt wurde der schwedische Ministerpräsident Olof Palme (19271986) durch seine außenpolitischen Aktivitäten. Seine politischen Bemühungen galten der atomaren Abrüstung sowie dem Kampf gegen die Apartheidpolitik in Südafrika. Außerdem engagierte er sich für den Freiheitskampf der Sandinisten in Nicaragua. Er fiel einem Mordanschlag in Stockholm zum Opfer, bei dem nicht geklärt werden konnte, ob es sich etwa um ein politisches Attentat handelt. Oltrogge-Platz Ratsbeschluß vom 29.5.1986. Mit der Benennung des kleinen Platzes zwischen Feld- und Lindenstraße wird Carl Heinrich Friedrich Oltrogge (1807-1876), der Gründer der Höheren Töchterschule (1831) geehrt, aus der sich die Wilhelm-Raabe-Schule entwickelte und ab 1875 als städtische Schule geführt wurde. Ortelsburger Straße Ratsbeschluß vom 26.9.1974. Wegen der Eingemeindung von Ebensberg nach Lüneburg und zur Vermeidung doppelter Straßennamen wurde die dortige Marienburger in Ortelsburger Straße umbenannt. Namengebend ist die Kreisstadt in Ostpreußen, deren Burg Ortolt von Trier, Ritter des Deutschen Ordens, gründete. Szczytno, Wojwodschaft Olsztyn, gehört seit 1945 zu Polen. Osterfeld Kein Ratsbeschluß. Alter Flurname im Zeltberggelände, seit 1938 Bezeichnung einer Straße. Osterwiese Ratsbeschluß vom 17.12.1981.
186
Mit der Eingemeindung Rettmers nach Lüneburg 1974 wurde die Straßenbezeichnung übernommen und unter dem o. g. Datum offiziell anerkannt. Ostlandring Ratsbeschluß vom 21.2.1951. Der Name erinnert daran, daß für zahlreiche Flüchtlinge und Vertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten Deutschlands in diesem Teil Lüneburgs Wohnraum geschaffen wurde. Ostpreußenring Ratsbeschluß vom 25.8.1960. Als wichtige Erschließungsstraße für das Neubaugebiet am Kreideberg hält der Ostpreußenring die Erinnerung daran wach, daß viele ehemalige Bewohner dieser Provinz nach dem Krieg eine neue Heimat in Lüneburg fanden. Otto-Brenner-Straße Ratsbeschluß vom 26.4.1973. Der Straßenname würdigt den langjährigen Vorsitzenden der IG Metall, Otto Brenner (1907-1972). Seit 1920 Mitglied der sozialistischen Arbeiterjugend und seit 1922 gewerkschaftlich tätig, wurde er 1933 für einige Monate inhaftiert. Nach 1945 gehörte er zu den Wiedergründern der SPD und der Gewerkschaften in Niedersachsen, dessen Landtag er 1951-53 angehörte. Seit 1952 war er Vorstandsvorsitzender der IG Metall, seit 1961 Präsident des Internationalen Metallarbeiterbundes und seit 1971 Präsident des Europäischen Metallgewerkschaftsbundes. Nach ihm benannte die IG Metall ihre Stiftung. Otto-Fuhrhop-Weg Ratsbeschluß vom 29.2.1996. Mit der Straßenbezeichnung in Oedeme wird der langjährige dortige Bürgermeister (1899-1989, Bürgermeister 1949-1974) geehrt. Ihm verdankt der Ort seinen Kindergarten. Otto-Snell-Straße Ratsbeschluß vom 16.6.1960. Benannt nach Geh. Sanitätsrat Dr. Otto Snell, dem ersten leitenden Direktor der 1901 eröffneten Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt, jetzt Landeskrankenhaus. Ovelgönne Von Manecke Ovelgünne genannt, ein kleines, länger als zwei Jahrhunderte der Stadt gehöriges Gehöft am Hasenburger Bach zwischen Oedeme und Hasenburg. Hammerstein weist darauf hin, daß die Ovelgönne, nach Volger in den nördlichen Teilen Hannovers fünfzehnmal begegnend, wie die Avelgünne in Obersachsen und die Abgunst in Bayern, die gegen eine fremde Mark vorgeschobenen Schäfereien und Vorwerke sind, welche auf Festsetzung in zweifelhaften oder annektirten Teilen 187
der Mark beruheten. Beispielsweise zeigt die Generalstabskarte 262 (Celle), zwischen Wiekenberg und Hambühren, Forst und Forsthaus Ovelgönne. Nach einer Urkunde von 1662 erwarb der Rat bey der Hasenburg belegenen, die Oevelgönne genandten Garten mit dessen Zubehörung, nämlich einem Wohn- oder Lusthause, vom Landhofmeister von Post; von 1577-1660 war der Besitz in Händen der Familie Töbing gewesen, vorher gehörte er zur Sodmeisterei. In das Adreßbuch ist Ovelgönne 1869 aufgenommen. Als Wohnplatz aufgehoben am 12.8.1965. In Hamburg-Eimsbüttel Oevelgönnerstraße; in Hildesheim gab es neben einem Hause, das Ovelgünne genannt wurde, die Bezeichnung Ghudegunne für ein wahrscheinlich in der Nähe gelegenes Haus. Ovelgönner Weg Kein Ratsbeschluß. Nach seinem Richtungsziel, als Straßenname im Gebrauch seit 1922. Pannings Garten Die Salzhändler- und Faktorenfamilie Panning gewann in ihrem ersten Mitgliede die Bürgerschaft 1617. Peter Joachim Panning wurde im Januar 1716 Senator, er starb April 1721. Pannings Garten grenzt nordwestlich an das Grundstück des städtischen Krankenhauses. Das Wohnhaus wurde bei Errichtung Krankenhaus 1961 abgebrochen.
des
neuen
Wirtschaftstraktes
zum
Papenburg Nördlich der Stadt, wo die nach Bardewik führende Landstraße, bis ins Achtzehnhundert durch einen Schlagbaum gesperrt, die Landwehr durchschneidet, auch schlechthin Landwehr genannt. Der anliegende Pachthof mit Schankgerechtsame war ehemals städtisch und als Ausflugsort der Lüneburger sehr beliebt; ein Tanzsaal befand sich bis ins zweite Drittel des vorigen Jahrhunderts hinein in den Resten eines alten Wachturmes. Die Papenburg wurde regelmäßig passiert von den mit Lüneburg in vielfacher Verbindung stehenden Mitgliedern des Bardewiker Domkapitels; der Name mag sich dadurch, harmlos genug, erklären. Auf der Weidebeziehung von 1616 wurde Klage geführt, daß wider altes Herkommen auf der Goseburg und R ö n n e n b u r g Kühe gehalten würden zur Verschmälerung gemeiner Weide. Manecke und Volger erwähnen die Rönnenburg nicht, Büttner gibt keine Auskunft, wo sie gelegen hat. Da Rönnenburg wohl entstanden ist aus renneburg, Grenzburg, werden wir sie gleich der Goseburg, Buntenburg, Papenburg, Hasenburg in der städtischen Landwehr suchen müssen. Papenburger Weg Kein Ratsbeschluß. Seit 1921, nach Vorstehendem leicht erklärt.
188
Blick in die Papenstraße nach Osten
Papenstraße Kein Ratsbeschluß. Der Name für die an das Grundstück der Prämonstratenser angrenzende, im Mittelalter vorwiegend von Vikaren der Johanniskirche, auch einigen Abgeordneten (terminariis) des Predigerordens bewohnte Verlängerung der Glockenstraße lag gewiß nahe. Gleichwohl setzte er sich erst nach der Reformationszeit durch. Von einem Hause zweier Vikare heißt es noch 1425 in einer Quergasse zwischen St. Johannis und dem Kloster Heiligenthal, in vico transversali qui est inter ecclesiam s. Joh. et mon. Hilgendal; ex opp. curie fratrum predicatorum 1427; neu erbautes Haus eines Geistlichen zwischen der peweler hove und dem Hause eines Geistlichen in der twijten achter der heren van Hilgendale kokene 1473. Es folgt die Bezeichnung Goldstraße, eine auch in anderen Städten (Braunschweig aurea platea 1297, Rostock Gr. und Kl. Goldstraße 1502) begegnende, euphemistische Deutung des Schmutzes, der sich in der schmalen Gasse wohl besonders breit machte. Die Provisoren von Nicolaihof veräußerten das Nachbarhaus eines Vikarienhauses von St. Gertruden in platea vulgariter nuncupata de goldstrate 1484; in opposito valve dominorum de sancta valle in platea dicta de goltstrate 1485; platea aurea 1490; die Witwe Blickershusen kaufte ein Haus in angulo platee auree 1493 und stiftete 1499 ein Gotteshaus (an der Papenstraße), das 1811 eingegangen ist; die Äbtissin von Hekelinge verkauft ein Haus infra portam valvalem dominorum terminariorum ordinis predicatorum und dem Wohnhause des Rm.s Schele retro ecclesiam s. Joh. ex opposito mon. Hilghendal in platea aurea 1498; Haus zwischen einem Wohnhause et domum prepositi in Hilgendale retro s. Joh. ex opp. domus terminariorum 1498; goltstrate twischen sunte Johanse unde deme Hilgendale 1513; das Haus der Wwe. Blickershusen in acie platee sacerdotum appellata kommt 1518 an den Bürger Schulte; Brauhaus Kröger neben dem Wohnhause des † Syndikus Glode in acie platee campanarum ex adverso auree platee 1524; in vico sive angiporto sacerdotum vulgariter der papen twyten nominato 1531; Vikarienhaus von St. Gertruden uppe der pewler orde in der goldstraten 1539; in der papen oder goldstraten an der sudersiden, zw. dem Hause des Liborius Becker und dem der Matthei Vikarie in armario s. Gertrudis, verfügte der Rat über ein Wohnhaus 1565. Haus Möller in platea quae vocatur die papenstrasse in acie 1580; zwei Brüder Elver verkaufen ein kleines Haus inter vallis sacri ad conrectoratum scholae Joannitanae ordinatas aedes (Nr. 6 [und 7]) et Hilckiae Blickeri nosocomium in quo aliquot vetulae habitant an die Buchdrucker Johann und Heinrich Stern 1635; in acie die Papen- oder Goldstrasse dicta 1679; Papenstraße 1765; eine Unterabteilung der Papenstraße heißt 18621866 Auf dem Heiligentalerhofe. Die Häuser Nr. 10 und 11 an der Papenstraße wurden 1875 abgebrochen, um für die Töchterschule Raum für den Spielplatz und Aborte zu gewinnen. Auch die Altstadt besaß eine Straße, die durch zahlreiche Wohnungen von Geistlichen als Papentwite charakterisiert war, die spätere Rübekule (zu vgl.). Eine Vikariatsbude und ein Holzhof in vico dicto vulgariter de papentwijte 1443; Eckhaus Sankenstede neben Gronehaghen ex opposito curie dni. prepositi de Ebbekestorpe in vico vulgariter dicto de papentwite 1447; sunte Lamberdes wedeme (Pfarrhaus) in der papentwijten 1459; Bude zwischen Buden in der papentwyten vulg. dicta 1461. Der Ebstorfer Hof an der Rübekule, jetzt Salzstraße 12 (und 12 a), gelangte nach Aufhebung der Klosterpropstei an den Herzog, im Jahre 1754 an die Stadt (nach Manecke von Lüneburgs Haus); er liegt mit der Rückfront seines Hauptgebäudes an der Rübekule , hat aber dort keinen Ein- oder Ausgang mehr.
190
In Braunschweig Papenstieg 1339, in Danzig platea sacerdotum 1382. In HamburgEilbeck, Greifswald und Stralsund Papenstraße, in Hildesheim papenstich 1370, in Lübeck papenstrate 1364, in Wismar pl. clericorum 1318. Parkstraße Kollegienbeschluß vom 7.11.1911. Bezeichnung für die auf dem Grundstücke am Lünerdamm 11/12 angelegte Villenstraße. Gebhardis Plan zeigt an jener Stelle den Salztonnenböttchergarten und davor im Stadtgraben die Albers Insel, wohl zum Garten des Senators Albers (Bellevue) gehörig. Peter-Schulz-Straße Ratsbeschluß vom 3.4.1947. Benannt nach dem am 31.3.1747 in Lüneburg geborenen Komponisten Johann Abraham Peter Schulz (gest. am 10.6.1800 in Schwedt/Oder). Ursprünglich, seit etwa 1939, Schlieffenstraße. Die Umbenennung erfolgte wohl aus Anlaß seines 200. Geburtstages. Die Melodien von J. A. P. Schulz erklingen noch heute vom Glockenspiel des Rathauses. Pfarrer-Kneipp-Weg Ratsbeschluß vom 2.11.1967. Der sog. Schwarze Weg durch den Kurpark wurde zu Ehren des Erfinders der „Wasserkur“, Sebastian Kneipp (1821-1897), umbenannt. Im südlichen Teil des Kurparks befindet sich eine Kneippsche Wassertretstelle. Philipp-Reis-Straße Ratsbeschluß vom 28.1.1999. Die Straßenbezeichnung erinnert an den Kaufmann und Lehrer Johann Philipp Reis (1834-1874), der auf dem Gebiet der Elektrotechnik arbeitete und sich mit dem Problem, die menschliche Stimme mit Hilfe des elektrischen Stromes zu übertragen, beschäftigte. 1861 konstruierte er den ersten Fernsprecher. Philipp-Spitta-Platz Ratsbeschluß vom 21.3.1985. Die Benennung geschieht in Erinnerung an den Liederdichter und späteren Burgdorfer Superintendenten Carl Johann Philipp Spitta (1801-1859), der von 18241828 als Hauslehrer in der Domäne Lüne tätig war und in dieser Zeit die aus gemeinsamen Göttinger Zeiten stammende Freundschaft mit Heinrich Heine pflegen konnte, bis es wegen allzu unterschiedlicher Charaktere zum Bruch kam. Spitta schuf vor allem ein durch sprachliche Klarheit und Schlichtheit ausgezeichnetes Liedwerk „Psalter und Harfe“ (2 Bände 1833-1844), das zum Teil in evangelische Gesangbücher übernommen wurde.
191
Pieperweg Ratsbeschluß vom 29.5.1958. Georg Pieper (1841-1917), Kaufmann und Fabrikant, war Begründer der Firma Lüneburger Düngekalkwerke Pieper & Blunck G.m.b.H. In unmittelbarer Nähe, Am Grasweg, befand sich Piepers erste Düngekalkfabrik. Pilgerpfad Kein Ratsbeschluß. Mit der Eingemeindung Rettmers nach Lüneburg 1974 wurde der dortige Klosterweg in Pilgerpfad umbenannt. Die Straße weist zwar Richtung Heiligenthal, ob die Namensgebung aber darin begründet ist, muß offen bleiben Pirolweg Ratsbeschluß vom 30.5.1963. Die Straße liegt im Wilschenbrucher „Vogelquartier“ und erinnert an die inzwischen selten gewordene Goldamsel. Planckstraße Ratsbeschluß vom 24.5.1956. Benannt nach dem Physiker Max Planck (1858-1947), der 1918 den Nobelpreis für Physik erhalten hatte. In seinen Forschungen legte er die Basis für die Quantentheorie und arbeitete mit am Ausbau der Einsteinschen Relativitätstheorie. Posener Straße Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Die Straßenbezeichnung im Stadtteil Ebensberg basiert auf der Hauptstadt der ehemaligen preußischen Provinz Posen (1815-1919), seit 1920 Poznań, Hauptstadt der gleichnamigen Wojwodschaft in Polen. Posten 90 Kein Ratsbeschluß. Bezeichnung einer Station an der Bahnlinie nach Dannenberg. Postweg Ratsbeschluß vom 16.12.1982. Der Straßenname soll an eine alte Flurbezeichnung erinnern. Pulverweg Kein Ratsbeschluß. Amtlich so bezeichnet 1922, im Volksmunde von alters so genannt, weil angeblich die für einen Pulverschuppen auf der Breitenwiese (beseitigt um die vorletzte Jahrhundertwende) bestimmten Pulverlieferungen ihn benutzten, denn sie durften nicht durch das Innere der Stadt fahren.
192
Quellenweg Ratsbeschluß vom 25.3.1953. Die Grundlage des Namens dieser Sackgasse am Südrand des Kreidebergs ist nicht eindeutig festzustellen. Möglicherweise gab es dort tatsächlich eine kleine Quelle. Querkamp Ratsbeschluß vom 29.8.1996. Die Straßenbezeichnung im Gewerbegebiet Hagen greift einen alten Flurnamen auf. Quickbaumweg Ratsbeschluß vom 12.12.1985. Die Bezeichnung geht auf einen alten Flurnamen im Stadtteil Ochtmissen zurück. Rabensteinstraße Ratsbeschluß vom 27.1.1954. Aus dem 17. Jahrhundert wird überliefert, daß die dortige Höhe köpkenberg oder rabenstein nach dem in der Nähe befindlichen Galgen genannt wurde; 1725 wird wiederum der Rabenstein als Richtstatt erwähnt. Die Rabensteinstraße verläuft parallel zum Straßenzug am Galgenberg. Rackerstraße Kein Ratsbeschluß. Gegen 1450 stellte der Rat in einem Erlaß über Straßenreinigung fest, daß in der vulen ouwe by des rackersz hus der Gastmeister vom Großen Hl. Geist verantwortlich sei; einen entsprechenden Hinweis und damit die zwiefach verbürgte Erklärung des Straßennamens finden wir in der Schoßrolle von 1453: bij der rackerijge. Rackerei ist die Abdeckerei, Racker der Schinder, der Abdecker. Die Form Rackerstraße ist erst nach 1700 nachzuweisen, wo es heißt die sog. Alte Bütteley in der Rackerstrassen an der Ecke gegen den Blauen Turm gelegen, in welcher vor diesen des Scharfrichters Knecht oder der Abdecker gewohnet, wird itzundes an den Aufseher auf die Guma oder Wassercanal überlassen, für jährliche Miete; in den ältesten Adreßbüchern wird hinzugefügt von der Heiligengeiststraße bis zur Rotenmauer r. bzw. l. Ein Rackerzaun (Bienenstand) und eine Wiese des Scharfrichters lagen, wenn wir Volger richtig verstehen, oberhalb des Ilmenaugartens nach dem Bokelsberge zu. Zu vgl. Faule Au. In Wismar bi de rakkemuren 1475, jetzt beim Küterhofe. Rehhagen Ratsbeschluß vom 12.3.1945. Die Straße liegt in einem Quartier beim Waldfriedhof mit Straßennamen auf der Grundlage heimischer Wildtiere. Der Zusatz - hagen - bedeutet Buschwerk, Gehölz. Rehrweg 193
Kein Ratsbeschluß. Bei der Wahl eines Straßennamens wurde auf eine alte Flurbezeichnung zurückgegriffen. Rehr kann entweder Sumpf bedeuten oder eine Ableitung von dem Personennamen Radheri sein. Reichenbachplatz Ratsbeschluß vom 9.6.1983. Vgl. Reichenbachstraße. Reichenbachstraße Kein Ratsbeschluß. An Stelle des um 1890 abgetragenen Bardewikerwalls, an dessen Nordseite damals das Städtische Schlachthaus erbaut wurde. Der aus dem Volksmunde entstandene Name S c h l a c h t h a u s s t r a ß e wurde im Dezember 1892 vom Magistrat gutgeheißen. 1927 aber auf Beschluß der städtischen Körperschaften umgewandelt in Reichenbach Straße Johannes Reichenbach, geboren in Lüneburg am 20. Januar 1836, war gelernter Böttchermeister. Als Geselle hatte er auf der Wanderschaft in Riga und Moskau Fässer gezimmert und daheim es verstanden, den von seinen Vorfahren ererbten handwerklichen Betrieb fabrikmäßig in großzügiger Weise auszugestalten. Als seine umfangreiche Fabrikanlage in der Nähe der Nikolaikirche am 27. Juni 1889 durch eine Feuersbrunst in Trümmer gelegt war, wodurch etwa 50 Arbeiterfamilien vorübergehend obdachlos wurden, kaufte er im Norden der Stadt ein ausgedehntes Gelände zu verheißungsvoller Gründung eines neuen Fabrikunternehmens. Seine Rührigkeit und Tüchtigkeit bewährte er nicht minder als Bürgervorsteher (seit 1872) und als Senator (seit 1885). Vorbild eines wackeren Bürgers, war er entscheidend beteiligt bei der Verkoppelung der städtischen Feldmark, bei der Wasserversorgung der Stadt, dem Feuerlöschwesen, der Schaffung einer Industriebahn, der Verbesserung der Ilmenau-Schiffahrt, der Förderung von Handel und Gewerbe, im Kirchenvorstande, im Verschönerungsverein. Seine allgemeine ungewöhnliche Beliebtheit zeigte sich an seinem 70. Geburtstage, als ihm der Ehrenbürgerbrief verliehen wurde, wie an seinem 50jährigen Meisterjubiläum (1909). Am 31.10.1908 wurde am Sande vor der IHK der „Reichenbach-Brunnen“ zu Ehren des Lüneburger Ehrenbürgers eingeweiht.1943 mußte er einem Feuerlöschteich weichen und wurde auf dem städtischen Bauhof eingelagert. Die Figur des Sülfmeisters erhielt 1960 einen neuen Platz auf dem ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Platz (jetzt ScunthorpePlatz), bevor der rekonstruierte Brunnen an der neu gestalteten nördlichen Zufahrt zur Altstadt an der Reichenbachstraße aufgestellt wurde. Johannes Reichenbach ist entschlafen am 24. Februar 1921. Reiherstieg Ratsbeschluß vom 4.4.1944. Die Straße liegt im Wilschenbrucher „Vogelquartier“ nahe der Ilmenau. Graureiher zählen zu den hier heimischen Schreitvögeln. Reitende-Diener-Straße 194
Kein Ratsbeschluß. Die Reitendedienerstraße wird beherrscht durch eine einheitlich gebaute, geschlossene Gruppe von Einfamilienhäusern, die sogenannten Garlopenwohnungen. Sie verdanken ihre Entstehung einem Vermächtnisse des Bürgermeisters Hinrik Garlop († 1553), dessen gleichnamiger Sohn († 1558 als letzter seines Geschlechts) und Schwiegersohn Franz von Witzendorff die malerische Häuserreihe erstehen ließen als Wohnung für die Stallbrüder oder Reitenden Diener. Die ridenden denre (unsere ridend sagt der Rat 1398), seit 1494 in Leydensches Tuch einheitlich gekleidet, waren eine bewaffnete Schutz- und Ehrentruppe des Rates unter dem Befehl eines Hauptmanns; ihre Zahl schwankte je nach der Unruhe der Zeit. Einer oder mehrere von ihnen, zumal der Schaffer, begleiteten die Ratssendeboten auf ihren Tagfahrten, auch zu wichtigen und eiligen Botengängen wurden sie herangezogen (ridende baden und im Gegensatz dazu gande baden); ihre Besoldung und die Lieferung der Pferde war Sache des Sodmeisters. Die Garlopenwohnungen werden seit 1731 gegen eine Mietsentschädigung an städtische Beamte vergeben. Nach einem Vergleich von 1613 wurden sie abwechselnd verliehen vom regierenden Bürgermeister, vom Ältesten der von Witzendorff und von Töbing. Heute sind dort Teile der Stadtverwaltung untergebracht. Die gegenüberliegende Ostseite der Straße wurde zu einem Teile wohl eingenommen durch Buden des Vogtes, von denen der Rat 1486 betonte, daß sie nicht freier seien als die der eigenen Bürger; von 1431-1446 gebrauchen die Schoßrollen durcheinander die Bezeichnung in der hertoghen bzw. in des vogedes boden, 1461 in des vogedes buden, 1465 achter deme vogede in den boden; wahrscheinlich schlossen sie sich an das Herzogshaus, das an der Ecke gegenüber dem Kämmereigebäude lag, nach Norden zu an. Ein Garten an der Reitenden Diener-Strassen Ecke bey dem Sprützenhause hatte der Secretarius Joh. Heinrich Büttner zur Miete. Derselbe berichtet über eine Tabakfabrik: Die neue TabaksFabrique in der Reitenden Diener Straßen ist auf Anhalten des Juden Moses Salomon von Grund auf, dicht an seinem der Cämmerey zugehörigen Hause, gebauet worden ao. 1718. Das Judenhaus daselbst veräußerte der Rat 1735 an den Faktor Meyer, gleichzeitig die Tabakfabrik an den Prokurator Hansen. Eine benachbarte Lakenfabrik (früher Marstall) nebst anstoßendem Platz zu den Wandrahmen und Pflanzungen der Karten-Disteln brachte einen Pachtzins ein. Stallbrüderstr. 1591; uff der reitenden Diener Str. 1613; achter des hertoghen husze 1629; Diener Straß 1652; Reitendienerstr. 1765; Reitenderdienerstr. 1794; Reitendedienerstr. 1802; Reitenden Diener Straße 1850; Reitendedienerstraße 1860. In Danzig Dienergasse. Rethgraben Ratsbeschluß vom 29.8.1996. Die Straßenbezeichnung in Rettmer soll den ländlichen Charakter des Stadtteils betonen. Rettmers Höhe Ratsbeschluß vom 23.7.1998. 195
Der Straßenname in einem Neubaugebiet in Rettmer zwischen Heiligentahler und Lüneburger Straße erinnert daran, daß dieser Bereich etwas höher liegt als das Altdorf Rettmer. Richard-Brauer-Straße Ratsbeschluß vom 21.2.1951. Richard Brauer (1861-1937) gründete die Knochen- u. Leimfabrik A. Brauer & Co. Lüneburg, heute Scheidemandel-Motard-Werke AG. Die nach ihm benannte Straße befindet sich auf ehemaligem Brauer’schen Grundbesitz. Richard-Hölscher-Straße Ratsbeschluß vom 18.10.1956. Sanitätsrat Dr. med. Richard Hölscher (1868-1949) war der erste Direktor des städtischen Krankenhauses von 1901 bis 1936. Rigaer Straße Ratsbeschluß vom 22.6.1976. Die Straße im Stadtteil Ebensberg ist nach der alten Bischofs- und Hansestadt und heutigen Hauptstadt Lettlands benannt. Rilkestraße Ratsbeschluß vom 18.5.1955. Benannt nach dem Dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926). Ringstraße Kein Ratsbeschluß. Als Straßenname zuerst im Adreßbuche von 1938 aufgeführt. Die Grundstücke auf der Westseite der Ringstraße wurden erst 1958 in den Stadtkreis Lüneburg einbezogen (früher Gemeinde Oedeme). Ritterstraße Kollegienbeschluß vom 27.11.1897. Das Gedächtnis an die heldenmütige Bezwingung der in die Stadt eingedrungenen feindlichen Scharen am frühen Morgen des Ursulatages 1371 ist in dem Namen Ritterstraße erhalten, denn dort verloren die auf allen Seiten von den streitbaren Bürgern umringten herzoglichen Mannen den harten, letzten Entscheidungskampf; der Westausgang der Ritterstraße war durch das Sülzervolk mit Sülzwagen gesperrt. Älteste urkundliche Erwähnung 1417, als der Pfarrer zu Bergen Joh. Leerte sin ene hus belegen by sinem groten huse in der ridderstrate verkauft; platea vulg. dicta de ridderstrate 1441 und 1444; in der Ridderstraten 1457; in platea militari 1462; pl. militum 1484; in pl. militari prope valvam salinarem 1507; pl. equitum auratorum 1595; pl. vulg. die Ritterstrate nominata 1610; in der Ritterstraßen 1625; in pl. equestri 1657.
196
Die Ritterstraße erstreckte sich von der Einmündung der Rackerstraße bis zum Sülztore, ja, nach den Plänen von 1765, 1794 und 1802 beschränkte sie sich ursprünglich sogar auf das westliche Drittel dieses Straßenzuges. Nach eben jenem Plane war die Straße nahe der Einmündung des Kageltimpens von einem Gewölbe überspannt – dieses gehörte wohl zum transitus longus des Hl. Geisthospitals, einer den Abfluß der Gumma benutzenden Abortsanlage: iuxta murum civitatis et transitum longum s. spir. 1407; iuxta transitum domus hosp. s. spir. 1428. Die Ausdehnung des Namens Ritterstraße auf die östliche Verlängerung bis zur Rotenstraße geschah durch Beschluß der städtischen Kollegien am 27. November 1897, weil die dortigen Bewohner angeblich unter der bis dahin üblichen Bezeichnung hinter der Rotenmauer zu leiden hatten. Achter oder hinter der Mauer ist im Plan von 1765 der östliche Teil der Ritterstraße, während die Strecke von der Rackerstraße über das Rote Tor hinaus zum Schweinemarkt hier Rote Straße heißt. Auf Besitzungen einzelner Adelsfamilien ist zumeist die Ritterstraße in anderen Städten zurückzuführen, in Braunschweig, Hildesheim, Lübeck (pl. militis 1438), Stade. Robert-Brendel-Straße Ratsbeschluß vom 29.9.1994. Dr. Robert Brendel (1889-1947) war von 1919-1934 Studienrat an der WilhelmRaabe-Schule in Lüneburg und ist aus politischen Gründen, auch wegen seiner jüdischen Frau, nach Wesermünde strafversetzt worden. 1936 erfolgte die Entfernung aus dem Schuldienst. Schreibverbot und Ausschluß aus der Reichsschrifttumskammer beendeten die schriftstellerische Tätigkeit von Dr. Robert Brendel. Robert-Koch-Straße Ratsbeschluß vom 18.5.1955. Benannt nach dem Bakteriologen Robert Koch (1843-1910), der 1882 das Tuberkulosebakterium und 1883 den Choleraerreger entdeckte. Mit seinen Forschungen wurde er zum Hauptbegründer der modernen Bakteriologie und erhielt 1905 den Nobelpreis für Medizin. Robert-Stolz-Platz Ratsbeschluß vom 29.8.1975. Benannt nach dem österreichischen Operettenkomponisten und Dirigenten Robert Stolz (1882 - 1975), der nicht lange vor seinem Tod noch ein Konzert im Fürstensaal des Rathauses gegeben hatte. Röntgenstraße Ratsbeschluß vom 18.5.1955. Benannt nach dem Physiker Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923). Er entdeckte 1895 die X-Strahlen und beschrieb ihr Verhalten. 1901 erhielt er als erster den Nobelpreis für Physik.
197
Dr. Robert Brendel (1889-1947)
Roggenkamp Ratsbeschluß vom 28.8.1975. Die Straßenbezeichnung in Häcklingen weist auf die wichtigste in Deutschland angebaute Getreideart hin. Rosenstraße Kein Ratsbeschluß. De stadt to Luneborch de heit to der tit in deme rosengarden – so beginnt eine kurze Chronik des Vierzehnhunderts ihre Erzählung vom Erbfolgekriege. In einem von Liliencron im ersten Bande seiner historischen Volkslieder veröffentlichen Gesang von der Ursulanacht heißt es: ...sprak Maneke mit der barden: „Gi heren, weset alle fro, gi sint im rosengarden.“ Ob an Stelle der Neustadt wirklich dereinst ein Rosengarten oder etwa ein Turnierplatz (ros, n. = Streitroß) gelegen hat und die Rosenstraße eine letzte Erinnerung daran in sich birgt? Möglich, daß die Straße ihren Namen erhielt als direkte Verbindung des Ratsmarstalls mit der Pferdetränke, und nicht ganz ausgeschlossen, daß die Erklärung des Namens in Zusammenhang zu bringen ist mit dem Hause Nr. 10, der ehemaligen Büttelei oder Frohnerei, der Freiwohnung des Scharfrichters. Bis in die jüngste Vergangenheit war dort neben schmalen Gefängniszellen der gewölbte Kellerraum erhalten, der als Folterkammer diente. Was an dem verborgenen Orte vor sich ging, geschah in aller Heimlichkeit, under der rosen, und mit dem grausigen Handwerk des Scharfrichters mochte man eine gleich anschauliche Vorstellung verknüpfen wie mit dem Rosengarten, wenn dieses Wort im bildlichen Sinne für das blutige Schlachtfeld gebraucht wurde. Der letzte Scharfrichter, Renzhausen, der von der Stadt noch Pension genoß, † 1860; seine Dienstwohnung wurde verkauft und ausgebaut, die Abdeckerei verpachtet. Für eine euphemistische Benennung nach Art der Goldstraße u. A. scheint die Straße zu breit angelegt. Die Belegstellen zeigen, daß im Vierzehn- und Fünfzehnhundert die Bezeichnungen Rosen- und Mühlenstraße miteinander wetteiferten und der Begriff Rosenstraße gelegentlich auch die Brotbänke mit umfaßte. Die Büttelei wird zuerst erwähnt 1367 prope domum preconis; die Bauherren verausgabten vor des bodels hus to buwende 71 M 1411; jegen dem bodele, jegen der stadt böden over 1450; benedden der bodelie 1450; ex opp. domus executoris iusticie 1460; ex opp. domus bedelli 1470; 1731 wurde die Alte Frohnerey verlicitiret; pl. molendinorum 1476; in der roszenstrate 1479; in pl. molendinari 1483; pl. vulg. de rosenstrate alias de molenstrate 1490; in der molenstrate Wohnhaus Hans Kote zw. Wohnbuden 1490; Eckhaus Kurnehagen-Willing in pl. rosarum 1494; in pl. vulgariter dicta de rosenstrate ex opposito domus torture 1495; by der bodelie in der rosenstraten 1495; der Rat gestattete einem Kersten Meyger ein kellergradt [Treppe] to makende uthe sijnem huse tor straten in der rosenstraten, densulven kellergrath to sijner neringe to gebrukende 1504; Eckhaus Töbing-Tippe prope domum torture in pl. rosarum 1507; in der molenstrate 1507; Eckhaus von Dassel-Kopke zwischen v. Dassel et intermediante pl. vulgo de Tittersche strate nuncupata in alia acie Gotschalci Konowen ... domos in pl. rosarum 1515; Konrad Hinrickes kaufte ein Haus zwischen dem Wohnhause Konrads v. Dassel et casas pro nostris consularis domus vel pretorii famulis deputatis in pl. rosarum 1518; Haus Tippe-Konow inter Petri Kopeken civis et carnificis sive lictoris domos in acie pl. rosarum 1520. Eckhaus Wichelmann-Voß ad duas januas nuncup. in pl. rosarum 1528 (drei Häuser für 199
Rathausbediente Anfang des 1700 in der Rosenstrassen, hinter den Schütting); zwischen von Dassel et casas ministrorum nostrorum prope tabernam cerevisiariam quam Schütting vocant in platea rosarum 1538; Bude in angulo pl. rosarum qua ad molendinum abbatis descenditur 1546; in pl. rosea (vulgo Roszentraszen) 1637; zwei Brüder Reimers erwarben im Konkursverfahren aedes iure acetum coquendi privilegiatas et in pl. rosarum penes custodiam publicam die fronerey genannt exstructas 1651; in pl. rosea in medio aedium Christopori Finxii et Lucae Elveri vasorum stanneorum fusoris sitam 1662. Der Plan von 1765 beschränkt die Bezeichnung Rosenstraße auf die östliche Verlängerung von der Ecke der Rotenhahnstraße ab; der von 1802 schiebt an dieser Stelle auffallenderweise eine zweite Schröderstraße ein und stützt sich damit auf Gebhardis Plan, der die Rosenstraße gar an die Stelle der heutigen Kalandstraße verlegt. Rosenhagen in Braunschweig, Hildesheim und Rostock, Rosengasse in Danzig, Rosenstraße in Hamburg und Hannover, hier nach einer Gastwirtschaft zur Rose 1848; rosenstrate 1352, rosengarde 1387 in Lübeck; pl. rosarum 1304 in Stade. Rostocker Straße Ratsbeschluß vom 25.8.1960. Benannt nach der bedeutenden Hanse und Universitätsstadt an der Ostsee. Rotehahnstraße Kein Ratsbeschluß. Im Januar 1478 kaufte der Bürger Hermann Barum ein Haus infra domini Hinrici Erpensen . domum vulg. t o m r o d e n h a n e nuncupatam et domum habitationis Hinrici Medingk in platea prefectorum, er verkaufte es wieder 1483 als domum . infra domum dni. Hinrici Erpensen vulg. tom rodenhone nuncup ... in pl. molendinari. Das bezeichnete Haus des Ratmanns Hinrik Erpensen führte seinen Namen vermutlich von einem rot gestrichenen Wetterhahn; es wurde, anscheinend nur zu einem Teile, später in ein Gasthaus oder Gotteshaus verwandelt und hat sich als städtisches Stift in seinem ganzen malerischen Reiz erhalten. Hospitale quod ad rubeum gallum vulg. nuncupatur in platea praefecti 1537; platea scriniariorum prope gallum rubrum 1667; in der Voigts Strassen, inter xenodochium rubri galli et Petri Wiegels aedes braxatorias 1676. Eine Erklärung der an dieser Stelle auffallenden Benennung der Rotenhahn- als Vogtsstraße ist unter Lünerstraße gegeben. Rothenhahnstr. 1765; Rodehahnenstr. mit dem Weißen Elephanten dem Stift gegenüber 1794; Rote Hahnenstr. 1802; inmitten der Ostseite schwarzes Roß. Neben dem Roten Hahn gab es ein Eckhaus zum goldenen Hahn; dieses lag im Sandviertel. Der Bürger Joh. Droste pictor, Meister der trefflich geschnitzten Elisabethlegende des Museums, kaufte 1497 ein kleines Haus infra domum acialem ad aureum gallum vulg. nuncupatum gegenüber Johann van der Mölen; im folgenden Jahre erwarb Hans Konow von Ludeke Reynstorp domum acialem vulg. tome gülden hanen nuncupatam . prope domum magistri Johannis Drosten pictoris ex opposito domus Joh. van der Mölen.
200
Rotemauer Vom Rotentore ab nach Osten und Westen sich erstreckend, nämlich von der Rackerstr. bis zur Rotenstr. und weiter bis zum Schweinemarkt, bzw. von der Rotenstr. bis zur Ritterstr. links 1860. Die Bezeichnung Rote Mauer, auch hinter der Roten Mauer, ist seit 1894/95 aufgegangen in dem Namen Ritter- und Kalandstraße. Bi der muren 1431, prope rubeam valvam versus occidentem iuxta murum 1464; ex adverso muri rubri 1634; retro murum civitatis rubrum et versus portam rubram 1659; e regione moeniorum rubrorum 1661. Rote Straße bzw. Schweinemarkt Plan von 1765. Eine Unterbezeichnung der Schoßrollen lautet seit 1433 in dem bullenstalle (Sandviertel); bij dem bullenstalle 1462; achter dem bullenstalle 1500. Dieser Bullenstall an der Roten Stadtmauer befand sich in nächster Nähe östlich des Rotentores und wurde im 1700 vom Bullenwärter bewohnt. Ein Sod in dem bullenhove wird 1409 erwähnt; to dem bullenstalle werden 15000 Mauer- und 9000 Dachsteine angefahren 1412; es wird davor gepflastert 1446, und 1450 werden 26 M verbaut an deme bullenstalle an der treppen de dar geyt up dat rode dor. Zwei Höfe mit sog. Gotteswohnungen, Ellenbergs Hospital (bis 1812) und Doppelers Gasthaus, auch Dankwertshof, Königshof genannt (bis 1805) lagen hinter der Rotenmauer westlich von den Predigergärten. Achter wandages Didericks Ellenberghes huse unde der provestie by unser stad muren 1487; achter der provestye bi der muren 1501. Die im Adreßbuche seit 1869 nicht mehr gebrauchte Straßenbezeichnung A m S c h w e i n e m a r k t umfaßte schon 1802 und bis zuletzt die Häuser hinter der Roten Mauer bis zur Roten Straße, während der Schweinemarkt sich ursprünglich auf den gegenwärtigen Spielplatz des Johanneums beschränkte. Schweinemarckt 1765; neben dem Schweinemarkt 1850; am Schweinemarkt 1860. Im Mai 1875 wurde ein Schweinemarkt vor der Sülze abgehalten, dahin verlegt von dem ehemaligen Kalandsplatze; zu Maneckes Zeit fand der Markt in den ersten Tagen der vier Adventswochen statt. Ein Schweinemarkt auch in der Altstadt Hamburg. Rotenbleicher Weg Kein Ratsbeschluß. Mit dem Zusatz von der Rotenbleiche in nördl. richtung links zuerst im Adreßbuche von 1880 für die einseitig bebaute Straße, die zur Rotenbleiche führt, seit 1902 auch für ihre doppelseitig bebaute erste Hälfte nach der Stadt zu. Zwei östlich abzweigende, auf grüne Gärten sich öffnende geschlossene Reihen winziger Häuschen hießen im Volksmunde langes Elend. Rotenburger Straße Kollegienbeschluß vom 20.9.1898. Angelegt von der Gemeinnützigen Baugesellschaft und benannt im Anschluß an die unweit gelegenen, ehemals zum Rotenburger Hof des Bischofs von Verden gehörigen Rotenburger Ländereien. Zu vgl. Am Marienplatze.
201
Rote Schleuse Kein Ratsbeschluß. Seit dem Siebzehnhundert eine Holzvogtswohnung, vorher Landsitz der Familie v. Dassel; älterer Name Kleine oder Niedere Schleuse im Gegensatz zur Großen, Oberen oder Vasmer Schleuse, die zu Maneckes Zeit schon lange eingegangen war; sie hatte am oberen Hasenburger Bach gelegen, wo jetzt ein schmaler Brückensteg aus der Lüneburger Schweiz nach dem Dorfe Hecklingen führt. Nach dem Testament des Heinrich Stern behielten Schwiegersohn und älteste Tochter des Testators vorm Rotentor belegene Schleuse 1677; Dorothee Margarethe Stern war die Ehefrau des Prof. Barthold Johann Vaßmars. Die Baurechnung von 1413 erwähnt eine größere Ausgabe für Eisenbänder und Nägel to der sluse vor deme roden dore, auch Zimmerleute und Arbeiter wurden bezahlt vor de erscrevenen slüse – schon an anderer Stelle ist ausgesprochen, daß es sich hier wohl um eine Schleuse im Stadtgraben handelt. Mittlere und Untere Schleuse werden wie folgt erwähnt: apiarium extra urbem penes mediam cataractam aquariam 1651 bzw. apiarium una cum pratis extra urbis portam quae dicitur rubra penes infimam apuarum cataractam 1652. Rotteschleuse (Manecke); Adreßbuch 1860 ff. Roteschleuse, 1869 zur Rotenschleuse. Rote Straße Kein Ratsbeschluß. Es ist die bis zum Anfang des Jahrhunderts wesentlich schmälere Straße, die aus dem Rotentore hinausführt. Sie heißt in den älteren Quellen, und noch auf Gebhardis Plan von 1794, vom Rathause aus gedacht, sinngemäß vor dem Rotentore. In der Nähe dieses Tores lag eine Badestube. Unsere Quellen ergeben, daß die Annahme, die Straße führe ihre Bezeichnung in Erinnerung an die Ursulanacht von all dem Blute, das dort geflossen sei, unhaltbar ist. Die rodestrate führt auf das rodedor und dieses auf das Rotefeld, d. h. die aus Wald oder Heide gerodete Ackerflur der Stadt (entsprechend die Rote Straße in Göttingen). Ante portam rubeam in arena 1288; area fabrice ante rufam valvam 1354; der Ratmann Houth verkaufte ein Haus cum stupa prope valvam civitatis que valva rubea nominatur situatas in cono 1361; in stupa et eius domo necnon in omnibus edificiis noviter circa eandem stupam edificatis ante rubeam valvam 1363; smede vor dem roden dore 1370; Hans von Ulsen de stover prope ruffam valvam 1426; in dem roden stoven 1431; domus balneatoris ante rubeam valvam 1448; Bäcker Hans Rolefstorp in dem winkele tor vordern hand der gassen de de geit van dem sande na dem roden dore 1451; ein ander Mal bezeichnet als Eckhaus jegen Gerd Hoyemars orde over boven dem sande; das stovenhusz daselbst 1454 mit Abfluß in den Stadtgraben; de staven vor deme roden dore zahlte 1 Schilling Wortzins 1497; in platea rubra diversorium vulgo das weisse pferdt genandt 1644. Vorn Rothen thor 1765; Rote Str. 1802; das Adreßbuch von 1860 gibt die Unterbezeichnungen vom Sande l. und vom Rotenwalle bis zum Sande l. Am Rotentore lag die im städtischen Eigentum befindliche Wohnung des Licentdieners (bis 1866). Die alte Wache am Rotentore, östl. der Straße, und das Torschreiberhaus diesem gegenüber wurden 1860 niedergerissen. Katholische Kirche 1855 bis Johannis 1857 (erster Gottesdienst), größtenteils durch Beiträge aus dem katholischen Deutschland; Einweihung durch den Bischof von Hildesheim erst Mai 1858; um diese Zeit erhielt der Turm 2 Glocken. (Neue
202
katholische Kirche s. Friedenstraße.) Haus des Stadtbaumeisters Maske auf dem Raume des ehem. Roten Walles (Rotestr. 11) 1868. Zu vgl. Ritterstraße. Rückertstraße Ratsbeschluß vom 18.5.1955. Nach dem Dichter und Übersetzer Friedrich Rückert (1788-1866) benannt. Ihm verdanken wir die Erschließung der orientalischen, vor allem persischen Dichtung des Mittelalters. Saatkamp Ratsbeschluß vom 29.8.1995. Die Straßenbezeichnung in Häcklingen beruht auf einem alten Flurnamen = Getreide- oder Kornfeld. Sachsenweg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Der Straßenname in Ochtmissen erinnert an eine der Ethnien, die in der Gegend von Lüneburg siedelten. Salzbrückerstraße Kein Ratsbeschluß. Es ist wohl die älteste Straße der Stadt, da sie den Kalkberg und die Pfarrkirche von St. Cyriak unmittelbar mit der Saline verband. Von der Salzbrücke, die der Straße ihren Namen gegeben hat, ist keine Spur mehr vorhanden. Man hat angenommen, daß diese Brücke einen Bach überspannte, der bei der Anlage der Stadtbefestigung abgeleitet sein soll, und könnte an die Gumma denken, die in der Wendischen Straße entsprang. Volger gibt in seinem Urkundenbuche ohne nähere Angabe der Quelle das Regest einer Urkunde von 1319, wonach das Lambertihospital Haus, Hof und Word neben der Badstube am Graben zum Geschenk erhält, und er bemerkt dazu: es floß sonst ein Bach vor der Sülze; daher die Sülzbrücke und die Sülzbrückerstraße, sowie die dortige Badstube der Straße den Namen Badstaven gegeben hat. Gleichwohl ist es möglich, daß der Ausdruck Brücke, brugge, als gebohlte, gepflasterte Straße zu fassen ist, sind doch bei Sielbauten Ausgang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts und wiederum bei Ausschachtungsarbeiten im Jahre 1907 1½ bzw. 1 m unter dem jetzigen Steinpflaster die Reste eines alten Bohlenweges aufgedeckt worden (Lün. Museumbl. Heft 5 Seite 94). Der Rat erwarb 1345 vom Benediktinermönch Jordan von Meding einen Teil seines Hofes de bi der sultebrugghen licht; Haus Grote von Wittorf apud pontem saline 1346; Badestube des Volkmar von der Weser iuxta sultebrughe 1353; das Kloster Ebstorf verkaufte 1355 Haus und Hof prope sultebrughe ex opp. stupae iuxta salinam und tauschte einen Hof dafür gegenüber dem Rektoratshause der Lambertikapelle; supra sultebrugghe 1358; prope saline stupam 1360; Gebhard vom Berge verkaufte ein Haus in vico iuxta pontem saline 1362; desgl. einen Hof (kein Burglehn) gegenüber dem Wittorfer Hofe bi der sultebruegge 1368; pl. qua itur de zultebrucghe ad s. Cyriacum 1368; die instiginge 1371 geschah achter der borgh, jegen der van Estorpe hove; drei Häuser von Geistlichen lagen rechter Hand cum itur ad sanctum 203
Cyriacum per plateam vulgariter sůltebrůgke nuncupatam 1376; die Provisoren vom Hl. Geist verkauften ein Haus circa pontem qui dicitur zultebrugghe 1376; in pl. qua itur de sultebrugghe ad salinam 1379; pl. nova directa inter pl. iudeorum et pontem saline 1389; Bürgermeister Hoyke verkaufte einem Hamburger Bürger eine Rente de balneo dicto vulgariter stupa et de domo curia et area eiusdem balnei iuxta quendam locum usitato nomine nuncupatum sultebrugge 1391; de domo balneorum vulg. dicta sultestoven 1392; neben dem Hofe des Ebstorfer Propstes die stuba des Bürgers Soltzenshusen 1403 (Soltsenshusen stove 1438 – man ist versucht, sie mit dem Sülzstaven zu identifizieren; dagegen spricht ein Hinweis von 1436, wonach fünf Buden eines Bürgers sich befanden uppe der stede dar wandages Solsenhusen stove plach to licgende); bi der sultebrugge 1405; 5 Eckbuden prope salinam gegenüber dem Wohnhause Repensteden nach Westen; pl. per quam itur a salina versus novam valvam 1448; benedden dem sultestoven lag eine Modekiste 1453; Haus neben dem Ebstorfer Propsteihause in huiusmodi pl. que primo ingreditur cum de salina directe itur versus novam valvam 1471; pl. stratorum saline vulg. de sultebrugger straten; in der sultebrugger straten 1525; daselbst der Hof des Klosters Ebstorf 1527; pl. pontis aut stratorum saline 1529; Brauhaus Schmedenstede zwischen Wohnhaus Zerstede und Lambertiküsterei iuxta pontem salinarem 1554; versus stubam sudatoriam salinarem (der Ausdruck deutet auf ein Schwitzbad) 1598; Haus und Hof balneum salinare dictum in pl. pontis salinaris ... prope angulum vandalicae plateae 1624; pl. vulgo indigitata die satzbrügger 1643; vereinzelt nach einem Anlieger Weidemanns strass 1652; Brauhaus der Agneta Pretzen, Wwe. des Maximilian Clement, nebst 15 Buden iegen der sültzbadstuben 1654; pl. vulgo die saltzbrückerstraße 1674; pl. (die Schulzbrückerstraten) vulgo dicta 1678 (mißverstanden). Soltbrüggerstraße 1794; Salbrügger Straße 1802; Salzbrüggerund Salzbrückerstraße 1819. Es scheint, daß der südliche Teil der Salzbrückerstraße zeitweise Kleine Sülz (oder Salz-)straße genannt wurde, analog der Kleinen Bäckerstraße. Der Bürger Semmelbecker kaufte 1502 ein Haus in parva pl. salinari qua itur ad stubam salinarem; der Bürger Snewerdingh 1508 ein Eckhaus in parva pl. salinari. An der südlichen Ecke der Salzbrückerstraße und Techt lag das im Jahre 1352 von Segeband von Wittorf auf seinem Wohnhofe in antiqua civitate gegründete Hospital zum Langen Hof, an dessen Mauer dem in der Ursulanacht gefallenen Ratmann van der Mölen ein Denkmal errichtet war; das Hospital ist aufgelöst zu Beginn des Achtzehnhunderts. Die Baurechnung von 1409 bucht eine Lohnausgabe von mehr als 85 M vor de stadtmüren by dem langen hove; Eckhaus Semmelbecker-Kröger ex opp. curie que vulg. dicitur de lange hof versus meridiem (prope murum nostre civ.) 1421; neven (jegen) dem langen have 1500; prope et iuxta longam curiam 1513. Im Jahre 1484, als die gewohnte Sülfmeisterkost ausfiel, umme vare unde angestes willen der groten pestilencien, de leyder do was, fand die Wahl der Barmeister in dem langen huse statt – ob hier der Lange Hof gemeint ist? Die mehrerwähnte Sülzbadestube wurde aus einem eigenen Sod gespeist, das ergibt folgender Vermerk des Ratsdenkelbuches: 1549 heft ein erbar radt, dewilen de sodt in dem sultestaven tho mererm dele vorgan und vordorven, also dat de stover dessulvigen waters wo bet anher geschen tho der gemeinen notroft ofte behof nicht kann geneten, up bithlich ansokent der sultelude und ock der andern bywanenden nabern so des stavens und badens gebruken vorgunstiget und nagegeven, dat de borne, so van dem schirborne buten dem nigen dare by des abts teilhave afgelecht 204
und durch Bockstekers torne by dem sultestaven in de stad lopt, in den staven tho leggende. Die Sülzbadestube sollte eine gemeine Badstube bleiben, so verfügte der Rat beim Wechsel eines Eigentümers 1624. In nächster Nähe der Sülzbrücke lag in ältester Zeit das Haus, in welchem die später im Rathause stattfindende Wahl des höchsten Salinbeamten, des Sodmeisters, vollzogen wurde. Eckhaus Upleggher prope pontem in vulgo dictum sultebrugghe iuxta domum in qua eligitur magister putei versus austrum 1399; ein Prövner des Hl. Geisthospitals verkaufte eine Rente ut dem huse, hove, wurd, dem lutteken huse und buden de darbi ligget und tohored, belegen bi der sultebrugge, dar me den sodmester inne plecht to kesende 1405; Hausverkauf iuxta domum in qua eligitur magister putei versus salinam 1410; namens der Erben des Ratmanns Joh. vame Lo wurde ein Haus verkauft bei der Sülzbadstube que quidem domus quondam dicebatur domus electionis ubi magister putei eligebatur 1484. Der Chronist Jürgen Hammenstede berichtet: das Churland, in welchem die Wahl des Sodmeisters stattfand, habe anfangs in der Sultzbrugger Strassen (1566 Brauhaus Lubbing) gelegen und zwar oberhalb der Sulzbadestube, schräg gegenüber dem ehemaligen Rathause (Brauhaus Kempe-Kroger) – sei doch die Stadt anfänglich gebaut worden zwischen Alter und Neuer Sülze und dem Kalkberge; nicht weit vom Tor hätten bei St. Michaelis die Fleischschrangen und auf den Vierorten das Gericht nebst Galgen und Rad gestanden. Das Haus Nr. 24 war bis 1911 das erste Pfarrhaus von St. Michaelis. Von der Salzbrückerstraße zweigten mehrere Höfe und schmale Verbindungsgänge ab: der Gödkengang (1794, später G ö t t g e n g a n g , 1860 bewohnt von einem Maurergesellen des Namens Göttgen), Neuerhof, 1802 (nie hof 1794), dessen von 1598 stammende Buden 1906 abgebrochen und in einigen Resten im Museum erhalten sind (Jahresberichte des Mus. von 1896/8 S. 117 f.), Tatergang seit 1911 aus dem Adreßbuche verschwunden; der Name hängt schwerlich mit den tateren, Tartaren, Zigeunern, zusammen, deren in den Kämmereirechnungen seit 1444 zwar des öfteren gedacht wird, sondern ist wie die Mehrzahl der übrigen Gänge auf einen Familiennamen zurückzuführen; so hatte bei Aufwerfung der Taterschanze, deren corps de garde 1651 abgebrochen wurde, ein Sülzer des Namens Tater 1645 den ersten Spatenstich gemacht. Anlage des Israelitischen Kirchhofes bei der ehemaligen Taterschanze 1823; Gebhardi nennt einen zweiten Tatergang in der Rackerstraße; endlich Hagemanns Hof 1794, 1802 Hamanns Hof. Salzstraße Kein Ratsbeschluß. In den mittelalterlichen Quellen gehen die Namen Salz- und Sülzstraße durcheinander. In cono platee qua itur ad salinam 1348 und 1353; ein Knappe v. Schwerin verkaufte 1358 einen Platz neben seinem Stalle und einem Wittorfer Hofe by der sultestrate; Querhaus in platea . salinari 1427; domuncula ... in platea vulgariter dicta de soltstrate 1437; in der soltstrate, platea saline 1438; jegen der Vlasborch [Flachsburg] in der soltstraten 1442; daselbst wohnte der Ratmann von Tzerstede 1446; Eckhaus mit zwei Buden in platea salinari 1446; Eckhaus super quatuor angulos vulgariter uppe den veer orden nuncupatos ... in platea salis versus s. Lambertum 1452; in pl. salis in opposito domus vulg. dicta de Vlassborg 1450; prope quatuor acies in platea salinari 1488 und 1493; domum prope curiam dni. 205
Salzstraße Nr. 26
prepositi in Ebbestorpe et domum dni. Hartwici Stoteroggen vulg. dictam Vlasborg in pl. salinari 1498; ex opposito nove saline in pl. salinari 1503; die Flachsburg mit Holzhof, Buden und Kellern in der kurzen Nebenstraße, die von der Salzstraße nach dem Ebstorfer Hof führte, ging 1526 in die Hände des Bürgermeisters Ludolf von Dassel über, habitatio quadam arx linea nuncupata cum curia lignaria et casis ac cellariis ... apud domum sive curiam prepositi monasterii in Ebstorp plateam salinarem versus; bei der Flachsburg ist natürlich ebensowenig wie bei der gerwerborch in Rostock an eine Befestigungsanlage zu denken. Salzstr. 17 mit schönem Hofflügel in Fachwerk von 1559 ist das Stammhaus der Familie von Laffert. In pl. salinari qua itur ad s. Lambertum 1608; in pl. salinari vulgo i n d e r p l a n c k e n 1629. Sültzstr. 1765; Soltstrate mit Beutlerherberge (Nr. 26) 1794; Salzstr. 1802. In den Adreßbüchern trägt die Salzstraße, die vom Lambertiplatz zur Neuen Sülze führt, den Zusatz am Vierorten oder an den Vierorten, zur Unterscheidung von der Salzstraße am Wasser. Das Haus Nr. 26 (Thöme) war bis in neuere Zeit die Herberge der Bäcker und Müller. 1862 erbaute der Maurermeister Warnecke ein neues Haus an der Salzstraße (Nr. 6); 1865 neues Haus an der Ecke der Salz- und Hl. Geiststraße. Zu vergl. An den Vierorten. Salzstraße am Wasser Kein Ratsbeschluß. Es ist die Kaistraße dem Kaufhause gegenüber, wo sich unter den gewaltigen Mauern des Viskulenhofes und anderer Salzspeicher ein Brennpunkt des Salzverkehrs entwickeln mußte. Bom ..., de dar hanget bi her Vischkulen torne upp dem water dar me mit den scheppen henne vart 1440; der Ratmann Hinrik u. der Bg. Clawes brodere Viskulen geheten verkaufen f. 600 M eine Rente von 30 M aus ihrem Wohnhause belegen an der Elmennow bij der stad muren vnd bome dar de schepe ut vnd in varen bynnen Luneborg 1450; Eckhaus Jürgen Ertborg bij dem watere 1451; eine bode by der soltstraten 1478; der Ratmann Konrad Lange kaufte von den Gläubigern des früher von den Visculen bewohnten Hauses ebendieses Haus in angulo nostre civitatis prope aquam 1485; Klaus und Ilsebe Viscule verkauften eine Rente aus ihrem huse, hove, wurd, soltrumen und allen anderen eren tobehoringen uppe der soltstraten by der Elmenouwe 1487; Wohnwesen des Clawes Viscule an der Elmenouwe twischen der Luner brugghe unde deme bome 1493. In platea salinari prope aquam wurde 1498 ein Haus des Ratmanns von Erpensen nebst sechs Salzräumen, receptaculis salis, verkauft; platea post forum gobiorum alias platea salis nuncupata 1523; Brauhaus Dithmers-Frese nebst Bude in platea salis prope aquas 1537; in pl. salinari ad aquarium 1632. Zu 1737 heißt es: die am Wasser hergehende Gasse vom Weisladerhause an bis an des olim Aumeisters Haus ... ist von viel hundert Jahren her zur Niederlage und Einschiffung des abzufahrenden Salzes, wie auch anderer ankommenden und wegzuschiffenden Viktualien und Waaren designiret und ... gebraucht worden, allermassen die Eichenschiffer und Haberführer daselbst ihre eigenen Stellen haben, da sie ihre Ladung einzunehmen befugt und gewohnt sind. Das Weiszladerhaus am Wasser an der Neuen Brücke wurde nach 1700 vom Weiszlader bewohnt. Salzstr. 1802. Nach dem Plan von 1802 hieß ein Winkel westlich vom Eingange in die Salzstr. am Wasser der B u l l e n o r t ; er läßt sich urkundlich bis in das Vierzehnhundert zurückverfolgen. Ort heißt Ecke. Gebhardi erläutert: Bullenort heißt Platz zwischen dem Witzendorfer Hause und Brauer Schulz Hause, und der dortige Winkel schietwinkel. Uppe dem bullenorde 1465; bi dem bullenort lagen Salzräume 1471, an 207
Zahl nach 1700 noch 31; platea vulg. de bullenorth nuncupata 1482; by Bullenorde, nicht uppe der soltstrate soll sommergossen Salz gemessen werden, das zu Lande versandt werden soll und by deme kope gekauft ist 1504; am Bullenorthe 1588; Eckbrauhaus Budeler-Bachmann zwischen Eckhaus Bock und repositoria salinaria [Salzbuden] iuxta aciem am bullenort vulgariter nuncupatam ex opposito pontis Lunaris 1608; in loco bullen 1618; Brauhaus Petersen-Meyer in acie plateae salinaris ad aquam quae vocatur der Bullenorth 1628; ein Haus beym Bullenohrt kaufte 1698 die Kämmerei, um es zur Tabaksfabrik einrichten zu lassen, diese aber wurde bald darauf von hannoverschen Juden an sich gebracht und an einen anderen Ort (s. Reitendedienerstraße) verlegt. Auf genannte Belegenheit weist die in den Adreßbüchern von 1860-1889 aufgeführte Benennung a m Z i e g e n o r t. Salzwedeler Straße Ratsbeschluß vom 25.8.1960. Der Straßenname erinnert an die in der benachbarten Altmark gelegene Hansestadt an Dumme und Jeetze, deren Burg im Besitz der Markgrafen der Nordmark und dann der Brandenburger die Straße Lüneburg-Magdeburg schützte. Über Elbe und Jeetze und über diese Straße gelangte Salz in die Stadt und weiter nach Osten. Sandwehe Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Mit dem Straßennamen in Häcklingen griff man auf eine überlieferte Flurbezeichnung zurück. St. Lambertiplatz Ratsbeschluß vom 28.10.1983. Die Platzbezeichnung erinnert an den Ort der 1860/61 abgebrochenen Kirche St. Lamberti, s. Bei der St. Lambertikirche. St.-Stephanus-Platz Ratsbeschluß vom 28.8.1975. Die als ökumenisches Zentrum errichtete Kirche des Erzmärtyrers St. Stephanus führte zu der Namensgebung des Platzes in Kaltenmoor. Sattlerstraße Ratsbeschluß vom 10.12.2001. Im Stadtteil Oedeme-Süd soll ein Viertel mit Bezeichnungen alter Handwerke als Straßennamen entstehen. Sattler fertigten nicht nur Reithilfen, sondern auch andere Lederarbeiten. Schanzenweg Kein Ratsbeschluß. Seit 1936, bis dahin vorübergehend Jahn Straße. Eine große Schanze erhob sich dort nach Angabe des Stadtbauamts bis 1800.
208
Schaperdrift Kein Ratsbeschluß. Mit der Eingemeindung nach Lüneburg 1974 wurde der Straßenname in Oedeme übernommen. Es handelt sich um eine alte Flurbezeichnung, die sowohl Weide als auch Herde des Schäfers meinen kann. Scharnhorststraße Kein Ratsbeschluß. Seit März 1936 für den im Volksmunde sog. Schwarzen Weg. General Scharnhorst, der Erneuerer des preußischen Kriegswesens, ist im hannoverschen Bordenau geboren am 12. November 1756, in Prag an seiner Verwundung bei GroschGörschen gestorben am 28. Juni 1813. Scheffelstraße Ratsbeschluß vom 24.4.1969. Die Straße im „Dichterviertel“ von Moorfeld ist nach dem Dichter Josef Victor von (geadelt 1876) Scheffel benannt (1826-1886). Der studierte Jurist widmete sich ab 1853 der Malerei und Poesie und hinterließ volkstümliche, humorige, auch gefühlvolle Romane, Gedichte und Schauspiele. Scherenschleiferstraße Kein Ratsbeschluß. Frühester Nachweis um 1720, als ein Wohnturm in der Stadtmauer by dem Bürgermeister Werder zu Ende der Schern-Schleiferstraßen erwähnt wird. Im Adreßbuche von 1938 noch aufgeführt, obschon sämtliche Wohnungen geschlossen sind. Ein Anhalt, ob ein Scherenschleifer oder mehrere seines Zeichens dort gewohnt haben, hat sich bisher nicht gefunden. Im Sandviertel unweit der Wandfärberei lag ein Haus, das von den Gebrüder Wilde im Jahre 1571 an den Ratmann Leonhard Elver verkauft wurde, und zwar inter gazophilatii et templ. s. Joh. habitationum domos in vico rosararum (statt rosarum?) alias in fornificulorum (sacrificulorum?) platea nominata. Diese Wohnungen des Kirchenkastens sind mutmaßlich am Ortsausgange der Papenstraße zu suchen und die platea fornificulorum wie der euphemistisch gemeinte vicus rosarum mit der Scherenschleiferstraße identisch. Schießgrabenstraße Kein Ratsbeschluß. Seit Beginn der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts, nachdem der Schießgrabenwall samt einer Erhöhung, der sog. hohen Batterie, in den 70er Jahren abgetragen war. Die Wohnhäuser der Straße liegen etwa an Stelle des ehemaligen westlichen Wallabhanges; zwischen Wall und Stadtgraben lag der Cratosche Garten. Schildsteinweg Kein Ratsbeschluß. 209
Nach seinem westlichen Abschluß so bezeichnet seit Mai 1925 (zu vgl. Am Kreideberg). Schillerstraße Kollegienbeschluß vom Januar 1907. Westlich der Wilhelm-Raabe-Schule. Benennung in Erinnerung an das SchillerGedächtnisjahr von 1905 (100. Todestag des Dichters Friedrich von Schiller, 17591805). So ist auch der zweite bedeutende Vertreter der deutschen Klassik im Roten Feld vertreten. Schlägertwiete Kein Ratsbeschluß. Twite ist eine schmale Gasse. Bei Schläger, sleger, möchten wir an die koppersleger denken, die nach freundlichem Hinweis einer Anwohnerin bis in die neuere Zeit zahlreich auf der oberen Grapengießerstraße wohnten und aus ihren Werkstätten auch die nahe Seitenstraße mit ihrem Klopfen und Hämmern erfüllten. Und wenn selbst in rauflustiger Vergangenheit sleger, Raufbolde, die entlegene Gasse gern als Schauplatz ihrer Kämpfe ausersehen haben sollten, so ist beileibe nicht daran zu denken, daß die Twite vorzugsweise von solchen Elementen bewohnt wurde oder gar noch bewohnt wird – es liegt also nicht der mindeste Anlaß vor, dem Wunsche der im übrigen höchst friedfertigen Anlieger nachzugeben und den durch die Jahrhunderte geschützten Straßentitel abzuschaffen. Iuxta plateam vulgariter dictam de slegerstrate 1409; sleghertwite 1431; in der strate de men nomet de slegerstwijten 1436; in vico dicto vulg. de sleghertwite 1447; in der slegeltwijten 1455; Haus des Clawes Balhorne zwischen Hermen Elers und Henningk Benhorne in der gropengheterstrate neffen der slegertwyten over 1482; uppe der slegertwyten orde by Alberde Adendorppe in der gropengheterstrate 1484; schlägertwite 1652; im schläger twiet 1765; Schlegers Twite mit Putensen Gang 1802 (Putensen Hof 1794); Schlägertwite 1819. Koppertwete zwischen Beckenwerker- und Weberstraße 1531 in Braunschweig, copperslegerstrate 1368 in Lübeck. Schlegelweg Ratsbeschluß vom 18.5.1955. Nach den Dichtern August Wilhelm (1767-1845) und Friedrich von Schlegel (17721829) benannt. Der ältere zeichnete sich auch als Literaturhistoriker, Übersetzer (Shakespeare) und Orientalist aus, der Jüngere als Kultur- und Kunstphilosoph sowie Literaturkritiker. Beide trugen wesentlich zur Verbreitung der Ideen der Romantik bei. Schlöbckeweg Kein Ratsbeschluß. Der Weg ohne direkte Anlieger zweigt vom Straßenzug Beim Benedikt/Am Springintgud nach Westen Richtung Kalkberg ab und erschließt den dortigen Kindergarten. Er ist nach dem Baurat Eduard Schlöbcke (1852-1936) benannt, der sich um den Erhalt des Kalkbergs als Naturdenkmal verdient gemacht hat. Aus seiner Feder stammt auch Der Kalkbergführer (1928). 210
Schmiedestraße Ratsbeschluß vom 10.12.2001. In Oedeme-Süd soll an alte Handwerksberufe erinnert werden. Die Schmiede waren in Grob- und Kleinschmiede unterteilt und als Messer- oder Nagelschmiede spezialisiert. Das Schmiedeamt gab es schon im 14. Jahrhundert. Schneidemühler Straße Ratsbeschluß vom 26.9.1974. Nach der Eingemeindung des OT Ebensberg 1974 wurde die dortige Elbinger Straße in Schneidemühler Straße umbenannt, um Verwechslungen mit der Elbinger Straße auf dem Kreideberg zu vermeiden. Schneidemühl wurde Ende des 14. Jh. gegründet, erhielt später Magdeburger Stadtrecht und gehörte bis 1772 zu Polen. Seit 1815 war es Preußen zugeschlagen und 1922-1945 Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirks in der Grenzmark Posen – Westpreußen bzw. Pommern. Seit 1945 gehört Piła (Wojwodschaft Poznań) wieder zu Polen. Schnellenberger Camp Ratsbeschluß vom 30.11.2000. Die Straßenbezeichnung greift die Feldflur des nahegelegenen Gutes Schnellenberg auf (s. Schnellenberger Weg). Schnellenberger Weg Kollegienbeschluß vom 23.9.1884. Benannt nach seinem Richtungsziele, dem von alters bis auf die Gegenwart im Besitz der Landmarschallfamilie v. Meding befindlichen Schnellenberger Hofe, der im Lehnregister von 1360 als Lüneburger Burglehn aufgeführt wird, dat borchlen up deme hus to Luneborch, dat is de hof to deme Snellenberge unde de mole ... Im Jahre 1384 gestand Wasmod v. Meding das Vorkaufsrecht auf den Snellenberch (in unsem hove to dem Snellenberghe) dem Lüneburger Rate zu, mit dem er auch 1386 van der vesten to dem Snellenberge ein freundschaftliches Abkommen traf; nach einem Vertrage von 1406 erhielt der Rat das Recht zur Anlage eines Grabens und Walles (erhöhten Weges) von Schnellenberg nach dem Schildsteine zu; die in mancher Beziehung interessante Belegstelle lautet: ok moghen se ... wan en dat bequeme is twe graven graven laten, dar en wal entwisschen sy, twier rode edder drier bred, uth dem olden borchgraven dar wandaghes dat slot Snellenberg uppe leghen hadde bette wedder to dem schildstene werd. Ein vorwerk to deme Snellenberghe wurde gebaut 1412. Bückmann leitet den Namen Schnellenberg vom Personennamen Snello ab, vielleicht einem Beinamen des Medingschen Ahnherrn, der das vorerwähnte alte Schloß erbaut hatte. Das Wort Snellenberg, hier vom Ort abzuleiten, kommt im Dreizehnhundert auch als Lüneburger Familienname vor. Auf der Höhe zwischen Schnellenberg und dem Schildstein lag ein von Lucas Lossius in seiner Dichtung auf Lüneburg als Tummelplatz freier Liebe erwähnter Wald, gen. M e i n e k e n h o p , 1360 Meynwerdes hop – hop (der Haufe) ist der Platz, wo sich etwas zusammen findet, auch sonst in Ortsnamen häufig. Abrechnung über 800 Faden Holz ud dem Meywers hope 1374. Im Januar 1639 kamen die v. 211
Meding mit den Vertretern des Rates dahin überein, daß dieser die ganze Holzung gegen eine Kaufsumme von 1000 Reichstalern in specie und 125 Dukaten innerhalb Jahresfrist ausroden durfte; bestimmend für solche Maßnahme war die ziemlich hohe, für einen Angriff auf die Stadt auszunutzende Lage des Holzes. Schnepfenwinkel Ratsbeschluß vom 29.5.1975. Der Straßenname in Wilschenbruch erinnert nicht nur an den selten gewordenen Zugvogel, sondern betont auch die Abgelegenheit am Rande des Tiergartens. Schomakerstraße Kein Ratsbeschluß. Die Lüneburger Patrizierfamilie Schomaker, nach welcher die Straße im Jahre 1903 ihren Namen erhalten hat, blühte vom Ausgang Zwölfhundert bis über die Mitte des Sechszehnhunderts hinaus. Fünf Bürgermeister, zahlreiche andere Ratmannen, Barund Sülfmeister sind aus ihr hervorgegangen; auch im geistlichen Stande zeichnete sie sich aus. Genannt seien nur der kunstsinnige Propst Nicolaus Schomaker in Lüne († 1506) und der Propst von St. Johannis, Dekan zu Bardewik, Jacob Schomaker († 1563), Verfasser der bekannten Lüneburger Chronik. Verlängerung der Straße am 16.6.1960. Schröderhof Ratsbeschluß vom 13.3.2000. Die Straßenbezeichnung im Bereich Osterwiese soll an das langjährige Mitglied im Ortsrat Rettmer, Lisa Schröder (1923-1992), erinnern. Schröderstraße Kein Ratsbeschluß. Ursprünglich der ganze Straßenzug von den Schrangen bis zum Markte, für den südlichen Abschnitt in siegreicher Konkurrenz mit der Bezeichnung beim Schrangen, während für die nördliche Hälfte die Neue Münze das Feld behielt. Daß sartores, Schröder oder Schrader, d. h. Schneider (v. schrÔten, schrâden, zerkleinern, in Stücke schneiden) jene Gegend bewohnten, ergibt sich aus den Belegstellen. Nach einer Nachricht von 1352 veräußerte der sartor Werner von Pattensen sein Haus in platea carnificum. In platea sartorum iuxta macellum 1420; Eckhaus Rolevestorp iuxta monetariam in pl. sartorum 1441; die Ehefrau des Heinr. Hesse, sartoris, verkaufte ein Haus inter ... et monetarium ... in platea sartorum 1445; dem Schröder Hans Hesse erlaubte der Rat 1465 dat he mochte maken laten eyn slagfenster an deme husze in der scroderstrate, dat Helmeke Wrydell de knakenhouwer plach to bewonende, unde dytsulve slagh scall nicht breder weszen den elenbreth; pl. sartorum prope macella 1454; Eckhaus des Schneiders Molre in pl. sartorum 1478. Als 1486 an einem Sode auf der Münze gebaut wird, bezahlt die Hälfte Hesse de scroder; in der schroderstrate by den schrangen 1487; neffen des rades munte over in der Scroderstrate 1488; in platea sartorum ex adverso macelli 1524; Haus Steinkamp-Meier nebst vier Buden zwischen dem Rm. Töbing und Georg Grote in platea sartorum in acie qua declinatur ad vicum scriptorum 1538; Brauhaus in acie e regione macelli in pl. sartorum 1555; Haus v. Ilten-Brömse inter domum monetalem 212
et stateram nostre civitatis in platea sartorum 1569; in pl. sartorum vulgo der schröter strassen 1636; schröderstrasse 1652; schrödtergasse 1654; in acie plateae schroderanae 1658; in pl. sartorum fabricae monetariae proximam 1665. Nach 1700 war die Münze in der Schröderstrassen für 60 M jährlich vermietet. Der Plan von 1765 bezeichnet die beiden Hälften der Straße beim Schrancken bzw. auf der Neun Müntze; 1794 beim Schrangen mit Schneiderherberge (Nr. 1); 1802 Scharn- oder Schröder Str. Das Haus Nr. 1 (Stehr) war um 1860 Herberge für die Reepschläger und Schornsteinfeger. Zu vgl. Rosenstraße. Schützenstraße Kein Ratsbeschluß. Übernommen aus dem 1943 eingemeindeten Ortsteil Hagen. Die Bezeichnung betont die Bedeutung des Schützenwesens in Lüneburg und Umgebung. Schulstraße Kein Ratsbeschluß. Übernommen aus dem 1943 eingemeindeten Ortsteil Hagen. Schweidnitzer Straße Ratsbeschluß vom 26.9.1974/17.12.1981. Im OT Ebensberg erfolgte die Straßenbenennung gewöhnlich mit Ortsnamen aus den ehemaligen Ostgebieten Deutschlands. Schweidnitz war die Hauptstadt des gleichnamigen Kreises am Eulengebirge in Niederschlesien und im 14. Jh. Zentrum des Herzogtums Schlesien-Jauer. 1742 gelangte die Stadt an Preußen, war von 1747-1867 Festung. Seit 1945 gehört Swidnica zu Polen (Wojwodschaft Wrocław). Mit der Eingemeindung Ebensbergs erhielt die vorherige Kolberger Straße den neuen Namen, um Verwechslungen mit der gleichnamigen Straße auf dem Kreideberg zu vermeiden. Scunthorpeplatz Ratsbeschluß vom 29.8.1996. Um die langjährige Partnerschaft mit der englischen Stadt in der Nähe von York zu würdigen, erhielt der ehemalige Kaiser-Wilhelm-Platz seinen neuen Namen. Scunthorpe hat inzwischen seine kommunale Selbständigkeit verloren, was der Partnerschaft abträglich ist. Siemensstraße Ratsbeschluß vom 18.5.1955. Straßenbezeichnung zur Erinnerung an die Industriellenfamilie (von 1888) Siemens, der auf dem Gebiet der Elektrotechnik bedeutende Entwicklungen verdankt werden.
213
Soltauer Allee Kein Ratsbeschluß. Die Allee ist die Fortführung der Soltauer Straße in Richtung Rettmer und wurde nach Eingemeindung des Dorfes übernommen. Soltauer Straße Kein Ratsbeschluß. Seit 1908 heißt die Straße nach dem Fernziel Ihrer Richtung. Das im städtischen Eigentum befindliche Wohnhaus des Obertotengräbers hieß, seit Erbauung (1887) bis zum genannten Jahre, C e n t r a l - F r i e d h o f N r. 1. Sonnenhang Ratsbeschluß vom 28.8.1975/18.12.1981. Die Straße war zuvor auch ein Teil der Straße „Am Bäckfeld“. Die Umbenennung in „Sonnenhang“ erfolgte 18.12.1981, um ein besseres Auffinden der Straße zu ermöglichen. Der Name sollte wohl auch die bevorzugte Lage betonen. Sonnenzeile Kein Ratsbeschluß. Mit Bekanntmachung vom 4.4.1944 erhielt die vom Lünerweg hinter der Eisenbahnkreuzung nach Osten abzweigende Sackgasse diese Bezeichnung. Sonninstraße Ratsbeschluß vom 1.2.1950. Ernst Georg Sonnin (1713-1794), einer der fähigsten Architekten seiner Zeit, war Lüneburger Stadtbaumeister von 1760 bis 1783. Sophia-von-Bodendike-Platz Ratsbeschluß vom 21.3.1985. Im Zeichen der Erneuerung klösterlichen Lebens begann unter der Priorin (14811504) Sophia von Bodendike im Kloster Lüne die Herstellung von gestickten Teppichen aus Leinen und Wolle. Sie werden heute in einem eigens dafür gebauten Museum mit Restaurierungswerkstatt gezeigt. Spangenbergstraße Kollegienbeschluß vom 8.10.1901. Gleich der Gellers Straße eine Verbindung der Dahlenburger und Bleckeder Landstraße, unweit des durch einen Denkstein gekennzeichneten Feldes, wo die beiden Leidensgenossen Gellers und Spangenberg ihren Kampfesmut und treue Pflichterfüllung mit dem Tode besiegeln mußten. Franz Spangenberg, ein Sohn des im Jahre 1770 aus Duderstadt eingewanderten gleichnamigen Peruquiers, hatte das Bürgerrecht 1800 gewonnen und war wie sein Vater Amtsmeister der Perückenmacher. Zu vgl. Gellers Straße.
214
Auferstehungsteppich aus dem Kloster Lüne, rechte untere Ecke mit der Nennung der Priorin Sophia von Bodendike
pechtsweg Kein Ratsbeschluß. Am 4.4.1944 umbenannt aus Im Moor. Diese alte Flurbezeichnung war 1925 als Straßenname eingeführt worden. Der neue Name im Wilschenbrucher Vogelquartier erinnert an die Familie von Vögeln, deren Mitglieder Schwarz- und Buntspecht auch hier heimisch sind. Speckmannweg Kein Ratsbeschluß. Dietrich Speckmann, Heidedichter und Pastor, geboren 1872 zu Hermannsburg, gestorben 1928 in Fischerhude bei Bremen. Diese Straße führte bis zum 15.5.1942 die Bezeichnung Bei den Eigenheimen nach der im Jahre 1919 gegründeten Gemeinnützigen Eigenheim-Genossenschaft. Sperberweg Kein Ratsbeschluß. Straßenbezeichnung vom 4.4.1944 im Wilschenbrucher Vogelquartier. Sperber sind in Europa weit verbreitete kleine Taggreifvögel. Spillbrunnenweg Ratsbeschluß vom 30.5.1963. Zu den ältesten Wasserleitungen Lüneburgs gehört der Spillbrunnen, der im Jahre 1495 angelegt wurde. Der heutige Spillbrunnenweg hat den Namen von seiner Lage an dem Orte, wo sich der Spillbrunnen in einem Teiche vom Schierbrunnen (s. das.) abzweigte. Spitzer Ort Ratsbeschluß vom 30.5.1953. Die Straßenbezeichnung erklärt sich aus der Beschaffenheit der dortigen Lokalität. Stadtkoppel Ratsbeschluß vom 29.8.1991. Die Straßenbezeichnung greift einen an dieser Stelle überlieferten Flurnamen auf. Stehrstraße Ratsbeschluß vom 18.5.1955. Die Straße wurde nach dem schlesischen Schriftsteller Hermann Stehr (1864-1940) benannt, der in der Tradition der Mystik seiner Heimat schrieb. Steinweg Kein Ratsbeschluß. Mit der Eingemeindung Oedemes nach Lüneburg im Jahr 1974 wurde der Straßenname übernommen. Er erinnert wohl an einen älteren Pflasterweg.
216
Stellmacherstraße Ratsbeschluß vom 10.12.2001. In Oedeme-Süd entstand ein Quartier mit Straßennamen, die auf traditionellen Handwerken beruhen. Stellmacher oder Wagner fertigten früher Transportmittel vor allem für den landwirtschaftlichen Bereich, aber auch Kutschen und Wagen für den Warentransport. Stendaler Straße Ratsbeschluß vom 25.11.1966. Die Stadt in Sachsen-Anhalt ist Sitz des gleichnamigen Kreises. Die Burg- und Marktsiedlung erhielt 1251 Stadtrecht und gehörte später zur Hanse. Der Roland vor dem Rathaus symbolisiert das Marktrecht. In Stendal ist der Altertumsforscher Johann Joachim Winckelmann geboren, dem dort heute ein Museum gewidmet ist. Sternkamp Kein Ratsbeschluß Unter Aufnahme einer alten, leicht verständlichen Flurbezeichnung eingeführt 1935. Stettiner Straße Ratsbeschluß vom 25.8.1960. Die Straße ist nach der ehemaligen Hauptstadt der Provinz Pommern und des gleichnamigen Regierungsbezirkes benannt. Die pomeranische Siedlung an der Mündung der Oder ins Stettiner Haff hatte 1243 Magdeburger Stadtrecht erhalten und wurde noch im 13. Jh. Mitglied der Hanse. 1648 kam Stettin an Schweden und wurde 1720 endgültig preußisch. 1945 wurde Stettin polnisch – Szczecin und Hauptstadt der gleichnamigen Wojwodschaft. Stöteroggestraße Kein Ratsbeschluß. Seit 1928. Die Sülfmeisterfamilie von Stöterogge, in Lüneburg ansässig seit 1317, hat der Stadt zahlreiche Bürgermeister, Ratsherren, Sodmeister, Barmeister, Obersegger geschenkt; sie starb 1760 in männlicher Linie aus. Zu den ansehnlichen Grabdenkmälern der Stadt gehören die für Bürgermeister Hartwich († 1537) und dessen Sohn, Bürgermeister Nikolaus von Stöterogge († 1560) an den westlichen Pfeilern des Mittelschiffs von St. Johannis. Verlängerung der Stöteroggestraße am 25.8.1960. Stralsunder Straße Ratsbeschluß vom 25.8.1960. Benannt nach der 1209 gegründeten und seit 1278 der Hanse angehörenden Stadt am Strelasund. 1648 fiel sie mit Vorpommern an Schweden, 1814 an Dänemark und ein Jahr später an Preußen. Trotz Zerstörung im 2. Weltkrieg ist die Stadt immer noch reich an Bauten der Backsteingotik.
217
Streitmoor Ratsbeschluß vom 23.3.1972. Die Straße im Industriegebiet Vrestorfer Heide ist nach einer alten Flurbezeichnung benannt. Stresemannstraße Ratsbeschluß vom 29.1.1976. Mit der Bezeichnung soll die Erinnerung an Gustav Stresemann (1878-1929), den Gründer der Deutschen Volkspartei, Reichsaußenminister und Reichskanzler, wachgehalten werden. Er leitete die Sanierung der Reichsfinanzen und die Verständigung mit Frankreich ein und führte Deutschland in den Völkerbund. 1926 erhielt er zusammen mit Aristide Briand den Friedensnobelpreis. Sülfmeisterstraße Ratsbeschluß vom 29.11.1984. Die Straßennamen im Neubaugebiet der ehemaligen Saline sollten die historische Bedeutung des Geländes würdigen. Die Haupterschließung wurde nach der Bezeichnung für Inhaber von Siederechten benannt. Sültenweg Kein Ratsbeschluß. Seit 1928 nach altüblicher volkstümlicher Bezeichnung für den zur Saline führenden Weg. Sülztorstraße Kein Ratsbeschluß. Die Deutung des Namens ergibt sich von selbst; unsere Quellen nehmen von den verschiedensten Gesichtspunkten aus auf das Tor Bezug. Nach Gebhardis Collectanea Bd. X stand das Sülztor, schon 1190 erwähnt, mit einem Graben davor 1321, da, wo (1786) die Anatomie sich erhob. Eine Anatomie-Kammer war 1753 im Inneren des Tores eingerichtet – dieses wurde 1800 abgebrochen. Im Jahre 1871 fiel auch die Brücke am Sülztore, der Platz wurde 1873 geebnet und als Begrenzung des Sülzhofes ein etwa 200 Fuß langes eisernes Gitter auf hoher steinerner Unterlage angelegt. Zu Anfang des 1700 wohnten auf dem Sülztore der Stadt Artillerie Lieutenant und ein Constabel, im Tore Torwärter, Zollaufseher, Torschließer, ferner in einer alten Corps de Garde ein Stadtsoldat und in zwei kleinen Wohnungen arme Witwen, die das Tor sauberzuhalten hatten. Haus Langheside-Hoyemann in angulo plateae ante valvam salinae 1347; area que wolgo dicitur en wort, que sita est inter valvam saline et inter valvam rufam 1350; Häuser des Hl. Geisthospitals extra valvam saline 1356; ante valvam saline 1360; domus secunda a valva saline versus occidentem 1372; Eckhaus van Hagen-Lese prope valvam saline versus occidentem 1379; buten dem sultedore uppe yennehalve dem hoghen cruce by des hilghen geystes lande, van dem wege an bet an dat teygelhus 1397 – dieses Ziegelhaus war, wie wir aus anderen Quellen schließen dürfen, zur Förderung des Johanniskirchenbaues angelegt; steinernes Eckhaus prope s. Lambertum trans ampnem [jenseits des Sods? Büttner übersetzt einmal 218
sultbeke] ante valvam saline ad sinistram manum cum exitur de civitate 1411; die Bauherren buchen 1415 eine Ausgabe to deme vrowenhuseken vor deme sultedore; Eckhaus Munter ex opposito valve saline trans ampnem saline 1417; Ausgaben der Kämmerei to dem buwe des sultedores 1444f.; ein servitor putei saline wohnte apud muros civitatis ante valvam saline 1451; ante portam salinarem 1530; ad portam salinarem 1651; gegen den Sülztorwall 1850. In den älteren Adreßbüchern finden sich nebeneinander die Bezeichnungen am Sülztore, vor dem Sülztore (d. h. außerhalb) und Sülztorstraße (letztere seit 1909 März 26 ausschließlich in Gebrauch für die Strecke bis zur Einmündung der Lindenstraße; von da ab südlich Uelzener Straße). Sülzwallstraße Kein Ratsbeschluß. Es ist das Gäßchen, das von der ehemaligen ersten Predigerwohnung von St. Michaelis die Richtung auf den Sülzwall nimmt; die Bezeichnung ist 1850 nachzuweisen. Der Plan von 1802 überliefert eine ältere Benennung, nämlich h i nt e r d e m s t r u n k. 1765 achter strunk, wobei wohl an einen auffallenden abgestorbenen Baumstamm zu denken ist. Die Sülzwallstraße mündet westlich auf diejenige Stelle der einstigen Stadtbefestigung, wo 1371 die feindlichen Scharen in die Stadt eindrangen und der Ratmann Nicolaus Garlop getötet wurde. Auf das Denkmal, das ihm an der Stelle, wo er gefallen war, gesetzt wurde, deutet eine Notiz der Baurechnung von 1426 ... kostede de torne to dekken unde de erkenere wedder to maken de steyt jegen dem langen hove dar der Garlopen cruse by steit. Der hier erwähnte Turm hieß Fredeke, wie Schomaker Mitte des Fünfzehnhunderts zu berichten weiß: stegen in die stadt in einen hof; die horde den erbarn van Estorpe, belegen bi der muren an dem torne geheten Fredeken. Der Name ist wohl als Diminutivform von vrede = Sicherheit, Schutz, aufzufassen, vielleicht vom Namen Vrederik abzuleiten. Sülzwiese Kollegienbeschluß vom Mai 1925. Alter Flurname für den Grund zwischen Kalkberg und Saline. Nach Gebhardi war die Sülzwiese durchschnitten von zwei Bächen Sülzbeke und Hingstbeke, gen Süden aber abgesondert durch ein stehendes Wasser oder die Gumme. Tangerwiese Eine zum Hospital Nicolaihof gehörige Forstwärterwohnung an der Landwehr bei Vögelsen hinter dem Dorfe Ochtmissen dicht an der Landwehre; dabei ein Bienenzaun und der Vögelser Fischteich. Der Name ist verdorben aus Tangken Wisch, d. h. der Wiese Tammekes (ein Tammeke von Groningen wurde 1296 Bürger). Der Kaland erwarb 1435 aus dieser Wiese eine Rente vom Bürger Hennecke Heryers – ute siner wisch genomed de Tanghenwisch, binnen der landwere to Luneborg bij dem dorpe Voghelsen belegen; Tangerwisck 1580. Die Tanger Wiese ging 1758 aus dem Besitz des Rates in die Hände des Geheimrats von Schwicheldt über als Entgelt für den Verdener Hof. Tannenweg 219
Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Wegen Namensgleichheit wurde der Ochtmisser Birkenweg nach der Eingemeindung des Ortes nach Lüneburg am 26.2.1974 in Tannenweg umbenannt. Dieser Name wurde 1981 offiziell übernommen. Teichwiesenweg Ratsbeschluß vom 27.1.1977. Der Straßenname in Oedeme basiert auf einer alten Flurbezeichnung. Gemeint sind hier die Teiche bei Gut Schnellenberg am Rande des Hasenburger Baches. Teigelhus Ratsbeschluß vom 27.8.1981. Bei dem Straßennamen handelt es sich um eine alte Flurbezeichnung der Gemarkung Ochtmissen im Bereich des Lerchenberges. Sie bedeutet „Ziegelhaus“. Teilfeld Ratsbeschluß vom 27.8.1981. Bei dem Straßennamen handelt es sich um eine alte Flurbezeichnung der Gemarkung Ochtmissen im Bereich des Lerchenberges. Theodor-Haubach-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Dr. Theodor Haubach (1896-1945), seit seiner Jugend mit Carlo Mierendorff befreundet und Mitglied der SPD seit 1922, war ab 1933 zweiter Vorsitzender des „Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold-Bund Deutscher Kriegsteilnehmer und Republikaner“. Er selbst hatte als Kriegsfreiwilliger am 1. Weltkrieg teilgenommen und war hoch dekoriert worden. In den 30er Jahren war Haubach mehrfach in KZs inhaftiert. Ab 1941 vertrat er im Kreisauer Kreis Arbeiterinteressen. Nach dem mißlungenen Attentat vom 20.7.1944 wurde er verhaftet, zum Tode verurteilt und am 21.1.1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Theodor-Heuss-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Dr. Theodor Heuss (1884-1963) schloß sich schon als Student dem Kreis um Friedrich Naumann an und war 1905-1912 Chefredakteur der „Hilfe“. Kurzzeitig wirkte er als Geschäftsführer des „Deutschen Werkbundes“ in Berlin, bevor er 1920 als Dozent an die neugegründete Hochschule für Politik berufen wurde (bis 1933). 1924-28 und 1930-33 war Heuss Reichstagsabgeordneter der Deutschen Demokratischen Partei. Ab 1933 kaltgestellt gab er zeitweise wieder die „Hilfe“ heraus und war schriftstellerisch/publizistisch (FAZ) tätig. 1945 wurde Heuss Kultminister von Württemberg-Baden und gehörte 1946 zu den Gründern der FDP. 1947 wurde er zum Professor für Neuere Geschichte und Politische Wissenschaften an der TH Stuttgart berufen und gehörte bis 1949 dem württembergischen Landtag
220
an. 1949-1959 war Theodor Heuss der erste Präsident der Bundesrepublik Deutschland. Theodor-Marwitz-Straße Ratsbeschluß vom 25.9.1997. Die Straße im Industriegebiet Hafen ist benannt nach dem Kaufmann und Tuchmacher Theodor Marwitz (1871-1945), der sein Unternehmen im Jahre 1919 von Ratzebug nach Lüneburg verlegte. Theodor-Storm-Straße Ratsbeschluß vom 21.2.1951. Die Straße wurde nach dem Juristen und Dichter (1817-1888) benannt. In seiner Lyrik stand Storm unter dem Einfluß von Claudius, Eichendorff und Mörike, doch wurde sein eigentliches Feld seit 1847 die Novelle, die stark von seiner nordfriesischen Heimat getönt war und in ihren späteren Ausformungen schon auf den Impressionismus verweist. Thorner Straße Ratsbeschluß vom 25.8.1960. Im Jahre 1956 hatte die Stadt Lüneburg die Patenschaft für die Heimatvertriebenen aus Thorn übernommen. Thorn ist eine Gründung des Deutschen Ordens und seit 1232 mit dem Stadtrecht von Kulm begabt. Die Stadt an der Weichsel war im 14. Jahrhundert Mitglied der Hanse und florierte durch den Weichselhandel. 1454 sagte sich Thorn vom Deutschen Orden los und schloß sich dem König von Polen an. Nach dem Übergang an Preußen (1793, 1815) wurde die Stadt zur Festung ausgebaut. Ab 1919 gehörte Thorn/Toruń zur polnischen Wojwodschaft Bromberg und war bis 1939 auch deren Hauptstadt. Tilsiter Straße Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Tilsit an der Memel entstand um eine Anfang des 15. Jahrhunderts erbaute Ordensburg in Ostpreußen und erhielt 1552 Stadtrecht. 1945 kam die Stadt als Teil des Oblast Kaliningrad unter sowjetische Verwaltung (Sowjetsk). Tobakskamp Kein Ratsbeschluß. Flurname im Zeltberggelände, als Straßenbezeichnung verwandt seit 1938. Töbingstraße Kein Ratsbeschluß. Seit 1903 statt Erste und Fünfte Straße zu Ehren der verdienten Patrizierfamilie v. Töbing. Die Töbings sind 1369 aus Töpingen im Kirchspiel Munster in Lüneburg eingewandert und haben vier Jahrhunderte hindurch an den Geschicken der Stadt wesentlichen Anteil genommen. Fünfzehn Bürgermeister sind ihr entsprossen, zahlreiche Ratsherren, Sodmeister und Barmeister; auch im auswärtigen Staats- und 221
Kriegsdienste hat das ausgezeichnete Geschlecht sich bewährt; weibliche Mitglieder des Hauses finden wir in großer Menge in den Landesklöstern, wiederholt in leitender Stellung. Töpferstraße Ratsbeschluß vom 10.12.2001. In Oedeme-Süd entstand ein Quartier mit alten Handwerksberufen: Töpfer gibt es in Lüneburg seit etwa 600 Jahren. Triftweg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Der Straßenname basiert auf einer Bezeichnung für Grasweide, besonders für Schafe, die gleichzeitig einen Weg zum Viehtrieb meint. Tüner Berg Kein Ratsbeschluß. Die Straßenbezeichnung in Neu-Oedeme wurde mit der Eingemeindung des Ortes nach Lüneburg im Jahre 1974 übernommen. Sie basiert auf einen Flurnamen. Uelzener Straße Kollegienbeschluß vom 2.12.1902. Als gradlinige Hannoversche Landstraße statt des alten gewundenen, über Vasmers Schleuse führenden Celler Postweges erst 1786 angelegt. Vorher ging nach Volger in südlicher Richtung der Hauptverkehr über Hasenburg. Der jetzige Straßenname wurde nach Errichtung der Wohnungen des Beamtenvereins verliehen. Zu vgl. Sülztorstraße. Uhlandstraße Ratsbeschluß vom 10.11.1954. Nach dem Germanisten, Dichter und Politiker Ludwig Uhland (1787-1862) benannt. Als Mittelpunkt der Schwäbischen Schule wurde er vor allem durch seine Balladendichtung bekannt. Er setzte sich nicht nur für Beschäftigung mit altdeutscher Sprache und Dichtung ein, sondern als Mitglied der württembergischen Ständekammer, des Landtags und der Frankfurter Nationalversammlung auch für das „gute alte Recht“ des Volkes. Ulmenweg Ratsbeschluß vom 24.4.1969. Ulmen oder Rüster sind in Deutschland verbreitete Bäume und Sträucher, deren Bestand heute durch die von einem Pilz verursachte Ulmenkrankheit bedroht ist. Rüster hat auch als Möbelholz Bedeutung. Unter der Burg Kollegienbeschluß v. 1.1.1910. 222
Mit dieser Benennung einer im Vororte Grimm zunächst dem Kalkberge angelegten Straße ist eine der ältesten Lüneburger Ortsbezeichnungen wieder in Aufnahme gekommen. Unter der Burg lag das älteste Benediktstift (s. oben beim Benedikt), während das auf halber Höhe des Kalkberges gelegene Benediktinerkloster nach seiner Örtlichkeit in castro Luneborch 1324, sinngemäß auch oppe deme hus, uppe deme huse to Luneborgh 1333, 45, up der borch to Luneborch 1352 bezeichnet wird. Ein i. J. 1333 an das Kloster verkaufter Erbhof des Knappen Huner van der Oedeme heißt under dher borch by dheme buhöve; ein Hof des Knappen Heinrich von Meding, gleichfalls vom Kloster angekauft, in Sterteshaghen sub castro Luneborch extra civitatem 1335; Sterteshagen („stert“ = Schwanz, Ende, „hagen“ = Gehege) hieß im ausgehenden Mittelalter auch der Stumpfebiel in Göttingen. Sub castro befand sich auch eine, zur Hälfte dem Abte, zur Hälfte dem Klosterkonvente gehörige curia caulium oder der heren garthof. Von den Burgmannenhöfen lag wohl nur derjenige derer von dem Berge im Mauergürtel der Lüneburg; eben dieser Hof, bewohnt vom Knappen Gebhard vom Berge, wurde 1354 an das Michaeliskloster veräußert; er stieß unmittelbar an die Abtskurie und heißt in castro Luneborch prope valvam abbatis oder coniuncta contigua et vicina curie abbatis; ein Hof der Gemahlin des Ritters Segebant vom Berge lag vor der borch 1352; ante idem castrum hatte auch die herzogliche Schule ihren Platz, die 1353 dem Kloster geschenkt wurde. Zu vergl. beim Benedikt und im Grimm. Untere Ohlingerstraße s. Obere Ohlingerstraße. Untere Schrangenstraße s. Obere Schrangenstraße. Van-der-Mölen-Straße Kein Ratsbeschluß. Seit 1927. Das Sülfmeistergeschlecht van der Mölen, in männlicher Linie erloschen 1577, schon im Zwölfhundert im Rat nachweisbar, trug seinen Namen von der Ratsmühle. Der Ratsherr Gebhard van der M. fiel in der Ursulanacht, Bürgermeister Albert van der M. hatte wesentlichen Anteil am glücklichen Ausgang des Prälatenkrieges. Vickenteich Kein Ratsbeschluß. Ein kleines Gehöft mit unlängst zugeworfenem Fischteich bei Ochtmissen im Ludmerfelde (Volger). Vikko, Vikke ist die Schmeichelform des Personennamens Vrederik; ein Bürger Vicke kommt schon 1294 vor, im Dreizehnhundert ist der Familienname Vicken (Vickonis) ausgebildet. Älteste nachweisbare Lesart Fikkendiek (Siebzehnhundert). Die noch übliche Flurbezeichnung Luttmer, im Ludmerfelde, auf der Luttmer geht auf die Lutmunde zurück, einen Wald, der sich vom Mönchsgarten nach Ochtmissen hin erstreckte. Bückmann erkennt auch in diesem Ortsnamen einen (langobardischen) Personennamen: Lusimundus. Iuxta silvam Lutmunde, usque ad Lutmunde 1345; ute dem lande ... dat lecht boven der Ludmere 1402; boven der Ludmere 1409; die vom Berge verkauften dem 223
Ansicht des 1959 abgebrannten Viskulenhofs von Nordosten
Michaeliskloster dat holt dat dar het de Luthmen mit synem ackere 1426; Vickendeich bis 1894, dann Vickenteich. Virchowstraße Ratsbeschluß vom 24.5.1956. Nach dem Pathologen, Vorgeschichtsforscher, Anthropologen und Ethnologen Rudolf Virchow (1821-1902) benannt. Virchow spielte eine gewichtige Rolle als Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses, Mitbegründer der Fortschrittspartei und Gegner Bismarcks im sog. Verfassungskonflikt. Viskulenhof Kein Ratsbeschluß. Das durch den Sülfmeister Julius Wolfs weithin bekannt gewordene ansehnliche Wohnwesen an der Ilmenau gegenüber dem Kaufhause gehörte der im Jahre 1554 (bzw. 1570) ausgestorbenen Patrizierfamilie Viskule, die ihren Namen offenbar der Belegenheit eben dieses Stammsitzes an einer Fischkule zu danken hatte. In quinque zoltrum situatis prope curiam Johannis Visculen 1369; retro valvam domini Hinrici Visculen 1437; retro curiam Hinr. Visculen 1442; bij der muren retro Viskulen 1449; gegenüber dem Lüner Klosterhause werden drei Salzräume cum laquearibus et lobiis retro Myrs erwähnt 1471; prope murum civitatis post portam valvalem Hinrici Visculen 1481. Im Konkursverfahren gelangte der Besitz 1485 an den Ratmann Cord Lange, domus quam olim de Visculen inhabitabant in angulo nostre civ. prope aquam; Eckhaus v. Dassel-Kuns neben dem Schiffergildehaus (domus nautarum) retro curiam quondam domini Nicolai Vischulen in platea divitum 1503; Fischkulen Hof 1802 (südlich davon zeigt der Plan den B a c h r a t z e n H o f). Ab 1929 zeitweise Eigentum des Museumsvereins für das Fürstentum Lüneburg wurde der Viskulenhof am 27.1.1960 das letzte Opfer des Lüneburger „Feuerteufels“ Herbert Rademacher. Vögelser Straße Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Der Straßenname gibt das Ziel an. Volgershall Ratsbeschluß vom 26.9.1985. Die ursprünglich volkstümliche Bezeichnung wurde für die Stichstraße zur Fachhochschule NON übernommen. Sie erinnert an eine ab 1867 tätige Schürfgesellschaft unter Leitung von Dr. Otto Volger aus Frankfurt a. M., Sohn des Lüneburger Schulmannes und Geschichtsschreibers Dr. Wilhelm Friedrich Volger. Volgerstraße Kein Ratsbeschluß. Seit 1879 zum Gedächtnis des am 6. März gen. J. verstorbenen Wilhelm Friedrich Volger, geb. in Neetze am 31. März 1794. V. ist 52 Jahre als Lehrer des Johanneums tätig gewesen, 37 Jahre als Rektor der Realklassen und des Realgymnasiums; nebenher ordnete er die Stadtbibliothek und einen Teil der 225
Originalurkunden des Stadtarchivs. Er wirkte als Worthalter der Bürgervorsteher, als Mitbegründer des Naturwissenschaftlichen und des Altertumsvereins und gab dem geistigen Leben der Stadt reiche Anregung durch seine geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Aufsätze und Veröffentlichungen. Als Greis von 75 Jahren begann er mit der Herausgabe des Lüneburger Urkundenbuches, von dem es ihm vergönnt war, drei Bände zum Abschluß zu bringen. Weit bekannt sind Volgers geographische Leitfäden. Sein Sohn Otto, Mineraloge und Geologe, geb. in Lüneburg 1822, † in Sulzbach am Taunus 1897, gründete 1859 das Freie Deutsche Hochstift zu Frankfurt a. M. Von-Dassel-Straße Ratsbeschluß v. 25.8.1954. Im Jahre 1852 starb mit dem Justizbürgermeister Johann von Dassel das letzte Lüneburger Patriziergeschlecht aus. Lediglich in einem in Lüneburg nicht ansässigen Zweige blüht die Familie noch heute. Von-Döring-Weg Ratsbeschluß v. 25.8.1954. Das Patriziergeschlecht von Döring ist in Lüneburg seit 1374 nachweisbar und erlosch hier im Jahre 1780. Von-Kleist-Straße Ratsbeschluß v. 10.11.1954. Benannt nach dem Dichter Heinrich von Kleist (1777 bis 1811), dessen Theaterstücke und Novellen zu den großartigsten Schöpfungen der deutschen Sprache gehören und die Grenzen der zeitgenössischen Dichtung hinter sich lassen. Vor dem Bardowicker Tore Kein Ratsbeschluß. Einige dem Wortlaute, nicht dem Sinne nach hierhergehörige Quellenstellen, die sich auf das Innere der Stadt, die Bardewikerstraße, beziehen, sind bereits wiedergegeben. Unter dem Stichworte Am Bardowickertore werden in den Adreßbüchern bis 1866 zwei im städtischen Eigentume befindliche Häuser aufgeführt, die ehemaligen Torschreiberwohnungen, deren östliche der Lizentdiener innehatte; zwischen beiden die Wache. Im Tore selber wohnten nach 1700 der Torwärter, der Aufseher auf die ein- und ausgehenden Zollwaren, der Torschließer; auf dem Tore ein Constabel und zwei alte Witwen, die das Tor fegen und sauberhalten mußten. V o r dem Tore hieß ehemals außerhalb, extra, buten. Gelegentlich eines Einbruchsdiebstahls i. J. 1274 wird das Bardewikertor zuerst erwähnt claves portae civitatis que ducit Bardewic; 1321 pro fossa fodienda extra valvam Bard.; 1328 ad fossam ante valvam Bard. – nach letzterer Stelle muß der Graben das Tor von allen Seiten umschlossen haben; 1408 twe stucke landes ... wente vor den Bardewikeren wech; das Bardewiker dor wird durch Anker verstärkt 1411; eine Bude vor dem Bard.tore gebaut dar man de schepel inne kempet, also ein Eichamt, 1421, noch im 1700 bewohnt von dem Kämper oder Vergleicher der Salzund Kornscheffel. Hesse in der singulen vor dem Bardewikeren dore 1426; vor deme Bardewikeren dore lagen 5 dem Rate gehörige Mühlsteine 1466; in sunte Nicolai 226
backhusze vore deme Bardewikeren dare wohnte der Bäcker Hans Ossingk, es wird auch bezeichnet in der Bardewiker strate in sunte Nicolai huse 1470. Eine Kegelbahn vor dem Tore, hier wohl außerhalb desselben, wurde vom Bauamte unterhalten: de bosebane to beslengede unde to thünende 1442; de bosselbane vor dem Bardewiker tore 1457. Die Kämmereirechnung von 1445 berichtet von einem Schützenwall vor dem Bard.tore; außerhalb des Tores, etwa auf dem Lindenberge, befand sich auch der Schützenplatz, auf welchem nach dem Papagei geschossen wurde. In dem schutenhove vor dem Bardewyker dore wurden schon 1428 Bauten ausgeführt; zum selben Jahre erwähnt die Kämmerei-Rechnung auch papeghoyen schuten; de nige lade to dem papegoienbom 1486; dat gardenbleck by dem pappeghogenbome buten dem Bardewiker dore 1513. Ob hiermit die nach Manecke einst vorhandene, in Urkunden nicht nachzuweisende Sebastianikapelle in Zusammenhang zu bringen ist? Gärten by deme Lindenberge 1451. Die sancte Antonius capelle buten dem Bard.dare wurde erneuert 1585; extra portam Bardovicensem e regione coemiterii ad d. Antonii 1648; der Antonifriedhof (1802 saint Anton) hieß auch der Bardowiecker Kirchhof. Ein Wildgraben mit Wärterhaus vor dem Bard.tore verursachte alljährlich Ausgaben für Hafer und Heu; dat hus uppe dem graven dar dat wilt ynne licht 1463; an dem gange vor dem Bardewikeren dore uppe dem walle dar dat wilt uppe loppet 1480. Peter in dem Bardewikertore erhielt 1530 von den Kämmerern 4 M vor de böme vor dem Bardewiker dore und by dem Lindenberghe up und to to schlutende. Fürn Bardowiecker Thor bey der Schnarbünde 1629 – „Schnar“ wohl verschrieben statt „schmar“, nach Bückmann = Schmier, Fett, während bünde, bünte ein eingehegtes Feld bezeichnet. Vor dem Bardowickertore hießen im Achtzehnhundert alle Häuser im Norden außerhalb der Stadt. Erst 1884 erhielten auf Anregung des Bürgervorsteherkollegiums die Gartenstraße und die Straße am Kreideberge ihre Sonderbezeichnung, der Rest der Wohnungen vor dem Bardowickertore behielt die letztere Benennung. Das Bardewiker Tor, 1438 in einem Neubau erstanden, ist abgebrochen 1817. Zu vergl. Gartenstraße. Vor dem Neuen Tore Kollegienbeschluß vom 23. September 1884. Nach Zerstörung der Burg auf dem Kalkberge erfolgte seitens der Stadt die Anlage eines neuen Tores als Ersatz für das wohl schon im Jahre 1365 zum Abbruch verurteilte Lindenberger Tor (zu vgl.) und Grimmer Tor. Erwähnt wird das neue Tor zuerst 1385: das steinerne Eckhaus eines Bürgers lag ex opposito nove valve prope desertam aream in veteri nostra civitate; iuxta valvam civitatis dictam vulgo nyedor 1393; der Bürger Wittorp verkaufte ein Haus iuxta valvam nostre civ. dictam vulgo nye dor in sinistro angulo dum ab eadem nostra civ. ad dictam portam ascenditur 1393; das Bauamt zahlte 63 M vor de stadmuren by deme nygen dore 1410; Mester Berteld empfing uppe dem nygen dore eine Dörntze 1416; der Rat verkaufte dem Rm. Cruse einen umzäunten Hof uppe deme orde to der vorderen hand wan men ute dem niendore ghan will bynnen unser stad 1420; prope novam valvam 1424; 1425 wurde ein Turm gebaut de steyt by des rades kalkhuse buten dem nyen dore; die Groten überlassen dem Michaeliskloster ene blek unde ene gardenstede buten dem nyen dore an dem anberge vor den garden to der luchteren hand alseme ute dem vorscreven dore gheid 1427; circa novam valvam 1435; Wohnhaus v. Meding vor deme nygen dore 1436; Haus des Bürgers Kornehagen zwischen Töbings Buden und dem Gildehause der Marienbrüderschaft ante novam valvam; an dem niggen 227
dore by sunte Ciriacus wurde gebaut, als der große Wind Dach und Blei abgeweht hatte 1467; ante novam portam lag die custodia s. Cyriaci 1562; der Rat protestiert gegen etliche ausgesetzte Fenster an einer Klosterwohnung vor dem Nienthor zwischen dem orthuse und s. Benedicti Hof und der capellen daselbst recht neben der stadt thurm und mauren über, nicht weit von des Klosters Thorwege beim Spring ins gut 1597. Wie die Mehrzahl der vorstehenden Belegstellen betrifft auch die Bezeichnung vor dem neuen Tore auf dem Plane von 1765 die nachherige Neuentorstraße, denn das vor ist vom Rathause aus gedacht, also im Innern des Tores. Über eine wesentliche Verstärkung der Toranlage berichtet Schomaker zu 1533, dat lange gewolfte, de nye dar ok de wal daraver went an den hogen torne, item de torne vor demsulvigen dare im graven wort betengt und in 2 iaren vollenbracht, über den Abbruch dieses Tores die Bauamtsrechnung von 1651. Der Plan von 1802 läßt an der Straße das neue Tor neben einer Bauschreiberwohnung die Wache und Torschreiberwohnung, außerdem eine alte Wache erkennen. Die drei ältesten Adreßbücher unterscheiden am Neuen Thore mit der Wohnung des Lizentdieners und vor dem Neuen Thore mit den zum Kalkberge (in der kalkkuhle) gehörigen Gebäuden. Der Name vor dem Neuen Tore in seinem gegenwärtigen Sinne ist neueren Datums, nämlich vom 23. September 1884, als die städtischen Kollegien beschlossen, der Straße beim Kalkberge und den Gebäuden längs der Landstraße nach Reppenstedt diese Bezeichnung beizulegen. Zu vgl. Görgesstraße. Über ein Siechenhaus vor dem Neuentore verlautet folgende Notiz der Baurechnung von 1434: vor mursteyns und dacksteyns de sint gekommen to dem sekenhuse buten dem nyen dore, item vor dat sekenhus to murende vor deme nyen dore. Außerhalb des Neuentores linker Hand (jetzt das westliche Eckgrundstück an der Jägerstraße), lag das Abtsziegelhaus, angelegt wohl erst gelegentlich der Erbauung des Michaeliskirchtumes im Vierzehnhundert. Erste Erwähnung 1441, als die vom Berge dem Abte zwei Äcker verkaufen dede beleghen synd vor L. bynnen den thünen dar desulve her nu ter tiyd syn teygelhus hefft; vier Stücke Land hat der Knappe v. Berge geerbt belegen in deme Grymme to der vorderen hant vor deme nygen dare alze men utgheyt ute der stad L. 1468; extra urbis huius moenia circa primum viae publicae pagulum ante portam novam versus laterariam suburbanam 1646. By dem teygelhave up dem Jüttkenmoor unterhielten die Klosterherren einen Finkenherd, der 1594 als auf gemeiner Weide befindlich niedergerissen wurde. Wohnhaus des Gärtners Wrede sen. vor dem Neuentore 1865. Der Wirt Meyer vor dem Neuentore (ehemals Cohrs Garten) hatte 1863 sein Haus durch Anbau eines östlichen Flügels vergrößert, Herbst 1865 Saal an der Ostseite. Vor dem Roten Tore Kein Ratsbeschluß. Iuxta valvam rubeam (statt rubram, aber gewiß nicht als Brombeertor zu versehen) 1289; Zins vom Waghenmor extra rufam valvam fällt an die Kämmerei 1291; Gärten daselbst 1302; extra valvam que dicitur rodendor 1325; extra rubeam valvam 1333; prope valvam civitatis que valva rubea nominatur 1361; Heyne Hoyeman erhielt 1364 vom Rate die Erlaubnis, en ziil unde en waterwegh dor der stad muren under deme roden dore anzulegen; Herzog Wilhelm entläßt 1367 vier Koten buten dem roden dore linker Hand aus seinem Hofdienste; er entsagt 1368 zugunsten des Rates allem Zins, Hofdienst usw. an Haus, Hof und Wurd de dar ligghen bi der Elmenowe buten 228
deme roden dore; extra valvam rubeam nahmen die Ratsherren den Leichnam Herzog Albrechts in Empfang, um den Sarkophag auf ihren Schultern nach der Grabkirche von St. Michaelis zu tragen (1385); herzoglicher Gartenzins buten deme roden dore by der Elmenow 1391; von einem neuen Pram wird gesagt de horet to der hude buten dem rohten dore 1392; im folgenden Jahre verkaufte der Rat zwei Bürgern den acker belegen van dem utersten orde des Mumpeleres kampes bette an Clawes Semmelbeckers ... gardentor buten dem roden dore vor unser stadt vortan bette an den rechten strom der Elmenow, mit grase, watere, rechticheit ... yodoch also, dat an demsulven ackere en wech blive van Clawes Semmelbecker dore an to rekende wente an de knechtewisch, und de wech schal wesen bret 14 mannes vote alse van des burmesters tune bette up den acker. Das Bauamt bezog 18 s. van dem prame und hude buten dem roden dore 1411; Schleuse vor dem roden dore, Zimmerer und Arbeitsleute erhielten seitens der Bauherrn ihren Lohn vor de erscrevene sluse unde dat vrowenhuseken to makende unde den graven dar entwischen to suverende 1413. Das vor dem Tore deutet an letztangeführter Stelle dem sonstigen Brauch entsprechend wohl auf das Innere der Stadt, die Schleuse mag eine Leitung der Abwässer in den Stadtgraben ermöglicht haben; desgl. ist eine vom Stadtbauamte 1423 mit einem Zaun versehene Holzhude vor dem roden dore innerhalb des Tores, nämlich nördlich der jetzigen Kalandstraße, zu suchen. Eine Wohnbude wird erwähnt, vor dem Rodentore by der stadtmuren tor vorderen hand wanne men uthe deme Roten dore ghan will 1484, Garten und Haus vor dem Rotentoer ihn twithen 1585. Buten deme roden dore lag zwischen einer Wiese und dem Wendeborn ein Garten mit Fischteich 1423. Der südliche Stadtgraben scheint gemeint zu sein 1437, item lete wy den pram ute dem water bringen, de lach by dem bokesberge, den lete wy bringen wente in den nyen graven; ein Zeughaus überm Rotentor 1602 erwähnt; 1632 heißt es ante portam rubram apud fossam civitatis. Im Rotentore wohnten der Aufseher, zugleich Hutmacher (gegen 1720), ein Aufwärter und der Torschließer, über dem Rotentor ein Zeugschmied und in einer alten Corps de Guarde ein Tagelöhner. Gebhardi nennt als Unterbezeichnungen Algier (in Göttingen Klein Paris) und die Kammmachertwite, auf Halvenslebens Badeanstalt zuführend. Volgers handschriftliche Chronik enthält eine Planskizze der 1868 erfolgten Veränderung der Weg- und Straßenführung am ehem. Leppienschen Grundstücke am Rotentore. Aus der generellen Bezeichnung vor dem Rotentore sind in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts allmählich die neu entstandenen Straßen ausgeschieden; noch 1902 umfaßte sie auch die nördliche Hälfte des Rotenbleicherund einen Teil des Wilschenbrucherweges. In den Adreßbüchern von 1875-1877 ist die zusammenfassende Benennung des damals entstehenden neuen Stadtviertels vor dem Rotentore (Barckhausen-, Linden-, Volger-, Feldstraße) i m R o t e n f e l d e ; zugrunde liegt die alte Flurbezeichnung. Zwischen dem Roten und dem Sülztore zeigt der Plan von 1802 östlich der Reepschlägerbahn den Roten Kirchhof, dessen letzte Überbleibsel 1952 beseitigt sind. Die Kirchhofskapelle war der Hl. Gertrud, der Bekämpferin böser Mächte, geweiht. Gelegentlich einer Verstärkung der Stadtbefestigung mußte sie ihren Erstlingsplatz räumen und wurde unweit davon wieder aufgebaut 1444/47. Hundert Jahre später (1553) wurde sie niedergerissen, angeblich unter Schonung der Sakristei, an deren Stelle um 1830 das bis 1953 stehende Fachwerkhäuschen 229
errichtet wurde. Gemeinhin diente der Kirchhof bis 1811 für die Bestattung von Nichtbürgern (Kunstdenkmäler 176f) Capella b. Gertrudis extra rubeam valvam 1358; by sunte Gertrude umme de kamp na dem rosengarden ließen die Bauherren 1446f. einen Graben ziehen; to sunte Gertrude vor dem roden dore beerdigte man nach der Schomaker-Chronik die im Prälatenkriege auf dem Marktplatze enthaupteten beiden Anführer der gegen den alten Rat gerichteten Aufstandsbewegung; montags wurden zu St. Gertrud Almosen ausgeteilt 1451; van des Kampfes wegene to sunte Gertruden (1455) bezog der Propst von St. Johannis eine Rente. Garnisons- oder Rote Kirchhof 1765; Roter Kirchhof 1802. Eine Schänke beim Gertrudenkirchhofe wird 1652 erwähnt, restionis tabernam extra portam urbis quae dicitur rubra penes coemiterium divae Gertrudis. Vor dem Weißen Berge Ratsbeschluß vom 30.11.2000. Für die Straßenbenennung im Bereich Mittelfeld/Oedeme wurde ein überlieferter Flurnamen übernommen. Vor der Heide Ratsbeschluß vom 30.11.2000. Die von der Straße Vor dem Weißen Berge abzweigende Verbindung erhielt ihren Namen ebenfalls von einem Flurnamen. Heideflächen sind dort allerdings nicht mehr zu sehen. Vor der Sülze Wie sich bei der außerordentlichen Bedeutung der Saline im wirtschaftlichen Leben Lüneburgs leicht versteht, ist ihre Belegenheit zum Ausgangspunkte zahlreicher topographischer Bezeichnungen geworden, deren eine ganze Reihe sich im vielmaschigen Netz der heutigen Straßennamen erhalten hat. Den ummauerten inneren Bereich der Sülze umfaßt die schon oben aufgeführte Benennung auf der Saline. Außerhalb des Salinhofes befinden wir uns, wenn es heißt an, nahe, hinter, bei, weit von, oberhalb, gegenüber der Saline oder ähnlich. Gern geben die Quellen einen erläuternden, begrenzenden Hinweis auf ein Brodhaus, das Lambertiküsterhaus, eine Solquelle (Brunnen?), den sog. hilgenborn, die Stadtmauer, das Pfannengießhaus (Bare), die Zollbude. Bei dieser Zollbude, in welcher der herzogliche Salzzoll als Warenzoll erhoben wurde, ist zu berücksichtigen, daß sie gelegentlich des Turmbaues von St. Lamberti von ihrem ursprünglichen Platze, wohl dem Hauptausgange der Sülze genau gegenüber, verlegt werden mußte, um an anderer Stelle, nämlich an der Ostseite der Kirche, in massivem Bau neu aufgeführt zu werden; der Herzog erinnerte an diese noch unerfüllte Zusage des Rates mit den Worten gii wolden uns ene stenen tolnbode weder buwen 1398. Herzog Wilhelm hatte sich auffallenderweise 1365 verpflichtet, in der tollenboede edder anderes woer binnen Luneborgh keinen Wein oder fremdes Bier laufen noch Wand schneiden zu lassen. Platea ante domum panis edificata est aput salinam 1274; ein Pelzer bewachte die Stadt apud antiquam salinam 1277; in domo panis apud sultam 1287; iuxta salinam 1353; prope domum que dicitur borenhus iuxta salinam 1358; prope salinam 1358; circa salinam ... versus murum civitatis 1365; prope sal. iuxta fontem qui dicitur 230
hilgheborne 1374; bi der zulten 1374; Eckhaus beleghen jeghen dem hilgen borne bi sunte Lamberte 1405; Eckhaus Malstorp-Segger neben dem Wohnhause des Ratmanns von Empsen versus occidentem ex opp. fontis vulgariter dicti hilgenborne 1406; boven dem Hilgenborne 1409; boven dem Hilghenborne bynnen L. 1418; supra fontem qui vulg. dicitur de hilgenborne 1419; achter der sulten wurde eine Schlammkiste ausgebracht 1411; baven der sulten wurden Turm und Mauern niedergebrochen und wieder aufgebaut 1412; Eckhaus Tzerstede-Rethem gegenüber dem Ratmann Duckel non longe a salina 1428; steenborne 1431; boven dem stenborne bij der sulten 1451; bij der stadmuren bij der zulten, ex opp. case theolonaris prope salinam 1464; Bude circa boram 1464; Haus oder Bude apud fontem lapideum circa salinam infra custodie s. Lamberti et Hans Bruns domos 1465; Eckhaus Engelbrecht-Brodermann in opposito fontis lapidei 1469; prope salinam wohnte der Küster von St. Lamberti 1478; ex opp. case salinaris 1497; Bude zwischen einer Bude des Rm.s Dorinck und dem früheren Wohnhause des Rm.s Vischule ex opposito saline prope domum vulgariter de bare nuncupatam 1499; Haus Bundeman-Bokel ad altos gradus ... ex adverso saline 1514; Schmiede in acie post eccl. s. Lamberti apud torrentem salinarem [dem Sod] 1530; Brauhaus Niendorp inter custodiam s. Lamberti capelle et domum que vocatur thom hohen trede ante salinam 1555; Brauhaus Nicolai prope salinam inter ipsius Nicolai adiacens aedificium olim custodia sacrorum nuncupatum und Hilmers Wohnhaus 1596. Hier seien eingeschoben auch die Bezeichnungen in loco indigitato h i n t e r d e r b a h r 1620; retro salinae fontem in loco hinter der bahre vulgo nominato 1646; non procul a salina retro domum bahra, ante salinam retro baram 1660. Der Plan von 1765 kennt die Bezeichnung vor der Sülze nicht, nennt aber die südwestliche Seite des Lambertiplatzes bey der Sültze; vor der Sülze im gegenwärtigen Sinne (1942!) zuerst 1802, wo auch schon der nach Westen hin abzweigende S c h e l l e r s – g a n g genannt wird – der Familienname Scheller begegnet unter den Krameramtsgenossen seit 1733; die Schoßrolle von 1850 hat zur Bezeichnung vor der Sülze die beiden Zusätze gegen St. Lambertikirche und am Himmelreich – hier wohnten ein Fuhrmann und ein Sülzer. Zu vgl. Auf der Saline. Buden der Eigentümer (Grelle) Bruns, Westede und Elebeke lagen 1479 in platea vulg. nuncupata u p p e d e m e r o d e n w o l d e , eine Bude der Gertrudenkapelle 1529 super rubea silva, vulg. up dem rodenwolde apud salinam; in vicu vulgo im rodewolt achter der bahr nuncupato heißt es 1610. Die Belegenheit nahe der Sülze ist danach verbürgt, ohne daß eine schriftliche oder mündliche Überlieferung oder die Deutung des Namens auf dem gerodeten Walde (?) (? oder im Zusammenhang mit dem Familiennamen Rodewold?) uns näheren Aufschluß zu geben vermöchte. Zeitweise ist die Straße Vor der Sülze ausgegangen. 1961 wurde das letzte Gebäude abgebrochen, die Gaststätte „Tante Erna“, Herberge für Maurer. Seit 1991 prägen ein Hotel und ein Alten- und Pflegeheim die Straße. Vor Mönchsgarten Kein Ratsbeschluß. Durch Beschluß vom Magistrat und Bürgervorsteher von 1884 für die Matthiesschen Häuser vom Neuen Kirchhofe nach Mönchsgarten, s. Mönchsgarten.
231
Das Geburtshaus des Komponisten Johann Abraham Peter Schulz (1747-1800) steht in der Waagestraße Nr. 1
Vrestorfer Weg Kein Ratsbeschluß. Weg von der Artlenburger Landstraße nach dem Gute Vrestorf. Straßenbezeichnung durch Bekanntmachung vom 4.4.1944. Waagestraße Kein Ratsbeschluß. Die alte Stadtwaage, die der Straße ihren Namen gegeben hat, lag mit einer zugehörigen Dienstwohnung an der Südostecke des Rathauses. Die Straße, die von dort an der Südseite des Rathauses entlangführt, konnte durch Ketten gesperrt werden und ist in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts um etwa ein Viertel verbreitert. Wir hören von der Waage zuerst 1367, als der Rat einer gewissen Edelke van der Heyde domum que vulgariter nominatur to der waghe mit allem Zubehör auf Lebenszeit überließ. Gelegentlich einer Verpfändung heißt es 1375 der stad waghe to Luneborgh myd dem dat darto hoord ... unde ok dat hus dat Hermen to der waghe had hadde; dieses Haus wird 1410 bezeichnet by dem seygertorne allernegest belegen, es ist wohl auch gemeint, wenn gesagt wird prope gradus quibus ascenditur ad domum panniscidarum 1374/1384, denn die Gewandschneider hatten ihre Stände im Erd- und Mittelgeschoß unter dem Fürstensaale, inmitten der Rathausfront; up der wage wohnte 1426 Hinrik Schermbeke. Im Siebzehnhundert befand sich über der Ratswaage eine Wohnung für den Schreibmeister im Marktviertel. Als Waagestraße ist auch anzusprechen platea per quam directe ascenditur a pl. pistorum ad novam salinam; dort lag neben der Schreiberei des Rates nach Westen hin das Haus des Bürgers Snewerding 1418. Gestützt auf diese Quelle sucht Gebhardi die sogleich zu erwähnende Schreiberstraße in der Apotheken- und Katzenstraße. Im Jahre 1430 bucht die Baurechnung eine Ausgabe für Pflasterung, 6 M 4 s. kostede de waghestrate to brüghende, de ene syde de dem rade böret to makende; in der wagestrate hatte ein Diener des Rates gewohnt 1433; einem anderen überweist der Rat dat hus bij des radhuses darwege alse men na unser leven vrowen gheit in der wagestraten 1452; Haus des Ratmannes vame Ripe circa domum monete in acie platee waghestrate vulg. nuncupate prope novum forum 1466; Eckhaus v. Saldern-Bardewik prope parvam pl. de wagenstrate vulg. nuncup. et domum monetariam 1480. Aus festlichem Anlaß hing uth dem radhuse uppe dem orde boven der wagen eine Pechpfanne 1487; wagestrasz 1652; der Plan von 1802 trägt die Waage unrichtig an der Südost- statt an der Nordostecke der Straße ein. Nach der Belegstelle von 1433 hatte ein Ratsschreiber sein Wohnwesen an der Waagestraße dem Rat geräumt und dafür den Anspruch erhalten auf de olde scriverie zwischen Snewerdingh und Kumhar, die ganz in der Nähe gelegen haben muß, hatte es doch hundert Jahre später den Anschein, als ob der Name Waagestraße durch den neueren Schreiberstraße verdrängt werden sollte. Actum in domo notariatus Luneburgensis 1427; Schriverstrate 1517; Haus Töbing-Roeth zwischen Bürgermeister Töbings Erbe et veterem nostram cancellariam in platea scriptorum 1524. Zimmer- und Mauerleute mußten sich beim Ausbruch eines Schadenfeuers ilich, so fro sick sodane ruchte irhevet, uppe dat market vor de wage begeben 1525; die Kämmerer verkauften das ehemalige Physikatshaus zwischen des Ratmanns Töbing Bude sive posticam et veterem cancellariam nostram in platea scriptorum 1525; ferner ihr Haus videlicet veterem nostram cancellariam zwischen 233
dem Presbyter Duderstad und dem Bürger Rodt in platea scriptorum 1527; Haus Schomaker in der Beckerstraten up der schriverstraten orde, die südliche Häuserreihe am Markte ist hier in der Schreiberstraße einbegriffen; Haus SteinkampMeier-Baventen und 4 Buden in platea sartorum in acie qua declinatur ad vicum scriptorum 1538, 1539 und 1556. Weiterhin kommt die Schreiberstraße nicht mehr vor. Haus Düsterhop-v. Dassel in foro ad aciem pl. librae publicae 1634. An der Wagestrassen Ecke wird nach 1700 das Syndikat-Haus erwähnt, itzo vermietet. Neue Wohnung des Färbers König in der Wagestraße 1865. Wacholderweg Ratsbeschluß vom 3.4.1947. Umbenannt aus Landrat-Albrecht-Straße in dem 1943 eingemeindeten Ortsteil Hagen. Am 11.9.1946 erfolgte eine Straßenneubenennung nach dem gleichen Landrat Albrecht (s. Seite 151). Namengebend ist der Charakterbaum der Lüneburger Heide. Waldweg Kein Ratsbeschluß. Der Straßenname wurde mit dem OT Ebensberg 1974 übernommen. Die Straße grenzt an die Neue Forst. Wallstraße Kein Ratsbeschluß. Entstanden nach Abtragung des Roten Walles nach 1866. Ende März 1866 standen 12 Häuser unter Dach, auf dem Sülzwalle, d. h. Wallstr.; gegen Ende des Jahres waren an der Nordseite 8 Häuser vollständig eingerichtet und bewohnt, das neunte unter Dach, an der Südseite 5 Häuser bewohnt, 2 unter Dach. Ende 1867 waren 17 Häuser fast vollständig bewohnt; ein Platz südlich der katholischen Kirche war ummauert; 1867/68 katholisches Schulhaus; 1868 wurde das 18. Haus gebaut, außerdem das Haus des Dr. Sprengel (Nr. 3); 1868 Nov. Anfang des Baues der Herberge zur Heimat; die Herberge eröffnet 1869 Aug. 22. Zum Jahre 1873 berichtet Volger: Das größte Gebäude an der Wallstraße stand zu Anfang des Jahres in Mauern, allein es blieb nicht das größte, denn im März begann der Bau des zwei Stockwerk hohen Hauses mit 12 Fach Fenstern, welches im Laufe des Jahres ausgebaut wurde (Nr. 53 u. 53 a). Heute ist das größte Gebäude der Straße die Zweigstelle der Bundesbank. Walter-Bötcher-Straße Ratsbeschluß vom 29.8.1991. Dr. jur. Walter Bötcher (1898-1981) hat 17 Jahre seines Lebens in den Dienst der Stadt gestellt. Er war von Oktober 1946 bis Mai 1955 Stadtkämmerer und anschließend bis Oktober 1963 Oberstadtdirektor und hat in dieser Zeit wesentlich zum Wiederaufbau Lüneburgs nach dem Krieg beigetragen. So wie William Watt, Bürgermeister von Thomasville in Georgia/USA Ehrenbürger von Lüneburg war, wurde W. Bötcher Ehrenbürger in Thomasville. Das wohl eindrucksvollste Ereignis in seiner Amtszeit war die 1000-Jahr-Feier 1956. 234
Wandfärberstraße Kein Ratsbeschluß. Want ist gleichbedeutend mit Tuchstoff (beiderwant ein Stoff aus Leinen und Wolle). Jürgen Hammenstede in seiner Chronik zum Jahre 1569: Die Wandschneider kaufen dem Rate einen ort van Hilgendal ab to behof der varwerie, so darsulvest gelegt. Eine Tuchfärberei an unserer Straße ist im Jahre 1571 nachweisbar, de wantververie. Eine in der Wandfärberstraße wohnende alte Lüneburger Wollweberfamilie des Namens Bernebrok lieferte jener Zeit alljährlich wand für die gekleideten Knechte des Rates. Die Administratoren von Heiligental verkauften 1607 ein Haus retro eiusdem monasterii coemiterium ... in tinctoria platea tinctorum 1613; 1642 wohnte der Bg. Jürgen Behre bei der Färberey; 1675 veräußerte der Ratmann Lente einem Färber aedes suas tinctorias in platea tinctoria inter domos ad vallem sacram spectantes; am Orte der Färbereystrasse, dem Heringsstegel gegenüber, das Grundstück des Kfm.‘s M. L. Petersen, vormals Heinr. Lühr 1828. Das ehemalige Kornhaus der Propstei, namals des Amtes Medingen, auf dem Plan von 1802 als Zollhaus bezeichnet, bewohnte um 1800 der Zollgegenschreiber. Das benachbarte Oldenstädter Klosterhaus, gleichfalls an der Wandfärberstr., gelangte nach der Reformation an den Landesherrn, später an den Magistrat, der es mit Bürgerpflicht wieder veräußerte. Die Kornböden dieses Klosterhauses wurden 1757 von den Franzosen zur Aufbewahrung von Heu benutzt. Wandrahmstraße Kein Ratsbeschluß. Wantramen sind die aufrecht stehenden, fest im Erdboden fußenden Gestelle, in welche das gefärbte Tuch in seiner ganzen Länge eingespannt wird, um in freier Luft zu trocknen und geglättet zu werden. Der Wandrahme uf diesem (Schneider) Wall 1602. Auf Gebhardis Plan sind Wandrahme mit einem Wachthaus an Stelle des Museums bis zur Stammersbrücke hin eingetragen, östlich davon noch ein Wandrahmwerder. Nach 1700 verpachtete die Kämmerei zwei Wiesen vor dem Altenbrückertore, dicht an einander liegend, davon die erstere genennet wird „der Wandrahme“, die andere die „Kleine Mühlenwiese“. Der Name Wandrahm haftete später an einem nahe der Frauenbadeanstalt (Badehaus schon auf Gebhardis Plan) liegenden städtischen Krankenhause, das im Jahre 1787 in einer vormaligen Kattundruckerei eingerichtet und seit 1869 nur noch für ansteckende Krankheiten und für Geisteskranke benutzt wurde. Es ist abgebrochen vor Errichtung der Volksbadeanstalt 1901. Die Wandrahmstraße ist bebaut gegen 1880; Errichtung des Museums 1889/91 (Erweiterungsbauten 1908 und 1913). Wandrahmen hatten sich, wie hier zwischen Ilmenau und Stadtgraben, auch hinter der Bardowickermauer befunden, so daß zu Maneckes Zeit das dortige Stadtgefängnis im gemeinen Leben der Wandrahm genannt wurde. Auf Gebhardis Plan ist die Strecke hinter dem Bardowicker Wall von der Reitendendiener- bzw. bis zur Ecke der Gralstr. bezeichnet köterkaben, als Gefängnis 1588 ff., 1616 und sonst erwähnt, und achtern wandhuse. In dem köterkaven werden etliche Fach wiedereingemauert 1643. In Göttingen in den wantremen, die jetzige Hospitalstraße. Mit dem Bau der Entlastungstraße, die den längs des Lösegrabens nord-südverlaufenden Teil der Wandrahmstraße mit einbezog, wurde dieser in Berliner Straße umbenannt (28.5.1959), so daß jetzt nur noch der vom Museum westlich bis an die Ilmenau reichende Straßenzug den Namen Wandrahmstraße trägt (vgl. hierzu auch unter Haagestraße). 235
Weberstraße Ratsbeschluß vom 10.12.2001. In Oedeme-Süd ist ein Viertel mit Straßennamen Handwerksberufe entstanden, wozu auch die Weber Wollenweber erhielten in Lüneburg in der ersten Hälfte Amtsordnungen und die Heiligengeiststraße (s. dort) trug Wollweberstraße.
auf der Basis alter zählten. Leinen- und des 15. Jahrhunderts zeitweise den Namen
Wedekindstraße Kollegienbeschluß vom 8.10.1901. Dem Gedächtnis an Anton Christian Wedekind gewidmet. Der rühmlichst bekannte Geschichtsforscher hat im Jahre 1763 in Visselhövede das Licht der Welt erblickt. Er besuchte die Michaelisschule zu Lüneburg und hat nach beendetem juristischen Studium dem Michaeliskloster von 1793 bis an seinen Tod 1845 als Amtsschreiber, Amtmann und Oberamtmann gedient. Seine Muße widmete er geschichtlichen Forschungen, die er an der Landesuniversität Göttingen förderte durch Errichtung einer fruchtreichen Preisstiftung; sein eigenes literarisches Hauptwerk sind die Noten zu einigen Geschichtsschreibern des deutschen Mittelalters (1821 bis 1837). Wedekinds Brustbild, gemalt von Nic. Peters, befindet sich im Museum. Wendische Straße Kein Ratsbeschluß. Wie das Wendische Dorf wird auch die Wendische Straße erst spät genannt, vermutlich rührt der Name her von einer Niederlassung wendischer Sülzarbeiter. An der Südostecke der Wendischen Straße lag die Sülzbadestube, daher die älteren Benennungen; achter deme sultestoven 1451; pl. stube salinaris 1472 und 1511; neffen deme sultestaven 1501; pl. wandalica 1584; vandalica pl. prope balneas salinaris 1604; prope angulum vandalicae plateae 1624; der Schmied Oetzeman kaufte die genannte Badestube im Jahre 1645 als domum et aream balneae salinares dictam in pl. pontis salinaris ad angulum pl. vandalicae; Wendische Straße 1765. S. oben Im Karnapp. In Braunschweig pl. slavorum und valva slavorum, die ins Wendenland hinausführten. Werner-Jansen-Weg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Der Professor in Berlin und Verfasser historischer Romane, Dr. phil. Werner Jansen (1890-1943), lebte von 1926 bis 1932 im Haus Nr. 28 in Ochtmissen. 1940 erhielt er die Goethemedaille. Seine literarische Qualität gilt als zweifelhaft, seine politische Einstellung als fragwürdig. Werner-von-Meding-Straße Kein Ratsbeschluß. Mit der Eingemeindung Oedemes nach Lüneburg im Jahr 1974 wurde auch diese Straßenbezeichnung in Neu-Oedeme übernommen. Sie erinnert an ein Mitglied eines der ältesten Burgmannen- und Adelsgeschlechter des Fürstentums Lüneburg. 236
Ein Träger dieses Namens war 1261 Mitbegründer des Klosters Medingen. Bis heute ist das Gut Schnellenberg im Besitz der Familie von Meding. Westädt’s Garten Ratsbeschluß vom 25.8.1964. Benannt nach dem bis zu Beginn dieses Jahrhunderts dort befindlichen Kaffeegarten. Westädt war der Name des Besitzers. Wichernstraße Ratsbeschluß vom 23.4.1952. Benannt nach Johann Heinrich Wichern (1808-1881), dem Gründer des Rauhen Haus in Hamburg. Wielandstraße Ratsbeschluß vom 27.1.1954. Benannt nach dem Dichter Christoph Martin Wieland (1733-1813). Ihm wird die erste deutsche Prosaübersetzung von 22 Stücken Shakespeares verdankt. 1772 berief Herzogin Anna Amalie von Sachsen-Weimar Wieland zum Erzieher ihrer Söhne. Mit seinen Romanen, Dramen und Übersetzungen verkörperte er das literarische deutsche Rokoko und wurde einer der Anreger der deutschen Klassik. Wiesengrund Kein Ratsbeschluß. Die Verbindung von Klosterweg und Osterwiese in Rettmer nimmt die Belegenheit der Straße als Basis für den Namen, der wohl 1974 vergeben wurde. Wiesenstraße Kollegienbeschluß vom 12.10.1903. Straßenname im neuen Stadtviertel auf der Breiten wiese (vgl. daselbst). Wiesenweg Kein Ratsbeschluß. Der Straßenname in Alt-Hagen wurde mit der Eingemeindung des Ortes 1974 übernommen. Wildgraben Ratsbeschluß vom 11.9.1964. Über den einstigen Wildgraben vor dem Bardowickertore s. das. Wilhelm-Busch-Weg Ratsbeschluß vom 10.11.1954. Der Maler, Zeichner und Dichter Wilhelm Busch (1832-1908) stammte aus Niedersachsen, wurde aber vor allem durch seine Arbeiten für Münchner Blätter 237
bekannt. Seine Bildergeschichten können als Vorläufer der Comics gelten. Sein Nachlaß wird im Wilhelm-Busch-Museum in Hannover bewahrt. Wilhelm-Fressel-Straße Ratsbeschluß vom 25.2.1988. Mit dem Straßennamen wird der Kaufmann Friedrich Wilhelm Fressel (1853-1920) gewürdigt. Er war Inhaber der Firma Julius Kallmeyer – Kolonial- und Eisenwaren – und von 1907-1920 Präsident der Handelskammer Lüneburg. In dieser Funktion setzte er sich besonders für die Ilmenauregulierung und das Nord-Süd-Kanalprojekt ein. Von 1911 bis 1919 gehörte Fressel dem Bürgervorsteherkollegium an und wurde im November 1911 zum Senator gewählt. Am 22.8.1907 war er mit dem Preußischen Kronenorden 4. Klasse ausgezeichnet worden. Wilhelm-Hänel-Weg Ratsbeschluß vom 17.12.1981. Mit dem Straßennamen hatte bereits der Gemeinderat Ochtmissens seinen langjährigen (1947-1967) Bürgermeister Wilhlem Hänel gewürdigt. Am 26.2.1974 wurde die nach ihm benannte Straße bis zur Lüneburger Straße verlängert. Mit dem o. g. Ratsbeschluß wurde der Name offiziell für die Stadt Lüneburg übernommen, wohin Ochtmissen seit 1974 eingemeindet war. Wilhelm-Hillmer-Straße Ratsbeschluß vom 29.1.1976. Der Tischlergeselle aus Garlstorf kam nach vierjähriger Wanderzeit 1903 nach Lüneburg und trat der SPD bei. 1905 wurde er Gründungsmitglied der Konsumgenossenschaft, deren Aufsichtsrat er später angehörte. Von 1912 bis 1933 war er Konsum-Filialleiter. 1919 gründete Hillmer die Arbeiterwohlfahrt Lüneburg, war von 1920 bis 1933 Vorsitzender der SPD in Lüneburg und von 1924 bis 1933 Mitglied des Bürgervorsteherkollegiums und Vorsitzender des Unterbezirkes. Nachdem er 1933 „kaltgestellt“ worden war, machte er sich mit einem Lebensmittelgeschäft in der Heiligengeiststr. 36 selbständig. Bereits 1945 gehörte Hillmer dem Rat an und erhielt von der Besatzungsmacht das Dezernat Sozialverwaltung übertragen. 1950 bis 1952 bzw. 1953 bis 1954 stand er dem Rat als Bürgermeister vor und schließlich 1958 bis 1961 als Oberbürgermeister. Hillmer setzte sich aber nicht nur für soziale Belange ein, sondern war auch das Mitglied Nr. 1 der Lüneburger Volksbühne. Wilhelm-Leuschner-Straße Ratsbeschluß vom 27.4.1967. Der gelernte Holzbildhauer Wilhelm Leuschner (1890-1944) gehörte seit 1919 in führender Position zur Gewerkschaftsbewegung in Darmstadt. 1928 bis 1933 war er Innenminister in Hessen. Nach der Rückkehr von einem internationalen Gewerkschaftskongreß in Genf wurde er 1933 verhaftet und bis 1934 in den Emslandlagern eingesperrt. Nach seiner Freilassung gründete Leuschner einen kleinen aber kriegswichtigem Betrieb und konnte so illegal Gewerkschaftsarbeit weiterführen. Er nutzte seine Möglichkeiten, um Verbindung zum militärischen 238
Widerstand aufzunehmen. In der neuen Regierung war er als Vizekanzler vorgesehen. Am 16. August 1944 wurde Leuschner verhaftet, am 8. September zum Tode verurteilt und am 29. In Plötzensee hingerichtet. Wilhelm-Reinecke-Straße Ratsbeschluß vom 10.11.1954. Professor Dr. Wilhelm Reinecke (1866-1952), Stadtarchivar von Lüneburg von 1895 bis 1935, daneben, seit 1897, auch Leiter des Museums für das Fürstentum Lüneburg und seit 1922 der Lüneburger Ratsbücherei, hat sich große Verdienste um die Erforschung der Geschichte Lüneburg erworben. William-Watt-Straße Ratsbeschluß vom 29.1.1976. In den schweren Zeiten nach dem Ende des 2. Weltkrieges unterstützte William Watt (1880-1967) als Bürgermeister von Thomasville (Georgia/USA) 1948/49 bedürftige Lüneburger und Heimatvertriebene. 1956 zur 1000-Jahr-Feier ehrte ihn die Stadt Lüneburg, die er 1961 erneut besuchen konnte, mit der Ehrenbürgerwürde. Willy-Brandt-Straße Ratsbeschluß vom 13.3.2000. Die Berliner Straße wurde von der Altenbrückertorstraße bis Munstermannskamp zu Ehren des Berliner Regierenden Bürgermeisters (1957-1966), Außenministers (19661969) und Bundeskanzlers (1969-1974) Willy Brandt (1913-1992) umbenannt. 1971 war Brandt mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden, vor allem aufgrund seiner Ostpolitik. 1964 bis 1987 war er Vorsitzender der SPD und nach seinem Rücktritt Ehrenvorsitzender, außerdem 1976 bis 1992 Präsident der Sozialistischen Internationalen. 1979 bis 1983 wirkte er als Mitglied des europäischen Parlaments und gründete 1986 die Stiftung „Entwicklung und Frieden“. Wilschenbruch Wilschenbruch, richtiger Wülschenbrock, ein adelig freier landtagsfähiger Hof, lag am rechten Ufer der Ilmenau und führte seinen Namen von der Patrizierfamilie Wülsche, die ihn von 1465 (nach Volger) drei Generationen hindurch besessen hat. Vorher gehörte er den v. Meding, später den Viskulen, Steffen Loitze, den v. Witzendorff u. a., seit dem ersten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts den v. Bülow. Die Wülsches, ein aus der Mark Brandenburg eingewandertes Geschlecht, sind 1532 im Mannesstamme ausgestorben. Der Name Wülschenbrock findet sich erstmals in einer Urkunde vom 28. Juli 1522, als der Bürger Clawes Wülsche der Ältere seinen beiden Neffen für 1500 Lün. M das Gut überantwortete, de Dathmunde, edder anders genant dat Wulschenbrock, mit have, ackeren ... szo dat van zeligen heren Didericke Wulsschen ... ok synen und mynen olderen, vorolderen und ock van den van Medingen und Viszkulen etc. itwan boseten. Wir finden in dieser Quelle auch den voraufgegangenen Namen des Hofes de Dathmunde, ursprünglich Dachmunde, auch Dachtmunde geheißen. Zwei vom Berge verkauften 1348 der Stadt ein Gehölz dat hern Diderikes van deme Berge holt menliken heit; dat begint van deme Goltbeke de bi der Viningheborch [d. h. 239
Moorburg] in de Elmenow vlůt, bitte in den graven dese in de Dachmünde geit. Der Wortlaut dieser Quellenstelle läßt uns den letzterwähnten Grenzgraben in ungefähr gleicher Richtung mit dem unlängst kanalisierten Goldbach am Rande des Wülschenbroker Gehölzes suchen, da wo noch jetzt ein Wässerlein einherfließt, um sich unterhalb der Brücke mit der Ilmenau zu vereinigen. Am linken Flußufer gedeiht hier in üppigster Weise das zum Decken von Häusern verwandte Schilfrohr, niederd. dach, das ehemals auch am rechten Ufer gleich günstigen Boden gefunden haben muß. Es liegt daher nahe, den Namen des von mehreren solcher Bächlein durchzogenen Mündungsgebietes aus seiner natürlichen Beschaffenheit zu erklären. Bückmann führt die Bezeichnung Dachmunde auf den langobardischen Personennamen Dachimundus zurück und verweist auf das noch innerhalb der Landwehr gelegene Dorf Dachtmissen, das er einwandfrei erläutert als Dachmundishûse. Dat brok to Dachtmunde wird 1475 erwähnt. Gebhardi gibt im 5. Bande seiner Collectanea zu Vininghe eine Zeichnung. Statt einer erst 1938 durch eine Fahrbrücke ersetzten Fußgängerbrücke Richtung Ilmenaugarten-Wülschenbrok vermittelte noch zu Büttners Zeit ein an einer Kette befestigtes Boot den Verkehr über den Fluß. Wilschenbrucher Weg Kein Ratsbeschluß. Die Erklärung des Namens ergibt sich aus dem vorstehenden Abschnitte. Zu Anfang ihrer Entstehung, Mitte der 1870er Jahre, hieß die Straße Vor dem Rotentore bzw. Im Rotenfelde. Die beiden Häuser am Knick der Straße (Nr. 9 und 11) heißen im Volksmunde im krummen Ellenbogen, ebenso wurde in Lübeck bis in neuere Zeit die Krumme Querstraße bezeichnet. Über die Anlage der Vorstadt vor dem Rotentore berichtet Volgers handschriftliche Chronik z. J. 1875. Winkelweg Kein Ratsbeschluß. Der Ortsname in Oedeme, basierend auf dem Straßenverlauf, wurde mit der Eingemeindung des Ortes nach Lüneburg 1974 übernommen. Wittenkamp Ratsbeschluß vom 27.1.1966. Alte Flurbezeichnung, zu erklären durch den hier teilweise bis an die Oberfläche anstehenden weißen Kreidekalk. In unmittelbarer Nähe liegen die beiden stillgelegten bzw. eingeebneten Kalkbrüche beiderseits der Bögelstraße. Witzendorffstraße Ratsbeschluß vom 25.7.1951. Geschlecht auf dem Krepauhof in Wietzendorf, Kreis Soltau, das seit 1290 in Hamburg und Lüneburg erscheint, 1639 die Adelsbestätigung erhielt und heute noch blüht. Der Lüneburger Zweig dieser Familie, welcher der Stadt einst zahlreiche Ratsherren und Bürgermeister stellte, starb indessen im 18. Jahrhundert aus.
240
Wulf-Werum-Weg Ratsbeschluß vom 30.8.2001. Benannt nach dem Gründer (1939-1982) der Software-Entwicklungsfirma Werum Datenverarbeitungssysteme, die an der Straße ihren Firmensitz hat. Yorckstraße Kein Ratsbeschluß. Im Zuge des Kasernenbaus südlich der Stadt wurden 1936 angrenzende Straßen nach berühmten preußischen Militärführern benannt. Ludwig Graf Yorck von Wartenburg (1759-1830) schloß als Befehlshaber des preußischen Hilfskorps im russischen Feldzug 1812 die Konvention von Tauroggen und war seit 1814 preußischer Feldmarschall. Zechlinstraße Ratsbeschluß vom 25.10.1950. Geheimer Studienrat Dr. Arthur Zechlin (1849-1942) war Direktor der Höheren Mädchenschule (Wilhelm-Raabe-Schule) und der Lehrerinnen-Bildungsanstalt zu Lüneburg von 1896 bis 1921. Zeltberg Kein Ratsbeschluß. Nach der Sage, die Volger als durchaus unwahrscheinlich verwirft, die aber eine sprachlich einwandfreie Erklärung des Namens gibt, hieß der Zeltberg so, weil Kaiser Friedrich Rotbart auf der Heimkehr von seinem Zuge gegen Heinrich den Löwen dort sein Lager aufgeschlagen haben soll. Arnold von Lübeck berichtet, daß dieses Lager auf der Ostseite der Lüneburg gelegen habe, eine Angabe, die mit unserer Sage sehr wohl in Einklang zu bringen ist. In Teltberge werden fünf Stücke bestelltes Ackerland verpfändet 1297; der Abt des Michaelisklosters erwirbt Anspruch auf gewisse Aecker iuxta campum Teltberghe 1324; super locum Teltberge 1345. Im Dreizehnhundert war der Zeltberg bewaldet; das dem Michaeliskloster gehörige A b t s h o l z (silva abbatis 1345) hatte jedoch gelegentlich einer Fehde den feindlichen Truppen Vorschub geleistet und wurde deshalb auf Grund eines Abkommens zwischen Rat und Sülfmeistern auf der einen, den Benediktinern auf der andern Seite abgehauen; der Boden mußte in Ackerland umgewandelt werden – umme ere holt, gheheten des abbetes holt, is ghedeghedinget 1396. Über die berührte Fehde berichtet der Chronist Schomaker zum genannten Jahre: item ein van Meltzinck was der stadt seher vient, de dede den borgeren vele ledes in des abts holte, dar nu J e r u s a l e m vor dem Bardewyker dare steit; ferner hertoch Hinrik ronde ein male vor de stadt in des abts holte, darto togen de borger henut ... dar vele eherliker borger und inwaner erslagen ... und solkes ok wider to sehende an dem monumento und warteken des stenes up dem Teltberge vor Luneborch to bofindende und to bosehende -; das hier erwähnte Denkmal ist leider vor etwa hundert Jahren verlorengegangen und nur in einer Skizze Gebhardis erhalten; es stand mit der Andachtsstätte Jerusalem (am Jerusalemsberg in Lübeck) wohl in Zusammenhang. Bey dem steine auf dem Teltberge hatten die Ochtmisser widerrechtlich Plaggen hauen lassen 1581.
241
Dr. Arthur Zechlin (1849-1942)
Zeppelinstraße Ratsbeschluß vom 30.05.1980. Bei dem Baugebiet handelt es sich um das ehemalige Flugplatzgelände. Die Straße wurde daher nach einem deutschen Pionier der Luftfahrt benannt. Ferdinand Graf von Zeppelin (1838-1917) startete 1900 sein erstes Luftschiff. Sein Name wurde ein Synonym für dieses Verkehrsmittel, mit dem bis zu der Katastrophe von Lakehurst 1936 Linienverbindungen für Passagiere und Fracht betrieben wurden. Ziegelei Es handelt sich um eine Lagebezeichnung im Ortsteil Ebensberg, keinen Straßennamen (vgl. Am Ziegeleiteich). Ziegelkamp Ratsbeschluß vom 30.05.1963. Die Straße erhielt ihre Bezeichnung nach einem Flurnamen in der Nähe des Altenbrücker Ziegelhofs (vgl. das.). Zollstraße Kein Ratsbeschluß. Inmitten der Bäcker-, d. h. der Hauptverkehrsstraße der Stadt, wurde vor der Haustür des Zolleinnehmers ein herzoglicher Zoll auf Waare und Wagen erhoben. Zu vgl. Hammerstein, Bardengau 144, wo angenommen wird, daß der Zoll ursprünglich in Bardewik erhoben und erst mit dessen Zerstörung nach Lüneburg verlegt worden sei. Dieses Amtshaus des Zöllners, bis 1750 von ihm bewohnt, lag an der Südecke des schmalen Gäßchens, das von Osten her in die Bäckerstraße einmündet und mit seinem Namen an den ehemaligen Zustand unmittelbar erinnert (Nr. 21). Das Zollhaus wird mit dem Zoll in der Bäckerstraße erwähnt 1353; mid sinem tollen de he [der Herzog] heft ... to Luneborch in der beckerstrate ... mid dem tollenhuse in dersulven bekkerstrate; in der beckerstrate jegen dem tolnhuse over 1434. Uppe der tollenboden speiste 1455 Herzog Frederik, als er ein Privileg bestätigte; ein schild der tollenbode wird 1471 erwähnt. Die älteste erhaltene Zollrolle wo men den tollen schal geven in der beckerstrate to Luneborgh ist vom Ausgange des Vierzehnhunderts. Ziemlich spät erst begegnet der Name Zollstraße, nämlich auf dem Plane von 1652; Manecke erwähnt gelegentlich (um 1800) die Zollgassen-Ecke. Zum Elfenbruch Ratsbeschluß vom 30.05.1980. Der Straßenname basiert auf einer überlieferten Flurbezeichnung. „Elf“ ist die niederdeutsche Bezeichnung für die Rohrdommel, so daß Elfenbruch soviel bedeutet wie „feuchte Niederung, wo es Rohrdommeln gibt“. Zum Gänsebruch Ratsbeschluß vom 29.08.1995. Grundlage des Straßennamens ist eine alte Flurbezeichnung für eine feuchte Niederung, in der Gänse gehalten wurden.
243
Zum Moorbruch Ratsbeschluß vom 23.7.1998. Der Straßenname im Neubaugebiet Rettmers westlich der Lüneburger Straße soll die Belegenheit in einem ländlich geprägten Ort betonen. Zur Ohe Ratsbeschluß vom 16.12.1982. Der Straßenname geht auf eine alte Flurbezeichnung im Ortsteil Hagen zurück. Das germanische „Ohe“ bedeutet „Land am Wasser“.
244
Anhang 1. Die Namen der Lüneburger Sülzhäuser Von den 54 Siedehütten der Saline, wie sie, obschon nicht ungelichtet, bis zur Erneuerung des Salinbetriebes gegen Ausgang des Siebzehnhunderts bestanden haben, wurden einige unter demselben Namen geführt und nur durch einen Hinweis auf ihre Lage zum Salzquell unterschieden: Berdinge apud puteum (am Sod), Berdinge superior, Berdinge inferior (auch apud Brokhusen, Berdinge perversum oder Vorkerken Berdinge, versus Woldertzinge), Cluvinge superior und Cluvinge inferior, Dörntzinge superior und inferior, Volquardinge superior und inferior. Es bleiben daher 48 verschiedene Namen, die in alphabetischer Ordnung folgendermaßen lauten: Alverdinge (Elverdinge, Elveringhe), Barninge (Bernerdinge, Berdinge, Bernding), Benninge (Beninge, Benniggehusen), Betzehusen (Beschehusen, Bechsehusen, Botzehusen), Bovinge, Breminge, Brochusen (Brokhusen, Borchusen), Butsinge (Buschinge, Butzinge), Campinge (Kempinge), Cluvinge, Codsinge (Kodetzinge, Katschinge), Deinge (Deyinge, Deginge), Dencquinninghe (Thencqueninge, Dencquerdinge, Denkweringe), Dernetsinge (Derneschinge, Dörntzinge), Dithmaringe (Thitmeringe), Ebbinge, Ebetzinge (Ebbetsinge, Ebetschinge), Ecbertinge (Egberdinge), Edinge, Egetinge, Einge (Eynghe, Eyinge), Enninge (Eming), Erderinge, Everinge, Geminge (Genninge, Gemigge), Gererdinge (Gerardinge), Glusinge, Godskalcschinge (Gosletzinge, Gosseling, Gutschinge), Grevinge, Henringe (Hennering, Haveringe, Hoveringe), Hinxtebeke (Hinxte, Hincste, Hinxste, Hingste, Hinxt, Hengestebeke), Honovere (Honover), Huginge (Hoyinge, Heuringe, Hauringe), Huninge, Huttinge, 245
Loteringe, Ludolvinge, Memminge (Menninge), Mettinge, Munschinge (Mutszinge, Muntzinge, Müntzing, Moncinghe), Seveninge, Soderstinge (Södersing, Suderstinge), to dhen starte (Starthe, Starthusen, Sterthusen), Udinge, Ulinge, Velinge, Volqwardinge (Volkwarde, Volcquardinge, Volquerdinghe), Wolderschinge (Woldertsinge, Woldertzinge, Woldertinge, Walderschinge)∗. Eine Zusammenstellung eben dieser Namen in verschiedenen Lesarten ist als eines der allerältesten und zugleich interessantesten Namendenkmäler des Bardengaues schon von Hammerstein (S. 556 ff.) mitgeteilt, und der gelehrte Forscher hat in einer übersichtlichen Tabelle die große Mehrzahl der Bezeichnungen in einleuchtender Weise zu erklären vermocht. Seine Nachweise sind durch Bückmann (S. 9 ff.) für 44 Namen ergänzt und vertieft, zum Teil berichtigt. Beim aufmerksamen Lesen unserer Liste, die der urkundlichen Überlieferung bis 1350 entnommen ist, bemerkt schon der Laie, daß den Benennungen der meisten Sülzhäuser Personennamen zugrunde liegen, und zwar vorwiegend solche, die bei den Langobarden nachzuweisen sind. Man erkennt leicht: Alverd (Elver, Alavard), Benno, Bernhard, Bero, Bezo, Bovo, Buzo (Burchard), Dankward, Thietmar, Ebbo, Ekbert, Ado, Aio, Enno (Emo), Gerhard, Gottschalk, Hengist (Henrik), Hugo, Lothar, Ludolf, Udo, Volkward, Wolder (Walthari); andere weniger geläufige zieht Bückmann heran: Primo (für Breminge), Campo, Gôzo (für Codesinge), Taco (Deynge), Ago (Eghetinge), Ardo (Erderinge), Ibor (Everhard? für Everinge), Gemmo, Gramund (für Grevinge), Hunald, Hudoald (Huttinge), Mammo (Memminge), Matingo (Mettinge), Munipert (Muntzinge), Savinus (Seveninge), Santari (Soderstinge), Ulimar (? Ulinge), Felo (für Velinge). Da das in 48 Fällen 44mal gebrauchte Suffix inge, (sinngemäß auch Betzehusen) auf die Abkunft hinweist, so sind damit die Namen fast aller Siedehütten einwandfrei gedeutet, wenn sich auch über diese Bernhard, Ebbo, Lothar usw. leider nichts anderes ergibt, als daß wir sie als Eigentümer oder Besieder der Hütten in einer grauen Vorzeit ansprechen dürfen. Cluving ist wohl mit der bekannten Burgmannenfamilie Cluver in Zusammenhang zu bringen; Glüsinge setzt Gebhardi in Beziehung zu Glis, Glismot. Die abweichende Bildung Hinxtebeke mag sich aus einer auffallenden Eigenart des betreffenden Hüttenbetriebes erklären, jedenfalls ist die Ableitung von einem Personennamen auch hier kaum zweifelhaft. Eine kleine Gruppe für sich bilden nur die Namen Brokhusen, Honovere und Starte. Alle drei Bezeichnungen weisen, wenn wir recht verstehen, auf die Belegenheit: das auf bruchigem Boden (brôk), das hoch (auf hohem Ufer) und das am Ende (stert = Schwanz, analog Sterteshaghen) gelegene Haus. ∗
Es wird an dieser Stelle abgesehen von vereinzelt vorkommenden Namen (domus Gighingi u. a.), deren Identifizierung nur auf Grund einer eingehenden Untersuchung über die ältesten Besitzverhältnisse der Saline möglich ist. 246
Jede Siedehütte führte ehemals eine Hausmarke und soll an einem besonderen Abzeichen aus Metallguß, das auf einer Stange beim Eingange befestigt war, kenntlich gewesen sein; auch diese Abzeichen, deren mehrere sich im Lüneburger Museum erhalten haben, nehmen auf den Namen des betreffenden Sülzhauses Bezug, ohne in diesem Betracht maßgebend sein zu können. Wenn eine Henne die Siedehütte Henringe, ein Geistlicher mit Rosenkranz (Abt) Ebbetzinge, ein Einhorn Enninge, ein Bär Berninge (= Bernerdinge), ein Butt Bützinge, eine Eule Ulinge veranschaulicht, so ist es die Auffassung des Fünfzehnhunderts, die aus diesen Symbolen zu uns spricht. Immerhin zeigte das Abzeichen des Hauses Benninge die Gestalt eines Mannes in alter Tracht, und die Unterschrift soll nach Gebhardi gelautet haben: Benno dux. Angefügt sei hier der Ausdruck künthe oder küntje (up der kunthe 1487). Er bezeichnete ein künstlerisch ausgestattetes Sitzungsgemach der Sülfmeister, das über dem Sod eingerichtet war; Hammerstein leitet das Wort ab vom nordischen kyn, Geschlecht, und nennt die künthe eine Geschlechterstube. Zu vergl. W. Reinecke, Von alten Siedehütten (Festblätter des Museumsvereins für das Fürstentum Lbg. Nr. 2).
2. Sonstige Hausnamen Schon bei der voraufgegangenen Behandlung der einzelnen Straßen hat eine Reihe von Hausnamen quellenmäßige Erwähnung gefunden: ad altos gradus (tom hohen trede vor der Sülze), Gholderden (1359), zum goldenen Hahn und zum roten Hahn (Rotehahnstraße), Himmelreich (vor der Sülze), ad duas januas (zu den beiden Torflügeln, Rosenstr.), zum hohen Kreuz (Sülztorstr.), Partekenkrog (am Berge), Rovekule (Rübekule), Schütting mit Vinkenbur (am Markte), zur gülden Treppe (ad aureos gradus am Berge), Vinkensteyn (Lünerstr.), Vlasborch (Salzstr.), Warborg (Hude). An Herbergsnamen wurden genannt der goldene und schwarze Adler, der schwarze Bär, der goldene Engel (1517), die Rose (1625), die Traube (Sand), der schwarze Elephant und das weiße Roß (auf dem Kauf); das witte perd in der Rotenstr. 1606, der weiße Elephant und das schwarze Roß (Rotehahnstr.), der rote Hirsch und im springenden Hirsch (Hl. Geiststr.), die goldene Krone und der goldene Löwe (Bäckerstr.), der goldene Mond, die goldene Sonne und der (goldene) Stern (Hl. Geiststr.), der weiße Schwan (Bardowiekerstr., 1606). Die Sodmeisterrechnung von 1486 nennt das Haus des Ratsherrn Hinrik Varendorp tom breden gefel. Der Altertumsverein zu Lüneburg hat in einer seiner Veröffentlichungen ein längst abgebrochenes, auffallend schmales Giebelhaus der Bardewikerstraße (Nr. 16) in Bild und Wort vorgeführt, den sog. hölzernen Herrgott, wohl nach einer ehemals vorhandenen geschnitzten Figur bezeichnet. Der sog. knöcherne Herrgott wurde 1863 abgetragen. Schon 20 Jahre vorher wurde das Eckhaus B 34, die Leuchte gen., ein schmales Gebäude, fast nur aus Fenstern bestehend, eingezogen zum Hause B 19. Am Eingange der Bardowickerstraße befanden sich nach mündlicher Überlieferung außer dem Hölzernen Herrgott das Lange Handtuch und die Trompete.
247
Im Jahre 1732 gab es außer bereits erwähnten Herbergen im gülden Arm 1625, Stadt Haarburg 1685 (zur Haarburger Herberge schon 1669), Stadt Hamburg, Stadt Magdeburg, Stadt Nürnberg seit 1726, (Mecklenburger Herberge), den gelben Adler, den silbernen Mond und den König von Engelland seit 1717. Die Überlieferung einer größeren Zahl von Namen der Lüneburger Brauhäuser verdanken wir einer Niederschrift Büttners, der um 1733 die Eigentümer der damals bestehenden achtzig Brauhäuser mit Nummer und Seite der Schoßliste namhaft gemacht und die ihm bekannten Häusernamen am Rande hinzugefügt hat. Es sind im Marktviertel: im Fahlenkrog oder Jungenskrog, im Fingerhut∗, im stolten Buer, in der Freude, im halben Schweinskopf, in der Kuhl, im Caldunenkrog olim im Schölerkrog; im Wasserviertel in dreckichten Saum item im hölten Küssen, im Bockstall, im Kringelkrog, im leddernen Koller, im stolten Buer item im deutschen Cavalier, im düstern Krog, im bundten Hahn, in twen dören (vgl. oben ad duas januas), im Storchsnest, im stijfen Hoht; im Sandviertel: im hölten Amboldt, im Syrach, im stolten Flegel, im solten Bock, im Kübelkrog, im Stöfsack, in der fetten Föhle [= fêle, feile, der Ort, wo etwas feilgeboten wird], im Pracherkroch; im Sülzviertel: im Kuhhirtenkrug (item) im Ossenkrog, in der Welt (item) im ruchen Vincken, im apenen Schapp, im hölten Häneken, im letzten Heller, im Kattenkop, im Himmelreich (siehe oben), im Putt, in der drögen Apotheken, im Lammerkrog nunc im bundten Küssen, in der Hölle, in der Bundtenburg, in der verstörten Bibel, im drögen Bock. Eine Erklärung dieser Namen erübrigt sich. Sie sind offenbar ein Erzeugnis des Volksmundes, nicht von der Obrigkeit verliehen, und als Dokument drastischen Volkshumors nur um so wertvoller. Die offizielle Annahme eines Hausnamens mit Aushängung eines Schildes kam wohl nur für Herbergen und Gastwirte in Frage und bedurfte der ausdrücklichen Genehmigung des Rates, der für jede Konzession eine Abgabe erhob. Einige Belegstellen seien wiedergegeben: 1635 Februar 3 bitten die Aelterleute des Bäckeramtes, am Kruge ihrer Knechte bei Johan Happen am schrangen gleich anderen Handwerkern ein Schild aushängen zu dürfen, damit wen ein frembder knecht wandern kumpt dannach sehen mochte, wan er nach handtwerks gewanheit einkehren konne. 1669 Mai 4. Der Bürger und Gastgeber Johann Möller erhält auf den Antrag, zu besserer Fortsetzung seiner wirthschaft und nahrung, auch mehrer wissenschaft und nachricht der negociiren- und reisenden von und nach Zell und Haarburg ein schildt „zur Zeller und Haarburger Herberge“ bezeichnet, vor sein in der Heil. Geiststraßen bey der Faulen Au an der ecken belegenes haus aushängen zu dürfen, vom Rate die Konzession, ein schildt, allein unter nahmen der „Haarburger Herberge“, vor sein haus zu männiglicher desto besserer nachricht auszuhengen. Die Gerichtsrechnung von 1685 enthält für die nördliche Hälfte des später Johann Frederich gehörigen Hauses (Güldener Löwe) den Vermerk: Peter Busche, welchem auf gethanes suppliciren an e. e. hochw. raht vergönstiget, vor seinem hause in der grossen Beckerstraßen einen löwen zu henken, hat vigore senatus decreti vom 27. augusti pro concessione gegeben 10 M.
∗
Brauhaus auf der Altstadt, Ecke Ohlingerstraße.
248
Protokollauszug einer Ratssitzung von 1685 Juli 16: Der Brauer Johan Peter Weyhe suppliciret zu verstatten, daß er ein schild aushengen möge. Conclusum: kan nicht verstattet werden, weil noch kein brauer damit ist angesehen; sonst kan man ihme die wirthschaft wohl gönnen. Notiz Büttners: Als ao. 1717 der sog. Schütting zum Traiteurhaus aptiret worden, ist auf des Pachters Hartwich Wieden Anhalten resolviret, einen Schild mit Sr. Maj. des Königs von Engelland u. a. Herren Bildnisz auszuhengen, so auch geschehen. Und hat derselbe gekostet: dem Kupferschmidt für den Schild dem Mahler Schormann für 50 Buch Gold dem Kleinschmidt
71 M 12 s 18 M 20 M 11 s 2 d 56 M Sa. 166 M 7 s 2 d
Kämmereiprotokoll von 1721 Oktober 31: Conrad Alsgut, Pensionarius des olim Güldens Garten that Ansuchung, daß ihme ein Schild möge gemachet werden. Der Bauschreiber Martin Johan Thießen berichtet, dasz annoch ein alter Schild bey Handen wäre, so gedachtem Alsgut zuzustellen, ist dorauf ein Wirtschaftl. Zeichen als den Silbernen Mond mahlen zu lassen resolviret. 1726 Dezember 20 kommt Johann Volckmann, Käufer des Güldengartens, beim Rate mit Erfolg darum ein, sein Haus mit der Schildgerechtigkeit der Stadt Nürenberg gratis zu begnadigen, und zwar unter der Begründung, dasz die Nürenberger Bohten, welche ihr bestendiges Ablager bey mir haben, mir zu verstehen gegeben, wie dasz es höchstnötig, dasz ihre Herberge ein gewisses Zeichen oder Schildt haben möchte, damit die Passagierer oder wer auf der route etwas zu bestellen, wissen könne, woselbst er sich zu adressiren habe. 1732 Sept. 12. Der Bürger Caspar Lorenz Dänhardt erhält von der Kämmerei mit Zustimmung des Rates die Befugnis, zu besserer Fortsetzung seiner Nahrung und Wirtschaft vor dem von ihm erstandenen Stöteroggischen Hause in der Großen Bäckerstr. ein Schild mit einer güldenen (englischen) Cronen auszuhängen (Rekognition 10 M). Wiederum nach einer Mitteilung Büttners seien endlich die Herbergen oder Krüge der Handwerker, welche Schilder ausgehänget haben, kurz aufgeführt, aus der Zeit von ca. 1730. Ein Wechsel der Herberge war nichts Ungewöhnliches, scheint jedoch obrigkeitlicher Genehmigung bedurft zu haben. Bäcker (Weiß- oder Feilbäcker), in Thebels Haus bei St. Nicolai Kirchen. Bäcker u. Perruquiers gegenüber dem Westausgange der Lünerstr. 1794. Beutler (Weißgerber), sel. v. Dörings Brauhaus bey den Vierörten an der Schrangenstraßen-Ecke. Dichtbinder, Wolffs Brauhaus Grapengießerstr. Leinweber, Behneken Brauhaus auf der Alten Stadt.
249
Maler-, Klempner-, Schlachter-, Barbiergesellen 1855: Bardstraße 29. Maurer, anfänglich auf dem Meer, dann auf der Saltzbrügger Str., sodann beim Schrangen, hierauf eigenmächtig nach Metzendorf Grapengießerstr., endlich 1732 nach H. J. Solthuen (Soltau) am Sande gebracht. Riemer, Haarburger Herberge in der Hl. Geiststr. Schlösser oder Kleinschmiede, Metzendorff in der Grapengießerstr. Schmiede (Grob und Hufschmiede), Fastnauers Brauhaus neben dem Gr. Hl. Geist. Schneider, 1680 in der Schröderstr., darauf Cordes Brauhaus gegen St. Nikolai Kirchen über, ao. 1734 translatum in Mengers Haus in der Schröderstr. [Zusatz]. Schuster, Carls Erben Brauhaus Salzstr. Tischler, Volckmanns Brauhaus Grapengießerstr. Zimmerleute, Fastnauers Wwe. Brauhaus gegen den Schrangen über. Aus den sechziger Jahren des vorigen Handwerksgesellen-Herbergen überliefert:
Jahrhunderts
Bäcker: Salzstraße D 12 (Nr. 26). Barbiere: Bardowickerstraße A 11 (Nr. 29). Böttcher: Grapengießerstraße C 142 (Nr. 48). Brauer: Kl. Bäckerstraße C 249 (Nr. 1). Buchbinder: daselbst. Büchsenmacher: Grapengießerstraße C 142 (Nr. 48). Bürstenbinder: Kl. Bäckerstraße C 249 (Nr. 1). Cigarrenmacher: s. Tabacksspinner. Drechsler: Am Sande C 149 (Nr. 1). Färber: Am Sande C 24 (Nr. 11). Gelbgießer: daselbst. Glaser: Lünerstraße B 85 (Nr. 10 A). Goldschmiede: Kl. Bäckerstraße C 249 (Nr. 1). Handschuhmacher: Am Sande C 6 (Nr. 25). Hutmacher: H. d. Joh.-Kirche C 312 (Nr. 13). Kammacher: Kl. Bäckerstraße C 249 (Nr. 1). Klempner: Lünerstraße B 85 (Nr. 10 A). Korbmacher: Am Sande C 149 (Nr. 1). Kürschner: Am Berge C 274 (Nr. 25). Kupferschmiede: Grapengießerstraße 142 (Nr. 48). Leineweber: H. d. Joh.-Kirche C 312 (Nr. 13). Lohgerber: Lünerstraße B 85 (Nr. 10 A). Maler: Kl. Bäckerstraße C 249 (Nr. 1). Maurer: Am Sande C 149 (Nr. 1). Messerschmiede: Grapengießerstraße C 142 (Nr. 48). Müller: Salzstraße D 12 (Nr. 26). Nagelschmiede: H. d. Joh.-Kirche C 312 (Nr. 13). 250
sind
folgende
Posamentierer: Kl. Bäckerstraße C 249 (Nr. 1). Repschläger: Schröderstraße A 330 (Nr. 1 A). Riemer und Sattler: Grapengießerstraße C 142 (Nr. 48). Schieferdecker: Lünerstraße B 29 (Nr. 12). Schiffer: Lünerstraße B 85 (Nr. 10A). Schlachter: Bardowickerstraße A 11 (Nr. 29). Schlosser: Grapengießerstraße C 142 (Nr. 48). Schmiede: H. d. Joh.-Kirche C 312 (Nr. 13). Schneider: Kl. Bäckerstraße C 249 (Nr. 1). Schornsteinfeger: Schröderstraße A 330 (Nr. 1 A). Schuhmacher: Lünerstraße B 85 (Nr. 10 A). Steinhauer: Am Stintmarkt B 189 (Nr. 12). Stellmacher: H. d. Joh.-Kirche C 312 (Nr. 13). Tabacksspinner und Cigarrenmacher: daselbst. Tapezierer: Grapengießerstraße C 142 (Nr. 48). Tischler: Bei der Lamberti-Kirche D 440 (Nr. 10/11). Töpfer: Kl. Bäckerstraße C 249 (Nr. 1). Tuchmacher: Am Sande C 6 (Nr. 25). Weißgerber: Grapengießerstraße C 142 (Nr. 48). Wollenweber: Kl. Bäckerstraße C 249 (Nr. 1). Zimmerleute: Bei der Lamberti-Kirche D 440 (Nr. 10/11). Zinngießer: Am Sande C 6 (Nr. 25).
3. Tore, Türme, Wälle Von den Lüneburger Toren, die je aus einem inneren und äußeren, durch Gewölbe verbundenen Tore bestanden und nach Ausweis alter Baurechnungen und Stadtansichten zu den imposantesten Profanbauten der Stadt gehörten, ist keines mehr erhalten. Die Torwohnungen wurden vom Rate vergeben, die Nachtwächter durften sich eine Zeitlang dort aufhalten. Das A l t e n b r ü c k e r t o r (erste Erwähnung gelegentlich der Errichtung eines Schlagtores 1328, valva antiqui pontis, circa antiquam valvam 1354) wurde abgerissen 1764; ein kleines, äußeres Tor, das 1787 an die Stelle trat, fiel den Eisenbahnbauten des Jahres 1878 zum Opfer. Das innere und äußere B a r d e w i k e r t o r (porta civitatis que ducit Bardewic 1274, valva Bardewich 1361) wurde 1817 beseitigt. Das äußere L ü n e r t o r (valvi novi pontis 1346) verschwand 1772. Das N e u e T o r , schon 1365 vorgesehen (vgl. unten), ist i. J. 1796 weggeräumt. Das R o t e T o r (porta rubea 1288, valva rufa 1291) ist abgebrochen im 3. Jahrzehnt des Achtzehnhunderts; ein offener Ersatzbau von 1865 wurde als Verkehrshemmnis wieder beseitigt 1906. Das S ü l z t o r (valva saline 1350) ist abgetragen 1800. Zwischen Sülztor und Kalkberg befand sich 1602 eine Kalkmühle, dabei eine Pforte. Nach Beseitigung der monumentalen mittelalterlichen Torbauten, die zur Winterzeit schon um 5 Uhr nachmittags oder noch früher geschlossen wurden, blieb doch eine Torsperre bis zur Aufhebung der Mahl- und Schlachtsteuer zu Anfang des Jahres 1869. So ist es zu verstehen, wenn Volger in seiner handschriftlichen Chronik erzählt, daß damals eine wichtige Umgestaltung der Stadt geschah. Es wurden die 251
Torflügel zunächst beseitigt, dann aber schritt man zum Abbruch der Tore selbst. Zuerst fiel das neue Tor, bis Dez. wurden mit Ausnahme des Rotentores die übrigen vier Tore beseitigt; das Lüner u. Sülztor öffentlich versteigert. Die Gebäude der ehemal. Torwachen waren, bis auf die am Sülz- u. Bardewikertore z. Tl. von Bürgern bewohnten, unbenutzt. 1872 wurde auch die Wache am Rotentore zur Wohnung des ehemal. Torschreibers gezogen; das Neuetor benutzten die Preußen von Zt. zu Zt. als Gefängnis. Alle genannten Tore sind in unserem Hauptabschnitte über die Straßennamen gegebenen Ortes mit behandelt, und auch die Belegstellen für das nach der Zerstörung der Lüneburg zugemauerte Grimmertor (valva in Grimme 1283) zwischen Kalkberg und Saline, wie für das Lindenbergertor (valva Lindenberge 1313) zwischen Kalkberg und Bardewikertor sind dort mit einbezogen. Es kommen für die Zeit bis 1371 hinzu das A b t s t o r , wohl unmittelbar am Kalkberge gelegen, als Zugang zum Benediktinerkloster; es wird zuerst erwähnt im Verfestigungsregister zum Jahre 1283; Wernerus Weggedef fregit seras et munitionem civitatis in valva abbatis (z. vgl. oben S. 201; ferner das w e l l e n d o r , zu belegen im Jahre 1272, als von einem Hehler ausgesagt wird, daß er extra portam que vocatur wellendor ein Haus besessen habe; im übrigen nicht nachzuweisen; für seinen Ausbau wurden nach der Kämmereirechnung von 13 [22] große Summen verausgabt; das R e n n e n b r u – c h e r T o r , vielleicht an Stelle der Rauschebrücke, wo später die Abtswasserkunst entstand, valva Rennenbruche ultra aquam Elmenouwe 1348; endlich das s p i l – l e k e n d o r , wie wir glauben möchten, mit dem Wellentore identisch, denn die Ausdrücke welle und spille werden in gleicher Bedeutung gebraucht und sind hier wohl einer technischen Einrichtung des Tores entnommen, das etwa mittels einer drehbaren Walze zu verschließen war. Zwei Urkundenstellen, die für unsere Namennachweise und zugleich für die einschneidenden topographischen Veränderungen der Altstadt zur Zeit des Erbfolgekrieges bedeutsam sind, haben oben Seite 67 ihren Platz gefunden; sie werden ergänzt durch folgenden Auszug eines Privilegs von 1369 Oktober 27. Die Herzöge Wilhelm und Magnus zu Braunschweig und Lüneburg verleihen dem Rat und der Bürgerschaft die Gnade dat se nu van staden an edder darna, wan ym dat evend, moghen tomuren dat Grimmedoer unde moghen dar graven butene vore breken unde maken laten to user borgh word, ok moghen se vor dat Spillekendoer enen graven maken laten to user borgh word unde moghen dar ene velbrucghe vore maken. So schollen se des Lindenberghedores bruken up unde tot to slutende also se der anderen stad dore doen; wolden se ok dat Lindenbergher doer verghaan laten, so scholden se twischen dat Grimmer doer unde dat Lindenbergher doer een doer in maken, also dhe breve spreken dhe ym darvore uppegheven syn. Die ältesten Stadtansichten, aus den 40er Jahren des Vierzehnhunderts, zeigen, daß der kurz zuvor erbaute innere und äußere Mauergürtel Lüneburgs rings durch eckige oder runde, hohe und niedrige Türme verstärkt war, und schon in Florekes Chronik von 1370 heißt es: ok dwangh he (Herzog Magnus) den raad, dat se eme antwerden musten alle der stad dor unde dhe slotele u n d e a l l e d h e t h o r n e u m m e d h e s t a d.
252
Die Türme haben wohl sämtlich ihren Namen gehabt, der bald auf die Belegenheit, bald auf den Erbauer oder Bewohner, bald auf die äußere Gestalt des Bauwerks, eine bauliche Eigenart, bald auf seine berufenen Verteidiger hinweist. Noch im Siebzehnhundert wurden die meisten Mauertürme von städtischen Angestellten bewohnt, von Wächtern, von Kuhhirten, vom Laufenden Stadtboten, Tagelöhnern u. a. Wir geben nachstehend eine gewiß nicht erschöpfende Namenfolge, wie sie in den verschiedensten Quellen des Archivs, vielfach erst aus der Mitte des Siebzehnhunderts überliefert ist, und beginnen, in östlicher Richtung die Stadt umschreitend, mit dem S p r i n g i n t g u d t u r m als dem nordwestlichen Pfeiler des Mauerringes, genauer des inneren Mauerrechteckes. In älteren Quellen heißt der Springintgud, von dem es zweifelhaft ist, ob der Bürgermeister Johann Springintgud, der darin umkam, nicht auch sein Erbauer war, de grote torn 1458, de boghe torn 1463, de hoghe torn in dem grale 1499. Der Springintgud wurde schon 1651 bis auf halbe Höhe, 1798 völlig abgetragen. Sein Nachbar war der W i p p t u r m am Gralwalle, gegenüber dem alten Gralhospital, wohl identisch mit dem torn up der monneke ganghe van sunte Michahele 1425 bzw. dem torn achter sunte Michile by der monnicke gange. Nördlich vom Franziskanerkloster schloß sich de torn der broder to unser leven frouwen 1490, wohl auch Steinhauers T u r m u f f m b r i n c k 1643 daran an. Außen ragten empor der im Jahre 1743 oder kurz zuvor heruntergenommene W o l l e n w e b e r z w i n g e r (der Wullenweber Torm 1602), wo die Bastion östlich an der Stadtmauer ansetzt; der G o l d s c h m i d t s – z w i n g e r (der Goldschmiede Torm 1602) mitten zwischen den Mündungen der Reitendendiener- und Burmeisterstraße; Volger bemerkt 1823: an der Bardewiker Mauer steht noch der untere Teil des alten Bürgergefängnisses (Köterkoben); der K r a m e r z w i n g e r westlich vom Ausgange des Wendischen Dorfes (Krämer Torm 1602), abgebrochen 1798; der S a l z m e s s e r z w i n g e r (torn boven der bomkulen 1485, de hoghe torn by der Elmenouwe 1490∗) an der Nordostecke der ummauerten Stadt. An der von Natur am stärksten befestigten Ostseite Lüneburgs war der Winterhafen des Stadtgrabens flußabwärts gesperrt; hier stand mitten im Wasser ein niedriger Wachtturm mit einer Durchfahrt, der sog. B ä r (Behr). In den thorn boven der neddersten molen werden die zum Schild geborenen Missetäter gesteckt (1331). Im übrigen war die Linie des Stadtgrabens nur durch die vom wehrhaften Lüner- und Altenbrückertore unterbrochene Umwallung gedeckt. Ein Festungsturm, der M ü h – l e n z w i n g e r (torn bij der molen 1413) erhob sich erst wieder an der Südostecke der Stadt. Das korrespondierende Flußbett der Ilmenau zwischen Stammersbrücke und Baumbrücke war durch mehrere Türme, zumeist mit Dienstwohnungen städtischer Beamter, verstärkt. Am rechten Ufer: H o b o r g e s t o r n gegenüber der Lüner Mühle, gedeckt 1423; P e n n e c k e n d o r p p e s t o r n , identisch damit, 1471; torn baven der sluse dar trumper wanen 1500; torn by den heringesteghen dar Ekholt uppe wanet 1500; am linken Ufer: torn boven der neddersten molen [?] 1334; torn achter dem covente, achter den bagynen und torn achter des provestes have van Medinge 1500. Ein Turm am Schweinemarkt, der letzte vollständig erhaltene der alten Stadttürme, wurde 1823 abgebrochen; einer der letzten Türme, zwar nur noch eine turmartige Wohnung, der sog. K o o p m a n n ‘ s c h e T u r m an der Ilmenau, der (nordwestl.) Ecke des Kaufhauses gegenüber, auf der Salzstraße ist 1847 auf Abbruch verkauft.
∗
Salzmesser Turm mit Gang zu einer Notpforte, die nach der Salzstraße führte 1602. 253
Die Reihe der südlichen Türme setzte sich außerhalb des Walles fort mit der P a p e n m ü t z e (Pfaffenmütze) nahe der Stammersbrücke; ungefähr auf halbem Wege zwischen Ilmenau und dem Rotentore stand der F u l l h a k e n z w i n g e r ; ein wenig östlich der Rackerstraßenmündung der D r e c h s l e r z w i n g e r ; hier stand wohl auch der Turm, in alten Zeiten der Pestturm genannt (nach 1700); westlich vom Sülztore der S c h u s t e r z w i n g e r , erbaut von 1444, vielleicht identisch mit dem W e i ß e n T u r m und etwa auch dem B a r n i n g e r T u r m ; Schuh- und Pantoffelmacher Turm 1602; Böttcher Turm 1602; an der Südwestecke der Stadt der S o d m e i s t e r z w i n g e r , gleichfalls erbaut vor 1444. Die Türme der Innenmauer sind an diesen Strecken schwer nach dem Namen zu scheiden. Im Jahre 1439 werden vier torne achter der wedeme, doch wohl hinter der Pfarrei von St. Johannis genannt; 1490 Martens des Wechters t o r n a c h t e r d e r p r o v e s t y e. Büttner nennt einen W ä c h t e r t u r m an der Faulen Au (torn in der vulen owe 1461) am Ausgange der Rackerstraße; der Sültewechter Torm uf der Fulen aw 1602; unweit westlich davon fällt auf manchen Stadtansichten der nach seinem Schieferdache sog. b l a u e T u r m auf (torn van baven, Bürgergehorsam 1794), de hoge torn by der vulen ouwe (nach 1490), auch wohl der torn achter der vulen ouwe 1481. Nach Westen schaute als Schutz her Johan E l v e r s t o r n bzw. der torn (unde gangh) den her Johan Elver buwed 1500, später E l v e r -, B ö s c h e n -, auch M a n e c k e n z w i n g e r (torn baven der sulten) genannt. Unter dem Böschenzwinger floß die Faule Fahrt. Die drei hohen Türme am äußeren Wall wurden 1645 auf halbe Höhe, 1730, 1750 und 1777 völlig niedergebrochen. Die innere Sülzmauer, die den Sülzhof nach dem Walle zu umgab, hatte ehedem fünf hohe Türme: den W e i ß e n T u r m , als Sülzergefängnis benutzt, aus Kalkstein erbaut, wohl auch Steinbrücker Turm genannt, und zu den ältesten Bauwerken der Stadt gehörig den S e g g e r t u r m mit der Wohnung für den Obersegger, während des Michaelismarktes von zwei Einhardern und des Seggers Knecht bewacht, den B a r g e n -, B a r n i n g e s u n d B a r b a r a T u r m , 1765 abgebrochen. In der Nähe sind zu suchen Hans Magnus torn – Hans Magnus wird genannt als grote segger, zusammen mit Hinrik Semmelbecker; in diesem Turme fand die von einem neuen Sodeskumpane zu gebende Kost statt 1502 – ferner de hoge runde torn darby und de hoge torn by der nien bare; die beiden ersten begegnen 1491, der dritte, möglicherweise an der inneren Stadtmauer, 1500. In einem Turme bei der Sülze dicta turris dni. Bertoldi Langhen wird ein Kleriker in Fußfesseln gefangen gehalten 1482. Beim Sülzstaven erhob sich B o k s t e k e r s t o r n , erbaut 1449; der Turm V r e d e k e weiter nördlich, wurde in der Ursulanacht 1371 von einem Ratmann verteidigt; der torn neven dem langhen hove dar Hermen Pannendregher ynne wand 1500; der torn neven sunte Benedictus 1500. Das ganze Gesichtsfeld der Stadt beherrschte der Wachtturm auf dem Kalkberge, ein Überbleibsel der alten Burg, im Lauf der Jahrhunderte wiederholt erneuert; die Turmerker erforderten 1602 eine Ausbesserung. Vorm Kalkberge lag damals eine Pulvermühle. Der K a l k b e r g z w i n g e r am Neuentore, nördlich zu Füßen des Berges, erbaut 1533, abgebrochen 1798, macht den Beschluß unseres Rundganges. Außerhalb der Stadt an der unteren Ilmenau wurde gegen die Wende des Dreizehnhunderts ein torn jegen Lune errichtet, auch St u r l ü n e (torn in der wischk 1499) genannt, weil er den von Lüne aus die Schiffahrt bedrohenden Anschlägen der Herzöge steuern sollte. 254
Es muß dahingestellt bleiben, wo M y s s e n e r s t o r n 1497, der im Jahre 1566 verfallene und heruntergekommene s l a c h t e r t o r n und des gewesenen m a r c k t v o i g t t h o r n , jetzt profossenwohnung, 1643 zur Hälfte abgetragen, gestanden haben. Die im Vierzehnhundert aufgeworfenen, im Fünfzehnhundert ausgebauten Wälle verdankten ihren Namen zumeist ihrer Lage; die Bezeichnung Schützenwall, die in älteren Rechnungsbänden angewandt wird, weist auf den Zweck dieser Bauwerke (de schuttenwall vor der oldenbrugge 1435, de schuttenwall vor dem Bardewikeren dore 1445), hat also generelle Bedeutung. Ein Wall beim Stadtgraben außerhalb des Grimmertores wurde 1349 seitens des Knappen Hinrik von Schwerin der Stadt zugesichert, vielleicht vorher der Sitz eines Burgmannenhofes. Es ist eine Eigenart des mittelalterlichen städtischen Verteidigungswesens, daß die einzelnen Ämter und Innungen, wenn sie ihrer Wehrpflicht zu genügen hatten, unter ihren Alterleuten als Hauptleuten geschlossen auf den Plan traten. Die Umwallung als Verteidigungslinie wurde nach den einzelnen Gewerken verteilt, und es lag nah, daß die Gliederung der Schützenkette zu einer festen, ein für allemal bindenden Tradition wurde. So war die Besetzung des Kalkberges in Tagen der Not ein Vorrecht der Schlachter, und es konnten Namen entstehen, wie sie uns im vorstehenden Abschnitte über die Türme (Schuster-, Salzmesser- usw. Zwinger) in größerer Zahl begegnet sind. Von den Namen der Lüneburger Wälle ist nur ein einziger, analog gebildeter geblieben, der S c h i f f e r w a l l (in Hamburg entsprechend Glockengießerwall). Ein Ratserlaß von 1498 über Wacht und Wächter gliedert den Wallring folgendermaßen: 2 Wächter auf dem Walle zw. den Mauern van deme hogen torne in deme Grale wente an de Elmenowe, 4 Wächter van der bomkulen wente an de Elmenowe beneffen heren Johan Semmelbeckeres garden, 6 Wächter van der Elmenow na deme roden dore, sultedore wente an de holten planken by deme nyen walle, 2 Wächter van der holten planken uppe deme nyen walle wente an dat blockhusz hinder sunte Cyriacus. Die Bewohner der Stadtwehr und Türme waren am Nachtwachtdienst insofern beteiligt, als sie bei Verlust ihrer Wohnung den Nachtwächtern auf Anruf antworten mußten. Sämtliche Wälle der Stadt werden in einer Art Mobilmachungsbefehl des Rates vom Jahre 1500, wie folgt, aufgeführt: Wal achter sünte Ciriacus kerken; wal achter unser leven vrowen wente vor dat Bardewiker dor (zu besetzen durch Wollweber und Goldschmiede; 1490 twischen deme Bardewikeren dare unde deme hogen torne dosulves); wal van dem Bardewiker dore wente uppe der Elmenowe (auch de grote wal kegen Lune by der bomkulen; Kramer und Riemschneider); wal na der Elmenowe (Schiffer, schiplude); wal twisken dem Luner dor unde der oldenbrugge (Schmiede); wal van der olden brugghe wente to der papiresmolen (Schröder, 1490 wall twisschen der papirsmolen unde der oldenbrugge); wal van der molen wente vor dat rode dor (Bäcker; 1490 wal twisschen der 255
Elmenouwe unde deme roden dore); wal wente to dem zultedor (Haken); wal achter der zulten: a) wal van dem zultedore wente to hern Johan Elvers torn (Schuster); b) de andere wal achter der zulten wente an den kalkberch. Die Verordnung läßt erkennen, daß sich um 1500 feste Namen noch nicht gebildet hatten; 1602: Schiffleute-, Schneider-, Pelzer-, Sülte-, Schmiedewall; für den Pelzer Wall schien damals eine Erhöhung erwünscht, weil man von Kaltenmoor darüber hinwegsehen konnte. Im Achtzehnhundert waren die Bezeichnungen üblich: Gral-, Bardowieker- (in seiner östlichen Hälfte Kastanien-) Schiffer-, Schießgraben-, Roterund Sülzwall. Der Schutt der Lambertikirche, gegen Ende Sept. 1861 völlig weggeräumt, war nach dem Sülzwalle geschafft zur Ausfüllung des seit Jahren verschlämmten und bei niedrigem Wasserstande der Ilmenau einen unerträglichen Geruch aushauchenden Torfkanals. Beschluß, den ganzen Sülzwall und einen Teil des Rotenwalles abzutragen. Mitte Febr. 1862 Beginn mit der Abtragung des schon sehr erniedrigten und bepflanzten Sülzwalles; der Salintorfkanal zugeworfen. Siel für den von der Sülze herfließenden Kanal nach Abbruch der Stadtgrabenbrücke am Rotentore Okt.Dez. 1863. Wegräumung der Wälle im Osten der Stadt 1873. Zu erwähnen ist noch die im Jahre 1645 von einem Kommandanten des Kalkberges, v. Dannenberg, als Außenwerk angelegte Taterschanze, so genannt nach dem Sülzer Namens Tater, der den ersten Grabscheid einstieß; die Taterschanze wurde schon 1657 auf Veranlassung des Rats wieder abgetragen.
256
Register Mit Hinweis auf Straße und Steine Aachenfahrt s. zur Hasenburg 120. Aalfang. Aalkiste s. Baumstr. 75, am Werder 56. abbatis silva s. Zeltberg 217. abbatis valva s. unter der Burg 201, Anhang 227. Abort, öffentlicher, s. Altenbrückertorstraße 34, am Gralwall 42, Gummastraße 117, Ritterstraße 177, vor dem Rotentore 206, z. vgl. vrovenmak und vrowenhuseken. achter der abtey s. auf dem Michaeliskloster 66. Abteivorwerk s. auf dem Michaeliskloster 66. Abtshof s. bei der Abtsmühle 76, unter der Burg 200, bei der Lambertikirche 82, hinter der Sülzmauer 128. Abtsholz, des abbetes holt s. bei der Abtsmühle 76, Zeltberg 217. Abtskunst, Abtswasserturm s. bei der Abtsmühle 76, am Fischmarkte 40. Abtsmühle s. Ilmenaustraße 130, Rosenstraße 179. Abtsobstgarten s. bei der Abtsmühle 76. Abtstor s. bei der Abtsmühle 76, unter der Burg 201 u. Anhang 227. Abtswasserkunst s. bei der Abtsmühle 76, am Markte 49. Abtswasserturm s. bei der Abtsmühle 76, am Fischmarkte 40. Abtsziegelhaus s. vor dem Neuentore 205. Abtsziegelhof s. Salzbrückerstr. 183. acies, angulos, super quatuor- (Vierorten) s. Salzstraße 185. anberge, in deme :-- s. vor dem Neuentore 204. Ackenhausen Gang s. Engestr. 102. adaquationis equorum platea s. bei der Abtspferdetränke 77. advocatorum platea s. Lünerstr.155. aeramentariorum fusorum platea s. Grapengießerstr. 114. ad aggerem Lunensem s. auf dem Lünerdamm 154. Albers Insel s. Parkstr. 171. albilatorium senatus s. am Sande 52. Algier s. vor dem Rotentore 206. allecialis, allecium domus, allecum macella s. am Fischmarkte 40, Ilmenaustraße 130, Kaufhausstraße 144. Alte Brücke s. Altenbrückertorstr. 34. Alte Kanzlei s. Wagestr. 209. Altenbrückerbleiche s. Altenbrückertorstraße 35. Altenbrückertore, vor dem: s. Altenbrückertorstr. 35, am Altenbrücker Ziegelhof 35, Anhang 226. Altenbrückerwall s. Altenbrückertorstraße 34. Altenbrücker Ziegelhof s. auch Altenbrückertorstraße 35. Alteneuestraße s. auf dem Meere 65, Ohlingerstr. 165. Alten Tore, vor dem: s. Altenbrückertorstr. 34. ad altos gradus s. vor der Sülze 208, Anhang 222. Altstadt s. auch Judenstr. 140. amehof s. am Markte 49. trans ampnem saline s. Sülztorstr. 196. Amtsbude s. Schrangenstr. 167. Amtsgerichtsstube s. auf dem Michaeliskloster 66. Amtsschreiberwohnung s. Görges Straße 111. 257
Anatomiekammer s. Sülztorstr. 196. Andreas- u. Laurentiuskirche s. am Berge 37. In angulo civitatis s. Salzstraße a. W. 186, Viskulenhof 202. antiqua civitatis s. Judenstr. 140. antiqua nova platea s. Ohlingerstr. 165. apud antiquam salinam s. vor der Sülze 207. antiqui pontis valva s. Anhang 226. Antonifriedhof, -kapelle s. vor dem Bardowickertore 204. apiarium (Bienenzaun) s. zur Rotenschleuse 182. Apotheke s. Görges Str. 111, an der Münze 60, am Sande 52. apothekers garden s. Gartenstr. 107. aquam, iuxta -, prope -s. Ilmenaustr. 130. aquam, prope - aquarium s. Salzstr. a. W. 186. aquarum porta s. Kaufhausstr. 144. area deserta s. auf dem Wüstenorte 66. arena, in-, super arenam u. ähnl. s. auf dem Sande 51 f. Arendsee s. am Markte 48. Armenhaus s. auf dem Klosterhofe 64. Arnemanns Fabrik zu Gebhardis Zeit hinterm Reitplatz bei St. Benedikt. arenskule ohne nähere Angabe von Gebhardi aufgeführt (1794). arskarbe, arskerwe s. auf dem Harz 63. aschenkuhl s. Bastionstr. 74. Aue, die, s. Ilmenaustr. 130, faule Au s. Engestr. 102. Aumeisters Haus s. Baumstr. 75, Salzstr. a. W. 186. aurea platea s. Papenstr. 170. ad aureos gradus s. Anhang 222. Auslucht s. am Ochsenmarkte 50. Außenkaufhaus s. auf der Hude 69. Bachratzen Hof s. Visculenhof 202. Backhäuser s. Bardowickerstr. 73, hinter dem Brunnen 31, Conventstraße 96, Engestraße 102, Glockenstr. 110, Grapengießerstraße 114, Heiligengeiststraße 122, Ilmenaustraße 131, Judenstr. 140, bei der Lambertikirche 82, auf dem Sande 51, im Wendischen Dorf 136. Backhaus der Schiffer s. bei der Nicolaikirche 83. Backofen s. Altenbrückertorstr. 34. Badeanstalt s. Altenbrückertorstr. 35, Wandrahmstr. 211. Badehaus der Benediktiner s. Jägerstr. 138, auf dem Michaeliskloster 65. baden, gande-, ridende- s. Reitendedienerstr. 175. Badstube s. Altenbrückertor 35, auf der Altstadt 68, Holeek 129, Ilmenaustr. 130, bei der Johanniskirche 80, Judenstraße 140, im Karnapp 133, am Lindenbergertore 46, bei der Michaeliskirche, auf dem Michaeliskloster 65, Münzstr. 160, Rotestr. 182, Salzbrückerstr.183, am Stintmarkte 55, Wendischestr. 212. Bäckerherberge s. Bardowickerstr. 73, an den Brodbänken 58, Anhang S. 222. Bäckerstraße, Kleine, s. auch Glockenstr. 110. Bär, Wachturm s. Anhang 228. Bäume (zum Absperren) s. vor dem Bardowickertore 204, Baumstr. 74, am Lindenbergertore 46, Papenburg 170, bei der Ratsmühle 78, Salzstr. a. W. 186. bagunen, bi den - s. Conventstr. 96. Bagutenkonvent s. Conventstr. 95. Barbara Turm s. Anhang 229. 258
Barbiergesellen Herberge s. Bardowickerstr. 73. Bardewiker Domherrenhaus s. Bardowickerstr. 73, Burmeisterstr. 93, Neue Sülze 163. Bardowicker Kirchhof s. vor dem Bardowickertore 204. Bardowicker Mauer s. Altenbrückermauer 33. Bardowickermauer, hinter der – s. auch Baumstr. 74. Bardowickerstr. s. auch Bäckerstr. 116. Bardowickertor s. Bardowickerstr. 72, am Lindenbergertore 46, bei der Nikolaikirche 83, Anhang 226. Bardowickertore, vor dem – s. Gartenstr. 107. Bardowiker Wall s. hinter der Bardowickermauer 127, Baumstr. 75, Bardowickerstr. 74, Gartenstr. 107. Bardowikeren wech s. vor dem Bardowickertore 203. Bare, borenhaus s. Neue Straße 163, auf der Saline 71, vor der Sülze 207. Bargen Turm s. Anhang 229. Barhof, im bahrhofsgange s. Ohlingerstr. 166. Barmeherticheit, hus der – s. am Gralwall 42. Barmeistergang s. Ohlingerstr. 166. Barmeister Haus s. auf dem Harz 62. Bariniger torn s. auf der Saline 71, Anhang s. 229. baromagistrorum curia, borenhof s. Ohlingerstr. 166. Bars, Hans – Keller s. auf der Rübekule 70. barveten broderen, achter den – s. hinter der Bardowickermauer 127. Bastion s. am Lindenbergertore 46. Batterie s. Schießgrabenstr. 188. Bauhof s. unter der Burg 201, Glockenstr. 110, Neue Sülze 163, auf dem Wüstenort 67. Baumgarten s. bei der Johanniskirche 80 f. Baumhaus s. Baumstr. 75. Baumkuhlbrücke s. Baumstr. 75, Kaufhausstr. 145. Baumkule s. Baumstr. 75. Baumschreibers Haus s. Baumstr. 75. Baumschule, in der – s. am Wienebüttelerwege 57. Baumstr. s. auch hinter der Bardowickermauer 127. baven, torn van – s. Anhang 229. Beckersgang s. Neue Straße 163. bedelli domus, bodels hus s. Koltmann Str. 148, Rosenstr. 179. Beleuchtungspfanne s. m Markte 49. Bellevue s. Bürgergarten 92, auf dem Lünerdamm 154. Benedictes Hof s. vor dem Neuentore 205, in der Techt 138. Benedikthospital s. beim Benedikt 83, unter der Burg 201, in der Techt 138. Benedictikapelle, hinter St. – s. beim Benedikt 83, hinter der Sülzmauer 128. to den benesholte s. Böhmsholz 89. berchfred, Bergfried s. Altenbrückertorstr. 34, am Lindenbergertore 46, bei der Ratsmühle 78. Bereiters Hof s. beim Benedikt 83. berge, uppe dem s. auch im Grimm 132, beim Holzberge 84, Lünertorstr. 156. Berge, Hof der vom – s. unter der Burg 201, bei Wilschenbruch 215. Berghauer Gang s. hinter der Sülzmauer 128. berghud s. bei der Ratsmühle 78. Berginspektion s. beim Kalkberg 84. 259
betekalk s. am Kreideberge 45. betekalkeshaus s. auf der Hude 69. Bethkalkbrennerei s. auf der Hude 69. Beutlermühle s. bei der Ratsmühle 78. Bienenzaun s. Hasenwinkel 121, Rackerstraße 174. Bierkeller, Hamburger, s. Bardowickerstr. 73, auf der Rübekule 70. Biller struck, Bilmer Strauch s. Bilmerstr. 87. Bilne, villa – s. Bilmerstr. 87. Bischofs Hof s. am Gralwalle 42. in des biscopes kellere s. im Verdener Hof 136. Blauer Convent s. am Berge 37, Conventstraße 95. Bleckeder Heerstraße s. an der Bleckeder Landstr. 87. Bleiche, Altenbrücker, s. Altenbrückertorstr. 35. Bleicherberg, Bleichelberg gegenüber der Breitenwiese an der Ilmenau, 1727. Bleicherhaus s. auf dem Lünerdamm 154. Blekerwege, am – s. an der Rotenbleiche 61. Block mit Holzmaß s. auf dem Harz 62. Blömkensahl, Blümchensaal s. Altenbrückertorstr. 35, Blümchensaal 88. ad boarium forum s. am Ochsenmarkte 50. Bockshorns Turm an der Landwehr am Diksbek, nach Volger. Bockstekers torn s. Salzbrückerstr. 185. bodeker strate s. Baumstraße 75. Böschen Zwinger s. Anhang 229. Böttcher Amtshaus, Gildehaus s. hinter der Bardowickermauer 127, Lünerstr. 155, bei der Nicolaikirche 83. Böttchergarten s. Lünertorstr. 156, Parkstr. 172. Böttcherhaus des Bardowicker Domkapitels s. Bardowickerstr. 73. Böttcherstraße s. Baumstraße 75. Böttcherteich s. Gartenstr. 108. Blauer Turm s. Anhang 229. Bohlenweg s. Salzbrückerstr. 183. bokelsberg s. beim Bockelsberge 84, vor dem Rotentore 206. bokstekers torn s. Anhang 229. Bollwerk s. bei der Ratsmühle 79. bombardarum domus s. Glockenstr. 110. Bomkulen, bowen der – s. Anhang 230. bonesholte, to den, s. Böhmsholz 89. Bordell s. im Grimm 132, Holeek 129. borenhof s. Ohlingerstr. 166. achter der borgh s. Salzbrückerstr. 183. born, achtern – s. hinter dem Brunnen 126. borninge s. bei der Abtspferdetränke 77. bosebane, bosselbane s. vor dem Bardowickertore 204. Brandts Garten s. Gummastr. 118. Brauergesellschaft s. bei der Abtsmühle 76. Brauergildehaus s. Engestr. 102, Grapengießerstraße 114 Brauhäuser s. Finkstr. 105, Glockenstr. 110, Grapengießerstr. 114, Heiligengeiststraße 123, bei der Johanniskirche 80, Katzenstr. 144, Koltmann Str. 148, Lünerstr. 155, Lünertorstr. 156, auf dem Meere 65, bei der Nicolaikirche 83, Auf der Rübekule 70, Salzbrückerstr. 184, Salzstr. a. W. 186, am Sande 52, Schröderstr. 191, am Stintmarkt 55, vor der Sülze 208, in der Techt 138, im 260
Wendischen Dorfe 136, s. auch Anhang 223. Braunschweiger Chaussee s. Feldstr. 104. tom breden gefel s. Anhang 222. bredtun s. bei der Michaeliskirche, auf dem Michaeliskloster 78, 65, Neue Straße 162. Breite Wiese s. Baumstr. 75. Brekwinkel s. Brockwinklerweg 91. by dem Brijlen, in dem Brilen s. Ohlingerstr. 166. Brink, auf dem, s. auf dem Klosterhofe 64, ein „Brink“ an der „Heerstr.“ vor der Saline wurde abgetragen 1799; z. vgl. Anhang Turm uffm brink 228. Brinkhof s. beim Benedikt 84. brocklosengasse s. Seite 105 Note. am Brockwinklerwege s. am Wienebüttelerwege 57. Brodbänke s. auch Fink Str. 104. Brodhaus s. vor der Sülze 207. brodschrangen s. an den Brodbänken 57. brok s. Neue Straße 162. brotlose twite s. Fink Straße 105. Brüche s. im Grimm 133. Brücke s. am Lindenbergertore 46. Brückengeld s. Altenbrückertorstr. 33. Brückensteg s. am Werder 56. brugge, sunte Johanses – s. Altenbrückertorstr. 34 Brunnen (puteus), Sod, born s. Altenbrückermauer 33, auf der Altstadt 68, Große Bäckerstraße 115, Glockenstr. 110, Judenstr. 141, beim Kalkberge 85, am Marienplatze 47, am Markte 49, an der Münze 60, Münzstr. 161, Neue Straße 162, Neue Sülze 163, Ohlingerstr. 166, Rotemauer 181, Salzbrückerstr. 184, am Sande 52, Schröderstr. 191, vor der Sülze 207, an den Vierorten 59. brustwehr s. Bastionstr. 74. Buden, in den boden, s. Engestr. 102, Hokel 129, Judenstr. 141, im Karnapp 133, Kaufhausstr. 144, auf dem Meere 65, Neue Straße 162, Neue Sülze 163, bei der Nicolaikirche 83, Ohlingerstr. 166, Papenstr. 171, bei der Ratsmühle 79, Reitendedienerstr. 176, Rosenstr. 179, auf der Rübekule 70, auf der Saline 71, Salzbrückerstr. 184, Salzstr. 185, Salzstr. a. W. 186, Schröderstr. 191, am Stintmarkt 55, vor der Sülze 207, in der Techt 138, im Timpen 135, an den Vierorten 59, Wagestr. 209, im Wendischen Dorfe 136, auf dem Wüstenorte 66. Buden, steinere, s. bei der Johanniskirche 81, am Markte 48. Büchsenschützen s. Bardowickerstr. 74. Bürgermeisterstube s. am Ochsenmarkte 50. Bürgermeisterwerder s. am Fischmarkte 41, am Werder 56. Bürgerschule s. am Gralwalle 43, an der Münze 60. Bürgerwache s. auf dem Klosterhofe 64. Büttelei s. Koltmann Str. 148, Rosenstraße 179. in locco bullen s. Salzstr. a. W. 187. bullenhof, bullenstall s. Rotemauer 181. bullenorde, by dem – s. bei der Nicolaikirche 83, Salzstr. a. W. 186 f. bune s. auf der Hude 69. Buntenburg s. auch Anhang 222 ff. Burg, unter der -, zur Seite der – s. beim Benedikt 83. Burgmannenhöfe s. auf der Altstadt 67, unter der Burg 201, Görges Straße 112, am Gralwalle 43, im Grimm 132, Holeek 129, am Iflock 44, am Lindenbergertore 46, 261
auf dem Michaeliskloster 65, vor dem Neuentore 205, Salzbrückerstr. 183, Salzstraße 185, Schnellenbergerweg 190, in der Techt 138. burmesters garden, - hus, - thun s. Burmesterstr.93, am Fischmarkte 41, auf dem Meere 65, vor dem Rotentore 206. bussenhus s. Glockenstr. 110. buten der brügge s. Altenbrückertorstraße 34. Butenburg s. Buntenburg 92. Butterwiese s. am Graswege 44. cancellaria (Kämmerei) s. am Ochsenmarkte 50. campanarum platea s. Glockenstr. 110. Cantorat von St. Michaelis s. Neue Str. 163. iuxta capitolium s. bei Benedikt 83. caprarum area s. Ohlingerstr. 166. apud carnificinam, carnificum platea s. Schrangenstr. 166, Schröderstr. 191. casa in qua abluitur allec s. am Fischmarkte 40. castro, in -, sub -, prope castrum s. beim Benedikt 83, unter der Burg 201. caulium curia s. unter der Burg 201. Cavalleriekaserne s. Bäckerstraße 116 (Ordonnanzhaus). Celler Herberge s. Anhang 223. Celler Postweg s. Uelzenerstr. 200. Central Friedhof s. Soltauerstraße 193. cerdones, inter-, cerdonum platea s. am Berge 37, bei der Johanniskirche 81. chafot s. Altenbrückertorstr. 35. cimeterium, iuxta – (s. Ciriaci) s. Görges Str. 112. cimiterium, fratrum minorum s. am Marienplatze 47. cimiterium, s. Joh. s. bei der Johanniskirche 80. cimiterium, s. Michaelis s. bei der Michaeliskirche, auf dem Michaeliskloster 78, 65. cimiterium, s. Nicolai s. bei der Nicolaikirche 83. cimiterium capelle s. spir. s. Heiligengeiststraße 122. Clasings Gang s. Altenbrückermauer 33. Clubgarten u. –haus s. auf dem Meere 65, am Ochsenmarkte 51. Cohrs Garten s. vor dem Neuentore 205. communis domus s. Engestr. 102. Constabelbaracken s. beim Kalkberge 85. Constabelwohnungen s. am Gralwalle 42. consularis domus s.. am Markte 48. Conventsturm s. Altenbrückermauer 33. Cordes Hof s. auf dem Kauf 63. coriariorum area, – platea s. Altenbrückertorstr. 34, bei der Johanniskirche 82. corps de guarde s. am Markte 49, Salzbrückerstraße 185. Cratos Garten s. Schießgrabenstraße 188. critenhus s. am Kreideberge 45. croneskamp s. Böhmsholz 89. cuniculorum mons s. hinter der Bardowickermauer 127. curia edificii consulum s. Neue Straße 163. curia episcopalis s. im Verdener Hof 136. curia fratrum predicatorum s. Papenstraße 171. curia imperialis aule s. beim Kalkberge 84. curia rectoris s. Lamperti s. bei der Lambertikirche 82. custodia sacrorum s. vor der Sülze 208. 262
cygnus albus s. Bardowickerstr. 73. Cyriaks Friedhof, Pfarre, -wiese s. Görges Str. 112. Cyriakskirche s. auf der Altstadt 67, Hokel 129, am Lindenbergertore 46. Cyriakskirche und Küsterei s. vor dem Neuentore 205. Dachmunde, Dathmunde s. Wilschenbruch 215. Dachtmissen s. Wilschenbruch 216. Dankwertshof s. Rotemauer 181. Dannenberger Heerstr. s. Dahlenburger Landstr. 96. v. Dassel Gang s. Neue Straße 163. v. Dassel Neubau s. Bäckerstr. 116. David, bunter s. am Markte 49. Dempwolffs Apotheke s. am Sande 52. Denkqwering, Siedehaus s. auf dem Harze 62. Denksteine s. am Markte 49. depen dale, up deme s. im Grimm 132. super deserta area s. auf dem Wüstenorte 66. Detterdesstrate s. Koltmann Str. 148. Diener Straße s. Reitendedienerstr. 176. Dienstwohnungen s. an den Brodbänken 58, am Fischmarkte 40, Rosenstr. 179. dike, up deme s. am Fischmarkte 40, bei der Ratsmühle 79. dyken, twischen beiden – s. bei der Ratsmühle 78. dingfreie Häuser s. am Iflock 44. Distorper Klosterhaus s. Conventstr. 96. v. Ditmars Garten s. Gartenstr. 108. Ditter Straße s. Koltmann Str. 148. divitum platea s. Baumstr. 76, Visculenhof 202. tegen des doctors hus s. am Marienplatze 47. doliatorum platea s. Baumstraße 75. Domherrenhaus, Bardewiker – s. Bardowickerstr. 73, Burmeisterstr. 93, bei der Johanniskirche 81. domicellorum societas s. Bäckerstr. 116. Doppelers Gasthaus s. Rotemauer 181. twischen den doreten kisten im Denkelbok nach 1400. Drechslerzwinger s. Anhang 229. dore uppem hare s. auf dem Harz 62. drecke, uppem – s. auf dem Harz 62. Dritte Straße s. Gartenstr. 108. ad duas januas s. Anhang 222. ducum domus s. am Ochsenmarkte 50. düvelstrate s. Düvelsbrook 99. dunkles Tor s. beim Kalkberge 85. Ebstorfer Hof s. bei der Lambertikirche 82, Papenstr. 171, auf der Rübekule 70, Salzbrückerstr. 183, Salzstr. 186. egeldik, ezeldyke, bi dem s. im Grimm 132. Eibenlaube s. am Iflock 44. Eichamt s. vor dem Bardowickertore 203, am Markte 49. Einhorn Apotheke s. am Sande 52. Eisenbahn s. Altenbrückertorstraße 35, Bahnhofstraße 72, am Bleckeder Bahnhof 39, Dammstr. 97, an den Reeperbahnen 58. 263
ek, de hole – s. auf der Altstadt 68. Elend, langes s. Rotenbleicherweg 181. Ellenbergs Hospital s. Rotemauer 181. Ellenbogen, im krummen s. Wilschenbrucherweg 216. Elvers, Johann-Turm, Elver Zwinger s. Anhang 229. emporium retro – s. Kaufhausstr. 144. Engelshof s. hinter der Sülzmauer 128. equestris -, equitum auratorum platea s. Ritterstr. 177. equile senatus s. Burmeisterstr. 93. equorum piscina s. bei der Abtspferdetränke 77. Erdrutsch s. beim Kalkberg 84. Erholungsheim s. Munstermanns Kamp 161. Erste Straße s. Töbing Str. 199. Esel, hölzerner s. am Markte 49. Essigbrauhaus s. Rosenstr. 180. Estorffer Hof s. im Grimm 132. executoris iusticiae domus s. Rosenstraße 179. fabrice area s. Rotestraße 182 Färberei s. im Schießgraben 134, am Werder 56. Färbereistraße s. Wandfärberstr. 211. Fahrtmeisterhof s. Neue Sülze 163. faule Au, faule Fahrt, bi der fulen ouw, - s. Engestr. 102, Gummastr. 118, Heiligengeiststraße 122, Anhang 223. faule Sole s. Gummastr. 117. Feldmühle s. bei der Ratsmühle 78. felium platea s. Katzenstr. 144. Fikkendiek s. Vickenteich 201. finitorium retro – s. Johannis s. bei der Johanniskirche 80. Finkenherd s. vor dem Neuentore 205. Finx Garte s. Gartenstr. 108. Fischbänke, -buden s. am Fischmarkte 40, am Markte 48, am Sande 51. Fischerhäuschen s. beim Bockelsberge 84. Fischschrangen s. auf der Altstadt 68, am Markte 48. Fischmenger Haus s. Altenbrückertorstraße 34. Fischteich s. vor dem Rotentore 206. Fleischbänke s. Neue Sülze 163. Fleischschrangen s. Salzbrückerstr. 185. fodina cretaria s. am Kreideberge 45. Folterkammer s. Rosenstraße 179. fontem, penes -, fontis lapidei, in opposito – s. hinter dem Brunnen 126. fornificulorum platea s. Scherenschleiferstr. 188. in foro boario s. am Ochsenmarkte 50. foro, in – caprario s. Kalandstr. 143. in foro novo s. am Markte 47. in foro sardarum, sardorum s. am Stintmarkt 55. circa forum gubii, gubeorum s. am Stintmarkt 54. forum panum s. an den Brodbänken 58. forum piscatorum – piscium s. am Fischmarkte 40. forum sardarum s. am Stintmarkte 55. prope forum spirinchorum, spiringiorum s. am Stintmarkt 55. 264
fossa, fovea raparum s. auf der Rübekule 70. Franziskanerkloster s. bei der Abtsmühle 76, Lünertorstraße 156, am Marienplatze 47. Franzosenbrücke s. Lünertorstr. 157. fratres minores, prope s. auf dem Klosterhofe 64. prope fratres minores, fratrum minorum cimiterium, ecclesia s. am Marienplatze 47. Frauenhaus s. im Grimm 132, Neue Straße 162. Fredeke s. Sülzwallstr. 197. Frederich Haus s. Bäckerstr. 116. Freimaurer s. am Altenbrücker Ziegelhof 36. Friedenseichen, nahe dem Johanneum, von Schülern gepflanzt 1871. Fronleichnamsgildehaus s. Ohlingerstraße 166. Fronerey s. Baumstraße 75, Rosenstraße 179. frouwenstrate s. Neue Straße 162. frumenti platea s. Heiligengeiststr. 123. Fünfte Straße s. Töbing Str. 199. Fürstenhaus s. am Ochsenmarkte 50. Fürstensaal s. Bardowickerstr. 73. Fullhakenzwinger s. Anhang 229. fullunia rubra s. an der Rotenbleiche 61. fullonum platea s. Heiligengeiststr. 122. fusorum aeneorum, lebetum, aeramentariorum fusorum platea s. Grapengießerstr. 114. fusorum campanarum platea s. Glockenstr. 110. Gänge s. Altenbrückermauer 32. Gänseburg s. Goseburg 112. Gärten s. Altenbrückerdamm 32, Altenbrückertorstraße 35, vor dem Bardowickertore 204, Baumstraße 75, Gartenstr. 108, im Grimm 132, Gummastr. 117, Hasenwinkel 121, bei der Johanniskirche 80, am Kreideberge 45, am Lindenbergertore 46, Lünerdamm 154, Lünertorstr. 156, Lüner Weg 157, Neue Sülze 63, am Ochsenmarkte 51, vor dem Neuentore 204, Ovelgönne 170, Pannings Garten 170, Parkstr. 172, bei der Ratsmühle 78, an der Rotenbleiche 61, Vor dem Rotentore 205, Schießgrabenstr. 188. Gagelmannsgang s. Altenbrückermauer 32. Galgen s. Baumstraße 75, am Galgenberge 41. Galgen u. Rad s. Salzbrückerstr. 185. Galgenberg s. Köppelweg 147. Garbraterhaus s. am Markte 49. Garlopenhaus, Garlopenwohnungen s. Reitendedienerstr. 176, Neue Sülze 164. Garnisonfriedhof s. vor dem Rotentore 207. garthof s. unter der Burg 201. Gasthäuser: Römer, Heiligengeiststr. 123, Goldener Stern, Heiligengeiststr. 123, Goldner Mond, Heiligengeiststr. 123, Goldne Sonne, Heiligengeiststr. 123, Springender Hirsch, Heiligengeiststr. 123. Gastwirtschaft s. Bardowickerstr. 73. gazophilatium (Kirchenkasten) s. Scherenschleiferstr. 188. Gefängnis s. bei der Abtsmühle 76, hinter der Bardowickermauer 127, Burmeisterstr. 93, Wandrahmstr. 211, Anhang 227. Gehölz, s. bei Wilschenbruch 216. Gehrhof s. im Schießgraben 134. 265
Gelber Adler s. Anhang 223. gemak s. Altenbrückertorstr. 34. Georgii, s. – truncus s. auf der Altstadt 68. geranium s. Kaufhausstr. 144. Gerber-, Gehrhof s. Altenbrückertorstraße 34. Gerberstr., in der gerwern s. bei der Johanniskirche 81. by sunte Gertrude s. vor dem Rotentore 207. Gerichtsburmeisterey s. Burmeisterstraße 93. Gerichtsstätte s. Altenbrückertorstr. 33, auf dem Harz 62, am Markte 49. armarium s. Gertrudis s. Papenstr. 171. Gertrudencapellen, by sunte, s. an den Reeperbahnen 58, vor dem Rotentore 207. Gertruden Kirchhof s. Barckhausenstr. 72, vor dem Rotentore 206 f. Gesellschaft s. Bäckerstr. 116. Gewandhause, gegenüber dem -, hinter dem - s. hinter der Bardowickermauer 127, am Markte 49. Gildehaus der Maurer, der Zimmerer s. Grapengießerstr. 114. Gildehof s. Engestr. 102, bei der Nicolaikirche 83. Gießhaus s. Bastionstr. 74. Glahnstwite s. Johannisstr. 140. Glockengießerstr. s. Glockenstr. 110. Glockenhaus s. Glockenstr. 110. Glöcknerhaus s. bei der Johanniskirche 81. gobiorum forum s. Salzstr. a. W. 186. Gösebrink s. auf dem Klosterhofe 64. Göttgengang s. Salzbrückerstr. 185. Gogericht, goh tor olden brugge, s. Altenbrückertorstr. 33, am Galgenberge 41. Goheberg s. am Galgenberge 41. Goldbach, Goltbeke s. bei Wilschenbruch 215. Goldmannsstr. s. Koltmann Str. 148. Goldner Adler s. am Sande 52, Anhang 222. zum Goldnen Engel s. auf dem Sande 52, Anhang 222. zum goldenen Hahn s. Rotehahnstraße 180, Anhang 222. Goldene Krone s. Bäckerstr. 116, Anhang 222. Goldener Löwe s. Bäckerstr. 116, Anhang 222. Goldener Mond, s. Anhang 222. Golderden s. Anhang 222. Goldner Stern s. Heiligengeiststr. 123, Anhang 222. Goldene Sonne s. Anhang 222. Goldschmiedezwinger s. Anhang 228. Goldstraße s. Papenstr. 171, Rosenstraße 179. Goseburg s. Papenburg 170. Gotteshaus, Gotteswohnungen s. Papenstr. 171, Rotehahnstr. 180, Rotemauer 181. Gräben, bi dem graven, s. auf der Altstadt 67, vor dem Bardowickertore 203, Engestr. 102, Garlop Str. 107, im Grimm 132 (Berggarten), Gummastr. 117, Ilmenaustraße 131, Kaufhausstr. 144, am Lindenbergertore 46, Lünertorstr. 156, auf der Saline 70, Schnellenbergerweg 190, Anhang 229. prope gradus s. Wagestraße 209. Gral s. auch bei der Michaeliskirche 78, Anhang 228. in dem grale s. auch am Springintgut 54. Gralpforte s. am Gralwalle 42. Gralstift s. Feldstr. 104, am Gralwalle 42. 266
Gralstraße s. hinter der Bardowickermauer 127, Egersdorff Str. 100. Gralwall s. auch Bäckerstr. 116, Anhang 228. beim Grawen closter iegen dem rathause über das Herzogshaus, 1637. Grimm s. auch unter der Burg 201, am Lindenbergertore 46, vor dem Neuentore 204. Grymer Recht s. im Grimm 132. Grimmertor s. im Grimm 132, am Lindenbergertore 46, Anhang 227. gropengeteresstrate s. Grapengießerstraße 114. de grote torn s. Anhang 228. gruntwerk de frige gote s. bei der Ratsmühle 78. im gulden Arm s. Anhang 223. guldene treppe s. am Berge 38, Anhang 222. Güldengarten s. Gartenstr. 108, Anhang 224. Gumma s. Engestr. 102, Salzbrückerstraße 183. Häringbuden s. am Werder 56. heringhus, heringmarkt s. am Fischmarkte 40, Kaufhausstr. 144, am Stintmarkt 54. Häringsteg s. Altenbrückermauer 33, am Fischmarkte 40, Anhang 228. heringstette, -Stegl s. Conventstr. 96. Hagemanns (Hamanns) Hof s. Salzbrückerstr. 185. hagepiscinam, apud – s. Gartenstr. 108. Halseisen s. am Ochsenmarkte 50. Hamburger Keller, achter dem Hamborger kelre s. Judenstr. 141, auf der Rübekule 70. Hamburger Predigermönche s. bei der Johanniskirche 81. Hammenstede Haus s. Bäckerstr. 116. Hammerichs Hof s. am Berge 37. Handwerksämter s. Badowickerstr. 73. Handwerkskrüge (und Herbergen) s. Anhang 224 ff. Hannoversche Landstr. s. Uelzenerstr. 200. Harburger Chaussee s. Gartenstr. 108. Harburger Herberge s. Anhang 223. Harburger Straße s. Neuetorstr. 164. hare, uppem – s. auf dem Harz 62. Harmonie Klub s. am Markte 48. Harzkehr s. auf dem Harz 62. Hasenburg s. Uelzenerstr. 200. Hasenburger Bach s. Roteschleuse 182. hasenleger s. auf dem Harz 63. hasennegergasse s. Hasenwinkel 121. hasenporte s. Hasenwinkel 121. Haushaltshof s. am Wienebüttelerwege 56. Hausmarken s. Anhang 222. Hausnamen s. Anhang 220. hechte der stad s. hinter der Bardowickermauer 127. Hedemanns Garten s. Gartenstr. 108 Heerstraße, Lübecker s. Lünerweg 157. Heiligengeisthospital s. Böhmsholz 89, Heiligengeiststr. 122, Korb 149, Ritterstr. 178, Sülztorstr. 196. Heiligen-Geist-Kapelle s. am Markte 47. Heiligen-Geist-Privaet s. Gummastraße 118. Heiligen-Geist-Schule s. Heiligengeiststraße 123. 267
Heiligengeiststr. s. auch Anhang 222. Heiligental, Kloster s. am Berge 37. Heiligental, beim -, im sog. - s. am Berge 38. Heiligental s. Gartenstr. 107, Glockenstr. 110, Lünertorstr. 97. Heiligentaler Friedhof s. Wandfärberstr. 211. auf dem Heiligentaler Hofe s. Papenstraße 171. Heiligentaler Küche s. Papenstr. 121. Heiligentaler Propstei s. Papenstr. 121. Herberge der Beutler s. Salzstr. 186. Bäcker s. Salzstr. 186. Müller s. Salzstr. 186. Büchsenmacher s. Grapengießerstr. 114. Messerschmiede s. Grapengießerstr. 114. Riemer, s. Grapengießerstr. 114. Sattler, s. Grapengießerstr. 114. Schlosser s. Grapengießerstr. 114. Tapezierer s. Grapengießerstr. 114. Färber s. am Sande 52. Gelbgießer, s. am Sande 52. Handschuhmacher s. am Sande 52. Kupferschmiede s. am Sande 52. Tuchmacher s. am Sande 52. Weißgerber s. am Sande 52. Zinngießer s. am Sande 52. Reper s. Schröderstr. 192. Schornsteinfeger s. Schröderstr. 192. Wollweber s. Heiligengeiststr. 122. Grobschmiede s. Heiligengeiststr. 123. Riemergesellen s. Heiligengeiststr. 123. Herberge zur Heimat s. Wallstr. 210. Herbergsnamen s. auf dem Kauf 63, Anhang 222. der heren garthof s. unter der Burg 201, Herenhof hieß 1706 der Platz des alten Fürstenhauses. der heren holt s. im Tiergarten 135. heren stalle, by der s. Burmeisterstr. 93. hertoghen, in des – boden, achter des – huse s. Reitendedienerstr. 176. Herzogshaus s. Reitendedienerstr. 176. Herzogsschloß s. am Markte 49. hilgenborn s. vor der Sülze 207 f. Hilligendale, achter dem -, bei dem – s. am Berge 37. am Himmelreich s. vor der Sülze 208, Anhang 222. Hingstbeke s. Sülzwiese 197. Hoborges torn s. bei der Lünermühle 77, Anhang 228. Hochgericht s. Dahlenburger Landstraße 96. Hochwasser s. Kaufhausstr. 145. Höhere Mädchen s. Feldstr. 104. hölzerner Herrgott s. Anhang 222. uppe yennehalve dem hogen cruce s. Sülztorstr. 196. by, to dem hogen torne s. am Springintgut 54, Anhang 228. achter dem hogen trede s. auf der Saline 71, vor der Sülze 208, Anhang 222. 268
Hohe Batterie s. Schießgrabenstr. 188. Hohengarten, beim – s. Elversstraße 101, Lauenstein Str. 152. zum hohen Kreuz s. Anhang 222. hoher Turm s. am Gralwalle 43, Anhang 228. Hoyemanne, achter – s. Apothekenstr. 61. Holzberg s. am Schützenplatze 53. Holzhaus (domus lignea) s. Bäckerstraße 116. Holzhof s. am Marienplatze 47, Ohlingerstr. 166, Papenstr. 171, Salzstr. 186, in der Techt 138. Holzhude, holt hude s. bei der Abtspferdetränke 77, beim Holzberge 84, auf der Hude 69, Lünertorstr. 156, vor dem Rotentore 206. Holzlager s. am Gralwalle 42, beim Holzberge 84. Holzvogtswohnung s. Roteschleuse 182. up dem hore, uppe dem hare s. auf dem Harz 62. Hospital, französisches s. auf dem Klosterhofe 64. hovetmannes, des – hus s. am Markte 48. achter Hoyemanne s. Apothekenstr. 61. hude s. auch vor dem Rotentore 206. Hudenwächterhaus s. auf der Hude 69. hus, uppe dem – unter der Burg 201. iflofe, in dem – s. am Iflock 44. Iflock s. hinter dem Brunnen 126. am Iflock s. auf dem Meere 65. Ilmenaustr. s. auch am Berge 37. Immenzaun s. im Tiergarten 135. imperialis aulae curia s. beim Kalkberge 84. Impoststube s. Ilmenaustr. 131. insolatorium, prope – s. an der Rotenbleiche 61. Interimskaufhaus s. auf der Hude 69. Irrenhaus s. Breitewiese 90. Isenhagener Hof s. Altenbrückermauer 33, am Berge 38, bei der Johanniskirche 80, in der Techt 138. Jägerhaus s. Jägerstraße 138. Jägerteich s. Jägerstraße 138. Jahn Straße s. Schanzenweg 187. Jammer, langer s. Gartenstr. 108. januas, ad duas s. Rosenstr. 179. Jerusalem s. Zeltberg 217. Johanneum s. Bardowickerstr. 74., (Turnplatz) am Gralwalle 43, Haage Str. 118, bei der Johanniskirche 80, Kalandstr. 142, Papenstr. 171, Rotemauer 181, im Tiergarten 135. Johanniskirchhof s. Altenbrückertorstr. 34, bei der Johanniskriche 80. Johannis Küsterei s. am Sande 52. Johannis Pfarrhaus s. bei der Johanniskirche 81. Johansen brugge, sunte s. Altenbrückertorstr. 34; in sunte Johanses strate, Schoßrolle von 1458 im Marktviertel. Judengraben s. am Werder 56. Judenhaus s. Reitendedienerstr. 176. Judenkirchhof s. Salzbrückerstr. 185. 269
Judenschule s. Judenstr. 140. Judenstr. judeorum platea, judeos, apud – s. auch auf der Altstadt 68, Judenstr. 140, Salzbrückerstr. 184, an den Viertorten 59. Jürgensblock s. auf der Altstadt 68. Jüttkenmoor, up dem – s. vor dem Neuentore 205. Jungfernstieg s. am Ochsenmarkte 50. Junker Gildehaus s. Bäckerstr. 116. Justitz s. Baumstr. 75, am Markte 49. kaelstrate, koelstrate s. Ohlingerstr. 166. Kagelbrüder Gesellschaft s. Bardowickerstr. 74. Kak s. am Markte 49. Kaland-, Kalanderstr. s. auch bei der Johanniskirche 80. kalandes, des – hus s. Altenbrückermauer 33, Kalandstr. 142. Kalandshof s. Altenbrückermauer 33. Kalandesholt s. Kalandstr. 143. Kalandsplatz s. Rotemauer 181. Kalkberg s. auf der Altstadt 67, unter der Burg 201, im Grimm 131, vor dem Neuentore 204, Anhang 229 (Kalkbergzwinger). Kalkbrüche s. am Kreideberge 45. Kalkhaus s. vor dem Neuentore 204. Kalkhude s. auf der Hude 69. Kalkkuhle, in der – s. vor dem Neuentore 205. Kalkschuppen s. auf der Hude 69. Kaltenmoor s. auch am Gralwalle 43. Kammachertwite s. vor dem Rotentore 206. kamp by sunte Gertruden s. vor dem Rotentore 207. Kanal s. auf der Hude 69. Kaninchenberg s. hinter der Bardowickermauer 127. Kanzlei des Rates, alte – s. am Ochsenmarkte 50, Wagestr. 209. Kastanienwall s. hinter der Bardowickermauer 127, Baumstr. 75. Katharinengildehaus s. Grapengießerstr. 114. Katholische Kirche s. Rotestr. 183 u. Friedenstraße 106. kattenstrate s. Katzenstr. 144. Kattundruckerei s. Wandrahmstr. 211. Kaufhaus s. am Fischmarkte 40, auf der Hude 69, Lünertorstr. 156. Kaufhaus bei der Lünermühle s. Kaufhausstraße 145. Kaufhausbrücke s. Kaufhausstr. 144. Kaufhausschauer s. auf der Hude 69. Kaufhaus Spritzenturm s. am Werder 56. Kavalleriekaserne s. Lünerdamm 154 kaventkloster s. am Fischmarkte 41. Kegelbahn s. vor dem Bardowickertore 204, im Schießgraben 134. kellergradt s. Rosenstr. 179. Kemnade s. am Berge 38. kerkhove, vor dem – s. bei der Johanniskirche 80. Kessel, im – s. beim Kalkberge 85. Ketten s. beim Benedikt 84, Heiligengeiststr. 123, auf der Hude 69, am Iflock 44, Katzenstr. 144, Koltmann Str. 148, Lünerstr. 155, Wagestr. 209. Kindergarten s. Neue Sülze 164. Kinder- und Versorgungsheim s. Hasenburg 120. 270
Kinderhospital s. Barckhausen Str. 72. Kirchenkastenwohnung s. Scherenschleiferstr. 188. Kirchhof, roter s. vor dem Rotentore 206. Kiste s. Engestr. 102. Kleine (klene) Straße s. Enge Str. 102, Kalandstr. 143, bei der Ratsmühle 79, in der Techt 138. Kleine Sülzstr. s. Salzbrückerstr. 184. Klempner Herberge s. Bardowickerstraße 73. Klokkenhove, in dem – s. Glockenstraße 110. Klosterdeich s. Jägerstr. 138. Klostermauer s. Klostergang 146. Klubhaus s. auf dem Meer 65. knapp, im s. im Karnapp 133. knechtewisch s. vor dem Rotentore 206. knöcherner Herrgott s. Anhang 222. Kochanstalt s. Altenbrückermauer 33. Haus der Köche s. auf dem Meere 65. koelstrate s. Ohlingerstr. 166. König von Engelland s. Anhang 223. Königshof s. Rotemauer 181. Königsweg – ein Garten vor dem Neuentore wird 1655 bezeichnet ad aciem viae regiae. Köpkenberg s. Altenbrückertorstr. 35, Köppelweg 147. köterkaben s. Wandrahmstr. 211, Anhang 228. in dem kogeltimpen s. im Timpen 135. kokenstrate s. Glockenstr. 110. Konsulatswerder s. Altenbrückermauer 33. koop, im -, by deme kope s. auf dem Kauf 63, Salzstr. a. W. 187. Koopmannsche, der – Turm s. Anhang 228. korehuse, by deme – s. Neue Sülze 164. kornehus s. Glockenstr. 110, Heiligengeiststraße 123. Kornmarkt, Kornstr. s. Heiligengeiststraße 123. Kornmesserstand s. am Sande 52. Korrektionshaus s. auf dem Klosterhofe 64. kostery, bi der – s. am Sande 52. kovente, achter dem – s. am Fischmarkte 41. Kramerzwinger s. Anhang 228. Kran, achter deme krane, s. am Fischmarkte 40, Ilmenaustr. 131, Kaufhausstr. 144, Lünertorstr. 156. Krankenhaus s. Klostergang 146, Wandrahmstr. 211. Kreitenbruchsofen s. auf der Hude 70. Kreitenkule s. Gartenstr. 108. Kriegskanzlei s. Bäckerstraße 116. krytenberch s. Kreideberge 45. kritenhus s. auf der Hude 69. kritenkule s. am Kreideberge 45. Krögers Gang s. hinter der Sülzmauer 128. Kronenhof s. Altenbrückermauer 33. Krügers Hof s. Altenbrückermauer 33. im krummen Ellenbogen s. Wilschenbrucherweg 216. Künnekenhof s. Neue Straße 163. 271
Künte s. Anhang S. 222. Küsterhaus, s. Bardowickerstr. 73, bei der Johanniskirche 81, bei der Lambertikirche 82, am Markte 48, vor dem Neuentore 205, Salzbrückerstr. 184, am Sande 52, vor der Sülze 207. Kuhle s. auf dem Meere 65. Kuhlengräberhäuser s. Gummastr. 118. Kuhlengräber Straße s. Kalandstr. 143. Kumbholz s. Baumstr. 75. uppe deme kusele s. hinter der Saline 128, Schoßrolle zu 1426 im Marktviertel. Lachskule s. bei der Abtsmühle 76. Lambertes, uppe sunte – hove s. bei der Lambertikirche 82. Lambertihospital s. Salzbrückerstr. 183. gegen St. Lambertikirche s. vor der Sülze 208, Anhang 231. Lamberti Pfarrhaus s. bei der Lambertikirche 82, Papenstr. 171, auf der Rübekule 70, Salzbrückerstr. 183. Lamberti platea s. bei der Lambertikirche 82. Lambertiplatz s. bei der Lambertikirche 82. bei Lammers kerk s. bei der Lambertikirche 82. Landes Heil- und Pflege-Anstalt bzw. Landeskrankenhaus s. Brockwinklerwege 91. Landgericht s. Bardowickerstr. 73, am Markte 49. Landwehr s. Baumstr. 75, am Berge 37, Böhmsholz 89, Buntenburger Weg 93, Hasenburg 120, Papenburg 170, Tangerwiese 197. in dem langen huse, Langer Hof, s. auf der Altstadt 67, am Marienplatze 47, Salzbrückerstr. 184, Sülzwallstr. 197, in der Techt 138. Langen Turm s. Anhang 229. Langes Elend s. Rotenbleicherweg 181. Langes Handtuch s. Anhang 222. lanificum platea s. Heiligengeiststr. 122. lapides, ad – s. auf dem Harz 62. lateraria suburbana s. vor dem Neuentore 205. laterum domus s. am Altenbrücker Ziegelhof 35. Lazarett s. Breitewiese 90. lehmkampe, by dem s. Korb 149. Leimsiederhof s. Gummastr. 118, Kalandstr. 143. Lerchenberg s. am Wienebüttelerwege 57. by deme lerkesberge s. am Wienebüttelerwege 57. Leuchte s. Anhang 222. unser leven frowen kloster, tegen – s. am Gralwalle 42. libre publice platea s. Wagestr. 210. achter dem hilgen lichame, Bezeichnung der Schoßrolle von 1465, und zwar im Sülzviertel vor der Ritterstr., hinter der Schlägertwiete. Liebfrauengildehaus, dat hus negest deme gange der olderlude unser leven frouwen gilde 1497. Lindenberg s. vor dem Bardowickertore 204, Elversstr. 101. Lindenberger Tor s. vor dem Neuentore 204, Anhang 227. linea arx s. Salzstr. 186. Linnenbleiche s. Altenbrückertorstr. 35. linteariorum platea s. Heiligengeiststraße 123. Lizentdienerwohnung s. vor dem Bardowickertore 203, vor dem Neuentore 205, Rotestr. 182. 272
Loch, das neue – s. auf dem Meere 65. Lösegraben und Brücke s. Altenbrückerdamm 32, Ilmenaustr. 131, Lünertorstr. 157. Löwenkule s. Bastionstr. 74. logen bank, an der s. Lünertorstr. 156. Lohgerberei s. Altenbrückermauer 33. Lohmühle s. bei der Ratsmühle 78. Lohstöters Gang s. Ohlingerstr. 166. lohus s. im Schießgraben 134. longa curia s. Salzbrückerstr. 184. Lopaus Durchgang s. am Berge 37 f. Luchte s. auf der Saline 71. Ludmerfeld, auf der Luttmer, Lutmunde s. am Markte 48, Vickenteich 201. Lübecker Heerstr. s. Lünerweg 157. Lüdersburg s. Altenbrückertorstr. 33. Lüneburg, die – s. auf der Altstadt 67, im Grimm 132. Lüner Amtshaus s. Breitewiese 90. Lüner Bleiche s. auf dem Lünerdamm 154, am Fischmarkte 40, Lünertorstraße 156. Lünerkamp s. Lünertorstr. 156. Lüner Klosterhaus s. Bäckerstr. 116, am Berge 38, auf dem Kauf 63, Lünerstr. 155, bei der Nicolaikirche 83, am Stintmarkt 54, Visculenhof 202. hinter der Lüner Mauer s. am Werder 56. Lüner Mühle s. am Fischmarkte 40. Lüner Propsteihaus s. auf dem Kauf 63. des provestes van Lune molen s. bei der Lünermühle 77 u. Lünerstr. 155. Lüner Rauchhaus s. Lünerstr. 155. Lünertor s. Altenbrückerdamm 32, Kaufhausstr. 144, Lünerdamm 154, Anhang 226 f. achter Lünertor s. am Werder 56. luna, porta quae a – nomen habet s. Lünertorstr. 156. Lunabrunnen s. am Markte 49. Lunaris, Lunensis valva s. Lünertorstraße 156. in monte Luneburgensi s. beim Kalkberge 84. ad Lunensem aggerem, in molae Lunensis aggere, s. auf dem Lünerdamm 154. macella allecum s. am Fischmarkte 40. macella inter – carnificum s. Schrangenstr. 166. macella panis s. an den Brodbänken 58. macellaris, macellinaria platea s. Schrangenstr. 166. macellorum platea s. Neue Sülze 164, Schrangenstr. 166. Mädchenschule, höhere s. Gravenhorststr. 115. Hans Magnus Turm s. Anhang 229. Malerherberge s. Bardowickerstr. 73. Maneckenzwinger s. Anhang 229. manhus s. auf der Hude 69. Mariengilde s. auf der Altstadt 67. Marienbrüderschaft, Gildehaus s. vor dem Neuentore 204. Marienfriedhof s. Neue Sülze 164. Marienkapelle, gegenüber der – s. am Marienplatze 47. Marienkirche, hinter Saint – s. am Gralwalle 43. Marienkirchhof s. auf der Altstadt 68, am Marienplatze 47. Marienkloster s. auf dem Klosterhofe 64. mari, in – maris platea s. auf dem Meere 65. 273
Markt s. an den Brodbänken 58. Marktfahne s. am Markte 49. Marktordnung s. auf der Altstadt 68, am Markte 49. Marktturm s. am Markte 48. Marktvogtturm s. Anhang 230. marstalle, by deme – s. Burmeisterstr. 93, auf dem Klosterhofe 64, Rosenstraße 179. Mauer, achter der – s. auf der Altstadt 67, Baumstr. 75 f., Burmeisterstr. 93, Engestr. 102, am Fischmarkte 40, Görges Str. 111, am Gralwalle 43, im Grimm 132, Gummastr. 118, Heiligengeiststr. 123, Holeek 129, Ilmenaustr. 130, bei der Johanniskirche 81, bei der Lambertikirche 82, am Lindenbergertore 46, Lünertorstr. 156, bei der Michaeliskirche, auf dem Michaeliskloster 78, 65, vor dem Neuentore 204, bei der Ratsmühle78, Ritterstr. 178, vor dem Rotentore 205, auf der Saline 70, Salzbrückerstr. 184, vor der Sülze 207, Sülztorstr. 196, im Timpen 135, Visculenhof 202, Anhang 227. Maurergildehaus s. Grapengießerstraße 114. Mauriciesz, sunte – Hof s. bei der Lambertikirche 82. Max – Wiesche s. auf der Hude 69. Mecklenburger Herberge s. Anhang 223. v. Meding Hof s. am Gralwalle 43. Medinger Klosterhof s. am Berge 38, bei der Johanniskirche 80, auf dem Kauf 63, auf dem Wüstenorte 67, Anhang 228. Medinger Kornhaus s. Wandfärberstr. 211. Meer, am Meere, auf dem Meere s. auch auf der Altstadt 68, hinter dem Brunnen 126, Neue Straße 162. Meiers Gang s. Ohlingerstr. 166. Meinbeks Turm, nach Volger am Dieksbek in der Landwehr. Meinekenhop, Meinwerdeshop, s. Schnellenbergerweg 190. Meinken Werder s. Altenbrückermauer 33. Meynwerdes hop s. Meinekenhop 159. mercatorum domus s. Ilmenaustr. 131. mercimoniorum domus s. Kaufhausstraße 144. mestershus des Michaelisklosters s. auf der Altstadt 68. Michaelisfriedhof s. Görges Str. 111. vor der Michaeliskirche s. Görges Straße 111. Michaeliskirchhof s. auf der Altstadt 68. Michaeliskloster s. bei der Abtsmühle 76, auf der Altstadt 68, brinkhof s. beim Benedikt 84, (Abtskurie) s. unter der Burg 201, (Prioratshaus) s. am Gralwalle 42, (Reitbahn) s. am Gralwalle 43, ferner im Grimm 132, Holeek 129, Jägerstr. 138, Lauenstein Str. 152, auf dem Meere 65, Neue Straße 163, vor dem Neuentore 204, am Wienebüttelerwege 57. Michaelismarkt s. auf der Altstadt 68, Grapengießerstr. 114. Michaelis Pfarrhaus s. Görges Str. 111, Salzbrückerstr. 185. neffen s. Michaelis porten s. bei der Michaeliskirche 78. Michaelisschule s. auf der Altstadt 68, unter der Burg 201, auf dem Meere 65, bei der Michaeliskirche 78, in der Techt 138. s. Michaelis stiegele s. bei der Michaeliskirche 78. Militärhospital s. Altenbrückermauer 33. militaris militum platea s. Ritterstraße 177. misericordiae domus s. am Gralwalle 42. modekiste, Schlammkiste s. Altenbrückertorstraße 34. 274
Modestorpe, Goh s. Altenbrückertorstraße 33. v. Möllers Hof s. am Gralwalle 43. Mönchsgang s. auf dem Michaeliskloster 66, Anhang 228. Mönchsgarten s. Görges Str. 111. molaris platea s. bei der Abtsmühle 76. molendinaris domus s. bei der Johanniskirche 80. molendinaris, molendinorum platea s. Rosenstraße 179, Rotehahnstr. 180. molendinis curia s. bei der Ratsmühle 79. molenkamp s. bei der Ratsmühle 78. molenstrate s. Rosenstr. 179. ohnweit der Molkenkammer vor dem Altenbrückertore werden im Jahre 1720 Gärten erwähnt. monetaria civitatis, monetaria platea s. an der Münze 60. iuxta monetariam, montarii domus s. Münzstr. 60, Schröderstr. 191. monneke dyk s. Jägerstr. 138. mons cretosus s. am Kreideberge 45. mons cuniculorum s. hinter der Bardowickermauer 127. mons Luneburgensis s. beim Kalkberge 84. mons sementi s. beim Kalkberge 84. montana platea, montem, supra – s. am Berge 37. Moths Werder s. Altenbrückermauer 33. Mühlenhaus s. Kalandstr. 143. Mühlenhof s. Gummastr. 118, bei der Ratsmühle 78. Mühlenkanal, Lüner s. Lünertorstraße 157. Mühlensteine s. Bardowickerstr. 73, vor dem Bardowickertore 203, Kalandstr. 143, am Marienplatze 47, bei der Ratsmühle 79. Mühlenstr. s. Rosenstr. 179. Mühlenteich s. am Fischmarkte 40. Mühlenwehr s. bei der Abtsmühle 77. Mühlenzwinger s. Anhang 228. Münze s. am Markte 48, auch Schröderstr. 191, Wagestr. 209. Münzerstr. s. Münzstr. 161. Münzstaven s. Münzstr. 161. Multergildehaus s. Engestr. 102. Mumpeleres kamp s. vor dem Rotentore 206. muntestrate s. Finkstr. 105. muren, by der, juxta murum s. Rotemauer 181. penes murum Bardovicensem s. hinter der Bardowickermauer 127 f. prope murum portae Lunensis s. am Werder 56. Museum s. Wandrahmstr. 211. Mysseners torn s. Anhang 230. Neubrückertor s. Ilmenaustr. 131, Lünertorstr. 156. Neue Apotheke s. auf dem Meere 65. Neue Brücke s. auf dem Kauf 63, Kaufhausstr. 144. Neue Münze s. Schröderstr. 209. Neuentor, vor dem s. Görges Str. 111. Neuer Friedhof s. Görges Str. 111 Neuerhof s. Salzbrückerstr. 185. Neue Saline, Neue Sülze s. auf der Saline 71, Salzstr. 185. Neues Tor s. Görges Str. 111, Hasenwinkel 121, beim Kalkberge 84, bei der 275
Lambertikirche 82, am Lindenbergertore 46, Anhang 226. Neumannsgang s. Ohlingerstr. 166. Neumarkt s. am Markte 47, am Ochsenmarkte 50. Neustadt s. auf dem Klosterhofe 64, am Markte 47 Note. Nicolai, sunte – hus s. vor dem Bardowickertor 204. sunte Nicolai strate s. bei der Nikolaikirche 83. Nicolaihof s. Große Bäckerstr. 115. Nicolaikirche s. Baumstr. 75. Nicolaikirchgeschworene s. Bardowickerstr. 73. Nicolaikirchhof s. Baumstr. 76. Nicolai Küsterhaus s. Bardowickerstraße 73. Niedermühle, Niederstemühle s. bei der Abtsmühle 76. nieflock, achtern – s. am Iflock 44. tor Nienbruche s. Ilmenaustr. 131. nienlande, uppe dem – s. bei der Johanniskirche 81. nienlock, hinterm s. am Iflock 44. notariatus domus s. Wagestr. 209. Notstall s. Grapengießerstr. 114, Heiligengeiststraße 122. nova platea s. Judenstr. 140, Ohlingerstraße 165. nova terra s. bei der Johanniskirche 81. in novo foro s. am Markte 47 f. prope novum forum s. Wagestr. 209. ad novum pontem s. Lünertorstr. 156. prope novum s. spiritum s. Heiligengeiststraße 122. Nyendore, vor deme – s. im Grimm 133. de nye strate by der bare s. Neue Straße 163. Oberseggerhaus s. auf der Saline 71. bi deme oberservatenkloster s. am Marienplatze 47. Obstbaumplantage s. am Wienebüttelerwege 57. Obstgarten der Propstei s. bei der Johanniskirche 80. Ölmühle, ut der olyemolen s. bei der Ratsmühle 78 f. Ohlingerstraße s. auch Neue Straße 162. Oldekop Wall s. am Schifferwall 53. Oldenbrügge, Goh s. Bleckeder Landstr. 87. oldenigestrate, ole nye strate s. Ohlingerstr. 165 f. olden lande, up dem s. bei der Johanniskirche 81. Oldenstädter Hof s. bei der Johanniskirche 81. Oldenstädter Klosterhaus s. bei der Johanniskirche 80, Wandfärberstr. 211. olerum platea s. Ohlingerstr. 166. ollificum, ollifusorum platea s. Grapengießerstr. 114. uppe de orde s. an den Vierorten 59. Organistenhaus s. Ohlingerstr. 166. apud ortum ferarum s. im Tiergarten 135. up dem overen dike s. bei der Ratsmühle 78 f. in der overen molen s. bei der Ratsmühle 79. in pago vandalico s. im Wendischen Dorfe 136. Palatium s. am Ochsenmarkte 50. panaria, infra -, apud panistra s. an den Brodbänken 58. platea ante domum panis s. vor der Sülze 207. 276
pannicidarum domus s. am Markte 48, Wagestr. 209. papegorienbom, papeghoyen schuten s. vor dem Bardowickertore 204. Papengarten s. Gartenstr. 108. Papenmütze s. Anhang 229. papentwite s. Papenstr. 171, auf der Rübekule 70. Papiermühle s. Baumstr. 75, Hasenburg 120, bei der Ratsmühle 78, Anhang 230. partekenkrog s. am Berge 37, Anhang 222. parva platea s. am Stintmarkte 54, Wagestr. 209. Pechpfanne s. Wagestr. 209. Paulinerhaus s. bei der Johanniskirche 81. pellipariorum platea s. bei der Johanniskirche 81. in acie pennarii s. an den Brodbänken 58. Pennekendorppes torn s. bei der Lünermühle 77, Anhang 228. penningbank s. bei der Lambertikirche 82. perdebornynge s. bei der Abtspferdetränke 77. Perlenstr., nach Gebhardi „angeblich“ für die Kalandstr. gebraucht (1794). Perruquiers Herberge s. Bardowickerstraße 73. pestilentzenhus s. auf der Breiten Wiese 90. der Peweler hof, Peweleren, by den – s. bei der Johanniskirche 81, Papenstr. 171. uppe der Pewler orde s. Papenstr. 171. Pfahlbauten s. am Fischmarkte 40. zur Pferdehütte s. in der Weide 138. Pferdeschwemme, Pferdetränke s. bei der Abtspferdetränke 77. Pfingststr. s. Fink Str. 105. Pflasterung s. Altenbrückertorstraße 34, Bäckerstraße 116, beim Benedikt 84, am Berge 38, am Fischmarkte 40 f., auf dem Harz 62, Kaufhausstr. 144, Korb 149, bei der Lambertikirche 82, am Markte 48, Rotemauer 181, Schrangenstr. 167, auf der Saline 71, Wagestr. 209, am Wienebüttelerwege 57. pharmacopolae platea s. Apothekenstraße 61. Physikatshaus s. Bäckerstr. 116, Wagestraße 209. uppe der pipers molen Schoßrollen von 1457 im Sandviertel (in turribus). piscatorum, piscium forum s. am Fischmarkte 40. piscatorum scampna s. auf der Altstadt 68, am Markte 48. pistrina s. Engestr. 102. Plan s. Altenbrückertorstr. 34, Glockenstr. 110, Kaufhausstr. 145, am Markte 48. Planken s. bei der Abtspferdetränke 77, Ilmenaustr. 130, Kalandstr. 143, Neue Straße 163, bei der Ratsmühle 78, auf der Saline 71, am Springintgud 54. in der planken s. Salzstr. 186. Poliermühle s. bei der Ratsmühle 78. ante pontem antiquum s. Altenbrückertorstr. 34. extra pontem novum s. Lünertorstr. 156. apud pontem saline s. Salzbrückerstraße 183. platea pontis veteris s. Altenbrückertorstr. 34. ante portam novam s. Hasenwinkel 121. Postamt s. am Sande 52. prefecti, prefectorum platea s. Lünerstraße 155, Rotehahnstr. 180, im Wendischen Dorfe 136. Prämonstratenserkloster s. bei der Abtsmühle 76. Pram, prambom s. Baumstr. 75, vor dem Rotentore 206, im Tiergarten 135. preconis domus s. Rosenstr. 179. Predigerhäuser s. bei der Johanniskirche 81. 277
Prioratshaus St. Michaelis s. am Gralwalle 42, auf dem Michaeliskloster 65. Privet s. auf dem Michaeliskloster 66, bei der Lambertikirche 82. Professenwohnung s. Anhang 230. Propstei s. bei der Johanniskirche 80, Rotemauer 181, am Sande 52. Protonotars Haus s. am Gralwalle 43, am Marienplatze 47. achter der provestye s. Rotemauer 181, Anhang 229. Prozession s. am Lindenbergertore 46. publica via (Landstr.), circa primum via publicae pagulum (kleines Landstücke) s. vor dem Neuentore 205. Pulvermühle s. Anhang 229. Pulverturm s. Baumstr. 75. Putensen Gang, Hof s. Schlägertwite 189. puteum, prope – s. hinter dem Brunnen 126. in quadrivio (Vierorten), platea quadrivium nominata s. auf der Rübekule 70, an den Vierorten 59. apud (super) quatuor angulos s. an den Vierorten 59. Quergasse s. Papenstr. 171. Rabenstein s. Altenbrückertorstr. 35. by der rackerige s. Rackerstr. 174. Rackers hus, Rackerzaun s. auch Engestr. 102, Rackerstr. 174. Rademacherhaus s. im Schießgraben 134. des rades, der heren stall s. Burmeisterstr. 93. platea apud Rambeke erwähnt im Verfestigungsregister z. J. 1282. Ramelsloh s. auf der Altstadt 69. Rathaus s. am Markte 49, Salzbrückerstr. 185. Ratsapotheke s. Apothekenstr. 61, Bäckerstr. 116. Ratsbücherei s. auf dem Klosterhofe 64. Ratsdienerbuden s. an den Brodbänken 58, Rosenstr. 179 f. Ratsmarke s. Kaufhausstr. 145. Ratsmarstall s. Burmeisterstr. 93. Ratsmühle s. Altenbrückertorstr. 35. Ratsmühlenhof s. Kalandstr. 143, bei der Ratsmühle 78. Ratsmusikanten Haus s. am Fischmarkte 40. Ratsschänke s. am Markte 48. Ratsschreiberei, de olde scriverie s. Wagestr. 209. Ratswasserkunst s. bei der Ratsmühle 79. Ratszeughaus auf dem Plan von ca. 1750 auf dem Windberge eingetragen. Rauchhaus s. Lünerstr. 155. Rauschebrücke, volkstümliche Bezeichnung für den Brückensteg an der Abtsmühle. receptacula salis s. Salzstr. am W. 186. Regierungsgebäude s. am Ochsenmarkte 51. Reichenstr. s. Baumstr. 75. Reiferbahn s. an den Reperbahnen 58. Reygerbeke s. im Grimm 132. Reimersgang, Reimershof s. Ohlingerstraße 166. Reinfelderhof s. Kalandstr. 143. Reitbahn, Reitplatz, beim – s. beim Benedikt 83, auf dem Michaeliskloster 66. Reithaus, Kgl. S. Bäckerstr. 116. Rektorat des Johanneums s. Kalandstr. 142, Konrektorat s. Papenstr. 171, der 2 278
Michaelisschule s. bei der Michaeliskirche 78, Konrektorat s. in der Techt 38. Rennenbrucher Tor s. Anhang 227. Repenstedere strate s. im Grimm 132, Neuetorstr. 164. Reperbahn s. Altenbrückerdamm 32. Reperbuden s. an den Reperbahnen 58. repositoria salinaria s. Salzstr. a. W. 187. richtehus s. am Markte 49. richtestat s. Altenbrückertorstr. 35. Rickshof s. am Berge 37. ridderstrate s. Ritterstr. 177. ridend, unse – s. Reitendedienerstr. 176. rikenstrate s. Baumstr. 75. versus ripam esocialem s. am Stintmarkte 54. Ritterakademie s. beim Benedikt 83, (Reithaus u. Bereitershof). ritterporte hinter dem Kalkberge 1607; den Schlüssel dazu empfängt ex gratia der Abt als Verwalter des Benedikthofes. Ritterschule s. bei der Abtsmühle 76, auf dem Michaeliskloster 66. Rodenborger hus s. Ilmenaustr. 131. Rodengang, Rotergang s. Altenbrückermauer 32. in dem roden stoven s. Rotestr. 182. uppe deme Rodenwolde s. vor der Sülze 208. Rönnenburg s. Papenburg 170. Roggelandes hus s. an den Vierorten 59. in vico rosararum s. Scherenschleiferstraße 188. rosarum lacum, prope – s. Gartenstraße 108. rosarum platea s. Scherenschleiferstraße 188. Rose s. am Sande 52, Anhang 222. rosen, under der – s. Rosenstr. 179. rosengarden, in deme – s. Rosenstr.179, vor dem Rotentore 207. Rosenkamp s. Gartenstr. 107. rosenplane, bi deme s. Gartenstr. 107. rosenpole, bi dem, Rasenpool s. Gartenstr. 107. Rosenstraße s. auch an den Brodbänken 57, Fink Str. 105, Kalandstraße 143. Rotenburgerhof s. Rotenburgerstr. 181, im Verdener Hof 136. im Rotenfelde s. Lindenstr. 153, am Altenbrücker Ziegelhof 36, Feldstr. 104, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 106, vor dem Rotentore 206. Roten Mauer, hinter der – s. Kalandstr. 143, Ritterstr. 178. Rotentore, vor dem s. Friedenstr. 106, auch Heiligengeiststr. 122, Johannisstr. 140, Rotemauer 181, auch Rotestr. 182. Roter Hahn (ruber gallus) s. Lünerstraße 155, Anhang 222. Roter Hirsch s. Heiligengeiststr. 123, Anhang 222. Roter Kirchhof s. vor dem Rotentore 206. Roter Wall s. Friedenstr. 106. Rotes Tor s. Anhang 226. Rotestr. s. auch Ritterstr. 178. Rotscher Buden s. am Fischmarkte 41. rövekule s. auf der Rübekuhle 70, Anhang 222. super rubea silva s. vor der Sülze 208. rubea valva, rubra porta s. Rotemauer 181, vor dem Rotentore 205 f. Rübekule s. auf der Altstadt 68. rundel, dat grote s. Baumstr. 75, hohes – Bastionstr. 74. 279
Saal s. Altenbrückermauer 33, Blümchensaal 88, Engestr. 102. sacellaris platea s. Schrangenstr. 167. sacerdotum platea s. Papenstr. 171. Sackstr. auf der Altstadt 1250 erwähnt. sacrificulorum platea s. Scherenschleiferstr. 188. Sägemühle s. bei der Abtsmühle 76. salina antiqua s. vor der Sülze 207. salina in veteri – s. Neue Sülze 163. salinaris platea s. Neue Sülze 164, Salzstr. 184. parva platea salinaris s. Salzstraße 184. salinaris porta, valva s. auf dem Harz 63. Salinhof s. Neue Sülze 164. Salinkanal s. Gummastr. 118. Salzbrückerstr. s. auch bei der Lambertikirche 82. Salzbude s. bei der Lambertikirche 82. Salzcomtoirs Holzhude s. auf der Hude 69. Salzmesser Zwinger s. Anhang 228. Salzquelle s. am Gralwalle 43. Salzräume s. Ilmenaustr. 131, am Stintmarkte 55, Visculenhof 202, hinter der Bardowicker Mauer 127. Salzschuppen s. auf der Hude 70. Salzspeicher s. am Berge 37, Lünertorstraße 156. Salzstr. a. W. s. auch hinter der Bardowickermauer 127, Baumstr. 75. Salztonnenböttchergarten s. Parkstr. 172. Sandkeller s. am Sande 52. sartorum platea s. an der Münze 60, Schröderstr. 191. Sassengang s. Altenbrückermauer 33. Sassenhof s. hinter der Sülzmauer 128. scampna panum, pistorum s. an den Brodbänken 57. scampna piscatorum, piscium s. auf der Altstadt 68, am Markte 48, am Sande 52. Schäferei s. Korb 149. Schänke s. vor dem Rotentore 207. Schafferei Wohnung s. am Gralwalle 43. Schandpfal s. am Markte 49. Scharfrichterwiese s. Rackerstr. 174. Scharnebeck s. auf der Altstadt 68. Scharnebecker Haus u. Hof s. auf der Altstadt 68, Baumstr. 76, auf dem Meere 65, bei der Nicolaikirche 83, Schrangenstr. 167, im Wendischen Dorfe 136. bi den scharren, s. Schrangenstr. 167. Scheibenschauer, Scheibenweiserhaus s. im Schießgraben 134. Schellersgang s. vor der Sülze 208. Schießplatz der Garnison 1860 angelegt, zwischen Dahlenburger Landstraße und dem Wege nach Hagen. schietwinkel s. Salzstr. a. W. 186. Schiffbauerwerft s. auf der Hude 69. Schiffbuden s. Baumstr. 76. Schifferhaus s. Baumstr. 76, bei der Nicolaikirche 83. Schiffergildehaus s. Visculenhof 202. Schifferwall s. auch Anhang 230. Schifferwohnhaus s. im Wendischen Dorfe 136. 280
Schiffhude s. auf der Hude 69. Schild s. am Berge 38. Schildstein s. im Grimm 132, am Kreideberge 45, Schnellenbergerweg 190. schiplude gang s. Lünertorstr. 156. schirborn s. Salzbrückerstr. 184. Schlagbaum s. vor dem Bardowickertore 204, Papenburg 170, bei der Ratsmühle 78, Schlagtor s. Anhang 230. Schlachterherberge s. Bardowickerstraße 73. Schlachthausstraße s. Reichenbach Str. 175. Schlagfenster s. Schröderstr. 191. Schlammkiste s. Altenbrückertorstr. 34, Conventstr. 96, Engestr. 102, vor der Sülze 208, z. vgl. modekiste. Schleifmühle s. bei der Ratsmühle 78. schlenge s. bei der Abtspferdetränke 77, Breitewiese 90, am Iflock 44. Schleuse s. Baumstr. 75, Ilmenaustr. 131, Kaufhausstr. 144, Lünertorstr. 156, Rote Schleuse 182, vor dem Rotentore 206, Uelzenerstr. 200. Schloß, Schlosskaserne, Schlossplatz s. am Markte 49. Schmiede s. Bardowickerstr. 73, in der Techt 138. schnarbünde s. vor dem Bardowickertore 204. Schneidemühle s. bei der Abtsmühle 76. Schneiderpforte s. bei der Michaeliskirche 78. Schnitticherstraße s. Baumstr. 75. by der schole to sunte Michele, ex. opp. scolae s. Michaelis s. bei der Michaeliskirche 78. Schrangenbuden, Schrangenplatz s. Schrangenstr. 166, vgl. auch Anhang 223. Schreiberei, Scheibmeister Wohnung, s. Wagestr. 209. schriverstrate, Schreiberstr. s. Wagestraße 209. Schröderstraße s. auch Rosenstr. 180. Schütting, achter dem schütting s. bei der Abtspferdetränke 77, Bardowickerstr. 73, an den Brodbänken 58, am Markte 48, Rosenstr. 180, auf der Rübekule 70, am Sande 52, im Schießgraben 134, Anhang 222. Schützengesellschaft s. Bardowickerstr. 74, im Schießgraben 134. Schützenhaus s. im Schießgraben 134, am Werder 56. Schützenplatz s. vor dem Bardowickertore 204. Schützenwall s. vor dem Bardowickertore 204, Anhang 230. retro scholam s. Johannis s. bei der Johanniskirche 80. Schule, herzogl. s. unter der Burg 201. Schule, zu St. Michaelis s. auf dem Meere 65. Schullehrer-Seminar s. auf dem Michaeliskloster 66. Schultheiß Wohnung s. hinter der Bardowickermauer 127. schur baven der bank s. auf dem Harz 62. Schusterzwinger s. Anhang 229. Schwalbenburg, swalkenborg s. am Schwalbenberge 53. Schwarzer Adler s. am Sande 52, Anhang 222. Schwarzer Bär, s. am Sande 52, Anhang 222. Schwarzer Elephant s. Anhang 222. Schwarzes Roß s. Anhang 222. Schwarzer Weg s. Scharnhorst Str. 188. Schweinemarkt s. Ritterstr. 178, Rotemauer 181. Schwibbogen s. Altenbrückermauer 33. scriniariorum platea s. Rotehahnstr. 180. 281
scriptorum platea, - vicus s. Schröderstr. 191, Wagestr. 209. scriverie, tegen der – s. am Marienplatze 47. Sebastianikapelle s. vor dem Bardowickertore 204. Sechste Straße s. Elversstr. 101. Seggerturm s. Anhang 229. Seifensiederei s. Schrangenstr. 167. seyger Uhrzeiger, s. auf der Hude 69. by dem seygertorne s. am Markte 48, Wagestr. 209. selschoppes hus s. Bäckerstr. 116. Seminargarten s. Görges Str. 111. Siechenhaus s. vor dem Neuentore 205. Siedehütten, Abzeichen der – s. Anhang 222, Sülzhäuser, ihre Lage und Namen s. Anhang 220 ff. Siel s. am Berge 38, Gummastr. 117 f., bei der Johanniskriche 81, am Lindenbergertore 46, auf dem Meere 65, bei der Ratsmühle 79, vor dem Rotentore 205. Silberner Mond s. Anhang 223. singule, Zingel s. vor dem Bardowickertore 203. slachbom s. Lünertorstr. 156. slachdor s. Altenbrückertorstr. 34, im Grimm 132, am Lindenbergertore 46, Lünertorstraße 156. slachtertorn s. Anhang 230. slagfenster s. Schröderstr. 191. slegertwite s. Schlägertwite 189, s. auch Grapengießerstr. 114. sleng s. Düvelsbrook 99, Gartenstr. 107, auf der Hude 69, bei der Ratsmühle 79, auf der Saline 71. Sod s. vor der Sülze 207. Sodmeister Wahlhaus s. Salzbrückerstraße 185. Sodmeister Zwinger s. Anhang 229. Soetbehrs Hof s. im Wendischen Dorfe 136. solarium s. Engestr. 102. solthus over s. bei der Lambertikirche 82. soltrume s. Salzstraße a. W. 186 f., Visculenhof 202. Soltzenhusen stove s. Salzbrückerstraße 184. spellude, der – husere s. am Fischmarkte 40. spiker by dem – s. Altenbrückertorstraße 34. Spillwasserbrunnen s Neue Sülze 164. Spillekendor s. Anhang 227. spirinchorum forum, spiringiorum platea s. am Stintmarkte 55. s. spiritus platea s. auch Engestr. 102. uppe den sponen s. auf dem Wüstenorte 66. im springenden Hirsch s. Anhang 222. Springinsgut, beim – s. vor dem Neuentore 205. Springintgut Turm s. am Gralwalle 42, Anhang 228. Spritzenhaus s. am Ochsenmarkte 50. stabulum, prope nostrum – s. Burmeisterstr. 93. stad, stade (Anlegeplatz) s. Kaufhausstraße 144, am Stintmarkte 54. Stadtbauhof s. auf dem Wüstenorte 67. Stadtgefängnis s. hinter der Bardowickermauer 127, Wandrahmstr. 211. Stadtgericht s. im Grimm 133. Stadtgraben s. Altenbrückerdamm 32, vor dem Rotentore 206, (de nie graven), 282
Rotestr. 182. Stadt Hamburg s. Große Bäckerstr. 115, Anhang 223. Stadt Hamburg s. Anhang 223. Stadt Magdeburg s. Anhang 223. Stadt Nürnberg s. Anhang 223. Stadtweide s. Düvelsbrook 99, Goseburg 112. Stallbrüder-Straße, -Wohnungen s. Reitendedienerstraße 176. Stammersbrücke s. Kaufhausstr. 145, bei der Ratsmühle 80. stampemole s. bei der Ratsmühle 79. statera (Wage) civitatis s. an der Münze 60, Schröderstr. 192. steenborne s. vor der Sülze 208. stegelen, byd to der – s. auf der Altstadt 68, bei der St. Johanniskirche 80. Stegen, Johanna – Haus, s. Görges Straße 111. stegen s. auf dem Meere 65. bey dem steine s. Zeltberg 217. Steinen, bei den s. auf dem Harz 62. steinerne Bude, steinernes Haus s. bei der Johanniskirche 81, am Markte 48, vor dem Neuentore 204, Sülztorstaße 196. Steinweg s. auf der Altstadt 68, Lünertorstraße 156. v. Sternsches Haus und Garten s. Papenstr. 171, Neue Sülze 164, am Sande 52. Sterteshagen s. unter der Burg 201, Anhang 221. styntstade s. am Stintmarkte 54. Stockfischbuden s. am Fischmarkte 41. Stockhaus, das alte – am Kalkberge, an der Ostseite des hinaufführenden Weges, westl. der Strafanstalt, abgebrochen im Sommer 1842. Ein anderes Stockhaus lag bei einem Turm hinter der Bardowicker Mauer und wurde von den Soldaten als Gefängnis gebraucht (nach 1700). stoven, stover s. bei der Abtsmühle 76, Altenbrückertorstr. 34. stovenhus s. Rotestr. 182. Strafgerichtsgebäude s. am Gralwalle 43. Straftafel s. Am Ochsenmarkte 50. Straßenbeleuchtung s. am Marienplatze 47, am Markte 49, Wagestraße 209. Straßenreinigung s. bei der Abtsmühle 76, Altenbrückertorstr. 34, auf der Altstadt 68, am Berge 38, an den Brodbänken 58, Conventstr. 96, Engestr. 102, am Fischmarkte 40, bei der Johanniskirche 80, Kalandstr. 143, bei der Lambertikirche 82, am Marienplatze 47, Neue Sülze 164, Rackerstr. 174, am Sande 51. achter, hinter dem strunk s. Sülzwallstr. 197. versus stubam sudatoriam salinarem s. Salzbrückerstr. 184. stube salinaris platea, prope saline stubam s. Salzbrückerstraße 138 f., Wendische Straße 212. Stürlüne s. Anhang 229. Sturmflut s. am Fischmarkte 41. sulfmester hus s. auf dem Harz 62. Sülzbeke s. Sülzwiese 197. Sülzgestänge s. bei der Ratsmühle 79. Sülzhäusernamen s. Anhang 220 f. Sülzstraße s. Salzstraße 185, kleine Sülzstr. s. Salzbrückerstr. 184. Sülztor s. auf dem Harz 62, bei der Lambertikirche 82, am Lindenbergertore 46, im Timpen 135, Anhang 226. am Sülzwall s. hinter der Sülzmauer 128. 283
auf dem Sülzwalle s. Wallstr. 210. sultbeke s. Sülztorstr. 197. bi der sultebruggen s. Salzbrückerstraße 183. buten dem sultedore s. Sülztorstr. 197. jegen der sulte over s. auf der Saline 71, Ohlingerstr. 166. achter, baven der sulten s. vor der Sülze 208. achter deme sultestaven s. Salzbrückerstr. 184. achter, neffen deme sultestoven s. Wendische Straße 212. sultestrate s. Salzstr. 185. sultewisch s. im Grimm 132. sultzbadstube s. Salzbrückerstr. 184. sulzkamp, ufm – s. an den Reperbahnen 58. superior pars civitatis s. auf der Altstadt 68. Synagoge s. auf der Altstadt 68, Judenstraße 140. swalkenborg s. am Schwalbenberge 53. Syndikatshaus s. am Marienplatze 47, am Ochsenmarkte 50. Tabakfabrik s. Reitendedienerstr. 176. Tangkenwisch s. Tangerwiese 197. Tapetenfabrik s. Goseburgstr. 112. Tatergang s. Engestr. 102, Salzbrückerstraße 185. Taterschanze s. Salzbrückerstr. 185, Anhang 231. teche, teghthe s. auf der Altstadt 68. in Teltberge s. Zeltberg 217. teolonii casa s. bei der Lambertikirche 82. tepidarium saline s. im Karnapp 133. terminarii, hus der s. bei der Johanniskirche 81, Papenstr. 171. Tetzelkapelle, nach dem Plan von ca. 1750 am Westeingange des Johannisfriedhofes. teufelsbruche s. Düvelsbrook 99. textorum platea s. Heiligengeiststr. 122. teygelhave, by dem -, teygelhus s. am Altenbrücker Ziegelhof 35, vor dem Neuentore 205. Theater s. Bäckerstr. 116. Theerhof s. am Werder 56. Thielengang s. hinter der Sülzmauer 128. bynnen den thünen s. vor dem Neuentore 205. im Tiefental s. auch im Grimm 132. tinctoria platea s. Wandfärberstr. 211. titerana platea, Titbersche strate, Tittentastersche, Tittersche strate, s. Fink Str. 105, Koltmann Str. 148, Rosenstr. 179. v. Töbings Gang s. auf dem Meere 65. Töpferei s. auf dem Michaeliskloster 66. tollenbode, tollenhus s. Zollstr. 218. Tor (valva) s. auf der Altstadt 68, dunkles – s. beim Kalkberge 85. vor dem Tore, der Brücke s. Altenbrückertorstr. 34. Tore s. Anhang 226 ff. Torfkanal s. Kalandstr. 143, Anhang 231. apud torrentem salinarem s. vor der Sülze 208. Torschreiberhaus, -wohnungen s. vor dem Bardowickertore 203, Lünertorstr. 156, vor 284
dem Neuentore 205, Rotestr. 182. Torsperre s. Anhang 226. torture domus s. Rosenstr. 179. Torwachen s. Anhang 227. Torwohnungen s. Anhang 227. tradekiste s. am Altenbrücker Ziegelhof 36. Traiteur- und Herbergierhaus s. Bardowickerstr. 74. Trammanns Garten s. Gartenstr. 108. transitus longus s. Ritterstr. 178. Transitzoll s. Bäckerstr. 116. transversalis platea s. Engestr. 102, Heiligengeiststr. 122, - vicus s. Papenstr. 171, Schrangenstr. 167. Traube s. am Sande 52, Anhang 222. Treppe zw. Bardowicker- und Lindenbergertor s. am Lindenbergertore 46. Treppe, zur goldenen – s. Lünerstr. 155. tribunitia domus s. Engestr. 102. Trompete s. Anhang 222. trumpers waninge s. Kaufhausstr. 144, Anhang 228. tuchtschole s. auf dem Klosterhofe 64. Türme s. am Berge 37, Conventstr. 96, Engestr. 102, am Fischmarkte 40, Hasenburg 120, auf der Hude 69, bei der Johanniskirche 81, beim Kalkberge 84, Kaufhausstr. 144, Lünertorstr. 156, auf dem Michaeliskloster 66, vor dem Neuentore 204, Papenburg 170, bei der Ratsmühle 79, auf der Saline 71, Schrangenstr. 167, am Springintgud 54, vor der Sülze 207, Sülzwallstr. 197, Anhang 228 f. Turmwohnung s. Kalandstr. 143. Turm bei der Bomkulen s. Baumstraße 75. Turm, hoher s. im Grimm 133. Turnhalle s. Kalandstr. 143. Turnierplatz s. Rosenstr. 179. twete, twyte s. Katzenstr. 144, Lünertorstr. 156, Papenstr. 171, im Wendischen Dorfe 136. twiten, in – s. vor dem Rotentore 206. Uferbefestigung s. auf der Hude 69. Uhrturm s. am Markte 48. Ulrichshof s. am Berge 37. by Unser leven frouwen kerkhof s. am Marienplatze 47. Untere Neuetorstr. s. Görges Str. 111. Ursulanacht s. auf der Altstadt 68, Engestr. 102, Gr. Bäckerstr. 115. vaccarum platea s. Kuhstr. 150. prope valvam quondam Meygers iudei s. Judenstr. 140. iuxta valvam Nienbruche s. Ilmenaustraße 131. van baven, torn – s. Engestr. 102. vandalica platea s. Salzbrückerstr. 184, Wendische Str. 212. Vasmers Schleuse s. Uelzenerstr. 200. Verdener Hof s. am Gralwalle 42, am Marienplatze 47, auf dem Meere 65, am Sande 51, Tangerwiese 197. veer orden, by den, Vierorten s. auch Judenstr. 141, auf der Rübekule 70, auch Salzstraße 185, Neue Sülze 164. 285
velbrucge s. Anhang 227. in veteri platea s. in der Techt 138. Vierte Straße s. Büttner Straße 92. vietorum platea s. Baumstr. 75. Vikariatshäuser s. bei der Johanniskirche 81. Vyninghe s. im Grimm 132. Viningeborch s. Wilschenbruch 215. vinkenbur s. Bardowickerstr. 73, Anhang 222. vinkensteyne, in deme – s. Lünerstr. 155, Anhang 222. „up den visbanken“ wurde 1430 ein Gericht gehegt über einen Falschmünzer. vischmarket s. Kaufhausstr. 144. Viskulenhof s. Baumstr. 76, Salzstr. a. W. 186. Viskulen Turm s. Salzstr. a. W. 186. vlasborch s. Salzstr. 185, Anhang 222. in den vlisschrangen s. Schrangenstraße 167. vogedie to Amelinghusen s. in der Techt 138. Vogtstraße s. Lünerstr. 155, bei der Nicolaikirche 83, Rotehahnstr. 180. Vogtbuden s. Reitendedienerstr. 176. Volgers Hof s. auf dem Kauf 63. Volksbadeanstalt s. Wandrahmstr. 211. am Vorsetzen, Vorsetzung s. im Schießgraben 135. vortsettelse s. bei der Ratsmühle 78. Vorwerk s. auf dem Michaeliskloster 65, Mönchsgarten 85, Schnellenbergerweg 190. Vredeke, Turm s. Garlop Str. 107, Sülzwallstr. 197, Anhang 229. vryg hus s. im Grimm 132. vrigote s. Engestr. 102, bei der Ratsmühle 78. vronerey s. Rosenstr. 179 f. vrowenbade, - strate s. Neue Straße 162. vrowenhuseken, vrowenmak s. Altenbrückertorstr. 34, vor dem Rotentore 206, Sülztorstr. 197. vule loch, dat – s. Engestr. 102. vulen ouwe, bi der -, na der – s. Engestr. 102, Heiligengeiststr. 122. Waage s. am Markte 49. Waagestrate s. auch am Markte 50. Wache s. Bäckerstr. 116, vor dem Bardowickertore 203, Bastionstrasse 74, Baumstr. 75, auf der Hude 69, beim Kalkberge 84 f., bei der Lambertikirche 82, Lünertorstraße 157, am Markte 49, an der Münze 60, vor dem Neuentore 205, Rotestr. 182, auf der Saline 71, vor der Sülze 207. Wachthaus s. Wandrahmstr. 211. Wachtturm s. beim Kalkberge 84, Papenburg 170, Anhang 229. Wächtergang s. auf dem Michaeliskloster 66. Wälle s. Altenbrückerdamm 32, Altenbrückertorstr. 34, vor dem Bardowickertore 204, am Grallwall 43, im Grimm 132, Gummastr. 118 (Sülzwall), am Lindenbergertore 46, auf der Saline 71, neuer Wall s. Salzbrückerstr. 185, Anhang 230. Wagenmoor s. vor dem Rotentore 205. Waisenhaus s. auf dem Klosterhofe 64. walkemole s. Altenbrückertorstraße 34. Walkemühle s. bei der Ratsmühle 78. Walkerstr. s. am Berge 37. Walldurchbruch s. Garlop Str. 107. 286
Wallpforte s. am Gralwalle 42. Wandfärberei s. Scherenschleiferstr. 188. Wandhaus s. hinter der Bardowickermauer 127, am Markte 48. achtern wandhuse s. Wandrahmstraße 211. Wandrahmstraße s. auch Haagestraße 119. Wandrahmwerder s. Wandrahmstr. 211. Wandschauer s. hinter der Bardowickermauer 127. Warborg s. Hasenwinkel 121, auf der Hude 69, Lünerdamm 154, Anhang 222. Warenmarke s. am Fischmarkte 41. Waschstege s. Altenbrückertorstr. 34, bei der Ratsmühle 79. Wasserburg s. Böhmsholz 89. Wasserleitung s. bei der Nicolaikirche 83, Gummastr. 118, am Markte 48, in der Techt 138. Wassertor s. Lünertorstr. 156. waterbom s. Baumstr. 75. watere, bi dem – s. Ilmenaustr. 131. watergank s. Lünertorstr. 156. waterkiste s. am Altenbrücker Ziegelhof 36. waterkum s. am Markte 48. waterstoven s. Ilmenaustr. 131, bei der Ratsmühle 79, am Stintmarkt 55. waterweg s. vor dem Rotentore 205. wedeme, wedemehof s. bei der Johanniskirche 81, Anhang 229. wegegeld s. Altenbrückertorstr. 33. Weide s. Hasenwinkel 121, vor dem Neuentore 204, Papenburg 170. Weidemanns Straß s. Salzbrückerstr. 184. Weidenplantage s. auf der Hude 69. das Weiße Pferd, Roß s. Rotestr. 182, Anhang 222. Weißer Elephant s. Anhang 222. Weißer Schwan s. Bardowickerstr. 73, Anhang 222. Weißer Turm s. auf der Saline 71, Anhang 229. Weißes Roß s. am Sande 52, Anhang 222. Weißgerberei s. Altenbrückermauer 33. Weißladerei s. Ilmenaustr. 131, auf dem Kauf 63, Kaufhausstr. 145, Salzstr. a. W. 186, am Sande 52. wellendor s. Anhang 227. wendeborn s. vor dem Rotentore 206. Wendisches Dorf s. auch Anhang 228. im Wendischen Goh s. im Wendischen Dorfe 136. Wendischen Straße s. auch Gummastraße 117. Werder s. auch Lünertorstr. 157. Werkhaus s. auf dem Klosterhofe 64. Weselows Hof s. Altenbrückermauer 33. Wienhäuser Klosterhaus s. auf der Altstadt 68. Wiese s. Altenbrückertorstr. 35, Rackerstr. 174, an der Rotenbleiche 61, vor dem Rotentore 206. Wildgraben s. vor dem Bardowickertore 204, Bastionstr. 74. Wilkens Gang s. auf der Rübekule 70. Windberge, am s. am Gralwalle 43; Plan von c. 1750 „auf dem Windfang“. Windmühle s. am Kreideberge 45, bei der Ratsmühle 79. Winterhafen s. Ilmenaustr. 131, am Schifferwall 53, Anhang 228. Wipkenloch s. Gummastr. 117. 287
velbrucge s. Anhang 227. in veteri platea s. in der Techt 138. Vierte Straße s. Büttner Straße 92. vietorum platea s. Baumstr. 75. Vikariatshäuser s. bei der Johanniskirche 81. Vyninghe s. im Grimm 132. Viningeborch s. Wilschenbruch 215. vinkenbur s. Bardowickerstr. 73, Anhang 222. vinkensteyne, in deme – s. Lünerstr. 155, Anhang 222. „up den visbanken“ wurde 1430 ein Gericht gehegt über einen Falschmünzer. vischmarket s. Kaufhausstr. 144. Viskulenhof s. Baumstr. 76, Salzstr. a. W. 186. Viskulen Turm s. Salzstr. a. W. 186. vlasborch s. Salzstr. 185, Anhang 222. in den vlisschrangen s. Schrangenstraße 167. vogedie to Amelinghusen s. in der Techt 138. Vogtstraße s. Lünerstr. 155, bei der Nicolaikirche 83, Rotehahnstr. 180. Vogtbuden s. Reitendedienerstr. 176. Volgers Hof s. auf dem Kauf 63. Volksbadeanstalt s. Wandrahmstr. 211. am Vorsetzen, Vorsetzung s. im Schießgraben 135. vortsettelse s. bei der Ratsmühle 78. Vorwerk s. auf dem Michaeliskloster 65, Mönchsgarten 85, Schnellenbergerweg 190. Vredeke, Turm s. Garlop Str. 107, Sülzwallstr. 197, Anhang 229. vryg hus s. im Grimm 132. vrigote s. Engestr. 102, bei der Ratsmühle 78. vronerey s. Rosenstr. 179 f. vrowenbade, - strate s. Neue Straße 162. vrowenhuseken, vrowenmak s. Altenbrückertorstr. 34, vor dem Rotentore 206, Sülztorstr. 197. vule loch, dat – s. Engestr. 102. vulen ouwe, bi der -, na der – s. Engestr. 102, Heiligengeiststr. 122. Waage s. am Markte 49. Waagestrate s. auch am Markte 50. Wache s. Bäckerstr. 116, vor dem Bardowickertore 203, Bastionstrasse 74, Baumstr. 75, auf der Hude 69, beim Kalkberge 84 f., bei der Lambertikirche 82, Lünertorstraße 157, am Markte 49, an der Münze 60, vor dem Neuentore 205, Rotestr. 182, auf der Saline 71, vor der Sülze 207. Wachthaus s. Wandrahmstr. 211. Wachtturm s. beim Kalkberge 84, Papenburg 170, Anhang 229. Wächtergang s. auf dem Michaeliskloster 66. Wälle s. Altenbrückerdamm 32, Altenbrückertorstr. 34, vor dem Bardowickertore 204, am Grallwall 43, im Grimm 132, Gummastr. 118 (Sülzwall), am Lindenbergertore 46, auf der Saline 71, neuer Wall s. Salzbrückerstr. 185, Anhang 230. Wagenmoor s. vor dem Rotentore 205. Waisenhaus s. auf dem Klosterhofe 64. walkemole s. Altenbrückertorstraße 34. Walkemühle s. bei der Ratsmühle 78. Walkerstr. s. am Berge 37. Walldurchbruch s. Garlop Str. 107. 288
Fotonachweis
OB Ernst Braune: Landeszeitung für die Lüneburger Heide, Lüneburg
Architekt Dr. h. c. Franz Krüger und Dr. Arthur Zechlin: Museum für das Fürstentum Lüneburg, Lüneburg
Alle anderen Fotos stammen aus dem Stadtarchiv Lüneburg.
289
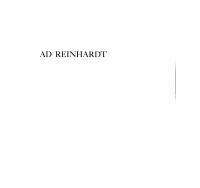

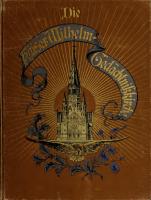
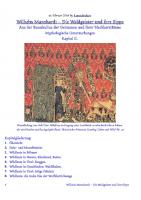






![Die Straßennamen Lüneburgs: Herausgegeben:Reinecke, Wilhelm; Luntowski, Gustav; Reinhardt, Uta;Mitarbeit:Reinhardt, Uta [5 ed.]
9783767570788, 3767570785](https://dokumen.pub/img/200x200/die-straennamen-lneburgs-herausgegebenreinecke-wilhelm-luntowski-gustav-reinhardt-utamitarbeitreinhardt-uta-5nbsped-9783767570788-3767570785.jpg)