Die materielle Polizeipflicht des Zustandsstörers und die Kostentragungspflicht nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme - dargestellt am Beispiel der Altlasten-Problematik [1 ed.] 9783428471645, 9783428071647
167 81 25MB
German Pages 166 Year 1991
Polecaj historie
Citation preview
MICHAEL GRIESBECK Die materielle Polizeipflicht des Zustandsstörers und die Kostentragungspflicht nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme - dargestellt am Beispiel der Altlasten-Problematik
Schriften zum Öffentlichen Recht Band 602
Die materielle Polizeipflicht des Zustandsstörers und die Kostentragungspflicht nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme - dargestellt am Beispiel der Altlasten-Problematik
Von
Michael Griesbeck
Duncker & Humblot * Berlin
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufhahme Griesbeck, Michael: Die materielle Polizeipflicht des Zustandsstörers und die Kostentragungspflicht nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme: dargestellt am Beispiel der AltlastenProblematik / von Michael Griesbeck. - Berlin: Duncker und Humblot, 1991 (Schriften zum Öffentlichen Recht; Bd. 602) Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1991 ISBN 3-428-07164-6 NE: GT
Alle Rechte vorbehalten © 1991 Duncker & Humblot GmbH, Berlin 41 Satz: Papyrus Schreib- und Büroservice, Bonn 1 Fotoprint: Werner Hildebrand, Berlin 65 Printed in Germany ISSN 0582-0200 ISBN 3-428-07164-6
Meinen EUern
Vorwort Die Untersuchung befaßt sich mit dem polizeirechtlichen Störerbegriff, insbesondere mit der materiellen Polizeipflicht des Zustandsstörers, und dem Umfang der Kostentragungspflicht des Eigentümers einer störenden Sache. Diese Fragen werden heute vor allem in Zusammenhang mit der Altlasten-Problematik erörtert, deren Darstellung daher im Vordergrund steht. Sie spielen aber auch in anderen Fällen, z.B. beim Abschleppen verbotswidrig geparkter Kraftfahrzeuge, eine Rolle und haben darüber hinaus grundlegende Bedeutung für das gesamte Polizeirecht. Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 1990/91 von der Juristischen Fakultät der Universität Regensburg als Dissertation angenommen. Für die Drucklegung wurde sie geringfügig geändert. Dabei konnte auch neu erschienene relevante Literatur und Rechtsprechung bis April 1991 berücksichtigt werden. Mein Dank gilt allen, die zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben. Ein besonderer Dank gebührt Herrn Professor Dr. Rainer Arnold, der die Dissertation sorgsam betreut und in vielen Gesprächen wertvolle Anregungen gegeben hat. Herrn Professor Dr. Udo Steiner danke ich für das gezeigte Interesse an meiner Arbeit und für die Übernahme des Zweitgutachtens. Zu Dank bin ich auch jenen verpflichtet, durch deren technische Hilfe der Fortgang der Arbeit beschleunigt wurde. Danken möchte ich schließlich auch allen Freunden und Kollegen, die das Vorhaben auch in schwierigen Zeiten begleitet und dadurch zu dessen Gelingen beigetragen haben. Dem Verlag Duncker & Humblot danke ich für die Aufnahme der Dissertation in die Reihe "Schriften zum Öffentlichen Recht". Nicht zuletzt gilt mein Dank auch dem Bundesministerium des Innern, das ein besonderes Interesse des Bundes an der Veröffentlichung festgestellt, das Erscheinen der Arbeit gefördert und einen Zuschuß zu den Druckkosten gewährt hat. Bonn, im Mai 1991
Michael Griesbeck
Inhaltsverzeichnis Einleitung
21 Erster
Teil
Einführung in das Störerrecht und in die Altlasten-Problematik
23
Erstes Kapitel Gefahrenabwehrrecht — Begriffliches und Problemstellung I.
23
Gefahr und Gefahrenabwehr
23
1. Die Entwicklung des materiellen Polizeibegriffs
23
2. Gefahrenabwehr im Polizei- und Ordnungsrecht des Bundes und der Länder . . . . 25 3. Gefahr und Störung
26
a) Abstrakte und konkrete Gefahr
26
b) Störung
27
4. Gefahr und Gefahrenvorsorge II. Störer und Polizeipflichtige
28 29
1. Störerrecht als Adressatenrecht
29
2. Formelle und materielle Polizeipflicht
30
3. Der Handlungsstörer
31
4. Der Zustandsstörer
32
5. Der Nichtstörer
33
III. Unmittelbare Ausführung und Ersatzvornahme
34
1. Unmittelbare Ausführung
34
2. Ersatzvornahme
35
IV. Die Kosten der Gefahrenbeseitigung 1. Kosten als tatsächliche finanzielle Folge einer Gefahrenabwehrmaßnahme
36 36
2. Die Kosten des Störers
36
3. Die Kosten des Nichtstörers
37
4. Die Entschädigung des nicht in Anspruch genommenen Dritten
38
10
Inhaltsverzeichnis
V. Problemstellung: Das Verhältnis von Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht . 39 1. Die Ansicht, das Störerrecht diene der Verteilung finanzieller Lasten
39
2. Die Ansicht von der Surrogatfunktion der Kostentragungspflicht
40
3. Die kritische Überprüfung dieser Ansichten anhand der Altlasten-Fälle
41
Zweites Kapitel Darstellung der Opfer-Fälle und der Versuche einer Begrenzung der Zustandsstörerverantwortlichkeit I.
Kriegstrümmer· und Öltransportunfall-Fälle
43 43
II. Die Altlasten-Problematik
44
1. Darstellung der Problematik
44
2. Darstellung der Lösungsvorschläge
47
a) Das Problem einer "billigen" Lösung
47
b) Der Eigentümer als Nichtstörer
48
c) "Haftungsbegrenzung"
49
d) Unbegrenzte Zustandsstörerverantwortlichkeit 3. Die Begründung der Reduzierung der Eigentümerverantwortlichkeit in den Altlasten-Fällen
49 50
a) Die Verbindung von Eigentumsgrundrecht und Zustandsstörereigenschaft . . . . 50 b) Das Modell gestörter Privatnützigkeit
51
c) Risikosphärenmodelle
52
4. Darstellung der Kritik
53
III. Eigene Position
55
1. Grundsätzliche Kritik
55
2. Eigener Ansatz
56
Zweiter
Teil
Rechtsgrund und Umfang der Zustandsstörerverantwortlichkeit
58
Erstes Kapitel Der Rechtsgrund der Zustandsstörereigenschaft in Rechtsprechung und Literatur I.
Art. 14 GG als Rechtsgrund der Zustandsstörereigenschaft
58 58
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Die Herleitung der Zustandsstörerverantwortlichkeit aus Art. 14 GG . 58 2. Eigentum und Zustandsstörerverantwortlichkeit bei Friauf
59
3. Erste Stellungnahme
60
4. Die Rechtskreistheorie
61
5. Die Polizeipflicht des Zustandsstörers als eine aus Art. 14 Abs. 2 GG resultierende Grundpflicht 61 II. Kritik der Herleitung der Zustandsstörerverantwortlichkeit aus dem Eigentum
62
1. Einleitung
62
2. Die Berücksichigung der Ursache der Gefahr
63
3. Die Vernachlässigung der Polizeipflicht des Inhabers der Sachherrschaft
63
4. Die Vernachlässigung der Freistellung des Eigentümers, wenn die Sachherrschaft gegen seinen Willen ausgeübt wird
64
5. Die Vermengung von Adressat und Objekt: Der Unterschied zwischen der materiellen Polizeipflicht des Eigentümers und der Polizeipflichtigkeit des Eigentums . 65 6. Das Abstellen auf Schranken des Eigentumsgrundrechts (Kritik der Rechtskreistheorie)
67
7. Die Umwandlung eines Rechts zu einer Pflicht
68
III. Die Zuordnung von Risikosphären
70
1. Herleitung der Zustandsstörerverantwortlichkeit aus der Zuordnung von Risikosphären
70
2. Die Begründung der Herleitung bei Pietzcker
70
IV. Kritik der Risikosphärentheorie
71
1. Herrschaft subjektiver Billigkeitskriterien
71
2. Abhängigkeit von Ursache und Vorhersehbarkeit
72
3. Gefährdung effektiver Gefahrenabwehr durch ungenaue Kriterien
72
V. Zwischenergebnis
73
Zweites Kapitel Die materielle Polizeipflicht als eigenständiger Rechtsgrund der Zustandsstörereigenschaft I.
75
Das Effektivitätspostulat im Polizeirecht und die materielle Polizeipflicht
75
1. Effektive Gefahrenabwehr als Leitprinzip polizeilichen Handelns und die Konsequenzen für die Beurteilung des Polizeirechts
75
a) Das Effektivitätspostulat im Polizeirecht
75
b) Der grundlegende Unterschied zwischen Polizeirecht und Zivil- und Strafrecht
76
Inhaltsverzeichnis
12
c) Polizeirecht und Haftungsrecht 2. Das Effektivitätspostulat im Störerrecht
77 78
a) Das Effektivitätspostulat als bestimmendes Prinzip des Störerrechts
78
b) Kriterien zur Bestimmung der Zustandsstörereigenschaft
79
c) Das Effektivitätspostulat und die Normen des Störerrechts
81
3. Effektivitätspostulat und materielle Polizeipflicht II. Die materielle Polizeipflicht als eigenständige öffentlich-rechtliche Pflicht zur Gefahrenbeseitigung
82
82
1. Die materielle Polizeipflicht als Gefahrenvermeidungspflicht
82
2. Argumente gegen eine Gefahrenvermeidungspflicht
83
a) Die materielle Polizeipflicht als Pflicht, die durch den Polizeiverwaltungsakt aktualisiert wird
83
b) Der Unterschied von materieller Polizeipflicht und Vorsorgepflicht
84
c) Die materielle Polizeipflicht als "Untertanenwohlverhaltenspflicht"
86
d) Gefahrenvermeidungspflicht und Vorhersehbarkeit
87
e) Gefahrenvermeidungspflicht und der Unterschied zwischen Handlungsstörer und Zustandsstörer 3. Die materielle Polizeipflicht als Gefahrenabwehrpflicht
88 88
a) Gefahrenabwehrpflicht statt Gefahrenvermeidungspflicht
88
b) Materielle Polizeipflicht und Interessenabwägung
89
c) Der Unterschied zwischen Störer und Nichtstörer
91
d) Der Lebenskreis als Anknüpfungspunkt der materiellen Polizeipflicht
92
4. Die materielle Polizeipflicht des Eigentümers III. Staats- und verfassungsrechtliche Einordnung der materiellen Polizeipflicht
93 94
1. Die materielle Polizeipflicht als Staatsbürgerpflicht
94
2. Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension
96
3. Die materielle Polizeipflicht als Grundpflicht
97
IV. Mögliche Grenzen der materiellen Polizeipflicht des Zustandsstörers im Hinblick auf die Kostentragungspflicht insbesondere in den Altlasten-Fällen
99
1. Einleitung und Problemabgrenzung
99
2. Berücksichtigung einer Opferlage
99
3. Nutzen-Lasten-Abwägung
101
4. Die Kosten der Beseitigung
102
Inhaltsverzeichnis
Dritter
Teil
Die Kostentragungspflicht nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme 104
Erstes Kapitel Das Verhältnis von Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht I.
Einleitung
104 104
II. Der Konflikt zwischen Effektivitätspostulat und Postulat gerechter Lastenverteilung und der Lösungsansatz einer getrennten Betrachtung 105 III. Das Verhältnis von Effektivitätspostulat einerseits und Postulat gerechter Lastenverteilung sowie Postulat rückschauender Betrachtung andererseits anhand ausgewählter Fälle 1. Effektivitätspostulat und Postulat gerechter Lastenverteilung bei der Auswahl zwischen mehreren Störern a) Auswahlermessen und Effektivität der Gefahrenabwehr
107 107 107
b) Zivilrechtlicher Gesamtschuldnerausgleich als Versuch zur Lösung des Konflikts zwischen Effektivitätspostulat und Postulat gerechter Lastenverteilung . 108 c) Die Freistellung des Störers von den Kosten durch den Staat
110
d) Bewertung: Die Bedeutung der Frage nach einer gerechten Lastenverteilung unter mehreren Störern für das vorliegende Thema
110
2. Effektivitätspostulat und Kostentragungspflicht in den Fällen der Anscheinsgefahr
111
a) Der Begriff der Anscheinsgefahr
111
b) Der Eigentümer als nicht kostentragungspflichtiger Störer
112
3. Ergebnis
113
IV. Auswirkungen der getrennten Betrachtung der Pflichten auf die Störereigenschaft Der weite und der enge Zustandsstörerbegriff des BayVGH 115 1. Der Kfz-Halter als Zustandsstörer
115
2. Der Beschluß des BayVGH vom 8.9.1983
117
3. Bewertung
118
4. Zwischenergebnis
119
V. Vorschläge einer getrennten Betrachtung von Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht in den Altlasten-Fällen
120
1. Darstellung
120
2. Kritik
121
VI. Ergebnis: Die Unabhängigkeit von Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht als Lösung der Opfer-Problematik
122
14
Inhaltsverzeichnis
Zweites Kapitel Rechtsgrund und Grenzen der Kostentragungspflicht nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme I.
Einleitung
II. Die Anwendung gebührenrechtlicher Grundsätze auf die Kostenerhebung nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme
124 124
124
1. Problemstellung
124
2. Polizeikosten und Kostenrecht
125
a) Die Funktion des Polizeikostenrechts
125
b) Aktuelle Probleme der Kostentragungspflicht und ihre Abgrenzung zum Gegenstand der Untersuchung
126
c) Polizeikostenrecht und allgemeines Kostenrecht
126
3. Die Ansicht von der Sonderstellung der Polizeikosten nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme
127
4. Das Merkmal der individuellen Zurechenbarkeit
129
a) Die individuelle Zurechenbarkeit im Gebührenrecht
129
b) Die individuelle Zurechenbarkeit im Polizeikostenrecht
130
III. Die individuelle Zurechenbarkeit der Leistung beim Zustandsstörer
131
1. Die Beseitigungspflicht als Zurechnungskriterium
131
2. Die Veranlassung als Zurechnungskriterium
132
3. Der aus der Sachherrschaft resultierende Nutzen als Zurechnungskriterium
133
IV. Grenzen der Kostentragungspflicht des Zustandsstörers
135
1. Die Grenzen der individuellen Zurechenbarkeit beim Zustandsstörer
135
2. Verstoß gegen Art. 14 GG
135
a) Die Auferlegung von Kosten als Eingriff in das Vermögen b) Kein Schutz des Vermögens als solches durch Art. 14 GG 3. Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG und den Grundsatz der Lastengleichheit
135 136 137
a) Der Grundsatz der Lastengleichheit
137
b) Der Grundsatz der Lastengleichheit im Gebührenrecht
138
c) Lastengleichheit und Sonderopfer
138
d) Störer und Sonderopfer
139
V. Fälle eines Verstoßes gegen den Grundsatz der Lastengleichheit beim Störer
140
1. Sonderopfer des Handlungsstörers
140
2. Voraussetzungen eines Sonderopfers des Zustandsstörers
140
Inhaltsverzeichnis
3. Einige Kriterien für die Prüfung eines Sonderopfers des Zustandsstörers bei Vorliegen einer Altlast
142
a) Die Kenntnis der ehemaligen Nutzung
142
b) Die Vorteile der Nutzung
143
c) Genehmigung oder Duldung des Betriebs durch Behörden
144
d) Die Erkennbarkeit der Gefährlichkeit des Betriebs
144
e) Sicherungsmaßnahmen
144
VI. Ergebnis
145
Drittes Kapitel Ein Ausgleichsanspruch für den Störer? I.
Einleitung und Problemstellung
II. Ausgleichsansprüche als Sonderopferentschädigung . . . 1. Ausgleichsansprüche des Nichtstörers
146 146 147 147
a) Die gesetzliche Regelung
147
b) Der zugrundeliegende Rechtsgedanke
148
2. Der Aufopferungsgrundsatz der §§ 74, 75 EinlALR im Störerrecht III. Ausgleichsansprüche des Störers
148 150
1. Die h.M. zur analogen Anwendung des Nichtstörerausgleichs auf den Störer . . . 150 2. Die analoge Anwendbarkeit unter dem Gesichtspunkt des Effektivitätspostulats . 151 3. Entschädigungsansprüche für den Störer in Spezialgesetzen
151
4. Zulässigkeit der analogen Anwendbarkeit der Regelung des Nichtstörerausgleichs auf bestimmte Zustandsstörer 152 Ergebnis
154
Zusammenfassung
155
Literaturverzeichnis
159
Abkürzungen a.A
anderer Ansicht
a.a.O.
am angegebenen Ort
Abs.
Absatz
AöR
Archiv für öffentliches Recht
Art.
Artikel
AtomG
Atomgesetz
Aufl.
Auflage
ALR
Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794
BayKostG
Bayerisches Kostengesetz
BayPAG
Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Staatlichen Polizei
BayVBl
Bayerische Verwaltungsblätter
BayVGH
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
BB
Betriebs-Berater
Bd.
Band
BerlASOG Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin Beschl. v.
Beschluß vom
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGH
Bundesgerichtshof
BGHZ
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (Amtliche Sammlung)
BGSG
Bundesgrenzschutzgesetz
BImSchG
Bundesimmissionsschutzgesetz
BremPolG
Bremisches Polizeigesetz
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Amtliche Sammlung)
BVerwG
Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts (Amtliche Sammlung)
BWPolG
Polizeigesetz für Baden-Württemberg
DAR
Deutsches Autorecht
Abkürzungen
ders.
derselbe
d.h.
das heißt
Diss jur.
juristische Dissertation
DÖV
Die öffentliche Verwaltung
DVB1
Deutsches Verwaltungsblatt
E
amtliche Entscheidungssammlung
EinlALR
Einleitung Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794
f.
folgend
ff.
folgende
FN
Fußnote
GastG
Gaststättengesetz
17
GewArchiv Gewerbearchiv GewO
Gewerbeordnung
GG
Grundgesetz
GVB1
Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt
HgbSOG
Hamburgisches Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
HessSOG
Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HessVGH
Hessischer Verwaltungsgerichtshof
h.M.
herrschende Meinung
Hrsg./hrsg.
Herausgeber, herausgegeben
i.S.d.
im Sinne des
i.V.m.
in Verbindung mit
JA
Juristische Arbeitsblätter
JöR
Jahrbuch für öffentliches Recht
Jura
Juristische Ausbildung
JuS
Juristische Schulung
JZ
Juristenzeitung
Lit.
Literatur
LS
Leitsatz
LStVG
Bayerisches Gesetzüber das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
m.E.
meines Erachtens
MEPolG
Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes des Bundes und der Länder
m.w.N.
mit weiteren Nachweisen
NdsSOG
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
2 Griesbeck
Abkürzungen
18
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
Nr.
Nummer
NuR
Natur und Recht
NVwZ
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NVwZ-RR
NVwZ-Rechtsprechungsreport
NwOBG
Nordrheinwestfälisches Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden
NWPolG
Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
NWVBl
Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter
NZV
Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht
OVG
Oberverwaltungsgericht
OVGE
Entscheidungen der Oberverwaltungsgerichte Lüneburg und Münster (Amtliche Sammlung)
PolKostV
Polizeikostenverordnung
PreußPVG Preußisches Polizeiverwaltungsgesetz PrOVG
Preußisches Oberverwaltungsgericht
PrOVGE
Entscheidungen des Preußiches Oberverwaltungsgerichts (Amtliche Sammlung)
PVG
Polizeiverwaltungsgesetz
Rdnr.
Randnummer
RhPfPVG
Polizeigesetz von Rheinland-Pfalz
Rspr.
Rechtsprechung
S.
Seite
s.a.
siehe auch
SaarlPVG
Saarländisches Polizeiverwaltungsgesetz
SHLVwG
Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein
s.o.
siehe oben
s.u.
siehe unten
UPR
Umwelt- und Planungsrecht
Urt. v.
Urteil vom
VBIBW
Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg
VG
Verwaltungsgericht
VGH
Verwaltungsgerichtshof
VGHBW
Baden-Württembergischer Verwaltungsgerichtshof
vgl.
vergleiche
VollzBek
Vollzugsbekanntmachung
Abkürzungen
VR
Verwaltungsrundschau
WDStRL
Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer
VwArchiv
Verwaltungsarchiv
VwGO
Verwaltungsgerichtsordnung
z.B.
zum Beispiel
ZRP
Zeitschrift für Rechtspolitik
19
Einleitung In Rechtsprechung und Literatur wird davon ausgegangen, daß die Kostentragungspflicht des Zustandsstörers Surrogat der Beseitigungspflicht ist und beide deshalb nicht getrennt werden können. Dies führt insbesondere in den Altlasten-Fällen dazu, daß der Eigentümer eines kontaminierten Grundstücks, der selbst Opfer eines unbekannten Handlungsstörers wurde, kostentragungspflichtig ist. Um dieses als unbillig empfundene Ergebnis zu korrigieren, wird in der Literatur vorgeschlagen, den Eigentümer in solchen Opfer-Fällen als Nichtstörer anzusehen oder seine Haftung zu begrenzen. Zur Begründung wird angegeben, die Zustandsstörerverantwortlichkeit sei Ausdruck einer Eigentumsschranke (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG) oder der Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG) und einer Risikoverteilung zwischen einzelnem und Allgemeinheit. Wenn die Gefahr aus der Risikosphäre der Allgemeinheit komme oder zu einer Störung der Privatnützigkeit des Eigentums führe, sei deshalb eine verfassungskonforme "Haftungsreduktion 11 geboten. Die Altlasten-Problematik führt somit an die Wurzeln des Polizeirechts, nämlich zu der Frage nach dem Grund der Zustandsstörereigenschaft und nach dem Umfang der Pflichten des Störers. Die vorliegende Arbeit will dieser Frage nachgehen, wobei geprüft wird, ob die Altlasten-Problematik auch ohne Durchbrechung polizeirechtlicher Grundsätze dadurch gelöst werden kann, daß man sich auf die materielle Polizeipflicht als eigentlichem Grund der Störereigenschaft besinnt und Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht getrennt betrachtet. Gerade im Zusammenhang mit der Altlasten-Problematik wurde die "quasi mechanische Verknüpfung von polizeirechtlicher Beseitigungsverantwortung und Kostenhaftung" kritisiert. Es sei nicht überzeugend, wenn man gezwungen werde, die Störerverantwortlichkeit einzuschränken, lediglich, um eine Begrenzung des Kostenrisikos zu erreichen (Diederichsen, BB 1988, 917, 921). Bei einer getrennten Betrachtung von Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht ist möglicherweise eine Freistellung des Eigentümers, der Opfer eines Handlungsstörers geworden ist, von den Kosten der Beseitigung ohne Rückgriff auf dem Polizeirecht systemfremde Bewertungstopoi
22
Einleitung
und ohne eine dem Wortlaut des Gesetzes widersprechende Erklärung des Eigentümers zum Nichtstörer möglich. Sie ergäbe sich aus den der Kostentragungspflicht zugrundeliegenden eigenständigen Prinzipien. Die Fragestellung bestimmt auch den Aufbau der Arbeit: Nach einer Einführung in das Gefahrenabwehrrecht, soweit es für die Problematik von Interesse ist, und einer Darstellung der Altlasten-Fälle und der Lösungsversuche (Erster Teil) befaßt sich die Arbeit mit Rechtsgrund und Umfang der Zustandsstörerverantwortlichkeit (Zweiter Teil) und mit der Kostentragungspflicht (Dritter Teil).
Erster
Teil
Einführung in das Störerrecht und in die Altlasten-Problematik Erstes Kapitel
Gefahrenabwehrrecht — Begriffliches und Problemstellung I. Gefahr und Gefahrenabwehr 1. Die Entwicklung des materiellen Polizeibegriffs Kennzeichnend für die Geschichte des Polizeibegriffe ist die Wandlung von der Bezeichnung für einen Zustand des Gemeinwesens zur Bezeichnung für Aufgaben und Tätigkeiten staatlicher Behörden und die Eingrenzung dieser Aufgaben von der Wohlfahrtspflege auf reine Gefahrenabwehr1. Der Begriff der Polizei bezeichnete bis ins 18. Jahrhundert einen Zustand der guten Ordnung des Gemeinwesens. Zur Tätigkeit der Polizei gehörte auch die Wohlfahrtspflege. Erst im Zuge der Aufklärung wurde die polizeiliche Eingriffebefugnis auf die Gefahrenabwehr beschränkt. § 10 II 17 des preußischen Allgemeinen Landrechts von 1794 bestimmte: "Die nöthigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung und zur Abwendung der dem Publiko oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizey"2. Die Beschränkung der Polizei auf die Gefahrenabwehr wurde - nach einer Renaissance des wohlfahrtstaatlichen Denkens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts - in der Entscheidung des Preußischen Oberver-
1 Drews/Wacfce/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 3 m.w.N.; Friauf in: von Münch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, S. 208; Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht III, S. 2 ff.; Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 2 ff.; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 6 ff.; Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 2. 2 Vgl. Friauf in: von Münch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, S. 208; s.a. Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 3.
24
Erster Teil: Einführung
waltungsgerichts vom 14. Juni 1882, dem sogenannten Kreuzberg-Urteil 3, durch die Rechtsprechung bekräftigt. In diesem Urteil wurde eine Polizeiverordnung für ungültig erklärt, deren Zweck es war, durch Bauverbote freie Sicht auf ein Denkmal zu gewährleisten. Das Gericht sah darin eine Maßnahme der Wohlfahrtspflege, die vom Aufgabenbereich der Polizei nicht gedeckt war. In § 14 Abs. 1 des Preußischen PVG von 1931 wurde die Aufgabe der Polizei wie folgt festgeschrieben: "Die Polizeibehörden haben im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßem Ermessen notwendigen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit oder dem Einzelnen Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit und Ordnung bedroht wird"4. Damit ist zugleich der materielle, d. h. von der Aufgabe her bestimmte5 Polizeibegriff festgelegt: Bei der Polizei handelt es sich demnach um Staatstätigkeit, die dazu dient, von der Allgemeinheit oder dem Einzelnen Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit und Ordnung bedroht wird. Der materielle Begriff der Polizei befaßt sich also mit der Frage, was unter Polizei als Verwaltungstätigkeit zu verstehen ist und unter welchen Voraussetzungen dabei zur Aufgabenerfüllung in die Rechtssphäre des Bürgers eingegriffen werden darf 6. Der formelle Begriff der Polizei bezieht sich dagegen auf den Zuständigkeitsbereich der Behörden, die organisationsrechtlich ausdrücklich als Polizeibehörden bezeichnet werden7. Polizeibehörden sind sowohl für die Gefahrenabwehr (präventives Tätigwerden) als auch für die Strafverfolgung (repressives Tätigwerden) zuständig8.
3
PrOVGE 9, 353 ff.
4
Vgl. Wolff/Bachofy Verwaltungsrecht III, S. 7; s.a. Drews fWacke/Vogel/Martens, Gefahre abwehr, S. 10 f.; zur Geschichte des Polizeibegriffs und zu den bayerischen Besonderheiten siehe Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 1 ff.; Drews fWacke/Vogel/'Martens, Gefahrenabwehr, S. 2 ff. 5
Drews fWackeßfogellMartens,
Gefahrenabwehr, S. 3.
6
Friauf in: von Münch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, S. 209; DrewsfWackefVogell Martens, Gefahrenabwehr, S. 33; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 14,17. 7 Friauf in: von Münch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, S. 209; Drews/Wacke/Vogel/ Martens, Gefahrenabwehr, S. 3, 33; zum materiellen und formellen Polizeibegriff s.a. Wolff! Bachof, Verwaltungsrecht III, S. 15 f.; Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 13 ff.; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 18; Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 1.
** Zur unterschiedlichen Terminologie siehe Knemeyer, Rdnr. 26.
Polizei- und Ordnungsrecht,
1. Kapitel: Gefahrenabwehrrecht
25
2. Gefahrenabwehr im Polizei· und Ordnungsrecht des Bundes und der Länder Die Aufgabe der Polizei ist zwischen Polizei- und Sicherheitsbehörden aufgeteilt, eine weitere Zersplitterung ergibt sich aus der bundesstaatlichen Ordnung. Bundesrechtliche Normen der Gefahrenabwehr finden sich z.B. im Polizeirecht des Bundes (Bundesgrenzschutzgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Eisenbahnordnung)9 und in Gesetzen zum Gewerberecht, Umweltschutzrecht, Recht des Gesundheitsschutzes, Lebensmittelrecht und im Versammlungsrecht10. Die Gesetzgebungskompetenz für das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht liegt bei den Ländern (Art. 70 GG). Manche Länder haben für Polizei- und Ordnungsbehörden ein einziges Gesetz, andere, z.B. Bayern, regeln Polizei- und Ordnungsrecht für Polizei- und Sicherheitsbehörden in gesonderten Gesetzen. Zum Zweck der Rechtsvereinheitlichung durch inhaltliche Angleichung der verschiedenen Polizeigesetze von Bund und Ländern wurde 1977 der Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes des Bundes und der Länder (MEPolG) vorgelegt. Er folgt dem bayerischen System des Polizeirechts (Trennung von Polizei- und Sicherheitsbehörden, von Aufgaben und Befugnissen und von Generalklausel und Spezialbefugnissen)11 und betrifft nur die Vollzugspolizei, nicht die Ordnungsverwaltung. Bayern hat sein Polizeigesetz 1978 dem MEPolG angeglichen, soweit dies erforderlich war. Da das bayerische Polizeiaufgabengesetz (BayPAG) und der MEPolG die Grundsätze des allgemeinen Rechts der Gefahreivabwehr in dem hier interessierenden Bereich der Abwehr einer konkreten Gefahr aufgrund der Eingriffsbefugnis der polizeilichen Generalklausel am besten verdeutlichen, soll bei der folgenden Darstellung von diesen beiden Regelungswerken ausgegangen werden. Auf das bayerische Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG), das auch Normen zur Abwehr abstrakter Gefahren und Verordnungsermächtigungen enthält, in seinem allgemeinen Teil jedoch weitgehende Parallelen mit dem BayPAG aufweist, soll aus Gründen der
y
Dazu Drews/WackeßSogel/Martens,
Gefahrenabwehr, S. 63 ff.
10
Zu diesen Gebieten des besonderen Sicherheitsrechts siehe Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 364 ff., und Drews fWackefVogeHMartens, Gefahrenabwehr, S. 154 ff. 11
Knemeyer in: Maunz/Obermayer/Berg/Knemeyer, Staats- und Verwaltungsrecht, S. 334.
26
Erster Teil: Einführung
Klarheit der Darstellung nur eingegangen werden, wenn dies erforderlich erscheint. Die Ermächtigungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr befinden sich in Gesetzen und Verordnungen, die sich mit einer bestimmten Rechtsmaterie beschäftigen (z.B. GewO, GaststättenG, BImSchG, Landesbauordnungen), in den Spezialnormen der Polizei- und Ordnungsgesetze (Ermächtigungsgrundlage für sog. Standardmaßnahmen wie z.B. Identitätsfeststellung, - Art. 12 BayPAG -, Platzverweisung - Art. 15 BayPAG -, Gewahrsam - Art. 16 BayPAG -, Durchsuchung - Art. 20 BayPAG) 12 sowie in der polizeilichen Generalklausel13. Diese ist Befugnisnorm für sogenannte atypische Maßnahmen. Die Generalklauseln in den Polizeigesetzen der Länder und des Bundes14 stimmen wörtlich oder sinngemäß mit § 8 MEPolG überein, der lautet: "(1) Die Polizei kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Fall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Gefahr) abzuwehren, soweit nicht die §§ 9 bis 22 die Befugnisse der Polizei besonders regeln. (2) Zur Erfüllung der Aufgaben, die der Polizei durch andere Rechtsvorschriften zugewiesen sind (§ 1 Abs. 4), hat sie die dort vorgesehenen Befugnisse. Soweit solche Rechtsvorschriften Befugnisse der Polizei nicht regeln, hat sie die Befugnisse, die ihr nach diesem Gesetz zustehen."
3. Gefahr und Störung a) Abstrakte und konkrete Gefahr Polizeiliches Einschreiten nach der Generalklausel setzt stets eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung voraus. Eine Gefahr ist eine Sachlage, die in absehbarer Zeit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden für die öffentliche Sicherheit und
12 Siehe dazu Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 111 ff.; DrewsfWackefVogell Martens, Gefahrenabwehr, S. 189 ff. 13 14
Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 18 ff.
§ 3 BWPolG; Art. 11 BayPAG; § 14 Abs. 1 BerlASOG; § 10 Abs. 1 BremPolG; § 3 HbgSOG; § 11 NdsSOG; § 8 NWPolG, § 14 NWOBG; § 9RhPfPVG; § 171 SHLVwG; § 10 BGSG.
1. Kapitel: Gefahrenabwehrrecht
27
Ordnung führen würde 15. Dabei sind konkrete und abstrakte Gefahren zu unterscheiden. Der Begriff der abstrakten Gefahr bezeichnet die Gefährlichkeit eines allgemeinen, abstrakten Sachverhalts. Eine abstrakte Gefahr liegt vor, wenn aus Handlungen und Zuständen nach den Gesetzen der Lebenserfahrung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit konkrete Gefahren zu erwachsen pflegen 16. Für den Erlaß einer Polizeiverordnung genügt eine abstrakte Gefahr. Dagegen ist unter konkreter Gefahr eine Sachlage zu verstehen, die im Einzelfall objektiv oder jedenfalls aus der (ex ante-) Sicht des für die Polizei handelnden Amtswalters bei verständiger Würdigung der Sachlage in naher Zukunft die Möglichkeit eines Schadens in sich birgt. Eine Gewißheit über den Schadenseintritt ist nicht erforderlich. Je bedeutsamer und höherrangiger das bedrohte Rechtsgut ist, um so geringere Anforderungen sind an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts zu stellen17. Für den Erlaß eines Polizeiverwaltungsakts nach der polizeilichen Generalklausel ist stets eine konkrete Gefahr erforderlich 18.
b) Störung Von einer Störung spricht man, wenn sich eine Gefahr verwirklicht hat und ein Schaden bereits eingetreten ist 19 . Bei einer bloßen Gefahrenlage dagegen braucht ein Schaden noch nicht eingetreten zu sein. Ein baufälliges Bauwerk stellt z.B. eine Gefahr dar, aber erst nach dem Einsturz ist eine Störung gegeben20. Ein Polizeiverwaltungsakt kann auch bei Vorliegen einer Störung erlassen werden, allerdings nur, wenn von ihr eine weitere Bedrohung von Rechtsgütern ausgeht. Eine Störung ist somit unter dem Gesichtspunkt
^ Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 115; auf die ζ. T. umstrittenen Begriffe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung braucht in unserem Zusammenhang nicht eingegangen zu werden. Entscheidend für das Thema sind die Pflichten des Störers beim Vorliegen einer Gefahr. 16
König, Bayerisches Polizeirecht, S. 35.
17
König, Bayerisches Polizeirecht, S. 32.
18
Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 28.
^ DrewsflVacIce/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 220; König, Bayerisches Polizeirecht, S. 36; Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 49. 2 0 Berner/Köhler, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 10 zu Art. 2 BayPAG.
28
Erster Teil: Einführung
präventiven Handelns der Polizei nur dann relevant, wenn von ihr eine in die Zukunft wirkende Gefährdung ausgeht21. Polizeirecht ist Sicherheitsrecht im Sinne eines Gefahrenabwehrrechts. Eine Gefahr abzuwehren, bedeutet nicht, einen Schaden im Sinn des Zivilrechts wiedergutzumachen, sondern eine Gefahrenlage zu beseitigen und dadurch die Sicherheit wiederherzustellen.
4. Gefahr und Gefahrenvorsorge Die Ausklammerung der Wohlfahrtspflege aus dem Polizeirecht und die Festlegung der Polizei auf die Aufgabe, Gefahren abzuwehren, sowie der Begriff der Gefahr und das Vorliegen einer konkreten Gefahr als Voraussetzung der Befugnis zum Eingriff, machen die Bedeutung des Begriffe der Gefahrenabwehr für sämtliche polizeilichen Maßnahmen deutlich. Die Probleme des Polizeirechts können nur dann zutreffend behandelt werden, wenn man nie aus den Augen verliert, daß Polizeirecht Gefahrenabwehrrecht ist. Eingriffe auf der Rechtsgrundlage des Polizeirechts setzen eine Gefahr voraus und haben der Gefahrenabwehr zu dienen. Damit ist dem Polizeirecht auch eine Grenze gezogen: Wenn keine Gefahr vorliegt, sind polizeiliche Eingriffsmaßnahmen auf der Rechtsgrundlage der Generalklausel unzulässig. Bloße Vorsorgemaßnahmen sind auf Spezialgesetze, nicht jedoch auf Normen des allgemeinen Polizeirechts zu stützen . Gerade Entwicklungen im Umweltbereich haben gezeigt, daß die gestiegene Komplexität und Interdependenz von Verhaltens- und Geschehensabläufen neben einer bloßen Gefahrenabwehr in zunehmenden Maße eine Gefahrenvorsorge notwendig macht. Dabei wurde auch deutlich, daß Gefahrenvorsorge und Gefahrenabwehr oft schwer zu trennen sind23. Infolgedessen wurde in der wissenschaftlichen Diskussion auch schon der "Abschied vom materiellen Polizeibegriff 1 postuliert24. Diese Überlegungen stießen jedoch auf Ablehnung: Am materiellen Polizeibegriff und der Beschränkung auf Gefahrenabwehr als Aufgabe der Polizei sei festzuhalten, vor einem Zurückfallen in die Zeit vor dem Kreuzberg-Urteil und vor der Einführung einer verkappten Wohlfahrtspflege sei zu warnen 25.
2i 2 2
Begründung zu § 8 MEPolG, abgedruckt bei284. Heise/Riegel, S.a. Rid/Hammann, UPR 1990, 281, 282,
2 3
Vgl. aus jüngster Zeit für den Bodenschutz Rid/Hammann,
2 4
Erichsen, W D S t R L 35 (1976), S. 182 ff., 216 (Leitsatz 5).
2 5
Martens, W D S t R L 35 (1976), S. 310 f.; Friauf,
Musterentwurf, S. 43. UPR 1990, 281, 282 ff.
W D S t R L 35 (1976), S. 315.
1. Kapitel: Gefahrenabwehrrecht
29
Dem ist zuzustimmen, da Gefahrenabwehr schon begrifflich eine bestehende Gefahr voraussetzt. Demgegenüber soll Gefahrenvorsorge den Eintritt einer Gefahr gerade verhindern. Eine konkrete Gefahr ist also in den Fällen der Vorsorge noch gar nicht eingetreten. In Spezialgesetzen mögen Vorsorge- und Gefahrenabwehrnormen dem gleichen Rechtsgut dienen und nebeneinanderstehen, wie das z.B. in § 5 BImSchG der Fall ist. Gleichwohl dürfen Gefahrenvorsorge und Gefahrenabwehr nicht gleichgesetzt werden26. Diese Erkenntnis spielt auch für die Bestimmung des Inhalts der Pflichten des Störers eine Rolle 27 .
IL Störer und Polizeipflichtige 7. Störerrecht
als Adressatenrecht
Polizeiliches Einschreiten bei einer konkreten Gefahr hat der Gefahrenabwehr zu dienen. Die Gefahr ist abgewehrt, wenn eine vorhandene Gefahrenlage oder eine Störung, von der eine weitere Gefahr ausgeht, beseitigt ist. Die Beseitigung auf Grund polizeilichen Tätigwerdens kann durch die Polizei selbst, durch Beauftragte der Polizei oder durch Dritte, die durch Polizeiverwaltungsakt verpflichtet werden, geschehen. Ein Polizeiverwaltungsakt kann sowohl ein Handlungsbefehl als auch eine Duldungsverfügung sein. Polizeibeamte, die nach einem Sturm festgestellt haben, daß ein abgebrochener Ast quer über die Straße hängt, dadurch den Verkehrsfluß stört und Autofahrer und Passanten gefährdet, können den Eigentümer des Grundstücks, auf dem der sturmgeschädigte Baum steht, verpflichten, den Ast abzusägen und fortzuschaffen. Sie können auch versuchen, falls sie den Eigentümer nicht antreffen, den Ast selbst aus dem Weg zu räumen. Sie können Passanten auffordern, ihnen dabei zu helfen oder auch einen Unternehmer mit der Beseitigung des Astes beauftragen. Unter welchen Voraussetzungen die Polizei zur Beseitigung einer konkreten Gefahr welche Zivilpersonen in Anspruch nehmen darf, ist in
2 6 So aber wohl Erichsen, W D S t R L 35 (1976), S. 180 f.; zu diesem Problem auch Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 8; Bracher, Gefahrenabwehr durch Private, S. 16 ff., 44 f.; zum Unterschied von Gefahrenabwehr und Gefahrenvorsorge im Umweltrecht s.a. Kloepfer, Umweltrecht, § 3, Rdnr. 9 ff.; SRU, Sondergutachten Altlasten, Tz. 833 ff., und am Beispiel des Bodenschutzes ausführlich Rid/Hammann, UPR 1990, 281, 282, 284 ff. 2 7
Dazu unten Zweiter Teil, Zweites Kapitel, II. 2. b).
30
Erster Teil: Einführung
den Normen des sog. Störerrechts (§§ 4, 5, 6 MEPolG, Art. 7, 8, 10 BayPAG, Art. 9 LStVG, §§ 6 ff. BWPolG, §§ 10 ff. BerlASOG, §§ 5 ff. BremPolG, §§ 7 HbgSOG, §§ 11 ff. HessSOG, §§ 6 ff. NdsSOG, §§ 4 ff. NWPolG, § 4 ff. RhPfPVG, §§ 184 ff. SHLVwG), die zu den allgemeinen Vorschriften des Polizei- und Ordnungsrechts gehören, geregelt. Maßnahmen sind nur zulässig, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme gerade der betreffenden Person vorliegen28. Es ist zu beachten, daß die Normen des Störerrechts nur die Richtung der Maßnahme, den Adressaten eines auf der Grundlage der Generalklausel ergangenen Polizeiverwaltungsakts bestimmen. Art. 9 LStVG ist demgemäß mit "Richtung der Maßnahmen" überschrieben. Art. 7, 8, 10 BayPAG, Art. 9 LStVG und vergleichbare Normen in anderen Länderund Bundesgesetzen sind keine Befugnisnormen 29. Die Voraussetzungen der Generalklausel-Eingriffsermächtigung - insbesondere das Vorliegen einer konkreten Gefahr 30 - müssen immer erfüllt sein. Wegen dieser Akzessorietät muß das Störerrecht auch am Zweck der Generalklausel gemessen werden31.
2 Formelle und materielle Polizeipflicht Die Normen des Störerrechts bezeichnen die potentiellen Adressaten eines Polizeiverwaltungsakts (formell Polizeipflichtige) 32. Dabei sind polizeiliche Maßnahmen vorrangig gegen die dort zuerst genannten Verantwortlichen (Handlungs- und Zustandsstörer) zu richten. Die Normen des Störerrechts geben jedoch nicht an, warum gerade die genannten Verantwortlichen vorrangig in Anspruch zu nehmen sind. Damit stellt sich die Frage nach dem Grund der Inanspruchnahme. Das ältere Polizeirecht sah den Grund der Inanspruchnahme in einer öffentlich-rechtlichen Pflicht, die nicht normiert ist, die sich jedoch aus der Generalklausel ergibt. Man spricht dabei von der materiellen Polizeipflicht. Die materielle Polizeipflicht wurde formuliert als "die Pflicht eines jeden Rechtsgenossen, sein Verhalten und den Zustand seiner Sachen so ein-
2 8
König, Bayerisches Polizeirecht, S. 151.
2 9
Nr. 7.1 VollzBek zu Art. 7 BayPAG; Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 82; König, Bayerisches Polizeirecht, S. 151,163. 3 0
Heise/Riegel,
31
Ähnlich Pietzcker,
3 2
Wolff/Bachof,
Musterentwurf, S. 35. DVB1 1984, 457, 459. Verwaltungsrecht III, S. 64; Gantner, Verursachung, S. 9.
1. Kapitel: Gefahrenabwehrrecht
31
zurichten, daß daraus keine Störungen oder Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung entstehen"33. Es handelt sich dabei um eine Pflicht, die schon vor Erlaß des Polizeiverwaltungsakts existiert und die durch den Polizeiverwaltungsakt lediglich aktualisiert und konkretisiert wird 34 . Die materielle Polizeipflicht ist der einheitliche Rechtsgrund für die Inanspruchnahme des Handlungsstörers und des Zustandsstörers.
3. Der Handlungsstörer Als Handlungsstörer (Art. 7 BayPAG; § 4 MEPolG; § 6 BWPolG; § 10 BerlASOG; § 5 BremPolG; § 8 HbgSOG; §§ 12, 13 HessSOG; § 6 NdsSOG; § 4 NWPolG; § 17 NWOBG; § 4 RhPfPVG; § 19 SaarlPVG; § 185 SHLVwG; § 13 BGSG) kann in Anspruch genommen werden, wer eine Gefahr verursacht hat 35 . Eine Gefahr kann auch durch Unterlassen verursacht werden, falls eine Rechtspflicht zum Handeln besteht36. Handlungsstörer ist aber nicht nur der Verursacher, sondern auch der Aufsichtspflichtige über den Verursacher oder derjenige, dessen Verrichtungsgehilfe der Verursacher war. Man spricht insoweit von Zusatzhaftung für fremdes Verhalten 37. Zu beachten ist, daß es beim Handlungsstörer weder auf Rechtswidrigkeit des Verhaltens noch auf Schuld ankommt. Auch Schuldunfähige und Minderjährige, die eine Gefahr verursacht haben, sind Verhaltensver-
3 3
Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 293; s.a. Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 189; Selmer, Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, S. 485; Gantner, Verursachung, S. 9 f.; Wolff. IBachof rechnen zur Polizeipflicht die "Pflichtigkeit zur Vermeidung von Gefahrenlagen und zur Beseitigung etwa dennoch eingetretener Störungen" (Verwaltungsrecht III, S. 63); ohne Bezugnahme auf den Begriff der materiellen Polizeipflicht: Pietzcker, DVB1 1984, 457, 459. DrewslWackefVogellMartens, Gefahrenabwehr, S. 293; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 189; Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht III, S.63; Gantner, Verursachung, S. 10. 3 5
Auf die verschiedenen Meinungen zum Verursacherbegriff braucht in diesem Zusammenhang nicht eingegangen zu werden; siehe dazu Drews /Wackeß/ogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 310 ff.; Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 88 ff. 3 6 Nr. 7.3 Vollzbek. zu Art. 7 BayPAG; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 203; Friauf in: von Münch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, S. 231. 3 7 DrewsfWackefVogellMartens, Gefahrenabwehr, S. 308 ff.; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 204 f.; Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 94.
32
Erster Teil: Einführung
antwortliche38. Auch auf Vorhersehbarkeit kommt es nicht an 39 . Die Verhaltensverantwortlichkeit ist damit als objektive Erfolgshaftung ausgestaltet und von subjektiven Verantwortlichkeitskriterien unabhängig40. Die Polizeibehörden sollen eine Gefahr möglichst schnell und wirksam abwehren können41.
4. Der Zustandsstörer Wenn die Gefahr vom Zustand einer Sache oder vom Zustand oder Verhalten eines Tieres ausgeht, sind Maßnahmen gegen den Inhaber der tatsächlichen Gewalt zu richten (Art. 8 Abs. 1 BayPAG, § 5 Abs. 1 MEPolG). Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist derjenige, der die tatsächliche Einwirkungsmöglichkeit - berechtigt oder unberechtigt - auf die Sache hat 42 . Auch ein Dieb kann in bezug auf die gestohlene Sache Zustandsstörer sein43. Maßnahmen können auch gegen den Eigentümer oder einen anderen Berechtigten gerichtet werden, es sei denn, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt übt diese ohne den Willen des Eigentümers oder des sonstigen Berechtigten aus (Art. 8 Abs. 2 BayPAG, § 5 Abs. 2 MEPolG). Art. 8 Abs. 2 BayPAG ist auch anwendbar, wenn die tatsächliche Gewalt gegen den Willen des Berechtigten ausgeübt wird 44 . Bei derelinquierten Sachen, von denen eine Gefahr ausgeht, ist auch der frühere Eigentümer Polizeipflichtiger (Art. 8 Abs. 3 BayPAG, § 5 Abs. 3 MEPolG). In allen diesen Fällen (siehe auch § 7 BWPolG; § 11 BerlASOG; § 6 BremPolG; § 9 HbgSOG; § 14 HessSOG; § 7 NdsSOG; § 5 NWPolG, § 18 NWOBG; § 5 RhPfPVG; § 20 SaarlPVG; § 186 SHLVwG; § 14 BGSG) spricht man vom Zustandsstörer oder Zustandsverantwortlichen. Auch hierbei kommt es auf ein Verschulden für die Beschaffenheit oder Lage der
3 8
Nr. 7.3 VollzBek. zu Art. 7 BayPAG; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 202; Friauf in: von Münch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, S. 231; Heise/Riegel, Musterentwurf, S. 35. 3 9
König, Bayerisches Polizeirecht, S. 154.
4 0
König, Bayerisches Polizeirecht, S. 154.
41
Wolff/Bachof
4 2
Nr. 8.3 VollzBek. zu Art. 8 BayPAG.
4 3
Berner/Köhler,
4 4
Nr. 8.6 VollzBek. zu Art. 8 BayPAG.
Verwaltungsrecht III, S. 65. Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 4 zu Art. 8 BayPAG.
1. Kapitel: Gefahrenabwehrrecht
33
störenden Sache nicht an 45 . Auch die Ursache der Gefahr und deren Vorhersehbarkeit spielt keine Rolle 46 . Der Inhaber der Sachherrschaft ist auch dann Zustandsstörer, wenn die Sache durch Dritte in den störenden Zustand versetzt wurde 47. Entscheidend ist das Vorliegen einer Gefahr und das Bestehen einer tatsächlichen oder rechtlichen Einwirkungsmöglichkeit auf die Sache, die gegebenenfalls zur Beseitigung der Gefahr genützt werden kann48. Auch der Inhaber der tatsächlichen Gewalt, der keinen Besitzbegründungswillen hat, ist aufgrund seiner faktischen Einwirkungsmöglichkeit Zustandsstörer 49. Auf ein Besitzrecht kommt es nicht an 50 . Wenn die tatsächliche Gewalt ohne oder gegen den Willen des Berechtigten ausgeübt wird, besteht eine Einwirkungsmöglichkeit nicht. Der schuldrechtlich Berechtigte, der nicht Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist, ist nur insoweit als Zustandsstörer polizeipflichtig, soweit er nach der Art der Gefahr eine Einwirkungsmöglichkeit hat, die zur Beseitigung der Gefahrenlage genützt werden kann51. 5. Der Nichtstörer Andere als die nach Art. 7 oder 8 BayPAG Verantwortlichen - sogenannte Nichtverantwortliche oder Nichtstörer - können gemäß Art. 10 BayPAG nur unter engen Voraussetzungen zur Beseitigung der Gefahrenlage in Anspruch genommen werden52:
4 5
Nr. 8.5 VollzBek. zu Art. 8 BayPAG.
^ DrewsßVacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 320; Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 256; a.A. Baur, JZ 1964, 354, 356, der der Ansicht ist, für höhere Gewalt (Naturgewalten) brauche der Eigentümer nicht einzustehen; Nr. 8.5 VollzBek. zu Art. 8 BayPAG besagt dagegen ausdrücklich, daß die Gefahr auch durch höhere Gewalt entstanden sein kann. 4 7
BayVGH, Beschl. v. 01.07.1986, BayVBl 1986, 625, 626.
4 8
DrewsfWackefVo&Martens, NVwZ-RR 1989, 298. 4 9
Gefahrenabwehr, S. 318 f.; BayVGH, Urt. v. 17.10.1988,
König, Bayerisches Polizeirecht, S. 160.
5 0
Amtliche Begründung zu § 5 Abs. 1 MEPolG, abgedruckt bei Heise/Riegel, wurf, S. 36.
Musterent-
5 1 Vgl. die amtliche Begründung zu § 5 Abs. 2 MEPolG, abgedruckt bei Heise/Riegel, Musterentwurf, S. 36; Berner/Köhler, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 5 zu Art. 8 BayPAG; Samper/Honnacker, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 7 zu Art. 8 BayPAG; Friauf in: von Münch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, S. 235 f. 5 2 Vgl. auch § 6 MEPolG; § 9 BWPolG; §13 BerlASOG; § 8 BremPG; § 15 HessSOG; § 8 NdsSOG; § 6 NWPolG; § 19 NWOBG; § 7 RhPfPVG; § 21 SaarlPVG; § 187 SHLVwG; § 16 BGSG.
3 Griesbeck
34
Erster Teil: Einführung
Es muß eine gegenwärtige, erhebliche Gefahr abzuwehren sein (Art. 10 Abs. 1 Nr. 1 BayPAG), wobei Maßnahmen gegen den Handlungs- oder Zustandsstörer nicht oder nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg versprechen (Art. 10 Abs. 1 Nr. 2 BayPAG) und auch die Polizei die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch Beauftragte im Wege der unmittelbaren Ausführung abwehren kann (Art. 10 Abs. 1 Nr. 3 BayPAG). Außerdem darf ein Nichtstörer nicht in Anspruch genommen werden, wenn er sich dadurch einer erheblichen eigenen Gefährdung aussetzen würde oder er höherwertige Pflichten verletzen müßte (Art. 10 Abs. 1 Nr. 4 BayPAG). Die Inanspruchnahme des Nichtstörers darf nur aufrechterhalten werden, solange die Abwehr der Gefahr nicht auf andere Weise möglich ist (Art. 10 Abs. 2 BayPAG). Die Inanspruchnahme unbeteiligter, außenstehender Dritter als Nichtstörer ist somit nur im "polizeilichen Notstand" zulässig53, in dem nur der Nichtstörer zur Beseitigung der Gefahr in der Lage ist. Doch selbst dann ist seine Inanspruchnahme nur unter engen Voraussetzungen möglich. Nur das Interesse an einer schnellen, sonst unmöglichen Gefahrenabwehr erlaubt einen Eingriff in seine Rechte. Er hat keine materielle Polizeipflicht, sondern wird erst durch den Polizeiverwaltungsakt zur Beseitigung verpflichtet. Dem Nichtstörer steht in bestimmten Fällen ein Entschädigungsanspruch zu. Dies ist jedoch nicht in den Normen des Störerrechts, sondern an anderer Stelle festgelegt 54. Art. 10 BayPAG und vergleichbare Normen regeln lediglich die — engen - Voraussetzungen der Inanspruchnahme des Nichtstörers zur Beseitigung einer Gefahrenlage. Aus der Formulierung der Gesetze "andere Personen als die nach Art. 7 oder 8 Verantwortlichen" (Art. 10 Abs. 1 BayPAG) oder "eine Person ..., die nicht nach Abs. 1 oder 2 verantwortlich ist" (Art. 9 Abs. 3 LStVG) wird deutlich, daß das Störerrecht ein geschlossenes System darstellt: Jemand ist entweder Störer oder Nichtstörer. Es gibt weder eine dritte Möglichkeit, noch Mischformen.
III. Unmittelbare Ausführung und Ersatzvornahme L Unmittelbare Ausführung Unter den Normen des Störerrechts, nach den Bestimmungen über Handlungs- und Zustandsstörer, aber noch vor der Regelung der Inan-
Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 104 ff. 5 4
S.u. IV.3.
1. Kapitel: Gefahrenabwehrrecht
35
spruchnahme des Nichtstörers, findet sich in den meisten Polizeigesetzen die Bestimmung über die sogenannte unmittelbare Ausführung (Art. 9 BayPAG; § 5a MEPolG; vgl. auch § 8 BWPolG; § 12 BerlASOG; § 7 BremPG; § 7 HbgSOG; § 14 a HessSOG; § 6 RhPfPVG; § 15 BGSG) 55 . Danach kann die Polizei eine Maßnahme selbst ausführen oder durch einen Beauftragten ausführen lassen, wenn der Zweck der Maßnahme durch Inanspruchnahme von Handlungs- und Zustandsstörer nicht oder nicht rechtzeitig erreicht werden kann. Die Bestimmung über die unmittelbare Ausführung bezeichnet nicht die Richtung einer Maßnahme. Sie ist daher nicht dem Adressatenrecht zuzurechnen. Dies wird besonders im LStVG deutlich, wo die Vorschrift über die unmittelbare Ausführung in dem Artikel über "Befugnisse der Sicherheitsbehörden" unmittelbar nach der polizeilichen Generalklausel steht (Art. 7 Abs. 3). Erst in Art. 9 LStVG folgen Bestimmungen über die "Richtung der Maßnahmen". Auf das Problem, ob die unmittelbare Ausführung einen Verwaltungsakt voraussetzt und das damit zusammenhängende Problem des adressatenlosen Verwaltungsakts braucht in Zusammenhang mit dem vorliegenden Thema nicht eingegangen zu werden56. Festzuhalten bleibt, daß die unmittelbare Ausführung eine besondere Maßnahme der Polizei ist, die sich aus dem Schutzzweck des Sicherheitsrechts ergibt 57. Die Polizei kann diejenige Handlung vornehmen, die der materiell Polizeipflichtige tätigen müßte, wenn eine Anordnung an ihn ergehen könnte58. Dabei kann es sich nur um eine vertretbare Handlung handeln, die der schnellen Gefahrenbeseitigung dient59. 2. Ersatzvornahme Von der unmittelbare Ausführung ist die Ersatzvornahme zu unterscheiden (Art. 34 BayPAG; § 30 MEPolG; § 26 HessSOG; § 44 NdsSOG;
5 5
In Hessen fehlte eine Bestimmung über die unmittelbare Ausführung; erst nachdem der HessVGH in seinem Urteil vom 24.11.1986, NVwZ 1987, 904, das Institut der unmittelbaren Ausführung mangels Rechtsgrundlage für unanwendbar erklärt hatte, wurde § 14 a HessSOG eingeführt; dazu näher Graulich, NVwZ 1988, 604 f. 5 6
en 5 8 5 9
Dazu Drews fiVacke/Vogel/Martens, Berner/Köhler,
Gefahrenabwehr, S. 441.
Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 1 zu Art. 9 BayPAG.
Samper/Honnacker,
Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 2 zu Art. 9 BayPAG.
Berner/Köhler, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 1 zu Art. 9 BayPAG; Samper/Honnacker, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 3 zu Art. 9 BayPAG; Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 265; Ule/Rasch, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 6 zu § 5a MEPolG.
36
Erster Teil: Einführung
§ 30 NWPolG; § 52 RhPfPVG; § 55 SaarlPVG; § 204 SHLVwG). Auch hier nimmt die Polizei eine vertretbare Handlung vor, diesmal jedoch auf der Ebene des Vollstreckungsrechts. Die Ersatzvornahme dient also - im Gegensatz zur unmittelbaren Ausführung - der Vollstreckung eines Polizeiverwaltungsakts, dem der Adressat nicht nachgekommen ist 60 . Die Ersatzvornahme ist somit nicht dem Gefahrenabwehrrecht, sondern dem Vollstreckungsrecht zuzuordnen. Damit ist die Ersatzvornahme streng von der unmittelbaren Ausführung zu unterscheiden61. Eine Ersatzvornahme braucht sich auch nicht unbedingt gegen den Störer zu richten; auch die Verpflichtung des Nichtstörers, die durch den an ihn gerichteten Polizeiverwaltungsakt ergeht, ist durch Ersatzvornahme vollstreckbar 62. Für die Ersatzvornahme gelten auch die Voraussetzungen des Vollstreckungsrechts: es muß ein rechtmäßiger Verwaltungsakt vorausgegangen sein (z.B. ein Polizeiverwaltungsakt auf der Grundlage der polizeilichen Generalklausel - Art. 11 BayPAG, § 8 MEPolG - ) und die Vollstreckung muß angedroht worden sein.
IV. Die Kosten der Gefahrenbeseitigung i. Kosten als tatsächliche finanzielle Folge einer Gefahrenabwehrmaßnahme Ein Polizeiverwaltungsakt hat meistens - zumindest vorübergehend Folgen für das Vermögen des Verpflichteten. Nur in einfachen Fällen wird man einem Polizeiverwaltungsakt nachkommen können, ohne daß eine Vermögenseinbuße entsteht, so z.B. wenn eine störende Sache einfach an einen Platz zu bringen ist, an dem sie nicht mehr stört (Wegräumen eines herabgefallenen Astes, Wegfahren eines eine Zufahrt versperrenden Autos). 2 Die Kosten des Störers In den Normen, die bestimmen, wer Adressat eines Polizeiverwaltungsakts ist, finden sich keine Aussagen über die finanziellen Folgen des
6 0
Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 264.
6 1
Samper/Honnacker, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 1 zu Art. 9 BayPAG; Berner/Köhler, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 1 zu Art. 9 BayPAG; Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 264, 285. 6 2
König, Bayerisches Polizeirecht, S. 164.
1. Kapitel: Gefahrenabwehrrecht
37
Polizeibefehls. Es wird dort nur angegeben, gegen wen ein Polizeiverwaltungsakt mit dem Ziel der Beseitigung einer konkreten Gefahr zu richten ist. Allerdings ist für die Fälle, in denen die Polizei eine vertretbare Handlung zur Gefahrenabwehr vornimmt, eine Bestimmung über den Kostentragungspflichtigen getroffen: In den Normen des Polizeivollstreckungsrechts ist festgelegt, daß vom Betroffenen Kosten (Gebühren und Auslagen) für die Ausführung der Ersatzvornahme erhoben werden (Art. 34 Abs. 1 Satz 2 BayPAG). Im übrigen gelte das Kostengesetz (Art. 34 Abs. 1 Satz 3 BayPAG). Auch Art. 9 Abs. 2 BayPAG bestimmt, daß für die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme von den nach Art. 7 oder 8 Verantwortlichen Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben werden. Auch hier wird im Anschluß daran auf die Geltung des Kostengesetzes im übrigen verwiesen. Der Wortlaut dieser gesetzlichen Regelung ist insofern bemerkenswert, als "Kosten (Gebühren und Auslagen)" staatliche Einnahmen bezeichnen (vgl. Art. 1 BayKostG). Damit ist in den genannten Regelungen lediglich eine Aussage über eine öffentlich-rechtliche Geldleistungspflicht, nicht jedoch über die Überwälzung der konkret entstandenen Ausgaben der Polizei getroffen 63.
3. Die Kosten des Nichtstörers Auch für den Nichtstörer ist in den Normen des Störerrechts keine Aussage über die Kosten der Gefahrenbeseitigung getroffen. Für ihn finden sich jedoch in einem gesonderten Abschnitt des Gesetzes Regelungen über die finanziellen Folgen der Inanspruchnahme (Art. 49 BayPAG; §§ 46 ff. MEPolG). Er kann in der Regel davon ausgehen, daß ihm keine bleibende Vermögenseinbuße entsteht: Falls ein Nichtstörer in Anspruch genommen wurde und dadurch einen Schaden erlitt, so ist ihm dafür Entschädigung zu leisten, soweit er nicht von einem anderen Ersatz zu erlangen vermag (Art. 49 Abs. 1 BayPAG) oder die Maßnahme auch unmittelbar seinem Schutz gedient hat (Art. 49 Abs. 3 BayPAG). Ersetzt wird jedoch nur der Vermögensschaden (Art. 49 Abs. 7 Satz 1 BayPAG). Mitwirkendes Verschulden und etwaige Vermögensvorteile des Entschädigungsberechtigten sind zu berücksichtigen (Art 49 Abs. 7 Satz 2 BayPAG).
6 3
Dazu ausführlich unten Dritter Teil, Zweites Kapitel, II.
38
Erster Teil: Einführung
Es handelt sich nicht um einen Schadensersatzanspruch, sondern um einen Schadensausgleichsanspruch64. Diese Entschädigungsregelungen gelten als Ausdruck des Sonderopfergedankens: Der Nichtstörer erbringt in der Regel ein Sonderopfer 65.
4. Die Entschädigung des nicht in Anspruch genommenen Dritten Gemäß Art. 49 Abs. 2 BayPAG gilt Art. 49 Abs. 1 BayPAG auch, wenn ein nicht in Anspruch genommener Nichtstörer einen nicht zumutbaren Schaden erleidet. Ein Unbeteiligter hat in diesen Fällen ohne den Willen der Polizei durch eine berechtigte polizeiliche Maßnahme einen Schaden erlitten. Schulfälle sind der durch einen fehlgegangenen Schuß, den die Polizei auf einen fliehenden Verbrecher abgab, Verletzte und die Kellnerin, die nach der Auflösung einer Versammlung durch die Polizei in dem entstehenden Chaos bei den Teilnehmern nicht mehr kassieren kann66. Dieser Anspruch des Unbeteiligten ergibt sich schon aus allgemeinen Entschädigungs- und Aufopferungsgrundsätzen, da auch der Unbeteiligte ein Sonderopfer zugunsten der Allgemeinheit erbringt. Ohne eine polizeirechtliche Regelung würde dem Geschädigten ein Ersatzanspruch aus allgemeinen Entschädigungs- und Aufopferungsgrundsätzen zustehen67. § 45 Abs. 2 MEPolG sowie einige Ländergesetze sehen einen angemessenen Ausgleich auch für Personen vor, die mit Zustimmung der Polizei bei der Erfüllung polizeilicher Aufgaben freiwillig mitgewirkt oder Sachen zur Verfügung gestellt und dadurch einen Schaden erlitten haben68. Es handelt sich dabei ebenfalls um ein besonderes Opfer. Der Geschädigte hat im Interesse der Allgemeinheit gehandelt69.
^
Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 296.
6 5
Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 293; Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 269; Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht III, S. 73; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 280; Ule/Rasch, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 1 zu § 45 MEPolG; Papier, DVB11975,567,569; die Tatsache, daß der Nichtstörerausgleich seinen Grund in dem erbrachten Sonderopfer hat, ist auch für die Beurteilung der Kosten des Störers von Bedeutung (dazu unten Dritter Teil, Zweites und Drittes Kapitel). 6 6 Drews [Wache/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 667; Friauf in: von Münch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, S. 278; Samper/Honnacker, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 7 zu Art. 49 BayPAG. 6 7
Drews /Wacke/Vogel/Martens,
Gefahrenabwehr, S. 666; Papier, DVB1 1975, 567, 572 f.
6 8
Ablehnend: Drews /Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 667; Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 233; Papier, DVB1 1975, 567, 569 f. Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 298.
1. Kapitel: Gefahrenabwehrrecht
39
V. Problemstellung: Das Verhältnis von Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht 1. Die Ansicht, das Störerrecht
diene der Verteilung finanzieller Lasten
Angesichts der im Gesetz enthaltenen Kostenregegelungen stellt sich die Frage, ob der Beseitigungspflichtige immer auch kostentragungspflichtig ist, ob also schon aus der Störereigenschaft auf eine Kostentragungspflicht geschlossen werden kann und - wenn das so ist - ob, in welchen Fällen und warum Ausnahmen zulässig sind. Obwohl in den Normen des Störerrechts lediglich Aussagen über die Adressaten eines Polizeiverwaltungsakts gemacht werden, wird - wohl unter dem Eindruck der Regelungen über die Kosten nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme und über den Nichtstörerausgleich vertreten, daß die Vorschriften über die polizeiliche Verantwortlichkeit bestimmter Personen nicht lediglich Eingriffsmöglichkeiten schaffen sollen, sondern daß sie zugleich dazu dienen, diefinanziellen Lasten der Gefahrenabwehr zwischen dem Einzelnen und der Gesamtheit der Steuerzahler zu verteilen. Es sei eine ungeschriebene Grundregel, daß der jeweilige Störer diese Lasten selbst zu tragen habe, während sie im Verhältnis zu einem Nichtstörer von der Allgemeinheit übernommen werden müßten70. Götz hat jedoch festgestellt, daß ein Rechtssatz, wonach der Störer für die Folgen der Störung einstehen und Ersatz leisten müsse, dem Polizeirecht unbekannt ist 71 . Diese Aussage, die im Zusammenhang mit den Kosten bei kommerziellen Großveranstaltungen getroffen wurde, soll jedoch nach Ansicht von Götz für die Kosten von unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme nicht gelten. Bei den Kosten von Großveranstaltungen handle es sich um rechtlich etwas ganz anderes als um den Kostenersatz bei unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme. Grundgedanke der Regelung dieser Kostentragungspflicht sei, daß Kosten einer Handlung der Polizei auf denjenigen übergewälzt werden dürfen, in dessen Rechte- und Pflichtenbereich diese Handlung regulär gehört. Der Kosten-
7 0
Friauf in: von Münch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, S. 230, 278; ähnlich Scholler/Broß, Grundzüge des Polizei- und Ordnungsrechts, S. 234; Erler, Maßnahmen der Gefahrenabwehr, S. 112: "Dem Störerbegriff kommt nämlich, wie die rechtssystematische Unterscheidung vom Begriff des "Nichtstörers" beweist, gerade auch die Funktion eines Lastenverteilungsprinzips zu." 7 1
Götz, DVB1 1984, 14,17; s.a. Selmer, Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, S. 490.
40
Erster Teil: Einführung
ersatz gehe aus der polizeirechtlichen Handlungspflicht hervor und trete gleichsam an ihre Stelle72.
2. Die Ansicht von der Surrogatfunktion
der Kostentragungspflicht
Auch bei denen, die der Ansicht von der Lastenverteilungsfunktion des Störerrechts kritisch gegenüberstehen, gilt es doch als sicher, daß der beseitigungspflichtige Störer auch kostentragungspflichtig ist, da beide Pflichten gleichsam untrennbar verknüpft sind. Nach der herrschenden Meinung ist die Kostentragungspflicht des Störers ein "Surrogat" der Beseitigungspflicht73. Die "Primärpflicht", die polizeilich geforderte Maßnahme auszuführen, verwandle sich in die "Sekundärpflicht", die Maßnahme zu dulden und die entstandenen Kosten zu erstatten74. Die Kostentragungspflicht wird als "Annex" der Polizeipflichtigkeit bezeichnet 75 , Ordnungspflichtigkeit und Kostentragungspflicht würden sich entsprechen76. Es wird auch von einer "Konnexität" von materieller Polizeipflicht und Kostentragungspflicht gesprochen77. Obwohl die Terminologie nicht einheitlich ist und auch die den oben genannten Begriffen zugrundeliegenden Rechtsgedanken voneinander abweichen (es sei nur auf den Unterschied von Surrogat und Annex hingewiesen), soll im Folgenden bei der Darstellung und Kritik einheitlich von der "Surrogatfunktion" der Kostentragungspflicht gesprochen werden, da sie das Gemeinsame der herrschenden Meinung am deutlichsten wiedergibt: Die Kostentragungspflicht tritt angeblich an die Stelle der Beseitigungspflicht. Der Störer kann nach dieser Ansicht die ihm entstandenen Kosten der Beseitigung im Gegensatz zum Nichtstörer nicht ersetzt verlangen. Er hat in den Fällen der unmittelbaren Ausführung und Ersatzvornahme die Kosten stets und in vollem Umfang zu tragen.
7 2
Götz, DVBl 1984, 14 ff.; ders. NVwZ 1987, 858, 864; ausführlich zu dieser Ansicht unten Dritter Teil, Zweites Kapitel, II. 3. 7 3
Selmer, Gedachtnisschrift für Wolfgang Martens, S. 483, 492; Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung, S. 28 f.; Brandner, Gefahrenerkennbarkeit, S. 40; Herrmann, Flächensanierung, S. 92; BayVGH, Urt. v. 17.10.1988, NVwZ-RR 1989, 298, 299. 7 4
Ule/Rasch, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 13 zu § 5 MEPolG.
7 5
BVerwG, Urt. v. 09.05.1960, E 10, 282, 285.
7 6
Seiben, DVBl 1985, 328.
7 7
Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 97; Selmer, Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, S. 483, 491; s.a. Bott, Verantwortlichkeit, S. 185.
1. Kapitel: Gefahrenabwehrrecht
41
In letzter Konsequenz der Prämisse, der Störer sei immer auch kostentragungspflichtig, wird vorgeschlagen, in die Störerbestimmung den Kostenaspekt miteinzubeziehen und die Störereigenschaft davon abhängig zu machen, ob es gerechtfertigt erscheint, dem Beseitigungspflichtigen die Kosten aufzuerlegen 78. Die Höhe der finanziellen Belastung würde dann über die Störerqualifikation entscheiden79.
5. Die kritische
Überprüfung
dieser Ansichten anhand der Altlasten-Fä
Die Annahme einer unbegrenzten Kostentragungspflicht des Zustandsstörers kann zu unbestreitbaren Härten führen, insbesondere in den Fällen, in denen ein Eigentümer Opfer" eines unbekannten Handlungsstörers geworden ist und die Beseitigung mit hohen Kosten verbunden ist. Nach dem Gesetzeswortlaut ist er Zustandsstörer und als solcher beseitigungspflichtig. Darüber hinaus muß er bei der Annahme einer Konnexität oder Surrogatfunktion die Kosten der Beseitigung tragen. Insbesondere diese "Opfer-Fälle" haben in Literatur und Rechtsprechung dazu geführt, den "Leitsatz", daß der Eigentümer immer Zustandsstörer ist und deshalb immer die Kosten zu tragen hat, einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Ziel (und in den meisten Fällen Ergebnis) war dabei eine Begrenzung der als ungerecht empfundenen Kostenlast des Eigentümers, von dessen Sache eine Gefahr ausging. Unter diesem Gesichtspunkt sind zwei Lösungsansätze denkbar: (1) Der Eigentümer ist nicht in jedem Fall Zustandsstörer (tatbestandsorientierter Lösungsansatz) (2) Der Zustandsstörer ist nicht immer kostentragungspflichtig (rechtsfolgenorientierter Lösungsansatz) Insbesondere in den Altlasten-Fällen wurde versucht, das als unbillig empfundene Ergebnis einer unbegrenzten Kostentragungspflicht des Grundstückseigentümers zu korrigieren. Dabei wurde jedoch grundsätzlich an der Untrennbarkeit von Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht festgehalten und die Lösung in einer aus dem Verfassungsrecht hergeleiteten Begrenzung der Zustandsstörerverantwortlichkeit gesucht. Im folgenden Kapitel sollen die Opfer-Fälle und die Versuche zur Begrenzung der Eigentümerverantwortlichkeit am Beispiel der Altlasten7 8
Herrmann, DÖV 1987, 666, 670; VoUmuth, Die Bestimmung, S. 31 f.
7 9
Ausführliche Kritik s.u. Zweiter Teil, Zweites Kapitel, IV. 4.
42
Erster Teil: Einführung
Problematik dargestellt werden. Dabei wird sich zeigen, daß es zu kurz gegriffen ist, nach einer Begrenzung der Zustandsstörerverantwortlichkeit zu fragen. Schlüssel zur Lösung der Altlasten-Problematik im Polizeirecht ist vielmehr die Untersuchung des Rechtsgrundes der Zustandsstörerverantwortlichkeit. Diesem Thema ist der Zweite Teil der Arbeit gewidmet.
Zweites Kapitel
Darstellung der Opfer-Fälle und der Versuche einer Begrenzung der Zustandsstörerverantwortlichkeit I. Kriegstrümmer- und Öltransportunfall-Falle Das Problem der (unbegrenzten) Kostentragungspflicht des Eigentümers allein aus der Tatsache, daß er Störer war, wurde in der unmittelbaren Nachkriegszeit vor allem in Zusammenhang mit den Pflichten des Grundstückseigentümers bei der Beseitigung von Kriegstrümmern relevant: Der Eigentümer eines durch Bomben zerstörten Hauses war nach der Gesetzeslage als Zustandsstörer polizeipflichtig im Hinblick auf die von der Ruine ausgehenden Gefahren (insbesondere Gefährdung von Leib und Leben von Passanten durch herabfallende Mauerteile oder durch Einsturz des Gebäudes). Dieses Ergebnis wurde zwar von einzelnen Gerichten nicht hingenommen und kritisiert 1, die herrschende Meinung in der Rechtsprechung hielt jedoch an der grundsätzlichen Verantwortlichkeit des Eigentümers auch in diesen Fällen fest 2. Verschiedentlich wurde jedoch trotz grundsätzlicher Verantwortlichkeit des Eigentümers in der wirtschaftlichen Unmöglichkeit eine Grenze der Inanspruchnahme gesehen3. Dies wurde damit begründet, daß nicht durch einen Verwaltungsakt etwas Unmögliches gefordert werden dürfe. Dazu gehöre auch die wirtschaftliche Unmöglichkeit4. Neuerdings hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, daß für den ordnungsgemäßen Zustand eines Gebäudes der Eigentümer grundsätzlich ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verantwortlich ist5.
1
Z.B. VGH Freiburg, Urt. v. 16.09.1952, DVB1 1953,145 ff.
2
Z.B. OVG Münster, Urt. v. 31.01.1952, OVGE 5, 185 ff.; OVG Berlin, Urt. v. 04.03.1953, DÖV 1954, 214 ff.; OVG Lüneburg, Urt. v. 15.05.1952, JZ 1952, 437; BVerwG, Urt. v. 09.05.1960, E 10, 282. 3
BVerwG, Urt. v. 09.05.1960, E 10,282,283; OVG Koblenz, Beschl. v. 13.03.1953, DÖV 1954, 216, 217. 4 So OVG Koblenz, Beschl. v. 13.03.1953, DÖV 1954, 216, 217; kritisch dazu Ule/Rasch, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 13 zu § 5 MEPolG; s.a. Brandita·, Gefahrenerkennbarkeit, S. 43 ff. 5
BVerwG, Urt. v. 11.04.1989, NJW1989,2638, allerdings betreffend bauordnungsrechtliche Regelungen; das Bauordnungsrecht ist jedoch ebenfalls Ordnungsrecht.
44
Erster Teil: Einführung
Dem ist zuzustimmen, da die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ja nicht das Bestehen der Zustandsstörerverantwortlichkeit betrifft, sondern lediglich die Möglichkeit der Ausführung der daraus resultierenden Pflichten beeinflussen kann. In den sechziger und siebziger Jahren spielte das Problem der Kostentragungspflicht des Eigentümers, der selbst Opfer eines Handlungsstörers geworden war, bei Unfällen von Tanklastzügen eine Rolle, bei denen Öl ausgelaufen war. Hier war der Eigentümer des Grundstücks, auf dem das Öl versickert war, polizeipflichtig im Hinblick auf die von dem Erdreich ausgehende Gefährdung des Grundwassers6. Die unbegrenzte Verantwortlichkeit des Grundstückseigentümers, der selbst Opfer des Handlungsstörers geworden war, wurde in der Literatur vielfach als unbillig empfunden7. Gerade für die Kriegsruinenfälle wurde jedoch auch hervorgehoben, daß das Polizeirecht zwingendes öffentliches Recht ist. Der Vermeidung unbilliger Härten würden andere Regelungen, wie etwa die des Kriegslastenausgleichs, dienen8.
IL Die Altlasten-Problematik i. Darstellung der Problematik Altlasten sind gefährliche Stoffanreicherungen im Boden, die Folge früherer Produktion und Ablagerung auf einem Gelände sind und nun das Grundwasser oder die Gesundheit der auf dem Grundstück lebenden Menschen gefährden 9. Von Altlasten spricht man, weil sie meist vor 1960 bzw. 1972 entstanden und damit die ansonsten einschlägigen Gesetze, das
6 OVG Münster, Urt. v. 03.10.1963, JZ1964,367,368; zu den Tanklastzug-Unfällen siehe auch die Sachverhalte in BVerwG, Urt. v. 16.11.1973, DVB1 1974, 297, 298 ff.; BGH, Urt. v. 27.04.1970, DVB1 1970, 499; OVG Münster, Urt. v. 22.01.1969, DVB1 1969, 594. 7 Zu den Kriegstrümmer- und Öltransportunfall-Fällen siehe z.B. Baur, JZ 1964, 354 ff.; Krampol, Festschrift für Rudolf Samper, S. 153 ff.; Kimmel, Eigentum und Polizei, S. 173; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 212; Friauf in: von Münch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, S. 237; Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 97; Ule/Rasch, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 13 und 15 zu § 5 MEPolG; Scholler/Broß, Grundzüge des Polizei- und Ordnungsrechts, S. 211. 8 9
Klaudat, Polizeipflicht, S. 9.
Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 212a; zu den Definitionen siehe auch Koch in: Brandt (Hrsg.), Altlasten S. 11 ff.; Staupe, DVB11988,606,607; Papier, NWVB1 1989, 322 f. mwN.; Paetow, NVwZ 1990, 510,511 mwN. zu den neuerdings in Länderabfallgesetze aufgenommenen Definitionen.
2. Kapitel: Die Altlasten-Problematik
45
Wasserhaushaltsgesetz von 1960 (WHG) oder das Abfallgesetz von 1972 (AbfG), nicht anwendbar sind10. Soweit (noch) keine spezialgesetzliche Regelung existiert11, sind diese Fälle nach allgemeinem Sicherheits- und Polizeirecht zu beurteilen12. So wird im Zusammenhang mit der Altlasten-Problematik von einer "Bewährungsprobe der polizeilichen Gefahrenabwehr" 13 sowie von einer "Renaissance des allgemeinen Ordnungsrechts"14 gesprochen. Einschlägige Befugnisnorm für das Tätigwerden von Polizei- und Ordnungsbehörden ist, da keine Standardmaßnahme eingreift, die polizeiliche Generalklausel15. Adressat der Maßnahme ist der Verursacher (als Handlungsstörer) oder der Inhaber der tatsächlichen oder rechtlichen Sachherrschaft (als Zustandsstörer). Da es sich bei der Kontamination des Erdreichs um die Folgen oft lange zurückliegender Produktion oder Ablagerung handelt, ist der Handlungsstörer in den Altlasten-Fällen meist nicht mehr zu ermitteln oder kann - z.B. nach Konkurs - nicht mehr in Anspruch genommen werden. Da somit oft nur auf den derzeitigen Grundstückseigentümer als Zustandsstörer zurückgegriffen werden kann, die Beseitigung oder Reinigung kontaminierten Erdreichs jedoch mit erheblichen Kosten verbunden ist 16 , ist mit der Altlasten-Problematik auch wieder die störerrechtliche Opferproblematik allgemein aktuell geworden. Typische Fallgestaltungen sind hierbei der Industriebetrieb, in dem vor Jahrzehnten - meist mit Genehmigung oder Duldung der Behörden Stoffe produziert wurden, deren Gefährlichkeit damals noch nicht bekannt war und dessen Betriebsgelände an ein anderes Unternehmen mit anderer Nutzung verkauft wurde, sowie das ehemalige Industriegelände oder die
10 Zu diesem Problem siehe BayVGH, Beschl. v. 13.05.1986, BayVBl 1986, 590, 591; Kloepfer, Umweltrecht, § 12, Rdnr. 132 f.; Hoppe/Beckmann, Umweltrecht, § 15, Rdnr. 43 ff.; Papier, Jura 1989, 505 f.; Knopp, BB 1990, 875, 879; Dombert, Altlastensanierung, S. 33; für eine Anwendbarkeit der Abfallgesetze auch auf vor 1971 entstandene Altlasten neuerdings Paetow, NVwZ 1990, 510, 512 ff., kritisch dazu Knopp, NVwZ 1991, 42, 44. 11
Einen Überblick über die rechtspolitischen Lösungsmodelle gibt Papier, Jura 1989,505, 511 ff.; s.a. Kloepfer, Umweltrecht, § 12, Rdnr. 151 f. 12
VGHBW, Beschl. v. 14.12.89, BB 1990, 237; Knopp, BB 1990, 875, 879.
13
Breuer t JuS 1986, 359.
14 Fehn, VR 1987, 267; siehe dazu auch Breuer, Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, S. 317 f.; Staupe, DVBl 1988, 606, 610. 15 16
Kloepfer,
Umweltrecht, § 12, Rdnr. 137
Zu den Sanierungsverfahren siehe SRU, Sondergutachten Altlasten, Tz. 446 ff. sowie Domberty Altlastensanierung, S. 46 ff.; zu den Kosten ausführlich SRU, Sondergutachten Altlasten, Tz. 651 ff.
46
Erster Teil: Einführung
ehemalige Deponie, die parzelliert, verkauft und mit Wohnhäusern bebaut wurde1 . Die Altlasten-Problematik wirft neben ökologischen und sanierungstechnischen auch eine Vielzahl juristischer Fragen auf. Die zu diesem Thema in den letzten Jahren erschienene Literatur ist inzwischen fast unübersehbar geworden18. Auf die im Zusammenhang mit Altlasten behandelten juristischen Probleme des Gefahrenerforschungseingriffs und der Legalisierungswirkung von Genehmigungen sowie auf die bauplanungsrechtlichen Probleme und die damit verbundenen Fragen des Kommunalrechts braucht angesichts des Gegenstands der Arbeit nicht eingegangen zu werden. Die Altlasten-Problematik bietet jedoch auch Gelegenheit, sich mit der Zustandsstörereigenschaft und den Pflichten des Zustandsstörers zu befassen. Nach dem Wortlaut der Polizei- und Ordnungsgesetze ist der Eigentümer des kontaminierten Grundstücks Zustandsstörer: Die Giftstoffe im Erdreich drohen ins Grundwasser zu gelangen oder die Gesundheit der auf dem Grundstück wohnenden Menschen zu beeinträchtigen. Von dem Grundstück geht somit eine konkrete Gefahr aus19. Der polizeiliche Aufgabenbereich ist eröffnet, die Behörde kann gegen die Störer eine Maßnahme auf der Grundlage der Generalklausel ergreifen. Der Verursacher der Gefahr ist nicht zu ermitteln oder kann nicht herangezogen werden. Der Eigentümer des Geländes kann damit nach dem Wortlaut der Polizei- und Ordnungsgesetze zur Gefahrenabwehr in Anspruch genommen werden. Da es sich bei der Altlastensanierung um komplizierte und aufwendige Verfahren handelt (möglich ist z.B. das Abtragen und Ausglühen des kontaminierten Erdreichs), ist meist die Heranziehung eines Spezialunternehmens notwendig. Letztlich geht es also bei der Altlasten-Problematik in der Praxis um die Frage, wer diese Unternehmen zu bezahlen hat.
17
Vergleiche z.B. den dem Beschluß des BayVGH vom 13.05.1986 (BayVBl 1986, 590) zugrundeliegenden Sachverhalt; siehe auch den Fall, den der BGH in seinem Urteil vom 26.01.1989 (DVB1 1989, 504) zu entscheiden hatte: dort war ein ehemaliges Deponiegrundstück durch Bebauungsplan als Wohngrundstück ausgewiesen, parzelliert und mit Häusern bebaut worden. Auf das dort relevante Problem einer Amtspflichtverletzung bei Aufstellen des Bebauungsplans kann hier nicht eingegangen werden. Siehe z.B. die Nachweise bei Herrmann, Flächensanierung, S. 210 ff. 19
OVG Münster, Urt. v. 24.02.1989, NVwZ 1989, 987, 988; BayVGH, Beschl. v. 13.05.1986, BayVBl 1986, 590, 591; VGHBW, Beschl. v. 14.12.1989, BB 1990, 237.
2. Kapitel: Die Altlasten-Problematik
47
Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung der Kostentragung nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme werden vom Betroffenen "Kosten (Gebühren und Auslagen)" erhoben (z.B. Art. 9 Abs. 2 und Art. 34 Abs. 1 Satz 2 BayPAG). Nach der Ansicht, daß die Kostentragungspflicht lediglich Surrogat der Beseitigungspflicht bzw. Annex der Polizeipflichtigkeit ist 20 , wäre der beseitigungspflichtige Grundstückseigentümer auch kostentragungspflichtig. Angesichts der hohen finanziellen Belastungen, die eine Sanierung verursacht, wird das Ergebnis einer unbegrenzten Kostentragungspflicht des Grundstückseigentümers als unbillig empfunden. Das allgemeine Sicherheits- und Polizeirecht wird als untauglich oder nur bedingt geeignet21 zur Lösung der Altlastenproblematik bezeichnet und als "für die anstehenden Fragestellungen an sich schon überkommen" angesehen22.
2. Darstellung der Lösungsvorschläge a) Das Problem einer "billigen" Lösung Die zur polizeirechtlichen Kostentragungspflicht des Eigentümers eines Altlasten-Grundstücks vertretenen Meinungen sind vielfältig. Da sie meist am Ergebnis orientiert sind und die verschiedensten Argumente miteinander kombiniert werden, sind sie schwer in ein System zu bringen. Zusätzlich erschwert wird die Analyse dadurch, daß unterschiedliche Begriffe für gleiche Sachverhalte und identische Termini für verschiedene Sachverhalte verwendet sowie neue Begriffe eingeführt werden, die eher zur Verwirrung denn zur Klärung der Probleme beitragen. Um der Klarheit der Darstellung willen soll auf die unterschiedliche Terminologie nur eingegangen werden, soweit dies notwendig erscheint. Allen Ansätzen gemeinsam ist der Versuch, die als unbillig empfundene Last der Kosten für die Beseitigungsmaßnahmen nicht dem Grundstückseigentümer aufzubürden, der ja selbst Opfer eines unbekannten oder nicht greifbaren Handlungsstörers geworden ist. Seine Heranziehung wird als "fragwürdig" bezeichnet23.
2 0
S.o. Erstes Kapitel V. 2.
21
Arndt in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 227; Fleischer, JuS 1988, 530; Knopp, BB 1990, 575, 576; s.a. Staupe, DVB11988, 606, 612. 2 2
Knopp, BB 1990, 575, 576.
2 3
Arndt in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 230.
48
Erster Teil: Einführung
Der Baden-Württembergische Verwaltungsgerichtshof stellte in einer Entscheidung vom Dezember 1989 ausdrücklich fest, daß von einer Inanspruchnahme der Grundstückseigentümerin zu Recht abgesehen wurde: Da sie selbst Opfer des Handlungsstörers geworden sei, sei es unbillig, sie darüber hinaus als Zustandsstörer mit den Kosten der Gefahrenabwehr zu belasten24. Allerdings war in dem entschiedenen Fall der Handlungsstörer greifbar. Letzlich geht es in vielen Vorschlägen zur Lösung der Opfer-Fälle nicht um die Verantwortlichkeit als solche, sondern um die Befreiung des Eigentümers vom Kostenrisiko25. In dem diffusen Bild der Meinungen lassen sich Grundlinien erkennen, wenn man eine Einteilung nach einer Lösung auf der Tatbestandsseite (der Eigentümer als Störer oder Nichtstörer) und auf der Rechtsfolgenseite (Handlungspflichten, Duldungspflichten, Entschädigung) vornimmt und bei der Begründung auf die Kriterien Übermaßverbot, Risikosphären sowie Störung der Privatnützigkeit abstellt.
b) Der Eigentümer als Nichtstörer Eine Meinung setzt bei der Zustandsstörereigenschaft an und erklärt den Grundstückseigentümer in bestimmten Fällen zum Nichtstörer. Entgegen dem Wortlaut der Gesetze ist nach dieser Meinung nicht jeder Eigentümer Zustandsstörer26. Eine Erklärung zum Nichtstörer hätte nicht nur zur Folge, daß der Eigentümer nicht kostentragungspflichtig wäre, sondern darüber hinaus auch noch einen Schadensausgleichsanspruch gem. Art. 49 BayPAG hätte. Außerdem könnte er nur unter den engen Voraussetzungen des polizeilichen Notstands herangezogen werden27.
2 4
VGHBW, Beschl. v. 14.12.1989, BB 1990, 237, 238, unter ausdrücklicher Bezugnahme auf Friauf und Papier. rews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 319; auf den Problemkreis der
86
Zweiter Teil: Zustandsstörerverantwortlichkeit - Rechtsgrund und Umfang
Bekanntestes Beispiel einer spezialgesetzlichen Vorsorgepflicht ist § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG, wonach Anlagen so zu errichten und zu betreiben sind, daß Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen getroffen wird. Während die Schutzpflicht des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG, wonach Genehmigungsvoraussetzung ist, daß Gefahren nicht hervorgerufen werden, in der Tradition gewerberechtlicher Gefahrenabwehr steht, statuiert die Pflicht der Nummer 2 eine von der Gefahrenabwehr streng zu trennende Vorsorgepflicht 49. Die Tatsache, daß nach Polizeirecht eine Verpflichtung zum Tätigwerden erst ab Vorliegen einer konkreten Gefahr besteht, ist natürliches Korrektiv der Weite der Generalklausel: Die Weite der polizeilichen Generalklausel, die notwendig ist, um eine effektive Abwehr konkreter Gefahren zu gewährleisten, verbietet es zugleich, die Generalklausel zur Rechtsgrundlage für alle möglichen Gefahrenvermeidungs- und Vorsorgepflichten zu machen. Mit anderen Worten: Das scharfe Schwert der polizeilichen Generalklausel mit seinem geringen Schutz vor Inanspruchnahme kann nicht für alle möglichen Situationen herangezogen werden, sondern ist nur in den Fällen anwendbar, in denen eine konkrete Gefahr tatsächlich vorliegt. Nicht alles, was ordnungsrechtlich wünschenswert ist, kann auf der Grundlage der polizeilichen Generalklausel durchgesetzt werden.
c) Die materielle Polizeipflicht als "Untertanenwohlverhaltenspflicht" Das dritte Argument betrachtet die materielle Polizeipflicht unter verfassungsgeschichtlichen Aspekten und weist auf die Konsequenzen der Entwicklung des Rechtsstaatsgedankens für den Polizeibegriff hin. Eine Pflicht, "den Zustand seiner Sachen so einzurichten, daß keine Gefahren entstehen11, würde den Grundprinzipien des freiheitlichen Rechtsstaats widersprechen: Es wäre dies eine Untertanenwohlverhaltenspflicht, die einen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit bedeuten würde und dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgebot widerspräche. Der Anachronismus einer solchen Auffassung der materiellen Polizeipflicht, die dem Denken des 19. Jahrhunderts entspricht, kommt in einem
Gefahrenabwehr durch Private, die nicht Störer sind, kann hier nicht näher eingegangen werden. 4 9 Vgl. dazu Rid/Hammann, UPR 1990, 281, 282, 286; Kloepfer, Umweltrecht, §7, Rdnr. 49 ff.; Hoppe/Beckmann, Umweltrecht, §25, Rdnr. 36; SRU, Sondergutachten Altlasten, Tz. 835.
2. Kapitel: Die materielle Polizeipflicht
87
Aufsatz von Scholz-Forni von 1925 zum Ausdruck, wo ausgeführt wird, die Norm des § 10 II 17 A L R 5 0 enthalte zugleich den stillschweigenden Befehl an die Untertanen, sich solcher Handlungen zu enthalten, die eine Gefahr verursachen51. Die Staatsbürger seien daher verpflichtet, alles zu unterlassen, wodurch eine Gefahr im Sinn des Polizeirechts hervorgerufen wird. Nur mit dieser Einschränkung seien die Freiheit des Handelns und die Eigentumsausübung rechtlich anerkannt52. Scholz-Forni sieht selbst, daß dies je nach Sachlage und den hinzutretenden Umständen mit sich bringen kann, daß dieselbe Handlung erlaubt oder nicht erlaubt sein kann, hält dies jedoch für vertretbar und schlägt als Korrektiv das Kriterium der Vorhersehbarkeit der Gefahr vor 53 . Abgesehen davon, daß die Vorhersehbarkeit gerade nicht maßgeblich für die Störereigenschaft ist (dazu anschließend 2. d)), ist diese Meinung auch vom heutigen Verfassungsverständnis her abzulehnen: In einem freiheitlichen Rechtsstaat kann es keine unbestimmte Wohlverhaltenspflicht des "Untertanen" und keine allgemeine Unterlassenspflicht als Pflicht, eine Gefahr nicht herbeizuführen, geben. Aus einem allgemeinen Gebot zur Gefahrenvermeidung läßt sich nicht entnehmen, was geboten und verboten ist 54 . Außerdem ist, da jedes Handeln und Unterlassen eine Gefahr hervorrufen kann55, eine allgemeine Rechtspflicht zum Unterlassen von gefahrenträchtigen Handlungen undenkbar.
d) Gefahrenvermeidungspflicht und Vorhersehbarkeit Die Polizeipflicht ist unabhängig von der Vorhersehbarkeit einer Gefahr 56. Die Annahme einer Pficht, sein Verhalten und den Zustand seiner Sachen so einzurichten, daß keine Gefahren entstehen, würde jedoch das Kriterium der Vorhersehbarkeit wieder in die Überlegungen zum Störerbegriff einführen 57. Eine Pflicht, seine Sachen in gefahrenfreiem Zustand zu
5 0
S.o. Erster Teil, Erstes Kapitel, 1.1.
5 1
Scholz-Forni, VwArch Bd. 30 (1925), 11 ff., 37.
5 2
Ebendort, S. 38.
5 3
Ebendort, S. 39 f.
5 4
S.a. Beye, Dogmatik, S. 91; vgl. auch Peine, DVBl 1980, 941, 948.
5 5
S.a. Klaudat, Polizeipflicht, S. 21.
5 6 S.o. Erster Teil, Erstes Kapitel, II. 3., 4.; s.a. das Beispiel bei Czeczatka, Erlaß und Inhalt polizeilicher Hoheitsakte, S. 57. 5 7
S.a. Koch, Bodensanierung, S. 19; Kloepfer, barkeit, S. 65.
NuR 1987,7,10; Brandner, Gefahrenerkenn-
88
Zweiter Teil: Zustandsstörerverantwortlichkeit
Rechtsgrund und Umfang
erhalten, erfordert nämlich, mögliche Gefahren zu erkennen und zu verhindern. Gefahren, die nicht vorhersehbar oder nicht zu verhindern sind, wie z.B. Naturkatastrophen, würden dann die Polizeipflicht nicht auslösen58. Der Eigentümer ist jedoch auch dann, wenn die Gefahr durch unvorhergesehene Ereignisse und durch höhere Gewalt entstanden ist, polizeipflichtig 59. e) Gefahrenvermeidungspflicht und der Unterschied zwischen Handlungsstörer und Zustandsstörer Die Annahme einer Pflicht, den Zustand seiner Sachen so einzurichten, daß keine Gefahren entstehen, würde die Zustandsverantwortlichkeit auch überflüssig machen: Der Zustandsstörer wäre zugleich Handlungsstörer, denn zum Handlungsstörer kann man auch durch Unterlassen werden, wenn eine Rechtspflicht zum Handeln besteht60. Die Pflicht, den Zustand seiner Sachen so einzurichten, daß daraus keine Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung entstehen, wäre eine solche Rechtspflicht zum Handeln, die den Zustandsstörer zugleich zum Handlungsstörer machen würde 61. Schenke spricht dieses Problem an und versucht es dadurch zu lösen, daß er die Pflicht des Zustandsstörers, die er aus Art. 14 Abs. 2 GG herleitet, nicht als Pflicht im Sinn der Pflichten des Handlungsstörers sieht62. 3. Die materielle Polizeipflicht
als Gefahrenabwehrpflicht
a) Gefahrenabwehrpflicht statt Gefahrenvermeidungspflicht Aus alledem ergibt sich, daß die materielle Polizeipflicht keine Gefahrenvermeidungspflicht sein kann. Das Störerrecht bezeichnet nur den Adressa-
5 8 So aber Scholz-Form, VwArch Bd. 30 (1925) 11 ff., 40 f., der - von seiner Auffassung einer Unterlassungspflicht her durchaus konsequent — der Vorhersehbarkeit Bedeutung beimißt: "Wenn man verpflichtet sein soll, zur Verhütung eines polizeiwidrigen Zustands eine an sich sonst erlaubte Handlung zu unterlassen, muß man vorhersehen können, daß die Handlung unter den gegebenen Umständen den polizeiwidrigen Zustand herbeiführen würde." (S. 40); für die Berücksichtigung der Vorhersehbarkeit auch Bcye, Dogmatik, S. 49, und Herrmann , DÖV 1984, 666, 674, der zwar nicht auf subjektive Erkennbarkeit abstellt, jedoch objektive Erkennbarkeit als Maßstab fordert. 5 9
Vgl. Nr. 8.5 VollzBek. zu Art. 8 BayPAG
6 0
Berner/Köhler, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 2 zu Art. 7 BayPAG; Samper/Honnacker, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 4 zu Art. 7 BayPAG. 6 1 Dies wird von Beye, Dogmatik, S. 50, vertreten, der in der Gewalthaberhaftung einen aus Art. 14 Abs. 2 GG legitimierten Sonderfall der Haftung durch Unterlassen sieht. 6 2
Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 87.
2. Kapitel: Die materielle Polizeipflicht
89
ten eines Polizeiverwaltungsakts. Voraussetzung dieses Polizeiverwaltungsakts ist das Vorliegen einer konkreten Gefahr. Ziel des Polizeiverwaltungskts ist die möglichst schnelle und effektive Beseitigung der Gefahrenlage. Die materielle Polizeipflicht muß sich daher ebenfalls an einer bestehenden Gefahr orientieren. Dies läßt nur einen Schluß zu: Nach der Ausgliederung der Wohlfahrtspflege aus dem Aufgabenbereich der Polizei und ihrer Beschränkung auf die Gefahrenabwehr kann die materielle Polizeipflicht nur als Gestaltungspflicht bei Vorhandensein einer Gefahrenlage verstanden werden.
Die materielle Polizeipflicht ist somit eine Pflicht zur Mitwirkung bei der Gefahrenabwehr. Sie realisiert sich beim Störer meist als Beseitigungspflicht y die beim Eigentümer in dem Augenblick auftritt, in dem eine Gefahr vom Zustand seiner Sachen ausgeht . Sie besteht schon vor Erlaß des Polizeiverwaltungsakts, nicht jedoch vor Eintritt der Gefahr. Die materielle Polizeipflicht muß unter der Geltung des Grundgesetzes als die jeden Rechtsgenossen treffende Verpflichtung sein Verhalten und den Zustan Sachen nach Auftreten einer Gefahr gefahrenfrei einzurichten verstan werden. b) Materielle Polizeipflicht und Interessenabwägung Eine solche Betrachtung entspricht auch den Interessen der Gemeinschaft und der Beteiligten: Die staatliche Gemeinschaft hat ein Interesse an gefahrenfreiem Zusammenleben. Dies beinhaltet auch ein Interesse daran, daß eine Gefahr
6Λ Für die materielle Polizeipflicht als Beseitigungspflicht auch Czeczatka, Erlaß und Inhalt polizeilicher Hoheitsakte, S. 55 ff. mit Nachweisen einschlägiger Urteile des PrOVG; kritisch zu Czeczatkas Herleitung Höhle, Störungsverbot, S. 59 ff., der eine materielle Polizeipflicht ganz ablehnt: der Störer habe nur kein Abwehrrecht gegen eine Inanspruchnahme, nicht aber eine eigenständige Pflicht (S. 178 f.); s.a. Vollmuth, Die Bestimmung, S. 44, der unter der Polizeipflicht die Pflicht des Verantwortlichen versteht, auf seine Kosten alles Erforderliche zur Beseitigung der Gefahr oder Störung zu tun; Peine, DVB1 1980, 941, 948 versteht unter der materiellen Polizeipflicht die aus den Polizeigesetzen folgende Pflicht, Störungen zu beseitigen, ohne daß es eines diese Pflicht begründenden Verwaltungsakts bedarf (modifiziert — allerdings ohne Begründung — in DVB1 1990, 733, 736: die materielle Polizeipflicht bedinge eine Störungsbeseitigungs- bzw -Verhinderungspflicht). Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht III, S. 63, rechnen zur Polizeipflicht ausdrücklich nicht nur die "Pflichtigkeit zur Vermeidung von Gefahrenlagen", sondern auch eine Pflichtigkeit zur Beseitigung eingetretener Störungen; aus der neueren Rechtsprechung OVG Münster, Urt. v. 24.02.1989, NVwZ 1989, 987 (Beseitigungspflicht als öffentlich-rechtliche Pflicht); da die Duldung fremder Beseitigung ebenfalls zum gewünschten Erfolg der Gefahrenabwehr beitragen kann, ist der weitere Begriff der "Gefahrenabwehrpflicht" passender als der enge Begriff einer "Beseitigungspflicht".
90
Zweiter Teil: Zustandsstörerverantwortlichkeit - Rechtsgrund und Umfang
gar nicht erst auftritt. Andererseits besteht ein Interesse an einem florierenden Gemeinschaftsleben. Die Auferlegung einer allgemeinen, unbestimmten Gefahrenvermeidungspflicht würde die Innovationsfreude lähmen sowie den Fortschritt hemmen und so das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben zum Erliegen bringen64. Sie wäre auch nicht praktikabel, da jedes Tun und Unterlassen eine Gefahr herbeiführen kann65. Den widerstreitenden Interessen an Gefahrenfreiheit einerseits und erforderlicher Risikobereitschaft und Handlungsfreiheit andererseits ist dann Rechnung getragen, wenn im Augenblick des Eintritts einer Gefahr derjenige, der - als Verursacher oder Inhaber der tatsächlichen oder rechtlichen Sachherrschaft - den mutmaßlich effektivsten Beitrag zur Beseitigung der Gefahrenlage leisten kann, zur Gefahrenabwehr verpflichtet ist und durch Polizeiverwaltungsakt ohne weiteres dazu verpflichtet werden kann. Die Abwehr der Gefahr durch die Polizei oder einen von ihr Beauftragten im Wege der unmittelbaren Ausführung (Art. 9 BayPAG, § 5a MEPolG) ist erst nach dem mißglückten Versuch der Inanspruchnahme des Störers zulässig. Dies entspricht den Interessen der Gemeinschaft nicht deshalb, weil sie damit von den Kosten der Gefahrenbeseitigung freigestellt wird, sondern weil zu vermuten ist, daß der Störer die Gefahr besser als die Polizei abwehren kann. Diese Nachrangigkeit der unmittelbaren Ausführung entspricht aber auch den Interessen des Störers, da er frei entscheiden kann, wie er die Gefahr am besten abwehrt, bzw. eine Störung am effektivsten beseitigt und somit das ihm günstigste Mittel der Gefahrenbeseitigung wählen kann. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Der Eigentümer eines Ruinengrundstücks, auf dem Passanten und spielende Kinder durch herabstürzende Mauerteile gefährdet sind, kann, nachdem er durch die Polizei als Zustandsstörer in Anspruch genommen und zur Beseitigung der Gefahr verpflichtet wurde, die Ruine abreißen lassen, brüchige Mauerteile sichern oder das Grundstück gegen unbefugtes Betreten absperren. Erst wenn derjenige, der als Verursacher bzw. als Inhaber der Sachherrschaft die Gefahr nicht abstellen kann und auch die Polizei den gewünschten Erfolg nicht herbeiführen kann, darf ein unbeteiligter Dritter, den mit der Gefahrenlage nichts verbindet als die aktuelle, nur im Zeitpunkt des Erlasses des Polizeiverwaltungsakts bestehende Nähe zur Gefahr, unter
6 4 Vgl. schon O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, S. 218, der jedoch noch von einer Nichtstörungspflicht als Untertanenpflicht ausging. 6 5
S.a. Klauäat, Polizeipflicht, S. 21.
2. Kapitel: Die materielle Polizeipflicht
91
bestimmten, engen Voraussetzungen zur Gefahrenbeseitigung herangezogen werden. Seine Inanspruchnahme ist subsidiär zur Gefahrenbeseitigung durch die Polizei oder einen von ihr Beauftragten. Der Vorrang der unmittelbaren Ausführung ist dabei Ausdruck der Tatsache, daß Gefahrenbeseitigung primär eine Staatsaufgabe ist. Das Interesse der Gemeinschaft an Gefahrenfreiheit überwiegt jedoch in den Fällen des polizeilichen Notstands das Interesse des "unbeteiligten" Bürgers, der nicht ein für die Gefahrenbeseitigung "Verantwortlicher", sondern lediglich "Inhaber des Gegenmittels"66 i s r \
c) Der Unterschied zwischen Störer und Nichtstörer Es ist jedoch noch zu klären, worin bei der Annahme der materiellen Polizeipflicht als einer Gefahrenabwehrpflicht der Unterschied zwischen Störer und Nichtstörer besteht. Herkömmlicherweise wird auf die Entschädigungsmöglichkeit als Hauptunterschied abgestellt und z.T. behauptet, die reine Störerqualifikation sei rechtlich neutral 68. Der entscheidende Unterschied zwischen Störer und Nichtstörer liegt jedoch nicht in der Möglichkeit der Entschädigung, die ja Folge der Inanspruchnahme des Nichtstörers ist (Art. 49 BayPAG, § 45 Abs. 1 MEPolG), sondern in den Voraussetzungen der Inanspruchnahme. Der Nichtstörer kann verlangen, daß die Gefahr durch einen Störer, der dazu in der Lage ist, beseitigt wird, und - vor allem - daß die Polizei ihrer ureigenen Aufgabe der Gefahrenabwehr nachkommt und die Gefahr beseitigt. Außerdem kann er auf bestimmte Härten (eigene Gefährdung, Verletzung höherwertiger Pflichten) verweisen. Der Grund für diese unterschiedliche Inanspruchnahme liegt in der materiellen Polizeipflicht. Im Gegensatz zu den nach Art. 7 oder Art. 8 BayPAG Verantwortlichen, die schon sofort nach Eintritt der Gefahr und noch vor Erlaß des Polizeiverwaltungsakts auf Grund der materiellen
6 6
Jellinek, Verwaltungsrecht, S. 445; s.a. Wacke, DÖV 1960, 93, 97.
f17
Die Subsidiarität der Inanspruchnahme des Nichtstörers bedeutet jedoch nicht, daß der Störer immer vor dem Nichtstörer herangezogen werden muß. Wenn der Schaden, der durch Maßnahmen gegen den Störer entsteht, außer Verhältnis zum Erfolg steht, darf der Nichtstörer vor dem Störer in Anspruch genommen werden: Die Veranstalter einer rechtmäßigen Versammlung sind Nichtstörer, gewalttätige Gegendemonstranten sind Störer; gleichwohl kann eine Auflösung der Versammlung zulässig sein (dazu m.w.N. DrewslWackelVogellMartens, Gefahrenabwehr, S. 334). Auch dies entspricht dem Interesse der Gemeinschaft an Gefahrenfreiheit. ^ So z.B. Kränz, Zustandsstörerverantwortlichkeit, S. 151.
92
Zweiter Teil: Zustandsstörerverantwortlichkeit
Rechtsgrund und Umfang
Polizeipflicht für die Beseitigung der Gefahr verantwortlich sind, muß der nicht nach Art. 7 oder Art. 8 BayPAG Verantwortliche, der sog. Nichtstörer, erst durch Polizeiverwaltungsakt zur Beseitigung verpflichtet und damit für die Beseitigung "verantwortlich" gemacht werden . Vor Erlaß des Polizeiverwaltungsakts besteht für ihn, abgesehen von den Fällen des § 323 c StGB, keine Hilfspflicht als öffentlich-rechtliche Pflicht 70. Vom Störer unterscheidet sich der Nichtstörer dadurch, daß er zwar im konkreten Einzelfall "Inhaber des Gegenmittels" ist (dies ist gerade der Grund seiner Heranziehung zur Gefahrenbeseitigung), daß ihn jedoch mit dem Gefahrenherd nichts verbindet als die Tatsache, daß er zufällig einen Beitrag zur Gefahrenbeseitigung leisten kann. Im Gegensatz zu ihm ist beim Handlungs- und Zustandsstörer auf Grund ihrer nicht nur zufälligen und vorübergehenden Verbindung mit der Gefahrenlage 71 von vornherein eine typisierte Beseitigungsfähigkeit und Gefahrenabwehrpflicht gegeben. d) Der Lebenskreis als Anknüpfungspunkt der materiellen Polizeipflicht Die materielle Polizeipflicht knüpft an tatsächliche Lebensumstände an. Die Grundrechte des Störers spielen erst eine Rolle, wenn die Behörden zur Abwehr einer konkreten Gefahr einen Polizeiverwaltungsakt an den Störer richten. Die Grundrechte sind dann als Eingriffsabwehrrechte des Adressaten des Polizeiverwaltungsakts zu prüfen. Vor Erlaß eines Polizeiverwaltungsakts, also vor Aktualisierung und Konkretisierung der materiellen Polizeipflicht beim Adressaten des Polizeiverwaltungsakts, besieht die Pflicht zur Beseitigung der Gefahr als eigenständige öffentlich-rechtliche Pflicht bei allen Störern. Die materielle Polizeipflicht ist somit nicht die Pflicht, einen Rechtskreis nicht zu überschreiten und eine Gefahr nicht entstehen zu lassen, sondern die Pflicht, den Lebenskreis, in dem eine Gefahr entstanden ist, durch schnelle und effektive Beseitigung der Gefahr wieder gefahrenfrei zu gestalten.
6 9
S.a. Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 255: "Auch Nichtverantwortliche können also polizeipflichtig gemacht werden". 7 0 Bracher, Gefahrenabwehr durch Private, S. 45; zum Verhältnis von § 323 c StGB und Art. 10 BayPAG siehe Samper/Honnacker, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 17 zu Art. 10 BayPAG. 7 1 Fischer, Unterlassene Hilfeleistung, S. 140 f., sieht den Unterschied zwischen Störer und Nichtstörer darin, daß der Zustandsstörer im Gegensatz zum Nichtstörer die Sachherrschaft — eine mit einer gewissen Dauer und Festigkeit versehene Einwirkungsmöglichkeit — hat.
2. Kapitel: Die materielle Polizeipflicht
93
Dieser Lebenskreis ist auch von einer Risikosphäre zu unterscheiden. Die Theorie von Risikosphären weist zwar den richtigen Weg zur Störerbestimmung, da auch sie auf tatsächliche Gegebenheiten abstellt und den Grund der Störereigenschaft im Polizeirecht selbst sucht. Der Lebenskreis umfaßt jedoch alle Sachen, auf die eine rechtliche oder tatsächliche Einwirkungsmöglichkeit besteht. Die Risikosphäre dagegen orientiert sich nicht nur an den Kriterien Gefahr und Sachherrschaft, sondern zusätzlich an der Ursache und Vorhersehbarkeit der Gefahr. Ursache und Vorhersehbarkeit spielen jedoch bei der Zustandsstörerverantwortlichkeit im Interesse einer effektiven Gefahrenabwehr keine Rolle.
4. Die materielle Polizeipflicht
des Eigentümers
Für den Eigentümer bedeutet die Betrachtung der materiellen Polizeipflicht als Pflicht, seinen Lebenskreis gefahrenfrei zu gestalten, daß allein die Nähe zum Gefahrenherd, nicht jedoch grundrechtliche Aspekte ausschlaggebend für seine Störereigenschaft sind. Der Grund für die Inanspruchnahme des Eigentümers als Zustandsstörer liegt nicht darin, daß er eine Pflicht aus Art. 14 Abs. 2 GG verletzt oder die Grenzen und Schranken des Eigentumsgrundrechts überschritten hat, sondern darin, daß er ab Eintritt der Gefahr als Inhaber der rechtlichen Sachherrschaft die schon vor Erlaß des Polizeiverwaltungsakts bestehende eigenständige öffentlich-rechtliche Pflicht hat, durch Beseitigung der Gefahr für einen gefahrenfreien Zustand seines Lebenskreises zu sorgen. Diese Pflicht ergibt sich aus der Einwirkungsmöglichkeit und entspricht dem in der Generalklausel festgelegten Effektivitätspostulat. Insoweit ist auch der Meinung zuzustimmen, die aus der Generalklausel und der Vorschrift über die Zustandsverantwortlichkeit die Pflicht herleitet, "das Eigentum in einem nicht gefährdenden Zustand zu halten"72, wenn darunter keine gefahrenvermeidende Nichtstörungspflicht oder eine Gefahrenvorsorgepflicht, sondern eine Gestaltungspflicht nach Eintritt der Gefahr gesehen wird. Die Annahme, der Störer müsse gegen eine Pflicht verstoßen haben oder die Grenze eines Rechts überschritten haben73, arbeitet mit Kategorien,
7 2 7 3
Pietzcker, JuS 1986, 719, 721; ähnlich Schenke, GewArchiv 1976, 1, 2.
Schnur, DVBl 1961,1, 5 stellt gerade fest, daß eine bestimmte Rechtswidrigkeit gerade nicht Voraussetzung der materiellen Polizeipflicht ist, hält jedoch am Gedanken eines sanktionierbaren Verhaltens fest; siehe dazu Pietzcker, DVBl 1984,457,458; Vieth, Rechtsgrundlagen, S. 78 ff.; Ziehm, Störerverantwortlichkeit, S. 41, 54 f.; Hölzle, Störungsverbot, S. 157 ff.; zum
94
Zweiter Teil: Zustandsstörerverantwortlichkeit - Rechtsgrund und Umfang
die im Polizeirecht, das weder tat- noch täterbezogen ist und eben keine Sanktionen enthält, keinen Platz haben. Diese Ablehnung der Herleitung der Störereigenschaft aus einer Pflichtverletzung oder der Überschreitung von Grundrechten - im Fall des Zustandsstörers des Eigentumsgrundrechts - macht jedoch auch eine neue Einordnung der materiellen Polizeipflicht im Gefüge von Staatstheorie und Verfassungsrecht notwendig, da insoweit die Grundrechte nicht mehr Rechtsgrund, sondern nur noch Grenze der materiellen Polizeipflicht sein können. Im nächsten Abschnitt soll daher untersucht werden, ob die materielle Polizeipflicht nicht als verfassungsrechtliche Grundpflicht gesehen werden kann.
III. Staats- und verfassungsrechtliche Einordnung der materiellen Polizeipflicht 1. Die materielle Polizeipflicht
als Staatsbürgerpflicht
Als Hauptmerkmale der materiellen Polizeipflicht sind festzuhalten: Die materielle Polizeipflicht ist nur eine Gefahrenabwehrpflicht nach Eintritt der Gefahr. Diese Pflicht existiert jedoch schon vor Erlaß des Polizeiverwaltungsakts als allgemeine Pflicht mit dem Inhalt, für einen gefahrenfreien Zustand seines Lebenskreises zu sorgen. Der Polizeiverwaltungsakt konkretisiert und aktualisiert diese Pflicht: Er schreibt einen bestimmten Weg der Gefahrenbeseitigung vor. Dies ergibt sich aus der Funktion des Polizeirechts als Recht der schnellen und effektiven Gefahrenabwehr in Verbindung mit dem Bedürfnis der Optimierung gegenläufiger Interessen in einer rechtsstaatlich organisierten Gesellschaft: Die Gemeinschaft hat ein Interesse an der Gefahrenfreiheit des Gemeinschaftslebens. Gefahren sollten daher gar nicht erst entstehen und bereits aufgetretene müssen schnell und effektiv beseitigt werden. Dem Interesse der Gemeinschaft daran, daß Gefahren gar nicht erst entstehen, steht das Interesse des Einzelnen gegenüber, tun und lassen zu können, was er will, solange er keine Gefahr hervorruft, und das Interesse der Gemeinschaft daran, daß nicht durch übertriebene Vorsicht das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben gelähmt wird.
Verhältnis von Rechtswidrigkeit und Polizeiwidrigkeit siehe auch Klaudat, S. 20 ff.
Polizeipflicht,
2. Kapitel: Die materielle Polizeipflicht
95
Dem Interesse des unbeteiligten Dritten, nur in Notfällen herangezogen zu werden, wird durch die Bestimmung Rechnung getragen, daß er nur unter bestimmten engen Voraussetzungen als "Inhaber des Gegenmittels" zur Beseitigung der Gefahr verpflichtet werden kann. Die materielle Polizeipflicht ist somit das Ergebnis einer Abwägung zwischen den Interessen der Gemeinschaft, den Interessen des Handelnden bzw. des Inhabers der tatsächlichen oder rechtlichen Sachherrschaft und den Interessen unbeteiligter Dritter. Die Pflicht zur Gefahrenabwehr, die an tatsächliche Lebensumstände anknüpft und denjenigen trifft, der typischerweise am schnellsten und effektivsten die Gefahr beseitigen und zur Wiederherstellung eines gefahrenfreien Zustands beitragen kann, kann nur dann Wirkung entfalten, wenn sie für jeden Rechtsgenossen beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen uneingeschränkt gilt. Es ist eine Pflicht, die jeden Staatsbürger betrifft und deshalb auch alle Staatsbürger ohne Ausnahme treffen muß. Auch ihre Bedeutung für den Bestand des Gemeinwesens läßt eine solche Betrachtung zu: Gefahrenfreiheit schafft erst die tatsächlichen Voraussetzungen des Zusammenlebens und der staatlichen Ordnung. Die materielle Polizeipflicht als Gefahrenbeseitigungspflicht gehört zum Minimum an Verhaltensregeln, die unabdingbare Voraussetzung menschlichen Zusammenlebens sind74. Die materielle Polizeipflicht ist daher richtigerweise als eine allgemeine Staatsbürgerpflicht anzusehen, durch die jeder Bürger an der Gefahrenfreiheit mitwirkt und damit zum Erhalt des Gemeinwesens beiträgt75. Die Einordnung der materiellen Polizeipflicht als Staatsbürgerpflicht und ihre Bedeutung für das Gemeinwesen legt eine Überprüfung nahe, ob es sich bei der materiellen Polizeipflicht nicht um eine verfassungsrechtliche Grundpflicht handelt. Vorweg sei jedoch darauf hingewiesen, daß die Beantwortung dieser Frage von der noch in der Diskussion befindlichen Dogmatik verfassungsrechtlicher Grundpflichten abhängt. Da die Überlegungen im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht umfassend dargestellt und auch die offenen Probleme hier nicht gelöst werden können, müssen auch die Ausführungen über die materielle Polizeipflicht als Grundpflicht notwendigerweise Anregungen für die weitere Diskussion bleiben. Andererseits bietet auch und gerade das Beispiel einer nicht aus Grundrechten abgeleiteten Gefahrenabwehrpflicht Raum für Überlegungen zu Standort
7 4
Vgl. Peine, DVB11980, 941, 948.
7 5
Volhnuthy Die Bestimmung, S. 53 ff.
96
Zweiter Teil: Zustandsstörerverantwortlichkeit
Rechtsgrund und Umfang
und Funktion von gemeinwohlbezogenen allgemeinen Staatsbürgerpflichten.
2. Grundpflichten
als verfassungsrechtliche
Dimension
Die Existenz von Grundpflichten des Bürgers als verfassungsrechtliche Dimension neben den Grundrechten ist anerkannt, wobei Einzelheiten weiterhin ungeklärt sind. Auf alle Aspekte der Diskussion über Grundpflichten kann hier nicht eingegangen werden76. Es soll jedoch untersucht werden, ob die materielle Polizeipflicht als abstrakte Staatsbürgerpflicht in das Schema der Grundpflichten passen würde. Zur Überprüfung soll von der Definition von Luchterhand ausgegangen werden: "Unter dem Grundgesetz sind Grundpflichten im materiellen Sinn solche Pflichten, die entweder (sofern formell in der Verfassung verankert) einer Verfassungsänderung bzw. gesetzlichen Aufhebung entzogen sind oder, auch unabhängig davon, herausragende Bedeutung für das Gemeinwesen besitzen und die insbesondere aufgrund ihrer Höchstpersönlichkeit, Unentgeltlichkeit, Schwere, Dauer und der Wahrscheinlichkeit ihrer Aktualisierung Freiheit und Eigentum des Einzelnen regelmäßig in hohem Grade belasten."77 Im Vorfeld und im Rahmen der Staatsrechtslehrertagung 1982 wurden folgende Merkmale herausgearbeitet: Bei Grundpflichten handelt es sich um verfassungsrechtlich verankerte oder sich aus der Verfassung ergebende, nicht bloß sittlich-ethische Pflichten eines jeden Staatsbürgers gegenüber dem Staat78. Sie stellen verfassungsrechtlich geforderte Pflichtbeiträge zum Gemeinwohl dar 79 . Sie sind von einer den Grundrechten vergleichbaren Bedeutung, stellen jedoch nicht Korrelate von Grundrechten oder Grundrechtsschranken dar, sondern stehen auf einer eigenen Ebene neben den Grundrechten und gehen diesen im demokratischen Rechtsstaat bei
7 6
Siehe dazu die Vorträge von Götz und Hofinartn sowie die Diskussionsbeiträge auf der Staatsrechtslehrertagung 1982, W D S t R L 41 (1983), S. 1 ff., 42 ff., 87 ff., und neuerdings Luchterhand, Grundpflichten als Verfassungsproblem, S. 1 ff., jeweils m.w.N. 7 7
Luchterhand, Grundpflichten als Verfassungsproblem, S. 587.
7 8
Merten, BayVBl 1978,354,357; Stober, NVwZ 1982,473; s.a. Luchterhand, Grundpflichten als Verfassungsproblem, S. 49 ff. 7 9
Götz, W D S t R L 41 (1983), S. 38; ähnlich Bachof, W D S t R L 41 (1983), S. 126; zu den Kriterien der Unverzichtbarkeit und der erhöhten Bedeutung für das Gemeinwesen siehe Luchterhand, Grundpflichten als Verfassungsproblem, S. 580.
Kapitel: Die materielle Polizeipflicht
97
einer Kollision nach80. Anders als Grundrechte müssen Grundpflichten erst aktualisiert und konkretisiert werden81. Als Grundpflichten sind anerkannt: Gesetzesgehorsam82, Wehrpflicht 83 und Steuerpflicht 84. Es handelt sich um Pflichten, die das Bestehen des Staates sichern und die Erfüllung von Staatsaufgaben erst ermöglichen: Gesetzesgehorsam ist unerläßlich für das Bestehen der Rechtsordnung und gewährleistet Rechtssicherheit85, die Wehrpflicht dient der Verteidigung der Freiheit und sichert den Staat nach außen86 und die Steuerpflicht ist eine essentielle Bedingung für eine wirksame Aufgabenerfüllung des Staates und insbesondere für die Wahrung des Verfassungsauftrags der Sozialstaatlichkeit87. Die Steuerpflicht gilt als klassische Grundpflicht, obwohl sie im Grundgesetz nur mittelbar (Art. 105 ff. GG) berücksichtigt ist. Viele Grundpflichten stehen somit in einem Zusammenhang mit Staatsaufgaben, da Grundpflichten als Leistungspflichten zur Erhaltung des staatlichen Gemeinwesens, in dem der Einzelne lebt, beitragen88.
5. Die materielle Polizeipflicht
als Grundpflicht
Auch die materielle Polizeipflicht als Gefahrenbeseitigungspflicht ist eine gemeinwohlorientierte Leistungspflicht, die mit einer Staatsaufgabe
8 0
Götz, W D S t R L 41 (1983), S. 12 ff.; Merten, BayVBl 1978, 554, 557; Stober, NVwZ 1982, 473 f.; zum Meinungsstand auch mit Nachweisen zur Gegenmeinung siehe Luchterhand, Grundpflichten als Verfassungsproblem, S. 463 ff. 81 Isensee, W D S t R L 41 (1983), S. 131; Stober, NVwZ 1982, 473; Luchterhand, Grundpflichten als Verfassungsproblem, S. 586. 8 2
Götz, W D S t R L 41 (1983), S. 148; Isensee, DÖV 1982, 609, 612.
8 3
Götz, W D S t R L 41 (1983), S. 23 ff.; Isensee, DÖV 1982,609,617; Stober, NVwZ 1982, 473; Luchterhand, Grundpflichten als Verfassungsproblem, S. 520. 8 4
Götz, W D S t R L 41 (1983), S. 33 ff.; Isensee, DÖV 1982,609,617; Stober, NVwZ 1982, 473, 475; Luchterhand, Grundpflichten als Verfassungsproblem, S. 514. 8 5
Schuppert, W D S t R L 41 (1983), S. 107; Isensee, DÖV 1982, 609, 612.
8 6
Stober, NVwZ 1982, 473, 475.
8 7
Stober, NVwZ 1982,473,475; s.a. Luchterhand, Grundpflichten als Verfassungsproblem,
S. 516. 8 8
Schuppert, W D S t R L 41 (1983), S. 106 ff.; zustimmend Hofmann , ebenda, S. 144, und Götz, ebenda, S. 117 f., der jedoch nicht jeder Staatsaufgabe bestimmte Grundpflichten zuordnet; Kirchhof\ ebenda, S. 130, leitet den Geltungsgrund der Grundpflichten aus den verfassungsrechtlichen Aussagen über die Staatsaufgaben, die dort angelegten Staatsbefugnisse und die Staatszielbestimmungen ab; kritisch dazu Hailbronner, ebenda, S. 131. 7 Griesbeck
98
Zweiter Teil: Zustandsstörerverantwortlichkeit
Rechtsgrund und Umfang
korrespondiert und die auch in anderen Merkmalen den genannten Grundpflichten vergleichbar ist: Eine staatliche Ordnung ist ohne ein Minimum an Gefahrenfreiheit ebensowenig denkbar wie ohne Rechtsgehorsam. Die Wahrung der Sicherheit der Bürger gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Staates. Die Gefahrenabwehr ist unverzichtbare staatliche Aufgabe 89. Gefahrenfreiheit ist für den einzelnen Voraussetzung der Ausübung seiner Grundrechte, für den Staat Voraussetzung der Erbringung von Leistungen90. Die materielle Polizeipflicht als Pflicht zur Beseitigung von Gefahren, die in seinem Lebenskreis aufgetretenen sind, stellt einen Beitrag dar, den der einzelne Bürger zum Gemeinwohl zu leisten hat. Wie die Wehrpflicht, die auch nur unter bestimmten Voraussetzungen beim einzelnen Bürger konkretisiert und durch Behördenakt aktualisiert wird, bedarf auch die materielle Polizeipflicht beim Störer der Konkretisierung und Aktualisierung. Es handelt sich auch um eine höchstpersönliche Pflicht. Die Tatsache, daß die materielle Polizeipflicht nicht als Pflicht in der Verfassung genannt ist, hindert die Annahme einer Grundpflicht nicht, da die materielle Polizeipflicht der Staatsaufgabe Gefahrenabwehr korrespondiert, die im Grundgesetz (z.B. in Art. 74 Nr. 4 a, 19, 20, 22, 24 GG) ihren Niederschlag gefunden hat. Ahnlich wie die Steuerpflicht ergibt sich die materielle Polizeipflicht damit mittelbar aus der Verfassung. Die materielle Polizeipflicht wurde - allerdings in der hier abgelehnten Form einer "Nichtstörungspflicht" - auch schon als Grundpflicht angesehen 91 . Die Einordnung der materiellen Polizeipflicht als Grundpflicht würde dem Problem der Störerverantwortlichkeit eher entsprechen als die starre Herleitung aus Grundrechten und der Überschreitung von Grundrechtsschranken. Grundrechte spielen dann zwar als Grenze der materielle Polizeipflicht immer noch eine Rolle, haben jedoch nichts mit dem Rechtsgrund der Störerverantwortlichkeit zu tun. Das Problem, ob die materielle Polizeipflicht eine Grundpflicht darstellt, hängt letzlich von der noch immer ungeklärten Dogmatik der Grundpflichten ab. Auf der Staatsrechtslehrertagung blieben, wie auch von den Referenten zugestanden
8 9
Friauf in: von Münch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, S. 206 m.w.N.; Ossenbühl, DÖV 1976, 463; Schuppen, W D S t R L 41 (1983), S. 108. 9 0 91
Drews/Wacke/Vogel/Martens,
Gefahrenabwehr, 1 f.
Quarìtsch , DVB1 1959, 455, 458; siehe auch m.w.N. Luchterhand, Grundpflichten als Verfassungsproblem, S. 468 f.
2. Kapitel: Die materielle Polizeipflicht
99
wurde, viele Fragen offen 92. Es soll auch nicht verschwiegen werden, daß Götz damals die Auffassung vertrat, die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung sei amrichtigstenund zuverlässigsten bei der Schrankendogmatik aufgehoben 93.
IV. Mögliche Grenzen der materiellen Polizeipflicht des Zustandsstörers im Hinblick auf die Kostentragungspflicht insbesondere in den Altlasten-Fällen i. Einleitung und Problemabgrenzung Wie dargestellt, ist die Beseitigungspflicht des Zustandsstörers als Inhaber der tatsächlichen oder rechtlichen Sachherrschaft streng zu unterscheiden von den Rechten und Pflichten des Eigentümers der störenden Sache auf Grund des Eigentumsgrundrechts. Dieses kann in bestimmten Fällen, z.B. bei Vernichtung der störenden Sache, möglicherweise dem an den Zustandsstörer gerichteten Polizeiverwaltungsakt entgegenstehen. Darauf soll jedoch hier nicht näher eingegangen werden, da Gegenstand der Untersuchung allein die Frage ist, ob die materielle Polizeipflicht als solche und insbesondere im Hinblick auf die Kostentragungspflicht begrenzt wird. Solche möglichen Einschränkungen der materiellen Polizeipflicht sollen nun geprüft werden. Die Begrenzung der Kostentragungspflicht selbst wird dann im Dritten Teil der Arbeit behandelt.
2. Berücksichtigung einer Opferlage Es ist zu fragen, ob die materielle Polizeipflicht nicht entfallen kann, wenn - wie in den Altlastenfällen - der Eigentümer Opfer des Handlungsstörers wurde.
9 2 9 3
So z.B. Götz, W D S t R L 41 (1983), S. 149.
Götz, W D S t R L 41 (1983), S. 147; interessante Anregungen zur Diskussion über die verfassungsrechtliche Lokalisierung des Schutzgutes öffentliche Sicherheit und Ordnung und über sein Verhältnis zu den Grundrechten vermag auch das ausländische Recht, auf das hier nicht näher eingegangen werden kann, zu liefern. Zum Verfassungsrang des ordre public und zur Abwägung mit Grundrechten im französischen Recht siehe z.B. Arnold, JöR Bd. 38 (1989), 197, 211 ff.
100
Zweiter Teil: Zustandsstörerverantwortlichkeit - Rechtsgrund und Umfang
Es ist anerkannt, daß der Gestörte nicht als Störer verantwortlich ist 94 . Das Schulbeispiel hierfür ist der Eigentümer eines Hauses, das durch Abbröckelungen von einem höher gelegenen Grundstück gefährdet ist. Er ist Nichtstörer und darf nicht als Störer zum Verlassen des Hauses oder zu Sicherungsmaßnahmen verpflichtet werden95. Ossenbilhl nimmt auch für die Öltransportunfall-Fälle 96 an, die Grundstückseigentümer seien als Opfer des Handlungsverantwortlichen "Gestörte" und damit nicht Störer 97. Dabei wird jedoch außer acht gelassen, daß das Grundstück das Grundwasser bedroht und damit vom Grundstück eine Gefahr ausgeht98. Nicht jedes Opfer eines Handlungsstörers ist Gestörter. Wenn von einer Sache eine Gefahr ausgeht, ist der Eigentümer verantwortlich, auch wenn ein anderer die Gefahr verursacht hat 99 . Dies zeigen auch die Fälle der Verantwortlichkeit des Kfe-Eigentümers bzw. -Halters beim Abschleppen von falsch geparkten Autos. Seine materielle Polizeipflicht wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß ein anderer das Fahrzeug in eine störende Lage gebracht hat 100 . Eine im Einzelfall als unbillig empfundene Opferlage läßt die materielle Polizeipflicht des Eigentümers nicht entfallen 1"1. Die Zustandsstörerverantwortlichkeit wird durch die Opferposition nicht aufgehoben. Der Sachlage kann nur dadurch Rechnung getragen werden, daß - sofern die effektive Gefahrenabwehr dadurch nicht gefährdet ist (!) - der Handlungsstörer vor dem Zustandsstörer in Anspruch genommen werden muß1 . Die Opferlage ändert jedoch nichts an der Zustandsstörereigenschaft selbst103.
9 4
Gefahrenabwehr, S. 308; Schenke in: Steiner (Hrsg.),
95
Gefahrenabwehr, S. 308; Scholler/Broß,
Drews/Wacke/Vogel/Martens, Besonderes Veiwaltungsrecht, Rdnr. 87. Drews/Wacke/Vogel/Martens, Polizei- und Ordnungsrechts, S. 220. 9 6
Grundzüge des
S.o. Erster Teil, Zweites Kapitel, I.
97
Ossenbühl, DÖV 1976, 463, 470, Fußnote 59a.
9 8
Dies betont auch Krampol, Festschrift für Rudolf Samper, S. 155 f.
9 9
Wolff/Bachofy
Veiwaltungsrecht III, S. 67; Gantner, Verursachung, S. 201.
100 O V G K o 5 1 e n Z ) U r t ν i5.io.1985, NJW 1986, 1369, 1370; BayVGH, Beschl. v. 01.07.1986, BayVBl 1986, 625, 626; a. A noch BayVGH, Beschl. v. 08.09.1983, BayVBl 1984, 16,17; unschlüssig OVG Koblenz, Urt. v. 17.09.1985, DÖV 1986, 37, 38. 101
So aber Kimmel, Eigentum und Polizei, S. 172, der den Eigentümer, der selbst Opfer einer polizeiwidrigen Situation ist, mit dem Argument entlasten will, es fehle jegliche mißbräuchliche Nutzung des Eigentums. 102 O V G K o 5 1 e n z , Urt. v. 15.10.1985, NJW 1986,1369,1370. 103
Krampol, Festschrift für Rudolf Samper, S. 158
2. Kapitel: Die materielle Polizeipflicht
101
3. Nutzen-Lasten-Abwägung In den Lösungsvorschlägen zu den Altlastenfällen findet sich oft der Ruf nach einer angeblich verfassungsrechtlich gebotenen Reduktion des Zustandsstörerbegriffc. Diese Reduktion wird aus Art. 14 GG als Risikozuweisungs- und Lastenverteilungsnorm abgeleitet104. Anhand der Gegenüberstellung der verschiedenen Interessen und der Bestimmung der materiellen Polizeipflicht als Beseitigungspflicht soll nun die Frage untersucht werden, ob besonders hohe Lasten die materielle Polizeipflicht von vorneherein entfallen lassen können. Maßgeblich für die materielle Polizeipflicht ist die Sachherrschaft. Diese mag die Nutzung der Sache mit den sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Vorteilen ermöglichen. Ein Abstellen nicht auf die Sachherrschaft allein, sondern auf die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Vorteile würde jedoch bedeuten, daß die Beseitigungspflicht des Inhabers der Sachherrschaft nicht mehr von der Gefahr, sondern von einer Abwägung der damit verbundenen Lasten und den aus der Sache gezogenen wirtschaftlichen Vorteilen oder der bloßen Möglichkeit der Nutzenziehung abhängen würde. Dies würde dem Effektivitätspostulat widersprechen: Im Polizeirecht hat die schnelle und effektive Gefahrenabwehr absoluten Vorrang; sie ist Normzweck der Generalklausel. Damit ist sie zugleich Richtschnur des Störerrechts. Für den Zustandsstörer bedeutet dies, daß die materielle Polizeipflicht nicht entfällt, wenn die Lasten der Sachherrschaft den Nutzen übersteigen. Der Vorschlag, der Eigentümer könne ja, falls eine Einordnung als Zustandsstörer wegen der im Vergleich zu den Lasten geringen wirtschaftlichen Vorteile, die bisher aus der Sache gezogen wurden oder noch gezogen werden können, als Nichtstörer in Anspruch genommen werden, hilft nicht. Erstens würde es den Interessen eines unbeteiltigten Dritten widersprechen, wenn ihm der Eigentümer, der unbestritten eine größere Sachnähe hat als er, gleichgestellt würde. Damit hätte die Polizei, falls man nicht einen Nichtstörer erster Klasse und einen Nichtstörer zweiter Klasse annimmt, ein Auswahlermessen zwischen seiner Inanspruchnahme und der Inanspruchnahme des Eigentümers. Vor allem aber würde eine Erklärung des Eigentümers zum Nichtstörer dem Interesse der Gemeinschaft an schneller und effektiver Gefahrenabwehr zuwiderlaufen. Der Eigentümer könnte als Nichtstörer nur unter den engen Voraussetzungen des polizeilichen Notstands in Anspruch genommen werden, was die Gefahrenabwehr
104
S.o. Erster Teil, Zweites Kapitel, II. 3.; s.a. Zweiter Teil, Erstes Kapitel, I. und III.
102
Zweiter Teil: Zustandsstörerverantwortlichkeit
Rechtsgrund und Umfang
vereiteln oder zumindest erschweren könnte 105 . Die materielle Polizeipflicht des Eigentümers ist nicht abhängig von Zurechnungskriterien, die über die Sachherrschaft hinausgehen. Kriterien wie z.B. mit der Beseitigung verbundene Lasten können nur nach der Gefahrenbeseitigung berücksichtigt werden, nicht schon bei der Störereigenschaft und der materiellen Polizeipflicht.
4. Die Kosten der Beseitigung Angesichts der teilweise hohen Kosten der Beseitigung der Gefahr wird vorgeschlagen, die Störereigenschaft nach den anfallenden Kosten der Beseitigung zu bestimmen1 . Herrmann sieht als Prämisse des geltenden Rechts den Satz, daß, wenn jemand Störer ist, er auch die Kosten zu tragen habe. Unter dieser Prämisse sei es bei der Bestimmung, wann jemand Störer ist, entscheidend, auch den Kostenaspekt miteinzubeziehen107. Die Ansicht von Götz, das Polizei- und Ordnungsrecht kenne keine Norm, nach der der Verantwortliche für die Schadensfolgen aufkommen müsse108, weist er als unzutreffend zurück, ohne dies jedoch näher zu begründen. Er verweist lediglich darauf, daß den Störer, der einer Anordnung folge, ohnehin die Kosten träfen und aus der unmittelbaren Ausführung oder der Ersatzvornahme die Kostentragungspflicht folge 109. Bei der Ansicht von Herrmann ist jedoch schon der Ansatz falsch: Anstatt zu fragen, ob denn der Zustandsstörer die Kosten immer und ausnahmslos tragen muß, wird die angeblich unabdingbare Rechtsfolge zum Tatbestandsmerkmal gemacht. Da Störer sei, wer die Kosten zu tragen habe, sei derjenige nicht Störer, der - aus welchen Gründen auch immer die Kosten nicht tragen solle. Dies ist eine Argumentation vom Ergebnis her. Die Rechtsfolgen des Störertatbestands können nicht zur Beantwortung der Frage, ob der Tatbestand vorliegt, herangezogen werden 110. Außerdem widerspricht
105
S.a. Kimmelf
Eigentum und Polizei, S. 193.
10 6
Herrmann , DÖV 1987, 666, 670; für den Verursachungsbegriff beim Handlungsstören Vollmuth, Die Bestimmung, S. 31 f. 107
Herrmann, DÖV 1987, 666, 670.
10 8
Götz, DVB1 1984, 14,17.
10 9
Herrmann, Flächensanierung, S. 76.
110
Fischer, Unterlassene Hilfeleistung, S. 142.
2. Kapitel: Die materielle Polizeipflicht
103
eine solche Argumentation den im Polizeirecht geltenden Prinzipien. Das Effektivitätspostulat wird durch sachfremde Gerechtigkeitsüberlegungen angereichert, um eine Rechtsfolge zu vermeiden, die als unbillig angesehen wird. Dies stellt eine unzulässige Vermengung der im Polizeirecht und im Polizeikostenrecht geltenden Prinzipien dar: Die materielle Polizeipflicht wird durch das Effektivitätspostulat geprägt, für die Kostentragungspflicht sind dagegen das Postulat gerechter Lastenverteilung und das Postulat rückschauender Betrachtung bestimmend. Dies soll im Ersten Kapitel des nun folgenden Dritten Teils anhand von Beispielsfällen dargestellt werden, bevor im Zweiten Kapitel auf die Grenzen der Kostentragungspflicht unter besonderer Berücksichtigung der Altlastenproblematik eingegangen wird.
Dritter
Teil
Die Kostentragungspflicht nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme Erstes Kapitel
Das Verhältnis von Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht L Einleitung Ausgehend von der Frage nach den Pflichten des Zustandsstörers in den Fällen, in denen er Opfer eines unbekannten oder nicht greifbaren Handlungsstörers geworden ist, soll im Dritten Teil nunmehr die Kostentragungspflicht nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme einer näheren Untersuchung unterzogen werden. Im letzten Kapitel wurde festgestellt, daß es sich bei der materiellen Polizeipflicht um eine Pflicht zur Abwehr einer konkreten Gefahr handelt und daß diese Pflicht nicht von der Höhe der entstehenden Kosten abhängt. Es soll nun geprüft werden, ob die Kostentragungspflicht umgekehrt auch unabhängig von der Beseitigungspflicht ist. Eine solche Unabhängigkeit würde bedeuten, daß der beseitigungspflichtige Zustandsstörer nicht automatisch kostentragungspflichtig ist, sondern daß die Frage, ob er auch diefinanziellen Lasten der Gefahrenabwehr zu tragen hat, gesondert untersucht werden muß. Dann ist möglicherweise eine Freistellung des Eigentümers einer störenden Sache, der Opfer eines Handlungsverantwortlichen geworden ist, zulässig, ohne daß er zum Nichtstörer erklärt wird und ohne daß auf dem Polizeirecht fremde Bewertungstopoi abgestellt wird. Sie ergäbe sich aus eigenständigen der Kostentragungspflicht zugrundeliegenden Prinzipien. Die Ansicht, beide Pflichten würden sich entsprechen oder im Verhältnis der Konnexität stehen, und die Meinung, die Kostentragungspflicht sei Annex oder Surrogat der Beseitigungpflicht1, gehen von einer Abhängigkeit und Untrennbarkeit aus.
S.o. Erster Teil, Erstes Kapitel, V. 2.
1. Kapitel: Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht
105
Allerdingsfinden sich auch Ausführungen und Fälle, denen eine getrennte Betrachtung zugrunde liegt und die darauf hinweisen, daß das Effektivitätspostulat, das die Heranziehung zur Gefahrenabwehr bestimmt, für die Kostentragungspflicht gerade nicht gilt. Anhand dieser Fälle können die maßgeblichen Prinzipien zur Bestimmung der Kostentragungspflicht herausgearbeitet werden. Insbesondere bei der Auswahl zwischen mehreren Störern und in den Fällen der Anscheinsgefahr wurden dem Effektivitätspostulat zwei Prinzipien gegenübergestellt, die die Kostentragungspflicht prägen: Das Postulat gerechter Lastenverteilung und das Postulat rückschauender Betrachtung. Wie sich das Wesen der materiellen Polizeipflicht durch das Effektivitätspostulat erschließt, läßt sich das Verhältnis von Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht anhand dieser Prinzipien bestimmen.
IL Der Konflikt zwischen Effektivitätspostulat und Postulat gerechter Lastenverteilung und der Lösungsansatz einer getrennten Betrachtung Die gerechte Lastenverteilung ist ein zentrales Problem polizeirechtlicher Fälle. Die geforderte gerechte Inanspruchnahme wird dann vorliegen, wenn derjenige belastet wird, dem die Gefahr am ehesten zugerechnet werden kann. Allerdings ist es möglich, daß die Verpflichtung dieses Störers nicht die schnellste und effektivste Abwehr der Gefahr darstellt. Es kann dann zu einem Konflikt von Effektivitätspostulat und Postulat gerechter Lastenverteilung kommen. Dieser ist umso größer, je stärker die Belastungen sind, die durch die Inanspruchnahme entstehen. Bei diesen Lasten handelt es sich meist um die Kosten der Gefahrenbeseitigung. Von einem "Spannungsfeld von Gerechtigkeit und Effizienz" 2 kann allerdings nur dann gesprochen werden, wenn der Beseitigungspflichtige immer auch die Kosten der Beseitigung zu tragen hat. Eine gemäß dem Effektivitätspostulat vorgenommene Inanspruchnahme des Störers zur Beseitigung kann dann gerecht sein, wenn der Störer nicht zusätzlich mit den Kosten der Beseitigung belastet wird. Dieser Ansatz beruht auf der Untersuchung der Zuordnung der Prinzipien zu den in polizeirechtlichen Fällen relevanten Pflichten: Das Effektivitätspostulat und das Postulat gerechter Lastenverteilung betreffen verschiedene Ebenen polizeilichen Handelns. Die Beseitigungspflicht unter-
2
Spannowsky, UPR 1988, 376.
106
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
liegt dem Prinzip effektiver Gefahrenabwehr (Effektivitätspostulat), das Polizeikostenrecht hingegen dem Postulat gerechter Lastenverteilung3. Das bedeutet auch, daß die Entscheidung über die Verpflichtung zur Beseitigung einer bestehenden Gefahr nicht von der Höhe der entstehenden Kosten beeinflußt werden darf. Die Gemeinwohlinteressen überwiegen insoweit im Polizeirecht die Individualinteressen4. Andererseits ist der Kostenaspekt nach der Beseitigung der Gefahr zu berücksichtigen, wenn es um die Frage geht, wer die Kosten der Gefahrenabwehr zu tragen hat. Dann steht das Prinzip gerechter Lastenverteilung im Vordergrund. Das Effektivitätspostulat spielt dann keine Rolle mehr, da die Auferlegung von Kosten ja nicht mehr der Abwehr einer bestehenden konkreten Gefahr dient5. Es kann dann ohne Zeitdruck weitere Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit geleistet werden. Das Effektivitätspostulat ist somit den Handlungs- und Duldungpflichten des Störers zuzuordnen, das Prinzip gerechter Lastenverteilung betrifft dagegen die Frage, welche Kosten dem Störer durch die Beseitigung der Gefahr entstehen oder verbleiben. Das Verhältnis von Effektivitätspostulat und Postulat gerechter Lastenverteilung hat insbesondere bei der Auswahl zwischen mehreren Störern sowie bei der Kostentragungspflicht des vermeintlichen Störers im Rahmen einer Anscheinsgefahr nach unmittelbarer Ausführung oder Ersatzvornahme eine Rolle gespielt. Bei den Fällen der erstgenannten Art stand die Frage der gerechten Lastenverteilung zwischen den einzelnen Störern, bei den Fällen der Anscheinsgefahr die gerechte Lastenverteilung zwischen Störer und Allgemeinheit im Vordergrund. Bei genauer Analyse dieser Fälle wird deutlich, daß es möglich und auch gebräuchlich ist, den Eigentümer einer Sache als Störer zur Gefahrenabwehr zu verpflichten, daß er jedoch bei einer rückschauenden Betrachtung nach der Beseitigung der Gefahr, wenn also das Effektivitätspostulat schnelles Handeln nicht mehr erforderlich macht, nicht mehr in Anspruch genommen werden darf, ihm also die Kosten für die Gefahrenabwehr nicht auferlegt werden dürfen, obwohl er zur Beseitigung als Störer herangezogen wurde oder hätte herangezogen werden können.
3
Broß, DVBl 1983, 377; Schenke, NJW 1983, 1889; Würtenberger,
NVwZ 1983, 196.
4
Kloepfer/Thull, DVBl 1989,1121; Kormann, UPR 1983, 285; Brandt/DiekmannfWagner, Altlasten, S. 57; s.a. OssenbM, DÖV 1976, 463, 471. 5
Berner/Köhler, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 7 zu Art. 54 a BayPAG; Schenke, NJW 1983, 1882,1887; siehe auch die Überlegungen von Hohmann, DVBl 1984, 997, 998.
1. Kapitel: Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht
107
ΙΠ. Das Verhältnis von Effektivitätspostulat einerseits und Postulat gerechter Lastenverteilung sowie Postulat rückschauender Betrachtung andererseits anhand ausgewählter Fälle 1. Effektivitätspostulat und Postulat gerechter Lastenverteilung bei der Auswahl zwischen mehreren Störern a) Auswahlermessen und Effektivität der Gefahrenabwehr Insbesondere bei dem Problem der Auswahl unter mehreren Störern hat das Effektivitätspostulat als bestimmendes Prinzip des Störerrechts bisher eine Rolle gespielt6. Die Polizei- und Sicherheitsbehörden haben bei der Heranziehung eines von mehreren Störern ein Auswahlermessen7. Die Ermessensausübung muß jedoch vom Gebot der effektiven und optimalen Beseitigung ausgehen8. Es ist anerkannt, daß die Polizei denjenigen in Anspruch nehmen kann, der die Gefahr am schnellsten und besten beseitigen kann9. Dies gilt auch dann, wenn sein Verursachungsbeitrag gering ist 10 . So ist unter diesen Voraussetzungen auch zulässig, den Zustandsstörer vor dem Handlungsstörer in Anspruch zu nehmen11. Die Polizei braucht sich weder an den wirtschaftlich Leistungsfähigeren zu halten12 noch muß sie zivilrechtliche Haftungsverhältnisse unter den Störern berücksichtigen13.
0
Dazu Fleischer, Die Auswahl unter mehreren Polizeipflichtigen, insbes. S. 55 ff.; Kormann, UPR 1983, 281, 284. η Scholler /Br oß, Grundzüge des Polizei- und Ordnungsrechts, S. 211; Friauf in: von Münch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, S. 240; Ule/Rasch, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 21 zu § 5 MEPolG; a.A. Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 260, für den sich die Entscheidung der Behörden aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ergibt; s.a.8 Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 234. Knopp, BB 1990, 575, 578. 9
Papier, Altlasten, S. 69; Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 100; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 236; Fleischer, Die Auswahl unter mehreren Polizeipflichtigen, S. 114 f., 120 f.; Fehn, VR 1987, 269; Ziehm, Störeiverantwortlichkeit, S. 70. 10
Papier, Alttasten, S. 70.
11
Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 304 f.; Spannowsky, UPR 1988, 377; Papier, Altlasten, S. 71; a A die früher h.M., vgl. Scholler/Broß, Grundzüge des Polizei- und Ordnungsrechts, S. 212, und Ule/Rasch, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 21 zu § 5 MEPolG jeweils mit zahlreichen Nachweisen zur Rechtsprechung. Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 236; Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 303. 13
Spannowsky, UPR 1988, 376, 377; für eine Verpflichtung zur Berücksichtigung der internen Verantwortlichkeit Fleischer, Die Auswahl unter mehreren Polizeipflichtigen, S. 89 ff.;
108
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
Dies geschieht im Interesse einer schnellen und effektiven Gefahrenabwehr. Dem Postulat gerechter Lastenverteilung muß deshalb auf andere Weise Rechnung getragen werden.
b) Zivilrechtlicher Gesamtschuldnerausgleich als Versuch zur Lösung des Konflikts zwischen Effektivitätspostulat und Postulat gerechter Lastenverteilung
Es soll als erstes untersucht werden, ob die Regeln des zivilrechtlichen Gesamtschuldnerausgleichs im Verhältnis der Störer untereinander anwendbar sind und ob dies auch wirklich zu einer gerechten Lastenverteilung führen kann. Die Anwendbarkeit des Gesamtschuldnerausgleichs für polizeirechtliche Sachverhalte war eine zentrales Problem in der polizeirechtlichen Literatur und Rechtsprechung der letzten Jahre 14. Im vorliegenden Zusammenhang interessiert diese Frage lediglich im Hinblick auf die Bestimmung des Verhältnisses von Effektivitätspostulat und Postulat gerechter Lastenverteilung bei der Kostentragungspflicht des Störers. Derjenige, der als Störer in Anspruch genommenen wurde, hat nach Rechtsprechung und herrschender Ansicht in der Literatur keinen Ausgleichsanspruch gegenüber den anderen, nicht in Anspruch genommenen Störern. Die Vorschrift des § 426 BGB, in der das Verhältnis von Gesamtschuldnern zueinander und ihre Ausgleichspflicht untereinander festgelegt ist, wenn einer von ihnen den Gläubiger befriedigt, kann im Verhältnis mehrerer Störer weder direkt noch entsprechend angewendet werden, da weder das Verhältnis der Polizeipflichtigen untereinander noch das Verhältnis der Polizei zu den Pflichtigen der zivilrechtlichen Gesamtschuld entspricht. Die Polizei kann beispielsweise nicht wie ein Gläubiger unter den Schuldnern frei auswählen, wer in Anspruch genommen wird, sondern sie ist an das Effektivitätspostulat gebunden. Es gibt im Polizeirecht nach der h.M. in Literatur und Rechtsprechung keinen Gesamtschuldneraus-
ihm folgend, aber nicht für ein ausschließliches Abstellen auf zivilrechtliche Verhältnisse Hilti, Die Entfernung von Kfe, S. 104; s.a. BayVGH, Beschl. v. 13.05.1986, BayVBl 1986, 590, 593. 14 Vgl. z.B. Knauf Gesamtschuld und Polizeikostenrecht, Diss. jur. Hannover 1985 m.w.N.
1. Kapitel: Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht
109
gleich15. Damit kann es in bestimmten Fällen zum Konflikt zwischen Effektivitätspostulat und Postulat gerechter Lastenverteilung kommen. Das Dilemma zwischen Effizienz und gerechter Lastenverteilung16 hat in der Literatur zu Überlegungen geführt, die Kosten der Beseitigung bzw. die wirtschaftliche Belastung des in Anspruch zu nehmenden Störers als abwägungserheblichen Belang bei der Auswahl zwischen mehreren Störern zu konstatieren17 oder einen Gesamtschuldnerausgleich im Störerrecht anzuerkennen18. Diese Wege bieten jedoch keine wirkliche Lösung des Konflikts von Effektivitätspostulat und Postulat gerechter Lastenverteilung. Die Einführung eines Gesamtschuldnerausgleichs würde das Problem nur verkleinern, indem man es auf mehrere Schultern verteilt. Bei der vorgeschlagenen Berücksichtigung der Kosten im Rahmen des Auswahlermessens wird - abgesehen davon, daß die Berücksichtigung wirtschaftlicher Kriterien möglicherweise die effektive Gefahrenabwehr gefährdet - das Kostenproblem ebenfalls nicht gelöst, sondern nur dem aufgebürdet, den es vermeintlich am wenigsten belastet. Das Problem, daß eine effektive Gefahrenabwehr gewährleistet sein muß und zugleich die Lasten gerecht verteilt werden müssen, hängt nicht von der Höhe der Kosten oder der Empfindlichkeit der Belastung für den einzelnen ab, sondern stellt sich als grundsätzliche Frage des Verhältnisses von Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht. Dies zeigt sich insbesondere dann, wenn - wie in den Altlasten- oder Öltransportunfall-
15
BGH, Urt. v. 11.06.1981, NJW 1981, 2457; BGH, Urt. v. 18.09.1986, UPR 1987, 29, 30 f.; Ule/Rasch, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 22a zu § 5 MEPolG; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 238; Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 261; Papier, Altlasten, S. 73 f.; Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 302; Hoppe/Beckmann, Umweltrecht, § 15, Rdnr. 64; Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung, S. 200 f.; Schwachheim, NVwZ 1988, 227; Ossenbühl, DÖV 1976, 471; s.a. Fleischer, Die Auswahl unter mehreren Polizeipflichtigen, S. 82 ff.; offen gelassen von HessVGH, Urt. v. 24.10.83, NJW 1984,1197,1199. 16
Kormann, UPR 1983, 284 f.; Fleischer, Die Auswahl unter mehreren Polizeipflichtigen, S. 68 f.; Brandt/Diekmann/Wagner, Altlasten, S. 55 ff; Spannowsky, UPR 1988, 376, 377; s.a. Schoüer/Broß, Grundzüge des Polizei- und Ordnungsrechts, S. 212, wo die Lösung dieses Konflikts in einer wertenden von-Fall-zu-Fall-Entscheidung gesucht wird. 17 18
Papier, Altlasten, S. 70; Fehn, VR 1987, 269.
Kormann, UPR 1983, 283 ff., 287 f.; Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 101; Ziehm, Störerverantwortlichkeit, S. 74; Herrmann , Flächensanierung, S. 175; Kloepfer/ThuU, DVB1 1989, 1125 ff.; Dombert, Altlastensanierung, S. 63 f.; Koch, Bodensanierung, S. 70; Seibert, DÖV 1983 964; Nauschütt, Altlasten, S. 175 f.; Pietzcker, JuS 1986, 722; Spannowsky, UPR 1989, 379 m.w.N.
110
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
Fällen - nur ein Störer, der Grundstückseigentümer, als Zustandsstörer greifbar ist. Ihm nützt weder eine "gerechte" Auswahl noch ein - nicht durchsetzbarer - Ausgleichsanspruch19. Außerdem wird durch die Anwendung des Gesamtschuldnerausgleichs die Trennung zwischen zivilrechtlichen Ausgleichsansprüchen und öffentlichem Gefahrenabwehrrecht aufgegeben20.
c) Die Freistellung des Störers von den Kosten durch den Staat Giesberts lehnt einen Ausgleich unter den Störern ab und schlägt vor, die erforderliche endgültige Lastenverteilung in zwei Schritten vorzunehmen: In einem ersten Schritt erfolge die Rückerstattung der Kosten an den verpflichteten Störer durch den Staat nach § 45 Abs. 1 Satz 1 MEPolG und sodann in einem zweiten Schritt der Rückgriff des Staates auf die übrigen Störer, die nach dem Postulat gerechter Lastenverteilung in Anspruch zu nehmen sind. Giesberts unterscheidet zwischen der Lastenverteilung vor der Gefahrenbeseitigung, die nach dem Effektivitätspostulat vorzunehmen ist, und derjenigen nach der Gefahrenbeseitigung, die nach dem Postulat gerechter Lastenverteilung (Art. 3 Abs. 1 GG) zu erfolgen hat. Der Gleichheitssatz stehe nicht der Verpflichtung eines Störers zur Beseitigung der gesamten Gefahr entgegen, wenn dies das Effektivitätspostulat erfordere. Er gebiete jedoch nach Gefahrenbeseitieung die Herbeiführung einer gerechten und endgültigen Lastenverteilung51.
d) Bewertung: Die Bedeutung der Frage nach einer gerechten Lastenverteilung unter mehreren Störern für das vorliegende Thema Auf die Frage nach dem verfassungsrechtlichen Standort des Postulats der gerechten Lastenverteilung sowie danach, ob auch der Störer einen Ausgleichsanspruch haben kann, soll erst an anderer Stelle eingegangen werden22. Giesberts Lösungsvorschlag macht jedoch deutlich, daß eine getrennte Betrachtung von Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht
19
Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung, S. 214, spricht von einer "stumpfen Waffe".
2 0
S.a. Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung, S. 214 f.
21
Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung, S. 196 ff., insbes. S. 216 ff.; Giesberts geht allerdings weiterhin davon aus, daß die Kostentragungspflicht Surrogat der Beseitigungspflicht ist (S. 204). 2 2
Zum verfassungsrechtlichen Standort des Postulats gerechter Lastenverteilung s.u. Zweites Kapitel; zum Ausgleichsanspruch nach § 45 Abs. 1 MEPolG s.u. Drittes Kapitel.
1. Kapitel: Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht
111
grundlegende Voraussetzung der Lösung des Konflikts zwischen Effektivitätspostulat und Postulat gerechter Lastenverteilung ist. Gerade weil das Effektivitätspostulat eine rasche Behördenentscheidung fordert, kann nicht davon ausgegangen werden, daß mit der Inanspruchnahme zur Gefahrenabwehr auch schon eine endgültige Entscheidung über die Kostentragung getroffen wurde 23. Die Diskussion um den Gesamtschuldnerausgleich im Polizeirecht zeigt, daß es allgemein als notwendig angesehen wird, um einer gerechten Lastenverteilung willen den als Störer zur Gefahrenbeseitigung Herangezogenen in bestimmten Fällen nicht auch noch mit den Kosten der Beseitigung zu belasten. Die konsequente Anwendung dieser Trennung von Beseitigungspflicht und endgültiger Lastenverteilung verlangt erst recht, nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme zu prüfen, ob die Inanspruchnahme des Eigentümers als Zustandsstörer zu einer gerechten Lastenverteilung führt. Die getrennte Betrachtung von Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht, die auch zu dem Ergebnis führen kann, daß ein Störer zwar beseitigungspflichtig ist oder gewesen wäre, daß ihm aber nicht die Kosten der Beseitigung auferlegt werden dürfen, ist nicht nur mit dem Grundsatz vereinbar, daß die materielle Polizeipflicht als Rechtsgrund der Störereigenschaft nur zur Beseitigung verpflichtet 24. Sie wurde für einen Sonderfall des Störerrechts, bei der Inanspruchnahme des Störers im Rahmen der Anscheinsgefahr, auch praktiziert. 2. Effekävitätspostulat und Kostentragungspflicht der Anscheinsgefahr
in den Fällen
a) Der Begriff der Anscheinsgefahr Der Begriff der Anscheinsgefahr bezeichnet Situationen, die sich bei verständiger Würdigung des Sachverhalts durch die Behörde im Zeitpunkt des Handelns (ex-ante-Perspektive) als Gefahrentatbestand mit Schadenseignung darstellen, und bei denen sich erst nachträglich herausstellt, daß die Möglichkeit eines Schadenseintritts nicht bestand25. Maßgeblich ist
So auch Domben, Altlastensanierung, S. 64, der jedoch nicht für eine Freistellung von den Kosten durch den Staat, sondern für einen Gesamtschuldnerausgleich zur Herstellung der gerechten Lastenverteilung eintritt. 2 4 2 5
S.o. Zweiter Teil, Zweites Kapitel.
Drews ßVacke/Vogel/Manens, Gefahrenabwehr, S. 225; Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 69; Breuer, Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, S. 333 f.
112
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
dabei nicht das subjektive Urteil des irrenden Amtswalters (dann läge eine sog. Putativgefahr vor 26 ), sondern das Urteil eines fähigen, besonnenen Beamten27. Eine Anscheinsgefahr liegt zum Beispiel vor, wenn aus einer Wohnung Hilferufe zu vernehmen sind und die Polizei deshalb tätig wird, sich beim Einsatz jedoch herausstellt, daß die Hilferufe nicht von einem gefährdeten Bewohner herrühren, sondern aus einem Radioapparat kommen28. Die Anscheinsgefahr bietet das gleiche Bild wie eine "reale" Gefahr 29. Bei umsichtiger, wenn auch irriger Würdigung des Sachverhalts ist auch in den Fällen der Anscheinsgefahr schnelle Hilfe notwendig. Die Anscheinsgefahr ist daher eine Gefahr im Sinne des Polizeirechts30 bzw. steht ihr gleich31. Dies ist damit zu begründen, daß die in umsichtiger Würdigung des Sachverhalts angenommene Gefährlichkeit im maßgeblichen Zeitpunkt, in dem schnelles Handeln erforderlich ist, nicht dadurch entfällt, daß sich später herausstellt, daß eine Bedrohung gar nicht existierte. Wenn eine Lawine - entgegen einer vor Räumung des vermeintlich gefährdeten Dorfes vorgenommenen umsichtigen Würdigung der Gefährlichkeit - nicht auf den gefährdeten Ort niedergeht, gehört dies nicht mehr zum für die Gefahrenbeurteilung relevanten Sachverhalt32.
b) Der Eigentümer als nicht kostentragungspflichtiger Störer Gegen den Eigentümer oder Inhaber der rechtlichen oder tatsächlichen Sachherrschaft über die scheinbar störende Sache können - da eine Gefahr vorliegt - Maßnahmen auf Grund der polizeilichen Generalklausel erlassen werden. Er wird auf Grund der Anscheinslage rechtmäßig als Störer in Anspruch genommen33.
2 6
Drews/Wacke/Vogel/Martens,
Gefahrenabwehr, S. 225 f.
2 7
Drews/Wacke/Vogel/Martens,
Gefahrenabwehr, S. 226.
2 8
Beispiel nach Drews/Wacke/Vogel/Martens,
2 9
Breuer, Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, S. 336.
Gefahrenabwehr, S. 226.
3 0
Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 69; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 125; Gerhardt, Jura 1987, 521, 523. 31
Berner/Köhler,
3 2
Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 127.
Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 9 zu Art. 2 BayPAG.
3 3 Breuer, Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, S. 336 f.; Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 226; Gerhardt, Jura 1987, 521, 523, 526; VGHBW, Urt. v. 10.05.1990, DÖV 1991, 165, 166.
1. Kapitel: Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht
113
Die Gegenansicht, der Anscheinsstörer sei Nichtstörer 34, wird z.T. damit bëgrûndet, daß Art. 14 Abs. 3 GG eine Entschädigung desjenigen verlange, der bei Anscheinsgefahr herangezogen wurde. Erwachse dem von einer solchen polizeilichen Maßnahme Betroffenen ein Schaden, der ein Sonderopfer begründe, so bedürfe es bei einem Eingriff in ein subjektives vermögenswertes Privatrecht einer Entschädigung35. Diese Ansicht, die durch Einordnung des Anscheinsstörers als Nichtstörer unbillige Rechtsfolgen vermeiden will, verkennt jedoch den grundlegenden Unterschied von Störer und Nichtstörer: Eine Behandlung des Betroffenen als Nichtstörer würde bedeuten, daß er nur unter den engen Voraussetzungen des polizeilichen Notstands in Anspruch genommen werden dürfte. Dem Problem einer möglichen Entschädigung kann auch durch eine getrennte Betrachtung von Beseitigungspflicht und vermögensrechtlichen Folgen Rechnung getragen werden: Wenn sich herausstellt, daß eine Gefahr nicht vorlag, wird die rechtmäßige Inanspruchnahme nicht rechtswidrig. Ein Adressat, der jedoch bei einer Anscheinsgefahr als Störer herangezogen wurde oder herangezogen hätte werden können, muß dann aber aus der ex-post-Perspektive als Nichtstörer behandelt werden, sofern er nicht den Anschein der Gefahr verursacht hat 36 . Das OVG Hamburg stellte zu dieser Problematik fest, daß bei einem polizeilichen Vorgehen im Fall einer Anscheinsgefahr die Polizei zwar gegen denjenigen einschreiten darf, der nach ihrem Kenntnisstand beim Eingreifen dem Anschein nach Störer ist, daß sie ihn jedoch auf Erstattung der Kosten des Polizeieinsatzes nur in Anspruch nehmen kann, wenn er, bei rückschauender Betrachtung nach Aufklärung des Sachverhalts, tatsächlich die Anscheinsgefahr veranlaßt und zu verantworten hat 37 .
3. Ergebnis Die Fälle der Anscheinsgefahr zeigen, daß der Konflikt zwischen Effektivitätspostulat und Postulat gerechter Lastenverteilung nicht nur bei der
3 4 Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 232; Hoffmann-Riem, Festschrift für Gerhard Wacke, S. 337; ihm folgend Spießhof er, Der Störer, S. 182 f. oc Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 93. 3 6 Breuer, Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, S. 335 ff. 3 7 OVG Hamburg, Urt. v. 24.09.85, NJW 1986, 2005; vgl. auch VGHBW, Urt. v. 10.05.1990, DÖV 1991, 165, 166 f.
8 Grìesbeck
114
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
Auswahl unter mehreren Störern eine Rolle spielt. Auch die Entscheidung, ob einem Störer die Kosten der Gefahrenabwehr aufzuerlegen sind, oder ob sie bei der handelnden Behörde verbleiben und sie damit die Allgemeinheit der Steuerzahler zu tragen hat, ist eine Frage der gerechten Lastenverteilung. In den Fällen der Anscheinsgefahr wird nicht nur eine getrennte Behandlung von Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht bei einem einzelnen Störer vorgestellt, sondern es wird darüber hinaus durch die Verwendung der Begriffe ex-ante-Perspektive und ex-post-Perspektive38 auch der Grund dafür deutlich. Für die Inanspruchnahme zur Beseitigung ist die ex-ante-Perspektive entscheidend, für die Klärung der vermögensrechtlichen Fragen die ex-postPerspektive39. Dies ist Folge des Effektivitätspostulats und liegt im Interesse der Funktionstüchtigkeit der Gefahrenabwehr 40. Bei einer Gefahr müssen gemäß dem Effektivitätspostulat die notwendigen Maßnahmen schnell ergriffen werden. Die Notwendigkeit ist von einer Prognoseentscheidung abhängig. Im Interesse einer effektiven Gefahrenabwehr kann die Behörde, solange sich nicht herausstellt, daß eine wirkliche Gefahr gar nicht vorliegt, alles unternehmen, was aus ihrer Sicht zur Gefahrenabwehr erforderlich ist. Sie kann daher den Eigentümer oder den Inhaber der tatsächlichen Sachherrschaft als Zustandsstörer in Anspruch nehmen und muß nicht erst die engen Voraussetzungen der Inanspruchnahme des Nichtstörers prüfen. Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht müssen also nicht nur deshalb getrennt betrachtet werden, weil sie verschiedenen Zielen dienen (schnelle Gefahrenabwehr einerseits und gerechte Lastenverteilung andererseits), sondern auch deshalb, weil für die Beurteilung der Pflichten verschiedene Zeitpunkte maßgeblich sind: Im Gegensatz zur Gefahrenabwehrpflicht beurteilt sich die Kostentragungspflicht danach, wie sich die Gefahrenlage und ihre Verursachung bei rückschauender Betrachtung darstellt41.
3 8
Breuer, Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, S. 336; Gerhardt, Jura 1987, 521; Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 232; VGHBW, Urt. v. 10.05.1990, DÖV 1991, 165, 166. 3 9
Breuer, Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, S. 336.
4 0
Breuer, Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, S. 336; s.a. VGHBW, Urt. v. 10.05.1990, DÖV 1991, 165, 167. 4 1
OVG Hamburg, Urt. v. 24.09.85, NJW 1986, 2005, 2006.
1. Kapitel: Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht
115
Indirekt hängt auch dies natürlich mit dem Postulat gerechter Lastenverteilung zusammen: Das Postulat der rückschauenden Betrachtung soll einem möglichst gerechten Interessenausgleich zwischen Allgemeinheit und Individuum dienen, wobei anders als bei der Beseitigungspflicht die Entscheidung nicht mehr vom Erfordernis einer schnellen Gefahrenabwehr geprägt wird und umfassende Aufklärungsarbeit geleistet werden kann.
IV. Auswirkungen der getrennten Betrachtung der Pflichten auf die Störereigenschaft — Der weite und der enge Zustandsstörerbegriff des BayVGH Nachdem nun für den Störer bei Anscheinsgefahr dargestellt wurde, daß Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht bei einem einzelnen Störer getrennt betrachtet werden können, soll nun untersucht werden, ob eine getrennte Betrachtung nicht auch außerhalb dieses Sonderfalls möglich ist und ob dies Auswirkungen auf den Störerbegriff hat. Einen Ansatz für die Prüfung dieser Frage bietet die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 8.9.1983, die sich mit den Pflichten des Kfz-Halters befaßte, dessen Fahrzeug von Dritten verbotswidrig geparkt wurde 42. In dem Beschluß wurde das Problem des Verhältnisses von Effektivitätspostulat und Postulat gerechter Lastenverteilung erkannt, jedoch ein Lösungsweg eingeschlagen, der mit der materiellen Polizeipflicht als Rechtsgrundlage der Störereigenschaft nicht vereinbar ist. Um den Beschluß vom 8.9.1983 besser in das System des Polizeirechts einordnen zu können, sollen zunächst die polizeirechtlichen Pflichten des Kfz-Halters dargestellt werden.
1. Der Kfe-Halter
als Zustandsstörer
Die Polizei oder der durch sie beauftragte Unternehmer führt beim Abschleppen verbotswidrig geparkter Kraftfahrzeuge eine Tätigkeit aus, die der Störer (Fahrer, Halter oder Eigentümer) selbst vorzunehmen hätte, nämlich die Entfernung des Kraftfahrzeugs 43. Insofern spielt auch hier
4 2 4 3
BayVGH, Beschl. v. 08.09.1983, BayVBl 1984, 16.
BayVGH, Urt. v. 17.10.1988, NVwZ-RR 1989, 298; OVG Bremen, Urt. v. 17.12.85, DAR 1989,159; umfassende weitere Nachweise der Rechtsprechung bei Knauf, Gesamtschuld und Polizeikostenrecht, S. 29 f.; zu den mit dem Abschleppen von Kraftfahrzeugen verbundenen polizeirechtlichen Problemen auch Hiltl, Diss. Regensburg, und Wegmann, BayVBl 1984,
116
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
die Frage eine Rolle, ob die Kostentragungspflicht Surrogat der Beseitigungpflicht ist. Verbotswidrig geparkte Kraftfahrzeuge stellen eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar 44 . Dabei kommt es auch nicht darauf an, ob durch das Falschparken, z.B. in einer Fußgängerzone, eine konkrete Störung des allgemeinen Fußgängerverkehrs durch Behinderung oder Gefährdung von Fußgängern verursacht wurde 45. Es genügt, daß eine straßenverkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeit vorliegt 46, wobei jedoch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten ist 47 . Der Aufgabenbereich der Polizei ist eröffnet. Befugnisnorm ist regelmäßig die polizeiliche Generalklausel (Art. 11 BayPAG). Nach anderer Ansicht liegt eine Sicherstellung (Art. 21 Nr. 1 BayPAG) vor. Auf die Frage, ob es sich beim Abschleppen eines Kfz nach Polizeirecht um eine Sicherstellung handelt oder nicht, braucht im vorliegenden Zusammenhang nicht eingegangen zu werden48; dies ist für die Frage der Kostentragungspflicht unerheblich, da bei einer Sicherstellune ebenfalls Handlungsstörer und Zustandsstörer Kostenschuldner sind49. Falls Fahrer, Halter oder Eigentümer nicht erreichbar sind, kann die Behörde im Wege der unmittelbaren Ausführung einen Unternehmer beauftragen, das
685, jeweils m.w.N.; zu den zivilrechtlichen Aspekten siehe m.w.N. Forster, Das von Privatpersonen veranlaßte Abschleppen, Diss. Regensburg, mit Nachweisen auch zur polizeirechtlichen Problematik (S. 150 ff.). 4 4 BayVGH, Beschl. v. 23.05.84, BayVBl 1984,559, 560, 561 f.; BayVGH, Urt. v. 17.10.88, NVwZ-RR 1989, 298; OVG Münster, Urt. v. 21.05.71, DVBl 1973, 922; OVG Münster, Urt. v. 13.11.74, DVBl 1975, 588; BayVGH, Urt. v. 04.10.1989, BayVBl 1990, 433, 434; BayVGH, Urt. v. 20.02.1990, DÖV 1990, 483, 484; HessVGH, Urt. v. 22.05.1990, NVwZ-RR 1991, 28. 4 5
BayVGH, 23.05.84, BayVBl 1984, 559, 561 f.; zustimmend, Köhler, BayVBl 1984, 630, 631; BayVGH, Urt. v. 04.10.89, NZV 1990, 47; OVG Münster, Urt. v. 16.02.82, NJW 1982, 2277; OVG Koblenz, Urt. v. 15.03.88, NVwZ 1988, 658, 659; VGHBW, Urt. v. 15.01.1990, DÖV 1990, 482, 483; HessVGH, Urt. v. 22.05.1990, NVwZ-RR, 1991, 28. 4 6
BayVGH, Urt. v. 18.07.78, BayVBl 1979, 307, 308; BayVGH, Urt. v. 17.10.88, NVwZRR 1989, 298; OVG Bremen, Urt. v. 17.12.85, DAR 1986, 159; zum Versperren von Grundstücksausfahrten siehe VG Freiburg, Urt. v. 23.09.86, VB1BW 1987, 472. 4 7
Darauf weist besonders Geiger, BayVBl 1983, 10, 11 hin; siehe auch BayVGH, Urt. v. 16.12.87, NVwZ 1988, 657, 658. 4 8
Siehe dazu m.w.N. Samper/Honnacker, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 4 zu Art. 24 BayPAG; Berner/Köhler, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 9 zu Art. 24 BayPAG; Hiltl, Die Entfernung von Kfz, S. 46 ff., für den beide Befugnisnormen für das Entfernen von Kfz geeignet sind. Welche Befugnisnorm eingreife, bestimme sich neben den Tatbestandsvoraussetzungen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (S. 67); aus der Rspr. BayVGH 23.5.1984, BayVBl 1984,559 mit Anmerkung Köhler, sowie BayVBl 1984,631; BayVGH, Urt. v. 04.10.1989, BayVBl 1990, 433, 434; BayVGH, Urt. v. 20.02.1990, DÖV 1990, 483, 484. 4 9
Samper/Honnacker,
Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 2 zu Art. 54a BayPAG.
1. Kapitel: Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht
117
Kraftfahrzeug zu entfernen 50. Fahrer, Halter oder Eigentümer sind dann als Handlungs- bzw. Zustandsstörer potentielle Kostenschuldner, an die ein Leistungsbescheid gerichtet werden kann51. Das Ermessen der Polizei ist bei der Heranziehung eines Störers zu den Kosten eingeschränkt. Sie muß - nachdem die Gefahr beseitigt und somit das Effektivitätspostulat nicht mehr maßgeblich ist - erst versuchen, den Fahrer des verbotswidrig geparkten Kraftfahrzeugs ausfindig zu machen und als Handlungsstörer in Anspruch zu nehmen. Erst wenn zumutbare Nachforschungen zu keinem Ergebnis führen, kann sie sich an den (anhand der Zulassung feststellbaren) Halter oder den Eigentümer als Zustandsstörer wenden52.
2. Der Beschluß des BayVGH vom 8.9.1983 In der Entscheidung ging es um die Kostentragungspflicht eines KfzHalters und -Eigentümers, dessen Fahrzeug von einem Dritten in eine störende Lage versetzt worden war. Dieser wurde vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof nicht als Zustandsstörer im engeren Sinn eingestuft, da nicht die Sache als solche störte, sondern eine andere Person mit ihrer Hilfe oder durch ihre Benützung die Gefahr verursacht hatte. Die Zustandsverantwortlichkeit setze voraus, daß eine Gefahr von einer Sache ohne menschliches Zutun ausgehe53. Diese Entscheidung wurde weitgehend abgelehnt54; auch der erkennende Senat rückte in einer späteren Entscheidung wieder davon ab 55 . Von Interesse an dem Beschluß des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 8.9.1983 ist im vorliegenden Zusammenhang jedoch die unterschiedliche Behandlung von Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht: Der Senat differenziert im Hinblick auf das Effektivitätspostulat zwischen engem und weitem Zustandsstörerbegriff: Zur Gefahrenabwehr könne auch
5 0
BayVGH, Urt. v. 17.10.88, NVwZ-RR 1989, 298.
5 1
BayVGH, Urt. v. 18.07.78, BayVBl 1979, 307; BayVGH Urt. v. 17.10.88, NVwZ-RR 1989, 298 f.; OVG Bremen, Urt. v. 17.12.85, DAR 1986, 159; BayVGH, Urt. v. 04.10.1989, BayVBl 1990, 433, 434. 5 2
Geiger, BayVBl 1983,10,12 f.
5 3
BayVGH, Beschl. v. 08.09.1983, BayVBl 1984,16.
5 4
Z.B. Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 97; Bon, Verantwortlichkeit, S. 177 ff.; Kränz, BayVBl 1985, 301. 5 5
BayVGH, Beschl. v. 01.07.1986, BayVBl 1986, 625, 626.
118
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
der für den Zustand der Sache verantwortliche Eigentümer einer durch einen nicht schnell ermittelbaren Dritten in eine störende Lage gebrachten und dann verlassenen Sache in Anspruch genommen werden. Diese auf Effektivitätsgründen der Gefahrenabwehr beruhende Erweiterung der Zustandsverantwortlichkeit gelte jedoch nicht für den Fall, daß nach Abwehr der Gefahr die Kosten hierfür vom Verantwortlichen nach Art. 9 Abs. 2 Satz 1 BayPAG verlangt werden sollen. Hier gelte allein der logische, engere Begriff der Zustandsstörerverantwortlichkeit, wenn für die Polizei bei gehöriger Überlegung, für die nun Zeit vorhanden sei, erkennbar sei, daß die Sache durch menschliches Verhalten in den störenden Zustand gebracht worden ist 56 . Entscheidend für die Pflichten des Zustandsstörers ist nach Ansicht des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs die Effektivität der Gefahrenabwehr. Der Grundsatz der Effektivität präge das Polizeirecht und rechtfertige das Vorgehen gegen den Eigentümer und Halter als Zustandsstörer. Bei der Kostentragungspflicht spiele jedoch der Grundsatz der Effektivität der Gefahrenabwehr keine Rolle mehr, so daß die Polizei verpflichtet sei, den Handlungsstörer zu ermitteln und heranzuziehen. Das allgemeine Rechtsgefühl gebiete die vorrangige Inanspruchnahme des Verhaltensverantwortlichen57. Auch von dieser getrennten Betrachtung von Beseitigungs- und Kostentragungspflicht ist der erkennende Senat in seiner Entscheidung vom 1.7.1986 wieder abgerückt. Die Kostenhaftung wird darin ausdrücklich als "Surrogat der Eigenbeseitigung11 bezeichnet58.
3. Bewertung Dem Beschluß des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 8.9.1983 ist insoweit zuzustimmen, als festgestellt wird, daß die Beseitigungspflicht dem Postulat schneller und effektiver Gefahrenabwehr unterliegt, dieser Gesichtspunkt jedoch bei der Kostentragungspflicht keine Rolle mehr spielt.
5 6
BayVGH, Beschl. v. 08.09.1983, BayVBl 1984,16.
5 7
BayVGH, Beschl. v. 08.09.1983, BayVBl 1984, 16 f. Auch der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg lehnte jüngst eine zwangsläufige Kostenersatzpflicht des Störers ab und führte aus, daß das Abschleppen eines Kraftfahrzeugs als unmittelbare Ausführung aus Gründen einer wirksamen Gefahrenabwehr rechtmäßig, eine Kostenbelastung des Halters in bestimmten, atypischen Fällen wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit jedoch rechtswidrig sei (VGHBW, Urt. v. 17.09.1990, DÖV 1991, 163, 164 f.). 5 8
BayVGH, Besch, v. 01.07.1986, BayVBl 1986, 625, 626.
1. Kapitel: Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht
119
Die vom Senat getroffene Unterscheidung zwischen "engem" und "weitem" Zustandsstörerbegriff ist jedoch abzulehnen: Es gibt keine zwei Zustandsstörerbegriffe. Maßgeblich für die Zustandsstörereigenschaft ist allein die materielle Polizeipflicht 59. Das Postulat rückschauender Betrachtung beeinflußt nicht den Störerbegriff selbst, sondern nur die Folgen der Inanspruchnahme im Hinblick auf das Vermögen. Auch die Meinung, der Gewalthaber sei nicht Zustandsstörer, wenn nicht die Sache als solche störe, sondern eine Person mit ihrer Hilfe oder durch ihre Benützung als Werkzeug die Gefahr verursacht habe, ist abzulehnen. Für die Zustandsstörerverantwortlichkeit ist lediglich die Tatsache von Bedeutung, daß von einer Sache eine Gefahr ausgeht. Auf die Ursache der Gefahr kommt es nicht an 60 . Zu dem Beschluß des Senats vom 1.7.1986 ist zu bemerken, daß zwar der falsche Weg der Privilegierung des Eigentümers, dessen Sache durch Dritte in den störenden Zustand versetzt wurde, berichtigt, dabei aber auch die zutreffende Überlegung, daß Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht getrennt betrachtet werden müssen, verworfen wurde.
4. Zwischenergebnis Auch bei einem einzelnen Störer können Beseitigungs- und Kostentragungspflicht getrennt betrachtet werden. Dies bedeutet jedoch nicht, daß es einen "engen" und einen "weiten" Störerbegriff gibt. Die Störereigenschaft richtet sich allein nach der materiellen Polizeipflicht. Die Kostentragungspflicht ist nicht Surrogat der Beseitigungspflicht, sondern unterliegt einer gesonderten Betrachtung, wobei Effektivitätsgesichtspunkte keine Rolle mehr spielen. Maßgeblich ist das Postulat gerechter Lastenverteilung, das nicht nur im Verhältnis der Störer untereinander, sondern auch im Verhältnis von Beseitigungspflichtigem und Allgemeinheit gilt. Die Kostentragungspflicht wird aus einer ex-post-Perspektive ermittelt. Bevor auf Rechtsgrund und Umfang der Kostentragungspflicht eingegangen wird, soll dargestellt werden, daß eine getrennte Betrachtung auch schon zur Lösung der Altlasten-Problematik, allerdings mit unzureichender Begründung, vorgeschlagen wurde. Die Mängel der Begründung weisen jedoch den Weg zumrichtigenAnsatzpunkt zur Lösung der Frage nach der Kostentragungspflicht.
5 9
Gegen eine Zweiteilung auch Hiltl, Die Entfernung von Kfz, S. 93 f.
6 0
S.a. Erster Teil, Erstes Kapitel, II. 4.
120
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
V. Vorschläge einer getrennten Betrachtung von Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht in den Altlasten-Fällen 1. Darstellung Eine getrennte Betrachtungsweise wurde auch schon für die Lösung der Altlasten-Fälle vorgeschlagen: Hohmann und Knopp sehen Art. 14 Abs. 2 GG als Rechtsgrund der Zustandsstörereigenschaft an und lehnen eine Kostentragungspflicht ab, wenn eine Abwägung ergibt, daß die Gefahr außerhalb der Risikosphäre des Eigentümers liegt 61 und dessen Inanspruchnahme somit die Sozialpflichtigkeit übersteige62. Sie wenden sich jedoch gegen die Auffassung, der Grundstückseigentümer, der selbst Opfer eines unbekannten Handlungsstörers geworden sei, könne deshalb nur als Nichtstörer in Anspruch genommen werden. Dadurch werde die Gefahrenabwehr erschwert und möglicherweise vereitelt, da regelmäßig das Vorliegen der engen Tatbestandsmerkmale der Norm über die Inanspruchnahme des Nichtstörers zu prüfen wäre. Wegen des im Polizeirecht herrschenden Gedankens einer schnellen und effektiven Gefahrenabwehr wird von ihnen die Zustandshaftung nicht in Frage gestellt. Zudem hätte der Grundstückseigentümer als Nichtstörer dann einen Entschädigungsanspruch nach Polizeirecht. Die Behörden seien gehalten, nach einer ex-ante-Betrachtung polizeiliche Maßnahmen gegen den Zustandsstörer zu richten63. Hohmann und Knopp empfehlen daher, den Grundstückseigentümer zumindest bezüglich der Beseitigung des kontaminierten Erdreichs als Zustandsstörer anzusehen64. Von der Beseitigungspflicht sei jedoch die Frage der Kostentragungspflicht zu trennen. Auf der "Sekundärebene" der Kostentragungspflicht ist nach ihrer Auffassung eine zusätzliche Abwägung unter Berücksichtigung gesetzlicher Wertungen und des Art. 14 GG erforderlich, um zu klären, ob nicht die Gesamtheit der Steuerzahler anstelle des betroffenen Grundstückseigentümers belastet werden müsse 65 . Knopp erkennt jedoch auch, daß die Belastung mit Kosten nicht einen Eingriff in das störende Grundstückseigentum, sondern in das Vermögen
6 1
Knopp, BB 1989,1425,1428 f.
6 2
Hohmann, NJW 1989,1254,1256; ders., DVB1 1984, 997, 999.
6 3
Knopp, BB 1989,1425,1428; Hohmann, DVB11984, 997, 998.
6 4
Hohmann, DVB11984, 997, 998; Knopp, BB 1989, 1425, 1428 ff.
6 5
Hohmann, DVB1 1984, 997, 998 f.; Knopp, BB 1989,1425, 1429.
1. Kapitel: Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht
121
des Eigentümers darstellt, daß es sich also um eine Geldleistungspflicht handelt66. Trotzdem will er - da er in Art. 14 Abs. 2 GG den Rechtsgrund der Zustandsstörereigenschaft sieht - auch die Begrenzung der Kostentragungspflicht daraus herleiten. Die Verbindung mit dem Eigentumsgrundrecht stellt er dadurch her, daß er auf das Übermaßverbot zurückgreift: Die Eigentumsgarantie sei nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bei reinen Geldleistungspflichten dann beeinträchtigt, wenn die Geldleistungspflicht den Pflichtigen übermäßig belaste67. In bestimmten Altlastenfällen sei eine solche übermäßige Belastung gegeben68.
2. Kritik Hohmann und Knopp gehen richtigerweise von der Notwendigkeit und Zulässigkeit einer getrennten Betrachtung von Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht auch in den Altlasten-Fällen aus. Allerdings leiten sie die Zustandsstörereigenschaft und auch die Begrenzung der Kostentragungspflicht aus Art. 14 Abs. 2 GG ab. Sofinden sie zwar die Lösung der Altlasten-Problematik, die getrennte Betrachtung von Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht, erkennen jedoch nicht die Konsequenzen dieses Ansatzes für die Begründung: Wenn Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht richtigerweise getrennt zu betrachten sind, ist es nicht notwendig, sie aus einem einzigen Rechtsgrund, der Sozialpflichtigkeit des Eigentums, herzuleiten. Rechtsgrund der Beseitigungspflicht des Zustandsstörers ist nicht das Eigentum, sondern die materielle Polizeipflicht. Knopp erkennt zwar das eigentliche Problem, daß die Kostentragungspflicht, da sie eine Geldleistungspflicht ist, eben nicht den störenden Eigentumsgegenstand, sondern das Vermögen betrifft. Er vermag dieses Problem jedoch wegen der Fixierung auf Art. 14 Abs. 2 GG und der Annahme einer grundsätzlichen Konnexität von Beseitungspflicht und Kostentragungspflicht nicht zu lösen: Da er den Rechtsgrund der Zustandsstörerverantwortlichkeit in Art. 14 GG sieht, sucht er auch die Begrenzung der Kostentragungspflicht daraus herzuleiten. Die Kostentragungspflicht als Geldleistungspflicht ist jedoch ein Eingriff in das Vermögen. Damit hat sie nichts mit dem Eigentumsgrundrecht an
6 6
Knopp, BB 1989,1425,1429.
6 7
Vgl. z.B. BVerfG, Urt. v. 24.07.1962, E 14, 221, 241; Beschl. v. 24.09.1965, E 19, 119, 129; Beschl. v. 14.05.1968, E 23, 289, 315. 6 8
Knopp, BB 1989, 1425, 1429.
122
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
der störenden Sache zu tun. Da das Vermögen nach herrschender Meinung auch nicht vom Schutzbereich des Art. 14 GG umfaßt wird 69 ist das Eigentumsgrundrecht auch nicht sedes materiae für Rechtsgrund und Grenzen der Kostentragungspflicht.
VI. Ergebnis: Die Unabhängigkeit von Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht als Lösung der Opfer-Problematik Wie gezeigt wurde, hängt die Störereigenschaft weder von den Kosten noch von einer Nutzen-Lasten-Abwägung oder von Zurechnungskriterien im Rahmen einer Risikosphärenverteilung, wie z.B. der Vorhersehbarkeit ab, sondern allein von der materiellen Polizeipflicht. Die materielle Polizeipflicht unterliegt jedoch dem im Polizeirecht geltenden Effektivitätspostulat und kann somit nur eine Pflicht, die der Gefahrenbeseitigung dient, nicht jedoch eine Haftungs- und Schadensausgleichsregelung sein. Die Kosten der Beseitigung können daher gesondert betracht werden. Ergibt sich die Störereigenschaft nicht aus den Kosten, so ist umgekehrt auch die Kostentragungspflicht nicht von der materiellen Polizeipflicht abhängig. Sie ist weder ein Surrogat der Beseitigungspflicht, noch kann von einer Konnexität von materieller Polizeipflicht und Kostentragungspflicht gesprochen werden. Beide Pflichten unterliegen verschiedenen Prinzipien und müssen daher gesondert betrachtet und getrennt behandelt werden. Die Kosten der Beseitigung sind zwingende Folge und Begleiterscheinung der Beseitigung. Sie sind der Beseitigung insoweit immanent. Diese faktische Verbindung begründet jedoch keine rechtliche Untrennbarkeit, da die Kosten nicht dem Effektivitätspostulat des Polizeirechts unterliegen. Sie müssen - insbesondere in den Opfer-Fällen - gesondert unter Berücksichtigung des Postulats gerechter Lastenverteilung und des Postulats rückschauender Betrachtung untersucht werden. Dabei ist nicht auf Art. 14 GG Bezug zu nehmen. Das Eigentumsgrundrecht ist weder Rechtsgrund der Zustandsstörereigenschaft und der Beseitigungspflicht des Zustandsstörers noch - wie zu zeigen sein wird - Grund einer ausnahmsweisen Begrenzung oder eines Wegfalls der Kostentragungspflicht des Zustandsstörers. Eine Untersuchung der Kostentragungspflicht muß vielmehr davon ausgehen, daß der Störer die entstandenen Kosten der Gefahrenabwehr nicht automatisch zu tragen hat, sondern daß ihm nach dem Wortlaut der
6 9
Dazu ausführlich unten Dritter Teil, Zweites Kapitel, IV. 2.
1. Kapitel: Kostentragungspflicht und Beseitigungspflicht
123
Polizeigesetze nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme Kosten (Gebühren und Auslagen) auferlegt werden können. Wesentlicher Anknüpfungspunkt für eine Prüfung muß sein, daß die Auferlegung von Kosten eine Minderung des Vermögens bewirkt und somit einen Eingriff in das Vermögen darstellt. Die Frage, warum und unter welchen Voraussetzungen ein solcher Eingriff möglich ist und wann diese Minderung des Vermögens nicht mehr zulässig ist, soll im nächsten Kapitel untersucht werden.
Zweites Kapitel
Rechtsgrund und Grenzen der Kostentragungspflicht nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme L Einleitung Bisher wurde entsprechend der Problemstellung erarbeitet, daß die Kostentragungspflicht nicht Surrogat oder Annex der Beseitigungspflicht ist und der beseitigungspflichtige Eigentümer, obwohl er Zustandsstörer ist, nicht immer kostentragungspflichtig ist. Die Arbeit wäre jedoch unvollständig, wollte man sich mit dem Ergebnis zufriedengeben, daß beide Pflichten getrennt betrachtet werden können, da sie verschiedenen Prinzipien unterliegen, und der Zustandsstörer möglicherweise beseitigungs-, nicht jedoch kostentragungspflichtig ist. Auch der Hinweis auf den Grundsatz gerechter Lastenverteilung und das Postulat rückschauender Betrachtung als Kriterien zur Bestimmung der Kostentragungspflicht mag zwar einen Weg zur Lösung der Altlasten-Fälle in der Praxis aufzeigen, kann jedoch nicht die grundsätzliche Frage nach dem Umfang der Kostentragungspflicht nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme beantworten. Der Frage nach Rechtsgrund und Grenzen dieser Kostenerhebung soll nunmehr nachgegangen werden, wobei besonderes Augenmerk darauf gelegt wird, nach welchen Kriterien sich die Kostentragungspflicht des Eigentümers eines kontaminierten Grundstücks richtet.
II. Die Anwendung gebührenrechtlicher Grundsätze auf die Kostenerhebung nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme 1. Problemstellung Beim Einsatz von Polizeikräften entstehen regelmäßig Kosten. Polizeibeamte müssen an den Einsatzort gebracht, andere Behörden müssen informiert, Absperrungen müssen aufgebaut, manchmal müssen Sachverständige befragt werden, gegebenenfalls muß ein Unternehmer beauftragt
2. Kapitel: Rechtsgrund und Grenzen
125
werden, eine Sicherungsmaßnahme durchzuführen. Die Polizei hat dadurch Ausgaben. Klärungsbedürftig ist, in welchen Fällen und warum die Polizei- und die Sicherheitsbehörden, wenn sie zur Gefahrenabwehr tätig werden, diese ihnen entstandenen Kosten ersetzt verlangen können und ob dabei ein Unterschied zwischen den bei der Gefahrenabwehr im Wege der unmittelbaren Ausführung und Ersatzvornahme entstehenden und anderen Polizeikosten zu machen ist. Damit ist die Frage nach dem Rechtsgrund der Kostentragungspflicht des Störers aufgeworfen.
2. Polizeikosten
und Kostenrecht
a) Die Funktion des Polizeikostenrechts In den Polizeigesetzen werden Kosten nur an wenigen Stellen erwähnt. Kostenregelungen finden sich in den Allgemeinen Vorschriften (Kostentragung nach unmittelbarer Ausführung - Art. 9 Abs. 2 BayPAG), bei den Spezialbefugnissen (Kosten nach Sicherstellung, Verwahrung, Unbrauchbarmachung und Verwertung sichergestellter Sachen - Art. 27 Abs. 3 BayPAG - ) und in den Vorschriften über die zwangsweise Durchsetzung nichtbefolgter Polizeiverwaltungsakte (Kosten nach Ersatzvornahme Art. 34 Satz 2 BayPAG -, Kosten nach unmittelbarem Zwang - Art. 37 Abs. 3 BayPAG - ) 1 . Angesichts des Zwecks des Polizeirechts, eine schnelle und effektive Gefahrenabwehr zu gewährleisten, ist das seltene Vorkommen von Kostenvorschriften nicht verwunderlich: Polizeirecht ist Gefahrenabwehrrecht, Ausgleichsansprüche und sonstige Lastenverteilungsvorschriften sind insofern nur zweitrangig. Daß sie trotzdem vereinzelt in die Polizeigesetze aufgenommen worden sind, rechtfertigt sich aus der Tatsache, daß behördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach allgemeinem Polizei- und Ordnungsrecht Anknüpfungspunkt der Kostentragungspflicht sind. Die Kostentragungspflicht selbst dient jedoch nicht mehr der schnellen und effektiven Gefahrenabwehr 2. Während sich Handlungs- und Duldungspflichten auf einen Zustand beziehen, in dem eine bestehende Gefahr noch abgewehrt werden muß, haben sich Ausgleichsansprüche an einer Sachlage
1
Nachweise zu den Polizeikostenvorschriften in den Bundesländern siehe Knauf\ Gesamtschuld und Polizeikostenrecht, S. 32 ff. 2
Berner/Köhler, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 7 zu Art. 54a BayPAG; Wegmann, BayVBl 1984, 685, 686; Schenke, NJW 1983,1882,1887.
126
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
zu orientieren, in der die Gefahr bereits beseitigt ist und in der es lediglich noch um eine angemessene Verteilung der Lasten der Gefahrenabwehr geht3. Polizeikosten werden erhoben, damit nicht der Allgemeinheit Ausgaben auf Dauer verbleiben, für die ein einzelner auf Grund Verursachung oder aus einem sonstigen Zurechnungsgrund aufkommen muß.
b) Aktuelle Probleme der Kostentragungspflicht und ihre Abgrenzung zum Gegenstand der Untersuchung Das Problem der Bezahlung polizeilichen Tätigwerdens spielte in den letzten Jahren vor allem bei der Kostenerhebung nach Maßnahmen unmittelbaren Zwangs4 sowie bei der Kostenerhebung nach Polizeieinsätzen bei privaten Großveranstaltungen und Demonstrationen5 eine Rolle. In diesen Fällen entstehen Kosten. Diese sind jedoch nicht Kosten einer vertretbaren Handlung. Sie resultieren nicht aus einer dem Kostenpflichtigen obliegenden Pflicht zur Abwehr einer konkreten Gefahr, die die Polizei an seiner Statt erfüllt hat, so daß sich die Frage, ob die Kostentragungspflicht Surrogat der Beseitigungspflicht des Störers ist, nicht stellt6. Die mit Polizeieinsätzen bei Demonstrationen und privaten Großveranstaltungen sowie mit der Anwendung unmittelbaren Zwangs verbundenen Fragen können und müssen daher hier nicht erörtert werden. Allerdings sind die im Zusammenhang mit diesen Problemen angestellten Überlegungen zur rechtlichen Einordnung des Polizeikostenrechts auch für das vorliegende Thema von Interesse.
c) Polizeikostenrecht und allgemeines Kostenrecht Bei Untersuchungen der Frage der Kostenerhebung nach Anwendung unmittelbaren Zwangs und nach privaten Großveranstaltungen und Demonstrationen wurde festgestellt, daß das Polizeikostenrecht dem
3
S.a. Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung, S. 57 f., 196 ff.
4
Siehe dazu m.w.N. Schenke, NJW 1983,1982,1888; Krekel, Kostenpflichtigkeit, S. 36 ff.; Erdmann, Kostentragung, S. 1 ff. 5 6
Siehe dazu m.w.N. Götz, DVBl 1984,14,16; Krekel, Kostenpflichtigkeit, S. 31 ff., 79 ff.
Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 330; ders., DVBl 1984,14,16 f.; Knemeyer, JuS 1988, 866, 868; Schenke, NJW 1983, 1882, 1883; auf die Frage, ob der Großveranstalter überhaupt Störer ist, soll hier nicht weiter eingegangen werden, siehe dazu m.w.N. Krekel, Kostenpflichtigkeit, S. 62 ff. und Schenke, NJW 1983,1883 f.
2. Kapitel: Rechtsgrund und Grenzen
127
Kostenrecht zuzuordnen ist und daß gebührenrechtliche Grundsätze, insbesondere der Grundsatz der individuellen Zurechenbarkeit, gelten7. Diese Verbindung wird auch durch die Vorschrift des Art. 54a BayPAG deutlich: Art. 3 des Kostengesetzes (Nichterhebung von Kosten) sei nicht anzuwenden, soweit das PAG die Erhebung von Kosten (Gebühren und Auslagen) bestimme. Im Umkehrschluß ergibt sich, daß Polizeikosten grundsätzlich dem Regime des Kostenrechts unterliegen8. Es soll nun geprüft werden, ob dies auch auf die Kostentragungspflicht nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme zutrifft.
3. Die Ansicht von der Sonderstellung der Polizeikosten nach unmittelbarer Ausphrung und Ersatzvornahme Es ist anerkannt, daß für Amtshandlungen der Gefahrenabwehr Gebühren erhoben werden können und daß auch polizeiliche Maßnahmen gebührenpflichtig sind9. Götz vertritt die Ansicht, die Kostentragungspflicht nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme sei eine Geldleistungspflicht eigener Art 1 0 . Gebührenrechtliche Vorschriften könnten für die Berechnung des Umfangs zwar eine Rolle spielen, es handle sich jedoch um ein aliud gegenüber Verwaltungsgebühr und Auslagenersatz". Er begründet dies damit, daß die Kostenerstattung auf dem Grundgedanken beruhe, daß Kosten einer Handlung der Polizei- und Ordnungsverwaltung auf denjenigen übergewälzt werden können, in dessen Rechte- und Pflichtenbereich die Handlung gehöre. Bei unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme werde dem Pflichtigen eine Handlung abgenommen, deren Vornahme aufgrund polizei- und ordnungsrechtlicher Pflicht seine Sache gewesen wäre 12. Die Kostentragungspflicht sei lediglich Surrogat der Beseitigungspflicht 13.
η Krekel, Kostenpflichtigkeit, S. 9 ff, 15 ff.; Erdmann, Kostentragung, S. 142 ff. jeweils m.w.N. ; zur Verbindung von Polizeirecht und Kostenrecht siehe Broß, DVBl, 1983, 377, 379; zum Grundsatz der individuellen Zurechenbarkeit s.u. ausführlich unter 4. ** Berner/Köhler, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 1 zu Art. 54a BayPAG. 9 Götz, DVBl 1984,14, 18 ff. Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 326. 11
Götz, DVBl 1984,14.
12
Götz, DVBl 1984, 14, 15.
13
Dazu schon oben Erster Teil, Erstes Kapitel, V. 2.
128
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
Dieser Ansicht ist jedoch nicht zu folgen. Beide Pflichten unterliegen verschiedenen Prinzipien und die Kostentragungspflicht dient nicht mehr der schnellen und effektiven Gefahrenabwehr 14. Für eine solche Betrachtung spricht im übrigen auch die Systematik des bayerischen Polizeikostenrechts und der Wortlaut des BayPAG, wenn in Art. 9 Abs. 2 und Art. 34 Abs. 1 BayPAG von "Kosten (Gebühren und Auslagen)" gesprochen wird und auf die Geltung des Kostengesetzes verwiesen wird. "Kosten" als Oberbegriff von Gebühren und Auslagen bezeichnet eine Abgabenart. Dieser für Einnahmen verwendete Oberbegriff ist identisch mit Gebühren im weiteren Sinn15. Gebühren (im engeren Sinn) und Auslagen unterscheiden sich in ihrer Berechnungsweise: Gebühren sind durchschnittliche Entgelte für Amtshandlungen, Auslagen dienen der Erstattung von Aufwendungen, die bei konkreten Einzelmaßnahmen entstanden sind16. Die zu fordernden Gebühren sind Entgelte für Amthandlungen der Polizei und erfassen z.B. Personal- und Sachaufwand und allgemeinen Verwaltungsaufwand. Auslagen sind die in Geld ausdrückbaren Aufwendungen, die der Polizei bei der Durchführung der Maßnahme entstanden sind (z.B. Fernsprechgebühren, Postgebühren sowie die durch Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen entstehenden Aufwendungen17). Dazu gehört auch das Entgelt für einen Unternehmer, der mit der Ausführung beauftragt wurde1 . Die Erhebung von "Kosten (Gebühren und Auslagen)" nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme stellt somit die Auferlegung einer öffentlich-rechtlichen Geldleistungspflicht dar, die dazu dient, entstandene Kosten (Ausgaben) zu decken. Der Kostenersatz ist keine eigene Kostenart, sondern läßt sich da "Kosten (Gebühren und Auslagen)" verlangt werden - unter das gebührenrechtliche System von Gebühren im engeren Sinn und Auslagen subsumieren19.
14 Vgl. oben Dritter Teil, Erstes Kapitel, s.a. Wegmann, BayVBl 1984, 685, 686; Schenke, NJW 1983,1882,1887; Berner/Köhler, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 7 zu Art. 54a BayPAG; aus der Rspr. BayVGH Beschl. v. 08.09.83, BayVBl 1984, 16, sowie VGHBW, Urt. v. 17.09.1990, DÖV 1991, 163, 164 f. 15
Wilke, Gebührenrecht und Grundgesetz, S. 115.
16
Wilke, Gebührenrecht und Grundgesetz, S. 115; Kirchof,
Die Höhe der Gebühr, S. 20.
17
Vgl. Art. 14 BayKostG; s.a. § 2 PolKostV vom 02.08.1983, GVB1, S. 555; Berner/Köhler, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 1 zu Art. 54a BayPAG. 18
Knemeyer, JuS 1988, 866, 867; Samper/Honnacker, Art. 9 BayPAG und Rdnr. 7 zu Art. 34 BayPAG 19
S.a. Knemeyer, JuS 1988, 866, 867.
Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 8 zu
2. Kapitel: Rechtsgrund und Grenzen
129
Dies bedeutet auch, daß auch für die Bestimmung des Kostenschuldners nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme gebührenrechtliche Grundsätze gelten. Dabei ist insbesondere der im Gebührenrecht geltende Grundsatz der individuellen Zurechenbarkeit zu beachten20. Auch der beseitigungspflichtige Störer ist nur dann kostentragungspflichtig, wenn ihm die Leistung der Polizei individuell zurechenbar ist. 4, Das Merkmal der individuellen
Zurechenbarkeit
a) Die individuelle Zurechenbarkeit im Gebührenrecht Die individuelle Zurechenbarkeit ist Hauptmerkmal der Gebühr 21 und bedeutet, daß zwischen öffentlicher Leistung und Gebührenschuldner eine spezifische Beziehung bestehen muß22. Die Gebühr hat ihren Grund nicht wie die Steuer in dem allgemeinen Finanzbedarf des Staates, sondern in einer speziellen Leistungsbeziehung zwischen Gebührenschuldner und Gebührengläubiger23. Fehlt dieser Charakter, handelt es sich nicht um eine Gebühr. Eine bloße Erfüllung öffentlicher Aufgaben stellt keine Leistung des Abgabeberechtigten zugunsten des Abgabepflichtigen dar 24 . Dieser hat seinenfinanziellen Beitrag dazu schon durch die Bezahlung der Steuern erbracht. Die spezielle Beziehung zwischen Leistung und Schuldner kann an die Veranlassung, an eine Verantwortlichkeit, an ein Interesse oder auch an
20 Es wird hier nicht bestritten, daß die nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme erhobenen Kosten möglicherweise eine Sonderrolle im Hinblick auf § 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO spielen, indem sie nicht zu den dort genannten öffentlichen Abgaben und Kosten gehören (so z.B. VGHBW, Beschl. v. 09.06.1986, NVwZ 1986, 933; a.A. BayVGH, Beschl. v. 24.10.1989, BayVBl 1990, 435; zu diesem Problemkreis ausführlich Menens, Kostentragung, S. 62 ff.). Dieser Streit ist jedoch im vorliegenden Zusammenhang insoweit unbeachtlich, als dies nicht als Argument dafür herangezogen werden kann, gebührenrechtliche Grundsätze nicht 2 1 anzuwenden, da es sich hier um ein veiwaltungsprozeßrechtliches Sonderproblem handelt. Kirchhof ; Die Höhe der Gebühr, S. 16 ff.; Wilke, Gebührenrecht und Grundgesetz, S. 86 ff., 151; Krekel, Kostenpflichtigkeit, S. 15 f.; Erdmann, Kostentragung, S. 152 ff.; ausführlich m.w.N. siehe auch Ott, Die gemeindliche Straßenreinigung, S. 141 ff.; zur Gebührendefinition siehe BVerfG, Beschl. v. 06.02.1979, E 50, 217,226 im Anschluß an Wilke, Gebührenrecht und Grundgesetz, S. 82 ff.; s.a. BVerfG (Vorprüfungsausschuß), Beschl. v. 22.03.84, NJW 1984,1871; ebenso BGH, Urt. v. 19.06.86, DVBl 1986,1055; Stober, JA 1988, 253; Henneke, Jura 1990,113. 2 2
Wilke, Gebührenrecht und Grundgesetz, S. 88.
2 3
Stober, JA 1988, 254; Henneke, Jura 1990,113.
2 4
BVerfG, Beschl. v. 12.10.1978, E 49, 343,353 f. unter Bezugnahme auf BVerfG, Beschl. v. 04.02.1958, E 7, 244, 254. 9 Griesbeck
130
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
einen zugeflossenen Vorteil anknüpfen 25. Entscheidend ist, daß der Gebührenpflichtige, aus welchen Gründen auch immer, der Leistung näher steht als die Allgemeinheit, so daß von einer besonderen Inanspruchnahme der Verwaltung gesprochen werden kann26. Diese besondere Leistungsbeziehung, die über das gegenüber der Allgemeinheit bestehende Maß hinausgeht, rechtfertigt die Erhebung einer Gebühr 27.
b) Die individuelle Zurechenbarkeit im Polizeikostenrecht Das Erfordernis der individuellen Zurechenbarkeit gilt auch im Polizeirecht 28. Die Zurechenbarkeit entfällt nicht schon deshalb, weil bei der unmittelbaren Ausführung mit der Beseitigung der Gefahrenlage zugleich auch die Staatsaufgabe Gefahrenabwehr erfüllt wird 29 . Auch eine Gefahrenabwehrmaßnahme, die auch im öffentlichen Interesse liegt, kann individuell zurechenbar sein30. Die Gebühr ist vorteilsneutral. Gebühren können auch für nachteilige Amtshandlungen erhoben werden31. Die Gefahrenabwehr durch die Polizei ist dem Störer auch zurechenbar, wenn sie ihm mehr Nachteile als Vorteile bringt. Es ist zu untersuchen, worin die individuelle Zurechenbarkeit beim Zustandsstörer besteht. Bei der Beseitigung der Gefahr oder Störung durch die Polizei oder die Sicherheitsbehörden bzw. durch die von ihnen Beauftragten im Wege der unmittelbaren Ausführung oder Ersatzvornahme handelt es sich um eine öffentliche Leistung. Diese muß jedoch dem
Vgl. Wilke, Gebührenrecht und Grundgesetz, S. 85; Vogel, Festschrift für Willi Geiger, S. 536. 2 6
η
Vgl. Kloepfer,
AöR Bd. 97 (1972), 232, 251.
Im einzelnen ist vieles noch ungeklärt, dazu Vogel, Festschrift für Willi Geiger, S. 519 ff.
2 8
Erdmann, Kostentragung, S. 141,149 ff.; Krekel, Kostenpflichtigkeit, S. 15 f.; Götz, DVBl 1884,14,19. 2 9
Krekel, Kostenpflichtigkeit, S. 16 ff. m.w.N.; a.A.Albrecht, Festschrift für Rudolf Samper, S. 177; gegen Albrecht u.a. Broß, DVBl 1983, 377, 381 f.; Würtenberger, NVwZ 1983,192, 196; Erdmann, Kostentragung, S. 148. 3 0
Zum Verhältnis von öffentlichem Interesse und Einzelinteresse im Gebührenrecht vgl. BVerwG, Urt. v. 08.12.1961, E 13, 214, 219. 31
Wilke, Gebührenrecht und Grundgesetz, S. 39, 69 m.w.N.; Henneke, Jura 1990, 113 m.w.N.;Götz, DVBl 1984, 14, 19; Kühling, DVBl 1981, 313, 316; Schenke, NJW 1983, 1882, 1889; Krekel, Kostenpflichtigkeit, S. 55; Erdmann, Kostentragung, S. 156; BVerwG, Urt. v. 27.06.1956, E 5, 136, 142; BVerwG, Urt. v. 08.12.1961, E 13, 214, 219.
2. Kapitel: Rechtsgrund und Grenzen
131
Zustandsstörer, der nach der Gefahrenbeseitigung für die Zahlung der Kosten in Anspruch genommen wird, auch individuell zurechenbar sein.
ΙΠ. Die individuelle Zurechenbarkeit der Leistung beim Zustandsstörer 2. Die Beseitigungspflicht
als Zurechnungskriterium
Dem Gesetzgeber ist für die Herstellung der individuellen Zurechenbarkeit ein sehr weites Ermessen eingeräumt32. Wilke sieht die Grenze erst dort, wo keine spezifische Beziehung zwischen Leistung und Gebührenschuldner mehr erkennbar ist 33 . Für Gefahrenabwehrmaßnahmen nimmt er individuelle Zurechenbarkeit an, wenn bestimmte Maßnahmen bestimmte Personen betreffen 34. Anknüpfungspunkt für die Kostentragungspflicht des Zustandsstörers nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme könnte die Störereigenschaft und die damit verbundene Beseitigungspflicht sein. Diese Auffassung liegt der Annahme zugrunde, daß die Kostentragungspflicht Surrogat der Beseitigungspflicht ist 35 . Sie wurde oben schon aus materiell-rechtlichen Gründen abgelehnt. Gegen eine solche Auffassung sprechen jedoch auch Argumente aus kostenrechtlicher Sicht36: (a) Die durch Leistungsbescheid auferlegten Gebühren sind Abgaben, mithin öffentliche Geldlasten, die von Handlungspflichten (wie z.B. der Gefahrenbeseitigungspflicht) streng unterschieden werden müssen37. (b) Bei Handlungs- und Duldungspflichten einerseits und der Kostentragungspflicht andererseits werden unterschiedliche Rechte berührt:
3 2
BVerwG, Urt. v. 08.12.1961, E 13, 214, 221; Wilke,
Gebührenrecht und Grundgesetz,
S. 88. 3 3
Wilke, Gebührenrecht und Grundgesetz, S. 88.
3 4
Wilke, Gebührenrecht und Grundgesetz, S. 88, FN 184; ihm folgend Erdmann, Kostentragung, S. 153; Krekel, Kostenpflichtigkeit, S. 55; s.a. Friauf\ Festschrift für Hermann Jahrreiß, S. 60 f. 3 5
S.o. Erster Teil, Erstes Kapitel, V. 2.
3 6
Zu den Argumenten aus polizeirechtlicher Sicht siehe schon oben Zweiter Teil, Zweites Kapitel. 3 7
Zu den Abgaben als öffentliche Geldlasten im Gegensatz zu Natural- und Dienstleistungen siehe Stober, JA 1888, 250, 251.
132
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
Geldleistungspflichten betreffen das Vermögen, Handlungs- und Duldungspflichten dagegen berühren Art. 2 oder Art. 14 GG. Knemeyer macht darauf aufmerksam, daß eigenständige Grundrechtseingriffe vorlägen, die eigenständiger Rechtsgrundlagen bedürften 38. (c) Auch Polizeikostenrecht ist Kostenrecht. Das Kostenrecht orientiert sich anfinanziellen und wirtschaftlichen Kriterien. Damit hat das Kostenrecht als Lastenverteilungsrecht eine ganz andere Funktion als das Polizeirecht, bei dem es um eine schnelle und effektive Beseitigung einer konkreten Gefahr geht. Somit kann nicht automatisch von der Beseitigungspflicht (als einer der Abwehr einer bestehenden Gefahr dienenden Pflicht) auf die Kostentragungspflicht (als einer der gerechten Verteilung von Lasten dienenden Pflicht) geschlossen werden. Die Kostentragungspflicht ist eine öffentlichrechtliche Geldleistungspflicht, die, da die Gefahr im Zeitpunkt des Entstehens dieser Pflicht schon beseitigt ist, nicht deren Abwehr dient39. Damit kann also auch unter diesen Aspekten eine Kostentragungspflicht nicht Surrogat einer Beseitigungspflicht sein. Die bloße Störereigenschaft oder die Gefahrenabwehrpflicht ist somit nicht Zurechnungskriterium der Gebührenpflicht. 2. Die Veranlassung als Zurechnungskriterium Die Veranlassung ist anerkanntes und in den Kostengesetzen der Länder auch normiertes Zurechnungskriterium 40. Es ist das umfassendste der Gebührenerhebungsprinzipien 41. In Art. 2 Abs. 1 BayKostG wird als Kostenschuldner vorrangig derjenige genannt, der die Amtshandlung veranlaßt hat. Die Veranlassung einer Amtshandlung ist dann gegeben, wenn ein Antrag auf Vornahme gestellt wurde oder ein Tatbestand geschaffen wurde, der für das behördliche Tätigwerden ursächlich war 42 . Der Handlungsstörer hat die Kosten der Gefahrenabwehr zu tragen, weil er als Verursacher der Gefahr Veranlasser des polizeilichen Tätigwerdens
3 8
Knemeyer, JuS 1988, 866, 868.
3 9
Schenke, NJW 1983, 1882, 1887; Wegmann, BayVBl 1984, 685, 686; Berner/Köhler, Polizeiaufgabengesetz, Rdnr. 7 zu Art. 54a BayPAG. 4 0
Ausführlich mit Nachweis der Vorschriften Vogel, Festschrift für Willi Geiger, S. 518,
531 f. 4 1 M.w.N. Wilke, Gebührenrecht und Grundgesetz, S. 83 f., zugleich kritisch zum unklaren Inhalt dieses Kriteriums. 4 2
Erdmann, Kostentragung, S. 150 m.w.N.
2. Kapitel: Rechtsgrund und Grenzen
133
ist 43 . Die individuelle Zurechenbarkeit beim Handlungsstörer knüpft demnach nicht an seine Beseitigungspflicht oder seine Störereigenschaft an, sondern an die Veranlassung . Der Zustandsstörer ist gerade nicht Verursacher der Gefahr. Er hat in den Fällen der unmittelbaren Ausführung und Ersatzvornahme auch keinen Antrag auf Vornahme der Gefahrenabwehrhandlung gestellt. Seine "Veranlassung" könnte sich jedoch aus seiner Verantwortlichkeit für die Sache, von der eine Gefahr ausgeht, ergeben; dadurch "veranlaßt" er die Kosten der Beseitigung45. Das bloße Innehaben der Sachherrschaft kann jedoch nicht als Veranlassung im Sinne der Schaffung eines Tatbestandes, der für das polizeiliche Einschreiten ursächlich war, angesehen werden. Die Tatsache, daß von einer Sache eine Gefahr ausgeht, ist dem Zustandsstörer nicht als Veranlassung im Sinn des Kostenrechts zuzurechnen46.
5. Der aus der Sachherrschaft resultierende Zurechnungskritenum
Nutzen als
Gebühren müssen nicht an die Veranlassung anknüpfen. Es gibt keinen allgemeinen Rechtsgrund, daß nur dem Veranlasser einer Leistung der Verwaltung Gebühren auferlegt werden dürfen 47. Die Möglichkeit, aus einer Sache, über die man tatsächliche oder rechtliche Herrschaft hat, Nutzen zu ziehen, könnte Grund der Auferlegung des Risikos sein, die Kosten für die Beseitigung der von der Sache ausgehenden Gefahr tragen zu müssen. Die wirtschaftliche Beziehung zur Sache würde es dann rechtfertigen, den Inhaber der Sachherrschaft heranzuziehen. Die Zustandsstörerverantwortlichkeit wird, wie oben gezeigt, von der h.M. aus Art. 14 GG und einer Vermögensrisikoverteilung zwischen Inhaber der Sachherrschaft und Allgemeinheit hergeleitet48. Der Eigentümer müsse als Korrelat der Sachherrschaft und der aus ihr gezogenen
4 3
Kühling, DVBl 1981, 313, 316; Würtenberger,
4 4
Erdmann, Kostentragung, S. 149 ff. m.w.N.
4 5
So Vogel, Festschrift für Willi Geiger, S. 533.
NVwZ 1983,192,195.
^ So aber wohl Friauf \ Festschrift für Hermann Jahrreiß, S. 60 f. (der Störer sei für die abzuwendende Gefahr stets verantwortlich) und Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 668 (der Zustandsstörer verursache durch den Zustand seiner Sache eine Gefahr). 4 7
BVerwG, Urt. v. 28.02.86, DVBl 1986, 729, 731.
4 8
S.o. Zweiter Teil, Erstes Kapitel.
134
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
Vorteile die in Zusammenhang mit der Sache stehenden Nachteile einschließlich der Lasten und Kosten der Gefahrenbeseitigung tragen 49. Wer den Nutzen der Sache hat, soll nach dieser Ansicht auch die finanziellen Lasten tragen50. Die Verbindung der materiellen Polizeipflicht mit den wirtschaftlichen Kriterien von Eigentum, Nutzenziehung und finanziellen Vor- und Nachteilen widerspricht, wie gezeigt51 , Sinn und Zweck des Polizeirechts als Recht der schnellen und effektiven Abwehr einer Gefahr. Solche Kriterien spielen für die materielle Polizeipflicht keine Rolle. Sie sind jedoch bei der Kostentragungspflicht des Zustandsstörers, die dem Postulat gerechter Lastenverteilung unterliegt, von Bedeutung. Wirtschaftliche Kriterien wie finanzieller Nutzen und Lasten, Risikosphären usw. entscheiden über die Verteilung einer Vermögenslast. Damit sind sie in polizeirechtlichen Fällen nicht bei der Entscheidung der Behörden relevant, ob jemand als Störer zur schnellen und effektiven Gefahrenabwehr verpflichtet ist und ohne Beachtung der engen Voraussetzungen der Nichtstörerinanspruchnahme zur Beseitigung herangezogen werden kann oder könnte, sondern bei der Frage, ob er diefinanziellen und wirtschaftlichen Folgen der Gefahrenabwehr zu tragen hat. Auch hier erweist sich die getrennte Betrachtung von materieller Polizeipflicht und Kostentragungspflicht als notwendig. Da dem Gesetzgeber für die Herstellung der gebührenrechtlichen individuellen Zurechenbarkeit ein weites Ermessen eingeräumt ist, ist es ihm grundsätzlich nicht verwehrt, bei der Gebührenpflichtigkeit einer staatlichen Leistung an wirtschaftliche und finanzielle Kriterien anzuknüpfen, soweit diese bewirken, daß der Gebührenpflichtige der Leistung näher steht als die Allgemeinheit. Diese besondere Beziehung ist beim Zustandsstörer in der Regel gegeben: Die Gefahr, die von der Behörde im Wege der unmittelbaren Ausführung oder Ersatzvornahme beseitigt wird, geht von einer Sache aus, über die er eine rechtliche oder tatsächliche Herrschaft hat, die ihm gleichzeitig die Möglichkeit gibt, wirtschaftlichen undfinanziellen Nutzen aus der Sache zu ziehen. Korrelat dieses wirtschaftlichen Nutzens ist nicht die Pflicht zur Beseitigung der Gefahr, wohl aber das Risiko von Ausgaben
4 9
Friauf
Festschrift für Gerhard Wacke, S. 301.
^ So z.B. Beye, Dogmatik, S. 50; Ziehm, Störerverantwortlichkeit, S. 54, 65; Spießhof er, Der Störer, S. 12; Domben, Altlastensanierung, S. 58 f.; Nauschütt, Altlasten, S. 150; Schwachheim, Unternehmenshaftung, S. 91. 5 1 S.o. Zweiter Teil, Zweites Kapitel.
2. Kapitel: Rechtsgrund und Grenzen
135
als Folge von Gefahren, soweit diese sachtypisch sind, der Risikosphäre des Zustandsstörers entspringen und die Allgemeinheit an ihrer Beseitigung ein größeres Interesse hat als der Zustandsstörer52. Das Auftreten einer von der Sache ausgehenden Gefahr ist in der Regel dem Risikobereich des Inhabers der Sachherrschaft zuzurechnen. Es handelt sich um eine nicht auszuschließende Begleiterscheinung der Sachherrschaft. Die für die Kostentragungspflicht erforderliche gebührenrechtliche individuelle Zurechenbarkeit läßt sich somit aus der rechtlichen oder tatsächlichen Sachherrschaft und der damit verbundenen Möglichkeit, aus der Sache Nutzen zu ziehen, herleiten. Der Zustandsstörer steht im Normalfall der Gefahrenabwehr durch Polizei- und Sicherheitsbehörden näher als die Allgemeinheit. Dies zeigt, daß die Heranziehung des Inhabers der Sachherrschaft zu den Kosten der Gefahrenbeseitigung allein durch die Beziehung zur Sache gerechtfertigt ist.
IV. Grenzen der Kostentragungspflicht des Zustandsstörers 1. Die Grenzen der individuellen
Zurechenbarkeit
beim Zustandsstöre
Trotz der weiten Befugnisse des Gesetzgebers bei der Auferlegung von Geldleistungspflichten hat die Zurechenbarkeit ihre Grenzen. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen die Gebührenpflicht nicht auf Veranlassung beruht, wie dies z.B. beim Handlungsstörer der Fall ist. Insbesondere darf die Inanspruchnahme des Kostenschuldners nicht gegen Grundrechte verstoßen. Es ist daher zu prüfen, ob die Anknüpfung an die Möglichkeit der Nutzenziehung und an die wirtschaftlichen Vorteile in bestimmten Fällen nicht ihre Grenze im Verfassungsrecht findet.
2. Verstoß gegen Art,. 14 GG a) Die Auferlegung von Kosten als Eingriff in das Vermögen Die Einforderung der Kosten der Gefahrenabwehr nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme könnte in bestimmten Fällen gegen Art. 14 GG verstoßen.
5 2
Zu diesen Einschränkungen siehe ausführlich unten V. 2. und 3.
136
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
Insbesondere in den Altlasten-Fällen wird vorgetragen, Art. 14 GG verbiete die Heranziehung eines Zustandsstörers, der selbst Opfer eines unbekannten Handlungsstörers geworden ist, zu den Kosten der Gefahrenabwehr53. Begründet wird dies zumeist damit, daß die Polizeipflicht des Eigentümers Auswirkung der Sozialgebundenheit des Eigentums sei und die Zustandsstörerverantwortlichkeit eine gesetzliche Schrankenziehung im Sinn des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG darstelle; da jedoch die Verantwortlichkeit des Eigentümers nicht weiterreichen könne als die Sozialgebundenheit des Eigentums, verstoße die Heranziehung zu den Kosten in bestimmten Fällen gegen Art. 14 GG 5 4 . Dabei wird jedoch übersehen, daß es sich bei der Auferlegung von Kosten nicht um einen Eingriff in das Eigentum an der störenden Sache handelt. Art. 14 GG spielt nur für einen solchen Eingriff eine Rolle. Die Vernichtung eines Eigentumsgegenstands, von dem eine Gefahr ausgeht, könnte in bestimmten Fällen einen Eingriff in Art. 14 GG darstellen55. Die Auferlegung einer Gebühr ist jedoch ein Eingriff in das Vermögen.
b) Kein Schutz des Vermögens als solches durch Art. 14 GG Unter die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG fallen nach h.M. in der Literatur und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts lediglich das Sacheigentum, Vermögenswerte Rechte des Privatrechts (z.B. bereits bestehende Forderungen) sowie bestimmte Vermögenswerte Rechtspositionen des öffentlichen Rechts, die dem Inhaber eine eigentümerähnliche Rechtsposition verschaffen, besonders dann, wenn sie Äquivalent eigener Leistung sind56. Das Vermögen als solches wird jedoch nicht durch Art. 14 GG geschützt57. Hoheitlich auferlegte Geldleistungspflichten lassen die Eigen-
5 3
S.o. Erster Teil, Zweites Kapitel, II. 3.
5 4
S.o. Zweiter Teil, Erstes Kapitel, I. 2.
5 5
S.o. Zweiter Teil, Zweites Kapitel, I. 2. b).
5 6
BVerfG, Beschl. v. 12.02.1986, E 72, 9,19.
5 7
Siehe z.B. BVerfG, Beschl. v. 19.10.1983, E 65,196,209; BVerfG, Beschl. v. 14.01.1987, E 74, 129, 148; Schenke, NJW 1983, 1882, 1887; Henneke, Jura 1990, 63, 69 jeweils m.w.N.
2. Kapitel: Rechtsgrund und Grenzen
137
tumsgarantie grundsätzlich unberührt 58, da sie nicht ein einzelnes vermögenswertes Recht, sondern das Vermögen als Ganzes betreffen. Ein Verstoß gegen Art. 14 GG bleibt bei den hier interessierenden Fällen der Auferlegung von Kosten nach Einsätzen der Gefahrenabwehr somit außer Betracht, da es sich dabei nicht um Eingriffe in das Eigentum handelt. Eine erdrosselnd wirkende Kostenerhebung wäre allerdings unzulässig59. Im Regelfall dürfte es sich jedoch lediglich um eine die Existenz nicht gefährdende Minderung des Vermögens handeln.
3. Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG und den Grundsatz der Lastengleichheit a) Der Grundsatz der Lastengleichheit Es könnte jedoch ein Verstoß gegen den aus Art. 3 Abs. 1 GG herzuleitenden Grundsatz der Lastengleichheit vorliegen60. Dieser ist die abgabenrechtliche Ausprägung des allgemeinen Gleichheitssatzes61 und gebietet die Gleichbehandlung aller Abgabenschuldner. Dies bedeutet nicht, daß öffentliche Lasten so zu verteilen wären, daß alle Abgabenschuldner den gleichen Beitrag zu zahlen hätten62. Es muß jedoch das Willkürverbot und das Gebot der Gerechtigkeit beachtet werden 63.
^ So die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, z.B. Urt. v. 20.07.1954, E 4, 7,17; Beschl. v. 15.07.1969, E 26, 327, 338; Beschl. v. 07.10.1969, E 27, 111, 131; Beschl. v. 15.01.1970, E 27, 326, 343; Beschl. ν. 09.03.1971, E 30, 250, 271 f.; offengelassen von BVerfG, Beschl. v. 19.12.1978, E 50, 57, 104; a.A. Wendt, Die Gebühr als Lenkungsmittel, S. 98 f.; v. Arnim, W D S t R L 39 (1977), 300 m.w.N. , mit dem Argument, es sei nicht einzusehen, warum die Entziehung einer Gläubigerstellung in den Schutzbereich des Art. 14 GG falle, dies jedoch für die Auferlegung einer Schuldnerstellung nicht gelten solle; s.a. Henneke, Jura 1990, 63, 70 m.w.N. 5 9
Vgl. Kimminich, Bonner Kommentar, Art. 14 GG, Rdnr. 59 ff.; siehe dazu auch das Beispiel von Schenke, NJW 1983,1882,1887 betreffend Polizeikosten im Zusammenhang mit Großveranstaltungen.
fin
Ausführlich zum Grundsatz der Lastengleichheit Friauf\ Festschrift für Hermann Jahrreiß, S. 45, 46 ff. sowie v. Arnim, W D S t R L 39 (1977), 318 ff. 6 1 BVerfG, Urt. v. 10.05.1960, E 11,105,119; BVerwG, Urt. v. 25.05.1984, NVwZ 1984, 651; a.A. v. Arnim, W D S t R L 39 (1977), 318, der den Grundsatz der Lastengleichheit aus Art. 14 GG herleitet. Art. 14 GG verdränge insofern Art. 3 Abs. I GG als lex specialis. Dies ist konsequent, da für ihn die Auferlegung von Geldleistungspflichten an Art. 14 GG zu messen ist (siehe oben 2. b)). 6 2
Friauf
6 3
v. Arnim, W D S t R L 39 (1977), 322 f.
Festschrift für Hermann Jahrreiß, S. 47.
138
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
Der Grundsatz der Lastengleichheit ist auch im Bereich der Auferlegung von Sach- und Dienstleistungen anwendbar. Auch hier werden vom einzelnen besondere Vermögensopfer gefordert, die andere nicht zu tragen haben64.
b) Der Grundsatz der Lastengleichheit im Gebührenrecht Im Gebührenrecht verbietet der Grundsatz der Lastengleichheit, den einzelnen Gebührenpflichtigen mit Kosten für Leistungen zu belasten, die der Allgemeinheit zugute kommen65. Er gilt somit nicht nur im Verhältnis der Abgabenschuldner untereinander, sondern auch im Verhältnis von einzelnem und Allgemeinheit. Ein Verstoß dagegen stellt eine Verletzung des Art. 3 Abs. 1 GG dar. Das Bundesverwaltungsgericht hat dies für den Fall der Belastung von Anliegern mit Straßenreinigungsgebühren deutlich formuliert: Es verstoße gegen den Gleichheitssatz, wenn Kosten, die die Befriedigung des Allgemeininteresses betreffen, den Abgabenschuldnern aufgebürdet würden. Um der Gleichheit der Lastenverteilung willen könne es nicht hingenommen werden, wenn Eigentümern etwas angelastet werde, was - eindeutig nicht ihnen, sondern der Allgemeinheit zuzurechnen sei 66 .
c) Lastengleichheit und Sonderopfer Diese Feststellung ist die Anwendung des Sonderopfergedankens im Gebührenrecht: Ein Sonderopfer liegt nach der Rechtsprechung des BGH dann vor, wenn dem Einzelnen ein den übrigen Rechtsträgern nicht zugemutetes Opfer für die Allgemeinheit auferlegt wird, das ihn unter Verletzung des Gleichheitssatzes besonders trifft 67. Ein Sonderopfer ist auch gegeben, wenn ein Kostenschuldner entgegen dem Grundsatz der Lastengleichheit zur Zahlung von Gebühren und Auslagen verpflichtet wird, die ihm nicht individuell zurechenbar sind,
6 4
Friauf
Festschrift für Hermann Jahrreiß, S. 56 ff.
6 5
BVerwG, Urt. v. 25.05.1984, NVwZ 1984,650 f. betreffend Straßenreinigungsbebühren; bestätigt in BVerwG, Urt. v. 07.04.1989, NVwZ 1990, 169, 170; ausführlich am Beispiel der Straßenreinigungsgebühren Ott, Die gemeindliche Straßenreinigung, S. 145 ff. 6 6
BVerwG, Urt. v. 07.04.1989, NVwZ 1990, 167, 170.
6 7
BGH, Beschl. v. 10.06.1952, BGHZ 6, 270, 280.
2. Kapitel: Rechtsgrund und Grenzen
139
wenn er also gezwungen wird, Kosten, die von der Allgemeinheit zu tragen wären, als Individuallast zu übernehmen68. Für das Verhältnis von Gemeinlastprinzip und Individuallastprinzip bedeutet dies, daß eine Gemeinlast nicht dann vorliegt, wenn die Allgemeinheit die Kosten tatsächlich trägt, sondern wenn sie die Kosten zu tragen hat, da andernfalls einem Individuum ein Sonderopfer auferlegt würde. Eine Prüfung ist insbesondere dann geboten, wenn der Verursacher als Kostentragungspflichtiger ausfällt und das Verursacherprinzip damit nicht anwendbar ist 69 . d) Störer und Sonderopfer Der Sonderopfergedanke hat auch in den Polizeigesetzen und dort insbesondere bei der Regelung der Auswirkungen der Inanspruchnahme des Nichtstörers auf dessen Vermögen seinen Niederschlag gefunden. Der Nichtstörer braucht die Kosten der Beseitigung nicht zu tragen. Er kann vielmehr einen Ausgleich für das Opfer, das ihm abweichend vom allgemeinen Prinzip der Lastenverteilung zunächst an der Stelle der Allgemeinheit zugemutet worden ist, verlangen (z.B. Art. 49 BayPAG, § 45 Abs. 1 Satz 1 MEPolG) 70 . Entscheidend für diesen Anspruch ist ein Vorteilsausgleichs- und Sonderopfergedanke, der sich an einer gerechten Lastenverteilung zwischen Allgemeinheit und Individuum orientiert. Es wird davon ausgegangen, daß der Nichtstörer in der Regel ein Sonderopfer erbringt 71. Eine Anwendbarkeit des Grundsatzes der Lastengleichheit auf den Störer wird mit der Begründung abgelehnt, er sei für die Gefahr stets verantwortlich und erbringe nie ein Sonderopfer 72.
6 8
S.a. Friauf
Festschrift für Hermann Jahrreiß, S. 59 f.
6 9
Zum Verursacherprinzip und zum Gemeinlastprinzip als Kostenzurechnungsprinzip sowie zum Verhältnis von Verursacher-, Individuallast- und Gemeinlastprinzip und deren zum Teil strittiger Bedeutung im Umwelt-, Polizei- und Abgabenrecht vgl. Kloepfer, Umweltrecht, § 3, Rdnr. 27 ff.; s.a. Schwachheim, Unternehmenshaftung, S. 123 ff. 7 0
Friauf
Festschrift für Hermann Jahrreiß, S. 61.
7 1
Drews fWacke(Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 293; Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 269; Wolff/Bachof Verwaltungsrecht III, S. 73; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 280; Ule/Rasch, Allgemeines Polizei-und Ordnungsrecht, Rdnr. 1 zu § 45 MEPolG; Papier, DVBl 1975, 567, 569; ausführlich zum Ausgleichsanspruch siehe unten Drittes Kapitel, II. 7 2
So Friauf Festschrift für Hermann Jahrreiß, S. 61; DrewsfWackefVogeHMartens, Gefahrenabwehr, S. 668.
140
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
Für die Störereigenschaft ist aber die materielle Polizeipflicht entscheidend, nicht jedoch eine Verantwortlichkeit für die Gefahr. Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht müssen getrennt betrachtet werden. Damit kann nicht automatisch von der Beseitigungspflicht auf die Kostentragungspflicht geschlossen werden. Das Vermögensopfer des Störers muß in jedem Fall am Grundsatz der Lastengleichheit gemessen werden73. Die Kostentragungspflicht des Störers (nicht aber die dem polizeirechtlichen Effektivitätspostulat unterliegende Gefahrenabwehrpflicht!) entfällt, wenn es sich bei den Kosten nicht mehr um eine Individuallast, sondern um eine Gemeinlast handelt, wenn also die Beziehung zwischen der leistenden Verwaltung und der Allgemeinheit im Hinblick auf die Leistung enger ist als zwischen dem Störer und der leistenden Verwaltung. Mit anderen Worten: Nicht nur der Nichtstörer, sondern auch der Störer ist nicht kostentragungspflichtig, wenn ihm damit ein Sonderopfer auferlegt würde.
V. Fälle eines Verstoßes gegen den Grundsatz der Lastengleichheit beim Störer i. Sonderopfer
des Handlungsstörers
Die Heranziehung des Handlungsstörers widerspricht dem Grundsatz der gerechten Lastenverteilung nicht, da er die Gefahr verursacht hat und die Allgemeinheit durch seine Kostentragung keinen Vorteil hat. Es handelt sich bei den Kosten des Handlungsstörers immer um eine Individuallast; er erbringt nie ein Sonderopfer. Zu prüfen ist jedoch, ob nicht in bestimmten Fällen beim Zustandsstörer keine Individuallast vorliegt, ob ihm nicht ausnahmsweise, obwohl er beseitigungspflichtig ist, mit den Kosten der Beseitigung ein Sonderopfer abverlangt würde. 2. Voraussetzungen eines Sonderopfers
des Zustandsstörers
Beim Zustandsstörer wird wegen der Möglichkeit der Nutzenziehung bei den Kosten ein Sonderopfer in der Regel nicht vorliegen. Die mit der
7 3 So auch Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung, S. 197: " Der Gleichheitssatz gebietet jedoch nach Gefahrenbeseitigung die Herbeiführung einer gerechten und endgültigen Lastenverteilung. Der rechtmäßig in Anspruch genommene Störer hat die Last nicht endgültig zu tragen, wenn die Grundsatze der gerechten Lastenverteilung für die endgültige Belastung eines anderen beteiligten Störers sprechen. Für die Verpflichtung eines Störers zur Gefahrenbeseitigung mögen Gründe der effektiven Gefahrenabwehr sprechen, für die gerechte und endgültige Lastenverteilung sind diese nicht maßgebend."
2. Kapitel: Rechtsgnd und Grenzen
141
Sache verbundenen finanziellen Lasten und Vermögenseinbußen müssen als Korrelat der Möglichkeit, aus der Sache wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen, vom Eigentümer und Inhaber der rechtlichen oder tatsächlichen Sachherrschaft hingenommen werden. Ein Sonderopfer ist in der Regel jedoch dann gegeben, wenn zwei Voraussetzungen zusammentreffen. Eine Voraussetzung ist ursachenorientiert, die andere wirküngsorientiert: (a) Die sich verwirklichende Gefahr ist keine sachtypische, der Sache gleichsam innewohnende Gefahr, mit der der Eigentümer zwar nicht zu rechnen brauchte, die aber eine Begleiterscheinung der Nutzenziehung darstellt. Insoweit und nur in bezug auf die Kostentragung kann auch von einer "Risikosphäre" der Allgemeinheit gesprochen werden. (b) Zusätzlich ist erforderlich, daß die Abwehr dieser "untypischen" Gefahr für die Allgemeinheit objektiv wichtiger ist als für den beseitigungspflichtigen Zustandsstörer. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn der Schaden an der Sache selbst ungleich geringer ist als die Gefahr für die Allgemeinheit und die Beseitigung somit nicht primär im Interesse des Zustandsstörers erfolgt. Entscheidend ist damit nicht, daß der Zustandsstörer von einem untypischen Geschehensablauf betroffen ist oder ein unbekannter Handlungsstörer die Gefahr verursacht hat, sondern daß er "Opfer" einer Gefahrenbeseitigung wäre, die primär im Allgemeininteresse vorgenommen wird 74 . Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Auf einem unbebauten Gelände inmitten landwirtschaftlich genutzten Gebietes wird festgestellt, daß sich im Erdreich zwei Tanks mit Resten von Öl befinden und infolge der Korrosion das Öl nun ins Erdreich sickert und das Grundwasser bedroht. Der jetzige Eigentümer hatte das Grundstück von einem Landwirt gekauft, war von einer stetigen landwirtschaftlichen Nutzung ausgegangen und hatte von den Tanks nichts gewußt. Wer die Tanks dort vergraben hatte und welchem Zweck sie dienten, ist nicht mehr feststellbar. Der jetzige Eigentümer nutzt das Grundstück als Lagerplatz. Im Boden befindliches Öl ist keine einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück innewohnende, sachtypische Gefahr. Das auslaufende Öl beeinträchtigt die Nutzung des Grundstücks als Lagerplatz nicht, gefährdet jedoch das Grundwasser. Die Allgemeinheit
7 4 Ähnlich Bott, Verantwortlichkeit, S. 199,209 und Ziehm, Störerverantwortlichkeit, S. 67, die jedoch an der Verbindung von Zustandsstörereigenschaft und Eigentumsgrundrecht festhalten; vgl. auch VGHBW, Urt. v. 17.09.1990, DÖV 1991, 163,165, wonach bei Sachverhalten, die dem Interesse der Allgemeinheit zuzurechnen sind, die unmittelbare Ausführung rechtmäßig, die Kostenbelastung des Störers jedoch rechtswidrig ist.
142
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
hat somit ein objektiv wesentlich größeres Interesse an einer schnellen Beseitigung als der Grundstückseigentümer, der auf die Idee kommen könnte, das Öl einfach durch das Erdreich hindurch ins Grundwasser abfließen zu lassen. Er wäre dann, da das Grundwasser nicht zum Grundstückseigentum gehört 75, nicht mehr Zustandsstörer. In solchen Fällen, in denen beide Voraussetzungen (keine sachtypische Gefahr und überwiegendes Allgemeininteresse an der Beseitigung) kumulativ vorliegen, sind die Kosten der Beseitigung keine sich aus der Möglichkeit der Nutzenziehung rechtfertigende Individuallast, sondern eine Gemeinlast, die gemäß dem Grundsatz der Lastengleichheit nicht dem einzelnen aufgebürdet werden darf. Dabei ist zu beachten, daß - im Gegensatz zur materiellen Polizeipflicht im Sinn einer Beseitigungspflicht - bei der Betrachtung der Kostentragungspflicht eine Berücksichtigung der Ursache zulässig und es auch erheblich ist, ob durch die Gefahrensituation eine wirtschaftlich sinnvolle Verwendungsart der störenden Sache ausgeschlossen ist. 3. Einige Kriterien für die Prüfung eines Sonderopfers Zustandsstörers bei Vorliegen einer Altlast
des
In den meisten der Opfer-Fälle aus dem Bereich der Altlasten-Problematik werden die Kosten der Beseitigung eine Gemeinlast darstellen. Es kommt jedoch bei dieser Beurteilung auf den Einzelfall an. Es sollen nunmehr einige Kriterien aufgeführt werden, die Anhaltspunkte für die Verantwortlichkeit geben und bei der Prüfung der Kostentragungspflicht zu beachten sind. Hinsichtlich der Bewertung und Gewichtung dieser Kriterien ist noch vieles umstritten. Eine ausführliche Darstellung der dazu vertretenen Meinungen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Letzlich wird eine einzelfallbezogene Prüfung der oben genannten Voraussetzungen eines Sonderopfers immer zu einem Ergebnis führen, das dem Grundsatz der Lastengleichheit eher entspricht als ein schematisches Vorgehen nach bestimmten Fallgruppen. Die nachfolgenden Kriterien können jedoch hilfreich für diese Prüfung sein. a) Die Kenntnis der ehemaligen Nutzung Der Käufer eines kontaminierten Grundstücks, der es in Kenntnis der ehemaligen Nutzung erworben hat und Bodenbelastungen hätte erkennen müssen, wird das Risiko der mit der Sanierung verbundenen Kosten zu
7 5
BVerfG, Beschl. v. 15.07.1981, E 58, 300, 328; Kloepfer,
Umweltrecht, § 12, Rdnr. 146.
2. Kapitel: Rechtsgrund und Grenzen
143
tragen haben. Dieses Risiko hätte der Käufer im Kaufvertrag berücksichtigen müssen, es kann nicht der Allgemeinheit aufgebürdet werden76. Bei den Kosten, die diesem Erwerber als Zustandsstörer entstehen, handelt es sich um eine Individuallast.
b) Die Vorteile der Nutzung Gleiches gilt, wenn Altlasten von einem industriellen Betrieb verursacht wurden und der Eigentümer des Grundstücks, z.B. durch den Pachtzins, von dieser Nutzung profitiert hat. Auch in diesen Fällen ist der Eigentümer nicht nur beseitigungspflichtiger Zustandsstörer, sondern hat auch die Kosten der Sanierung zu tragen 77, da er einen wirtschaftlichen Vorteil gerade von dieser Nutzung hatte. Da sich eine sachtypische Gefahr verwirklicht hat, stellen die Kosten lediglich das Korrelat der Nutzung dar. Es ist daher insoweit auch dem OVG Lüneburg zuzustimmen, wenn es in einem Beschluß, der die Zustandsstörerverantwortlichkeit des Grundstückseigentümers betrifft, auf die Vorteile und Risiken für den Eigentümer und die Allgemeinheit abstellt: Der Verpächter und nicht die Allgemeinheit habe während der Dauer des Vertrags allein die Vorteile aus dem Abbauvertrag gezogen. Er könne deshalb nicht verlangen, daß die mit dem Bodenabbau generell verbundenen Risiken, die in Bodenverunreinigungen durch Maschinen, aber auch in einer Verfüllung der Abbaustelle mit kontaminiertem Material bestehen können, von der Allgemeinheit getragen werden. Es wäre Sache des Klägers gewesen, sich gegen Risiken dieser Art vertraglich abzusichern. Wenn er dies unterlassen habe, führe dies nicht zu einer Einschränkung der rechtlichen Möglichkeiten der Ordnungsbehörden, ihn als Verantwortlichen für seine Rächen zur Gefahrenbeseitigung heranzuziehen78. Das OVG Münster hat eine Gemeinde als Zustandsstörerin angesehen, die ein Gelände durch Verpachtung an Sondermüllverwertungsbetriebe der Nutzung zugeführt hat. Die Gemeinde müsse sich als Grundstückseigentü-
7/>
Siehe dazu auch Koch, Bodensanierung, S. 23, 48; in dem dort geschilderten Fall hatte der Zustandsstörer ein ehemaliges Deponiegrundstück ausdrücklich in Kenntnis der vormaligen Nutzung und unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung erworben; zustimmend Breuer, NVwZ 1987, 756; s.a. Fehn, VR 1987, 267, 268; Dombert, Altlastensanierung, S. 58 m.w.N.; aus der Rspr. z.B. VGHBW, Urt. v. 11.10.1986, NuR 1987, 320, 321. 77
Kloepfer, NuR 1987, 7, 17; Mosler, Öffentlich-rechtliche Probleme der Sanierung, S. 7138 f.; s.a. m.w.N. Dombert, Altlastensanierung, S. 58. 8 OVG Lüneburg, Beschl. v. 28.08.1989, NuR 1990, 480, 481.
144
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
merin die Risiken ihrer eigenverantwortlich getroffenen Entscheidung zurechnen lassen, da sie im Rahmen der Formulierung des Pachtvertrages auf das Betriebsgeschehen hätte Einfluß nehmen können79.
c) Genehmigung oder Duldung des Betriebs durch Behörden Allerdings kann eine Legalisierung oder Duldung des Betriebs durch Behörden oder - in Ausnahmefällen - die Unkenntnis über die Gefährlichkeit des Betriebs für das Erdreich wieder dazu führen, daß der Eigentümer die Kosten nicht zu tragen hat 80 . Die Allgemeinheit darf nicht von Kosten freigestellt werden, für die die Behörde mitverantwortlich ist. Eine Kontamination ist in der Regel keine sachtypische Gefahr eines genehmigten Betriebs. Die Auferlegung der Kosten der Beseitigung würde ein Sonderopfer des Grundstückseigentümers zugunsten der Allgemeinheit begründen.
d) Die Erkennbarkeit der Gefährlichkeit des Betriebs Die Tatsache, daß die Gefährlichkeit des Betriebs nicht erkennbar war, reicht für die Freistellung von der Kostentragungspflicht alleine jedoch nicht aus81. e) Sicherungsmaßnahmen Eine Rolle für die Risikoverteilung bei der Kostentragungspflicht kann auch spielen, welche Sicherungsmaßnahmen der Grundstückseigentümer getroffen hat, um eine Einwirkung Dritter auf sein Grundstück zu verhindern 82. Dies spielt insbesondere in den Fällen eine Rolle, in denen die Altlast auf eine Einwirkung von Dritten, z.B. auf das Abstellen von undichten Ölfässern auf einem Grundstück, zurückzuführen ist. Hier ist zu
7 9
OVG Münster, Urt. v. 24.02.1989, NVwZ 1989, 987,988.
8 0
Siehe das Beispiel bei Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 97; sa. Dombert, Altlastensanierung, S. 69 m.w.N.; Schwachheim, Unternehmenshaftung, S. 165, befürwortet einen Ausschluß der Zustandsstörerverantwortlichkeit, wenn der Grundstückseigentümer zugleich Empfänger einer Genehmigung zum Betrieb einer Anlage auf seinem Grundstück ist und die abzuwehrende Gefahr auf genehmigten Handlungen beruht. 81 8 2
Kloepfer,
NuR 1987, 7,16; Schwachheim, Unternehmenshaftung 163 f., 165 f.
Selmer, Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, S. 502; BayVGH, Beschl. v. 13.05.86, BayVBl 1986, 590, 593.
2. Kapitel: Rechtsgrund und Grenzen
145
prüfen, ob nicht der Eigentümer Unbefugte durch Zäune oder Absperrungen am Betreten des Grundstücks hätte hindern müssen. Seine Nachlässigkeit kann nicht zu Lasten der Allgemeinheit gehen.
VI. Ergebnis Die vermögensrechtlichen Folgen der Gefahrenbeseitigung richten sich also nicht danach, wer Störer und wer beseitigungspflichtig ist, sondern entsprechend dem Grundsatz der gerechten Lastenverteilung danach, ob eine Gemeinlast oder eine Individuallast vorliegt. Entscheidend ist, ob der Beseitigungspflichtige mit den Kosten ein Sonderopfer zugunsten der Allgemeinheit bringen würde oder nicht. Somit ist auch beim Störer in jedem Einzelfall zu prüfen, ob ihm nach einer unmittelbaren Ausführung oder Ersatzvornahme die Kosten auferlegt werden dürfen oder nicht. Dies wird beim Handlungsstörer aus dem Gesichtspunkt der Veranlassung und beim Zustandsstörer aus dem Gesichtspunkt der Möglichkeit, aus der Sache wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen, meistens der Fall sein. Insofern sind auch die Bestimmungen der Art. 9 Abs. 2 und 34 Abs. 1 Satz 2 BayPAG bzw. der §§ 5a Abs. 2 und 30 Abs. 2 MEPolG (Kostentragungspflicht des Handlung- bzw. Zustandsstörers nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme) als typisierende Regelungen gerechtfertigt. Eine Inanspruchnahme des Eigentümers in bestimmten Fällen, in denen er Opfer eines unbekannten Handlungsstörers wurde, würde jedoch gegen den Grundsatz der Lastengleichheit als Ausprägung des Art. 3 Abs. 1 GG verstoßen. Die oben dargestellten Gesichtspunkte gestörter Privatnützigkeit, Verteilung von Risikosphären und Kostentragung als Korrelat der Nutzenziehung sind zutreffende Kriterien einer gerechten Lastenverteilung zwischen Allgemeinheit und Störer. Sie sind jedoch nicht bei der dem Effektivitätspostulat unterliegenden materiellen Polizeipflicht des Eigentümers einschlägig, sondern erst bei der Kostentragungspflicht. Entscheidend ist die Frage, ob die Kosten eine Individuallast oder eine Gemeinlast darstellen, ob also dem Zustandsstörer mit den Kosten ein Sonderopfer abverlangt würde oder nicht. Dem Zustandsstörer können nur dann "Kosten (Gebühren und Auslagen)" auferlegt werden, wenn für ihn eine Individuallast vorliegt. Die Verpflichtung zur Zahlung einer Gemeinlast würde dem Grundsatz der Lastengleichheit widersprechen und gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßen. Dem Zustandsstörer würde ein Sonderopfer abverlangt.
10 Grìesbeck
Drittes Kapitel
Ein Ausgleichsanspruch für den Störer? L Einleitung und Problemstellung Thema der vorliegenden Arbeit war die materielle Polizeipflicht des Zustandsstörers und die Kostentragungspflicht nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme. Für letztere wurde festgestellt, daß sie nicht Annex oder Surrogat der Beseitigungspflicht ist, und daß diese Kosten unter den Polizeikosten keine Sonderstellung einnehmen, sondern sich wie alle anderen Kosten am gebührenrechtlichen Kriterium der individuellen Zurechenbarkeit der erbrachten Leistung orientieren müssen. Abschließend soll nun noch geprüft werden, ob dem Störer, dem Kosten (Ausgaben) dadurch entstanden sind, daß er die Gefahr selbst beseitigte oder beseitigen ließ, ein Ausgleichsanspruch in den Fällen zusteht, in denen ihm nicht Kosten (Gebühren und Auslagen) hätten auferlegt werden dürfen. Gegen die Lösung, daß der Zustandsstörer in den Fällen, in denen er Opfer eines unbekannten oder nicht mehr greifbaren Handlungsstörers geworden ist, zwar eine Gefahrenabwehrpflicht hat und durch Polizeiverwaltungsakt zur Beseitigung herangezogen werden kann, jedoch bei unmittelbarer Ausführung oder Ersatzvornahme die Kosten nicht tragen muß, wurde eingewendet, daß der Zustandsstörer, der sich dem Polizeibefehl widersetzen würde, besser gestellt sei als derjenige, der dem Polizeiverwaltungsakt nachkomme und die Gefahr auf eigene Kosten selbst abwehre1. Das Problem stellt sich z.B. dann, wenn ein Grundstückseigentümer, der als Zustandsstörer in Anspruch genommen wurde, ein Unternehmen beauftragt, kontaminiertes Erdreich, aus dem ein gefährlicher Stoff ins Grundwasser zu sickern droht, abzutragen und an einen sicheren Ort zu bringen. Da nicht die Polizei das Tätigwerden des Unternehmers veranlaßt hat und somit keine unmittelbare Ausführung oder Ersatzvornahme
1
Bott, Verantwortlichkeit, S. 201; Kränz, Zustandsstörerverantwortlichkeit, S. 236; Brandner, Gefahrenerkennbarkeit, S. 40; Seibert, DVBl 1985,328; Selmer, Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, S. 483,492; s.a. Schenke in: Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rdnr. 97.
3. Kapitel: Ein Ausgleichsanspruch für den Störer?
147
vorliegt, wird auch keine Forderung nach Zahlung von Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben werden. Damit kann jedoch auch nicht geprüft werden, ob die Gefahrenabwehr eine Individuallast des Zustandsstörers darstellt oder ob ausnahmsweise eine Gemeinlast vorliegt. Wenn es sich bei den dem Zustandsstörer entstandenen Kosten um eine Gemeinlast handelt und er somit ein Sonderopfer brachte, weil sich keine sachtypische Gefahr verwirklicht hat und die Beseitigung für die Allgemeinheit wichtiger war als für ihn, wäre er gegenüber dem Zustandsstörer, der sich weigert, dem Polizeiverwaltungsakt nachzukommen, auf den ersten Blick benachteiligt. Eine Analyse der Ausgleichsansprüche des Polizeirechts zeigt jedoch, daß dies nicht so ist. Dem Postulat gerechter Lastenverteilung kann auch in den Fällen Rechnung getragen werden, in denen gebührenrechtliche · Grundsätze (individuelle Zurechenbarkeit und Lastengleichheit) mangels einer Forderung nach Zahlung von Kosten (Gebühren und Auslagen) nicht geprüft werden.
IL Ausgleichsansprüche als Sonderopferentschädigung 1. Ausgleichsansprüche des Nichtstörers a) Die gesetzliche Regelung In Art. 49 ff. BayPAG, §§ 45 ff. MEPolG (vgl. auch § 37 BerlASOG; §§ 68 ff. RhPfPVG; §§ 188 ff. SHLVwG) sind die Ausgleichsansprüche des Nichtstörers und des Unbeteiligten geregelt, die durch eine rechtmäßige Polizeiverfügung einen Schaden erlitten haben. Es werden sowohl Eingriffe in Vermögenswerte wie auch nichtVermögenswerte Rechte geregelt. Auch reine Vermögensschäden sind erstattungsfähig 2. Auch Aufwendungen des Betroffenen können ein Schaden im Sinn des § 45 MEPolG sein3. Der Nichtstörer ist jedoch dann nicht schadensausgleichsberechtigt, wenn die Gefahrenbeseitigung dem Schutz seiner Person oder seines Vermögens diente (Art. 49 Abs. 4 BayPAG; s.a. § 46 Abs. 5 Satz 1 MEPolG). Mitwirkendes Verschulden muß ebenfalls berücksichtigt werden (Art. 46 Abs. 7 Satz 2 BayPAG; § 46 Abs. 5 Satz 2 MEPolG). Anderweitige
L Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 281; zu Inhalt, Art und Umfang des Schadensausgleichsanspruchs mit Nachweis der einschlägigen Vorschriften in den Länderpolizeigesetzen siehe Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 300 ff. 3
Amtliche Begründung zu § 45 Abs. 1 MEPolG, abgedruckt bei Heise/Riegel, wurf, S. 130.
Musterent-
148
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
Ersatzansprüche sind abzutreten (§ 46 Abs. 6 MEPolG); ein Anspruch entfällt, wenn der Nichtstörer schon Ersatz erhalten hat. b) Der zugrundeliegende Rechtsgedanke Die gesetzliche Regelung macht deutlich, daß sich diefinanziellen Folgen nicht automatisch aus der Nichtstörereigenschaft ergeben. Der Schadensausgleichsanspruch wird vielmehr nach Rechtsgrund und Umfang danach beurteilt, inwieweit der Nichtstörer ein Sonderopfer erbracht hat und ob diese Opferlage noch fortbesteht. Bei der Bemessung des Schadensausgleichs ist eine umfassende Interessenabwägung vorgesehen4. Der gesetzlichen Regelung liegt der Gedanke zugrunde, daß der Nichtstörer in der Regel ein Sonderopfer zugunsten der Allgemeinheit erbringt5. Ein solches ist nicht gegeben, wenn der Nichtstörer mitursächlich für die Gefahr war oder die Gefahrenbeseitigung dem Schutz seiner Person oder seines Vermögens diente und somit in seinem Interesse lag. Die spezialgesetzlichen Normen des Nichtstörerschadensausgleichs konkretisieren somit nur den allgemeinen Sonderopfergedanken 6. 2. Der Aufopferungsgrundsatz
der §§ 74, 75 EinlALR im Störerrecht
Der Grundsatz, daß derjenige, der ein Sonderopfer zugunsten der Allgemeinheit erbringt, entschädigt werden muß, war schon in §§ 74, 75 EinlALR normiert. Dort hieß es: "§ 74. Einzelne Rechte und Vortheile der Mitglieder des Staats müssen den Rechten und Pflichten zur Beförderung des gemeinschaftlichen Wohls, wenn zwischen beyden ein wirklicher Widerspruch (Collision) eintritt, nachstehen. § 75. Dagegen ist der Staat denjenigen, welcher seine besonderen Rechte und Vortheile dem Wohle des gemeinen Wesens aufzuopfern genöthigt wird, zu entschädigen gehalten.
4 Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 301; vgl. auch die amtl. Begründung zu § 46 Abs. 5, abgedruckt bei Heise/Riegel, Musterentwurf, S. 133.
^ Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 293; Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 269; Wolff/Bachof Verwaltungsrecht III, S. 73; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 280; Ule/Rasch, Rdnr. 1 zu § 45 MEPolG; Papier, DVBl 1975,567,569. 6 Vgl. auch die amtl. Begründung zu § 45 Abs. 1 MEPolG, abgedruckt bei Musterentwurf, S. 130. 7
Heise/Riegel,
Vgl. Scholler/Broß, DÖV 1976, 472; zur Bedeutung der §§ 74, 75 EinlALR s.a. Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht I, S. 524 ff.
3. Kapitel: Ein Ausgleichsanspruch für den Störer?
149
Die Geltung des § 75 EinlALR im Polizeirecht wurde bereits 1842 gesetzlich normiert und fand auch in den §§ 70 ff. PreußPVG ihren Niederschlag8. Die Geltung des Aufopferungsgrundsatzes im Gefahrenabwehrrecht bedeutet allgemein formuliert: Trifft eine Gefahrenabwehrmaßnahme einzelne Bürger besonders, so ist dies dennoch mit dem Gleichheitssatz vereinbar, falls das Vermögensopfer ausgeglichen und damit die Lastengleichheit wiederhergestellt wird . Auch die Norm über den Schadensausgleich des Nichtstörers ist nur eine Konkretisierung des allgemeinen Prinzips der §§ 74, 75 EinlALR 10 . Die sogenannten Nichtstörer können zwar zur Vermeidung größerer Schäden zur Beseitigung herangezogen werden, dürfen aber nicht mit den wirtschaftlichen Folgen ihrer Inanspruchnahme belastet werden. Dies ergibt sich aus der Verbindung von Effektivitätspostulat und dem Aufopferungsgrundsatz des § 75 EinlALR: Es ist zulässig, einen Dritten, der als Inhaber des Gegenmittels zufällig für die Hilfeleistung in Betracht kommt, ohne Störer zu sein, zur Gefahrenabwehr zu verpflichten. Es würde jedoch dem Rechtsgedanken der §§ 74,75 EinlALR widersprechen, ihn für ein Sonderopfer, das er dabei zugunsten der Allgemeinheit erbracht hat, nicht zu entschädigen11. Da der Nichtstörerausgleich lediglich eine Konkretisierung des Aufopferungsgedankens der §§ 74, 75 EinlALR ist, ist er nicht nur auf die im Gesetz genannten Fälle anzuwenden, sondern auf alle Fälle des Polizeirechts, in denen jemand nach einer polizeilichen Maßnahme, die der Gefahrenabwehr diente, durch die Gefahrenbeseitigung einen Schaden an Leben, Gesundheit, Eigentum oder Vermögen erlitten hat und dies ein Sonderopfer zugunsten der Allgemeinheit darstellte.
8
BGH, Urt. v. 14.06.1952, BGHZ 7, 96,100; BGH, Urt. v. 30.09.1954, BGHZ 14, 363, 365 f.; Drews fWackefVogellMartens y Gefahrenabwehr, S. 651 f. 9
Drews/Wacke/Vogel/Martens,
Gefahrenabwehr, S. 660.
10
BGH, Urt. v. 30.09.1954, BGHZ 14,363,365 f. für den Schadensausgleichsanspruch des Nichtstörers gem. § 70 PreußPVG; Knemeyer, Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 298. 11 Scholler/Broß, Grundzüge des Polizei- und Ordnungsrechts, S. 241 leiten — allerdings ohne nähere Begründung — die Entschädigungspflicht nicht aus §§ 74, 75 EinlALR her, sondern aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 und Abs. 3 GG); auf die Frage, ob der Aufopferungsgrundsatz der §§ 74, 75 EinlALR Verfassungsrang hat, und wenn ja, wo er im Verfassungsrecht zu lokalisieren ist, kann in Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit nicht näher eingegangen werden. Wolff/Bachof \ Verwaltungsrecht I, nehmen für den Aufopferungsanspruch Verfassungsrang an (S. 535); dort auch ausführlich zur Verbindung der §§ 74, 75 EinlALR mit dem Gleichheitssatz (S. 524 ff.).
150
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
Es ist zu prüfen, ob auf den Zustandsstörer, der ausnahmsweise ein Sonderopfer erbrachte, dann nicht die Regelung über den Nichtstörererausgleich analog angewendet werden kann.
III. Ausgleichsansprüche des Störers 1. Die h.M. zur analogen Anwendung des Nichtstörerausgleichs auf den Störer Die Polizeigesetze sagen über die Entschädigung des Störers nichts aus, so daß diese Lücke möglicherweise durch Analogie gefüllt werden könnte. Eine Analogie ist immer dann möglich, wenn zwei Tatbestände infolge ihrer Ähnlichkeit in den für die gesetzliche Bewertung maßgeblichen Hinsichten gleich zu bewerten sind, ohne gleich zu sein1 . Die Regelung über den Nichtstörerausgleich könnte für solche Fälle eines polizeirechtlichen Sonderopferausgleichs analogiefähig sein, in denen jemand durch die Gefahrenbeseitigung einen Schaden erlitten hat und dabei ein Sonderopfer erbrachte. Eine entsprechende Anwendung des Nichtstörerausgleichs für den Störer wurde bisher von der herrschenden Meinung abgelehnt, da der Störer nach dieser Ansicht niemals ein Sonderopfer bringt. Wer durch sein Handeln oder durch den Zustand seiner Sachen eine polizeiliche Gefahr verursache, müsse die Maßnahmen hinnehmen, die zur Beseitigung der Gefahr erforderlich seien. Die Polizeipflicht sei Ausfluß der allgemeinen Sozialpflichtigkeit 13 . Im Zweiten Kapitel des Dritten Teils wurde dargelegt, daß auch der Zustandsstörer in bestimmten Fällen ein Sonderopfer bringt. Dies legt die Annahme nahe, daß auch ihm in diesen Ausnahmefällen eine Entschädigung durch eine analoge Anwendung der gesetzlichen Regelung des Nichtstörerausgleichs oder der spezialgesetzlichen Entschädigungsnormen
12 13
Lorenz, Methodenlehre, S. 366.
So z.B. DrewsfWackelVogellMartenSy Gefahrenabwehr, S. 668 m.w.N.; interessant bei dieser Argumentation ist, daß der Zustandsstörer als Verursacher der Gefahr dargestellt wird und ihm deshalb ein Schadensausgleichsanspruch vorenthalten wird: Mag dies für den Verursacher zutreffen, so ist dieses Argument nicht auf den anwendbar, der Opfer des Handlungsstörers wird; s.a. BGH, Urt. v. 14.02.1952, BGHZ 5,144,151; Ule/Rasch, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 8 zu § 45 MEPolG; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 279.
3. Kapitel: Ein Ausgleichsanspruch für den Störer?
151
für Störer zu gewähren ist. Die Prüfung kann dabei wiederum von dem in polizeirechtlichen Fällen bedeutsamen Effektivitätspostulat ausgehen.
2. Die analoge Anwendbarkeit unter dem Gesichtspunkt des Effektivitätspostulats Überlegungen zu einer analogen Anwendung in den Fällen, in denen der Eigentümer Opfer des Handlungsstörers geworden ist, finden sich schon bei SchollerIBroß, wo in Zusammenhang mit den Kosten nach TanklastzugUnfällen darauf hingewiesen wird, daß es wegen der effektiven Gefahrenabwehr keine Verantwortlichkeitslücke geben dürfe und der Eigentümer deshalb Zustandsstörer sei. Es sei jedoch zu überlegen, ob man ihm nicht einen Ausgleich in Analogie zu den Vorschriften, nach denen ein Nichtstörer Ersatz verlangen kann, gewähren müsse14. Dem ist zuzustimmen. Gerade das Effektivitätspostulat macht langwierige Überlegungen, ob die Kosten der Beseitigung für den Eigentümer möglicherweise ein Sonderopfer darstellen werden, unmöglich. Um die schnelle Gefahrenabwehr nicht durch solche Überlegungen zu gefährden, bietet sich - zumindest für die Kosten der Beseitigung - eine analoge Anwendung des Nichtstörerausgleichs auch für den Störer an. Auch Giesberts sieht den Störer und den Nichtstörer im Hinblick auf die gerechte Lastenverteilung als vergleichbar an, wenn der Störer lediglich aus Gründen der schnellen und effektiven Gefahrenabwehr herangezogen und dabei dem Prinzip der gerechten Lastenverteilung nicht entsprochen wurde. Der in Anspruch genommene Störer werde im Interesse der Allgemeinheit im Vergleich zu den nicht verpflichteten Störern ungleich behandelt. Insoweit könne, wie beim Nichtstörer, von einem durch die Gefahrenbeseitigung erbrachten Sonderopfer gesprochen werden15. 3. Entschädigungsansprüche fär den Störer in Spezialgesetzen Auch einige Spezialgesetze geben dem Störer einen Entschädigungsanspruch (z.B. §§ 49, 57 BSeuchG, § 66 TierseuchenG, § 6 ReblausG). Diesen Entschädigungsansprüchen liegt folgende Erwägung zugrunde: Der Störer soll zur schnellen Hilfe bei der Gefahrenabwehr veranlaßt werden, da die Gefahr für die Allgemeinheit ebenso groß oder größer ist als für den
14
Schüller/Broß,
15
Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung, S. 220 f.
Grundzüge des Polizei- und Ordnungsrechts, S. 211.
152
Dritter Teil: Die Kostentragungspflicht
Störer (dies gilt besonders im Fall von Seuchen)16. Als Grund für die Bestimmung des § 57 BSeuchG wurde auch aufgeführt, daß der Betroffene schicksalsbedingt zum Störer geworden sei und im Interesse der Allgemeinheit zu einem Sonderopfer genötigt wird 17 . Diese Vorschriften könnten auch auf bestimmte Fälle der Inanspruchnahme des Zustandsstörers anwendbar sein. Auch Ausnahmevorschriften sind analogiefähig 18. Eine analoge Anwendbarkeit dieser Vorschriften auf das allgemeine Polizeirecht ist jedoch abzulehnen. Es handelt sich um Gesetze des besonderen Sicherheitsrechts, die eine Spezialmaterie regeln. Insoweit ist eine im Rahmen der Analogie geforderte Ähnlichkeit nicht gegeben. Der auf der Grundlage der polizeilichen Generalklausel in Anspruch genommene Störer und der Adressat eines Spezialgesetzes, das aus dem allgemeinen Polizeirecht hervorging, um eine bestimmte Materie besser regeln zu können und das nicht nur die allgemeine Gefahrenabwehr betrifft, sind nicht vergleichbar. Die genannten Vorschriften zeigen jedoch, daß der Gedanke eines ausnahmsweisen Sonderopfers des Störers dem Gefahrenabwehrrecht nicht fremd ist und daß bei Gefahren, deren Beseitigung der Allgemeinheit einen größeren Vorteil bringt als dem Störer, eine Entschädigung des Störers für Einbußen am Vermögen grundsätzlich nicht ausgeschlossen ist 19 .
4. Zulässigkeit der analogen Anwendbarkeit der Regelung des Nichtstörerausgleichs auf bestimmte Zustandsstörer Auch wenn eine analoge Anwendung der Spezialnormen abzulehnen ist, könnte doch die Vorschrift des Nichtstörerausgleichs in Opfer-Fällen für die Kosten der Beseitigung auf den Zustandstörer anwendbar sein. Die Ähnlichkeit der Fälle liegt in dem - sowohl vom Nichtstörer als auch vom Zustandsstörer in bestimmten Fällen - mit der Gefahrenbeseitigung erbrachten Sonderopfer. Die Fälle sind gleich zu bewerten, weil sowohl der Nichtstörer als auch der Zustandsstörer in bestimmten Fällen einen
16 Drews fWacke[Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 674; Scholler/Broß, Grundzüge des Polizei- und Ordnungsrechts, S. 260; Götz, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rdnr. 279; Scholler/Broß, DÖV 1976, 472; Broß, DVB1 1983, 378. 17
Krakau, DÖV 1970,178,184, m.w.N.
18
Engisch, Einführung, S. 147 f.
19
S.a. BGH, Urt. v. 25.01.73, DVB1 1973, 627, 631.
3. Kapitel: Ein Ausgleichsanspruch für den Störer?
153
Schaden erleiden und dabei ein Sonderopfer zugunsten der Allgemeinheit erbringen 20. Der zugrundeliegende Rechtsgedanke der §§ 74, 75 EinlALR hat zwar lediglich für den Nichtstörerausgleich und - in manchen Ländergesetzen - für den unbeteiligten Dritten 21 seine gesetzliche Konkretisierung gefunden. Er bedingt jedoch, daß jedem, der nach einer polizeilichen Maßnahme, die der Gefahrenabwehr diente, durch die Gefahrenabwehr einen Schaden erlitt und ein Sonderopfer zugunsten der Allgemeinheit erbrachte, ein Ausgleich zu gewähren ist. Da Zustandsstörer in bestimmten Opfer-Fällen insoweit dem Nichtstörer vergleichbar sind, ist die Anwendung der gesetzlichen Regelung des Nichtstörerausgleichs im Hinblick auf die Rückerstattung der durch die Gefahrenbeseitigung entstandenen Kosten möglich22. Es sind dies die Fälle, in denen auch der Zustandsstörer ausnahmsweise ein Sonderopfer erbringt, wenn sich also keine sachtypische Gefahr verwirklicht und die Gefahrenbeseitigung der Allgemeinheit mehr Vorteile bringt als dem Zustandsstörer. Der Grundsatz der Lastengleichheit würde in diesen Fällen dann bei unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme eine Freistellung von den Kosten (Gebühren und Auslagen) gebieten. Dem Postulat gerechter Lastenverteilung wird in diesen Fällen, in denen keine unmittelbare Ausführung oder Ersatzvornahme stattfindet, durch die analoge Anwendung der Nichtstörerausgleichsregelung Rechnung getragen.
2 0
S.a. Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung, S. 220 f.
2 1
Art. 49 Abs. 2 BayPAG; § 189 SHLVwG.
2 2
Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung, S. 221.
11 Griesbeck
Ergebnis In polizeirechtlichen Fallgestaltungen und dabei insbesondere in den Fällen, in denen der Zustandsstörer Opfer eines unbekannten Handlungsstörers wurde, sind das Effektivitätspostulat und das Postulat gerechter Lastenverteilung von großer Bedeutung. Jenes spielt für das Polizeirecht als Recht einer schnellen Gefahrenabwehr, dieses für das Polizeikostenrecht als Recht der Verteilung der Lasten der Gefahrenabwehr zwischen einzelnem und Allgemeinheit eine Rolle. Einem Dilemma zwischen Effektivitätspostulat und dem Grundsatz gerechter Lastenverteilung kann man entgehen, wenn man - wie in bestimmten Fällen auch schon geschehen Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht gesondert behandelt. Eine solche Betrachtung ist wegen der Zuordnung des Polizeikostenrechts zum Gebührenrecht und der daraus resultierenden Geltung der gebührenrechtlichen Grundsätze, insbesondere des Grundsatzes der individuellen Zurechenbarkeit und des Grundsatzes der Lastengleichheit als gebührenrechtliche Ausprägung des allgemeinen Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG), unter Beachtung des Sonderopfergedankens verfassungsrechtlich sogar geboten. Die Kosten stellen dann in den Fällen, in denen der Zustandsstörer selbst Opfer eines unbekannten oder nicht mehr greifbaren Handlungsstörers geworden ist, unter Umständen keine Individuallast, sondern eine Gemeinlast dar. Eine Gemeinlast liegt vor, wenn sich keine sachtypische Gefahr verwirklicht hat und die Allgemeinheit an der Beseitigung ein wesentlich größeres Interesse hat als der Zustandsstörer. In vielen Opfer-Fällen wird dies der Fall sein. Der Eigentümer ist dann nicht Nichtstörer. Er ist weiterhin aufgrund seiner materiellen Polizeipflicht zur Beseitigung der Gefahr verpflichtet; er kann jedoch nach einer unmittelbaren Ausführung und Ersatzvornahme nicht zu den Kosten herangezogen werden. Falls er die Gefahr auf eigene Kosten abgewehrt hat, steht ihm aus Aufopferungsgesichtspunkten ein Ausgleichsanspruch entsprechend dem Anspruch des Nichtstörers zu.
Zusammenfassung 1. In der h.M. in Rechtsprechung und Literatur wird davon ausgegangen, daß die Kostentragungspflicht des Zustandsstörers Surrogat der Beseitigungspflicht ist. Dies führt insbesondere in den Altlasten-Fällen dazu, daß der Eigentümer eines kontaminierten Grundstücks, der selbst Opfer eines unbekannten Handlungsstörers geworden ist, kostentragungspflichtig ist. Um dieses als unbillig empfundene Ergebnis zu korrigieren, wird in der Literatur z.T. vorgeschlagen, den Eigentümer in solchen Fällen als Nichtstörer anzusehen oder seine Haftung zu begrenzen. Zur Begründung wird angegeben, die Zustandsstörerhaftung sei Ausdruck des Art. 14 GG und einer Risikoverteilung zwischen einzelnem und Allgemeinheit. Wenn die Gefahr aus der Risikosphäre der Allgemeinheit komme oder zu einer Störung der Privatnützigkeit des Eigentums führe, sei eine verfassungskonforme Haftungsreduktion geboten. 2. Die dieser Haftungsbegrenzung zugrundeliegende Annahme, daß Art. 14 GG der Rechtsgrund der Zustandsstörereigenschaft sei, läßt außer acht, daß die Ursache der Gefahr im Polizeirecht keine Rolle für die Verantwortlichkeit spielt, daß nicht nur der Eigentümer, sondern in erster Linie der Inhaber der tatsächlichen Sachherrschaft Zustandsstörer ist und daß der Eigentümer nicht Zustandsstörer ist, wenn die Sachherrschaft gegen seinen Willen ausgeübt wird. Dem Vorteil des Eigentums korrespondiert das Risiko, daß die störende Sache bei der Gefahrenabwehr vernichtet wird, nicht jedoch das Risiko, als Zustandsstörer zur Gefahrenbeseitigung verpflichtet zu werden. Aus einem Grundrecht würde andernfalls eine abstrakte, unbestimmte, nicht spezialgesetzlich normierte Gefahrenvermeidungspflicht mit Haftungsfolgen hergeleitet werden. 3. Gegen die Risikosphärentheorie spricht, daß durch ungenaue Kriterien wie "Risikosphären" die effektive Gefahrenabwehr gefährdet wird und entgegen den Grundsätzen des Polizeirechts Ursache und Vorhersehbarkeit eine Rolle für die Störerbestimmung spielen. 4. Die Pflichten des Zustandsstörers sind anhand der materiellen Polizeipflicht als einheitlichem Rechtsgrund von Handlungsstörer- und Zustandsstörerverantwortlichkeit zu bestimmen. Auszugehen ist dabei von der Aufgabe des Polizeirechts, schnelle und effektive Gefahrenabwehr zu gewährleisten.
156
Zusammenfassung
5. Ziel des Polizeirechts ist weder eine Sanktion wie im Strafrecht noch ein Schadensausgleich oder eine Haftungszurechnung wie im Zivilrecht. Die Vorschriften des Polizeirechts dienen auch nicht dazu, Aufwendungen von Steuermitteln zu vermeiden und der Allgemeinheit Kosten zu ersparen. Das Polizeirecht ist wirkungsorientiert und erfolgsbezogen. Sein Ziel ist die schnelle Beseitigung einer Gefahr. Polizeiliche Maßnahmen unterliegen dem Effektivitätspostulat. 6. Maßgebliches Kriterium für die Bestimmung der Störereigenschaft ist die rechtliche und tatsächliche Einwirkungsmöglichkeit. Für die Zustandsstörereigenschaft ist daher nicht das Eigentum und die damit verbundene Nutzungsmöglichkeit ausschlaggebend, sondern die mit der Sachherrschaft verbundene Einwirkungsmöglichkeit, die es dem Zustandsstörer ermöglicht, die Sache in einen gefahrenfreien Zustand zu versetzen. 7. Unter Beachtung des Effektivitätspostulats und des Zwecks des Polizeirechts als Gefahrenabwehrrecht ist die materielle Polizeipflicht nicht als Pflicht zu verstehen, den Zustand seiner Sachen so einzurichten, daß daraus keine Gefahr entsteht. Dies wäre eine - nach dem Ausscheiden der Wohlfahrtspflege aus dem Polizeibegriff - systemwidrige Gefahrenvermeidungs- und Untertanenwohlverhaltenspflicht. Eine aus der polizeilichen Generalklausel hergeleitete allgemeine Gefahrenvermeidungs- oder Gefahrenvorsorgepflicht ist zu unbestimmt und könnte auch nicht durch einen Polizeiverwaltungsakt, der ja eine bestehende Gefahr bereits voraussetzt, aktualisiert werden. 8. Die materielle Polizeipflicht ist die schon vor Erlaß des Polizeiverwaltungsakts bestehende eigenständige öffentlich-rechtliche Pflicht eines jeden Rechtsgenossen, nach Auftreten einer Gefahr in seinem Lebenskreis für Gefahrenfreiheit zu sorgen. Es handelt sich um eine Gefahrenabwehrund nicht um eine Gefahrenvermeidungspflicht. 9. Vom Nichtstörer unterscheidet sich der Störer dadurch, daß den Nichtstörer mit der Gefahr nichts verbindet als die Tatsache, daß er als unbeteiligter Dritter zufällig einen Beitrag zur Gefahrenbeseitigung leisten kann; der Störer hingegen hat, da die Gefahr in seinem Lebenskreis auftritt, typischerweise die Möglichkeit rascher und effektiver Einwirkung zur Gefahrenbeseitigung. 10. Die materielle Polizeipflicht als eigenständige ôffentlich-rèchtliche Pflicht eines jeden Rechtsgenossen, bei Auftreten einer Gefahr in seinem Lebenskreis für Gefahrenfreiheit zu sorgen, ist das Ergebnis einer Abwägung zwischem dem Interesse der Gemeinschaft an größtmöglicher Gefahrenfreiheit bei minimaler Einschränkung des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens, dem Interesse der Rechtsgenossen, erst nach Auftreten
Zusammenfassung
einer Gefahr in ihrem Lebenskreis zu gefahrenorientiertem Handeln verpflichtet zu sein, und den Interessen eines unbeteiligten Dritten, nur in Notfällen zur Beseitigung herangezogen zu werden. 11. Die Beseitigungspflicht des Störers ist nicht Resultat einer Grundrechtsüberschreitung oder einer Pflichtverletzung. Die materielle Polizeipflicht als Gefahrenabwehrpflicht ist eine verfassungsrechtliche Grundpflicht. Sie ist der Beitrag der Bürger zur Erfüllung der Staatsaufgabe Gefahrenabwehr. 12. Da die materielle Polizeipflicht nur als Mitwirkungspflicht zur Gefahrenabwehr verstanden werden kann, ist die Kostentragungspflicht nicht aus der materiellen Polizeipflicht herzuleiten. Die Auferlegung der Kosten dient nicht mehr der Gefahrenabwehr. Die Kostentragungspflicht unterliegt nicht dem polizeirechtlichen Effektivitätspostulat, sondern dem gebührenrechtlichen Postulat gerechter Lastenverteilung. Beide Prinzipien betreffen verschiedene Ebenen polizeilichen Handelns. 13. Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht müssen getrennt betrachtet werden. Da sie verschiedenen Prinzipien unterliegen, ist der Beseitigungspflichtige nicht immer kostentragungspflichtig. Damit ist eine Erklärung des Eigentümers eines kontaminierten Grundstücks zum Nichtstörer oder eine systemwidrige Haftungsreduzierung aus Kostengründen nicht notwendig. 14. Eine getrennte Betrachtung von Beseitigungspflicht und Kostentragungspflicht ist dem Polizeirecht nichtfremd: In den Fällen der gerechten Auswahl zwischen mehreren Störern und in den Fällen der Inanspruchnahme bei Anscheinsgefahr ist für die Heranziehung zur Beseitigung wegen des Effektivitätsgebots die ex-ante-Perspektive entscheidend, für die vermögensrechtlichen Fragen die ex-post-Perspektive. Das Postulat rückschauender Betrachtung spielte auch schon in den Fällen des Abschleppens von verbotswidrig geparkten Kraftfahrzeugen eine Rolle und wurde auch allerdings unter Bezugnahme auf Art. 14 GG - zur Lösung der AltlastenProblematik schon vorgeschlagen. 15. Bei den nach einer unmittelbaren Ausführung oder Ersatzvornahme geforderten Kosten (Gebühren und Auslagen) gelten die gebührenrechtlichen Grundsätze, insbesondere das Erfordernis der individuellen Zurechenbarkeit sowie der Grundsatz der Lastengleichheit. 16. Der Grundsatz der Lastengleichheit als abgabenrechtliche Ausprägung des allgemeinen Gleichheitssatzes verbietet auch, einen einzelnen Gebührenpflichtigen mit Kosten von Leistungen zu belasten, die der Allgemeinheit zugutekommen. Die Kostentragungspflicht (nicht aber die
158
Zusammenfassung
dem Effektivitätspostulat unterliegende Beseitigungspflicht!) entfällt daher, wenn es sich dabei nicht um eine Individuallast, sondern um eine Gemeinlast handelt und dem Störer ein Sonderopfer auferlegt würde. 17. Kriterien wie Privatnützigkeit, Risikosphären und Nutzenziehung sind nicht bei der dem Effektivitätspostulat unterliegenden Frage nach der Beseitigungspflicht oder der Zustandsstörereigenschaft, sondern erst bei der Betrachtung der Kostentragungspflicht und der Bestimmung eines Sonderopfers relevant. 18. Dem Zustandsstörer, der die Gefahr auf eigene Kosten beseitigt hat, steht bei Vorliegen einer Gemeinlast ein Ausgleichsanspruch analog Art. 49 Abs. 1 BayPAG zu, da er ein Sonderopfer zugunsten der Allgemeinheit erbracht hat. Damit ist der abwesende oder sich weigernde Zustandsstörer nicht besser gestellt als derjenige, der die Gefahr auf eigene Kosten beseitigt, obwohl es sich bei den dabei entstehenden Kosten um eine Gemeinlast handelt.
Literaturverzeichnis Albrecht, Karl-Dieter, Probleme der Kostenerhebung für polizeiliche Maßnahmen, in: Festschrift für Rudolf Samper zum 70. Geburtstag, hrsg. von Manfred Schreiber, Stuttgart, München Hannover 1982, S. 165. Arndt, Wolfgang, Wirtschaftsverwaltungsrecht, in: Udo Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 3. Auflage, Heidelberg 1988, S. 705. von Arnim, Hans Herbert, Besteuerung und Eigentum, W D S t R L 39 (1981), S. 286. Arnold, Rainer, Ausgestaltung und Begrenzung von Grundrechten im französischen Verfassungsrecht, JöR, Bd. 38 (1989), 197. Baur, Fritz, Der Ersatz der Aufwendungen für präventiven Gewässerschutz, JZ 1964, 354. Berner, Georg/Köhler, Michael, Polizeiaufgabengesetz, 11. Auflage, München 1990. Beye, Friedrich Wilhelm, Zur Dogmatik polizeirechtlicher Verantwortlichkeit, Diss, jur., Mainz 1969. Bielfeldt, Carsten, Rechtliche Probleme der Bebauung von Altlasten — Ordnungs- und sanierungsrechtliche Maßnahmen der Gemeinden, DÖV 1989, 441. Bott, Pia, Die Verantwortlichkeit wegen des Verhaltens Dritter im allgemeinen Sicherheitsund Polizeirecht, Diss. jur. Würzburg 1986. Bracher, Christian-Dietrich, Gefahrenabwehr durch Private, Berlin 1987. Brandner, Thilo, Gefahrenerkennbarkeit und polizeirechtliche Verhaltensverantwortlichkeit — Zur Störerverantwortlichkeit insbesondere bei Altlasten, Berlin 1990. Brandt, Edmund (Hrsg.), Altlasten - Untersuchung, Sanierung, Finanzierung, Taunusstein 1988. Brandt, Edmund/Lange, Holger, Kostentragung bei der Altlastensanierung, UPR 1987,11. Brandt, Edmund/Dieckmann, Martin/Wagner, Kersten, Altlasten und Abfallproduzentenhaftung, Düsseldorf 1988. Breuer, Rüdiger, "Altlasten" als Bewährungsprobe der polizeilichen Gefahrenabwehr und des Umweltschutzes, JuS 1986, 359. ~ Rechtsprobleme der Altlasten, NVwZ 1987, 751. - Umweltschutz und Gefahrenabwehr bei Anscheins- und Verdachtslagen, in: Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, hrsg. von Peter Selmer und Ingo v. Münch, Berlin, New York 1987, S. 317. Broß, Siegfried, Zur Erstattung der Kosten von Polizeieinsätzen, DVB1 1983, 377. Czeczatka, Sieghart, Der Einfluß privatrechtlicher Rechtsverhältnisse auf Erlaß und Inhalt polizeilicher Hoheitsakte — Zugleich ein Beitrag zur Begründung der materiellen Polizeipflicht, Frankfurt a. M. 1978.
160
Literaturverzeichnis
Diederichsen, Uwe, Verantwortlichkeit für Altlasten - Industrie als Störer?, BB 1988, 917. Dombert, Matthias, Altlastensanierung in der Rechtspraxis: rechtliche und technische Aspekte der Sanierung schadstoffbelasteter Betriebsflächen, Berlin 1990. Drews, Bill/Wacke, Gerhard/Vogel, Klaus/Martens, Wolfgang, Gefahrenabwehr, 9. Auflage, Köln, Berlin, Bonn, München 1986. Dürig, Günter, Art. 2 des Grundgesetzes und die Generalermächtigung zu allgemeinpolizeilichen Maßnahmen, AöR Bd. 79 (1953/54), 57. Engisch, Karl, Einführung in das juristische Denken, 7. Auflage, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1977. Emmerig, Ernst, Die Befreiung des Polizeirechts vom strafrechtlichen Denken, BayVBl 1955, 69. Erdmann, Joachim, Die Kostentragung bei Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs, Köln, Berlin, Bonn, München 1987 Erichsen, Hans-Uwe, Der Schutz der Allgemeinheit und der individuellen Rechte durch die polizei- und ordnungsrechtlichen Handlungsvollmachten der Exekutive, W D S t R L 35 (1977), S. 171. Erler, Arnold, Maßnahmen der Gefahrenabwehr und verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie, Berlin 1977. Fehn, Bernd J., Altlasten und Haftung - die Renaissance des allgemeinen Ordnungsrechts, VR 1987, 267. Fischer, Michael, Unterlassene Hilfeleistung und Polizeipflichtigkeit, Diss. jur. Tübingen 1989. Fleischer, Herbert, Die Auswahl unter mehreren PoHzeipflichtigen als Rechtsfrage, Diss. jur. Mainz 1980. - Polizeiliche Fragestellungen in Altlastenfällen, JuS 1988, 530. Forster, Elmar, Das von Privatpersonen veranlaßte Abschleppen widerrechtlich auf Privatgrund geparkter Fahrzeuge und damit zusammenhängende rechtliche Probleme unter besonderer Berücksichtigung der negatiorum gestio (ausgewählte Probleme), Diss. jur. Regensburg 1986. Friauf, Karl Heinrich, Öffentliche Sonderlasten und Gleichheit der Steuerbürger, in: Festschrift für Hermann Jahrreiß zum 80. Geburtstag, hrsg. vom Institut für Völkerrecht und ausländisches Recht der Universität Köln, Köln u.a. 1974, S. 45. ~ Polizei- und Ordnungsrecht, in: Ingo v. Münch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 8. Auflage, Berlin, New York 1988, S. 201. - Zur Problematik des Rechtsgrundes und der Grenzen der polizeilichen Zustandshaftung — untersucht am Beispiel der Haftung für Zufallsfolgen des modernen Massenverkehrs, in: Festschrift für Gerhard Wacke zum 70. Geburtstag, hrsg. von Klaus Vogel und Klaus Tipke, Köln 1972, S. 293. Gantner, Volker, Verursachung und Zurechnung im Recht der Gefahrenabwehr, Diss jur. Tübingen 1983. Geiger, Harald, Die Haftung des Kfz-Halters für polizeiliche Abschleppkosten, BayVBl 1983, 10.
Literaturverzeichnis
Gerhardt, Hans-Jürgen, Anscheinsgefahr, Gefahiverdacht und Putativgefahr im Polizei- und Ordnungsrecht, Jura 1987, 521. Giesberts, Ludger, Die gerechte Lastenverteilung unter mehreren Störern — Auswahl und Ausgleich insbesondere in Umweltschadensfällen, Berlin 1990. Götz, Volkmar, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 9. Auflage, Göttingen 1988. - Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension, W D S t R L 41 (1983), S. 7. - Die Entwicklung des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts (1984 bis 1986), NVwZ 1987, 858. - Kostenrecht der Polizei- und Ordnungsverwaltung, DVBl 1984,14. Graulich, Kurt, Die gesetzliche Regelung der unmittelbaren Ausführung im hessischen Polizeirecht und ihre Bedeutung für die Abschleppraxis, NVwZ 1988, 604. Heise, Gerd/Riegel, Reinhard, Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes, 2. Auflage, Stuttgart, München, Hannover 1978. Henneke, Hans-Günther, Finanzierungsformen im Abgabenstaat, Jura 1990, 63,113. Hennes, German, Der Verursachungsbegriff im Polizeirecht, Diss. jur. Heidelberg 1973. Herrmann, Nikolaus, Flächensanierung als Rechtsproblem, Baden-Baden 1989. - Verantwortlichkeit im allgemeinen Polizei- und Ordnungrecht, DÖV 1987, 666. Hiltl, Gerhard, Die Entfernung von Kfz auf Veranlassung der Polizei nach dem Recht der Gefahrenabwehr in Bayern, Diss. jur. Regensburg 1987. Hölzle, Klaus, Das Störungsverbot als präventive und repressive Verhaltensnorm im allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht — zum Rechtswidrigkeitsmerkmal der Störung, Diss, jur. Berlin 1986. Hoffmann-Riem, Wolfgang, "Anscheinsgefahr" und "Anscheinsverursachung" im Polizeirecht, in: Festschrift für Gerhard Wacke zum 70. Geburtstag, hrsg. von Klaus Vogel und Klaus Tipke, Köln 1972, S. 327. Hohmann, Harald, Einschränkungen der Kostentragungspflicht des Grundstückseigentümers bei Ablagern von Giftfässern, DVBl 1984, 997. - Nochmals: Zur Unterlassungstäterschaft im Abfallstrafrecht bei "wilden" Müllablagerungen, NJW 1989,1254. Hoppe, Werner/Beckmann, Martin, Umweltrecht, München 1989. Isensee, Josef, Die verdrängten Grundpflichten des Bürgers, DÖV 1982, 609. Jellinek, Walter, Verwaltungsrecht, 3. Auflage, Nachdruck Berlin 1966. Karpen, Ulrich, Anmerkung zu BVwG, Urt. v. 19.01.1989, JZ 1989, 895, JZ 1989, 898. Kimmel, Rolf-Dieter, Eigentum und Polizei, Diss. jur. München 1967. Kimminich, Otto, Art. 14 GG, in: Kommentar zum Bonner Grundgesetz (Bonner Kommentar), 35. Lieferung 1976. Kirchhof, Ferdinand, Die Höhe der Gebühr - Grundlagen der Gebührenbemessung, Berlin 1981. Kirchhof, Paul, Sicherungsauftrag und Handlungsvollmachten der Polizei, DÖV 1976, 449.
Literaturverzeichnis
162
Klaudat, Harald, Polizeipflicht und Kausalität, Diss. jur. Münster 1968. Kloepfer, Michael, Die Verantwortlichkeit für Altlasten im öffentlichen Recht, NuR 1987, 7. - Die lenkende Gebühr, AöR Bd. 97 (1972), 232. - Umweltrecht, München, 1989. Kloepfer, Michael/Thull, Rüdiger, Der Lastenausgleich unter mehreren polizei- und ordnungsrechtlich Verantwortlichen, DVB1 1989,1121. Knauf, Norbert, Gesamtschuld und Polizeikostenrecht, Diss jur. Hannover 1985. Knemeyer, Franz-Ludwig, Polizei- und Ordnungsrecht, 3. Auflage, München 1989. -
Polizei- und Sicherheitsrecht, in: Maunz, Theodor/Obermayer, Klaus/Berg, Wilfried/ Knemeyer, Franz-Ludwig, Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern, 5. Auflage, Stuttgart, München, Hannover 1988, S. 329.
- Der Schutz der Allgemeinheit und der individuellen Rechte durch die polizei- und ordnungsrechtlichen Handlungsvollmachten der Exekutive, W D S t R L 35 (1977), S. 221. - Polizeikosten im System von Verwaltungsabgaben und -kosten, JuS 1988, 866. Knopp, Lothar, Grenzen der Kostentragung durch den Grundstückseigentümer bei Altlasten, BB 1989,1425. - Praktische Rechtsfragen der Sicherung und Sanierung von kontaminierten Abfall-Ablagerungen und Standorten, BB 1990, 575. - Die "radioaktive" Altlast, NVwZ 1991, 42. Koch, Hans-Joachim, Bodensanierung nach dem Verursacherprinzip, Heidelberg 1985. - Altlasten — eine umweltpolitische Herausforderung, in: Brandt, Edmund (Hrsg.), Altlasten — Untersuchung, Sanierung, Finanzierung, Taunusstein 1988, S. 11. Köhler, Gerd-Michael, Anmerkung zu BayVGH, Beschl. v. 23.05.1984, BayVBl 1984, 559, BayVBl 1984, 630. König, Hans-Günther, Bayerisches Polizeirecht, 2. Auflage, Köln, Berlin, Bonn, München 1985. Kormann, Joachim, Lastenverteilung bei Mehrheit von Umweltstörern, UPR 1983, 281. Kothe, Peter, Probleme der Altlastenbeseitigung, ZRP 1987, 399. Krakau, Knud, Offene Rechtsfragen der Entschädigung für Seuchenschutzmaßnahmen, DÖV 1970,178. Krampol, Karl, Bei Vorhandensein von Zustandsstörer und Handlungsstören Freies Ermessen in der Auswahl? Verhältnismäßigkeitsgrundsatz? Beispiel: Öltransportunfälle, in : Festschrift für Rudolf Samper zum 70. Geburtstag, hrsg. von Manfred Schreiber, Stuttgart, München, Hannover 1982, S. 153. Kränz, Joachim, Zustandsverantwortlichkeit im Recht der Gefahrenabwehr, München, 1990. - Nochmals: Das Verhältnis von Verhaltens- und Zustandshaftung im Recht der Gefahrenabwehr, BayVBl 1985, 301. Krekel, Klaus, Die Kostenpflichtigkeit vollzugspolizeilicher Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung der Kostenerhebung von Großveranstaltern und von Störern bei Anwendung unmittelbaren Zwangs, Frankfurt a. M., Bern, New York 1986.
Literaturverzeichnis
Kühling, Jürgen, Kosten für den Einsatz der Polizei, DVBl 1981, 315. Kunig, Philip/Schwermer, Gerfried/Versteyl, Ludger-Anselm, Abfallgesetz, München 1988. Larenz, Karl, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Auflage, Berlin, Heidelberg, New York 1975. Lerche, Peter, Übermaß und Verfassungsrecht, Köln, Berlin, München, Bonn 1961. Löhnert, Waldemar, Der Begriff des Störers im Hinblick auf die rechtlichen Folgen, Diss. jur. Würzburg 1967. Luchterhand, Otto, Grundpflichten als Verfassungsproblem in Deutschland — Geschichtliche Entwicklung und Grundpflichten unter dem Grundgesetz, Berlin 1988. Mayer, Otto, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1.2, 3. Auflage, Berlin 1924 Merten, Detlef, Grundpflichten im Verfassungssystem der Bundesrepublik Deutschland, BayVBl 1978, 554. Mertens, Klaus, Die Kostentragung bei der Ersatzvornahme im Verwaltungsrecht, Berlin 1976. Mosler, Jürgen, Öffentlich-rechtliche Probleme bei der Sanierung von Altlasten, Frankfurt a. M. 1989. Nauschütt, Jürgen, Altlasten: Recht und Technologie der Umweltsanierung, Baden-Baden 1990. Niemuth, Bettina, Die Sanierung von Altlasten nach dem Verursacherprinzip, DÖV 1988,291. Ossenbühl, Fritz, Der polizeiliche Ermessens- und Beurteilungsspielraum — Zur Dogmatik von Gefahrenabwehrentscheidungen, DÖV 1976, 463. Ott, Wolfgang, Die gemeindliche Straßenreinigung als Natural- und Geldlast, Berlin 1978. Paetow, Stefan, Das Abfallrecht als Grundlage der Altlastensanierung, NVwZ 1990, 510. Papier, Hans-Jürgen, Altlasten und polizeiliche Störerhaftung, Köln, Berlin, Bonn, München 1985. - Die Entschädigung für Amtshandlungen der Polizei, DVBl 1975, 567. - Altlasten und polizeiliche Störerhaftung, DVBl 1985, 873. - Die Verantwortlichkeit für Altlasten im öffentlichen Recht, NVwZ 1986, 256. - Rechtsgrundlagen der Altlastensanierung, NWVB1 1989, 322. ~ Altlasten - Rechtsprobleme und politische Lösungsmodelle, Jura 1989, 505. Peine, Franz-Joseph, Die Rechtsnachfolge in öffentlich-rechtliche Pflichten, DVBl 1980, 941. - Rüstungsaltlasten, DVBl 1990, 733. Pietzcker, Jost, Polizeiliche Störerbestimmung nach Pflichtwidrigkeit und Risikosphäre, DVBl 1984, 457. - Öffentliches Recht: Die Altlast, JuS 1986, 719. Quaritsch, Helmut, Eigentum und Polizei, DVBl 1959, 455. Rid, Urban/Hammann, Wolf, Grenzen der Gefahrenabwehr im Umweltrecht, UPR 1990, 281. Samper, Martin/Honnacker, Rudolf, Polizeiaufgabengesetz (PAG), 14. Auflage, Stuttgart, München, Hannover 1987.
164
Literaturverzeichnis
Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, in: Udo Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 3. Auflage, Heidelberg 1988, S. 161. - Rechtsnachfolge in polizeiliche Pflichten?, GewArchiv 1976,1. - Erstattung der Kosten von Polizeieinsätzen, NJW 1983,1882. - Anmerkung zu BVwG, Urt. v. 04.10.1985, DVB11986, 360, DVB11986, 362. Schink, Alexander, Wasserrechtliche Probleme der Sanierung von Altlasten, DVB11986,161. - Abfallrechtliche Probleme der Sanierung von Altlasten, DVB1 1985,1149. Schnur, Roman, Probleme um den Störerbegriff im Polizeirecht, DVB11962,1. Scholler, Heinrich/Broß, Siegfried, Grundzüge des Polizei- und Ordnungsrechts in der Bundesrepublik Deutschland, 3. Auflage, Heidelberg 1981. ~ Entschädigungsleistungen an den Störer?, DÖV 1976, 472. Scholz-Form, Über die Verantwortlichkeit des Urhebers eines polizeiwidrigen Zustands und über den Ausschluß der Verantwortlichkeit im Falle der Ausübung des Rechtes, VeiwArchiv 30 (1925), 11, 244. Schräder, Christian, Altlastensanierung nach dem Verursacherprinzip? — Rechtsfragen der Kostenübernahme vor dem Hintergrund der Legalisierungswirkung von Genehmigungen, Berlin 1988. Schwachheim Jürgen F., Unternehmenshaftung für Altlasten: die polizeirechtliche Verantwortlichkeit der Industrie unter besonderer Berücksichtigung des Verfassungsrechts, Köln, Berlin, Bonn, München 1991. - Zum Gesamtschuldnerausgleich unter mehreren Störern, NVwZ 1988, 225. Seibert, Max-Jürgen, Zum Zusammenhang von Ordnungs- und Kostentragungspflicht, DVB1 1985, 328. Selmer, Peter, Gedanken zur polizeilichen Verhaltensverantwortlichkeit — zugleich ein Beitrag zur angeblichen Dichotomie Störer/Nichtstörer, in: Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, hrsg. von Peter Selmer und Ingo v. Münch, Berlin, New York 1987, S. 483. Spannowsky, Willy, Altlastensanierung und Störerhaftung im Spannungsfeld von Gerechtigkeit und Effizienz, UPR 1988, 376. Spießhofer, Birgit, Der Störer im allgemeinen und im Sonderpolizeirecht, Frankfurt a. M. 1989. Staupe, Jürgen, Rechtliche Aspekte der Altlastensanierung, DVB11988, 606. Stober, Rolf, Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension, NVwZ 1982, 473. ~ Finanzierung der Wirtschaftsverwaltung durch Abgaben, JA 1988, 250. SRU - Der Sachverständigenrat für Umweltfragen, Altlasten - Sondergutachten 1989, Stuttgart 1990. Ule, Carl Herrmann/Rasch, Ernst, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Band III, 1. Halbband, 2. Auflage, Köln, 1982. Vieth, Willi, Rechtsgrundlagen der Polizei- und Ordnungspflicht, Berlin 1974.
Literaturverzeichnis
Vogel, Klaus, Vorteil und Verantwortlichkeit - Der doppelgliedrige Gebührenbegriff des Grundgesetzes, in: Festschrift für Willi Geiger zum 80. Geburtstag, hrsg. von Hans Joachim Faller, Paul Kirchhof und Ernst Träger, Tübingen 1989, S. 518. Vollmuth, Joachim, Die Bestimmung der polizeirechtlich relevanten Ursache, Diss. jur. München 1972. Wacke, Gerhard, Der Begriff der Verursachung im Polizeirecht (Bedingungslehre), DÖV 1960, 93. Wegmann, Bernd, Zur Frage des Konkurrenzverhältnisses von Handlungs- und Zustandsverantwortlichkeit im Recht der Gefahrenbeseitigung und im Kostenrecht des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes, BayVBl 1984, 685. Wendt, Rudolf, Die Gebühr als Lenkungsmittel, Hamburg 1975. Wilke, Dieter, Gebührenrecht und Grundgesetz - Ein Beitrag zum allgemeinen Abgabenrecht, München, 1973. Wolf, Heinz, Polizeirecht und Altlasten, VB1BW 1988, 208. Wolff, Hans J./Bachof, Otto, Veiwaltungsrecht I, 9. Auflage, München 1974. - Verwaltungsrecht III, 4. Auflage, München 1978. Würtenberger, Thomas, Erstattung von Polizeikosten, NVwZ 1983,192. Ziehm, Hanno, Die Störerverantwortlichkeit für Boden- und Wasserverunreinigungen — Ein Beitrag zur Haftung für sogenannte Altlasten, Berlin 1989.
![Die Kompetenz des Vermittlungsausschusses - zwischen legislativer Effizienz und demokratischer Legitimation: Dargestellt am Beispiel des Steuergesetzgebungsverfahrens [1 ed.]
9783428532094, 9783428132096](https://dokumen.pub/img/200x200/die-kompetenz-des-vermittlungsausschusses-zwischen-legislativer-effizienz-und-demokratischer-legitimation-dargestellt-am-beispiel-des-steuergesetzgebungsverfahrens-1nbsped-9783428532094-9783428132096.jpg)
![Die verfassungsrechtlichen Grenzen der Tätigkeit des Vermittlungsausschusses: Dargestellt am Beispiel des 2. Haushaltsstrukturgesetzes [1 ed.]
9783428456475, 9783428056477](https://dokumen.pub/img/200x200/die-verfassungsrechtlichen-grenzen-der-ttigkeit-des-vermittlungsausschusses-dargestellt-am-beispiel-des-2-haushaltsstrukturgesetzes-1nbsped-9783428456475-9783428056477.jpg)
![Die Aufgabe der Zusammenschlußkontrolle: dargestellt am Beispiel der Sanierungsfusion [1 ed.]
9783428448951, 9783428048953](https://dokumen.pub/img/200x200/die-aufgabe-der-zusammenschlukontrolle-dargestellt-am-beispiel-der-sanierungsfusion-1nbsped-9783428448951-9783428048953.jpg)
![Die verfassungsrechtliche Belastungsgrenze der Unternehmen,: dargestellt am Beispiel der Personalzusatzkosten [1 ed.]
9783428487400, 9783428087402](https://dokumen.pub/img/200x200/die-verfassungsrechtliche-belastungsgrenze-der-unternehmen-dargestellt-am-beispiel-der-personalzusatzkosten-1nbsped-9783428487400-9783428087402.jpg)
![Die Grundrechtsrelevanz »virtueller Streifenfahrten« – dargestellt am Beispiel ausgewählter Kommunikationsdienste des Internets [1 ed.]
9783428551712, 9783428151714](https://dokumen.pub/img/200x200/die-grundrechtsrelevanz-virtueller-streifenfahrten-dargestellt-am-beispiel-ausgewhlter-kommunikationsdienste-des-internets-1nbsped-9783428551712-9783428151714.jpg)
![Sozialmoral und Verfassungsrecht: Dargestellt am Beispiel der Rechtsprechung des amerikanischen Supreme Court und ihrer Analyse durch die amerikanische Rechtstheorie [1 ed.]
9783428500543, 9783428100545](https://dokumen.pub/img/200x200/sozialmoral-und-verfassungsrecht-dargestellt-am-beispiel-der-rechtsprechung-des-amerikanischen-supreme-court-und-ihrer-analyse-durch-die-amerikanische-rechtstheorie-1nbsped-9783428500543-9783428100545.jpg)
![Der Arbeiterhaushalt im 18. und 19. Jahrhundert: Dargestellt am Beispiel des Heim- und Fabrikarbeiters [1 ed.]
9783428413546, 9783428013548](https://dokumen.pub/img/200x200/der-arbeiterhaushalt-im-18-und-19-jahrhundert-dargestellt-am-beispiel-des-heim-und-fabrikarbeiters-1nbsped-9783428413546-9783428013548.jpg)
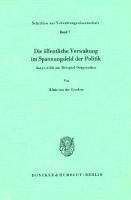
![Die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft: Eine wissenschafts- und erkenntnistheoretische Analyse am Beispiel der Klimaforschung [1. Aufl.]
9783839419748](https://dokumen.pub/img/200x200/die-glaubwrdigkeit-der-wissenschaft-eine-wissenschafts-und-erkenntnistheoretische-analyse-am-beispiel-der-klimaforschung-1-aufl-9783839419748.jpg)
![Inhalt und Grenzen des Grundsatzes der Planerhaltung: Dargestellt am Beispiel der §§ 214-216 BauGB [1 ed.]
9783428506989, 9783428106981](https://dokumen.pub/img/200x200/inhalt-und-grenzen-des-grundsatzes-der-planerhaltung-dargestellt-am-beispiel-der-214-216-baugb-1nbsped-9783428506989-9783428106981.jpg)
![Die materielle Polizeipflicht des Zustandsstörers und die Kostentragungspflicht nach unmittelbarer Ausführung und Ersatzvornahme - dargestellt am Beispiel der Altlasten-Problematik [1 ed.]
9783428471645, 9783428071647](https://dokumen.pub/img/200x200/die-materielle-polizeipflicht-des-zustandsstrers-und-die-kostentragungspflicht-nach-unmittelbarer-ausfhrung-und-ersatzvornahme-dargestellt-am-beispiel-der-altlasten-problematik-1nbsped-9783428471645-9783428071647.jpg)