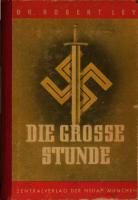Die grosse Krise in Amerika. Vergleichende Studien zur politischen Sozialgeschichte 1929 - 1939 9783647359571, 3525359578, 9783525359570
137 98 12MB
German Pages [244]
Polecaj historie
Citation preview
KRITISCHE STUDIEN ZUR GESCHICHTSWISSENSCHAFT Herausgegeben von Helmut Berding, Jürgen Kocka, Hans-Christoph Schröder, Hans-Ulrich Wehler
Band 6 Die große Krise in Amerika Herausgegeben von Heinrich August Winkler
GÖTTINGEN • VANDENHOECK & RUPRECHT · 1973
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die große Krise in Amerika Vergleichende Studien zur politischen Sozialgeschichte 1929-1939
Mit Beiträgen von Willi Paul Adams, Ellis W. Hawley, Jürgen Kocka, Peter Lösche, Hans-Jürgen Puhle, Heinrich August Winkler, Hellmut Wollmann
Herausgegeben von Heinrich August Winkler
GÖTTINGEN · VANDENHOECK & RUPRECHT · 1973 © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
ISBN 3-525-35957-8 Umschlag: Peter Kohlhase © Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1973. - Printed in Germany. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus auf foto- oder akustomechanischem Wege zu vervielfältigen, - Satz und Druck: Guide-Druck, Tübingen. Bindearbeit: Hubert Sc Co., Göttingen
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Inhalt Einleitung
7
ELLIS W. HAWLEY
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“ in internationaler Sicht JÜRGEN KOCKA
Die Organisationen amerikanischer Angestellter in Wirtschaftskrise und New Deal
40
PETER LÖSCHE
Arbeiterbewegung und New Deal: Zur Integration der amerikanischen Gewerkschaften in den Organisierten Kapitalismus . . . .
81
HANS-JÜRGEN PUHLE
Populismus, Krise und New Deal: Zum Verhältnis von agrarischer Demokratie und organisiertem Subventionismus in der Zwischenkriegszeit 107 HELLMUT WOLLMANN
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal: Eine Fallstudie über die 153 Grenzen der Sozialpolitik WILLI PAUL ADAMS
Krise des amerikanischen Konstitutionalismus: Der New Deal vor Gericht 189 HEINRICH AUGUST WINKLER
Die Anti-New-Deal-Bewegungen: Politik und Ideologie der Opposition gegen Präsident F. D. Roosevelt 216 Autorenverzeichnis
236
Abkürzungsverzeichnis
238
Register
240
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Einleitung Für deutsche Betrachter scheint die Geschichte der Jahre 1933 bis 1945 gleichsam im Nationalsozialismus aufzugehen. Die faschistische Diktatur war — zumindest für diejenigen, die sie bewußt erlebt haben — eine so überwältigende Erfahrung, daß alle anderen Entwicklungen daneben verblassen mußten. Das deutsche Geschichtsbild nimmt, überspitzt formuliert, von anderen Staaten nur insoweit Kenntnis, als diese etwas mit dem Deutschland Adolf Hitlers zu tun hatten: sie erscheinen lediglich als außenpolitische Akteure. Die innere Entwicklung dieser Länder ist im allgemeinen Bewußtsein ein weißer Fleck geblieben. Das gilt auch für die Vereinigten Staaten von Amerika. Zwar wissen Kenner der amerikanischen Szene natürlich längst, daß die gegenwärtigen Probleme der westlichen Führungsmacht nicht zu begreifen sind, wenn sie nicht in historischer Perspektive gesehen werden. Zwar stimmen grundsätzlich heute die meisten Historiker darin überein, daß ein verengter nationalstaatlicher Blickwinkel keinen Zugang zum Verständnis der Weltgeschichte erlaubt. Aber die Praxis des akademischen und schulischen Lehrbetriebs entspricht dieser Einsicht noch nicht im wünschenswerten Maße. Die Wirkung eines nationalen Partikularismus zeigt sich noch in seiner theoretischen Negation. Wer etwa eine allgemeine Theorie über den Zusammenhang von Kapitalismus und Faschismus entwickeln will, muß ihr ein umfassendes historisches Vergleichsmaterial zugrunde legen, und darf nicht vorschnell das deutsche „Beispiel“ verallgemeinern. Letzteres scheint indes, obwohl meist mehr implizit als explizit, schon fast zum Regelfall geworden. Eine vergleichende Betrachtung der Zwischenkriegszeit könnte demgegenüber sowohl den Blick schärfen für die spezifischen Vorbedingungen, die den faschistischen Bewegungen in Teilen Europas den Erfolg ermöglichten, als auch für den andersartigen sozialen und institutionellen Rahmen, der in den angelsächsischen Ländern demokratische Problemlösungen begünstigte. Wenn nun der Vergleich der amerikanischen und der deutschen Geschichte zwischen 1929 und 1939 etwas lehrt, dann dies, daß prinzipiell identische ökonomische Herausforderungen diametral entgegengesetzte politische Antworten finden können. Die Vereinigten Staaten sind, wie Jürgen Kocka in diesem Band darlegt, von der Weltwirtschaftskrise insgesamt kaum minder hart getroffen worden als das Deutsche Reich. Dennoch hat die am höchsten entwikkelte kapitalistische Gesellschaft nicht ihr demokratisches Regierungssystem zugunsten eines totalitären aufgegeben, sondern die Krise durch Reformen zu bewältigen versucht. Eine solche qualitative Differenz hervorheben heißt nun freilich nicht Mängel und Grenzen des New Deal der Kritik entziehen. Die Maßnahmen der Administration Franklin Delano Roosevelts zielten, in heutigen Begriffen ge-
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
8
Einleitung
sprochen, nicht auf „Systemüberwindung“, sondern auf „Systemstabilisierung“. Wer dies feststellt, muß aber zugleich fragen, ob irgendeine prinzipielle Alternative zum kapitalistischen Wirtschaftssystem eine repräsentative Basis in der amerikanischen Gesellschaft besaß. Auch wenn man davon ausgeht, daß die Roosevelt-Administration zunächst über einen ganz erheblichen, keineswegs voll ausgenutzten Handlungsspielraum verfügte, dürfte die Antwort eher auf ein Nein hinauslaufen. Die Kritik ist damit noch nicht widerlegt, wohl aber historisch relativiert. Die „Neue Linke“ in der amerikanischen Geschichtswissenschaft, die die Vergangenheit des eigenen Landes oft in einer ähnlichen nationalstaatlichen Isolierung betrachtet wie konservative Historiker, tut sich schwer, diese Einschränkung ihrer scharfen Urteile hinzunehmen. Für manche marxistischen Faschismus-Theoretiker gilt Entsprechendes. Die Suche nach „funktionalen Äquivalenten“ zum deutschen und italienischen Faschismus verleitet sie häufig dazu, grundlegende Unterschiede zwischen liberaler Demokratie und faschistischer Diktatur zu übersehen und formalen Übereinstimmungen — etwa im Bereich staatlicher Wirtschaftslenkung — eine unangemessene Bedeutung einzuräumen. Eine undogmatisch vergleichende Geschichtswissenschaft kann solche Verengungen nicht akzeptieren. Die Autoren des vorliegenden Bandes, die im übrigen von durchaus unterschiedlichen Standpunkten ausgehen, sind sich dessen bewußt. Die meisten von ihnen behandeln ausgewählte Probleme der politischen Sozialgeschichte Amerikas in der Zwischenkriegszeit, indem sie sich explizit für eine vergleichende Perspektive entscheiden. Ellis W. Hawley von der University of Iowa, der einzige Amerikaner unter den Autoren dieses Bandes, skizziert den theoretischen Bezugsrahmen, wenn er den New Deal als eine besondere Erscheinungsform des „Organisierten Kapitalismus“ (Rudolf Hilferding) analysiert. Jürgen Kocka (Münster) und Peter Lösche (Berlin) befassen sich mit der politischen Entwicklung der Arbeitnehmer. Beide Autoren sehen sich mit dem Problem konfrontiert, weshalb die Krise keine breite Fundamentalopposition hervorrief — sei es eine sozialistischer oder eine faschistischer Provenienz. Das Scheitern der agrarischen Protestbewegungen ist das Thema des Aufsatzes von Hans-Jürgen Puhle (Münster), der zugleich den Bogen zurückschlägt zum Populismus des 19. Jahrhunderts und damit den Bezugspunkt für einen internationalen Vergleich findet. Hellmut Wollmann (Heidelberg) zeigt am Beispiel des Wohnungsbaus, wie eng die Grenzen der Rooseveltschen Sozialpolitik da waren, wo diese nicht von machtvollen Organisationen gestützt wurde. Willi Paul Adams (Frankfurt) behandelt in seiner Studie über den Supreme Court eine wichtige institutionelle Schranke der Reformpolitik F. D. Roosevelts. Der Herausgeber versucht abschließend das Scheitern der gegen den New Deal gerichteten Bewegungen zu erklären und ihre Eigenarten gegenüber den europäischen Faschismen herauszuarbeiten. Für die Herstellung des Registers und ihre Mitarbeit beim Lesen der Korrekturen danke ich Fräulein Christiane Sigwart. Heinrich August Winkler Freiburg 1. Br., im November 1972 © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“ in internationaler Sicht“ Von ELLIS W. HAWLEY
In den letzten Jahren haben zwei geschichtswissenschaftliche Entwicklungen ältere Interpretationen der amerikanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts abgelöst, und zwar insbesondere jene Interpretationen, die ihr Hauptaugenmerk auf die Politik der Liberalen gerichtet und in dem modernen amerikanischen Staat den Triumph einer bodenständigen liberalen Demokratie erblickt hatten. Es handelt sich bei den neuen Tendenzen einerseits um das Aufkommen einer „Organisationsgeschichte'', für die der Aufstieg einer bürokratisierten Industriewirtschaft und das damit Hand in Hand gehende Streben nach Ordnung, Stabilität und Systematisierung die zentralen Themen der jüngsten amerikanischen Entwicklung darstellen1. Die andere Richtung ist gekennzeichnet durch die Renaissance der „Vergleichenden Geschichtswissenschaft“, welche die „Einzigartigkeit“ der amerikanischen Entwicklung aufs neue in Frage stellt. Die grundlegenden Prozesse, die die Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten gestalteten, sollen nach dieser Auffassung ihr Gegenstück in anderen sich modernisierenden Gesellschaften haben. Für das Verständnis der amerikanischen Geschichte wie auch der Weltgeschichte ist es unumgänglich, diese gemeinsamen Entwicklungen zu ermitteln und festzustellen, welche Abweichungen sich in den verschiedenen institutionellen Rahmen herausgebildet haben2. Durch eine gründliche Beschäftigung mit Franklin D. Roosevelts New Deal war es den beiden neuen wissenschaftlichen Richtungen möglich, zuvor nur undeutlich erkennbare Beziehungen klarer herauszuarbeiten. Wenn man die Periode des New Deal beispielsweise unter organisationsgeschichtlichen Aspekten untersucht, erscheint sie als das Stadium der Konsolidierung in der Entwicklung eines koordinierten und organisierten Kapitalismus — mit anderen Worten: als eine Zeit, in der die Führungsgruppen der amerikanischen Politik und Wirtschaft nach Möglichkeiten suchten, um die für die Erhaltung der sozialen Stabilität und für die Rationalisierung des Marktverhaltens erforderlichen Mittel und Wege zu finden und mit den Problemen der Gesamtnachfrage und der Kapitalentwicklung fertig zu werden3. Vom vergleichenden Standpunkt aus gesehen wird der Aufstieg des „organisierten Kapitalismus“ in den Vereinigten Staaten zu einem Teilgebiet einer umfassenderen „Revolution der Manager“, die für moderne Gesellschaften des 20. Jahrhunderts überhaupt kennzeichnend ist. Natürlich sind in diesen Gesellschaften Unterschiede im * Aus dem Amerikanischen von Liselotte und Raymund Mickel
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
10
Ellis W. Hawley
Hinblick auf Intensität und Tempo und auf die Resultate jener Revolution zu beobachten. Diese Unterschiede hängen von den Vorstellungen der leitenden Kreise und von dem jeweiligen institutionellen Rahmen ab. Aber die Übernahme der modernen Technologie, die Erfordernisse der Kriegführung des 20. Jahrhunderts und die Bemühungen von „Reformern“, mit den damit einhergehenden sozialen Unruhen fertig zu werden, haben überall stark bürokratisierte politische und ökonomische Strukturen hervorgebracht. In allen Fällen spielt der Nationalstaat nun auch im Ablauf der ökonomischen Prozesse eine weit größere Rolle. Und überall gerät die Macht mehr und mehr in die Hand der Manager, der „Planer“ und Techniker, die als Bürokraten, Wissenschaftler und Fachleute neue Bedeutung gewinnen. In den meisten Fällen hat der Aufstieg der bürokratischen Industriewirtschaft darüber hinaus nicht nur erbitterte Konflikte über die Verteilung von Macht und Einkommen ausgelöst, sondern auch heftige Spannungen zwischen den neuen und den aus der Vergangenheit überkommenen Wertmaßstäben. In Gesellschaften zum Beispiel, wo das neue System auf merkantilistische, feudale oder absolutistische Fundamente aufgestockt wurde, war eine der Haupttendenzen der Modernisierungsideologien, ihre Forderungen mit der Lebensweise der aristokratischen Militärkaste, mit den Bedürfnissen des Staates und der Anziehungskraft älterer Hierarchien und traditioneller sozialer Ordnungen in Einklang zu bringen. In Gesellschaften, wo die moderne Technologie von einem revolutionären Regime der politischen Linken eingeführt wurde, haben „Revisionisten“ den Versuch unternommen, die revolutionären Ideale den Bedürfnissen der technischen Elite und der Manager anzupassen. In Gesellschaften, wo die nationale Integration auf starke lokale Traditionen stieß, hat man häufig nach Möglichkeiten gesucht, die „Wohltaten“ der Zentralisierung sicherzustellen, ohne dafür die Voneile der lokalen Autonomie und einer aktiven Betätigung der Bürger auf der örtlichen Ebene zu opfern. In Gesellschaften schließlich, wo das neue System sich auf dem Nährboden eines bereits vorhandenen Unternehmer-Kapitalismus entwickelte, wo also die Ideologie des klassischen Liberalismus feste Wurzeln geschlagen hatte und wo der „Weg zum modernen Industrialismus“ durch die „utopischen Träume des 18. Jahrhunderts“4 führte, wurde es notwendig, die neue Ordnung in das Erbe konkurrierender individualistischer und anti-planwirtschaftlicher Ideale einzubauen. Zeitweise waren die dieser Entwicklung innewohnenden Spannungen freilich kaum bemerkbar — eine Feststellung, die besonders für die Zeit gilt, in der der aufkommende bürokratische Industrialismus den Anschein erweckte, daß er das Fundament für materiellen Reichtum, für soziale Integration und nationale Größe legte. Dies war zum Beispiel in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg, in den Vereinigten Staaten der zwanziger Jahre oder auch in Frankreich ausgangs der zwanziger Jahre der Fall. Zu anderen Zeiten jedoch, und besonders während der Periode lähmenden wirtschaftlichen Niedergangs, die die fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften in den dreißiger Jahren durchmachten, kamen die Spannungen wieder in akuter Form zum Vorschein, wobei © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“
11
sie sich nach 1929 offenbar infolge zweier widerstreitender Tendenzen verschärften. Während einerseits die Exponenten des neuen industriellen Systems ihre Schwierigkeiten mehr und mehr einem „ruinösen Konkurrenzkampf“ und der „sozialen Anarchie“ in die Schuhe schoben, wurden beharrliche Forderungen nach einer festeren Organisation, größerer sozialer Disziplin und einer stärkeren Heranziehung des Staates bei der Planung, Rationalisierung und Stabilisierung wirtschaftlicher Unternehmen laut. In dem Maß, wie das Vertrauen in die damaligen Wirtschaftsführer und ihre Argumente schwand und man sich der Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit bewußt wurde, tauchten auf der anderen Seite nicht weniger nachdrückliche Forderungen auf, wonach ererbte Ideale wieder zu ihrem Recht kommen und die angeblich mißbrauchten wirtschaftlichen Kontrollen abgebaut, neuerrichtet, neugeregelt oder gar verstaatlicht werden sollten. In den dreißiger Jahren führten diese widerstreitenden Tendenzen zu einer ideologischen Konstellation, die wohl von Nation zu Nation beträchtliche Unterschiede aufwies, die im großen und ganzen aber für die Politik in den meisten fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften kennzeichnend war. Es wurde eine Unzahl von korporativistischen und nationalistischen Lösungen angeboten, die von der rechten Seite des politischen Spektrums ausgingen und den Anspruch erhoben, gegen den „ruinösen Konkurrenzkampf“ und die „soziale Anarchie“ vorzugehen, während sie gleichzeitig die Verwirklichung hochgehaltener nationaler Ideale ermöglichen wollten. Sie reichten von einem modernisierten Gildensozialismus über den „kooperativen“, den „genossenschaftlichen“ oder „christlichen“ Kapitalismus bis zu einer Art zentral gelenkter Kriegswirtschaft. In der politischen Mitte, wo der klassische Liberalismus jetzt in schlechtem Ruf stand, wurde eine ganze Kollektion von „neuen Liberalismen“ entwickelt, die alle die organisierte Industrie und den modernen Staat in den liberalen Rahmen zu integrieren versuchten, wobei man sich bemühte, die liberalen Ideale mit den neuen Bestrebungen nach Ordnung, Planung und sozialer Gerechtigkeit zu verbinden. Auf der Seite der Linken, deren Konzeptionen im allgemeinen eine Übertragung der Macht an Arbeiterorganisationen oder an „Vertreter“ der Arbeiterklasse vorsahen, entstand eine Mischung aus aufgefrischten marxistischen, syndikalistischen und pluralistischen Zukunftsvisionen. Auch eine Anzahl von vorindustriellen und antiindustriellen Ideologien warb um Konvertiten aus allen politischen Lagern, wobei einige agrarische, feudalistische oder absolutistische Modelle im Auge hatten, während andere „post-industrielle“ Utopien etwickelten. Bis zu einem gewissen Grad hing die Politik einer jeden Nation davon ab wofür sich die Inhaber der Schlüsselpositionen entschieden, und von jenen nicht vorherzusehenden Zufälligkeiten, durch die bestimmte Männer oder Gruppen an die Macht kamen. Doch war der Bereich, in welchem persönliche Entscheidungen möglich waren oder wo der Zufall entschied, deutlich durch den institutionellen Rahmen eingeschränkt, in dem konkurrierende Gruppen und ideologische Modelle aufeinanderprallten. Rechtsradikale Lösungen zum Beispiel © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
12
Ellis W. Hawley
waren weniger wahrscheinlich in Gesellschaften mit ererbten Unternehmeridealen und liberal-demokratischen Wertbegriffen, mit einer mächtigen und gesellschaftlich anerkannten Arbeiterbewegung, wo man seit langem in der Politik mehr Wert auf die Herstellung von Konsens als auf Polarisierung legte. Und umgekehrt waren sie wahrscheinlicher in Industriegesellschaften, wo das Stadium des Unternehmerkapitalismus übersprungen worden oder kaum in Erscheinung getreten war, wo sich ein mächtiger Landadel und eine Militärkaste erhalten und sich Mittelschichten herausgebildet hatten, die von vorkapitalistischen Wertbegriffen ausgingen, eine intensive Abneigung gegenüber der Arbeiterbewegung empfanden und mehr für eine Politik der Unterdrückung und Ausschaltung als für eine Politik des allgemeinen Konsens waren. In solchen Gesellschaften also konnten sich starke rechtsgerichtete Koalitionen bilden — Koalitionen, die in der Regel aus Militär-Aristokraten und ultranationalen Extremisten, aus mittelständischen Korporativisten und Romantikern bestanden, aus Technokraten und Ingenieuren der Produktionsgüterbranchen und Direktoren von Großkonzernen. Einmal an der Macht, haben diese Koalitionen alle liberalen oder linksorientierten Bestrebungen unterdrückt und so die fortdauernden politischen Konflikte abgelenkt auf Auseinandersetzungen zwischen dem bürokratischen Industrialismus einerseits und reaktionären Romantikern, technokratischen Utopisten und politisch-militärischen Abenteurern andererseits. Die Erfahrungen Italiens, Japans und Deutschlands sind hierfür typisch. In allen drei Ländern hat der institutionelle Rahmen — trotz wesentlicher Abweichungen im einzelnen — die Behauptung oder Ergreifung der Macht durch eine rechtsgerichtete Koalition begünstigt, und hier wie dort hat sich die politische Interaktion zwischen konkurrierenden Gruppen und Modellen bald auf die zwischen den Mitgliedern der herrschenden Koalition beschränkt. Im halb-industriellen Italien zum Beispiel, wo ein etabliertes faschistisches Regime den führenden Industriellen half, den Wettbewerb zu kontrollieren und für soziale Disziplin zu sorgen, stammten die konkurrierenden Modelle aus dem Korporativismus faschistischer „Revolutionäre“ und aus dem Expansionismus der Ultranationalisten5. In dem sich modernisierenden, aber traditionsorientierten Japan, wo eine fest organisierte Geschäftswelt sich auf staatliche Unterstützung verließ, von antikapitalistischen Militaristen und Traditionalisten jedoch bekämpft wurde, fand die Kollision statt zwischen einem patriarchalischen Wohlfahrtskapitalismus, einem militaristischen Dirigismus und verschiedenen vorindustriellen Modellen6. Und im hochindustrialisierten Deutschland, wo ein verlorener Krieg, tiefgreifende Inflationsfolgen und radikale Tendenzen innerhalb der Arbeiterbewegung es einer rechtsgerichteten Koalition besonders leicht gemacht hatten, die Macht an sich zu reißen, bestanden auch weiterhin Spannungen zwischen einer kartellierten Wirtschaft, wie sie die führenden Industriellen wünschten, den romantischen Ideen eines „Mittelklassen-Sozialismus“, den Effizienzkult des „wissenschaftlichen“ Managements und den politischen Zielen der nationalsozialistischen Führer7. Wenn auch Unterschiede in den © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“
13
Institutionen und in Einzelheiten bestanden, waren doch die beteiligten Gruppen und Ideologien sich bemerkenswert ähnlich. Und in allen drei Ländern bestand die Tendenz, die mittelständischen Romantiker beiseite zu drängen, die organisierte Wirtschaft funktional aufzugliedern und schließlich die gesamte Industrie in die vom Staat dirigierte Kriegswirtschaft zu integrieren. In anderen Industrienationen, deren institutionelles Erbe rechtsradikalen Lösungen weniger günstig war, gab es andere Modelle. In Frankreich zum Beispiel, wo bürokratischer Zentralismus, politische Polarisierung und starke korporativistische Tendenzen mit einem rigiden Arbeitgeberstandpunkt und einer schwächer ausgeprägten Tendenz zur Wirtschaftskonzentration zusammentrafen, wechselte die Politik häufig. Sie schwankte hin und her zwischen den Empfehlungen der klassischen Volkswirtschaftslehre, einer begrenzten „Wirtschaftsplanung“ und den arbeiterfreundlichen Maßnahmen der Volksfront, brachte es jedoch bis zur militärischen Niederlage von 1940 fertig, Versuche einer rechtsradikalen Machtübernahme abzuwehren8. In den skandinavischen Ländern mit ihren mächtigen, aber weniger radikalen Arbeiterbewegungen, ihren starken Kooperativen und ihrer auf breiten Konsens zielenden Politik entschied man sich für einen „mittleren Weg“, gekennzeichnet durch tarifvertragliche Abmachungen, Investitionsplanung und wohlfahrtsstaatliche Politik9. In Großbritannien endlich, dem Vorkämpfer des Unternehmer-Kapitalismus und einer demokratischen Arbeiterbewegung, hat die traditionelle Anhänglichkeit an die klassische Volkswirtschaftslehre, an die wohlfahrtsstaatlichen Prinzipien der Torys und den demokratischen Sozialismus nicht nur bewirkt, daß diese verschiedenen Richtungen sich gegenseitig ihrer Wirkung beraubten, sondern daß darüber hinaus auch der Einfluß anderer Modelle eingeschränkt wurde. „Planung“ blieb suspekt, obwohl sie von rechts wie von links gefordert wurde. „Erzwungener“ Wettbewerb und die hochgeschätzte Vertrags- und Koalitionsfreiheit gerieten miteinander in Konflikt. Und obwohl für bestimmte Industrien Zwangskartelle eingerichtet wurden, konnte die verbreitete Bewegung zur „industriellen Selbstverwaltung“ niemals die starken antimonopolistischen Traditionen und die Vorliebe der Arbeiterbewegung für Nationalisierung statt Rationalisierung überwinden10.
II In den Vereinigten Staaten, wo ähnliche Bemühungen, mit den Unzulänglichkeiten des „Organisierten Kapitalismus“ fertig zu werden, ihrer Form nach ebenfalls durch den institutionellen Rahmen bestimmt waren, war die Ähnlichkeit mit Großbritannien am größten. Durch das gemeinsame Erbe und eine lange Tradition individualistischer Expansion hatten beide Nationen eine starke Neigung zum Prinzip des Wettbewerbs, zu einer liberalen Demokratie und den Werten der Spontaneität, der offenen Gesellschaft, des demokratischen Konsens und der Beschränkung staatlicher Macht. Doch waren auch entscheidende Unterschiede festzustellen. Einmal hatte die amerikanische Antimonopoltradition eine © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
14
Ellis W. Hawley
andere Entwicklung genommen. Man legte größeren Wert auf Gewerbe- und Handelsfreiheit als auf Vertrags- und Koalitionsfreiheit. So wurde diese Tradition nicht nur als Waffe gegen dirigistische Interventionen verwandt, sondern die „Trust-buster“ benutzten sie auch dazu, Antitrustgesetze und „freien Wettbewerb“ durchzusetzen11. Andererseits war die amerikanische Arbeiterbewegung nur schwach, am Prinzip des Berufsverbands orientiert und daher voluntaristischen oder korporativen Modellen zugeneigt, weshalb der demokratische Sozialismus und andere Ideen der Linken hier kaum Unterstützung fanden12. Und zum dritten hatten die geringe Bedeutung der Arbeiterbewegung, das Fehlen eines Landadels, die Tendenz zur Aufspaltung der Regierungsgewalt und der an Deutschland erinnernde Kult des wissenschaftlichen Managements und der systematischen Rationalisierung eine mächtige, besonders angesehene und angeblich „aufgeklärte“ industrielle Führungsgruppe entstehen lassen und so Experimenten mit „industrieller Selbstverwaltung“ Auftrieb gegeben. In Amerika mußte sich dieser Korporativismus als „neuer Liberalismus“ ausgeben, doch schien diese politische Richtung in entscheidenden Punkten den rechtsgerichteten Modellen Kontinentaleuropas näher zu stehen als denen in Großbritannien. Ein fortdauerndes Problem in Amerika, das über fünfzig Jahre älter war als die Depression, bestand darin, Ziele und Macht dieser aufstrebenden BusinessElite mit den unternehmerisch-demokratisch-regionalistischen Grundsätzen zu harmonisieren, die durch diese Gruppe bedroht waren. Als die neue Ordnung Gestalt gewonnen hatte, war es noch schwieriger geworden, sie als „individualistisch“, „demokratisch“ oder „denzentralistisch“ hinzustellen. Dennoch haben die meisten Amerikaner sich darauf versteift, sowohl die neue Ordnung als auch die ältere Tradition beizubehalten, und die meisten Reformmodelle haben diesen Versuch unternommen13. Im Zeichen der „New Freedom“, wie sie Woodrow Wilson und Louis Brandeis vertraten, wurde zum Beispiel hartnäckig behauptet, der korporative Zentralismus sei über das Maß des technologisch Notwendigen hinausgegangen. Wilson und Brandeis schwebte eine Wirtschaftsform vor, die nicht nur modern und wissenschaftlich, sondern auch dezentralisiert war und auf freiem Wettbewerb beruhte. Der „New Nationalism“ von Theodore Roosevelt und Herbert Croly hatte ein System nationaler Kontrollen und öffentlich-privater Kooperation ins Auge gefaßt, aber zugleich darauf bestanden, es werde zu einem neuen, höherwenigen Individualismus führen. Die „New Competition“, hinter der „progressive Industrielle“ wie Arthur Eddy oder Edward Hurley standen, zielte auf autonome Verbände und einen vom Staat inspirierten gesellschaftlichen „Voluntarismus“ ab, um so eine „industrielle Demokratie“ heraufzuführen. Und der „interest-group liberalism“, eine Weltanschauung, wie sie in wachsendem Maß für die Wortführer von Farmern, Arbeitern und kleinen Geschäftsleuten kennzeichnend wurde, versprach die Freiheit durch die Schaffung eines Machtgleichgewichts von Interessengruppen zu fördern, das an die Stelle des klassischen Wettbewerbs treten sollte14. Aus dieser Mischung war die „progressive“ Gesetzgebung erwach© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“
15
sen, in der sich bis zu einem gewissen Grad sämtliche Reformmodelle spiegelten. Dabei wurde häufig die Verantwortung den Verwaltungsorganen zugeschoben, wie zum Beispiel bei der Gründung der Federal Trade Commission, die gegen den „unlauteren Wettbewerb“ vorgehen sollte. Die erste wirkliche Erfahrung mit einer „Wirtschaftsplanung“ machte man im Ersten Weltkrieg, als die amerikanische Regierung — wie die meisten anderen kriegführenden Nationen — ein sich immer weiter ausdehnendes Netzwerk von administrativen Kontrollen, kooperativen Einrichtungen und Werbungsund Beratungsorganen dazu benutzte, die Hilfsquellen des Landes zu mobilisieren und zu lenken. In Amerika waren jedoch die privaten und freiwilligen Elemente dieser Kriegsmaschinerie umfassender als bei den meisten anderen Nationen. Und während gewisse phantasiebegabte Leute in der Kriegs- und Nachkriegszeit — wie es auch in Deutschland, Italien und Frankreich der Fall war — sich für die kriegsbedingten Auffassungen von einem nationalen Management, sozialen Einrichtungen und einem kooperativen Gemeinwesen begeisterten15, hat die nachfolgende Reaktion gegen die Zentralisierung die Bemühungen, sie zu vollenden, durchkreuzt. Unter solchen Umständen einigten sich die Befürworter einer „korporativen“ Rationalisierung auf eine Strategie, die eine bundesweite Koordination ohne Erweiterung der Staatsbürokratie anstrebte16, wobei man sich auf nationale Wirtschaftsverbände, auf Gruppen von Technikern und gehobenen Angestellten, auf Spitzenorganisationen wie die Chamber of Commerce, die National Association of Manufacturers und die National Civic Federation stützte. Diese Reformbestrebungen, die jetzt von Männern wie dem Handelsminister Herbert Hoover oder dem Leiter der Bundesforstbehörde, William Greeley, ausgingen, führten zur Bildung eines „kooperativen“ oder „genossenschaftlichen“ Systems, in dem „progressive“ Regierungsstellen „wissenschaftliche“ Forschung und Public-Relations-Methoden anwandten, um eine „konstruktive Betätigung“ von „aufgeklärten“ Eliten, sich selbst verwaltenden Verbänden und Gemeinden hervorzubringen. Ein solches Vorgehen — erklärten die Initiatoren der neuen Ära — stelle einen neuen und besseren „American way“ dar — ein System, in dem gleichzeitig Ordnung und Freiheit herrschten, das modern und doch dezentralisiert sei, in dem es Lenkung und dennoch Selbstregulierung gebe17. Und die meisten Amerikaner, die damals von der raschen industriellen Expansion und einem technologischen Durchbruch zur Wirtschaft des Massenkonsums profitierten, waren offenbar damit einverstanden. Dennoch sollte es nicht zu einem ständigen Fortschritt in Richtung auf eine kapitalistische Utopie kommen. 1929 brach das System zusammen, da es nicht in der Lage war, die Kaufkraft der Massen und den stetigen Zustrom neuen Kapitals hervorzubringen, die für eine weitere Expansion notwendig gewesen wären. Und nachdem der Schrumpfungsprozeß erst einmal eingesetzt hatte, zeigten sich auch schnell die widerstreitenden Tendenzen, die auch anderswo für eine Depressionspolitik kennzeichnend sind. Einerseits begann eine © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
16
Ellis W. Hawley
wachsende Zahl von Wirtschaftsführern auf stärkere Zwangsmaßnahmen bei der Zusammenarbeit von Unternehmern und Regierung zu drängen. Sie legten 1931 Pläne vor, die auf die Beseitigung der Anti-Trust-Gesetze, eine zwangsweise Rationalisierung und Kartellierung und eine Wiedereinführung von wesentlichen Teilen der Kriegsmaschinerie hinausliefen18. Andererseits wurde die Auffassung, daß die Übereinkünfte der zwanziger Jahre einen einzigartigen und überlegenen „American way“ darstellten, immer heftiger angegriffen. Die Meinung gewann an Boden, daß die verbandsmäßig organisierte Wirtschaft nur eine Fassade sei, hinter der egoistische Monopolisten ihre Macht konzentriert und mißbraucht und auf diese Weise die Nation in die Depression hineinmanövriert hatten. Infolge dieser Enttäuschung kam es zu einem Wiederaufleben früherer Reformmodelle, zu modernisierten Versionen des New Nationalism, der New Freedom und des „Interessengruppen-Liberalismus“, wobei auch viel von den „Experimenten“ im Ausland, von der Notwendigkeit einer neuen Kriegsregierung, von einer „umfassenderen Anwendung“ des wissenschaftlichen Managements und von der Unzulänglichkeit der klassischen Regeln des Währungs- und Finanzwesens die Rede war19. Präsident Hoover, der zwischen den Parteien eingekeilt war, widersetzte sich beiden Tendenzen, da er der Meinung war, daß ein Nachgeben in der einen oder der anderen Richtung die Grundlage für einen weiteren Fortschritt zerstören würde, und er verblieb insgesamt im liebgewordenen Rahmen eines auf Freiwilligkeit beruhenden Verbandssystems. Gestützt auf Pläne, die er in den zwanziger Jahren propagiert hatte, stellte er ein „kooperatives“ Programm auf, das die Kaufkraft erhalten und zu Investitionen ermutigen sollte. Und selbst nachdem dieses Programm offensichtlich gescheitert war, hielt er weiter daran fest und führte den fortdauernden Konjunkturrückgang auf ungünstige Entwicklungen im Ausland und auf politische Sabotage im eigenen Land zurück. In sein „Zweites Programm“ nahm er lediglich Maßnahmen neu auf, die das Finanzsystem stützen und lokale Erleichterungen bringen sollten und die der Verteidigung der „Pfeiler“ des Geschäftsvertrauens, dem Goldstandard und einem ausgeglichenen Budget dienten. Gegen seine hartnäckige Verteidigung des „American way“ kam der „neue Liberalismus“, wie er sich in verschiedenen Planungs-, Finanzierungs- und Durchführungsvorschlägen verkörperte, kaum voran. Ebensowenig erreichte der „neue Korporativismus“. Die Anutrust-Gesetze hätten zwar eine gewisse Revision vertragen, das räumte selbst Hoover ein. Aber da er ein „geschlossenes Kartellsystem“ unter allen Umständen vermeiden wollte und die wiederauflebende AntimonopolTradition vor Augen hatte und da er außerdem überzeugt war, daß entweder eine rechtsradikale Diktatur oder der schließliche Triumph eines sterilen Sozialismus die Folge wäre, wenn man „faschistische“ Methoden durch eine „Hintertür“ einschmuggelte, war er weder bereit, eine Aufhebung der Antitrust-Gesetze noch eine staatlich inaugurierte Wirtschaftsplanung zu befürworten20. 1932 stand bereits ein großer Teil des New Deal hinter den Kulissen © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“
17
bereit, doch konnte das „Experiment“ erst beginnen, nachdem Hoover nicht mehr im Amt war. Damals wirkte der Übergang von Hoover zu Roosevelt fast wie eine „Revolution“. Nach drei Jahren einer sich ständig verschlimmernden Depression, die ernster war als irgendwo sonst auf der Welt, wurde der Ruf nach einem Wechsel immer dringender, und unter einer Administration, die die meisten Befürworter eines Kurswechsels inzwischen in ihren Reihen hatte und die sich verpflichtet hatte, „etwas zu unternehmen“, nahm der Einfluß der Regierung in der Wirtschaft rasch zu. Allerdings ist die Neuartigkeit dieses New Deal oft übertrieben worden. Die Verschiebung erfolgte nicht vom Laissez-faire zu einer gelenkten Wirtschaft, sondern eher von dem Versuch einer Lenkung durch inoffizielles Zusammenwirken von Wirtschaft und Regierung zu einem neuen, förmlicheren und stärker auf Zwang abgestellten Versuch. Die Spannungen, die die politischen Entscheidungen bestimmten, änderten sich zwar durch die Erholung der Wirtschaft und die bessere Organisation bis zu einem gewissen Grad, doch unterschieden sie sich im Grund wenig von denen, mit denen sich schon die früheren maßgebenden Politiker herumgeschlagen hatten. Und die Leitmodelle der neuen Ordnung entstammten meistenteils den Ideen der Neuerer der vorangegangenen Reformperiode. Sie entstammten den Erfahrungen dieser Leute aus der Planwirtschaft der Kriegszeit und aus den „Lehren“ und „logischen Folgerungen“, die man offenbar aus Hoovers Erfahrungen und aus seiner Methode ziehen zu müssen glaubte21. Die Vereinigten Staaten hielten sich nun nicht länger an die Problemlösungen der zwanziger Jahre und bekannten sich zu ihrer eigenen Version der umfassenden Bewegung zu sozioökonomischer Integration. Doch hingen sie dabei — wie es auch anderswo oft der Fall ist — weiterhin an der Vergangenheit, und ihr Verhalten ist nur im Zusammenhang mit der nationalen Gesamtgeschichte ganz zu verstehen. Von einem vergleichenden Standpunkt aus gesehen, waren die Administrationen Hoovers und Roosevelts Regierungen der politischen Mitte und — wie es immer noch dem Willen der meisten Amerikaner entsprach — auf die Erhaltung sowohl einer liberalen Demokratie als auch der kapitalistischen Institutionen ausgerichtet. Roosevelts „mittlerer Weg“ war sicherlich breiter als der von Hoover. Aber trotz der Vorwürfe, er sei „Sozialist“, und trotz seines Anspruchs, „Pragmatiker“ zu sein, war sein Streben nach Änderungen und Experimenten durch unverrückbare ideologische Grenzen deutlich eingeschränkt22. Von vornherein ausgeschlossen waren einerseits jene Richtungen des Korporativismus oder des nationalen Dirigismus, die sich offen zu einem „geschlossenen“23, „autoritären“ oder „monopolistischen“ System bekannten. Ausgeschlossen waren andererseits jene Formen des demokratischen Kollektivismus oder von sozialer Demokratie, welche kapitalistische Initiative, Verfassungsgarantien oder moderne Technologie ernsthaft bedroht hätten24. Und ausgeschlossen waren — selbst innerhalb dieser Grenzen — Programme, deren Durchführung größere Auseinandersetzungen oder radikal neue Formen der Politik oder Verwaltung mit sich gebracht hätten. Ganz allgemein bestand die 2 Winkler, Krise
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
18
Ellis W. Hawley
Neigung, Differenzen auszugleichen, sich anzupassen und an bereits bestehende Einrichtungen anzuknüpfen. Was die neue Regierung jedoch beisteuerte, war eine Reihe von ideologischen Abgrenzungen und keine fertige Ideologie. Auf ihrem „mittleren Weg“ war Platz für die meisten Reformmodelle, die während Hoovers Regierung betrieben worden waren, und da Roosevelt dazu neigte, starren Festlegungen aus dem Weg zu gehen, auch gegenteilige Ansichten zu Wort kommen zu lassen und mit Konflikten zu regieren25, wurden die meisten dieser Modelle bald anstelle von Hoovers Methoden energisch betrieben. Gewisse Anhänger des New Deal zum Beispiel, die ihre Anregungen aus dem New Nationalism, der Kriegsregierung oder aus dem Zukunftsbild eines „assoziativen“ Kapitalismus bezogen, wollten noch weitergehen in Richtung auf eine staatlich gelenkte Wirtschaftsplanung und führten hitzige Debatten darüber, ob man dies durch Bildung einer „Partnerschaft“ mit der organisierten Wirtschaft erreichen könnte, wobei der Staat die Wirtschaftsplaner inspirieren und lenken sollte, oder ob man sich für Kontrollen entscheiden sollte, die von Regierungsbeamten und „Vertretern der Öffentlichkeit“ durchzuführen wären. Andere, die von pluralistischen oder Wettbewerbsmodellen ausgingen, wollten entweder die Marktwirtschaft neu beleben oder irgendeinen organisatorischen Ersatz dafür finden. Und wieder andere wollten sich hauptsächlich auf monetär-fiskalische Mittel und Wege verlassen, um die Wirtschaft durch inflationäre Mittel anzukurbeln oder für ihre Defekte einen Ausgleich zu schaffen26. Diesen verschiedenen Auffassungen entsprachen ähnliche Meinungsverschiedenheiten in der Wirtschaftswelt. Hier fiel es der Richtung, die für eine staatlich inspirierte Wirtschaftsplanung eintrat, schwer, sich auf ein bestimmtes Programm zu einigen oder die gesamte Unternehmerschaft hinter sich zu bekommen27. Gruppen wie die American Trade Association Executives und die National Association of Manufacturers fürchteten noch immer, die Revision der Antitrust-Gesetze könnte zu lästigen Kontrollen oder zur Erstarkung der Gewerkschaften führen, und verschiedene Andersdenkende hielten noch immer an den Unternehmeridealen fest und griffen Vorschläge im Sinn ihrer „monopolistischen“ Rivalen heftig an oder schoben ihre Schwierigkeiten „big government“ oder „big labor“ in die Schuhe. Unter einem Präsidenten, der Wert auf Zusammenarbeit und Beständigkeit legte, hätten derart unterschiedliche Ratschläge vielleicht einen Aufschub der versprochenen Aktion erforderlich gemacht. Roosevelts Antwort aber war, jedem „etwas“ zu geben, die Meinungsverschiedenheiten zu institutionalisieren und wenigstens für den Augenblick eine definitive Entscheidung für ein bestimmtes Reformmodell zu vermeiden. Folglich gingen aus seinem anfänglichen Wiederaufbau- und Reformprogramm lediglich neue Verwaltungsinstanzen mit unbestimmten oder ambivalenten Aufgaben hervor, und es blieb den uneinigen Regierungsbeamten, den miteinander konkurrierenden Ideologien und den streitenden „pressure groups“ überlassen, die Lücken im einzelnen auszufüllen. Dies traf zum Beispiel auf das Gesetz zu, durch das die Tennessee Valley Authority ins Leben gerufen wurde, sowie auf das neue Farmprogramm © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“
19
und die Bankgesetzgebung. Vor allem aber galt es für den National Industrial Recovery Act, jene Maßnahme, die dem angeschlagenen „Organisierten Kapitalismus“ wieder auf die Beine helfen sollte. Diesem Gesetz entsprechend sollten die wirtschaftlichen Verbände, von den Behörden locker überwacht, für ihre jeweiligen Branchen regulierende Normen („codes“) aufstellen. Diese Vorschriften sollten — nach Billigung durch den Präsidenten — Gesetzeskraft erhalten. Wenn sie nur gewisse Beschwörungsformeln gegen die „Monopolwirtschaft“ und einen obligatorischen, aber vage gehaltenen Abschnitt über Arbeiterschutz enthielten28, sowie Präambeln, die auf unbestimmt definierte Ziele des Wiederaufbaus Bezug nahmen, so konnten sie im übrigen fast alles enthalten, was ihren Verfassern vom Präsidenten genehmigt wurde. Im wesentlichen stellte dieses Gesetz keinen New Deal dar, sondern eine „Wirtschaftscharta“, unter der sich allenfalls ein New Deal herausbilden konnte. Es war, mit anderen Worten, lediglich ein äußerer Rahmen, den die verschiedenen Regierungsstellen dazu benutzen konnten, völlig unterschiedliche Versionen von „industrieller Demokratie“ zu entwickeln29. III 1933 hing die künftige Form eines reformierten „Organisierten Kapitalismus“ von der Gestaltung des neuen administrativen Rahmens und insbesondere davon ab, wie die „codes“ aussehen und zu welchen Zwecken sie benutzt werden würden. Wie sich schon in den vorangegangenen Debatten gezeigt hatte, hatten die rivalisierenden Gruppen voneinander abweichende Vorschläge anzubieten, mit deren Hilfe sie die Erfordernisse der Industrie mit den überkommenen Idealen zu versöhnen gedachten. Und es setzt kaum in Erstaunen, daß bei der Ausarbeitung der neuen „codes“ wiederum verschiedene, wortreich verfochtene Tendenzen auftraten, denen allen eine andere Zukunftsvorstellung zugrunde lag. Eine davon, nämlich diejenige, die von den Befürwortern der „Wirtschaftsplanung“ und der „industriellen Selbstverwaltung“ ausging, visierte zum Beispiel ein rationalisiertes Korporativsystem an, das angeblich liberal-demokratischen Zielen, einem neuen Gemeinwesen — wie man sich ausdrückte — dienen sollte. „Aufgeklärte“ Gruppen aus der Wirtschaft sollten sich für eine kooperative „Planung“ und soziale Verbesserungen einsetzen, und die Arbeiterbewegung sollte die Rolle eines Junior-Partners spielen, während die Regierung es durch Ausschaltung von „Schwindlern“ und durch Förderung der Geschäftstätigkeit den „Planern“ ermöglichen sollte, die Investitions- und Kaufkraft neu zu beleben. Eine zweite Strömung, die hauptsächlich von Linksintellektuellen ausging, hatte eine „kollektive Demokratie“ im Auge, welche eine „nationale Planung“ betreiben sollte, ein System, in dem — wie es hieß — mächtige „Vertreter der Öffentlichkeit“ in Verfolgung demokratischer Ziele den „verrotteten“ korporativen Kapitalismus neu aufbauen und dem „öffentlichen Interesse“ dienstbar machen sollten. Eine dritte Strömung, die ihre Schlagworte aus einer aktualisierten und erweiterten Version der New Freedom bezog, 2*
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
20
Ellis W. Hawley
träumte von einer Wirtschaft, in der „wahre Liberale“ und „unabhängig gesinnte“ Unternehmer die neuen „codes“ dazu benutzen würden, die dezentralisierten Marktstrukturen, die für einen wahren Fortschritt unentbehrlich waren, neu zu beleben, zu „säubern“ und zu erhalten. Und noch eine andere Strömung, die hauptsächlich von Vertretern der Arbeiterbewegung und Sozialarbeitern ausging, setzte sich für ein „ausgewogenes“ System ein, das man dadurch zu erreichen gedachte, daß man bis jetzt ausgebeutete Gruppen organisierte und schützte30. Für Roosevelt besaß jede dieser Zukunftsvisionen ihre einleuchtenden Seiten, doch scheint seine ursprüngliche Auffassung von der Aufgabe der „codes“ hauptsächlich von seinen Erfahrungen aus der Kriegszeit bestimmt gewesen zu sein31. General Hugh Johnson, ein ehemaliges Mitglied des War Industrial Board, war der Mann, der den Auftrag erhielt, die Aufstellung der Vorschriften und ihre Durchführung zu überwachen. Und wie Johnson scheint der Präsident im großen und ganzen der Meinung gewesen zu sein, daß man am vorteilhaftesten auf die Art der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Regierung und auf die Public-Relations-Methoden zurückgriff, mit deren Hilfe man die Kriegskrise überwunden hatte. Infolgedessen ergab es sich von selbst, daß der ursprüngliche Versuch, eine erfolgreiche „industrielle Demokratie“ aufzubauen, den Absichten der „Wirtschaftsplaner“ weitgehend entsprach. Natürlich deckte er sich nicht völlig damit. Konflikte innerhalb der Geschäftswelt, die Macht einiger weniger Gewerkschaften und Proteste von Seiten anderer Reformer machten zahlreiche und gelegentlich sogar wesentliche Konzessionen an die Wünsche der Arbeiterschaft, der Verbraucher und der Gegner der Monopolirtschaft unumgänglich. Trotzdem war das System, so wie es sich Ende 1933 Erstellte, durch eine staatlich abgesicherte Wirtschaftsplanung gekennzeichnet. Es war typisch dafür, daß bei den Vorschriften ganz allgemein das Bestreben im Mittelpunkt stand, den „ruinösen Konkurrenzkampf“ auszuschalten oder wenigstens zu reduzieren, daß die Befugnis, Kontrollmaßnahmen auszuarbeiten und ihre Durchführung zu veranlassen, den Führern der Industrie übertragen wurde, daß eine Zusammenarbeit mit der Arbeiterschaft unter den Bedingungen der Industrie vorgesehen war und daß wenig darin enthalten war, was dem Schutz der Verbraucher oder der Entwicklung einer zentralisierten Planung durch die Regierung dienen konnte32. In der Praxis gelang jedoch dieser Versuch, zu einer Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Regierung zu kommen, ebenso wenig wie der frühere unter Hoover, eine Expansion zu erreichen, und so wurde er schnell als autoritär und repressiv gebrandmarkt. Vielleicht wäre es anders ausgegangen, wenn die Industrie massive Unterstützungsgelder aus dem Etat für öffentliche Arbeiten, billige Kredite oder Verlustgarantien erhalten hätte. Aber alle Bemühungen in dieser Richtung scheiterten an orthodoxen fiskalischen Auffassungen und am Bürokratismus33. Die Hoffnungen auf steigende Umsätze und Gewinne verflüchtigten sich rasch. Es stellte sich heraus, daß die „codes“ dazu benutzt wurden, die Preise zusammen mit den Gehältern in die Höhe zu © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“
21 fördern34.
treiben und neue Investitionen eher zu unterbinden als zu Was ursprünglich den Anschein erweckt hatte, daß man damit einen neuen „American way“ schaffen würde, war nun immer heftigeren Angriffen ausgesetzt — besonders von Farmer- und Arbeiterführern, andersdenkenden Industriellen, von sogenannten „Wiederherstellern der Marktwirtschaft“ und Vertretern einer „nationalen Planung“35. Und da Roosevelt im Gegensatz zu Hoover sich nicht auf ein bestimmtes Modell festgelegt hatte, gewann es den Anschein, daß er sich vom ursprünglichen Programm lossagte, um einer anderen Art von „industrieller Demokratie“ den Weg freizumachen. Eine einheitliche Alternative bildete sich jedoch nur langsam heraus, vor allem deshalb, weil die widersprüchlichen Reformbestrebungen sich gegenseitig den Wind aus den Segeln nahmen und eher zu Stagnation und Durcheinander als zu einer neuen Synthese führten. Während der ersten Hälfte des Jahres 1934 zum Beispiel machte sich der Einfluß einer Richtung fühlbar, die den Wettbewerb wieder als Regulator eingesetzt wissen wollte. Unterstützt von der aufkommenden Kritik, von verschiedenen Gruppen von Unzufriedenen und gestützt auf Befragungsergebnisse wie die des National Recovery Review Board, gelang es ihr zu verhindern, daß verschiedene in den „codes“ vorgesehene Bestimmungen durchgeführt wurden. Diese Gruppe konnte schließlich sogar eine offizielle politische Absichtserklärung durchdrücken, die sich zu den Methoden des freien Wettbewerbs bekannte und auf Preisfestsetzungen und Produktionskontrollen verzichtete. Aber gegen den vereinten Widerstand der für die „codes“ zuständigen Behörden und ihrer Befürworter — einer Gruppe, auf deren Mitarbeit die Regierung offenbar auch weiterhin nicht verzichten wollte — mußten diese „Wiederhersteller der Marktwirtschaft“ feststellen, daß sie nicht einmal in der Lage waren, eine Revision jener „codes“ durchzusetzen, die Wettbewerbsbeschränkungen enthielten, und noch viel weniger, neue Vorkehrungen für die Durchsetzung eines freien Wettbewerbs zu treffen. Das Äußerste, was sie vermochten, war, sich in den technischen und beratenden Abteilungen der National Recovery Administration (NRA) festzusetzen, sich mit anderen zusammenzutun, um Johnson hinauszudrängen und alle Bemühungen um eine Kartellierung zu unterbinden, die auf offenen Kontrollen und Regierungsaktionen gegen die „Schwindler“ beruhten36. Ebensowenig imstande, ihr politisches Konzept in die Praxis umzusetzen, waren diejenigen, die ein Gegengewicht zur wirtschaftlichen Macht schaffen und den Aufbau einer „industriellen Demokratie“ durch eine Stärkung der organisierten Arbeiterschaft herbeiführen wollten. Auch hier forderte die offizielle Auslegung des Gesetzes durch die neuerrichteten Labor Boards, daß die Arbeitgeber kollektiv und ausschließlich mit der Gewerkschaft verhandelten, welche die Mehrheit ihrer Arbeitnehmer repräsentierte. Angesichts des Widerstandes unternehmerfreundlicher Verwaltungsorgane, der Scheu vor juristischen Auseinandersetzungen und der Kompromißbereitschaft Roosevelts gelang es den Vorkämpfern dieser Interpretation jedoch nicht, den Exekutivapparat der NRA unter ihre Kontrolle zu bringen oder zu verhindern, daß der Präsident © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
22
Ellis W. Hawley
persönlich eingriff, um für Schlüsselindustrien Ausnahmen zu machen. Sie waren daher nicht in der Lage, die „codes“ zugunsten der Arbeiterschaft zu revidieren oder ein wirksames Gegengewicht zu schaffen. „Big labor“ konnte in Amerika erst entstehen, nachdem es 1935 Senator Robert Wagner gelungen war, jenes Gesetz durchzubringen, das den Gewerkschaften den Schutz und die Unterstützung der Regierung sicherte37. Noch weniger erfolgreich und frustrierender waren die Erfahrungen all derer, die die Erarbeitung der „codes“ auf eine neue Grundlage stellen, d. h. unvoreingenommenen Experten und „Vertretern der Öffentlichkeit“ in die Hand geben wollten, um sie für eine Art „kollektiver Planung“ zu benutzen, die sich sowohl mit den Gewinnen und Investitionen als auch mit der Preisbildung und Produktion befassen sollte. Im Gegensatz zu den „Wiederherstellern der Marktwirtschaft“ wurden diese „Kollektivisten“ von vielen ihrer Mitbürger als „unamerikanisch“ oder als reine Theoretiker angesehen. Und wenn sich Roosevelt auch gelegentlich besonders Linksintellektuelle wie Rexford Tugwell und Mordechai Ezekiel anhörte, so stand er ihren Ansichten doch skeptisch gegenüber und hatte keine Lust, ihre Gegner vor den Kopf zu stoßen. Die Befugnis des Präsidenten, Unternehmenslizenzen zu erteilen, die ihm ursprünglich nur auf ein Jahr zugestanden worden war und in der viele „Kollektivisten“ das Fundament einer echten Planwirtschaft sahen, lief ab, ohne daß sie jemals in Anspruch genommen worden wäre. Die Agitation für Ziele wie Gewinnkontrollen, Qualitätsstandards, drittelparitätische „code“Instanzen (Staat, Unternehmer, Gewerkschaften) oder für eine systematische „Expansionsplanung“ war meist vergeblich. Die Einschränkung der Macht und Funktionen der Kontrollbehörden erfolgte offenbar größtenteils auf Grund von Beschwerden über Mißbräuche und unterschiedliche Anwendung der „codes“, und nicht etwa, weil man auf diese Weise eine zentrale Planung hätte erleichtern wollen38. 1934 waren einige der Wirtschaftsplaner durchaus bereit, der Agitation für eine Änderung zuzustimmen. Sie hatten offenbar das Gefühl, daß Konzessionen die Reform in konservativen Bahnen halten, das Gerede über eine soziale Revolution unterbinden und trotzdem eine wirksame „Wirtschaftsplanung“ ermöglichen würden38. Öfter jedoch war die Reaktion in Wirtschaftskreisen Erbitterung, Beunruhigung und entschlossener Widerstand. Einige, die sich noch immer gegen Antitrust-Bestimmungen immun machen wollten und bereit waren, dafür einen Preis zu zahlen, bekannten sich zu den durch die „codes“ geschaffenen Strukturen. Einige, die überzeugt waren, daß dem „Sozialismus“, der „Anarchie“ und den „Gewerkschaftsmonopolen“ Tür und Tor geöffnet wurden, verlangten eine Revision der „codes“, welche die Autonomie der Industrie stärken und die Klauseln zum Schutz der Arbeiterschaft abschwächen sollte. Wieder andere, die inzwischen von der Arbeit des NRA enttäuscht oder von tiefer Besorgnis über die weitere Entwicklung erfüllt waren, schlossen sich denen an, die von Anfang an verlangt hatten, man solle das ganze Programm liquidieren40. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“
23
Gegen Ende 1934 neigten die amerikanischen Wirtschaftsführer immer mehr dazu, die „Tyrannei des New Deal“ und nicht so sehr den „ruinösen Konkurrenzkampf“ für ihre Schwierigkeiten verantwortlich zu machen. Alle, die der „Wirtschaftsplanung“ ablehnend gegenüberstanden oder von ihr enttäuscht waren, solche, die der Meinung waren, daß man dieser keine faire Bewährungschance geboten hatte, und diejenigen, denen die Angriffe auf den New Deal Furcht einjagten — sie alle waren sich darin einig, daß eine allgemeine Scheu vor Investitionen herrschte und daß die wirtschaftliche Gesundung durch die unkontrollierte Ausweitung einer bedrohlichen, unkalkulierbaren und möglicherweise gefährlichen Staatsbürokratie blockiert wurde. In ihrem Bemühen, dieser Ausweitung Einhalt zu gebieten und sie wieder rückgängig zu machen, verkündeten sie bald mehr oder weniger aufrichtig die Ideale der Neuen Ära oder die des Unternehmer-Kapitalismus, der klassischen Ökonomie und des Jeffersonschen Liberalismus. Als die kritische Situation überwunden war, hatten sie offenbar das Gefühl, man könne die Aufgabe, Auswüchse des Konkurrenzkampfes zu beseitigen und ein vernünftiges Wirtschaftsverhalten herbeizuführen, wieder privaten Gruppen anvertrauen — besonders dann, wenn die Alternative — so wie es offenbar der Fall war — darin bestand, daß man sich auf unzuverlässige öffentliche Werkzeuge in der Hand schlecht informierter, praxisferner und wirtschaftsfeindlicher Bürokraten verlassen mußte41. Auf Grund derartiger Befürchtungen und Ansichten widersetzten sich die meisten Geschäftsleute der defizitären Finanzpolitik, den Projekten für öffentliche Arbeiten und den Sozialversicherungsprogrammen, die ihnen neue Märkte und Gelegenheiten zu Investitionen hätten bieten können. Nur in seltenen Fällen erkannten ein paar „Wirtschaftsplaner“ und „aufgeklärte Konservative“ an, daß ein Ausgabenausgleich und ein Wohlfahrtsdirigismus der organisierten Wirtschaft von Nutzen sein könnten. Auch in den einzelnen Verbänden gab es nur wenige Persönlichkeiten, die denen zustimmten, welche damals und später derartige Bestrebungen als im Grunde konservativ bezeichneten und der Ansicht waren, daß sie dazu dienten, die bestehende Ordnung zu stützen, ihre Kritiker zu integrieren und strukturelle Veränderungen zu verhindern. Stattdessen betrachtete man derartige Programme als Belastung für die Wirtschaft, als unmoralische Abweichungen vom „American way“, als Vorboten von lähmenden Steuern und Kapitalabgaben, als Mahnzeichen einer wirtschaftlichen Katastrophe oder als Machenschaften, um korrupte Politiker an die Macht zu bringen und einer bedrohlichen, verschwendungssüchtigen Bürokratie den Rücken zu stärken. Wiederaufbau der Wirtschaft und Sicherheit waren — nach zahlreichen Reden aus Kreisen der Wirtschaft Ende 1934 zu urteilen — nur durch eine Beschneidung der Regierungsbefugnisse und eine gesunde Finanzpolitik zu erreichen, nicht aber durch eine Ausweitung amtlicher Befugnisse und ein Spiel mit dem Vertrauen der Öffentlichkeit42. Teilweise als Antwort auf diese Kritik und auch weil Roosevelt selbst grundsätzlich weiterhin Anhänger eines ausgeglichenen Haushalts blieb, bemühte sich die Regierung, die Ausweitung der Sozialleistungen und der öffentlichen Investitionen mit einer ortho© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
24
Ellis W. Hawley
doxen Finanzpolitik zu koppeln. Sie hielt so die Expansionsmöglichkeiten durch Staatsdefizite weit unter dem Niveau, das für eine Vollbeschäftigung oder einen neuen Investitionsboom nötig gewesen wäre43. Als das Jahr 1935 herankam, hatten die New Dealer noch immer nicht entdeckt, mit welchen Maßnahmen man den „Organisierten Kapitalismus“ innerhalb eines liberal-demokratischen Systems funktionstüchtig machen konnte. Die Art von „Wirtschaftsplanung“, die man 1933 betrieben hatte, wurde nun als undurchführbar und autoritär heftig kritisiert. Jedoch machten die meisten ihrer Anhänger gar nicht erst den Versuch, die Kritiker durch partielle Zugeständnisse zu gewinnen. Sie schienen es vielmehr darauf anzulegen, die in Mißkredit geratenen Modelle von 1920 oder 1890 wiederzubeleben. Ihre Rivalen, die „Wiederhersteller der Marktwirtschaft“, die „kollektivistischen Planwirtschaftler“ und die „Anti-Organisatoren“ waren überdies noch zu schwach, um eine Erprobung ihrer Lösungsvorschläge erzwingen zu können. Und bisher war noch keine neue Weltanschauung aufgetaucht, die in der Lage gewesen wäre, die widerstreitenden Tendenzen so miteinander zu versöhnen, daß eine für die Amerikaner annehmbare neue, höhere Synthese zustande gekommen wäre. In gewissem Sinn hatte natürlich das Durcheinander von miteinander in Konflikt liegenden Tendenzen zu einer Institutionalisierung gegensätzlicher Interessen geführt — besonders in der Politik der NRA —, aber die meisten Betroffenen hatten dabei nur das Gefühl, an einem toten Punkt angekommen zu sein, ein Gefühl der Frustration also und nicht die Überzeugung, zu einem wünschenswerten und befriedigenden Arrangement gelangt zu sein. Die Kritiker der „Wirtschaftsplanung“ schienen überzeugt, daß Roosevelts Optimismus und Experimentierfreudigkeit dieses Arrangement doch noch zustande bringen könnten. Die NRA jedoch, die sich 1935 als Sackgasse erwiesen hatte, besaß nur noch wenige wirkliche Freunde. Bei vielen erweckte die Entscheidung des Obersten Bundesgerichts vom Mai 1935, das die „codes“ und ihre Ausführungsbestimmungen als verfassungswidrig hinwegfegte, eher den Eindruck, daß damit ein Hindernis beseitigt wurde, als den, daß dadurch notwendige Reformen blockiert würden44. Wenigstens war jetzt die Bahn frei für einen neuen Start.
IV Wie zu erwarten, gründete sich das Programm, das schließlich 1935 Gestalt annahm, auf frühere Entwicklungen, besonders auf die Bemühungen all jener, welche die Macht der Wirtschaft lieber begrenzen oder eindämmen, als den Versuch machen wollten, sie für öffentliche Interessen einzusetzen. Diesen Gruppen wandte nun Roosevelt seine Unterstützung zu, teils offenbar deshalb, weil das Ende der NRA ihm freie Hand gab, teils, weil die feindliche Haltung der Wirtschaft ihn veranlaßte, seine Politik lieber auf die Farmer und Arbeiter zu stützen, und teilweise wohl auch, weil er verhindern wollte, daß ihm industriefeindliche Demagogen in die linke Flanke fielen45. Auch waren ihm die Hände durch die Hindernisse gebunden, die sich nun anderen Alternativen in © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“
25
den Weg stellten. Die Wirtschaftsplanung unter der Schirmherrschaft des Staates war durch die schlechten Erfahrungen mit der NRA weitgehend diskreditiert, selbst wenn das Oberste Bundesgericht sich bereit gefunden hätte, ihr in irgendeiner Form zuzustimmen. Die kleine Gruppe, die immer wieder versuchte, die NRA zu neuem Leben zu erwecken, war nicht in der Lage, sich ausreichende Unterstützung in Wirtschaftskreisen oder in Kreisen der Politik zu verschaffen. Und eine „kollektivistische Planung“ war noch weniger zu verwirklichen. Obwohl einige ihrer Befürworter eine „umgekehrte NRA“ ausarbeiteten und propagierten, mit der sie eine „geplante Expansion“ zuwege zu bringen hofften, konnten sie ihre Mitbürger doch nicht überzeugen, das dieser Weg gangbar oder „amerikanisch“ war oder daß er — falls man ihn tatsächlich einschlagen sollte — nicht genau wie die NRA für die Interessen der „egoistischen Monopolisten“ ausgenutzt werden würde46. Was sich dann ergab, als die „Wiederhersteller der Marktwirtschaft“ und die „Anti-Organisatoren“ ans Ruder kamen und der „Zweite New Deal“ Gestalt annahm, war im wesentlichen eine selektive Mischung aus „trust-busting“, gewerkschaftlichen Zusammenschlüssen, die von der Regierung unterstützt wurden, und einer begrenzten Expansion und Zentralisierung sozialer Einrichtungen, sowie einer fortdauernden, jedoch versteckten Kartellierung von „Ausnahmegruppen“, die bereit waren, gehörig dafür zu zahlen und die am richtigen politischen und ideologischen Hebelarm saßen. Für alle, die sich durch die Propagandareden gegen die Trusts und für die Gewerkschaften, durch die präsidentielle Schmähung der „wirtschaftlichen Royalisten“ und die Ablehnung von „Wirtschaftsplanung“ als politischem Globalrezept beeindrucken ließen, schien diese Mixtur eine allgemeine politische Schwenkung nach links anzuzeigen47. Aber für verhinderte „Kollektivisten“ wie Rexford Tugwell oder den Direktor der Tennessee Valley Authority, Arthur E. Morgan, bedeutete die Kursänderung einen Verzicht auf soziale Maßnahmen zugunsten eines legalistischen Konservativismus. Der Leitgedanke, so behaupteten sie, sei nicht ein kooperatives Gemeinwesen, das sich auf eine optimistische Auffassung von der menschlichen Natur gründe, sondern vielmehr ein System von „checks and balances“, das auf der Ansicht beruhe, daß der Mensch seinem inneren Wesen nach immer selbstsüchtig bleiben werde, daß Macht sich unvermeidlich korrumpiere und daß das öffentliche Interesse am besten durch die Institutionalisierung von Konflikten zu ermitteln sei. Bestenfalls, so meinten sie, könnten derartige Maßnahmen dafür sorgen, daß Konflikte und Ausbeutung innerhalb der Grenzen des menschlichen Anstands blieben. Sie könnten jedoch niemals eine integrierte, organische, funktionsfähige Gesellschaft zuwege bringen, wie das Programm von 1933 es vermocht hätte, wenn es nur richtig in die Wege geleitet und durchgeführt worden wäre. Die Erfahrung sollte darüber hinaus bald lehren, daß die „Wiederherstellung der Marktwirtschaft“, wie sie nach 1935 betrieben wurde, nicht imstande war, das „unabhängige Unternehmertum“ wiederherzustellen oder den „privaten Sozialismus“ auszurotten, den Roosevelt nach wie vor verurteilte. Die meisten, © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
26
Ellis W. Hawley
die sich für die „Wiederherstellung der Marktwirtschaft“ einsetzten, waren nicht bereit, deshalb die korporativen Organisationen zu verdammen oder auf die moderne Technologie zu verzichten49. Und diese Einschränkung bedeutete — wenn die Macht dahinter stand, über welche die „privaten Sozialisten“ noch immer verfügten —, daß die „Reform“ sich hauptsächlich auf politisch anfällige Gruppen wie den „Power Trust“, die Kreditbanken und bestimmte Industrieunternehmen konzentrierte, die scharfen Angriffen von seiten einflußreicher „Unabhängiger“ ausgesetzt waren50. Dies soll natürlich nicht heißen, daß sich nichts geändert hätte. Die heftigen Kämpfe auf politischem und gesetzgeberischem Gebiet um die Mitte der dreißiger Jahre führten zu Rationalisierungsmaßnahmen in Versorgungsbetrieben, zu einer billigeren und reichlicheren Stromversorgung, zu einer strengeren Regelung der Finanzierungspraktiken der Banken, zu größeren Sicherheiten im Wertpapier- und Wechselgeschäft und zu einer etwas weitherzigeren Auffassung von „monopolistischem“ Verhalten. Aber als schließlich alles gesagt und getan war, erwies es sich, daß doch das Netzwerk von Supertrusts, Industrieverbänden und oligopolitischen Absprachen, das den innersten Kern des korporativen Systems bildete, im wesentlichen intakt geblieben war, daß der Bereich des „unabhängigen“ Unternehmertums sich nicht wesentlich erweitert hatte und daß alle Anstrengungen, wirksame Mittel zur Bekämpfung der Trusts — etwa durch ein neues Steuersystem oder durch Änderungen des Gesellschaftsrechts — zu finden, sämtlich entweder vereitelt oder auf Maßnahmen abgelenkt worden waren, die wenig reale Wirksamkeit besaßen51. Außerdem wurden die Bemühungen der „Wiederhersteller der Marktwirtschaft“ durch ihre Bereitwilligkeit abgeschwächt, „Ausnahmen“ nicht nur für „natürliche Monopole“, sondern auch für alle die zuzulassen, die behaupteten, natürliche Hilfsquellen erhalten zu wollen, der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit zu dienen, wichtige Versorgungseinrichtungen zu unterhalten oder für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Man räumte ein, daß es bei derartigen Bemühungen gelegentlich unumgänglich sei, sich auf administrative Kontrollen und nicht auf die neubelebten Marktmechanismen zu verlassen; und in der Praxis wurden diese Konzessionen zu einer Hintertür für Gruppen, die noch immer eine von der Regierung gestützte Kartellierung brauchten und sich auf diese Weise zu sichern wußten, ohne einen ihrer Ansicht nach übertrieben hohen Preis dafür zu zahlen. Die Ölindustrie zum Beispiel brachte es fertig, ein „Partner“ der Regierung zu bleiben, da sie angeblich durch eine Kombination von privaten und vom Staat unterstützten Produktionskontrollen dem Umweltschutz Rechnung trug52. Die Kohlenindustrie brachte es mit ähnlichen Argumenten fertig, ihre NRA-Vorschriften wieder in Kraft zu setzen und bewegte sich auf ein System „gerechter“ Preise anstelle von Marktpreisen zu53. Die landwirtschaftlichen Erzeuger und Verarbeitungsbetriebe betonten die Notwendigkeit eines wirtschaftlichen „Gleichgewichts“, der Landschaftserhaltung und der Existenz freier Bauern, und es gelang ihnen auf diese Weise, sich ein ausgeklügeltes System von staatlich unterstützten Produktionskontrollen, © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“ erhalten54.
27
Marktkartellen und Mindestpreisgarantien zu Den Organisationen des unabhängigen Einzelhandels gelang es mit ihrer Propaganda gegen die „monopolistischen“ Großhändler, Gesetze gegen Kettenläden und „unlauteren Wettbewerb“ durchzusetzen55. Die Transportindustrie sicherte sich als Dienstleistungsgewerbe durch die Einwilligung in eine milde „Regulierung“ sowohl Bundessubventionen als auch eine von der Regierung unterstützte Kartellierung56. Und selbst dort, wo der Anstoß zu einer solchen „Regulierung“ von verbraucherfreundlichen Beamten ausging, wie zum Beispiel bei der Nahrungsmittel-, Arzneimittel- und Kosmetikindustrie, hat die sich daraus ergebende Verpflichtung zu höheren Qualitätsstandards dazu geführt, daß bereits etablierten Gruppen und privaten Kontrollinstanzen der Rücken gestärkt wurde57. 1937 hatten die widerstreitenden Kräfte, die durch ihren Druck die Antitrust-Politik gestalteten, eine ähnliche Situation wie Ende 1934 geschaffen. Offiziell hieß das Ziel — genau wie 1934 — „Wiederherstellung der Marktwirtschaft“. Jedoch unternahm die Regierung in weiten Bereichen von ausschlaggebender Bedeutung nichts, um den Wettbewerb wieder herzustellen, während sie auf anderen Gebieten — ganz ähnlich wie 1934 — Maßnahmen zur Einschränkung des Wettbewerbs aktiv unterstützte. Der Hauptunterschied lag vor allem darin, daß die Kluft zwischen Politik und Praxis nicht mehr so deutlich aus den offiziellen Verordnungen hervorging; zweitens lag er darin, daß man sich große Mühe gab, die Unterstützung der Kartellierung mit demokratisch-sozialen Zielen zu rechtfertigen; und drittens darin, daß sich die Angriffe gegen besonders anfällige Gruppen verstärkten, wodurch die weitverbreitete Abneigung gegen die Trusts ein breiteres Ventil erhielt. Mit anderen Worten, der New Deal wußte es nun geschickter zu verbergen, daß er investiertes Privatkapital und Brancheninteressen protegierte. Und weil man dies besser zu verbergen verstand, waren die liberal-demokratischen Kritiker 1937 nicht mehr ganz so unzufrieden wie 1934. Außerdem zog offenbar die Geschäftswelt die leise angedeuteten Antitrust-Drohungen und den etwas höheren „Preis“, den unterstützungsbedürftige Industrien zu zahlen hatten, den Gefahren vor, die ihrer Meinung nach 1934 im NRA gelauert hatten. Obwohl an den „Angriffen auf die Wirtschaft“ und an der Unterstützung rivalisierender Gruppen nach wie vor heftig Kritik geübt wurde, trug man doch kein Verlangen nach einer Wiederbelebung eines Systems offizieller Verordnungen58. Die meisten Führer der verschiedenen Verbände hätten es vorgezogen, zu den früheren Absprachen mit der Arbeiterschaft zurückzukehren. Denn die Regierung bediente sich nun seit dem Wagner-Act von 1935 ihrer Machtbefugnisse, um den gewerkschaftlichen Zusammenschluß zu fördern und um zu verhindern, daß Gewerkschaften gesprengt wurden. Auch gab sie die Unnachgiebigkeit der Manager der öffentlichen Kritik preis, so daß eine neue Art von militanten Arbeiterführern die Möglichkeit erhielt, sich in den Industrien der Massenproduktion zu organisieren und zu echten Partnern bei der Festsetzung der Ecklöhne und der Arbeitsbedingungen zu werden59. Auf diesem Gebiet — mehr als auf jedem anderen — haben die Reformen des „Zweiten New Deal“ eine © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
28
Ellis W. Hawley
tatsächliche Machtverschiebung, eine Machtkonzentration bei „big labor“ als Gegengewicht gegen „big business“ bewirkt. Doch war selbst hier die Veränderung nicht so groß, daß man sie direkt als revolutionär hätte bezeichnen können. Den Gewerkschaftsführern gelang es nicht, sich einen Anteil an der Macht der Großunternehmen über Produktion, Preisfestsetzung und Einsatz der vorhandenen Mittel zu erobern. Größtenteils streckten sie nicht einmal die Hand danach aus. Und schließlich hat ihr Aufstieg kaum eine wesentliche Neuverteilung und Neustrukturierung der Wirtschaft mit sich gebracht oder die Massenkaufkraft wesentlich erhöht60. Unter dem Eindruck der Macht, die die Industrie behauptet hatte, und des konservativen Kurses, den die amerikanische Arbeiterbewegung auch weiterhin beibehielt, haben spätere Beobachter immer wieder ihre Verwunderung darüber geäußert, daß die meisten Führer der großen Verbände und Wirtschaftsgruppen die Neuerungen so erbittert bekämpft haben. Der andere wichtige Aspekt des „Zweiten New Deal“ war die Ausweitung und bundeseinheitliche Regelung der Sozialleistungen, wofür die Einrichtung der Altersversicherung und der Arbeitslosenunterstützung, verbesserte Arbeitsbeschaffung, Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut, Umschulungsprogramme für die Landwirtschaft, neue Wohnungs- und Umweltschutzprogramme und bessere Arbeitsbedingungen besonders kennzeichnend waren61. Weitgehend trat nun an die Stelle der älteren Formen der amerikanischen „Wohlfahrt“, die von den Großunternehmen, den kleinen Gemeinden oder den großstädtischen Kommunalverwaltungen getragen wurde, die umfassendere und breiter angelegte staatliche Wohlfahrtspolitik. Paradoxerweise wurden jedoch aus dem Wunsch heraus, die aktive Beteiligung der Bevölkerung in den überschaubaren Lebensräumen zu erhalten, diese älteren Einrichtungen in mancher Hinsicht eher stärker gefördert als durch andere ersetzt. Die Gemeinden nahmen in der Wohlfahrtspflege auch weiterhin Schlüsselstellungen ein. Politische Institutionen stärkten ihren Einfluß dadurch, daß sie als Vermittler auftraten62. Wirtschaftsgruppen profitierten von den öffentlichen Investitionen oder sie ließen sich „überreden“, „Partner“ auf dem Wohlfahrtssektor zu werden. Und nur allzu oft bewirkte der Druck, den etablierte Interessengruppen ausübten, daß gerade die, welche Schutz und Hilfe am nötigsten gehabt hätten, davon ausgeschlossen blieben. Verglichen mit europäischen Wohlfahrtsstaaten war die amerikanische Version eine auffallend begrenzte, dezentralisierte und konservative Angelegenheit. Man hätte logischerweise erwarten dürfen, daß die „aufgeklärte“ Gruppe von Wirtschaftsführern, die zu weiteren Schritten bereit war, weit größer gewesen wäre. Logischerweise hätte man auch erwarten können, daß sowohl die Führer der Großunternehmen als auch die Vertreter des „Zweiten New Deal“ von der 1937 zustande gekommenen Kombination zu der „mixed economy“ vorgedrungen wären, die von ähnlichen Gruppen in den fünfziger Jahren propagiert wurde. Letztere bestand schließlich aus einem merkwürdigen Gemisch von privater „Wirtschaftsplanung“ und einer solchen durch Interessengruppen mit © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“
29
Antitrust-Tendenz, einem rituellen „trust-busting“, prokapitalistischen Arbeitergewerkschaften und bescheidenen, halbstaatlichen sozialen Maßnahmen. Darüber hinaus war man allgemein der Überzeugung, daß eine derartige Mischung eine höhere Synthese darstellte und daß sie außerdem bessere Methoden zur Förderung und Regulierung des wirtschaftlichen Wachstums gewährleistete. Wenn die politisch einflußreichen Kräfte 1937 bereit gewesen wären, die notwendige psychologische Anpassung zu vollziehen, für die Ausweitung des Handels und die technologische Entwicklung etwas größere Mittel abzuzweigen und die von den Volkswirtschaftlern Keynes'scher Richtung und von einigen Anhängern des New Deal propagierte Theorie Öffentlicher Ergänzungsinvestitionen aufzugreifen, wäre das neue „amerikanische System“ möglicherweise schon in den dreißiger Jahren zustande gekommen und nicht erst in den Fünfzigern. Anstatt sich jedoch zu der notwendigen Anpassung bereit zu finden, fuhren die Führer der Verbände und die New Dealer fort, sich gegenseitig für das Ausbleiben neuer Investitionen und einer anhaltenden Expansion verantwortlich zu machen. In Wirtschaftskreisen vertrat man die Ansicht, daß die Schwierigkeiten daher rührten, daß der New Deal den privaten Investoren „Handschellen anlege“, daß er ihnen „Lasten aufbürde“ und sie „abschrecke“. In New-Deal-Kreisen schob man die Schuld auf hartnäckige Strukturfehler, die immer wieder zu Fehlverteilungen, zu übertriebenen Einsparungen und einem Versagen der Kaufkraft führten. Und in beiden Lagern beurteilten viele den Keynesianismus als produktionshemmend, verschwenderisch, unehrlich oder auch als eine „künstliche“ Lösung, die von ihren Gegnern erfunden worden sei, um „unnatürliche“ Strukturen und änderungsbedürftige Kontrollmaßnahmen zu verewigen63. In der ersten Hälfte des Jahres 1937, als Steuererhöhungen die expansive Wirkung eines Veteranen-Bonus wiederaufhoben und die Regierung auf eine Lohn-Preis-Spirale, einen spekulativen Ausverkaufsboom und auf einen nachgebenden Wertpapiermarkt überempfindlich reagierte, war die Szene für eine neue Rezession vorbereitet. Im Herbst war es dann soweit. Eine begrenzte Erholung und ein scheinbar sich anbahnendes Gleichgewicht zwischen den organisierten Interessen und den liberal-demokratischen Idealen wurden von der „Roosevelt-Depression“ abgelöst, und eine neue Runde politischer Konflikte begann64.
V Als die Lage sich Ende 1937 verschlechterte, begannen gewisse Wirtschaftsführer abermals auf eine von der Regierung gestützte „Wirtschaftsplanung“ zu drängen, die den „ruinösen Konkurrenzkampf“ beseitigen oder reduzieren sollte. Die große Mehrheit jedoch glaubte, der Rückgang habe politische Ursachen und sei mehr durch eine feindselige Regierungspolitik als durch innere Schwächen verschuldet, weshalb man ihm am besten mit Steuersenkungen und einer Ablösung des New Deal und nicht mit einer neuen NRA begegnen könne. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
30
Ellis W. Hawley
Für die meisten Unternehmer waren die Maßnahmen, die man später als „Stabilisierungsfaktoren“ und als „Schwungräder“ ansah, immer noch „Handschellen“ und „Belastungen“. Sie hatten endgültig genug davon. Auch waren sie noch nicht bereit, sich zu der Ansicht zu bekehren, daß man einem Konjunkturrückgang mit einer stärkeren Staatsverschuldung begegnen könne. Wenn auch die Steuererleichterungen, die sie Anfang 1938 durch ihre Lobby im Kongreß durchbrachten, ein größeres Defizit und damit eine Dosis Keynesianismus mit sich brachten, so war dies doch nicht ihre Absicht gewesen. Ihrer Meinung nach hätten reduzierte Regierungsausgaben und ein ausgeglichenes Budget mit den Steuersenkungen Hand in Hand gehen sollen65. Inzwischen versuchten verschiedene Gruppen innerhalb der Regierung und des Kongresses ebenfalls den Zusammenbruch zu analysieren und verlangten nach Änderungen in der Politik, aber immer noch weitgehend in dem Sinn, wie sie es auch schon früher angestrebt hatten. Eine beträchtliche Zahl schien zum Beispiel bereit, sich jetzt zu der Lösung der Geschäftswelt zu bekennen und den Versuch zu machen, das „Vertrauen“ durch ausgeglichene Budgets, Steuersenkungen und eine Pause in den Reformen wiederherzustellen. Eine zweite Gruppe, die sich hauptsächlich aus früheren NRA-Beamten rekrutierte, wollte mit Hilfe von industriellen „codes“ ein neues „Wirtschaftsplanungsprogramm“ aufstellen. Eine dritte befürwortete Gesetze, die der „industriellen Expansion“ dienen sollten. Sie hoffte, daß derartige Gesetze in ihrer Struktur den Vorschriften des NRA ähnlich sein würden; doch sollten diesmal Sicherheitsvorkehrungen eingebaut und Maßnahmen getroffen werden, um die Produktion auf volle Touren zu bringen und nicht etwa Produktionsbeschränkungen zu begünstigen. Eine vierte Gruppe, die wieder einmal das Ideal einer „Wiederherstellung der Marktwirtschaft“ beschwor, wollte, daß man die „Monopolisten“ ihrer Macht beraube, Preise vorzuschreiben, Kapital zurückzuhalten und die Kaufkraft zu zerstören. Und eine fünfte, zwar noch kleine, aber immer einflußreichere Gruppe war nun bereit, die bestehende Struktur für annehmbar zu erklären und die geplanten Defizite als ein Mittel zu ihrer Stabilisierung anzuerkennen. Gestützt auf Keynes' „General Theory of Employment, Interest and Money“ (1936), hatte diese Gruppe neues Selbstvertrauen und einen stärkeren inneren Zusammenhalt gewonnen, doch wurde sie in der nachfolgenden Debatte hauptsächlich von Leuten unterstützt, die zum damaligen Zeitpunkt im Geldausgeben den besten Ausweg sahen, einen Weg, der zu andersartigen Reformen und auch zur Befriedigung dringender sozialer und humanitärer Bedürfnisse hinführen könne66. Genau wie 1933 zögerte Roosevelt, selbst eine Entscheidung zu treffen, und schien geneigt, jedem etwas zu geben. Einmal trat er als „Budget-Ausgleicher“ auf, und dann wieder war er abwechselnd „Geldausgeber“, „Antimonopolist“, „Manager“ der Preisstruktur und Befürworter der „Wirtschaftsplanung“. Eine Zeitlang schien alles ein einziges Durcheinander, aber allmählich wurden einige Alternativen ausgeschieden und andere eingeschränkt. Eine „Planung“ schien letzten Endes noch immer undurchführbar. Einen „Budgetausgleich“ hielt man © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“
31
für wirkungslos, auch hatte er sich auf die Dauer kaum ohne Steuererhöhungen durchhalten lassen. Und da sich nur wenige darüber einigen konnten, was man sich unter „Dezentralisierungsbestrebungen“ eigentlich vorzustellen hatte, überließ man einschlägige Forderungen den langwierigen Untersuchungen eines „Temporary National Economic Committee“. Übrig blieb ein Programm, das in der Hauptsache aus der Mischung von 1937 plus zwei wichtigen Ergänzungen bestand. Die eine war der Versuch von Thurman Arnolds „Antitrust Division“, das Sherman-Antitrust-Gesetz von 1890 als Waffe zur Preisüberwachung zu benutzen. In Schlüsselbereichen, d. h. auf Gebieten, wo hohe Preise und Kosten als wirtschaftlicher „Engpaß“ empfunden wurden, machte sich Arnold daran, die Dinge durch die publizistische Ausschlachtung von Verstößen und durch Verhandlungen über zahlreiche Genehmigungsanträge zu bessern. Die andere, für die Zukunft weit bedeutsamere Neuerung, war Roosevelts Zustimmung zu den geplanten Defiziten zum Zweck der wirtschaftlichen Expansion. Nachdem er sich einmal zugunsten des neuen Regierungsprogramms, das erhöhte Ausgaben befürwortete, entschieden hatte, ging er dazu über, dies mit Keynes'schen Theorien zu rechtfertigen und das Verdienst für die darauffolgende Aufwärtsentwicklung für sich in Anspruch zu nehmen67. Als das Jahrzehnt zu Ende ging, gab es über beide Neuerungen heftige Debatten; und was daraus geworden wäre, wenn es keinen Krieg gegeben hätte, ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich wäre es angesichts der Ablehnung des neuen Gesetzes über die Staatsausgaben im Jahre 1939 zu ein oder zwei neuen schweren Depressionen gekommen, bevor der Keynesianismus sich als etablierte Richtung zur Regulierung und Stabilisierung der Gesamtnachfrage hätte durchsetzen können. Und vermutlich hätte es angesichts von Arnolds Hang zum Dramatischen noch etwas länger gedauert, bis die Wirtschaftsplaner der Verbände es fertig gebracht hätten, das Antitrust-Abenteuer in die relativ sicheren Bereiche zurückzuführen, wo man sich darauf beschränkte, besonders auffälligen Mißbräuchen Einhalt zu gebieten und die einzelnen Wirtschaftsgruppen vor gegenseitigen Übergriffen zu schützen. Es stellte sich heraus, daß der Krieg beide Prozesse beschleunigte. Das Arnold-Programm wurde schließlich zu den Akten gelegt, nachdem es mit der „Kooperation“ und „Planung“ der Kriegszeit in heftigen Konflikt geraten war, und es geriet in Vergessenheit68. Der durch die Kriegsausgaben gerechtfertigte Keynesianismus wurde rasch zu einem Bestandteil des „American way“, besonders da die Kriegsschulden, die kriegsbedingte Ausweitung des öffentlichen Sektors und die „Notwendigkeit“ von Ausgaben für Rüstung, Technologie und Auslandshilfe eine Finanzpolitik ermöglichten, die den Wirtschaftsführern genehmer war. Anstatt von fluktuierenden öffentlichen Ausgaben abhängig zu sein, welche kapitalistische Tugenden in ihr Gegenteil zu verkehren und einen Kampf um das private Unternehmertum heraufzubeschwören vermochten, konnten sie sich nun auf einen festen Kern „wünschenswerter“ Ausgaben verlassen, und damit rechnen, daß die Schwankungen in den Regierungseinkünften die Gesamtnachfrage regulieren würden69. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
32
Ellis W. Hawley
In den vierziger Jahren erklärten sich dann die meisten Führer der Verbände auch mit den anderen Neuerungen des New Deal einverstanden, teils auf Grund ihrer neuen „Partnerschaft“ mit der Regierung während des Krieges, teils weil es ihnen in der Nachkriegszeit gelang, die der Umstellung auf Friedensproduktion dienenden Kontrollen über Bord zu werfen und die Macht der Gewerkschaften einzudämmen. Sie waren der Ansicht, daß ein gehörig eingeschränkter „Wohlfahrtsdirigismus“, „verantwortungsbewußte“ Arbeitergewerkschaften, eine von den Interessenverbänden betriebene „Planung“ und Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung eines „funktionsfähigen Wettbewerbs“ zusammen einen stabilen Rahmen abgeben würden, in dem die korporativen Organisationen gedeihen und wachsen konnten. Andererseits war der Eindruck stark, den die Leistungen des „Organisierten Kapitalismus“ Amerikas während der Kriegs- und Nachkriegszeit, die veränderte Einstellung der Unternehmensführer und die offenkundige Notwendigkeit hervorriefen, ein funktionierendes System vor der „Unvernunft“ der „radikalen Rechten“ zu schützen. Die Folge war, daß diejenigen, die sich zum Ziel gesetzt hatten, das korporative System zu „demokratisieren“ und zu „liberalisieren“, zu dem Schluß kamen, daß ihr Bemühen von Erfolg gekrönt war. Sie mußten zwar zugeben, daß die korporative Elite immer noch über beträchtliche Macht verfügte, aber angesichts des neuen „korporativen Gewissens“, des „funktionsfähigen Wettbewerbs“ und des Systems der „countervailing powers“, welches durch die Reform zustande gekommen war, bestand die Hoffnung, daß diese Macht einer ständigen Weiterentwicklung der amerikanischen liberalen und demokratischen Ideale nicht gefährlich, sondern förderlich sein würde70. In den fünfziger Jahren hatte es den Anschein, daß sich die Spannungen, mit denen der New Deal zu kämpfen gehabt hatte, in einer neuen, höheren Synthese des „demokratischen Pluralismus“, der „gemischten Wirtschaftsform“ oder der „vitalen Mitte“ aufgelöst hatten. Amerika, so argumentierte man, war der Durchbruch zu einer großartigen Verschmelzung zweier Welten gelungen, zu einem System, das technokratische Rationalität, soziale Sicherheit und stabiles Wachstum mit einem großen Spielraum für demokratische Entscheidungsprozesse, individuelle Freiheit und dezentralisierte Initiative verband. Und dieser Durchbruch, so hieß es oft, habe den „American way“ zum Inbegriff des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts gemacht. Amerikas Weg sei der Weg, den auch ein großer Teil der übrigen Welt schließlich einschlagen werde, besonders nachdem sie gelernt habe, die falsche Dichotomie zwischen Sozialismus und Kapitalismus zu verwerfen und den Fallgruben extremistischer Ideologien aus dem Weg zu gehen. Manche glaubten bereits deutliche Tendenzen in dieser Richtung zu sehen — Tendenzen, die sich in dem „neuen Kapitalismus“ spiegelten, wie er sich bei den ehemaligen Achsenmächten herausbildete, in der „gemischten Wirtschaftsform“, in welcher die britischen Sozialisten und Konservativen zueinander fanden, und in den Bemühungen der Franzosen, ihre „Planwirtschaft“ mit Maßnahmen zur Förderung des Wettbewerbs zu kombinieren. Angesichts dieser Tatsache meinten gewisse Autoren, der amerikanische © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“
33
New Deal habe die Vereinigten Staaten nicht nur auf dem Weg des wahren Fortschritts weitergeführt, er sei auch das Buschmesser der Weltgeschichte gewesen, mit dem ein Pfad zu einem neuen, höheren Niveau der sozioökonomischen Entwicklung gebahnt worden sei71. VI Natürlich erschienen diese Interpretationen aus den fünfziger Jahren weit weniger stichhaltig, als man in den sechziger Jahren die amerikanischen Leistungen an den ehemaligen Erwartungen maß und die alten Spannungen sich wieder bemerkbar machten. Hinter der Fassade des Pluralismus, so meinten gewisse Kritiker, hätten die „Reformen“ der dreißiger Jahre in Wirklichkeit einer „neuen Tyrannei“ den Weg geebnet, die von einer verantwortungslosen „Machtelite“ und von einer modernen Abart feudaler Vasallen ausgeübt oder doch „manipuliert“ werde und die zu keiner gerechten Gesellschaft, sondern zu „Imperialismus“, „Repression“ und individueller „Entfremdung“ geführt habe72. Und trotz des Geredes über „Bigness“ und trotz aller Ansprüche auf die Überlegenheit des Pragmatismus war das amerikanische System nach Meinung anderer in Wirklichkeit mangelhaft koordiniert, verschwenderisch und chaotisch, gelähmt durch seinen traditionellen Individualismus, durch die Teilung der Macht und die Rivalität innerhalb der Exekutive — und daher in der Entwicklung einer strukturellen und finanziellen Planung behindert, durch welche ein schnelles Wachstum mit Vollbeschäftigung, Währungsstabilität und gesellschaftlicher Integration zu vereinbaren gewesen wäre73. Man war jetzt häufiger der Ansicht, die entscheidenden Maßnahmen zu einer modernen kapitalistischen Entwicklung seien in Frankreich, Schweden oder Japan und nicht in den Vereinigten Staaten zu beobachten, und es gewann den Anschein, daß die unter dem New Deal entwickelten Einrichtungen vielleicht für die Weltgeschichte doch nicht die Bedeutung haben könnten, die man ihnen einmal unterstellt hatte. Es bestand die Möglichkeit, daß dieser New Deal kaum mehr war als ein Irrweg, der von den Hauptentwicklungsbahnen in der Welt wegführte, daß er Amerika auf einen kostspieligen Umweg gebracht oder sogar in eine ausweglose Sackgasse hineingetrieben hatte74. Welche dieser Interpretationen recht behalten wird, dürfte von zukünftigen Entwicklungen abhängen, aber es erscheint unwahrscheinlich, daß die ältere Auffassung vom modernen amerikanischen Staat als dem Triumph einer bodenständigen liberalen Demokratie sich jemals wieder voll durchsetzen wird. Die Reformbestrebungen im Amerika des 20. Jahrhunderts waren nach Auffassung der Historiker des „Organisierten Kapitalismus“ nicht nur von liberaldemokratischen und humanitären Idealen inspiriert, sondern auch von dem Zukunftsbild eines wissenschaftlichen Managements und einer Rationalisierung der Großwirtschaft. Zeitweise war es zu besonders heftigen Zusammenstößen zwischen diesen widerstreitenden Kräften gekommen. Daher darf man in dem „liberalen“ amerikanischen Staat, besonders in der Form, die er in den dreißi3 Winkler, Krise © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
34
Ellis W. Hawley
ger Jahren angenommen hatte, nicht ausschließlich das Werk liberaler Demokraten oder einer Elite von Managern sehen, sondern eher das Produkt einer komplexen Wechselwirkung von verschiedenen „Liberalismen“, von streitenden Interessengruppen und widerspenstigen Traditionen. Im Licht der vergleichenden Geschichtswissenschaft sieht es überdies so aus, als ob dieses Experiment, wiewohl es der amerikanischen Tradition angepaßt und von amerikanischen Politikern gestaltet worden ist, doch Teil umfassender Konflikte war — der Konflikte nämlich zwischen einer auf Modernisierung ausgerichteten „Revolution der Manager“ und den traditionellen Werten, die sie umformen wollte. Es läßt sich zwar noch immer darüber streiten, wie das Experiment des New Deal in diese umfassenderen Modelle der amerikanischen Geschichte und der Weltgeschichte im einzelnen hineinpaßt, aber daß man es in diesem Zusammenhang sehen sollte, dürfte kaum zu bezweifeln sein.
Anmerkungen 1 Vgl. L. Galambos, The Emerging Organizational Synthesis in Modern American History, BHR 44. 1970, 279—290. Zu den maßgebenden Publikationen der neuen Richtung gehören: R. Wiebe, The Search for Order, 1877—1920, New York 1967; S. Hays, Conservation and the Gospel of Efficiency, Cambridge/Mass. 1959; S. Haber, Efficiency and Uplift, Chicago 1964; J . K. Galbraith, The New Industrial State, Boston 1967, und L. Galambos, Competition and Cooperation, Baltimore 1966. 2 Eine Diskussion der neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der vergleichenden Geschichtswissenschaft und der Modernisierungsbestrebungen findet sich in C. E. Black, The Dynamics of Modernization: Α Study in Comparative History, New York 1966, 175—199. 3 Vgl. z.B. Galbraith, I ndustrial State, 302—310. Unter „Organisiertem Kapitalis mus“ verstehe ich ein System, bei dem die meisten Produktions- und Distributionsmittel sich in Privatbesitz befinden und nach Gewinngesichtspunkten betrieben werden, wo jedoch das unabhängige Unternehmertum weitgehend durch mächtige hierarchische oder Verbandskollektive ersetzt worden ist, die von „Organization men“ geleitet werden, und wo Preise und Produktion nach Gesichtspunkten des Managements oder auf Grund von Kollektivvereinbarungen festgelegt werden, wo Neuerungen und Risiken institutionalisiert und geregelt sind und die Koordination mehr durch Planung, Verwaltungsmaßnahmen und Verhandlungen erreicht wird als durch Marktwettbewerb. 4 Die Formulierung stammt aus: B. D. Karl, Executive Reorganization and Reform in the New Deal, Cambridge/Mass. 1963, xiii. 5 Eine Untersuchung dieser Spannungen findet sich in R. Sarti, Fascism and the Industrial Leadership in Italy, 1919—1940, Berkeley 1971. 6 Vgl. Β. Marshall, Capitalism and Nationalism in Prewar Japan, Stanford 1967. 7 Eine Untersuchung, die sich speziell mit diesen Spannungen beschäftigt, ist A. Schweitzer, Big Business in the Third Reich, Bloomington 1964. Vgl. auch H. Lebovics, Social Conservatism and the Middle Classes in Germany, Princeton 1969, und Η. Α. Turner, Big Business and the Rise of Hitler, AHR 75. 1969, 56—70. 8 Siehe Η. W. Ehrmann, Organized Business in France, Princeton 1957, bes. Kap. 1; Μ. Elbow, French Corporative Theory, New York 1953, bes. Kap. 5; V. G. Venturini, Monopolies and Restrictive Trade Practices in France, Leyden 1971, 15—47, 314—317, u. A. Shonfield, Modern Capitalism, London 1965, 71—87.
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“
35
9 Siehe Μ. Childs, Sweden: The Middle Way, New Haven 1947 u. F. Scott, The United States and Scandinavia, Cambridge/Mass. 1950, bes. Kap. 5. 10 Siehe J . W. Grove, Government and I ndustry in Britain, London 1962, 42—55, 182—183, 298—326. Siehe auch A. Lucas, I ndustrial Reconstruction and the Control of Competition, London 1937, u. P. Guenalt u. J . M. Jackson, The Control of Mono poly in the United Kingdom, London 1960, 6—24. 11 Eine Diskussion dieser verschiedenen Traditionen findet sich in C. Edwards, Control of Cartels and Monopolies: An I nternational Comparison, Dobbs Ferry 1967, 17—21. Vgl. auch D. Dewey, Monopoly in Economics and Law, Chicago 1939, Kap. 11 u. 19. 12 Siehe R. Radosh, The Development of the Corporate I deology of American Labor Leaders, 1914—1933, phil. Diss., University of Wisconsin 1967, MS. 13 Natürlich gab es einige Gruppen, die lieber die bestehende Industrieordnung zerstört wissen wollten, und andere, zu denen gewisse Korporativisten, Technokraten, Sozialisten und Syndikalisten gehörten, welche das Erbe des liberalen Kapitalismus aufgeben wollten. Aber diese Gruppen waren und blieben Randerscheinungen im großen Strom der Politik. 14 Zeitgenössische Darlegungen dieser Reformmodelle sind: W. Wilson, The New Freedom, New York 1913; J . B. u. J . M. Clark, The Control of Trusts, New York 1914; H. Croly, The Promise of American Life, New York 1909; Ch. van Hise, Concentration and Control, New York 1912; A. Eddy, The New Competition, New York 1912; E. Hurley, The Awakening of Business, Garden City 1917, u. A. Bentley, The Process of Government, Chicago 1908. 15 Vgl. Ch. Hirschfield, National Progressivism and World War I, Mid-America 45. 1963, 139—156; R. Himmelberg, The War Industries Board and the Antitrust Question, Journal of American History 52. 1965, 59—74; F. Redlich, German Economic Planning for War and Peace, Review of Politics 6. 1944, 315—335; Ch. S. Maier, Between Taylorism and Technocracy, Journal of Contemporary History 5. 1970, 38—41, 45 bis 56, 49, u. Ehrmann, 19—22. 16 Siehe R. Cuff, Business, the State, and World War I, War and Society in North America, Montreal 1971. 17 Derartige Argumente finden sich in Η. Hoover, The New Day, Stanford 1928, 9—44; M. Thorpe, The Business Revolution, Nation's Business, März 1927, 27—28, u. Ε. Ε. Hunt, The Cooperative Committee and Conference System, in: Commerce Department Official Files (Hunt), Hoover Papers, Hoover Presidential Library, West Branch, I owa. 18 R. Himmelberg, Relaxation of the Federal Anti-Trust Policy as a Goal of the Business Community during the Period 1918—1933, phil. Diss., Pennsylvania State University 1963, MS, 223—241, 249—251; R. Bruere, Swope Plan and After, Survey, 67. 1932, 583—585; A. M. Schlesinger, Jr., The Age of Roosevelt, I (The Crisis of the Old Order), Boston 1957, 181—183. 18 Schlesinger, I , 191—202; G. Soule, National Planning, New Republic 64. 1931, 61—65; Program of the Progressive Conference, March 11—12, 1931, George Norris Papers, Library of Congress, Washington, D. C. 20 Die beste Darstellung von Hoovers kooperativem Programm findet sich in A. Romasco, The Poverty of Abundance, New York 1964, 24—65. Zu seinen Ausein andersetzungen mit dem Neuen Liberalismus und dem Neuen Korporativismus vgl. ebd., 186—201; J . Schwarz, I nterregnum of Dispair, Urbana 1970, 88—105, 142—178; R. Himmelberg, Relaxation, 209—218, u. Ε I yons, H. Hoover, Garden City 1964, 294. 21 Überzeugend finde ich die Ansichten von R. S. Kirkendall, The Great Depression: Another Watershed in American History?, in: J . Braeman u. a. Hg., Change and Continuity in Twentieth-Century America, Columbus 1964, 147—189. Meiner Meinung nach hebt jedoch Kirkendall die Kontinuität zwischen der Neuen Ära und den
3*
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
36
Ellis W. Hawley
zwanziger Jahren, der Hoover-Regierung und dem New Deal, besonders auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik nicht genügend heraus. Klarer in dieser Hinsicht ist H. Stein, The Fiscal Revolution in America, Chicago 1969, 6—38. 22 Ausführlich besprochen in: Th. Rosenof, Roads to Recovery: The Economic Ideas of American Political Leaders, 1933—1938, phil. Diss., University of Wisconsin 1970, MS. 23 Obwohl häufig behauptet wurde, das Ende der „Frontier“ und der wirtschaftliche Reifungsprozeß würden Stagnation und strenge Kontrollen heraufbeschwören, wollte die große Mehrheit dies nicht hinnehmen. Statt dessen suchte man nach „New Frontiers“ durch Anheben der Massenkaufkraft, durch Ausweitung des Handels, durch die Entwicklung neuer Technologien, durch vermehrte öffentliche Investitionen oder andere Mittel. 24 Auch die Außenstehenden, d. h. die nicht-kapitalistische Linke, die äußerste Rechte und verschiedene Gruppen von Agrar-Reaktionären, übten gelegentlich einen gewissen Einfluß aus, doch wurden ihre Vorschläge nie ernsthaft in Erwägung gezogen, und sie hatten kaum je eine Chance, an die Macht zu kommen. 25 Fast alle Historiker, die sich mit Roosevelt näher beschäftigt haben, stimmen darin überein, daß er diese Eigenschaften besaß, nur waren es für die einen Tugenden und für die anderen Schwächen. Vgl. A. M. Schlesinger, The Age of Roosevelt, II (The Coming of the New Deal), Boston 1959, 192—194, 527—532; R. G. Tugwell, The Compromising Roosevelt, WPQ 6. 1953, 320—341; J . M. Burns, Roosevelt: The Lion and the Fox, New York 1956, 474—475. 26 Vgl. W. E. Leuchtenburg, F. D. Roosevelt and the New Deal, New York 1963, 33—38, u. E. W. Hawley, The New Deal and the Problem of Monopoly, Princeton 1966, 35—52. Eine Erörterung der verschiedenen Gruppen findet sich in: Rosenof, passim. 27 Die beste Abhandlung über die Wirtschaftsströmungen, die zum National Industrial Recovery Act führten, ist Galambos, Competition and Cooperation, 181—202. Zu den verschiedenen Richtungen innerhalb der Wirtschaft vgl. auch Himmelberg, Relaxation of Anti-Trust, 245—255, u. E. George, Antitrust Laws as to National Economic Planning, Frederick Feiker Papers Record Group 151 (Box 103), National Archives, Washington D. C. 28 Es war dies der berühmte Artikel 7, in dem verlangt wurde, daß die „codes“ Mindestarbeitsbedingungen vorsehen und das Recht der Arbeiterschaft, sich zu organisieren und über die Gewerkschaften allgemeinverbindliche Tarifverträge abzuschließen, garantieren müßten, wobei es jedoch weiteren „code“-Verhandlungen überlassen blieb, dieses Mindestmaß im einzelnen festzulegen und die Garantien so zu formulieren, daß Hintertüren für die Betriebsgewerkschaften und individuelle Verhandlungen offenblieben. Die antimonopolistischen Zusicherungen in Artikel 3, auf denen die antimonopolistisch eingestellten Senatoren bestanden hatten, sollten dafür sorgen, daß kein „code“ „Monopole und monopolistische Praktiken“ unterstützte. 29 Eine ausführliche Besprechung der Entstehungsgeschichte der „Charta“ findet sich in Hawley, 19—34. 30 Siehe Schlesinger, Age of Roosevelt, II, 87—102, und Hawley, 26—28, 35—52. 31 Einzelheiten hierzu bei W. Leuchtenburg, The New Deal and the Analogue of War, in: Braeman u. a., 84—92, u. G. Nash, Experiments in Industrial Mobilization: WIB and NRA, Mid-America 43. 1963, 157—174. 32 Einzelheiten hierzu in Hawley, 55—71, und in: L. Lyon u. a. Hg., National Recovery Administration, Washington, D. C. 1935, 93, 123, 166, 212, 224, 267, 280, 458—461, 568—577, 585—589, 610—611, 623—637, 653—669, 689—694. 33 Siehe Stein, 39—57. 34 Die Schlußfolgerungen hieraus in Lyon u. a., 621, 744—745, 804—809, 871—877 sind noch immer überzeugend. 35 Hawley, 69—70, 78—79. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“
37
Ebd., 79—110, 114—118. Siehe F. R. Dulles, Labor in America, New York 1966, 267—273; I. Bernstein, Turbulent Years, Boston 1970, 172—205, 318—330, u. S. Fine, The Automobile under the Blue Eagle, Ann Arbor 1963, 219—230. 38 Siehe Schlesinger, Age of Roosevelt, II, 214—217; Hawley, 89, 102—133; L. Lorwin u. A. F. Hinrichs, National Economic and Social Planning, Washington, D. C. 1935, 164—165, u. Lyon u. a., 272—276. 39 Man könnte zu dieser Gruppe auch Männer rechnen wie Thomas Watson von den International Business Machines, Joseph Kennedy, der Erster Vorsitzender der neuen Securities Exchange Commission war, und W. Averell Harriman von der Union Pacific rechnen, außerdem Henry Harriman von der New England Power Company, Gerard Swope von General Electrics und Allie Freed, der mit seinem Committee for Economic Recovery den Versuch machte, die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Regierung zu einer Dauereinrichtung zu machen. Männer dieser Art bilden ein wichtiges Bindeglied zwischen der korporativen „Aufklärung“ der zwanziger Jahre und der der fünfziger Jahre, doch waren sie nicht — wie einige Autoren behaupten — mit dem Big Business identisch. Ende 1934 waren sie selbst unter den Verbandsmanagern und den Führern der Körperschaften nur noch eine kleine Minoritätsgruppe. 40 Anfang 1935, als die Debatten über eine Verlängerung der auf zwei Jahre begrenzten „Charta“ von 1933 anfingen, wurde diese dreifache Aufspaltung besonders deutlich. Gruppen wie der Commerce Department's Business Advisory and Planning Council und das Industry and Business Committee for NRA Extension forderten eine einfache Verlängerung des National Industrial Recovery Act. Die Chamber of Commerce und verschiedene andere Gruppen waren nur für eine Verlängerung, wenn zuvor drastische Revisionen vorgenommen würden. Und das Committee for Elimination of Price-Fixing and Production Control, das sich aus Geschäftsleuten zusammensetzte, die gegen die „Handschellen der Regierung“ angingen, war überhaupt gegen jede Verlängerung. Vgl. Hawley, 120—122. 41 Darstellungen der veränderten Haltung der Geschäftswelt finden sich in Schlesinger, Age of Roosevelt, II, 472—488; G. Wolfskill u. J . Hudson, All but the People, Toronto 1969, 144—149; F. Rudolph, The American Liberty League, 1934—1940, AHR 56. 1950, 19—33, u. Burns, 202—208, 239—240. 42 Vgl. z. B. die Reden von C. P. Dennett, Virgil Jordan, Alfred P. Sloan, Jr. u. Winthrop Aldrich, in: Vital Speeches, I, 1934, 144—146, 150—155, 163—168, 176 bis 181. 43 Stein, Fiscal Revolution, 56—57, 74—76; E. C. Brown, Fiscal Policy in the Thirties: A Reappraisal, AER 46. 1956, 863—868. 44 Über Reaktionen gegen Ende der NRA vgl. A. M. Schlesinger, The Age of Roosevelt, III (The Politics of Upheaval), Boston 1960, 283—291, u. Burns, 222—223. 45 Siehe Burns, 224—226. 49 Die Tätigkeit der Planer aus den Reihen der Wirtschaft wie auch die aus den Reihen der Kollektivisten behandelt Hawley, 159—186. 47 Z. B. B. Rauch, A History of the New Deal, New York 1944, 156—190. 48 Siehe R. G. Tugwell, The New Deal: The Progressive Tradition, WPQ 3. 1950, 390—427. Vgl. auch Schlesinger, Age of Roosevelt, III, 389—392, u. Th. McGraw, TVA and the Power Fight, New York 1971, 87—88, 106. 49 Wieder waren einige Kreise der Landwirtschaft und des Zwischenhandels bereit, darauf einzugehen, doch war ihr Einfluß immer noch minimal. 50 Die Anfälligkeit der Elektrizitätsgesellschaften und Investitionsbanken kam zum Teil von der erneuten populistischen Propaganda, zum Teil auch davon, daß sie in den Krach der Wertpapierbörse und dessen Nachwirkungen verwickelt waren, zum Teil aber auch von weithin publik gewordenen Enthüllungen über frühere finanzielle und politische Entgleisungen. Weitere wichtige Zielscheiben der Antitrust-Bewegung waren die „Wohnungsringe“ und die „Nahrungsmitteltrusts“, die man herkömmlicherweise 36
37
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
38
Ellis W. Hawley
für die hohen Lebenshaltungskosten verantwortlich machte, die „Interessen der im Ausland Lebenden“, die angeblich den Gemeinden das Lebensmark aussaugten, sowie die etablierten Marktpraktiken der Petroleum-, Stahl-, Automobil- und Filmindustrie, die von unabhängigen Verkaufsmanagern und Zwischenhändlern verschiedener Art angegriffen wurden. 51 Einzelheiten über die Anti-truster und ihren Einfluß bei Hawley, 283—379. Über die Eigentümlichkeiten des amerikanischen Wirtschaftssystems gegen Ende des Jahrzehnts vgl. D. Lynch, The Concentration of Economic Power, New York 1946, 111 bis 142, 173—236. Die beste Darstellung der Veränderungen des Wertpapierwesens findet sich in M. Parrish, Securities Regulation and the New Deal, New Haven 1970, 228—232. 52 Siehe G. Nash, United States Oil Policy, 1890—1964, Pittsburgh 1968, 146 bis 156. 53 Siehe J . Johnson, Α New Deal for Soft Coal, phil. Diss. Columbia University 1968 MS., u. W. Fisher u. Ch. James, Minimum Price Fixing in the Bituminous Coal Industry. Princeton 1955. 54 Siehe Μ. Benedict, Farm Policies of the United States, New York 1953, 349 bis 401. 55 Siehe Ε. Grether, Price Control under Fair Trade Legislation, New York 1939, u. J . Palamountain, Jr., The Politics of Distribution, Cambridge, Mass., 1955. 56 Siehe Ε. Williams, Jr., Regulation of Rail-Motor Rate Competition, New York 1958; H. L. Smith, Airways, New York 1942, u. P. Zeis, American Shipping Policy, Princeton, 1938. 57 Siehe Ch. Jackson, Food and Drug Legislation in the New Deal, Princeton 1970, 201—221. 58 Eine abgeänderte NRA wurde allerdings von Donald Richberg und einigen anderen früheren NRA-Verwaltungsbeamten befürwortet, doch wurden sie von der Wirtschaft darin kaum unterstützt. Näheres hierüber bei Hawley, 164—165. 58 Eines der wichtigsten Ereignisse dieses Jahrzehnts war die Gründung des Congress of Industrial Organizations (CIO), der sich am Prinzip der Industrie- und nicht an dem der Berufsgewerkschaft orientierte und der mehr mit Sitzstreiks und politischen Aktionen als mit den herkömmlichen Waffen der Arbeiterbewegung kämpfte. Der CIO wurde 1936 aus der American Federation of Labor ausgeschlossen und übernahm anschließend die Führung in der gewerkschaftlichen Organisation der auf Massenproduktion abgestellten Industrien, so daß es in den Vereinigten Staaten fast zu einer Verdreifachung der Mitgliedschaft in den Gewerkschaften kam. Ende der dreißiger Jahre konnte man zum erstenmal in der amerikanischen Geschichte von „big labor“ als einem wichtigen politischen und wirtschaftlichen Machtfaktor sprechen. Vgl. Bernstein, Turbulent Years, 786—793, u. D. Brody, The Emergence of Mass Production Unionism, in: Braeman u. a., 244—256. 60 Siehe A. Smithies, The American Economy in the Thirties, AER 36. 1946, 21 bis 23, u. A. Chandler, The Role of Business in the United States, Daedalus 48. 1969, 37—38. Zu den wichtigsten strukturellen Änderungen in den Wirtschaftsorganisationen gehörte, daß die Personalabteilungen und die Spezialisten für industrielle Beziehungen eine wichtigere Rolle zugewiesen bekamen und die Werkmeister an Einfluß verloren. 61 Die entscheidenden Gesetze waren das Gesetz für Soziale Sicherheit, das Bodenerhaltungsgesetz und das Gesetz über Nothilfe und Wiederaufbau aus dem Jahr 1935, das Walsh-Healey-Arbeitsstandardgesetz und das Norris-Rayburn-Land-Elektrifizierungsgesetz von 1936, das Wagner-Steagall-Wohnungsgesetz und das Bankhead-JonesFarmpacht-Gesetz von 1937, sowie das Gesetz über angemessene Arbeitsbedingungen (Fair Labor Standards Act) von 1938. 62 Siehe z. B. Β. M. Stave, The New Deal and the Last Hurrah, Pittsburgh 1970, 182. 63 Stein, 87—93, 119. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
New Deal und „Organisierter Kapitalismus“
39
64 Ebd., 93—102. Vgl. auch D. Hayes, Business Confidence and Business Activity, Ann Arbor 1951, 118—126, u. K. Roose, The Economics of Recession and Revival, New Haven 1954, 234—241. 65 Stein, 103—104, 113—114: Hawley, 357—358, 388. 65 Ebd., 388—403. Siehe auch Stein, ebd., 102—103, u. Leuchtenburg, Roosevelt, 244—247. 67 Ebd., 248—249, 254—264; Hawley, 390—391, 394, 396, 399—402, 404—414, 428—440; Stein, 103—115; G. M. Gressley, Thurman Arnold, Antitrust, and the New Deal, BHR 38. 1964, 224—225, 230. 68 Hawley, 441—443. 69 Stein, 169—190; Galbraith, I ndustrial State, 226—232. 70 Siehe Β. Sternsher, Liberalism in the 1950's, Antioch Review 32. 1962, 315—331. Zu den wichtigsten Veröffentlichungen zum Thema der neuen Synthese gehören: J . Galbraith, American Capitalism, Boston 1952; A. Berle, Twentieth Century Capitalist Revolution, New York 1954, u. A. D. H. Kaplan, Big Enterprise in a Competitive System, Washington, D. C. 1954. 71 Außer den in Anm. 70 erwähnten Arbeiten: A. Link, American Epoch, New York 1955, 595—602; R. Hofstadter, The Age of Reform, New York 1955, 254—255, 314—316; J . D. Hicks, The Third American Revolution, Nebraska History 36. 1955, 227—245; Α. Μ. Schlesinger, Jr., The Vital Center, Cambridge, Mass 1947; D. Bell, The End of I deology, Glencoe 1960, u, E. Rostow, Planning for Freedom, New Haven 1959. 72 Vgl. z. Β. Β. Bernstein, The New Deal: The Conservative Achievements of Liberal Reform, in: ders. Hg., Towards a New Past, New York 1967; P. Conkin, The New Deal, New York 1967, 71—81, und Ch. Reich, The Greening of America, New York 1970, 41—58. 73 Siehe Th. Lowi, The End of Liberalism, New York 1969, 297—314; R. Wolff, The Poverty of Liberalism, Boston 1968, u. Shonfield, 385—388. 74 Ebd., 81—86, 199—208; Toward the Japanes Century, Time, 2. März 1970; A. Hacker, The End of the American Era, New York 1970.
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter in Wirtschaftskrise und New Deal1 Von JÜRGEN KOCKA
1. Ökonomische und soziale Voraussetzungen Mißt man die Härte der 1929 beginnenden Depression an dem Ausmaß der Massenarbeitslosigkeit und am Kaufkraftverlust der Massen, also an jenen quantifizierbaren Indices, die für die Lebenssituation der breiten Bevölkerung vor allem wichtig waren, so stellt sich heraus, daß die Schärfe der amerikanischen Depression kaum hinter der der deutschen zurückstand. Während die Zahl der gearbeiteten Stunden von 1929 bis 1932 in den USA sogar etwas stärker zurückging als in Deutschland, sank hier die Zahl der Beschäftigten etwas tiefer — ein Hinweis auf die größere Verbreitung von Kurzarbeit, von work-sharing“, in den ohne adäquate Arbeitslosenversicherung von der Krise getroffenen USA. Wenn trotzdem die Arbeitslosenziffer 1932 in Deutschland 30,1 %, in den USA nur 23,6 % erreichte, so erklärt sich dies aus der verschiedenen Ausgangslage 1929: Deutschland zählte in diesem Jahr 9,3 %, USA aber nur 3,2 % Arbeitslose. Alle Indices zeigen die raschere Erholung Deutschlands ab 1933 und den Rückfall der amerikanischen Entwicklung im Jahre 1938, der im rüstenden Deutschland keine Parallele hatte2. In beiden Ländern sanken die Reallöhne der Arbeiter von 1929 bis 1932 um durchschnittlich 14 bis 15 %. Allerdings traf dieser Einbruch die USA nach einer fast zehnjährigen Periode ziemlich gleichmäßigen Wachstums der Arbeiter-Kaufkraft, während die deutschen Reallöhne nach scharfem Rückgang in Krieg, Inflation und Stabilisierung 1929 nur knapp den Stand von 1913 überstiegen hatten. Die amerikanischen Reallöhne erreichten außerdem ihren Vor-Depressionsstand bereits 1935 wieder, während dies in Deutschland bis 1938 dauerte3. Die 1930 etwa 10,4 Millionen amerikanischen Angestellten, die etwa 22 % aller Erwerbstätigen ausmachten, wurden von der Krise schwer getroffen, wenn in der Regel auch etwas später und im ganzen etwas weniger hart als die Arbeiter. Von 1929 bis 1932 gingen im amerikanischen Bundesstaat Ohio die Zahl der Lohnarbeiter um 39,6 %, die Zahl der „Buchhalter, Stenographen und Büroangestellten“ um 20,1 %, die der kaufmännischen Angestellten um 25,6 % zurück. Das durchschnittliche nominale Jahreseinkommen der weiterhin Beschäftigten sank bei denselben Gruppen um 32,7%, 17,1 % und 26,2 %. An der durch Mindestlohn- und Höchstarbeitszeit-Bestimmungen unterstützten Erholung ab Anfang 1933 nahmen die Arbeiter andererseits in größerem Maße teil als die Angestellten4.
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
41
1937, als die Erholung weiter fortgeschritten war und „nur“ noch ca. 15 % Arbeitslose gezählt wurden, befanden sich unter diesen noch 1,17 Millionen Angestellte (622 000 Männer und 548 000 Frauen). Das entsprach 9,5 % der Angestellten (8,8 % bei den Männern und 10,5 % bei den Frauen) insgesamt 5 .; Die geringere Entlassungsquote bei den Angestellten resultierte aus ihrerstärkeren Vertretung in weniger hart getroffenen Wirtschaftszweigen, der weniger direkten Abhängigkeit ihrer Tätigkeiten von Marktschwankungen und der vielfach motivierten Tendenz von Unternehmensleitungen, mittlere und höhere Angestellte auch dann nicht zu entlassen, wenn sie vorübergehend mehr kosteten als einbrachten (sofern diese profitwidrige Situation nicht zu lange dauerte). Auch hierin glichen sich übrigens die amerikanische und die deutsche Entwicklung. Beschränkt man die Betrachtung auf den industriellen Bereich, so zeigt sich in beiden Ländern die größere Arbeitsplatzsicherheit der Angestellten an ihrem in Depressionsjahren steigenden Anteil an der Gesamtbeschäftigtenzahl. Angestellte (salaried employees) in % aller Arbeitnehmer in Industrie und Handwerk in den USA und Deutschland6:
1925 1929 1932 1937 1938
USA
Deutschland
12,5 13,7 16,3 12,9 14,2
12,9 13,1 15,0 11,7 11,9
Auch das Verhältnis von Gehältern und Löhnen veränderte sich in beiden Ländern in ähnlicher Weise. Zwar setzten die meisten amerikanischen Unternehmensleitungen die Gehaltssätze früher und stärker herab als die Lohnsätze 7 . Bei den tatsächlichen Verdiensten fielen die Arbeiter jedoch weiter zurück als die Angestellten, da ihre Löhne viel direkter und quantifizierbarer von den erbrachten Leistungen, der Produktion und damit vom Markt abhingen. Wenn die Lohn-Gehalts-Differenz in der amerikanischen Industrie wie in der deutschen 1929 bis 1932 wuchs, so setzte, wie bereits angedeutet, mit der allmählichen Erholung eine schrittweise und deutliche Angleichung der amerikanischen Arbeiter- und Angestelltenverdienste ein, die nur im Krisenjahr 1938 unterbrochen wurde und die im nationalsozialistischen Deutschland kaum eine Parallele hatte. Verhältnis zwischen Arbeiter- und Angestelltenverdiensten (Jahresdurchschnittswerte pro Kopf) in der amerikanischen und deutschen Industrie 1929, 1932, 19378:
1929 1932 1937
USA
Deutschland
1 : 2,05 1 : 2,52 1 : 1,94
1 : 1,54 1 : 2,09 1 : 1,91
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
42
Jürgen Kocka
Abgesehen von einigen charakteristischen Unterschieden — sehr viel günstigere Einkommensentwicklung vor 1929, langsamere Erholung nach 1932, stärkere Gehalt-Lohn-Nivellierung in den dreißiger Jahren auf der amerikanischen Seite — wirkte sich also die Depression auf amerikanische wie deutsche Angestellte (insbesondere auch relativ zur Arbeiterschaft des jeweiligen Landes) in puncto Massenarbeitslosigkeit und Verdienstrückgang ähnlich aus. Eine entsprechende Ähnlichkeit bestand nicht in bezug auf viele soziale, politische und ideologische Bedingungen, unter denen jene ökonomischen Veränderungen wirksam wurden. Die ökonomische Krise, die im Winter 1932/33 ihren Höhepunkt erreichte, führte zu vielen punktuellen Protestaktionen. Doch im ganzen blieb die Stimmung bemerkenswert unrevolutionär; Hoffnung und Geduld, Pessimismus und Resignation waren für die übergroße Mehrheit der Amerikaner sehr viel typischer als die Bereitschaft zur Rebellion, als die Forderung nach Wandel oder die Infragestellung der Herrschenden bzw. des Herrschaftssystems selbst. Die Erfahrung des massenhaften Elends traf in den USA nicht wie in Deutschland auf eine durch größere Knappheit von jeher, aber besonders durch Krieg, Niederlage und Inflation geprägte, in breiten Kreisen wirksame Tradition der Unsicherheit, Enttäuschung und Skepsis gegenüber der Funktionsfähigkeit des Systems. Besonders in den ersten Jahren der Krise erwarteten die meisten eine baldige Erholung. Zudem hinderten die in der amerikanischen Bevölkerung tief verwurzelten Glaubenssätze über die Verantwortung des einzelnen für seinen ökonomischen und sozialen Erfolg, über die Möglichkeit, durch Leistung und Arbeit tatsächlich voranzukommen und im Wettbewerb bestehen zu können, viele daran, ihre Misere als kollektive zu erkennen oder gar zu bekämpfen. Längere Arbeitslosigkeit, Verarmung und Deklassierung wurden deshalb häufig im stillen auf das eigene Versagen statt auf sozioökonomische oder politische Zusammenhänge zurückgeführt. Wenn sich Proteste — je langer desto mehr — dennoch entwickelten und sich Aggressionen nach außen wandten, dann richteten sie sich, im Gegensatz zu Deutschland, nicht so sehr gegen den Staat, von dem der durchschnittliche Amerikaner ohnehin wenig erwartete, der, objektiv und im Bewußtsein der vielen, Funktionen der kollektiven Daseinssicherung noch kaum übernommen hatte und wegen Erfolgslosigkeit bei ihrer Ausführung deshalb auch nicht diskreditiert werden konnte. Das Fehlen sozialer Organisationsformen (etwa einer fundamentalkritischen Arbeiterbewegung), die ein Protestpotential schnell hätten ausdrücken können, sowie die Stabilität eines Regierungssystems, das nach zwölf Jahren Republikaner-Herrschaft — ganz im Gegensatz zur Weimarer Republik — eine unverbrauchte Alternative innerhalb des Systems anzubieten hatte, trugen ebenfalls zu der für den deutschen Beobachter erstaunlich ruhigen, protestarmen Haltung der amerikanischen Bevölkerung in der Krise bei9. 1934 jedoch, als die ersten Erfolge von Roosevelts New Deal ebenso sichtbar geworden waren wie seine Grenzen, nahm die Manifestation der auf Veränderungen drängenden Unzufriedenheiten zu, aber auch die Abwehr der konser© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
43
vativen Eliten wurde starrer. Protestpolitiker wie Coughlin, Townsend und Gerald Smith, wie Floyd Olson, Huey Long und Upton Sinclair, stellten den New Deal von Positionen aus in Frage, die sich für Beobachter und Historiker meist der klaren Einordnung in Kategorien „rechts-links“ entzogen und entziehen. Die Gewerkschaftsbewegung begann, neue Mitglieder in bisher kaum organisierten Industrien und Arbeiterschichten zu gewinnen und ihre Forderungen und Kämpfe in begrenztem Ausmaß zu radikalisieren. Streiks wurden häufiger, in Angriff und Abwehr gewalttätiger. Die Gründung des „Congress of Industrial Organisation“ (CIO) signalisierte eine Ausweitung und (begrenzte) Militanz, die in den traditionellen Organisationsformen der AFL nicht ausgetragen werden konnte. Die Reaktion der herausgeforderten Unternehmer war zwar uneinheitlich, führte aber punktuell zur Errichtung von antiradikalen Bürgerwehren, zur immer lauteren Warnung vor Klassendenken und Klassenkampf und zunehmend zur Kritik an Roosevelt, dessen arbeiterfreundliche Politik und bescheidene, den freien Wettbewerbskapitalismus modernisierende Reformen auf immer stärkeren Widerstand der Unternehmer und Wohlhabenden trafen. Zweifellos fand im Bewußtsein der Zeitgenossen ein Prozeß relativer klassengesellschaftlicher Polarisierung ab 1934 statt, in dem Roosevelts Politik der „all-class alliance“ nicht überlebte. Im sogenannten Zweiten New Deal, der mit einer neuen Welle regierungsinitiierter Reformgesetze begann, schlug sich Roosevelt entschiedener als bisher auf die Seite der Bewegungskräfte. Die städtischen Massen, die Empfänger geringer Einkommen, die nichtalteingesessenen ethnischen Gruppen, die Neger und die organisierte Arbeiterschaft gehörten bei seinem Wahlsieg von 1936 zu seinen klarsten Anhängergruppen, doch erhielt er auf diesem Höhepunkt seiner Macht auch viele Stimmen aus wohlhabenderen Kreisen10. Die zunehmende Entschlossenheit der Gewerkschaften, die sich in den weithin mißbilligten, und nach Meinung vieler durch die Regierung nicht konsequent genug bekämpften „Sit-Down-Strikes“ seit Ende 1936 ausdrückte; Roosevelts mißglückter Versuch, auf die Zusammensetzung des sozialkonservativen Supreme Court stärker als von der Verfassung vorgesehen Einfluß zu gewinnen, um dessen Widerstand gegen die New-DealGesetzgebung zu bezwingen; und schließlich der erneute Einbruch der Krise seit Sommer 1937 kosteten den Präsidenten einen großen Teil seiner Autorität gegenüber dem Kongreß und ließen die Reformgesetzgebung fast zum Stillstand kommen. Einerseits erhielt die konservative Forderung nach Rückkehr zur „Normalität“ der zwanziger Jahre Auftrieb, andererseits rührten sich radikale Gruppen auf der Rechten und Linken mehr als je seit Beginn der Krise11. Erst die Verschärfung der außenpolitischen Situation, die Bedeutungszunahme außenpolitischer und später militärischer Argumente in der politischen Auseinandersetzung, schließlich der Kriegsausbruch in Europa und die anlaufende Rüstungskonjunktur verhalfen dem zum dritten Mal kandidierenden Roosevelt zu einem Sieg, der allerdings knapper ausfiel als 1936 und der eindeutiger als 1936 auf der Unterstützung der großen Städte und der niederen Einkommensschichten beruhte12. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
44
Jürgen Kocka
Stärker als je zuvor unterschieden sich damit politische Meinungen und Verhaltensweisen nach „class lines“, wie amerikanische Autoren zu schreiben pflegen, nach sozioökonomischen Kriterien, die ethnische, kulturelle und religiöse Bestimmungsfaktoren des sozio-politischen Verhaltens weiter in den Hintergrund drückten. Der Zusammenhang zwischen sozialökonomischen Prozessen und Politik, zwischen klassen- und schichtspezifischen Interessen einerseits und politischen Haltungen und Handlungen andererseits erhielt mehr als zuvor die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Auch der Gruppierung der Angestellten wandte sich das öffentliche Interesse in diesem Zusammenhang ein wenig mehr zu als bisher. Die in dieser Mittelschicht erstmals auftretende Massenarbeitslosigkeit, aber auch die Frage, welche politische Richtung die „white collar workers“ bei Fortdauer der Depression und angesichts zunehmender politischer Polarisierung wohl schließlich unterstützen würden, beschäftigte eine zunehmende Anzahl von Kommentatoren und Diskussionsbeiträgen. Würden sie sich, in Absetzung zur zunehmend organisierten Arbeiterschaft, stärker nach „rechts“ orientieren und gar, wie teilweise in Zentraleuropa, zur Massenbasis eines von vielen gefürchteten, von manchen erwarteten amerikanischen Faschismus werden? Oder würde vielmehr die Krise, im Unterschied zu den Auswirkungen, die diese in Deutschland hatte, die zur kollektiven Interessenwahrnehmung bereiter werdenden Angestellten an die Seite der sich dadurch weiter verstärkenden Arbeiterbewegung treiben und damit zur Unterstützung einer gemäßigt demokratisch-liberalen und sozialen Reformpolitik? Würde sich unter dem Eindruck von Not und Deprivation der Krise ähnlich wie in Deutschland ein spezifischer, etwa mittelständischer Angestelltenprotest verstärken bzw. erst einmal entwickeln? Oder würde sich die Organisierung der Angestellten (soweit sie überhaupt stattfand) ohne Absetzung von der Arbeiterschaft, ohne anti-proletarische Stoßrichtung, innerhalb der amerikanischen Arbeiterbewegung entwickeln? Diese Fragen, die in Ansätzen von amerikanischen Zeitgenossen diskutiert und verschiedenartig beantwortet wurden13, leiten die folgende Untersuchung, die die bisher noch nicht analysierte Entwicklung amerikanischer Angestelltenverbände in den dreißiger Jahren klären will. Zunächst sollen anhand einiger repräsentativer Fälle, nämlich: der sich spaltenden Verkäufergewerkschaft, eines kleinen Technikerverbands und anhand von zwei überberuflichen Angestelltenverbänden vier verschiedene Typen der Interessenorganisation amerikanischer Angestellter vorgestellt werden. Der Schlußteil versucht, die Gesamtsituation zu erfassen und einige Folgerungen zu ziehen.
2. Verkäufergewerkschaften Die „Retail Clerks' International Protective Association“ (RCIPA) hatte zu Beginn der Depression fast drei Jahrzehnte als Einzelgewerkschaft innerhalb der „American Federation of Labor“ (AFL) hinter sich, von deren anderen © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
45
Mitgliedsorganisationen — meist Arbeiter-Einzelgewerkschaften auf berufsverbandlicher Basis — sie sich im Prinzip nicht unterschied. 1890 gegründet, hatte sie am Ende des Weltkriegs und parallel zur allgemeinen Gewerkschaftsbewegung ihre größte Mitgliederzahl — 21 000 — erreicht und war in den gewerkschaftsungünstigen zwanziger Jahren auf offiziell 10 000, in Wahrheit wohl noch viel weniger Mitglieder zusammengeschrumpft. Die begrenzte Militanz und Energie, die der Verband, vor allem im Weltkrieg ähnlich den Arbeitergewerkschaften besessen hatte, war jetzt verschwunden. Fast einflußlos, vegetierte die Organisation dahin. 1929 fehlten sogar die organisatorischen und finanziellen Mittel, um den fälligen Gewerkschaftstag abzuhalten14. Mit den einsetzenden Klagen über Arbeitslosigkeit und Verdienstausfälle, über Lohnkürzungen und den Abbau von innerbetrieblichen freiwilligen Sozialleistungen während der Krise begann sich die Tonart der Verbandszeitschrift zu verschärfen. Wenn auch noch jahrelang keine Erfolge und Siege gemeldet werden konnten, so berichtete man nach den apathischen vorhergehenden Jahren doch gern über die Entstehung von Unzufriedenheit, Protesten und Ungerechtigkeiten hier und dort. Die Kritik an Unternehmern auf Grund rücksichtsloser Ausnutzung der ihnen günstigen Arbeitsmarktlage nahm zu. Der schon am Ende des Weltkriegs vorgebrachte Protest gegen die Entlassung von Verkäufern mittleren Alters fand neue Aufmerksamkeit15, Ende 1931 polemisierte die RCIPA gegen das 80 000 Leute beschäftigende Kettenunternehmen „Great American and Pacific Tea Company“ (A & P), das seine Angestellten erfolgreich daran hinderte, sich zu organisieren, und das durch Tarifverträge mit den Gewerkschaften der in ihm arbeitenden Handarbeiter die Solidarität der Gewerkschaftsbewegung zerstöre. Verkäufer, deren Interessen für gewerkschaftliche Organisation bekannt würden, verlören ihren Arbeitsplatz, Zunehmend griff der „Advocate“ Beispiele unternehmerischer Übermacht und Unterdrückung an. Tiefe Unzufriedenheit über die unerträglichen Arbeitsbedingungen im Detailhandel sei im Entstehen, die gewerkschaftliche Organisation vieler Verkäufer stehe unmittelbar bevor. „Werde ich nächste Woche noch meine Stellung haben? Werden sie meinen Lohn senken? Diese beiden Fragen stehen im Bewußtsein der Detailhandelsangestellten heute obenan. Sie sind verantwortlich für die herrschende Stimmung von Furcht und Beklommenheit.“ Ende 1932, nach weiteren Angriffen auf die großen Kettenunternehmen, erweckte der „Advocate“ den Eindruck, als sehe die RCIPA eine „Woge der Organisation“ in unmittelbarer Zukunft vor sich. Mit relativ militanten Worten erklärte der Verband seine Bereitschaft16. Bis 1933 nahm die Mitgliederzahl der RCIPA jedoch nicht zu, sondern ab. Selbst nach eigenen Angaben besaß der Verband jetzt nur 5000 Mitglieder. Die schwierige finanzielle Situation der potentiellen Mitglieder und die Übermacht der organisationsfeindlichen Unternehmer unter für sie günstigen Arbeitsmarktbedingungen behinderten die Übersetzung von sich aufstauender Unzufriedenheit in gewerkschaftlichen Druck und Protest — wie in jeder Depression zuvor. Dies galt für die amerikanische Gewerkschaftsbewegung generell, die 1933 © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
46
Jürgen Kocka
ihren numerischen Tiefstand erreichte17. Die überdurchschnittliche Schwäche von Organisation und Finanzen verschärfte diese allgemeine Tendenz im Falle der RCIPA. Erst ein Anstoß „von oben“ schaffte die Bedingungen, die die allmähliche gewerkschaftliche Organisation der sich aufstauenden latenten Spannungen und Proteste erlaubte. Das Gesetz über die „National Recovery Administration“ (NRA) vom Juni 1933 war das Kernstück von Roosevelts Versuch, das wirtschaftliche Wachstum durch maßvoll dosierte staatliche Interventionen wiederanzukurbeln und die Depression zu überwinden. In teilweise bewußtem Rückgriff auf staatliche Wirtschaftsorganisationsversuche während des Weltkriegs sah die NRA zum einen die Lockerung bisher geltender Anti-Trust-Gesetze und die Regelung der Konkurrenz durch staatlich beaufsichtigte und staatlich abzuzeichnende Absprachen der Unternehmer (u. a. über Höchstarbeitszeiten, Mindestlöhne, Arbeitsbedingungen und Preisgestaltung) vor; auf Betreiben der AFL fixierte sie andererseits das Recht der Arbeitnehmer, Gewerkschaften beizutreten (oder nicht beizutreten) und durch selbst gewählte Vertreter mit der Arbeitgeberseite gleichberechtigt und kollektiv über Arbeitsbedingungen zu verhandeln und Tarifverträge abzuschließen. Dieses Recht der Arbeitnehmer wie auch die Absprachen über Höchstarbeitszeiten, Mindestlöhne, Arbeitsbedingungen und Preisgestaltung waren gemäß dem neuen Gesetz in für jede Industrie und jede Wirtschaftsabteilung einzeln festzusetzenden NRA-Satzungen („codes“) zu fixieren. Diese sollten zwischen den organisierten Unternehmern der jeweiligen Branche und den betroffenen Gewerkschaften ausgehandelt und dann vom Präsidenten bestätigt und mit öffentlicher, im Prinzip auch staatlich erzwingbarer Autorität versehen werden. Wenn solche Verhandlungen zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern nicht zustande kamen, hatte der Präsident das Recht, die entsprechenden Bestimmungen zu dekretieren. Laissez-Faire-Liberale, anti-monopolistische Klein- und Mittelunternehmer, „radicals“ aus der Jefferson-Tradition, Sozialisten und Kommunisten haben die NRA als Übergang zum korporativen, ja faschistischen Staat, als Inthronisation der assoziierten Großunternehmen auf Kosten der Kleinen und der Öffentlichkeit, als Abkehr von den amerikanischen Traditionen des freien Unternehmertums und der freien Marktwirtschaft kritisiert. Wirtschaftswissenschaftler und Historiker haben die ökonomische Erholungswirkung der NRA skeptisch beurteilt. Für die organisierte Arbeiterschaft jedoch bedeutete das Gesetz ein bis dahin mit Ausnahme des Weltkriegs nicht verwirklichtes Ausmaß an öffentlicher Anerkennung und die Chance zur Einflußnahme und Machtvergrößerung, zugleich natürlich auch einen weiteren Schritt zur Einbindung in das bestehende privatwirtschaftliche System, das sich durch solche gegen starken Unternehmerwiderstand durchgesetzte Legalisierung von „collective bargaining“ anpassend veränderte und stabilisierte. Der AFL-Präsident und die Führung der RCIPA feierten den entsprechenden Abschnitt des neuen Gesetzes — Section 7 (a) — als „Magna Charta“ der Arbeiter. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
47
Als der sozialkonservative Oberste Gerichtshof die NRA im Mai 1935 als nicht verfassungskonform befand und für ungültig erklärte, waren es die Bestimmungen über Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehungen, die vor allem durch den „National Labor Relations Act (Wagner Act)“ vom Juli 1935 perpetuiert und im Sinne gewerkschaftlicher Interessen konkretisiert und verschärft wurden. Der Wagner Act, der bis heute die Grundsäule des amerikanischen Arbeitsrechts blieb, sah u. a. die Errichtung eines staatlichen „National Labor Relations Board“ mit weitreichenden Kompetenzen zur industriellen Konfliktregelung vor, verbot Unternehmern alle „unfair labor practices“, vor allem die seit 1935 als Reaktion auf Section 7 (a) blühende unternehmerische Unterstützung für „gelbe“ Werkvereine und verstärkte die staatliche Autorität hinter dem gewerkschaftlichen Recht auf industrielles „collective bargaining“18. Die RCIPA-Führung erkannte, daß ihr die NRA eine Chance bot, aber keine Gewähr für deren Verwirklichung. Gerade für die von öffentlichen Meinungen so abhängigen Verkäufer bedeutete es viel, wenn der Gewerkschaftswerber seine Aufforderungen zum Beitritt mit der Bemerkung stützen konnte, daß es der Präsident und der Kongreß so wollten. Gewerkschaftsmitgliedschaft wurde im New Deal respektabler. Auftrieb konnte die gewerkschaftliche Organisationsarbeit auch aus dem nun offenkundigen Bedürfnis jeder Arbeitnehmergruppe nach starker Repräsentation im politischen Entscheidungsprozeß auf Bundesebene gewinnen. Bei der bevorstehenden Aushandlung der die Arbeitsverhältnisse im Kleinhandel regelnden bundesweiten Satzungen („codes“) war der Nutzen einer starken Vertretung offensichtlich und unbezweifelbar. Tatsächlich kam es zur Neugründung einiger Ortsgruppen gleich nach Verkündung der NRA. Doch in den Verhandlungen über den Kleinhandels-Code, die im Sommer 1933 in Washington stattfanden, spielte RCIPAPräsident Coulter nur eine schwache Rolle. Zu klein und machtlos war die Organisation, die er vertrat19. Der Kleinhandels-Code, den Präsident Roosevelt im Oktober 1933 unterschrieb, kürzte die erlaubte Arbeitszeit auf maximal 48 Stunden; er verbot alle Überstunden; er setzte den Mindestlohn für Arbeitnehmer in Detailhandelsgeschäften je nach Ortsgröße auf 10 bis 14 Dollar pro Woche fest, mit einigen Sonderregelungen für minderjährige Anfänger; er verbot Lohnsenkungen unter den Stand vom Juli 193320. Der Code bezog sich auf alle Arbeitnehmer des Einzelhandels, zwischen Arbeitern und Angestellten differenzierte er nicht, ebensowenig wie zwischen Frauen und Männern. Eine zweischneidige Sonderstellung billigte er lediglich den leitenden Angestellten zu: Angestellte mit Verantwortung für die Leitung des Geschäfts oder eine Abteilung davon und mit einem Mindestverdienst von 25 bis 35 Dollar die Woche (je nach Ortsgrößenklasse) fielen nicht unter die Höchstarbeitszeitbestimmungen21. Der Code führte zu effektiven Arbeitszeitverkürzungen und zur Anhebung der Verdienste der am schlechtesten Bezahlten. Die Mehrzahl der Geschäfte mußte ihre Mindestsätze als Folge der neuen Gesetzgebung anheben22. Diese Verbesserung, die ja nicht aus gewerkschaftlicher Arbeit resultierte, scheint die © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
48
Jürgen Kocka
Organisationsbereitschaft der Nutznießer eher weiter reduziert als gestärkt zu haben. Die Tradition der Indifferenz gegenüber gewerkschaftlicher Organisation, antigewerkschaftlicher Widerstand der Handelsunternehmer trotz Section 7 (a), wahrscheinlich auch mangelnder Einsatz der Gewerkschaftsleitung trotz einiger großer Streiks 1934/35, daneben auch AFL-typische Konflikte zwischen der RCIPA und den Berufsverbänden anderer im Kleinhandel tätiger Arbeitnehmer erklären, warum die RCIPA bis 1935 nur geringfügige Verstärkungen erzielen konnte23. Die Anstöße zu neuem Wachstum kamen schließlich aus drei Richtungen; aus dem Protest der mittleren und gehobenen Ränge des Verkaufspersonals; anläßlich der Lohnsenkungen und Arbeitszeitverlängerung nach dem Fall der NRAGesetzgebung; aus der Entwicklung der allgemeinen Gewerkschaftsbewegung, insbesondere der Abspaltung des CIO von der AFL. Die Geschäftsführer und Filialleiter der großen Kettenbetriebe („Chain Managers“ oder „Head Clerks“) erhielten einen großen Teil ihrer Verdienste als prozentuale Beteiligung am Verkaufserfolg ihrer Niederlassung. Gewinnund Verlustüberlegungen der Firmenleitung, scharfe Konkurrenz und Vergleiche zwischen den Filialen bestimmten die Stellung dieser leitenden Angestellten, zu deren Kompetenz die Einstellung und Entlassung des Personals gehörte. Sie standen unter schärfstem Leistungsdruck, hatten äußerst lange Arbeitszeiten und wurden von der Zentrale häufig ohne Angabe von Gründen versetzt, mit der Absicht, ihnen neue Chancen zu geben, d. h. in einer neuen Umgebung mit neuem Personal neue „aggressive“ Verkaufs- und Gewinnerhöhungsmethoden einzuführen, zu denen häufig der Austausch von Teilen des Personals und damit die Einstellung billigerer Anfänger ebenso gehörten wie die Erstickung von Ansätzen zur Routinisierung und Entspannung der Verkaufs-, Konkurrenz- und Personalantreibungsmethoden24. Der Rückgang der Verkaufsvolumina und Gewinne in der Depression entspannte zwar nicht den Druck und die Anforderungen, unter denen sich diese Gruppe der Angestellten fand, er wirkte sich vielmehr unmittelbar als Verdienstrückgang, als Entlassungsgefahr und damit als verstärkter Konkurrenzdruck auf sie aus. 12 bis 16 Stunden, die neu auftauchende Konkurrenz Arbeit suchender, sich billig anbietender Hochschulabsolventen, vor allem die empfindliche Beschneidung der Profit-gekoppelten Verdienste ließen merkliche Unruhe und Unzufriedenheit unter diesen bis dahin für die Gewerkschaft weitgehend unerreichbaren Managern und ihren nächsten Mitarbeitern entstehen25. Als „executives“ fielen sie nicht unter die Schutzbestimmungen der NRA-Gesetzgebung, konnten also weiterhin zu langen Arbeitstagen verpflichtet werden. Die Mindestlohnbestimmungen halfen ihnen ohnehin nichts, im Gegenteil: Die gesetzlich verlangte Anhebung der untersten Gehälter führte nicht nur zur Verkleinerung des Abstandes zwischen untersten und mittleren Verdienstebenen, sie führte zum Teil auch zu Senkungen der gesetzlich und tariflich nicht abgesicherten mittleren Gehälter, nämlich dann, wenn der Unternehmer versuchte, ohne eine Steigerung seiner gesamten Lohnkosten davonzukommen26. In Grenzfällen dagegen hob © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
49
die Unternehmensleitung die Bezahlung von Angestellten auf knapp über 35 Dollar pro Woche an, um sie der Arbeitszeitbeschränkung zu entziehen27. Die so entstehende Unruhe und Unzufriedenheit, die mindestens ebenso sehr aus einer relativen Deprivation (Abnahme der bisherigen Unterschiede zu schlechter Gestellten) wie aus einer absoluten Notlage resultierten, führten zu Protesten und organisierten Gegenmaßnahmen innerhalb der allgemeinen Gewerkschaftsbewegung. Nicht als leitende Angestellte in Absetzung von der Masse der Verkäufer, nicht als Angestellte in Absetzung zu den Arbeitern organisierten sich, soweit sichtbar, diese „Manager“, sondern als „Managers & Clerks Unions“ — wie manche Ortsgruppen der RCIPA jetzt hießen — innerhalb der oder wenigstens in enger Verbindung mit der AFL28. Diese „Store Managers“ füllten in der jetzt wachsenden RCIPA häufig Führungspositionen aus und gaben ihrer Weiterentwicklung wichtige Anstöße29. Es ist hervorhebenswert, daß selbst diese mittleren bis leitenden Angestellten dann, wenn sie an ihren individuellen Karrierechancen und Durchsetzungshoffnungen irre wurden, wenn sie, was schwierig und relativ selten genug blieb, zur kollektiven Wahrnehmung ihrer beruflichen ökonomischen und sozialen Interessen schritten, daß sie dann gleich auf die Linie der allgemeinen Arbeiterbewegung einschwenkten. Erst das die Gewerkschaftsmacht beschränkende Taft-HartleyGesetz von 1947 schloß die „Supervisory Employees“ und so auch diese Gruppe von Gcschäftsleitern aus dem gewerkschaftlichen Einzugsbereich aus30. Die gerichtliche Ungültigkeitserklärung der NRA-Gesetze schien die alte Politik der AFL glänzend zu bestätigen, die primär auf Tarifverträge statt auf Mindestlohngesetzgebung abgezielt hatte. Schutzgesetze, besonders Mindestlohngesetze, brächten keine wirkliche Sicherheit — mit diesem Argument hatte auch die RCIPA die Notwendigkeit der gewerkschaftlichen Arbeit, der Tarifverträge und damit ihrer selbst zu begründen versucht. Gesetze, so lautete das alte AFL-Argument, würden durch die unternehmerfreundlichen staatlichen Organe entweder nicht durchgesetzt oder durch eine neue parlamentarische Mehrheit, bzw. einen konservativen Richter zurückgenommen31. Ohne gültige gesetzliche Schranken in den meisten Industrien — erst der 1939 wirksam werdende „Fair Labor Standards Act“ von 1938 setzte wieder Mindestsätze (25 bis 40 Cents pro Stunde) fest, die dann durch die inflatorische Entwicklung der Kriegszeit schnell überholt wurden — wurden die Arbeitszeiten 1935 wieder länger und viele Löhne kürzer. Nach dieser Enttäuschung und unter dem Eindruck des mittlerweile in anderen Wirtschaftsbereichen schnellen und spektakulären Gewerkschaftswachstums trafen jetzt die werbenden Rufe der RCIPA auf steigende Organisationsbereitschaft auch unter den schlecht verdienenden Verkäufern, die ja so viel mehr als gelernte Industriearbeiter von der NRALohn- und Stundenminimum-Gesetzgebung profitiert hatten und für deren Organisation die NRA gerade deshalb ein beträchtliches Hindernis bedeutet hatte32. Möglicherweise erleichterte die aus dem Scheitern der NRA folgende unruhige Unzufriedenheit unter den ungelernten und angelernten Arbeitern jene 4
Winkler, Krise
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
50
Jürgen Kocka
Aufspaltung der amerikanischen Arbeiterbewegung in AFL und CIO, die 1935/36 begann und bis 1955 dauerte33. Die Abspaltung des CIO war primär in der Unfähigkeit der damaligen AFL-Führung begründet, das in der AFLOrganisation (wenn auch nicht ausschließlich) herrschende Berufsprinzip gegen die Interessen mächtiger konservativer Facharbeiterverbände (wie der Maschinisten, der verschiedenen Bauhandwerkerverbände, der Kesselschmiede, der Graveure und anderer) so zu dehnen und zu modifizieren, daß eine effektive, durch Streit zwischen den Berufsverbänden nicht gehemmte Organisation der bisher weitestgehend unorganisierten, nach dem Berufsverbandsprinzip objektiv nicht erfaßbaren, un- und angelernten Arbeiter nach dem Industrieverbandsprinzip möglich geworden wäre, wie sie durch die spontane Organisations- und Kampfbereitschaft in diesen Arbeiterschichten nach einigen Jahren Depression, aber auch durch die Arbeitsgesetzgebung des New Deal möglich gemacht und nahegelegt wurde. Der vor allem auf Gewerkschaften in den Sektoren Kohle, Textilien, Kleidung, Stahl, Autos, Öl und Gummi gestützte CIO galt vielen Zeitgenossen als „links“ von der AFL, als Beginn einer amerikanischen sozialdemokratischen Arbeiterbewegung. Ihre größere Bereitschaft zu politischem Engagement, ihr Interesse an breiteren Ökonomischen, sozialen und politischen Problemen, ihr Eintreten für die große Masse der bisher nicht oder kaum von der gewerkschaftlichen Arbeit profitierenden, ungelernten und angelernten Massen, unter denen relativ spät eingewanderte Emigranten und ihre unmittelbaren Nachkommen stark vertreten waren, die sehr viel demokratischere Haltung der CIO-Organisationen gegenüber Basis-Impulsen, ihre militanteren Techniken, schließlich auch die relativ große Zahl von Kommunisten, die nach Aufgabe (1935) ihrer eigenen Gewerkschaftsgründungsversuche in den CIO eindrangen und zum Teil einflußreiche Stellen einnahmen — all das erweckte den Eindruck, als ob man dem Aufbruch einer neuen radikal-reformerischen Arbeiterbewegung beiwohnte. Diesen Eindruck der Zeitgenossen wird man in seiner teilweisen Berechtigung nicht verwischen dürfen, auch wenn man in der Retrospektive wohl richtiger zu dem Schluß kommt, daß der CIO außer der Einbeziehung der Ungelernten — und auch die war vorher nicht völlig unmöglich und wurde ab Mai 1937 auch verstärkt von der sich aufraffenden, weil in Frage gestellten AFL betrieben — konsequent in der Tradition der amerikanischen Arbeiterbewegung mit ihrer ziemlich engen Arbeitsplatzorientierung, ihren primär ökonomischen Interessen, ihrem unrevolutionären, auch weitgehend konsequenter Reform fernbleibenden Gradualismus, mit ihrer prinzipiellen und praktischen Akzeptierung des Kapitalismus und der ManagementPrägorativen blieb34. Seit Mitte 1935 wandten sich zwei New Yorker Ortsgruppen der RCIPA, die eine unter sozialdemokratisch orientierter, die andere unter kommunistischer Führung gegen den RCIPA-Vorstand. Die Kritik der beiden Ortsgruppen an einigen Personen in der RCIPA-Führung, die von der Spitze abgelehnte Forderung nach Abhaltung des seit 1924 hinausgeschobenen Gewerkschaftstages sowie das Verlangen nach agilerer Agitation und Mitgliederwerbung gingen in die © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
51
Verweigerung finanzieller Abführungen an die RCIPA-Spitze und den bei der AFL gestellten, erfolglosen Antrag auf selbständige Organisation über. Im Februar 1937 gründete die New Yorker Opposition eine eigene Plattform in der RCIPA („New Era Committee“), hielt eine turbulente Massenversammlung mit 3000 bis 4000 Personen (auch mit Delegierten aus Orten außerhalb New Yorks) ab und affiliierte im Mai 1937 mit dem CIO. Als „United Retail Employees of America“, bald als „United Retail and Wholesale Employees of America“ (URWEA) hielt sie ab 1937 Gewerkschaftstage ab und verfügte angeblich 1937 bereits über 40 000 Mitglieder (RCIPA 1937: knapp 24 000)35. Soweit ersichtlich, drückten sich neben politischen Unterschieden zwischen den linken New Yorker Ortsgruppen und der AFL-typischen RCIPA-Führung und neben persönlichen Rivalitäten vor allem zwei strukturelle Probleme in dieser Spaltung aus. In der Zusammensetzung des Vorstands, wie er aus der Wahl von 1924 hervorgegangen war, und nach all den sozialen und politischen Veränderungen auch 1936 noch bestand, fand das mittlerweile eingetretene Wachstum von Ortsgruppen in östlichen Großstädten, insbesondere in New York, keinen ausreichenden Niederschlag; der Vorstand reflektierte noch die alte Vorherrschaft mittelwestlicher Ortsgruppen. Zum andern scheint die Scheu der RCIPAFührung unter Präsident Coulter vor der Einberufung des längst fälligen Gewerkschaftstages auf eine gewisse Entfremdung zwischen Führung und Basis hinzuweisen, die sich auch in den Vorwürfen mangelnder Aktivität und Kampfbereitschaft seitens der rebellierenden Ortsgruppen ausdrückte36. Das von den zum CIO übergehenden Verkäufern im Einklang mit dem Hauptunterschied zwischen CIO und AFL vorgebrachte Argument — die Abspaltung sei notwendig gewesen, weil das in der RCIPA herrschende Berufsverbandsprinzip eine effektive Organisation der Kaufhäuser mit ihrer Berufsvielfalt und ihren vielen Un- und Angelernten verhindert hätte37, — dieses Argument traf bestenfalls zur Hälfte zu. Gewisse Streitigkeiten zwischen RCIPA und den Verbänden der Fuhrleute, Fleischer und Schneider um die Abgrenzung der Einzugsbereiche fanden zwar statt, doch hinderten sie die Organisationsarbeit kaum. Stärker fiel zweifellos ins Gewicht, daß Kaufhausunternehmer die Vertretungen der wenigen bei ihnen beschäftigten Arbeiter mit Verträgen schnell zufrieden zu stellen suchten, um desto leichter die RCIPA als Vertreterin der Verkäufer, die die Mehrzahl ihrer Arbeitnehmer ausmachten, zurückweisen zu können. Das Berufsverbandsprinzip erschwerte sicherlich ein solidarisches Vorgehen aller Arbeitnehmer, und zwar nicht wie in Deutschland auf Grund eines von Unternehmern gepflegten Sonderbewußtseins der Angestellten, sondern umgekehrt auf der Basis des hier primär von den Facharbeitern hochgehaltenen Berufsprinzips und der damit den Unternehmern gegebenen Möglichkeit, die Arbeiter vor den Angestellten zu hofieren und tarifvertraglich zu privilegieren38. Andererseits ist nicht zu bezweifeln, daß die RCIPA seit 1933 ihre Arbeitskämpfe primär auf die Kaufhäuser und Kettenläden richtete, daß nach den Streikberichten die Kooperation zwischen RCIPA und lokalen Arbeitergewerkschaften funktionierte und daß die RCIPA-Ortsgruppen sich keineswegs gründ4*
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Jürgen Kocka
52
lich an das Berufsprinzip hielten, sondern — örtlich verschieden — alle Typen von Kaufhausbeschäftigten einschließlich der Lagerarbeiter zu organisieren versuchten39. Eindeutig bekannte sich zunächst allerdings nur die URWEA zum Industrieverbandsprinzip und organisierte alle „persons employed in and about retail, wholesale and warehouse establishments“40. Die RCIPA-Definition: „all employees of stores, mercantile and mail order establishments who are actively engaged in handling or selling merchandise“41 hielt zwar am Bezug zum Verkaufsvorgang fest, war jedoch, wie die Praxis bewies, bei vorhandenem Willen breit genug, um eine sehr große Zahl von Arbeitnehmergruppen in allen kaufmännischen Betrieben zu organisieren. Nach Definition des Einzugsbereichs unterschieden sich die RCIPA und URWEA vor allem darin, daß jene sich auf den Detailhandel mit seinen vielen Berufen (allerdings unter Respektierung der Bereiche der „International Ladies Garment Workers Union“, der „International Brotherhood of Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and Helpers“ und einiger anderer AFL-Organisationen) konzentrierte, während diese (ohne solche Rücksichtnahmen) sämtliche Arbeitnehmer in Groß- und Kleinhandel organisieren wollte42. Die Fixierung aufs Berufsprinzip fiel bei den sich organisierenden Verkäufern der dreißiger Jahre weder in der AFL noch im CIO ins Gewicht. Die Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten spielte in beiden Organisationen bei der Abgrenzung der Jurisdiktionen erst recht keine Rolle43. Die Unzufriedenheit der mittleren Angestellten, die Aufhebung der NRASchutzgesetze und die organisatorische Trennung der AFL und CIO, die mit heftiger Konkurrenz und starkem Einsatz der Verbände verbunden war, schließlich auch die allgemeine depressionsbestimmte Stimmung und NewDeal-stimulierte Organisationsbereitschaft dieser Jahre förderten das Wachstum und eine begrenzte Radikalisierung der Handelsangestelltengewerkschaften. Folgt man Leo Troy, der auf der Basis der tatsächlich gezahlten Mitgliederbeiträge (sofern aus den Quellen ersichtlich) die wohl besten Entwicklungsreihen für die Mitgliedschaften amerikanischer Gewerkschaften seit Beginn der 1930er Jahre aufgestellt hat, so wuchsen RCIPA und URWEA folgendermaßen seit 1935/37 (in 1000)44: RCIPA (AFL) 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1945 1950 1955
12,0 17,6 23,8 30,0 51,0 73,5 83,0 96,0 179,1 273,4
URWEA (CIO)
AFL (insges.)
CIO (insges.)
40,0 40,0 44,0 47,9 47,9 60,0 52,7 122,7
3218,4 3516,4 3179,7 3547,4 3878,0 4343,2 5178,8 6890,4 8494,0 10593,1
1991,2 1957,7 1837,7 2154,1 2653,9 3927,9 3712,8 4808,3
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
53
Den sprunghaften Anstieg der URWEA in den Jahren der CIO-Gründung und „Sit-Down-Strikes“ (1936/37) machte die RCIPA bis 1939 wieder gut, zumal das Wachstum der URWEA — wie das des gesamten CIO — nach 1937 stagnierte. Für die Verkäuferorganisationen wie für die Gewerkschaftsdachverbände überhaupt galt: Die Abspaltung des CIO forderte die AFL zu neuen Organisationsanstrengungen heraus, die zu einem AFL-Aufschwung führten, der den des CIO in den Schatten stellte45. In URWEA und RCIPA — in jener mehr als in dieser — radikalisierten sich die Stellungnahmen, Forderungen und Techniken der organisierten Verkäufer in den späten 1930er Jahren. 1937 erreichte die Streikaktivität in der amerikanischen Wirtschaft einen Höhepunkt. In diesem Jahr fanden fast so viele Arbeitsniederlegungen und Aussperrungen statt wie 1936 und 1938 zusammen: 4740 mit 1,8 Millionen Teilnehmern46. Von September 1936 bis Juni 1937 nahmen fast 500 000 Arbeiter und Angestellte an den spektakulärsten Streiks dieser Jahre, den „Sit-Down-Strikes“ teil, die insbesondere in der bis dahin gewerkschaftsfreien Autoindustrie zur Besetzung der Werke durch Arbeiter führten und die Riesenwerke von General Motors und Chrysler zum Nachgeben zwangen47. Im Februar und März 1937 fanden „Sit-Down-Strikes“ bei Woolworth und anderen Großkaufhäusern in Detroit statt. Verkäufer sowie Restaurant- und Küchenpersonal, in verschiedenen AFL-Gewerkschaften organisiert, besetzten die Läden in bester Kooperation und mit promptem Erfolg. Polizei griff zumeist nicht ein, solange kein Öffentlicher Tumult („disturbance“) drohte, Verkäufer-„Sit-Down-Strikes“ in New York, Philadelphia, Providence und anderen Städten folgten. Kaufhäuser vermehrten ihre Detektive, Spione und das Bewachungspersonal. Es scheint, daß die RCIPAFunktionäre von der Aktionsbereitschaft und Militanz der Verkäufer überrascht und häufig vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Die treibenden Kräfte waren sie nicht, zum Teil verloren sie die Kontrolle über die Aktionen, die viel von spontanem Aufbegehren an sich hatten. Da sich neue Führer in der Regel nicht anboten, verblieb den Gewerkschaftsfunktionären aber durchweg die Ernte: sie führten die Verhandlungen, die oft in Zugeständnissen der Unternehmer in puncto Arbeitsverhältnissen und Gewerkschaftsanerkennung resultierten. Ab März nahm der CIO-Einfluß zu. Durchweg arbeiteten verschiedene Arbeitnehmerkategorien, das Verkaufspersonal darunter, eng zusammen48. Auch nachdem die „Sit-Down-Strike“-WeIle seit April abebbte, setzte sich die Streikbewegung im Sommer 1937 und abgeschwächt in den nächsten Jahren fort49. Boykotte und andere streikfreie Aktionen, der Kampf um die Anerkennung als Sprecher der Arbeitnehmer — oftmals nach staatlich beaufsichtigten Wahlen am Arbeitsplatz — traten nach Mitte 1937 wieder stärker in den Vordergrund. Bei RCIPA und URWEA ging es bei diesen Kämpfen im Grunde um die gleichen Forderungen: Lohnerhöhungen, Mindestgehälter, Arbeitszeitregelungen, Anerkennung des „Union Shop“- oder des „Closed Shop“Prinzips, 50 % Überstundenaufschlag, Anerkennung von Senioritätsregeln bei Entlassungen, Auflösung von „gelben“ Werkvereinen, keine Diskriminierung © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
54
Jürgen Kocka
gegen Gewerkschaftsmitglieder, Verbesserung von Ferienregelungen, kurzum, die möglichst umfassende gewerkschaftliche Arbeitsplatzkontrolle durch Tarifverträge („collective bargaining“)50. Zweifellos fehlte den Auseinandersetzungen im Detailhandel das Ausmaß, die Intensität, die blutige Schärfe und die mörderische Gewaltsamkeit der großen Kämpfe in den Massenproduktionsindustrien dieser Jahre. Kaufhausunternehmer gaben leichter nach als Ford, U. S. Steel oder Firestone, u. a. weil sie vom ununterbrochenen Kontakt mit der kaufenden Öffentlichkeit abhängiger waren als jene. Handelsangestellte, deren Schwächen in Fragen gewerkschaftlicher Organisation nicht über Nacht geschwunden waren, forderten trotz aller aufkeimenden Militanz weniger und dies weniger hartnäckig als die Produktionsarbeiter. Der Organisationsgrad der Arbeitnehmer im Detailhandel blieb weiterhin gering, er erreichte 1939 nur knapp 3 %51. Die ganz großen Ketten, z. B. „A & P“ mit seinen ca. 90 000 Beschäftigten (so viel wie RCIPA und URWEA zusammen an Mitgliedern besaßen!) ließen die Gewerkschaften nur wenig Fuß fassen52. Mit diesen Abstrichen glichen die Forderungen und Techniken der Verkäufer denen anderer Gewerkschaften, und zwar klarer und eine größere Zahl von Verkäufern betreffend als in den 20er Jahren. Die Reden auf den Gewerkschaftstagen der RCIPA und der URWEA 1939 ließen eine neue Akzentuierung des gewerkschaftlichen Arbeitnehmerbewußtseins erkennen. Quasiprofessionelle Ideologien, die in den zwanziger Jahren eine zunehmende Rolle gespielt und die Eigenständigkeit des Verkäuferberufs, seine Überlegenheit und Würde betont hatten, wurden jetzt auch indirekt nicht deutlich. Auf beiden Tagungen hielten sich viele Gastredner von befreundeten Arbeitergewerkschaften auf, die ein rasantes Wachstum der Verkäufergewerkschaften in den kommenden Jahren voraussahen. Die Satzung der RCIPA ließ in ihrer neuen Fassung von 1939 neue Akzente erkennen. Klarer als je zuvor betonte sie das identische Interesse aller Arbeitnehmer, stellte Regeln für Streiks und Aussperrungen auf, kannte einen Streikfonds, sprach jetzt wieder vorwiegend von „fellow workers“, weniger von „retail clerks“, kaum von „sales people“. Erstmals wurde die Präambel seit den 1890er Jahren jetzt umformuliert und zwar in einer leicht militanteren, zugleich konkreteren Tonart53. Im Vergleich zum Gewerkschaftstag der URWEA wirkte der der AFLVertreter allerdings relativ konservativ und straff geführt, unpolitisch und schwunglos. Als voll integrierter Teil des CIO, einer — wie die Redner sagten — militanten, demokratischen und aggressiven Arbeiterbewegung, fühlten sich die Vertreter von insgesamt 200 URWEA-Ortsgruppen, die im Dezember 1939 in Detroit zusammenkamen. So wenig sie sich in den konkreten Forderungen nach Ausgestaltung und Ausweitung der Tarifverträge und bezüglich der Stellung der Gewerkschaft in den Unternehmen von der RCIPA unterschieden, so eindeutig sie sich als gut amerikanische, verantwortungsvolle, das System in keiner Weise in Frage stellende Gewerkschaft darstellten und es zurückwiesen, als kommunistische Organisation böswillig abqualifiziert zu werden54, so sehr stach doch ihre progressive Haltung zu allgemeinen sozialen und politischen © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
55
Fragen von der entsprechenden Enthaltsamkeit der RCIPA ab. Wiederholte scharfe Stellungnahmen und Resolutionen gegen jede Beschneidung von Bürgerrechten, gegen jede Form von rassischer, religiöser und sonstiger Diskriminierung; die Ablehnung der europäischen Diktatoren und die Warnung vor der Gefahr, daß Amerika in die europäischen Auseinandersetzungen hineingezogen werden könnte; die Berufung auf die amerikanische demokratische Vergangenheit des 18. Jahrhunderts bei der Kritik an den weißen Suprematie-Ansprüchen insbesondere in den Südstaaten, bei der Forderung von Anti-Lynch-Gesetzen und beim Protest gegen fremdenfeindliche Kriegsgesetze; erzieherische Ansätze innerhalb einer auf breiteste Emanzipation der Arbeiterklasse gerichteten Programmatik; die Befürwortung von staatlicher Wirtschafts- und Sozialpolitik im Sinne des New Deal; das Plädoyer für maximales politisches Engagement der Arbeiterbewegung, zugleich aber die eindeutige Unterstützung der Wiederwahl Roosevelts; überhaupt eine Stimmung voll Fortschrittsgefühl, manchmal fast pathetische Begeisterung für allgemeine Reformen; die ausdrückliche Ablehnung der These, daß Gewerkschaften nur als „collective bargaining“-Institutionen mit „Brot- und Butterzielen“ zu verstehen seien — all das unterschied diese Gewerkschaft von Handelsangestellten und -arbeitern von der Parallelorganisation in der AFL55. Wahrscheinlich fehlten hier die mittleren Angestellten und „store managers“, die in der AFL mitarbeiteten. Die unteren Ränge der Kaufhaus- und Kettenlädenverkäufer, in geringerem Maße auch Lagerhausangestellte und Transportarbeiter, zum Teil mit ost- und südeuropäisch klingenden Namen, gaben in der URWEA-Delegiertenversammlung den Ton an. Das Durchschnittsalter der Mitglieder lag bei 25 bis 30 Jahren. Nach 1943 waren 60 % der Mitglieder Männer58. Am Ende der Depression, kurz bevor die anlaufende Kriegskonjunktur die immer noch riesige Arbeitslosigkeit überwand und zusammen mit der Kriegswirtschaftsorganisation die ökonomischen und sozialen Bedingungen auch der hier untersuchten Gruppen stark veränderte, waren die Verkäufer und einige andere Handelsangestellte, soweit sie sich überhaupt als solche organisierten, mehr als je ein Teil der amerikanischen Arbeiterbewegung. Depression und New Deal hatten ihre Protest- und Organisationsbereitschaft gefördert, die sie jedoch — ganz im Unterschied zu Deutschland — eindeutig innerhalb der zweigeteilten amerikanischen Arbeiterbewegung verwirklichten. Das Verhalten, die Forderungen, die Ideologien von RCIPA und URWEA unterschieden sich im Prinzip nicht von denen anderer AFL- bzw. CIO-Organisationen, jedenfalls nicht mehr als verschiedene Produktionsarbeiterverbände innerhalb dieser Dachorganisation voneinander differierten. Insofern standen die sich organisierenden Einzelhandelsangestellten stellvertretend für die große Mehrheit aller anderen organisierten Angestellten in den USA der dreißiger Jahre. Soweit bisher überblickbar, ließen die großen und im New Deal wachsenden Verbände von Post-, Bahn- und öffentlichen Angestellten, die meist der AFL, seltener dem CIO, manchmal der Gruppe unabhängiger Einzelgewerkschaften angehörten, kein spezifisches Angestelltenverhalten © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
56
Jürgen Kocka
erkennen, sondern waren, wie andere Berufs- und Industrieverbände auch, in die amerikanische Arbeiterbewegung integriert57. Sie unterstützten damit innerhalb der für diese kennzeichnenden Abstufungen und Grenzen ein gemäßigt progressives, primär ökonomisches und arbeitsplatz-orientiertes Programm, das der sozial- und allgemeinpolitischen Dimension jedoch je länger desto weniger entbehrte, das die vorsichtig-fortschrittliche New Deal-Reformpolitik nachdrücklich unterstützte und eher links als rechts von der Mitte des damaligen politischen Spektrums einzuordnen war. 3. Gewerkschaften professioneller57a Berufe Wie erwähnt, litten auch die industriellen Gehaltsempfänger stark unter Arbeitslosigkeit, wenn auch weniger hart als die Industriearbeiter. Eine Aufstellung des Handelsministeriums berichtete, daß im Bereich Industrie (einschließlich Bergbau und Bauwesen) und Verkehr 1929 bis 1932 700 000 Gehaltsempfänger (oder 3 0 % der Gesamtzahl) und 5 100 000 Lohnarbeiter (oder 42 % der Gesamtzahl) arbeitslos waren58. Es wurde zudem üblich, bei entsprechender Auftragslage Angestellte nur für wenige Tage pro Woche zur Arbeit kommen zu lassen und ihnen die freien Tage vom Gehalt abzuziehen50. Die veränderte Konjunktur führte in vielen Unternehmen zu Einsparungen im Bürobereich, zu schärferen Kontrollen der Angestelltenarbeit und damit zum weiteren Abbau kleiner Sonderrechte und Freiheiten, die die Bürobelegschaft von der Werkstatt unterschieden haben mochten60. Ab 1932 schrumpfte der Abstand zwischen dem durchschnittlichen Angestelltengehalt und dem durchschnittlichen Arbeiterlohn in der amerikanischen Industrie klar und stetig zusammen. Der Einbruch von 1938 hielt diesen Nivellierungsprozeß kurzfristig auf, bevor er sich in der Rüstungskonjunktur ab 1939 beschleunigt fortsetzte61. Sparsamkeitserwägungen und die zu ihren Gunsten veränderte Arbeitsmarktsituation bewogen viele Unternehmensleitungen, innerbetriebliche „Wohlfahrtseinrichtungen“ und Personalprogramme zu reduzieren. Auch das betraf manchen Angestellten in negativer Weise. Insbesondere zeigte sich der teilweise Zusammenbruch des in den zwanziger Jahren so sehr gefeierten „Wohlfahrtskapitalismus“ im industriellen Bereich an der Reduktion von Aktien- und Gewinnbeteiligungen, Eigenheimprogrammen für Belegschaftsangehörige, Sparplänen, Firmenkantinen und bezahlten Ferien, im Abbau von Unternehmensangeboten im Freizeitbereich (Sport, Musikveranstaltungen, Betriebsausflüge, Picknicks etc.) und von innerbetrieblichen Fortbildungskursen (Lehrlings-, Meister- und Praktikantenkursen)62. Zudem nahmen in der Depression der dreißiger Jahre die Aufstiegschancen im kaum mehr wachsenden industriellen Bereich im Vergleich zu den vorhergehenden Jahrzehnten merklich ab. Am klarsten verlangsamte sich das Wachstum der höheren Angestelltenstellen, am wenigsten das der Arbeiterpositionen. Das Wachstum der Zahl der vor allem auf qualifizierte und leitende Stellen reflektierenden Schulabgänger nahm im selben Zeitraum jedoch nicht ab63. Für beschäftigte und nachdrängende Indu© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
57
strieangestellte ergab sich damit ein Aufstiegsstau, der angesichts der traditionellen Aufstiegsaspirationen dieser Gruppen fast notwendig zu Enttäuschungen führen und die aus anderen Depressionsfolgen geschürte Unzufriedenheit weiter verstärken mußte. Deren Umsetzung in organisierte Interessenwahrnehmung und kollektive Proteste hing eng mit der Arbeits- und Sozialgesetzgebung des New Deal sowie mit der allgemeinen Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung in den dreißiger Jahren zusammen. Die Arbeits- und Sozialgesetzgebung des New Deal — insbesondere der „National Industrial Recovery Act“ (NRA) von 1933 mit seinen Arbeitszeit-, Lohn- und Organisationsbestimmungen, der „Social Security Act“ von 1935, der ein noch sehr unvollkommenes Sozialversicherungssystem für Arbeitnehmer einrichtete, der „National Labor Relations Act (Wagner-Act)“ von 1935 mit seinen Regelungen für gewerkschaftliche Organisation der Arbeitnehmer sowie der Mindestlöhne wie Höchstarbeitszeiten regelnde „Fair Labor Standards Act“ von 193864 — differenzierten in Rechten und Pflichten nicht zwischen Arbeitern und Angestellten. Differenzierungen fanden entweder nach vertikalfunktionalen Kriterien statt, etwa wenn einzelne Wirtschaftsabteilungen (wie Landwirtschaft, häusliche Dienstleistungen, Transport und öffentliche Dienste) 1935 aus der Sozialversicherung ausgeklammert blieben, oder horizontal entlang einer Linie, die eine Oberschicht von gehobenen Angestellten („professionals“) von der aus allen Arbeitern und der großen Masse der Angestellten gemeinsam bestehenden generellen Arbeitnehmerschaft abgrenzte und von den Schutzgesetzen (NRA und „Fair Labor Standards Act“) ausnahm65. Für die Freiberuflichen und die gut verdienenden Angestellten von professioneller Qualifikation bedeutete solche Ausklammerung keinen Nachteil, sondern die erwünschte Möglichkeit, ihre ökonomische Position weiterhin durch individuelle Verträge bzw. Tauschakte, relativ unbehindert von Gesetzen, selbst zu beeinflussen. Sofern sie überhaupt zu sozialökonomisch definierten Organisationen gehörten, dann zu professionellen Verbänden, die, wie die der Ärzte, Rechtsanwälte und meisten Ingenieurkategorien, aus ihrem professionellen Selbstverständnis heraus jede gewerkschaftliche Tätigkeit scharf ablehnten und sozial- wie auch allgemeinpolitisch mehrheitlich konservativ, d. h. wie die meisten Unternehmer rechts vom New Deal orientiert waren66. Für einen Teil jener als professionell oder leitend geltenden und damit aus den neuen Schutzgesetzen weitgehend ausgeklammerten Angestellten bedeutete die NRA-Gesetzgebung jedoch einen Anstoß zu gewerkschaftlicher Organisation. Neben den mittleren und gehobenen Einzelhandelsangestellten galt dies im industriellen Sektor vor allem für die Techniker und Ingenieure in nichtleitenden und mittelmäßig bezahlten Stellungen. Einerseits um den zur Abfassung der Codes führenden Willensbildungsprozeß auf oberster politischer Ebene zu beeinflussen, andererseits um durch kollektives Verhandeln mit dem jeweiligen Arbeitgeber das zu erreichen, was den nichtprofessionellen Arbeitnehmern, die nun zudem sich verstärkt zu organisieren begannen, gesetzlich garantiert worden war, schließlich um der © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
58
Jürgen Kocka
Tendenz mancher Arbeitgeber entgegenzuwirken, durch Senkung von Gehältern das wieder hereinzuholen, was man durch Erhöhung der untersten Löhne zugezahlt hatte, rührten sich in der organisationsfreudigen Stimmung ab 1933 auch unter den Technikern neue Ansätze zur gewerkschaftlichen Organisation. Die seit dem Weltkrieg bestehende kleine Techniker- und Zeichnergewerkschaft „International Federation of Technical Engineers', Architects' and Draftmen's Unions“ (AFL) nahm die Chance nicht wahr. Sie war unter überalterter Führung fast ausschließlich auf die Interessenvertretung von technischen Angestellten und Beamten im öffentlichen Dienst konzentriert, auf die die NRA ohnehin nicht zutraf. Sie kümmerte sich offenbar kaum um die vielen entlassenen Techniker. Schließlich scheint ein gewisses Mißtrauen der AFL gegenüber mittleren Angestellten, von denen man fürchtete, daß sie Unternehmerinteressen verträten, eine Rolle bei dem Verzicht auf die Organisation von Technikern und Ingenieuren in der Privatwirtschaft gespielt zu haben. Die AFL-Technikergewerkschaft blieb jedenfalls zunächst so unbedeutend, daß sie selbst von interessierten Beobachtern und Bestandsaufnahmen gänzlich übersehen wurde. Sie wuchs erst nach 193867. Techniker und Ingenieure schlossen sich in dieser neuen, von langjähriger Krise und organisationsfördernder Gesetzgebung gekennzeichneten Situation spontan an verschiedenen Orten zur Verbesserung ihrer ökonomischen Lage zusammen68. 1933 entstand außerhalb der AFL-Technikergewerkschaft die „Federation of Architects, Engineers, Chemists and Technicians“, deren Ziel es war „to unite all employee and student technicians for the purpose of obtaining and preserving employment with adequate wages and proper hours and working conditions.“ Ihre Mitglieder suchte sie unter allen „who are qualified by training or experience in any professional capacity, in architecture, engineering or any other scientific or technical work“, ausgenommen Arbeitgeber oder Angestellte im Vorgesetztenstatus, wenn dieser beinhaltete, daß die Betreffenden anstellen, entlassen, befördern und Gehälter festsetzen konnten. Die neue Organisation umschloß Techniker und Ingenieure, die im öffentlichen Dienst, in der privaten Industrie und auf den öffentlichen Notstandsarbeitsprojekten beschäftigt waren. Unter den Mitgliedern überwogen Techniker in industriellen, ärztlichen und zahnärztlichen Laboratorien, Bauzeichner und Chemiker, also zweifellos eher die schlechter bezahlten, nicht-leitenden Mitglieder dieser Berufsgruppe. 1936 meldete sie 6000 Mitglieder in 16 Abteilungen69. In der gewerkschaftsfreundlichen Presse wurde die „Federation“ als Neuheit begrüßt. „Ist ein Techniker ein Arbeiter (workingman), der wie jeder andere Arbeiter aus einer Gewerkschaft Nutzen ziehen kann? Oder praktiziert er eine ,profession' und ist es deshalb ,unter seiner Würde', an gemeinsamen Aktionen mit seinen Kollegen (fellow technicians) teilzunehmen? Bisher haben die Techniker immer die zweite Theorie verfolgt. Aber heute, angesichts enormer Arbeitslosigkeit . . . und der Verschlechterung ihrer Position unter der NRA, ändern viele Techniker ihre Meinung.“70 Zweifellos änderten die meisten Tech© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
59
niker und Ingenieure ihre Meinung nicht und betrachteten weiterhin, wie auch große Teile der Öffentlichkeit, professionellen Status als unvereinbar mit gewerkschaftlicher Organisation71. Ihre gewerkschaftliche Abstinenz und die Angriffe ihrer weiterhin rein professionellen Organisationen auf die „Federation“ zeigen das72. Diese jedoch betonte, daß man professionelle und gewerkschaftliche Interessen zugleich vertreten könne; sie weigerte sich, den Ausdruck „Professionalismus“ als Verbot für eigene Interessenwahrnehmung zu akzeptieren. Sie fühlte sich als „progressive Vorhut der technischen Berufe (professions)“ und sprach zugleidi von den „fellow workers“ in den Werkstätten, auf deren Hilfe man angewiesen sei73. Wie die gelernten und berufsbewußten „crafts“ in der AFL bewahrten diese Techniker ihre professionelle Identität und Stadien in ihren praktischen gewerkschaftlichen Forderungen und Methoden wie in ihren allgemeinen politischen Aussagen doch kaum von den Arbeitergewerkschaften ab, mit denen sie zusammenarbeiteten, Ihr Versuch, in die AFL einzutreten (die mit ihrem Berufsverbandsprinzip dem technischen Professionalismus an sich viel naher stand als der CIO) scheiterte an deren Widerstand74. Als schwache Organisation auf breitere Unterstützung angewiesen, schloß sie sich im Januar 1937 dem aufnahmebereiten CIO an und erhielt in dieser auf dem Industrieverbandsprinzip basierenden Organisation eine bezeichnende Sonderstellung: Sie setzte es durch, daß ihre Mitglieder nicht auf die jeweils für sie zuständigen Industrieverbände verteilt und dort mit anderen Berufen, mit gelernten und ungelernten Arbeitern zusammen organisiert wurden; sie setzte es aber auch durch — und das zeigt den Vorsprung des professionellen gegenüber einem sicher nicht ganz fehlenden Angestelltenbewußtsein in dieser Gruppe —, daß sie nicht in der entstehenden, weiter unten noch zu behandelnden, allgemeinen Angestelltengewerkschaft des CIO aufging; sie verstand sich als Gewerkschaft von „professionals“ und hielt an den daraus resultierenden organisatorischen Konsequenzen auch im CIO fest75. Soweit es die Protokolle des Gewerkschaftstages von 1938 erkennen lassen, war im übrigen die „Federation“ eine vollgültige, normale CIO-Gewerkschaft. Sie vertrat die üblichen „Brot- und Butter-Forderungen“, ohne irgendeinen Wunsch auf Privilegierung vor den „fellow workers“ erkennen zu lassen und akzeptierte Tarifvertrag und Streik als gewerkschaftliche Mittel76. Sie anerkannte die bisherigen (vor allem finanziellen und personellen) Hilfestellungen einzelner CIO-Gewerkschaften, bat um weitere Unterstützung beim geplanten Angriff auf die Stahl- und Elektroindustrie, erklärte ihre Bereitschaft zur engsten Zusammenarbeit, um den Werkstattarbeitern das oftmals bestehende Gefühl von der „Überlegenheit“ der Angestellten zu nehmen. Mit dem CIO — und im Unterschied zur AFL — bejahte sie ein starkes politisches Mandat der Gewerkschaften; sie unterstützte den New Deal, forderte mehr Sozialpolitik und öffentliche Arbeiten, polemisierte gegen „Big Business“, setzte sich in Resolutionen für die Sicherung der Bürgerrechte, den Kampf wider den Faschismus, gegen die berufliche Diskriminierung von Negern und Frauen und für öffentlich subventionierte billige Wohnhäuser ein. 1944 hatte sie 4900, ihre © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
60
Jürgen Kocka
ähnlich klar in die AFL integrierte Konkurrenzorganisation 7100 Mitglieder77. Nach dem Krieg wurde sie wegen angeblicher kommunistischer Unterwanderung aus dem CIO ausgestoßen und verschmolz, stark reduziert, 1946 mit der noch zu behandelnden CIO-Angestelltengewerkschaft (UOPWA)78. Die AFLGewerkschaft nannte sich ab 1950 „American Federation of Technical Engineers“ und zählte 1955 10 000 Mitglieder79. Die kurze Geschichte der „Federation of Architects, Engineers, Chemists and Technicians“ exemplifiziert, wie professionelle Gruppen ohne völlige Aufgabe ihres professionellen Selbstverständnisses und ohne einen besonderen Typ der Angestelltengewerkschaft zu entwickeln, innerhalb der amerikanischen Arbeiterbewegung Platz fanden. Wie schon während des ersten Weltkrieges war es für eine kleine Minderheit dieser Berufsgruppe durchaus möglich, ihre bis dahin rein professionellen Organisationen ohne Zwischenstufe in Gewerkschaften innerhalb der allgemeinen Arbeiterbewegung zu verwandeln80. Dasselbe Muster organisatorischen Verhaltens entwickelten andere professionelle oder halbprofessionelle Gruppen außerhalb des hier untersuchten industriellen Bereiches. Wirtschaftskrise und NRA gaben den Anstoß für die Gründung der Journalistengewerkschaft „Newspaper Guild“. Deren Mitglieder demonstrierten ihr professionelles Sonderbewußtsein durch Vermeidung des Begriffes „union“ und durch vorläufigen Verzicht auf Anschluß an die AFL. Doch unterschieden ihre konkreten, auf Tarifverträge hinstrebenden Ziele wie auch die angewandten Mittel (bis hin zu viel beachteten Journalistenstreiks) sie kaum von Arbeitergewerkschaften. Mit 5800 Mitgliedern schloß sich die „Newspaper Guild“ 1936 der AFL, mit 11 100 Mitgliedern 1937 dem CIO an, zu deren politisch linkem Flügel sie fortan gehörte. Erst 1940 entstand eine Konkurrenzorganisation in der AFL-zugehörigen „American Editorial Association“, die sich von der „Newspaper Guild“ besonders durch ein antikommunistisches Programm abzusetzen versuchte, im übrigen aber sowohl deren professionelles Selbstverständnis wie deren gewerkschaftlichen Charakter teilte81. Gehaltskürzungen und Entlassungen überzeugten auch eine große Anzahl von Flugpiloten von der Notwendigkeit, ihre bis dahin rein professionellen Organisationen in gewerkschaftliche umzuwandeln. „Die Tage des Individualismus und der individuellen Anstrengungen sind vorbei. Alles bewegt sich jetzt en masse . . . Nur große Organisationen scheinen noch überleben zu können. Wir müssen diesem Zug der Zeit folgen. Von jetzt ab ist es von wesentlicher Bedeutung, daß wir in unserem Beruf („profession“) einen gewissen Teil unserer Zeit für unsere Organisation zur Verfügung stellen . . .“82 Die „Air Line Pilots' Association“ entstand insgeheim 1930, öffentlich 1931. Vor allem um Zugang zu den für sie interessanten Behörden zu erlangen, trat sie der AFL bei. Ihren professionellen Charakter gab die schnell wachsende Pilotengewerkschaft damit nicht auf. Wenig später gab sie sich sogar einen professionellen Ehrenkodex83. In den genannten Fällen der Techniker, Journalisten und Piloten — hinzuzufügen wären: die Lehrer, die Musiker und vielleicht auch die Schauspieler84 — erwies sich jeweils für eine Minderheit der in diesem Beruf als Angestellte © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
61
Beschäftigten professionelles Selbstverständnis als kein Hindernis für gewerkschaftliche Organisation innerhalb der allgemeinen Arbeiterbewegung. Als spezieller Beruf — nicht als Teil der Angestelltenschicht — organisierten sie sich in AFL und CIO; die große Zahl derjenigen, die diesen Schritt nicht mitvollzog, blieb unorganisiert bzw. innerhalb von sozialökonomisch und sozialpolitisch weitgehend abstinenten professionellen Verbänden, die — schon weil sie selbständige Mitglieder des jeweiligen Berufes ebenfalls umschlossen und zudem die jeweilige professionelle Spezialisierung zur Grundlage hatten — ebenfalls mit Angestelltenverbänden deutscher Art nicht auf eine Stufe gestellt werden können. Die Organisation von „professionals“ innerhalb der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung reflektierte das Fehlen eines mittelständischen, antiproletarischen, sich von der Arbeiterschaft abgrenzenden Angestelltenbewußtseins. In enger Verknüpfung damit verwies sie zum anderen darauf, daß der Ökonomistische, berufliche Spezialisierung respektierende, instrumentelle Charakter der amerikanischen Arbeiterbewegung, die eben selbst auf ihrem linken Flügel von ihren Mitgliedern kein proletarisches Klassenbewußtsein, keine Solidarität mit Haut und Haar und vor allem nur bedingt spezifische politische Bekenntnisse forderte, den Eintritt von Gruppen relativ leicht machte, die in ihrem Beitritt vor allem ein Mittel zur Erreichung spezifischer ökonomischer, arbeitsplatzorientierter, auch sozialpolitischer Zwecke, nicht aber ein die ganze Person umfassendes Standortbekenntnis sahen85. 4. Überberufliche Angestelltenverbände Gleichwohl gab es daneben einige schwache Ansätze zur gemeinsamen Interessenorganisation von Angestellten verschiedener Berufszugehörigkeit in Verbänden, die sich von den Selbständigen und Arbeitgebern ebenso abgrenzten wie von den Handarbeitern. Die Veränderungen der Arbeitsorganisation im Büro hatten eine große Anzahl von Angestelltenpositionen auf unterer und mittlerer Ebene hervorgebracht, deren Inhaber sich von den traditionellen Büroberufen wie „Buchhalter“, „Stenograph“ oder „Sekretärin“ stark unterschieden, entweder weil sie nur eine eng spezialisierte Teiltätigkeit (Bedienung einer Addiermaschine, Zeitkontrollen) oder aber als „general clerks“ allgemeine, beruflich gar nicht mehr definierbare Bürohilfs- und Schreibtätigkeiten ausübten. Der berufliche Inhalt solcher Tätigkeiten hatte sich im Zuge zunehmender Arbeitsteilung weitgehend aufgespalten oder aber geradezu verflüchtigt86. Eine Organisation nach dem Berufsprinzip war auf den unteren Ebenen des modernen Büros genauso unmöglich wie unter den un- und angelernten Arbeitern der modernen Massenindustrie, geschweige denn eine Organisation auf der Basis professioneller Identitäten. Seit dem ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts gab es vereinzelte „Bookkeepers', Stenographers' and Accountants Unions“, die, wie ihr Name anzeigt, noch von einzelnen Büroberufen ausgingen, sie aber gemeinsam organisierten. Den Schwerpunkt hatten sie in gewerkschaftseigenen Büros. Unter Führung der © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
62
Jürgen Kocka
New Yorker Gruppe waren sie als örtliche Gewerkschaften der AFL angeschlossen, die ihnen jedoch nicht den Status einer Allamerikanischen Gewerkschaft verlieh, weil sie die Büros wohl für unorganisierbar hielt, weil das in ihr herrschende Berufsprinzip zu Organisationsanstrengungen in diesen damit nur schwer zu erfassenden Gebiet nicht gerade drängte und weil ihr die politische Radikalität dieser Büroangestelltengruppen nicht zusagte. Mehrfach wurden einzelne dieser örtlichen Gewerkschaften (oder Teile davon) aus der AFL ausgeschlossen, wobei der Verdacht zu großer Kommunistenfreundlichkeit stark ins Gewicht gefallen zu sein scheint87. Unter den Bedingungen der Depression wuchs die Zahl der Mitglieder dieser insgesamt vierzig Örtlichen Büroangestelltengruppen, die dennoch von der AFL nicht auf nationaler Ebene als Gewerkschaft anerkannt wurden. Dreizehn von ihnen trennten sich schließlich unter Leitung der New Yorker Gruppe im Mai 1937 ganz von der AFL, schlossen sich mit neun unabhängigen Ortsorganisationen zur „United Office and Professional Workers of America, International“ (UOPWA) mit (nach eigenen Angaben) 8600 Mitglieder zusammen und traten dem CIO bei. Die AFL gründete, wahrscheinlich im darauf folgenden Jahr, ihren „Office Employees' International Council“, aus dem 1944 die „Office Employees' International Union“ hervorging88. Zum ersten Mal wurde damit auf nationaler Ebene versucht, eine Gewerkschaft zu gründen, die sich weder auf eine besondere Industrie, noch auf einzelne Berufe oder „professions“ konzentrierte, sondern sich um die Organisation aller Angestellten bemühte. Über Wirtschaftszweige und Berufsgrenzen hinweg wurden die „white collar salaried employees“ nunmehr als Schicht mit genügend ähnlichen Problemen und Merkmalen aufgefaßt, um sie in ein und derselben Organisation zusammenzuschließen89. Gewerkschaftler wie Unternehmer glaubten, daß langfristige Strukturveränderungen im Büro, die Auswirkungen der Depression und die tendenzielle Nivellierung des sozialökonomischen Unterschiedes zwischen Arbeitern und Angestellten diese für gewerkschaftliche Organisation reif gemacht hätten90. Die Besonderheiten der Angestelltenpsychologie erschienen dennoch den CIO-Führern als bedeutsam genug, um eine eigene Angestelltenorganisation ins Leben zu rufen, die auf die traditionelle Gewerkschaftsablehnung der meisten Angestellten und deren immer noch nicht genügend erschütterten Individualismus Rücksicht nehmen und besondere Techniken der Werbung anwenden sollte91. Die CIO-Führer stimmten also — mit einigen Einschränkungen — der gemeinsamen Organisation von Versicherungs-, Bank-, Verlags-, Industrie- und anderen Angestellten zu, was zumindest in bezug auf die Industrieangestellten eine klare Durchbrechung der industrieverbandlichen Prinzipien des CIO bedeutete und tatsächlich auch zunehmend zu Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen der UOPWA und den jeweiligen Industrieverbänden (der Autoarbeiter z. Β.) führte92. Es mag daran mitgelegen haben, daß die schnell wachsende UOPWA93 fast alle ihre Mitglieder aus reinen Angestelltenbereichen gewann, nämlich vor allem: Versicherungs- und Verlagsangestellte, daneben Sozialarbeiter, Künstler, © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
63
Reklameleute und einige Handelsvertreter, aber kaum Bankangestellte94. In den großen industriellen Angestelltenbereichen blieb der UOPWA-Erfolg bis 1943 fast ganz aus. Immerhin ist bedeutsam, daß diese erste erfolgreiche Angestelltengewerkschaft, die insbesondere in den großen Versicherungskonzernen mehrere öffentlich beaufsichtigte Vertreterwahlen mit großen Mehrheiten gegenüber konkurrierenden „unabhängigen“ und „gelben“ Organisationen gewinnen konnte, in der Militanz ihrer Mittel hinter anderen CIOGewerkschaften nicht zurückstand und in ihrer politischen Färbung zum äußersten linken Flügel des CIO gehörte. Sie setzte sich für keine speziellen Angestelltengesetze, aber für das sozialpolitische Programm des CIO in voller Schärfe ein. Sie polemisierte gegen die zunehmende Beschneidung von Bürgerrechten, gegen die Diskriminierung von Negern, Frauen und Linken. 1940 stimmten die Delegierten mehrheitlich dagegen, Roosevelts Wiederwahl zu unterstützen. Zu weit sei er von seiner ehemals fortschrittlichen Politik abgerückt. Die UOPWA-Führung, mindestens aber ihr Präsident Lewis Merrill, arbeitete eng mit kommunistischen Gruppen zusammen. 1949 wurde die UOPWA deshalb aus der CIO ausgeschlossen95. Antiproletarisch, mittelständisch und statusbewußt war diese erste amerikanische überberufliche Angestelltengewerkschaft gewiß nicht. In mehreren Großunternehmen entstanden etwa zur gleichen Zeit Angestelltenorganisationen, von denen das nicht mit gleicher Eindeutigkeit gesagt werden konnte. Im East Pittsburgher Zweig des Elektro-Großunternehmens Westinghouse96 führte eine überraschende Gehaltssenkung im Juni 1938, die im auffälligen Gegensatz zur relativ günstigen Lohnentwicklung in den gewerkschaftlich organisierten Werkstätten stand, zu Angestelltenprotesten und zur Gründung der „Association of Westinghouse Salaried Employees“, die Ingenieure, Zeichner, Kaufleute, Buchhalter, Büro- und Werkstattangestellte aller Art umschloß, aber keine Produktionsarbeiter aufnahm. Mit ähnlichen Organisationen, die in anderen Unternehmenszweigen entstanden, bildete sie bald die „Federation of Westinghouse Independent Salaried Unions“ (FWISU). Sie schloß alle Angestellten im Vorgesetztenstatus („supervisors“) aus, um vom zuständigen Bundesamt, dem „National Labor Relations Board“ als vollgültige Gewerkschaft anerkannt zu werden. Erfolgreich drängte sie die CIO-Technikergewerkschaft und die CIO-Elektroarbeiter, die sich um die Einbeziehung von Angestellten in ihre Organisation bemühten, zurück und gewann 1940 zwei öffentlich beaufsichtigte Vertreterwahlen. Mit massivem Druck, der angeblich bis hart an den Rand eines Angestelltenstreiks führte, setzte sie Gehaltserhöhungen, geregelte Gehaltsabstufungen sowie andere Verbesserungen in den Anstellungsverhältnissen bei der Konzernleitung durch. Sie trat weder der AFL noch dem CIO bei, bezog aber ein Büro außerhalb der Firma, um nicht von den beaufsichtigenden Regierungsstellen, wie so viele andere „independent unions“, als unternehmensabhängig zurückgewiesen zu werden. Ab 1939, besonders aber während des Weltkrieges mit seiner starken Intensivierung der Arbeitsgesetzgebung trat die FWISU als gewählte Vertretung von 9000 © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
64
Jürgen Kocka
Westinghouse-Angestellten und als selbsternannte Sprecherin für die Masse der unorganisierten Angestellten Amerikas in Washington auf, verhandelte mit Behörden und sagte vor Kongreßausschüssen aus. Gegen Ende des Krieges nahm sie Kontakte zu anderen, ähnlichen, bereits bestehenden, unabhängigen (d. h. weder der AFL noch dem CIO angehörigen) Angestelltenverbänden auf und initiierte die Errichtung eines Angestelltengewerkschaftsbundes auf nationaler Ebene. Die so entstehende „National Federation of Salaried Unions“ gab 1944 15 000, 1945 25 000 Mitglieder an, verlor dann aber rasch an Stärke und zählte 1962 11 600 Mitglieder97. Die FWISU verstand sich ausdrücklich als Antwort auf die vorwärtsdrängenden gewerkschaftlichen Industrieverbände. Durch Selbstorganisation der Angestellten verhinderte sie deren eventuelle Einbeziehung in CIOGewerkschaften, die zunehmend danach strebten, Angestellte in ihre Verbände einzubeziehen. Soweit aus den Quellen ersichtlich, vermied sie jeden Angriff auf die großen Gewerkschaftsverbände und jeden anti-proletarischen Zungenschlag. Sie versicherte, „keine Antipathie“ gegen AFL und CIO zu haben, hielt es aber für nötig, daß sich Angestellte in Organisationen zusammenschlössen, die unter Leitung von Angestellten stünden, statt, wie die meisten CIO-Gewerkschaften, von Männern geleitet zu werden, die primär mit den Problemen von Lohnarbeitern beschäftigt seien. Lohnarbeiter und Gehaltsempfänger seien mit verschiedenen Problemen konfrontiert, und die FWISU betonte als ihren Hauptvorteil, nicht von Arbeitern im Stunden- oder Stücklohn kontrolliert zu werden. Auch schon vor Beginn des Krieges beklagte sie als eines der wichtigsten Angestellten-spezifischen Probleme, daß seit Beginn der Erholung, seit der Mitte der dreißiger Jahre, die Lohnarbeiter mit Hilfe starker Organisationen die nicht-organisierten Gehaltsempfänger zum Teil finanziell überrundet und sich die Teilnahme an „Privilegien“ erkämpft hatten, die bis dahin den Angestellten vorbehalten gewesen waren. In ihren Verträgen mit der Unternehmensleitung, die wahrscheinlich lieber mit der FWISU als mit einer CIO-Gewerkschaft verhandelte, handelte sie zum einen jene konkreten Vorteile aus, die, wie Überstundenzuschläge, den Arbeitern längst, den Angestellten oft noch nicht gewährt wurden. Sie versuchte, offenbar nicht ohne Erfolg, eine allzu starke Nivellierung von Löhnen und Gehältern durch regelmäßige Revision der gesamten Gehaltsstruktur (an der ihre Vertreter beteiligt wurden) zu verhindern. Sie bemühte sich schließlich um die vertragliche Beibehaltung oder Gewährung kleiner Privilegien, die die Angestellten (oder einzelne Angestelltengruppen) weiterhin von den Arbeitern im Unternehmen unterscheiden sollten98. Die FWISU schloß den Streik als Kampfmittel nicht aus, doch muß angesichts ihrer relativ niedrigen Beiträge und der fehlenden Unterstützung seitens anderer Verbände entschieden bezweifelt werden, ob sie zu einem Streik fähig gewesen wäre. Als ihr Ziel formulierte sie: „to provide a legal and accredited means for collective bargaining and for the promotion of the industrial, economic and social welfare of its members“, „cooperation, understanding and © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
65
fair dealing“ wollte sie im Verhältnis zur Unternehmensleitung verwirklichen“. Zweifellos gehörte sie nicht zu den Anhängern eines Denkens, das die Beziehungen zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern primär unter dem Gesichtspunkt struktureller Konflikte begriff. Während sie darin vielen Arbeitergewerkschaften (vor allem in der AFL) glich, unterschied sie sich von den meisten Arbeitergewerkschaften in CIO und AFL durch ihren Verzicht auf weit verbreitete gewerkschaftliche Forderungen wie „closed shop“, „union shop“ oder obligatorischen Abzug der Mitgliederbeiträge von den Bezügen der Arbeitnehmer durch den Unternehmer („checkoff“). Die FWISU erkannte klar, daß in dem Maße, in dem gesetzliche und überhaupt staatliche Interventionen die Arbeits- und sozialen Verhältnisse beeinflußten, auch die Angestellten ihren organisierten Einfluß geltend machen müßten , wenn sie nicht noch weiter hinter den Lohnarbeitern zurückfallen wollten. Schon vor dem Krieg nahm sie die daraus folgende Lobby-Funktion wahr und beeinflußte etwa Modifikation und Auslegung des „Fair Labor Standards Act“ von 1938, der bekanntlich eine Schicht von gehobenen Angestellten aus seinen Schutzbestimmungen ausnahm. Ihre Interessenvertretungsaktivität in Washington nahm im Krieg zu, als es darum ging, die Verdienste und Arbeitsverhältnisse tief beeinflussenden Gesetze und Verordnungen der Regierung zugunsten der Gehaltsempfänger zu beeinflussen. Dies gelang kaum. Preissteigerungen, Arbeiterknappheit, die im Krieg weiter an Macht gewinnenden Gewerkschaften und die durch sie beeinflußten, unvollkommenen, die Angestellten mehr als die Arbeiter benachteiligenden staatlichen Eingriffe wirkten zusammen, um die Realverdienste der Angestellten gegenüber denen der Arbeiter weiter zurückfallen zu lassen. Vergleicht man die durchschnittlichen Wochenverdienste der Arbeiter (Industrie, Verkehr, einige Dienstleistungen) mit denen der Angestellten (Industrie, Verkehr, Versicherungen, Öffentlicher Bereich und Erziehung), so ergibt sich, daß 1943 erstmals die Arbeiter pro Woche mehr nach Hause trugen als die Angestellten100. Zurecht hatten die meisten Angestellten das Gefühl, absolut und relativ zu den Verlierern des Krieges zu gehören101. UOPWA und FWISU forderten die Einrichtung eines speziellen Angestelltenamtes auf Bundesebene mit Beteiligung der Interessenten und gezielte Maßnahmen des „National War Labor Board“ und des „Office of Economic Stabilization“, um die eingetretenen Gehalt-Lohn-Verschiebungen wenigstens zum Teil wieder rückgängig zu machen. Dieser nur unter den Ausnahmebedingungen des Krieges mit seinen starken und verzerrenden Staatsinterventionen verständliche Hilferuf nach einer spezifischen Angestelltenschutzpolitik verzichtete nicht ganz auf ideologische Ornamente. Von CIO-Seite wurde versichert, daß der konstante Lebensstandardsrückgang die Angestellten in Not, Verwirrung und Bestürzung treibe, daß ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit und damit — da sie zentrale und wertvolle gesellschaftliche Funktionen ausübten — die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Nation bedroht seien102. Die FWISU entwickelte gewisse Ansätze einer mittelständischen Rhetorik. Sie forderte Schutz für die „riesige Menge von 5 Winkler, Krise
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
66
Jürgen Kocka
gebildeten, gewissenhaften, Gehalt empfangenden Individuen“, von denen zudem immer eine gepflegte Erscheinung erwartet werde, Schutz für jene Zwischengruppe, die den Großteil der geistigen Arbeit leiste und ohne die keine Institution bestehen könne. „Pity the poor white-collar workers! . . . The salaried employees are truly the forgotten Americans.“ Sie seien das „Rückgrat der amerikanischen Gesellschaftsordnung“, sie spendeten in der Regel mehr für wohltätige Zwecke als die oft mehr verdienenden Lohnarbeiter, sie könnten die besonderen Anforderungen ihrer Stellungen nicht mehr erfüllen. Die Bitterkeit der Angestellten über ausbleibende Regierungshilfen und das ökonomischfinanzielle Chaos, das ihnen drohe, seien der „moralischen Desintegration und dem Verfall der Prinzipien christlicher Brüderlichkeit“ förderlich103. Wenn hier drei bis vier Jahrzehnte später als in Deutschland schwache Ansätze eines mittelständischen, von der Arbeiterschaft sich abhebenden, staatlichen Schutz fordernden, organisierten, kollektiven, schicht- und nicht berufsspezifischen Angestelltenprotestes sichtbar wurden, so sind dessen Unterschiede zu den Protesten den deutschen „neuen Mittelstandes“ gleichwohl nicht aus den Augen zu verlieren. Die FWISU verzichtete auf antiproletarische Frontstellungen, sie hielt sich von weltanschaulich-politischer (etwa antisozialistischer) Überformung ihrer Forderungen fern104; sie unterstützte im Grunde die Sozialpolitik des New Deal105; in ihren Argumentationen überwog ganz eindeutig die ökonomische Dimension, sie verstand sich als Instrument zur Erreichung bestimmter wirtschaftlicher, finanzieller, arbeitsplatzmäßiger Verbesserungen, nie aber auch nur in Andeutung als Standesorganisation. Zu allgemeinen politischen Problemen nahm sie nicht Stellung. Die das amerikanische Gewerkschaftswesen vom deutschen so sehr unterscheidende Tendenz zur klareren Differenzierung und Separierung der ökonomischen, sozialen und politischen Dimensionen in Programm, Aktionen und Selbstverständnis bestimmte auch diesen Angestelltenverband, und das zu einer Zeit, da im CIO mit seinem allgemeinen Reformprogramm erstmals eine gewisse Verschmelzung der Ökonomischen, sozialen und politischen Emanzipationsforderungen auf Massenbasis eingesetzt hatte. Zwar thematisierte die FWISU deutlicher als andere vor ihr die bedrohten und zerrinnenden Angestelltenprivilegien. Doch angesichts der von den Löhnen im Durchschnitt überholten Gehälter, angesichts gewisser Ungerechtigkeiten der Kriegswirtschaft fiel es ihr nicht schwer, ihre Forderungen in egalitärer, nach gleicher Chance für alle rufender Rhetorik vorzutragen106. Und vor allem: dieser Protest, so sehr er verbreitete Erfahrungen und Ressentiments formulieren mochte, wurde nicht zu einer sozial und politisch ins Gewicht fallenden Bewegung, er stagnierte zudem, so scheint es, in der Nachkriegs- und Nachdepressionszeit der folgenden Jahre. 5. Angestellte und Arbeiterbewegung
Versucht man die Ergebnisse dieser Verbände-Untersuchung zusammenzufassen und einzuordnen, so darf man nicht aus den Augen verlieren, daß nur © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
67
eine geringe Minderheit amerikanischer Angestellter in diesen Verbänden organisiert war und daß deshalb eine Analyse von Angestelltenverbänden in USA sehr viel weniger Urteile auf die Angestellten als soziale Gruppierung erlaubt als entsprechende Untersuchungen in Deutschland. 1932 waren im Deutschen Reich ca. 31 % der Angestellten und Beamten gewerkschaftlich organisiert. Damit unterschied sich ihr Organisationsgrad kaum von dem der Arbeiter, der 1932 34 % betrug. Betrachtet man nur die Privatangestellten (ohne Beamte), dann zeigt sich, daß sie mit 43 % die Organisationsbereitschaft der Arbeiter in der Krise sogar übertrafen107. In den USA gehörten 1935 nur 12 % der Arbeiter und nur 5 % der Angestellten Gewerkschaften an108. Von den knapp 7 Millionen gewerkschaftlich organisierten deutschen Arbeitnehmern waren 1932 25 % Angestellte. 1935 zählten die 156 amerikanischen Gewerkschaften zusammen 4655 Millionen Mitglieder. Davon entfielen 588 000 oder 12,6 % auf 26 Gewerkschaften, die ausschließlich oder vorwiegend Angestellte organisierten109. Der Organisationsgrad aller amerikanischen Arbeitnehmer war also ungleich geringer als der der deutschen. Zusätzlich und im Unterschied zum zeitgenössischen Deutschland blieb aber in den USA der Organisationsgrad der Angestellten weit hinter dem der Arbeiter zurück. Jedoch führten die sozialökonomischen und ideologischen Wirkungen der Wirtschaftskrise, die Sozial- und Wirtschaftspolitik des New Deal, der Vormarsch der Arbeitergewerkschaften (insbesondere der neuen Industrieverbände) und schließlich besonders der Krieg zur Intensivierung der Organisationsbestrebungen auch unter den amerikanischen Angestellten. Wenn 1935 5 % aller Angestellten gewerkschaftlich organisiert waren, so betrug der Anteil 1939 7 % und 1948 16 %110. In den dreißiger Jahren organisierten sich Angestellte nach vier verschiedenen Mustern: in Berufsverbänden wie Arbeiterberufsverbände auch (Beispiel: RCIPA); in Industrieverbänden zusammen mit Arbeitern wie andere Industrieverbände auch (Beispiel: URWEA); in professionellen Gewerkschaften (Beispiel: Federation of Architects, Engineers, Chemists and Techniciens, CIO); in Angestelltengewerkschaften auf überberuflicher Basis (UOPWA, FWISU). Die entstehenden und wachsenden Angestelltengewerkschaften waren mit ihrer wirtschaftlichen, sozialen und politischen Dimension weitgehend in die amerikanische Arbeiterbewegung integriert. Antiproletarisches Absetzungsstreben und mittelständische Angestelltenbesonderheiten spielten in ihnen nur eine sehr geringe Rolle. Eine Zweiteilung in Arbeiterbewegung und Angestelltenbewegung trat nicht ein. Die hier vor allem im industriellen und im Handelsbereich untersuchten Verbände erlauben nicht die Generalisierung, daß Angestelltenorganisationen in der Regel konservativer, weniger radikal oder eher nach „rechts“ tendierend waren als Arbeiterverbände. Besonders gegen Ende des untersuchten Zeitraums zeigten sich allerdings — hauptsächlich als Reaktion auf die konsequente Arbeiterorganisation der Industrieverbände und auf die im New Deal beschleunigte Herausbildung staatlicher Interventionen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich — Ansätze 5*
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Jürgen Kocka
68
zu schichtspezifischen Forderungen, Verhaltensweisen und Protesten, die einiger mittelständischer Komponenten nicht entbehrten. Eine gewisse Abweichung des Organisationsverhaltens von dem der Arbeiter zeigt sich auch in der etwas disproportionalen Verteilung aller organisierten Angestellten auf die drei großen amerikanischen Gewerkschaftsgruppen111: Gewerkschaftsgruppe
Gesamtzahl der org. Gesamtzahl aller organisierten Angestellten in der Arbeitnehmer in der Gew.gruppe Gew.gruppe
Anteil der Angestellten an der Gesamtzahl aller in dieser Gew.gruppe organisierten Arbeitnehmer
1939 AFL CIO Unabhängige
3 878 000 1 837 700 839 800
442 100 87 400 213 300
11 % 5% 26 %
1945 AFL CIO Unabhängige
6 890 400 3 927 900 1 743 800
713 100 169 000 441 000
10 % 4% 25 %
Mehr als die Hälfte aller organisierten Angestellten gehörten also zwar der AFL an. Doch besaßen die unabhängigen, d. h. weder der AFL noch dem CIO angeschlossenen Verbände einen höheren Angestelltenanteil als die AFL und erst recht als der relativ radikale, über arbeitsplatzbezogene Forderungen in Richtung sozialer und politischer Programme hinausdrängende, militante, industrieverbandliche CIO, der am wenigsten Anziehungskraft auf die Angestellten ausübte112. Diese Verteilung dürfte (nicht durchweg, aber der Tendenz nach) auf eine gewisse, auch innerhalb der FWISU und an späteren, hier nicht behandelten, professionellen Ingenieurgewerkschaften deutlich gewordene Zurückhaltung mancher sich organisierender Angestellter gegenüber völliger Einbeziehung in die Arbeiterverbände hindeuten. Daß solches Distanzierungsstreben nicht deutlicher hervortrat, daß Angestelltenverbände in der Regel und trotz der angedeuteten Modifikationen relativ problemlos in der allgemeinen Arbeiterbewegung Platz fanden, lag nicht nur an den Einstellungen und Verhaltensweisen der Angestellten selbst, sondern auch an dem lockeren, der beruflichen Eigenart viel Raum lassenden, politische und weltanschauliche Festlegungen kaum verlangenden, ökonomisch und arbeitsplatzkonzentrierten, nicht-revolutionären, wenig radikalen Charakter der amerikanischen Arbeiterbewegung (der AFL mehr als des CIO). Wie sich immer wieder zeigte, bestand — mit kleinen Einschränkungen seit den späten dreißiger Jahren — für die amerikanischen Angestellten nicht die Alternative zwischen Gewerkschaften im Sinne der Arbeiterbewegung oder „mittelständischer“, antiproletarischer Angestelltenbewegung; sondern sie hatten die Wahl zwischen ihrer Organisation innerhalb der Arbeiterbewegung und dem Verzicht auf Organisation überhaupt. Über 90 % entschieden sich noch 1939 für die zweite ihnen zur Verfügung stehende Alternative — ganz im Unterschied zu ihren deutschen Kollegen. Das verweist einerseits darauf, daß © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
69
bestimmte in Deutschland früh vorhandene Auslöser und Antriebe der Angestelltenorganisation in USA lange fast ganz fehlten und erst in den dreißiger Jahren zum Teil nachgeholt wurden, so insbesondere die konsequente gewerkschaftliche Organisation der Arbeiterschaft und der zur kollektiven Organisation gesellschaftlicher Interessen geradezu zwingende staatliche Sozial- und Wirtschaftsinterventionismus; sie verweist auch auf die Tatsache, daß die lange vom Berufsprinzip beherrschte amerikanische Gewerkschaftsbewegung lange darauf verzichtete, Angestellte en masse zum Beitritt aufzufordern. Diese Entscheidung amerikanischer Angestellter gegen die Organisation auf sozialökonomischer Grundlage überhaupt, gegen die kollektive Vertretung wirtschaftlich-sozialer Interessen scheint darüber hinaus aber auch auf einen verbreiteten, letztlich am kapitalistischen Unternehmermodell orientierten, oft auch an die Bedingungen großer Organisationen modifizierend angepaßten, mit professionellen Einstellungen vereinbaren Individualismus dieser Arbeitnehmer, auf ihren individuellen Erfolgs-, Leistungs- und Karrierebegriff hinzuweisen, der wahrscheinlich bei den meisten deutschen Angestellten weniger ausgeprägt war. Grob ausgedrückt und die in Wahrheit graduellen Unterschiede vereinfachend: Während viele deutsche Angestellte durch ihr Gefühl der Zugehörigkeit zu einem besseren „Stand“ am Eintritt in die zudem fundamentaloppositionellen, als proletarisch und auch politisch als Gegengruppe definierten Arbeitergewerkschaften gehindert wurden (aber nicht an kollektiver Interessenorganisation überhaupt!), schreckten die meisten amerikanischen Angestellten auf Grund individuellen Leistungs- und Erfolgsstrebens vor dem Eintritt in jede Organisation zur kollektiven Durchsetzung ihrer sozial-Ökonomischen Interessen zurück. Unter Druck, Not, Depression und Enttäuschung konnte dieser berufliche Individualismus so erschüttert werden, daß — wie bei den geschilderten professionellen Minderheiten — die Sperren gegen den Eintritt in eine Teilorganisation der (zudem nicht ausgesprochen proletarischen, relativ gemäßigten, ökonomisch konzentrierten) Arbeiterbewegung zum Zwecke kollektiver Interessenvertretung möglich wurde. Wer sich dazu nicht durchrang — und das war die große Mehrheit — blieb jenem vereinzelnden, zu kollektiven Handlungen nicht prädisponierenden individuellen Selbstverständnis, nicht aber wie in Deutschland einem kollektive Aktionen und Proteste relativ leicht ermöglichenden, quasi ständischen oder am bürokratischen Modell orientierten, schichtspezifischen Angestelltenselbstverständnis verhaftet. Ein mittelständischer „dritter Weg“ zwischen allgemeiner Gewerkschaft und Nicht-Organisation stand diesem Denken nicht zur Verfügung.
Anmerkungen 1 Die folgende Untersuchung stützt sich auf einen Abschnitt meiner Habilitationsarbeit: Studien zur Sozialgeschichte amerikanischer Angestellter 1890 bis 1940, Münster
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Jürgen Kocka
70
1972, die ich in absehbarer Zeit zu veröffentlichen hoffe. Vgl. auch J . Kocka, Amerikanische Angestellte in Wirtschaftskrise und New Deal 1930 bis 1940. VfZ 20. 1972, 333—75, mit einer Diskussion des Forschungsstands, einiger methodischer Voraussetzungen und umgreifender Erkenntnisinteressen, in deren Zusammenhang auch die folgende Untersuchung gesehen werden kann. — Ihre Vorbereitung wurde durch ein Forschungsstipendium des American Council of Learned Societies und einen Forschungsaufenthalt im Charles Warren Center for Studies in American History (Harvard University) 1969/70 ermöglicht. 2 Beschäftigungsstand und Arbeitslosigkeit in den USA und Deutschland 1929 bis 1938:
(a) (c) (d) (b) Beschäftigte Geleistete Arbeitnehmer Arbeitsstunden (1929 = 100) (1929 = 100) USA
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
100,0 94,3 86,7 78,7 79,5 85,4 88,1 93,0 96,7 90,4
Dtl.
100,0 93,3 81,5 71,4 74,0 85,5 90,6 97,2 104,3 110,9
USA
100,0
— —
53,7 56,9 61,1 67,9 77,5 82,2 162,2
Dtl.
100,0 83,5 66,4 53,8 61,5 80,6 88,4 99,4 110,8 118,8
(0
(e)
(h)
(g)
Arbeitslosigkeit USA
Deutschland
in 1000
in %
in 1000
in %
1 550 4 340 8 020 12 060 12 830 11 340 10 610 9 030 7 700 10 390
3,2 8,7 15,9 23,6 24,9 21,7 20,1 16,9 14,3 19,0
1 899 3 076 4 520 5 576 4 804 2718 2 151 1 593 912 430
9,3 15,3 23,3 30,1 26,3 14,9 11,6 8,3 4,6 2,1
Quelle: Spalten a) und b): International Labour Office, Year-Book of Labour Statistics, Genf 1939, 24 f.; Spalten c) und d): ebd., 28 (nur Lohnempfänger); Spalten e) bis h): United Nations, Statistical Yearbook 1948, I, New York 1949, 84. — V g l auch: Labor Force, Employment and Unemployment 1929—1939, Estimating Methods, in: Monthly Labor Review 67. 1948, 50—53. 3 Vgl. G. Bry, Wages in Germany 1870—1945, Princeton 1960, 467 (1913 = 100): Reallöhne (Wochenverdienste) in den USA und Deutschland 1913—38 (1913 = 100)
1913 1929 1932 1935 1938
USA
Deutschland
100 132 112 132 142
100 110 94 103 114
4 Monthly Labor Review 38. 1934, 159; 42. 1936, 713. Zur Zahl und Gliederung der amerikanischen Angestellten: Kocka, Amerikanische Angestellte, 333 ff. 5 Arbeitslosenzahlen (1937) nach U. S. Bureau of Census, Census of Partial Employ-
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
71
ment, Final Report on Total and Partial Unemployment, U. S. Summary, Washington 1938, 5. Diese Ziffern umfassen die durch Öffentliche Notstandsarbeiten Beschäftigten, aber nicht die Teilbeschäftigten. Gesamtbeschäftigungszahlen von 1940 nach D. L. Kaplan u. N. C. Casey, Occupational Trends in the United States 1900 to 1950 (U. S. Bureau of the Census, Working Paper No. 5), Washington 1958, 6. 6 Zahlen errechnet aus S. Kuznets, National Income and Its Composition 1919 to 1938, New York 1941, 557, 597, 600, 643; Statistik d. Dt. Reichs 408. 1931, 110; Wirtschaft u. Statistik 19. 1939, 294 ff. Näheres zu Berechnung und Definitionen: Kocka, Amerikanische Angestellte, Anm. 3. 7 Vgl. die Einzelheiten bei National Industrial Conference Board, Salary and Wage Policy in the Depression, New York 1932. 8 Errechnet aus Kuznets, 576—604; Wirtschaft u. Statistik 19. 1939, 296, 299. Die amerikanischen Zahlen verstehen sich ausschließlich, die deutschen einschließlich Bauwesen und Bergbau. 9 Einige Belege in Kocka, Amerikanische Angestellte, Anm. 42 bis 46. Einführend: W. E. Leuchtenburg, F. D. Roosevelt and the New Deal, New York 1963; D. Wecter, The Age of the Great Depression 1929—1941, New York 1948. 10 Zu den Politikern des Protests: A. M. Schlesinger, Jr., The Age of Roosevelt, III (The Politics of Upheaval), Boston 1960, 15—207, und den Aufsatz von H. A. Winkler in diesem Band. Zur Gewerkschaftsgeschichte: I. Bernstein, Turbulent Years. A History of the American Worker 1933—1941, Boston 1970. — Von den nicht-landwirtschaftlichen Arbeitnehmern waren 1930 11,7, 1933 11,5, 1935 13,4, 1937 22,8 und 1939 28,9 % organisiert (U. S. Bureau of Census, Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1957, Washington 1960, 98). 1930 fanden 637 Arbeitsniederlegungen oder Aussperrungen statt, 1933: 1695, 1935: 2014, 1937: 4740, 1939: 2613 (ebd., 99). Zum „Second New Deal“: Schlesinger, Age of Roosevelt, III, 211—657; F. Freidel, in: A. L. Hamby, Hg., The New Deal, New York 1969, 11—32, bes. 25 ff.; Leuchtenburg, Roosevelt, 147—196. Zur sozialen Basis der Roosevelt-Koalition: S. Lubell, The Future of American Politics, New York 1951, 232—234; R. S. Kirkendall, The Dreat Depression, in: J . Braeman u. a. Hg., Change and Continuity in 20thcentury America, Columbus 1964, 167—174 (mit weiterer Literatur den sehr bescheidenen Forschungsstand referierend); W. F. Ogburn u. E. Hill, Income Classes and the Roosevelt Vote, Political Science Quarterly 50. 1935, 186—193. 11 Vgl. S. Fine, Sit-Down. The General Motors Strike of 1936—1937, Ann Arbor 1969; Bernstein, Turbulent Years, 519 ff.; sowie den Aufsatz von P. Lösche in diesem Band. Zur Gewerkschaftsgeschichte: J . MacGregor Burns, Roosevelt: The Lion and The Fox, New York 1956, 291—478 zur New Deal-Geschichte ab 1937; eine ausführliche Übersicht über die meist zahlenmäßig unbedeutenden, aber lautstarken faschistischen oder faschistoiden Randgruppen bei D. S. Strong, Organized Anti-Semitism in America, Washington 1941; zuletzt S. M. Lipset u. E. Raab, The Politics of Unreason, RightWing Extremism in America, 1790—1970, New York 1970, 150—208. Zum wachsenden Einfluß der Kommunisten im CIO: I. Howe u. L. Coser, The American Communist Party, Boston 1957, bes. 368—386; J . G. Rayback, A History of American Labor, New York [1959] 21966, 366 f.; D. R. McCoy, Angry Voices, Left-of-Center Politics in the New Deal Era, Lawrence, Kansas 1958. 12 Vgl. Kirkendall, 170; Lubell, Future, 51 ff.; Burns, 442—455. 13 Vgl. dazu Kocka, Amerikanische Angestellte, Abschnitt IV. 14 Ein ausführliche Analyse dieses Verbandes in meiner Habilitationsschrift (oben Anm. 1). Vgl. auch G. C. Kirstein, Stores and Unions. A Study of the Growth of Unionism in Dry Goods and Department Stores, New York 1950. 15 Vgl. The Retail Clerks' International Advocate (i. d. F. zit. als: Advocate), Sept./ Okt. 1930, 15: „All is Not Quiet on the Western and Southern Fronts“; Nov./Dez. 1930, 1—3: „Danger Ahead!“; Jan./Febr. 1931, 1—4: „Take it or leave it“ sei die © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
71
Jürgen Kocka
Haltung vieler Unternehmer, wenn sie Lohnsenkungen anordneten. März/April 1931, 1 ff.: Beginn eines Boykotts gegen einen Filialbetrieb in Casper (Wyoming) unter Mithilfe der dortigen Arbeitergewerkschaften. — März/Juni 1931, 7: „There is No Dead Line at Forty for Live Ones“. 16 Advocate, Nov./Dez. 1931, 1—4: „Though Shalt Not-Organize!“. — März/ April 1932, 1—3: „Retail Salespeople Unite!“. — S. 12: „What Does the Future Hold?“ — Sept./Okt. 1932, 3: „We are aware of the opposition that will meet our efforts, but we also know that ,constant dropping wears away the stone' and that there is a psychological moment when the tide of the battle turns and victory is won; so we are going to be on the job, standing right back of these employees when they are sufficiently fed up with their present conditions to take their places where they belong, in the ranks of the other organized wage earners.“ 17 Die Mitgliedschaft der AFL war von 4,1 Millionen (1920) auf 2,1 Millionen (1933) gefallen (U. S. Bureau of Census, Historical Statistics, 97). Allgemein zur Gewerkschafts- und Arbeitergeschichte 1929—1932: I. Bernstein, The Lean Years. A History of the American Worker 1920—1933 (1960), Baltimore 1966, 245—513, bes. 334—366, 416 ff. 18 Vgl. Bernstein, Turbulent Years, 19—36, zur Entstehung der NRA-Gesetzgebung und den Interessen dahinter; 318—351 zur Entstehung des Wagner Act; R. W. Fleming, The Significance of the Wagner Act, in: M. Derber u. E. Young, Hg., Labor and the New Deal, Madison 1957, 121—155; zum Zusammenhang zwischen Kriegswirtschaftslenkung und New Deal: W. E. Leuchtenburg, The New Deal and the Analogue of War, in: Braeman u.a., 81—143; am besten zur NRA und ihren Kritikern: Ε. Ε. Hawley, The New Deal and the Problem of Monopoly, Princeton 1966; sowie seinen Aufsatz in diesem Band. Zur Stellungnahme der RCI PA gegenüber der NRA: Advocate, Juli/Aug. 1933, 1—4; Nov./Dez., 2, zur Section 7 (a): „We predict that this act of emancipation will go down in history as marking the doom of industrial tyranny in the United States.“ 19 Dies geht hervor aus Advocate, Sept./Okt. 1933, 1; zur Gründung von 24 neuen Ortsgruppen innerhalb von zwei Monaten vgl. ebd., Jan./Febr. 1934, 18. 20 Abgedruckt in Advocate, Nov./Dez. 1933, 1—5; Jan./Febr. 1934, 14. 21 Nach Advocate, Nov./Dez. 1933, 4. 22 Vgl. H. Baker, Personnel Programs in Department Stores, Princeton 1935, 44. 23 Die Warnungen der RCIPA-Führung an die Verkäufer vor der Annahme, daß nun nach der NRA die Regierung für das Nötigste sorgen werde und man deshalb eine Gewerkschaft nicht brauche, waren häufig. Vgl. Advocate, Juli/Aug. 1933, 3, 15; Nov./ Dez. 1933, 1, 2, 4; Jan./Febr. 1934, 1 f. über die Entlassung von Gewerkschaftsmitgliedern und die Gründung einer Management-gestützten „gelben“ Organisation bei Montgomery Ward & Co. in Denver, Colorado; Mai/Juni 1934, 1, zur Managementgeleiteten Gründung von „company unions“ in verschiedenen Kaufhäusern als Mittel, die AFL herauszuhalten: über einen erfolglosen Streik Dez./Jan. 1934/35 gegen den „Boston Store“ in Milwaukee vgl. White-Collar Strike, The Nation, New York 9 . 1 . 1935, 49 f. und Advocate, Jan./Febr. 1935, 1—10. Zum Streit der RCIPA mit der Fleischergewerkschaft über Einflußsphären vgl. RCIPA, 18th Convention (1939), Proceedings, 42. 24 Vgl. die Studie der „Boston University School of Theology“, zit. in: Advocate, Nov./Dez. 1931, 1 f. 25 Vgl. Advocate, Sept./Okt. 1932, 1 f.: „Chain Store Managers Rebel“; Nov./Dez. 1932, 3. 26 Dies ergab eine Umfrage 1935: Baker, Personnel Programs, 44. Bestätigend: Advocate, Nov./Dez. 1933, 4, mit der Aufforderung zum Eintritt in die Gewerkschaft; 15: „Registered Men Organizing“ (über die Unzufriedenheit der „professionellen“, ebenfalls aus der NRA ausgeklammerten Pharmazieangestellten). © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
73
27 St. Louis AFL Retail Stores Employees Union, 20 Years of Progress, 1934—1954 (Local Union 655), ο. Ο., ο. Τ., 6. 28 Zum Kampf der „Managers and Clerks Union“ zusammen mit den „Teamsters“, den „Meat Cutters“, den „Warehousemen“, den „Auto Mechanics“ und der „Typo graphical Union“ gegen „A & P“ in Cleveland, Ohio, 1934, vgl. Advocate, Nov./Dez. 1934, 1—3. — St. Louis AFL Retail Stores Employees Union, 20 Years, 7, zur entschei denden Rolle der „Store Managers“ bei der Gründung dieser RCIPA-Ortsgruppe, die in direkter Kooperation mit dem „St. Louis Central Trades and Labor Council“ stand. 29 Vgl. ebd., 8, zur Karriere von Vernon A. Housewright, der als „Store Manager“ diese erste Ortsgruppe mitgründete und schließlich (1947) Präsident des Gesamtverbands wurde. Sein Nachfolger in der Leitung der Ortsgruppe in St. Louis, Renschen, der 1946 Vorsitzender der St. Louis Central Trade and Labor Union wurde, war ebenfalls ursprünglich „Store Manager“. 30 Vgl. ebd., 9. 31 Ein Beispiel unter vielen: Advocate, Okt./1921, 11: „Minimum Wage Laws Afford No Security“; zur allgemeinen AFL-Politik vgl. Elizabeth Brandeis, Protective Legislation, in: Derber/Young, 202 ff., 221 ff. Noch 1933 trat die AFL gegen Mindestlohngesetze auf, akzeptierte dann aber die Mindestlohnparagraphen in der NRA-Gesetzgebung (ohne viel Begeisterung). Es ist hier nicht zu behandeln, daß die AFL als Organisation vor allem gelernter Berufe schon deshalb wenig Interesse an Mindestlohngesetzen haben konnte, weil diese vor allem den schlecht bezahlten Ungelernten zugute kamen. 1937/38 bekämpfte die AFL immer noch ein Mindestlohngesetz, nun ganz klar in Verletzung der Interessen der ungelernten Massen. 32 Zur Enttäuschung über Arbeitszeitverlängerungen und Lohnsenkungen nach dem Fall der NRA vgl. die Beispiele in Advocate, Juli/Aug. 1935, 1—5 („,ChiseIers' Quick to Take Advantage. End of NRA Leaves Unorganized Clerks Subject to Wage Cuts and Increased Hours“); Sept./Okt. 1935, 1—3: „Increased Hours For Sales Clerks“. 33 Dieser Zusammenhang zwischen Beendigung der NRA, Unruhe unter den Unund Angelernten und gewerkschaftlicher Organisation außerhalb der AFL wird von der Entwicklung im Einzelhandel nahegelegt und müßte an anderen Industrien überprüft werden. 34 Zustimmung verdient insofern D. Brody, Labor and the Great Depression (unveröff. Ms. für die AHA-Tagung in Boston, Dez. 1970); Brody bestätigt letztlich S. Perlman, Labor and the New Deal in Historical Perspective, in: Milton/Derber, 363—370; im selben Band 45—76 als Zusammenfassung der wichtigsten Daten: Young, The Split in the Labor Movement. Ausführlich und unanalytisch: W. Galenson, The CIO Challenge to the AFL, Cambridge/Mass. 1960; Bernstein, Turbulent Years, 353 ff. (684 f. zu einer Liste der CIO-Gewerkschaften Oktober 1937 und 771 ff. zur erfolgreichen Abwehr der CIO-Herausforderung durch eine sich anpassend-verändernde AFL): M. M. Kampelmann, The Communist Party vs. the CIO, New York 1957; P. Lösche in diesem Band. Jüngere „revisionistische“ Historiker betonen ebenfalls die Kontinuität der amerikanischen Arbeiterbewegung durch die 1930er Jahre. Vgl. z.B. R. Radosh, The Corporate Ideology of American Labor Leaders from Gompers to Hillmann, in: J . Weinstein u. D. W. Eakins, Hg., For a New America. New York 1970, 125—152. Für Radosh war es das Ziel und die Politik der amerikanischen Arbeiterführer seit dem Ersten Weltkrieg, die Gewerkschaften in das System des Organisierten Kapitalismus zu integrieren. Jedoch unterscheidet Radosh zu wenig zwischen langfristiger Funktion der gewerkschaftlichen Politik und Wünschen, Absichten, bzw. Zielen der Gewerkschaftsführer; er unterschätzt bzw. unterschlägt den doch äußerst scharfen Widerstand der meisten Unternehmer gegen das gewerkschaftliche Vordringen, das mithin nur schwer als bewußt gehandhabtes, kapitalistisches Integrationsinstrument zu beschreiben ist; er unterschätzt vor allem, daß Machtzuwachs und Integration der Gewerkschaften zugleich Veränderung des Kapitalismus bedeuteten und verfehlt damit die Dialektik von
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
74
Jürgen Kocka
integrativer Status-quo-Erhaltung und sich anpassender Veränderung, die letztlich für jede Reform (mit wechselnden Gewichten allerdings) kennzeichnend ist. 35 Ab 1940 hieß sie „United Retail, Wholesale and Department Store Employees of America“. Zahlen nach L. Troy, Trade Union Membership, 1897—1962 ( = National Bureau of Economic Research, Occasional Paper, no. 92), New York 1965, A—5, A —22; Troys Zahlen errechnet nach den Beitragszahlungen (zur Methode: ebd., 10 bis 17). Zur Geschichte der Spaltung: Kirstein, Stores, 55—62. 36 Vgl. URWEA, 2nd Biennial Convention (1939), Proceedings, 8—10; Kirstein, Stores, 56—60; es ist schwer, die wirklichen Ursachen zu erkennen, da die Auseinandersetzung mit sehr persönlichen Argumenten (Vorwurf der Korruption und Kriminalität) und allgemeiner Rhetorik ausgetragen wurde. 37 So URWEA, 2nd Convention (1939), Proceedings, 9 f.; Kirstein, Stores, 56, übernimmt das Argument meines Erachtens unkritisch; vgl. auch: White Collar on Their Way, in: Business Week, 19. Aug. 1939, 30, zu AFL- und CIO-Bemühungen um die Kaufhausbelegschaften. 38 Beispiele für solche Unternehmertaktik: Advocate, Nov./Dez. 1931, 3: „These companies make much of the fact that their buildings are erected and equipped by union labor, that they hire union truck drivers; this, they claim should entitle them the right to hire non-union salespeople, and they get by with it where the union men and women fail to press a demand for union stores throughout.“ Ähnlich Sept./Okt. 1936, 3. 39 Vgl. z.B. die Gründung der Ortsgruppe in St. Louis im Mai 1934. Sic organisierte „salespeople and allied workers in their industry“, 1935 wurden die Lagerarbeiter aufgenommen (St. Louis AFL Retail Store Employees Union, 20 Years, 7, 8); allerdings konnte das zu Konflikten mit stärkeren Berufsverbänden führen. Vgl. RCIPA, 18th Convention (1939), Proceedings, 42. 40 URWEA, Constitution 1939, Art. Ill, Section 1. 41 RCIPA, Constitution, 1939, Section 6 (a). 42 Die URWEA begründete diese Einbeziehung des Großhandels damit, daß im Falle von Streiks Groß- und Kleinhandel eng miteinander zusammenhängen. Vgl. 2nd Convention (1939), Proceedings, 59. 43 Häufig formten die URWEA- und RCIPA-Werber bei der Neugründung von Ortsgruppen zunächst einen Kern aus organisationsbereiten Lagerarbeitern, Packern, Restaurantarbeitern und Lkw-Fahrern, die dann den ersten Durchbruch gegen Unternehmerwiderstand schafften, wonach sich das Verkaufspersonal leichter anschloß. Nach: Business Week, 19. Aug. 1933, 33. 44 Vgl. Troy, Trade Union Membership, A-8, A-18, A-22, A-26 und 10—20. 45 Zur allgemeinen Entwicklung: Bernstein, Turbulent Years, 771 ff. 46 Vgl. U. S. Bureau of Census, Historical Statistics, 99 (1935: 2014, 1936: 2172, 1937: 4740, 1938: 2772, 1939: 2613). 47 Vgl. S. Lens, Left, Right, and Center. Conflicting Forces in American Labor, Hinsdale, Ill. 1949, 304; Fine, Sit-Down. 48 Vgl. die Beschreibungen in Kirstein, Stores, 63—74. 49 Vgl. Advocate, März/April 1937, 1 ff.: Beschreibung von fünf Kaufhausstreiks, die zu Redaktionsschluß stattfanden. RCIPA, 18th Convention (1939), Proceedings, 36 f., zur Ausdehnung des neu geschaffenen Streikfonds; 43 zu Kämpfen gegen Kettenläden; Harry A. Millis, How Collective Bargaining Works, New York 1942, 941, zum AFL-geleiteten, erfolgreichen 55-Tage-Streik im Herbst 1938 in San Francisco gegen einen Arbeitgeber-Verband („Retailers' Council“) mit 43 Kaufhäusern und vielen anderen Geschäften. 50 Vgl. Advocate, März/April 1937, 2 f.: Abdruck von Streikforderungen; URWEA, 2nd Convention (1939), Proceedings, 56 ff.: Bericht von Präsident Wolchok; National Industrial Conference Board, Unions of White Collar Employees, New York 1943, 5. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
75
Zur Erläuterung der Begriffe „closed shops“ und „union shops“ vgl. den Beitrag von Peter Lösche in diesem Band. 51 95 000 gewerkschaftlich Organisierten (darunter einige wenige Großhandelsangestellte und -arbciter) standen 4,47 Millionen Arbeitnehmer im Detailhandel gegenüber. Vgl. U. S. Bureau of Census, Historical Statistics, 520; St. Lebergott, Manpower in Economic Growth, New York 1964, 518. 52 Zur „A & P“: URWEA, 2nd Convention (1939), Proceedings, 63; Advocate, Juli/Aug. 1938, 1 ff.; März/April 1939, 12, zu begrenzten RCIPA-Erfolgen u. a. gegen „Α & Ρ“ in Wisconsin und Georgia. 53 Vgl. RCI PA, 18th Convention (1939), Proceedings, 9, 10; 80; 14 ff. zum Auftritt des AFL-Vorsitzenden Green; URWEA, 2nd Convention (1939), Proceedings, 48 ff.: CIO-Vizepräsident Dalrymple (United Rubber Workers) begründete die Solidarität seiner Gewerkschaft mit den Verkäufern u. a. damit, daß sich auch die Unternehmer lokal über Wirtschaftszweiggrenzen hinweg zusammenschlössen. — RCIPA-Constitution, 1939, bes. Punkt (d) der Präambel. 54 Vgl. URWEA, 2nd Convention (1939), Proceedings, 52 ff., 58. 55 Vgl. ebd., 7—12, 30 f., 33, 41, 52 f., 66, 92, 80 f. Der einzige schwarze Delegierte — schwarze Mitgliedschaft in den Ortsgruppen sei, so wurde erwähnt, häufiger — sprach für Rassensolidarität. 56 Die Quellen erlauben keine systematische Analyse der Mitgliedschaften. Die obigen Aussagen stützen sich auf die Liste der Delegierten ebd., 15 ff. und beiläufige Berufserwähnungen in den Debatten; sowie National Industrial Conference Board, Unions of White Collar Employees, 5. Vgl. allgemein zur URWEA: B. Stolberg, The Story of the C. Ι. Ο., New York 1938, 261—264. 57 Gemeint sind vor allem folgende Verbände (in Klammern die Mitgliederzahlen 1935 [CIO: 1937] und 1939): AFL: National Association of Letter Carriers (54 100, 65 400), National Federation of Post Office Clerks (31 900, 43 700), Brotherhood of Railway and Steamship Clerks . . . (72 500, 91 000), American Federation of State, County and Municipal Employees (gegr. 1937, 1939: 27 000), Order of Railroad Telegraphers (35 000, 44 000), Commercial Telegraphers' Union (2000, 3500); CIO: American Communications Association (4200, 6000), State, County and Municipal Workers of America (5800, 5800); unabhängig; National Federation of Federal Employees (56 000, 64 600); United National Association of Post Office Clerks of the United States (30 000, 34 500), National Association of Postal Supervisors (6500, 8800), National Association of Postmasters of the United States (15 200, 18 000), Order of Railway Conductors of America (33 800, 33 000). — Zahlen nach Troy, Trade Union Membership. — Vgl. Κ. Baarslag, History of the National Federation of Post Office Clerks, Washington 1945; H. Henig, The Brotherhood of Railway Clerks, New York 1937; A. M. McIsaac, The Order of Railroad Telegraphers, Princeton 1933; J . Barbash, Unions and Telephones, New York 1952; V. Ulriksson, The Telegraphers, Washington 1953; N. Denton, History of the Brotherhood of Railway and Steamship Clerks, Freight Handlers, Express and Station Employees, Cincinnati, Ohio 1965; H. Hollan der, Quest for Excellence, Washington 1968 (über die National Federation of Federal Employees); L. Kramer, Labor's Paradox. The American Federation of State, County, and Municipal Employees, AFL-CIO, New York 1962; „The American Federation of Government Employees“ (AFL-CIO-Bibliothek Washington, Labor History-International Unions, File: Government Employees); National Association of Letter Carriers (AFL-CIO), Seminar Booklet (ca. 1960) (AFL/CIO-Bibliothek Washington, Labor History-International Unions); F. B. Powers, Fifty Years of Union History. An Article About the Commercial Telegraphers Union, in: The American Federationist, Juli 1952, 22—24. — Als gegenwartsbezogene Übersicht über das Thema: E. M. Kassalow, WhiteCollar Unionism in the United States, in: A. Sturmthal, Hg., White-Collar Trade Unions: Contemporary Developments in Industrial Societies, Urbana 1966, 305—364; © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
76
Jürgen Kocka
eine allgemeine Bestätigung unserer These bei: C. Wright Mills, White Collar (1951), London 1956, 316 f. 57a Unter professionellen Verbänden sind Berufs- bzw. Fachverbände zu verstehen, wie sie am frühesten von den „professions“ der Ärzte und Rechtsanwälte, dann auch von denen der Lehrer, Ingenieure und vielen anderen Berufsgruppen gebildet worden sind. Zur Umschreibung des schwer ins Deutsche übersetzbaren angelsächsischen Begriffs: H. A. Hesse, Berufe im Wandel. Ein Beitrag zum Problem der Professionalisierung, Stuttgart 1968, 45 f., 49, 68 f.; eine Aufzählung der „professions“ in England und USA ebd., 40—42. 58 Nach WPA [Works Progress Administration], Government Aid During the Depression to Professional, Technical and Other Service Workers, Washington 1936, 3. 59 Vgl. L. F. Bollens, White Collar or Noose? The Occupation of Millions, New York 1947, 184 f. 60 Vgl. Factory and Industrial Management 83 (New York 1932), 17 f.: „Gone are the Good Old Days“: empfiehlt Abbau des „overhead“ durch Umwandlung von Büroangestelltengehältern in leistungs- und kostenbezogene variable Bezahlung; 198 bis 199: „If Fixed Salaried Were Not Fixed“ (Plädoyer für größere Marktbezogenheit von Angestelltenbezahlung); 459 f.: „Down with Overhead“. 61 Vgl. R. K. Burns, The Comparative Economic Position of Manual and White Collar Employees, Journal of Business 27. 1954, 260 f. 62 Vgl. National Industrial Conference Board, Effect of the Depression on Industrial Relations Programs, New York 1934, 3, 4, 6; ders., What Employers Are Doing For Employees, New York 1936. 63 Dazu Belege und Berechnungen in meiner Habilitationsarbeit (s. oben Anm. 1). 64 Als knappe Übersichten: B. Mitchell, Depression Decade, New York 1969, 228 to 313; Μ. Derber, The American I dea of I ndustrial Democracy 1865—1965, Urbana 1970, 302—307. 65 Damit stellte sich das Problem der Abgrenzung im Einzelnen, das durch die Praxis der Unternehmer und die Rechtsprechung nur allmählich geklärt wurde. Das TaftHartley-Gesetz von 1947 zog die Konsequenz aus diesem Klärungsprozeß und definierte in Titel I, Section 2 (12) den „professional employee“. Zit. u. a. bei N. S. Falcone, Labor Laws, New York 1962, S. 424. 66 Vgl. H. J . Laski, The Decline of the Professions, Harper's Monthly Magazine, November 1935, 676—685; zu den Ingenieur-Verbänden, die ihre früheren sozialreformerischen Ansätze weitgehend aufgegeben hatten und sich zunehmend antigewerkschaftlich, anti-sozialstaatlich und New-Deal-kritisch äußerten: E. L. Brown, The Professional Engineer, New York 1936, 40—59; E. T. Layton, Jr., The Revolt of the Engineers. Social Responsibility and the American Engineering Profession, Cleveland/London 1971, 225—242. 67 Dies auf der Basis der maschinenschriftlich vervielfältigten Jahrestagungsberichte der Organisation von 1932, 1937 und 1938 in der AFL-CIO-Bibliothek in Washington; sowie: International Federation of Technical Engineers, Architects, and Draftsmen's Unions, Silver Anniversary, 1918—1943, [Washington] 1943. 68 Vgl. ebd., 24, zur Gründung einer New Yorker Techniker-Organisation, die als „Architectural and Engineering Guild“ 1933 zum Zweck der Beeinflussung der NRAGesetzgebung entstand und erst 1937 der AFL-Technikergewerkschaft beitrat. 69 Nach Handbook of American Trade Unions, 1936 Edition, 291 f.; Labor Research Association, Labor Fact Book III, New York 1936, 116; Sidney Hill, Technicians in Revolt, in: New Masses, 12, 4. Sept. 1934, 16—18; Stolberg, The Story of the CIO, 264 f. 70 Unions for Technicians, in: The New Republic, 24. Jan. 1934, 195—196; auch S. Hill, Technicians in Revolt, 17. 71 Vgl. National Industrial Conference Board, Unions of White Collar Employees, © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
77
New York 1943, 6: Psychologisch seien die Techniker und Ingenieure von Gewerkschaften schwer zu erreichen, „owing to their proximity to management and their feeling of professional standing“. 72 Minutes of the Third Annual Convention of the Federation of Architects, Engineers, Chemists, and Technicians (CIO), Detroit 1937, 11 f., 20 f. 73 Ebd., 2, 8, 9, 22. 74 Vgl. International Federation . . . (AFL), Synoptic Report of Proceedings . . . (1937) 32 (AFL-CIO-Bibliothek Washington). Die Gründe bleiben unklar. Möglicherweise spielte auch eine Rolle, daß die „Federation“ bereits den Ruf einer kommunistisch geleiteten Gewerkschaft hatte. Vgl. Stolberg, The Story of the CIO, 264. 75 Vgl. die Diskussion in: United Office and Professional Workers of America (UOPWA), 2nd Convention, Proceedings, Washington 1938, 40 f. 76 Wir stützen uns, auch im folgenden, auf Minutes of the Third Annual Convention of the Federation of Architects, Engineers, Chemists and Technicians (CIO), Detroit 1937 (als einziges Protokoll aus jenen Jahren maschinenschriftl. vervielf. und in der AFL-CIO-Bibliothek, Washington vorhanden). 77 Nach Troy, Trade Union Membership, A-20. 78 Vgl. Stolberg, The Story of the CIO, 264; Directory of Labor Unions in the United States (= Bureau of Labor Statistics, Bull., No. 1127), Washington 1953, 5; und maschinenschriftl. Notiz vom 9. 5. 1957 in: File „History of Organizations“ (AFLCIO-Bibliothek Washington). 79 Directory of National and International Labor Unions in the United States, 155 (= Bureau of Labor Statistics, Bull., No. 1185), Washington 1955, 30. — 1953 hieß der Verband vorübergehend: „International Federation of Technical Engineers, Architects and Draftsmen“. 80 Im Frühjahr 1938 traten z. Β. 2000 Mitglieder der in der mittelwestlichen Auto industrie basierenden „Society of Designing Engineers“ in die „Federation“ ein. Vgl. Stolberg, The Story of the CIO, 265. 81 Vgl. National Labor Relations Board, Division of Economic Research, Collec tive Bargaining in the Newspaper I ndustry, Washington 1939, bes. 104—140; sehr informativ zur Frühgeschichte: D. J . Leab, Α Union of I ndividuals. The Formation of the American Newspaper Guild, 1933—1936, New York 1970; ders., Toward Unioni zation, in: Labor History, 11. 1970, 3—22; B. Minton u. J . Stuart, Hg., Men Who Lead Labor, New York 1937, 115—142 über Heywood Brown, den Gründer und Führer der „Newspaper Guild“; Stolberg, The Story of the CIO, 245—256; Bernstein, Turbulent Years, 127—137; Kampelman, The Communist Party vs. the CIO, 18 f., 32, 42, 43, 46, 47, 112, 118, 201; zur Gründung der „American Editorial Association“ (AFL): The Story of a Newspaper Union, in: The American Federationist, Nov. 1940, 11; Mitgliederzahlen nach Troy, Trade Union Membership, A-6, A-22. 82 Air Line Pilots Association International, News and Progress Bull., 1, no. 3 (Jan. 1932), 3 f.: Leitartikel des Vorsitzenden Behncke. 83 Vgl. The Alpa Story. Α Study of the History, Purposes, Functions and Organi zation of the Air Line Pilots Association I nternational (AFL-CI O), by the ALPA Public Relations Department, o. O. 2. Aufl. [1957] 1966, bes. 1 f., 16. Der Verband zählte 1935 700, 1939 1000 Mitglieder. Nach Troy, Trade Union Membership, A-1. 84 Die American Federation of Teachers (AFL) zählte 1929 4200, 1932 7000, 1935 13 700 und 1939 32 010 Mitglieder; die Musikergewerkschaft (AFL) hatte 1929 bis 1934 100 000, 1939 127 000 Mitglieder. Die Schauspieler- und Künstlergewerkschaft in der AFL hatte 1935 43 000, 1939 20 100 Mitglieder. Nach L. Wolman, Ebb and Flow in Trade Unionism, New York 1936, 189; Troy, Trade Union Membership, A-6, A-9. Zu den Lehrern: American Federation of Teachers, Organizing the Teaching Profession, Glencoe, Ill. 1955; Th. D. Martin, Building a Teaching Profession. A Century of Progress 1857—1957, Middletown, N. Y. 1957; zu den Musikern: R. D. Leiter, The © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
78
Jürgen Kocka
Musicians and Petrillo, New York 1953; vgl. auch: Μ. Ross, Stars and Strikes: Unioni zation of Hollywood, New York 1941. 85 Vgl. S. Perlman, Eine Theorie der Gewerkschaftsbewegung (amerikan. Original 1928, 2. Aufl. 1949), Berlin o. J . , 109—180; ders., Labor and the New Deal in Histori cal Perspective, in: M. Derber u. E. Young Hg., Labor and the New Deal, Madison 1957, 361—370. 86 Vgl. F. G. Nichols, A New Conception of Office Practice, Cambridge/Mass. 1927, bes. 42—47; G. L. Coyle, Present Trends in the Clerical Occupations, New York 1928, bes. 17 ff. 87 Vgl. UOPWA, 2nd Convention (1939), Proceedings 7; J . H. Clermont, Organiz ing the I nsurance Workers, Washington, 1966, 4—8; Stolberg, The Story of the CI O, 257 f. 88 1937 soll allein die New Yorker „Bookkeepers', Stenographers', and Accoun tants' Union“ 2500 Mitglieder gezählt haben; dazu und zum Austritt aus der AFL, der hindernde Trägheit im Angestelltenbereich vorgeworfen wurde: Clermont, Organizing the Insurance Workers, 8—12. 89 Vgl. UOPWA, 3rd Convention (1940) Proceedings, 3: „Events forecast a period of extreme difficulty for white collar workers, whose status in society and whose normal way of life was ruptured, first by the last war, and then by the 1929 crash.“ — 7: „White collar workers' status in society compared to their own past standards as well as compared to other sections of the population is steadily becoming worse.“ 90 Vgl. UOPWA, 2nd Convention, Proceedings, 6 f.; National Industrial Conference Board, Unions for White Collar Employees, New York 1943, 3. 91 Vgl. UOPWA, 2nd Convention, Proceedings, 18, 51; dies., 3rd Convention, 5: Angestellte hätten „unfamiliarity with common action“ und „profound belief in their ability to solve their basic economic problems individually and upon a personal basis“. 92 Einschränkungen des UOPWA-Einzugsgebiets wurden zugunsten der selbständigen CIO-Technikergewerkschaft, zugunsten der CIO-Gewerkschaften im öffentlichen Bereich und ansatzweise zugunsten der ClO-Industrieverbände vorgenommen. Vgl. Art. 1 (Sec. 2) der UOPWA-Verfassung von 1942: „The UOPWA shall have jurisdiction over all employees in offices and with offices as headquarters in those industries in which such employees predominate and also in those industries where they form a minority of the employees but are not organized by the industrial unions existing in the industries in which they are employed. The primary jurisdiction of the UOPWA shall be all employees in the graphic arts and related fields, all financial institutions (including insurance companies), and all non-profit institutions such as the social service agencies.“ 93 Nach Troy, Trade Union Membership (A-22 und A-7) hatte die UOPWA 1937 8700, 1939 13 800, 1941 13 000, 1943 22 200, 1945 31 500 und 1948 50 800 Mitglieder. Die erst 1944 selbständige AFL-Parallelorganisation hatte 1945 13 600 und 1948 26 200 Mitglieder. 94 Diese verschiedenen Kategorien wurden meist in ein und denselben Ortsgruppen zusammengefaßt. 1939 bestanden 36 „gemischte“ Ortsgruppen (incl. verschiedenste Angestelltenkategorien), 28 Ortsgruppen für Versicherungsangestellte, 2 für Verlagsangestellte, 1 für Reklameleute, 1 für Künstler, 1 für kaufmännische Vertreter. Nach UOPWA, 2nd Convention, Proceedings, 16. 95 Vgl. ebd., 14 f.: Faschismuskritik; 54 f.: Unterstützung der allgemeinen CIOSozialgesetzgebungsarbeit; 59: erwägt spezielle Anstrengungen, schwarze Angestellte zu organisieren; 65 f.: wird als erste amerikanische Organisation Mitglied der „International Federation of Commercial Clerical and Technical Employees“ (Amsterdam); 73; Unterstützung für Roosevelt und den New Deal. UOPWA, 3rd Convention, Proceedings, 3 ff.: scharfe Kritik am sozialpolitisch zunehmend nachlassendenn New Deal; Kriegsabenteuer seien geeignet, um von der inneren Misere abzulenken; 246 ff., © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Organisationen amerikanischer Angestellter
79
254: gegen Wiederwahl Roosevelts, für John L. Lewis und „Labor's Non-PartisanLeague“; 250: scharfer Angriff auf Wall Street und Großkapital; 261: wehrt sich gegen Vorwurf, kommunistisch zu sein; 271 f. für ein Bundesgesetz gegen das Lynchen; 272 für Aufnahme von Flüchtlingen aus faschistischen Ländern; 273 gegen Antisemitismus. Vgl. Bernstein, Turbulent Years, 714 zu Bergarbeiterführer Lewis und seine Attacke gegen Roosevelt 1940, die ihn von der Mehrheit des CIO isolierte, ihm aber Applaus von den Kommunisten eintrug. Vgl. Clermont, Organizing the Insurance Workers, 9—138 zur UOPWA auf dem Versicherungssektor bis zum Ausschluß aus der CIO; zur kommunistischen Orientierung von Merrill: Kampelman, The Communist Party vs. the CIO, 96—100. 96 Das Folgende auf der Basis von zum Teil gedrucktem, zum Teil maschinenschriftl. Informationsmaterial, das ich von der Central Library, Westinghouse Electric Corporation mit Brief vom 4. Dez. 1970 erhielt; und auf der Basis von Bollens, White Collar or Noose; Bollens war der erste Präsident der „Association of Westinghouse Salaried Employees“ und der daraus hervorgehenden FWISU und der „National Federation of Salaried Unions“. 97 Welche andere Angestelltenverbände auf Unternehmensebene beitraten, muß offen bleiben. Seit 1937 bestand aber z. B. eine „New Jersey Esso Employees Association (clerical)“ mit 500 Mitgliedern. Vgl. Troy, Trade Union Membership A-32, A-33, A-41, auch zur „National Federation“. Zu deren Gründung: Bollens, White Collar, 212 ff.; N. F. S. U. Expands, Business Week 19. 5. 1945, 106—107. 98 So etwa längere Ferien; den Anspruch der bei Arbeiterstreiks ihre Arbeit einbüßenden Werkstattangestellten auf Gehaltsfortzahlung trotz Nicht-Arbeit für 10 Wochen; die Befreiung gehobener Angestellter von bestimmten Zeukontrollen und sonst gültigen Zwängen wie Benutzung bestimmter Eingänge, genaue Festlegung der Essenszeiten usw.; etwas höhere Meilengelder für Angestellte, die im eigenen Pkw zur Arbeit kamen, etc. — Aufstellung dieser und ähnlicher Erfolge bei Bollens, White Collar, 126—131. 99 Ebd., 78 (Artikel 2 der Verfassung der FWISU). 100 Nach Burns, The Comparative Economic Position, 260 f. (dort auch genauere Definition der Kategorien): Durchschnittliche Wochenverdienste (in Dollar) Jahr 1929 1933 1937 1939 1944 1946 1949 1952
Arbeiter 27,14 18,59 25,25 25,44 45,27 45,83 56,75 69,24
Angestellte 34,78 29,42 32,57 33,04 43,63 49,14 57,57 66,63
101 Vgl. dazu ausführlich: Bollens, White Collar, 2—11, 184—212; aber auch UOPWA, Push Salaries Up!, New York, 2. Aufl. 1944; Lewis Merrill, A Salary Policy to Win the War, o. J . (UOPWA) Sept. 1943, 3 f.; ders., The White Collar Worker and the Future of the Nation (= Testimony before the Senate Sub-Committee on Wartime Health and Education, 2 5 . - 2 9 . Tan. 1944), 6, 20. 102 Merrill, The White Collar Workers and the Future of the Nation, 6 f., 17; ders., A Salary Policy, 3 f. 103 Bollens, White Collar, 13, 101, 181, 193, 204, 210. 104 Ebd., 36 f.; allerdings 44 f.: Ablehnung jeder Form von „Radikalismus“. 105 Ebd., 28 ff.; gegen Ende des Krieges allerdings gegen höhere Steuern (195).
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
80
Jürgen Kocka
106 „Equity“, „justice“, „equality“ forderte sie, wies auf die „Diskriminierung“ der Angestellten hin, auf ihre quasi undemokratische Benachteiligung als „orphans of labor“ (ebd., 14, 202, 213). 107 Die Zahlen sind errechnet nach: Bry, Wages in Germany 1871—1945, 28 u. 34 (der auf amtlichen deutschen Statistiken fußt); Geschäftsbericht des Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes 1950/51, Köln 1952, 733. 108 Wir schließen uns der Schätzung von Mills, White Collar, 302, 362 f. an. Genauere Schätzungen sind schwierig, weil die Aufschlüsselung der amerikanischen Erwerbstätigen in Arbeiter und Angestellte nur für die vollen Jahrzehnte durchgeführt ist und die Mitgliedschaft von Einzelgewerkschaften häufig Arbeiter und Angestellte in unbestimmbaren Zusammensetzungen enthält. 109 Errechnet aus Handbook of American Trade-Unions, 1936 Edition (= Bureau of Labor Statistics, Bull., No. 618), 7 ff.; 21 f. 110 Für 1935 und 1948: Mills, White Collar, 302; für 1939: „White Collar Unions on their Way“, in: Business Week, 19. August 1939, 31 (nach eigenen Schätzungen überprüft). 111 Errechnet aus Troy, Trade Union Membership. Folgende Organisationen wurden einbezogen: AFL: Actors and Artists; Air Line Pilots; Architects and Draftsmen; Musicians; Office Employees; Post Office Clerks; Railroad Telegraphers; Railway and Steamship Clerks; Retail Clerks; State, County and Municipal Employees; Teachers; Telegraphers. — CIO: Architects, Engineers, Chemists and Technicians; American Communications Association; Newspaper Guild; Office and Professional Workers; Retail, Wholesale and Department Store Union; State, County and Municipal Workers. — Unabhängige: Empire State Telephone Union; Federal Employees; Maryland Telephone Traffic Union; Maryland Telephone Workers; Motion Picture Art Directors; New England Telephone Operators; New Jersey Esso Employees Association; Post Office Clerks; Postal Employees; Postal Supervisors; Railway Conductors; National Federation of Salaried Unions; Screen Directors' Guild; Screen Writers; United Telephone Organizations; National Federation of Telephone Workers; Telephone Workers of New Jersey. 112 Anteil der Gewerkschaftsgruppen an der Gesamtzahl aller organisierten Angestellten: 1939 1945 54 % AFL 59 % 13 % CIO 12 % Unabhängige 33 % 29 %
In diesen wie den obigen Zahlen sind die Angestellten, die in Verbänden mit überwiegender Arbeitermitgliederschaft organisiert waren, nicht mitgerechnet. Dies dürfte insbesondere für den CIO zu Verfälschungen nach unten führen, allerdings in geringem Ausmaß (nicht mehr als 2 oder 3 % ) .
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Arbeiterbewegung und New Deal - Zur Integration der amerikanischen Gewerkschaften in den Organisierten Kapitalismus Von PETER LÖSCHE
Als im Herbst 1935 nach Beendigung des Kongresses der American Federation of Labor (AFL), der erneut das Industriegewerkschaftsprinzip abgelehnt hatte, acht prominente Gewerkschaftsführer das Committee for Industrial Organisation ins Leben riefen, schien sich eine Revolution in der amerikanischen Arbeiterbewegung anzubahnen. Es hatte den Anschein, als manifestiere sich in dem neuen Verband, dem späteren Congress of Industrial Organisations, nicht nur der organisatorische Bruch mit den Fachgewerkschaften der AFL, sondern auch eine Abkehr von der unpolitischen, allein an „Brot-und-Butter“Zielen orientierten, parteiungebundenen („non-partisan“) Tradition amerikanischer Gewerkschaften. Der CIO hatte demonstrativ mit dem „Voluntarismus“ der AFL-Gewerkschaften gebrochen, mit dem — in der Praxis nicht immer eingehaltenen — Prinzip, daß ohne Eingriff des Staates die Beziehungen zwischen Gewerkschaft und Unternehmer auf freiwilliger Basis geregelt werden sollten. Der CIO plädierte nicht nur für die staatliche Rahmenregelung des Verhältnisses von Unternehmern und Gewerkschaften, sondern verdankte letztlich der Staatsintervention — nämlich dem National Industrial Recovery Act (NIRA) mit seinem Artikel 7 a und dem Wagner Act, dem National Labor Relations Act (NLRA) — Entstehung und Aufschwung. Die politische Orientierung des CIO und seine Fixierung auf den Staat kamen nicht zuletzt in der Bildung eigener politischer Organe, der Labor's Non-Partisan League1, der American Labor Party in New York und des Political Action Committee während des Zweiten Weltkrieges zum Ausdruck. In die CIO-Gewerkschaften strömten Kommunisten, Sozialisten und die alten Mitglieder der syndikalistischen Industrial Workers of the World, die „Wobblies“, die alle bis dahin eben wegen ihrer gesellschaftspolitischen Konzepte am Rande der Gewerkschaftsbewegung gestanden hatten. Zu den Gründergewerkschaften des neuen Verbandes gehörten die sozialdemokratischen Gewerkschaften in der Textilindustrie Amalgamated Clothing Workers of America (ACWA), International Ladies' Garment Workers' Union und die Hutmacher-Gewerkschaft2, deren Vorsitzende Sidney Hillman, David Dubinsky und Max Zaritzky sich alle früher als Sozialisten bekannt hatten. In verschiedenen CIO-Gewerkschaften, so bei den Automobilarbeitern und in der Elektroarbeitergewerkschaft, gab es starke kommunistische und sozialistische Fraktionen. Die Politisierung des CIO 6 Winkler, Krise
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
82
Peter Lösche
wurde offensichtlich auch dadurch verstärkt, daß in seinen Gewerkschaften die bis dahin nicht organisierten ungelernten und angelernten Arbeiter der Massengüterindustrien zusammengefaßt wurden, die von den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise besonders betroffen und entsprechend mobilisiert worden waren3. Von 1936 bis 1941 steigerten die Gewerkschaften des CIO ihre Mitgliederzahl von ca. 800 000 auf 4 bis 5 Millionen4. In seiner Militanz, so bei den großen Sit-Down-Streiks der Gummi- und Automobilindustrie, überflügelte der CIO die vorsichtig taktierenden AFL-Gewerkschaften. 1937 traten 1,2 Millionen CIO-Gewerkschafter in mehrwöchige Streiks, 1941 — dem Jahr der Organisierung der Ford-Werke — waren es sogar 1,6 Millionen. Dieser blitzartige Aufstieg des CIO vollzog sich zu einer Zeit, in der das in den zwanziger Jahren vorhandene Vertrauen der amerikanischen Öffentlichkeit in die Genialität des Großunternehmers und in den „Wohlfahrtskapitalismus“ durch die Weltwirtschaftskrise endgültig verlorengegangen war. Rexford Tugwell, einer der engsten Berater Franklin D. Roosevelts, glaubte, daß beim Amtsantritt des neuen Präsidenten 1932 die Sozialisierung der Banken möglich gewesen wäre. Meinungsbefragungen bestätigten diese Annahme, sie zeigten zumindest, daß die politische Öffentlichkeit sich dem kaum widersetzt hätte. Andere Belege ließen sich dafür aufzählen, daß die politische Situation in der Weltwirtschaftskrise und in den ersten Regierungsjahren Roosevelts für gesellschaftspolitische Alternativen offener gewesen ist, als sie in der traditionellen Geschichtsschreibung — etwa bei Schlesinger5 — gesehen wird. So etwa gab es in mehreren Gewerkschaften des CIO, konzentriert in den industriellen Zentren New York City, Detroit und Chicago, eine relativ starke Tendenz unter den Mitgliedern, die die Gründung einer amerikanischen Arbeiterpartei nach britischem Vorbild anstrebte. Wenn wir Verhalten und Politik des CIO und seiner Einzelgewerkschaften sowie der in ihnen aktiven politischen Fraktionen untersuchen, so ergibt sich, daß die im New Deal schnell wachsende Industriegewerkschaftsbewegung letztlich dennoch fest in das politische und wirtschaftliche System der Vereinigten Staaten eingebunden gewesen ist, keine gesellschaftspolitische Alternative entwickelt hat (und vielleicht auch nicht entwickeln konnte), daß die Wiedervereinigung von AFL und CIO nach dem Zweiten Weltkrieg kein historischer Zufall gewesen ist. Die Gründe hierfür liegen sowohl in langfristig durch die gesamte amerikanische Geschichte wirkenden Faktoren wie in anderen Faktoren, die vornehmlich erst im zweiten Viertel unseres Jahrhunderts relevant geworden sind. Bevor wir versuchen, diese Entwicklung in einen größeren historischen und theoretischen Zusammenhang zu stellen, sollen Arbeitsweise und Funktion der amerikanischen Gewerkschaften in den dreißiger Jahren, ihre Rolle im „System der Arbeitsbeziehungen“ (labor relations system) und die Politik der Industriegewerkschaften des CIO dargestellt und analysiert werden.
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Arbeiterbewegung und New Deal
83
I Im System der Arbeitsbeziehungen werden das Verhältnis von Unternehmer und Gewerkschaft in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen sowie im einzelnen Betrieb und die Stellung der Gewerkschaft im Unternehmen geregelt. Dieses aus dem Gewohnheitsrecht und aus einigen älteren Gesetzesbestimmungen gewachsene System wurde durch den Wagner Act 1935 und die Bestätigung des Wagner Act durch das Verfassungsgericht im Verfahren National Labor Relations Board v. Jones and Laughlin Steel Company im April 1937 staatlich bestätigt und zum Gesetz des Landes erhoben. Die Sicherung von Tarifverhandlungen und Tarifverträgen läßt sich zurückverfolgen zu der Entscheidung des Verfassungsgerichts in Commonwealth v. Hunt von 1894, zu den Entscheidungen des National War Labor Board und des Railway Labor Board, zum Railway Labor Act von 1926, Norris-La-Guardia Act von 1932, Bancrupty Act vom März 1933, zum Artikel 7 a des NIRA und zu den Entscheidungen des durch Public Resolution 44 im Jahr 1934 eingerichteten National Labor Board6. Der Wagner Act7 enthielt vier Prinzipien, auf denen das System der Arbeitsbeziehungen fortan basierte: 1. Arbeitnehmer haben das Recht, sich zu organisieren und zum Zweck der Tarifverhandlungen Vertreter ihrer eigenen Wahl zu bestimmen. 2. Arbeitgeber dürfen Arbeitnehmer nicht unter Druck setzen oder in ihrem Recht einschränken, sich zu organisieren und ihre Vertreter zu wählen. 3. Vertreter zum Zweck von Tarifverhandlungen werden in geheimer Wahl bestimmt. 4. Der Arbeitgeber muß die von seinen Arbeitnehmern bestimmten Vertreter als Verhandlungspartner akzeptieren. Verschiedene Einzelstaaten ergänzten den NLRA durch eigene Gesetze, so daß aus diesen und den Entscheidungen des durch den Wagner Act ins Leben gerufenen National Labor Relations Board (NLRB) sowie des Verfassungsgerichts ein fester Rechtskanon im System der Arbeitsbeziehungen entstand. Die einzelnen Industriezweige und die in ihnen tätigen Gewerkschaften wurden durch eine im Wagner Act verankerte Bestimmung, die „majority rule“, fragmentiert, die vorsah, daß in Wahlen der Arbeitnehmer innerhalb einer Tarifverhandlungseinheit (bargaining unit) festgelegt wurde, welche Gewerkschaft alle Arbeitnehmer, gleich ob sie Mitglied einer Gewerkschaft waren oder nicht, als ihr alleiniger Vertreter in Tarifverhandlungen mit dem Unternehmer repräsentieren sollte. Durch diese Klausel des NLRA wurde gleichsam das amerikanische Mehrheitswahlrecht aus dem politischen in den wirtschaftlichen Bereich übertragen. Das Prinzip der majority rule implizierte drei Elemente: (1) Hatte eine Gewerkschaft einmal durch Abstimmung das Vertretungsrecht gewonnen, so war sie der exklusive Repräsentant der Arbeitnehmer; keine andere Gewerkschaft hatte dann das Recht, in dieser Tarifverhandlungseinheit für die Arbeitnehmer zu sprechen und zu handeln. Nur wenn 30 Prozent der Beschäftigten in einer Tarifverhandlungseinheit durch Unterschrift ihren Willen 6*
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
84
Peter Lösche
bekundeten, von einer anderen Gewerkschaft als der bisherigen vertreten werden zu wollen, mußte der National Labor Relations Board Neuwahlen ansetzen. Die Gewerkschaft, die in einer solchen Wahl dann die Mehrheit der Stimmen gewann, wurde neuer exklusiver Tarifverhandlungsrepräsentant8. Derartige Herausforderungswahlen durften nicht Öfter als einmal im Jahr stattfinden. In Wirklichkeit gab es nur wenige Ausnahmefälle, in denen eine Gewerkschaft, die sich einmal als Tarifverhandlungsrepräsentant etabliert hatte, abgewählt wurde. (2) Zentral für den Ausgang jeder Abstimmung war natürlich die Festlegung des „Wahlkreises“, der angemessenen Tarifverhandlungseinheit (appropriate bargaining unit). Konnten sich konkurrierende Gewerkschaften untereinander oder Gewerkschaft und Unternehmer nicht darüber einigen, entschied nach Anhörung aller Beteiligten der NLRB9. Die erbittertsten Kämpfe zwischen AFL- und CIO-Gewerkschaften fanden während des New Deal darüber statt, ob die Tarifverhandlungseinheiten nach dem Industrie- oder dem Berufsprinzip bestimmt werden sollten. Der Aufstieg der CIOGewerkschaften wurde dadurch begünstigt, daß der NLRB während der ersten Jahre seines Wirkens in der Regel industriellen Tarifverhandlungseinheiten zuneigte. (3) Schließlich mußte festgelegt werden, welche Kategorien von Beschäftigten (Arbeiter, Vorarbeiter, Angestellte, leitende Angestellte) einer Tarifverhandlungseinheit angehörten, wer also stimmberechtigt war und wen die Gewerkschaft dann nach der Wahl gegenüber dem Management vertrat. Abgesehen von Teilen der Bauindustrie und des Druckereigewerbes, in denen durch Gewohnheitsrecht bereits andere Regelungen bestanden, schloß der NLRB alle Beschäftigten, die Managerfunktionen wahrnahmen — und dazu gehörten nach den Entscheidungen des Boards in den Massengüterindustrien nicht nur leitende Angestellte, sondern auch Vorarbeiter — von der Tarifverhandlungseinheit aus. Das Prinzip der majority rule führte in den Massengüterindustrien dazu, daß in einer industriell — und nicht fachberuflich — bestimmten Tarifverhandlungseinheit eine Gewerkschaft (in der Regel dem CIO angeschlossen) und ein Unternehmer gegenüberstanden. Mehr als die Hälfte aller Streiks in den Jahren 1936 bis 1941 wurde um die Anerkennung einer Gewerkschaft durch den Unternehmer als Tarifverhandlungspartner geführt10, darunter die großen Streiks in der Auto- und Gummiindustrie. Der Typ von Tarifverhandlungseinheiten in den Massengüterindustrien, der sich aus den Streiks um die Gewerkschaftsanerkennung ergab, umfaßte nicht die geschlossenen Industriesyndikate — etwa Automobil-, Elektro- und Stahlindustrie — und in der Regel auch nicht die einzelnen Großkorporationen wie General Electric, General Motors, Goodyear. Vielmehr war die Organisationsweise von Industrie zu Industrie verschieden. Als Tendenz zeichnete sich ab, daß einzelne Fabrikationsstätten vom NLRB als Tarifverhandlungseinheit bestimmt wurden, so etwa die Fordwerke in Dearborn, Michigan; General Electric in Lynn, Mass.; AllisChalmers Manufacturing Company in einem Vorort von Milwaukee, Wisconsin. Eine Untersuchung des Bureau of Labor Statistics von 1950, aus der sich © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Arbeiterbewegung und New Deal
85
die Strukturen der Tarifverhandlungseinheiten des New Deal noch nachzeichnen lassen, hat ergeben, daß zwei Drittel aller Tarifverträge die Beschäftigten nur einer einzelnen Fabrik umfaßten11. Dies war allerdings nur ein Drittel aller Arbeitnehmer, für die Tarifverträge abgeschlossen worden waren. Ein Achtel aller Tarifverträge hingegen umfaßte Tarifverhandlungseinheiten, zu denen mehrere Fabriken gehörten und in denen 40 Prozent aller Arbeitnehmer, für die Tarifverträge bestanden, arbeiteten. Der CIO versuchte, die Tarifverhandlungseinheiten so durch den NLRB bestimmen zu lassen, daß mehrere Fabriken zu ihnen gehörten. 1939 setzte die Automobilarbeitergewerkschaft gegen den Widerstand in der eigenen Mitgliedschaft durch, daß Tarifverträge geschlossen wurden, die ganze Unternehmen — darunter General Motors — umfaßten: Von der nationalen Gewerkschaftsführung und der Leitung der Großkorporation wurde dann ein Rahmentarifvertrag vereinbart, der durch lokale Verträge, die die Betriebsgewerkschaftsorganisationen und das Management in den einzelnen Fabriken aushandelten, ergänzt wurde. Trotz dieser Zentralisationstendenzen in einigen Industrien fanden — und das wird im Vergleich mit Deutschland besonders deutlich — auch in den Massengüterindustrien Tarifverhandlungen dezentralisiert statt. Dies lag daran, daß die Arbeiter nicht nur am Arbeitsplatz direkt organisiert und von einer Gewerkschaft exklusiv repräsentiert wurden, sondern daß „local issues“, Probleme, die sich am Arbeitsplatz in der einzelnen Fabrik ergaben, auch in den dreißiger Jahren eine zentrale Rolle bei Tarifverhandlungen spielten. Die auf dem Prinzip der majority rule beruhende Tarifverhandlungspraxis resultierte so in der Fragmentierung der Industriegewerkschaften des CIO in einzelne Tarifverhandlungseinheiten. Diese durch das Prinzip des exklusiven Tarifverhandlungsrepräsentanten angelegte Fragmentierung wurde durch das System der Arbeitsbeziehungen in der einzelnen Tarifverhandlungseinheit noch weiter verstärkt. In amerikanischen Tarifverträgen fanden (und finden) sich nicht nur Bestimmung über Lohn, Arbeitszeit und Urlaub sowie Arbeitsbedingungen, sondern die Gewerkschaften haben immer versucht, ihre Stellung im Betrieb über die Regelungen des Wagner Acts hinaus tarifvertraglich abzusichern. Zu den Mitteln dieser union security gehörten u. a.: (1) closed shop: Der Unternehmer verpflichtet sich, nur Mitglieder der Gewerkschaft — die, wie oben gezeigt wurde, „exclusive bargaining agent“ ist — einzustellen und jeden zu entlassen, der aus der Gewerkschaft austritt. Der Wagner Act gestattete den closed shop, er wurde erst mit dem Taft-Hartley Act 1947 ungesetzlich. (2) Verbunden mit dem closed shop war häufig — besonders in Industrien, die unter saisonbedingten Konjunkturschwankungen litten, wie der Bau- und Textilindustrie — die union hiring hall, ein in der Regel von der Gewerkschaft errichtetes Büro, das Arbeitskräfte an die Unternehmer vermittelte. (3) Union shop: Ein Beschäftigter ist verpflichtet, nach einer bestimmten Zeit, normalerweise dreißig Tage nach seinem Eintritt in den Betrieb, der Gewerkschaft beizutreten und regelmäßig Beiträge an sie abzuführen. Dem CIO gelang es, den union shop bei mehreren © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
86
Peter Lösche
Großkorporationen durchzusetzen, so bei Ford 1941 und in mehreren Unternehmen der Stahlindustrie. (4) Dues-check-off: Der Unternehmer übernimmt es, die Beiträge der Gewerkschaftsmitglieder vom Lohn einzubehalten und an die Gewerkschaft abzuführen. (5) Die Vertrauensleute der Gewerkschaft im Betrieb, die „shop stewards“, werden teilweise für Gewerkschaftsarbeit freigestellt. Sie können während der Laufzeit eines Tarifvertrages nicht entlassen werden. Die Gewerkschaft erhält die Möglichkeit, im Betrieb ihre Literatur zu verteilen und in festgelegten Abständen Versammlungen aller Angehörigen einer Tarifverhandlungseinheit während der Arbeitszeit zu veranstalten12. (6) Union label: Durch Etikett oder Aufdruck auf einem Produkt wird den Konsumenten angezeigt, daß die Ware in einem gewerkschaftlich organisierten Betrieb hergestellt wurde. Der Absatz dieses Produkts soll dadurch gefördert, der Absatz der in nichtorganisierten Unternehmen hergestellten Erzeugnisse boykottiert werden13. Alle erwähnten Maßnahmen der „union security“ sind von den CIOGewerkschaften in verschiedenen Industrien und Tarifverhandlungseinheiten im New Deal durchgesetzt worden, am häufigsten der union shop, dues-checkoff, union label und die Sonderstellung der Gewerkschaftsfunktionäre im Betrieb. Union security hat so zur weiteren Fragmentierung der Gewerkschaften beigetragen: Nicht nur sicherte die Gewerkschaft im Betrieb ihre eigene Stellung, sondern die Kooperation von Gewerkschaft und Unternehmer in der Tarifverhandlungseinheit wurde institutionalisiert, die einzelne Tarifverhandlungseinheit gleichsam als Syndikat etabliert und nach außen abgeschlossen14. Innerhalb jedes Tarifverhandlungssyndikats wurde zudem durch die in den Tarifverträgen festgelegte seniority rule die Belegschaft hierarchisch strukturiert: Entlassung und Wiedereinstellung, Zuteilung von Überstunden, Länge des Urlaubs und Beförderung (bei gleicher Qualifikation) hingen von der Länge der Zugehörigkeit des Arbeiters zum Betrieb ab. War die seniority rule ursprünglich gegen die Willkür des Managements gerichtet und zum Schutz des einzelnen an seinem Arbeitsplatz gedacht, so band sie seit der endgültigen Herausbildung des Systems der Arbeitsbeziehungen im New Deal den Betriebsangehörigen an seine Tarifverhandlungseinheit, da er im Fall des Arbeitsplatzwechsels seiner aus hoher Seniorität resultierender Rechte verlustig ging und im neuen Betrieb an der untersten Stufe der Senioritätsleiter wieder beginnen mußte. Eine weitere tarifvertragliche Regelung verfestigte die Funktion der Tarifverhandlungseinheiten als in sich abgeschlossene (Tarif-)Syndikate: Ein stark formalisiertes Beschwerde- und Schlichtungsverfahren (grievance procedure), aus dem durch Entscheidungen in Präzedenzfällen ein quasi-autonomes Rechtssystem im einzelnen Betrieb entwuchs. Dieses Verfahren sah vor, daß ein Arbeiter bei Beschwerden über Arbeitsbedingungen oder in Streitfällen über die Auslegung des Tarifvertrages sich zunächst an seinen Gewerkschaftsvertrauensmann, der für seinen Arbeitsplatz zuständig war, wandte. Dieser war dann verpflichtet, den Fall dem Vorarbeiter vorzutragen. Konnte keine Einigung © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Arbeiterbewegung und New Deal
87
erzielt werden, so zog sich das Beschwerdeverfahren über mehrere Stufen hin, bis schließlich in letzter Instanz ein Schlichter (arbitrator) oder ein Schiedsrichterkollegium, von Gewerkschaft und Unternehmer in gegenseitigem Einverständnis bestimmt, einen bindenden Schlichtspruch fällte (binding arbitration). Diese letzte Stufe des Schlichtverfahrens war bereits im New Deal in einigen Tarifverträgen vorgesehen, setzte sich allgemein aber erst mit den Entscheidungen des National War Labor Boards im Zweiten Weltkrieg durch. Funktion der grievance procedure war es, Arbeitskonflikte, die einst zu spontanen Arbeitsniederlegungen — sogenannten „quickies“ — oder Arbeitsverzögerungen geführt hatten, im gegenseitigen Einvernehmen von Gewerkschaft und Management zu regeln und den Arbeitsfrieden so zu gewährleisten, daß effiziente und kontinuierliche Produktion nicht gefährdet wurden. Grievance procedure trug also nicht nur zur Integration und Abschließung des einzelnen Tarifverhandlungssyndikats bei, sondern lag im unmittelbaren Profitinteresse des Unternehmers. Schließlich kam ein weiterer Komplex von Regelungen in Tarifverträgen — beginnend im New Deal, um sich greifend während des Zweiten Weltkrieges, in voller Blüte jedoch erst in der Nachkriegszeit — hinzu, der die Tarifverhandlungseinheit gleichsam funktional-syndikalistisch etablierte: die Festsetzung sogenannter fringe benefits. Zu ihnen gehörten Rentenversicherungspläne, die die öffentliche Sozialversicherung ergänzten, Krankenversicherungen, Unfallversicherungen, u. U. auch Lebensversicherungen, die für die Arbeiter einer Tarifverhandlungseinheit abgeschlossen und die je nach Macht der Gewerkschaft ganz oder teilweise vom Unternehmen getragen wurden. Daß ein solches (zusätzliches) syndikalistisches Sozialversicherungssystem die Bindung des Arbeiters an seinen Betrieb und an seine Gewerkschaft — die in vielen Fällen, wie bei den Bergarbeitern, den Rentenfonds verwaltete — verstärkte, ist offenkundig, zumal einige Leistungen der Versicherungen entsprechend der seniority rule erst nach einer bestimmten Zeit der Betriebszugehörigkeit in Anspruch genommen werden konnten und bei Arbeitsplatz- oder Berufswechsel verfielen. Fassen wir zusammen: Das amerikanische System der Arbeitsbeziehungen, wie es sich im New Deal in den Massengüterindustrien herausgebildet hat, führte zu einer syndikalistischen Fragmentierung der Gewerkschaften in Tarifverhandlungseinheiten. Durch das Mittel des Tarifvertrags und die in ihm enthaltenen Regelungen über union security, seniority rule, grievance procedure und fringe benefits schlossen die Gewerkschaften sich gildenmäßig ab und wurden hierarchisch in den Tarifsyndikaten organisiert. Die Gewerkschaften des CIO wurden im New Deal in die funktionalen Tarifsyndikate durch das Mittel der Tarifverhandlungen integriert und als nationale Industriegewerkschaften auf Grund der Dezentralisation der Tarifverhandlungen fragmentiert15. Das im CIO vorhandene politische Potential ist so zum Teil absorbiert, zum Teil atomisiert worden. Die Aktivitäten der politischen Organe des CIO überschritten nie jene Grenze, die das System der Arbeitsbeziehungen setzte: © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
88
Peter Lösche
Arbeitskämpfe, oft mit in der deutschen Geschichte unbekannter Militanz geführt, spielten sich jeweils in einem Industriesyndikat, in einer Tarifverhandlungseinheit ab. Auseinandersetzungen zwischen Unternehmern und Gewerkschaften wurden im New Deal unter Einsatz von Militär und Polizeitruppen, durch Fabrikbesetzungen und Sit-Down-Streiks geführt. Das System der Arbeitsbeziehungen ließ größte Militanz — auch der Gewerkschaften — in jedem einzelnen Syndikat zu, ohne daß das System selbst gefährdet oder auch nur in Frage gestellt worden wäre. So hatten die großen Streiks des New Deal — etwa der Sit-Down-Streik gegen General Motors in Flint 1937 und der Streik gegen Ford 1941 — die Anerkennung der Gewerkschaft oder die Verbesserung der Tarifverträge zum Ziel, nicht aber gesellschaftspolitische Veränderungen. Die Kriegsverwaltungswirtschaft während des Zweiten Weltkriegs beschleunigte die Integration des CIO und seiner verschiedenen politischen Fraktionen in das System der Arbeitsbeziehungen. Unternehmer, Gewerkschaften und Vertreter des Staates kooperierten zur Steigerung der Produktivität der Kriegswirtschaft in verschiedenen Regierungsausschüssen18. Unternehmer und Gewerkschafter saßen gemeinsam in diesen Kommissionen und Behörden, wobei allerdings die Vertreter der Großkorporationen zumeist zahlenmäßig und vom Einfluß ihrer Position her überlegen waren. Der bekannteste Vertreter der Gewerkschaften in der Kriegsbürokratie war Sidney Hillman, Vorsitzender der ACWA, Mitbegründer des CIO und zeitweilig einer der engsten Berater Franklin D. Roosevelts. Die Entscheidungen des National War Labor Board sind in ihrer Bedeutung für die Verfestigung des Systems der Arbeitsbeziehungen kaum zu überschätzen: In der Regel traten seine Entscheidungen — die große Ausnahme war der Bergarbeiterstreik von 1943 — an die Stelle der sonst innerhalb der einzelnen Tarifverhandlungssyndikate ausgetragenen Arbeitskämpfe17. Durch die Entscheidungen des Board ist in der gesamten Massengüterindustrie das Beschwerde- und Schlichtungsverfahren (grievance procedure) einschließlich seiner letzten Stufe, des bindenden Spruches durch einen Schlichter (binding arbitration) voll etabliert worden18. Schließlich trug zur Integration der Gewerkschaften in die Wirtschaftsordnung nicht unwesentlich bei, daß die Öffentlichkeit die Mitarbeit der Gewerkschafter in den verschiedenen Regierungsbehörden pries und diese als gleichberechtigte Partner der Korporationen ansah, was in dem patriotischen Klima des Weltkriegs wiederum nicht ohne Einfluß auf oppositionelle radikale Gewerkschaftsgruppen im CIO blieb19. II Daß der CIO zu keinem Zeitpunkt seines Bestehens gesellschaftspolitische Alternativen entwickelt hat und wie fest er in das kapitalistische System integriert gewesen ist, ergibt auch die Untersuchung der Politik der Organisationen, die der Gewerkschaftsbund sich als politischen Arm geschaffen hat, nämlich die © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Arbeiterbewegung und New Deal
89
Labor's Non-Partisan League (LNPL, 1936 gegründet), die American Labor Party (ALP) in New York (1936) und das Political Action Committee (PAC, 1943)20. Ziel des CIO und seiner politischen Organe war die Organisierung der Arbeiterschaft besonders in den Massengüterindustrien und der Abschluß von Tarifverträgen. Entsprechend wurden LNPL und ALP dazu eingesetzt, jede Modifizierung des Wagner Act zu verhüten, wie sie z. B. die AFL aus Opposition gegen die den Industriegewerkschaften zunächst freundlichen Entscheidungen des NLRB anstrebte. Der CIO unterstützte den „court packing“ Plan Roosevelts, weil er befürchten mußte, daß das Verfassungsgericht den NLRA für verfassungswidrig erklären würde. Für die Sozialgesetzgebung des New Deal trat der CIO nur insoweit ein, als Sozialversicherung und Festlegung eines Mindeststundenlohns (im Fair Labor Standards Act von 1938)21 die Konkurrenz der Arbeitslosen um Arbeitsplätze, die von gewerkschaftlich Organisierten besetzt waren, abmilderte und so die Gefahr von Lohnsenkungen blockte22. Im übrigen gehörte nicht die Senkung der Arbeitslosenquote zu den Prioritäten der CIO-Politik, sondern die Erhöhung von Stundenlöhnen, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Sicherung der Stellung der Gewerkschaften im Betrieb. Das PAC wurde 1943 als Reaktion auf den gegen das präsidentielle Veto vom Kongreß verabschiedeten Smith-Connally Act, der das Streikrecht einschränkte, gegründet. Der CIO befürchtete, daß in Zukunft das Recht zu Tarifverhandlungen durch staatlichen Eingriff geschmälert werden würde, wie es im Taft-Hartley Act von 1947 dann auch tatsächlich geschah. LNPL und PAC — und mit Einschränkungen auch die ALP — erfüllten zwei Funktionen: Sie propagierten die Vorstellungen des CIO zur Arbeits- und Sozialgesetzgebung und sie gewährten jenen Kandidaten finanzielle und organisatorische Wahlhilfe, die die Ziele des CIO zu fördern versprachen. Zur Unterstützung ihnen genehmer Kandidaten organisierten LNPL und PAC schwerpunktmäßig in einigen Staaten regelrechte Wahlkampfmaschinen23, in denen die politischen Aktivitäten auch der linken CIO-Fraktionen wie der Sozialisten und Kommunisten neutralisiert wurden und in denen Gewerkschaftsfunktionäre hauptamtlich arbeiteten. Der CIO unterstützte alle jene Vorlagen zur Änderung der Wahlgesetze, die die Basis für den New Deal und die Rooseveltsche Politik unter der Wählerschaft verbreitert hätte wie die Anti-Poll-Tax Bill und die Soldier-Voting Bill. Letztlich ist weder in der LNPL, noch im PAC, noch in der ALP ein Ansatz für eine amerikanische Arbeiterpartei nach dem Vorbild der britischen zu erkennen gewesen. Äußerungen führender Gewerkschafter wie Sidney Hillman, Jacob Potovsky, Alex Rose und David Dubinsky, daß die ALP Ausgangspunkt für eine amerikanische Sozialdemokratie sei, waren nur taktischer Natur, um den Forderungen linker Gruppen in den New Yorker Textilarbeitergewerkschaften den Wind aus den Segeln zu nehmen24. Die ALP wurde in New York mit der finanziellen und organisatorischen Hilfe der Demokratischen Partei und des Vorsitzenden des Democratic National Committee, James Farley, gegründet. Sie ermöglichte es linken Wählern, für den New Deal und die Politik des CIO zu stimmen, ohne „Tammany Hall“, die © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
90
Peter Lösche
diktatorische und allein auf dem Öl der Patronage laufende Parteimaschine der Demokraten in New York City, wählen zu müssen. Die schriftliche Versicherung des Vorsitzenden der LNPL an Präsident Roosevelt kennzeichnete die politische Rolle des CIO: Die LNPL sei gebildet worden, um Arbeiterstimmen für den New Deal zu gewinnen und die Gründung einer Arbeiterpartei zu verhindern25. Der CIO blieb so letztlich der parteiungebundenen Tradition der AFL verhaftet: Er unterstützte in der Regel die Kandidaten der Demokratischen Partei, aber auch liberale Republikaner, wenn sie nur seinen politischen Zielen — nämlich Sicherung der Arbeits- und Sozialgesetzgebung sowie des Instituts der Tarifverhandlungen — folgten. Eine Verbindung zwischen Demokratischer Partei und CIO, die mit der zwischen Sozialdemokratie und freien Gewerkschaften in Deutschland und anderen europäischen Ländern vergleichbar wäre, ist in den USA nie zustande gekommen20. Die Aktivitäten von LNPL, ALP und PAC waren von den tariflichen Interessen des CIO bestimmt und stellten weder in Theorie noch in Praxis den Kapitalismus in Frage. Im Zusammenhang mit den politischen Organisationen des CIO soll kurz auf die am besten organisierte linke Fraktion in der Gewerkschaftsföderation, die Kommunisten, hingewiesen werden. Zunächst sei die in der Literatur schon oft getroffene Feststellung auch hier bestätigt, daß ein Teil des linken Potentials, Kommunisten wie Sozialisten, durch die Rhetorik des New Deal und die — wie pragmatisch sie auch immer gewesen sein mag — gewerkschaftsfreundliche Politik der Roosevelt-Regierung absorbiert worden ist. In den politischen Organen des CIO arbeiteten (mit Ausnahme der ALP) relativ wenige Sozialisten und Kommunisten mit, sie waren stärker in den Organisationsstäben des CIO und als Funktionäre in den Betriebsgewerkschaftsorganisationen an der Basis vertreten. Die Bemühungen der Kommunisten um Massenzulauf aus der Arbeiterschaft blieben in der Geschichte der amerikanischen Gewerkschaften immer dadurch erschwert, daß die Partei strikt und blindlings der von der Dritten Internationale ausgegebenen Linie folgte27. So hatten erst 1934 die amerikanischen Kommunisten im Zuge der Volksfrontpolitik ihr Konzept von einer doppelten und oppositionellen Gewerkschaftsorganisation aufgegeben und begannen von innen her in der AFL zu bohren. Im Frühjahr 1937 änderten sie plötzlich ihre Taktik und gingen geschlossen in den CIO, den sie bis dahin als Spalterorganisation einer Einheitsgewerkschaft bitter befehdet hatten. Im CIO waren sie als erfahrene und versierte Organisatoren willkommen und gewannen auch die Unterstützung der Arbeiter in den Tarifverhandlungseinheiten, da sie als harte und militante Verhandler und Streikführer deren materielle Interessen gegen die Unternehmer durchzusetzen verstanden. 1941 standen die Kommunisten auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs im CIO 28 : Sie kontrollierten ca. 21 CIO-Gewerkschaften mit etwa 500 000 Mitgliedern, darunter als größte die United Electrical Workers mit 133 000 Mitgliedern, der sechstgrößten CIOGewerkschaft. Kommunisten wurden als Gewerkschaftsvertreter solange akzeptiert, als sie die ,,Brot-und-Butter“-Interessen der Arbeiter in einer Tarifver© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Arbeiterbewegung und New Deal
91
handlungseinheit erfolgreich vertraten und die ihnen von der Dritten Internationale vorgegebene Parteilinie dabei nicht in die Quere kam. Der Abschluß des Hitler-Stalin-Pakts bereitete ihnen daher — nimmt man die Demaskierung vor einer Schicht linksliberaler Intellektueller aus — zumindest in den Betrieben relativ wenige Schwierigkeiten: Der Krieg in Europa wurde als Auseinandersetzung zwischen den Imperialisten, bei denen es zwischen den Demokratien und den faschistischen Staaten nach kommunistischer Auffassung keinen qualitativen Unterschied gab, auf die Seite geschoben. Höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, durchzusetzen mit den Mitteln von Tarifverhandlungen und Streik, standen im Zentrum der kommunistischen Fabrikagitation. Im Frühjahr 1941, als die USA intensiv aufrüsteten, griff die Bundesregierung gegen einen von Kommunisten geführten Streik in der Flugzeugindustrie von Inglewood, Kalifornien, ein und nahm — gegen lautstarken kommunistischen Protest — die bestreikte Fabrik vorübergehend in Bundeskontrolle. Wenige Wochen spater warfen die amerikanischen Kommunisten nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion von einem Tag auf den anderen das Steuer in den Betrieben um 180 Grad herum: Arbeitsfriede, Ablehnung eines jeden Streiks und jeder Arbeitsverzögerung, Überstunden, Akkordarbeit und effiziente Produktion hießen jetzt die Forderungen. War es schon schwer, die außenpolitische Schwenkung der Partei verständlich zu machen, so folgten die Arbeiter in den Betrieben nicht im gleichen Tempo den kommunistischen Produktionsparolen. Der neuen kommunistischen Taktik kam allerdings zugute, daß sie nach Pearl Habor parallel zu der durch das Land laufenden patriotischen Welle ging. Diese Taktik gipfelte 1944 in der freiwilligen Selbstauflösung der Partei, durch die die Vaterlandsliebe der Kommunisten demonstriert werden sollte. Als Gewerkschaftsfunktionäre waren die Kommunisten dort ungefährdet, wo sie Patriotismus und Vertretung der materiellen Interessen der Arbeiter in den Tarifverhandlungseinheiten miteinander verbinden konnten. Im Ergebnis fügten Taktik und Politik der CIO-Kommunisten sich genau in die Strukturen des Systems der Arbeitsbeziehungen ein: Die Kommunisten hatten nicht nur die Organisationsstreiks und Tarifverhandlungen in den dreißiger Jahren akzeptiert, sondern seit 1941 agitierten sie als am besten organisierte Gruppe in den Gewerkschaften des CIO für die Effizienz und Reibungslosigkeit der Kriegsverwaltungswirtschaft. Weder theoretisch noch in der Praxis offerierte die Kommunistische Partei Amerikas eine Alternative zum Kapitalismus. Es überraschte daher nicht, daß Gerad Swope von General Electric in Tönen höchsten Lobes von dem kommunistischen Führer der United Electrical Workers, Julius Emspak, sprach und daß in den Fabriken von General Electric in Lynn, Mass., das Management daran interessiert war, Kommunisten als Gewerkschaftsvertreter ihrer Tarifverhandlungseinheit im Amt zu behalten: Die Kommunisten waren wegen ihrer Organisationserfahrung am besten in der Lage, Unruhe und Unzufriedenheit unter den Arbeitern zu kontrollieren29. Andere, außerhalb der organisierten amerikanischen Arbeiterbewegung und des Systems der Arbeitsbeziehungen liegende Faktoren haben dazu geführt, © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
92
Peter Lösche
daß das in den CIO-Gewerkschaften vorhandene — zumindest theoretisch — auf Gesellschaftsveränderung gerichtete politische Potential absorbiert worden ist. Zu ihnen gehört das amerikanische Regierungssystem, worauf in der Literatur bekanntlich extensiv hingewiesen worden ist. So hat Werner Sombart in griffigen Formulierungen die Stabilität des Zweiparteiensystems der auf dem Öl der Patronage laufenden Wahlmaschinen herausgestrichen30. Auch in den dreißiger und vierziger Jahren hat das Mittel der Patronage seine integrierende Wirkung nicht verfehlt, wie der Personalaustausch zwischen dem CIO, besonders seinen politischen Organen, und den New-Deal-Ämtern und Kriegsbehörden auf allen Ebenen der bürokratischen Hierarchie zeigte31. Amerikanischer Föderalismus und die — verglichen mit anderen Regierungssystemen — relative Stärke der kommunalen Selbstverwaltung haben zur Fragmentierung der Gewerkschaften und zur Zersplitterung ihres politischen Potentials beigetragen. Wir haben gesehen, daß die Organisierung der Arbeiterschaft in den Massengüterindustrien und der Abschluß von Tarifverträgen in der Prioritätenliste des CIO an erster Stelle standen. Dies aber verwies die politischen Aktivitäten des Gewerkschaftsbundes auf die Ebenen der Einzelstaaten und der Kommunen, band politische Phantasie und Arbeitskraft an der Basis. Im New Deal wurde zwar auf Bundesebene ein — immer noch weitmaschiges — nationales Netz der Arbeits- und Sozialgesetzgebung gewoben, doch unterlagen alle über den Social Security Act und den Wagner Act hinausgehenden sozialpolitischen und arbeitsrechtlichen Maßnahmen der Kompetenz und dem Zugriff der Einzelstaaten. Der CIO war daher gezwungen, sowohl in den Hauptstädten der Einzelstaaten seine Lobbies einzurichten als auch Kandidaten für einzelstaatliche Regierungs- und Parlamentsfunktionen, oft durch Aufbau von im Einzelstaat konzentrierten Wahlkampfmaschinen, zu unterstützen oder abzublocken32. Gerade bei den Organisationskampagnen der CIO-Gewerkschaften war das Verhalten der Regierungen in den Einzelstaaten für Erfolg oder Niederlage oft wichtiger als wohlwollende Neutralität oder Vermittlungsversuche der Roosevelt-Administration im fernen Washington. Um ein Beispiel zu geben: Der Sit-Down-Streik der Automobilarbeiter gegen General Motors 1937 wäre voraussichtlich fehlgeschlagen, wenn der Gouverneur von Michigan die Nationalgarde voll eingesetzt hätte. Gouverneur von Michigan war zu dieser Zeit der gewerkschaftsfreundliche und mit Hilfe des CIO gewählte Frank Murphy, der die Nationalgarde zwar herausrief, um die öffentliche Meinung zu besänftigen, der die Truppen aber nicht zur Niederschlagung des Streiks benutzte. Der Erfolg gewerkschaftlicher Organisationsbemühungen hing aber auch vom Verhalten der Selbstverwaltungsorgane der Gemeinden ab, in denen die zu organisierenden Betriebe lagen. So arbeitete die Polizei von Dearborn, Michigan, mit dem Service Department von Ford, der Privatpolizei des Autowerks, eng zusammen, um mit aller Brutalität die Funktionäre der Automobilarbeitergewerkschaft vom Fabrikgelände und aus der Stadt zu vertreiben. Um diese kommunalen Barrieren zu überwinden, waren CIO-Gewerkschaften oft gezwungen, sich aktiv an der lokalen Politik zu © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Arbeiterbewegung und New Deal
93
beteiligen und ihnen günstig gesonnene oder wenigstens neutrale Kandidaten in das Amt des Bürgermeisters, des Sheriffs oder Polizeipräsidenten zu wählen. Die gleiche Politik verfolgte der CIO auch in solchen Fällen, in denen lokale Richter, die in allgemeinen Wahlen bestimmt worden waren, durch den Erlaß einstweiliger Verfügungen die Arbeit der Gewerkschaftsfunktionäre in und vor den Fabriken behindert hatten33. Gerade in den dreißiger Jahren, in denen der CIO in den Massengüterindustrien seine militanten Organisierungskampagnen führte, wurden die politischen Aktivitäten der Gewerkschaften in die Gemeinden und Einzelstaaten eingebunden und das politische Potential, das u. U. zur Errichtung einer nationalen Arbeiterpartei hätte genutzt werden können, absorbiert. Die Einbindung der Industriegewerkschaften in die Einzelstaaten und damit die Fragmentierung ihres nationalen politischen Potentials wurde durch einen weiteren Faktor verstärkt, nämlich durch die regional differenzierten materiellen Interessen der verschiedenen CIO-Gewerkschaften. Bedingt durch die Industriestandorte waren Gewerkschaften in einigen Staaten überhaupt nicht präsent, während sie in anderen die CIO-State-Councils dominierten. So lag der Schwerpunkt der gewerkschaftlichen und politischen Arbeit der UAW in Michigan, der ACWA im Staat New York und in Chikago und der United Mine Workers im Appalachengebiet. Thomas Kennedy, der Schatzmeister und Generalsekretär der Bergarbeiter, wurde 1934 zum Lieutenant Govenor des Kohlenstaates Pennsylvania gewählt und unterlag 1938 in den Vorwahlen als Gouverneuraspirant nur knapp gegen den Kandidaten der Demokratischen Parteimaschine. Der Guffey-Snyder Act und der Guffey-Vinson Act waren vom Bergarbeiterverband initiiert und auf die Kohlenbergbaugebiete, besonders die Bedürfnisse des Staates Pennsylvania, zugeschneidert worden. Nur durch den Druck des Bergarbeiterverbandes verabschiedete der Kongreß diese beiden Gesetze, die faktisch die Bestimmungen des für verfassungswidrig erklärten NIRA dem Kohlebergbau erhielten. Der stellvertretende Vorsitzende der UAW, Richard Frankensteen, kandidierte (und unterlag) als Bürgermeister von Detroit. Mehrere Funktionäre der Textilarbeitergewerkschaften, der ACWA, der International Ladies' Garment Workers' Union und der Hatters, Cap and Millinery Workers, wurden in das Staatsparlament von New York nach Albany entsandt. Zusammenfassend läßt sich also sagen: Die funktionale Bindung der CIO-Gewerkschaften an verschiedene Industrieregionen fragmentierte die politische Arbeit des Gewerkschaftsbundes. Eine nationale Politik des CIO gab es nicht, abgesehen von der Unterstützung der New-Deal-Kandidaten bei nationalen Wahlen, allen voran Franklin D. Roosevelt, und dem Versuch, die Bundesarbeits- und Sozialgesetzgebung zu bewahren. Die Einbindung der Industriegewerkschaften in das System der Arbeitsbeziehungen und die Begrenzung des kommunistischen und sozialistischen Einflusses im CIO wurde schließlich durch die gewerkschaftliche Arbeit der Katholiken und die Wirkung der korporativen Ideen der katholischen Soziallehre gefördert. Im Unterschied zu den Fachgewerkschaften der AFL waren im © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
94
Peter Lösche
CIO überwiegend Katholiken organisiert, so aus Italien eingewanderte Textilarbeiter in New York, aus Polen und Irland eingewanderte ungelernte und angelernte Arbeiter in der Stahl-, Auto- und Gummiindustrie. Die amerikanischen Diözesen übten gegenüber den gewerkschaftlichen Organisationskampagnen in den dreißiger Jahren zumindest wohlwollende Neutralität. Mehrere katholische Bischöfe riefen die Arbeiter in ihren Sprengein auf, sich den Industriegewerkschaften anzuschließen34. In den Betriebsgewerkschaftsorganisationen an der Basis und in den Gewerkschaftsvorständen des CIO waren viele Funktionäre praktizierende Katholiken, darunter Philip Murray, seit 1940 Vorsitzender des CIO. Eine Minorität katholischer CIO-Gewerkschafter schloß sich in einem eigenen Verband, der Association of Catholic Trade Unionists (ACTU), zusammen und errichtete in einigen der bedeutendsten Industriezentren — Philadelphia, New York, Chikago, Detroit — Kapitel. Die Bedeutung der ACTU darf nicht überschätzt werden, doch erfüllte sie zwei Funktionen: (1) Bei einigen heiß umstrittenen innergewerkschaftlichen Wahlen — etwa bei den Vorstandswahlen mehrerer Betriebsgewerkschaftsorganisationen der UAW in Michigan — war die ACTU das Zünglein an der Waage in der Auseinandersetzung zwischen politisch radikalen und gemäßigten Kandidaten. Sie entschied sich jeweils gegen den Kommunisten und in der Regel gegen den Sozialisten. Das traf auch zu, wenn es um die Entscheidung darüber ging, welcher Kandidat für ein öffentliches Amt vom CIO unterstützt werden sollte. (2) Die ACTU popularisierte und propagierte auf der Grundlage der katholischen Soziallehre Konzepte der korporativen Wirtschafts- und Staatsordnung im CIO. Die bekanntesten Beispiele hierfür waren der Industrial Council Plan Philip Murrays und ein zu Beginn des Zweiten Weltkrieges vom Detroiter Kapitel veröffentlichter Plan, der ein System von Wirtschaftsräten vorschlug, in denen nach Industrie getrennt Unternehmer und Gewerkschafter gleichberechtigt vertreten sein sollten35. Derartige Pläne begünstigten nicht nur Harmonisierungstendenzen in der organisierten Arbeiterschaft, sondern sie demonstrierten auch die strukturelle Affinität zwischen katholischer Soziallehre und der amerikanischen Tarifverhandlungspraxis in den dreißiger und vierziger Jahren. Wir können an dieser Stelle nicht weiter auf die Rolle der im CIO organisierten Katholiken und die der ACTU eingehen, doch ist ihr Beitrag zur Integration der Industriegewerkschaften in das System der Arbeitsbeziehungen und zur Kontrolle radikaler Gewerkschaftsfraktionen36 nicht zu übersehen37. III Absorption des politischen Potentials des CIO in den dreißiger Jahren und namentlich die Herausbildung eines gesetzlich abgesicherten Systems der Arbeitsbeziehungen sind in dem größeren Zusammenhang der Entwicklung des amerikanischen Kapitalismus unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise zu sehen. Erst jetzt kam jener schon über Jahrzehnte auch in den USA andauernde, © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Arbeiterbewegung und New Deal
95
durch die Sogwirkung des „Wohlfahrtskapitalismus“ der zwanziger Jahre verdeckte Prozeß zum vollen Durchbruch, durch den die aus dem 19. Jahrhundert überkommene, geistesgeschichtlich dem Liberalismus entstammende Trennung von Staat und Gesellschaft real und für jeden sichtbar aufgehoben wurde. Die amerikanische Gesellschaftsgeschichte trat in die Periode des organisierten Kapitalismus ein. Die Wirtschaft des freien Spiels, weitgehend auf Einzelunternehmen basierend und relativ frei vom Staatseingriff, wurde u. a. auf Grund technologischer Entwicklungen durch eine organisierte Wirtschaft abgelöst, für die horizontale und vertikale Konzentration und Zentralisation, Monopolisierung, Kartell- und Trustbildung im nationalen, zunehmend aber auch im internationalen Rahmen charakteristisch war. Effizienz und Profit konnten auf Dauer innerhalb der Großunternehmen nur durch planend-wissenschaftliche Produktionsmethoden und zweckrational-bürokratisches Management, gesamtwirtschaftlich allein durch den ordnenden Eingriff des Staates (als Konjunktur-, Struktur- und Sozialpolitik) garantiert werden38. In dieser allgemeinen Begriffsbestimmung trifft der Ausdruck „Organisierter Kapitalismus“ die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Der von William Appleman Williams und seinen Schülern39 verwendete Begriff des „corporate capitalism“ für die amerikanische Organisierung des Kapitalismus weist jedoch auf die Besonderheiten der amerikanischen Entwicklung hin. Zwar fällt auch in den USA — um die Formulierung von Friedrich Engels aufzunehmen — dem Staat die Funktion des „ideellen Gesamtkapitalisten“ zu, doch ist mit „corporate capitalism“ gemeint, daß der amerikanische organisierte Kapitalismus im Unterschied zu Deutschland 1. stärker an den vorgegebenen Strukturen der Großkorporationen orientiert ist und 2. die Staatsintervention sich häufig auf Rahmenregelungen beschränkt, so daß — und zwar namentlich in den Arbeitsbeziehungen — ein staatsfreier, gleichsam „privater“ Bereich ausgespart wird, den Gewerkschaften und Unternehmer im gegenseitigen Einverständnis durch gewohnheitsrechtliche Regelungen ausfüllen. Eine Übersetzung des Terminus „corporate capitalism“ ist nur schwer möglich, da er dem deutschen Leser falsche Assoziationen nahelegen würde: Weder ist damit gemeint, daß die Großkorporationen von sich aus gewissermaßen nach ihrem Bild Wirtschaft und Gesellschaft geformt hätten, noch daß ein ständestaatlich-korporatives Modell realisiert worden wäre. Das System der Arbeitsbeziehungen ist wesentlicher Bestandteil des amerikanischen organisierten Kapitalismus. Wir hatten oben gesehen, wie durch die majority rule des NLRA und durch tarifvertragliche Absprachen über union security, Seniorität, das innerbetriebliche Beschwerde- und Schlichtungsverfahren und zusätzliche Sozialleistungen die Beziehungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmen in den einzelnen Tarifverhandlungseinheiten gleichsam syndikalistisch strukturiert worden sind. Genau dieses syndikalistische Element findet sich aber auch — und es ist das Verdienst von Williams, darauf hingewiesen zu haben — in der Makrostruktur des Organisierten Kapitalismus. Und zwar sind Wirtschaft und Gesellschaft in die drei großen „Syndikate“ © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
96
Peter Lösche
Kapital, Arbeit und Staat organisiert. „Syndikalismus“ wird hier also weder in dem Sinn des revolutionären Arbeitersyndikalismus noch in dem des italienischen Faschismus gebraucht. Diese syndikalistische Organisation des Kapitalismus ergibt sich aus dem Lösungsversuch, den kapitalistischen Grundwiderspruch zwischen fortschreitender Vergesellschaftung der Produktion und profitorientierter privater Disposition über das Produktionsergebnis zu überbrücken40. Die Großunternehmen streben unter Einschaltung des Staates und bei Verständigung mit den Organisationen der Arbeiterbewegung Stabilität, ökonomische Planbarkeit und Sicherheit an41. Dabei bedeuten: Stabilität den Ausschluß eines auf die Vernichtung des Konkurrenten angelegten wirtschaftlichen Wettbewerbs und Abschirmung vor Wirtschaftskrisen; ökonomische Planbarkeit die Möglichkeit, unbeschadet außerökonomischer Faktoren mittel- und langfristig Produktion und Investition zu planen; Sicherheit den Schutz vor solchen politischen Eingriffen in das Wirtschaftssystem, die dieses andern oder überhaupt abschaffen würden, wie etwa die Vergesellschaftung profitbringenden Privateigentums. Es bleibt freilich zu betonen, daß der amerikanische organisierte Kapitalismus nicht das Ergebnis einer Verschwörung aufgeklärter Unternehmer gewesen ist, wie mehrere Historiker der „Neuen Linken“ nahezulegen scheinen42. Vielmehr vollzog sich die Staatsintervention zunächst gegen den vehementen Widerstand der Großkorporationen, bis schließlich deutlich wurde, daß der Staatseingriff die (kapitalistischen Systemen immanente) Profitmaximierung nicht nur nicht gefährdete, sondern auf Dauer überhaupt erst sicherstellte. Konkret: General Motors und Ford haben die Organisierung ihrer Betriebsangehörigen durch die Automobilarbeitergewerkschaft United Automobile Workers (UAW) zunächst mit allen Mitteln bekämpft und die National Association of Manufacturers hat sich der Arbeits- und Sozialgesetzgebung des New Deal widersetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die öffentliche Meinung sich gegen die Gewerkschaften sowie gegen die Sozialregelungen des New Deal wandte, hat es weder bei General Motors noch bei Ford eine gegen die Gewerkschaften gerichtete „roll back“-Strategie gegeben, noch versuchte die Washingtoner Lobby der National Association of Manufacturers den Social Security Act widerrufen zu lassen. Dies illustriert, daß es anfänglich Widerstand gegen staatliche Sozialinterventionen gab, daß aber die Gewerkschaften als Element des organisierten Kapitalismus schließlich akzeptiert worden sind. Allerdings hat es den Typ des „aufgeklärten“ Unternehmers gegeben, personifiziert etwa in Mark Hanna, Arthur H. Young von U. S. Steel oder Gerad Swope von General Electric, der bereits Mitte der zwanziger Jahre den Vorsitzenden der AFL, William Green, aufgefordert hatte, die Arbeiter seines Unternehmens in Industriegewerkschaften zu organisieren43. Auf die Geschichte des amerikanischen organisierten Kapitalismus kann hier nicht näher eingegangen werden. Laissez faire und Sozialdarwinismus wurden spätestens im New Deal durch Schlagworte wie Kooperation, Koordination, Verantwortung abgelöst. Mit Kooperation war dabei die Zusammenarbeit von © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Arbeiterbewegung und New Deal
97
Kapital, Arbeit und Staat gemeint, was gleichwohl die Akzeptierung von Gewerkschaften durch Unternehmer nicht notwendig implizieren mußte. Diese Dreisäuligkeit wurde als Organisationsprinzip etwa schon vor dem Ersten Weltkrieg in der National Civic Federation, der der Industrielle Mark Hanna ebenso wie der AFL-Vorsitzende Samuel Gompers und der Marinestaatssekretär Franklin D. Roosevelt angehörten, oder der Kriegsverwaltungswirtschaft während des Ersten Weltkrieges praktiziert. Je bedeutender die gesellschaftliche Funktion einer Dienstleistung oder eines Produktes war, um so stärker und schneller wurde die dreisäulige syndikalistische Kooperation in einem Wirtschaftsbereich realisiert, wie sich am Beispiel des Eisenbahnwesens im Ersten Weltkrieg und der Eisenbahngesetzgebung während der zwanziger Jahre zeigen läßt. Die Organisation der Wirtschaft im Weltkrieg und in der Eisenbahnindustrie hat die Strukturen des Organisierten Kapitalismus der dreißiger und vierziger Jahre vorgezeichnet und war für diesen Vorbild. Ziel war jeweils, industriellen Konflikt durch staatlich angeregte und geleitete Koordination von Kapital und Arbeit zu überwinden. Die Formierung des Organisierten Kapitalismus bedeutete nicht, daß die Konzepte und Politik des laissez faire in den dreißiger Jahren von der Bildfläche verschwunden gewesen wären. Vielmehr zog sich durch den New Deal ein politischer und ökonomischer Kampf zwischen denen, die Planung, Zentralisierung und stärkere Kartellisierung um der größeren technologischen und wirtschaftlichen Effizienz willen verlangten und denen, die Dezentralisierung und Entflechtung wirtschaftlicher Konzentration zur Rettung und Erhaltung von Individualismus und traditionellem Liberalismus forderten, ein Kampf von Monopolisten und Planern gegen Anti-Monopolisten. Diese Auseinandersetzung ist von Ellis W. Hawley nachgezeichnet worden44. Relevant in unserem Zusammenhang ist, daß der CIO — und in geringerem Ausmaß auch die Gewerkschaften der AFL — in den Massengüterindustrien sich als Gegenorganisation zu den Großkorporationen etablierte, die gleichsam dem „natürlichen“ Entwicklungsprozeß des Kapitalismus entsprungen waren. Dabei hat der Organisationsprozeß in Industriesyndikate sich in der Regel, aber nicht ausschließlich an den bestehenden Großunternehmen orientiert; er verlief je nach Industrie verschieden. In der Elektro- und Autoindustrie etwa waren die Unternehmen so zentralisiert und kartellisiert, daß sie auch von den Banken relativ unabhängig geworden waren und ihre Investitionen zum großen Teil aus eigenen Gewinnen schöpften. Ihnen gegenüber blieb die Arbeiterschaft in den zwanziger Jahren entweder hoffnungslos fragmentiert in Fachgewerkschaften organisiert und besaß am Tarifverhandlungstisch — von wenigen Spezialberufen abgesehen — so gut wie keine Macht (Elektroindustrie) oder jeder Ansatz zur Gewerkschaftsorganisation wurde brutal unterdrückt (Autoindustrie). Im Braunkohlenbergbau und in der Textilindustrie war die Situation genau umgekehrt: Hier standen starke Industriegewerkschaften einer großen Zahl mittlerer und kleinerer Unternehmer gegenüber, die durch Überproduktion und einen selbstmörderischen Konkurrenzkampf am Rande des 7 Winkler, Krise © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
98
Peter Lösche
Bankrotts standen und aus wirtschaftlichen Gründen die Lohnforderungen der Gewerkschaften nicht erfüllen konnten. Am Ende des New Deal standen den Korporationen in der Elektro- und Autoindustrie starke Industriegewerkschaften, in der Braunkohlen- und Textilindustrie den Industriegewerkschaften starke Unternehmensverbände gegenüber. Kartellisierung, vorübergehende Preisbindung, Einschränkung der Anti-Trust-Gesetze, Produktionsabsprachen und Produktionsbeschränkung waren die vom Staat offerierten Mittel, mit deren Hilfe die Industrie sich organisierte. Für die Gewerkschaften dagegen wurde das gesetzlich garantierte Recht der Arbeitnehmer auf Tarifverhandlungen zur Grundlage ihres Erfolgs und der Anerkennung durch Großkorporationen und Unternehmensverbände. Die New Deal-Gesetzgebung — so der National Industrial Recovery Act, der Wagner Act und, speziell für den Kohlenbergbau, der Guffey-Snyder Act und der Guffey-Vinson Act — begünstigte zwei parallellaufende Tendenzen: Die Kartellisierung sowie die Organisierung bisher nicht organisierter Bereiche der Wirtschaft (wie der Arbeiterschaft und der Unternehmer in Kohlebergbau und Textilindustrie). Die syndikalistischen Elemente des Organisierten Kapitalismus, die sich sowohl in seiner Makrostruktur wie im System der Arbeitsbeziehungen finden, gehören zu den wesentlichen Ursachen für die Fragmentierung der amerikanischen Industriegewerkschaften im New Deal und für die Absorption des politischen Potentials im CIO. Wagner Act und Tarifvertrag waren die Mittel, durch die der amerikanische organisierte Kapitalismus seine Grenzen selbstadaptiv so verschob, daß die — potentielle — Herausforderung von links — präventiv — durch Integration beantwortet wurde. Diese in spezifischer Weise im amerikanischen organisierten Kapitalismus entwickelten Integrationsmechanismen des Systems der Arbeitsbeziehungen sind in der bisherigen Literatur, die sich mit dem Scheitern von auf Gesellschaftsveränderung gerichteten politischen Ansätzen im CIO auseinandersetzte, viel zu wenig beachtet oder als selbstverständlich vorausgesetzt und damit übersehen worden. In diesem Zusammenhang sollte keineswegs der Eindruck entstehen, als sei die Ausformung des Systems der Arbeitsbeziehungen im New Deal für die amerikanische Arbeiterschaft negativ zu Buche geschlagen. An dieser Stelle soll vielmehr — sehr kursorisch — die Frage nach Nutzen und Kosten des Organisierten Kapitalismus für die bis in die dreißiger Jahre unterprivilegierten gesellschaftlichen Gruppen aufgeworfen werden. Auf der Nutzenseite steht an erster Stelle die größere soziale und wirtschaftliche Sicherheit der bis zum New Deal gewerkschaftlich Nichtorganisierten, den zumeist ungelernten oder angelernten Arbeitern in den Massengüterindustrien. Gewerkschaft und Tarifvertrag boten Schutz vor der Willkür des Unternehmers. Verglichen mit nichtorganisierten Industrien und Betrieben waren die Löhne organisierter Arbeiter in Zeiten des Konjunkturaufschwungs nicht höher, wohl aber waren in der Rezession — wie schon die Weltwirtschaftskrise gezeigt hatte und die Rezession 1937/38 erneut bewies — organisierte Arbeiter sicherer als Nichtorganisierte vor drastischen Lohnkürzungen45. Schließlich waren in der Regel die tariflieb © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Arbeiterbewegung und New Deal
99
zugestandenen Sozialleistungen in Form der „fringe benefits“ in den organisierten Industrien höher als in den nichtorganisierten. Diese verbesserte materielle Lage der gewerkschaftlich Organisierten wurde durch den gestiegenen politischen Einfluß der amerikanischen Gewerkschaften — besonders des CIO, der als einer der tragenden Pfeiler der Roosevelt-Koalition galt — abgesichert. Zu den Kosten des amerikanischen organisierten Kapitalismus gehörte es, daß die gewerkschaftlich Nichtorganisierten weder größere soziale Sicherheit noch andere materielle Vorteile errangen. Zu ihnen zählten die Farmarbeiter und die öffentlich Bediensteten, die bis heute vom Tarifverhandlungsgebot des NLRA ausgeschlossen sind46, die Arbeiter und vor allem Angestellten in gewerkschaftlich schlecht organisierten Industrien wie Dienstleistungen, Handel und Banken; und die Arbeiter in den Industrien der Südstaaten, die nur in Ausnahmefällen vom CIO organisiert werden konnten. Nicht organisiert waren oft auch die Arbeiter rassischer und ethnischer Minoritäten, denen durch korrupte Gewerkschaftspraxis oder Maßnahmen der union security der Eintritt in die Arbeiterorganisationen häufig verwehrt war, obwohl im Gegensatz zu den AFL-Gewerkschaften der CIO eine weniger diskriminierende Politik verfolgte. Auf der Kostenseite des Organisierten Kapitalismus schlagen also jene sogenannten Randgruppen zu Buche, die im System nicht repräsentiert sind. Eine amerikanische Revolutionsstrategie oder eine Strategie fundamentaler systemüberwindender Reformen konnte — theoretisch-systematisch, wenngleich kaum in der Praxis — allein hier, bei den marginal groups, eine soziale Basis für eine Massenbewegung finden47. Endlich gehört zu den Kosten des amerikanischen Kapitalismus seine zwar durch die Maßnahmen des New Deal abgemilderte, gleichwohl aber fortbestehende Krisenanfälligkeit, die Steigerung des wirtschaftlichen und sozialen Elends in der Rezession von 1937/38 und seine Unfähigkeit, trotz — wenn oft auch zögernder — Anwendung Keynes'scher Wirtschaftspolitik, die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise wie die Arbeitslosigkeit vor Beginn der Aufrüstung zum Zweiten Weltkrieg zu überwinden. IV Am Schluß unserer Überlegungen über die Integration der amerikanischen Gewerkschaften während des New Deal steht ein Katalog neuer Fragen: Warum wurde das im Wagner Act ausformulierte System der Arbeitsbeziehungen in den Industriegewerkschaften, die sich als Opposition zur AFL verstanden, unbestritten akzeptiert? Warum strebten alle politischen Fraktionen im CIO, auch die Kommunisten und Sozialisten, die Anerkennung ihrer Gewerkschaften als Tarifpartner an? Warum gab es in den dreißiger Jahren, in der gesellschaftlichen und politischen Krise der Großen Depression unter der Arbeiterschaft der Großbetriebe kein ausgeprägtes Klassenbewußtsein? Diese Fragen lassen sich auf Werner Sombarts altes Problem reduzieren, warum es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus gebe. Dahinter verbirgt sich — 7*
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
100
Peter Lösche
radikal gestellt — letztlich die Frage, ob der Marxismus Produkt spezifisch europäischer Bedingungen im 19. Jahrhundert ist oder nicht. Anders gewendet: Ist der Sozialismus überhaupt ein notwendiges Resultat des Kapitalismus? Eine Antwort laßt sich nicht allein aus der Analyse einer Periode der amerikanischen Geschichte wie der des New Deal geben, die Diskussion müßte vielmehr auf die gesamte Geschichte der organisierten Arbeiterbewegung und der Arbeiterschaft in den Vereinigten Staaten und Europa ausgedehnt werden. Jenes am Anfang unserer Untersuchung bereits gestreifte Problem der langfristig in der amerikanischen Geschichte wirkenden Strukturen und Tendenzen, die die Integration der Arbeiterbewegung mitverursachten, stellt sich hier erneut. Es wird nur durch einen Vergleich der amerikanischen und europäischen Sozialgeschichte gelöst werden können, der es ermöglicht, spezifisch amerikanische Bedingungen herauszuarbeiten und allgemeine, in der Geschichte kapitalistischer Systeme liegende Entwicklungen zu erkennen. Im folgenden wird — sehr verkürzt — auf einige relevante Faktoren hingewiesen, ohne daß wir damit den hypothetischen Charakter einer Antwort aufheben könnten. Uns scheint, daß die wesentlichen Vorentscheidungen für das Fehlen einer sozialistischen Massenbewegung in den USA und damit auch für die Integration des CIO in den Organisierten Kapitalismus bereits im 19. Jahrhundert in der Gründungsphase der organisierten Arbeiterbewegung gefallen sind. Während in Europa die feudale Tradition die Zugehörigkeit des einzelnen zu einer konkreten sozialen Gruppe und damit auch die des Arbeiters zu einer bestimmten Klasse mit einem entsprechenden Klassenbewußtsein vorgeprägt hatte, gab es in den Vereinigten Staaten keinen Feudalismus; die amerikanische Gesellschaft war in ihrer Ausgangssituation von vornherein offener48. Die Solidarität besonders der deutschen Arbeiterschaft wurde durch staatliche Verfolgung und Unterdrückung noch verstärkt. Während hier nach dem Scheitern der Bourgoisie in der 48er-Revolution und im preußischen Verfassungskonflikt die Arbeiterorganisationen um Bürgerrechte, gleiche Wahlchancen und bessere Bildungsmöglichkeiten kämpfen mußten, genossen die amerikanischen Arbeiter spätestens seit der politischen Emanzipation der „middle class“ in der Jack-
sonian Democracy diese Rechte. Die deutsche Arbeiterbewegung war von Anfang an politisch, d. h. auch am Staat orientiert, dessen aus dem aufgeklärten Absolutismus überkommene Bürokratie in der take-off-Phase wiederholt Initialzündungen zur Industrialisierung gegeben hatte. Im Gegensatz dazu orientierten sich die amerikanischen Gewerkschaften an den privaten Unternehmen, die im wesentlichen Amerika industrialisiert hatten: Eine nationale staatliche Bürokratie gab es zu jener Zeit nicht, die Bürokratien der Einzelstaaten waren nur äußerst schwach entwickelt. Die Staatsorientierung der deutschen und die Unternehmensorientierung der amerikanischen Arbeiterbewegung wurden noch durch die Lage auf dem Arbeitsmarkt in der Gründungsphase der Arbeiterorganisationen bekräftigt: Während in den Vereinigten Staaten durch Arbeitskräfteknappheit der einzelne (Fach-)Arbeiter individuell dem Unternehmer seine Arbeitskraft so teuer wie möglich verkaufen konnte, war sein © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Arbeiterbewegung und New Deal
101
deutscher Kollege auf Grund des Arbeitskräfteüberschusses auf den Staatseingriff, auf Arbeits- und Sozialgesetzgebung angewiesen, um seine elende soziale Lage zu verbessern49. Aus dieser Überlegung wird verständlich, warum amerikanische Gewerkschaften traditionell „Brot und Butterziele“ verfolgt haben, während in Deutschland (Lassalle!) der Sozialismus gleichsam von Staats wegen eingeführt werden sollte50. Schließlich hat ein ideologisches Moment die Möglichkeiten für eine sozialistische Massenbewegung in den Vereinigten Staaten schon sehr früh begrenzt. Es ist immer wieder und bis in unsere Gegenwart argumentiert worden, daß die Frontier, also unbesiedeltes Land im Westen, als Sicherheitsventil der amerikanischen Gesellschaft gewirkt habe und daß die soziale Mobilität in den Vereinigten Staaten erheblich großer gewesen sei als in Europa: Dies habe das Entstehen eines proletarischen Klassenbewußtseins und entsprechender politischer Arbeiterorganisationen verhindert. Beide Thesen sind heute nicht mehr haltbar51. Gleichwohl haben sie als Kernstück der amerikanischen Ideologie, des Traums vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten, konkret gegen alle Ansätze für eine sozialistische Bewegung gewirkt. Alle diese Faktoren, die hier nur kurz genannt wurden, haben dazu beigetragen, daß die amerikanischen Gewerkschaften einschließlich des CIO sich in den dreißiger Jahren schnell an den reoganisierten Kapitalismus angepaßt haben. Während des New Deal hat es keine qualitative Änderung, sondern im wesentlichen nur die Ausdehnung der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung auf die Massengüterindustrien gegeben52. Der Aktualitätsbezug unserer Untersuchung liegt auf der Hand: Die polemisch gestellte Frage, ob die amerikanischen Gewerkschaften heute ein „Hort der Reaktion“ oder eine „Basis für Revolution“ seien, läßt sich nicht beantworten, ohne die Funktion der Gewerkschaften im syndikalistisch Organisierten Kapitalismus, wie er sich im New Deal herausgebildet hat, zu analysieren. Die naive Hoffnung auf spontane Arbeiteraufstände und Revolten der gesellschaftlichen Randgruppen übersieht diesen Zusammenhang, unterschätzt das Integrationspotential kapitalistischer Systeme.
Anmerkungen 1 Zunächst nur aus taktischen Gründen „non-partisan“ genannt, um den Bruch mit den Traditionen der Gewerkschaftsbewegung nicht als zu offenkundig erscheinen zu lassen. Innerverbandlich wurde die Labor's Non-Partisan League zeitweise als Ansatz und Beginn für eine amerikanische Arbeiterpartei nach britischem Vorbild ausgegeben. 2 Mitglieder dieser Gewerkschaften waren in der Mehrzahl osteuropäisch-jüdische Einwanderer, die den Sozialismus aus ihren Geburtsländern in die Neue Welt mitgebracht hatten. 3 Viele der späteren CIO-Betriebsvertrauensleute waren 1931/32 in die oft von Kommunisten kontrollierten Arbeitslosenräte geströmt und dort für Betriebsarbeit in der Massengüterindustrie geschult worden. 4 Für das zahlenmäßige Wachstum der amerikanischen Gewerkschaften und speziell des CIO in den dreißiger Jahren vgl. M. Derber, Growth and Expansion, in: ders. u.
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
102
Peter Lösche
Ε. Young Hg., Labor and the New Deal, Madison, Wisc. 1957 und W. Galenson, The CIO Challenge to the AFL, A History of the American Labor Movement 1935—1941, Cambridge/Mass. 1960 583 ff. 5 Vgl. A. M. Schlesinger Jr., The Age of Roosevelt I : The Crisis of the Old Order, 1919—1933, Boston 1957, I I : The Coming of the New Deal, Boston 1958; I I I : The Politics of Upheaval, Boston 1960. Schlesingers episch ausladende Geschichte des New Deal gilt als ein Standardwerk amerikanischer Geschichtsschreibung. Zur Kontroverse um die I nterpretation des New Deal vgl. P. Lösche, Revolution u. Kontinuität. Zur Auseinandersetzung um den New Deal in der amerikanischen Geschichtswissenschaft, in: Festschrift H. Herzfeld, Berlin 1972, 121—153. 6 Zur Vorgeschichte des NLRA vgl. M. Derber, The American Idea of Industrial Democracy 1865—1965, Urbana 1970. 7 Vgl. aus der umfangreichen Literatur zum Wagner Act u. a. I. Bernstein, The New Deal Collective Bargaining Policy, Berkeley 1950; ders., Turbulent Years, A History of the American Worker, 1933—1941, Boston 1970; Derber/Young, passim; H. A. Millis u. E. C. Brown, From the Wagner Act to Taft-Hartley, A Study of National Labor Policy and Labor Relations, Chicago 1965. 8 Bei der Wahl eines Tarifverhandlungsrepräsentanten kann auch die Alternative „no union“ (in der Regel vom Unternehmer verlangt und unterstützt) zur Abstimmung gestellt werden. 9 Dabei wurde in den Entscheidungen des National Labor Relations Board die Geschichte der Tarifverhandlungen in den einzelnen Unternehmen (soweit es eine solche gab), die besonderen Bedingungen in einer Industrie und die Interessen und Argumente von Unternehmer und Gewerkschaft berücksichtigt. 10 Vgl. Derber/Young, 131. 11 Ebd., 320 ff. In der Untersuchung wurden die abgeschlossenen Tarifverträge nicht danach differenziert, welchem Gewerkschaftsverband — AFL oder CIO — die vertragschließende Gewerkschaft angehörte. 12 Derartige Regelungen wurden und werden in Deutschland im allgemeinen nicht tarifvertraglich, sondern gesetzlich — heute in der Bundesrepublik vor allem durch das Betriebsverfassungsgesetz — festgelegt. — Die Stärke der amerikanischen Gewerkschaften im Betrieb zeigt sich u. a. darin, daß verglichen mit der Bundesrepublik die „shop stewards“ zwei Funktionen wahrnehmen, die bei uns juristisch säuberlich voneinander getrennt sind: Sie nehmen sowohl die Aufgaben der Gewerkschaftsfunktionäre als auch der Betriebsräte wahr. 13 Die Anbringung eines „union label“ kann durchaus auch im Interesse des Unternehmers liegen. So richtete diese Kennzeichnung der Waren in der Textilindustrie sich besonders gegen asiatische Importe und kaum gegen Betriebe, die gewerkschaftlich nicht organisiert waren. 14 Durch die Dezentralisation der Tarifverhandlungen und die Abgeschlossenheit der Gewerkschaften in den Tarifverhandlungseinheiten wird u. U. die Korruption auf der Ebene der Betriebsgewerkschaftsorganisationen ermöglicht. Eine Untersuchung der Korruption in den amerikanischen Gewerkschaften müßte von den Implikationen des Systems der Arbeitsbeziehungen ausgehen. 15 Dies trifft noch mehr auf die AFL-Gewerkschaften zu, die aus historischen Gründen föderalistischer aufgebaut waren als die CIO-Industriegewerkschaften und die in dieser Hinsicht eine noch größere Affinität zum dezentralisierten System der Arbeitsbeziehungen besaßen. 16 Zu ihnen gehörten der National Defense Mediation Board, National Defense Advisory Commission, Office of Production Management, War Production Board, War Manpower Board, National War Labor Board, Office of Price Administration. Zu den verschiedenen im Krieg errichteten Behörden vgl. u. a. Derber, Industrial Democracy, 368 ff.; J . Seidman, American Labor From Defense to Reconversion, Chicago 1953; © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Arbeiterbewegung und New Deal
103
B. Stein, Labor's Role in Government Agencies During World War I I , Journal of Economic History 17. 1957, 390—408; Μ. Derber, Labor-Management in World War II, Current History 48. 1965, 340—345; D. de Schweinitz, Labor and Management in a Common Enterprise, Cambridge/Mass. 1949. 17 So gab es in den Jahren zwischen Pearl Harbor und dem Ende des Weltkriegs nur insgesamt 14 700 Arbeitsniederlegungen, in denen weniger als ein Promille der Gesamtarbeitszeit verlorenging. — Als schärfste Waffe konnte der War Labor Board immer mit der Übernahme des Betriebes, in dem gestreikt wurde, durch die Regierung drohen, was in einigen Fällen auch tatsächlich geschah. 18 Ebenso wurde eine Maßnahme der union security, die aus einem Kompromiß zwischen Gewerkschaftern und Unternehmern hervorgegangen war, die „maintenance of membership“ Klausel, in die meisten während des Weltkriegs geschlossenen Tarifverträge aufgenommen: Danach mußten für die Laufzeit des Tarifvertrags Gewerkschaftsmitglieder in ihrer Organisation bleiben und durften nur in den ersten fünfzehn Tagen nach Abschluß eines neuen Vertrags aus der Gewerkschaft austreten. 18 Etwa 3000 in verschiedenen Industrien und Betrieben zur Steigerung der Produktion eingerichtete Labor-Management-Committees erfüllten nicht so sehr die ihnen eigentlich zugedachte Funktion, als daß sie vielmehr die öffentliche Meinung über die Rolle der Gewerkschaften in der Kriegsproduktion günstig beeinflußten. Auch dies bestätigte und verfestigte die Integration der Gewerkschaften. Zu den Labor-Management-Committees vgl. Schweinitz, passim. 20 Eine größere Untersuchung des Verfassers über die politischen Organe und Fraktionen im CIO wird demnächst erscheinen. 21 Der Fair Labor Standards Act wurde vom CIO politisch unterstützt, von der AFL dagegen bekämpft. Die AFL-Führer befürchteten, daß der Mindeststundenlohn zugleich Höchststundenlohn werden würde. 22 Anders als die Facharbeiter in den AFL-Gewerkschaften waren die in den CIOGewerkschaften organisierten ungelernten und angelernten Arbeiter gegenüber der Konkurrenz von Arbeitslosen anfälliger, weil sie im Produktionsprozeß mit nur geringen Kosten und leichter austauschbar waren als Spezialisten. 23 Dies traf auch für die ALP in New York City zu. 24 Ich bin zu dieser Einsicht auf Grund des Studiums verschiedener Nachlässe und Bestände des Archivs der ACWA und der Akten und Briefwechsel in der Roosevelt Library in Hyde Park, New York, gelangt. Interviews mit Bessie Hillman, der Witwe Sidney Hillmans, Jacob Potovsky und David Dubinsky haben dieses Ergebnis bestätigt. 25 Memorandum to the President von George L. Berry am 22. 6. 1936 (F. D. Roosevelt Library, President's Personal File). 26 Diese These läßt J . D. Greenstone (Labor in American Politics, New York 1969) mehrfach durchblicken und führt sie für das Verhältnis von Demokraten und UAW in Detroit und Michigan aus. Aus vielen Gründen scheint mir seine Argumentation nicht stichhaltig, die empirische Basis für diese These zu dünn zu sein. 27 Die Literatur über die Geschichte der Kommunistischen Partei Amerikas ist sehr umfangreich. Vgl. hierzu J . Seidman, Communism in the United States, A Bibliography, New York 1969. Meine Thesen über die Rolle der CPUSA stützen sich u. a. auf mehrere unveröffentlichte Dissertationen, in denen die Rolle der Kommunisten in lokalen Betriebsgewerkschaftsorganisationen untersucht worden ist, und auf das Studium der einschlägigen Periodika der Partei. Vgl. R. W. Ozanne, The Effects of Communist Leadership on American Trade Unions, Diss. University of Wisconsin. 1954; F. Th. Malm, Local 201, UE-CIO: A Case Study of a Local Industrial Union, Diss. Massachusetts Institute of Technology, 1946; W. H. Riker, The CIO in Politics 1936—1946, Diss. Harvard University, 1948. 28 Genaue Zahlen über die Stärke des kommunistischen Einflusses im CIO lassen sich nicht geben, da ein Teil der Kommunisten immer im Untergrund blieb. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
104
Peter Lösche
29 Vgl. hierzu F. Th. Malm, Local 201; Oral History Project Columbia University, Interviews mit Swope und Emspak. In mehreren Inverviews mit Gewerkschaftsführern, die in der Elektroindustie aktiv waren, wurde mir diese These bestätigt. 30 Vgl. W. Sombart, Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus? (Tübingen 1906), Darmstadt 1969, 40 ff. 31 Zu denen, die von Roosevelt für öffentliche Ämter gewonnen wurden, gehörten auch ehemalige Sozialisten. S. Hillman, J . Potovsky u. a. übernahmen hohe Funktionen im Regierungsapparat und Ehrenämter in der Demokratischen Partei; G. L. Berry, 1936/37 Vorsitzender der LNPL, wurde auf den freiwerdenden Senatorenposten von Tennessee berufen. 32 Ph. Taft hat in einer detaillierten Studie über die Gewerkschaften des Staates Kalifornien gezeigt, daß der Schwerpunkt der politischen Arbeit des CIO — und gleichermaßen nach dem Zweiten Weltkrieg auch der AFL — auf der einzelstaatlichen Ebene lag: Labor Politics American Style: The California State Federation of Labor, Cambridge/Mass. 1968. 33 Die kommunalpolitische Aktivität des CIO kann an folgendem Beispiel illustriert werden: Die CIO-Gewerkschaften in Cincinnati, Ohio, begannen 1939 eine eigene Wahlkampfmaschine aufzubauen, um eine gewerkschaftsfreundliche Mehrheit im City Council zu erreichen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte das City Council jeweils einen Sheriff gewählt, der durch gezielte Polizeieinsätze die Organisierung der Textilarbeiter in den ACWA verhindert hatte. Erst nach mehrjähriger intensiver Kleinarbeit war der CIO in der Stadt kommunalpolitisch so erfolgreich, daß das City Council einen Gewerkschaftskandidaten zum Sheriff bestimmte. 34 1942 erschien eine halboffiziöse Publikation der katholischen Kirche, in der aus der katholischen Soziallehre heraus der closed shop, also die strikteste und in der amerikanischen Öffentlichkeit umstrittenste Maßnahme der union security, befürwortet wurde. Vgl. Rev. Τ. L. Toner, The Closed Shop, Washington, D. C. 1942. 35 Die Ähnlichkeit des von der ACTU Detroit vorgelegten Konzeptes mit den Vorschlägen von Cohen und Kaliski zu Wirtschaftsräten in der November-Revolution ist verblüffend. Eine Untersuchung, unter welchen historischen Bedingungen derartige — ständestaatlich-korporativ gefärbte — Konzeptionen entwickelt werden, wäre äußerst lohnend. 36 Meine Einschätzung der Rolle der ACTU ergibt sich aus einem intensiven Studium der Akten mehrerer Locals der UAW in Detroit, den Protokollen der Bundeskongresse der ACTU und der ACTU-Presse. 37 Zu den Faktoren, die in den dreißiger Jahren die Integration der Gewerkschaftsbewegung beschleunigten und eine gesellschaftspolitische Alternative im Keime erstickten, ist — neben anderen — schließlich noch der Antikommunismus und Antisozialismus zu rechnen. Darunter ist nicht die rationale Auseinandersetzung mit dem Kommunismus und der Kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten — etwa dem Zick-Zack ihrer Parteilinie — zu verstehen, sondern Antikommunismus als gesellschaftlich relevantes Vorurteil. Der Kommunismusvorwurf ist gegen den CIO und alle seine Einzelgewerkschaften, gegen die politischen Organe des CIO (LNPL, ALP, PAC) — gleich, ob es in ihnen kommunistische Fraktionen gab oder nicht — und gegen prominente Gewerkschaftsführer (bei Sidney Hillman verbunden mit antisemitischen Tönen) erhoben worden. Führend in dieser Propagandakampagne war seit dem Ende der dreißiger Jahre das von dem texanischen Kongreßabgeordneten Martin Dies geleitete House-Committee-On-Un-American-Activities. 38 Zur Definition des Begriffs „Organisierter Kapitalismus“ vgl. R. Hilferding, Die Aufgaben der Sozialdemokratie in der Republik, in: Sozialdemokratischer Parteitag Kiel 1927 (Protokoll), Berlin 1927, 165—184; H.-U. Wehler, Probleme der modernen deutschen Wirtschaftsgeschichte, in: ders., Krisenherde des Kaiserreichs 1871—1918, Göttingen 1970, 291—311; J . Kocka, Unternehmensverwaltung und Angestelltenschaft
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Arbeiterbewegung und New Deal
105
am Beispiel Siemens 1847—1914, Stuttgart 1969, 315 ff.; Η. Α. Winkler, Pluralismus oder Protektionismus? Verfassungspolitische Probleme des Verbandswesens im deut schen Kaiserreich. Wiesbaden 1972, 33 f. 39 Vgl. W. A. Williams, The Contours of American History, Chicago 1966. Vgl. auch die weiter unten aufgeführten Arbeiten von Kolko und Radosh. 40 Im Abschnitt über „corporate capitalism“ sind einige Anregungen aus der Einleitung zu einem demnächst erscheinenden Reader über Probleme des Spätkapitalismus (W. D. Narr u. C. Offe Hg.) übernommen worden. 41 Vgl. hierzu G. Kolko, The Triumph of Conservatism, A Reinterpretation of American History, 1900—1916, Chicago 1967, 3. 42 Dieser Eindruck jedenfalls wird zuweilen von Historikern der „Neuen Linken“ erweckt, die — entgegen ihrem eigenen theoretischen Anspruch — in personalistischer Weise wenige „aufgeklärte“ Unternehmer wie Gerad Swope von General Electric in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen stellen. Sie abstrahieren vorschnell und damit mißlingt ihnen eine Typologie des amerikanischen Großunternehmers. 43 Der Vorschlag Swopes entsprang nicht idealistisch-humanistischen Einsichten, sondern entsprach dem ökonomischen Interesse seines Unternehmens: Wurde die kontinuierliche und effiziente Produktion bei General Electric in den zwanziger Jahren durch (mögliche) Streiks der in mehr als einem Dutzend Berufsgewerkschaften organisierten Facharbeiter bedroht, so hätte industrielle Organisation diese Gefahr erheblich vermindert. Zum Angebot von Swope an Green vgl. R. Radosh, The Development of the Corporate Ideology of American Labor Leaders, 1914—1933, Diss. University of Wisconsin, 1967. 44 Vgl. Ε. W. Hawley, The New Deal and the Problem of Monopoly, A Study in Economic Ambivalence. Princeton, N. J . , 1966, und seinen Beitrag in diesem Band. 45 Zum Problem der unterschiedlichen oder gleichen Lohnhöhe von gewerkschaftlich organisierten und nichtorganisierten Arbeitern vgl. G, H. Hildebrand, The Economic Effects of Unionism, in: Ν. W. Chamberlain u.a. Hg., A Decade of I ndustrial Rela tions Research 1946—1956, New York 1958. Dort auch weiterführende Literatur. 46 Der NLRA galt — und gilt — auf Grund der „interstate commerce clause“ der amerikanischen Verfassung nur für jene Arbeitnehmer, die in Betrieben beschäftigt sind, deren wirtschaftliche Aktivität über die Grenzen eines Einzelstaates hinausging. Nur knapp die Hälfte aller Beschäftigten fiel in den dreißiger Jahren unter das Tarifverhandlungsgebot des Wagner Act. Diese Zahl ist heute durch die extensive Auslegung der „interstate commerce clause“ in Entscheidungen des Verfassungsgerichts erheblich ausgedehnt worden. 47 Dabei stellt sich dann natürlich sofort wieder die Frage nach den selbstadaptiven Fähigkeiten des Kapitalismus. Die angestrebte Ausdehnung des NLRA auf Farmarbeiter und — in modifizierter Form — auf öffentlich Bedienstete deutet bereits in diese Richtung. Es ist kein Zufall, daß die amerikanischen Farmarbeiter-Gewerkschaften sich heute dagegen wehren, unter die Jurisdiktion des NLRA zu fallen: Ihre Machtposition würde durch die restriktiven Regelungen des Arbeitsgesetzes, besonders durch eine Limitierung des Streikrechts, geschwächt werden. 48 Das Feudalismusargument für das Fehlen des Sozialismus in den Vereinigten Staaten entspringt einer langen Tradition, zu der sich auch Marx und Engels in ihren Briefen an amerikanische Freunde geäußert haben. L. Hartz hat diese These neuerdings einseitig und geistesgeschichtlich limitiert überbetont: Wegen des Fehlens des Feudalismus in der Neuen Welt könne es in den USA weder eine radikale (Sozialismus) noch reaktionäre (Toryismus) politische Partei geben: The Liberal Tradition in America, An Interpretation of American Political Thought since the Revolution, New York 1955. 49 Nach Mitte der neunziger Jahre hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt verkehrt: Während in den Vereinigten Staaten bis in unsere Gegenwart eine strukturelle © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
106
Peter Lösche
Arbeitslosigkeit bestand, stieg in Deutschland die Arbeitslosenquote bis 1914 nicht wesentlich über 2 Prozent. Beide Entwicklungen verstärkten gleichwohl die Staatsorientierung der deutschen Arbeiterorganisationen, die in der Senkung der Arbeitslosigkeit einen Erfolg ihrer auf den Staat gerichteten Politik sahen, bzw. die Unternehmensorientierung der amerikanischen Gewerkschaften, die sich in den Betrieben mit Hilfe der union security gegen die Arbeitslosen verschlossen. 50 Ein anderer Faktor kommt hinzu, der die Solidarität der deutschen Arbeiterbewegung bestärkte, der amerikanischen schwächte: Die deutsche Arbeiterschaft ist im Vergleich zur amerikanischen immer homogener gewesen. Rassische, ethnische und religiöse Fragmentierung hat im amerikanischen Proletariat nur schwer ein kollektives Bewußtsein aufkommen lassen. 51 Die Frontierthese hat am schärfsten formuliert F. J . Turner, The Significance of the Frontier in American History, in: R. A. Billington Hg., Frontier and Section, Selected Essays of F. J . Turner, Englewood Cliffs, N. J . , 1961, 37—62. Zur Widerlegung dieser These vgl. C. Goodrich u. S. Davison, The Wage Earner in the Westward Movement, I u. II, Political Science Quarterly 50. 1935 u. 51. 1936, 161—185 und 61—116; Μ. Kane, Some Considerations on the Safety Valve Doctrine, Mississippi Valley Historical Review 23. 1936, 169—188; F. A. Shannon, The Homestead Act and the Labor Surplus, American Historical Review 41. 1936, 637—665, Zum Vergleich der sozialen Mobilität in Europa und den USA vgl. S. M. Lipset u. R. Bendix, Social Mobility in Industrial Society, Berkeley 1959. Lipset und Bendix haben gezeigt, daß soziale Mobilität charakteristisch für jede kapitalistische Industriegesellschaft ist und daß es in den Vereinigten Staaten keine größere soziale Mobilität als in Europa gibt. Vertikale Mobilität ist häufig mit horizontaler, d. h. geographischer, verwechselt worden, die in der Neuen Welt größer ist. 52 Ich schließe mich hier weitgehend der Interpretation von D. Brody an, der allerdings von einer anderen Ausgangsbasis her die amerikanischen Gewerkschaften im New Deal und nicht im Kontext des Organisierten Kapitalismus beurteilt. Vgl. D. Brody, The Emergence of Mass-Production Unionism, in: J . Braeman u. a. Hg., Change and Continuity in Twentieth Century America, I, Columbus 1964, 221—262, u. D. Brody, Labor and the Great Depression: The Interpretative Prospects, Labor History 13. 1972, 231—244.
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal Zum Verhältnis von agrarischer Demokratie und organisiertem Subventionismus in der Zwischenkriegszeit Von HANS-JÜRGEN PUHLE
Die Wirtschaftskrise und die Politik des New Deal im vierten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts haben die politische Landschaft der Vereinigten Staaten von Amerika entscheidend verändert. Zwar bewies das politische System der USA (im Gegensatz zum ökonomischen, das einfach zusammenbrach) in der Krise und danach genügend Kraft, sich selbst zu regenerieren und mittels partieller und sektoraler Reformen wieder zu stabilisieren1, ohne in die autoritären, faschistischen oder nationalsozialistischen Verformungen kontinentaleuropäischer Länder zu verfallen. Auf der anderen Seite aber führten der Ruf der privaten Wirtschaftssektoren nach Staatshilfe und die damit in Zielen und Mitteln keineswegs immer übereinstimmende (und daher notwendigerweise Konflikte auslösende) größere Bereitschaft der Regierung zu — für amerikanische Verhältnisse theoretisch immer noch höchst unorthodoxer — staatlicher Intervention in Wirtschaft und Gesellschaft nicht nur zu einem veränderten Führungsstil der Exekutive, zu einer Vergrößerung des bürokratischen Apparates2 und zu Modifikationen der politischen Ideologien und Wahlkampfthemen, sondern vor allem auch zu einem dauerhaften „renversement“ der politischen Koalitionen. Diese gesamtpolitische Koalitionsumschichtung hat nicht nur den Stellenwert einzelner sozialer und organisierter politischer Gruppen für die konkreten tagespolitischen EntScheidungsprozesse auf einzelstaatlicher wie nationaler Ebene verändert; sie hat sich auch nachhaltig auf den konkrete Veränderungen wesentlich träger registrierenden Bereich der politischen Kultur ausgewirkt3. Eine ganze Reihe vormals traditioneller Parteiaifiliationen wurde lockerer, etwa die der Neger des Südens oder vieler „Progressives“ des Mittelwestens an die Republikanische Partei; nach den etablierten hierarchischen Parteiapparaten (machines) der großen Städte geriet nun auch das faktische Einparteiensystem des demokratischen „Solid South“ in die ersten Krisen. Die „Roosevelt Coalition“ aus Liberalen und „Progressives“, organisierter Arbeiterschaft (Labor), Farmern und großen Teilen der städtischen Mittelklassen und traditioneller Demokraten4 veränderte aber nicht nur den Charakter der Demokratischen Partei, sondern sie bedeutete auch das Ende des selbständig organi-
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
108
Hans-Jürgen Puhle
sierten traditionellen agrarischen „Populism“, sowie des ländlichen wie städtischen „Progressivism“. Es ist einerseits kein Zufall, daß die zunehmende Wiederaufnahme alter populistischer und progressiver Forderungen und Programmpunkte seit dem Ende der sechziger Jahre zum größten Teil innerhalb der Demokratischen Partei vonstatten ging und fast immer zugleich anknüpft an die Politik des New Deal5. Auf der anderen Seite bedarf aber der Umstand einer Erklärung, daß das Protestpotential der jüngsten Zeit, das hinter solchen Forderungen steht, anders zusammengesetzt ist als noch in den zwanziger und zu Beginn der dreißiger Jahre und daß es allem Anschein nach auch insgesamt schwächer geworden ist, jedenfalls bislang nicht in dem Maße wie die Populists und Progressives älteren Datums imstande gewesen ist, die eigenen Forderungen nach und nach wenigstens teilweise den beiden großen Parteien, Demokraten und Republikanern, aufzuzwingen6. Auf der Suche nach einer Erklärung soll in diesem Zusammenhang hier lediglich der agrarische Sektor näher untersucht werden, dessen Reaktion auf die Wirtschaftskrise und die Politik des New Deal aus einer Reihe von Gründen besonders interessant ist: — Erstens ist die endgültige Zähmung der seit der „reconstruction“ die ländliche Szenerie relativ kontinuierlich beherrschenden populistischen Protestbewegungen neben der Anerkennung der großen Gewerkschaften als ernsthafter politischer Koalitionspartner und den Anfängen einer Sozialgesetzgebung auf Bundesebene eine der wenigen nachwirkenden strukturellen Veränderungen durch die Politik des New Deal gewesen7. Aus der Tatsache, daß sich vor 1933 vor allem die Farmer des Mittelwestens und Südens, zeitweise auch die des pazifischen Nordwestens, durchgängig an den verschiedensten radikalen Protestbewegungen gegen die Politik der Regierungen und des „Big Business“ beteiligt haben, sie aber in dieser Funktion seit Ende der dreißiger Jahre nicht mehr in Erscheinung getreten sind, vielmehr heute agrarischer Protest (etwa der schwarzen „sharecroppers“ des Südens oder der mexicoamerikanischen „chicanos“ und Farmarbeiter) nicht mehr als solcher, sondern fast nur noch vermittelt (etwa durch die Bürgerrechtsbewegung und andere spezifische „issues“ deklassierter Gruppen) sichtbar wird8, läßt sich die Vermutung ableiten, daß es der Politik Franklin D. Roosevelts gelungen ist, für den Agrarsektor ähnliche Mechanismen der Integration und Besänftigung zu entwickeln wie für „big labor“9. Diese Vermutung soll hier ebenso überprüft werden wie die Frage, mit welchen Mitteln, zu wessen Nutzen und auf wessen Kosten der zur Debatte stehende Wandel bewerkstelligt wurde. — Zweitens läßt sich gerade auch an einer Analyse des agrarischen Sektors, dessen demokratisch-partizipatorischer Radikalismus in den USA zuzeiten sehr viel deutlicher ausgeprägt war als der der organisierten Arbeiterschaft, und vor allem an der Politik der großen politischen Agrarbewegungen deutlich machen, in welchem Maße womöglich bei den Angehörigen des Wirtschaftszweiges selbst die Bereitschaft zur Integration ins politische und Ökonomische System und zu © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
109
Kooperation mit der Regierung schon vorhanden war, also nur noch kanalisiert werden mußte. — Drittens sind die Mechanismen der staatlichen Intervention für den Agrarsektor ohne Zweifel am längsten vorbedacht und debattiert und am umfassendsten konzipiert und später durchgesetzt worden, ebenso wie sie auch bewußt von den Farmern selbst akzeptiert wurden, so daß sich gerade für diesen Bereich die Untersuchung der Diskussionen über das Verhältnis von staatlichen Eingriffen zu freien Unternehmerentscheidungen, von Marktmechanismen zu Planungsinstrumenten lohnt. — Viertens trat die Reformpolitik des New Deal, was den seit den Verfassungsvätern und Jefferson traditionell mit „Demokratie“ assoziierten Agrarsektor angeht10, mit wesentlich größeren Ansprüchen auf Verbreiterung demokratischer Partizipation, Selbstbestimmung und Kontrolle an als bei ihren Hilfestellungen für „big business“ (das schon eher mit Darwinismus zu assoziieren wäre) oder „big labor“. Die New Dealer konnten dabei an die direktdemokratischen Forderungen der Populists der neunziger Jahre ebenso anknüpfen wie an Jeffersons Ideal des „yeoman farmer“ und Andrew Jacksons „grass roots democracy“ der Pionierzeiten11. Die Frage nach der Möglichkeit und den Bedingungen breiter Basisdemokratie bei gleichzeitig intensivierter Staatsintervention stellt sich also für den landwirtschaftlichen Bereich besonders scharf12. — Fünftens ist die Frage nach der Reaktion des Agrarsektors auf Krisen im zunehmend organisierten Kapitalismus13 für vergleichende Analysen besonders fruchtbar, weil bestimmte strukturelle wirtschaftliche Entwicklungstendenzen und Krisenprädispositionen Ländern mit vergleichbarem industriellen Entwicklungsstand gemeinsam sind (Abnahme des Anteils der landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung und des Anteils der Landwirtschaft am Bruttosozialprodukt; veränderte Technologien, Industrialisierung, Urbanisierung, Migrationen etc.), also im Vergleich vor allem auch die grundlegenden Unterschiede der Ausgangspositionen und der Bezugssysteme Beachtungfindenkönnen. Bevor jedoch im einzelnen die Politik der amerikanischen Agrarbewegungen in der Agrarkrise der zwanziger Jahre und ihr Verhältnis zu den Reformen des New Deal behandelt werden, muß kurz die Rede sein vom Einfluß früherer populistischer Traditionen auf die Politik und die politische Kultur der USA. Unter Populism sollen dabei in unserem Zusammenhang auch jene regional weiterwirkenden Bewegungen nach dem Ende der organisierten dritten Partei (Populist Party) nach 1896 miterfaßt werden, die von der traditionellen Literatur meistens nicht mehr dazu gerechnet werden, aber doch unzweideutig in der Tradition des agrarischen Populismus stehen. Ausgeklammert bleibt dagegen der städtische Sektor des Progressivism. So wenig sich der Begriff „Populism“ als analytische Kategorie des Vergleichs zu eignen scheint14, so wenig sinnvoll ist es doch, im Rahmen des amerikanischen Bezugssystems einen — wie es scheint — kontinuierlichen Traditionsstrang durch verschiedene Benennungen unscharfer erscheinen zu lassen15. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
110
Hans-Jürgen Puhle I
Die politische Kultur der USA ist entscheidend geprägt worden von agrarischen Traditionen, die allerdings nicht ohne weiteres mit denen Europas zu vergleichen sind. Die amerikanische Landwirtschaft ist in der Tradition der schon kommerzialisierten englischen Landwirtschaft des 18. Jahrhunderts und der Lockeschen Ideologie des individuellen Privateigentums als des entscheidenden Konstituens politischer Rechte16 von Anfang an kapitalistisch und marktorientiert gewesen. Schon die Verfassungsväter hatten den Grundbesitz als Produktionsfaktor und Spekulationsobjekt begriffen, an sich gleichberechtigt neben dem Handels- und Bankenkapital der Städte, und der Streit zwischen „Hamiltonians“ und „Jeffersonians“ bis ins erste Drittel des 19. Jahrhunderts hinein war mehr darüber geführt worden, welcher der beiden Sektoren stärker gefördert werden sollte, hatte aber bereits keine kategoriale Andersartigkeit der agrarischen Produktion mehr postuliert (wie es z. Β. kontinentaleuropäische Ideologen noch bis ins 20. Jahrhundert hinein taten)17. Im Gegensatz zu Europa fehlten auch feudale und vorkapitalistische Traditionen. Das Idealbild des Jahrhunderts der nach Westen noch offenen Grenze und der aufeinanderfolgenden Einwanderungswellen war der extensiv wirtschaftende und mobile Pionierfarmer, kein freier Bauer nach europäischem Muster, sondern eher eine zuweilen romantisch verklärte, abenteuernde Variante des auf sich selbst gestellten „wagenden Unternehmers“, der in apologetischen europäischen Wirtschaftsgeschichten auf den industriellen Bereich beschränkt bleibt. Auch die Negersklaverei der südstaatlichen Plantagenwirtschaft vor dem Bürgerkrieg ermangelt des Elements der gegenseitigen personalen Beziehung zwischen Grundeigentümer und abhängigem Landarbeiter und kann daher nicht als feudal, sondern nur als verdinglichter Produktionsfaktor innerhalb eines spezifischen Systems frühkapitalistischer Ausbeutung interpretiert werden18, an dem im übrigen auch die formale Abschaffung der Sklaverei noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein relativ wenig änderte: die Pläne der prononciert industriekapitalistischen radikalen Republikaner zur Aufteilung und politischen Reglementierung des südlichen Großbesitzes scheiterten, und durch den Kompromiß der 1876 im Grundsatz abgeschlossenen „reconstruction“ blieben Wirtschafts- und Herrschaftssystem des Südens erhalten; die Einführung eines im Effekt den ostelbischen Zuständen nicht ganz unähnlichen Mini-Pacht (sharecropping)Systems (statt Lohnarbeit) ersetzte lediglich die juristische Verdinglichung der Neger durch ökonomisch erzwungene Rechtlosigkeit und Abhängigkeit19. Der Sieg des nordöstlichen Industriekapitalismus im Bürgerkrieg war mithin unvollständig geblieben. Die im Norden und Süden herrschenden Klassen waren zwar eindeutig stärker polarisiert worden, aber vernichtet war keine. Die Hilfe der Farmer des Mittelwestens im Krieg war zwar von seiten der Union bereitwillig akzeptiert worden, jedoch blieben diese ebenso wie die Arbeiter und unteren Mittelschichten der Städte und die Neger (und armen Weißen) des Südens von der Herrschaft ausgeschlossen — eine Konstellation, die nicht © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
111
nur für die weitere Sonderentwicklung des Südens und auch der südstaatlichen Spielarten des Populismus wichtig wurde (auf die gelegentlich zurückzukommen sein wird), sondern die vor allem auch neben der zunehmenden Industrialisierung, Urbanisierung und verkehrstechnischen Erschließung des Nordens, Mittelwestens und später auch des Westens die weitere Entwicklung des amerikanischen Industriekapitalismus ebenso entscheidend mitbestimmt hat wie die der gegen ihn gerichteten, sich seit den siebziger Jahren periodisch dichter formierenden populistischen Protestbewegungen. Ob es ratsam ist, den amerikanischen Bürgerkrieg — wie Barrington Moore behauptet — als die „letzte kapitalistische Revolution“ zu begreifen20, kann jedoch in unserem Zusammenhang ebensowenig diskutiert werden wie andere zum Teil kontroverse (oder zeitweilig kontrovers gewesene) Grundfragen der amerikanischen Geschichte, die für die Vorgeschichte unserer Problematik bedeutsam sind: die Diskussion um die Zentralbank, die Nachwirkungen Jeffersonscher Ideen und das basisdemokratische Konzept der Ära Jackson21, die Bedeutung der offenen Grenze (frontier) und der Einwanderungswellen22 und die „Stufen“ der Industrialisierung und der Entwicklung des zunehmend organisierten Kapitalismus23. Es kann hier lediglich festgehalten werden, daß nach 1865 das Vordringen der Industrialisierung in die agrarische Welt, am sinnfälligsten demonstriert am Bau der transkontinentalen, von den Farmern zunächst erbittert bekämpften Eisenbahnen24, die zunehmende Attraktion der sich schneller entwickelnden, prosperierenden Städte und ihrer Gewerbezweige25, der Preisverfall wichtiger landwirtschaftlicher Produkte und die rapide Vermehrung der Farmbetriebe in den siebziger Jahren26, die wachsende Verschuldung und die für die Anwendung der immer notwendiger werdenden Massenproduktionstechniken generell zu kleinen Betriebsgrößen27 zusammen mit bis 1897 stagnierenden oder sinkenden Profiten28 konstitutiv wurden für das Klima vehementen agrarischen Protests vor der Jahrhundertwende. Dieser Protest der Farmer gegen die Ökonomische und politische Übermacht der Städte, die Monopole und Eisenbahngesellschaften, Banken und Trusts des „big business“ und gegen die deflationistische Währungspolitik der Regierung fand sein erstes organisatorisches Vehikel in der 1867 von Ο. Η. Kelley (mit zunächst unpolitischer Zielsetzung) gegründeten Grange (Patrons of Husbandry), die sich nach der Krisenpanik von 1873 schnell politisierte und die Agitation der siebziger Jahre beherrschte29, und danach in anderen Vereinigungen wie dem Agricultural Wheel, den Brothers of Freedom, den Parteien der eine inflationierte Währung befürwortenden Greenback-Bewegung30, der Farmers' Mutual Benefit Organization, der Farmers' Alliance, die 1877 gegründet und in den achtziger Jahren zur stärksten Organisation wurde31, und schließlich in deren parteipolitischem Ableger, der People's Party (oder zuzeiten auch: Populist Party) von 1891/2, der ersten einflußreichen „dritten Partei“ der USA, die zusammen mit den Gruppen der starken Bimetallistenbewegung die Politik der neunziger Jahre nachhaltig geprägt hat32. Die Hauptagitationspunkte (issues) der genannten Bewegungen variierten © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
112
Hans-Jürgen Puhle
und verschoben sich zeitweilig unter Beibehaltung der wesentlichen Ziele: Erhöhung der Produktionspreise, Herabsetzung der Produktionskosten und Verringerung der langfristigen Verschuldung. Hatte die frühe Grange wie auch die zahlreichen kleineren Organisationen33 vor allem um einheitliche und niedrige Eisenbahnfrachtsätze (railroad regulation), bessere Kreditbedingungen (vor allem im Süden) und gegen die hohen Profitspannen des Zwischenhandels, seit Mitte der siebziger Jahre auch für genossenschaftliche Marktorganisationen und Steuererleichterungen gekämpft, so forderten die Farmers' Alliance und die Populist Party darüber hinaus nicht nur weiterreichende wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen wie stärkere Marktorganisation und stützende Staatsinterventionen nach dem „SubtreasuryPlan“ des Dr. Macune34, sondern sie nahmen auch allgemeinpolitische Forderungen zur Erweiterung demokratischer Partizipation aus der Jacksonschen Tradition auf wie die nach der direkten Volkswahl der (noch in den einzelstaatlichen Parlamenten gewählten) US-Senatoren, direkten Vorwahlen (primaries), Frauenstimmrecht, „recall“ der Amtsträger, Initiative und Referendum35. Zum Hauptthema der vehement und demagogisch geführten Kampagnen der neunziger Jahre wurde jedoch (in sehr viel stärkerem Maße als in den europäischen Ländern) der schon seit den siebziger Jahren vernehmbar gewesene36 Ruf nach „free silver“, nach Wiedergutmachung des „Verbrechens von 1873“, d. h. der Wiederherstellung des Silberstandards der Währung neben dem Goldstandard („Doppelwährung“) im Verhältnis 1:16, einer inflationären Politik des leichten Geldes also, die den Interessen nicht nur der verschuldeten Farmer und kleinen Handwerker (z. Β. Knights of Labor), sondern auch der Greenbacker und der gerade 1889/90 der Union neu beigetretenen silberproduzieren den Rocky Mountains-Staaten entgegenkam ebenso wie allen anderen, die dem östlichen „big business“ durch eine Schwächung der Währungsstabilität eins auswischen wollten37. Der Populismus des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts war keine einheitliche Bewegung, ebensowenig wie die amerikanische Landwirtschaft einheitlich war. Die Zentren der Grange lagen vor allem im östlichen Mittelwesten (Ohio, Indiana, Michigan), aber auch in Pennsylvania und den nordatlantischen Staaten, die sich zunehmend der Veredelungs- und Milchwirtschaft zuwandten, in denen die Grange noch heute ihre Hausmacht hat; sie griff aber auch bereits in die Zentren der Maisproduktion (und Schweinezucht) im östlichen Teil des westlichen Mittelwestens (Illinois, Wisconsin, Iowa, Minnesota) aus, wo sie zeitweise die Parlamente beherrschte und staatliche „railroad regulation“ und Maximaltarife durchsetzte. Farmers' Alliance und Populist Party eroberten zusätzlich die Getreideanbaugebiete des westlichen Mittelwestens (Kansas, Nebraska und die Dakotas) und drangen weiter nach Nordwesten vor38. Stark war die Populistenpartei auch in Texas und vor allem in den vornehmlich Baumwolle und Tabak produzierenden Südstaaten, in denen sie sich auf die Southern Alliance stützen konnte, die — aus ökonomischer Notwendigkeit — © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
113
im Ganzen noch radikaler und fortschrittlicher war als die Gruppen des Mittelwestens. Die ersten Forderungen nach stärkerer Intervention der Bundesregierung, nach Mindestpreisen, Produktions- und Verkaufskontrolle sind schon in den neunziger Jahren gerade aus dem Süden gekommen39. Es gab auch erhebliche Unterschiede in der Organisationsdichte der einzelstaatlichen Bewegungen40; ihr politisches Gewicht war oftmals stark abhängig von der Überzeugungskraft der regionalen politischen Führer, Ideologen, Propagandisten, Organisatoren und Demagogen, von denen gerade diese Bewegung eine außerordentlich bunte Reihe hervorgebracht hat41. Die politischen Ziele im konkreten waren wesentlich gebunden an die Anforderungen der jeweiligen Wirtschaftsweise, d. h. an das wichtigste Anbauprodukt (vor allem Weizen und Mais im Mittelwesten und Baumwolle im Süden) und damit an die Region und die überschaubare politische Einheit, in der Regel den Einzelstaat, der im Gegensatz zur Union mit dem Einsatz der verfügbaren Energien entscheidend mitgestaltet werden konnte. Innerhalb einer Region (oder vergleichbarer Regionen) aber herrschte seit den Tagen der Grange eine erstaunliche Solidarität unter den Farmern, auf der die späteren Agrarbewegungen des 20. Jahrhunderts aufbauen konnten. Geht man nur von der Seite des Bewußtseins aus, so könnten in den neunziger Jahren in den USA die Farmer vor allen anderen eine (objektiv in sich allerdings nicht einheitliche) Klasse genannt werden, zudem mit einem ausgeprägt dichotomischen Gesellschaftsbild, das den Klassenfeind deutlich in den großen Städten, dem „big business“ und den „gold bugs“ in Mark Hanna's republikanischer Parteimaschine lokalisierte42, nicht zu reden von den zahllosen Weltverschwörungsmythen der populären Agitation43. Die Unterschiede in den Besitzgrößen44, im Status der Besitzer45 und im Wert der Farm46 traten demgegenüber wesentlich mehr in den Hintergrund als etwa in Deutschland oder Frankreich — nicht zuletzt auf Grund des Fehlens feudaler Traditionen, dank der Jefferson-Jackson'schen Gleichheitsideologie und der Locke'schen Grundlegung des kapitalistischen Systems und ihrer sozialdarwinistischen Weiterentwicklung zur These von der rein personalisiert begriffenen „equal opportunity“ für jeden47. Das Problem der Neger und der armen Weißen (auch der „dirt farmers“) des Südens wurde auch in der Programmatik der Populisten zunächst ebenso verdrängt wie die Frage nach den Arbeitsbedingungen abhängiger Pächter und Landarbeiter überhaupt48, zumal die Betroffenen bis weit ins 20. Jahrhundert die Energie zu eigener Organisation nicht aufbrachten49. Die Populisten verloren zwar die Präsidentschaftswahlen 1892 und vor allem die mit großem Aufwand (zusammen mit den Demokraten) geführte Bryan-Kampagne von 1896, die zuweilen den Eindruck erweckt hatte, als ginge es allein um die Alternative: Goldstandard oder Doppelwährung, und sonst nichts50. Die dritte politische Partei verkümmerte danach, die Agitationsund Protestbereitschaft der Farmer wurde mit dem Konjunkturaufschwung seit 1897 (der anhielt bis 1920) geringer, und manche Forderungen der Populisten gerieten vorübergehend in Vergessenheit51. Die populistische Bewegung aber 8 Winkler, Krise © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
114
Hans-Jürgen Puhle
wirkte weiter. Zahlreiche ihrer Forderungen wurden nach der Jahrhundertwende aufgegriffen von den Progressives sowohl innerhalb der beiden großen Parteien als auch unabhängig von ihnen, und vieles wurde sogar in relativ kurzer Zeit verwirklicht wie z.B. die Volkswahl der US-Senatoren 1913, die Einführung der nationalen Einkommensteuer 1913 und der „primaries“ in verschiedenen Staaten, das allgemeine Frauenstimmrecht 1920, die staatliche Kontrolle der Eisenbahntarife und ansatzweise Monopolkontrolle, in einigen Einzelstaaten sogar der „recall“ der Amtsträger. Gemessen an der Durchsetzung konkreter Einzelforderungen und der Wahrung vertretener Interessen können die Populisten im 20. Jahrhundert, selbst wenn es sie in einer einheitlich organisierten Form nicht mehr gab, als eine der erfolgreichsten politischen Bewegungen Amerikas überhaupt gelten. Es soll an dieser Stelle nicht die Grundsatzdebatte über den „wahren Charakter“ des Populismus in extenso referiert und wieder aufgenommen werden, die bis Mitte der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts zahlreiche amerikanische Historiker beunruhigt hat, die nahezu alles, vom latenten Faschismus52 über Xenophobie und Antisemitismus53 bis zum latenten Sozialismus54, in den populistischen Bewegungen entdecken konnten55. Es muß aber festgehalten werden, daß selbst dann, wenn man Abstriche macht von den übertriebenen und einseitigen Darstellungen des hinterwäldlerischen, antisemitischen und autoritären Potentials des Populismus (das übrigens kaum größer gewesen sein dürfte als das anderer Sektoren der amerikanischen Gesellschaft) diese Bewegung auch nicht als „Sozialrevolutionär“ oder sozialdemokratisch mißverstanden werden darf. Der Populismus begann als agrarischer Protest in der Krise gegen die Ungleichheit der Chancen (opportunities) und die günstigeren Rahmenbedingungen der Industrie und des „big business“ (nicht gegen die Industrialisierung an sich!), gegen die Deflationspolitik der Regierung zugunsten der Industrie und das gleichzeitige laissez-faire auf dem Agrarsektor. Die Populisten kämpften nicht gegen den Kapitalismus, sondern nur gegen dessen zunehmende Organisierung, bzw. später gegen den Ausschluß der Landwirtschaft von der Organisierung. Die Farmer waren selber kapitalistische Unternehmer, nur nicht ganz große. Der Populismus ist damit, wenn man die Wirtschaftssektoren nicht voneinander isoliert, eine versuchte Revolte kleinerer und mittlerer Unternehmer gegen die großen gewesen56, die zwar als Revolte mißlang, in der Form beständiger „progressiver“ Reformpolitik aber auf die Dauer Erfolg hatte, wobei man auf die Forderungen der großen Zahl der ganz Schwachen und der Abhängigen nicht einmal Rücksicht nehmen mußte, da dank des Nichtvorhandenseins einer starken sozialistischen Arbeiterbewegung von dieser Seite vorerst keine Gefahr drohte. Auch die radikalen basis-demokratischen, egalitären und partizipatorischen Forderungen der Populisten sind „revolutionär“ nur in jenem alten englischen Wortsinn, in dem „revolution“ noch die Wiederherstellung ursprünglich gewesener und dann verdorbener Zustände bedeutet; sie richten sich gegen das © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
115
Prinzip übergreifender Organisation, sei es im Trust, sei es in der politischen „machine“; sie verlangen nicht mehr Demokratie, und schon gar nicht mehr soziale Gerechtigkeit, sondern nur die Wiederherstellung der alten, noch nicht so sehr organisierten Form von Demokratie, bzw. dem, was man vor dem Erscheinen von Beard's „Economic Interpretation of the Constitution“ darunter verstand. Die Ideologie des Populismus zielt nicht auf die Veränderung in der Zukunft; sie ist rückwärtsgewandt57. Der individuelle Eigentümer und Unternehmer sollte unabhängig von Wirtschaftsweise, Betriebsgröße und Konjunktur seine wirtschaftliche Freiheit, Gleichberechtigung und Profitchance zurückerhalten, die die zunehmende Konzentration, Organisation und Unüberschaubarkeit der Wirtschaft ihm weitgehend genommen hatten. Aber paradoxerweise passen — streng genommen — die in Aussicht gestellten Mittel nicht zur Zielsetzung und die konkrete Politik nicht zur Ideologie: Denn die Wiederherstellung jenes manchesterliberalen Urzustands mit Profit für alle sollte nach den Vorstellungen der Populisten unter Beteiligung der Betroffenen die gesamtgesellschaftliche Organisation, also der Staat, trotz allen Verlangens nach Dezentralisation zur Not sogar die Bundesregierung übernehmen, zunächst durch Reglementierung der großen, dann auch durch Subventionierung der kleinen Unternehmer58. Hier liegt auch die entscheidende Bedeutung des Populismus für die weitere amerikanische Politik: Konkrete Regulierungsfunktionen der Regierung und Staatsintervention in Wirtschaft und Gesellschaft (und nicht nur Rahmensetzung), bis dahin fast tabu, werden in Kauf genommen, wenn nicht sogar gefordert, allerdings immer gekoppelt mit dem Anspruch auf angemessene „demokratische“ Beteiligung der Interessenten an Entscheidungen und Geldverteilung. In diesem Punkt (wie in vielen anderen) knüpft der „Progressivism“ des 20. Jahrhunderts, dessen agrarische Wurzeln lange Zeit unterschätzt worden sind59, bruchlos an den Populismus an und führt dessen Politik weiter. Die konsequente Realisierung populistischer Ziele implizierte gegen die Intentionen ihrer Urheber den Beginn des Weges zu „big government“. Die ins 20. Jahrhundert weiterwirkenden populistischen Traditionen haben sich jedoch, eingebunden in spezifische regionale Besonderheiten und bezogen auf unterschiedene Wirtschaftsweisen und Gesellschaftsordnungen (vor allem im Mittelwesten, im Süden und im Südwesten) in verschiedenen Varianten ausgeprägt: Die einen betonen die Notwendigkeit der Staatsinterventionen stärker (Progressivism); andere mehr die Gleichheitsrhetorik vom „kleinen Mann“60 (z. Β. Huey Long), wobei beide Elemente die gelegentliche Ver bindung mit isolationistischen, imperialistischen oder rassistischen Zielsetzungen oder „law-and-order“-Parolen nicht ausschließen. Im Amerika der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts stehen so weit voneinander entfernte Politiker wie George McGovern (South Dakota)61 und George Wallace (Alabama)62 beide in der Tradition des Populismus.
8*
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
116
Hans-Jürgen Puhle II
Die konkrete Interessenlage und die politische Handlungsmotivation der Populisten waren allerdings ebensowenig wie die langfristigen (und sich erst später deutlicher abzeichnenden) Implikationen ihrer Strategie (big government) Hindernisse dafür, daß um die Jahrhundertwende der Farmsektor im Hinblick auf kurzfristige Forderungen, politische Techniken und Rhetorik von allen Sektoren der amerikanischen Wirtschaft und Gesellschaft als der am meisten aufgefächerte und bei weitem „demokratischste“ gelten konnte. Es wäre zwar angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und zunehmenden Organisation des kapitalistischen Systems in den außeragrarischen Sektoren falsch, eine ungebrochene Kontinuität und Dominanz „agrarischer Demokratie“ von Jefferson bis 1900 anzunehmen; es ist aber zweifellos richtig, die folgende Entwicklung des 20. Jahrhunderts als einen „Verfall der agrarischen Demokratie“ zu interpretieren63. Der agrarische Populismus in den USA hat gleichzeitig zwei Gesichter: das demokratisch-partizipatorische und das interessenpolitische, das des radikalen Protests und das der kalkulierten und egoistischen Reform und Stabilisierung. Die Entwicklung seit der Jahrhundertwende begünstigte allerdings eindeutig die zweite Tendenz; ihren Höhepunkt sollte sie im New Deal der dreißiger Jahre erreichen. Bedeutsam für die weitere Entwicklung bis in die dreißiger Jahre sollte auch werden, daß nach dem Debakel der „systemwidrigen“ dritten Partei im Jahre 1892 schon 1896 deutlich wurde, daß der kontinuierlich über ein Drittel der Bevölkerung stellende Mittelwesten keineswegs einheitlich „populistisch“ wählte64; man wählte zwar seitdem vielfach populistische oder „progressive“ Kandidaten, jedoch entweder in regionaler organisatorischer Zersplitterung oder ad personam aus den beiden großen Parteien, wobei bis in die dreißiger Jahre republikanische „Progressives“ überwogen, während im Süden (mit mehr als einem Viertel der Gesamtbevölkerung) die Vormachtstellung der Demokratischen Partei vorerst ungebrochen blieb65. Der Boden für die seit der Koalitionsumschichtung der dreißiger Jahre generell festzustellende geringe Parteibindung der amerikanischen Farmer und für ihre vergleichsweise große Bereitschaft zum „shifting vote“66 wurde im Mittelwesten schon seit der Jahrhundertwende bereitet. Die politischen Konzepte und Bewegungen der Jahre zwischen der Jahrhundertwende und dem Ersten Weltkrieg, die in der Regel unter dem (wegen der Gefahr der Vereinfachung) nicht ganz unproblematischen Begriff der „Progressive Era“ zusammengefaßt werden und die zum Teil in den letzten zehn Jahren durch überzeugende Analysen, die übereinstimmend den stabilisierenden Charakter des „Progressivism“ unterstreichen, eine gründliche Umwertung erfahren haben67, können hier nicht im einzelnen behandelt werden. Es muß genügen, bestimmte Kontinuitätslinien zu betonen und die Auswirkungen auf den agrarischen Sektor in die Betrachtung mit einzubeziehen: Weder © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
117
— der einseitig auf interventionistisches „trust busting“ festgelegte „New Nationalism“ des in manchen Punkten eher konservativen und offen imperialistischen Theodore Roosevelt und seiner späteren „Bull Mooser“68, — der in ähnlicher Weise vor allem auf Eisenbahn- und sonstige Regulierung abzielende Wisconsin'sche „Progressivism“ Robert La Follette's69 oder — die zaghaften Korporationsideen des späten Wilson70, noch — die gegen die „Bosse“, politischen „machines“ und Korruption gerichtete Agitation der „muckrakers“ in den Städten71 oder — der diffuse städtische Liberalismus etwa Herbert Crolys, des den „Fluch der Größe“ (curse of bigness) anprangernden Louis D. Brandeis und der individuellen Wettbewerb bei möglichst geringfügiger Intervention favorisierenden „New Freedom“ Wilsons von 1912, der mit zur Grundlage der späteren Ideologien der Demokratischen Partei wurde, des New Deal ebenso wie der Kennedyschen „New Frontier“ und Johnsons „Great Society“72, alle diese Konzepte auf der „Suche nach einer Ordnung“78 vermochten nicht (und versuchten es auch nicht), die kontinuierlich zunehmende Organisation der außeragrarischen Wirtschaftsbereiche — zum Teil in neuen Formen und in neuen Sektoren — aufzuhalten, sondern leisteten in der Regel sogar Hilfestellung dabei74. Andererseits benachteiligten sie im Gegensatz zu Mark Hanna's Republikanern vor der Jahrhundertwende aber auch nicht den Agrarsektor, der sich ohnehin konjunkturell etwas erholt hatte, wenn auch die späteren Idealisierungen eines „goldenen Zeitalters“ landwirtschaftlicher Prosperität zwischen 1909 und 1914 (die den „Paritäts“-Berechnungen zugrunde gelegt wurden) übertrieben sein mögen75. Im Gegenteil waren „trust busting“, „railroad regulation“, partielle Staatsintervention und Wiederherstellung des klein- und mittelbetrieblichen Wettbewerbs alte Forderungen der Farmer, und die engagierte basis-demokratische Reformagitation der „muckrakers“ setzte überwiegend die populistische Kampagne in den Städten fort. Daneben führten die von den „progressiven“ Politikern (besonders von Theodore Roosevelt) geförderte, gegenüber Europa sehr spät entwickelte76 Tendenz zur Verwissenschaftlichung der Landwirtschaft und Agrarpolitik (soil conservation etc.) und schließlich die Organisation der Ernährungswirtschaft im Ersten Weltkrieg77 zu einer folgenreichen neuen Kanalisierung der politischen Energien und Gruppen des Agrarsektors.
III Die amerikanische Agrarpolitik der zwanziger Jahre ist überwiegend gekennzeichnet durch — die Herausbildung neuer, sich von dem Versuch der gesamtpolitischen Intervention abkehrender, allmählich als pressure groups funktionierender Organisationsformen des landwirtschaftlichen Sektors und © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
118
Hans-Jürgen Puhle
— zunehmende Ansätze und Pläne zur Bewältigung der Folgen des Konjunkturrückgangs im Zuge der nach dem Boom der Kriegsjahre 1920 einsetzenden und — von kurzfristigen sektoralen Schwankungen abgesehen — bis in die allgemeine Krise zum Ende der zwanziger Jahre hinein dauernde „farm depression“78. Der Boden für die neuen Organisationen war gut vorbereitet worden: während die traditionellen Instrumente der Außenhandelspolitik dank der kontinuierlich hochprotektionistischen und ohnedies von industriellen Interessen beherrschten Zollpolitik79 im Agrarexportland USA80 zu keiner Zeit dasselbe Interesse der Farmer auf sich gezogen hatten wie etwa das der vor noch ernsteren und breiter gefächerten Problemen stehenden deutschen Großagrarier81, war die innere Organisation der Landwirtschaft in der Progressive Era erheblich fortgeschritten. Technische Verbesserungen der Qualität des Saatguts, die Erfindung der Mehrzweck-„combine“, fortschreitende Mechanisierung und Arbeitsrationalisierung82, die zunehmende Gründung von Branchenverbänden und An- und Verkaufsgenossenschaften83 zur Organisation der Märkte spiegeln sektorale Aspekte einer umfassenden Gesamtentwicklung aus Elementen der Selbstregulierung und dem wider, was in Preußen „innere Kolonisation“ und in Amerika „extension“ hieß. Dieser Prozeß wurde von staatlicher Seite, vor allem auch von der Bundesregierung mit wachsender Energie unterstützt: Die bereits in den sechziger Jahren begonnene und in den späten achtziger Jahren durch die Bewilligung zusätzlicher Bundesmittel intensivierte wissenschaftliche Beschäftigung mit konkreten landwirtschaftlichen Produktionsproblemen84 hatte insbesondere durch den 1911 veröffentlichten Bericht der drei Jahre zuvor von Präsident Theodore Roosevelt eingesetzten Kommission zum Studium des Landlebens85 neuen Auftrieb erhalten. Die ersten „Farm Bureaus“ auf lokaler Ebene, die die Arbeit der jetzt in vermehrtem Umfang eingesetzten technischen Landwirtschaftsberater (county agents) koordinieren und fördern sollten86, waren noch im selben Jahr im Staat New York und in Texas eingerichtet worden; ähnliche Organisationen folgten wenig später87. Die Diskussionen und Bemühungen um Bodenkonservierung und -Verbesserung und produktionsbezogene Fortbildung der Farmer erreichten in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre einen Höhepunkt88; die genossenschaftliche Marktorganisation und die Kreditmöglichkeiten wurden, zum Teil in enger Zusammenarbeit mit großen Banken, verbessert89. Wie sehr sich der Diskussionsstand und die kurzfristigen politischen Prioritäten seit den Tagen der Populist Revolt verschoben hatten, machten die neuen, nach der Jahrhundertwende gegründeten Farmerorganisationen wie die in der Tradition der Grange stehende American Society of Equity90 und die mehr an die alte Farmers' Alliance anknüpfende Farmers' Union91 (beide 1902 gegründet) ebenso deutlich wie die Politik der immer noch einflußreichen Gruppen der ehemaligen Southern Alliance92 und der gleichzeitig entstehenden und oft personell oder sachlich untereinander verbundenen „progressiven“ Bewegungen in Iowa (unter Führung der drei Wallaces)93 und Wisconsin (unter Führung © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
119
des Gouverneurs und späteren Senators und unabhängigen Präsidentschaftskandidaten von 1924, Robert La Follette)94 oder später — in und kurz nach dem Weltkrieg — das schnelle Scheitern der radikaleren, Staatsinterventionismus propagierenden und hochgradig isolationistischen Non Partisan League mit ihrem Schwerpunkt in North Dakota und den angrenzenden Staaten oder der Farmer-Labor Party in Minnesota95. Entscheidend für die neue Entwicklung war jedoch keineswegs allein die relative Prosperität der Jahre von der Jahrhundertwende bis in den Krieg. Sie fügt sich vielmehr ein in die in der Progressive Era eingeleitete, auch auf anderen Sektoren spürbare Gesamttendenz zur Ersetzung umfassender Protestkundgebungen durch Kooperation bei konkreten Reformarbeiten, freilich unter Wahrung der jeweiligen Interessen95a. Deutlich wird dieser Bruch im Stil der agrarischen Politik auch am Charakter jener Organisation, die seit den zwanziger Jahren immer mehr zur (bis heute) beherrschenden Interessenvertretung der amerikanischen Landwirtschaft wurde, dem 1919 ins Leben gerufenen Zusammenschluß der regionalen und einzelstaatlichen Farm Bureaus: der American Farm Bureau Federation (AFBF). Die AFBF stellt das organisatorische Vehikel einer von allgemeinpolitischen Aspirationen auf sektorale Dimensionen reduzierten pressure group-Politik dar. Sie stand nur noch teilweise, regional vereinzelt und bedingt in der Tradition der populistischen Bewegungen, am meisten noch der ursprünglichen Grange (die als eigene Organisation immer konservativer und einflußloser wurde)96. Die basis-demokratischen und partizipatorischen Forderungen traten in den Hintergrund und wurden ersetzt durch gezielten Druck und Lobbyismus in Washington, eine bürokratische Zentralverwaltung, Koordination und Konsultation97. Das politische Ziel der Federation war nicht mehr, die für den Agrarsektor in ihren Folgen unter Umständen bedrohliche zunehmende Organisation der anderen Wirtschaftssektoren zu verhindern oder zu zerschlagen, sondern statt dessen die Landwirtschaft selber möglichst ebenso effektiv zu organisieren, zumindest in politischer Hinsicht. Die Abkehr vom ausschließlich rückwärtsgewandten, ländlichen „Fundamentalismus“ und der individuellen Eigentümerideologie wurde damit auch in der Praxis vollzogen. Die AFBF wurde zum Sprachrohr eben jenes Drittels der (größeren) Farmer, deren Anteil am Wert der vermarkteten Agrarerzeugnisse über 80 % betrug98. Die AFBF war keine Massenorganisation und wollte keine sein; ihr Mitgliederbestand — davon mehr als die Hälfte im östlichen Mittelwesten (Ohio, Illinois, Michigan, Indiana und Iowa) und in Texas ging auf Grund der geforderten hohen Beiträge99 in schlechten Zeiten sogar erheblich zurück und überschritt bis 1940 nie die halbe-Million-Grenze100. Was mehr zahlte, waren eine weitreichende, erstmals auch institutionell abgesicherte Organisation und die engen Kontakte zur Regierungsbürokratie und zum Kongreß. Für beides hatten die Politik der Progressive Era und der Erste Weltkrieg die Grundlagen bereits geschaffen: © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
120
Hans-Jürgen Puhle
— Die einzelstaatlichen Farm Bureaus waren zwar (ebenso wie erst recht die AFBF) private Verbände; aber die Tatsache, daß der in ihre Kompetenz gegebene „extension service“ überwiegend und schließlich fast ganz aus öffentlichen Mitteln (vor allem des US Department of Agriculture) finanziert wurde und die praktisch als Zweigstellen der Farm Bureaus wirksamen (ursprünglich auch privat finanzierten) „county agents“ bereits 1924 zu 93 % aus öffentlichen Geldern bezahlt wurden101, gab ihnen de facto den Charakter einer subventionierten, halboffiziösen Korporation, ohne daß es notwendig gewesen wäre, sie in ähnlicher Weise wie etwa die deutschen Landwirtschaftskammern auch de jure zu einer staatlichen Veranstaltung zu machen102. Hinzu kommt noch, daß sich außerdem von Anfang an interessierte Banken, Handelskammern, Eisenbahngesellschaften, Industrie- und Handelsunternehmen (vor allem große Landmaschinenhersteller und Versandhäuser) an der Finanzierung der Arbeit der Farm Bureaus beteiligt hatten103, also nicht nur die organisatorische und finanzielle Verklammerung des Agrarsektors mit den staatlichen Stellen, sondern auch mit den anderen Sektoren eines zunehmend Organisierten Kapitalismus gewährleistet war104. — Zum anderen hatten nach erfolglosen Ansätzen zu einer alle Farmer umfassenden agrarischen Organisation vor dem Weltkrieg105 die Konsultationspraktiken der Kriegsjahre, insbesondere bei der Ausarbeitung des Emergency Food Production Act 1917, in den diversen Food Control-Verwaltungen und im Farmers' National War Council — Institutionen, die zum Teil später unter anderer Bezeichnung weiterlebten106 — nicht nur bei den Agrarfunktionären das Bewußtsein der (nach Möglichkeit) solidarischen Gesamtvertretung eines wichtigen Produktionszweigs und die Einsicht in die dadurch eröffneten Einflußmöglichkeiten verstärkt, sondern auch auf der Seite der staatlichen Verwaltung die Bereitschaft erhöht, den Repräsentanten der organisierten Landwirtschaft größeren Einfluß einzuräumen. Obwohl auch die sich immer mehr auf den Nordosten zurückziehende Grange und die vor allem die getreideproduzierenden Staaten der Great Plains vertretende Farmers' Union zur Washingtoner Lobby gehörten, gelang es der AFBF dank ihrer guten Organisation, ihrer weniger radikalen Politik und ihrer penetrant staatstragenden Rhetorik107 in den in Gesetzgebung und Politik ohnehin auf konservativ gestimmten zwanziger Jahren, diese neuen Einflußmöglichkeiten zeitweise dergestalt zu monopolisieren, daß Rivalen geradezu von einer „Nebenregierung“ (assistant government) der AFBF in Agrarfragen sprachen108. Das Scheitern konkurrierender politischer Gruppen wie der Non Partisan League, der Progressives und diverser Farmer-Labor-Verbindungen und die Wahlniederlage La Follette's 1924109 trugen ebenso noch zusätzlich zur Stärkung der AFBF bei wie die Tatsache, daß es nach dem neuerlichen Fall der Baumwollpreise 1925 gelang, auch die Agrarorganisationen der Südstaaten weitgehend in die Federation zu integrieren und damit die starke Allianz zwischen den Interessenvertretungen des immer noch (wenn auch nicht mehr lange) © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
121
überwiegend republikanischen Mittelwestens und des demokratischen Südens wiederherzustellen110. Die Beziehungen der Federation zur Regierung der republikanischen Business-Präsidenten Harding und Coolidge waren dabei nicht ungetrübt: Henry C. Wallace, der Landwirtschaftsminister im Kabinett Harding, war zwar ein erprobter Vertrauensmann der Farmerorganisationen, konnte sich aber gegen seinen mehr auf Handels- und Industrieförderung bedachten Kollegen Herbert Hoover nur schwer durchsetzen; Präsident Coolidge legte 1927 und 1928 zweimal sein Veto ein gegen die von der AFBF mit großem Aufwand propagierten und vom Kongreß auch verabschiedeten McNary-Haugen Bills und Präsident Hoover gab seine Zustimmung zum Agricultural Marketing Act 1929 erst unter dem Druck stärkerer agrarischer Pressionen und der um sich greifenden großen Krise. Die Stärke der AFBF-Lobby in Washington lag vor allem im Kongreß. Der im Mai 1921 (bis 1923) vom Washingtoner Büro der Federation quer durch die beiden Parteien organisierte111, vornehmlich die Interessen des Mittelwestens repräsentierende „Farm Bloc“ in beiden Häusern des Parlaments, der stets mehr als 25 Senatoren und im Repräsentantenhaus über 95 Abgeordnete umfaßte112, konnte der Regierung zwischen dem Sommer 1921 und 1923 zahlreiche gesetzliche Regelungen aufzwingen, die den schon seit langem erhobenen Forderungen der in den Farm Bureaus organisierten Farmer entsprachen: so den Packers and Stockyard Act zur Regulierung und Kontrolle der seit fast zehn Jahren umstrittenen Preise der fleischverarbeitenden Betriebe, den Futures Trading Act zur Einschränkung der Getreidespekulation, die faktische Weiterführung der War Finance Corporation zwecks besserer Erschließung ausländischer Märkte und eine Reihe von Gesetzen zur Ausweitung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Kreditbedingungen und zur Förderung genossenschaftlicher Marktorganisation und -kontrolle113. Maßnahmen zur Produktionskontrolle und -planung, wie sie schon zu Anfang der zwanziger Jahre von einzelnen Gruppen und von der Farmers' Union gefordert wurden, gehörten zu dieser Zeit noch nicht zum Programm der AFBF, die am abstrakten Ziel der Ertragssteigerung festhielt114. Wie die verschiedenen agrarischen Gruppen die Krise der zwanziger Jahre bewerteten und welche Kräfte sich durchsetzten, wird besonders deutlich in den Debatten um die als „McNary-Haugen-Plan“ bekannt gewordenen handelspolitischen Maßnahmen, die dem berüchtigten, auf Verstaatlichung der Getreideein- und -ausfuhr zielenden Antrag Kanitz der deutschen Agrarier der neunziger Jahre in nichts nachstanden115. Der ursprüngliche Plan von G. N. Peek und H. S. Johnson (die beide später in den dreißiger Jahren entscheidenden Anteil am Aufbau der AAA und NRA hatten) war erstmals auf der National Agricultural Conference 1922 vorgetragen worden. Er ging aus von der Grundannahme der Unterprivilegierung der Landwirtschaft im bestehenden Wirtschaftssystem durch einseitigen Zollschutz der Industrie und hohe Preise für industrielle Bedarfsgüter gegenüber © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
122
Hans-Jürgen Puhle
dem durch Überproduktion bewirkten Zwang für die Farmer, billig zu verkaufen, und forderte die Wiederherstellung des Vorkriegsverhältnisses der landwirtschaftlichen und industriellen Kaufkraft (parity). Zu diesem Zwecke sollte für die Zeit von zehn Jahren eine zu errichtende staatliche Behörde das im Inland nicht verbrauchte landwirtschaftliche surplus bestimmter Produkte zu überhöhten Fixpreisen ( = Weltmarktpreis + Zollsatz) ankaufen und damit die Inlandspreise künstlich so hoch halten, daß die Farmer zu dem ihnen zustehenden „fair exchange value“ für Industriegüter kämen. Der beim Verkauf des surplus durch den Staat auf dem Weltmarkt erzielte Verlust sollte durch eine Art Verkaufssteuer (equalization fee), die auch von den Farmern zu tragen war, ausgeglichen werden116. Während dieser Plan, der zunächst außer Henry C. Wallace kaum jemanden begeisterte und von den meisten Organisationen als zu radikal verworfen wurde, eindeutig als befristete Übergangslösung konzipiert war und nebeneinander Staatsintervention zugunsten bevorzugter landwirtschaftlicher Produktionszweige, Fixpreise, Ausschaltung des Unternehmerrisikos, aber Beteiligung der Produzenten am Ausgleich des Verlusts vorsah, in dieser Form auch 1924 vom Kongreß abgelehnt wurde, wiesen die drei später erneut im Kongreß eingebrachten McNary-Haugen Bills bereits erhebliche Modifikationen auf, die vornehmlich von den Gruppen der AFBF — und insbesondere den sich seit 1926 stärker durchsetzenden Organisationen des corn belt117 — erreicht wurden. Die Vorlagen verloren den Charakter der Übergangslösung, bezogen genossenschaftliche Marktorganisation ein und beschnitten die staatlichen Interventionsmöglichkeiten, verzichteten auf Fixpreise, schlossen am Ende alle landwirtschaftlichen Produkte ein und verlagerten die vorgesehene Ausgleichssteuer immer mehr zum Verbraucher hin118. Das ursprüngliche Konzept wurde damit stärker in Einzelmaßnahmen aufgeteilt, die beliebig mit anderen Plänen kombiniert werden konnten, wie es z. B. vergeblich versucht wurde mit dem von der Grange favorisierten Rückzollscheinsystem (export debenture) nach deutschem Vorbild119 oder später erfolgreich von der Roosevelt-Regierung, die die Ausgleichssteuer120 mit vertraglichen Bindungen des Handels und Elementen des ebenfalls schon in den zwanziger Jahren insbesondere von M. L. Wilson und dem Harvard-Professor John D. Black propagierten „domestic allotmentplans“ kombinierte, der u. a. Produktionskontrollen und Prämien auf reduzierte Produktion vorsah121. Die letzten beiden McNary-Haugen Bills wurden 1927 und 1928 vom Kongreß mit zunehmend größer werdenden Mehrheiten angenommen, wobei es am Ende fast nur noch den Parlamentariern des Nordostens und einiger Industriezentren gelang, entgegen dem starken agrarischen Druck bei ihrer Ablehnung zu bleiben122. Die AFBF hatte dabei nicht nur die Vorlagen in ihrem Sinne entschärfen helfen, sondern sie hatte auch entscheidenden Anteil am Zusammenbringen der Koalition für die bills. Nach dem zweiten Veto des Präsidenten zeichnete sich zwar für einige Zeit © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
123
eine Art Arbeitsteilung zwischen den landwirtschaftlichen Interessenorganisationen ab, aber am durchsetzungsfähigsten erwiesen sich sowohl bei der Formulierung des Hooverschen Agrarprogramms 1928/29 als auch des Rooseveltschen nach 1932 wiederum die gemäßigteren Gruppen der Farm Bureau Federation: Einerseits zwangen die trotz gewisser Erleichterungen fortdauernde Krise123 und die zunehmende Aggressivität der besonders vom Corn Belt Committee und der Farmers' Union getragenen Agitation im Mittelwesten beide Parteien, die Forderungen der Farmer in ihren Wahlplattformen für 1928 zu berücksichtigen, wenngleich die personelle Alternative zwischen dem als Gegner der Agrarier bekannten Herbert Hoover und dem katholischen östlichen Großstädter AI Smith, der jetzt besonders von den Gruppen um Peek im American Council of Agriculture und im Corn Belt Committee trotz deren traditionell republikanischer Affiliation unterstützt wurde, unbefriedigend bleiben mußte124. Andererseits berücksichtigten der nach der Wahl von der Hoover-Regierung durchgesetzte Agricultural Marketing Act (1929) und die Einrichtung des Federal Farm Board und der Grain (sowie: Cotton) Stabilization Corporation trotz des Wegfalls der begehrten Ausgleichssteuer zentrale Forderungen der Farm Bureaus, so u. a. die verstärkte, von den Produzenten (und nicht von der Regierung) kontrollierte Marktorganisation zwecks Preisstabilisierung und die Bereitstellung erheblicher indirekter Subventionen125. Obwohl der Agricultural Marketing Act und das Federal Farm Board die ersten entscheidenden Schritte in Richtung auf ein umfassendes Hilfsprogramm der Bundesregierung zugunsten der Landwirtschaft darstellen, war kaum jemand zufrieden mit der Hooverschen Gesetzgebung, auch nicht die AFBF, der die indirekten Preisfestsetzungs- und Marktregulierungsbefugnisse der Regierung zu weit gingen126. Die Federation hatte aber immerhin ihr unbequeme Alternativen verhindern und die Position ihrer Funktionäre institutionell dergestalt stärken können, daß auch die Roosevelt-Regierung später, selbst wenn sie das gewollt hätte, nicht an einer engen Zusammenarbeit mit ihnen vorbeigekommen wäre. Andererseits radikalisierte die gerade unter dem Eindruck der 1929 hereinbrechenden gesamtwirtschaftlichen Krise, akuter Geldknappheit und zunehmender Zwangsversteigerungen127 noch ungenügende Berücksichtigung der Farmprobleme durch die Hooversche Politik das neben der pressure group der AFBF durchaus immer noch vorhandene Protestpotential der ländlichen Basis, besonders im Mittelwesten, in einer Weise, die weitergehende und wirksame politische Maßnahmen zur Beruhigung der Farmer dringend nahelegte. Starke Gruppen der Farmers' Union mit dem Zentrum in Iowa und Ablegern vor allem in Minnesota, Wisconsin, Michigan und South Dakota organisierten sich unter der Führung von Milo Reno in einer wieder stärker an populistische Praktiken anknüpfenden, aber auch Bankiers, Geschäftsleute und Farm Bureau-Mitglieder umfassenden Bewegung, der sie (in Anlehnung an die Schließung der Banken) den sinnigen Namen „Farmers' Holiday Association“ (FHA) gaben, und riefen zur selben Zeit zum Streik der agrarischen Produzenten (d. h. zur Einstellung der Lieferungen in die Städte) © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
124
Hans-Jürgen Puhle
auf und blockierten die Straßen, als Franklin D. Roosevelt zum Präsidenten gewählt wurde128. IV Die Wirtschaftskrise stimulierte zu Beginn der dreißiger Jahre noch einmal für kurze Zeit das radikale Erbe populistischer Rhetorik und direkter Aktion unter Amerikas Farmern: Den Anstoß dazu hatte u. a. das Auseinanderbrechen des Corn Belt Committee im Streit über die Politik des Hooverschen Federal Farm Board 1931 gegeben. Die Mehrzahl der Farm-Bureau-Funktionäre und andere gemäßigtere Gruppen hielten zwar auch die Maßnahmen des Farm Board für unzureichend, lehnten aber gewaltsame direkte Aktionen vorerst ebenso ab wie allzu intensive Staatsintervention — unter ihnen auch Henry A. Wallace, der Herausgeber von „Wallaces' Farmer“ und spätere Landwirtschaftsminister der RooseveltRegierung, der noch Ende 1933 das Schreckgespenst der „all public utility regulation“ der Landwirtschaft beschwor und zumindest den Grundsatz des „rugged individualism“ einer verklärten Vergangenheit nicht ganz aufgeben wollte129. Die radikaleren und politisch beweglicheren Gruppen der Farmers' Union (FU)130 und der neugegründeten Farmers' Holiday Association gingen dagegen bereits im Sommer 1932 zur Aktion über. Die von Milo Reno131 zwischen Juli 1932 und dem Herbst 1933 organisierten und vor allem gegen den Zwischenhandel gerichteten Farmstreiks132 dürfen jedoch nicht überschätzt werden. Sie hatten weder eine Auswirkung auf die extrem niedrigen Produktenpreise133, noch kamen sie wesentlich über ein eng umgrenztes Gebiet — das westliche Iowa und die Grenzgebiete zu South Dakota und Nebraska — hinaus; trotz eines beeindruckenden Massenanhangs134, starker Solidarität an der Basis, die an die Tage der Populist Revolt erinnerte135, und vereinzelter gewalttätiger Eskalationen136 konnten sie, abgesehen von punktuellen Erleichterungen und Moratorien137, nicht einmal den Gouverneuren der mittelwestlichen Staaten die Forderung der FHA nach einem Embargo des grenzüberschreitenden Handels aufzwingen, wobei nicht zuletzt auch die Rivalitäten und Abgrenzungsversuche der auf zahlreiche kleine Gruppen verteilten politischen Erben des Populism und Progressivism im Mittelwesten eine entscheidende Rolle spielten: Non Partisan League in North Dakota (Frazier, Lemke, Langer); La Follette-Progressives in Wisconsin; Olsons Farmer-Labor-Gruppe in Minnesota und Farmer-Labor-Parteien in Iowa und South Dakota138. Auch die weitergehenden Forderungen der FHA nach einem nationalen Moratorium für Zwangsversteigerungen, Nationalisierung der Banken und einer drastischen „soak the rich“-Einkommensteuer blieben vorerst folgenlos136. Die Hauptprogrammpunkte der revoltierenden Farmer: Umschuldung durch umfassende Inflationspolitik und von der Regierung garantierte Festpreise für landwirtschaftliche Produkte nach dem Schema: „cost of production plus a reasonable profit“ trugen allerdings, obwohl sie keineswegs im Sinne der FU © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
125
und der FHA realisiert wurden, wesentlich bei zur Ausarbeitung der neuen Rooseveltschen Agrar- und Währungspolitik, ebenso wie die direkte Agitation der corn belt-Farmer durchaus Anteil hat sowohl an der erstaunlichen Wahlniederlage Hoovers im traditionell überwiegend republikanischen Mittelwesten140 als auch an der Schnelligkeit und Direktheit der nach dem Regierungswechsel eingeleiteten Hilfsmaßnahmen für den Agrarsektor. Andererseits gelang es aber der neuen Regierung, den protestierenden Farmorganisationen in kurzer Zeit die Schau zu stehlen: Milo Reno sagte den für Mai 1933 geplanten Streik nach Inkrafttreten des ersten Agricultural Adjustment Act auf Bitten des Präsidenten ab, und der Versuch einer Wiederaufnahme im Herbst scheiterte, vor allem am Desinteresse vieler Farmer, die inzwischen bereits Ausgleichszahlungen von der Regierung erhielten141. Obwohl zahlreiche kleinere Farmorganisationen des Mittelwestens später im Lager der Anti-New Deal-Opposition noch einige Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnten, war die „corn belt rebellion“, was politische Folgen angeht, schon im Herbst 1933 zu Ende. Vor allem setzte die Regierung ihr eigenes pragmatisches Kompromißkonzept zur Linderung der Agrarkrise durch: — Statt der dogmatischen und in den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen unübersehbaren Inflationspläne der FU und FHA, die gleichzeitig die Abwertung des Golddollar, Wiederherstellung der Doppelwährung und Umschuldung der Hypothekenschulden durch neu ausgegebene „greenbacks“ (also praktisch Streichung der Schulden) vorsahen142 und zeitweilig von bis zu 36 Senatoren aus allen Parteien, aber überwiegend aus dem agrarischen Mittelwesten und Süden, unterstützt wurden (unter ihnen Frazier, La Follette, Huey Long, Norbeck, Nye, Shipstead, Wheeler, Mc Adoo, Norris, Thomas, Capper und Smith)148, wurde Ende April 1933 lediglich ein „gebremstes“ Inflationsprogramm verabschiedet, das — unter dem Beifall nicht nur mancher traditioneller Populisten und Silverites, sondern auch des Hauses Morgan — zwar grundsätzlich den Goldstandard aufgab, aber alle wichtigen Entscheidungen ins Ermessen der Regierung stellte und den Außenhandel einbezog144. — Statt der rigiden, stärker staatsinterventionistischen „cost of production“Rechnung der FU wurde dem neuen Agrarprogramm neben einigen Elementen der alten McNary-Haugen-Vorschläge im wesentlichen das „domestic allotment“-Schema zugrunde gelegt, das bereits in den letzten Jahren des Farm Board stärker diskutiert worden, aber im Kongreß gescheitert war145, und zu dem sich außer der Mehrheit seines primär agrarpolitisch orientierten „brains trust“146 auch Roosevelt selbst schon im Wahlkampf vorsichtig bekannt hatte147. Die Politik der ersten Agricultural Adjustment Administration (AAA) in der ersten Phase des New Deal, wie sie seit dem Frühjahr 1933 unter intensiver Mitarbeit und Konsultation der großen Agrarverbände, vor allem der AFBF148, in einem Bündel von Gesetzen formuliert und durch eine Fülle neuer Institutionen, die den Interventionsspielraum der Bundesregierung erheblich verbreiterten, durchgesetzt wurde149, kombinierte neuerliche Kreditverbesserungen und © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
126
Hans-Jürgen Puhle
Schuldenerleichterungen (im Rahmen der gebremsten Inflationspolitik) mit Zollabsicherungen, (freiwilligen, aber unwiderstehlich attraktiven) Produktionskontrollen und Marktabsprachen zum Zweck der Preisstabilisierung und Regulierung des Angebots (dem eigentlichen domestic allotment-Plan)150, verbunden mit einer Weiterverarbeitungssteuer. Das erklärte Ziel war die Wiederherstellung der Kaufkraft des agrarischen Sektors im Sinne der „Parität“, wie sie die AFBF und die McNary-Haugen-Bewegung schon seit fast zehn Jahren gefordert hatten. Die Farmerorganisationen konnten aber in den dreißiger Jahren nicht nur ein Maximum ihrer bisherigen Forderungen durchsetzen; es gelang ihnen auch, sich in der engen Zusammenarbeit der neugeschaffenen Regierungsagenturen und des USDA mit den Organisationen der „sachverständigen“ Interessenten im Lande quasi institutionellen Einfluß auf konkrete Einzelentscheidungen zu sichern und zu bewahren, wobei sich dank der guten lokalen und regionalen Organisation der Farm Bureaus und der engen Kopplung der AAA und ihrer Finanzmittel an den von ihr wahrgenommenen extension service vor allem die AFBF durchsetzte151. Daran änderte auch die juristische Umstellung der AAA nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs von 1936 nichts152; im Gegenteil verstärkten die neuerliche Betonung der „soil conservation“ (seit langem eine Domäne der AFBF!) und der Einbezug der von Staat und Produzenten gemeinsam vorgenommenen Oberschußregulierung nach Henry Wallace's „workable ever normal granary“-Plan in den zweiten Agricultural Adjustment Act von 1938 die Position der etablierten Interessenten noch zusätzlich153. Während die von der Regierung — ähnlich wie im Falle der TVA154 — besonders betonten, dem 19. Jahrhundert verpflichteten Intentionen des Agrarprogramms zur Förderung partizipatorischer „ökonomischer Demokratie“155 im wesentlichen akklamative Ornamente blieben (denn von welchem Produzenten kann schon erwartet werden, daß er gegen höhere Preise und Profite stimmt?)158, funktionierte die konkrete Interessenwahrung außerordentlich gut: Die Farmorganisationen arbeiteten mit an Cordeil Hulls Handelsvertragsprogramm zur Erschließung neuer Märkte157, sie profitierten von der vom Staat getragenen Elektrifizierung ländlicher Gebiete158 ebenso wie von den Verwertungskampagnen der neuen Wohlfahrtsorganisationen (z. B. Schulspeisung etc.)159 und der Einschränkung der Güterspekulation180, und sie setzten durchweg ihre (nach 1938 jeweils einzeln zu bewilligenden) „parity payments appropriations“ im Kongreß durch, im weniger agrarfreundlichen Repräsentantenhaus zum Teil in weitreichenden Kompromißgeschäften mit den Gewerkschaften und städtischen Abgeordneten161. Soweit sie untereinander einig waren, richteten sich die größeren Agrarorganisationen im neuen System einer hochsubventionierten und mit Staatshilfe korporativ organisierten Agrarpolitik ein. Die von einigen Unermüdlichen (denselben wie 1933) Anfang 1939 erneut im Senat eingebrachte inflationäre „cost of production“-Vorlage (Frazier-Lemke-Bill), die im Ausschuß begraben wurde fand nicht einmal mehr die Unterstützung der Farmers' Union162. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
127
Wenn die Gruppen sich nicht einig waren, setzte sich in der Regel im Kongreß die gemäßigte und nach 1936 immer mehr auf Bewahrung des günstigen status quo gerichtete Strategie der AFBF sogar dann durch, wenn die FU mit den Gewerkschaften und der Regierung im Bunde war. Insbesondere konnte die Federation gegen alle anderen ihre liberal-kapitalistische Vorstellung von den engen Grenzen sozialpolitischer Förderungs- und Reformmaßnahmen innerhalb der Agrarpolitik durchsetzen: Die von der linken, „kollektivistischen“ Fraktion der Washingtoner Agrarbürokratie im Mai 1935 mühsam durchgesetzte Resettlement Administration, die mit sehr bescheidenen Mitteln die strukturell bedingte Notlage der Pächter und Landarbeiter aufbessern sollte, die in dem umfangreichen Subventionsprogramm des New Deal für Großproduzenten und rentabel wirtschaftende Familienbetriebe keine Berücksichtigung gefunden hatten, scheiterte am Widerstand des Kongresses163. Die vor allem auf Betreiben der 1934 in Arkansas gegründeten Southern Tenant Farmers' Union (STFU), die trotz mancher „sozialistischer“ Ornamente fest in der Tradition des südlichen Populismus, der Industrial Workers of the World („Wobblies“) und wohl auch der Social Gospel stand164, vom USDA angeordnete Untersuchung der Lage der Pächter und Landarbeiter im Süden wurde verschleppt; der Myers-Report, der die Vorwürfe der STFU gegen Regierung und AAA bestätigte, wurde innerhalb des Landwirtschaftsministeriums auf skandalöse Weise unterdrückt und geheimgehalten165. Eine Reihe prominenter linker Agrarbürokraten fiel im Streit um die Arbeitsverhältnisse der Pächter in Baumwollplantagen auf Druck der Produzentenverbände und südlichen Handelskammern im Frühjahr 1935 einer großen, propagandistisch ausgeschlachteten Säuberung im Ministerium zum Opfer168 und der stellvertretende Minister Rexford Tugwell trat ein Jahr später resignierend zurück167. Die zahlreichen am Rande des Existenzminimums lebenden kleinen Pächter und Landarbeiter — vor allem im Süden168 — blieben auch weiterhin die „Stiefkinder des New Deal“169: Zwar setzte die Regierung 1937 mit dem Bankhead-Jones Farm TenancyAct und der Einrichtung der Farm Security Administration (FSA) ihre einzige größere sozialpolitische Vorlage für den Agrarsektor durch170; doch deren Erfolg blieb begrenzt: zum einen ließen sich die angestrebten Mindestlöhne für Landarbeiter auf der (vorgesehenen) freiwilligen Basis vielfach ebensowenig durchsetzen wie die Intention, neues Kleineigentum für Pächter, croppers und Arbeiter zu schaffen; das (übrigens erste) öffentliche Wohnungsbauprogramm zur Ansiedlung von Wanderarbeitern blieb in Ansätzen stecken und die Bestimmungen des Gesetzes kamen im Endeffekt vor allem der Erhaltung der schon bestehenden Familienbetriebe zugute171. Zum anderen gelang es der AFBF, die die Regierungspolitik seit 1937 zunehmend kritisierte und deren sozialpolitische Projekte für den Agrarsektor von Anfang an bekämpft hatte, dank ihres überragenden Einflusses im Kongreß, die FSA gegen den Widerstand der FU und zeitweise auch der CIO allmählich zu zerschlagen: Im Schutz der Notwendig© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
128
Hans-Jürgen Puhle
keit zu neuer kriegswirtschaftlicher Kooperation und entsprechender Prosperität erfolgte 1941 die erste Attacke auf die FSA; durch den Farm Labor Supply Act 1944 wurden erhebliche Kompetenzen der FSA auf die Agenturen des extension service (also die Farm Bureaus) übertragen; die Errichtung der (dann bis in die siebziger Jahre weiter ausgebauten) Farmers' Home Administration 1946 bedeutete die endgültige Umfunktionierung der ursprünglichen Intentionen der Regierung im Sinne der größeren kommerziellen Interessenten der AFBF und gleichzeitig das Ende der FSA172. Die Rooseveltsche Agrarpolitik der dreißiger Jahre fügt sich somit unabhängig von den Absichten der beteiligten Initiatoren im Ergebnis bruchlos ein in die Kontinuitätslinie des seit der Zeit des „Progressivism“ und besonders seit den zwanziger Jahren intensivierten staatlichen Agrarsubventionismus für die selbständigen Unternehmer ohne wesentliche strukturelle Reformen zugunsten der Unselbständigen. Der Staat stützte die organisierten Farmer in der Krise, stärkte aber gleichzeitig durch Einräumung von institutionell abgesicherten und verbrieften finanziellen Ansprüchen173 ihre Selbständigkeit in einer Weise, daß sie in besseren Zeiten in den Stand gesetzt wurden, die Regierung wirksam an weitergehenden Reformmaßnahmen zu hindern und immer mehr in die Rolle einer bloßen Mittel-Verteilungsstelle zu drängen. Der Staatsinterventionismus nahm zwar quantitativ zu, die Bestimmung der Richtung lag aber weiterhin eindeutig bei den stärksten organisierten privaten Interessenten. Im Lichte seiner Agrarpolitik war der New Deal weder revolutionär noch sonderlich reformistisch174, sondern stellte — auch der zeitweilig in Washington tonangebenden Brandeis'schen Philosophie von der erstrebenswerten Rückkehr zum freien Wettbewerb kleinbetrieblicher Einheiten (die auch von manchen „Wilsonians“ geteilt wurde) zum Trotz175 — lediglich eine weitere Beschleunigungsphase der schon vorher tendenziell dominanten Entwicklung zum organisierten Kapitalismus dar176. V In dem Maße, in dem sich in den dreißiger Jahren die schon 1920 eingeleitete Tendenz zur konkreten pressure group-Politik für den Agrarsektor verfestigte und die starke AFBF zunächst die Regierungspolitik unterstützte, bis 1936 ausdrücklich und ohne große Vorbehalte, von 1937 bis 1941 zurückhaltender und in Einzelfragen kritischer177, und ab 1941 (allerdings gebremst durch den Zwang zur kriegswirtschaftlichen Kooperation) stärker mit dem konservativen Lager im Kongreß zusammenarbeitete, das sich seit 1937 formiert hatte178, in demselben Maße verloren die Ideale „agrarischer Demokratie“ an Substanz und die selbständig und in Opposition zur Rooseveltschen Politik organisierten spätpopulistischen Protestbewegungen an Attraktion. Nachdem sie in der Krise Anfang der dreißiger Jahre und kurz danach noch einmal die Aufmerksamkeit der Nation auf sich gezogen hatten, waren sie, als die neuen Integrationsmechanismen erst funktionierten und die Hilfsprogramme der Regierung ihre © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
129
Wirkung zeigten, trotz versuchter Allianzen mit anderen (zu schwachen) Protestgruppen zum Scheitern verurteilt. Ohne die Unterstützung der — jetzt besänftigten — „normalen“ Familienbetrieb-Farmer im Mittelwesten und Süden war wirksamer populistischer Protest unmöglich179. Die Gruppen, die ihn dennoch versuchten, waren — abgesehen von dem auf Betreiben der konservativen American Liberty League 1935 inspirierten Farmers' Independent Council of America, das die AAA vom Standpunkt des privatkapitalistischen „rugged individualism“ her kritisierte und daher unzeitgemäß und kurzlebig blieb180 — entweder (wie die meisten mittelwestlichen Organisationen) Relikte älterer „progressiver“ Traditionen oder (wie zum Teil im Süden und äußersten Westen) Versuche neuer Bündnisse der Unterprivilegierten, die über den agrarischen Sektor hinausreichten: Die diffusen „progressiven“ Gruppen der dreißiger Jahre waren in der Regel auf die Staaten des Mittelwestens beschränkt und standen „links“ von der Politik des New Deal, waren durch die Erfahrung der Krise vielfach zu radikalen Kritikern des Systems geworden und sympathisierten teilweise und vorübergehend mit „sozialistischen“ Vorstellungen. Ihre organisatorischen Zentren waren vor allem die alte Non Partisan League (NPL) in North Dakota, die in der Krise wieder an Einfluß gewonnen hatte, die aus der älteren NPL hervorgegangene Farmer-Labor Party in Minnesota, die nach vergeblichen Anläufen zwischen 1930 und 1936 mit dem früheren „Wobbly“ Floyd Olson den Gouverneur stellte, und die Progressive Party in Wisconsin, der alten Hochburg der La Follettes. Die Versuche dieser und zahlreicher anderer Gruppen, die regionale Begrenzung zu überwinden und eine nationale „progressive“ Partei ins Leben zu rufen, scheiterten aber nicht nur an der schon traditionellen Uneinigkeit der progressiven „Primadonnen“181, sondern vor allem auch daran, daß die Rooseveltsche Politik einen großen Teil der alten Forderungen der Progressives übernommen hatte und zu realisieren begann. Das von Alfred Bingham und Seiden Rodman herausgegebene linksliberale Intellektuellenblatt „Common Sense“, das bis 1936 die progressiven Sammlungsbewegungen gegen den (als „kompromißlerisch“ angesehenen) New Deal ebenso energisch unterstützt hatte wie die Forderungen nach mehr Staatsintervention zugunsten der Unterprivilegierten und der Aktionseinheit mit dem linken Flügel der Gewerkschaften182, betonte dann auch nach Roosevelts überwältigendem Wahlsieg 1936183, daß es darauf ankäme, die New Dealer — besonders deren sozialreformerische Fraktion — in die neue Sammlungspartei einzubeziehen und den New Deal auszubauen zu einer umfassenden Reform der Gesellschaft184 — Ideen, denen der Präsident gelegentlich gar nicht so fern gestanden haben mag, wenn sie ihm auch irreal und unpraktikabel erschienen185. Die 1929 von John Dewey mitgegründete League for Independent Political Action (LIPA), die eng mit Milo Renos FHA zusammengearbeitet hatte, und die 1933 aus ihr hervorgegangene Farmer-Labor Political Federation (FLPF) mit Alfred Bingham als Generalsekretär blieben auf ihre Rollen als ideologi9 Winkler, Krise © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
130
Hans-Jürgen Puhle
sche holding companies freischwebender antikapitalistischer Agitation beschränkt186. Selbst deren stärkste Gruppe, die in Minnesota regierende FarmerLabor-Party, die einen Teil ihres gemäßigt sozialistischen Programms in praktische Politik umzusetzen begann187, und die von ihr gestützte, im Juni 1935 in Zusammenarbeit mit der FHA, den „linken“ Progressives aus Wisconsin und einigen Gewerkschaften in scharfer Ablehnung gegen „Kommunisten und Faschisten“ gegründete American Commonwealth Political Federation (ACPF)188 mit ihrem gegen die „neue Phase des Kapitalismus“ gerichteten „production for use“-Programm189 — eine Organisation, die Olson zur Grundlage einer nationalen Farmer-Labor-Bewegung machen zu können hoffte190 — vermochten gegen die integrative Attraktion der Rooseveltschen Politik nichts auszurichten. Der Versuch der Gründung einer neuen Farmer-Labor-Partei 1936 blieb in der Formulierung eines relativ gemäßigten Grundsatzprogramms stecken191; auf die Aufstellung eines eigenen Präsidentschaftskandidaten wurde verzichtet, um die Wahl Roosevelts nicht zu gefährden, der seinerseits, wie schon 1932, die Unterstützung des Progressive National Committee akzeptierte192 und der Farmer-Labor-Party in Minnesota, den Progressives in Wisconsin und dem unabhängigen progressiven Senator Norris (Nebraska)193 ebenso Wahlhilfe angedeihen ließ wie der jenen ideologisch verwandten American Labor Party in New York194. Das Scheitern der Farmer-Labor-Bewegung auf nationaler Ebene, der ein Stimmenanteil zwischen 3,5 und 10 Millionen bei den Wahlen und wesentlich größere Chancen für 1940 prophezeit worden waren195, lag allerdings nicht nur an der Anziehungskraft der Regierungspolitik und einer Verkettung unglücklicher Umstände: dem frühen Tod Floyd Olsons, ihres einzigen charismatischen Führers von nationaler Statur196, und dem Tod Milo Renos im Mai 1936 sowie der verstärkten Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Regierung seit 1935 und der Gründung der Union Party als einer diffusen und sektiererischen Sammelpartei mit Unterstützung eines Teils der NPL in North Dakota. Die Tatsache, daß Farmer-Labor-Bewegungen auch nach 1936 nicht mehr an Boden gewannen und sich die Mehrzahl der organisierten Farmer gegen Ende der dreißiger Jahre zunehmend rechts von der Mitte sammelte197, scheint noch zusätzlich auf eine strukturelle Schwäche gerade dieser Gruppen hinzudeuten: ihre Unfähigkeit, den Doppelcharakter des Farmers, der gleichzeitig kleiner Kapitalist und Handarbeiter ist, anzusprechen und die daraus resultierende Einseitigkeit, die wohl die Aktionseinheit der Farmer mit der Arbeiterschaft in der Krise berücksichtigt, ihre empirische Neigung zur Allianz mit dem business-Sektor (und der Republikanischen Partei) in besseren Zeiten zwecks Verteidigung des ökonomischen und sozialen status quo aber unberücksichtigt läßt. Während die NPL in North Dakota durch die Auseinandersetzungen um die Amtsführung des Gouverneurs Langer198 und die Bereitschaft ihres bislang durchaus „progressiven“ Kongreßabgeordneten William Lemke, sich bei den Präsidentschaftswahlen von 1936 als „Father Coughlin's Kandidat“ für die im © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
131
Mittelwesten im Geruch des Kryptofaschismus stehende Union Party herzugeben199, zunehmend an Einfluß verlor, gewann die Progressive Party von Wisconsin zunächst an Stärke: Sie sammelte seit 1934 die progressiven Republikaner, die in nationalen Angelegenheiten Roosevelt unterstützten, und beschränkte ihr Tätigkeitsfeld vor 1938 bewußt auf den Einzelstaat200. Dabei konnten sich dank der Zurückhaltung der Demokratischen Partei und der weiter gewährten Patronage der Bundesregierung kurzfristig die Brüder La Follette201 gegen die linke Gruppe um den Abgeordneten Amlie, die stärker mit der Farmer-Labor-Bewegung und mit sozialstaatlichen Zielsetzungen sympathisierte, durchsetzen202. Doch der Bruch der La Follettes mit Roosevelt und interne Korruptionsskandale brachten 1938 ein schnelles Ende: Robert La Follette verlor die Gouverneurswahlen; der Versuch einer neuen Parteigründung, der National Progressives of America, schlug fehl203; der organisierte mittelwestliche „Progressivism“ hatte endgültig seine letzte Basis verloren201. Auch andere spätpopulistische Erscheinungen blieben in den dreißiger Jahren ohne weiterreichende Folgen: so die Agrarromantik des folkloristisch anmutenden „Alfalfa Bill“ Murray, der 1930 mit einer „Bread, Butter, Bacon and Bcans-Platform“ Gouverneur von Oklahoma wurde205; die Commonwealth Federations in den Staaten Washington und Oregon, die nur für kurze Zeit die Dcmokratisdie Partei kontrollierten206, und Upton Sinclair's EPIC-Bewegung in Kalifornien, die mit ihrem frühsozialistisch-utopischen „production for use“Programm zwar die demokratische Nominierung gewann, aber die Gouverneurswahlen 1934 verlor207. Eine Sonderform des späten südstaatlichen Populismus stellt das Regime des Gouverneurs (1928 bis 1932) und späteren Senators (1932 bis 1935) Huey Long in Louisiana dar, auf das hier im einzelnen nicht eingegangen werden soll208. Festzuhalten ist, daß es Long zwar innerhalb kurzer Zeit gelang, in seinem Heimatstaat ein umfassendes autokratisches Regierungssystem zwecks Entwicklungsdiktatur zu errichten und die Politik Louisianas tiefgreifend und dauerhaft zu verändern209, daß sein Einfluß auf die nationale Politik jedoch nicht überschätzt werden darf. Angesichts der unmittelbar sichtbaren Erfolge der Politik Roosevelts, den Long 1932 noch unterstützt hatte und erst ab 1933 in sehr emotionaler Weise bekämpfte, ist es trotz des (weitgehend nur auf dem Papier bestehenden) Massenanhangs für Longs radikal wirtschaftsreformerisches, aber nicht immer durchdachtes „Share Our Wealth“-Programm210 doch sehr fraglich, ob der Senator, wenn er nicht 1935 ermordet worden wäre und 1936 statt Lemke für eine dritte Partei kandidiert hätte, wesentlich erfolgreicher hätte sein können. Ganz sicher hätte auch ihn die Allianz mit der antisemitischen und präfaschistischen National Union of Social Justice des Radiopriesters Coughlin211 und der Townsend-Bewegung212 die Stimmen des Mittelwestens gekostet, dessen progressive Gruppen sich eindeutig für Roosevelt entschieden. Die Union Party von 1936 ist nicht vergleichbar mit den früheren „dritten Parteien“. Sie war weder populistisch, noch „progressiv“, noch eigentlich 9*
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
132
Hans-Jürgen Puhle
agrarisch; sie hatte kaum regionale Hochburgen, noch ein konkretes Programm; sie war eine ad hoc zusammengesuchte heterogene und erfolglose Protestkoalition, deren spärlicher Anhang sich nach den Wahlen schnell verlief213. Das Ende der selbständigen agrarischen Protestbewegungen spiegelt sich nicht in der Niederlage der Union Party bei den Wahlen von 1936, sondern im gleichzeitigen Erfolg Roosevelts. Die zunehmende Krisenabsicherung und Prosperität einer staatlich geschützten, organisierten und verwalteten Agrarwirtschaft, auf die sich auch die „Roosevelt-Depression“ von 1938 nicht mehr so schwerwiegend auswirkte wie auf den Industrie- und business-Sektor214, trugen neben der Empörung traditioneller Kreise über Roosevelts „court-packing“-Plan215 und den ab 1937 verstärkten Konflikten zwischen der AFBF und der Regierung (die gelegentlich sogar mit einer Trennung der AAA vom extension service der Farm Bureaus drohte218) mit dazu bei, daß die mittelwestlichen Agrarstaaten in den Wahlen von 1938 und 1940 insgesamt wieder stärker republikanisch wählten, wie es ihrer Tradition entsprach217. Zwar hielt die „Roosevelt-Koalition“ vorerst, vor allem dank der endgültigen Konsolidierung der Stimmen der großen Städte und industriellen Siedlungszentren zugunsten des Präsidenten und der Demokratischen Partei218, doch war im Einzelfall die Mehrheit der Regierung im Kongreß besonders dann gefährdet, wenn sich die agrarisch orientierten Kongreßmitglieder auf die Seite der ansonsten sehr uneinheitlichen „konservativen Koalition“ aus Republikanern und südstaatlichen Demokraten schlugen, was ab 1940 immer öfter vorkam. Die politischen Erben des agrarischen Populismus waren im Verlauf des „renversement des coalitions“ in den dreißiger Jahren in ihrer Mehrheit und unter der Führung ihrer etablierten Großverbände gewissermaßen aus einer Position des Protestes links von der Mitte in eine Position der status quoBewahrung rechts von der Mitte gewandert, aus der traditionellen Opposition der Populisten gegen private und staatliche Organisation der nicht-agrarischen Sektoren durch eine Phase des Arrangements mit der Regierung und der eigenen quasi-korporativen und öffentlichen Organisation in eine Allianz mit den anderen organisierten Wirtschaftssektoren gegen sozialreformerische Plane der Regierung. Die Gewerkschaften, früher die einzigen potentiellen Koalitionspartner der Populisten, waren Ende der dreißiger Jahre eine der wichtigsten Stützen der Regierung geworden und Business, früher der Hauptgegner der aufbegehrenden Farmerorganisationen, war in einem langen Umschichtungsprozeß zwischen 1920 und 1940 zu ihrem willkommenen Verbündeten geworden. Ohne einer (zweifellos notwendigen) umfassenderen Gesamtwürdigung der Entwicklung der Landwirtschaft im organisierten Kapitalismus der USA vorzugreifen (die u. a. auch die Veränderung des Stellenwerts des Agrarsektors in der Gesamtwirtschaft gründlicher zu analysieren hatte), darf doch folgendes festgehalten werden: — Die zunehmende Organisation und Integration des landwirtschaftlichen Sektors in ein staatlich subventioniertes und reguliertes Gesamtsystem zur © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
133
Steigerung der privaten Gewinne hat die Großproduzenten und die rentabel wirtschaftenden Familienbetriebe wirtschaftlich gestärkt und ihren Interessenvertretungen die radikale Spitze genommen. Lediglich die „Verlierer“: vor allem kleine Pächter, Land- und Wanderarbeiter, sharecroppers etc. lassen sich heute noch zu radikalem Protest mobilisieren, bedürfen aber zusätzlicher Koalitionspartner aus dem nichtagrarischen Bereich. Die soziale Polarisierung der Agrarbevölkerung ist dabei möglicherweise größer geworden 219 . — Die zunehmende koordinierte Kooperation mit und in staatlichen oder intermediären Regulierungs- und Ausgleichsinstitutionen hat die Farmerorganisationen insgesamt pragmatischer, aber auch konservativer gemacht. Die Wendung vom Protest zu „pressure group politics“ hat das direkt-demokratische „grass-roots“-Potential der Agrarbewegungen entscheidend abgeschwächt und ihren früher anregenden und weitertreibenden Einfluß auf die Gesamtpolitik verringert. — Die konsequente, schubweise Durchsetzung systemregulierender, staatsinterventionistischer „progressiver“ Politik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (die auf dem Agrarsektor am intensivsten und auch am meisten kontinuierlich verlaufen ist) und die dadurch provozierte Entwicklung von „big government“ auf allen Ebenen hat außerdem in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht die Freiheitsräume der individuellen Privatunternehmer (zwecks Reduzierung ihres Risikos) eingeschränkt und dadurch zusätzlich den Stellenwert basis-demokratischer Institutionen zugunsten „korporativer“ oder „syndikalistischer“ Selbstregulierung herabgesetzt 220 . — Der Sieg des organisierten Subventionismus über die alten frühkapitalistischen und wirtschaftsliberalen Ideale „agrarischer Demokratie“ bedeutet zwar das Ende des amerikanischen Populismus in seiner traditionellen, „ländlichen“ Form, reflektiert aber lediglich die konsequente und prinzipientreue Entwicklung einer von Anfang an kapitalistischen Agrarwirtschaft aus der Phase des unorganisierten Konkurrenzkapitalismus in ein zunehmend organisiertes System untereinander verklammerter privater und öffentlicher Sektoren zur Sicherung und Stabilisierung der Privatwirtschaft.
Anmerkungen 1 Zur Stabilisierungsfunktion des New Deal vgl. B. J . Bernstein, The New Deal: The Conservative Achievements of Liberal Reform, in: ders. Hg., Towards a New Past. Dissenting Essays in American History, Ν. Υ. 1969, 263—288; W. Ε. Leuchten burg, The New Deal and the Analogue of War, in: J . Braeman u. a., Hg., Change and Continuity in Twentieth Century America, N. Y. 1966, 81—143. 2 Darauf hat Harold Laski schon 1939 ausführlich hingewiesen: The American Presidency, An Interpretation, Ν. Υ. 1940, 12ff.; auch B. D. Karl, Executive Reorgani zation and Reform in the New Deal, Cambridge/Mass. 1963, 166 ff. 3 Zum Begriff: S. Verba, Comparative Political Culture, in: L. W. Pye-S. Verba Hg., Political Culture and Political Development, Princeton N. J . 1965, 512—560, bes. 545 u. H.-J. Puhle, Politischer Stil, in: Η. Η. Röhring-K. Sontheimer Hg., Hand-
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
134
Hans-Jürgen Puhle
buch des deutschen Parlamentarismus, München 1970, 398—401. 4 Zur „Roosevelt Coalition“ vgl. S. Lubell, The Future of American Politics, Ν. Υ. 19562, 29—60. 5 Vgl. die Programmpunkte der Präsidentschaftskandidaten McGovern und Wallace und die demokratische Wahlplattform von 1972: . . . For the People, Platform of the 1972 Democratic National Convention, New Directions 1972—1976 (Sonderdruck aus dem Congressional Record), Washington 1972, 4 f., 9 f., 14, 17 f. 6 Vgl. die Analyse von R. M. Scammon-B. J . Wattenberg, The Real Majority, Ν. Υ. 1971, 64 f., 325 ff., 337 f. 7 Zum Gesamtkomplex vgl. F. Freidel, The New Deal in Historical Perspective, Washington 19652, und die weiter unten angeführte Literatur. 8 Vgl. die ausführliche Übersicht über die neuere Literatur von J . Womack, jr., The Chicanos, The New York Review of Books (NYR) 19. 1972, 12—18 (31. 8.). 9 Vgl. den Beitrag von P. Lösche in diesem Band. 10 Vgl. A. W. Griswold, The Agrarian Democracy of Thomas Jefferson, in: L. H. Douglas Hg., Agrarianism in American History, Lexington/Mass. 1969, 12—16; G. McConnell, The Decline of Agrarian Democracy, Ν. Υ. 1969, 3 ff.; Ch. M. Wiltse, The Jeffersonian Tradition in American Democracy, Ν. Υ. 1960, 218 ff. 11 Vgl. L. D. White, The Jacksonians. Α Study in Administrative History 1829 to 1861, Ν. Υ. 1954, 300 ff. u. d. Übersicht bei: Ch. G. Sellers, Jacksonian Democracy, Washington 1958, 3 ff. 12 Vgl. McConnell, 1 f. 13 Der Begriff, der hier nicht im einzelnen erläutert werden kann, meint nicht nur „corporation capitalism“ (W. Α. Williams) oder „political capitalism“ (G. Kolko), sondern die enge Verklammerung der privaten Wirtschaftssektoren untereinander und mit den zunehmend intervenierenden Agenturen der Staatsmacht. 14 Versucht in den Beiträgen der Sammlung: G. Ionescu-E. Gellner Hg., Populism. Its Meanings and National Characteristics, London 1969, und dem Protokoll des Symposions: To Define Populism. Government and Opposition 3. 1968, 137—179. Ein besonders fragwürdiges Beispiel: K. Barkin, A Case Study in Comparative History: Populism in Germany and America, in: H. J . Bass Hg., The State of American History, Chicago 1970, 373—404. 15 In der Folge ist hier mit „populism“ immer nur der US-populism gemeint. 16 Vgl. John Taylor of Caroline, Agriculture Imperilled and Agrarianism Triumphant (1817), in: Douglas Hg., 8—12; H. J . Carman-R. G. Tugwell, The Significance of American Agricultural History, Agricultural History (AH) 12, 1938, 99—106; zur Lockeschen Tradition: L. Hartz, The Liberal Tradition in America, N. Y. 1955, 119 ff. 17 Vgl. Ch. A. Beard, An Economic Interpretation of the Constitution of the United States (1913), N. Y. 1969, 19 ff., und die sich daran anschließende Diskussion. 18 Vgl. L. Hartz, United States History in a New Perspective, in: ders. Hg., The Founding of New Societies, Ν. Υ. 1964, 69—122, bes. 103 ff. 19 Vgl. Β. Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy, Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Boston 1966, 149 ff. 20 Ebd., 111. 21 Vgl. für viele: B. Hammond, Banks and Politics in America from the Revolution to the Civil War, Princeton, N. J . 1957; M. D. Peterson, The Jefferson Image in the American Mind, N. Y. 1962; M. Meyers, The Jacksonian Persuasion, Politics and Belief, Stanford 1960. 22 Vgl. die Diskussion um Frederick Jackson Turners zuerst 1893 erschienenen Essay: The Frontier in American History, und Oscar Handlins Immigrations-Studien. 23 Zur Übersicht vgl. W. Α. Williams, The Contours of American History, Chicago 1966; vgl. auch Anm. 13. 24 Vgl. dazu R. W. Fogel, Railroads and American Economic Growth, Essays in © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
135
Economic History, Baltimore 1964; A. D. Chandler, jr. Hg., The Railroads, The Nation's First Big Business, N. Y. 1965, u. Kap, I bis I I I in: G. Kolko, Railroads and Regulation, 1877—1916, Ν. Υ. 1965. 25 Der Anteil der in der Landwirtschaft Tätigen an der Gesamtbevölkerung betrug 1870 noch 51,6 %; 1880: 48,8; 1890: 42,5; 1900: 37,7 und 1910: 30,7 %; der Anteil der in ländlichen Verhältnissen lebenden (rural) Bevölkerung sank von 1880: 71,4% auf 1890: 64,6; 1900: 60 und 1910: 54,2%. Vgl. S. Kuznets, National Income: A Summary of Findings, Ν. Υ. 1946, 41; US Bureau of Census, Historical Statistics of the United States. Colonial Times to 1957 (Hist. Stat.), Washington 1960, 4, 14. 26 Die Anzahl der Farmbetriebe stieg von 1870: 2 659 985 auf 1880: 4 008 907 (1850: 1 449 073; 1860: 2 044 077); die Zunahme hielt ungebrochen an bis nach 1920 (1890: 4 564 641; 1900: 5 737 372; 1910: 6 361 502; 1920: 6 448 343). US Department of Commerce and Labor, Statistical Abstract of the United States (Stat. Abstr.) 1904, 509; 1925, 585; Hist. Stat., 278—280. Zur Preisbewegung: Hist. Stat., 289—302. 27 Die Durchschnittsgröße nahm bis 1880 ab und blieb danach bis in den ersten Weltkrieg relativ konstant: 1850: 202,6 acres; 1860: 199,2; 1870: 153,3; 1880: 133,7; 1890: 136,5; 1900: 146,2; 1910: 138,1; 1920: 148,2; 1930: 156,9. Erst in den dreißiger Jahren überschritt die Durchschnittsfarm wieder (1940: 174,0) die im Homestead Act von 1862 festgelegte und für moderne Bewirtschaftungsmethoden bereits zu klein konzipierte „Normalgröße“ von 160 acres (= ca. 64 ha). Fundstellen wie Anm. 26 und Stat. Abstr. 1942, 699 u. 1969, 592—593. Zwar konnte trotz des Verlustes von ca. 3,5 Mio. landwirtschaftlichen Arbeitskräften zwischen 1870 und 1900 die Produktivität in derselben Zeit um 86 % gesteigert werden (die Ernteerträge in neun Staaten stiegen zwischen 1830 und 1895 um ca. 500 % ) , doch erlaubten die kleinen Betriebsgrößen keine entsprechenden Kostensenkungen durch technologische Verbesserungen. Vgl. Th. Saloutos, The Agricultural Problem and Nineteenth Century Industrialism, AH 22. 1948, 156—174, bes. 162 f.; schon Ch. W. Baker, Monopolies and the People, Ν. Υ.—London 1889, 127. 28 Vgl. C. F. Emerick, An Analysis of Agricultural Discontent in the United States, Political Science Quarterly (PSQ) 11. 1896, 601 f., 626—628. Zur Verschuldung auch: J . L. Laughlin in: Atlantic Monthly 78. 579, 582 f. Zur Krise insgesamt: Ch. Hoffman, The Depression of the Nineties, Westport 1970, 47 ff., 233 ff. 29 Vgl. Ο. Η. Kelley, Origins and Progress of the Order of the Patrons of Hus bandry, Philadelphia 1875, 11 ff. und das Standardwerk von S. J . Buck, The Granger Movement. A Study of Agricultural Organization and its Political, Economic and Social Manifestations 1870—1880 (1913), Lincoln 1969, 40 ff. Die Zahl der lokalen „granges“ stieg von 1870:38 auf 1871: 125; 1872: 1105 und 1873: 8400. 30 Zur I nteressenlage der Greenback-I nflationisten: I . Unger, The Greenback Era. Α Social and Political History of American Finance, 1865—1879, Princeton 19683, 41 ff., 68 ff.; zum Anteil der Farmer ebd., 195. Die Greenback-Präsidentschaftskandidaten erreichten bei den Wahlen von 1876, 1880 (Gen. J . B. Weaver) und 1884 keine nennenswerten Stimmenzahlen: über 81 700 (davon über die Hälfte im westlichen Mittelwesten), über 308 000 (41 % im MW) und über 175 000 (bei jeweils über 4 Mio., bzw. 4,8 Mio. für die jeweiligen Wahlsieger). Vgl. E. Stanwood, A History of the Presidency, Boston 1898, 383, 417. 31 Vgl. J . E. Bryan, The Farmers' Alliance: Its Origin, Progress and Purposes, Fayettville 1891. Zur Geschichte vor allem J . D. Hicks, The Populist Revolt. A History of the Farmers' Alliance and the People's Party (1931), Lincoln 1967, 96 ff., 128 ff., 153 ff., 186 ff. 32 Ebd., 205 ff., 238 ff., 274, 301 ff.; zur Sonderentwicklung in Texas vgl. R. C. Martin, The People's Party in Texas. A Study in Third Party Politics, The Univ. of Texas Bull. 3308, Austin 1933, 30 ff., 113 ff., 141 ff., 189 ff. (zur Presse), 209 ff., 252 ff. 1892 erhielt General Weaver als populistischer Präsidentschaftskandidat über 1,04 Mio. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
136
Hans-Jürgen Puhle
Stimmen (gegen 5,5 Mio. des Wahlsiegers Cleveland), davon die meisten im Mittelwesten, in einigen Südstaaten und in Texas. Nähere Angaben in: A. M. Schlesinger, jr.-F. L. Israel-W. P. Hansen Hg., History of American Presidential Elections, 1789 —1968, Ν. Υ. 1971, II, 1746. 33 Vgl. z. Β. Th. Saloutos, The Agricultural Wheel in Arkansas, Arkansas Hist. Quarterly 2. 1943, 127—140. 34 Der Plan sah (als Pendant zum Zollschutz der I ndustrie) die Errichtung staat licher Lagerhäuser vor, in denen die Ernte zwecks Erzielung möglichst günstiger Verkaufspreise gegen Ausgabe von Papiergeld eingelagert werden sollte, ähnelt also in groben Zügen den Ideen der deutschen „Kornhaus“-Bewegung. National Economist (Organ der Southern FA) 2. 1889, 216 f., 228; Hicks, Revolt, 186 ff.; J . C. Malin, The Farmers' Alliance Subtreasury Plan and European Precedents, Mississippi Valley Historical Review (MVHR) 31. 1944, 255—260. 35 Diese Forderungen stehen nicht — wie vielfach in Europa — in der direkten Tradition Rousseauscher Theorie. 36 A. Weinstein, Prelude to Populism: Origins of the Silver Issue, 1867—1878, New Haven 1970, 53 ff., 214 ff. 37 Vgl. das erstmals 1894 in Chicago erschienene Standardpamphlet von W. Η. Harvey, Coin's Financial School (Neuausgabe Cambridge/Mass. 1963, 93 ff.) und den Verriß von H. White, Coin's Financial Fool, in dem Monometallienblatt: Sound Currency II, 11 v. 1.5. 1895, u. J . L. Laughlin, History of Bimetallism in the United States, Chicago 1897. Zum Problem (das im übrigen bis in die dreißiger Jahre große Attraktion gehabt zu haben scheint): M. Friedman-Α. J . Schwartz, A Monetary History of the United States 1867—1960, Princeton 1971 (19631), 89 ff., 113 ff., 462 ff. Ich beabsichtige, dieses Paradebeispiel einer interessegeleiteten und irrationalisierten Wirtschaftsideologie mit Massenzulauf demnächst in vergleichender Perspektive gesondert zu untersuchen. 38 Die Populists kontrollierten in den neunziger Jahren ein Reihe von Staaten, zeitweise in sehr turbulenter Wild-West-Manier wie 1893 in Kansas, als sich ein populistisches und ein republikanisches Parlament befehdeten. 39 Sehr illustrativ die Beschreibung der Omaha-Convention von 1892 in: Iowa Farmers' Tribune v. 13. 7. 1892. Vgl. Th. Saloutos, Farmer Movements in the South 1865—1933, Lincoln o. J . (1965), 69 ff., 118 ff., 136 ff., 282—285 u. W. A. Williams, The Roots of the Modern American Empire. Α Study of the Growth and Shaping of Social Consciousness in a Marketplace Society, N. Y. 1969, 385 ff. 40 Zur regionalen Entwicklung im Süden vgl. Α. Μ. Arnett, The Populist Movement in Georgia, N. Y. 1922; J . B. Clark, Populism in Alabama, Auburn 1927; A. D. Kir wan, Revolt of the Rednecks, Lexington, Ky. 1951; D. M. Robinson, Bob Taylor and the Agrarian Revolt in Tennessee, Chapel Hill 1935; W. D. Sheldon, Populism in the Old Dominion. Virginia Farm Politics 1885—1900, Princeton 1935; W. J . Hair, Bour bonism and Agrarian Protest, Louisiana Politics 1877—1900, Baton Rouge 1969; J . D. Hicks, The Farmers' Alliance in North Carolina, N. C. Hist. Rev. I I . 1925, 162—187; J . O. Knauss, The Farmers' Alliance in Florida, South Atlantic Quarterly (SAQ) 25. 1926, 300—315. Zu Texas: R. C. Martin, People's Party. I m Mittelwesten (MW): Ε. D. Stewart, The Populist Party in I ndiana, I ndiana Magazine of History 14. 1918, 332 bis 367 u. 15. 1919, 53—74; J . D. Hicks, The People's Party in Minnesota, Minn. Hist. Bull. 5. 1924, 531—560; Η. C. Nixon, The Economic Basis of the Populist Movement in I owa, I owa Journal of History and Politics 21. 1923, 373—396; R. V. Scott, Agrarian Movement in I llinois, 1880—1896, Urbana 1962; R. C. Miller, The Back ground of Populism in Kansas, MVHR 11. 1925, 469—489; J . D. Barnhart, Rainfall and the Populist Party in Nebraska, American Political Science Review (APSR) 19. 1925, 527—540. I m Westen: L. W. Fuller, Colorado's Revolt against Capitalism, © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
137
MVHR 21, 1934, 343—360; M. Harrington, The Populist Movement in Oregon 1889 —1896, Univ. of Oregon M. A. thesis 1935, mimeo 1940. 41 So „Sockless Jerry“ Simpson († 1905), Gen. J . B. Weaver († 1912), „Calamity“ Weller, C. W. Macune, J . Burrows (Nebraska), W. A. Peffer (Kansas), „Pitchfork Ben“ Tillman (S. C ) , Bob Taylor (Tenn.), die unermüdliche Mary Ellen Lease (deren Forderung „to raise less corn and more hell“ sprichwörtlich wurde), der demagogische Antisemit Ignatius Donnelly († 1901) aus Minnesota, dessen 1890 veröffentlichte Utopie: Caesar's Column. Α Story of the Twentieth Century Rekordauflagen erreichte, und Tom Watson (Georgia), der noch 1900, 1904 und 1908 der völlig erfolglose Präsidentschaftskandidat der Populists wurde; er erreichte nur über 50 500 Stimmen bzw. über 114 500 (so viele, weil Bryan nicht für die Demokraten kandidierte) und über 29 100 (bei über 7,2 bzw. 7,6 Mio. für die Wahlsieger). Der charismatische „Great Commoner“ William Jennings Bryan, völlig unbekannt vor 1895, der 1896 als gemeinsamer Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei und der Populistenpartei, der Free Silver Party and anderer Bimetallistengruppen die Wahl knapp gegen McKinley verlor, 1900 und 1908 wieder für die Demokraten kandidierte und später Wilsons Außenminister wurde, gehört nur teilweise in diese Reihe. 42 Bekannt wurde das Wort von J . Simpson: „There is a struggle between the robbers and the robbed.“ Vgl. W. A. Peffer, The Farmer's Side, N. Y. 1891, 273; J . B. Weaver, A Call to Action, Des Moines 1892, 377 ff. 43 Dafür typisch I. Donnelly, Caesar's Column. A Story of the Twentieth Century (1890), Neudruck Cambridge/Mass. 1960, passim oder: S. E. V. Emery, Seven Financial Conspiracies Which Have Enslaved the American People, Lansing 1896. Vgl. R. Hofstadter, The Folklore of Populism, in: ders., The Age of Reform, N. Y. 1955, 60 ff., bes. 70 ff. 44 Der Census von 1900 verzeichnet (in Tausend) folgende Betriebe: 41 226 1664 1366 1912 378 103 47 5737
unter 3 acres: 3—9 10—50 50—100 100—260 260—500 500—1000 über 1000 insgesamt
(1930:)
43 315 2000 1375 1864 451 160 81 6289
Hist. Stat., 279; zur Verteilung auf Staaten (allerdings erst ab 1910) vgl. Stat. Abstr. 1925, 589 u. 1942, 696. 45 Neben Eigentümern, Teileigentümern und Managern sind noch die Pächter (tenants) zu berücksichtigen, von denen es vor allem im Süden verschiedene Abstufungen gibt: cash tenant (festgesetzte Geldpacht und eigenes Inventar), share tenant (1/4 bis 1/3 der Ernte als Pacht; Teilinventar), sharecropper (die Hälfte der Ernte als Pacht, kein eigenes Inventar) und einige Sonderformen (standing renter, „bale-a-plow“). Verteilung (aufgerundet in Tausend): 1900: Eigentümer: Teileigentümer: Manager: Pächter: insgesamt:
US 3202 451 59 2025 5737
dav. n. w. 176 30 2 559 768
Süden 1237 133 19 1231 2620
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
dav. n. w. 158 28 2 552 741
Hans-Jürgen Puhle
138 1930: Eigentümer: Teileigentümer: Manager: Pächter: dav. cropper: ingsesamt:
US 2912 657 56 2664
dav. n. w. 159 44 3 710
6289
9Ϊ6
Süden
dav. n. w.
1191
140
225 17 1791 776 3224
42 0,8 699 393 882
“
— dav. n. w. = davon „non-white“. — Hist. Stat. 278. Zur Verteilung auf Einzel staaten (ab 1910) vgl. Stat. Abstr. 1925, 592—596; 1943, 706—708. 46 Der Betriebswirt wäre eher vergleichbar als die Größen, nur sind die als Daten verfügbaren Durchschnittswerte meistens nicht mehr unter die Einzelstaaten aufgeschlüsselt. Vgl. Stat. Abstr. 1906, 540—542; 1917, 131—134; 1925, 586—588; 1943, 697. Demgegenüber für die jüngste Zeit die Klassifikation nach Verkaufserlös ab 1950, in Stat. Abstr. 1969. 592—597. 47 Vgl. Th. E. Watson, The Life and Times of Andrew Jackson, Thomson 1912, 325 iL Zum Problem der Priorität der „opportunity“ auch R. Hofstadter, Social Darwinism in American Thought, Boston 1960, 85 ff. 48 D. E. Conrad, The Forgotten Farmers. The Story of Sharecroppers in the New Deal, Urbana 1965, 1 ff., 6 ff.; J . Abramowitz, The Negro in the Agrarian Revolt, AH 24. 1950, 89—95. 49 Bezeichnend ist der Sinneswandel von Tom Watson, der zunächst die schwarzen Pächter gleichberechtigt behandelt wissen wollte, aber später gegen sie (wie gegen Katholiken und Juden) auftrat und vom KuKuxKIan einen Kranz zur Beerdigung (1922) bekam; Th. E. Watson, Political and Economic Handbook, Thomson, Ga. 19165, 63 ff., 414 ff. — Vgl. C. V. Woodward, Tom Watson, Agrarian Rebel, Ν. Υ. 1938. 50 Das Ergebnis war knapp: Bryan bekam über 6,5 Mio. Stimmen auf dem demokratischen ticket und über 0,2 Mio. auf dem populistischen. McKinley über 7,1 Mio. Vgl. R. F. Durden, The Climax of Populism: The Election of 1896, Lexington, Ky. 1966 u. P. W. Glad, McKinley, Bryan, and the People, Ν. Υ. 1964. 51 So z.B. der Lubin-Plan der kalifornischen grange von 1894, der Exportprämien für Farmer vorsah und dessen Grundzüge im export-debenture-Plan der zwanziger Jahre wiederzufinden sind. Vgl. J . S. Davis, The Farm Export Debenture Plan, Stanford 1929, 1—41. 52 Vgl. V. C. Ferkiss, Populist Influences on American Fascism, Western Political Quarterly (WPQ) 10. 1957, 350—373; kritisch: P. S. Holbo, Wheat or What? Populism and American Fascism, WPQ 14. 1961, 727—736; Ferkiss, Populism: Myth, Reality, Current Danger, WPQ 14. 1961, 737 ff. Ähnlich P. Viereck, The Revolt Against the Elite, in: D. Bell Hg., The Radical Right, Garden City, N. J . 1963, 161—183 und Ε. A. Shils, The Torments of Secrecy. The Background and Consequences of American Security Policies, Glencoe, I ll. 1956. 53 Vor allem unterstrichen von Hofstadter in seinem die „Revisionismus“-Debatte einleitenden Buch: The Age of Reform, From Bryan to F. D. R., Ν. Υ. 1955, 60 ff., bes. 70 ff. u. 82 ff. Kritisch zurechtgerückt von O. Handlin, Reconsidering the Populists, AH 39, 1965, 68—74. Unnötigerweise völlig geleugnet von N. Pollack, Myth of Populist Anti-Semitism, American Historical Review (AHR) 68. 1962, 76—80. 54 So A. Rochester, The Populist Movement in the United States, Ν. Y. 1943, bes. 120 ff. und F. L. McVey, The Populist Movement, in: T. N. Carver Hg., Selected Readings in Rural Economics, Boston 1916, 692—698. 55 I n der Folge der traditionell positiven Bewertung von Hicks, Populist Revolt, u. Ch. A. u. M. R. Beard, The Rise of American Civilization, Ν. Υ. 1929, 320 ff., vor allem: Ν. Pollack, The Populist Response to I ndustrial America. Midwestern Populist © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
139
Thought (1962), Ν. Υ. 1966; ders., Hofstadter on Populism. A Critique of „The Age of Reform“, JSH 26. 1960, 478—500; ders., Fear of Man: Populism, Authoritarianism, and the Historian, AH 39. 1965, 59—67. Sehr abgewogen und kritisch im Detail: W. T. K. Nugent, The Tolerant Populists: Kansas Populists and Nativism, Chicago 1963, und C. V. Woodward, The Populist Heritage and the I ntellectual, in: ders., The Burden of Southern History, Baton Rouge 1968, 141—166 sowie die Beiträge von O. Handlin, Reconsidering the Populists (68—74); I. Unger, Critique of Norman Pollack's „Fear of Man“ (75—80), u. J . R. Hollingsworth, Populism: The Problem of Rhetoric and Reality (81—85), AH 39. 1965; Th. Saloutos, The Professors and the Populists (235—254) u. W. T. K. Nugent, Some Parameters of Populism AH 40. 1966, 255—270. Zur südlichen Sonderentwicklung und ihrer Historiographie: D. Potter, The Enigma of the South, Yale Review 51. 1961, 242—251, u. A. J . Going, The Agrarian Revolt, in: A. S. Link-R. W. Patrick Hg., Writing Southern History, Essays in Historiography in Honor of F. M. Green, Baton Rouge 1967, 362—382. Zum Diskussionsstand vgl. die Sammlungen von G. Β. Tindall Hg., Α Populist Reader, I ndianapolisN. Y. 1966; R. J , Cunningham Hg., The Populists in Historical Perspective, Boston 1968, u. Th. Saloutos Hg., Populism, Reaction or Reform?, Ν. Υ. 1968. 50 Die Charakterisierung des Populism (und vor allem seiner Führer) als „middle class“ ist insofern nicht ganz unangemessen (vgl. D. J . Saposs, The Role of the Middle Class in Social Development: Fascism, Populism, Communism, Socialism, in: H. Taylor Hg., Economic Essays in Honor of W. C. Mitchell, N. Y. 1935, 393—424; R. Hofstadter, Age, 73 ff., 101 ff.), wenngleich es grundsätzlich nicht ratsam scheint, den in den USA ohnehin diffusen Begriff der „Mittelklasse(n)“ auch noch auf den FarmSektor auszuweiten. Zum Problem vgl. den Beitrag von J . Kocka in diesem Band. 57 Insoweit folgen wir der Hofstadterschen Analyse: Age, 62 ff. 58 Die Agitation gegen Monopole und Trusts überschritt schon in den neunziger Jahren ihren Höhepunkt, zumal die Regierung „unfairerweise“ die Bestimmungen des Sherman-Anti-Trust-Act von 1890 auch auf die seit 1890 sich rapide vermehrenden Farmer-Genossenschaften anwandte, die erst durch den Clayton Act 1914 und den Capper-Volsteadt Act 1922 von der Anti-Trust-Gesetzgebung ausgenommen wurden (vgl. R. H. Elsworth, Agricultural Cooperative Associations, USDA Technical Bull. 40, Washington 1928, 2—8). — Der Schwerpunkt der agrarischen Forderungen lag nach 1900 vor allem auf Mindestpreisen, Produktions- und Marktkontrollen, nach 1910 zunehmend auf An- und Verkaufsgenossenschaften, Krediterleichterungen, Parität des Lebensstandards und der Gewinne im Verhältnis zu andern Sektoren und Ausgleichssubventionen (equalization fees). 59 W. Ε. Fuller, The Rural Roots of the Progressive Leaders, AH 42. 1968, 1—13; J . D. Hicks, The Persistence of Populism, Minnesota History 12. 1931, 3—20; S. J . Buck, The Agrarian Crusade, New Haven 1920. Vgl. dagegen: A. D. Chandler, The Origins of Progressive Leadership, in: E. E. Morison u. a. Hg., The Letters of Th. Roose velt, Cambridge/Mass. 1954, 8, 1462—1465; Hofstadter, Age, 174 ff. 60 Die Termini variieren: „common man“, „the plain man, the common man, the ignorant man, the unaccomplished man, the poor man“ (W. Wilson), „the forgotten man“ (F. D. Roosevelt in Wiederaufnahme einer Formulierung von W. G. Sumner), „every man“ (Huey Long), „average citizen“ (George Wallace). 61 Zum ursprünglichen Programm McGoverns vgl. G. McGovern, On Taxing and Redistributing Income, NYR 18. 1972, 7—11 (4. 5.). 62 Aufschlußreich die programmatische Rede des Gouverneurs von Alabama auf dem demokratischen Parteitag in Miami Beach am 11. 7. 1972, Ν. Υ. Times v. 12. 7. 1972, vgl. auch G. Myrdal, An American Dilemma, N. Y. 1964 19441), I , 452 ff. 63 Vgl. G. McConnell, Decline, 1 ff. 64 1896 wählten Wisconsin (inch Robert La Follette), Minnesota, Iowa und Illinois ebenso wie der Osten, Kalifornien und Oregon mehrheitlich republikanisch; Bryan © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
140
Hans-Jürgen Puhle
blieb außer dem Süden und der Mehrheit der Rocky-Mountains-Staaten nur der westliche Rand des Mittelwestens: Kansas, Nebraska und die Dakotas. Vgl. Ε. Ε. Robinson, The Presidential Vote 1896—1932, Stanford 1934, 46 ff. w Ebd., und Hist. Stat. 12, 688, 693. 66 A. Campbell u. a., The American Voter, Ν. Υ. 1960, 402 ff., u. S. Berger, Les Etats-Unis: Une Agriculture sans Classe Paysanne, in: H. Mendras-Y. Tavernier Hg., Terre, paysans et politique, Paris 1969, I, 220—260, bes. 245 ff. 67 Vgl. vor allem G. Kolko, The Triumph of Conservatism. A Reinterpretation of American History, 1900—1916, Chicago 1967 (19631); ders., Railroads and Regula tion 1877—1916, Ν. Υ. 1970 (19651); J . Weinstein, The Corporate I deal in the Liberal State 1900—1918, Boston 1968; R. H. Wiebe, Businessmen and Reform: Α Study of the Progressive Movement, Cambridge/Mass. 1962; ders., The Search for Order 1877 —1920, Ν. Υ. 1967 (mit einigen Fehlinterpretationen); M. J . Sklar, W. Wilson and the Political Economy of Modern United States Liberalism, Studies on the Left, Ν. Υ. 1960; M. I . Urofsky, Big Steel and the Wilson Administration. A Study in Business-Govern ment Relations, Columbus 1969, gegenüber der traditionellen Literatur: B. P. De Witt, The Progressive Movement (1915), Seattle 1968; S. J . D. Clark, The Progressive Movement. Its Principles and its Program, Boston 1913; A. Mann Hg., The Progressive Era. Liberal Renaissance or Liberal Failure?, N. Y. 1963; G. E. Mowry, The Progressive Movement 1900—1920. Recent Ideas and New Literature, Washington 1958; ders., The Era of Theodore Roosevelt, 1900—1912, N. Y. 1958. Vermittelnd: A. S. Link, Woodrow Wilson and the Progressive Era 1910—1917, N. Y. 1963 (19541). Eine breite Quellenauswahl: R. Hofstadter Hg., The Progressive Movement 1900—1915, Englewood Cliffs 19653. 68 Roosevelt (Präsident-Rep. 1901 — 1909) bekam 1912 als Kandidat der Progressive Party über 4,1 Mio. Stimmen; Wilson (Dem.) über 6,2 Mio. Vgl. Th. Roosevelt, The New Nationalism, Englewood Cliffs 1961 (19101), 21 ff., 50 ff., 86 ff. 69 Vgl. La FoIIette's Autobiography, Madison 1968 (19111), 98 ff., 137 ff., 159 ff. 70 Vgl. A. S. Link, The Higher Realism of W. Wilson and other Essays, Nashville 1971, 17, 31 ff., u. W. A. Williams, Wilson, NYR 17, 9, 1971, 3—6. 71 Für viele: L. Steffens, The Shame of Our Cities, Ν. Υ. 1957 (19041). Zum Hinter grund vgl. R. Ginger, Altgeld's America. The Lincoln I deal vs. Changing Realities, Chicago 1965 (19581). 72 Vgl. H. Croly, The Promise of American Life, N. Y. 1965 (19091), 100 ff., 141 ff., 215 ff., 399 ff.; L. D. Brandeis, Other People's Money and How the Bankers Use it, N. Y. 1914, 4ff.; Link, Wilson, 25 ff., 54 ff. Generell auch: Hartz, Liberal Tradition, 228 ff. 73 Wiebe, The Search for Order 1877—1920, Ν. Υ. 1967. 74 Kolko, Triumph, 2 ff., 255 ff. Das Element der Kontinuität der kapitalistischen „functional syndicalist organization“ bis hin zu Hoover und F. D. Roosevelt betont auch Williams, Contours, 343 ff., 390 ff. 75 Hist. Stat. 283 ff.; D. Friday, The Course of Agricultural Income During the Last Twenty-Five Years, AER 13. 1923, suppl., 147—158, u. J . C. Malin, Mobility and History. Reflections on the Agricultural Policies of the U. S. in Relation to a Mechanized World, AH 17. 1943, 177—191, bes. 186 f. 76 Der Progressivism mußte vieles nachholen bzw. neu inszenieren, was z. Β. in Frankreich oder Deutschland in nachabsolutistischer und obrigkeitlicher Tradition längst zu den Funktionen des Staates und einer entwickelten Bürokratie gehörte. Vgl. H.-J. Puhle, Vom Wohlfahrtsausschuß zum Wohlfahrtsstaat, in: G. A. Ritter Hg., Vom Wohlfahrtsausschuß zum Wohlfahrtsstaat, Köln 1973. 77 Dieser Gegenstand bedarf dringend einer gründlichen Bearbeitung. Bisher: Β. Η. Hibbard, Effects of the Great War upon Agriculture in the United States and Great Britain, N. Y. 1919; A. B. Genung, Agriculture in the World War Period, in: USDA, © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
141
Farmers in a Changing World, The Yearbook of Agriculture, Washington 1940 (USDA, Farmers), 277—296. Kursorisch: Th. Saloutos-J. D. Hicks, TwentiethCentury Populism. Agricultural Discontent in the Middle West 1900—1939, Lincoln o.J. (19511), Kap. I V, 87—110; G. Soule, Prosperity Decade. From War to Depres sion: 1917—1929, N. Y. 1968 (19471), 20 ff., 53 ff., 77 ff. Anregend neuerdings: Μ. Ν. Rothbard, War Collectivism in World War I , in: R. Radosh-M. N. Rothbard Hg., A New History of Leviathan, Ν. Υ. 1972, 66—110. 78 Die Baumwollpreise zogen 1922 an und blieben bis 1925 auf der Vorkriegshöhe. Hist. Stat., 283, 289 f., 294—302; Stat. Abstr. 1943, 737—745. Generell vgl. Ch. C. Davis, The Development of Agricultural Policy since the End of the World War, in: USDA, Farmers, 297—326; J . H. Shideler, Farm Crisis 1919—1923, Berkeley 1957. 79 Die Zollsätze waren zwischen 1861 (Morrill Tariff Act) und 1909 (Payne-Aldrich Tariff Act) generell immer wieder heraufgesetzt worden: besonders 1890 im McKinleyTarif und 1897 im Dingley-Tarif; 1913 setzte der Underwood-Simmons Tariff Act sie etwas herunter, blieb aber ebenso wie noch der Fordney-McCumber Tariff Act von 1922 und der Hawley-Smoot Tariff Act 1930 grundsätzlich protektionistisch. Vgl. F. W. Taussig, The Tariff History of the United States, N. Y. 1964 (19318), 155 ff., 251 ff., 321 ff., 361 ff., 409 ff., 447 ff., 489 ff., 527 ff. 80 Der Anteil der landwirtschaftlichen Exporte am Gesamtexport nahm zwar ab, blieb aber erheblich: Jahresdurchschnitt 1875—1880: 78,8%; 1895—1900: 66,4%; 1905—1910: 54,9%; 1915—1920: 41 %; 1925—1930: 37,1 %, USDA, Farmers, 1184 bis 1196. 81 Eine ansatzweise neue Entwicklung (allerdings auch nicht über die Zollpolitik) zeichnete sich erst im McNary-Haugen Movement und im Export-Debenture-Plan sowie der Absage der American Farm Bureau Federation an den amerikanischen Isolationismus (mit dem Hintergedanken an landwirtschaftliche Absatzmärkte in Europa) Ende 1923 ab. Vgl. AFBF Resolutions 38, 1; J . R. Connor, National Farm Organizations and United States Tariff Policy in the 1920's, AH 32. 1958, 32—43, bes. 43. Zur deutschen Entwicklung vgl. H.-J. Puhle, Agrarische Interessenpolitik und preußischer Konservatismus im wihleminischen Reich 1893—1914, Hannover 1966, 28 ff. 82 1930 wurden nur noch 3 bis 4 man hours zur Produktion eines acre Weizen und 6 bis 8 man hours zur Erzeugung eines acre Mais benötigt; 1890 waren es 8 bis 10 (1825: 50 bis 60) man hours für Weizen und 14 bis 16 (1850: 30—35) man hours für Mais gewesen. USDA Farmers, ebd. — 1920 (1930) hatten bereits 30,7 (58) % aller Betriebe Autos und über 38 % Telefon, allerdings nur 7 (13) % Elektrizität. Stat. Abstr. 1925, 602 und USDA, Farmers, ebd. 85 Besonders einflußreich waren u. a. die Southern Cotton Growers Association, die California Fruit Growers Exchange und die meistens aus Gruppen der Grange heraus gegründeten (etwa 1800) Grain Elevator and Farmers' Stores Cooperatives. 1907 gab es nach einer Übersicht des USDA ca. 85 000 Genossenschaften mit etwa 3 Mio. Mitgliedern (= ca. 5 0 % aller Farmer), darunter 30 000 Bewässerungsgenossenschaften, 5000 An- und Verkaufsgenossenschaften, 1500 gesellige und Bildungsvereinigungen. Agricultural Yearbook 1908, 186; F. Α. Shannon, The Farmer's Last Frontier, Ν. Υ. 1959, 329 ff., 347 f.; Saloutos, South, 153 ff. 84 Gleichzeitig mit der Errichtung des USDA (das 1889 Kabinettsrang erhielt) und dem Homestead Act war 1862 der Morrill Land Grant College Act zur Förderung der Agronomie in Forschung und Lehre und 1887 der Hatch Act zur Einrichtung von Experimentierstationen verabschiedet worden; die American Association of Agricultural Colleges and Experiment Stations (später: Assoc. of Land Grant Colleges and Universities mit dem geistigen Zentrum an der Cornell University) datiert ebenfalls von 1887. Vgl. Shannon, 270 ff. 85 Report of the Commission on Country Life, N. Y. 1911; vgl. W. R. Cross, Ideas © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
142
Hans-Jürgen Puhle
in Politics: The Conservation Policies of the Two Roosevelts, Journal of the History of Ideas (JHI) 14. 1953, 421—438. 88 Anfang 1915 gab es ca. 1000 county agents in den USA, die Mehrheit davon in den Südstaaten. In den anderen Staaten gab es mehr als jeweils 20 nur in Indiana, Minnesota, New York und West Virginia sowie in Texas. USDA, Misc. Publ. 15, Washington 1920, 60—65; O. M. Kile, The Farm Bureau Movement, Ν. Υ. 1921, 89 bis 93. Vgl. auch: A. C. True, A History of Agricultural Extension Work in the United States 1789—1925, N. Y. 1926; G. Baker, The County Agent, Chicago 1939, u. J . C. Bailey, Seaman A. Knapp, Schoolmaster of American Agriculture, N. Y. 1945. 87 Bundesstaatliche Anerkennung erhielt das county agent-System im Smith-Lever Extension Act von 1914. 1920 gab es in fast jedem Staat Farm Bureaus; die erste staat liche Federation wurde 1915 in Missouri gegründet. 88 Bis hin zum „Master Farmer Movement“ und Purnell Act 1925 und zur Errichtung der ersten hybrid seed-corn-Company 1926. — Der Extension Service lag (bis 1954) wesentlich in den Händen der Farm Bureaus in den counties und Einzelstaaten. Bereits 1929 hatten über 3/4 aller agrarischen counties landwirtschaftliche Fachberater (2323 von 3076); 1934 über 2800 und 1939 rund 3000, also fast alle. G. McConnell, Decline, 202. Der Smith-Hughes Act von 1917 hatte außerdem die Fachausbildung wesentlich gefördert. 89 Insbesondere durch den Capper-Volstead Act und Grain Futures' Act von 1922, den Federal Farm Loan Act von 1916 und den Agricultural Credits Act von 1923 sowie die seitdem mögliche Vergabe mittelfristiger Kredite durch die Federal Intermediate Credit Bank. Vgl. J . W. Wright, Farm Mortgage Financing, Ν. Υ. 1923 u. F. Baird-C. L. Brenner, Ten Years of Federal I ntermediate Credits, Washington 1933; Saloutos Hicks, Populism, Kap. I ll, 56—86 u. Kap. X, 287—320. — Nach dem Coun cil of North American Grain Exchanges (1910) wurde 1920 von A. Sapiro die American Cotton Cooperative Association, später das National Council of Farmers' Cooperative Marketing Associations gegründet; 1926 wurde die Division of Cooperative Marketing im Bureau of Agricultural Economics (USDA) eingerichtet. 90 Die Society of Equity war am stärksten in Wisconsin, wo sic 1907: 10 000 und 1920 über 40 000 Mitglieder hatte, ferner in North Dakota und Minnesota. Vgl. Saloutos-Hicks, Populism, Kap. IV, 111—148; R. H. Bahmer, The American Society of Equity (33—63) und Th. Saloutos, The Wisconsin Society of Equity AH 14. 1940, 78—95. 91 Die Farmers' Educational and Cooperative Union (Farmers' Union = FU) war in Texas von dem Alliance-Funktionär und Journalisten J . Ν. („Newt“) Gresham gegründet worden, hatte 1910 etwa 120 000, 1919: 140 000 und 1930: über 90 000 Mitglieder; am stärksten war sie in Texas, einigen Südstaaten und im westlichen Mittelwesten: Kansas, Nebraska und Iowa. Von allen Gruppen dieser Zeit argumentierte die FU zwar am „radikalsten“ und am stärksten klassenbezogen, förderte aber gleichzeitig die genossenschaftliche Organisation am meisten und arbeitete am reibungslosesten mit den AFL-Gewerkschaften zusammen. Vgl. E. Wiest, Farmers' Union, ESS 1937, III, 132 f., sowie Saloutos-Hicks, Populism, Kap. VIII, 219—254, u. Saloutos, South, 184 bis 212. 92 Saloutos, South, ebd. 93 Die „Iowa-Idea“ zentrierte sich um die Zeitschrift „Wallaces' Farmer and Iowa Homestead“, nacheinander herausgegeben von H. Wallace, Η. C. Wallace (1921 — 1924 Landwirtschaftsminister unter Harding) und H. A. Wallace, der von 1933 bis 1940 Landwirtschaftsminister unter F. D. Roosevelt, 1941 bis 1944 Vizepräsident und 1948 erfolgloser Präsidentschaftskandidat der (dritten) Progressive Party wurde. Zur Kontinuität der progressiven Politik der Wallaces vgl. M. O. Sillars, H. A. Wallace's Editorials on Agricultural Discontent, 1921—1928, AH 26. 1952, 132—140 und die Diskussionsbeiträge von D. L. Winters (109—120), J . H. Shideler (121—125), E. L. und
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
143
F. H. Schapsmeier (127—137), R. S. Kirkendall (139—142) und Th. Rosenof (143 bis 153) in AH 41. 1967 sowie R. Lord, The Wallaces of I owa, Ν. Υ. 1947, 87 ff., 133 ff., 211 ff., 223—230, 281 ff., 322 ff., 473 ff. u. E. L. — F. H, Schapsmeier, Henry A. Wallace of I owa, Arnes, Io. 1968. 94 Vgl. die frühe Würdigung von F. C. Howe, Wisconsin: An Experiment in Democracy, Ν. Υ. 1912 und R. S. Maxwell, La Follette and the Rise of the Progressives in Wisconsin, Madison 1956. 95 Die 1915 gegründete Non Partisan League (NPL) unter der Führung des sozialistischen Dissidenten A. C. Townley, H. G. Teigan, L. Frazier, W. A. Langer und W. Lemke (des späteren unglücklichen Präsidentschaftskandidaten des Father Coughlin 1936) wirkte vornehmlich durch die beiden Traditionsparteien, indem sie die jeweiligen primaries, vorzugsweise der Republikaner, für ihre Kandidaten entschied; sie stellte zwischen 1917 und 1923 den Gouverneur und kontrollierte das Parlament von North Dakota ebenso wie ab 1918 im Verein mit den Gewerkschaften das von Minnesota. Starken Einfluß übte die League vorübergehend auch in Iowa, Nebraska, Kansas, Montana und Colorado aus, während sie sich in Wisconsin nicht gegen La Follette's Progressives durchsetzen konnte. Entscheidend für ihren Zerfall seit 1923 waren neben Korruptionsskandalen vor allem der Streit mit La Follette und die zunehmende Organisation der einzclstaatlichen Farm Bureaus und neuer Farmer-Labor-Bewegungen im östlichen und der Farmers' Union im westlichen Einflußbereich der League. Die beiden US-Senatoren, die noch 1945 gegen den Eintritt der USA in die UN stimmten, Langer und Shipstead, waren alte Non-Partisans. Vgl. R. L. Morlan, Political Prairie Fire. The NPL 1915—1922, Minneapolis 1955, 22 ff., 87 ff., 152 ff.; Saloutos-Hicks, Populism, Kap. VI und VII, 149—218; R. P. Wilkins, The NPL and Upper Midwest Isolationism, AH 39. 1965, 102—109, u. d. Ergebnisse der Diss. von M. R. Lorentz, Henrik Shipstead, Minnesota Independent 1923—1946, Diss. Abstr. 26, Aug. 1965, 1007. Zum Zerfall: C. Ε. Russell, Bare Hands and Stone Walls, N. Y. 1933, 343 f. 95a Auf die diesbezügliche generelle Kontinuität zwischen Progressivism und New Deal verweisen auch Α. Μ. Scott, The Progressive Era in Perspective, Journal of Poli tics (JP) 21. 1959, 696 ff., u. S. Fine, Laissez-Faire and the General Welfare State. Α Study of Conflict in American Thought 1865—1901, Ann Arbor 1956, Kap. 11. 96 Die Grange trat auch dem als koordinierender Dachverband gedachten National Board of Farm Organizations (1919) nicht bei. Zur weiteren Entwicklung der Grange vgl. D. C. Wing, Trends in National Farm Organizations, in: USDA, Farmers, 941 bis 979, bes. 945—954. 97 Nähere Angaben zur Organisation der AFBF und einzelstaatlicher Bureaus in der offiziellen Gründungsgeschichte von O. M. Kile, The Farm Bureau Movement, Ν. Υ. 1921, 130 ff.; zur Beziehung zu anderen Wirtschaftssektoren 258 ff.; zur Washingtoner Lobby 176 ff., 264 ff. 98 L. B. Schmidt, The Role and Techniques of Agrarian Pressure Groups, AH 30. 1956, 49—58, bes. 52. 99 10 bis 15 Dollar im Jahr. McConnell, Decline, 56. 100 1921 waren 466 421 Familien Mitglieder, 1924 301 747, 1927 272 049, 1930 321 195, 1933 163 246, 1936 356 564, 1939 398 197, davon 208 739 im Mittelwesten, 97 141 im Süden, 65 312 im Nordosten und 27 005 im Westen; 1941 518 031, 1946 1 128 259. G. Baker, County Agent, 23; McConnell, Decline, 185. 101 Vgl. W. A. Lloyd, County Agricultural Agent Work Under the Smith-Lever Act, 1914 to 1924, USDA Misc. Circ. 59, 1926, 9. 102 Vgl. H.-J. Puhle, Von der Agrarkrise zum Präfaschismus, Wiesbaden 1972, 21 ff. 103 The New International Year Book 1912, 20; Saloutos-Hicks, Populism, 261—265; auch: Kile (1921), 258 ff. 104 Auf die damit zusammenhängenden Probleme kann hier leider nicht näher eingegangen werden. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
144
Hans-Jürgen Puhle
105 In den Farmers' National Headquarters 1910, im National Board of Farm Organizations 1917. 108 Ζ. Β. im Farmers' National Council, dem National Board of Farm Organiza tions 1919, der National Agricultural Conference, der American Agricultural Confe rence und ähnlichen Organisationen. 107 Der erste AFBF-Präsident J . R. Howard verstand z. Β. die Landwirtschaft als ausgleichenden Faktor gegen die Herrschaft des Kapitals und die Radikalität der Gewerkschaften, als „patriotischen“ Hort gegen Streik, Anarchie, Bolschewismus und alles „Un-Amerikanische“. Farmer-Labor-Parteien erschienen ihm als „wirtschaftliche und politische Unmöglichkeit“. Iowa Farm Bureau Messenger v. 7.2. 1920; Milwaukee Journal v. 10.6.1921 und AFBF Resolutions of November 14, 1919, and March 4, 1920, Chicago 1920 (Flugblatt). 108 So der Vorsitzende der Farmers' Union und des National Board of Farm Organizations, Charles S. Barrett, in: Ν. Υ. Times v. 15.5.1921. Zum Klima generell vgl. J . W. Prothro, The Dollar Decade: Business I deas in the 1920's, Baton Rouge, 1954. 109 La Follette als Kandidat der Progressive Party errang nur über 4,8 Mio. Stimmen, gegenüber mehr als 15 Mio. für Coolidge. Die relative Mehrheit erreichte er nur in Wisconsin; in Idaho, California, Minnesota, den Dakotas, Washington, Wyoming, Nevada und Oregon erreichte er den zweiten Platz. E. E. Robinson, Presidential Vote, 13. Vgl. Ch. H. Rowell, La Follette, Shipstead and the Embattled Farmers: What's Happening in Wisconsin and Minnesota and Why?, in: World's Work 46. 1923, 415 ff.; F. H. Haynes, The Collapse of the Farmer-Labor-Bloc, Social Forces IV. 1925, 148—156; K. C. MacKay, The Progressive Movement of 1924, Ν. Υ. 1947. 110 Vgl. Saloutos, South, 265—272. 111 Auf die zentrale Rolle des AFBF-Repräsentanten Chester Η. Gray dabei weist bes. Saloutos (Saloutos-Hicks, Populism, 321 ff., bes. 323 f.) hin. 112 Dazu gehörten im Senat u. a. Kendrick (D, Wyo.), Norris (R, Na.) La Follette (R, Wisc), Ransdell (D, La.), Heflin (D, Ala.); die Führung lag bei Kenyon (R, Iowa), Smith (D, S. C.) und Capper (R, Kansas). Vollständige Liste bei Kile (1921), 188 f. und E. D. Graper, The American Farmer Enters Politics, CH 19. 1924, 817—826, bes. 818 f. Vgl. auch A. Capper, The Agricultural Bloc, Ν. Υ. 1922 und J . G. Welliver, Agricultural Crisis and the Bloc, American Review of Reviews 65. 1922, 159 ff. 118 Saloutos-Hicks, Populism, 325 ff., 339 ff. 114 Auf die „syndicalist commodity marketing philosophy“ der AFBF und die Gegensätze zwischen den Gruppen verweist u. a. J . C. Malin, Mobility and History, AH 17. 1943, 177—191, bes. 185. 115 Zum Antrag Kanitz vgl. Puhle, Interessenpolitik, 230 ff. 116 G. N. Peek, Equality for Agriculture with Industry, in: Proceedings of the Academy of Political Science 12. 1927, 564—575; G. C. Fite, G. N. Peek, Equality for Agriculture, CH 28. 1955, 351—355, bes. 353. Vgl. auch ders., G. Ν. Peek and the Fight for Farm Parity, Norman 1954. 117 Dazu A. M. Christensen, Agricultural Pressure and Governmental Response in the United States, 1919—1929, AH 11. 1937, 33—42, 38. 118 Dazu J . D. Black, The McNary-Haugen Movement, AER 18. 1928, 405—427, bes. 422 ff., u. D. N. Kelley, The McNary-Haugen Bills, 1924—1928, AH 14. 1940, 170—180, 175 ff. Ferner J . D. Hicks, Republican Ascendancy 1921—1933, N. Y. 1960, 193 ff. 119 Der export debenture-Plan wurde nach einer I dee von Ch. L. Stewart (Univ. of I llinois) zuerst 1926 im Kongreß eingebracht. Zum Vergleich beider Pläne vgl. die Berechnungen von J . R. Connor, AH 32, 1958, 32—43, bes. 42 und die Beiträge von H. N. Owen, G. N. Peek-Η. S. Johnson und L. J . Taber in: G. McGovern, Agricul tural Thought in the Twentieth Century, I ndianapolis — Ν. Υ. 1967, 114 ff., 135 ff.
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
145
120 Allerdings in der Form jener Steuer auf die Weiterverarbeitung, die dann 1936 vom Supreme Court für verfassungswidrig erklärt wurde. 121 Vgl. J . D. Black, Agricultural Reform in the United States, Ν. Υ. 19293. 122 1927 stimmten im Senat 47 dafür und 39 dagegen (bei 9 Enth.), im Repräsentantenhaus 214 dafür und 178 dagegen (39 Enth.); 1928 nahmen besonders die Enthaltungen zu: im Senat 53:23 (17) und im Repr.-Haus 204:121 (105 Enth.). Zur geographischen Aufschlüsselung: J . D. Black, AER 18. 1928, 408—411. 125 Die Weizenpreise waren seit 1925 wieder gefallen (1925: 1.43; 1926: 1.21; 1927: 1.19, 1928: 0.99; 1929: 1.03); die Mais- und Baumwollpreise seit 1927 (Mais 1927: 0.84; 1928: 0.84; 1929: 0.79; Baumwolle 1927: 20.1; 1928: 17.9; 1929: 16.7). Hist. Stat. 296 f., 301. 124 Die Formulierungen blieben allerdings unklar: Schlesinger-Israel-Hansen Hg., III, 2614—2616 (Dem.) und 2631 f. (Rep.) 125 Es wurden zusätzlich 500 Mio. Dollar zur Verfügung gestellt. Vgl. den Wortlaut in: First Annual Report of the Federal Farm Board, Washington 1930, 64—70; C. P. Howland, The Failure of Farm Board Stabilization, Yale Review N. S. 21. 1932, 503—505 und D. A. Shannon, Between the Wars: America 1919—1940, Boston 1965, 128 ff. 126 Vgl. Th. Saloutos, Government and the Farmer since World War I, CH 31. 1956, 144—149, 146; E. R. A. Seligman, The Economics of Farm Relief, N. Y. 1929, 127 Die Weizenpreise fielen auf 1930: 0.67; 1931: 0.39: 1932: 0.38; Mais 1930: 0.59; 1931: 0.32; 1923: 0.31; Baumwolle 1930: 9.4; 1931: 5.6; 1932: 6.5 $/bushel, bzw. c/lb. — Vgl. L. H. Bean, Agriculture and the World Crisis, in: Yearbook of Agriculture, Washington 1933, 91—95 und die Preis- und Betriebsstatistik ebd., 399 ff.; ferner: W. E. Leuchtenburg, The Perils of Prosperity, 1914—1932, Chicago 1958, 241 ff.; J . K. Galbraith, The Great Crash 1929, N. Y. 1962 (19541), 91 ff.; Α. Μ. Schlesinger, The Age of Roosevelt (Vol. I : The Crisis of the Old Order), 1919—1933, Boston 1964, 155 ff. 128 Sehr illustrativ die Erlebnisschilderungen der Zeitgenossen in: S. Terkel, Hard Times. An Oral History of the Great Depression, Ν. Υ. 1970, 213—235, u. in D. A. Shannon Hg., The Great Depression, Englewood Cliffs 1960, 16—34; D. Kramer, The Wild Jackasses. The American Farmer in Revolt, N. Y. 1956, 222 ff., u. die Mono graphie von J . L. Shover, Cornbelt Rebellion: The Farmers' Holiday Association, Urbana 1965, 36 ff. 129 Wallaces' Farmer and I owa Homestead 58 v. 25. 11. 1933, 5. 130 Eine 1942 durchgeführte Roper-Umfrage hat deutlich gemacht, daß auch die Mitglieder der FU überwiegend Farmer der oberen Einkommensklassen waren, also nicht Unterschiede des sozialen Status, sondern eher die historisch-geographischen Differenzen (Great Plains gegenüber dem älteren, Östlichen Mittelwesten) die größere Radikalität der FU im Vergleich zur AFBF erklären. The Fortune Survey: Farmers II, Fortune, April 1943, 8. 181 Reno war trotz mancher volkstribunenhafter Züge keineswegs nur ein spätpopulistischer Demagoge, der gleicherweise gegen die „Ausbeuter“ und für „property“ im traditionellen Sinn argumentierte, sondern ein gut bezahlter Manager und Agrarfunktionär, der sich auch auf das konkrete „bargaining“ mit Politikern verstand und der bis 1934 in der Regel ernster genommen wurde als etwa eine so schillernde und sprunghafte Figur wie Louisianas Senator Huey Long. Bis zu seinem Tode im Mai 1936 war er neben John A. Simpson der einflußreichste Führer der Farmers' Union. Vgl. seine Artikel in: Des Moines Register v. 13. 4. 1931 und 27.1.1934; R. A. White, Milo Reno. Farmers' Union Pioneer, Iowa City 1941, 17 ff.; G. C. Fite, John A. Simpson: The Southwest's Militant Farm Leader, MVHR 35. 1949, 563—584. 152 Der für den 4. Juli (!) 1932 angesetzte Streik wurde kurzfristig auf den August verschoben; am 11.8. begann der Milch-Streik in Sioux City, am 25.8. kam es zu
10 Winkler, Krise
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
146
Hans-Jürgen Puhle
Zusammenstößen in Council Bluffs. Vgl. M. Reno, The Farmers' Holiday Association's Strike, Radio Address ν. 20. 7. 1932, in: McGovern, 162—170 und die zeitgenössischen Eindrücke bei D. R. Murphy, The Farmers go on Strike, New Republic 72, 31. 8. 1932, 66 ff. und J . O. Babcock, The Farm Revolt in Iowa, Social Forces 12, März 1934, 369 ff.; D. Kramer, Jackasses, 224 ff.; J . L. Shover, The Farmers' Holiday Association Strike, August 1932, AH 39. 1965, 196—203. 133 Einerseits aufgrund der saisonbedingten Marktflaute, andererseits aufgrund der entscheidenden Bedeutung der (weit entfernten) zentralen Märkte für die Preisbildung. Vgl. J . L. Shover, Depression Letters from American Farmers, AH 36. 1962, 163—168. 134 An der nationalen Versammlung der FHA in Des Moines im März 1933 nahmen Repräsentanten von 1 Mio. Farmern aus 16 Staaten teil. D. R. McCoy, Angry Voices. Left-of-Center Politics in the New Deal Era, Lawrence 1958, 31. 135 Dazu bes. Kramer, 228 ff. und die ausführliche, ältere Darstellungen ersetzende Arbeit von J . L. Shover, Cornbelt Rebellion. 136 Bei den Straßenblockaden und besonders den Ausschreitungen gegen einen Richter in Le Mars Ende April 1933. 137 In Iowa wurde die Vermögenssteuer kurzfristig um 20 % gesenkt, in Minnesota wurden Schuldenmoratorien eingeräumt, in Wisconsin zeitweise Festpreise dekretiert. 138 Allein Floyd Olson (Minn.) war zu dem Embargo bereit. Das im Oktober 1933 von Gouverneur Langer für North Dakota dekretierte Weizenembargo wurde durch gezielte Preisstützungskäufe der Farm Credit Administration (Morgenthau) für die Wohlfahrtseinrichtungen (Hopkins) auf Weisung des Präsidenten aufgefangen. J . M. Blum, From the Morgenthau Diaries. Years of Crisis, 1928—1938, Boston 1959, 57 bis 60; V. L. Perkins, The AAA and the Politics of Agriculture: Agricultural Policy Formulation in the Fall of 1933, AH 39. 1965, 220—229, 225 f. Vgl. McCoy, 32 ff., 42 ff.; Saloutos-Hicks, Populism, 443 ff. 139 Farm Holiday News v. 22. 3. 1933. 140 Hoover hatte 1928 noch in allen mittelwestlichen Staaten die Mehrheit bekommen, 1932 in keinem einzigen mehr, sondern nur noch in vereinzelten (östlichen) counties. Vgl. Ε. Ε. Robinson, Vote, 26, 28. 141 Vgl. W. Davenport, Money in the Mailbox (Colliers v. 10.2.1934) und W. Powell-Α. T. Cutler, Tightening the Cotton Belt (Harper's, Febr. 1934), in: F. Freidel Hg., The New Deal and the American People, Englewood Cliffs 1964, 46 ff., 53 ff.; ferner das Ergebnis der Diss. von J . Korgan, Farmers Picket the Depression, Diss. Abstr. 22, Nov. 1961, 1601. 142 Zwei von drei Briefen, die Landwirtschaftsminister Henry A. Wallace in den ersten drei Monaten des Jahres 1933 bekam, favorisierten das radikale „cost of produc tion“ Schema. G. C. Fite, Farmer Opinion and the Agricultural Adjustment Act, 1933, MVHR 48. 1962, 656—673. Zeitweise spielte auch der von G. F. Warren (Cornell) propagierte „commodity dollar“ eine Rolle. 143 Vgl. die Guttman-Skalierung der Senatsabstimmungen in J . L. Shover, Populism in the Nineteen-Thirties: The Battle for the AAA, AH 39. 1965, 17—24, bes. 19 ff. 144 Das von Raymond Moley überarbeitete Thomas-Amendment ermächtigte den Präsidenten, den Goldgehalt des Dollar herabzusetzen, Auslandsschulden bis zu 100 Mio. Dollar in Silber zu akzeptieren und den Kredit durch Ausgabe von 3 Mrd. Dollar in Banknoten auszuweiten (angenommen 64:20 im Senat). Die Frazier-Bill wurde daraufhin abgelehnt. 145 Die Hope-Norbeck Bill (ausgearbeitet von M. L. Wilson, J . D. Black und M. Ezekiel) war 1932 abgelehnt worden. 146 Eine ganze Reihe der Roosevelt-Berater, die sich später anderen Sektoren zuwandten, hatten sich ursprünglich mit Agrarfragen beschäftigt: Außer H. A. Wallace © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
147
und Rexford G. Tugwell vor allem M. L. Wilson, W. J . Spillman, J . D. Bladk, M. Ezekiel, G. Warren, G. N. Peek, Η. S. Johnson, B. Ruml, Chester C. Davis und beson ders der Herausgeber des „American Agriculturalist“, Henry Morgenthau, jr., der FDR schon als Gouverneur von New York beraten hatte (vgl. G. A. Slichter, F. D. Roose velt's Farm Policy as Governor of New York, 1928—1932, AH 33. 1959, 167—176, bes. 169 ff.). 147 I n seiner agrarpolitischen Rede in Topeka am 14. 9. 1932 (wesentlich ge schrieben von Wilson, Ezekiel und Tugwell). Vgl. Ch. McFadyen Campbell, The Farm Bureau and the New Deal. A Study of the Making of National Farm Policy 1933— 1940, Urbana 1962, 51. 148 Über die Vorgeschichte der sog. „National Agricultural Conference“ vom 10. 5. 1933 und die Mittlerrolle der AFBF vgl. Campbell, 52 ff. sowie Ο. Μ. Kile, The Farm Bureau Through Three Decades, Baltimore 1948, 184 ff. u. W. R. Johnson, National Farm Organizations and the Reshaping of Agricultural Policy in 1932, AH 37. 1963, 34—42. 149 Dazu gehören nicht nur die im engeren Sinne agrarpolitischen Maßnahmen: Agricultural Adjustment Act (und Gründung der AAA) v. 12.5.1933, die Errichtung der Farm Credit Administration (mit Morgenthau als Direktor) im Juni 1933, des Soil Erosion Service im Innenministerium im September, der Federal Surplus Relief Corporation und der Commodity Credit Corporation im Oktober 1933 und der FrazierLcmke Farm Bankruptcy Act von 1934 oder der Bankhead-Jones Act von 1935, der die Mittel für die Land Grant Colleges erhöhte, sondern auch die Rural RehabilitationProgramme der FERA und anderer Wohlfahrtseinrichtungen. Ausführlich die kritische Bestandsaufnahme in: E. G. Noursc-J. S. Davis-J. D. Black, Three Years of the Agricultural Adjustment Administration, N. Y. 1937, 32 ff., 78 ff.; zur internen Verwaltung 246 ff.; Th. Saloutos, The New Deal and Farm Policy in the Great Plains, AH 43. 1969, 345—355; W. Ε. Leuchtenburg, F. D. Roosevelt and the New Deal, 1932—1940, N. Y. 1963, 137 ff.; A. M. Schlesinger, The Age of Roosevelt (Vol. I I : The Coming of the New Deal), Boston 1965, 55 ff. und die Kritik von G. Bouvard, L'Agriculture dirigeé aux Etats-Unis. Essai critique sur l'économie autoritaire, Paris 1935, 115 ff., 147 ff., 235 ff. 150 Der ursprüngliche Plan stammte von W. J . Spillman und war von J . D. Black, B. Ruml und Μ. L. Wilson modifiziert worden. Vgl. Spillman, Balancing the Farm Output, N. Y. 1927; (Wilson), The Voluntary Domestic Allotment Plan for Wheat, Food Research I nstitute, Stanford, Wheat Studies 9. 1932, 23—62. Zur Planungs perspektive bes. Nourse u.a., 24 ff., 115 ff., 217 ff., 386 ff., 420 ff.; zur Ertragslage der Betriebe 280 ff. — Produktionskontrolle hieß im ersten Jahr auch Vernichtung der Ernte- bzw. Zuchtüberschüsse, worüber sich zum Teil (wie im Fall der abgeschlachteten Ferkel) die Öffentlichkeit erregte. Vgl. die Ergebnisse der Diss, von Ch. R. Lambert, New Deal Experiments in Production Control: The Livestock Program 1933—1935, Diss. Abstr. 23, Sept. 1962, 1000. 151 Campbell, 103 ff., 122 ff.; Kile (1948), 197 ff.; Nourse et al., 115 ff., 123 ff., 217 ff., 329 ff.; Saloutos, The American Farm Bureau Federation and Farm Policy; 1933—1945, South West Social Sciences Quarterly (SWSSQ) 28. 1948, 313—333, bes. 316 ff.; ders., The Farmer's New Deal, CH 26. 1954, 99—104; ders., Edward A. O'Neal: The Farm Bureau and the New Deal, CH 28. 1955, 356—361, bes. 358 f. 152 Da das Urteil zum Fall Hoosac Mills v. 6. 1.1936 die Weiterverarbeitungssteuer für verfassungswidrig erklärt hatte, wurde die AAA-Gesetzgebung durch den Soil Conservation and Domestic Allotment Act v. 29. 2.1936 kurzfristig umgestellt auf das Motiv der Bodenkonservierung, das auch dem zweiten Agricultural Adjustment Act vom 16.2.1938 zur Begründung diente. Vgl. die Diskussion in: P. Murphy, The New Deal Agricultural Problem and the Constitution, AH 29. 1955, 160—169 und W. E. Leuchtenburg, FDR, 170 ff. 10*
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
148
Hans-Jürgen Puhle
153 Zusätzlich zu den Maßnahmen der bisherigen AAA sah der „ever normal granary“-Plan Überschuß- und Marktregulierung durch vermehrte Lagerkredite und Festlegung von Marktquoten (mit Zustimmung von 2/3 der am Programm beteiligten Farmer) vor, also eine Verbesserung der Möglichkeit, die Produktenpreise künstlich hochzuhalten, die von der AFBF enthusiastisch begrüßt wurde. H. A. Wallace, A Defense of the New Deal Farm Program, in: H. Zinn Hg., The New Deal Thought, Indianapolis — N. Y. 1966, 232—239; Kile 227 ff. und 236 ff. (bes. zur engen Koordination der Planung mit der AFBF); M. S. Eisenhower-R. J . Kimmel, Old and New in Agricultural Organization, in: USDA, Farmers, 1125—1137. 154 Auf dieses Sonderproblem kann hier nicht näher eingegangen werden. Vgl. Kile, 247—253; D. E. Lilienthal, TVA. Democracy on the March, Chicago 1966 (19441), bes. 77 ff., 138 ff.; Ph. Selznick, TVA and the Grass Roots, Α Study in the Sociology of Formal Organization, Ν. Υ. 1966, 19 ff., 47 ff., 117 ff., 264 ff. 155 Wallace, ebd., 237. Vgl. auch Wallace's I dealisierung der Farmer als „6 000 000 competing units in a world of corporate organizations and increasing industrial con trol“, die die Wirklichkeit längst nicht mehr traf (ebd. 236); ferner die programmatische Abhandlung des damaligen USDA-Funktionärs Rensis Likert, Democracy in Agriculture — Why and How?, in: USDA, Farmers, 994—1002. 156 Bei den Abstimmungen der beteiligten Produzenten entschieden sich im Mai 1935 über 404 000 von über 466 000 Farmern für die Fortsetzung der Produktionskontrolle für Weizen; beim Programm für Mais und Schweinezucht (corn-hog) waren es im Oktober 1934 67 %; 1935 über 85 %. USDA, AAA, Agricultural Adjustment 1933 to 1935, Washington 1936, 176. Vgl. auch R. E. Martin, The Referendum Process in the Agricultural Adjustment Programs of the United States, AH 25. 1951, 34—47. Eine gewisse Ausnahme machten bestimmte neue Typen von Genossenschaften: vgl. Ε. Α. Foster-Η. A. Vogel, Cooperative Land Use Planning — A New Development in Democracy, in: USDA, Farmers, 1138—1156. 157 Der erste Reciprocal Tariff Act wurde 1934 verabschiedet, die Außenhandelspolitik nach 1937 intensiviert. Vgl. Campbell, 152 ff. und das Resumée von L. A. Wheeler, Reciprocal Trade Agreements-Α New Method of Tariff Making, in: USDA, Farmers, 585—595. 158 Die Rural Electrification Administration wurde im Mai 1935 eingerichtet. Vgl. Η. S. Persons, The Rural Electrification Administration in Perspective, AH 24. 1950, 70—89. 159 Das School Lunch Program der FERA wurde 1935 eingerichtet, der Food Stamp Plan (für Bedürftige) 1939; seit April 1934 gab es bereits verschiedene Rural Rehabilitation-Programme der FERA, die eng mit der Federal Surplus Relief Corporation zusammenarbeiteten. 160 Vgl. C. B. Cowing, Populists, Plungers, and Progressives. A Social History of Stock and Commodity Speculation 1890—1936, Princeton 1965, 264 ff., bes. 271—273. 161 So z. Β. mit Hilfe La Guardias im Geschäft gegen die Wages and Hours Bill im Juni 1939 (Campbell, 116—121). 162 Saloutos-Hicks, Populism, 532—534. 163 Vgl. die Erinnerung des Leiters des Programms R. G. Tugwell, The Resettlement Idea, AH 33. 1959, 159—164, bes. 161. 164 Dazu überzeugend erst die neueren Interpretationen von D. H. Grubbs, Gardner Jackson, That „Socialist“ Tenant Farmers' Union, and the New Deal, AH 42. 1968, 125—137, bes. 126 f.; ders., Cry from the Cotton, The STFU and the New Deal, Chapel Hill 1971, 30ff.,58, 75 u. D. E. Conrad, The Forgotten Farmers, 83 ff. Die Charakterisierung der STFU als durchweg sozialistisch ist zweifellos einseitig: so M. S. Venkataramani, Norman Thomas, Arkansas Sharecroppers and the Roosevelt Agricultural Policies, 1933—1937, MVHR 47. 1960, 225—246, u. J . Auerbach, Southern Tenant Farmers: Socialist Critics of the New Deal, Labor History 7. 1966, 3—18. Besser:
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
149
W. E. Leuchtenburg, FDR, 137 f. u. Schlesinger, Coming, 377 ff. 155 Conrad, 140 ff., 177 ff. 166 Entlassen wurden u. a. Jerome Frank, Francis Shea, Lee Pressman und Gardner Jackson, indirekt auch Frederick Howe, nicht jedoch Alger Hiss und Paul Appleby. Die Initiative lag (mit der Rückendeckung von Minister Wallace und Roosevelt) vor allem bei Chester C. Davis. Vgl. vor allem Conrad, 117, 123 ff., 135—153, bes. 139 ff.; sehr unvollständig dagegen: Lord, Wallaces of Iowa, 404 f., u. Schlesinger, Coming, 77 ff. 167 Tugwell war einer der prononciertesten Befürworter intensiver Planung und sozialreformerischer Programme, auf den sich AFBF, konservative Presse und Kongreßausschüsse zunehmend eingeschossen hatten. Vgl. R. G. Tugwell, The Democratic Roosevelt, Baltimore 1969 (19571), 413 ff. 168 Die Landarbeiter machten regional verschieden in den dreißiger Jahren zwischen 35 und 55 % der landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung aus (in Kalifornien 53 % ) ; die Pächter verschiedener Größenordnungen durchweg 25 %; hinzu kommen ca. 5 % Wanderarbeiter. Der Durchschnittslohn betrug 1935/36 zwischen 125 und 347 Dollar im Jahr. Die erste größere Landarbeitergewerkschaft: United Farm Workers wurde erst Mitte der sechziger Jahre von Cesar Chavez gegründet und ist bis heute noch keineswegs überall als Tarifpartner anerkannt. Hist. Stat., 75, 77, 278; C. McWilliams, Ill Fares the Land, Boston 1942, 352—390, in: H. Zinn Hg., New Deal Thought, 251 bis 261, bes. 252 f. Vgl. auch John Steinbeck: Dubious Battle in California (1936) und The Grapes of Wrath (1939). US
1930 6Ö32 2664 710 4290
1940 5362 2361 517 3632
Süden 3224 Farmer, Manager und Pächter — dav. n. w. 882 — dav. Pächter 1791 — — dav. n. w. 699 — dav. croppers 776 — — dav. n. w. 393 (dav. n. w. = davon „non-white“) Hist. Stat. 75, 77, 278.
3007 680 1449 507 541 299
Anzahl in Tausend Farmer, Manager und Pächter — dav. Pächter: - - dav. n. w.: Landarbeiter:
169
239 f.
W. R. Amberson, Damn the Whole Tenant System, in: Zinn Hg., 239—243, bes.
170 Tugwell sah in dem Gesetz „einen der zwei bemerkenswerten Erfolge“ der Regierung im Jahre 1937. Für McConnell stellt es „die größte Neuerung in der Agrarpolitik seit dem Homestead Act“ und den „vielleicht einzigen entscheidenden Versuch in der Geschichte der USA“ dar, „das Problem der Armut auf dem Lande anzupacken“. Der Anteil der Neger am Programm der FSA entsprach erstmals fast ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung. Tugwell, Roosevelt, 435; McConnell, Decline, 112; Myrdal, American Dilemma, I, 274 f. 171 Vgl. R. S, Kirkendall, The Great Depression: Another Watershed in American History, in: Braeman u. a., 145—189, bes. 161. Resettlement Administration und FSA trugen zwischen 1935 und 1946 insgesamt etwa 2 Mrd. Dollar zur „Rehabilitierung“ von 0,9 Mio. Familien bei (J. G. Maddox, The Farm Security Administration, phil. Diss., Harvard University 1950, MS., 79 ff.). 172 Vgl. Maddox, 480 ff.; McConnell, 97 ff., 112 ff., 127 ff.; S. Baldwin, Poverty
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
150
Hans-Jürgen Puhle
and Politics: The Rise and Decline of the Farm Security Administration, N. Y. 1967, 325 ff., 365 ff.; Saloutos, CH 28. 1955, 356—361, bes. 360 f. Aus der Sicht der AFBF: Kile (1948), 264—273. 173 So verfügten die zehn wichtigsten autonomen Organisationen der US-Landwirtschaft im Haushaltsjahr 1962 selbständig über 5,6 Mrd. $ von insgesamt 6,7 Mrd. $ Ausgaben des USDA; hinzu kamen noch 5,8 Mrd. $ Kredite. Th. Lowi, How the Farmers Get What They Want, The Reporter 30 v. 21. 5. 1964, 35 f. 174 Zur kontroversen Interpretation vgl. vor allem F. Freidel, The New Deal in Historical Perspective, Washington 19652; die Beiträge in: E. C. Rozwenc Hg., The New Deal, Revolution or Evolution?, Lexington/Mass. 1959; A. A. Ekirch, Ideologies and Utopias. The Impact of the New Deal on American Thought, Chicago 1969; Β. J . Bernstein, The New Deal: The Conservative Achievement of Liberal Reform, in: ders. Hg., Towards a New Past. Dissenting Essays in American History, Ν. Υ. 1969, 263 bis 288, u. neuerdings R. Radosh, The Myth of the New Deal, in: Radosh-Rothbard Hg., Leviathan, 146—187, u. P. Lösche, Revolution und Kontinuität. Zur Auseinandersetzung um den New Deal in der amerikanischen Geschichtswissenschaft, in: Festschrift H. Herzfeld, Berlin 1972, 121—153, u. die dort angegebene Lit. 175 Die Brandeis'schen Ideen erlebten vor allem im sog. „zweiten“ New Deal nach 1935 vorübergehend eine Renaissance. Vgl. A. M. Schlesinger, The Age of Roosevelt (Vol. I l l : The Politics of Upheaval), Boston 1966 (19601), 385 ff.; Leuchtenburg, FDR, 143 ff. 176 Die Agricultural Marketing Acts von 1938, 1941, 1942 setzten die „Paritäten“ über 90% fest; zwischen 1941 und 1949 betrugen sie faktisch jeweils über 100%; partielle Erleichterungen für die Konsumenten wurden durch verstärkte staatliche Subventionen abgefangen (Brannan-Plan 1948). Der Agricultural Marketing Act von 1954 setzte die Paritäten erst zwischen 82,5 und 90 % und 1955 auf 75 bis 90 % fest. — Zur Funktion der New-Deal-Politik vgl.: Nourse et al. 449 ff.; P. Douglas, Controlling Depressions, Ν. Υ. 1935; A. C. Bunce, Economic Nationalism and the Farmer, Arnes, I owa 1938, 20 ff.; E. G. Nourse, Government in Relation to Agriculture, Brook ings I nst. 25, Washington 1940; die kritischen Beiträge von R. G. Tugwell in: WPQ 1. 1948, 373—385; 3. 1950, 390—427; 4. 1951, 295—312 u. 469—486; 5. 1952, 274—289 u. 483—503; Cowing, 264 ff.; McConnell, 66 ff.; R. S. Kirkendall, Social Scientists and Farm Politics in the Age of Roosevelt, Columbia, Mo. 1966, 255 ff. (betont die „business values“ der Agrarpolitik); ders., in: Braeman et al. Hg., 155 ff., bes. 156 f.; Bernstein, 267 ff.; P. K. Conkin, The New Deal, N. Y. 1967, 41 ff. Leuchtenburgs Vergleich der New Deal Politik mit dem Merkantilismus (FDR, 87) verkennt allerdings die Differenz der jeweiligen Motive der Staatsintervention. 177 Vgl. Campbell, 156 ff. und die Ergebnisse der Diss, von W. M. Smith, Reactions of Kansas Farmers to the New Deal Farm Program, Diss. Abstr. 21, Mai 1961, 3443 f. 178 Die konservative Koalition war weder einig noch hatte sie ein gemeinsames Programm. Dazu ausführlich: J . T. Patterson, Congressional Convervatism and the New Deal. The Growth of the Conservative Coalition in Congress, 1933—1939, Lexington, Ky. 1967, 188 ff., 339 ff. 170 Zum Mittelwesten vgl. R. Β. Nye, Midwestern Progressive Politics. A Historical Study of I ts Origins and Development 1870—1958, N. Y. 1965 (19591), 354—362. 180 Vgl. J. C. Carey, The Farmers' I ndependence Council of America, 1935—1938, AH 35. 1961, 70—77; G. Wolfskill, The Revolt of the Conservatives: A History of the American Liberty League, 1934—1940, Boston 1962. 181 D. R. McCoy, Voices, 77. 182 J . Chamberlain, Roosevelt — Reformer or Revolutionary, Common Sense ( = CS) I I , July 1933, 17 f.; For a Farmer-Labor Party (ed.), Aug. 1933, 2 f.; An Oppor tunity for Action: The United Conference for Progressive Political Action (ed.), Sept. 1933, 2 f.; J . Dewey, The I mperative Need for a New Radical Party, Sept. 1933, 6 f.; © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Populismus, Krise und New Deal
151
A. M. Bingham, Progress on the Farmer-Labor Front: The FLPF Forges Ahead, Dec. 1933, 26; S. Rodman, What Progress Among Progressives?, I ll, Jan. 1934, 12—14; E. Lundeen, A Farmer-Labor Party for the Nation, I V, June 1935, 6—8; vgl. auch: A. Bingham-S. Rodman Hg., Challenge to the New Deal, Ν. Υ. 1934, passim. 183 Roosevelt gewann mit über 27,7 Mio. Stimmen in allen Staaten außer Maine und Vermont; Landon (Rep.) erreichte über 16,6 Mio.; Lemke (Union Party) weniger als 0,9 Mio. 184 New Deal or New Party? (ed.), Common Sense (CS) VI. Sept. 1937, 3—5; H. G. Teigan, Why the Farmer-Labor Party is still Local, Nov. 1937, 13 f.; Th. R. Amlie, A Progressive Looks at the New Deal, VII, Nov. 1938, 8—11. 185 R. Tugwell, Roosevelt, 409 ff., bes. 410, 412. 186 Vgl. McCoy, Voices, 4ff., 30 ff., 39 ff.; A. M. Bingham, The FLPF. Its Formation at the Chicago Conference, CS II. Oct. 1933, 18—20. 187 Das Programm von 1934 sah u.a. vor: Staatliche Verkaufsagenturen für landwirtschaftliche Produkte, Vergesellschaftung der Minen, Wasserkraftwerke, des Transport- und Kommunikationswesens, der Banken, großen Verarbeitungs- und öffentlichen Dienstleistungsbetriebe (mit Ausnahme der bereits genossenschaftlich bewirtschafteten); staatliche Regelung der Arbeitsverhältnisse; öffentliche Sozialversicherung; Schaffung einer staatlichen Zentralbank; höhere Besteuerung großer Einkommen und Erbschaften, Abschaffung der Steuererleichterungen für Kapitalbesitzer, freie Lehrmittel in den Schulen (McCoy, Voices, 56 f.). Zwischen 1930 und 1935 gründete Olson in Minnesota 663 neue Genossenschaften (ebd., 97). Vgl. A. Ross, The Farmer-Labor Party of Minnesota, CS IV. March 1935, 14—17. 188 Vorsitzender wurde Th. A. Amlie (Progr. Wisc); Stellvertreter J . H. Bosch (FHA); Generalsekretär Bingham (CS); dem Vorstand gehörten ferner Lundeen (FLP) und F. Rosenblum (Amalgamated Cloth Workers of America) an (McCoy, Voices, 81 ff., bes. 82). 180 Amlie, zit. b. McCoy, 84; zum „production for use“-Programm: F. B. Olson, My Political Creed. Why a New Party must Challenge Capitalism, CS IV. Apr. 1935, 6 f. 190 Olson, Why a New National Party?, CS V. Jan. 1936, 6—8; ders., A National Third Party. The Farmer-Labor Challenge to Toryism, CS II. Nov. 1933, 10 f. 191 Der production for use-Plan wurde nicht mehr erwähnt. Vgl. McCoy, 111. 192 Auch Olson, die La Follettes, Norris und La Guardia unterstützten Roosevelt. Vgl. D. R. McCoy, The Progressive National Committee of 1936, WPQ 9. 1956, 454 bis 469. 193 Zur Abneigung des republikanischen Senators, sich organisierten progressiven Gruppen anzuschließen, vgl. R. Neuberger-S. B. Kahn, Integrity. The Life of G. W. Norris, Ν. Υ. 1937, 186, 379 ff. 194 Vgl. die Ergebnisse der Diss. von R. F. Carter, Pressure from the Left: The American Labor Party, 1936—1954, Diss. Abstr. 26, Dec. 1965, 3275. 195 I n einer Schätzung von CS V. Apr. 1936, 23. 196 Vgl. G. H. Mayer, The Political Career of Floyd B. Olson, Minneapolis 1951, 93 ff., 120 ff., 143 ff., 223 ff. 197 Bei den Präsidentschaftswahlen 1940 fielen u. a. Michigan, Indiana, Iowa, Kansas, Nebraska und die Dakotas sowie Colorado an die Republikaner. 198 Langer wurde 1934 aus dem Amt verdrängt, aber 1937 wiedergewählt. Vgl. H. V. Knight, Bungling in North Dakota, Langer vs. the NPL, CS III. Aug. 1934, 20 f. u. ders., North Dakota goes Langer, CS VI. March 1937, 16—19. 199 Vgl. E. C. Blackorby, Prairie Rebel. The Public Life of W. Lemke, Lincoln 1963, 42 ff., 80 ff., 172 ff., 182 ff., 216 ff. 200 Vgl. D. R. McCoy, The Formation of the Wisconsin Progressive Party in 1934, The Historian 14. 1951, 70—90, bes. 78 ff. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
152
Hans-Jürgen Puhle
Robert La Folette, jr. war Gouverneur; Philip La Follette US-Senator. McCoy, Voices, 49 ff.; Η. Μ. Groves, The Wisconsin Progressive Party, CS I V. May 1935, 19—22. Die Herausgeber von CS unterstützten Amlie gegen die „unklare“ Programmatik der La Follettes (ebd., 22). 203 Vgl. McCoy, The National Progressives of America, 1938, MVHR 44. 1957, 75—93; Progressives, What Now? (ed.), CS VII. June 1938, 3—5. 204 Der Artikel des engagierten Milo Reno-Mitarbeiters Dale Kramer: Where are the Third Parties?, CS IX. Oct. 1940, 22 f., liest sich fast wie ein Nachruf. 205 Vgl. die Ergebnisse der Diss. von K. L. Bryant, jr., „Alfalfa Bill“ Murray: Apostle of Agrarianism, Diss. Abstr. 26. March 1966, 5395. 208 McCoy, Voices, 66 f. 207 EPIC = End Poverty in California (oder: Civilization). Das Programm sah eine Tauschwirtschaft zwischen neuen agrarischen und industriellen Kolonien vor. Vgl. C. McWilliams, Upton Sinclair and His EPIC, New Republic v. 22. 8.1934. 208 Vgl. den Beitrag von Η. Α. Winkler in diesem Band. 209 Vgl. vor allem T. H. Williams, Huey Long, N. Y. 1969, u. R. G. Swing, Fore runners of American Fascism, Ν. Υ. 1935, 62-107. Zu den Nachwirkungen in Loui siana vor allem: A. P. Sindler, Huey Long's Louisiana, State Politics 1920—1952, Baltimore 1956, 56 ff., 87 ff., 117 ff., 238 ff. 210 Der Bewegung waren angeblich fast 7,7 Mio. Personen beigetreten. S. M. LipsetE. Raab, The Politics of Unreason. Right — Wing Extremism in America 1790—1970, N. Y. 1970, 189 ff., bes. 191. 211 Vgl. vor allem Ch. J . Tull, Father Coughlin in the New Deal, Syracuse, Ν. Υ. 1965; D. Η. Bennett, Demagogues in the Depression. American Radicals and the Union Party, 1932—1936, New Brunswick 1969, 27—84; J . Shenton, Fascism and Father Coughlin, Wisc. Mag. of Hist. 44. 1960, 6—11. 212 Vgl. A. Holtzman, The Townsend Movement: A Study in Old Age Pressure Politics, phil. Diss. Harvard University 1952, bes. 40 ff., 263 ff., 327 ff., 455 ff. u. D. H. Bennett, The Year of Old Folks Revolt, American Heritage 16. 1964, 48—51, 99—107. 213 Vgl. Bennett, Demagogues, 185 ff., 251 ff., 268 ff.; D. O. Powell, The Union Party of 1936: Campaign, Tactics, And I ssues, Mid-America 46. 1946, 126 ff.; Ergeb nisse auch in Diss. Abstr. 23. March 1963, 3337 bis 3338. Nicht ganz zutreffend die Analyse von S. Lubell, The Future of American Politics, N. Y. 1956 (19511), 150—155. 214 Vgl. Leuchtenburg, FDR, 254 ff.; J . M. Burns, Roosevelt: The Lion and the Fox, N. Y. 1956, 316 ff. 215 Leuchtenburg, FDR, 231 ff.; Schlesinger, Upheaval, 447 ff.; Burns, 291 ff. 216 Vgl. Campbell, 156 ff. 217 Vgl. oben Anm. 197. Der Anteil der Demokraten an den Sitzen im Repräsentantenhaus fiel von 1936: 331 (1932: 310; 1934: 319) auf 1938: 261 (1940: 268). Hist. Stat., 691. Genauere Aufschlüsselungen für die Präsidentschaftswahlen bei Ε. Ε. Robin son, They Voted for Roosevelt, Stanford 1947, 58 ff. 218 Vgl. die Analyse von N. A. Graebner, Depression and Urban Votes, CH 23. 1952, 234—238, bes. 237 f. 219 Nach meinem Eindruck; ein exakter Nachweis steht noch aus. 220 Vgl. McConnell, Decline, 173 ff.; ders., Private Power and American Democ racy, Ν. Υ. 1970 (19661), 119 ff., 196 ff., 246 ff.; Ρ. Η. Appleby, Big Democracy, Ν. Υ. 1970 (19451), 39 ff., 78 ff., 135 ff.; Th. Lowi, The End of Liberalism, Ν. Υ. 1969, 93 ff., 102 ff.; Ch. Α. Reich, The Greening of America, N. Y. 1971, 91 ff.; D. Eakins, Policy Planning for the Establishment, in: Radosh-Rothbard Hg., Leviathan, 188 bis 205. 201
202
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal Eine Fallstudie über die Grenzen der Sozialpolitik Von HELLMUT WOLLMANN
Die insbesondere von den jüngeren amerikanisdien Historikern der „Neuen Linken' ausgelöste Kontroverse um Analyse und Einsdiätzung des New Deal1 wird wesentlich unter der Fragestellung ausgetragen, ob zwischen der unter dem Präsidenten Franklin D. Roosevelt seit 1933 zur Bekämpfung der Großen Depression eingeleiteten Politik und den vorangegangenen Perioden amerikanischer Innenpolitik, vor allem der „Progressive Era“, eine ,Kontinuität' anzunehmen oder ob der New Deal als eine Zäsur, wenn nicht als ,Revolution' aufzufassen sei, wobei es nicht nur um die Instrumente des „policy-making“ der Bundesregierung, sondern auch und vor allem um die Ziele und Inhalte dieser Politik geht. Weit entfernt, eine in Methode und Theorie einheitliche ,Schule' zu sein, gehen die Historiker der ,Neuen Linken' mehr oder weniger explizit von einem politökonomischen Analyse- und Erklärungsmodell aus, das beispielsweise Gabriel Kolko den „political capitalism“ nennt2 und das er wesentlich dadurch gekennzeichnet sieht, daß dem Staatsapparat die Funktion zukomme „to attain order in the economic sphere and security in the political arena“3. Zieht man die deskriptiveren Aussagen von Kolko heran, so ist dies — zugespitzt und für den Sprachgebrauch der entsprechenden Diskussion in der Bundesrepublik verständlicher formuliert — dahin zu begreifen, daß dem Staatsapparat im „political capitalism“ die Funktion zukomme, die Bedingungen privater Kapitalverwertung zu erhalten und die für die Systemstabilität erforderliche Massenloyalität zu sichern4. Im folgenden soll der Versuch unternommen werden, einen Teilbereich des Crisis-Management des New Deal, nämlich seine Intervention auf dem Bauund Wohnungssektor, mit der Absicht zu untersuchen, das Modell des „political capitalism“ heuristisch anzuwenden und empirisch zu überprüfen, wobei ein Weg der empirischen Überprüfung darin gesehen wird, bei der Analyse eines bestimmten Politikbereichs jeweils zu fragen, zum Vorteil welcher Gruppen die Politikergebnisse („policy outcomes“) ,ausfallen'. Während eine funktionalistische ex-ante-Analyse von policy-making gegen empirische Überprüfung weitgehend immunisiert erscheint (die hypothetisch unterstellte Funktion läßt sich im realen Wirkungszusammenhang meist doch ,irgendwo' aufweisen!) und man bei einer solchen ex-ante-Analyse zudem entweder auf die in mehrfacher Hin-
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
154
Hellmut Wollmann
sicht problematische Selbstinterpretation des Handelnden oder auf eine empirisch kaum greifbare ,Latenz' der Funktion angewiesen ist, erscheint es ergiebiger, gewissermaßen ex-post auf die Politikergebnisse („policy outcomes“) abzustellen und aufgrund der realen „Wirkungen“ auf die Funktionsimperative rückzuschließen5. I. Hatten die Städte und Ortschaften der Kolonialzeit bereits feuer- und gesundheitspolizeiliche Vorschriften für den Häuserbau erlassen, so fand der Haus- und Wohnungsbau im letzten Jahrhundert in den im Zuge der Industrialisierung und der Masseneinwanderung (im Jahr 1882 rund 800 000 Einwanderer!6) rapide expandierenden Städten weitgehend bar jeglicher baupolizeilicher Reglementierung und Aufsicht statt, Ausdruck der gerade in diesem Sektor praktizierten laissez-faire-Doktrin7. Dieses weitgehende Fehlen einer staatlichen oder lokalen Bauaufsicht trug erheblich dazu bei, daß sich vor allem in den Städten des einer stürmischen Industrialisierung unterliegenden und die Einwandererwellen zunächst aufstauenden Ostens ganze Stadtteile in Ansammlungen überfüllter Elendsquartiere verwandelten. Besonders kraß vollzog sich diese Entwicklung in New York City, wo die Einwohnerzahl von 250 000 im Jahr 1833 auf 3,5 Millionen im Jahr 1900 sprang, von denen zwei Drittel in 80 000 Mietshäusern, zum Teil in schlimmsten Elendsvierteln, hausten8. Erst auf Betreiben sozial-reformerischer privater Vereinigungen, unter dem Eindruck verschiedener Veröffentlichungen über die horrenden Zustände in den Slum-Vierteln, vor allem aber wohl als Maßnahme gegen die New York City periodisch heimsuchenden Cholera-Epidemien erließ der Staat New York 1867 einen Tenement House Act, der für Mehrfamilienhäuser (tenement houses9) eine Reihe von — vornehmlich gesundheits- und feuerpolizeilicher — Bauvorschriften enthielt10. Als eine Novellierung dieses Gesetzes im Jahr 1887 unter anderem anordnete, daß jedes Stockwerk eines „tenement house“ einen Wasseranschluß aufzuweisen habe, kam es zu einem bemerkenswerten Rechtsstreit11, in dem sich eine Kirche, Eigentümerin zahlreicher Slum-Wohnungen und als ausbeuterische Vermieterin berüchtigt12, gegen diese Vorschrift zur Wehr setzte und das Gericht in erster Instanz deren Verfassungsmäßigkeit denn auch verneinte, indem es — Ausdruck schierer laissez-faire-Doktrin — Installationen wie einen Wasseranschluß von einer Selbstregulierung durch Angebot und Nachfrage („If tenants require it, self-interest and the rivalry of competition are sufficient to secure it“13) abhängig machte, so als ob die in die Slums gepferchten Einwanderermassen eine Wahl gehabt hätten. Allerdings wurde dieses Urteil vom Gericht zweiter Instanz kassiert, das die betreffende Vorschrift als von der „police power“ des Staates gedeckt ansah14, womit die Bauaufsicht als ,negative' Aufgabe des Staates in der Rechtsprechung endgültig anerkannt war. Einem ,positivenf Eingreifen der staatlichen oder lokalen Stellen zur Behebung der Wohnungsnot sprachen die Gerichte freilich bis zum © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
155
Ersten Weltkrieg die Berechtigung ab. Als 1872 eine Feuersbrunst große Teile von Boston in Asche gelegt hatte, ermächtigte der Staat Massachusetts die Stadt Boston, kommunale Schuldverschreibungen aufzulegen, um aus diesen Mitteln den Feuergeschädigten öffentliche Kredite zum Wiederaufbau ihrer Häuser zu gewähren. In einer Entscheidung des Supreme Court von Massachusetts wurde diese gesetzliche Ermächtigung für verfassungswidrig erklärt, weil die Ausgabe kommunaler Schuldverschreibungen als eine Form der Steuererhebung nur im Interesse von „public welfare“ erfolgen könne und die Förderung privaten Wohnungsbaus nicht hierunter falle15. Waren somit, sieht man von dem Erlaß baupolizeilicher Vorschriften durch Einzelstaaten ab, aktive Schritte zur Beseitigung der Elendsquartiere in den Slums von lokalen oder staatlichen Stellen, geschweige denn vom Kongreß oder der Bundesregierung, bis zum Ersten Weltkrieg nicht zu erwarten, traten etwa seit der Jahrhundertmitte in einer Reihe von Städten, zunächst und vor allem in New York City, Gruppen auf, deren Mitglieder, überwiegend der bürgerlichen Mittelklasse angehörend, von sozialreformerischer Absicht geleitet und dem „Progressivism“ zuzurechnen, auf eine Linderung, wenn nicht Beseitigung des Wohnungselends in den Slums hinarbeiteten. Auf die Gefahr, die innerhalb des „Progressivism“ zutage tretende konzeptionelle Unterschiedlichkeit unerträglich zu verkürzen16, lassen sich bei den „housing reformers“ eine Reihe gemeinsamer Positionen aufzeigen, die in der weiteren Entwicklung der Wohnungsbaupolitik wirksam blieben und deshalb im Rahmen dieser Studie von Interesse sind. Nachhaltige Wirkung kommt hierbei vor allem dem Bestreben der „Progressives“ zu, den vorherrschenden Einfluß des „Social Darwinism“ zurückzudrängen und durch ein ihren sozialreformerischen Absichten Plausibilität verleihendes Konzept zu ersetzen. Diese Frontstellung tritt besonders anschaulich in der Einschätzung des sozialen Elends in den Slum-Quartieren und seiner Ursachen zutage. Nach dem „Social Darwinism“17, der von dem britischen Sozialtheoretiker Herbert Spencer in Anlehnung an die Darwinsche Evolutionstheorie ausgedacht und verbreitet wurde, beruht die gesellschaftliche Entwicklung auf einem — vor allem ökonomischen — Konkurrenzkampf, in dem der Auswahlmechanismus des Überlebens des Tüchtigsten („survival of the fittest“) die Spreu vom Weizen sondert, so daß soziales Elend lediglich als Teil eines dem gesellschaftlichen Fortschritt insgesamt förderlichen Auslesemechanismus, des „purifying process“ (Herbert Spencer)18, zu sehen ist. Wohl Indiz seiner ideologischen Funktion, die blutige Landnahme durch die weißen Einwanderer gegen die indianische Urbevölkerung und dann vor allem die von einer Generation rücksichtsloser Unternehmer, den „robber barons“, vorangetriebene Industrialisierung des Landes zu legitimieren, wurde der „Social Darwinism“ bis hin zur Jahrhundertwende weithin akzeptiert (Spencer wurde 1882 während eines USA-Besuchs triumphal empfangen). Die „Progressives“ griffen den Sozialdarwinismus wesentlich in dem Punkt an, daß sie die Fähigkeit oder Unfähigkeit des einzelnen zum „survival of the fittest“ nicht als gewisser© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
156
Hellmut Wollmann
maßen von Natur vorgegeben und vorentschieden, sondern als durch bestimmte Umweltfaktoren bedingt ansahen, weswegen ihre Reformkonzepte an der Veränderung der jeweils als ,kritisch' angesehenen Umweltvariable ansetzten. Da die „Progressives“ — mit den Sozialdarwinisten insofern einer Meinung — das kapitalistische Konkurrenzsystem als vorgegeben akzeptierten, liefen ihre Pläne darauf hinaus, durch entsprechende Teilreformen die Gleichheit der Startbedingungen für den Eintritt in den kapitalistischen Konkurrenzkampf anzustreben18. Dieser „environmental determinism“ der „Progressives“ findet sehr anschaulich bei denjenigen „housing reformers“ Ausdruck, die das soziale Elend in den Slums weitgehend monokausal auf die physische Wohnumwelt20 (so besonders pointiert Lawrence Veiller, der wohl einflußreichste Wonführer einer in den Slums ansetzenden „housing reform“21) oder auf das Bildungsdefizit der SlumBewohner (so vor allem die in „settlement houses“ tätigen Sozialarbeiter)22 zurückführten. Diesen sozialreformerischen Gruppen der „Progressive Era“ war insgesamt eigentümlich, daß sie zwar einzelne gesellschaftliche Problemfelder (etwa das soziale Elend in den Slum-Quartieren) als „Mißstände“ empfanden, diese mit bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen (hier etwa: die Wohnqualität in den Slums) erklärten und ihr Reformkonzept entsprechend ausschnitthaft (hier: Verbesserung der Wohnqualität für die Slumbewohner) ansetzten, es jedoch unterließen, den von ihnen angenommenen Zusammenhang (im genannten Beispiel: zwischen Wohnqualität und sozialem Elend) und die darauf abgestellte Reformstrategie im Zusammenhang mit einer umfassenderen gesellschaftlichen Analyse und Kritik zu problematisieren, die sich nicht dagegen verschlossen hätte, das bestehende Wirtschaftssystem zumindest in Zweifel zu ziehen. Die Ambivalenz des Reformkonzepts derartiger „particularist reform groups“23, die in Teilbereichen auf Veränderung und im Gesamtsystem auf Erhaltung gerichtet sind, traf denn auch nicht nur für die „housing reformers“ der „Progressive Era“, sondern auch, wie noch zu zeigen ist, auf die Verfechter des öffentlichen Wohnungsbaus in den dreißiger Jahren zu. Der weitgehend konservative Grundzug der überwiegend der bürgerlichen Mittelklasse angehörenden „housing reformers“ um die Jahrhundertwende ist besonders deutlich daran festzumachen, daß sie mit ihrer Hochschätzung des Eigenheims fest in der dominanten Vorstellungswelt wurzelten. Welche stabilisierende Wirkung sie dem Eigenheim als Mittel der Beseitigung der Slums und ihrer sozialen und politischen Probleme beimaßen, erhellt aus einer Äußerung von Lawrence Veiller, die wegen ihrer Anschaulichkeit ausführlich zitiert sei: „It should be recognized at the outset that the normal method of housing the working population in our American cities is in small houses, each house occupied by a separate family, often with a small bit of land, with privacy for all, and with a secure sense of individuality and opportunity for real domestic life. Under no other methods can we expect American institutions to be maintained. It is useless to expect a conservative point of view in the workingman, © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
157
if his home is but three or four rooms in some huge building in which dwell from twenty to thirty other families, and this home is his only from month to month. Where a man has a home of his own he has every incentive to be economical and thrifty, to take his part in the duties of citizenship, to be a real sharer in governement. Democracy was not predicated upon a country made up of tenement dwellers, nor can it so survive.“24 Für die Einschätzung der Wirksamkeit dieser Eigenheim-Ideologie, die dann auch in den dreißiger Jahren von den Gegnern des öffentlichen Wohnungsbaus mit Erfolg mobilisiert wurde, ist im Auge zu behalten, daß sie nicht nur romantisierend auf das Jeffersonsche Wunschbild einer agrarischen ,heilen Welt' unabhängiger Kleinfarmer auf eigener Scholle zurückzugreifen brauchte, sondern angesichts der verhältnismäßig großen Verbreitung des Eigenheims im letzten Jahrhundert, freilich außerhalb der Slums der Großstädte, eine reale Unterlage hatte. Zwar blieben die Aneignung von Siedlungsland an der „frontier“25 und die Inanspruchnahme des Homestead Act von 1862 — nicht zuletzt wegen des erheblichen Eigenkapitals, das ein Siedlungswilliger selbst bei unentgeltlichem Erwerb des Anwesens für den Transport seiner Familie in den Westen und die notwendigen Investitionen aufbringen mußte — für die Besitzlosen des Ostens weitgehend unverwirklichbar28 und damit ideologische Verheißung. Gleichwohl war der Anteil der Eigenheime an bäuerlichen und nichtbäuerlichen Anwesen beträchtlich und wuchs ständig. Obschon wegen des Fehlens einer schichtenspezifischen Aufschlüsselung nur beschränkt aussagekräftig, mag als Indiz dienen, daß um die Jahrhundertwende 65 % aller Farmhaushalte eigene Höfe hatten und 37 % aller nichtbäuerlichen Haushalte in Eigenheimen wohnten27. Selbst unter den Industriearbeitern, zumindest in kleineren Städten, scheint bereits im letzten Jahrhundert ein nicht unerheblicher Teil der Haushalte in Eigenheimen gewohnt zu haben28. Unter den mit den Elendsquartieren der Slums befaßten Reformergruppen können drei (sich in Wirklichkeit teilweise überlappende) Strömungen unterschieden werden, deren jede spezifische Beiträge für die Entwicklung der Wohnbaupolitik bis in die dreißiger Jahre geliefert hat. — Ab Mitte des letzten Jahrhunderts, zunächst in New York City, traten überwiegend der bürgerlichen Mittelklasse angehörende Gruppen auf, die das Wohnungselend in den Slums anprangerten und auf den Erlaß baupolizeilicher Vorschriften drängten, von deren Anwendung sie eine nachhaltige Verbesserung der Wohnverhältnisse in den Slums erwarteten29. Eine Gruppe um Lawrence Veiller hatte maßgeblichen Anteil daran, daß der Staat New York im Jahr 1867 den (bereits erwähnten) Tenement House Act erließ, der entsprechende Vorschriften für Mehrfamilienhäuser enthielt. Dem im weiteren Gang des Jahrhunderts immer greller werdenden Wohnungselend in den Slums widmeten die „muckrakers“ einige ihrer anklagenden und vielgelesenen Reportagen, unter denen das 1890 erschienene Buch von Jacob A. Riis „How the Other Half Lives“ mit Berichten über die Slums von New York City am bekanntesten wurde30. Wiederum auf das Drängen und nach regelrechter ,Öffentlichkeitsarbeit' der Charity Organization © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
158
Hellmut Wollmann
Society, darunter vor allem Lawrence Veiller, kam im Staat New York 1901 ein Tenement House Law zustande, das die bis dahin detaillierteste und durchdachteste Bauregelung für Mehrfamilienhäuser darstellte31. Für den Standort dieses im Rahmen seiner begrenzten Ziele bemerkenswert erfolgreichen Flügels der Wohnungsreformer blieb über die Jahrhundertwende hinaus bezeichnend, daß sie sich auf die Verbesserung der Bauvorschriften und der Bauaufsicht, also auf ein , n e g a t i ν e s ' Eingreifen staatlicher oder lokaler Stellen beschränkten und einen . p o s i t i v e n ' Beitrag staatlicher oder lokaler Stellen zur Behebung des Wohnungselends, etwa durch die staatliche Förderung des Baues neuer Wohnungen, ablehnten, wobei beispielsweise Lawrence Veiller den Bau kommuneeigener Wohnungen, also den öffentlichen Wohnungsbau, als ,sozialistisch' verwarf32. Die Ablehnung ,positiver' staatlicher Intervention teilend, arbeitete ein anderer Flügel der „housing reformers“ darauf hin, den Bestand ordentlicher Wohnungen für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen durch private Initiative zu vermehren, wobei er das Konzept entwickelte, private Bauträger für eine Beschränkung ihrer jährlichen Dividendenausschüttung („philantropy plus 5 percent“) zu gewinnen („limited-dividend corporations“) und durch die Beschränkung der Profitrate privater Bautätigkeit eine Senkung der Mieten zu erreichen. Zwar fand dieses Konzept um die Jahrhundertwende nur ein geringes Echo, so daß von einer fühlbaren Rückwirkung auf die Wohnverhältnisse in den Slums nicht gesprochen werden kann, zumal die von den „limiteddividend corporations“ erhobenen Mieten für die unteren und untersten Einkommensschichten nach wie vor unerschwinglich blieben. Jedoch spielte das Konzept der „limited-dividend corporations“ in der weiteren Entwicklung des Wohnungsbaus noch eine erhebliche Rolle. Schließlich ist die Gruppe der „settlement workers“ zu nennen — Sozialarbeiter, die zwischen 1880 und 1890 in verschiedenen Städten dazu übergingen, in den Slums in sog. „settlement houses“ mit den Familien zusammenzuleben und vor allem Bildungsarbeit zu leisten. Von der in den Slums ebenfalls vereinzelt geübten karitativen Fürsorge privater Wohlfahrtsvereine sahen sich die „settlement workers“ dadurch abgegrenzt, daß es sich für sie nicht in erster Linie darum handelte, individuelle Not zu lindern, sondern darum, die Slumbewohner in den Stand zu setzen, ,sich selbst zu helfen' und aus dem Slum ,auszusteigen'. Ihre Zielgruppen waren deshalb die bei Hungerlöhnen und periodischer Arbeitslosigkeit verarmten, aber immerhin, zumindest zeitweise, erwerbstätigen Teile der Slumbevölkerung, die ,potentiellen Aufsteiger' gewissermaßen, während die infolge dauerhafter Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit vollends verarmten, ständig auf Fürsorge angewiesenen Bevölkerungsteile praktisch außer Betracht blieben, worin eine Scheidelinie sichtbar wurde, die, später mit den Vokabeln „deserving poor“ und „undeserving poor“ bezeichnet, in der weiteren Entwicklung der Sozial-, aber auch Wohnbaupolitik wirksam blieb. Erhebliche Bedeutung für die Ausformung der Wohnbaupolitik der dreißiger Jahre, vor allem des öffentlichen Wohnungsbaus, erlangte © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
159
die Bewegung der „settlement workers“ dadurch, daß Mary Simkhovitch und Helen Alfred, zwei hervorragende Sozialarbeiterinnen und durch ihre Tätigkeit in „settlement houses“ mit den Wohnproblemen der Slums aufs engste vertraut, 1932 an der Gründung einer den öffentlichen Wohnungsbau propagierenden Vereinigung, der National Public Housing Conference, maßgeblich beteiligt waren und deren Programm und Tätigkeit stark beeinflußten33. II. Während sich die Einzelstaaten nach der Jahrhundertwende zunehmend bereit zeigten, über den Erlaß baupolizeilicher Vorschriften und deren Durchsetzung auf eine Verbesserung der Wohnverhältnisse in den Slums hinzuwirken, ließen Ansätze einer gegenüber diesem Problemfeld sensiblen Bundespolitik bis zum Ersten Weltkrieg auf sich warten. Zwar bewilligte der U. S. Congress im Jahr 1892 einen Betrag von 20 000 Dollar für die Untersuchung der SlumBedingungen in den Großstädten mit über 200 000 Einwohnern und setzte Präsident Theodore Roosevelt im Jahr 1908 eine Kommission zur Untersuchung der Slumverhältnisse im District Columbia ein. Jedoch blieben die erstatteten Berichte und die auf eine aktivere Wohnbaupolitik des Bundes gerichteten Empfehlungen dieser Kommission zunächst folgenlos. Der Erste Weltkrieg brachte insofern eine Zäsur, als die Bundesregierung angesichts dessen, daß in der Nähe wichtiger Rüstungsbetriebe nicht genügend Arbeiterwohnungen vorhanden waren, ein Notstandsprogramm anwarf, das den Bau von Arbeiterwohnungen förderte — und zwar teils mittelbar, indem der Bund über eine Sonderbehörde, die United States Shipping Board Emergency Fleet Corporation, öffentliche Kredite an vom betreffenden Schiffsbauunternehmen zu gründende „limited-dividend corporations“ vergab, teils unmittelbar, indem er über eine andere Sonderbehörde, die United States Housing Corporation, selber als Bauherr auftrat und bundeseigene Wohnungen baute34. Vor allem der letztere Weg des Baues bundeseigener, also öffentlicher Wohnungen stellte eine „dramatic departure from American practice“35 dar, zumal sich der Bund innerhalb dieses Notstandsprogramms als Bauträger und Eigentümer ganzer neuer Siedlungen betätigte36. Nach dem Krieg setzte eine lebhafte Diskussion darüber ein, was aus dem Programm öffentlichen Wohnungsbaus durch den Bund und aus den während des Kriegs gebauten bundeseigenen Wohnungen (rund 30 000 Wohneinheiten) werden sollte. Während sich vor allem die American Federation of Labor (AFL), die bereits 1914 eine aktive staatliche Wohnbaupolitik und insbesondere „the passage of laws that will bring about a system of Government loans of money for municipal and private ownership of sanitary houses“37 gefordert hatte, für die Fortsetzung einer aktiven Wohnbaupolitik des Bundes zugunsten von Arbeiterwohnungen und für die Beibehaltung des öffentlichen Eigentums an den während des Krieges gebauten bundeseigenen Wohnungen einsetzte, wurde von anderen Interessengruppen, vor allem der einflußreichen Vereinigung der Grundstücks© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
160
Hellmut Wollmann
makler, der National Association of Real Estate Boards (NAREB), die sofortige Beendigung des Bauprogramms und die Reprivatisierung dieser Öffentlichen Wohnungen verlangt. Im Januar 1920 beschloß der Kongreß, die während des Kriegs gebauten bundeseigenen Wohnungen zu reprivatisieren, worauf sie unter den Hammer kamen und das Programm öffentlichen Wohnungsbaus durch den Bund vorerst Episode blieb. Obgleich unmittelbar nach Kriegsende ein ungewöhnlicher Wohnungsmangel — weit über die Slums hinaus — sichtbar wurde (der Fehlbedarf wurde auf rund 5 Millionen Wohneinheiten geschätzt38), blieb die Bundesregierung bei dieser wohnungsbaupolitischen Abstinenz. Ein vom U. S. Senat 1920 eingesetzter Ausschuß („to inquire into the general building situations and to report to the Senate . . . such measures as may be deemed necessary to stimulate and foster the development of construction work of all its forms“) vertrat die Auffassung, der Wohnungsmangel könne durch private Bautätigkeit behoben werden, und lehnte eine aktive Wohnungsbaupolitik des Bundes ab. Angesichts der durch den Wohnraummangel geschürten Mietpreissteigerungen der unmittelbaren Nachkriegsjahre sahen sich um 1920 eine Reihe von Einzelstaaten veranlaßt, Mietstoppgesetze (rent control) zu erlassen, deren Verfassungsmäßigkeit von einflußreichen Interessengruppen, vor allem der Bundesvereinigung der Grundstücksmakler (NAREB), bestritten, jedoch von den Gerichten, als auf einer selbständigen welfare-Funktion des Staates basierend, bestätigt wurden. Die über die Wohnungssituation entbrannte öffentliche Diskussion verebbte indessen39, und auch etliche einflußreiche Verfechter einer aktiven, öffentlichen Wohnungsbau einbegreifenden staatlichen Wohnungsbaupolitik, vor allem die AFL40, verstummten zunächst wieder, als zu Beginn der zwanziger Jahre ein beispielloser Bauboom einsetzte, der 1925 mit 930 000 in diesem Jahr begonnenen Neubau-Wohneinheiten (gegenüber 247 000 im Jahr 1920!) einen Höhepunkt erreichte41. Auf die Wohnverhältnisse in den Slums und der dort wohnenden unteren und untersten Einkommensgruppen wirkte sich dieser in erster Linie von Großinvestoren und der Mittelklasse getragene Bauboom der zwanziger Jahre kaum aus. Lediglich der Staat New York unternahm den Versuch, den Bau von Niedrig-Miete-Wohnungen staatlich zu fördern. Zu Beginn der zwanziger Jahre ging er zunächst dazu über, den Bau neuer Wohnungen insgesamt durch die Gewährung einer befristeten Befreiung von der Grundsteuer (property tax) anzuregen. Freilich erwies sich dieser Ansatz einer aktiven Wohnbaupolitik insofern als Fehlschlag, als die Steuerbefreiung von Bauspekulanten kassiert wurde, die die Mieten nicht nur für mittlere und untere Einkommensgruppen unerschwinglich hoch ansetzten, sondern mit den in aller Eile und schlampig hergestellten Wohnkomplexen die Entwicklung neuer Slums geradezu programmierten42. Ein neuer Impuls ging von dem fortschrittlichen Gouverneur von New York, Alfred E. Smith, aus, der die Annahme, daß der private Bau- und Wohnungsmarkt aufgrund der ihn bestimmenden Profiterwartungen der Investoren außerstande sei, Niedrig-Miete-Wohnungen in guter Qualität her© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
161
vorzubringen43, erstmals zum Ausgangspunkt einer nicht nur als Notstandsprogramm konzipierten staatlichen Wohnbaupolitik machte. 1926 setzte er ein Gesetz durch44, das zur Förderung des Baues von Niedrig-Miete-Wohnungen die Bautätigkeit über „limited-dividend corporations“ — vermittels derer, wie erwähnt, Gruppen von „housing reformers“ seit der Jahrhundertwende neue Wohnungen zu niedrigen Mieten in die Slums zu bringen gesucht hatten — für private Investoren dadurch attraktiver machen sollte, daß diejenigen Bauträger, die sich auf eine Jahresdividende von 6 % beschränkten, für 10 Jahre von der staatlichen und lokalen Vermögenssteuer (property tax) befreit werden konnten. In der Sache war das eine staatliche Subvention privater Bautätigkeit45. Das Ziel niedriger Mieten für einkommensschwache Gruppen sollte dadurch gesichert werden, daß die für die Gewährung der Steuerbefreiung zuständige staatliche Stelle, das State Board of Housing, ein Mitspracherecht bei der Festsetzung der Mieten und der Festlegung der Mietergruppen erhielt. Mit seinem weitergehenden Vorschlag, die Bautätigkeit von „limited-dividend corporations“ über die Steuerbefreiung hinaus mit öffentlichen Krediten zu fördern, drang Gouverneur Smith nicht durch. Die Verabschiedung dieses Gesetzes war von einer lebhaften Kontroverse in der publizistischen Öffentlichkeit begleitet und wurde von konservativen Sprechern heftig befehdet („amazing threat in the direction of State paternalism and socialism“, „thinly disguised State landlordism“, „Un-American plan fraught with grave dangers“46). Ließ sich die Förderung des Baues von Niedrig-Miete-Wohnungen, wenn auch abermals eher für die mittlere als die unterste Gruppe der niedrigen Einkommen, verhältnismäßig erfolgreich an, insbesondere in einer von einer Gewerkschaft, den Amalgamated Clothing Workers, getragenen Baugenossenschaft (cooperative)47, so wurde diese Entwicklung durch die hereinbrechende Depression gestoppt. Obgleich es natürlich nicht Aufgabe dieser Studie sein kann, auf die Ursachen der Wirtschaftskrise näher einzugehen, so legt es die Beschäftigung mit dem Wohnungsbausektor doch nahe, vor allem zwei Faktoren aufzuhellen, die zunächst die Dynamik der Krise beeinflußten und dann Ansatzpunkte staatlicher Gegensteuerung wurden, nämlich der überdurchschnittliche Rückgang der Bautätigkeit und der weitgehende Zusammenbruch des Hypothekenkreditmarktes. — Wie weiter vorn erwähnt, erlebten die USA Mitte der zwanziger Jahre einen Bauboom sondergleichen, der 1925 mit 930 000 begonnenen Neubau-Wohneinheiten seinen Höhepunkt erreichte. Wie drastisch in der Depression gerade das Bauvolumen absackte, läßt sich etwa daran ablesen, daß die Zahl der begonnenen Neubau-Wohneinheiten im Jahr 1933 auf 93 000, d. h. auf rund 10 % des Niveaus von 1925 zurückfiel und das Volkseinkommen im Bereich der Bauwirtschaft von 1929 bis 1933 auf rund 20 % zurückging, während es gesamtdurchschnittlich auf rund 50 % zusammenschrumpfte. Berücksichtigt man außerdem, daß die Bauwirtschaft infolge ihres traditionell geringen Rationalisierungsgrades überdurchschnittlich personalintensiv war, läßt sich abschätzen, daß die Arbeitslosenrate unter den Bauarbeitern die gesamtdurch11 Winkler, Krise
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
162
Hellmut Wollmann
schnittliche Rate von knapp 25 % im Jahr 193348 weit überstiegen haben muß. Als ein zunehmend neuralgischer Faktor im Bausektor erwies sich ferner das Hypothekenkreditsystem. Der Bauboom der zwanziger Jahre ging mit einem rapiden Anstieg der hypothekarischen Verschuldung der Hauseigentümer einher. Die hypothekarische Belastung von nichtbäuerlichen Wohngrundstücken stieg von 9,3 Milliarden Dollar im Jahr 1920 auf 18,3 Milliarden 1925 und auf 29,4 Milliarden 1929. Berücksichtigt man, daß der Hypothekenkreditmarkt der zwanziger Jahre offensichtlich geradezu ein Tummelplatz für spekulierende Kreditgeber mit zum Teil halsabschneiderischen Kreditbedingungen (hohe Kreditzinsen, überaus kurze Laufzeiten, kostspielige Umschuldung und dergleichen) war49, erscheint es erklärlich, wie lawinenartig die erste Welle massenhafter Zwangsverkäufe (foreclosures) von Grundstücken, deren hypothekarisch verschuldete Eigentümer, in der ersten Phase der Depression arbeitslos geworden, ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen konnten, weitere Wellen der Unsicherheit und Panik auslöste und schließlich, da die Erlöse aus den Zwangsverkäufen der vielfach überschuldeten Grundstücke immer schmaler ausfielen, auch zahlreiche Insolvenzen von Hypothekenkreditinstituten und Banken nach sich zog. Mit welcher Wucht diese Entwicklung die hypothekarisch verschuldeten Hauseigentümer getroffen hat, läßt sich daran ermessen, daß die Zahl der Zwangsverkäufe von 68 000 im Jahr 1926 auf 252 000 im Jahr 1933 sprang und der Anteil der Eigenheime an der Gesamtzahl nichtbäuerlicher Wohneinheiten zwischen 1930 und 1940 von 46 % auf 41 % zurückfiel. Als sich die Anzeichen einer Wirtschaftskrise mehrten, die nicht nur über die ,normale' Arbeitslosigkeitsrate der zwanziger Jahre (immerhin durchschnittlich etwa 4 %!) hinausging, sondern eine zunehmende Zahl von Hauseigentümern der Mittelklasse (die Zahl der Zwangsverkäufe von Grundstücken: 1929: 134 000, 1930: 150 000, 1931: 193 00050), trat 1931 in Washington, privat finanziert, jedoch unter der Schirmherrschaft des Präsidenten Herbert Hoover, eine Konferenz über Fragen des Wohnungsbaus zusammen („Conference on Home Building and Home Ownership“), an deren über Monate sich hinziehenden Beratungen fast 3700 Fachleute beteiligt waren und die schließlich mit einem elfbändigen Bericht herauskam51. Eine unmittelbare Wirkung hatte diese Konferenz zunächst darin, daß der U. S. Congress entsprechend der Empfehlung der Konferenz und auf Betreiben des Präsidenten Hoover im Juli 1932 den Federal Home Loan Bank Act verabschiedete, durch den — etwa analog und parallel zum Federal Reserve System — eine Art Reservesystem für die Hypothekenkreditinstitute geschaffen wurde, das aus Haushaltsmitteln des Bundes mit einem Grundkapital ausgestattet wurde und bei dem sich die privaten Hypothekenkreditinstitute durch ,Verkauf' von Hypothekenforderungen Liquidität verschaffen konnten52. Der Vorteil für die Hypothekenkreditinstitute lag vor allem darin, daß sie sich bei Hypothekenforderungen, deren Schuldner zahlungsunfähig geworden waren und bei denen auch das Betreiben des Zwangsverkaufs des Grundstücks keinen © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
163
deckenden Erlös gebracht hätte, durch deren Verkauf an das staatliche Reservesystem den vollen Nominalwert der Forderung beschaffen und das Risiko für den Ausfall somit gewissermaßen verstaatlichen' konnten. Mittelbare Nutznießer dieses staatlichen Reservesystems waren freilich auch die zahlreichen zahlungsunfähig gewordenen und deshalb vom Zwangsverkauf ihrer Grundstücke bedrohten Hauseigentümer, die sich anstelle der ,alten' Gläubiger, der auf das sofortige Eintreiben der ausstehenden Schuld erpichten Hypothekenkreditinstitute, nunmehr dem staatlichen Reservesystem als ,neuern', zur Stundung der Forderung bereiten Gläubiger gegenübersahen. Allerdings kam diese staatliche Rettungsaktion für Hunderttausende kleiner Hauseigentümer der Mittelklasse zu spät, da ihre Grundstücke bereits unter den Hammer gekommen waren53. Zielte der Erlaß des Federal Home Loan Bank Act in erster Linie darauf, den angeschlagenen Hypothekenkreditmarkt mit dem Einsatz staatlicher Mittel zu stützen, so sah der gleichzeitig in Kraft getretene Emergency Relief and Construction Act, indem eines seiner Teilprogramme die Reconstruction Finance Corporation (RFC) ermächtigte, öffentliche Kredite an limiteddividend corporations („. . . wholly for the purpose of providing housing for families of low income, or for reconstruction of slum areas“) zu geben54, primär ein wenn auch noch zaghaftes Programm öffentlicher Arbeiten (Public Works), also ein staatliches Arbeitsbeschaffungsprogramm, vor. Gleichzeitig bedeutete dieses Teilprogramm („housing for families of low income“ und „reconstruction of slum areas“) den Eintritt des Bundes in eine aktivere Wohnbaupolitik, wobei hinsichtlich der Förderungsmechanik (öffentliche Kredite an „limited-dividend corporations“) an das über die Shipping Board Emergency Fleet Corporation abgewickelte Kriegswohnbauprogramm angeknüpft wurde, wie dieses vorerst ebenfalls ein Notstandsprogramm. Da nach dem Gesetz die RFC Kreditanträge von privaten Bauträgern nur berücksichtigen durfte, wenn deren jeweiliger Heimatstaat ein die Bildung von „limited-dividend corporations“ regelndes Gesetz („enabling legislation“) erlassen hatte und ein entsprechendes Gesetz bis 1932 lediglich im Staat New York ergangen war, nämlich der erwähnte Housing Act von 1926, war die Zahl der bewilligungsfähigen Kreditantragsteller zunächst überaus gering. Unter diesem Programm wurden schließlich nur einige Projekte in New York City gefördert, vor allem das Knickerbocker Village mit 1600 Wohneinheiten. Die Bedeutung des Programms ist somit vor allem darin zu sehen, daß es die Einzelstaaten dazu brachte, die gesetzliche Regelung der Bildung von „limited-dividend corporations“ nachzuholen und daß es insgesamt die Bereitschaft der Hoover-Administration, vor allem des Präsidenten Hoover selbst, markierte, den Interventionsspielraum der Bundesregierung auf staatliche Arbeitsbeschaffungsprogramme und, wenn auch vorerst als Notstandsprogramm instrumentalisiert, auf eine aktivere Wohnbauund Slumsanierungspolitik auszuweiten.
11* © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
164
Hellmut Wollmann III.
Eine Analyse der von der Roosevelt-Administration in ihren ,ersten hundert Tagen' im Wohnbausektor ergriffenen Maßnahmen zeigt, daß sie zumindest in diesem Bereich an die von der Hoover-Administration 1932 inaugurierten Teilprogramme weitgehend anknüpfte und sie weiterentwickelte. Die erste New-Deal-Maßnahme auf dem Wohnbausektor war der am 16. Juni 1933 in Kraft getretene Home Owners Loan Act. Er ergänzte den unter Hoover 1932 verabschiedeten Federal Home Loan Bank Act insofern, als die Home Owners Loan Corporation (HOLC) eingerichtet wurde, an die sich der in Zahlungsschwierigkeiten geratene Eigentümer eines hypothekarisch belasteten Grundstücks nunmehr unmittelbar mit dem Antrag wenden konnte, ihn gegenüber dem auf Zahlung drängenden Hypothekengläubiger ,freizukaufen'55. Die finanzielle Prozedur war dahin geregelt, daß sich die HOLC ihr Geschäftskapital durch zurückzuzahlende Kredite von der Bundeskasse, also aus Öffentlichen Mitteln, beschaffte und die dies beantragenden Hypothekenschuldner in voller Höhe der ausstehenden Schuld abfand und an dessen Stelle Hypothekengläubigerin wurde. Für den in Zahlungsschwierigkeiten geratenen Hauseigentümer hatte dieser ,Freikauf' den unmittelbaren Vorteil, daß er sich anstelle des auf Zahlung drängenden ,alten' Hypothekengläubigers nunmehr der HOLC als ,neuer' Hypothekengläubigerin gegenübersah, die ihm die Rückzahlung der Hypothekenschuld stundete und erleichterte. Welchen Anklang diese staatliche Stützungsaktion zugunsten der in Not geratenen Hauseigentümer bei diesen fand, erhellt daraus, daß sich, wie geschätzt wurde, in der ersten Phase dieses Hilfsprogramms rund 40 % aller Eigentümer von hypothekarisch belasteten Grundstücken mit Hilfeersuchen an die HOLC wandten und diese im Höhepunkt ihrer Tätigkeit infolge massenhafter ,Freikäufe' Gläubigerin von insgesamt 15 % aller derzeitigen Hypothekenschulden auf Wohngrundstücken geworden war56. Freilich ist zu beachten, daß trotz umfangreicher Interventionen des Federal Home Loan Bank System und der HOLC, die mit dem Einsatz erheblicher öffentlicher Mittel verbunden waren, die Zahl der Zwangsverkäufe nichtbäuerlicher Häuser und Grundstücke zunächst noch sehr hoch blieb und erst ab 1936 deutlich abnahm (1933: 252 000, 1934: 230 000, 1935: 228 000, 1936: 185 000“). Der nur wenige Tage nach dem Home Owners Loan Act in Kraft getretene National Industrial Recovery Act, Kernstück des vom New Deal in dieser Phase unternommenen „Crisis Management“, sah in seinem zweiten Teil ein Programm öffentlicher Arbeiten (Public Works) vor, unter deren Gegenständen auch „construction, reconstruction, alteration, or repair under public regulation or control of low-cost housing and slum-clearance projects“ aufgezählt wurden. Zur Durchführung des Programms öffentlicher Arbeiten wurde die Federal Emergency Administration of Public Works (PWA) eingerichtet, innerhalb derer wiederum eine Unterbehörde, die Housing Division, gebildet wurde, die mit dem Wohnbau- und Slumsanierungsprogramm betraut wurde © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
165
und insofern das der Reconstruction Finance Corporation (RFC) der HooverAdministration zugewiesene Teilprogramm übernahm und fortführte. Zunächst knüpfte die PWA Housing Division denn auch an das von der RFC verwandte Aktionsmuster an, indem sie ihr Bauprogramm durch die Gewährung öffentlicher Kredite an „limited-dividend corporations“ abzuwickeln suchte. Als die Zahl der bewilligungsfähigen Anträge — wie schon unter der RFC — wegen des Fehlens der einzelstaatlichen Gesetze über „limited-dividend corporations“ gering blieb (bis Anfang 1934 wurde ein Bauvolumen von kaum mehr als 5000 Wohneinheiten bewilligt58), beschloß die PWA Housing Division, selbst als Bauherrin und Sanierungsträgerin aufzutreten, zwar im Hinblick auf den Bau bundeseigener Arbeiterwohnungen durch die United States Housing Corporation im Ersten Weltkrieg kein völliges Novum, jedoch angesichts einer Föderalismus-Tradition, für die die ,Impermeabilität' der Einzelstaaten gerade in Bereichen wie Wohnungsbau und Slumsanierung, also in als ,kommunal' angesehenen Problemfeldern, als geradezu unantastbar galt, eine dramatische Intervention des Bundes diesmal wie damals. Diese von der PWA Housing Division unternommenen bundesunmittelbaren Bau- und Sanierungsvorhaben wurden jedoch 1935 gestoppt, als sie im Rahmen eines in Louisville, Kentucky, verfolgten Slumsanierungsprojektes das Enteignungsverfahren (eminent domain) gegen einen Grundstückseigentümer einleitete, dieser gegen das Vorgehen der Bundesbehörde klagte und der „Louisville-Case“ von den Gerichten sowohl in erster wie in zweiter Instanz dahin entschieden wurde, daß die Inanspruchnahme der Enteignungsbefugnis (eminent domain) durch eine Bundesbehörde in diesem Falle verfassungswidrig gewesen sei, weil Slumsanierung (slum-clearance) nicht zu den Kompetenzen des Bundes gehöre, womit implizit eine selbständige welfare-Kompetenz des Bundes abgelehnt wurde59. Die Bundesregierung verzichtete, diese Streitfrage vor den noch mehrheitlich konservativen und sich dem New Deal widersetzenden U. S. Supreme Court zu bringen, um ihm nicht zusätzliche Gelegenheit zu geben, ein weiteres Stück des New Deal-Programms für verfassungswidrig zu erklären. Das Aktionsmuster bundesunmittelbarer Intervention im Bereich von Wohnungsbau und Slumsanierung wurde somit abgebrochen und wurde, wie noch zu zeigen ist, auch später nicht mehr aufgenommen. Das weitere Vorgehen der PWA Housing Division wurde durch einen anderen, etwa gleichzeitig laufenden Rechtsstreit, den „Muller-Case“, vorgezeichnet, als die New York City Housing Authority im Verlauf eines lokalen Sanierungsprojekts das Enteignungsverfahren gegen einen Grundstückseigentümer, einen Mr. Muller, betrieb, dieser dagegen klagte und das Gericht entschied, daß das Vorgehen der lokalen Behörde durch die dem Staat New York (als Einzelstaat!) zustehende „police-power“ gedeckt und damit rechtens sei. Für die PWA Housing Division bot sich damit der Ausweg, auf die administrative Durchführung des ihr zugewiesenen Wohnbau- und Slumsanierungsprogramms zu verzichten, diese vielmehr an lokale Stellen zu dezentralisieren und sich im wesentlichen auf die Finanzierung und allgemeine Reglementierung © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
166
Hellmut Wollmann
zu beschränken. Freilich kam das von der PWA Housing Division initiierte und finanzierte Wohnbau- und Slumsanierungsprogramm über verhältnismäßig spärliche Ansätze nicht hinaus. Innerhalb dieses wurden zwischen 1934 und 1937 lediglich rund 21 000 neue Wohnungen gebaut und 10 000 SlumWohnungen abgerissen, während von 1934 bis 1937 im gesamten Wohnungsbau über 1 Million Neubau-Wohneinheiten begonnen wurden. Dieses geringe Bauvolumen der PWA Housing Division ist vor allem damit zu erklären, daß regelmäßig erhebliche Teile der für ihr Programm bereitgestellten Mittel wieder abgezogen (zum Beispiel 110 Millionen von 135 Millionen im Jahr 1935!) und für unmittelbare Sozialfürsorgemaßnahmen ausgegeben wurden, worin nicht nur die größere Dringlichkeit der letzteren, sondern offenbar auch die Enttäuschung darüber zum Ausdruck kam, daß sich die über die PWA Housing Division laufenden Wohnbau- und Slum-Sanierungsprojekte nicht in dem erhofften Umfang als Arbeitsbeschaffungsprogramme zur Bekämpfung der unter Bauarbeitern besonders hohen Arbeitslosigkeit erwiesen60. Innerhalb des Bündels von New Deal-Maßnahmen der ,ersten hundert Tage' zielte die HOLC darauf ab, die Hunderttausende von Hauseigentümern, die sich im Bauboom der zwanziger Jahre hoch verschuldet hatten, vor der drohenden Zwangsversteigerung ihres Grundstücks zu bewahren. Die PWA Housing Division war in erster Linie als Arbeitsbeschaffungsprogramm angelegt, das — abgesehen davon, daß es auch als solches weitgehend versagte — nur eine sehr geringe Zahl von Niedrig-Miete-Wohnungen erbrachte und damit die Wohnverhältnisse vor allem der zu Miete wohnenden unteren und untersten Einkommensgruppen nicht fühlbar verbesserte. Der 1934 erlassene Federal Housing Act dagegen bezweckte, durch die Erleichterung und Absicherung der Aufnahme neuer Hypothekenkredite die Bautätigkeit von Privaten anzuregen und damit die Bauwirtschaft „anzukurbeln“61. Zu diesem Zweck wurde eine Art staatlicher Hypothekenkreditversicherung ins Leben gerufen: beabsichtigte ein Bauwilliger, bei einem Kreditinstitut einen Hypothekenkredit aufzunehmen, übernahm die aufgrund des Federal Housing Act gebildete Federal Housing Administration (FHA) gegenüber dem Kreditgeber die Bürgschaft für die Kreditsumme, wobei der Kreditnehmer eine geringfügige Jahresprämie an einen Fonds der FHA zu zahlen hatte, aus dem im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Kreditnehmers der Kreditgeber in voller Höhe der ausstehenden Schuld abgefunden wurde. Der Vorteil dieses Mechanismus vor allem für die Kreditinstitute als Kreditgeber liegt auf der Hand 62 : ihr Kreditrisiko wurde praktisch null, da es auf die Gesamtheit der in den Fonds der FHA Prämien einzahlenden Kreditnehmer abgewälzt, damit gewissermaßen vergesellschaftet' wurde und für den Fall, daß dieser aus den Prämien der Kreditnehmer gespeiste Fonds der FHA bei einer krisenhaften Zuspitzung für die Abfindung der Kreditgeber nicht ausreichen sollte, letztlich auf die hinter der FHA stehende Bundeskasse abgeschoben und damit verstaatlicht' würde. Springt der Vorteil, den die Einrichtung der FHA für die Kreditinstitute und damit für das ganze Bankenkapital hatte, somit förmlich ins Auge, darf der Vorteil nicht übersehen © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
167
werden, der sich mittelbar auch für die Bauwilligen selbst, also insbesondere die Mittelklasse, aus der Schaffung der FHA insofern ergab, als die Kreditinstitutionen gleichsam als ,Gegenleistung' dafür, daß ihnen das Kreditrisiko praktisch abgenommen wurde, bereit waren, die in den zwanziger Jahren üblichen, für die Kreditnehmer teilweise überaus ungünstigen Hypothekenkreditkonditionen abzuändern und die Kreditaufnahme für Bauwillige zu erleichtern und zu verbilligen (Senkung des Zinssatzes, Verlängerung der Laufzeit, Herabsetzung der erforderlichen Eigenkapitalsumme und dergleichen). Nutznießerin der von der FHA angebotenen Hypothekenkreditabsicherung war schließlich auch die Bauindustrie, da die FHA dadurch, daß sie das Interesse der Kreditinstitute an der (risikolosen) Gewährung von Baudarlehen, aber auch die Bereitschaft der Bauwilligen zur Aufnahme von Krediten weckte, wichtige Voraussetzungen für die Belebung der Bautätigkeit schuf. Die an einer Festigung und Förderung des privaten Bausektors interessierten pressure groups, vor allem die einflußreiche Vereinigung der Grundstücksmakler (NAREB), die sich an der Ausarbeitung des Federal Housing Bill beteiligt und sich für seine Verabschiedung eingesetzt hatten, begleiteten denn auch die Einrichtung der FHA mit Beifall und berechtigten Erwartungen. Tatsächlich erwies sich die Einrichtung der FHA als ein wirkungsvoller Stimulans der privaten Bautätigkeit, was daran abzulesen ist, daß von den nach 1935 begonnenen Neubauten (Zahl der jährlich begonnenen Neubau-Wohneinheiten 1935: 221 000, 1936: 319 000, 1938: 406 000) bis zu fast einem Drittel mit Hilfe von FHA-abgesicherten Hypothekenkrediten erstellt wurde (Anteil 1936: 15 %, 1938: 28 %, 1940: 29 % ) . Dabei kam die Förderung durch die FHA überwiegend der Mittelklasse zugute. Wie ermittelt wurde, entfielen auf die unteren 40 % der Einkommensskala lediglich 11 % der FHA-abgesicherten Hypothekenkredite. Über die kurzfristige Belebung der privaten Bautätigkeit und der „Ankurbelung“ der Bauwirtschaft hinaus erwies sich die FHA insofern als überaus folgenreich, als die von ihr bewirkte Erleichterung der Baukreditaufnahme durch die Mittelklasse, die von ihr ausdrücklich verfolgte Förderung des EinFamilien-Eigenheims, die wachsende Verbreitung des Automobils und das von Bund, Staaten und Kommunen mit öffentlichen Mitteln immer enger ausgebaute Straßennetz — im Zusammenwirken dieser Faktoren — die Voraussetzungen für die gegen Ende der dreißiger Jahre beginnende, nach dem Zweiten Weltkrieg sich verstärkt fortsetzende ,Flucht' der weißen Mittelklasse aus den zentralstädtischen in suburbane Wohnlagen schufen63. Während das von der PWA Housing Division im Rahmen des Programms Öffentlicher Arbeiten (Public Works) verfolgte Teilprogramm auf den Bau von Niedrig-Miete-Wohnungen in zentralstädtischen Bereichen und auf die SlumBeseitigung gerichtet war, wurde 1935 durch den Resettlement Act ein weiteres New Deal-Programm inauguriert, das zu einem wesentlichen Teil die Schaffung von Wohnplätzen in ländlichen und suburbanen Gebieten zum Gegenstand hatte64. Wie hier nur ganz verkürzt aufgezeigt werden kann, war dieses in mehrere Teilprojekte aufgefächerte Programm insgesamt von einer die länd© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
168
Hellmut Wollmann
liehe Lebensform gegenüber der städtischen romantisierenden Grundeinstellung bestimmt. Für das Zustandekommen dieses — im weiteren Verlauf weitgehend Episode bleibenden — Programms dürften folgende Gründe maßgebend gewesen sein. Zum einen teilten eine Reihe der New Dealers, voran M. L. Wilson, zeitweise Franklin D. Roosevelt selbst65, die Vorstellung, daß eine ,Rückkehr' („resettlement“) des von Industrialisierung und Verstädterung heimgesuchten Amerikaners aufs Land („back to the land“) erstrebenswert sei und vor allem die subsistence homestead, eine Art Nebenerwerbshof, den Rahmen biete, in dem der einzelne, teilzeitig auf seinem Hof, teilzeitig in industrieller oder gewerblicher Arbeit lohnabhängig tätig, die Tugenden des agrarischen Amerika à la Jefferson bewahren könnte ( „ . . . raise a good share of their living on an acre or two of land, keep some hens, a pig, some goats, or a cow, and be almost independent“68). Zum anderen war beim Zustandekommen dieses Programms offenbar auch das pragmatische Kalkül im Spiel, daß ein resettlement größeren Umfangs ein brauchbares Mittel sei, um einen Teil der ein Konfliktpotential bildenden städtischen Arbeitslosen in ländliche und suburbane Bereiche abzusaugen und diejenigen, die im Laufe der Depression auf der Suche nach billigeren Wohn- und Lebensgelegenheiten bereits von den Städten aufs Land gezogen waren, dort zu halten. In dem für die Fragestellung dieser Studie interessanten Teilprogramm der Resettlement Act, dem Suburban Resettlement67, kam dieser „jeffersonisch“ romantisierende Grundton, wenn auch abgeschwächt, in dem Konzept zum Ausdruck, am Rande der Großstädte in breite Gürtel („greenbelts“) eingebettete Trabantenstädte anzulegen, bei deren Konzipierung neben diesem einheimischen Ideologiestrang sicherlich auch die „Gartenstadt“-Idee des englischen Planers Ebenezer Howard Pate stand. Dieser ideologische Hintergrund der „greenbelt cities“ darf nicht den Blick davor verstellen, daß es sich bei dem „Suburban Resettlement Program“ in seiner Anlage und seinen Entwicklungsmöglichkeiten wohl um das weitestgehende, ja kühnste Wohnbau- und Städtebauprojekt des New Deal handelte. Sah dieses Konzept doch vor, daß sich über die Resettlement Administration der Bund unmittelbar als Planer, Bauherr und Eigentümer ganzer Ortschaften und ihrer Wohnungen betätigen sollte. Nachdem für die erste Versuchsphase der Bau von zunächst vier, dann drei „greenbelt cities“ geplant und durchgeführt worden war, die im ersten Bauabschnitt zwischen 750 und 1250 Wohneinheiten hatten, blieben weitere finanzielle Bewilligungen für das Programm aus, das somit eine wenn auch bemerkenswerte Marginalie der Wohnungsbaupolitik des New Deal blieb68.
IV. Wie die vorstehende Analyse einzelner den Wohnungsbau unmittelbar oder mittelbar berührender New Deal-Programme gezeigt hat, waren diese Interventionen und der mit ihnen verbundene Einsatz öffentlicher Mittel primär darauf gerichtet, das angeschlagene Hypothekenkreditkapital zu stützen, die © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
169
hypothekarisch verschuldete Mittelklasse abzusichern und die Bautätigkeit privater Investoren zu stimulieren. Zwar war im Programm Öffentlicher Arbeiten (Public Works) der Bau von Niedrig-Miete-Wohnungen vorgesehen, indes war dieses in erster Linie auf Arbeitsbeschaffung gerichtet und blieb überdies im Bau neuer Wohnungen praktisch belanglos. Das „Suburban Resettlement Programm“, an sich gerade im Hinblick auf Niedrig-Miete-Wohnungen überaus entwicklungsfähig, blieb unergiebig und folgenlos. Dabei hat es, insbesondere seit 1933, an Bestrebungen und Anläufen nicht gefehlt, eine Politik des Bundes zur Förderung des Baus von Niedrig-MieteWohnungen durchzusetzen. Wie weiter vorn dargestellt wurde, reicht die Tradition der um eine Verbesserung der Wohnverhältnisse der sozial Deklassierten in den Slums bemühten sozialreformerischen einzelnen und Gruppen bis zurück in die Mitte des letzten Jahrhunderts. Bis zum Ersten Weltkrieg beschränkten sich die „housing reformers“ darauf, den Erlaß strikter baupolizeilicher Vorschriften durch die Einzelstaaten zu verlangen und durchzusetzen, und waren gelegentlich bemüht, private Investoren („philantropy plus 5 percent“) zum Bau von Wohnungen zu erschwinglichen Preisen zu gewinnen; eine aktive Wohnbaupolitik der Einzelstaatcn oder gar des Bundes lehnten sie ab und verwarfen öffentlichen Wohnungsbau als ,sozialistisch'. Während der zwanziger Jahre — offenbar unter dem Eindruck des beispiellosen Baubooms — teilweise verstummt, verschafften sie sich erst zu Beginn der dreißiger Jahre wieder Gehör. Im Jahr 1931 bildete sich — im wesentlichen auf die Initiative von Mary Simkhovitch und Helen Alfred, zwei hervorragenden Sozialarbeiterinnen der „settlement-house“-Bewegung — eine Gruppe, die sich Public Housing Conference nannte und sich als Kristallisationskern für eine Interessengruppe zur Durchsetzung des öffentlichen Wohnungsbaus verstand. 1932 gründete diese Gruppe eine bundesweite Vereinigung, die National Public Housing Conference (NPHC), deren Präsidentin bzw. Geschäftsführerin Mary Simkhovitch und Helen Alfred wurden“. Diese „housing reformers“ der dreißiger Jahre gingen von der Erkenntnis aus, daß es eine breite Schicht unterer und unterster Einkommensgruppen gab, denen ordentliche Wohnungen in ausreichender Zahl zu ihnen erschwinglichen Preisen oder Mieten bereitzustellen für die private Bau- und Wohnwirtschaft nicht profitabel genug war. Sie folgerten daraus, daß es Aufgabe des Staates sei, sich dieses für private Investoren uninteressanten und deshalb vernachlässigten Teils der Wohnbevölkerung durch den Bau öffentlicher Wohnungen anzunehmen70. Nicht als Zugeständnis an ihre Gegner, sondern in Konsequenz ihres im „Progressivism“ wurzelnden sozialreformerischen Konzepts, waren sie somit auf eine Teilreform gerichtet, die die profitorientierte privatkapitalistische Struktur des Wohnbausektors nicht in Frage stellte, sondern sie vielmehr voraussetzte und mit öffentlichen Mitteln dort zu intervenieren suchte, wo die private Wohnwirtschaft infolge ihrer Profiterwartungen als Erzeugerin von ordentlichen Wohnungen zu niedrigen Mieten ausfiel. Wenn die „housing reformers“ der dreißiger Jahre immer wieder versicherten, daß © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
170
Hellmut Wollmann
der öffentliche Wohnungsbau nicht darauf zielte, der privaten Wohnungswirtschaft „Konkurrenz zu machen“71, so verdeutlicht dies die Begrenzung ihres Reformkonzepts, ist indessen zumindest auf dem Hintergrund jenes Vorstellungsstrangs des „Progressivism“ nicht selbstverständlich, der sich, angesichts der erpresserischen Praktiken und horrender Gebührenfestsetzungen privater Elektrizitätswerke (public utilities) in den zwanziger Jahren entstanden, in der Forderung öffentlichen Eigentums (public ownership) an Elektrizitätswerken und deren ,Meßlatten-Funktion' („yard-stick“) gegenüber privaten ausdrückte und dann 1933 durch die Schaffung der Tennessee Valley Authority (TVA) und die in ihrem Rahmen betriebenen öffentlichen Kraftwerke teilweise verwirklicht wurde, wobei die „yard-stick“-Funktion der Stromabgabe durch Öffentliche Kraftwerke zwar von den privaten Kraftwerken befehdetes, von der New Deal-Administration indessen offiziell bekräftigtes Teilziel dieser Unternehmung war72. Diesen eher traditionellen als radikalen Inhalten ihrer Reformvorstellungen entspricht es, daß sich die „public housers“ der dreißiger Jahre weitgehend der Mittel bürgerlich-liberaler „pressure-politics“ (,Öffentlichkeitsarbeit', „lobbying“ usw.) bedienten und praktisch darauf verzichteten, die potentiellen Nutznießer eines Programms öffentlichen Wohnungsbaus, die Unterprivilegierten in den Slums, zu aktivieren und mobilisieren. Die Forderung nach öffentlichem Wohnungsbau wurde zu keinem Zeitpunkt durch eine Aktivierung der unmittelbar Betroffenen an den „grass-roots“ getragen73, sie blieb die Angelegenheit einer Gruppe von „professionalized reformers“74. Waren anfangs die Zahl der an der Arbeit der National Public Housing Conference Interessierten und ihr Zusammenhalt noch gering75, so war es immerhin nicht zuletzt ihrem Drängen zu verdanken, daß 1933 der Bau von Niedrig-Miete-Wohnungen und die Slum-Beseitigung als Gegenstände des Programms öffentlicher Arbeiten (Public Works) in den 2. Teil des National Industrial Recovery Act aufgenommen wurden. Einen wichtigen Bündnispartner erhielt die NPHC im Jahr 1934, als eine Gruppe von an öffentlichem Wohnungsbau für Arbeiter interessierten Gewerkschaftlern die Labor Housing Conference (LHC) gründete und als deren Geschäftsführerin Catherine Bauer gewann, eine brilliante Sozialreformerin und Wohnungsexpertin, die gerade von einer längeren Studienreise aus Europa zurückgekehrt war, wo sie vor allem den öffentlichen Wohnungsbau in England untersucht hatte. Wesentlich auf das Betreiben der Labor Housing Conference ist es zurückzuführen, daß die American Federation of Labor, die zwischen 1914 und 1921 ein Programm öffentlichen Wohnungsbaus gefordert hatte, dann aber davon abgerückt war, auf ihrer im Oktober 1935 abgehaltenen Jahresversammlung in mehreren Resolutionen öffentlichen Wohnungsbau und Slum-Sanierung forderte. Damit hatte sich die Front der Verfechter des öffentlichen Wohnungsbaus formiert. Auf scharfe Ablehnung stieß „public housing“ als Mittel der Erzeugung von Niedrig-Miete-Wohnungen vor allem bei den an Bau, Verkauf und Vermietung privaten Wohnraums interessierten pressure groups. Unter ihnen hatte die Bundesvereinigung der Grundstücksmakler (NAREB) wohl den größten Ein© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
171
fluß, weil sie als lobby in Washington ausgezeichnete Beziehungen hatte und überdies in den zahllosen lokalen Vereinigungen der Grundstücksmakler über ein weitverzweigtes Netz wohlorganisierter und -finanzierter Einflußbasen verfügte, die — wie sich im Verlauf der Auseinandersetzung um „public housing“ zeigen sollte — sich hervorragend dazu eigneten, die Grund- und Hauseigentümer am Ort gegen die ,Bedrohung' durch „public housing“ zu mobilisieren und die herkömmlich besonders gegenüber lokalem „pressure“ sensiblen Kongreß-Abgeordneten zu ,bearbeiten'. Als Gegner von „public housing“ machten ferner die Baumaterialhändler (National Retail Lumber Dealers Association) ihren Einfluß geltend, da sie fürchteten, ein in größerem Stil betriebener Öffentlicher Wohnungsbau könnte mit neuartigen, rationelleren Baustoffen arbeiten und ihnen damit das Geschäft mit den überkommenen Baumaterialien verderben. Zur Front der Gegner von „public housing“ zählten ferner die U. S. Chamber of Commerce und die United States Building and Loan League78. Zur Begründung ihrer Ablehnung von „public housing“ brachten diese Gruppen, je nach Interessenlage etwas modifiziert, übereinstimmend etwa zwei Argumente vor. Zum einen wurde geltend gemacht, die private Bau- und Wohnwirtschaft sei, wenn auch erst auf längere Sicht, durchaus in der Lage, auch die unteren und untersten Einkommensgruppen mit ordentlichen Wohnungen zu versorgen, und zwar im wesentlichen aufgrund des „filter-down“Prozesses, bei dem die unteren Einkommensgruppen in die Wohnungen ,aufrücken', die die besser verdienenden Einkommensgruppen räumen, sobald sie sich eine Neubaumietwohnung oder gar das Eigenheim leisten können. Zum anderen wurde die Eigenheim-Ideologie beschworen, indem der Erwerb des Eigenheims als der Inbegriff amerikanischen Leistungsstrebens und Hort demokratischer und anderer Tugenden dargestellt und demgegenüber der Bau öffentlicher Wohnungen als ein ,un-amerikanischer', noch schlimmer: sozialistischer' Abfall von dieser Tradition gebrandmarkt wurde77. Der Widerstand dieser Gruppen gegen eine Intervention des Bundes zugunsten der unteren Einkommensgruppen hinderte sie — entsprechend ihrer Interessenlage — freilich nicht, staatliche Interventionen und den massiven Einsatz öffentlicher Subventionen dort zu fordern (und zu erreichen), wo diese etwa der Bauindustrie, dem Hypothekenkreditkapital und auch der Mittelklasse zugute kamen, wie die Beispiele des Federal Home Loan Bank System (1932), der HOLC (1933) und der FHA (1934) zeigen, an deren Zustandekommen vor allem die Vereinigung der Grundstücksmakler (NAREB) aktiven Anteil hatte. Anfang 1935 ergriff die National Public Housing Conference die Initiative, den Kongreß zur Verabschiedung eines „public housing“-Programms zu bewegen, das nicht nur, wie im Programm öffentlicher Arbeiten (Public Works), eine Art Anhängsel, zudem Notstandsprovisorium sein, sondern als ein auf Dauer gestelltes Programm sozialen Wohnungsbaus konzipiert und finanziert werden sollte. Wiederum unter maßgeblicher Mitwirkung von Mary Simkhovitch und Helen Alfred arbeitete die Gruppe der „public housers“ einen © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
172
Hellmut Wollmann
Gesetzentwurf aus und gewann Roben F. Wagner, den demokratischen Senator aus dem Staat New York, dafür, den Gesetzentwurf im Kongreß einzubringen. Die Zusage von Senator Wagner, den Gesetzentwurf zu übernehmen und zu unterstützen („sponsor“), wog um so mehr, als er sich längst als eine Schlüsselfigur im Gesetzgebungsverfahren der Arbeits- und Sozialgesetzgebung des New Deal erwiesen hatte und zudem, deutschgebürtig, Einwanderer, in den Slums von New York City aufgewachsen, mit den Problemen um „public housing“ wohlvertraut war. Die Gesetzgebungsgeschichte des Wagner Housing Act kann hier nur grob angedeutet werden. Von Senator Wagner im März 1935 eingebracht, blieb der Gesetzentwurf nach Zuweisung an einen Senatsausschuß in diesem stecken'. Im Frühjahr 1936 von Wagner erneut eingebracht, wurde der Gesetzentwurf zwar vom Senat verabschiedet, schieiterte dann aber im Repräsentantenhaus, wo sich vor allem der Vorsitzende des mit dem Gesetzentwurf befaßten Ausschusses, Henry Steagall, konservativer Demokrat aus dem Süden, querlegte und, Beispiel für die traditionelle Machtfülle der Ausschußvorsitzenden, den von ihm als ,ozialistisch' angesehenen Gesetzentwurf im Ausschuß ,begrub'. Freilich hinderte seine konservative Grundlinie den Ausschußvorsitzenden Steagall in anderen Fällen nicht, sich den Gesetzgebungswünschen des Präsidenten Roosevelt dort zu fügen, wo dieser ihm seine Gesetzgebungsprioritäten eindeutig und nachdrücklich zu erkennen gegeben hatte. Vieles spricht dafür, daß es Roosevelt hinsichtlich der Wagner Housing Bill 1936 unterlassen hat, auf Steagall nachdrücklich einzuwirken, wobei für ihn wahlkampftaktische Überlegungen angesichts der im November 1936 anstehenden Präsidentschaftswahl maßgebend gewesen sein dürften. Auch wenn Franklin D. Roosevelt, zumindest verbal, im Wahlkampf von 1936 zu jenem „huge, sudden, and unplanned shift leftward“79 ansetzte und es an heftigen Worten an die Adresse der „economic royalists“80 nicht fehlen ließ, wurde doch die Wohnbaupolitik und insbesondere „public housing“ als Mittel zur Behebung der Wohnmisere der sozial und wirtschaftlich Unterprivilegierten als Wahlkampfthema merkwürdig ausgespart. Hatte die Wahlkampfplattform der Demokraten den öffentlichen Wohnungsbau implizit eher abgelehnt als unterstützt („We believe every encouragement should be given to the building of new homes by private enterprise; and that the Government should steadily extend its housing program toward the goal of adequate housing for those forced through economic necessities to live in unhealthy and slum conditions“), so blieb er im ganzen Verlauf des Wahlkampfes praktisch ein „non-issue“81. Nach Roosevelts Erdrutsch-Wahlsieg und angesichts der in seinem Sog entstandenen überwältigenden demokratischen Mehrheit in beiden Häusern82 waren freilich die Chancen der „public housers“, mit einem Gesetzentwurf durchzudringen, besser denn je. Zudem war aus jener vielzitierten Passage seiner Inauguraladresse vom 20. 1. 1937 zumindest die Absichtserklärung des wiedergewählten Präsidenten herauszuhören, daß sich die neue Administration vermehrt den Problemen des „one-third of a nation ill-housed, ill-clad, ill-nourrished“ zuwenden werde. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
173
Der von Senator Robert F. Wagner im Februar 1937 abermals eingebrachte Gesetzentwurf zum „public housing“ wurde denn auch in seinem dritten Anlauf vom Kongreß verabschiedet83, wobei eine maßgebliche Rolle spielte, daß nunmehr Präsident Roosevelt, von einigen Gruppen der ,Roosevelt-Koalition'84, vor allem der AFL und der National Public Housing Conference, beim Wort genommen und gedrängt, das Gesetz unterstützte. Der konservative Flügel in den beiden Häusern und die gegen „public housing“ opponierenden Interessengruppen, die 1935 und 1936 das Zustandekommen des Gesetzes verhindert hatten, verlegten sich nun darauf, das Gesetz durch Zusätze zu ,entschärfen'85. Der Kompromißcharakter, den das Gesetz schließlich hatte, erhellt aus Einzelheiten seiner Regelung. Für die administrative Mechanik des Federal Housing Act von 1937 stand weitgehend die dezentralisierte Struktur Modell, deren sich die PWA Housing Division nach der Louisville-Entscheidung bedient hatte86. Auf der Bundesebene wurde nunmehr die United States Housing Authority eingerichtet, für die lokale Ebene war die Bildung lokaler Sonderbehörden (local public authorities) vorgesehen, die für die Planung, Verwaltung und den Bau der einzelnen Projekte Öffentlichen Wohnungsbaus in den Kommunen zuständig waren und in unmittelbare Verhandlungen und vertragliche Beziehungen mit der United States Housing Authority traten. Ein politisch folgenreiches Merkmal dieser dezentralisierten Verwaltungsstruktur, von den Konservativen von vornherein gefordert und begrüßt, bestand darin, daß die Bildung einer lokalen Bausonderbehörde, einer „local public authority“, und damit der Start eines „public housing“-Projekts nur mit Zustimmung des jeweiligen Gemeinderats möglich war, womit die Entscheidung, ob, wo und in welchem Umfang es zum Bau Öffentlicher Wohnungen überhaupt kommen sollte, letztlich bei den Gemeinden lag, was sich, später verschiedentlich noch durch die Ermöglichung lokaler Referenden verstärkt, als Hebel erwies, über den sich die vor allem unter der hausbesitzenden Mittelklasse gegen „public housing“ leicht mobilisierbaren konservativen Mehrheiten auf der Lokalebene durchsetzen konnten. Die im Finanzierungsteil, Kernstück des Gesetzes, vorgesehene Regelung zielte darauf, die Mieten in den öffentlichen Wohnungen dadurch drastisch zu senken, daß die gesamten Baukosten im Ergebnis aus Haushaltsmitteln des Bundes aufgebracht wurden und die Mieten darauf beschränkt blieben, die laufenden Verwaltungsund Unterhaltungskosten der öffentlichen Wohnungen zu decken. Die Finanzierung der gesamten Baukosten war dahin geregelt, daß diese zunächst — über öffentliche Kredite der United States Housing Authority oder über kommunale Schuldverschreibungen vom Kapitalmarkt — von der „local public authority“ aufzubringen waren und dann, über 60 Jahre verteilt, in Form jährlicher, verlorener Zuschüsse („annual contributions“) aus Haushaltsmitteln des Bundes der lokalen Sonderbehörde erstattet werden sollten. Mochten die Verfechter von „public housing“ in diesem Modus der „annual contributions“ als einer Art ,Ratenzahlung' des Bundes den taktischen Vorteil sehen, die vom Bund zu erbringende Bausumme als über viele Jahre verteilt und damit in den Augen © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
174
Hellmut Wollmann
der Konservativen als womöglich weniger anstößig erscheinen zu lassen, so boten gerade diese „annual contributions“, da sie jährlich mit dem Bundeshaushalt neu beschlossen werden mußten, den Gegnern von „public housing“ im Kongreß die Möglichkeit, das gesamte Programm über seinen Lebensnerv, die Finanzierung durch den Bund, zu kontrollieren und zu lähmen87. Indem das Gesetz als Nutznießer des Baus von öffentlichen Wohnungen die „Familien mit niedrigem Einkommen“ („families of low income“) festlegte, stellte es klar, daß nur solche Einkommensgruppen Öffentlich behaust werden sollten, die mit ordentlichen Wohnungen in hinreichender Zahl zu erschwinglichen Preisen zu versorgen für die private Bau- und Wohnungswirtschaft nicht profitabel genug war („,Families of low income' means families who are in the lowest-income group who cannot afford to pay enough to cause private enterprise in their locality . . . to build an adequate supply of decent, safe, and sanitary dwellings for their use“, wie es im Gesetzes-Englisch heißt88). Wenn weiter vorgeschrieben war, daß die Mieter bei Überschreiten einer bestimmten Einkommensgrenze ihre Öffentlichen Wohnungen zu räumen hatten, wurde damit auch dem Interesse der privaten Wohnungswirtschaft Rechnung getragen, das darauf ging zu verhindern, daß potentielle Nachfrager von privatem Wohnraum mit öffentlichen Wohnungen versorgt würden. War somit die Gruppe der Nutznießer — vor allem im Interesse der um ihre Klientel besorgten privaten Bau- und Wohnungswirtschaft — ,nach oben' begrenzt, so war sie andererseits dadurch auch ,nach unten' abgesteckt, daß die Miete aus eigenem Einkommen aufzubringen war, weswegen Gruppen ohne eigenes Einkommen, vor allem die infolge dauernder Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit ständig auf Fürsorgeleistungen angewiesenen Familien, für die Aufnahme in „public housing“ nicht in Betracht kamen89. Teils mochte hierin ein Zugeständnis der „public housers“ an ihre Gegner liegen, den Wohnplatz in öffentlichen Wohnungen nicht gänzlich aus öffentlichen Mitteln zu subventionieren, sondern den Mieter über die zu entrichtende Miete zumindest für die laufenden Unterhaltskosten der Wohnung heranzuziehen. Zum Teil kommt darin sicherlich aber auch das sozialreformerische Konzept zum Ausdruck, die öffentlichen Wohnungen als eine Art ,Zwischenstation', als eine Starthilfe für diejenigen Gruppen aufzufassen, die, durch die ,Umstände', nicht zuletzt durch die Wohnverhältnisse in den Slums, behindert und überdies durch die Depression zurückgeworfen, an sich als fähig angesehen werden, aus eigener Kraft ,voranzukommen', die ,potentiellen Aufsteiger' oder die „submerged middle-class“ also90. Vermutlich ist hier der Einfluß der „settlement house“-Bewegung im Spiele, die, wie oben gezeigt, bei der Auswahl ihrer Zielgruppen die Unterscheidung zwischen „deserving poor“ und „undeserving poor“ praktiziert hatte und der einige der einflußreichsten „public housers“ der dreißiger Jahre entstammten. Von den während des Gesetzgebungsverfahrens beschlossenen Abänderungen des Gesetzentwurfs hatten vor allem noch die beiden folgenden erhebliche und nachhaltige Bedeutung. Zum einen wurde die sog. „equivalent elimination“© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
175
Klausel eingefügt, wonach in jedem Ort eine der Zahl der neugebauten Öffentlichen Wohnungen entsprechende Anzahl von Slum-Wohnungen abgerissen werden sollte91. Diese von einem Senator eingebrachte und von den gegen „public housing“ opponierenden Interessengruppen, besonders wiederum der Vereinigung der Grundstücksmakler (NAREB), unterstützte Klausel war nach deren Vorstellungen dazu bestimmt zu verhüten, daß durch den öffentlichen Wohnungsbau der Wohnungsbestand insgesamt erhöht und etwa durch ein Überangebot an Wohnungen der untersten Kategorie der ,Preismechanismusc für den ganzen Wohnungsmarkt ,gestört' werden könnte. Die „public housers“ lehnten eine solche Verklammerung von Slumsanierung und Öffentlichem Wohnungsbau vor allem deshalb ab, weil sie befürchteten, ein solches Junktim würde die ohnehin beschwerliche Abwicklung von „public housing“-Projekten nur noch weiter komplizieren und die bisherigen Slum-Gebiete als den Standort künftiger Projekte Öffentlicher Wohnungen prädestinieren. — Eine von dem konservativen Senator Harry Floyd Byrd aus Virginia initiierte, von den „public housing“ bekämpfenden Interessengruppen ebenfalls unterstützte Abänderung des Gesetzentwurfs legte Höchstbeträge für die im Öffentlichen Wohnungsbau je Wohneinheit aufzuwendende Bausumme fest92. Verfolgten die Verfechter dieser Regelung die Absicht, den öffentlichen Wohnungsbau damit auf eine Schlichtbauweise festzuschreiben und dessen Produkte eher als Notunterkünfte denn als dauerhafte Wohnungen auszustatten, so befürchteten umgekehrt die „public housers“, daß eine solche Festlegung, zumal mit dem schließlich verordneten sehr niedrigen Kostenlimit, den Bau öffentlicher Wohnungen insbesondere in den solche Projekte verteuernden Großstädten zu einer Primitivbauweise verurteilen, wenn nicht ganz unterbinden könnte. Daß die Entwicklung von „public housing“ unter diesem Programm die in die Vorschrift der Schlichtbauweise gesetzten Erwartungen seiner Gegner erfüllte, wenn nicht übertraf, wird noch kurz nachgetragen werden. Trotz der Einschränkungen, denen der United States Housing Act von 1937, sei es von vornherein aufgrund der Konzeption seiner Verfechter, sei es infolge der von seinen Gegnern im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens vorgenommenen Eingriffe, schließlich unterworfen war, stellte er vor allem deshalb eine durchaus spektakuläre Neuerung dar, weil er ein erstmals nicht als Notstandsmaßnahme gemeintes, sondern auf Dauer angelegtes wohnbau- und sozialpolitisches Programm enthielt, das darauf zielte, durch den Einsatz öffentlicher Mittel einer breiten Schicht unterer Einkommensgruppen, dem „one-third of a nation ill-housed“, ordentliche Wohnungen zu erschwinglichen Mieten zu beschaffen. Wenn auch kein ,echtes Kind' des New Deal, sondern ein ihm insbesondere von der National Public Housing Conference, der AFL und Senator Robert F. Wagner im Zusammenwirken mehr oder weniger aufgedrängtes, so wurde das Programm dann doch von der zweiten Roosevelt-Administration getragen und ist dieser zuzurechnen. Zwar erreichte es in den ersten Jahren nach seiner Verabschiedung bis in die Kriegsjahre ein Bauvolumen, das jenes der früheren mit „public housing“ befaßten Teilprogramme des New Deal © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
176
Hellmut Wollmann
(also vor allem der PWA Housing Division im Rahmen von „Public Works“ und des „Suburban Resettlement“) um ein Vielfaches übertraf (Zahl der jährlich begonnenen öffentlichen Neubau-Wohneinheiten 1938: 6700, 1939: 56000, 1940: 73 000, 1941: 86 000, 1942: 54 000, für die übrigen Kriegsjahre und die ersten Nachkriegsjahre praktisch null) und beispielsweise 1938 immerhin 11 % und 1939 12 % von der Gesamtzahl der in diesen Jahren begonnenen NeubauWohneinheiten ausmachte. Jedoch reichte dieses Bauvolumen bei einem Gesamtbestand des vorhandenen Wohnraums von rund 28 Millionen Wohneinheiten im Jahr 1940 einfach nicht aus, um die Wohnverhältnisse des „one-third of a nation ill-housed“ fühlbar und nachhaltig zu verbessern93. Die weitere Entwicklung von „public housing“ kann hier nur in wenigen Strichen angedeutet werden, vor allem im Hinblick darauf, wie sich einige der dem United States Housing Act von 1937 beigebrachten Restriktionen ausgewirkt haben. Vom United States Housing Act von 1949 modifiziert und fortgeführt94, erreichte der Bau öffentlicher Wohnungen auch in seiner zweiten Phase kein wirklich durchschlagendes Volumen: Von 1937 bis 1970 wurden insgesamt 1,1 Millionen, also jahresdurchschnittlich rund 33 000 öffentliche Wohnungen gebaut, wobei sich der Anteil der öffentlichen Wohnungen am Wohnungsgesamtbestand 1970 auf 1,7 % belief95. Vor allem das durch das ByrdAmendment eingefügte Kostenlimit erwies sich dadurch als besonders folgenreich, daß es die lokalen Bauträger (local public authorities) besonders in den Großstädten nötigte, die öffentlichen Wohnungen in verdichteten, oft vielgeschossigen Gebäudekomplexen zu errichten96 und die Wohnungen innen vielfach nur kärglich, etwa nur mit den notwendigsten Installationen auszustatten, was insgesamt dazu beitrug, den öffentlichen Wohnungskomplexen den Eindruck von Wohnkasernen und Wohlfahrtsanstalten zu verschaffen und sie von den umliegenden Wohngebieten physisch und psychologisch zu isolieren97. Ferner erwies sich insbesondere die Vorschrift, wonach Mieter bei Überschreiten eines bestimmten Einkommens die öffentlichen Wohnungen zu räumen hatten, insofern als folgenschwer, als sie den Anstoß zu einer tiefgreifenden Umschichtung der Mieter öffentlicher Wohnungen gab. Durch diese Vorschrift genötigt, teilweise freilich auch aus freien Stücken, etwa von der durch die FHA gegebenen Erleichterung einer Hypothekenaufnahme zum Erwerb eines Eigenheims ermutigt, verließen zahlreiche der infolge des Kriegsbooms nunmehr besser verdienenden Arbeiter mit ihren Familien noch während des Krieges, vor allem aber danach die öffentlichen Wohnungen. Damit bahnte sich eine weitgehende soziale und ethnische Umschichtung unter den Mietern öffentlicher Wohnungen an, in deren Verlauf der Anteil der auf Sozialhilfe angewiesenen Familien (1963 bereits 39 % aller Mietparteien) und insbesondere der Schwarzen (1966 erstmals über 50 %!) ständig zunahm, wobei der steile Anstieg des Anteils der schwarzen Familien die massive Binnenwanderung widerspiegelt, in der nach Kriegsende Millionen verarmter schwarzer Familien aus dem ländlichen Süden in die Großstädte des Nordens und Westens strömten und als deren Ergebnis in einigen Großstädten der Anteil der Schwarzen an der Stadtbevölkerung ent© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
177
weder bereits 50 % überschritten hat (so in Washington D. C. und Newark, Ν. J . ) oder dies demnächst zu erwarten ist98. Verschärfte der wachsende Anteil der auf öffentliche Fürsorge angewiesenen Familien („problem families“) die soziale Diskriminierung gegen die öffentlichen Wohnbauprojekte dadurch, daß in ihnen nicht mehr allein die von der umwohnenden weißen Mittelklasse gleichsam als „submerged middle-class“ immerhin mit einem gewissen paternalistischen Wohlwollen gelittenen „deserving poor“, sondern nunmehr in immer größerer Zahl die von dieser als ,Versager' und Almosenempfänger verachteten „undeserving poor“ wohnten, so geriet „public housing“ mit dem steigenden Anteil schwarzer Mieter überdies noch in den Teufelskreis rassischer Diskriminierung. Hierbei erwies sich die durch den United States Housing Act von 1937 vorgeschriebene Dezentralisierung des „pubIic-housing“-Programms vielfach als ein wirksamer Hebel, über den, sei es durch lokale Referenden, sei es durch Gemeinderatsbeschlüsse, die weiße Mittelklasse den Bau öffentlicher Wohnungen in ihrem Ort und damit den möglichen Zuzug sozial unterprivilegierter Gruppen, vor allem der Schwarzen, verhindern konnte, was darauf hinauslief, diese in den zentralstädtischen Slums ,einzumauern' und eine größere Flexibilität des „public housing“-Programms zu vereiteln“. Aber sogar für die „public housers“ selbst war diese soziale und ethnische Umschichtung unter den Mietern der öffentlichen Wohnungen vielfach ein Grund, ihre Mitarbeit und ihr Interesse am „public housing“, zumindest in seinem ursprünglichen Konzept, aufzugeben. Hatten sie, hierin letztlich Angehörige der Mittelklasse und zudem in der Tradition der „settlement-houses“-Bewegung wurzelnd, den öffentlichen Wohnungen auch eine erzieherische Funktion beigemessen und die „deserving poor“ als ,potentielle Aufsteiger' zur Zielgruppe gehabt, so ließ die massenhafte Ankunft sozial deklassierter und, wie im Falle der Schwarzen aus dem Süden, auf das Leben in einer verstädterten, industrialisierten Umwelt in keiner Weise vorbereiteter Gruppen als neue Mieter öffentlicher Wohnungen die Voraussetzungen jenes ursprünglichen Konzepts in der Vorstellung vieler „public housers“ zerfallen. Viele, die seit den dreißiger Jahren als Verwalter und in ähnlicher Funktion in öffentlichen Wohnungsprojekten tätig gewesen waren, verließen sie enttäuscht, um von einer Generation von Hausverwaltern abgelöst zu werden, die, von der sozialreformerischen Tradition ihrer Vorgänger abgeschnitten, die öffentlichen Wohnungsprojekte und ihre Bewohner in erster Linie als „Verwaltungsprobleme“ auffaßten und die im Gang befindliche Entwicklung nur noch beschleunigten. „The very words ,public housing' are anathema to too many people, including the program's clientele; the words evoke images of massive, ugly projects, located in the most undesirable parts of the city, teeming with problem families, governed by harsh and arbitrary regulations.“100
12 Winkler, Krise
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
178
Hellmut Wollmann V.
Für die in der Einleitung zu dieser Studie formulierte Fragestellung, ob die den Bau- und Wohnungssektor betreffenden staatsinterventionistisdien Programme des New Deal als ein Beispiel für die Funktionsweise des „political capitalism“ aufzufassen seien, wonach die Funktionen des Staatsapparates in erster Linie darin bestehen, die Bedingungen privater Kapitalverwertung zu sichern und die für die Systemstabilität erforderliche Massenloyalität zu erhalten, dürfte die vorstehende Untersuchung folgende Belege geben. 1. Stellt man auf die ,Nutznießer' ab, zu deren Vorteil (benefits) die einzelnen Interventionsprogramme des New Deal im Bau- und Wohnungssektor ,ausgefallen' sind, so läßt sich sowohl hinsichtlich der zeitlichen Abfolge als auch nach dem finanziellen Umfang dieser Programme die folgende ,Prioritätenskala' angeben: An die erste Stelle ist die Stützung des angeschlagenen Hypothekenkreditkapitals zu rücken (Schaffung der HOLC, die an das 1932 von der Hoover-Administration eingerichtete Federal Home Loan Bank-System anknüpfte und dieses ergänzte), wobei gleichzeitig die gegenüber den Hypothekenkreditinstituten hochverschuldete, mit ihnen somit ökonomisch eng verklammerte haus- und grundbesitzende Mittelklasse vor der drohenden massenhaften Zwangsversteigerung ihrer Anwesen bewahrt wurde. An oberer Stelle ist ferner das ,Ankurbeln' (pump-priming) der Bautätigkeit der privaten Bauwirtschaft zu nennen (einmal durch die — ebenfalls einen Ansatz der Hoover-Administration fortführende!101 — Bereitstellung öffentlicher Mittel unter dem Programm öffentlicher Arbeiten, die im wesentlichen über private Unternehmungen abgewickelt wurden, und zum andern durch das über die FHA organisierte System einer staatlichen Hypothekenkreditversicherung), wobei das FHA-Programm zugleich der bauwilligen Mittelklasse zugute kam. An letzter Stelle dieser ,Prioritätenskala' bleibt der Bau von Niedrig-MieteWohnungen für die unteren Einkommensgruppen anzugeben; dieses schlug in den ersten Teilprogrammen (Public Works und Suburban Resettlement) praktisch nicht zu Buche und erreichte auch ab 1937 unter dem der New DealAdministration eher aufgedrängten als von ihr initiierten Programm öffentlicher Wohnungen zu keinem Zeitpunkt einen Umfang, der die Wohnverhältnisse des „one third of a nation ill-housed“ merklich verbessert hätte, zumal „public housing“ den sozial Deklassierten, insbesondere den auf Fürsorge angewiesenen Familien der Slums, verschlossen blieb. Die schichtenspezifische Asymmetrie, die dieser Verteilung der ,benefits' der staatsinternventionistischen Programme im Bau- und Wohnungssektor eigentümlich ist, läßt sich an den staatlichen Hilfsaktionen zugunsten der Eigentümer des Hypothekenkreditkapitals besonders deutlich zeigen. Dem ,Anarchismus', der gerade den Hypothekenmarkt der zwanziger Jahre — für die Kreditgeber überaus gewinnträchtig — gekennzeichnet und wesentlichen Anteil an der lawinenhaften Wucht hatte, mit der sich die Wirtschaftskrise in diesem Sektor auswirkte, wurde 1932 und 1933 durch staatliche Interventionen gegen© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
179
gesteuert, die zunächst vor allem darin bestanden, daß just den Kreditgebern, die an der unsoliden Aufblähung des Hypothekenkreditvolumens in den zwanziger Jahren erheblich beigetragen hatten, die Möglichkeit geboten wurde, nunmehr ihre infolge der Zahlungsunfähigkeit des Kreditnehmers und der schmalen Erlöse aus Zwangsversteigerungen praktisch wertlos gewordenen Hypothekenforderungen an staatliche Stellen (Federal Home Loan Bank System und HOLC) zum vollen Nennwert zu ,verkaufen' und den ihnen drohenden Verlust somit zu ,verstaatlichen'. Dieses Interventions- und Subventionsmuster prägte denn auch die über FHA organisierte staatliche Hypothekenkreditversicherung, durch die der Kreditgeber sein Kreditrisiko auf die Gesamtheit der Kreditnehmer abwälzen, gewissermaßen ,vergesellschaften* und, wenn auch diese ausfallen, letztlich verstaatlichen' kann. Diese im Bau- und Wohnungssektor besonders anschaulich beobachteten Vorkehrungen, die das ,unternehmerische Risiko' durch den Einsatz öffentlicher Mittel mindern, wenn nicht voll übernehmen, gaben Charles Abrams Anlaß, in der bekannten, später von Michael Harrington verbreiteten Formel vom „socialism for the rich and private enterprise for the poor“ zu sprechen102. Umfang und Richtung der staatsinterventionistischen Maßnahmen, die teilweise bereits 1932 unter der Hoover-Administration sichtbar, dann aber in den „ersten hundert Tagen“ des New Deal gebündelt ergriffen wurden, kennzeichnet eine Bemerkung, die A. A. Berle zwar auf die 1932 geschaffene Reconstruction Finance Corporation (RFC) münzte, die indessen auch für andere Interventionsstellen gilt: RFC „became an instrument for safeguarding and making available the banking and credit structure which is the life blood of all trade. For a period the RFC virtually took over the great bulk of work normally done by Wall Street and by the financial centers throughout the country“103. 2. Die Tatsache, daß die staatlichen Interventionen auf dem Hypothekenkreditsektor zugleich auch zahlreiche Eigentümer überschuldeter Grundstücke, vor allem mithin die haus- und grundbesitzende Mittelklasse, vor der drohenden Zwangsversteigerung ihrer Anwesen retteten, hatte bei den Betroffenen und über sie hinaus psychologische Rückwirkungen, deren stabilisierender, die Loyalität gegenüber dem bestehenden politischen und ökonomischen System stützender Effekt gar nicht überschätzt werden kann, zumal wenn man bedenkt, welchen einzigartigen Stellenwert das Eigenheim traditionell in der Vorstellungswelt der weißen Mittelklasse hatte und welchen geradezu existentiellen Schock die Wellen der Zwangsversteigerungen (1933: 252 000 im Jahr) 104 bei der breiten Schicht kleiner Hauseigentümer (Anteil der Eigenheime an der Gesamtzahl der Wohneinheiten im Jahr 1930: 46 % ) , auch wenn bei weitem nicht alle unmittelbar betroffen waren, hervorgerufen haben müssen. Mochten die Möglichkeit einer tiefgreifenden Loyalitätskrise gerade bei dieser breiten Mittelschicht als Ergebnis der durch die Depression erzeugten Panik fürs erste groß gewesen und die Chance von politischen Gruppierungen, mit radikaler Infragestellung des bestehenden politischen und wirtschaftlichen Systems, sei es von ,links' oder ,rechts', Gefolgschaft zu finden, erheblich gewesen 12* © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
180
Hellmut Wollmann
sein, so gelang es dem New Deal jedenfalls rasch, diese drohende Loyalitätskrise abzufangen, wie der überwältigende Wahlsieg von Roosevelt im November 1936 zeigte. Was die städtische Mittelklasse betrifft, bei der Roosevelt besonders hohe Wahlmehrheiten erzielte, dürfte die Annahme nicht fehlgehen, daß bei deren politischer Stabilisierung die staatlichen Stützungsmaßnahmen für ausstehende Hypothekenschulden durch die HOLC eine deutliche Rolle gespielt haben105. 3. Auch wenn diese einzelnen staatsinterventionistischen Programme des New Deal weitgehend unkoordiniert neben-, wenn nicht teilweise sogar gegeneinander liefen und Beispiele für den dem New Deal vielfach nachgesagten „experimentalism“ sind106, kann kein Zweifel daran bestehen, daß ihnen insgesamt von der New Deal-Administration, sieht man von dessen insofern einflußlosen ,linkem' Flügel, insbesondere Rexford G. Tugwell ab107, die Funktion zugedacht war, die Wirtschaftskrise unter Beibehaltung des bestehenden Wirtschaftssystems zu überwinden und auszusteuern. „Designed to maintain the American system, liberal activity was directed towards essentially conservative goals. Experimentation was most frequently limited to means; seldom did it extend to ends. Never questioning private enterprise, it operated within safe channels, far short of Marxism or even of native American radicalisms that offered structural critiques and structural solutions.“108 Einer wissenschaftlich-theoretischen Fundierung einer Wirtschaftspolitik à la Keynes abhold, zum „deficit spending“ nur zeitweise geneigt und wenn einer wirtschaftspolitischen Grundmaxime überhaupt, dann dem Grundsatz eines ,ausgeglichenen Haushalts' mit einer „dogged tenacity and consistency“ zugetan109, ließ Präsident Roosevelt — ungeachtet aller späteren Rhetorik gegen die „economic royalists“ — niemals einen Zweifel an seiner positiven Einstellung zum kapitalistischen Wirtschaftssystem aufkommen: „He took the status quo in our economic system as much for granted as his family“, wie Frances Perkins bemerkte110. Dies freilich schloß nicht aus, daß FDR, insofern in der sozialreformerischen Tradition des „Progressivism“ stehend, das bestehende kapitalistische Wirtschaftssystem als der Teilreformen bedürftig und fähig ansah. „Action was necessary to remove the sore spots which had crept in our economic system, if we were to keep the system of private property for the future. To preserve we had to reform“, sagte Roosevelt 1937111. In einer von A. A. Berle entworfenen, für das New Deal-Konzept vom „welfare-state“ (der Begriff wurde erst Ende der vierziger Jahre gängig)112 sehr aufschlußreichen Rede vom September 1932, der sog. „Commonwealth Club“-Rede, führte Roosevelt aus, daß mit dem Schließen der „frontier“ und dem Auftreten monopolistischer Wirtschaftsunternehmen die sich gewissermaßen im ,freien Spiel der Kräfte' selbstregulierende ,alte' „opportunity“ dahin sei und deshalb eine „enlightened administration“ die Aufgabe habe, „to assist the development of an economic declaration of rights“113, also den Wirtschaftssubjekten einen Handlungsspielraum etwa mit dem Ziel vorzugeben, „to give honest business a chance to go ahead and to make a reasonable profit and to give everyone a © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
181
living“ 114 .
chance to earn a Mag der New Deal in anderen Bereichen seiner Politik, etwa in der Arbeits- und Sozialgesetzgebung, bemerkenswerte soziale Fortschritte gebracht haben, so waren seine Interventionen im Bau- und Wohnsektor primär auf die Sicherung des Hypothekenkreditkapitals und der Bauwirtschaft und in diesem Zusammenhang auf die Förderung der bauwilligen Mittelklasse gerichtet. Auch der 1937 in Angriff genommene Bau öffentlicher Wohnungen für untere Einkommensgruppen konnte diese „schichtenspezifische Asymmetrie“ der Vorteilsverteilung staatsinterventionistischer Subventionen nicht nennenswert verschieben. „In acting to protect the institution of private property and in advancing the interests of corporate capitalism, the New Deal assisted the middle and the upper sectors of society.“ 115
Anmerkungen 1 Für eine materialreiche und kritische Darstellung des Diskussionsstandes vgl. P. Lösche, Revolution u. Kontinuität, in: Festschrift H. Herzfeld, Berlin 1972, 121—153 mit zahlreichen Nachweisen. 2 Vgl. G. Kolko, The Triumph of Conservatism. A Reinterpretation of American History, 1900—1916, Chicago 1967, insbes. 2—3, 58—59, 284—285, 302—303. 3 Ebd., 302. 4 Vgl. C. Offe, Politische Herrschaft u. Klassenstrukturen. Zur Analyse spätkapitalistischer Gesellschaftssysteme, in: G. Kress und D. Senghaas, Politikwissenschaft, Frankfurt 1969, 180—181. 6 Diese recht kruden methodologischen Überlegungen können hier nicht vertieft werden. 6 Angabe nach: U.S. Bureau of the Census, Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1957, Washington, D. C. 1960 (zit.: Historical Statistics), 57. 7 Vgl. W. Karlin, New York Slum Clearance and the Law, in: Political Science Quarterly 52. 1937, 242; P. Jacobs, Prelude to Riot, A View of Urban America From the Bottom, N. Y. 1968, 136—138. 8 Angaben nach: R. W. DeForest und L. Veiller Hg., The Tenement House Problem, I, N. Y. 1903, zit. nach: J . G. Hill, Fifty Years of Social Action in the Housing Front, The Social Service Review 22. 1948, 160. 9 Gemäß der Legaldefinition des Tenement House Act von 1867 ist ein „tenement house“ „. . . any house occupied as the home of three families or more, living independently of one another and doing their own cooking on the premises“, zit. nach Hill, 160. 10 Zur Entstehung des Tenement House Act von 1867 und seinen Vorschriften vgl. L. Μ. Friedman, Government and Slum Housing, A Century of Frustration, Chicago 1968, 26—29. 11 Health Department of City of New York v. Rector, etc. of Trinity Church in the City of New York. 17 N. Y. Supp. 510. Vgl. hierzu N. Straus, The Seven Myths of Housing, Ν. Υ. 1945, 200—201. 12 Vgl. etwa: Ch. Ε. Russel, The Tenements of Trinity Church — Does the good done by the charitable enterprises of Trinity Church equal the evil of tenements which help finance them, in: Everybody's (1908), abgedruckt in: A. u. L. Weinberg Hg., The Muckrakers, Ν. Υ. 1964, 311—320. Die Urteilsgründe verdienen, ausführlicher zitiert zu werden: „There is no ncces-
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
182
Hellmut Wollmann
sity for legislative compulsion on a landlord to distribute water through the stories of his building; since, if tenants require it, self-interest and the rivalry of competition are sufficient to secure it . . . Now, if it be competent for the legislature to impose an expense on a landlord in order that tenants may be furnished with water in their rooms instead of in the yard or basement, at what point must this police power pause? . . . A conclusion contrary to the present decision would involve the essential principle of that species of socialism under the regime of which the individual dis appears, and is absorbed by a collective being called the ,state' — a principle utterly repugnant to the spirit of our political system, and necessarily fatal to our form of liberty“, zit. nach: Straus, 200—201. 14 Health Department of New York City v. Rector, etc. of Trinity Church of New York City, 145 N. Y. 32 (1895), vgl. hierzu Τ. L. McDonnell, The Wagner Housing Act, A Case Study of the Legislative Process, Chicago 1957, 4. 15 Lowell v. Boston, 111 Mass. 461 (1873), vgl. hierzu McDonnell, 4—5, wo ein Auszug der Urteilsgründe zitiert ist. 18 Auf die umfangreiche Diskussion um Abgrenzung und Interpretation kann hier nicht eingegangen werden. Eine sehr gute Übersicht über den Diskussionsstand vermitteln die bei D. M. Kennedy Hg., Progressivism, The Critical Issues, Boston 1971, abgedruckten Artikel sowie dessen annotierte Bibliographie, ebd., 183—191, 17 Zum Social Darwinism in den USA vgl. R. Hofstadter, Social Darwinism in American Thought, Boston 1955, passim; Ε. F. Goldman, Rendezvous with Destiny, Ν. Υ. 1956, 70—72. Dazu, daß diese Einschätzung der Armut eine weit zurückreichende Tradition hat, die durch den Sozialdarwinismus lediglich auf einen zeitgemäßen Begriff gebracht worden ist, vgl. L. M. Friedman, Government, 19—20 mit Nachweisen. 18 So H. Spencer, Social Statics, Ν. Υ. 1880, 353—356, abgedruckt in und zit. nach: R. E. Will u. H. G. Vatter Hg., Poverty in Affluence, Ν. Υ. 19702, 36—38. 19 Vgl. Goldman, 71; Hofstadter, Social Darwinism, 201; ders., The Age of Reform, Ν. Υ. 1955, 305. 20 Vgl. J . P. Dean, The Myths of Housing Reform, American Sociological Review 14. 1949, 286; R. Lubove, The Roots of Urban Planning, in: ders. Hg., The Urban Community, Housing and Planning in the Progressive Era, Englewood Cliffs 1967, 6—7. 21 Hierzu etwa L. Veiller, Housing Reform, N. Y. 1910, 3—7, abgedruckt in und zit. nach: Lubove, Urban Community, 57: „Environment leaves its ineffaceable records on the soul, minds and bodies of men . . . I mprovement of social conditions, as indeed of all others, starts with the improvement of domestic life.“ Für eine knappe Charakterisierung von L. Veiller vgl. Lubove, Urban Community, 55. 22 A. F. Davis, Spearheads for Reform, The Social Settlements and the Progressive Movement, 1890—1914, Ν. Υ. usw. 1970, insbes. 40—59. 23 So K. McNaught, Socialism and the Progressives. Was Failure I nevitable?, in: Α. Ε. Young Hg., Dissent, Explorations in the History of American Radicalism, De Kalb 1968, 254. 24 Veiller, Housing Reform, nach Lubove, Urban Community, 58. 25 Auch auf die Diskussion um die „Frontier Thesis“ von F. J . Turner kann hier nicht eingegangen werden. Für eine Übersicht über den Diskussionsstand vgl. die bei R. A. Billington Hg., The Frontier Thesis, Valid Interpretation of American History, Ν. Υ. 1966 abgedruckten Artikel sowie die annotierte Bibliographie ebd., 119—122. 26 Hierzu etwa R. Hofstadter, The Thesis Disputed, in: Billington, 104. 27 Angaben nach: Historical Statistics, 394. 28 St. Thernstrom, Poverty and Progress, Social Mobility in a Nineteenth Century City, Ν. Υ. 1969, insbes. 116—117, wo er in seiner Studie der Sozialstruktur der Stadt Newburyport für die Zeit zwischen 1850 und 1880 zum Ergebnis kommt: „Real estate © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
183
was strikingly available to working class men who remained in Newburyport for any length of time. From a third to a half of these workmen were able to report some property holdings after a decade of residence in the city; after 20 years the proportion of owners had risen to 63 percent in one group and 78 percent in another“. 29 Zur Rolle dieser Bürgergruppen, vor allem der Charity Organization Society vgl. Hill, 161—174. 30 J . A. Riis, How the Other Half Lives (1890), Neudruck American Century Series, New York 1957; zur Bedeutung von Riis vgl. dortige Einleitung von D. N. Bigelow, ebd., VII—XIV; ferner Hill, 161. 31 Für Einzelheiten des Tenement House Law des Staats New York von 1901 vgl. Friedman, Government, 33—36. 32 Vgl. Lubove, Roots, 7. Für den auszugsweisen Abdruck eines Berichts, den L. Veiller und R. W. DeForest 1900 erstatteten und in dem sie u. a. kommuneeigenen Wohnungsbau für Arbeiterfamilien diskutierten und ablehnten, vgl. Hill, 174—175. 33 Hierzu Friedman, Government, 73—87; Davis, insbes. 8—14, 18—22, 40—59, 241; McDonnell, 54 f. 34 Ebd., 6 f.; R. M. Fisher, 20 Years of Public Housing. Economic Aspects of the Federal Program, N. Y. 1959, 73—79. 35 M. L. Colean zit. ebd., 77. 38 Dadurch, daß bei diesen neuen Siedlungen mit umfassenden stadtplanerischen Konzepten gearbeitet wurde, übten sie im übrigen eine faszinierende und anregende Wirkung auf eine ganze Generation von Stadtplanern aus, vgl. hierzu Lubove, Roots, 16. 37 Fisher, 75; McDonnell, 8 f. (meine Hervorhebung, H. W.). 38 Vgl. Who Will Build Five Million Homes?, The Literary Digest 66. 1920, No 9, 17—18. 39 P. F. Wendt, Housing Policy — The Search for Solutions. A Comparison of the United Kingdom, Sweden, West Germany, and the United States since World War II, Berkeley 1962, 146 f., McDonnell, 12—14, 18—22, 52. 40 Dazu, daß für das Abrücken der AFL von ihrer Befürwortung Öffentlichen Wohnungsbaus auch innergewerkschaftliche Gruppierungen verantwortlich waren, die Regierungsintervention und vor allem öffentlichen Wohnungsbau als ,sozialistisch' bezeichneten und verwarfen, ebd., 67—69. 41 Nach: Historical Statistics, 393. 48 Vgl. Hill, 176. 43 Governor Smith führte hierzu in der Jahresbotschaft von 1926 an das Parlament von New York unter anderem aus: „Investigations and studies made by every type of agency force us to the realization that the construction of certain types of homes for wage-earners of moderate income is unprofitable. The building of homes has been looked upon as an enterprise conducted like any other business in which the element of speculative profit has been operative. So long as this point of view is maintained it has been proven to be impossible to construct the homes we need or to rebuild the tenement areas“, zit. nach: Shall the State Help Build Homes, The Literary Digest 88. 1926, No. 5, 5. 44 Zum New York State Housing Act von 1926 vgl. Friedman, Government, 87 —88; McDonnell, 23—25; G. A. Cam, United States Government Activity in LowCost Housing, 1932—1938, The Journal of Political Economy 47. 1939, 358. 45 Vgl. Friedman, Government, 90. 46 Vgl. den Pressespiegel in: Shall the State Help Build Homes?, The Literary Digest 88. 1926, No. 5, 5—7. 47 Friedman, Government, 88. 48 Angaben nach: Historical Statistics, 73, 140, 393. 49 Ebd., 396, Zum Bauboom der zwanziger Jahre und der Situation auf dem Hypo© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
184
Hellmut Wollmann
thekenkreditmarkt vgl. National Commission on Urban Problems, Building the Ameri can City, Washington D. C. (1969) (zit.: Building the American City), 94. 50 Nach: Historical Statistics, 73, 395, 398. 51 Vgl. McDonnell, 26—27; Building the American City, 94. 52 Vgl. D. T. Rowlands, Urban Housing Activities of the Federal Government, The Annals of the American Academy of Political and Social Science 190. 1937, 84 —85. 53 Vgl. Τ. D. Hicks, Republican Ascendancy 1921—1933, Ν. Υ. 1960, 274. 54 Vgl. Friedman, Government, 88—89; McDonnell, 27—28; Cam, 357—359. 55 Vgl. L. N. Bloomberg, The Role of the Federal Government in Urban Housing, The American Economic Review 41. 1951, 588—589; The President's Committee on Urban Housing, A Decent Home, Washington D. C. 1969 (zit.: A Decent Home), 55. 58 Bloomberg, 589; A Decent Home, 55. Als einige Jahre nach dem Zweiten Welt krieg die von HOLC in den dreißiger Jahren aufgekauften Hypothekenforderungen von den Hypothekenschuldnern an HOLC schließlich ganz abgezahlt waren und HOLC ihrerseits die ihr aus der Bundeskasse vorgestreckten Mittel voll zurückgezahlt hatte, ergab sich sogar ein kleiner „Gewinn“, vgl. A Decent Home, 55. Es wäre jedoch ein Fehlschluß, daraus — ex post — folgern zu wollen, daß somit diese gewaltige staatliche Stützaktion zugunsten der Grundstückseigentümer die öffentliche Kasse „nichts gekostet“ habe. Die den Hauseigentümern in den dreißiger Jahren zugeflossene „Subvention“ bestand vielmehr darin, daß für ihren „Freikauf“ von der drohenden Zwangsversteigerung des Grundstücks Öffentliche Mittel aufgewandt wurden, die damit vorerst „verbraucht“ waren und für andere Zwecke fürs erste nicht zur Verfügung waren. 57 Nach: Historical Statistics, 398. 58 Vgl. Fisher, 82—91; McDonnell, 29—50; Wendt, 150—151. 59 United States v. Certain Lands in City of Louisville, Jefferson County. Ky. et al., 78 F. (2d) 684 (1935) und 9 F. Supp. 137 (1935). Zu diesem Louisville Case vgl. McDonnell, 45—46; Ch. Abrams, The City is the Frontier, Ν. Υ. 1967, 243—245. β0 New York City Housing Authority v. Muller, 279 Ν. Υ. 299 (1935) und 270 Ν. Υ. 333 (1936). Zum Muller Case vgl. Karlin, 250—251; Abrams, The City, 242 bis 246; McDonnell, 47 f.; Fisher- 85—90; Historical Statistics, 393; Cam, 362 f. 61 Zur FHA vgl. McDonnell, 40—41; A Decent Home, 55; ausführlich in: Building the American City, 94—107. 62 Ebd., 95: „FHA thus bolsters the lending institutions, permitting them to make practically riskfree loans on . . . homes.“ Noch pointierter Abrams, The City, 231—232, der von „socialization of risk“ spricht. 63 McDonnell, 60; W. W. Parrish, New Deal's Far-Reaching Housing Program, The Literary Digest 118. 1934, No. 2, 4; ders., A Real New Deal for the Home Owner, ebd., 118. 1934, No. 3, 6; Historical Statistics, 393; Wendt, 176; Building the American City, 99 f.; Ch. Tunnard und Η. R. Reed, American Skyline, Mentor 1956, 177—178. 84 Zu den verschiedenen Facetten des Resettlement-Programms und der dahinter stehenden Vorstellungswelt vgl. G. McConnell, The Decline of Agrarian Democracy, Ν. Υ. 1969, 84—96; Α. Μ. Schlesinger, The Age of Roosevelt. I I (The Coming of the New Deal), Boston 1958, 354—373; Friedman, Government, 113—116; A. E. Ekirch, Ideologies and Utopies. The I mpact of the New Deal on American Thought, Chicago 1969, 116—118; ausführlich P. K. Conkin, Tomorrow a New World: The New Deal Community Program, Ithaca 1959. 65 Vgl. Schlesinger, Age of Roosevelt, II, 361—363; Ekirch, 117. 66 So der Abg. Lord im U. S. House of Representatives am 21. 8. 1937, zit. nach Friedman, 114. 67 Zum Suburban Resettlement-Programm vgl. Cam, 369—373; Advisory Commission on Intergovernmental Relations, Urban and Rural America: Policies for © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
185
Future Growth, Washington D. C. 1968 (zit.: Urban and Rural America), 72—73. 68 Friedman, Government, 114: „. . . the most daring examples of public housing attempted under the New Deal and an example of serious social and economic planning“; Cam, 371. Zur weiteren Entwicklung der drei „greenbelt cities“ nach 1938: Urban and Rural America, 72 f. 69 McDonnell, 54—55; Davis, 240—241. 70 Diese „public housing“ tragende Konzeption hat besonders anschaulich in einer von Senator Robert F. Wagner im Dezember 1935 gehaltenen Rede Ausdruck gefunden, worin es u. a. heißt: „The object of public housing, in a nutshell, is not to invade the field of home building for the middle-class or the well-to-do which has been the only profitable area for private enterprise in the past. Nor is it even to exclude private enterprise from major participation in a low-cost housing program. It is merely to supplement what private industry will do, by subsidies which make up the difference between what the poor can afford to pay and what is necessary to assure decent living quarters... The subsidy idea, like schools and parks, hospitals and public libraries embodies the principle that distribution of our national income has not been entirely just, and that the interest of all the people require that the Government play its part in promoting improvement . . .“, zit. nach: McDonnell, 134—135. 71 Vgl. hierzu besonders anschaulich eine Rede von Nathan Straus, die dieser, seit 1937 Chef der aufgrund des Wagner Housing Act eingerichteten, mit dem „public housing“-Programm befaßten United States Housing Authority, im Januar 1938 vor einer Versammlung der United States Chamber of Commerce hielt, abgedruckt in: H. Zinn Hg., New Deal Thought, Ν. Υ. 1966, 158—166. I n dieser Rede heißt es unter anderm: „Let me assure you that no competition with private industry is contemplated by me or . . . is even possible under the Act“, ebd., 161. 72 Zur historischen Entwicklung und Begründung dieser Forderung der „Progressives“ nach öffentlichem Eigentum an Elektrizitätswerken (public utilities) und nach ihrer Meßlatten-Funktion' (yard-stick) und der weiteren im Zusammenhang mit TVA geführten Diskussion vgl, Ekirch, 118—121; A. S. Link, What Happened to the Progressive Movement in the 1920?, American Historical Review 64. 1959; ferner Ε. W. Hawley, The New Deal and the Problem of Monopoly, Princeton 1966, 337—343; Schlesinger, The Age of Roosevelt, I I I (The Politics of Upheaval), Boston 1966, 362 bis 376. 73 Vgl. McDonnell, 42, 54—55. 74 Zu diesem Begriff, den D. P. Moynihan (polemisch) auf die sozialreformerischen Theoretiker und Praktiker des War on Poverty unter Präsident L. B. Johnson münzte, vgl. D. P. Moynihan, Maximum Feasible Misunderstanding, Ν. Υ. 1970, 21—37. 75 Ernest J . Bohn, von Anfang an Mitglied der NPHC, bemerkte im Rückblick sarkastisch: „If we wanted to have a convention of all those working for public housing in 1934, we could have held it in a telephone booth“, zit. nach: McDonnell, 42. 76 Ebd., 55—70, 116—120; Freedman, 38, 59, 63. 77 Eine besonders anschauliche Darlegung dieser Positionen findet sich in einem Bericht, den W. S. Schmidt, Präsident der NAREB, 1935 gab. Er sei deshalb ausführlicher zitiert: „One of the distinguishing marks of our American civilization is a widespread ownership of land which is the bulwark of a democratic form of government. It was to obtain such a stake in land that the founders and early settlers of our country were motivated to endure the hardships involved in building this civilization. Wise federal action should tend to protect and stimulate private ownership. The necessities of the emergency should not cause government to take such action as will discourage ownership by setting up competition which individuals cannot meet, or by making tenement occupancy so attractive that the urge to buy one's own home will be diminished . . . Housing should remain a matter of private enterprise and private ownership. It is contrary to the genius of the American people and the ideals they have estab© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
186
Hellmut Wollmann
lished that government become landlord to its citizens . . . Very serious repercussions to our national life will follow if government continues its policy of direct action in becoming landlord to masses of its people . . . There is sound logic in the continuance of the practice under which those who have initiative and the will to save acquire better living facilities and yield their former quarters at modest rents to the group below. The movement might well be accelerated by Federal help.“ Zit. nach McDonnell, 138—139. 78 Ebd., 60, 88—114, 144—234. 79 So Burns, 375. 80 FDR verwandte diese Formel erstmals in der Rede, mit der er seine Wiedernominierung als Präsidentschaftskandidat durch den Parteikonvent der Demokraten im Jahr 1936 annahm: „These economic royalists complain that we seek to overthrow the institutions of America. What they really complain of is that we seek to take away their power“, vgl. Burns, 273—275. 81 McDonnell, 235 f. 82 Nach den Wahlen von 1936 war im (75.) Kongreß das Verhältnis von Demokraten und Republikanern: im Repräsentantenhaus: 331 zu 89, im Senat: 76 zu 16, nach: Historical Statistics, 691. 83 Zit. nach: McDonnell, 250; 269—273. 84 Zum Begriff der im Wahlkampf 1936 geformten ,RooseveIt-Koalition' vgl. Burns, 264—288; Schlesinger, Age of Roosevelt, III, 499—657, insbes. 592—600; vgl. auch S. Lubell, The Future of American Politics, Garden City, Ν. Υ. 19562, 29—60. 85 Zum „lobbying“ der einzelnen Verbände vgl. die grundlegende Monographie von McDonnell, passim. 86 Vgl. Friedman, Government, 106—107; ausführlicher ders., Public Housing and the Poor: An Overview, California Law Review 54. 1966, 624—649, abgedruckt in: D. M. Gordon Hg., Problems in Political Economy, An Urban Perspective, Lexington/ Mass. 1971, 399—402. 87 Vgl. Friedman, Government, 106—109; Freedman, 20—25, 38—40; Fisher, 92 bis 125. 88 Zit. ebd., 93. 89 Vgl. hierzu Senator Robert F. Wagner, der am 3. 10. 1937 im Senat erklärte: „There are some people whom we cannot possibly reach; I mean those who have no means to pay the rent . . . Obviously this bill cannot provide housing for those who cannot pay the rent minus the subsidy allowed“, zit. nach Friedman, 109. 90 Zum Begriff „submerged middle-class“ vgl. Freedman, 100—101. 91 Zu dem nach seinem Initianten, Senator David I. Walsh aus Massachusetts, genannten „Walsh amendment“, das die „equivalent elimination clause“ vorsah, und den Auseinandersetzungen über es vgl. McDonnell, 323—324, 333—338, 349—350, 357 bis 358, 374, 383, 388, 393. Vgl. auch Friedman, Public Housing 398. 92 Zu dem nach seinem Initianten, Senator Harry Floyd Byrd aus Virginia, genannten „Byrd amendment“ und den Auseinandersetzungen über es vgl. McDonnell, 324, 326—332, 348—349, 353—354, 394—395. 93 Vgl. H. Zinn in: ders. Hg., XVI; B. J . Bernstein, The New Deal: The Conservative Achievements of Liberal Reform, in: ders. Hg., Towards a New Past, Dissenting Essays in American History, Ν. Υ. 1969, 278; R. Radosh, The Myth of the New Deal, in: ders. und M. N. Rothbard Hg., A New History of Leviathan, Ν. Υ. 1972, 186. Die Zahlenangaben und die Berechnung nach: Historical Statistics, 393—395. 94 Zum United States Housing Act von 1949 vgl. etwa Freedman, 17—25; Building the American City, 110—111. 95 Angaben und Berechnung nach: U. S. Bureau of the Census, Statistical Abstract of the States: 1971, Washington D. C. 1971, 273. 96 Vgl. insbes. Friedman, Government, 120; Jacobs, 158. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Wohnungsbaupolitik des New Deal
187
97 C. Bauer, The Dreary Deadlock of Public Housing, Architectural Forum, Mai 1957, 141—142; Ch. W. Hartman, The Politics of Housing, in: J . Larner und I. Howe Hg., Poverty: View from the Left, N. Y. 1969, 155. 98 Vgl. Jacobs, 156; Friedman, Government, 122; Building the American City, 114 (mit weiteren Angaben); Report of the National Advisory Commission on Civil Disorders, N. Y. 196S („Kerner-Report“), 236—265, für eine Zusammenstellung der Großstädte mit vorhandenen bzw. zu erwartenden schwarzen Mehrheiten vgl. ebd., 391. 99 J . Belush u. M. Hausknecht, Public Housing: The Context of Failure, in: dies. Hg., Urban Renewal: People, Politics, and Planning, Garden City 1967, 452—455; Hartman, 151—154; Freedman, 20—25; M. Meyerson u. E. C. Banfield, Politics, Planning, and the Public Interest, The Case of Public Housing in Chicago, New York 1955, 25—27. Für die Fall-Studie eines Konflikts über die Errichtung eines öffentlichen Wohnungsbaus in Chicago nach 1949 vgl. dies., passim, vgl. ferner H. Wollmann, „Citizen Participation“ in USA — zwischen town meeting und community control, in: U. Bermbach Hg., Theorie und Praxis der direkten Demokratie, Opladen 1973, 331 —335. 100 Jacobs, 159; Belush u. Hausknecht, 455; Hartman, 160. Vgl. auch Η. Ε. Salis bury, The Shook-up Generation, Greeenwich 1959, 61—72, wo öffentliche Wohnungsprojekte in New York City beschrieben und als die „new ghettos“ bezeichnet werden. Für den Schwanengesang einer in den dreißiger Jahren elanvollen und einflußreichen Verfechterin des public housing vgl. Bauer, 140—142, 219, 221, ferner die auf diesen Arikel Catherine Bauers folgende Diskussion, an der sich elf Fachleute, darunter weitere ,alte' „public housers“ wie Charles Abrams, ebenfalls kritisch vom „public housing“ bisherigen Stils abrückend, zu Worte meldeten. Vgl. The Dreary Deadlock in Public Housing — How to Break It, Architectural Forum, Juni 1957, 139—141. 101 Insofern ist der neuerdings vor allem von M. N. Rothbard verfochtenen These zuzustimmen, daß die Hoover-Administration in ihrer letzten Phase einen Teil des Interventionsprogramms und -Instrumentariums des New Deal vorweggenommen hat. Vgl. hierzu Μ. Ν. Rothbard, The Hoover Myth, in: Weinstein u. Eakins Hg., 162 bis 179; ferner Bernstein, 265. 102 Abrams, City, 237, ähnlich „socialization of risk“, ebd., 232. 103 A. A. Berle, The Social Economics of the New Deal, The New York Times Magazine, October 29. 1933, 4 ff., auszugsweise abgedruckt u. zit. nach: W. E. Leuchtenburg Hg., The New Deal, Ν. Υ. 1968, 38. 104 Angabe nach: Historical Statistics, 398. 105 Vgl. Lubell, 58; F. Freidel, The New Deal in Historical Perspective, Washington D. C. o. J . , 14. Für eine Case-Study der Welle von Zwangsverkäufen auf der lokalen Ebene und der stabilisierenden Wirkung von HOLC vgl. R. S. u. H. M. Lynd, Middletown in Transition, New York 1937, 190—191, 395 (dort auch die Zahlenangaben). 106 Zum Topos vom ,experimentierenden' Roosevelt, vgl. F. Perkins, The Roosevelt I Knew, New York 1964, 328—333; Burns, 322. Vgl. insbes. jene vielzitierte Passage aus einer von FDR im Mai 1932 gehaltenen Rede: „The country needs . . . bold, persistent experimentation. It is common sense to take a method and try it: if it fails, admit it frankly and try another. But above all, try something.“ Abgedruckt in: Zinn Hg., 83. 107 Für eine kurze Kennzeichnung des ,linken' Tugwell, vgl. Zinn Hg., 84, ferner dessen Artikel „The Principle of Planning and the Institution of Laissez Faire“ (1932), abgedruckt ebd., 84—91. 108 Bernstein, 264. 108 Vgl. Burns, 322, 330—334, „dogged tenacity and consistency“, ebd., 323. Vgl. auch den offenen Brief, den John Maynard Keynes im Februar 1938, die neuerliche Verschärfung der Krise („Roosevelt depression“) zum Anlaß nehmend, an FDR richtete und in dem er u. a. zu Öffentlichem Wohnungsbau in größerem Stil als Gegenstand von
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
188
Hellmut Wollmann
deficit spending riet (Housing is by far the best aid to recovery because of the large and continuing scale of potential demand) und der bisherigen Wohnbaupolitik der Roosevelt-Administration (als Wirtschaftspolitik) bescheinigte: „The handling of the housing problem has been really wicked“, in: Zinn Hg., 406. 110 Perkins, 328. 111 Zit. nach: S. Fine, Laissez Faire and the General Welfare State, 1865—1901, Ann Arbor 1966, 382—383. 112 Vgl. A. Achinstein, The Welfare State — The Case For and Against, in: Ch. I. Schottland Hg., The Welfare State, N. Y. usw. 1967, 152. 113 F. D. Roosevelt, „Commonwealth Club Speech“, abgedruckt in und zit. nach: R. Hofstadter Hg., Great Issues in American History, 2, N. Y. 1958, 343—350. 114 Zit. nach Schlesinger, Age of Roosevelt, III, 652. 115 Bernstein, 281—282, ferner 278; vgl. auch Zinn, in: ders. Hg., XVI—XVII; Radosh, 170.
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Krise des amerikanischen Konstitutionalismus Der New Deal vor Gericht Von WILLI PAUL ADAMS
Unabhängige Rechtsprechung kann in zweifacher Weise als wesentliches Instrument sozialen Wandels dienen. Durch die Interpretation und Anwendung vorgegebener Normen auf konkrete Situationen kann sie permanenter Kritiker der Normen selbst sein. Durch ihre politische Eigenständigkeit kann sie Machtmißbrauch anderer Organe der Regierungsgewalt einschränken1. Vor dieser Aufgabe versagte das Rechtsprechungssystem der Vereinigten Staaten in den 1930er Jahren. Die Mehrheit der neun Richter des Supreme Court vermochte nicht, eine der konkreten Situation angemessene Verfassungsinterpretation zu entwickeln. Unter Berufung auf die Unantastbarkeit des Eigentums und der Vertragsfreiheit untersagte sie Kongreß und Präsident und Einzelstaatsregierungen, die öffentlichen Auswirkungen privaten Produzierens und Handelns auch im öffentlichen Interesse zu regeln. Sie entwickelte kein den politischen Tatsachen angemessenes Kriterium des Machtmißbrauchs, sondern ging von einem rigiden Verständnis der Machtverteilung zwischen Bund und Einzelstaaten, Kongreß, Exekutive und rechtsprechender Gewalt aus, das den Tatsachen wirtschaftlicher Konzentration nicht mehr entsprach. Erst 1937 vollzog der Supreme Court die vielleicht einschneidendste Wende in der Verfassungsrechtsprechung seit seinem Bestehen. Das Gericht billigte dem Bundesgesetzgeber und den Einzelstaatslegislativen von nun ab zu, wirtschaftliche Grundfragen, wie das Verhältnis von Gewerkschaften und Arbeitgebern, Mindestlöhne, Höchstgrenzen für Arbeitszeit und Arbeitslosenversicherung zu regeln. Auch die längst vollzogene Verschiebung der Machtverteilung zugunsten des Bundes wurde nun verfassungsrechtlich sanktioniert. Zuvor kam es, zum ersten Mal seit der Sezession der Südstaaten, zu einer Krise des Herrschaftssystems selbst. Nicht nur im Bewußtsein der Verfassungsjuristen nahm die Konfrontation der rechtsprechenden Gewalt mit der Legislative und Exekutive das Ausmaß einer Systemkrise an. Eines der Prinzipien des Regierungssystems schien sich selbst ad absurdum geführt zu haben. Gewaltenteilung und gegenseitige Gewaltenkontrolle drohten auch angesichts größter sozialer Probleme den offenbar notwendigen Einsatz der Regierungsgewalt auf Einzelstaats- und auf Bundesebene zu verhindern. Eindringlicher als je stellte sich die Frage, was die Machtfülle der auf Lebenszeit ernannten neun Richter rechtfertige, was von der Souveränität, von der Herrschaft des
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
190
Willi Paul Adams
Volkes bleibe, wenn fünf der neun ein von Repräsentantenhaus, Senat und Präsident gebilligtes Gesetz für verfassungswidrig und damit nichtig erklären können. Ein ,Veto' der Richter konnte anders als ein Veto des Präsidenten nicht mit einer qualifizierten Mehrheit der Legislative übergangen werden. Die Kompetenz des „judicial review“, der gerichtlichen Normenkontrolle, war fester Bestandteil des Verfassungsrechts geworden, und der Supreme Court war die letzte Instanz der Normenkontrollverfahren2. Sein Wille hätte nur auf zwei langwierigen Wegen umgangen werden können. Der Kongreß hätte durch ein Gerichtsorganisationsgesetz die Anzahl der Richter erhöhen und der Präsident die neuen Sitze mit pro-New-Deal Juristen besetzen können. Oder eine Verfassungsänderung hätte die Normenkontrollkompetenz des Obersten Gerichtes einschränken können. In dem heftigsten theoretischen Angriff auf die Normenkontrollkompetenz des Obersten Bundesgerichts, einem zweibändigen historischen Überblick unter dem Titel „Government by Judiciary“ erklärte 1932 Louis Boudin, New Yorker Anwalt und zeitweiliges Mitglied der American Labor Party, das amerikanische Regierungssystem sei degeneriert zu „Judicial Despotism, with all powers lodged in an irresponsible judiciary“. Er warf dem Supreme Court vor, noch unkontrollierbarer als ein „American House of Lords“ geworden zu sein, und die im amerikanischen Wortsinn „liberalen“ Richter hätten dazu fast ebenso viel beigetragen wie die konservativen und reaktionären3. I Der Wahlkampf von 1932 war weder von den Republikanern noch von den Demokraten mit einem klaren wirtschaftspolitischen Programm geführt worden. Der von den Demokraten in Aussicht gestellte „New Deal“ war eine Wahlparole geblieben. Roosevelts Wahlkampfrhetorik hatte jedoch Absagen an die von Amtsinhaber Hoover noch am Tiefpunkt der Depression beschworenen laissez-faire-Vorstellungen enthalten. Die sechshundert Konzerne, die zwei Drittel des amerikanischen Marktes beherrschten, hatte Roosevelt erklärt, seien zur öffentlichen Gefahr geworden. Die Regierungsgewalt müsse jetzt neue Aufgaben übernehmen: „The task of government in its relations to business is to assist the development of an economic declaration of rights, an economic constitutional order.“4 Wenige Tage nach seinem Amtsantritt am 4. März 1933, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, rief Roosevelt den Kongreß zu einer Sondersitzung zusammen. In den folgenden drei Monaten verabschiedete der Kongreß mit einem Minimum eigener Beratung den von Roosevelts bald als „brains trust“ bekannt gewordenem Beraterstab entworfenen und mit den betroffenen Interessengruppen zum Teil abgesprochenen ersten Schub von Gesetzen. Das Werbewort „New Deal“ wurde mit Inhalt gefüllt. Die Gesetze sollten vor allem den akuten Notstand mildern. Sie brachten Banken und Finanzen stärker als bisher unter die Kontrolle des Treasury Department. (Eine echte Verstaatlichung © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Krise des amerikanischen Konstitutionalismus
191
hatte niemand mit politischem Einfluß, auch keiner der „progressiven“ Senatoren aus dem Mittelwesten, vorgeschlagen4a.) Der Agricultural Adjustment Act versuchte, die fallenden Preise für Landwirtschaftserzeugnisse durch künstliche Verknappung, d. h., durch Prämiierung von Nicht-Anbau, hochzuhalten. Der National Industrial Recovery Act sollte ganze Industriezweige zur Vereinbarung fairer Wettbewerbsbestimmungen (codes of fair competition) bewegen, Gewerkschaften und Arbeitgeber unter Beteiligung der Regierung an den Verhandlungstisch bringen und Streiks verhindern. Direktmaßnahmen wie Arbeitslosenunterstützung und die Schaffung vorübergehender Arbeitsplätze durch öffentliche Bauten, Wiederaufforstung, und dergleichen, sollten den Arbeitslosen — bei Roosevelts Amtsantritt etwa 14 Millionen — helfen. Das „Herz des New Deal“ beschrieb Hugh Johnson, Leiter der National Recovery Administration, als „the principle of concerted action in industry and agriculture under government supervision looking to a balanced economy“5. Die einzelnen Maßnahmen und die divergierenden Konzepte waren sehr umstritten. Von rechts wurden viele von ihnen als sozialistisch, kommunistisch oder bolschewistisch, von links als sozial-faschistisch, einen Korporationen-Staat anstrebend, abgelehnt6. Die bloße Tatsache staatlichen Handelns wirkte dem schwindenden Glauben an die Funktionsfähigkeit des politischen Systems entgegen. Der New Deal war zu einem erheblichen Teil ein Stimmungsumschwung, ebensosehr ein Phänomen der Sozialpsychologie wie der Sozialpolitik. Wie populär, wie wirksam und wie konservativ — im Sinn von: die hergebrachte Wirtschafts- und Herrschaftsordnung in ihrer Grundstruktur erhaltend — die New Deal Maßnahmen auch gewesen sein mögen, das dritte Regierungsorgan, der Supreme Court, bedrohte ihre Durchführung. Die geplante Zusammenarbeit, von der die New Dealer sich die Überwindung der Wirtschaftskrise erhofften, erschien dem Obersten Gericht und dem größten Teil des Berufsstandes der Juristen, ob in der Funktion des Anwalts oder des Richters, als das Ende des amerikanischen Systems föderativer, konstitutionell limitierter Herrschaft. Seit den 1870er Jahren hatte der Supreme Court Hunderten von Einzelstaats- und Bundesgesetzen, die Handel, Industrie und Arbeitsbedingungen zu regeln versuchten, die Verfassungsmäßigkeit abgesprochen. Er hatte 1895 das Bundeseinkommenssteuergesetz mit 5:4 Stimmen verworfen7. Erst durch die Verfassungsänderung von 1913 wurde eine Bundeseinkommensteuer möglich. 1905 hatte er ein New Yorker Gesetz verworfen, das die Arbeitszeit von Bäckern auf 10 Stunden begrenzte8. 1918 hatte er einem Gesetz die Konformität mit den Verfassungsnormen abgesprochen, das die Erzeugnisse von Kinderarbeit vom (inneramerikanischen) zwischenstaatlichen Handel ausschließen wollte9. 1923 hatte er ein Bundesgesetz annulliert, das einen Mindestlohn für die Arbeit von Frauen im District of Columbia festlegte10. Auch nachdem die Organisation der Rüstungsindustrie durch das War Industries Board während des Ersten Weltkrieges das Tabu staatlicher Lenkung und Planung gebrochen hatte, und noch nach dem wirtschaftlichen Zusammen© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
192
Willi Paul Adams
bruch, der die Schwache freien' Unternehmertums und nur am Privatinteresse orientierter Kapitalverwertung in verheerenderer Weise als je zuvor sichtbar gemacht hatte, wollte der Supreme Court keine durchgreifende gesetzliche Regelung von Grundfragen der Industrieproduktion und der Landwirtschaft dulden. Präsident, Kongreß und Einzelstaatsregierungen mußten handeln. Das Ausmaß der Arbeitslosigkeit und der politischen Radikalisierung erlaubten nicht länger, alle Warntafeln zu beachten, die der Supreme Court staatlichem Eingreifen in der Vergangenheit entgegengestellt hatte. Die Konfrontation von Präsident, Kongreß und einigen Einzelstaatslegislativen einerseits und dem Obersten Bundesgericht als dem Hüter der nach überholten Wertvorstellungen interpretierten Verfassung andererseits wurde unvermeidlich. II 1933 und 1934 ergingen über 260 Urteile von Einzelstaatsgerichten und Bundesgerichten in Streitfällen über die Ausführung des NIRA und des AAA und analoger „recovery“-Gesctze der Einzelstaaten. Etwa jede fünfte Urteilsbegründung nahm zur Verfassungsmäßigkeit des betreffenden Gesetzes Stellung. Das Resultat war eine Reihe widersprüchlicher Urteile, die Vereinheitlichung durch das Oberste Bundesgericht verlangten. Der Petroleum Code z. Β., der unter anderem Tankstellen die Gewährung von Rabatten verbot, wurde in drei Fällen als verfassungsmäßig beurteilt. Vier Gerichte hielten ihn dagegen für verfassungswidrig, weil er nicht den zwischenstaatlichen Handel, sondern ein rein lokales Geschäft reguliere. In drei Fällen hielten Gerichte die Vergabe von Milchlizenzen entsprechend einem Code unter dem AAA für eine verfassungskonforme Aufgabe des Bundes, in acht Fällen urteilten sie entgegengesetzt11. Im Januar und März 1934 fällte das Oberste Gericht mit 5:4 Stimmen zwei Entscheidungen, die in der Öffentlichkeit als grünes Licht für den New Deal gedeutet wurden. Es billigte ein Gesetz des Staates Minnesota, das für die Dauer des derzeitigen Notstandes die Eintreibung fälliger Hypotheken durch Zwangsversteigerung aussetzte12. Das Gericht sah die Verletzung des Rechtsgutes „Vertragsfreiheit“ im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang und erklärte, ein Ausnahmezustand oder Notstand hebe die Grenzen limitierter Regierungsgewalt nicht auf. Zur Beseitigung des Notstandes dürften keine eindeutigen Verfassungsgebote verletzt werden — z. Β. die alleinige Kompetenz des Bundes, Münzen und Papiergeld herzustellen —, aber die interpretierfähigen allgemeinen Klauseln der Verfassung müßten in einer solchen Situation in ihrem größeren Zusammenhang gesehen werden. Der grundsätzliche Schutz von Verträgen z.B. setze voraus, daß es eine Regierungsgewalt gebe, die „den Frieden und die Ordnung einer Gesellschaft“ aufrechterhalten könne. Katastrophen wie Feuer, Überschwemmung oder Erdbeben könnten den Verzicht auf die Erfüllung von Verträgen rechtfertigen. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Krise des amerikanischen Konstitutionalismus
193
Das Minderheitenvotum sah in dieser flexiblen Interpretation bereits das Ende einer geschriebenen Verfassung. Es lehnte die Notstandstheorie ab. Richter Sutherland, dessen Begründung sich Van Devanter, McReynolds und Butler anschlossen, zitierte den für seine restriktive Verfassungsinterpretation bekannten Kommentator Thomas Cooley, der 1868 geschrieben hatte, es sei Aufgabe eines Gerichtes, Recht und Gesetz so zu erklären, wie es geschrieben steht. Der Inhalt der Verfassung stehe fest, wenn sie verabschiedet werde, und er habe sich nicht geändert, wenn zu einem späteren Zeitpunkt ein Gericht ihn interpretieren müsse. Dem Volk selbst sei es überlassen, Verfassungsänderungen vorzunehmen18. In der zweiten Entscheidung bestätigte das Gericht die Verfassungsmäßigkeit eines New Yorker Gesetzes, das einem Milchkontrollrat die Bestimmung des Verbraucherpreises für Milch übertrug. Der feste Verkaufspreis beraube den klagenden Einzelhändler nicht der „equal protection of the laws“, die ihm die 14. Verfassungsänderung garantiere. Denn die Maßnahme sei weder „willkürlich“ noch „unvernünftig“. Sie falle voll in die „police power“ oder „internal police“ des Staates New York. Das Gericht sah die permanente Kollision privater Verfügung über Eigentum und der Vertragsfreiheit mit der „police power“, dem Anspruch der Regierungsgewalt auf die Durchsetzung der allgemeinen Wohlfahrt. Ebenso grundlegend wie der private Rechtsanspruch, erklärte es, sei das Recht der Öffentlichkeit, ihn im allgemeinen Interesse zu regulieren. Nur ein Kriterium müsse der Einsatz der Regierungsgewalt zur Förderung des Gemeinwohls erfüllen: die eingesetzten Mittel dürften nicht die Garantie eines ordentlichen Gerichtsverfahrens, des „due process of law“, verletzen. Das Gericht behielt sich vor, die Angemessenheit der Mittel im Einzelfall zu überprüfen. Das Minderheitenvotum der Vier lehnte diese extensive Auslegung der „police power“ ab zugunsten der Vertragsfreiheit und des Rechts auf Eigentum. Im folgenden Jahr, 1935, billigte die Mehrheit des Obersten Gerichtes in mehreren „gold clausea-Entscheidungen ebenfalls die Joint Resolution des Kongresses vom 5. Juni 1933, die in privaten und öffentlichen Verträgen die Erfüllung vereinbarter Goldklauseln suspendiert hatte14.
III Wer waren die neun Männer, die von 1933 bis 1937 die Spitze der rechtsprechenden Gewalt verkörperten? Der juristisch-politologisch-historische Forschungszweig, der die soziale Herkunft der Berufsgruppe Richter — judicial recruitment —, ihr Verhalten — judicial behavior — und ihre Wertsetzungen — judicial values — untersucht, steckt noch in den Anfängen15. Ein Pionier auf diesem Gebiet, der Chicagoer Politologe Herman C. Pritchett, veröffentlichte 1948 eine Untersuchung des Supreme Court mit dem Untertitel „A Study in Judicial Politics and Values“16. Anhand der Urteile stellte mit Minderheitsvoten Pritchett Häufigkeitstabellen 13 Winkler, Krise
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
194
Willi Paul Adams
auf, die er aber nur dadurch mit einem gewissen Erklärungswert füllen konnte, daß er die weniger exakten Begriffe „conservative“, „moderate“ und „left“ zu Hilfe nahm. Sozialen Hintergrund und Urteilssprüche der Richter versuchte er nicht zu korrelieren. Pritchetts Ansatz ist inzwischen von Glendon Schubert und anderen erheblich verfeinert worden17. Noch weit entfernt aber ist man von einem Erklärungsmodell, das alle Faktoren miteinander verbindet, die einen Richter oder eine Gruppe von Richtern in einer bestimmten Situation sich zu einem bestimmten Urteil entschließen lassen. Die weniger ehrgeizige Frage nach der politischen Gruppierung und dem sozialen Hintergrund der neun Richter ist unschwer zu beantworten. Nicht anders als in vielen gesetzgebenden Versammlungen hatten sich zwei klar definierte Flügel ausgebildet, zwischen denen der Rest schwankte. Der konservative Flügel bestand aus Willis Van Devanter (1910 ernannt), James C. McReynolds (1914 ernannt), George Sutherland (1922 ernannt) und Pierce Butler (1922 ernannt). Ihre Position war konservativ im Sinn von: gegen staatliche Eingriffe in die Wirtschaft und für weitgehenden Schutz des Grundrechts auf Eigentum. Den Flügel der „Liberalen“ bildeten Louis D. Brandeis (1916 ernannt), Harlan F. Stone (1925 ernannt) und Benjamin N. Cardozo (1932 ernannt). Ihre Einstellung war „liberal“ im amerikanischen Sinn von: für gesetzliche Regelung von Wirtschaftsproblemen und für weitgehenden Schutz des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung. Zwischen beiden Gruppierungen schwankten der Vorsitzende Charles Evans Hughes (1930 ernannt) und Owen J . Roberts (ebenfalls 1930 ernannt). Sehr wenige Richter am Obersten Gericht sind vor ihrer Ernennung Rechtsgelehrte gewesen. Nicht nur in der Verfassungstheorie bildet der Supreme Court eine von drei Staatsgewalten. Viele von ihnen sind auch Politiker im engeren Sinn des Wortes gewesen. Und wenn sie sagten, sie seien nur Richter, die den Verfassungstext und Gesetzestexte interpretierten, dann sagten sie dies als die Politiker, die die dritte Staatsgewalt darstellten. Als Beispiel möge der besonders stationenreiche Werdegang von Chief Justice Hughes genügen. Er schien ganz und gar den Traum vom Aufstieg des Tüchtigen zu rechtfertigen: 1862 als Sohn eines Baptistenpredigers und einer Lehrerin im Staat New York geboren; Stipendium für die Law School der Columbia Universität; brillantes Examen; Eintritt in eine New Yorker Anwaltssozietät; Anwalt eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Staates New York zur Überprüfung der Gebühren privater Gas- und Elektrizitätswerke; Publizität als Anwalt des Volkes (die Gas- und Stromgebühren wurden gesenkt); 1906 als Kandidat der Republikanischen Partei zum Gouverneur von New York gewählt; 1910 zum Richter am Supreme Court ernannt; 1916 aufsehenerregender Rücktritt vom Supreme Court und Kandidatur gegen Woodrow Wilson für das Präsidentenamt: sehr knappe Niederlage; 1921 bis 1925 Secretary of State unter Präsident Harding; 1925 bis 1930 prominentester amerikanischer Anwalt („the acknowledged leader of the American bar“, wie ihn einer seiner Biographen beschrieb); 1928 bis 1930 Richter am Internationalen Gerichtshof des Völker© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Krise des amerikanischen Konstitutionalismus
195
bundes in Den Haag; und schließlich, 1930, von Präsident Hoover zum Chief Justice ernannt18. Der persönliche Hintergrund der neun Richter enthält folgende Merkmale19: A. Zunächst die vier Konservativen: 1. Familienhintergrund Drei von ihnen waren in den Jahrzehnten nach dem Bürgerkrieg unter „frontier“-Verhältnissen, einer auf einer Plantage in Kentucky aufgewachsen. Zwei waren Einwandererkinder, zwei Kinder eines Juristen bzw. Arztes. Als Katholik gehörte einer einer Minderheitengruppe an. 2. Ausbildung Zwei hatten eine vornehmlich praktische Ausbildung genossen; einer hatte an der Law School der University of Virginia, einer an der Law School von Cincinnati studiert. 3. Heimatstaat des Erwachsenen Utah, Minnesota, Tennessee, Wyoming. 4. Berufstätigkeit Zwei Eisenbahn-Anwälte; davon einer zuletzt Richter; einer Anwalt in einer Sozietät; einer Anwalt und Professor. 5. Politische Ämter Einer Senator; einer Assistant Attorney General; einer erfolgloser Kandidat für das Repräsentantenhaus; zusätzlich einige politische Ämter in ihren Heimatstaaten. 6. Sympathie für politische Parteien Alle vier sympathisierten mit der Republikanischen Partei. B. Die drei „Liberalen“: 1. Familienhintergrund Einer war als Sohn eines eingewanderten Getreidehändlers in Kentucky aufgewachsen, einer in einer angesehenen Farmerfamilie in New Hampshire, einer in einer etablierten Juristenfamilie in New York. Zwei von ihnen gehörten als Juden eindeutig einer Minderheitengruppe an. 2. Ausbildung Zwei hatten an der Law School der Columbia Universität, einer an der Harvard Universität studiert. 3, Heimatstaat des Erwachsenen Zwei lebten in New York, einer in Massachusetts. 13* © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Willi Paul Adams
196
4. Berufstätigkeit Einer Anwalt und Publizist, einer Anwalt und Dean der Law School von Columbia, einer Richter am höchsten Einzelstaatsgericht von New York. 5. Politische Ämter Einer Attorney General. 6. Sympathie für politische Parteien Einer Republikaner, einer Demokrat, einer wahrscheinlich (Cardozo).
Demokrat
C. Hughes und Roberts: 1. Familienhintergrund Einer stammte aus einer Prediger- und Lehrerfamilie, einer aus einer Müllerfamilie in Pennsylvania. 2. Ausbildung Law School der Columbia University; Law School der University of Pennsylvania. 3. Heimatstaat des Erwachsenen Einer New York, einer Pennsylvania. 4. Berufstätigkeit Einer prominenter Anwalt in New Yorker Sozietät, die einige der größten Firmen des Landes vor dem Supreme Court vertrat; einer führte Anwaltspraxis und nahm Lehrauftrag an der Law School der University of Pennsylvania wahr. 5. Politische Ämter Hughes: Gouverneur von New York, Secretary of State, Präsidentschaftskandidat. Roberts: keine. 6. Sympathie für politische Parteien Beide Republikaner. Aus diesen Daten eine Regelhaftigkeit ableiten zu wollen, die die späteren Stellungnahmen der einzelnen Richter zum New Deal erklärt, ist verlockend, aber unmöglich. Die angeführten Merkmale ergeben ein Muster. Der regionale Gegensatz von Westen und Süden gegenüber dem Osten ist ebenso eindeutig wie der Unterschied in der institutionellen Qualität der Ausbildung. Aber über die Regelhaftigkeit des Zusammenhanges dieser und anderer Faktoren mit den © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Krise des amerikanischen Konstitutionalismus
197
Verfassungsinterpretationen kann man beim derzeitigen Kenntnisstand nur spekulieren. Eine wichtige Rolle für die Supreme Court Richter — das wird in den Biographien der Richter deutlich — spielten zwei Institutionen, die einander teilweise antagonistisch gegenüberstanden: die bundesweite Standesorganisation der Bar Associations und einige der großen Law Schools. Das Verhältnis zu beiden war eng verknüpft mit der Karriere und den sozialen Ordnungsvorstellungen eines politisch aktiven Juristen. Er konnte seinen intellektuellen Rückhalt in der affirmativen Welt der Bar Associations oder aber in der reformerischen Grundstimmung einer der führenden Law Schools suchen. Die Optionsmöglichkeit zwischen beiden Bezugsgruppen lag dem Ausspruch von Chief Justice Taft zugrunde, als er 1927 über seinen Amtsbruder Stone sagte: „I am very much disappointed in him; he hungers for the applause of the lawschool professors and the admirers of Holmes.“20
IV Einige Law Schools, vor allem Columbia, Yale und Harvard waren zu intellektuellen Ausgangspunkten und publizistischen Stützpunkten der Klärung des Verhältnisses von Recht und Gesellschaft geworden21. Hier entwickelten — anknüpfend an den Skeptizismus von Oliver Wendell Holmes und die ,soziologische Jurisprudenz' von Roscoe Pound — Karl Llewellyn, Thomas Reed Powell, Thurman Arnold, Jerome Frank u. a. eine ,realistische Jurisprudenz', die sich nicht mehr mit der Exegese von Rechtsgrundsätzen zufrieden gab, sondern die gesellschaftlichen Bedingungen und Auswirkungen des Rechtsprechungsprozesses mit zu bedenken versuchte. Schon 1920 hatte der Dean der Yale Law School, Thomas W. Swan, neben die professionelle Ausbildung von Juristen als gleichwertige Aufgabe der Law Schools gestellt: „improving the law by scientific and analytical study of existing laws, by comparative study of the jurisprudence of other countries, by criticism of defects and suggestion for improvement in the administration of law and in methods of legislation, and by relating law to other institutions of human society.“ Juristen, die dieser Aufgabe gerecht werden sollten, brauchten mehr als eine Ausbildung in den Rechtstechniken. In dieser Erkenntnis forderte Harlan Stone als Dean der Columbia Law School 1923 ein umfassenderes Konzept des Lehrplans: „We have failed to recognize as clearly as we might that law is nothing more than a form of social control intimately related to those social functions which are the subject matter of economic and the social sciences generally.“22 Die in einigen Jahren folgenden Lehrplanreformen machten einige der Law Schools der Ostküste zu Foren der Diskussion gesamtgesellschaftlicher Probleme. Es war nur folgerichtig, daß Vertreter des „legal realism“ wie Jerome Frank, Herman Oliphant, Charles E. Clark, Thurman Arnold, William O. Douglas und Felix Cohen artikulierte Verteidiger des New Deal wurden und daß Kritiker des „legal realism“ wie Lon Fuller und in zunehmendem Maß auch Roscoe Pound zugleich Kritiker des New Deal waren23. Politologen, Historiker und Wirtschaftswissenschaftler © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
198
Willi Paul Adams
wie Charles Beard, Edward Corwin und John Commons hatten ebenfalls seit zwei Jahrzehnten zu einer realistischeren Analyse der Entwicklung der Verfassungsrechtsprechung beigetragen24. Die Neuinterpretation des verfassungsgemäßen Verhältnisses von Regierungsgewalt und Wirtschaft war vorbereitet und begleitet von einer bitteren Debatte um die Funktion der rechtsprechenden Gewalt. Was ab 1937 herrschende Meinung wurde, war seit der Jahrhundertwende von den Rechtslehrern und anderen Sozialwissenschaftlern diskutiert, in den Law Reviews und politikwissenschaftlichen Zeitschriften publiziert und von liberalen Richtern wie Holmes, Brandeis und Stone in einer Serie von Minderheitsvoten vor der Öffentlichkeit als Alternative aufgebaut worden. Die juristischen Verteidiger des New Deal und weiterführender Reformen des Rechtsprechungsprozesses selbst stellten sich in die Tradition dieser Bemühungen. Die Zeit der Einteilung von Problemen in „legal“, „economical“, „political“, „technological“ und dgl. sei vorüber, erklärte der Herausgeber der ab Dezember 1933 an der Duke University School of Law in Durham, North Carolina, veröffentlichten Zeitschrift „Law and Contemporary Problems“. Die Artikel der ersten beiden Bände behandelten „The Protection of the Consumer of Food and Drugs“, „Low-Cost-Housing and Slum Clearance“, „Agricultural Readjustment in the South: Cotton and Tobacco“, „Extending General Power Over Crime“. „Installment Selling“ und „The Wage Earner's Life Insurance“. Frederic Beutel von der Tulane Law School verlangte von der juristischen Profession mehr Wissenschaft' im Sinn kontrollierten Experimentierens. Die sozialen Auswirkungen von Gesetzen und Rechtsnormen müßten beobachtet und ausgewertet werden: „The whole of political science and that part of experimental economics and sociology which involves theories about scientific laws governing the effect of government regulation of business and community activity become merged with, and part of, experimental jurisprudence.“ Auch Psychologie, fügte er hinzu, könne vielleicht einen Beitrag leisten. Nur zusammen mit neuen Formen der Handhabung der Regierungsgewalt auf nationaler wie auf lokaler Ebene sah Beutel die Möglichkeit der Verwirklichung wissenschaftlicher' Gesetzgebung und Rechtsprechung. Die Alternative sei nicht mehr Freiheit oder Reglementieren, sondern planloses Reglementieren und Experimentieren im Interesse der derzeit herrschenden Klasse (dominating class) oder Reglementieren und Experimentieren unter einer umfassenden Zielsetzung25. Anstelle einer Wertlehre wollte diese Richtung der Rechtsreformer die bewußte Analyse der sozialen Folgen legislativen und rechtsprechenden Handelns sehen. Der des Radikalismus unverdächtige Roscoe Pound, von 1916 bis 1936 Dean der Harvard Law School, sah die Notwendigkeit eines an die Wurzeln des amerikanischen Selbst- und Rechtsverständnisses gehenden Umdenkens. In Amerika, schrieb er 1933, habe sich das Ideal der „competitive acquisitive selfassertion“ am hartnäckigsten behauptet. Neue Wirtschaftsformen verlangten jedoch neue Rechtsfiguren: © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Krise des amerikanischen Konstitutionalismus
199
In all parts of the world economic unification and organization of industry are affecting the relations of man to man in society. Our received ideal can no longer be one of free competitive activity of individually self-sufficing units. It must be redrawn as one of adjusted relations of economically interdependent units26. Klarer als die anderen artikulierte Max Lerner, derzeit an der Herausgabe der „Encyclopedia of the Social Sciences“ beteiligt, die Kluft zwischen dem demokratischen Ideal und der Wertskala, von der sich der Supreme Court seit dem Bürgerkrieg hatte leiten lassen. Die Rechtsprechung hatte sich zum Schutzpatron der kapitalistischen Wirtschaftsweise entwickelt: The real Constitution became under capitalism merely the modus operandi of business enterprise. Between it on the one hand, and on the other the ideals of the American experiment and the phrases in which the eighteenth century had clothed those ideals, there was an ever lengthening gulf: it became the function of the Supreme Court to bridge that gulf. Capitalist enterprise in America generated, as capitalism has everywhere generated, forces in government and in the underlying classes hostile to capitalistic expansion and bent upon curbing it: it became the function of the Court to check those forces and to lay down the lines of economic orthodoxy27. Ein Marxist, so erklärte Lerner das zeitgenössische politische Spektrum, sieht bei diesem Tatbestand im Obersten Gericht das Werkzeug und im Kapitalismus die treibende Kraft. Ein Jeffersonianer schlußfolgere, daß jede Einschränkung der Rechte des kleinen Mannes, jede Zentralisierung abzulehnen sei; er fürchte den Supreme Court nicht weniger als Wall Street, könne sich aber nicht entscheiden, welches der Schatten und welches die Substanz sei. Ein „liberal“ könne drei Positionen beziehen. Wenn er ein konstruktiver „liberal“ ist, wird er versuchen, das Oberste Gericht als Kontrollmittel gegen den Kapitalismus zu nutzen. Wenn er ein ethischer „liberal“ ist, der sich von organisatorischen Veränderungen keine Folgen verspricht, glaubt er, daß die „Qualität der amerikanischen Erfahrung“ sich in beiden Institutionen auswirke. Und wenn er ein technologischer „liberal“ ist, der das Heil in staatlicher Planung sieht, dann betrachtet er den derzeitigen Supreme Court als den großen Feind, der irgendwie umgangen werden muß. Lerner selbst sah keine Determiniertheit. Das konstitutionelle System ließ seines Erachtens dem Obersten Gericht prinzipiell die Unabhängigkeit, sich aus seiner bisherigen Interessenverflechtung zu lösen und sich anders als in den vergangenen sieben Jahrzehnten zu entscheiden.
V Die Verteidigung der Verfassungsmäßigkeit des New Deal entsprang dem gleichen Impuls, wie die gesamte politische Begründung der vielfältigen Reformmaßnahmen, dem Glauben an die Offenheit des Regierungssystems für Experimente. In der gegebenen verfassungsrechtlichen Lage nahm dieses Motiv die Form an: Der Supreme Court wird dem Geist der Verfassung von 1788 gerecht, wenn er der Bundesregierung und den Einzelstaatsregierungen die © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
200
Willi Paul Adams
Chance gibt, der neuartigen Situation mit neuartigen Gesetzen zu begegnen; verfassungsmäßig ist, was Abhilfe schafft. Wenn die bisherige Verfassungsrechtsprechung der Anwendung eines besonderen Mittels im Weg stehe, müsse sie ebenso revidiert werden, wie frühere Verfassungsinterpretationen revidiert worden seien18. Das Verfassungsverständnis der New Dealer, einschließlich der Rolle des Supreme Court, formulierte Felix Frankfurter, Professor an der Harvard Law School, Freund Roosevelts und ab 1939 selbst Supreme Court Richter, in einer Radioansprache in Boston im Mai 1933: The justices of the Supreme Court are in fact arbiters of social policy. They are so because their duties make them so. The words of the Constitution are usually so unrestrained by their intrinsic meaning, or by their history, or by prior decision, that they leave the individual justice free, if indeed they do not compel him to gather meaning, not from reading the Constitution, but from reading life29. Die Formel des „due process of law“ und die Handels-Klausel in Artikel I, Sektion 8 der Verfassung betrachteten sie als nützliche Instrumente zur Lösung der gegenwärtigen Probleme. Die New Dealer verlangten eine prinzipiell aktive Rolle des Supreme Court, auch wenn die Aktivität oft lediglich darin bestand, den Legislativen die Freiheit zum Experimentieren zu verschaffen. „The Court is not in a position“, erklärte der Dean der Yale Law School, „to exercise leadership in an economic and social emergency. It should not put a stop to attempts of other governmental agencies to do so.“ 30 Als David Podell, der Mit-Autor des NIRA, im März 1934 vor einem Ausschuß der American Bar Association die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes begründete, bemühte er nicht die Dogmengeschichte, sondern schilderte den Notstand, den das Gesetz beseitigen sollte: „A year ago the grave danger and the real source of danger to our national economy lay in the fact that our legitimate labor organizations were being by degrees demoralized and that Communist groups and Red agitators and Left Wingers were eating into the very heart of these organizations.“ 31 Die in ihrem Ausmaß einmalige Arbeitslosigkeit habe den Extremisten in die Hände gespielt. Um der Arbeitslosigkeit Herr zu werden, habe man vor allem die „legitimen“ Arbeiterorganisationen stärken müssen. Diese Umstände, argumentierte Podell, müßten bei der Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit des N I R A berücksichtigt werden: No court on earth can study the constitutionality and do justice to the question of constitutionality involved, without considering it in the light of the background, in the light of the conditions, in the light of the aims, the objects, the purposes, the prevailing strife and struggle of a three-year period of depression. The ultimate test . . . might well be: is it really working well? . . . Are we to wipe it from the books because in some instances it may hamper the minority in a group. Rather find a way of protecting the minority judicially or administratively. That may well be accomplished by judicial review of the provisions of each code.82 Podell verlangte die Art von Lösung, die vorausschauende Juristen längst hatten kommen sehen, die Entwicklung der in Amerika bis dahin kaum aus© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Krise des amerikanischen Konstitutionalismus
201
gebauten Verwaltungsrechtsprechung und entsprechend spezialisierter Gerichte33. Die New Dealer prangerten die Stagnation seit Ende des Weltkrieges an. Die Krise hatte offensichtlich nicht erst 1929 begonnen, sondern spätestens mit dem künstlichen „back to normalcy", das die Fortentwicklung der einschneidenden Änderungen der Kriegsjahre verhindert hatte. Während der 1920er Jahre hatten gleichzeitig die Konzentration des Vermögens und der wirtschaftlichen Entscheidungsbefugnis und die Arbeitslosigkeit zugenommen. Das hemmungslose Wirtschaftssystem habe sich 1929 selbst zerstört, erklärte Robert H. Jackson vor dem jährlichen Bankett der Association of American Law Schools im Dezember 1934. Roosevelt und der Kongreß hätten nicht die Kontrolle über die Wirtschaft usurpiert; die Wirtschaft hätte abgedankt und sich der staatlichen Autorität in die Arme geworfen: „The government was the last source of unimpaired credit, the only institution to hold public confidence." Der New Deal war die logische Folge34. Jackson sah die Schlüsselrolle der Juristen für die Verwirklichung der neuen Funktion der Regierungsgewalt, und er sah die mangelnde Bereitschaft der Mehrheit der Zunft, diese Rolle zu übernehmen. Er sprach das vielleicht härteste Urteil der New Dealer über die Juristen, besonders die organisierte Anwaltschaft aus: „Although many eminent and influential liberals are lawyers the net contribution of the bar to the balance of forces is, and will likely remain, on the conservative side . . . At present the bar is one of the most stubborn, reactionary and short-sighted groups in our national life."35 Wie Frankfurter, Clark, Podell und Jackson verteidigte eine Anzahl der dem New Deal nahestehenden Juristen in Reden und Artikeln seine Verfassungsmäßigkeit und forderte ein neues Selbstverständnis der rechtsprechenden Gewalt als verantwortlicher dritter Staatsgewalt36.
VI Ihre Opponenten waren ebenfalls Juristen. Was sich abspielte, war aber weniger ein Austausch verfassungsrechtlicher Argumente als eine Konfrontation von Weltanschauungen. In den meisten Juristenverbänden dominierte auch nach 1929 die Selbstzufriedenheit. Die politischen Mehrheitsmeinungen der Bar Associations der Einzelstaaten und einiger Großstädte waren sicher nicht uniform, und beim derzeitigen Forschungsstand ist es kaum möglich, detaillierte Aussagen über die Variationen zu machen37. Sicher ist jedoch die Ablehnung des New Deal durch die Spitze der American Bar Association und die Verbreitung großer Mengen von Anti-New-Deal-Literatur durch das Verbandsbüro38. Viele Juristen zogen sich in eine angeblich unpolitische Dienstleistungsmentalität zurück. Der Canon of Judicial Ethics der American Bar Association sah den vorbildlichen Juristen als „fearless of public clamor, regardless of public praise, and indifferent to private, political or partisan influence.“39 Das Berufsbild des Juristen wurde in die Nähe des Arztes und sogar des Priesters © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
202
Willi Paul Adams
gerückt40. Im Zentrum der Argumentation gegen die Verfassungsmäßigkeit des New Deal stand die Verabsolutierung eines Mittels zum Selbstzweck. Die Bewahrung des bestehenden Corpus der Verfassungsrechtsprechung galt als höchste Aufgabe in sich selbst. Politisch wurde diese Position gerechtfertigt mit einem mythischen Konzept der ,Suprematie der Verfassung' und der ,Herrschaft der Gesetze'. Wer Revision der herrschenden Interpretation des Verhältnisses von Regierungsgewalt und Wirtschaft forderte, kündigte den 1788 geschlossenen Bund und die in ihm vereinbarte Machtverteilung zwischen Einzelstaaten und Bundesregierung. Wer der Justiz Versagen vorwarf, bedrohte ihre Unabhängigkeit41. Wo die New Dealer ein soziales Problem sahen, das es zu lösen galt, sahen ihre juristischen Gegner vor allem schwindenden Glauben an „den Wert unserer konstitutionellen Regierungsform“, dem mit patriotischen Appellen zu begegnen war. Die Verfassungskritik der Rechtslehrer an den Universitäten verurteilte diese Juristen als Untergrabung der „moralischen Autorität der Verfassung“42. Sie sagten, sie lehnten nicht jede Neuerung ab. Sie verlangten nur, daß der Wandel sich entsprechend den Normen der herrschenden Verfassungsinterpretation zu vollziehen habe. Verfassungsgemäßer Verfassungswandel, lautete eines ihrer häufigsten Argumente, ist Teil des erfolgreichen amerikanischen Systems. Unfreiwillig ad absurdum führte diese Position allerdings der Präsident der American Bar Association, William Ransom, als er im September 1935 erklärte, wenn 10 Millionen Menschen arbeitslos und zwischen einem Viertel und einem Drittel der Bevölkerung für Essen, Unterkunft und Kleidung von der Bundesregierung abhängig seien, dann müsse man sich fragen, ob die Zeit günstig sei für „a deliberate and untrammeled expression of the will of the people, as to changing their Constitution“43. Dem Refrain der New Dealer, der Notstand verlange Experimente, hielten sie die Verfassung als Garant eines „orderly process of change" entgegen44. Ihre Parole war: „If this government . . . is not staunch enough to weather an economic depression, then it is no government at all." Die sich zuspitzende Krise Europas nutzten sie als Hintergrund, um ihre Mitbürger vor Abweichungen vom rechten amerikanischen Kurs zu warnen. Ihre Gegenwartsanalyse spielte sich im Rahmen einiger weniger krasser Alternativen ab: Freiheit durch Herrschaft der Gesetze oder Kommunismus — Diktatur — Anarchie45. Dem Notstandsdenken und der Desillusionierung über die Leistungsfähigkeit des Regierungssystems hielten sie glorifizierende historische Rückblicke entgegen, die das bestehende Regierungssystem als amerikanisch und die geforderten Experimente als europäisch, zu Armut und Chaos führend, identifizierten46. Das bewährte amerikanische System hatte in ihrer Sicht der Dinge nicht 1929 versagt, die New Dealer wollten es zerstören, indem sie die Machtverteilung in doppelter Weise veränderten: (1) Extensiver als je hatte der Kongreß die Handels-Klausel der Verfassung in Anspruch genommen und die „police power" der Einzelstaaten weitgehend an sich gerissen. Der Föderalismus war damit zu Ende47. (2) Die neuen Gesetze waren nur mit einer riesigen Admini© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Krise des amerikanischen Konstitutionalismus
203
stration durchzuführen und bedeuteten in vielen Fällen die Übertragung quasilegislativer Aufgaben an die Exekutive. Die übermächtige Bundesbürokratie bedrohte die Eigenständigkeit der Einzelstaaten und die Freiheit des einzelnen. „Ordered liberty and the supremacy of the people“ werde abgelöst durch „state supremacy“ 48 . Kurz, europäischer Totalitarismus bahnte sich an; Patriotismus gebot Ablehnung des gefährlichen New-Deal-Experiments. Die zugrunde liegende Gesellschaftstheorie dieser Juristen formulierte der Präsident der American Bar Association auch noch im September 1935 unerschüttert: If the Federal Government regulates and prescribes the wages, hours, and conditions of labor in all our communities, the Federal Government will thereby dictate and control the lives of our people, their standards of living, the extent of self-reliance to build character and citizenship. The America of the Constitution is not a charitable or correctional institution; its people should not be made dependents or treated as wards or defectives. Self-support and individual ambition are not yet in disrepute49.
VII Von Januar 1935 bis Mai 1936 verwarf das Oberste Gericht elf wichtige Gesetze, die der Kongreß zur Bewältigung der Auswirkungen der Depression erlassen hatte 50 . Die beiden 1934 positiv entschiedenen Fälle hatten, wie gesagt, Einzelstaatsgesetzen gegolten 51 . Im Januar 1935 erklärte der Supreme Court zum ersten Mal einen Teil eines New-Deal-Gesetzes des Bundes für verfassungswidrig. Der National Industrial Recovery Act hatte u. a. den Präsidenten bevollmächtigt, den Transport von Erdöl in Ölleitungen zu regulieren und seinen Verkauf zu kontingentieren. Zwei texanische Erdölgesellschaften klagten gegen die Kontingentierung. Der Kongreß habe in verfassungswidriger Weise der Exekutive legislative Aufgaben übertragen. Der Supreme Court gab den Klägern recht. Sektion 9c des Recovery Act überlasse dem Präsidenten so viel Entscheidungsspielraum, daß er praktisch die Aufgabe einer Legislative wahrnehmen müsse. Dies widerspreche dem Gewaltenteilungsprinzip 52 . Im gleichen Monat folgte im Fall der kranken Hühnchen die einstimmige Entscheidung gegen den zentralen Teil des Recovery Act 53 . Eine New Yorker Hühnerschlachterei hatte gegen die Anwendung der für diesen Erwerbszweig erlassenen ,fairen Wettbewerbsvorschriften' geklagt, weil (1) nur die Legislative solche Vorschriften erlassen dürfe und (2) die Schlachterei keinen zwischenstaatlichen (interstate) Handel treibe und daher keiner Bundesregelung unterliege. Die Verfügung der Recovery Administration gegen die Schlachterei hatte unter den Verstößen nicht nur den Verkauf kranker Hühner, sondern auch die Nichtbeachtung der Mindestlohn- und Höchstarbeitszeitbestimmungen aufgeführt. Das Gericht gab der Schlachterei recht. Da die Wettbewerbsvorschriften alle Betriebe einer Branche banden, waren sie in Wirklichkeit Gesetze. Sektion 3 des Recovery Act, die dem Präsidenten den Erlaß der von den Interessenvertretern einzelner Industriezweige und Administratoren vereinbarten Wettbewerbsvorschriften © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
204
Willi Paul Adams
übertrug, sei daher ebenfalls verfassungswidrig. Der Supreme Court sah auch die Merkmale des „Stromes oder Flusses zwischenstaatlichen Handels“ nicht erfüllt. Chief Justice Hughes schrieb in der Urteilsbegründung eine der wenigen Sentenzen unterkühlten Supreme Court Humors: „So far as the poultry here in question is concerned, the flow in interstate commerce had ceased. The poultry had come to a permanent rest within the state.“ Die Urteilsbegründung hatte sich nicht auf einen Faktor der Verfassungswidrigkeit beschränkt, sondern war so umfassend, daß das ganze NRA-Programm durch neue, präziser abgefaßte Gesetze neu bestätigt oder eingestellt werden mußte. Das NRA-Nachfolgegesetz, das im August 1935 für einen Teil des Kohlenbergbaus die Wettbewerbsund Arbeitsbedingungen wieder regelte, erklärte das Oberste Gericht 1936, jedoch nur mit 5:4 Stimmen, für ungültig. Es hatte wesentliche Regelungen des Recovery Act beibehalten und einem Nationalen Kohlenrat die Befugnis übertragen, die Produktion zu kontingentieren und Preise festzusetzen. Die Position der Gewerkschaften in Tarifverhandlungen war gestärkt und ein vom Präsidenten zu ernennender Schlichtungsausschuß vorgesehen worden. Um die Bergbaugesellschaften zur Befolgung zu bewegen, belegte das Gesetz den Verkauf von Kohle ab Bergwerk mit einer 15 %igen Steuer. Arbeitete die Gesellschaft nach den Vorschriften des Kohlenrates erhielt sie 90 % der Steuer zurück. Als ein Aktionär einer Bergwerksgesellschaft gegen die 15 %ige Verkaufssteuer klagte, gab der Supreme Court ihm im Mai 1936 recht. Das Gericht wiederholte die Argumente, die es gegen das Landwirtschaftsgesetz vorgebracht hatte: Wieder habe der Bundesgesetzgeber in den alleinigen Zuständigkeitsbereich der Einzelstaaten eingegriffen und versucht, lokales Wirtschaftsleben zu regulieren. Diese Bedrohung der föderalen Struktur sei auch nicht mit der allgemeinen Wohlfahrtsklausel zu rechtfertigen, auf die sich die Anwälte der Administration berufen hatten. Die Tennessee Valley Authority, das konkreteste Projekt umfassender regionaler Planung, Entwicklung und Kontrolle durch die Bundesregierung, billigte das Oberste Gericht 1936 mit einer Begründung, die die Frage der Verfassungsmäßigkeit dieses Experimentes nicht vollends klärte, sondern weitere Prozesse nach sich zog54. Das wichtigste Landwirtschaftsgesetz, den Agricultural Adjustment Act, erklärte das Gericht im Mai 1936 mit einem 6:3-Urteil ebenfalls für verfassungswidrig55. Das Gesetz hatte den „akuten wirtschaftlichen Notstand“ erklärt und den Secretary of Agriculture u. a. ermächtigt, den Nicht-Anbau von Baumwolle, Weizen, Reis, Mais und Tabak und die Einschränkung der Viehzucht zu vergüten. Den Verarbeitern der Landwirtschaftsprodukte wie Mühlen, Baumwollwebereien, Tabak- und Fleischfabriken hatte das Gesetz eine Verarbeitungssteuer auferlegt. Das Gericht entschied: (1) Die Regulierung der Landwirtschaft innerhalb eines Einzelstaates ist nicht Aufgabe des Bundes. (2) Die Verarbeitungssteuer ist integraler Bestandteil eines Gesetzes, dessen Hauptziel die Regulierung der Landwirtschaft auch innerhalb von Einzelstaaten ist. Ergo: Die Steuer darf nicht eingezogen werden. Die Wohlfahrtsklausel der Verfassung, die den Kongreß ermächtigt, Steuern zu erheben, „to © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Krise des amerikanischen Konstitutionalismus
205
provide for the general welfare“, ließ das Gericht nicht als Rechtsgrundlage gelten: „It is an established principle that the attainment of a prohibited end may not be accomplished under the pretext of the exertion of powers which are granted.“ Das Gericht erinnerte seine Kritiker daran, daß die amerikanische Union eine „dual form of government“ sei und daß der Zuständigkeitsbereich der Einzelstaaten vor Übergriffen des Bundes bewahrt bleiben müsse. Die drei „Liberalen“ dagegen sahen die Verarbeitungssteuer eindeutig durch die Wohlfahrtsklausel gedeckt. Richter Stone schrieb ein beißendes Minderheitenvotum, das in der Feststellung gipfelte, die Gerichte seien nicht das einzige Organ der Regierungsgewalt, von dem angenommen werden müsse, daß es die Fähigkeit besitze, zu regieren. Die verfassungswidrige Ausübung der Macht durch den exekutiven und legislativen Teil der Regierung, schrieb Stone, sei der Kontrolle durch die Richter unterworfen; die einzige Beschränkung der Machtausübung des Obersten Gerichts aber sei die Selbstbeschränkung der Richter. Der Grundsatz der Selbstbeschränkung (self-restraint) bei der Beurteilung von Gesetzen, die das Verhältnis von Wirtschaft und Regierungsgewalt betrafen, wurde erst 1937 zur Mehrheitsmeinung. Zuvor sollte es zum direkten Eklat zwischen Präsident und Supreme Court kommen. VIII Im November 1936 stellte sich Roosevelt zur Wiederwahl. Die Republikaner verwiesen im Wahlkampf auf die Urteile des Obersten Gerichts und griffen den New Deal als Untergrabung der verfassungsmäßigen Ordnung an. Die Wahl wurde zu einem überwältigenden Referendum für Roosevelt. Er erhielt 27,7 Millionen Stimmen, der Republikaner Landon 16,6 Millionen, die übrigen fünf Kandidaten zusammen 1,2 Millionen. Von allen Staaten, außer Maine und Vermont, erhielt Roosevelt die Wahlmännerstimmen 56 . Im Bewußtsein dieses in der amerikanischen Geschichte einmaligen Wählermandats beschloß Roosevelt ohne Konsultation des Kabinetts und der führenden Politiker seiner Partei in Repräsentantenhaus und Senat, eine radikale Maßnahme gegen das Oberste Gericht einzuleiten. Statt die bereits zirkulierende Idee einer die Normenkontrollkompetenz des Gerichts einschränkenden Verfassungsänderung aufzugreifen — er hatte sich ausgerechnet, daß deren Ratifizierung im besten Fall bis 1942 dauern würde — unterbreitete er dem Kongreß am 5. Februar 1937 den Entwurf eines Gesetzes zu Reformen in der Bundesjustiz. Das Gesetz hätte dem Präsidenten unter anderem erlaubt, für jeden Richter über 70 Jahren, der nicht zurücktrat, einen zusätzlichen Richter zu nominieren, bis das Oberste Gericht 15 Richter umfaßte. Die Befugnis des „judicial review“ ließ der Vorschlag unangetastet. In der begleitenden Botschaft begründete Roosevelt den Entwurf nicht mit den Urteilen von 1935 und 1936, sondern mit angeblicher Ineffizienz der Gerichte57. Die Anzahl der Supreme-Court-Richter war in der Vergangenheit mehrfach vom Kongreß geändert worden. Als sich nach dem Bürgerkrieg abzeichnete, daß das Oberste © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
206
Willi Paul Adams
Gericht einige der Reconstmction-Gesetze für verfassungswidrig erklären und Präsident Johnsons gemäßigte Politik gegenüber den besiegten Südstaaten auf diese Weise unterstützen könnte, hatte der von den Radical Republicans beherrschte Kongreß durch Gesetz zweimal die Größe des Gerichts und damit die Mehrheitsverhältnisse manipuliert58. Die politische Konstellation von 1937 aber war anders. Im Kongreß fand sich keine entsprechend entschlossene, mit dem Supreme Court unzufriedene Mehrheit. Im Gegenteil, Roosevelts publizistisch nicht vorbereiteter Gesetzesvorschlag war ein zusätzlicher Anlaß für die Spaltung der Demokratischen Partei und für die Stärkung der sich aus Flügeln beider Parteien formierenden Conservative Coalition59. Roosevelts unehrliche Begründung des Gesetzentwurfs rächte sich. Die öffentliche Debatte spielte sich weithin in den reduzierten Kategorien von „für Roosevelt“ und „für die Verfassung“ ab. Einige Verteidiger des Vorschlags erinnerten an die Rolle des Zensors, die der Supreme Court gegenüber den New Deal Gesetzen spielte. Sie hielten auch im Frühjahr 1937 die „Blockade“ durch die vier Konservativen mit einem von Fall zu Fall wechselnden Bundesgenossen noch nicht für beendet60. Sie argumentierten, daß das Gericht selbst das föderale System untergrabe, weil es den Einzelstaatslegislativen untersage, örtlichen Krisen mit angemessenen Mitteln zu begegnen61. Eine Verfassungsänderung solle ein Referendum vorsehen, das ein Supreme Court Veto aufheben könne.62 Thurman Arnold, inzwischen Assistant to the Attorney General, verteidigte den Gesetzesentwurf als „konservatives Mittel“ zur Behebung eines akuten Problems. Der Standesorganisation warf Arnold „moralischen Mystizismus“ und Flucht hinter Symbole vor: Organizations like the American Bar Association are necessarily as dependent on slogans, symbols and ceremony as colleges, or churches, or Rotary clubs. The Supreme Court of the United States has always occupied the central place on the high altar of the American Bar. It is obviously as impossible to expect them to be objective and realistic about it as for communists to be realistic about Karl Marx63. Aber die Verteidiger des unaufgeklärten Konstitutionalismus64 hatten leichtes Spiel. Roosevelts Vorschlag hatte unter anderem die verfassungsmäßige Manipulierbarkeit der Meinung des Hüters der Verfassung offensichtlich gemacht. Vor dieser Einsicht scheute die gleiche Mittelklassenmehrheit zurück, die ihm im November 1936 ihr Vertrauen ausgesprochen hatte. Sie wollte sich trotz allem nicht den Glauben an ein über der Politik stehendes, unabhängiges Organ der Gerechtigkeit rauben lassen. Zu der verbreiteten Furcht vor dem Ende der Achtung von Gesetz und Ordnung hatte auch die erfolgreiche neue SitzstreikTaktik des CIO beigetragen65. Eine Meinungsumfrage im April 1936 und Juli 1937 zeigte ein klares Ergebnis. Von den alternativen Aussagen „The Supreme Court has recently 1. protected the people against rash legislation — 2. stood in the way of the people's will“, erhielt die erste die Billigung von 39 % (Juli 1937: 43 %) der Befragten und die zweite 22 % (Juli 1937: 23 % ) 6 6 . Ein betont überparteiliches National Committee to Uphold Constitutional © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Krise des amerikanischen Konstitutionalismus
207
Government wurde gegründet. Es verschickte Tonnen von Literatur. Die größte Berufsgruppe auf seiner Adressenliste waren die 161 000 Juristen. Von Douglas Johnsons Pamphlet „The Assault on the Supreme Court“ verteilte das Komitee eine Viertelmillion Exemplare. In einer Radioansprache, die die Organisation vermittelte, hieß es, Roosevelts Vorschlag sei „a surrender to impulses all too much like the action of Hitler in packing the courts of the German Reich.“67 Die American Bar Association entfaltete ebenfalls alle publizistische Aktivität, zu der sie fähig war. Sie setzte einen Ausschuß ein, der ein ablehnendes Memorandum für die Anhörung des Judiciary Committee des Senats am 15. April 1937 vorbereitete68. Sie verschickte einen Fragebogen an ihre 29 616 Mitglieder, der den Gesetzesentwurf in sechs Einzelvorschlage aufteilte. 19 136 gültige Stimmzettel kamen zurück. Ober 16 000 lehnten die Vermehrung der Sitze des Supreme Court ab. Für andere Reformen fanden sich Mehrheiten69. Der Präsident der ABA, Frederick H. Stinchfield, stellte zwei Regierungsformen einander als unvereinbar gegenüber, die „konstitutionelle“ und die unkontrolliert „legislative“. Wenn Roosevelts Vorlage Gesetz werde, warnte er, sei die amerikanische konstitutionelle und föderale Regierungsform zu Ende und 130 Millionen Menschen würden in Zukunft von einer unkontrollierbaren Bürokratie in Washington regiert70. Die National Lawyers Guild jedoch, die 1936 von einer kleinen, mit der Verbandspolitik der ABA unzufriedenen Gruppe von Juristen gebildet worden war, sprach sich auf ihrer ersten Jahrestagung Ende Februar 1937 in Washington für das Gesetz aus. In der Satzung der Guild hieß es, daß die „Wahrung und Erweiterung der Rechte der Arbeiter und Farmer“ wichtiger sei als das Festhalten an Präzedenzfällen71. Der politische Kern von Roosevelts Vorschlag fand bereits in dem vorbereitenden Ausschuß des Senats keine Zustimmung. Zu einer Schlußabstimmung ist es weder in Senat noch Repräsentantenhaus gekommen. Der Präsident erlitt eine der spektakulärsten politischen Niederlagen seiner Amtszeit. Im August 1937 verabschiedete der Kongreß ein politisch harmloses Justizreformgesetz72.
IX Schon vor Roosevelts Gesetzesvorschlag hatte sich im Supreme Court eine 5:4-Mehrheit für die erste große Pro-New-Deal-Entscheidung gefunden. Da sich die Bekanntgabe des Urteils bis Ende März 1937 hinzog, mußte es in der Öffentlichkeit jedoch unweigerlich zu einer falschen Kausalverknüpfung kommen. Dem für die Entscheidung ausschlaggebenden Richter Roberts wurde vorgeworfen, er habe seine Verfassungsinterpretation in der Mindestlohnfrage innerhalb von neun Monaten umgekehrt73. Die Entscheidung war aber bereits im Dezember 1936 gefallen, und Roberts hatte sich vor allem durch eine Verfahrensfrage daran gehindert gesehen, schon im Tipaldo-Fall seiner Meinung Ausdruck zu geben und den Präzedenzfall von 1923 außer Kraft zu setzen74. Im Parrish-Fall vom März 1937 war die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes des Staates Washington zu beurteilen, das einen Ausschuß dieser Einzelstaats© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
208
Willi Paul Adams
regierung bevollmächtigte, den Mindestlohn für Frauenarbeit festzusetzen 75 . Der Kläger, ein Hotelbesitzer, der einem Zimmermädchen den Mindestlohn von 14,50 Dollar für die 48-Stunden-Woche nicht zahlen wollte, berief sich auf die Garantie des „due process of law“ und auf den Präzedenzfall von 1923; das Mindestlohngesetz beraube ihn seiner Vertragsfreiheit ohne ordentliches Gerichtsverfahren. Das Gericht verwarf die Entscheidung von 1923. Auch unter Verweis auf „die wirtschaftlichen Verhältnisse, die seither eingetreten sind“ erklärte es, die Vertragsfreiheit sei keine absolute Freiheit: The liberty safeguarded is liberty in a social organization which requires the protection of law against the evils which menace the health, safety, morals and welfare of the people. Liberty under the Constitution is thus necessarily subject to the restraints of due process, and regulation which is reasonable in relation to its subject and is adopted in the interests of the community is due process. Getragen wurde diese Entscheidung von den drei „Liberalen“ und den beiden Unabhängigen. Die gleiche Mehrheit billigte im folgenden Monat mit einer weiten Interpretation der Kompetenz des Bundes, den zwischenstaatlichen Handel zu regeln, den National Labor Relations Act, der inzwischen an die Stelle des für verfassungswidrig erklärten NIRA getreten war 76 . Auch das Sozialversicherungsgesetz von 1935 fand im Mai 1937 die Billigung dieser fünf Richter 77 . In zusätzlichen Urteilen bauten sie die neue, inzwischen „liberal nationalism“ und „new federalism“ genannte Interpretation des Verhältnisses von Regierungsgewalt und Wirtschaft einerseits und Bund und Einzelstaaten andererseits aus 78 . Sie bejahten im wesentlichen zwei Neuerungen. (1) Die Machtverteilung zwischen Bund und Einzelstaaten hatte sich zugunsten des Bundes verschoben. Der Bund erhielt unter der Handelsklausel die Kompetenz, auch scheinbar lokale Angelegenheiten wie Tariffragen und Vorschriften für die Landwirtschaft zu erlassen 79 . (2) Der Anspruch auf ein ordentliches Gerichtsverfahren (den „due process of law“) entrückt die Verfügung über Eigentum und die Vertragsfreiheit nicht jedem Eingriff des Bundes, den die Verfassung beauftragt hat, „to provide for the general welfare“ — und auch nicht dem Zugriff eines Einzelstaates, der sich auf seine umfassende „police power“ berufen kann. Das öffentliche Interesse ist im Konfliktfall das höherrangige Rechtsgut. Roosevelt erhielt nun auch, ohne gesetzlichen Eingriff, die langerwartete Möglichkeit, neue Richter zu nominieren. Van Devanter trat im Mai 1937 im Alter von 78 Jahren zurück; Sutherland folgte ihm im Januar 1938 im Alter von 75. Cardozo starb im Juli 1938, Brandeis ließ sich im Februar 1939 pensionieren, Butler starb im November 1939. Zwischen Oktober 1937 und Februar 1940 ernannte Roosevelt Hugo L. Black, Stanley Reed, Felix Frankfurter, William O. Douglas und Frank Murphy. Die Epoche des „Roosevelt Court“ hatte begonnen. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Krise des amerikanischen Konstitutionalismus
209
X Die Konfrontation der Mehrheitsmeinung des Supreme Court mit der Legislative und Exekutive des Bundes und einigen zugunsten des New Deal urteilenden untergeordneten Gerichten zwischen 1933 und 1937 war keine unvorhergesehene, allein durch die Wirtschaftskrise plötzlich herbeigeführte Konstellation. Sie war lediglich die dramatische Zuspitzung eines seit Jahrzehnten offenbaren und kommentierten Interessenkonflikts zwischen an privatem Profit orientierter Wirtschaft und der Notwendigkeit öffentlicher Kontrolle. In diesem Konflikt war der mögliche Mißbrauch der Grundsätze des amerikanischen Konstitutionalismus, des Legalitätsprinzips, des Prinzips der gegenseitigen Gewaltenkontrolle und des Grundgedankens limitierter Herrschaft selbst offensichtlich geworden. Das Legalitätsprinzip war zur formelhaften Anwendung von Verfassungsrechtsdogmen erstarrt. Die Garantie des ordentlichen Gerichtsverfahrens war vom Rechtsschutz zum Schutz vor Recht pervertiert. Eine rigide verstandene Gewaltenteilung zwischen den Organen des Bundes hatte den Kongreß daran gehindert, fallbezogene Entscheidungen zur Überwindung akuter Mißstände der Bürokratie zu übertragen. Die eng interpretierte Gewaltenteilung zwischen Bund und Einzelstaaten hatte Bund und Einzelstaaten gelähmt. Der Grundgedanke limitierter Herrschaft selbst, die nur ein Mittel rationaler Selbstbestimmung sein kann, war zu einem Zweck an sich erklärt worden. Die Wende von 1937 korrigierte diese Fehlentwicklung. Sie markierte den endgültigen Abschied von dem Selbstverständnis des Obersten Gerichts als außerhalb des politischen Prozesses stehender Hüter einer vorgegebenen Verfassungsordnung. Die Frage nach der Rolle der rechtsprechenden Gewalt angesichts der Probleme der amerikanischen Gesellschaft stellte sich dem Gericht jedoch immer wieder neu. Es stand zum Beispiel sofort vor der Aufgabe zu entscheiden, ob der Grundsatz der Selbstbeschränkung der Richter in Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik, das Gewährenlassen von Kongreß und Präsident, auch das Verhalten der Richter in Fällen von Meinungsfreiheit bestimmen sollte. Mußte das Gericht nicht eine aktive Rolle übernehmen, wenn die Freiheiten des 1. Amendment durch Gesetz eingeschränkt wurden? Die verfassungsrechtliche Bejahung neuer Kompetenzen der Exekutive und Legislative zog die Notwendigkeit richterlichen Schutzes vor dem Mißbrauch der neuen Machtbefugnisse, etwa in Form eines ausgeprägten „administrative law“, nach sich. Das juristische Umdenken hatte an der Spitze der Rechtswissenschaft und der Rechtsprechung begonnen. Die ,soziologische' und die ,realistische' Jurisprudenz hatten endgültig mit der Fiktion gebrochen, daß Recht eine zugleich normative und exakte Wissenschaft sei. Der Supreme Court setzte neue Normen. Die gesamte Rechtsprechung war aber dennoch zu einem erheblichen Teil von den Ordnungsvorstellungen des ganzen Standes der Juristen beeinflußt. Und ein positives Verhältnis der durchschnittlichen Juristen zur Rechtsprechung als 14 Winkler, Krise © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
210
Willi Paul Adams
Instrument sozialen Wandels mußte sich erst noch entwickeln. Robert H. Jackson hatte es 1935 völlig negativ beurteilt: The effort of the law to extend its function and to reduce the area of economic or social anarchy and lawless irresponsibility has always met the opposition of the average lawyer. He has never adapted himself to the administrative method. In spite of abstract reverence for law and order he fears extension of the field of law. He thinks of his Constitution, not as a source of power to advance the general welfare, but only as a document of limitation80. Das langfristig wahrscheinlich wichtigste Resultat der Konfrontation der rechtsprechenden Gewalt und des New Deal bestand darin, daß sie die Besinnung auf die Funktion der rechtsprechenden Gewalt dringlicher als je zuvor erscheinen ließ und die Debatte über den Kreis der Experten hinaus in eine breitere Öffentlichkeit trug.
Anmerkungen Dem Artikel liegt ein Habilitationsvortrag vor dem Fachbereich Geschichtswissenschaften der Freien Universität Berlin 2ugrunde. Den Kritikern des Vortrages, insbesondere Gerald Stourzh, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Wien, danke ich für ihre Anregungen. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Charles Warren Center for Studies in American History der Harvard Universität verdanke ich einen Forschungsaufenthalt in Cambridge, der u. a. die Überarbeitung des Vortrages möglich gemacht hat. 1 Zur Rolle der Rechtsprechung in der amerikanischen Gesellschaft J . W. Hurst, Law and Social Process in United States History, Ann Arbor 1960. Allgemein: J . Stone, Social Dimensions of Law and Justice, Stanford 1966, u. W. Friedmann, Law in a Changing Society, London 19722, dt. 1969. 2 Zur Ausbildung der im Verfassungstext nicht geregelten Kompetenz des „judicial review“: Ch. G. Haines, The American Doctrine of Judicial Supremacy, New York 19592; E. Wolf, Verfassungsgerichtsbarkeit und Verfassungstreue in den Vereinigten Staaten: Eine Untersuchung über die Entwicklung des amerikanischen Verfassungsrechts auf Grund der rechtlichen Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der Bundesgesetze, Basel 1961; und mit umfassender Bibliographie R. Berger, Congress versus the Supreme Court, Cambridge/Mass. 1969. 3 L. Β. Boudin, Government by Judiciary, I , New York 1932, I V—V; I I , 514. 4 Commonwealth Club Speech, 23. Sept. 1932. S. I . Rosenman Hg., The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt, I , New York 1938, 752. 44 Frank Freidel, Franklin D. Roosevelt: The Depression Crisis, angekündigt für Sept. 1973, Kap. 13. 5 H. Johnson, The Blue Eagle from Egg to Earth, New York 1935, 168. Zum ersten Schub von New Deal Gesetzen Α. Μ. Schlesinger, The Age of Roosevelt, I I (The Coming of the New Deal), Boston 1958, Kap. 1—3. 6 Siehe hierzu die Beiträge von E. W. Hawley und Η. Α. Winkler in diesem Band. 7 Pollock v. Farmers' Loan and Trust Co., 157 US 429 und 158 US 601 (1895). 8 Lochner v. New York, 198 US 45 (1905), 9 Hammer v. Dagenhart, 247 US 251 (1918). 10 Adkins v. Children's Hospital, 261 US 525 (1923). Überblicke in Α. Η. Kelly
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Krise des amerikanischen Konstitutionalismus
211
u. W. A. Harbison, The American Constitution: I ts Origins and Development, New York 19704, Kap. 19—26; A. S. Miller, The Supreme Court and American Capitalism, New York 1968; W. F. Swindler, Court and Constitution in the Twentieth Century, I (The Old Legality 1889—1932), I ndianapolis 1968; I I (The New Legality 1932 to 1968), I ndianapolis 1970; P. L. Murphy, The Constitution in Crisis Times 1918—1969, New York 1972. 11 S. Rudy, The Recovery Program Comes into Court, California Law Rev. 23. 1935, 193—204. Auch L. M. Alpert, Suits against Administrative Agencies under NIRA and AAA, New York Univ. Law Quart. Rev. 12. 1935, 393—438 und, ohne Verfasserangabe, The I mpact of the Courts upon the NRA Program: Judicial Administration of the NI RA, Yale Law T. 44. 1934, 90—109. 12 Home Building and Loan Association v. Blaisdell, 290 US 398 (1934). 13 290 US 452—453. 14 Nebbia v. New York, 291 US 523 (1934). Die Entscheidung verwarf die enge Auslegung der Bestimmung von Handel und I ndustrie als „affected with a public interest“, die sich nach Munn v. I llinois, 94 US 113 (1877) entwickelt hatte. Zur Dog mengeschichte, mit umfassenden Literaturangaben: H. N. Scheiber, The Road to Munn: Eminent Domain and the Concept of Public Purpose in the State Courts, Perspectives in Am. Hist. 5. 1971, 327—402. — Perry v. US, 294 US 330 (1935); US v. Bankers Trust Co., 294 US 240 (1935) Norman v. Baltimore and Ohio Railroad Co., 294 US 240 (1935) und Nortz v. US, 294 US 317 (1935). 15 Siehe die Artikel von G. Schubert, W. F. Murphy u. J . R. Schmidhauser, I nter national Encyclopedia of the Social Sciences 8. 1968, 307—324. 18 Η. C. Pritchett, The Roosevelt Court: Α Study in Judicial Politics and Values 1937—1947, New York 1948, behandelt auch die fünf Sitzungsperioden vor 1937. 17 G. Α. Schubert, Quantitative Analysis of Judicial Behavior, Glencoe/I ll. 1959; J . R. Schmidhauser, The Supreme Court: I ts Politics, Personalities and Procedures, New York 1960; auch die Forschungsberichte in J . B. Grossman und J . Tanenhaus Hg., Frontiers of Judicial Research, New York 1969. 18 Hughes veröffentlichte zudem 1928 The Supreme Court of the United States, Its Foundation, Methods and Achievements: an Interpretation. Biographien: S. Hendel, Charles Evans Hughes and the Supreme Court, New York 1951, u. M. Pusey, Charles Evans Hughes, 2 Bde., New York 1951. 19 Die Angaben entstammen F. L. Israel u. L. Friedman Hg., The Justices of the United States Supreme Court, 1789—1969. 4 Bde., New York 1969, Weitere Biographien: Α. Τ. Mason, Brandeis: A Free Man's Life, New York 1956; D. J . Danelski, A Supreme Court Justice I s Appointed [über Pierce Butler], New York 1964; Β. Η. Levy, Cardozo and Frontiers of Legal Thinking, Cleveland 1969; St. T. Early, James C. McReynolds and the Judicial Process, phil. Diss. University of Virginia, Charlottes ville 1954, MS; F. Frankfurter, Mr. Justice Roberts, Univ. of Pennsylvania Law Rev. 104. 1955, 311—317, und die übrigen Beiträge in dieser Gedenknummer; Α. Τ. Mason, Harlan Fiske Stone: Pillar of the Law, New York 1956; J . F. Paschal, Mr. Justice Sutherland: A Man against the State, Princeton 1951. 20 A. T. Mason, William Howard Taft, Chief Justice, New York 1965, 228. 21 R. Stevens, Two Cheers for 1870: The American Law School, Perspectives in Am. Hist. 5. 1971, 403—548. Auch Ε. L. Brown, Lawyers, Law Schools, and the Public Service, New York 1948. Den Überblick von A. J . Harno, Legal Education in the United States, San Francisco 1953, wertet R. Stevens, Professor an der Yale Law School: „This was part of the American Bar Association Survey of the Legal Profession, and suffers from almost the same degree of complacency which many of the volumes of that study exhibit.“ Stevens, 406. 22 Swan zit. nach Stevens, 271; Stone zit. nach Stevens, 472. Zu „sociological jurisprudence“ und „legal realism“ M. White, Social Thought in America: The Revolt 14*
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
212
Willi Paul Adams
against Formalism, Boston 1947; W. E. Rumble Jr., American Legal Realism: Skepticism, Reform, and the Judicial Process, Ithaca 1968; E. A. Purcell Jr., American Jurisprudence between the Wars: Legal Realism and the Crisis of Democratic Theory, AHR 75. 1969, 424—446. Dort (433—434) zu Pounds Warnungen vor dem Normenrelativismus in den 1930er Jahren. 23 Purcell, 436, 438—440; Stevens, 487. 24 Ch. A. Beard, The Supreme Court and the Constitution, New York 1912; ders., An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, New York 1913; E. S. Corwin, The Doctrine of Judicial Review. Its Legal and Historical Basis and other Essays, Princeton 1914; J . R. Commons, Legal Foundations of Capitalism, Madison 1924. 25 F. K. Beutel, Some Implications of Experimental Jurisprudence, Harv. Law Rev. 48. 1934, 169—197; Zitate 193, 197. 28 R. Pound, A Comparison of Ideals of Law, Harv. Law Rev. 47. 1933, 17. 27 M. Lerner, The Supreme Court and American Capitalism, Yale Law J . 42. 1933, 668—701; Zitat 671—672, Paraphrase 672—673. 28 M. P. Sharp, Movement in Supreme Court Adjudication: A Study of Modified and Overruled Decisions, Harv. Law Rev. 46. 1933, 361—403, 593—637, 795—811. Der Artikel schloß in beschwörendem Ton mit dem Zitat aus einer Urteilsbegründung von Brandeis: „The Court bows to the lessons of experience and the force of better reasoning, recognizing that the process of trial and error, so fruitful in the physical sciences, is appropriate also in the judicial function.“ Burnet v. Coronado Oil & Gas Co., 285 US 407—408 (1932). 29 Rede am 14. Mai. Ausführlicher Bericht im Boston Globe, 15. Mai 1933: auch in Roosevelt and Frankfurter: Their Correspondence 1928—1945, annotated by M, Freedman, Boston 1967, 132—133. 30 Ch. E. Clark, Legal Aspects of Legislation Underlying [the] National Recovery Program, American Bar Association Journal (ABAJ) 20. 1934, 272: Referat vor dem Handelsausschuß der ABA am 11. April 1934. 31 Ob Podell eine echte Selbstinterpretation lieferte, oder plädierte, um die Juristen zu gewinnen, läßt sich schwer entscheiden. Er fuhr fort: „Something was necessary, first to strike at the major disease that afflicted this country, this business of having millions of people unemployed, and the only way that that could be effectively worked out . . . was to revitalize the legitimate labor organization, to give it power, to give it life, to give it strength. . . . And so there was this one labor policy incorporated in the Act; to wit the American idea of collective bargaining through freely chosen representatives of a legitimate labor organization. . . . When you fortify a conservative, responsible labor organization, you thereby deal a blow to the illegitimate, irresponsible kind.“ D. L. Podell, Essential Factors in Determining the Constitutionality of the Recovery Act, ABAJ 20. 1934, 282. 32 Podell, 282. 33 Die gleiche Forderung erhob R. Η. Jackson, The Bar and the New Deal, ABAJ 21. 1935, 95. Henry Hart beklagte noch 1940 die Unbeholfenheit des Supreme Court angesichts der Zusammenarbeit von Gerichten mit den „agencies“ der Exekutive, die z. B. beim Verstoß gegen Wettbewerbsbestimmungen Sanktionen verhängen. Der mangelnden Fähigkeit, dieses neue Problem zu lösen, liege ein „steriles“ Konzept der Gewaltenteilung zugrunde. Hart, The Business of the Supreme Court at October Terms 1937 and 1938, Harv. Law Rev. 53. 1939—1940, 616—617. Für ein „administrative law“, das nicht mehr vom engen Fall-Begriff des Common Law ausgeht: Th. W. Arnold, Trial by Combat and the New Deal, Harv. Law Rev. 47. 1934, 913—947. Kritischer Bericht über die Diskussion in der Anwaltschaft: L. L. Jaffe, Invective and Investigation in Administrative Law, Harv. Law Rev. 52. 1939, 1201—1245. 34 Jackson, Bar, 94. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Krise des amerikanischen Konstitutionalismus
213
Jackson, Bar, 96. Einige Beispiele: Der Secretary des Department of Commerce, Daniel C. Roper, hielt eine Rede vor der Florida State Bar Association über The Lawyer's Relation to the New Deal, Florida Law J . , 9. 1935, 309—312. Attorney General Homer S. Cummings sprach vor der Bar Association von New York City über The American Constitutional Method, ABAJ 22. 1936, 24—28. Solicitor General Stanley Reed, ab 1938 selbst Richter am Supreme Court, sprach vor dem Institute of Public Affairs der University of Virginia über The Constitution of the United States, ABAJ 22. 1936, 601—608. Fletcher Riley, Richter am Supreme Court von Oklahoma, sprach im Dezember 1935 vor der Nebraska State Bar Association über Judicial Liberalism, Nebraska Law Bulletin 15. 1936, 96—109. 37 Die karge Literatur über die Bar Associations ist der politischen Bedeutung des Gegenstandes keineswegs angemessen. Bibliographie: N. C. Brockman, The History of the American Bar Association: Α Bibliographic Essay, Am. J . of Legal Hist. 6. 1962, 269—285. Darstellungen: J . Grafton Rogers, The American Bar Association in Retro spect, New York 1937; A. A. Brooks, Jr., The American Bar Association and Social Issues 1925—1937, Duke Bar Association J . 5. 1937, 80—84; zuviel im Titel ver sprechen M. L. Rutherford, The I nfluence of the American Bar Association on Public Opinion and Legislation, Philadelphia 1937, u. E. R. Sunderland, History of the American Bar Association and I ts Work, o. O. 1953. Einzelstudie: G. Martin, Causes and Conflicts: The Centennial History of the Association of the Bar of the City of New York 1870—1970, New York 1970. 38 Brockman, 276—277. 39 ABAJ 21. 1935, 472. 40 Editorial des ABAJ 23. 1937, 615. Typisch für das moralisierende Verständnis der Aufgabe des Juristen ist die Aussage: „The substance of impartial justice, the essence of free government in reality, the enduring ministry of law to human happiness and security, the vouchsafing of justice and fair play to poor and rich . . . for the attainment of these vital things the organized Bar should renew and re-double its efforts, as they are peculiarly a responsibility of the lawyers of America.“ Ebd. 41 So z. B. die Rede des Präsidenten der ABA, Scott Μ. Loftin, vor der Jahres versammlung der ABA am 16. Juli 1935 u. d. T. I ndependence of the Judiciary, ABAJ 21. 1935, 469—473. 42 Das Committee on American Citizenship der ABA beschloß am 17. Nov. 1933 An Appeal to the American Bar, in dem sich die Ablehnung des New Deal deutlich abzeichnete. Text in: ABAJ 20. 1934. 15—17. Dort auch die Zitate. 43 W. L. Ransom, What Constitution Are You Talking About?, Indiana Law J . 11. 1935, 20. Rede vor der Indiana Bar Association am 7. Sept. 1935. Entgegnung auf die Ansprache Hugh Johnsons am Vorabend u. d. T. What Constitution Are We Talking About?, ebd., 1—14. 44 Ransom, 20—21: S. H. Strawn, Congress and the Courts, Indiana Law J . 11. 1936, 478. 45 Committee on American Citizenship der ABA, Appeal, 15. 46 Strawn, 478; voll historisierenden Pathos': Ransom, 15—18. 47 F. H. Wood, Some Constitutional Aspects of the Recovery Program, ABAJ 20. 1934, 318; Referat vor dem Handelsausschuß der ABA am 11. April 1934. Ebenso Ransom, 20—21 und Η. Η. Smith, Anwalt der Michigan Manufacturers Association, in dem Referat The National I ndustrial Recovery Act: I s I t Constitutional?, ABAJ 20. 1934, 273—280. 48 Ν. L. Miller, ein früherer Gouverneur von New York, vor der Jahrestagung der ABA in Milwaukee, The Constitution and Modern Trends, ABAJ 20. 1934, 623. 49 Ransom, 21. Zur weiteren Diskussion des New Deal und der rechtsprechenden 35
36
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
—
214
Willi Paul Adams
Gewalt in den Law Reviews und Bar Journals zwischen Oktober 1934 und Juli 1937 siehe Index to Legal Periodicals, 4. 1938, 31—32, 360—374. 50 Pritchett, Roosevelt Court, 74. 51 Siehe oben 192 f. 52 Panama Refining Co. v. Ryan, 293 US 388 (1935). 53 Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 US 495 (1935). 54 Bituminous Coal Conservation Act, meist Guffey Coal Act genannt. Entscheidung im Fall Carter v. Carter Coal Co., 298 US 238 (1936). Mit der Feststellung, „production is a purely local activity“ bedrohte das Urteil implizit die Verfassungsmäßigkeit der Regelung von Tarifverhandlungen durch Bundes-Codes. Zum Problem der Tarifverhandlungen Calvert Magruder, A Half Century of Legal Influence upon the Development of Collective Bargaining, Harv. Law Rev. 50. 1936—1937, 1071 bis 1117. Auch Ε. Fraenkel, Das richterliche Prüfungsrecht in den Vereinigten Staaten von Amerika unter besonderer Berücksichtigung des Arbeitsrechts, Jb. des öffentl. Rechts der Gegenwart, N. F. 2. 1953, 35—105; E. Lieberman, Unions before the Bar: Historic Trials Showing the Evolution of Labor Rights in the United States, New York 19602; Ch. O. Gregory, Labor and the Law, New York 1961 2 : R. C. Cortner, The Wagner Act Cases, Knoxville 1964. — Ashwander v. TVA, 297 US 288 (1936); W. E. Leuditenburg, The Constitutional Revolution of 1937, in: Victor Hoar, Hg., The Great Depression; Essays and Memoirs from Canada and the United States, Vancouver 1969, 35. 55 U. S. v. Butler, 297 US 1 (1936). 59 A. M. Schlesinger, The Age of Roosevelt, III: The Politics of Upheaval, Boston 1960, 499—644. 57 Text des Gesetzentwurfs und der Begleitbotschaft in: H. St. Commager Hg., Documents of American History, New York 19637, II, 382—387. Zur Supreme Court Kontroverse R. H. Jackson, The Struggle for Judicial Supremacy: A Study of a Crisis in American Power Politics, New York 1941, Kap. 5—8; J . MacGregor Burns, Roosevelt: The Lion and the Fox, New York 1956, Kap. 15; Ereignisgeschichte: L. Baker, Back to Back: The Duel Between F. D. R. and the Supreme Court, New York 1957; Analyse: W. E. Leuchtenburg, The Origins of Franklin D. Roosevelt's ,Court Packing' Plan, Supreme Court Rev. (keine Bandzählung), 1966, 347—400, ders., Franklin D, Roosevelt's ,Court Packing' Plan, in: W. H. Droze u. a. Hg., Essays on the New Deal, Austin 1969, 69—115. 58 Als einer der damals 10 Richter starb und Johnson seine erste Gelegenheit zur Nominierung eines Richters erhielt, verringerte der Kongreß die Anzahl der Sitze vorsorglich auf 8. Als 1867 dennoch ein Musterprozeß gegen den Willen der Radical Republicans auszugehen drohte, entzog der Kongreß dem Supreme Court während des Verfahrens, im März 1868, die Jurisdiktion über die Kategorie von Fällen, zu denen Ex Parte McCardle, 7 Wallace 506 (1869) gehörte. Präsident Johnson konnte das Gesetz durch sein Veto nur kurze Zeit aufhalten. Nach Präsident Grants Amtsantritt 1869 erhöhte der Kongreß die Richterzahl auf 9. Die neue Mehrheit verwarf 1871 mit 5:4 Stimmen das im Vorjahr gesprochene Urteil gegen das Papiergeldgesetz von 1862 und sicherte diesen Teil der Reconstruction-Politik der Republicans auch verfassungsrechtlich. Kelly & Harbison, 478—486. 59 Burns, Kap. 14—16; W. E. Leuchtenburg, Franklin D. Roosevelt and the New Deal, New York 1963, Kap. 10; J . T. Patterson, Congressional Conservatism and the New Deal, Lexington 1967. 60 C. S. Collier, Professor of Law an der George Washington University in Washington, D. C , The Constitutional Crisis — The Case for a Synthetic Solution, ABAJ 23. 1937, 358—363. 61 So der Senator von Rhode Island, Theodore Francis Green, in The Supreme Court and the President's Proposal, ABAJ 23. 1937, 420—424; Osmond K. Fraenkel © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Krise des amerikanischen Konstitutionalismus
215
in Rezension in: Harv. Law Rev. 50. 1937, 857—858. Zur Rolle Felix Frankfurters s. Roosevelt and Frankfurter, annotiert v. Freedman, 15. 62 Fraenkel, 857. 63 Th. W. Arnold, A Reply, ABAJ 23. 1937, 364—368, Zitat: 367. Arnold hatte das Problem ausführlicher behandelt in: The Symbols of Government, New Haven 1935; im Oktober folgte: The Folklore of American Capitalism, New Haven 1937. 64 W. H. Hamilton prangerte falsch verstandenen „Konstituuonalismus“ an: Encyclopedia of the Social Sciences 4. 1931, 255—259. Auch Μ. Lerner, Constitution and Court as Symbols, Yale Law J . 46. 1937, 1290—1319; und E. S. Corwin, The Consti tution as I nstrument and as Symbol, Am, Pol. Science Rev. 30. 1936, 1071—1085. 65 Leuchtenburg, 243: „Joined together, the President's policies on the Court and the sit-downs threatened to destroy the middle-class base of the Roosevelt coalition.“ 66 Ε. Roper, You and Your Leaders: Their Actions and Your Reactions 1936—1956, New York 1957, 31. Auch Ε. Kimbark MacCall, The Supreme Court and Public Opinion, unveröff. Diss. Univ. of California, Los Angeles 1953. 67 R. Polenberg, The National Committee to Uphold Constitutional Government 1937—1941, Journal of American History 52. 1965, 586. 68 Bericht über die Anhörung in: ABAJ 23. 1937, 318—328. 69 ABAJ 23. 1937, 271—277. 70 ABAJ 23. 1937, 233—236. Die monatlichen Hefte des ABAJ behandelten von April bis Juli 1937 kaum ein anderes Thema. 71 Mitglieder der National Lawyers Guild waren u. a. der frühere Chief Justice von Minnesota, John P. Devancy (amtierender Präsident), der Gouverneur von Wisconsin Philip La Follette, Abraham Fortas von Yale, Malcolm P. Sharp von der Universität von Chicago und Carlton Ogburn, Anwalt der AFL in Washington. ABAJ 23. 1937, 164—165. 72 Erläuterung des Gesetzes in anonymer „note“ in: Harv. Law Rev. 51. 1937, 148 bis 155. 73 In der Entscheidung gegen ein Mindestlohngesetz von New York im Fall Morehead v. New York ex rel. Tipaldo, 298 US 587 (1936) hatte Roberts noch mit der konservativen Mehrheit gestimmt. 74 Frankfurters spätere Erklärung des Vorganges aufgrund eines Memorandums von Roberts in: Frankfurter and Roosevelt, annotiert v. Freedman, 392—396. Auch J . W. Chambers, The Big Switch: Justice Roberts and the Minimum Wage Cases, Labor History 10. 1969, 44—73. 75 West Coast Hotel Company v. Parrish, 300 US 379. 76 National Labor Relations Board v. Jones and Laughlin Steel Corp., 301 US 1 (1937); dazu R. C. Cortner, The Jones & Laughlin Case, New York 1970. 77 Stewart Machine Co. v. Davis, 301 US 548 (1937). 78 Den vom neuen Föderalismus abgelösten „dual federalism“ definierte Edward S. Corwin 1950 im nachhinein: „1. The national government is one of enumerated powers only; 2. Also the purposes which it may constitutionally promote are few; 3. Within their respective spheres the two centers of government are sovereign' and hence ,equal'; 4. The relation of the two centers with each other is one of tension rather than collaboration.“ ders., „The Passing of Dual Federalism“, Virginia Law Rev. 36. 1950, 4. 79 Zum neuen Föderalismus J . Ε. Kallenbach, Federal Cooperation with the States under the Commerce Clause, Ann Arbor 1942; J . T. Patterson, The New Deal and the States: Federalism in Transition, Princeton 1969. 80 Jackson, Bar, 96.
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Anti-New-Deal-Bewegungen Politik und Ideologie der Opposition gegen Präsident F. D. Roosevelt Von HEINRICH AUGUST WINKLER
Im Jahre 1906 veröffentlichte der deutsche Nationalökonom Werner Sombart eine Broschüre unter der inzwischen schon fast klassisch gewordenen Titelfrage: „Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus?“ Sombart untersuchte einen ins Auge springenden Unterschied zwischen der europäischen und der nordamerikanischen Sozialentwicklung und glaubte die wichrigste Ursache dieser Differenz darin zu finden, daß im „Kanaan des Kapitalismus“ der Arbeiter jahrzehntelang zwischen unselbständiger und selbständiger Existenz habe wählen können: die offene Grenze im Westen schien ein hohes Maß an sozialer Mobilität und damit eine die bestehende Gesellschaftsordnung prinzipiell bejahende Mentalität zu bewirken, die sich vom proletarischen Klassenbewußtsein europäischer Prägung scharf abhob1. Drei Jahrzehnte später hätten europäische Beobachter der amerikanischen Szene versucht sein können, Sombarts Frage zeitgemäß abzuwandeln; „Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Faschismus?“ Wenn die Zeit der Weltkriege die „Epoche des Faschismus“ genannt werden kann, so bildete sie zugleich das letzte Kapitel der Weltgeschichte Europas2. Es waren die gemeinhin unter dem Begriff „Faschismus“ zusammengefaßten Regime, die Ende der dreißiger Jahre in Kontinentaleuropa dominierten und durch die von Europa aus nochmals der übrigen Welt das Gesetz des Handelns aufgezwungen wurde. Im Rückblick erscheint es jedoch keineswegs selbstverständlich, daß die politische Entwicklung der Vereinigten Staaten in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen gänzlich anders verlief als etwa diejenige Deutschlands. Die Weltwirtsdiaftskrise traf die USA insgesamt kaum weniger hart als Deutschland, und sie dauerte in Amerika sehr viel länger als in Mitteleuropa3. Die politische Reaktion auf die Krise war gleichwohl im einen Fall der Sieg des Nationalsozialismus, im anderen der New Deal. Schärfer und zugleich allgemeiner gewendet: während die Stabilisierung des kapitalistischen Wirtschaftssystems in Deutschland sich unter vollständiger Beseitigung der Errungenschaften und Institutionen des liberal-parlamentarischen Staates vollzog, wurde dieselbe Operation in Amerika unter prinzipieller Beibehaltung der überkommenen Gewaltenteilung und der individuellen Rechtssicherheit durchgeführt. Mit dieser Feststellung haben wir bereits eine Art definitorischer Vorentscheidung getroffen. In der zeitgenössischen Diskussion über den Faschismus gab es
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Anti-New-Deal-Bewegungen
217
durchaus andere Meinungen, und es illustriert die Vieldeutigkeit dieses Begriffs, daß unter ihm sowohl der New Deal als auch die gegen die Wirtschaftspolitik F. D. Roosevelts gerichteten Bewegungen rubriziert wurden. Wir wollen das zweite Problem — die Beurteilung der Protestbewegung gegen Roosevelt — für einen Augenblick noch zurückstellen und uns zunächst der Interpretation des New Deal durch einzelne seiner Kritiker zuwenden. Wenn ein linksliberaler Publizist wie I . F. Stone bereits 1933 meinte, Roosevelts Politik werde als Ganzes nur unter der Hypothese verständlich, daß er sich auf den Faschismus zubewege, so zielte diese Befürchtung vor allem auf die staatlichen Eingriffe in die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wie sie die National Recovery Administration (NRA) in Form von Rahmenverträgen (codes) mit Mindestlohn- und Arbeitszeitbestimmungen vornahm. Dieselbe Tendenz sahen die amerikanischen Kommunisten am Werk: der New Deal, so schrieb 1935 der „Daily Worker“, strebe nach Faschismus und Krieg, um die Arbeiter in industrieller Sklaverei zu halten4. Aber auch bei Demokraten der alten Schule stieß die staatliche Wirtschaftssteuerung auf Faschismusverdacht. Sie bedauerten, wie es einer von ihnen — Senator Carter Glass von Virginia — formulierte, „die äußerst gefährliche Bemühung der Bundesregierung in Washington, den Hitlerismus in jeden Winkel des Landes zu verpflanzen“5. Was diese Kritiker an die Praktiken des faschistischen Italien und des nationalsozialistischen Deutschland erinnerte, war nicht nur die propagandistische Untermalung des Rooseveltschen Arbeitsbeschaffungsprogramms, sondern die Rolle des Staates bei der Lenkung der Wirtschaft überhaupt. Für einen Ökonomen wie Robert F. Brady zielte praktisch jeder staatliche Versuch, die Krise auf dem Boden der gegebenen Wirtschaftsordnung zu überwinden, die Überführung des liberalen Wettbewerbskapitalismus in den staatlich organisierten Kapitalismus also, in die Richtung des Faschismus. Er konnte darauf verweisen, daß es zahlreiche Kräfte in der amerikanischen Unternehmerschaft gab, die danach strebten, die Gewerkschaften als sozialen Kontrahenten auszuschalten und die Gesamtgesellschaft ideologisch auf die mit dem Gemeinwohl identifizierten Interessen von „big business“ zu verpflichten6. Der erste Einwand, der sich gegen diese These erheben läßt, zielt auf die zugrunde liegende Begriffsbestimmung des Faschismus. So unbestreitbar es ist, daß italienischer Faschismus und deutscher Nationalsozialismus die auf dem Privateigentum beruhende Wirtschaftsordnung stabilisiert und die sie in Frage stellenden gesellschaftlichen Kräfte aus dem politischen Leben ausgeschaltet haben, so unleugbar ist es doch andererseits, daß dies nicht das strategische Ziel beider Regime, sondern nur die Vorbedingung der Verwirklichung ihrer politischen Programme war. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, an dieser Stelle eine umfassende Definition des Herrschaftstypus „Faschismus“ vorzulegen. Dreierlei wird man jedoch heute als gesichert ansehen dürfen: Die Machtzentren im nationalsozialistischen Deutschland und im faschistischen Italien waren nicht „Agenten des Monopol© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
21S
Heinrich August Winkler
kapitals“, sondern relativ autonome Faktoren; ihre letzten Zielsetzungen waren nicht wirtschaftlicher Art, sondern durch ein Primat der Politik gekennzeichnet; die aggressive Wendung nach außen war nicht das logische Resultat ökonomischen Interessendrucks, sondern eines extremen Nationalismus, der sich als Ideologie quasi verselbständigt hatte. Wenn man nicht einem inflationären Gebrauch des Begriffs „Faschismus“ Vorschub leisten will, wird man festhalten müssen, daß die beiden Regime, auf die dieser Terminus am eindeutigsten anwendbar ist, charakterisiert waren durch eine vollständige Loslösung der Exekutivgewalt von parlamentarischer und judikativer Kontrolle, durch die gewaltsame Unterdrückung eines autonomen gesellschaftlichen Pluralismus bei gleichzeitiger Aurfechterhaltung der auf dem Privateigentum beruhenden Sozialbeziehungen und — in Deutschland noch weit radikaler als in Italien — durch den Willen zu hegemomaler Expansion. Die Übereinstimmung zwischen wichtigen Teilen der Unternehmerschaft und dem Regime beruhte in beiden Fällen, wenn man von den direkten Nutznießern der Aufrüstung absieht, primär auf dem gemeinsamen Interesse an einer Neutralisierung von Parlament und Arbeitnehmerorganisationen7. Eine Verfassungsfeindschaft wie in Deutschland gab es unter den amerikanischen Unternehmern nicht. Die prinzipiell gewerkschaftsfeindlichen Tendenzen konnten sich unter der Roosevelt-Administration nicht durchsetzen. Das führt uns zu einem zweiten Einwand gegen die Argumentation Bradys, der die Wirtschaftspolitik im engeren Sinn, den Charakter des New Deal und die Stellung der Unternehmer zu ihm, betrifft. Anders als in Deutschland brachte in den Vereinigten Staaten die Wiederankurbelung der Wirtschaft der Arbeiterschaft nicht die Liquidation ihrer Errungenschaften, sondern einen Gewinn an Rechten. Die Gewerkschaften wurden nicht ausgeschaltet; sie bildeten vielmehr, seit ihnen die Tarifvertragsfähigkeit und ein von den Arbeitgebern unbeschränktes Koalitionsrecht ausdrücklich bestätigt worden waren, eine der verläßlichsten Säulen der „Roosevelt Coalition“. Durch den Social Security Act von 1935 wurden auf Bundesebene eine Arbeitslosenversicherung und — wenigstens für Teile der Arbeiterschaft — eine Altersversicherung eingeführt; beides Maßnahmen, mit denen ein elementarer sozialpolitischer Nachholbedarf gegenüber Europa befriedigt werden sollte. Der New Deal bildete das Begriffsdach über einer Vielzahl von Institutionen und Projekten, die sich keineswegs alle an einer einheitlichen Zielsetzung orientierten. Das entsprach der Heterogenität der Kräfte, die die Wirtschaftspolitik der Roosevelt-Administration formten. Neben Anhängern einer durchkartellierten, sich selbst verwaltenden Wirtschaft und Befürwortern einer quasikorporativen Zusammenarbeit der Organisationen von Unternehmern und Arbeitern gab es Advokaten des unverfälschten Wettbewerbs, die die Tradition der „trust busters“ des Jahrhundertanfangs fortsetzten. Die Konzentrationsgegner entfalteten — vor allem seit der neuerlichen Rezession von 1937 — eine bemerkenswerte propagandistische Aktivität. Die Kartellierungstendenzen, die durch die NRA, solange sie bestand, faktisch gefördert worden waren, konnte © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Anti-New-Deal-Bewegungen
219
diese Gruppe freilich nicht aufhalten. Die Anerkennung des „collective bargaining“ widersprach zwar der traditionell gewerkschaftsfeindlichen Haltung der meisten Unternehmer, erwies sich aber bald als eine der wirksamsten Sicherungen des gegebenen Wirtschaftssystems. Der Staat handelte in der NewDeal-Phase gewissermaßen als aufgeklärter Gesamtkapitalist. Er setzte die übergreifenden Interessen der individuellen Unternehmer auch gegen deren Widerstand durch. Die New Dealer glaubten, wie Arthur M. Schlesinger, Jr., bemerkt, an den Kapitalismus; sie wünschten das System zu reformieren, nicht zu zerstören8. In diesem Punkt trafen sie sich durchaus mit den europäischen Protagonisten eines „Organisierten Kapitalismus“, deren Vorstellungen vom notwendigen Ausmaß staatlicher Wirtschaftssteuerung vielen Unternehmern zu weit gingen. Der Widerstand der deutschen Industrie gegen Schleichers Politik öffentlicher Arbeitsbeschaffung ist ein Beispiel dafür. Wie in Deutschland und Italien stand auch in den Vereinigten Staaten die während des Ersten Weltkrieges erprobte staatliche Koordination der Wirtschaft Modell für die Bewältigung der Weltwirtschaftskrise10. In den Vereinigten Staaten aber waren Arbeitsbeschaffungsprogramme, Bankenkontrolle und landwirtschaftliche Sanierung Mittel einer Wiederbelebung der Wirtschaft und nicht, wie im nationalsozialistischen Deutschland, Instrumente, die primär der Kriegsvorbereitung dienten. Die Mängel des New Deal waren offenkundig. Wie wenig ihm eine Gesamtkonzeption zugrunde lag, zeigte sich daran, daß einzelne seiner Maßnahmen sich strikt widersprachen. Dem Kleingewerbe etwa, das durch die arbeitsrechtlichen Rahmenregelungen der NRA zum Teil hart getroffen wurde, billigte der Robinson-Patman-Act von 1936 einen, allerdings nicht sehr wirksamen Schutzanspruch gegen Preisdiskriminierungen zu. Der erwähnten Konzentrationsförderung durch die NRA stand die Konzentrationsbekämpfung auf dem Gebiet der Energieversorgung gegenüber. Die Aktivitäten der NRA erwiesen sich wirtschaftspolitisch insgesamt als Fehlschlag: die „codes“ wirkten preissteigernd und kaufkraftmindernd. Soweit die Wirtschaft sich wieder erholte, war dies nicht eine Folge irgendwelcher organisatorischer Eingriffe, sondern des staatlichen „deficit spending“. Aber auch auf dem Gebiet der Konjunkturpolitik war Roosevelt nicht konsequent. So hat zu der Rezession von 1937 vor allem der Umstand beigetragen, daß angesichts gewisser Symptome eines konjunkturellen Aufschwungs die staatlichen Ausgaben vorzeitig zurückgeschraubt worden waren. Finanzminister Morgenthau war grundsätzlich ein Anhänger des ausgeglichenen Budgets. Das „deficit spending“ blieb bis 1937 so halbherzig, daß man den New Deal kaum als ein frühes Musterbeispiel des praktischen Keynesianismus bezeichnen kann. Überdies tat die Administration Roosevelts auch psychologisch nicht viel, um die Investitionsbereitschaft der Unternehmer zu steigern. Die von der öffentlichen Hand induzierte Konsumkonjunktur war darum nur bedingt ein Beitrag zur Überwindung der Depression. Wie immer man indes Mängel und Leistun© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
220
Heinrich August Winkler
gen des New Deal bewertet — das Etikett „faschistisch“ ist ein Zeichen von Begriffsverwirrung11. Seine entschiedensten Anhänger fand Roosevelts Wirtschaftspolitik bei Arbeitern, Angestellten in nicht-leitender Stellung, großen Teilen der Farmer und bestimmten ethnischen Gruppen mit meist geringem Einkommen wie Italienern und Polen. Dazu kamen die Neger. Obwohl Roosevelt mit Rücksicht auf die südstaatlichen Demokraten keinerlei Schritte zur Erweiterung der Bürgerrechte unternahm, bewirkten die sozialen Anstrengungen seiner Administration, daß die Neger erstmals 1936 sich von der Partei Abraham Lincolns, den Republikanern, abwandten und mehrheitlich die Demokratische Partei Franklin Delano Roosevelts unterstützten12. Der „Roosevelt Coalition“ stand — nach einer kurzen Phase begrenzter Kooperation — seit 1934 als nahezu geschlossene Opposition „big business“, an seiner Spitze die New Yorker Banken, gegenüber. Für das Gros der Industriellen und Bankiers signalisierte der New Deal einen Bruch mit der Tradition des „free enterprise“, einen Angriff auf die überkommenen Wertvorstellungen des „rugged individualism“ und den Vormarsch etatistischer, kollektivistischer und sozialistischer — kurz: unamerikanischer Tendenzen. Um eine Abwehrfront gegen diese Kräfte zu mobilisieren, wurde 1934 unter ausschlaggebender Mitwirkung der Konzerne Du Pont und General Motors die „American Liberty League“ ins Leben gerufen. Sie sollte die Lücke füllen, die die führer- und konzeptionslosen Republikaner 1933 hinterlassen hatten. Die neue Vereinigung beschwor den Geist der amerikanischen Verfassung, der allen ausländischen Regierungssystemen und Ideologien wie Kommunismus, Nationalsozialismus und Faschismus weit überlegen sei. Es gelte, so erklärte ihr Vorsitzender, Jouett Shouse, im November 1934, gegenüber subversiven Theorien und fremdartigen Doktrinen den „fundamental Americanism“ aufrechtzuerhalten. Gemeint war damit die freie, nicht von der staatlichen Bürokratie regulierte Unternehmerwirtschaft im Sinne des Manchesterkapitalismus — eine liberale Idylle, die angesichts der Weltwirtschaftskrise notwendigerweise reaktionäre Züge annahm. In der Tat schlug die American Liberty League ernsthaft vor, alle direkten Fürsorgefälle dem Roten Kreuz zu übertragen. Für die übrigen hieß das Allheilmittel „Selbsthilfe“. In dem Maß, wie Roosevelt seit 1935 — im Zeichen des sogenannten „Zweiten New Deal“ — nach links rückte und ein umfangreiches soziales Hilfsprogramm zu verwirklichen begann, spitzte sich die Polemik der Liberty League gegen den Präsidenten zu. Bei den Präsidentschaftswahlen des Jahres 1936 unterstützten die meisten ihrer führenden Mitglieder, darunter auch der ehemalige demokratische Präsidentschaftskandidat AI Smith, den republikanischen Bewerber Alfred M. Landon. Roosevelts überwältigender Sieg — er gewann die Mehrheit in allen Staaten mit Ausnahme von Maine und Vermont und erhielt über 10 Millionen Summen mehr als sein wichtigster Gegenkandidat — bezeichnete zugleich den Anfang vom Ende der American Liberty League. Die Honoratiorenvereinigung des amerikanischen Konservativismus, © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Anti-New-Deal-Bewegungen
221
die Roosevelts Mythos vom „forgotten man“ keine überzeugende Alternative entgegenzusetzen vermocht hatte, konnte nach dieser Niederlage kaum noch mit öffentlichem Interesse rechnen. Im Jahre 1940 hörte sie zu bestehen auf15. Weitaus massiver als die Aktivität der American Liberty League war die Agitation des Pressekonzernherrn William Randolph Hearst, der sich 1933 binnen kurzem von einem Anhänger zu einem Gegner Roosevelts gewandelt hatte. Daß die Regierung sich in die Privatwirtschaft „einmischte“, setzte sie bereits dem Verdacht aus, kommunistisch infiltriert zu sein. Gegen den Kommunismus aber mußte mit allen Mitteln vorgegangen werden und das in Europa getan zu haben, war das ausgiebig gewürdigte Verdienst Mussolinis und Hitlers. In den Vereinigten Staaten sah Hearst, wie er im November 1934 die Chefredakteure seiner etwa 30 Zeitungen und Zeitschriften wissen ließ, noch („as yet“) keine wirkliche faschistische Bewegung am Werk. Für die Zukunft schloß er die Notwendigkeit einer solchen jedoch nicht aus. „Der Faschismus ist ganz eindeutig eine Bewegung mit dem Ziel, den Kommunismus zu bekämpfen und unschädlich zu machen, und so die am wenigsten fähige und glaubwürdige Klasse davon abzuhalten, die Kontrolle über dieses Land zu gewinnen. Der Faschismus wird in den Vereinigten Staaten erst entstehen, wenn eine solche Bewegung wirklich nötig wird, um uns vor dem Kommunismus zu bewahren.“ Für wünschenswert hielt Hearst diese Entwicklung nicht. Solange die bestehende Gesellschaftsordnung mit den traditionellen Mitteln aufrechtzuerhalten war, zeigte sich Hearst geneigt, dem amerikanischen Regierungssystem den Vorzug vor allen „crazy isms“ zu geben. Allerdings mußte man zu diesem Zweck bereit sein, gravierende Abstriche an durchaus nicht unamerikanischen Errungenschaften vorzunehmen. So erklärte die Hearst-Presse die akademische Freiheit für eine „Phrase, die von den radikalen Gruppen als eine neue Tarnung übernommen wurde, um uns fremdartige Doktrinen zu lehren“. Im Herbst 1934, unmittelbar nach seiner Rückkehr von einem Besuch bei Hitler, organisierte Hearst eine Pressekampagne zur gewaltsamen Unterdrückung des Generalstreiks in San Francisco, Die Bewunderung für die faschistischen Regime Europas schlug zusehends um in die Propagierung einer Politik, die Amerika diesen Systemen angleichen mußte14. Von den Widerständen, auf die der New Deal innerhalb der Machtelite stieß, war indes nicht die demagogische Opposition Hearsts, sondern die legalistische des Supreme Court die effektivste. Aufgrund einer Verfassungsinterpretation, die in etwa der Philosophie der American Liberty League entsprach, erklärte er sieben von neun wichtigen New-Deal-Gesetzen für ungültig. Das richterliche Prüfungsrecht bewährte sich noch einmal als das konservative Korrektiv zur Gesetzgebung, als das es Alexander Hamilton einst im „Federalist“ No. 78 konzipiert hatte. Folgerichtig feierten die Republikaner im Wahlkampf 1936 den Obersten Gerichtshof als diejenige Institution, die Amerika vor einer totalitären Diktatur bewahrt habe. Der Versuch des überlegenen Wahlsiegers Roosevelt, die Zusammensetzung des Obersten Gerichtshofes auf dem Gesetzesweg zu ändern, stieß indes auf heftigen Widerspruch auch seiner politischen © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
222
Heinrich August Winkler
Freunde. Erst der Gesinnungswandel eines Richters, dem bald der Rücktritt mehrerer seiner Kollegen folgte, änderte schließlich die Mehrheitsverhältnisse im Supreme Court und beseitigte damit den wirksamsten institutionellen Rückhalt der konservativen Opposition gegen die neue Wirtschaftspolitik15. Die Ablehnung einer staatlichen Steuerung des Produktionsprozesses war das gemeinsame Merkmal der konservativen Widerstände gegen den New Deal. In ebendiesem Punkt unterschieden sie sich deutlich von den auf Massenbasis beruhenden oppositionellen Strömungen, denen der New Deal in der Zähmung von „Wall Street“ und in der Einkommensumverteilung nicht weit genug ging. Ihre Attacken auf das internationale Finanzkapital haben den Anti-DewDeal-Bewegungen zwei Etikettierungen eingetragen, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben: zum einen sind sie als Erben des Populismus des späten 19. Jahrhunderts, zum anderen als die amerikanische Spielart des Faschismus bezeichnet worden10. Die „populists“, eine hauptsächlich von Farmern des Mittelwestens, der nordwestlichen Zentralstaaten und des Südens getragene Bewegung, waren die erfolgreichsten aller „dritten Parteien“, die außerhalb des hergebrachten Zweiparteienschemas Einfluß auf die Politik von Bund und Einzelstaaten zu nehmen suchten. Ihr Protest richtete sich vor allem gegen die für den Getreidetransport wichtigen Eisenbahn-Aktiengesellschaften, von denen sich die Farmer materiell übervorteilt fühlten, und gegen die deflationistische Währungspolitik der Regierung, als deren Hauptnutznießer die Banken galten. Positiv traten die Populisten vor allem für eine Verstärkung der plebiszitären Komponente im Willensbildungsprozeß ein — eine Zielsetzung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts die gegen die industriellen Monopole gerichtete Bewegung des „progressivism“ übernahm. Nicht zuletzt dieser Programmatik verdankten es die Populisten, daß sie lange Zeit als eine fortschrittliche Bewegung und als Ausdruck einer „grass root democracy“ angesehen wurden17. Unter dem Eindruck des McCarthyismus wurde in den fünfziger Jahren dieses positive Bild namentlich von Richard Hofstadter in Frage gestellt, der der bisherigen Forschung eine Unterschätzung der agrarromantischen und antisemitischen Elemente des Populismus vorwarf18. Da man diese Momente verstärkt bei einigen der Anti-Roosevelt-Bewegungen fand und bei diesen unschwer Berührungspunkte mit dem deutschen Nationalsozialismus entdecken konnte, schienen die Zusammenhänge hinreichend geklärt. Neuere Untersuchungen sind inzwischen zu differenzierteren Ergebnissen gelangt. Kritiker Hofstadters haben die Existenz eines weitverbreiteten populistischen Antisemitismus in Abrede gestellt, die Rolle von Industriearbeitern als Verbündete der Farmer betont und nachgewiesen, daß die rechtsradikale Bewegung des McCarthyismus den Kern ihrer Anhängerschaft nicht im ehedem populistischen Milieu, sondern bei der traditionell republikanischen Wählerschaft gehabt hat19. Zwischen Populismus und Protestbewegung gegen den New Deal ist dagegen zumindest in einem Fall ein wahlsoziologischer Zusammenhang schlüssig zu belegen: in Louisiana. Hier konnte der Gouverneur und spätere Senator Huey © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Anti-New-Deal-Beweguneen
223
Long überall dort besonders große Wahlerfolge erringen, wo früher die Populisten stark gewesen waren. Long galt vielen Zeitgenossen als ein potentieller amerikanischer Hitler. Anlaß zu diesem Vergleich gab die persönliche Diktatur, die Long in dem traditionellen Einparteienstaat Louisiana errichtet hatte: er kontrollierte die Verwaltung durch ein System perfektionierter Patronage, beherrschte die Legislative und die Justiz und hatte fast unbegrenzte Möglichkeiten zur Manipulation von Wahlergebnissen. Im Jahre 1928 als Kandidat der weißen Unterschichten — vor allem der ländlichen Distrikte — an die Macht gekommen, behandelte Long das traditionelle Honoratiorenregime der Plantagenbesitzer und der Standard Oil Company als Hauptgegner. Seine innenpolitischen Errungenschaften — eine armenfreundliche Steuergesetzgebung, umfangreiche Straßenbauarbeiten, die Einführung kostenloser Lernmittel an den Schulen — sicherten ihm eine breite populäre Resonanz nicht nur bei den weißen, sondern auch bei den in seine Wohlfahrtsmaßnahmen bewußt einbezogenen schwarzen Unterschichten. Obwohl Long die rassischen Vorurteile des durchschnittlichen Südstaatlers teilte, hat er doch nicht versucht, aus dem Ressentiment gegen die Neger politisches Kapital zu schlagen. Zu einem Faktor der nationalen Politik wurde Long erst, seit er sich in die Front der Gegner Roosevelts eingereiht und Präsidentschaftsaspirationen hatte durchblicken lassen. Die Initiative zum Bruch scheint von Roosevelt ausgegangen zu sein: der Präsident sah in Long, der 1932 bei der Nominierung von F. D. R. auf dem demokratischen Parteikonvent eine Schlüsselrolle gespielt und den New Deal anfangs nachdrücklich unterstützt hatte, einen Demagogen und gefährlichen Rivalen. Die Entscheidung, Anhänger Longs von der präsidentiellen Ämterpatronage auszuschließen, gab den unmittelbaren Anstoß zum Konflikt. Wenig später leiteten die Bundesbehörden eine Untersuchung wegen vielfach behaupteter Unregelmäßigkeiten bei Longs Wahl zum Senator (1930) ein. Long seinerseits warf dem Präsidenten die Kürzung der Veteranenrenten, mangelnde Bereitschaft zur Umverteilung des Vermögens und — allgemein — eine wachsende Abhängigkeit von Banken und Konzernen vor. Die nationale Plattform Longs bildete seit 1932 das „Share-Our-Wealth“-Programm, eine Sammlung werbewirksamer wirtschaftspolitischer Leitsätze, deren Prämissen freilich nicht durchwegs von nationalökonomischem Sachverstand zeugten. Nach den Vorstellungen Longs sollte etwa jeder Familie ein schuldenfreies Mindestvermögen von 5000 $ garantiert und, um dieses Ziel zu erreichen, eine obere Vermögensgrenze etwa bei 5 Millionen $ gezogen werden. Ferner sollten alle Personen über 60 Jahren eine monatliche Rente erhalten, jedermann ein jährliches Mindesteinkommen von 2000 $ gewährleistet, die Arbeitszeit verkürzt, die Agrarproduktion durch Regierungsankäufe ausbalanciert und begabten Kindern eine kostenlose College-Ausbildung gewährt werden. Angesichts der raschen Ausbreitung der „Share-Our-Wealth“-Clubs über das ganze Land — ihre Zahl betrug 1935 27 000 — und der erfolgreichen Werbefeldzüge Longs bei den Farmern des Mittelwestens nahm man im Weißen Haus die Ambitionen des Senators auf das höchste Amt der Vereinigten Staaten durchaus ernst. Zu © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
224
Heinrich August Winkler
einer Nominierung Longs als Präsidentschaftskandidat einer dritten Partei kam es jedoch nicht mehr: Long wurde im September 1935 von einem österreichischen Einwanderer ermordet. Die weitgehende Abschaffung aller für eine demokratische Repräsentativverfassung konstitutiven Elemente im Louisiana Huey Longs reicht kaum aus, sein Regime als faschistisch zu bezeichnen. Von den faschistischen Diktaturen Europas unterschied es sich vor allem darin, daß es nicht gegen die organisierte Arbeiterschaft gerichtet war. Indem Long die traditionelle Oberschicht aus ihrer politischen Führungsrolle verdrängte, blieb er vielmehr durchaus der populistischen Tradition treu. Sein Regime trug manche Züge einer Entwicklungsdiktatur. Damit ist zugleich angedeutet, daß man zwischen der regionalen und der nationalen Funktion Longs differenzieren muß. Die Herrschaftsmethoden, die in dem sozialökonomisch unterentwickelten Louisiana partiell als Vehikel des sozialen Wandels dienen mochten, wären auf Bundesebene ihrem Zweck völlig unangemessen gewesen. Betrachtet man die gesellschaftspolitischen Forderungen Longs isoliert, so waren sie innerhalb des politischen Panoramas der Vereinigten Staaten eher links als rechts von der Mitte einzuordnen. Zwar kann von einer besonders arbeiterfreundlichen Politik Longs ebensowenig die Rede sein wie von einer prinzipiell unternehmerfreundlichen; er tat nur wenig für die Arbeitslosen und in seinen posthum erschienenen hypothetischen Memoiren „My First Days in the White House“ ernannte Präsident Huey Long einige führende Bankiers und Industrielle zu Mitgliedern seines Kabinetts. Die Vermögensumschichtung zugunsten einkommensschwacher Gruppen aber, die Long beharrlich propagierte, ging weit über das hinaus, was aus den Kreisen der New Dealer bisher an Reformplänen vorgelegt worden war. Seine Anhänger fand Long, wie einige Meinungsumfragen aus dem Jahr 1935 zeigen, im tiefen Süden und in den alten Hochburgen des Populismus, dem mittleren Westen und den RockyMountain-Staaten. Wähler, die früher „linke“ Protestkandidaten unterstützt hatten, waren besonders geneigt, sich Long anzuschließen. Da Long — trotz der 7,7 Millionen eingetragener Interessenten seines ShareOur-Wealth-Movement — keinerlei Chance besaß, als Führer einer dritten Partei Präsident zu werden, hätte die von ihm angestrebte Kandidatur äußerstenfalls den Effekt haben können, die konservative Opposition der Republikaner wieder ins Weiße Haus zu bringen. Long kalkulierte diese Möglichkeit ein, ja er sah in ihr eine Voraussetzung für seinen Wahlsieg im Jahre 1940. Die stark subjektiven Elemente seines Kampfes gegen Roosevelt waren für die Protestbewegung gegen den New Deal typisch. Sie trugen mit dazu bei, daß diese Bewegung ihre Reformimpulse ebenso verlor wie ihren Massencharakter und in einzelnen Ausläufern auf dem äußersten rechten Rand des politischen Spektrums endete20. Diese Feststellung trifft in besonderem Maß auf einen Mann zu, den man sehr viel eindeutiger als Long den Exponenten eines amerikanischen Faschismus nennen kann: auf Father Charles Coughlin, einen katholischen Priester aus © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Anti-New-Deal-Bewegungen
225
Detroit, der mit seinen regelmäßigen Rundfunkansprachen zeitweilig ein Publikum von 40 Millionen erreichte. Wie Long hatte Coughlin als Anhänger Roosevelts und des New Deal begonnen, um dann seit 1934 eine immer schärfere Sprache gegenüber dem Präsidenten anzuschlagen. Über die mangelnde Würdigung seiner rhetorischen Hilfsdienste für Roosevelt enttäuscht, konzentrierte Coughlin seine Attacken auf das nach seiner Ansicht zu langsame Tempo des deficit spending, die nicht ausreichenden Schutzmaßnahmen für die Farmer und die unverändert große Macht des internationalen Finanzkapitals. Seine Agitation stellte er folgerichtig einmal auf das agrarische Amerika ab, das dem modernen Kapitalismus innerlich fremd gegenüberstand, zum anderen auf die städtische Unterschicht, soweit sie sich vom New Deal nicht hinlänglich berücksichtigt sah. In diesem Milieu fand Coughlin, als er sich 1934 in der „National Union for Social Justice“ eine politische Plattform schuf, auch die meisten Anhänger: neben Farmern der westlichen Zentralstaaten insbesondere schlecht entlohnte Arbeiter und Arbeitslose im Nordosten, während „small business“ weniger stark in Erscheinung trat. Das Programm der neuen Vereinigung forderte unter anderem einen gerechten Mindestlohn für jede Art von Arbeit, gerechte Preise für die Farmer, die ausschließliche Zuständigkeit des Kongresses für Fragen der monetären Politik, das Koalitionsrecht für die Arbeiter bei gleichzeitiger Pflicht des Staates, die Organisationen der Arbeiter vor den „vested interests of wealth and intellect“ (!) zu schützen. Der radikalste Programmpunkt bestand in der Forderung nach einer Nationalisierung von solchen Wirtschaftssektoren, „die ihrer Natur nach zu wichtig sind, um von Privatpersonen kontrolliert zu werden“ — gemeint waren Energieversorgung und Bodenschätze. In allen übrigen Bereichen sollte das Privateigentum unangetastet bleiben. Ihre regionalen Schwerpunkte hatte die National Union for Social Justice in katholischen Stadtbezirken der Staaten Massachusetts und New York, wo es 1935 viermal so viele lokale Untergruppen gab wie in den agrarisch-protestantisch geprägten Staaten Minnesota und Wisconsin. Coughlin griff damit über das Einzugsfeld des Populismus weit hinaus. Meinungsumfragen, die allerdings aus dem Jahre 1938 stammen, bestätigen, daß Coughlin in den einkommensschwächsten Gruppen auf die stärksten Sympathien stieß. Unter den Protestanten, die sich im Durchschnitt zu Coughlin eher ablehnend als zustimmend verhielten, fand sich nur bei den Lutheranern eine relative Mehrheit von Coughlin-Sympathisanten. Innerhalb gegebener religiöser und sozialer Gruppen stand die Bereitschaft, Coughlins Ansichten zu unterstützen, in einem Verhältnis umgekehrter Proportionalität zur Einkommenshöhe. Für die Zeit bis 1936 wird man von einer populistischen Phase Coughlins sprechen können. Seine, das unverdorbene Volk gegen die korrupten Führungsschichten ausspielende Rhetorik, der Ruf nach einer Silberwährung — im Effekt einer Politik des leichten Geldes also — und die direkte Berufung auf Wortführer des Farmerprotestes des späten 19. Jahrhunderts machen deutlich, in 15 Winkler, Krise © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
226
Heinrich August Winkler
welcher Tradition Coughlin sich selber sah. Obwohl extrem nationalistische, gewerkschaftsfeindliche und gelegentliche antisemitische Elemente in der Agitation Coughlins auch schon vor 1936 in Erscheinung traten, waren sie damals noch nicht das dominierende Merkmal seiner Bewegung. Das änderte sich nach den Präsidentschaftswahlen jenes Jahres. Coughlin, der sich als gebürtiger Kanadier nicht selbst um das höchste Amt der Vereinigten Staaten bewerben konnte, hatte zusammen mit Gerald L. K. Smith, dem Nachfolger Longs als Führer des Share-Our-Wealth-Movement, und dem kalifornischen Altersrentenreformer Dr. Peter Townsend eine neue Partei, die Union Party, gegründet und den Kongreßabgeordneten William Lemke aus North Dakota als Präsidentschaftskandidaten der neuen Gruppe unterstützt. Lemke sollte alle diejenigen hinter sich bringen, denen der New Deal nicht weit genug ging und die Republikaner zu konservativ waren. Bis auf die fehlende Nationalisierungsforderung war das Programm der Union Party mit dem der National Union for Social Justice nahezu identisch. Diese Rechnung ging jedoch nicht auf. Roosevelt hatte rechtzeitig der Protestbewegung den Donner gestohlen, indem er den Arbeitslosen, den Farmern und den Alten effektive Hilfe zuteil werden ließ und große Einkommen sowie den Kapitalbesitz von Aktiengesellschaften einer verschärften Besteuerung unterwarf. Lemke erhielt im ganzen Land nicht einmal 900 000 Stimmen, die meisten davon in den Hochburgen der National Union of Social Justice. Dazu kamen einige Schwerpunkte der Townsend-Bewegung in den pazifischen Küstenstaaten und des Farmerprotestes im mittleren Westen. Die Tatsache, daß unter den Anhängern Coughlins irische und deutsche Katholiken besonders stark vertreten waren, hat zu der Vermutung geführt, bereits 1936 habe sich im Votum für die Union Party ein isolationistisches Ressentiment gegen den englandfreundlichen „Internationalisten“ Roosevelt artikuliert. Außenpolitische Gesichtspunkte haben indes bei der zweiten Wahl Roosevelts offensichtlich noch keine Rolle gespielt und sind auch von der Union Party nicht zum Wahlkampfthema gemacht worden. Daß Roosevelt als Vertreter der intellektuellen und anglophilen Elite der Ostküste auf Aversionen bei vielen irischen Katholiken und deutschen Farmern stieß, war ein unbezweifelbares, aber durchaus innenpolitisch zu erklärendes Faktum21. Der Mißerfolg der Anti-Roosevelt-Agitatoren war so eindeutig, daß Coughlin unmittelbar nach der Wahl erklärte, er werde seine Rundfunkreden nicht fortsetzen. Anstatt dieses Versprechen einzulösen, nahm er jedoch nach kurzer politischer Abstinenz seine Agitationstätigkeit wieder auf, wobei die Thematik seiner Reden und Artikel sich bemerkenswert verschob. Davon überzeugt, daß das System Roosevelt mit einem sozialen Reformprogramm nicht überwunden werden könne, bekannte er sich seit 1938 offen als Antisemit, bezeichnete Kommunismus und internationales Finanzkapital als verschiedene Formen derselben jüdischen Weltverschwörung, stellte Gewerkschaftler und liberale Intellektuelle als Handlanger der Kommunisten hin und feierte Hitler, Mussolini und Franco als Retter der abendländischen Kultur. Eine neue Kampforgani© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Anti-New-Deal-Bewegungen
227
sation Coughlins, die „Christian Front“, organisierte in mehreren Großstädten antisemitische Ausschreitungen. Gleichzeitig rückte die Außenpolitik in das Zentrum der Agitation. In Anknüpfung an die Tradition der Progressivisten und in Vorwegnahme der Aktivitäten des eher großkapitalistischen „America First Committee“ versuchte Coughlin die Stimmung für eine isolationistische Politik zu mobilisieren. Das Paradox seiner Haltung war dabei offenkundig: Die Nichtintervention in Europa kam einer Intervention zugunsten der Achsenmächte gleich. Coughlins Sympathien für den europäischen Faschismus gerieten nach Pearl Harbour immer mehr in die Nähe des Hochverrats und lösten strafrechtliche Sanktionen gegen sein Organ „Social Justice“ aus. Sein endgültiger Rückzug aus der Politik im Jahre 1942 war ein Resultat kombinierten kirchlichen und staatlichen Drucks25. Wahrscheinlich waren die wirtschaftspolitischen Postulate des Father Coughlin nie mehr gewesen als auswechselbare Versatzstücke seines Bedürfnisses, öffentliche Aufmerksamkeit zu finden. Seine Äußerungen über den Kapitalismus waren durchaus ambivalent: einmal sah er ihn zum Scheitern verurteilt und keines Rettungsversuches würdig, das andere Mal bekannte er sich emphatisch zum Privateigentum und warf der Regierung kommunistische Tendenzen vor. „Das System des Kapitalismus darf nicht zerstört werden“, erklärte er Ende 1930. „Wir dürfen nicht der falschen Philosophie anhängen, die von modernen Sophisten erfunden wurde, daß nämlich der Mißbrauch einer Sache ihre Zerstörung rechtfertigt.“ Eine solche Ambivalenz gegenüber dem Kapitalismus kann man bei den meisten faschistischen Bewegungen vor allem in ihrer Frühphase finden. Unzutreffend aber wäre es, mit Lipset und Raab Coughlin in die Nähe des argentinischen Diktators Peron zu rücken — mit dem Argument, daß er seine soziale Basis vor allem in bestimmten Gruppen der Arbeiterschaft gefunden habe. Anders als Peron war Coughlin nämlich nicht gewerkschaftsfreundlich gesinnt. Die Formulierung des Programms der National Union for Social Justice von 1934, wonach die Gewerkschaften vom Staat gegen intellektuelle Einflüsse zu schützen seien, deutete bereits an, daß autonome Arbeitnehmerorganisationen nicht Coughlins Ideal entsprachen. 1937 machte es der Pater dem Gouverneur von Michigan, Frank Murphy, zum Vorwurf, daß er kein Militär gegen die streikenden Arbeiter von General Motors eingesetzt habe. 1938 proklamierte er unter Berufung auf die päpstliche Enzyklika „Quadragesimo anno“ den korporativen Staat, in dem freie Gewerkschaften keinen Platz mehr gehabt hätten24. Coughlins Verhältnis zum europäischen Faschismus war selbst nach 1936 weniger eindeutig als es auf den ersten Blick scheinen mag. Coughlin ließ in seinem Blatt „Social Justice“ die „Protokolle der Weisen von Zion“ und Reden von Joseph Goebbels abdrucken; er bezeichnete noch Mitte 1939 Deutschland als das Opfer eines Krieges, der ihm neun Jahre zuvor von den Juden erklärt worden sei; den deutschen Angriff auf die Sowjetunion feierte er als „ersten Schlag in dem heiligen Krieg gegen den Kommunismus“. 1936 erklärte er in einem Interview, man stehe an einer Wegegabel. „Ein Weg führt zum Faschis15*
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
228
Heinrich August Winkler
mus, der andere zum Kommunismus. Ich beschreite den Weg zum Faschismus.“ Auf der anderen Seite kritisierte er die Behandlung der Kirchen im nationalsozialistischen Deutschland und proklamierte den „Kampf gegen Kommunismus, Faschismus und Antichristentum“. Das Programm der „Christian Front“ versprach, „niemals sich mit Kommunismus, Nazismus oder irgendeinem anderen System“ einzulassen, „das darauf zielt, das repräsentative Regierungssystem zu zerstören“. Allerdings fürchte sich die „Christian Front“, die bewußt als Gegen-Volksfront gedacht war, auch nicht vor dem Etikett „faschistisch“, da dieses Wort lediglich den Kommunisten als propagandistisches Schlagwort diene25. Wenn es irgendwelche Fixpunkte in den Ansichten Coughlins gab, waren es sein leidenschaftlicher Haß auf England, der durch seine irische Abkunft zu erklären ist, und eine ebenso emotionale Gegnerschaft zum Marxismus, in dem er wesentlich einen militanten Atheismus sah. Beide Faktoren ließen ihn gegenüber den faschistischen Regimen Europas eine zumindest apologetische Position einnehmen. Coughlin mochte Zweifel an der Übertragbarkeit eines faschistischen Systems haben — betrachtet man die Entwicklung seiner außen- und gesellschaftspolitischen Ansichten seit 1936 als Ganzes, so ist es dennoch legitim, ihn einen Klerikofaschisten zu nennen. In seinem ehemaligen Verbündeten, dem Reverend Gerald L. K. Smith, der sich seit 1936 ebenfalls mit zunehmender Offenheit als extremer Nationalist und Antisemit zu erkennen gab, fand er ein protestantisches Pendant von allerdings erheblich geringerer öffentlicher Wirkung. Wir haben damit einen Punkt erreicht, der uns ein erstes Resume erlaubt. Solange die Protestbewegung gegen Roosevelt primär gesellschaftspolitische Bestrebungen vertrat, war sie nicht faschistisch, sondern in Stil und Programmatik eher eine Fortsetzung des Populismus. Sie war, um einen Terminus Seymour Martin Lipsets aufzugreifen, eher ein Extremismus der Mitte als ein Extremismus der Rechten“. Sie geriet in eindeutig faschistisches Fahrwasser, nachdem sie als Anti-New-Deal-Bewegung gescheitert war und soweit sie sich zu einer Art „nationaler Opposition“ umzuwandeln versuchte. Hatte ihre „Weltanschauung“ bisher im Bekenntnis zum simplen populistischen Dualismus von Volk und herrschenden Cliquen bestanden, so machte sie jetzt das „internationale Judentum“ zur Schlüsselerklärung für alle Übelstände. Die irrationalen Momente der außerparlamentarischen Opposition gegen Roosevelt verstärkten sich derart, daß die Bewegung immer deutlicher sektiererische Züge annahm. Sie glich sich damit solchen obskuren Gebilden wie den freikorpsähnlichen „Silver Shirts“ des Hitler-Bewunderers William Dudley Pelley und dem ebenfalls pronationalsozialistischen „German American Bund“ an. Coughlin fand zwar Meinungsumfragen zufolge für seine Ansichten 1938 die Zustimmung von etwa 25, im Jahr darauf immerhin noch von 15 Prozent der amerikanischen Bevölkerung. Aber man kann mit guten Gründen vermuten, daß diese — tendenziell abnehmende — öffentliche Unterstützung eher den aktuellen und konkreten Ansatzpunkten seiner Kampagnen als seinem militan© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Anti-New-Deal-Bewegungen
229
ten Antisemitismus galt. Eine Billigung von Ansichten Coughlins bedeutete auch noch längst nicht, daß man seine jeweilige Organisation aktiv unterstützte. Noch weniger konnte der Pater die Wahlentscheidung breiter Massen wesentlich beeinflussen. Wenn er auf diesem Feld irgend etwas bewirkte, dann war es höchstens ein Beitrag zur Stärkung der Republikanischen Partei in den Wahlen von 1938 und 194027. Das Scheitern der Kräfte, die man am ehesten als Vertreter eines amerikanischen Faschismus ansprechen kann, war keineswegs nur die Folge historischer Zufälle und persönlicher Unzulänglichkeiten. Der Publizist Raymond Gram Swing kam 1935 aufgrund einer intensiven Beschäftigung mit der jüngsten politischen Entwicklung Europas und Amerikas zu dem Ergebnis, daß für die Erfolge faschistischer Regime vier Bedingungen notwendig seien: erstens die Verarmung von Mittelschichten; zweitens ein Konjunkturrückgang und in seiner Folge Massenarbeitslosigkeit; drittens die Lahmlegung des demokratischen Regierungssystems; viertens das Vorhandensein einer starken kommunistischen Bewegung. Die ersten beiden Bedingungen waren in Amerika zweifellos gegeben. Den Machtzuwachs des Präsidenten sah Swing als Zeichen dafür an, daß auch in den Vereinigten Staaten die überkommene Gewaltenteilung bedroht war. Nur die vierte Voraussetzung fehlte nach seiner Ansicht völlig: eine starke, gegen das private Eigentum gerichtete Bewegung 28 . In der Tat war die bestehende Gesellschaftsordnung in Amerika auch während der Weltwirtschaftskrise niemals ernsthaft bedroht. Sombarts These hatte sich damit, was die sozialpsychologischen Effekte der offenen „frontier“ angeht, nochmals bestätigt und zugleich ihren Autor widerlegt: der deutsche Ökonom hatte damit gerechnet, daß sich eine sozialistische Arbeiterbewegung in den Vereinigten Staaten entwickeln werde, nachdem die Westwanderung räumlich und zeitlich zu Ende gekommen war. Doch so paradox es klingt: Seit der Hoffnung auf soziale Verselbständigung der Boden entzogen war, zeigte sich, daß es eine Verselbständigung von Ideologien geben kann. Als Mythos überlebte die offene Gesellschaft die Wirklichkeit der offenen Grenze. Es bedurfte freilich keiner starken eigentumsfeindlichen Bewegung in Amerika, um einen teilweise irrationalen Antikommunismus zu einem Faktor der amerikanischen Politik zu machen. Diese Entwicklung hatte mit dem „Red Scare“ von 1919/20, gipfelnd in der Verhaftung Tausender von angeblichen Revolutionären ausländischer Herkunft, den sogenannten „Palmer Raids“, begonnen. Coughlins militante Kampagnen gegen den Marxismus und alles, was er für marxistisch hielt, bildeten (neben der Tätigkeit des 1938 vom Repräsentantenhaus eingesetzten „Dies-Kommittees“ zur Untersuchung unamerikanischer Umtriebe) das historische Bindeglied zwischen dieser frühen Phase des „red baiting“ und dem McCarthyismus der fünfziger Jahre 29 . Die Wortführer des Anti-Roosevelt-Protestes bekämpften stets nur bestimmte Erscheinungsformen des Kapitalismus, nie das System selbst. Nimmt man ihren ausgeprägten Antisozialismus hinzu, so mag man sich fragen, ob nicht die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen der „etablierten“ und der © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
230
Heinrich August Winkler
„populistischen“ Opposition gegen die Politik Roosevelts bestand. Über Verbindungen zwischen der American Liberty League und Huey Long und eine Unterstützung der Union Party durch dieselbe Vereinigung hat es zwar um 1935/1936 Gerüchte gegeben, erhärten lassen aber haben sich solche Vermutungen nicht. Insgesamt kann man davon ausgehen, daß für die konservative Geschäftswelt die Protestbewegung gegen den New Deal zu „radikal“ war. Die „demagogues“, wie man sie nannte, wollten auf ihre Weise m e h r Staat, big business w e n i g e r . Schließlich fühlte sich die Geschäftswelt trotz aller Attacken auf die staatliche Wirtschaftspolitik vom New Deal nicht vital bedroht. Es gab daher keinen subjektiv zwingenden Grund, dem überkommenen politischen System die Loyalität aufzukündigen30. Anders als in Deutschland gab es in Amerika während der Weltwirtschaftskrise kein Machtvakuum, in das faschistische Massenbewegungen hätten stoßen können. Als die Krise ausbrach, stand keine organisierte Kraft bereit, die große Teile der Gesellschaft zum Kampf gegen das „System“ hätte führen können. Es gab nicht jene extremen nationalistischen Ressentiments, wie sie nur aus einer gemeinsam erlebten traumatischen Erfahrung, einem verlorenen Krieg zumal, entstehen konnten. Politischer Wandel war innerhalb des überlieferten Systems möglich: Zu Hoover gab es die Alternative Roosevelt. Und Roosevelt verfügte — im Unterschied zu Heinrich Brüning — über ein persönliches Charisma, das auch seine radikalen Gegner nicht übertrumpfen konnten. Mindestens ebenso wichtig freilich war, daß Roosevelt nicht durch äußere Faktoren wie Reparationslasten daran gehindert wurde, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Nicht zuletzt darauf war es zurückzuführen, daß es auch bei jenen Gruppen nicht zu einer länger währenden, umfassenden Radikalisierung kam, die die klassische Basis faschistischer Bewegungen in Europa bildeten: bei der Landbevölkerung und den städtischen Mittelschichten. Die Protestbewegung unter den Farmern konnte Roosevelt durch seine Hilfsmaßnahmen weitgehend neutralisieren. Zum Mißerfolg der Union Party im Jahre 1936 trug denn auch nicht zuletzt der Umstand bei, daß sich ihr eine der wichtigsten agrarradikalen Vereinigungen, die ganz in der populistischen Tradition stehende „Farmers“ Holiday Association“, nicht anschloß. „Small business“ war vor dem Zweiten Weltkrieg noch kaum organisiert: es stand ideologisch dem übrigen Unternehmertum weitaus näher als irgendeiner anderen Gruppe und teilte mit ihm die Aversion gegen Staatsinterventionen. Sein politischer Standort war eher konservativ als radikal. Die Angestellten waren von den Arbeitern politisch und ideologisch weniger unterschieden als in Deutschland und tendierten ebenso wie diese zur Demokratischen Partei F. D. Roosevelts. Eine der wesentlichen Schwächen der Protestbewegungen gegen den New Deal lag mithin darin, daß sie keine einzelne soziale Gruppe ganz oder auch nur zu erheblichen Teilen für sich mobilisieren konnten. Daß Father Coughlin die Unterstützung von Teilen der Arbeiterschaft fand, deutet andererseits auf eine größere soziale Spannweite rechtsextremer Bewegungen in Amerika hin. Auf jeden Fall scheint die Arbeiterschaft — auch nach neueren © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Anti-New-Deal-Bewegungen
231
Beobachtungen — in den Vereinigten Staaten konservativen und rechtsradikalen Parolen gegenüber anfälliger zu sein als in Europa31. Schließlich darf eine historische Grundbedingung nicht außer Betracht bleiben: Wenn die Krisenbewältigung ohne radikalen Bruch mit dem demokratischen Regierungssystem gelang, so war ein entscheidender Grund hierfür die relative Stärke der demokratischen Tradition in der amerikanischen Gesellschaft jener Jahre. Weder eine Massenbewegung noch eine breite intellektuelle Fronde stellte die Grundlagen der Verfassung in Frage. Wenn die Vereinigten Staaten — nach dem zutreffenden Urteil von Ernst Troeltsch — ihre Entstehung einer konservativen Revolution verdankten, so war dieses Ereignis einschneidend genug, um ihnen eine „konservative Revolution“ nach Art der rechten Opposition gegen Weimar zu ersparen. Historisch trifft cum grano salis zu, was Ernst Fraenkel so ausgedrückt hat: Es habe in den Vereinigten Staaten niemals ein antidemokratisches Ressentiment gegeben, weil der Sieg der Demokratie nicht mit der Niederlage einer Klasse verbunden war32. In Amerika fehlten jene feudalen und obrigkeitsstaatlichen Relikte, die in Kontinentaleuropa für den Erfolg faschistischer Bewegungen wichtiger waren als der Entwicklungsgrad des Kapitalismus in abstracto. In Italien und in Deutschland bildeten die konservativsten Kräfte im Staatsapparat und in der Landaristokratie sozusagen natürliche Bündnispartner für antidemokratische Bestrebungen in den Mittelschichten und im Unternehmerlager. In Amerika fehlten für eine solche systemsprengende Koalition die soziologischen Grundlagen. Neben Realität und Mythos der offenen Grenze ist es vor allem dieser Tatbestand, der Amerikas politische Entwicklung bis ins 20. Jahrhundert mit zu erklären vermag33. Für die Gegenwart sollten aus den Befunden der Zwischenkriegszeit allerdings keine voreiligen Schlußfolgerungen gezogen werden. Die gesellschaftliche und moralische Krise, in der sich die Weltmacht Amerika heute befindet, hat die Grundlagen des überlieferten Systems kaum weniger ernsthaft in Frage gestellt als die Weltwirtschaftskrise. Durch den Vietnamkrieg ist der nationale Konsens schwerer erschüttert worden als durch irgendein anderes Ereignis seit dem Bürgerkrieg. Das Gefühl der Entfremdung gegenüber den politischen Institutionen beschränkt sich längst nicht mehr auf den schwarzen Bevölkerungsteil. Die Renaissance des Populismus, deren Zeugen wir heute sind, äußert sich auf gegensätzliche Weise: das Unbehagen an den etablierten Mächten kann offenbar durch rassistische Demagogen ebenso genutzt werden wie durch Wortführer der sozialen Reform. Noch immer verfügt Amerika über liberale Korrektive zu den Tendenzen ängstlicher Intoleranz und militanter Beharrung — Korrektive, die stark genug sein dürften, um die Machtergreifung einer faschistischen Bewegung unmöglich zu machen. Ob die Vereinigten Staaten freilich zu jenen tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen fähig sind, ohne die insbesondere die lang verschleppte „urban crisis“ nicht überwunden werden kann, das ist eine offene Frage. Immerhin könnten die Erfahrungen der New-Deal-Periode europäische Beobachter davor bewahren, das Reformpotential Amerikas zu unterschätzen. © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
232
Heinrich August Winkler Anmerkungen
1 W. Sombart, Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus? Tübingen 1906. Daß die „offene Grenze“ nur psychologisch und nicht real den von Sombart beschriebenen Effekt hatte, dürfte heute kaum noch umstritten sein. Vgl. dazu die Bemerkungen und die Literaturangaben in dem Beitrag von P. Lösche in diesem Band. 2 E. Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche, München 1963; H. Freyer, Weltgeschichte Europas, Stuttgart 19542. 3 Vgl. hierzu etwa die Daten in dem Beitrag von J . Kocka in diesem Band. 4 A. M. Schlesinger, Jr., The Age of Roosevelt, III (The Politics of Upheaval), Boston 1960, 175—180. Zahlreiche weitere Belege aus dem liberalen Lager bei: J . J . Martin, American Liberalism and World Politics, 1931—1941, Liberalism's Press and Spokesmen on the Road Back to War between Mukden and Pearl Harbour, I, New York 1964, sowie bei A. A. Ekirch, Ideologies and Utopies, The Impact of the New Deal on American Thought, Chicago 1969. 5 Carter Glass an Walter Lippmann am 10. August 1933, zitiert bei W. Ε. Leuchten burg, F. D. Roosevelt and the New Deal 1932—1940, New York 1963, 67. 6 R. A. Brady, Business as a System of Power, New York 1943, 189—220. 7 Daß jede allgemeine Begriffsbestimmung des Faschismus ein so zentrales Element des deutschen Nationalsozialismus wie seinen militanten Antisemitismus auslassen muß, zeigt, daß auch dieser Typusbegriff in einer unaufhebbaren Differenz zur historischen Wirklichkeit steht. 8 Schlesinger, III, 191. Zur Gesamtbeurteilung des New Deal vgl. jetzt — außer den genannten Werken — besonders F. Freidel, The New Deal in Historical Perspective, Washington, D. C. 19622; O. L. Graham, An Encore for Reform: The Old Progressives and the New Deal, New York 1967; die vorzügliche Analyse von E. W. Hawley, The New Deal and the Problem of Monopoly, Princeton 1966 sowie seinen Beitrag in diesem Band. Aus der „revisionistischen“ Schule vor allem: P. W. Conkin, F. D. R. and the Origins of the Welfare State, New York 1967; B. J . Bernstein, The New Deal: The Conservative Achievements of Liberal Reform, in: ders. Hg., Towards a New Past, New York 19693, 263—288; auch: W. A. Williams, The Contours of American History, Chicago 1966, 439—461. Einen guten Überblick über den Forschungsstand gibt jetzt: P. Lösche, Revolution u. Kontinuität, Zur Auseinandersetzung um den New Deal in der amerikanischen Geschichtswissenschaft, in: Festschrift H, Herzfeld, Berlin 1972, 121—153. Vgl. aus der neueren deutschen Literatur ferner: W. J . Helbich, F. D. Roosevelt, Berlin 1971. Zu den Grenzen der Rooseveltschen Sozialpolitik am Beispiel des Wohnungsbauprogramms vgl. den Beitrag von H. Wollmann in diesem Band. 9 Vgl. dazu meinen Aufsatz: Unternehmerverbände zwischen Ständeideologie und Nationalsozialismus, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 17. 1969, 341—371 und die dort angegebene Literatur. 10 Für Deutschland: G. D. Feldman, Army, Industry and Labor in Germany 1914 to 1918, Princeton 1966; D. Petzina, Autarkiepolitik im Dritten Reich, Stuttgart 1968; für Italien jetzt: R. Sarti, Fascism and the Industrial Leadership in Italy, 1919—1940, Berkeley 1971; Κ. Brachmann, Die Bedeutung der faschistischen I deologie für den Restrukturationsprozeß des italienischen Kapitalismus: Benito Mussolini und Alfredo Rocco (Diss. Berlin), Essen 1971, 78—84; für die USA: W. E. Leuchtenburg, The New Deal and the Analogue of War, in: J . Braeman u. a. Hg., Change and Continuity in Twentieth Century America, New York 1966, 81—143. Zum internationalen Vergleich nach wie vor lesenswert und materialreich: Brady, passim. 11 Hawley, 66—132; Η. Jaeger, Die Bankiers und Roosevelts New Deal, Viertel jahresschrift für Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte 55. 1968, 214—256; V. Carosso, Washington and Wall Street: The New Deal and Investment Bankers, 1933—1940, Business History Review 44. 1970, 425—445.
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Die Anti-New-Deal-Bewegungen
233
12 Leuchtenburg, Roosevelt, 185—187. Vgl. dazu auch den Beitrag von J . Kocka in diesem Band. Über die Neger unter dem New Deal: R. Wolters, Negroes and the Great Depression, Westport 1970. 13 J . Shouse, „Progress“ vs. „Change“, American Liberty League, Document No. 2, Washington, D. C. 1934; F. Rudolph, The American Liberty League, 1934—1940, American Historical Review (AHR) 56. 1956, 19—33; G. Wolfskill, The Revolt of the Conservatives, A History of the American Liberty League, 1934—1940, Cambridge/Mass. 1962; ders. u. J . A. Hudson, All But the People, Franklin D. Roosevelt and his Critics, London 1969, 143—171. Zur Opposition im Kongreß: J . Τ. Patterson, Congressional Conservatism and the New Deal. Lexington 1967. 14 R. G. Swing, Forerunners of American Fascism, New York 1935, 134—152; W. A. Swanberg, A Biography of William R. Hearst, New York 1961; F. Lundberg, I mperial Hearst, New York 1936. 15 Dazu außer dem Beitrag von W. P. Adams in diesem Band besonders: W. E. Leuchtenburg, F. D. Roosevelt's Supreme Court Packing Plan, in: H. M. Hollingsworth u. W. F. Holmes Hg., Essays on the New Deal, Austin 1969, 69—115; R. Berger, Congress vs. Supreme Court, Cambridge/Mass. 1969; L. Baker, Back to Back, The Duel between FDR and the Supreme Court, New York 1967; E. Fraenkel, Das amerikanische Regierungssystem, Köln 19622, 186—190. 16 V. C. Ferkiss, Populist Influences on American Fascism, The Western Political Quarterly (WPQ) 10. 1957, 350—373. Kritisch hierzu: P. S. Holbo, Wheat or What? Populism and American Fascism, ebd., 14. 1961, 727—736; Ferkiss' Antwort: Populism: Myth, Reality, Current Danger, ebd., 14. 1961, 737—740. — Zu den hier nicht erörterten links-populistischen Kräften der Farmer Labor Party um den Gouverneur von Minnesota, Floyd Olson, und zu den zeitweiligen Erfolgen des Schriftstellers Upton Sinclair, der 1934 mit einem sozialistischen Programm die demokratischen Primaries für die Gouverneurswahl in Kalifornien gewann: Schlesinger, III, 96—122. Über Olson auch: G. H. Mayer, The Political Career of F. Β. Olson, Minneapolis 1951. 17 Typisch hierfür: J . D. Hicks, The Populist Revolt, Minneapolis 1931. 18 R. Hofstadter, The Age of Reform, New York 1955. 19 M. P. Rogin, The Intellectuals and McCarthy: The Radical Specter, Cambridge/ Mass. 1967. Einen Überblick über die Populismus-Debatte und die sich an Hofstadter anschließende Kritik gibt R. J . Cunningham Hg., The Populists in Historical Perspective, Boston 1968. Vgl. auch den Beitrag von H.-J. Puhle in diesem Band. 20 Über Long jetzt vor allem: T. H. Williams, Huey P. Long, New York 1969. Aus der früheren Literatur besonders: A. P. Sindler, Huey Long's Louisiana. State Politics, 1920—1952, Baltimore 1956; F. Davis, Huey Long, A Candid Biography, New York 1935; C. Beals, The Story of Huey P. Long, Philadelphia u. London 1935. Ferner: D. R. McCoy, Angry Voices, Left-of-Center Politics in the New Deal Era, Lawrence 1958, 115—158; Swing, 62—107; Schlesinger, III, 62—68. Von Long selbst vor allem: My First Days in the White House, Harrisburg 1935; Every Man a King, New Orleans 1933. Zur Wahlsoziologie Louisianas u.a.: R. Heberle, Social Movements, New York 1951, 251—259; ferner: V. O. Key, Jr., Southern Politics in State and Nation, New York 1949, 156—182. Zu den Meinungsumfragen von 1935: S. M. Lipset u. E. Raab, The Politics of Unreason, Right-Wing Extremism in America, 1790—1970, New York 1970, 192—199. 21 Über Coughlin jetzt vor allem: Ch. J . Tull, Father Coughlin and the New Deal, Syracuse 1965; D. H. Bennett, Demagogues in the Depression, American Radicals and the Union Party, 1932—1936, Brunswick 1969; J . Shenton, Fascism and Father Coughlin, Wisconsin Magazine of History 44. 1960, 6—11; ders., The Coughlin Movement and the New Deal, Political Science Quarterly (PSQ) 73. 1958, 352—373. — Zur sozialen Basis der Coughlin-Anhängerschaft: Lipset/Raab, 171—178. Von den befragten Katholiken billigten laut einem Gallup Poll 1938 42 % Coughlins Ansichten, 25 %
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
234
Heinrich August Winkler
lehnten sie ab, 33 % äußerten keine Meinung. Für die Protestanten allgemein lauten die entsprechenden Zahlen 19 %, 31 %, 50 %; für die Lutheraner 29 %, 21 %, 50 %. Siehe hierzu auch: S. M. Lipset, Three Decades of the Radical Right: Coughlinites, McCarthyites and Birchers, in: D. Bell Hg., The Radical Right, Garden City 1963, 373—446. 22 Über die Union Party und die Kandidatur Lemkes u.a.: D. Ο. Powell, The Union Party of 1936: Campaign Tactics and I ssues, Mid-America 46. 1946, 126—141; H. P. Kerr, The Rhetoric of Political Protest, The Quarterly Journal of Speech 45. 1959, 146—152; E. C. Blackorby, Prairie Rebel: The Public Life of William Lemke, Lincoln 1963; Bennett, passim; ebd., 270—272, auch eine kritische Auseinandersetzung mit S. Lubell (The Future of American Politics, New York 1956, 152), der das Votum für Lemke primär aus isolationistischen Motiven zu erklären versucht. — Nach dem Plan des Dr. Peter Townsend sollte allen Personen über 60 Jahren, die freiwillig aus dem Berufsleben ausschieden oder bereits ausgeschieden waren, eine monatliche Rente von 200 § gewährt werden — unter der Bedingung, daß sie diese Summe unmittelbar danach verbrauchten. Dadurch sollten Arbeitsplätze frei und neue Kaufkraft geschaffen werden. Das Rentensystem wollte Townsend durch eine Transaktionssteuer finanzieren. Hierzu: A. Holtzman, The Townsend Movement: Α Study in Old Age Pressure Poli tics, phil. Diss., Harvard University, Cambridge/Mass. 1952, MS; D. Η. Bennett, The Year of Old Folks Revolt, American Heritage 16. 1964, 48—51, 99—107. Zu der erfolgreichen Kampagne Coughlins und anderer I solationisten gegen einen Beitritt der USA zum Weltgerichtshof 1935: Tull, 75. 23 Über Coughlins Aktivität seit 1936 außer der in Anm. 21 genannten Literatur besonders: W. Stegner, The Radio Priest and His Flock, in: J . Leighton Hg., The Aspirin Age, 1919—1941, New York 1949, 232—257. Zum Isolationismus der Zwischenkriegszeit besonders: M. Jonas, Isolationism in America, 1935—1941, Ithaca 1966; W. S. Cole, America First, The Battle Against Intervention 1940—1941, Madison 1953. 24 Tüll, 89; Father Coughlin's Radio Sermons, October 1930—April 1931, Baltimore 1931, 81; Lipset/Raab, 178. 25 Bennett, 230, 280; Tull, 89, 176—198. 28 S. M. Lipset, „Fascism“ — Left, Right, Center; in: ders., Political Man, New York 1960, 131—179. 27 Über pronationalsozialistische Splittergruppen in USA: Schlesinger, III, 78—95; M. Schonbach, Native Fascism during the 1930“s and 1940's: A Study of its Roots, its Growth and its Decline, phil. Diss, University of California, Los Angeles 1958, MS; L. v. Bell, The Failure of Nazism in America: The German American Bund, 1936 to 1941, PSQ 85. 1970, 585—599. Über das politische Sektenwesen zusammenfassend: G. Myers, History of Bigotry in the United States, New York 1960. Kritisch zum „selective support“ für Coughlin, zur Abwanderung katholischer Wähler von den Demokraten zu den Republikanern (1938—1940) und zur Verbreitung antisemitischer Ressentiments: Lipset/Raab, 184—189. 28 Swing, 19. 29 Über die Palmer Raids vom Januar 1920, benannt nach Wilsons Justizminister A. Mitchell Palmer: R. K. Murray, Red Scare, A Study in National Hysteria 1919 to 1920, New York 1964. Zum Dies-Kommittee: D. A. Saunders, The Dies Committee: First Phase, The Public Opinion 3. 1939, 223—238. A. R. Ogden, The Dies Committee, Washington, D. C. 1945. Zum Antikommunismus allgemein: E. Latham, The Communist Controversy in Washington from the New Deal to McCarthy, New York 1965; S. Lens, The Futile Crusade, Anti-Communism as American Credo, Chicago 1964. 30 Zum Problem einer Verbindung zwischen „populistischer“ und „etablierter“ Opposition gegen den New Deal: Wolfskill, Revolt, 173, 195. 31 Zum Farmerprotest im allgemeinen und der von dem Bauernführer Milo Reno aus Iowa gegründeten Farmers' Holiday Association im besonderen vgl. außer dem © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
235 Die Anti-New-Deal-Bewegungen Beitrag von H.-J. Puhle in diesem Band vor allem: J . L. Shover, Cornbelt Rebellion, The Farmers' Holiday Association, Urbana 1964. Über die Angestellten vgl. den Beitrag von J . Kocka in diesem Band und die dort angegebene Literatur. Über „small business“ u.a.: J . H. Bunzel, The American Small Businessman, New York 1962; H. Zeigler, The Politics of Small Business, Washington, D. C. 1961; K. Mayer, Small Business as a Social Institution, Social Research 14. 1947, 332—349. Zum Vergleich der amerikanischen und der deutschen Entwicklung: Η. Α. Winkler, Mittelstand, Demo kratie u. Nationalsozialismus, Die politische Entwicklung von Handwerk und Klein handel in der Weimarer Republik, Köln 1972, 190—197. Über die Anziehungskraft, die heute die Bewegung um George Wallace auf Teile der Arbeiterschaft ausübt: Lipset/Raab, 338—427. 52 E. Troeltsch, Deutscher Geist u. Westeuropa, Tübingen 1935, 5 f.; Fraenkel, 45. Zum intellektuellen Profaschismus in Amerika u.a.: Schlesinger, III, 69—95; Α. Ε. Stone, Seward Collins and the American Review: Experiment in Pro-Fascism, 1933 to 1937, American Quarterly 12. 1960, 3—19; J . D. Diggins, Flirtation with Fascism: American Pragmatic Liberals and Mussolini's I taly, AHR 71. 1966, 487—506. 33 Zum Fehlen der feudalen und absolutistischen Elemente in Amerika besonders: L. Hartz, The Liberal Tradition in America, New York 1955; S. M. Lipset, The First New Nation, The United States in Historical and Comparative Perspective, Garden City 1967. — Das häufige Zusammenspiel von konservativen Republikanern des industrialisierten Nordens und konservativen Demokraten des agrarischen Südens blieb systemkonform. Das gilt auch für die sich aus diesen Kräften rekrutierende informelle Anti-Roosevelt-Koalition im Kongreß der Jahre nach 1938.
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Autorenverzeichnis Willi Paul Adams, Jg. 1940. 1960—68 Studium der Geschichte und Anglistik/ Amerikanistik in Bonn und Berlin; 1968 Prom.; 1968—71 Wiss. Assistent am J . F. Kennedy-Institut für Amerikastudien der Freien Universität Berlin; 1971—72 Ass. Prof.; 1972 Habil. im Fach Neuere Geschichte mit bes. Berück, der anglo-amerikanischen Geschichte; 1972 Research Fellow am Charles Warren Center for Studies in American History der Harvard Universität; 1972 Prof. am Amerika-Institut der Universität Frankfurt. Veröff.: Republikanismus u. die ersten amerikanischen Einzelstaatsverfassungen, phil. Diss. FU Berlin 1968; Republicanism in Political Rhetoric before 1776, Political Science Quarterly 85. 1970; Das Gleichheitspostulat in der amerikanischen Revolution, Historische Zeitschrift 212. 1971. Ellis W. Hawley, Jg. 1929. Studium der Geschichte; 1950 B. A. der Universität von Wichita; 1957—68 Ass. Prof. an der North Texas State University; 1968—69 Prof. an der Ohio State University in Columbus; seit 1969 Prof. für Geschichte an der Universität von Iowa, Iowa City. Veröff.: The New Deal and the Problem of Monopoly, Princeton 1966; Politics of the Mexican Labor Issue, Agricultural History, 1966; Secretary Hoover and the Bituminous Coal Problem, Business History Review 42. 1968; u. a.: Herbert Hoover and the Crisis of American Capitalism, Cambridge/Mass. 1973. Jürgen Kocka, Jg. 1941. 1960—67 Studium der Geschichte, Politikwissenschaft und Soziologie in Marburg, Wien, Chapel Hill, N. C. (USA) und Berlin (FU); Μ. Α. in Politikwissenschaft 1965 an der University of North Caro lina, Chapel Hill; 1968 Prom. FU Berlin, 1972 Habil. in Münster im Fach Geschichte; 1972 Dozent für Neuere Geschichte an der Universität Münster. Seit 1973 o. Professor für Allgemeine Geschichte u. bes. Ber. der Sozialgeschichte an der Universität Bielefeld. Veröff.: Unternehmensverwaltung u. Angestelltenschaft am Beispiel Siemens 1847—1914, Stuttgart 1969; Klassengesellschaft im Krieg, Göttingen 1973; Otto Hintze, in: H.-U. Wehler Hg., Deutsche Historiker, Bd. 3, Göttingen 1972; Karl Marx u. Max Weber, Zeitschrift f. d. gesamte Staatswissenschaft 122. 1966; Aufsätze zur deutschen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und zur Theorie der Geschichte. Peter Lösche, Jg. 1939. Studium der Geschichte, Politikwissenschaft, Geographie und Philosophie in Berlin, Göttingen und in den USA; 1966—1971 Assistent, seit 1971 Ass. Prof. an der Freien Universität Berlin; 1969—1971 German Kennedy Memorial Fellow an der Harvard University, Cambridge/ Mass.; 1972/73 Lehrstuhlvertretung an der Universität Hamburg. Veröff.: Der
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
237
Autorenverzeichnis Bolschewismus im Urteil der deutschen Sozialdemokratie 1903—1920, Berlin 1967; Aufsätze in Fachzeitschriften. Hans-Jürgen Puhle, Jg. 1940. Studium der Geschichte, Politikwissenschaft, Soziologie, Philosophie in Tübingen, Marburg und Berlin, 1966—68 Stellvert. Leiter des Lateinamerikanischen Sozialforschungsinstituts der Friedrich-EbertStiftung in Santiago de Chile; 1970—71 German Kennedy Memorial Fellow an der Harvard University, Cambridge/Mass.; Wiss. Assistent am Historischen Seminar der Universität Münster. 1973 Habil. in Münster im Fach Geschichte. Veröff.: Agrarische Interessenpolitik u. preußischer Konservatismus im Wilhelminischen Reich (1893—1914), Hannover 1966; Politik in Uruguay, Hannover 1968; Tradition u. Reformpolitik in Bolivien, Hannover 1970; Von der Agrarkrise zum Präfaschismus, Wiesbaden 1972; Hrsg., Perspectives del Progreso, Santiago 1969; Parlament, Parteien u. Interessenverbände in Deutschland 1890—1914, in: M. Stürmer Hg., Das Kaiserliche Deutschland, Düsseldorf 1970; Aufsätze zur deutschen und lateinamerikanischen Geschichte. Hellmut Wollmann, Jg. 1936. Assessor, Wiss. Assistent und Lehrbeauftragter am Institut für Politische Wissenschaft Heidelberg; zur Zeit Habil.-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Veröff.: Stellung der parlamentarischen Minderheiten in England, der Bundesrepublik Deutschland u. Italien, Den Haag 1971; ,Citizen Participation' in USA; Tendenzen der SowjetDemokratie, in: U. Bermbach Hg., Theorie u. Praxis der direkten Demokratie, Opladen 1973. Heinrich August Winkler, Jg. 1938. 1957—63 Studium der Geschichte, des Öffentlichen Rechts, der Philosophie und Politikwissenschaft in Münster, Heidelberg, Tübingen; Prom. 1963; 1964—1970 Assistent an der Freien Universität Berlin; 1967/68 u. 1970/71 German Kennedy Memorial Fellow an der Harvard University, Cambridge/Mass.; 1970 Habil.; 1970—72 Prof. am Fachbereich Politische Wissenschaft der FU Berlin; seit 1972 o. Professor für Neuere u. Neueste Geschichte an der Universität Freiburg i. Br.; Veröff.: Preußischer Liberalismus u. deutscher Nationalstaat, Tübingen 1964; Mittelstand, Demokratie u. Nationalsozialismus, Köln 1972; Pluralismus oder Protektionismus? Wiesbaden 1972; Gesellschaftsform u. Außenpolitik, Historische Zeitschrift 214. 1972; Aufsätze zur deutschen und vergleichenden Sozialgeschichte.
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Abkürzungsverzeichnis AAA
Agricultural Adjustment Act
ABA
American Bar Association
ABAJ
American Bar Association Journal
ACTU
Association of Catholic Trade Unionists
ACPF
American Commonwealth Political Federation
ACWA
Amalgated Clothing Workers of America
AER
American Economic Review
AFBF
American Farm Bureau Federation
AFL AH
American Federation of Labor
AHR
American Historical Review
ALP
American Labor Party-
APSR
American Political Science Review
BHR
Business History Review
CH CIO
Current History
CS
Common Sense
EPIC
End Poverty in California
ESS FDR
Encyclopedia of the Social Sciences
FERA
Federal Emergency Relief Administration
FHA FLP
Federal Housing Administration
FLPF
Farmer — Labor Political Federation
FSA
Farm Security Administration
FU
Farmers' Union
FWISU
Federation of Westinghouse Independent Salaried Unions
Hist. Stat.
Historical Statistics
Agricultural History
Congress of Industrial Organisation
Franklin Delano Roosevelt
Farmer Labor Party
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Abkürzungsverzeichnis HOLC
Home Owners Loan Corporation
JHI
Journal of the History of Ideas
JP JSH
Journal of Politics
LHC
Labour Housing Conference
LIPA LNPL
League for Independent Political Action Labor's Non-Partisan League
MVHR
Mississippi Valley Historical Review
NAREB
National Association of Real Estate Boards
NIRA
National Industrial Recovery Act
NLRA
National Labor Relations Act
NLRB
National Labor Relations Board
NPHC
National Public Housing Conference
NPL
Non Partisan League
NRA
National Recovery Administration
NYR
New York Review of Books
PAC
Political Action Committee
PSQ
Political Science Quarterly
239
Journal of Southern History
PWA
Public Works Administration
RCIPA
Retail Clerks' International Protective Association
RFC
Reconstruction Finance Corporation
SAQ
South Atlantic Quarterly
STFU
Southern Tenant Farmers' Union
SWSSQ
South West Social Sciences Quarterly
TVA
UOPWA
Tennessee Valley Authority United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America United Office and Professional Workers of America
URWEA
United Retail and Wholesale Employees of America
ÜSDA
U.S. Department of Agriculture
VfZ
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
WIB WPA
War Industries Board Works Progress Administration
WPQ
Western Political Quarterly
UAW
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Personenregister Autoren sind nur aufgeführt, soweit sie im Text namentlich erwähnt sind. Nicht enthalten sind solche Personennamen, die nur in Gesetzestiteln oder als Bezeichnung juristischer Streitfälle (z. B. „Wagner Act“, „US vs. Butler“) erscheinen. Kursiv gesetzte Seitenzahlen beziehen sich auf den Anmerkungsteil. Abrams, Charles 179, 187 Alfred, Helen 159, 169, 171 Amlie, Thomas 131, 151 f. Appleby, Paul 149 Arnold, Thurman 31, 197, 206, 215 Barrett, Charles S. 144 Bauer, Catherine 170, 187 Beard, Charles A. 115, 198 Bchnke 77 Berle, Adolf A. 179 f. Berry, George L. 103 f. Beutel, Frederic 198 Bingham, Alfred 129, 151 Black, Hugo L. 208 Black, John D. 122, 146 f. Bohn, Ernest J . 185 Bollens, L. F. 79 Bosh, J . H. 151 Boudin, Louis 190 Brady, Robert F. 217 f. Brandeis, Louis D. 14, 117, 128, 150, 194, 198, 208, 212 Brody, D. 106 Brown, Heywood 77 Brüning, Heinrich 230 Bryan, William J . 113, 137 ff. Burrows, J . 137 Butler, Pierce 193 f., 208, 211 Byrd, Harry F. 175, 186 Capper, Arthur 125, 144 Cardozo, Benjamin N. 194, 196, 208 Chavez, Cesar 149 Clark, Charles Ε. 197, 201 Cleveland, Stephen G. 136 Cohen, Felix 197 Cohen, Max 104 Commons, John 198 Cooley, Thomas 193 Coolidge, Calvin 121, 144
Coughlin, Father Charles E. 43, 130 f., 143, 224—230, 233 f. Coulter 47, 51 Croly, Herbert 14, 117 Corwin, Edward S. 198, 215 Cummings, Homer S. 213 Dalrymple 75 Davis, Chester C. 147, 149 De Forest, R. W. 183 Dennett, C. P. 37 Devaney, John P. 215 Dewey, John 129 Dies, Martin 104, 229 Donnelly, I gnatius 137 Douglas, William O. 197, 208 Dubinski, David 81, 89, 103 Eddy, Arthur 14 Emspak, Julius 91, 104 Engels, Friedrich 95, 105 Ezekiel, Mordechai 22, 95, 146 f. Farley, James 89 Fortas, Abraham 215 Fraenkel, Ernst 231 Franco, Francisco 226 Frank, Jerome 149, 197 Frankensteen, Richard 93 Frankfurter, Felix 200 f., 208, 215 Frazier, Lynn 124 f., 143 Freed, Allie 37 Fuller, Lon 197 Gardner, Jackson 149 Glass, Carter 217, 232 Goebbels, Joseph 227 Gompers, Samuel 97 Grant, Ulysses S. 214 Gray, Chester H. 144 Greely, William 15
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Personenregister Green, Theodore F. 214 Green, William 75, 96, 105 Greenstone, J . D. 103 Gresham, J . N. 142 Hamilton, Alexander 110, 221 Hamilton, Walton H. 215 Handling, Ο. 138 Hanna, Mark 96 f., 113, 117 Harding, Warren G. 121, 142, 194 Harriman, W. Averell 37 Harriman, Henry 37 Harrington, Michael 179 Hart, Henry 212 Harvey, W. H. 136 Haugen, Gilbert N. 121 f., 125 f., 141 Hawley, Ellis W. 37, 97 Hearst, William R. 221 Heflin, Thomas 144 Hilferding, Rudolf 8 Hillman, Bessie 103 Hillman, Sidney 81, 88 f., 103 f. Hiss, Alger 149 Hitler, Adolf 7, 91, 207, 217, 221, 223, 226, 228 Hofstadter, Richard 222, 233 Holmes, Oliver W. 197 f. Hoover, Herbert 15—18, 20 f., 35 f., 121, 123 f., 140, 146, 162 ff., 165, 178, 190, 195, 230 Hopkins, Harry 146 Housewright, Vernon A. 73 Howard, Ebenezer 168 Howard, J . R. 144 Howe, Frederick 149 Hughes, Charles E. 194, 196, 204, 211 Hull, Cordell 126 Hurley, Edward 14 Jackson, Andrew 100 f., 109, 111 ff. Jackson, Gardner 149 Jackson, Robert H. 201, 210, 212, 214 Jefferson, Thomas 23, 109 ff., 113, 116, 157, 168, 199 Johnson, Andrew 206, 214 Johnson, Douglas 207 Johnson, Hugh S. 20 f., 121, 147, 191, 213 Johnson, Lyndon B. 117, 185 Jordan, Virgil 37 Kaliski, Julius 104 Kanitz, Hans Graf von 121, 144 Kelly, Ο. Η. 111 Kendrick, John B. 144
241
Kennedy, John F. 117 Kennedy, Joseph 37 Kennedy, Thomas 93 Kenyon, William S. 144 Keynes, John Maynard 29 ff., 99, 180, 187, 219 Kolko, Gabriel 105, 134, 153 Kramer, Dale 152 La Follette, Philip F. 131, 151 f., 215 La Follette, Robert M., jr. 117, 119 f., 124 f., 129, 131, 139, 143 f., 151 f. La Guardia, Fiorello H. 148, 151 Landon, Alfred M. 151, 205, 220 Langer, William 124, 130, 143, 146, 151 Laski, Harold 133 Lassalle, Ferdinand 101 Lease, Mary E. 137 Lemke, William 124, 130 f., 143, 151, 226, 234 Lerner, Max 199 Lewis, John L. 79 Likert, Rensis 148 Lincoln, Abraham 220 Lippmann, Walter 232 Llewellyn, Karl 197 Locke, John 110, 113, 134 Loftin, Scott M. 213 Long, Huey 43, 115, 125, 131, 139, 145, 223 ff., 230, 233 Lord, Russell 184 Lundeen, Ernest 151 Macune, C. W. 112, 137 Magruder, Calvert 214 Marx, Karl 105, 206 McAdoo, William G. 125 McCardle 214 McCarthy, Joseph 222, 229 McConnell 149 McKinley, Arthur 137 f. McNary, Charles 121 f., 125 f., 141 McReynolds, James C. 193 f. Merrill, Lewis 63, 79 Miller, N. L. 213 Moley, Raymond 146 Morgan, Arthur E. 25 Morgan, John P. 125 Morgenthau, Henry, jr. 146 f., 219 Moynihan, D. P. 185 Murphy, Frank 92, 208, 227 Murray, Philip 94, 131 Mussolini, Benito 221, 226
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Personenregister
242 Norbeck, Peter 125 Norris, George 125, 130, 144, 151 Nye, Gerald 125
Ogburn, Carlton 215 Oliphant, Herman 197 Olson, Floyd Β. 43, 124, 129 f., 146, 151, 231 Palmer, A. Mitchell 229, 234 Peek, George N. 121 ff., 147 Peffer, W. A. 137 Pelley, William D. 228 Perkins, Frances 180 Peron, Juan 227 Podell, David 201 f., 212 Potovsky, Jacob 89, 103 f. Pound, Roscoe 197 f., 212 Powell, Thomas R. 197 Pressman, Lee 149 Pritchett, Herman C. 193 f. Raab, Earl 227 Ransdell, J . P. 144 Ransom, William L. 202, 213 Reed, Stanley 208, 213 Reno, Milo 123 ff., 129 f., 145 f., 152, 234 Renschen 73 Richberg, Donald 38 Riis, Jacob A. 157, 183 Riley, Fletcher, 213 Roberts, Owen J . 194, 196, 207, 215 Rodman, Seiden 129 Roosevelt, Franklin D. 7 ff., 17 f., 20—25, 29 ff., 36, A2 f., 46 f., 55, 63, 70 f., 82, 88, 89 f., 92 f., 97, 99, 103 f., 107 f., 122—125, 128—132, 134, 139 f., 142, 146 f., 149, 151, 153, 164, 168, 172 f., 175, 180, 186 ff., 190 f., 200 f., 205 bis 208, 215, 216—221, 223—226, 228 ff., 232, 235 Roosevelt, Theodore 14, 117 f., 140, 159 Roper, Daniel C. 145, 213 Rose, Alex 89 Rosenblum, F. 151 Rousseau, Jean-Jacques 136 Ruml, Beardsley 147 Sapiro, A. 142 Schleicher, Kurt von 219 Schlesinger, Arthur M., jr. 82, 102, 219 Schmidt, W. S. 185 Schubert, Glendon 194 Sharp, Malcolm P. 215
Shea, Francis 149 Shipstead, Henrik 125, 143 Shouse, Jouett 220 Simkhovitch, Mary 159, 169, 171 Simpson, Jerry 137 Simpson, John A. 145 Sinclair, Upton 43, 131, 233 Sloan, Alfred P., jr. 37 Smith, Alfred Ε. 123, 160 f., 183, 220 Smith, Ellison 125, 144 Smith, Gerald L. K. 43, 226, 228 Smith, Η. Η. 213 Sombart, Werner 92, 99, 216, 229, 232 Spencer, Herbert 155 Spillman, W. J . 147 Stalin, Josef 91 Steagall, Henry B. 172 Stevens, R. 211 Stewart, Ch. L. 144 Stinchfield, Frederick H. 207 Stone, Harlan F. 194, 197 f., 205 Stone, J . F. 217 Stourzh, Gerald 210 Straus, Nathan 185 Sumner, William G. 139 Sutherland, George 135, 193 f., 208 Swan, Thomas W. 197 Swing, Raymond G. 229 Swope, Gerard 37, 91, 96, 104 f. Taft, William H. 197 Taylor, Bob 137 Teigan, H. G. 143 Thomas, Elmer 125 Tillman, Benjamin F. 137 Townley, A. C. 143 Townsend, Peter 43, 131, 226, 234 Troeltsch, Ernst 231 Troy, Leo 52 Tugwell, Rexford G. 22, 25, 82, 127, 147 ff., 180, 187 Turner, Frederick J . 134, 182 Van Devanter, Willis 193 f., 208 Veiller, Laurence 156 ff., 182 f. Wagner, Robert F. 22, 172 f., 175, 185 f. Wallace, George 115, 134, 139, 235 Wallace, Henry 118, 126, 142 Wallace, Henry A. 118, 124, 142, 146, 148 f. Wallace, Henry C 118, 121 f., 142 Walsh, David J . 186 Warren, George F. 146 f.
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
Personenregister Watson, Thomas 37, 137 f. Weaver, James B. 13S 137 Weller, Lemuel H. 137 Wheeler, Burton K. 125 White, Η. 136 Williams, Appleman W. 95, 134 Wilson, M. L. 122, 128, 146 f., 168 Wilson, Woodrow 14, 117, 137, 139 f.,
194, 234 Winthrop, Aldrich 37 Wolchok 74 Young, Arthur H. 96 Zaritzky, Max 81
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
243
KRITISCHE STUDIEN ZUR GESCHICHTSWISSENSCHAFT Herausgegeben von Helmut Berding, Jürgen Kocka, Hans-Christoph Schröder, Hans-Ulrich Wehler Band 1
Wolfram Fischer Wirtschaft und Gesellschaft im Zeitalter der Industrialisierung Vorträge — Aufsätze — Studien 1972. 547 Seiten, Paperback
Band 2
Wolfgang Kreutzberger Studenten und Politik 1918—1933 Der Fall Freiburg im Breisgau 1972. 239 Seiten, Paperback
Band 3
Hans Rosenberg Politische Denkströmungen im deutschen Vormärz 1972. 142 Seiten, Paperback
Band 4
Rolf Engelsing Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel- und Unterschichten 1972. 314 Seiten, Paperback
Band 5
Hans Medick - Naturzustand und Naturgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft
Die Ursprünge der bürgerlichen Sozialtheorie als Geschichtsphilosophie und Sozialwissenschaft bei Samuel Pufendorf, John Locke und Adam Smith 1972. 330 Seiten, Paperback Band 7
Helmut Berding Napoleonische Herrschafts- und Gesellschaftspolitik
Die französischen Dotations-Domänen im Königreich Westfalen 1807—1813 1973. Etwa 148 Seiten, Paperback
Band 8
Jürgen Kocka - Klassengesellschaft im Krieg Deutsche Sozialgeschichte 1914—1918 1973. Etwa 200 Seiten, Paperback
Band 9
Organisierter Kapitalismus Voraussetzungen und Anfänge Herausgegeben von Heinrich August Winkler. Mit Beiträgen von Gerald D. Feldmann, Gerd Hardach, Jürgen Kocka, Charles S. Maier, Hans Medick, Hans-Jürgen Puhle, Volker Sellin, Hans-Ulrich Wehler, Bernd-Jürgen Wendt, Heinrich August Winkler 1973. Etwa 220 Seiten, Paperback
VANDENHOECK & R U P R E C H T I N G Ö T T I N G E N U N D © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN E-Book: 978-3-647-35957-1
ZÜRICH