Die Einheitlichkeit der Bewertung im Konzernabschluß [1 ed.] 9783428491490, 9783428091492
138 74 20MB
German Pages 201 Year 1997
Polecaj historie
Citation preview
LAZARUS F. XENIDES
Die Einheitlichkeit der Bewertung im Konzernabschluß
Schriften zur wirtschaftswissenschaftlichen Analyse des Rechts herausgegeben von
Heinz Grossekettler, Münster· Bernhard Großfeld, Münster Klaus J. Hopt, Hamburg . Christian Kirchner, Berlin Dieter Rückle, Trier· Reinhard H. Schmidt, Frankfurt/Main
Band 30
Die Einheitlichkeit der Bewertung im Konzernabschluß Von Lazarus F. Xenides
Duncker & Humblot · Berlin
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Xenides, Lazarus F.: Die Einheitlichkeit der Bewertung im Konzernabschluß / von Lazarus F. Xenides. - Berlin : Duncker und Humblot, 1997 (Schriften zur wirtschaftswissenschaftlichen Analyse des Rechts ; Bd. 30) Zug!.: Münster (Westfalen), Univ., Diss., 1996 ISBN 3-428-09149-3
D6
Alle Rechte vorbehalten © 1997 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: Klaus-Dieter Voigt, Berlin Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Germany ISSN 0935-5065 ISBN 3-428-09149-3
e
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706
Meinen Eltern
Vorwort Die verbundenen Unternehmen und die besonderen Probleme, die ihr Bestand für die Rechtsordnung bedeutet, haben in den vergangenen Jahren mehrfach im Mittelpunkt rechts wissenschaftlicher Forschung gestanden. Trotzdem hat sich diese Forschung fast immer auf die Fragen der Konzernhaftung und der Konzernorganisation beschränkt, während die für das tiefgreifende Verständnis auch dieser beiden Bereiche grundlegende Problematik der Konzernrechnungslegung als Betätigungsfeld der Wirtschaftswissenschaften verstanden und dementsprechend vernachlässigt wurde. Der grundlegende Umbruch, der durch die Globalisierung der Wirtschaft seit einigen Jahren eingetreten ist, zwingt zum Umdenken. Im globalisierten Markt der Zukunft, in dem nicht bloß die Geschäftspartner, sondern auch die Aktionäre einer Aktiengesellschaft selbst Global Players sind, wird auch die Frage nach derem Rechtsschutz anders gestellt sein: Die erste und wichtigste Frage für deren effektiven Rechtsschutz wird in der angemessenen, sachkundigen und zuverlässigen unternehmensbezogenen Information bestehen. Das Konzernbilanzrecht erweist sich mithin nicht nur als eine notwendige Waffe im Arsenal des Wirtschaftsrechtlers, sondern auch als unabdingbares Gespann für das Konzernhaftungs- und Konzernorganisationsrecht. Vorliegende Arbeit versteht sich als einen Beitrag in diese Richtung. Sie hat im Wintersemester 1996/97 der Westf. Wilhelms-Universität Münster als Dissertation vorgelegen. Das Manuskript wurde im Oktober 1996 abgeschlossen. Später erschienene Literatur (jedoch bis zum Januar 1997) wurde in den Fußnoten berücksichtigt. Meinem Doktorvater, Prof. Dr. Bernhard Groß feld, der die Arbeit angeregt und stets mit unermüdlicher Zuwendung betreut hat, bin ich zu herzlichem Dank verpflichtet. Danken mächte ich ferner Herrn Prof. Dr. Dieter Birk für die schnelle Anfertigung des Zweitgutachtens. Ebenso danke ich Herrn Prof. Dr. Dieter Rückle und dem Verlag Duncker & Humblot für die Aufnahme meiner Arbeit in die Schriftenreihe. Münster, im Mai 1997
Lazarus F. Xenides
Inhaltsverzeichnis Einleitung: Die Einheitliche Bewertung im Gefüge des Konzernabschlusses . 17 I. Wesen und Funktionen des Konzernabschlusses ........................
17
11. Einheitliche Bewertung als Bestandteil des Konzernabschlusses . . . . . . . . ..
19
Kapitel A
Entstehungsgeschichte und Anwendungsbereich von § 308 HGB
23
I. Entstehungsgeschichte von § 308 HGB ...............................
1. Der frühere Maßgeblichkeitsgrundsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. Angloamerikanischer Einfluß ..................................... a) Vereinigte Staaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. b) Großbritannien ............................................... 3. 7. EG-Richtlinie ................................................. 4. Umsetzung der Richtlinie - § 308 HGB ............................
23 23 25 26 28 30 33
11. Anwendungsbereich von § 308 HGB .................................
35
Kapitel B
Einheitlich Bewerten
38
1. Methodenfreie und methodische Bewertung ......................... 2. Begriff der Bewertungsmethode ....................... . . . ......... 3. Bewertungswahlrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a) Wahlrechte und Bewertungsspielräume .......................... b) Wahlrechte und Sachverhaltsgestaltungen ........................ 4. Ansatzwahlrechte ............................. . ...... . ........... 5. Bewertungsregeln des Mutterunternehmens .........................
38 38 39 42 43 45 46 49
11. Einheitliche Ausübung der anwendbaren Bewertungsmethoden .......... 1. Leitlinien der Bewertungseinheitlichkeit im Konzern ................. a) Fiktion rechtlicher Einheit ..................................... b) Zeitliche und sachliche Stetigkeit ............................... c) Einzelbewertungsgrundsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. d) WilIkürverbot ............................................ .. .. e) Wirtschaftlichkeit der Konzernrechnungslegung .................. f) Wortsinnargument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
51 52 52 55 57 60 62 64
I. Auf den Konzernabschluß anwendbare Bewertungsmethoden ............
10
Inhaltsverzeichnis 2. Bestimmung der Bewertungseinheitlichkeit durch die Generalnorm a) Generalnorm als "Overriding Principle" der Rechnungslegung . . . . .. b) Einheitliche Bewertung als Ausfluß der durch die Generalnorm determinierten Zweckbestimmung der Wertfindung ...............
66 66
III. Einheitlichkeit der Bewertung im lahresabschluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
77
IV. Zwischenergebnis ..................................................
80
72
Kapitel C
Neubewertungspflicht
82
I. Wiederaufleben der Bewertungswahlrechte - Handelsbilanz 11 ........... 1. Wiederaufleben der Bewertungswahlrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. Handelsbilanz 11 .................................................
82 82 84
11. Freiwillige Neubewertung beim Mutterunternehmen ....................
86
III. Neubewertungspflicht bei Abweichungen von den Bewertungsmethoden des Konzerns ...................................................... 1. Pflicht zur Neubewertung - Inhalt und Ausmaß ..................... 2. Neubewertung bei inländischen Tochterunternehmen ................. 3. Neubewertung bei ausländischen Tochterunternehmen ................
89 89 91 92
Kapitel D
Einschränkungstatbestände
96
I. Abweichende Bewertung bei der Einbeziehung von Banken und Versicherungsunternehmen .................................................. 96 1. Sachliche Differenzierungen bei der Rechnungslegung von Banken und Versicherungsunternehmen ........................................ 96 2. Übernahme von Wertansätzen der Banken .......................... 97 3. Übernahme von Wertansätzen der Versicherungsunternehmen ......... 100 11. Wesentlichkeitsgrundsatz ........................................... . 102 III. Abweichungen in Ausnahmefallen ................................... 104 IV. Übernahme von Wertansätzen nach steuerlichen Vorschriften ............ 1. Die Konzeption des § 308 Abs. 3 HGB ............................ a) Die umgekehrte Maßgeblichkeit im deutschen Bilanzrecht ......... b) Das Mitgliedstaaten-Wahlrecht des Art. 29 Abs. 5 der 7. EG-Richtlinie ....................................................... " 2. Steuerrechtlich zulässige niedrigere Wertansätze und Sonderposten .... a) Unterlassene Zuschreibungen ................................... b) Steuerrechtliche Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. c) Steuerrechtliche Wertberichtigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. d) Unversteuerte Rücklagen ......................................
107 107 107 108 109 109 109 110 111
Inhaltsverzeichnis
11
3. Nachholung steuerrechtlicher Sachverhalte .......... . . . . . . . . . . . . . . .. 111 4. Entsprechende Sachverhalte bei ausländischen Unternehmen und PersonenhandelsgeseUschaften ......................................... 113 5. Angaben im Konzernanhang 114
Kapitel E Erweiterungstatbestände
116
1. Währungsumrechnung .............................................. 1. Das Umrechnungsproblem ........................................ 2. Umrechnungskurse - Umrechnungsmethoden ....................... a) Umrechnungskurse .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. b ) Umrechnungsmethoden ........................................ aa) Auf der globalen Theorie basierende Umrechnungs methoden . .. (1) Fristigkeitsmethode (current - non current method) ....... (2) Umrechnung nach dem Geldcharakter der Bilanzpositionen (monetary - non-monetary method) ..................... (3) Zeitbezugsmethode (temporal principle of translation) ..... bb) Auf der lokalen Theorie basierende Umrechnungsmethoden .... (1) Reine Stichtagskursmethode ............................ (2) Modifizierte Stichtagskursmethode ...................... cc) Kombination von globaler und lokaler Theorie: Die funktionale Umrechnungsmethode ..................................... 3. Währungsumrechung und konzerneinheitliche Bewertung .............
116 116 117 117 119 119 120
11. Konsolidierungsvorgänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. Kapitalkonsolidierung ............................................ a) Kapitalkonsolidierung nach der Erwerbsmethode ................. aa) Buchwertmethode .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. bb) Neubewertungsmethode .................................... cc) Einheitliche Bewertung bei der Kapitalkonsolidierung nach der Erwerbsmethode ......................................... . b) Kapitalkonsolidierung nach der Interessenzusammenführungsmethode 2. Schuldenkonsolidierung .......................................... 3. Zwischenergebniselirninierung ..................................... 4. Aufwands- und Ertragskonsolidierung ..............................
131 132 133 134 135
121 123 124 125 126 127 128
136 138 139 140 143
III. Einheitliche Bewertung bei Gemeinschaftsunternehmen ................ . 144 1. Begriff des Gemeinschaftsuntemehmens - Quotenkonsolidierung ..... . 144 2. Konzerneinheitliche Bewertung bei Gemeinschaftsunternehmen ....... 146 IV. Einheitliche Bewertung bei Anwendung der Equity-Methode ............ 1. Definition, Anwendungsbereich und Merkmale der Equity-Methode ... 2. Einheitliche Bewertung ........................................... 3. Angaben im Konzernanhang .................................... . .
147 147 149 152
Inhaltsverzeichnis
12
Kapitel F Einheitliche Bewertung und Konzernbilanzpolitik
153
I. Konzerneinheitliche Bewertung als Instrument der Konzernbilanzpolitik 153 1. Möglichkeit für eine eigenständige Konzernbilanzpolitik ............. 153 2. Grenzen der konzernbilanzpolitischen Ausrichtung der Bewertung im Konzernabschluß ................................................ 155
11. Konzerneinheitliche Bewertung und kapitalmarktorientierte Rechnungs-
legung - Aufstellung von Konzernabschlüssen nach den US-GAAP oder lAS .............................................................. 1. Zwang zur Internationalisierung der Rechnungslegung ............... 2. Bewertungspolitischer Handlungsspielraum bei der Aufstellung internationaler Konzernabschlüsse ....................................... a) Bilanzieller Aussagewert als Voraussetzung für den gesellschaftsrechtlichen Gläubigerschutz ................................... . b) Aussagefähige Konzernabschlüsse durch konzerneigene GoB . . . . . . . 3. Gesetzgeberischer Lösungsansatz - Entwurf eines Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetzes ..............................................
158 158 161 161 165 167
Zusammenfassung ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 171 Literaturverzeichnis ................................................... 175 Rechtsprechungsverzeichnis
198
Sachwortverzeichnis .................................................. . 199
Abkürzungsverzeichnis a.A. ABI. EG Abs. A/D/S a.E. a. F. AG AktG Art. BB BBK Bd. Beck'scher BK Beck'sches HdR BFuP BGBI. BGH BiRiLiG BMJ BoHR BR BT bzw. DB DBW ders. d.h. dies. Diss. DM DÖV Drucks. EC EG EGHGB EStDV EStG etc.
anderer Auffassung Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Absatz Adler / Düring / Schmaltz am Ende alte Fassung Aktiengesellschaft Die Aktiengesellschaft (Zeitschrift) Aktiengesetz vom 6. September 1965 Artikel Der Betriebs-Berater Buchführung, Bilanz, Kostenrechnung (Zeitschrift) Band Beck'scher Bilanz-Kommentar Beck'sches Handbuch der Rechnungslegung Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis Bundesgesetzblatt Bundesgerichtshof Bilanzrichtlinien-Gesetz vom 19. 12. 1985 Bundesministerium der Justiz Bonner Handbuch der Rechnungslegung Deutscher Bundesrat Deutscher Bundestag beziehungsweise Der Betrieb Die Betriebswirtschaft derselbe das heißt dieselbe, dieselben Dissertation Deutsche Mark Die Öffentliche Verwaltung Drucksache European Community (Communities) Europäische Gemeinschaften Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung vom 28. Juli 1992 Einkommensteuergesetz vom 7.9.1990 et cetera
14 EU EuGH EuZW EWGV/EGV
f. FASB ff. fifo FS GAAP GAktG GEFIU gern. GmbH GmbHG GmbHR GoB GuV HdKR HdR HFA HGB Hrsg. hrsg. lAS IASC IDW IOSCO i. S. i. v.m. JuS JZ KG KGaA lifo m.w.N. NJW No. Nr. OECD para. PublG Rabe1sZ RegE.
Abkürzungsverzeichnis Europäische Union Europäischer Gerichtshof Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. 3. 1957 folgende (Seite) Financial Accounting Standards Board folgende (Seiten) First in - first out Festschrift Generally Accepted Accounting Principles griechisches Aktiengesetz (Gesetz 219011920) Gesellschaft für Finanzwirtschaft in der Unternehmensgruppe e. V. gemäß Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung vom 20. April 1892 GmbH-Rundschau Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Gewinn- und Verlustrechnung Handbuch der Konzernrechnungslegung Handbuch der Rechnungslegung Hauptfachausschuß des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 Herausgeber herausgegeben International Accounting Standards International Accounting Standards Committee Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. International Organization of Securities Commissions im Sinne in Verbindung mit Juristische Schulung Juristenzeitung Kommanditgesellschaft Kommanditgesellschaft auf Aktien Last in - first out mit weiteren Nachweisen Neue Juristische Wochenschrift Number Nummer Organization for International Cooperation and Development paragraph Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und Konzernen vom 15. August 1969 (Publizitätsgesetz) Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht Regierungsentwurf
Abkürzungsverzeichnis RIW Rn Rs. S. s. SABI
sch. SEC SFAS Sig. Sp. SSAP StuW subs. supp!. Tz. u.a. u.s.w. VersBiRiLiG vg!. Vo!. WM WP WPg
z.B. ZBB ZEuP ZfB ZtbF ZfhF ZGR ZIP ZVgIRWiss
15
Recht der Internationalen Wirtschaft Randnummer Rechtssache Seite section Sonderausschuß Bilanzrichtlinien-Gesetz des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. schedule Securities Exchange Commission Statement of Financial Accounting Standards Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs und des Gerichts erster Instanz Spalte Statement of Standard Accounting Practice Steuer und Wirtschaft subsection supplement Textziffer unter anderem und andere und so weiter Versicherungsbilanzrichtlinien-Gesetz vom 24.6.1994 vergleiche Volume Wertpapier-Mitteilungen (Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht) Wirtschaftsprüfer Die Wirtschafts prüfung zum Beispiel Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft Zeitschrift für Europäisches Privatrecht Zeitschrift für Betriebswirtschaft Zeitschrift für betriebs wirtschaftliche Forschung Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft
Einleitung: Die Einheitliche Bewertung im Gefüge des Konzernabschlusses I. Wesen und Funktionen des Konzernabschlusses Die selbständige Handelsgesellschaft, vor allem die selbständige Kapitalgesellschaft wird mehr und mehr die Ausnahme. Im Laufe der Unternehmenskonzentration werden immer mehr Unternehmen in Unternehmensverbänden einbezogen 1. Das konzernierte Unternehmen behält zwar seine rechtliche Selbständigkeit und bleibt somit das primäre, wenn nicht sogar ausschließliche (vgl. etwa §§ 302, 317 AktG) Zugriffsobjekt der Ansprüche seiner Gläubiger, Anteilseigner und Arbeitnehmer; in der Regel verliert es aber seine wirtschaftliche Selbständigkeit2 • Das ganze Produktions- und Finanzgebaren innerhalb der Unternehmensgruppe unterliegt den Weisungen des Mutterunternehmens, die in der Regel von den Bedingungen des Marktes abweichen3 . Somit aber verliert der Jahresabschluß des einzelnen Konzernunternehmens an Aussagefähigkeit, da er nicht auf den Umfang der konzerninternen Lieferungen, Leistungen und Liquiditätsverschiebungen oder auf die Intensität der finanziellen Verflechtungen mit anderen Konzernunternehmen schließen läßt4 • Der Ablauf dieser Vorgänge kann dagegen nur in einem Gesamtabschluß des Konzerns in seinen Dimensionen und in seiner Komplexität erfaßt werdenS. 1 V gl. Großfeld, Aktiengesellschaft, Unternehmenskonzentration und Kleinaktionär, Tübingen 1968. Nach einer Studie aus dem Jahre 1993 betrug der Anteil der konzernierten Aktiengesellschaften in Deutschland 73,61 %; bezüglich des Nennkapitals betrug ihr Anteil sogar 96,3 % (Angaben aus Ordelheide, Germany. Group Accounts, in: Ordelheide/KPMG (Hrsg.), Transnational Accounting, Bd. I, S. 1547, 1555). 2 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 16f. 3 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 215, Rn 519; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 16f.; Jonas, Der Konzernabschluß, Stuttgart 1986, S. 72f.; Kropff, Aktiengesetz, 1965, Düsseldorf 1965, S. 436; zum Wesen des Konzerns als Spannungsfeld zwischen Unternehmen und Markt siehe, Schildbach, Der handelsrechtliche Konzernabschluß, 4. Auflage, München/Wien 1996, S. 1 ff. 4 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 215, Rn 519; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 19ff. 5 V gl. Reuter, Analyse von Weltabschlüssen nach Bilanzrichtlinien-Gesetz, zm 1988, S. 285. 2 Xenides
18
Einleitung
Denn der Konzernabschluß ennöglicht die Darstellung des Konzerns als Ganzes unter Herausrechnung der innerkonzernlichen Beziehungen (Fiktion der rechtlichen Einheit des Konzerns - § 297 Abs. 3 Satz 1 HGB)6. Erst durch die Offenlegung der innerkonzernlichen Verflechtungen im Konzernabschluß können auch die Posten in den Jahresabschlüssen der Konzernunternehmen nachvollzogen werden; die Einzelabschlüsse von konzernierten Unternehmen sind nur zusammen mit dem Konzernabschluß der Gesamtgruppe verläßlich 7 . Der Konzernabschluß unterscheidet sich aber vom Jahresabschluß auch dadurch, daß er andere Aufgaben zu erfüllen hat und daß auf ihn andere Erwartungen gerichtet sind. Der Jahresabschluß der Einzelgesellschaft dient nämlich außer seiner Infonnationsfunktion auch als Basis für die Gewinnausschüttung an die Anteilseigner (vgl. § 58 AktG, § 30 GmbHG) und mit Blick auf § 5 Abs. 1 EStG (sog. Maßgeblichkeitsgrundsatz) als Grundlage für die Steuerbilanz des Unternehmens. Die Einzelbilanz hat also eine Zahlungsbemessungsfunktion8 . Im Unterschied aber zu den Regeln anderer Staaten, etwa der USA oder Großbritanniens 9 , besteht nach deutschem Recht die Rolle des Konzernabschlusses - und trotz Gedanken in der Literatur für seine mittel- oder unmittelbare Heranziehung bei der Bemessung der Gewinnausschüttung lO und der Besteuerung ll - in der Infonnationsfunktion; Zugriffsobjekt sowohl der Gewinnansprüche der Anteilseigner wie auch der Steueransprüche des Fiskus bleibt das einzelne Unter6 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 215, Rn 519; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 19 ff.; Pellens, Der Informationswert von Konzernabschlüssen, Bochum 1993, S. 321 f. 7 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 28ff.; v. Wysocki/Wohlgemuth, Konzernrechnungslegung, 4. Auflage, S. 4. 8 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, Vorbemerkungen zu §§ 290 - 315 HGB, Rn 16. 9 Vgl. AID/S, 6. Auflage, Vorbemerkungen zu §§ 290 - 315 HGB, Rn 16. 10 Vgl. Beusch, Rücklagenbildung im Konzern, FS Goerdeler, S. 25 ff.; Busse v. Colbe, Der Konzernabschluß als Bemessungsgrundlage für die Gewinnverwendung, FS Goerdeler, S. 61 ff.; Geßler, Rücklagenbildung im Konzern, AG 1985, S. 257ff.; Goerdeler, Rücklagenbildung nach § 58 Abs. 2 AktG 1965 im Konzern, WPg 1986, S. 229ff.; Götz, Die Sicherung der Rechte der Aktionäre der Konzernobergesellschaft bei Konzernbildung und Konzernleitung, AG 1984, S. 85 ff.; ders. Rücklagenbildung in der Unternehmensgruppe, FS Moxter, S. 573ff.; Lehertshubber, Unternehmensvertragsrecht und Konzernhandelsbilanz, BFuP 1986, S. 326ff.; Lutter, Zur Binnenstruktur des Konzerns, FS Harry Westermann, S. 347, 352 ff.; ders., Rücklagenbildung im Konzern, FS Goerdeler, S. 327 ff.; Ordelheide, Der Konzern als Gegenstand betriebs wirtschaftlicher Forschung, BFuP 1986, S. 304 ff.; Pick, Ausschüttungsregelung bei Konzernverflechtung, Thun 1985; Schildbach, Der Konzernabschluß als Ausschüttungsbemessungsgrundlage, WPg 1993, S. 53ff. und 94ff.; Thomas, Rücklagenbildung im Konzern, ZGR 1985, S. 365ff. 11 Vgl. Haase, Zur steuerlichen Anerkennung der Konzernabschlüsse, DB 1968, S. 237f.; Harrns/Küting, Perspektiven der Konzernbesteuerung, BB 1982, S. 445ff.
11. Einheitliche Bewertung als Bestandteil des Konzernabschlusses
19
nehmen 12. Zweck des Konzernabschlusses ist es, Gesellschaftern und Gläubigem aller Konzernunternehmen sowie den übrigen Abschlußadressaten "unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanzund Ertragslage des Konzerns zu vermitteln" (§ 297 Abs. 2 Satz 2 HGB Generalnorm) "als ob diese Unternehmen insgesamt ein einziges Unternehmen wären" (§ 297 Abs. 3 Satz I HGB)13. Dementsprechend bedarf der Konzernabschluß nicht der Feststellung und das Gesetz sieht die Nichtigkeit des Konzernabschlusses - etwa wie in § 256 AktG - gar nicht vor 14 . Trotzdem wird der Konzernabschluß immer mehr als das maßgebliche Meßinstrument der Rentabilität und Kreditwürdigkeit der in ihm abgebildeten Unternehmen angesehen. Entsprechend ist seine Bedeutung für die Zulassung und das Ansehen seiner Gesellschaften bei den Kapitalmärkten groß 15 . Von besonderer Bedeutung für den Konzernabschluß ist deshalb seine Prüfung durch den Konzernabschlußprüfer (§ 316 Abs. 2 HGB): Sollte der Konzernabschluß gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen oder ein unrichtiges Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermitteln, ist der Bestätigungsvermerk einzuschränken oder sogar zu verweigern (§ 322 Abs. 3 HGB)16. Mit Blick auf die Bedeutung des Konzernabschlusses bei den Kapitalmärkten und die immer größer werdende Rolle des Kapitalmarktes für die Eigen- und Fremdfinanzierung der Unternehmen kommt dieser Sanktion eine weitreichende Bedeutung zu. 11. Einheitliche Bewertung als Bestandteil des Konzernabschlusses Der Konzernabschluß wird also von seiner Informationsfunktion geprägt; sein Hauptzweck ist, gegenwärtigen und potentiellen Anteilseignern, Gläubigem, Arbeitnehmern, der Öffentlichkeit usw. mit qualifizierten und aussagefähigen Informationen zu versorgen. Ebenso wie im Einzelabschluß einer Gesellschaft sind auch im Konzernabschluß von zentraler Bedeutung die Fragen des Ansatzes und der Bewertung: Was darf angesetzt werden und 12 Vgl. Oroßfeld, Konzernabschluß, 2. Auflage, S. 230f., Rn 563f.; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 21 ff.; v. Wysocki/Wohlgemuth, Konzernrechnungslegung, 4. Auflage, S. 4. 13 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 22. 14 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, Vorbemerkungen zu §§ 290 - 315 HOB, Rn 72; siehe aber auch §§ 331 ff. HOB und die dort vorgesehenen Straf- und Bußgeldvorschriften sowie Zwangsgelder. 15 Vgl. Küting/Hayn, Der internationale Konzernabschluß als Eintrittskarte zum weltweiten Kapitalmarkt, BB 1995, S. 662ff. 16 Vgl. AlD/S, 6. Auflage, Vorbemerkungen zu §§ 290 - 315 HOB, Rn 72. 2*
20
Einleitung
wie hoch (oder wie niedrig) darf der anzusetzende Wert sein 17. Im Gegensatz aber zur Bewertung im Einzelabschluß liegen auf der Ebene des Konzernabschlusses schon Entscheidungen über die aufzunehmenden Vermögensgegenstände und Schulden vor, nämlich die in den Einzelabschlüssen der Konzernunternehmen angesetzten Werte (es sei denn, daß sie in den Einzelabschlüssen wegen eines Ansatzverbots oder -wahlrechts gar nicht angesetzt waren). Da bei einern international expandierten Konzern die meisten Tochterunternehmen in der Regel in verschiedenen Ländern angesiedelt oder in unterschiedlichen Rechtsformen organisiert sind, sie also unterschiedliche Rechnungslegungsregeln anzuwenden haben, dürften sich ihre Wertansätze auch stark voneinander unterscheiden 18 . Unterschiede können sich aber schon daraus ergeben, daß Personen aus unterschiedlichen Wirtschafts- und Kulturkreisen mit unterschiedlichen Wert- und Risikovorstellungen auf der Einzelabschlußebene die Bewertung durchzuführen haben 19 . Die in den Einzelabschlüssen der Konzernunternehmen enthaltenen Wertansätze sind also prinzipiell miteinander nicht vergleichbar. Nach der Fiktion rechtlicher Einheit des Konzerns (§ 297 Abs. 3 Satz I HGB) ist der Konzernabschluß aber so aufzustellen, als ob alle Konzernunternehmen ein rechtlich einheitliches Unternehmen wären. In einern einheitlichen Unternehmen wendet man aber weder gleichzeitig mehrere nationale Rechte an, noch bilanziert anhand von für verschiedene Rechtsformen geltende Vorschriften. Die auf der Basis der einbezogenen Einzelabschlüsse ermittelten Wertansätze sind also heterogen, miteinander nicht vergleichbar und entsprechen nicht der im Konzernabschluß geltenden Fiktion rechtlichen Einheit des Konzerns. Im Rahmen seiner Informationsfunktion hat der Konzernabschluß "ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns zu vermitteln" (§ 297 Abs. 2 Satz 2 HGB). Die Aussagefähigkeit des Konzernabschlusses setzt aber die Vollständigkeit des ausgewiesenen Vermögens und die Vergleichbarkeit der angesetzten Werte voraus 20 . Voraussetzung der Aussagefahigkeit des Konzernabschlusses ist also der Ausweis homogener Wertansätze und Voraussetzung der Ermittlung homogener Wertansätze ist die Anwendung einheitVgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 36, Rn 81. Vgl. Ordelheide, Gennany. Group Accounts, S. 1547, 1592. 19 Vgl. Müller, Eberhard, Der Konzemabschluß im Konfliktfeld verschiedener Interessen, in: Baetge (Hrsg.), Der lahresabschluß im Widerstreit der Interessen, S. 213, 232ff. 20 Vgl. Davies/Paterson/Wilson, UK-GAAP, 4. Auflage, S. 220; Friedrich, Die Problematik der Erstellung aussageflihiger Weitabschlüsse unter Berücksichtigung der in der Praxis angewandten Methoden, Diss. Augsburg 1974, S. 31 f. 17
18
11. Einheitliche Bewertung als Bestandteil des Konzernabschlusses
21
licher Bewertungsmethoden bei der Ermittlung dieser Wertansätze. Dieser Tatsache trägt das Gesetz Rechnung, indem es die Anwendung einheitlicher Bewertungsmethoden für den Konzernabschluß vorschreibt (§ 308 HGB) und die Mißachtung dieser Vorschrift als Ordnungswidrigkeit qualifiziert (§ 334 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. d HGB). Allerdings erfordert die Bewertungseinheitlichkeit im Konzernabschluß vom Bilanzersteller sowie vom Bilanzleser in zweierlei Hinsicht besondere Aufmerksamkeit: Erstens muß bei der Bewertung die Internationalität des Konzernabschlusses berücksichtigt werden: Die Andersartigkeit des Ausländischen ist auch bei der Vereinheitlichung der Bewertung zu beachten; die für den Einzelabschluß des Mutterunternehmens konzipierten (nationalrechtlichen) Bewertungsregeln dürfen trotz Fiktion rechtlicher Einheit nicht mechanisch auf ein so vielfältiges Gebilde wie ein multinationaler Konzern übertragen werden 21 • Zweitens sind die Bewertungsregeln bei ihrer Übertragung auf den Konzernabschluß unter einem anderen Blickwinkel zu sehen als im Einzelabschluß: beim lahresabschluß werden die Bilanzwerte auf seine Zahlungs bemessungsfunktion ausgerichtet, die Informationsfunktion kommt nur bedingt zum Ausdruck. Beim Konzernabschluß dagegen dominiert die Informationsfunktion, Bewertungsregeln sind im Konzernabschluß mit Blick auf diese Prämisse auszulegen22 • Neuerdings ist der Einheitlichkeit der Bewertung im Konzernabschluß ein weiterer Aspekt hinzugekommen: Bisher ging es bei der Vereinheitlichung der Wertansätze um die Beseitigung der durch nationalrechtliche Vorschriften oder unterschiedliche Rechtsform der Konzernunternehmen entstandenen Unterschiede bei der Bewertung; der Konzernabschluß sollte den Unternehmensverbund auf der Basis der 4. und 7. EG-Richtlinien und des HGB so darstellen, als ob er ein einziges Unternehmen wäre (§ 297 Abs. 3 Satz 1 HGB). Allerdings setzt die voran schreitende Internationalisierung der Kapitalmärkte kräftige Impulse für die Rechnungslegung frei. Für international operierende deutsche Konzerne reicht es nicht mehr aus, einen Konzernabschluß aufzustellen, der ebensogut ist wie der lahresabschluß einer deutschen Kapitalgesellschaft. Die vielen Mitgliedstaaten-Wahlrechte der 7. EGRichtlinie und die ebensovielen Wahlrechte des HGB orientieren sich an den z&hlungsbemessungsorientierten lahresabschluß der Einzelgesellschaft Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 291, Rn 719. Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 231, Rn 564; Niehus, Zur Entwicklung von ,,konzerneigenen" GoB durch Paradigmawechsel, FS Moxter, S. 623, 637ff. 21
22
22
Einleitung
und sanktionieren einen informationsfeindlichen Ansatz- und Bewertungsrahmen. Dafür gibt es aber weder Bedarf noch Platz bei der globalisierten Rechnungslegung der Zukunft. Der deutsche wie überhaupt der Europäische Konzemabschluß muß informativer werden; dazu sind aber grundsätzliche Änderungen vor allem beim Bewertungskonzept erforderlich 23 •
23
Vgl. Kapitel F, 11. dieser Arbeit und die dort angegebene Literatur.
Kapitel A
Entstehungsgeschichte und Anwendungsbereich von § 308 HGB I. Entstehungsgeschichte von § 308 HGB 1. Der frühere Maßgeblichkeitsgrundsatz
Vereinzelte Fälle von Konzernabschlüssen hat es in Deutschland schon vor dem zweiten Weltkrieg gegeben. Sie waren meistens auf Wunsch von amerikanischen Kreditgebern und Börsenzulassungsstellen und durch amerikanische Treuhandgesellschaften aufgestellt 1. Dagegen sahen weder die Aktienrechtsnovelle 1931 noch das AktG 1937 eine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung von Konzernabschlüssen vor (sie enthielten lediglich in § 261 d bzw. § 134 eine Ermächtigung der Reichsregierung, für Konzerngesellschaften Vorschriften über die Aufstellung des eigenen und eines gemeinschaftlichen Jahresabschlusses zu erlassen)2. Der Zwang zur Aufstellung von Konzernabschlüssen kam erst durch die alliierten Besatzungsbehörden, die für die neu geordneten Unternehmen des Kohlebergbaus und der Stahl- und Eisenindustrie in Westdeutschland nach amerikanischem Vorbild eine konsolidierte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung verlangten, die vom Abschlußprüfer der Gesellschaft geprüft und bestätigt war3 . Von dieser Möglichkeit machten sehr bald viele Unterpehmen auch freiwillig Gebrauch4 . Obwohl es hierbei an genauen Vorschriften zur Bewertung in der Konzernbilanz gefehlt hat, wurde davon ausgegangen, daß bei der Aufstellung des Konzernabschlusses die Vorschriften und Grundsätze anzuwenden sind, die auch für ein rechtlich einheitliches Unternehmen der betreffenden Rechtsform galten, und daß eventuelle 1 Vgl. Menninger, Die Voraussetzungen für die Aufstellung von Konzernbilanzen, Diss. Heidelberg, 1940, S. 30. 2 Vgl. Dümpel, Der Grundsatz der einheitlichen Bewertung im Konzern und seine Problematik insbesondere bei Einbeziehung ausländischer Tochterunternehmen in den Konzernabschluß, Krefeld 1991, S. 107. 3 Vgl. Dümpel, Der Grundsatz der einheitlichen Bewertung, S. 109. 4 Vgl. Münstermann, Konsolidierte Bilanzen deutscher Konzerne, in: ZfhF 1957, S. 435, 442.
24
Kap. A: Entstehungsgeschichte und Anwendungsbereich von § 308 HGB
Unterschiede bei der Bewertung in den Einzelabschlüssen im konsolidierten Abschluß zu vereinheitlichen waren 5 . Das AktG 1965 hat die Pflicht zur Konzernrechnungslegung aufgenommen und für Konzerne, an deren Spitze eine Aktiengesellschaft oder KGaA stand, vorgeschrieben (§ 329 AktG a. F.). Dabei waren allerdings alle in den Einzelbilanzen der Konzernunternehmen ausgewiesenen Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Sonderposten mit Rücklageanteil, Rückstellungen, Wertberichtigungen und Rechnungsabgrenzungsposten mit den in den Jahresabschlüssen angesetzten Werten nach § 331 Abs. 1 Nr. 1 AktG 1965 in die Konzernbilanz aufzunehmen. Sowohl der Ansatz wie auch die Bewertung der einzelnen Bilanzposten in den Bilanzen der in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen waren für ihre Aufnahme in die Konzernbilanz maßgeblich. Man sprach vom sogenannten "Maßgeblichkeitsgrundsatz,,6 (der Terminus taucht auch im Zusammenhang mit einem ganz anderen Vorgang auf, nämlich die Bindung der Steuerbilanz an die Handelsbilanz der Unternehmen gemäß § 5 Abs. 1 EStG). Schon unter der Geltung des AktG 1965 hat man erkannt, daß die unveränderte Übernahme von Wertansätzen aus den Einzelbilanzen in die Konzembilanz, die auf unterschiedlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beruhten, problematisch für die Aussagefähigkeit des Konzernabschlusses war. Denn diese Übernahme führte zu einem "Bewertungskonglomerat,,7 und entsprach keineswegs der Fiktion der rechtlichen Einheit, die im übrigen den Konzernabschluß auch nach dem AktG 1965 prägte. Vielmehr wurde eingesehen, daß die Aussagefähigkeit der Konzernbilanz von der Einheitlichkeit der Bewertung der in ihr übernommenen Werte abhing 8 . Trotzdem dominierte die Auffassung, daß das Maßgeblichkeitsprinzip als kodifiziertes Recht einer aus dem Gedanke der Einheitstheorie abgeleiteten Bilanzierung vorgehe 9 . Hinzu kam, daß die die Einbeziehung ausländischer Tochtergesellschaften nur als Wahlrecht (§ 329 Abs. 2 Satz 1, Satz 3 zweiter Halbsatz AktG 1965) vorgesehen war, was zu einer weiteren erheblichen Einschränkung der Aussagekraft des Konzernabschlusses führte lO • Dümpel, Der Grundsatz der einheitlichen Bewertung, S. 110. Barz in Großkommentar zum AktG, 3. Auflage, § 331, Anm. 2ff.; Gross/ Schruff/v. Wysocki, Der Konzernabschluß nach neuem Recht, 2. Auflage, S. 115; Kronstein in Kölner Kommentar zum AktG, 1. Auflage, § 331, Rn 37; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, Rn 1; Scherrer in BoHR, § 308 HGB, Rn 1. 7 Vgl. Havermann, Zweifelsfragen der Rechnungslegung im Konzern, in: Wirtschaftsprüfung im neuen Aktienrecht, Düsseldorf 1966, S. 78. 8 Vgl. Barz, Großkommentar, § 331 AktG, Anm. 2f.; Kronstein, Kölner Kommentar, § 331 AktG, Rn 37. 9 Vgl. WP-Handbuch 1973, S. 766; WP-Handbuch 1981, S. 892. 10 Busse v. Colbe, Neuere Entwicklungstendenzen in der Konzernrechnungslegung, WPg 1978, S. 652, 653. 5
6
I. Entstehungsgeschichte von § 308 HGB
25
Für die Aufstellung von Weitabschlüssen wurde bald eine Ausnahme vom Maßgeblichkeitsgrundsatz und nur für die Bilanzen ausländischer Tochtergesellschaften angenommen, solange sie nach Methoden aufgestellt worden waren, die mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung (kurz GoB) nicht vereinbar waren (gemilderte Maßgeblichkeit); dies könnte z. B. dann der Fall sein, wenn Vermögensgegenstände im lahresabschluß des ausländischen Tochterunternehmens zu Wiederbeschaffungskosten bewertet waren 11. Hier schob man als Vorstufe der Übernahme der Wertansätze in den Konzernabschluß eine Anpassung an die GoB, die in einer besonderen, zum Zwecke der Angleichung an die GoB aufgestellten Bilanz (sog. Handelsbilanz 11) stattfand 12. Allerdings machten sich die Nachteile des Maßgeblichkeitsgrundsatzes auch sonst schnell bemerkbar. Denn er schränkte die Vorteile des Einheitsgedankes bei der Konzernrechnungslegung wesentlich ein, wich von dem in den USA und England schon etablierten Einheitlichkeitsgrundsatz ab und verringerte die Aussagefähigkeit des Konzernabschlusses: Nach Busse v. Colbe war der Konzernabschluß "made in Germany" im Vergleich zur angloamerikanischen Praxis bereits zum Zeitpunkt seiner Entstehung überholt l3 . Im Laufe der Zeit wuchs die Überzeugung, daß das Maßgeblichkeitsprinzip als bloße technische Vorschrift nur unter dem höheren Aspekt der Generalnorm und des Zwecks des Konzernabschlusses gesehen werden sollte l4 , daß es die Aufstellung eines aussagefähigeren Konzernabschlusses nicht verhindern könnte l5 . 2. Angloamerikanischer Einfluß
Theorie und vermehrt auch Praxis lehnten den Maßgeblichkeitsgrundsatz ab; sie orientierten sich vielmehr an den angloamerikanischen Grundsätzen des Weitabschlusses und der Einheitlichkeit der Bewertung 16. Somit ergibt sich aber die Frage nach dem Inhalt der Bewertungseinheitlichkeit im Recht der USA und vor allem Großbritanniens. 11 Havennann, Die Handelsbilanz II - Zweck, Inhalt und Einzelfragen ihrer Erstellung, FS Döllerer, S. 185, 186; Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 3. 12 Havennann, FS Döllerer, S. 185, 186; Lederle in Beck'sches HdR, C 300, Rn 3. 13 V gl. Busse v. Colbe, WPg 1978, S. 652, 653 f. 14 V gl. Friedrich, Die Problematik der Erstellung aussagefähiger Konzernabschlüsse, S. 165. 15 Bartke, Bedeutung und Grenzen des Maßgeblichkeitsprinzips im aktienrechtlichen Konzernabschluß, BFuP 1971, S. 457, 470. 16 Vgl. Busse v. Colbe, WPg 1978, S. 652, 654; Müller, Eberhard, Aufstellungsmöglichkeiten konsolidierter Bilanzen internationaler Unternehmungen, Düsseldorf 1974, S. 47; Rätseh, Betrachtungen zur Konzernrechnungslegung nach der 7. EGRichtlinie im Vergleich zur Praxis in den USA, in: BFuP 1981, S. 569, 577.
26
Kap. A: Entstehungsgeschichte und Anwendungsbereich von § 308 HGB
a) Vereinigte Staaten Die Konzernrechnungslegung hat sich im US-amerikanischen Recht sehr früh entwickelt. Die erste Veröffentlichung eines konsolidierten Abschlusses ist in den USA schon im Jahre 1893 durch die National Lead Company erfolgt. In Verbindung mit der in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten eingesetzten Konzentrationswelle 17 hat sich dieser Trend bis zum Jahre 1910 zu einer allgemein anerkannten Form der Rechnungslegung entwickelt 18. Schon 1917 begannen Konzernabschlüsse sogar auch für Zwecke der Besteuerung eingesetzt zu werden 19. Für die Bewertung im Konzernabschluß sieht das US-amerikanische Recht vor, daß sich die Wertansätze im Konzernabschluß auf der Basis der Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)20 zu vereinheitlichen sind 21 . Für ausländische Tochtergesellschaften fordert SFAS No. 52 als Vorstufe sowohl der Währungsumrechnung als auch der anschließenden Konsolidierung ausdrücklich eine Anpassung der Wertansätze an die US-amerikanischen GAAp22 . So fordern viele amerikanische Mutterunternehmen von ihren ausländischen Tochtergesellschaften neben dem nach Landesrecht aufgestellten Jahresabschluß einen auf US-GAAP beruhenden und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk eines amerikanischen Wirtschaftsprüfers versehenen Jahresabschluß (Jahresabschluß 11), der dann unverändert in den Konzernabschluß aufgenommen wird 23 • Ansonsten fehlt es aber im US-amerikanischen Recht an einer ausdrücklichen Normierung der Bewertungseinheitlichkeit im Konzernabschluß 24 . Allerdings wäre es falsch, daraus den Schluß zu ziehen, daß eine erheblich 17 Zur Konzentrationswelle am Ende des vorigen Jahrhunderts in den USA siehe statt aller Großfeld, Aktiengesellschaft, Unternehmenskonzentration und Schutz des Kleinaktionärs, Tübingen 1968, S. 168 ff. 18 Vgl. Gingeie, Rudolf, Der Konzernabschluß in den Vereinigten Staaten von Amerika, Frankfurt 1989, S. 53ff. 19 Vgl. Gingeie, Der Konzernabschluß in den Vereinigten Staaten, S. 55 f. 20 Zu den GAAP und der amerikanischen Rechnungslegung im allgemeinen siehe Ballwieser (Hrsg.), US-amerikanische Rechnungslegung, Stuttgart 1995. 21 Vgl. SEC, Reg. S-X, Rule 4.01, in: SEC (Hrsg.), Accounting, Rules, Regulations, Annotations, Releases, Forms, Securities and Exchange Commission, Chicago 1993; Baker/Rapaccioli/Solomon, United States of America. Group Accounts, in: Ordelheide/KPMG (Hrsg.), Bd. II, S. 3097, 3123. 22 Financial Accounting Standards Board (Hrsg.), SFAS No. 52 "Foreign Currency Translation", FASB, Stamford, December 1981, P. 4b, 70b, 72, und 97; vgl. auch Rätsch, BFuP 1981, S. 569, 577. 23 Vgl. Dreger, Der Konzernabschluß, Wiesbaden 1969, S. 263; Dümpel, Der Grundsatz der einheitlichen Bewertung, S. 224. 24 Vgl. Kubin, The United States and The Seventh Directive, in: Gray/Coenenberg, International Group Accounting, London 1988, S. 155, 172.
I. Entstehungsgeschichte von § 308 HGB
27
differenzierte Bewertung möglich wäre. Dies erklärt sich vielmehr dadurch, daß das US-amerikanische Bilanzrecht nur ein einziges Ansatz- (betreffend die Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens) und nur sehr wenige Bewertungswahlrechte kennt25 . Dementsprechend bedeutet die konzern weite Anwendung von US-GAAP im Konzernabschluß eines US-amerikanischen Mutterunternehmens eine viel umfassendere Einheitlichkeit als die bloße Anwendung der Bewertungsregeln des Mutterunternehmens auf den Konzernabschluß einer deutschen Muttergesellschaft. Grundsätzliches Ziel des Bewertungskonzepts im US-Konzernabschluß ist also, alle Aktiva und Passiva anhand der überschaubaren und für den US-amerikanischen Bilanzleser vertrauten Bewertungsregeln des Mutterunternehmens zu erfassen, wobei diese letzteren nur sehr wenige Bewertungsalternativen (Wahlrechte) zulassen. Eine weitergehende Einheitlichkeit wird dadurch sichergestellt, indem sich die Bewertung im US-amerikanischen Konzernabschluß stark an den Grundsatz der Vergleichbarkeit (comparability principle) orientiert; gleiche Sachverhalte sind also grundsätzlich sowohl im Zeitablauf wie auch sachlich (horizontal) einheitlich zu behandeln26 • Darüber hinaus schreiben in der Praxis die meisten amerikanischen Konzerne für ihre Tochterunternehmen auch für die wenigen Wahlrechte die Anwendung einheitlicher Bewertungsmethoden vor, weil sie sich gerade auch für Zwecke der inneren Kontrolle die Vergleichbarkeit der in den Konzernabschluß angesetzten Werte wünschen27 . Die strenge Ausprägung der Einheitlichkeit durch Vergleichbarkeit im US-amerikanischen Recht wird auch dadurch deutlich, daß die Neubewertung von Wertansätzen aus dem lahresabschluß des Mutterunternehmens nicht erlaubt ist. Vermögens gegenstände und Schulden des amerikanischen Mutterunternehmens müssen - abgesehen von Konsolidierungsmaßnahmen mit denselben Wertansätzen in den Konzernabschluß eingestellt werden, mit denen sie im lahresabschluß des Mutterunternehmens angesetzt waren 28 .
25 Vgl. Baetge/Roß, Was bedeutet "fair presentation" in: Ballwieser (Hrsg.), USamerikanische Rechnungslegung, S. 40; Haller, Wesentliche Ziele und Merkmale US-amerikanischer Rechnungslegung, in: Ballwieser (Hrsg.), ebenda, S. 18. 26 Vgl. Dümpel, Der Grundsatz der einheitlichen Bewertung, S. 223. 27 Vgl. Kubin, The United States and The Seventh Directive, S. 155, 172. 28 Vgl. Baker/Rapaccioli/Solomon, United States of America. Group Accounts, in: Ordelheide/KPMG, Transnational Accounting, London 1995, S. 3097, 3123; Kubin, The United States and the Seventh Directive, S. 155, 172.
28
Kap. A: Entstehungsgeschichte und Anwendungsbereich von § 308 HGB
b) Großbritannien Die Entwicklung der Konzernrechnungslegung hat sich in Großbritannien im Vergleich zu den USA wesentlich verzögert. So geht die erste konsolidierte Bilanz auf das Jahr 1910 zurück29 . Auch in den Jahren danach blieb die Aufstellung von Konzernabschlüssen eine Rarität30 . Trotzdem hat man sehr früh erkannt, daß die einfache Zusammenfassung von Wertansätzen in der Konzernbilanz, obwohl sie nach verschiedenen Ansatz- und Bewertungsvorschriften in den Einzelbilanzen der Konzernunternehmen ermittelt worden waren, der Erhöhung der Vergleichbarkeit und Aussagefähigkeit des konsolidierten Abschlusses sehr wenig verhilft. So hat die Unternehmensgruppe NobelIndustries im Jahre 1922 eine konsolidierte Bilanz veröffentlicht, wobei der Unternehmensvorsitzende auf die Anwendung von abweichenden Ansatz- und Bewertungsmethoden in den Abschlüssen der verschiedenen Konzerngesellschaften hinwies und die Unbrauchbarkeit für den Bilanzleser einer solchen bloßen Häufung der Einzelabschlüsse feststellte 31 . Gleichzeitig hob er hervor, daß als Basis für die Konsolidierung im Konzernabschluß seines Unternehmens eine besondere (speziell für den Konzernabschluß) einheitliche Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden aller Konzerngesellschaften durchgeführt wurde 32 . Kurz danach lassen sich Stimmen auch in der Theorie finden, die für eine einheitliche Bewertung plädierten. So hat Sir Gilbert Gamsey in einem in der Zeitschrift "The Accountant" mit dem Titel "Holding Companies and their published Accounts,,33 veröffentlichten Vortrag die Notwendigkeit der Aufstellung konsolidierter Bilanzen betont und dabei die einheitliche Bewertung der in die Konzernbilanz eingehenden Vermögensgegenstände und Schulden zur Bedingung gemacht34 . Allerdings hat das vom Wirtschaftsministerium zum Zwecke der Novellierung des Rechnungslegungsrechts im Jahre 1926 eingesetzte sogenannte "Greene-Comittee" diese Überlegungen mehrheitlich abgelehnt35 . 29 Vgl. Edwards/Webb, The Development of Group Accounting in the United Kingdom to 1933, The Accounting Historians' Journal 1984, S. 31, 38. 30 Vgl. Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz im britischen und deutschen Recht der Konzernbilanz, Berlin 1992, S. 38 ff. 31 "A mere aggregation of the existing Balance Sheets as they stand, would, therefore, be very difficult, and of practically no value to anyone when obtained"; zitiert nach Garnsey, Holding Companies and their Published Accounts, The Accountant 1923, S. 53, 59. 32 Zitiert nach Garnsey, ebenda. 33 Holding Companies and their Published Accounts, The Accountant vom 6.1.1923, S. 13ff. und vom 13.1.1923, S. 53ff. 34 Garnsey, The Accountant 1923, S. 53, 56; ders., Holding Companies and their Published Accounts, London 1923.
I. Entstehungsgeschichte von § 308 HGB
29
Der entscheidende Durchbruch für die Bewertungseinheitlichkeit ist kurz nach dem zweiten Weltkrieg erzielt worden. Der Companies Act von 1948 schrieb in seinem s. 150(1) i.V.m. 151(1) die Pflicht der Aufstellung von Konzernabschlüssen vor und zwar unabhängig vom Sitz der Tochterunternehmen, er normierte also die Pflicht zum Weltabschluß36 . Daraufhin hat das englische Institute of Chartered Accountants bezogen auf paragraph 17 von schedule 8 des Companies Acts von 1948 einige Anmerkungen zu Konzernabschlüssen, darunter auch die Pflicht zur einheitlichen Bewertung veröffentlicht. So heißt es dazu: "Konsolidierte Abschlüsse werden schwieriger zu erstellen sein, wenn heitlichkeit in der Anwendung von Bilanzierungsgrundsätzen besteht, in bezug auf die Form der Abschlüsse der Einzelgesellschaften und in solche Faktoren wie die Berechnungsbasis für Anlagevermögen, die bungsmethoden und die Anwendung der Besteuerung ... ,,37.
nicht Einbesonders bezug auf Abschrei-
In Anschluß hieran hat in der Folgezeit das Accounting Standards Comittee 38 den Einheitlichkeitsgrundsatz in seinen Statements of Standard Accounting Practice (SSAP) normiert 39 . Die Wirkung der SSAP besteht vor allem darin, daß sie von den Buchpruferverbänden für verbindlich für ihre Mitglieder vorgeschrieben werden. Da die Pflichtprufung für Jahres- und Konzernabschlüsse vorgesehen ist, müssen sie auch von den Bilanzierenden angewendet werden4o . Mittlerweile hat der britische Gesetzgeber den normativen Charakter von SSAP anerkannt und bestätigt41 • Aus heutiger Sicht fordert der Companies Act die Vereinheitlichung der Wertansätze auf der Konzernabschlußebene, wenn in den Einzelabschlüssen der Konzernunternehmen nach unterschiedlichen Methoden bewertet wurde ("where assets and liabilities ... have been valued or otherwise determined by undertakings according to accounting rules differing from those used for the group accounts, the values or amounts shall be ajusted so as to accord with the rules used for the group accounts .. 42 ). Daraus schließt die britische Vgl. Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 47ff. Vgl. Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 53 f. 37 Zitiert nach Peat, Marwick, MicheIl & Co, The Fundamental Principles of Group Accounts, London 1973, S. 87; vgl. ferner Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 54 f. 38 Britisches Fachgremium, dessen Stellungnahmen verbindlichen Charakter haben ("Standards-Setter"); seit dem 1.8. 1990 ist dieses Gremium in Accounting Standards Board unbenannt worden; vgl. ausführlicher Davies/Paterson/Wilson, UK-GAAP, 4. Auflage, S. 12ff. 39 Vgl. Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 55 ff. 40 Vgl. Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 55; ferner Ordelheide, BFuP 1993, Beitrag im Meinungsspiegel zum Thema: Amerikanische Rechnungslegungsgrundsätze: Vorbild für Europa, S. 427, 430. 41 Davies/Paterson/Wilson, UK-GAAP, 4. Auflage, Basingstoke 1994 S. 4ff. 42 Companies Act, sch. 4A, para. 3 (I). 35
36
30
Kap. A: Entstehungsgeschichte und Anwendungsbereich von § 308 HGB
Theorie, daß " ... the accounts must .. , give a true and fair view of the group as a whole and it is difficult to imagine that this could be achieved by adding together material figures which have been compiled using profoundly different policies" oder "that the figures beeing agreegated in the consolidation process must have been compiled on a consistent basis and therefore that uniform accounting policies should have been adopted by all the members of the group .. 43. 3. 7. EG-Richtlinie
Qualifizierte und zuverlässige Informationen im Bereich der Wirtschaft sind eine unerläßliche Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit jedes auf einer freien Wirtschaftsordnung beruhenden Marktes. Dies nimmt an Bedeutung, wenn es um einen so vielfältigen und dezentralen, aus mehreren autonomen Gliedern bestehenden Markt wie den Europäischen Binnenmarkt geht. Hierbei kommt der Rechnungslegung eine bedeutende Rolle zu. Denn die verschiedenen Teilnehmer des Europäischen Binnenmarktes können ihre Entscheidungen nur dann zuverlässig treffen, wenn die in diesem Markt agierenden Unternehmen gleiche oder mindestens vergleichbare Rechnungslegungs- und Publizitätsvorschriften anwenden. Zu diesem Zweck hat der Europäische Gesetzgeber die 4. EG-Richtlinie für die Harrnonisierung der Rechnungslegungsbestimmungen in den Jahresabschlüssen von Kapitalgesellschaften 44 erlassen45 . Darüber hinaus wurde erkannt, daß Jahresabschlüsse von konzernierten Gesellschaften als solche nicht einen getreuen Einblick in ihre Lage geben können und daß dies nur durch die Aufstellung von Konzernabschlüssen möglich wäre46 . Die Harmonisierung der Rechnungslegung sollte sich also auch auf die Konzernrechnungslegung erstrecken. Zu diesem Zweck hat der Rat der Europäischen Gemeinschaften nach langjährigen Beratungen47 gestützt auf Art. 54 Davies/Paterson/Wilson, UK-GAAp, 4. Auflage, S. 220. Also AG, KGaA und GmbH (Art. 1 Abs. I der 4. Richtlinie); mittlerweile sieht Art. lAbs. 1 der Richtlinie 90/605IEWG des Rates vom 8. 11. 1990, ABI. EG vom 16.11.1990, Nr. L 317, S. 60ff. die Anwendung der Bestimmungen der 4. EGRichtlinie auch auf die GmbH & Co KG bzw. AG & Co KG vor. 45 Richtlinie 78/6601EWG, ABI. Nr. 222 vom 14.8.1978, S. 11 ff. 46 Präambel zum Vorschlag für eine 7. Richtlinie vom 2. Juni 1976, ABI. 1976, C 121, S. 2, erster Gedankenstrich; vgl. auch Niessen, The Seventh Directive on Consolidated Accounts within the Framework of Company Law Harrnonisation in the Community, in Gray ICoenenberg (Hrsg.), International Group Accounting, London 1988, S. 3, 4; van Hulle/van der Tas, European Union. Group Accounts, in: Ordelheide/KPMG (Hrsg.), Transnational Accounting, S. 1047, 1053. 47 Zur Entstehung der 7. EG-Richtlinie siehe van Hulle/van der Tas, ebenda, S. 1047, 1054ff. 43
44
1. Entstehungsgeschichte von § 308 HGB
31
Abs. 3 Buchst. g)48 des EWG-Vertrages am 13.6.1983 die sogenannte "siebente Richtlinie,,49 erlassen. Hierbei war die Bewertungsfrage von großer Bedeutung: man war sich bewußt, daß der Konzernabschluß den erforderlichen getreuen Einblick nur vermitteln kann, "wenn die in den Abschluß einbezogenen Vermögensgegenstände auf gleicher oder zumindest vergleichbarer Basis bewertet werden,,5o. Denn nur so kann die Konzeption der Einheitstheorie, wonach der Konzern nicht nur eine wirtschaftlich, sondern auch eine rechtlich selbständige Einheit darstellt, verwirklicht werden 5l . Der ohnehin in seinem Heimatland Deutschland umstrittene Maßgeblichkeitsgrundsatz wurde von Anfang an verdrängt52 . Ausgangspunkt der Richtlinie war stets die Einheitlichkeit der Bewertung im Konzernabschluß. Der Entwurf sah sogar sowohl in seiner ursprünglichen, als auch in seiner geänderten Fassung die Anwendung der gleichen Bewertungsmethoden sowohl auf den Konzernabschluß selbst wie auch auf die ihm zugrunde liegenden Jahresabschlüsse der einbezogenen Unternehmen vor53 . Als Begründung wurde angeführt, daß sonst die Gefahr eines Auseinandergehens vom Jahresabschluß und Konzernabschluß bestünde, da die Unternehmen in ihrem für die Dividenden- und Steuerbemessung relevanten Jahresabschluß vorsichtig bewerten würden, wäh48 Siehe aber Bedenken hinsichtlich der Tauglichkeit von Art. 54 Abs. 3 Buchst. g) EWGV als Rechtsgrundlage für die Richtlinie bei Wirtschafts- und Sozialausschuß, ABI. Nr. C 75 vom 26.3. 1977, S. 6, Absatz 1.4. 49 Richtlinie 83/349/EWG, ABI. Nr. L 193 vom 18.7.1983, S. 1 ff. 50 BR-Drucks. 348/1978, S. 19. 51 VgI. Harms/Küting, Zur Einheitlichkeit der Bewertung im Konzern nach künftigem Bilanzrecht, BB 1984, S. 105. 52 VgI. Art. 15 des Entwurfs vom 2.6.1976, ABI. 1976, C 121, S. 7; Art. 15 des geänderten Entwurfs vom 17.1.1979, ABI. 1979, C 14, S. 13f.; Art. 29 der 7. Richtlinie; siehe ferner Großfeld, Konzernpublizität im deutschen und Europäischen Recht, RabelsZ 1985, S. 257, 267; Biener, Die Harmonisierung der Konzernrechnungslegung in der Europäischen Gemeinschaft nach dem Vorschlag für eine siebte gesellschaftsrechtliche Richtlinie, DB 1977, S. 1831, 1836; ders., Die Konzernrechnungslegung nach der siebenten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften über den Konzernabschluß, DB 1983, Beilage Nr. 19, S. 8; ders., Handelsrechtliche Grundsatzfragen der 4. und 7. EG-Richtlinie, ZfbF 1980, Sonderheft 10, S. 307, 323f.; Biener/Schatzmann, Konzernrechnungslegung, Düsseldorf 1983, S. 46; Busse v. Colbe, WPg 1978, S. 652, 653f.; Oessling/Wiesner, Zum Vorschlag einer siebten EG-Richtlinie über die Konzernrechnungslegung, AG 1977, S. 40, 42ff.; Niehus, Vor-Bemerkungen zu einer Konzernbilanzrichtlinie, WPg 1984, S. 285, 286f.; Wiesner, Harmonisierung der Rechnungslegung vor der Verabschiedung, AG 1979, S. 275, 277. 53 ABI. 1976, C 121, S. 7, Art. 15 Buchstabe b; ABI. 1979, C 14, S. 13, Art. 15 Buchstabe b; BR-Drucksache 348/1976, S. 20; dazu kritisch Biener, DB 1977, S. 1831, 1837.
32
Kap. A: Entstehungsgeschichte und Anwendungsbereich von § 308 HGB
rend sie im Konzernabschluß eher eine großzügige Bewertung bevorzugen würden 54 . Eine solche Regelung würde allerdings bei weitem den Regelungsbereich der Richtlinie überspringen, da es sich unter den einbezogenen Tochterunternehmen auch solche befinden könnten, die außerhalb der EU angesiedelt seien oder einer nicht von der 4. Richtlinie geregelten Rechtsform (z. B. Kommanditgesellschaften) angehörten 55 . Deshalb ist die Richtlinie in ihrer Formulierung (Art. 29 der 7. Richtlinie) nicht so weit gegangen. Sie verlangt die einheitliche und mit der 4. Richtlinie übereinstimmende Bewertung der in den Konzernabschluß übernommenen Gegenstände des Aktivund Passivvermögens der Konzernunternehmen, ohne sich aber in die Bewertung auf der Ebene des Jahresabschlusses einzumischen 56 . Ihr Konzept besteht in der Einheitlichkeit der Bewertung auf der Ebene des Konzernabschlusses anhand der Vorschriften, die das Mutterunternehmen auf seinen eigenen Jahresabschluß anwendet. Zulässig ist jedoch auch, daß die Mitgliedstaaten die Anwendung (einheitlich auf den ganzen Konzernabschluß) auch anderer Methoden erlauben oder vorschreiben, soweit diese mit den Bewertungsregeln der 4. Richtlinie übereinstimmen, was aber zu Berichts- und Begründungspflichten führt 57 • Nach anderen als die im Konzernabschluß angewendeten Methoden bewertete Bewertungsobjekte sind vor ihrer Übernahme in den Konzernabschluß nach den Konzernmethoden neuzubewerten. Daher sind im Zuge der Konsolidierung - und nur für ihre Zwecke - die Bewertungsvorschriften der 4. Richtlinie auch auf die Aktiva und Passiva von ausländischen NichtEG-Tochterunternehmen sowie inländischen Einzelunternehmen und Personnenhandelsgesellschaften und somit auf den ganzen Weitabschluß anzuwenden 58 . Eine Ausnahme sieht die Richtlinie vor, wenn das Ergebnis dieser Neubewertung nur von untergeordneter Bedeutung für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns ist59 . Darüber hinaus sind Abweichungen vom Grundsatz der einheitlichen Bewertung auch in 54 Vgl. Commission of the European Communities, "Explanatory Memorandum to the 1976 Proposal for a Seventh Directive concerning group accounts", Bulletin EC 1976, S. 19, 29. 55 Vgl. Biener, DB 1977, S. 1831, 1836; Oessling/Wiesner, AG 1977, S. 40, 44; Wiesner, AG 1979, S. 275, 277; van Hulle/van der Tas, European Union, Group Accounts, S. 1047, 1094. 56 Art. 29 Abs. 1 der Richtlinie; vgl. auch Harms/Küting, BB 1984, S. 105, 107. 57 Art. 29 Abs. 2 Buchstabe a und b; vgl. auch Harms/Küting, BB 1984, S. lOS, 108. 58 Vgl. Harms/Küting, BB 1984, S. 107. 59 Art. 29 Abs. 3 Satz 1.
1. Entstehungsgeschichte von § 308 HGB
33
Ausnahmefällen zulässig, die aber im Anhang anzugeben und zu begründen sind6o . In Absatz 4 regelt Art. 29 der 7. Richtlinie die Problematik der latenten Steuern im Konzern. Sie wird allerdings erst dann Bedeutung erlangen, wenn der Konzern anstelle der Konzernunternehmen einschließlich der Konzernleitung der Besteuerung unterworfen wird (die Vorschrift ist nicht in deutsches Recht umgesetzt worden)61. Bedeutend ist dagegen Absatz 5, in dem verlangt wird, steurrechtlich motivierte Tatbestände rückgängig zu machen. Solche Wertansätze dienen der Minimierung der Steuerlast des Unternehmens und sind deshalb für den Jahresabschluß gemäß § 5 Abs. I EStG notwendig. Trotzdem sind sie für die handelsrechtliche Ergebnisermittlung störend, denn sie verfälschen das Bilanzbild und beeinträchtigen die Aussagefähigkeit des Konzernabschlusses62 . Darüber hinaus erschwert die Übernahme steuerlich motivierten Wertansätze auch die internationale Vergleichbarkeit des Konzernabschlusses, da sie bei ausländischen Rechtsordnungen selten vorkommt. Deshalb ist sie auch mit dem Harmonisierungswille der Richtlinie unvereinbar63 . Allerdings ist die Eliminierung steuerlich motivierter Wertansätze auf Drängen der deutschen Seite nur als Mitgliedstaatenwahlrecht formuliert, was zu ihrer Aushöhlung durch den Gesetzgeber geführt hat64 . 4. Umsetzung der Richtlinie - § 308 HGB
Die siebente, die vierte sowie die achte EG-Richtlinie sind durch das sogenannte "Bilanzrichtlinien-Gesetz,,65 ins deutsche nationale Recht umgesetzt worden, darunter auch Art. 29 der 7. Richtlinie, das seine Entsprechung in § 308 HGB fand. Dabei standen vor allem drei Fragen im Vordergrund. Erstens mußte entschieden werden, ob für die Bewertung im Konzernabschluß nur die deutschen Bewertungsvorschriften gelten sollten oder ob man den Unternehmen erlauben oder vorschreiben sollte, auf ihren Konzernabschluß EG-ausländische Bewertungsregeln anzuwenden, wie es in Art. 29 Abs. 2 Buchst. a) Satz 2 der Richtlinie als Mitgliedstaatenwahlrecht vorgesehen ist. Der Ent60 Art. 29 Abs. 3 Satz 2; vgl. auch die Kritik des WSA hinsichtlich dieser Ausnahme in ABI. EG 1977, C 75, S. 7. 61 Art. 29 Abs. 4; Biener, DB 1977, S. 1831, 1832. 62 Vgl. Forster, Karl-Heinz, Bilanzpolitik und Bilanzrichtlinien-Gesetz, welche Freiräume bleiben noch?, BB 1983, S. 32, 34. 63 Vgl. Schrnidt, Wie maßgeblich bleibt die Maßgeblichkeit, FS Ludewig, S. 901, 908; ders., Wird die Handelsbilanz zur Steuerbilanz?, WPg 1991, S. 605, 607. 64 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzemabschlüsse, 6. Auflage, S. 109. 65 BGBI. 1 1985, S. 2355 ff. 3 Xenides
34
Kap. A: Entstehungsgeschichte und Anwendungsbereich von § 308 HGB
wurf eines Vorschlags zu einem Regierungsentwurf vom Mai 198466 sowie der Regierungsentwurf vom November 198467 sahen diese Möglichkeit vor, wenn der überwiegende Teil des Konzernvermögens im EG-Ausland angesiedelt ist68 . Aus der Sicht der Wirtschaftlichkeit der Rechnungslegung spricht sicherlich Einiges für diese Lösung. Allerdings ist diese Regelung auf heftigen Widerstand gestoßen. Man war der Ansicht, daß eine solche Einpflanzung von EG-ausländischen Bewertungsregeln in einem im übrigen deutschen Konzernabschluß Verwirrung verursachen und zur Minderung der Aussagekraft des Abschlusses beitragen könnte 69 . Deshalb ist bei der Umsetzung der Richtlinie von dieser Möglichkeit abgesehen worden. Noch wichtiger ist die zweite Frage. Die Richtlinie spricht von den Methoden, "welche das Unternehmen auf seinen eigenen lahresabschluß anwendet", als Maßstab für die Bewertung im Konzernabschluß. Allerdings kann diese Formulierung als eine Pflicht zur Anwendung sowohl der vom Mutterunternehmen in seinem lahresabschluß tatsächlich angewandten Bewertungsmethoden wie auch der Bewertungsmethoden, die das Mutterunternehmen auf seinen lahresabschluß anwenden dürfte, d. h. des gesamten Rahmens aller auf seinen lahresabschluß anwendbaren Bewertungsmethoden, verstanden werden 7o . Die zweite Lösung erweist sich als flexibler und geeigneter, die Vielfalt eines Konzerns abbilden zu können, zumal viele Mutterunternehmen reine Holding-Gesellschaften sind und kein Sachanlagevermögen besitzen7 !. Der Gesetzgeber hat sich in § 308 Abs. 1 Satz 1 HGB zu Recht für die "auf den lahresabschluß des Mutterunternehmens anwendbaren Bewertungsmethoden" entschieden72 . Bei der Neubewertungspflicht ist dagegen die Rede von Bewertungsmethoden, "die anzuwenden sind oder ... in Ausübung von Wahlrechten auf den Konzernabschluß angewendet werden" (§ 308 Abs. 2 Satz 1). Die Formulierung ist sehr eng, indem sie praktisch den "Einheitlichkeitsgürtel" des Abs. 1 Satz 1 sehr eng schnallt und bei Wort genommen noch weitergehenBMJ 3507 - 30310/84. BMJ 3507/10- 30946/84. 68 § 2730 des Entwurfs eines Vorschlags zu einem Regierungsentwurf bzw. § 289 des Regierungsentwurfs vom November 1984. 69 Vgl. IDW, Stellungnahme zur Transformation der 7. EG-Richtlinie, WPg 1984, S. 509, 512; Ordelheide, WPg 1985, S. 509, 513; Busse v. Colbe, Stellungnahme zu § 308 HGB bei der Sachverständigenanhörung vor dem Unterausschuß-Bilanzrichtlinien-Gesetz, in: Heimrich (Hrsg.), BiRiLiG, S. 231. 70 Vgl. Harms/Küting, BB 1984, S. 105, 109. 71 Vgl. Harms/Küting, BB 1984, S. 105, 109. 72 Vgl. § 289 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 des Regierungsentwurfs vom November 1984, § 289 Abs. 1 Satz 1 des Regierungsentwurfs vom Mai 1985 sowie § 308 Abs. 1 Satz 1 HGB. 66 67
11. Anwendungsbereich von § 308 HOB
35
der zu sein scheint, als der Bewertungsrahmen für den Jahresabschluß eines rechtlich einheitlichen Unternehmens73. Ihre richtige Handhabung setzt sachgerechte Auslegung voraus 74. Die dritte Frage betraf das in Art. 29 Abs. 5 eingeräumte Mitgliedstaatenwahlrecht in bezug auf die Rückgängigmachung steuerlicher Sachverhalte, die nach allgemeiner Überzeugung zur Fälschung des Bilanzbildes beitragen und nicht zum Konzernabschluß gehören75. In diesem Punkt hat sich seinerzeit die Forderung der Praxis durchgesetzt und das Beibehaltungswahlrecht wurde in vollem Umfang an die Unternehmen weitergegeben76. Insofern steht nach § 308 Abs. 3 HGB der Konzernleitung frei, ob sie steuerlich motivierte Wertansätze in der Konzernbilanz rückgängig machen oder beibehalten will 77 • 11. Anwendungsbereich von § 308 HGB
Die in den §§ 290ff. HGB vorgeschriebenen Konzernrechnungslegungsvorschriften finden Anwendung nur auf Konzerne, an deren Spitze eine Kapitalgesellschaft steht78 . Dementsprechend ist § 308 HGB nur auf solche Konzerne anzuwenden, die unter der einheitlichen Leitung einer AG, GmbH oder KGaA stehen (§ 290 Abs. 1 HGB i. V. m. der Überschrift zum zweiten Abschnitt des dritten Buches des HGB). Mittlerweile hat zwar der Rat der EU die sogenannte GmbH & Co-Richtlinie79 erlassen, die die Ausdehnung der 4. und 7. EG-Richtlinien auch auf solche Personenhandelsgesellschaften vorsieht, von denen alle unbeschränkt haftenden Gesellschafter die Rechtsform einer Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung haben (Art. 1 Abs. I der GmbH & Co-Richtlinie für die vierte und Art. 2 Abs. 1 der GmbH & Co-Richtlinie für die siebte EG-Richtlinie), allerdings ist diese Richtlinie noch nicht ins deutsche Recht umgesetzt worden 8o . Siehe Kritik bei Ordelheide, WPg 1985, S. 575, 576. Dazu siehe Kapitel C, III. 1. dieser Arbeit. 75 Vgl. etwa, Schroff, BFuP 1993, S. 400, 408ff.; Havennann, Der Aussagewert des Jahresabschlusses, WPg 1988, S. 612, 614f. 76 Vgl. Busse v. Colbe, Zur Anpassung der Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, BFuP 1995, S. 373, 383. 77 Vgl. IDW, HFA 3/1988, WPg 1988, S. 483,484. 78 Vgl. § 290 Abs. 1 HOB. 79 Richtlinie des Rates 90/6051EWO vom 8. 11. 1990, ABI. EO 1990, Nr. L 317 vom 16. 11. 1990, S. 60 ff. 80 Vgl. auch Nothelfer, Die Auswirkungen der GmbH & Co-Richtlinie auf die Praxis, BB 1996, S. 1655. 73 74
3*
36
Kap. A: Entstehungsgeschichte und Anwendungsbereich von § 308 HGB
Für Konzerne, an deren Spitze nicht eine der drei genannten Gesellschaftsformen steht, kann sich die Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses aus § 11 des sogenannten Publizitätsgesetzes81 ergeben. Gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 1 PublG gilt § 308 HGB für einen nach dem PublG aufzustellenden Konzernabschluß sinngemäß. Hier sieht das Gesetz vor, daß § 279 Abs. 1 und § 280 HGB nicht angewendet zu werden brauchen (§ 13 Abs. 3 Satz 1 PublG); dies kann die Legung stiller Rücklagen im Konzernabschluß ermöglichen, selbst wenn die Jahresabschlüsse der Tochterunternehmen nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt sind 82 . Diese Gefahr wird insofern vermindert, als nach dem PublG aufgestellte Konzernabschlüsse nur dann befreiende Wirkung für die Teilkonzernabschlüsse ihrer Tochterunternehmen-Kapitalgesellschaften nach § 291 HGB haben, wenn in ihnen nicht von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht worden ist (§ 13 Abs. 3 Satz 3 PublG)83. Darüber hinaus stellt der in den §§ 290ff. HGB geregelte Konzernabschluß auf Konzerne ab, deren Tätigkeit dem Bereich Industrie und Handel zuzuordnen ist84 . Dagegen sieht das Gesetz zum Teil abweichende Vorschriften für den Banken- und den Versicherungsunternehmenkonzernabschluß vor85 . In der Praxis existieren also drei unterschiedliche Konzernabschlüsse: der allgemeine (für Konzerne, deren Tätigkeitsbereich grundsätzlich dem Bereich Industrie und Handel zuzuordnen ist), der Bankenkonzernabschluß und der Konzernabschluß für Versicherungsunternehmen 86 . Bei den letzteren findet § 308 HGB nur entsprechend Anwendung 87 .
81 Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und Konzernen vom 15. August 1969, BGBL 1, S. 1189ff. 82 Vgl. scharfe Kritik bei Ordelheide, WPg 1985, S. 509, 515ff. 83 Vgl. Biener, Stellungnahme zu § 308 HGB bei der Sachverständigenanhörung vor dem Unterausschuß-Bilanzrichtlinien-Gesetz, in: Heimrich (Hrsg.), BiRiLiG, S. 232; Maas/Schruff, Der Konzernabschluß nach neuem Recht, WPg 1986, S. 237, 238. 84 Vgl. Richtlinie 86/635/EWG vom 8.12.1986, ABI. Nr. L 372, S. 1 ff., Präambel, Gedankenstrich 16, Satz 1. 85 Vgl. §§ 340i f. HGB (bzw. Richtlinie 86/635/EWG) für den Bankenkonzernabschluß und §§ 341i f. HGB (bzw. Richtlinie 911674/EWG vom 19.12.1991, ABI. Nr. L 374, S. 7 ff.) für den Versicherungsunternehmenkonzernabschluß. 86 Zu beachten ist allerdings der Entwurf einer Bilanzregelung für Finanzkonglomerate der Federation des Experts Comptables, wonach gemischte Finanzkonzerne, die sowohl Bank- als auch Versicherungsgeschäfte betreiben, möglicherweise mittelfristig mit den auf sie zugeschnittenen spezifischen Rechnungslegungsvorschriften einer neuen Richtlinie rechnen müssen. Vgl. dazu Ordelheide, Notwendigkeiten und Probleme der Weiterentwicklung der EG-Bilanzrichtlinien und des deutschen Konzernabschlußrechts, in: Baetge (Hrsg.), Die deutsche Rechnungslegung vor dem
11. Anwendungsbereich von § 308 HGB
37
In dieser Arbeit wird grundsätzlich auf die einheitliche Bewertung im allgemeinen Konzemabschluß (§§ 290ff. HGB) eingegangen.
Hintergrund internationaler Entwicklungen, S. ll, 15; ders., Entwicklung und Arbeit des Accounting Advisory Forums der EU-Kommission, FS Budde, S. 483, 484. 87 Vgl. § 340i Abs. 2 Satz 1 HGB bzw. § 341j Abs. 1 Satz 1 HGB, Art. 66 Nr. 6 der Richtlinie 91/674/EWG.
Kapitel B
Einheitlich Bewerten I. Auf den Konzernabschluß anwendbare Bewertungsmethoden 1. Methodenfreie und methodische Bewertung
Der Jahres- bzw. Konzernabschluß ist das entscheidende Meßinstrument, um wirtschaftlich relevante Sachverhalte im Rahmen der Rechnungslegung erfassen und abbilden zu können 1. Allerdings ist die in ihm abzubildende Realität außerordentlich vielfältig: Die für den Unternehmensabschluß relevanten Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge lassen sich nach einer Unzahl von Merkmalen oder Kriterien abbilden und ordnen. Mithin erscheint es auf den ersten Blick angebracht, die Aufstellung eines anforderungsgerechten Jahresabschlusses von der Berücksichtigung sämtlicher bewertungsrelevanter Gesichtspunkte aller angesetzten Bilanzposten abhängig zu machen, die einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden also anhand ihrer individuellen Merkmale einzeln zu bewerten (methodenfreie Bewertung)2. Eine solche individuelle Bewertung setzt allerdings voraus, daß der Bewertende alle wertbestimmenden Faktoren in jedem Einzelfall festzulegen, zu gewichten und daraus den betreffenden Wert abzuleiten hat. Demzufolge ist ein solches Vorgehen mit einem enormen Arbeitsaufwand verbunden und in der Praxis schwer realisierbar3 . Vielmehr ist aber eine solche individuelle Bewertung abzulehnen, weil sie sehr stark von der subjektiven Beurteilung des Bewertenden abhängt: Je mehr die Bewertungsobjekte individuell bewertet werden, desto mehr hängt die Verläßlichkeit des Jahresabschlusses von der Verläßlichkeit des Bewertenden ab, desto weniger ist der so entstehende Jahresabschluß hinsichtlich seiner Verläßlichkeit beurteilbar4 . 1 Vgl. Schneider, Wozu eine Refonn des Jahresabschlusses?, in: Der Jahresabschluß im Widerstreit der Interessen, in Baetge (Hrsg.), S. 131, 133. 2 Vgl. Selchert, Uneinheitlichkeit bei der Bewertungseinheitlichkeit?, DB 1995, S. 1574; Patzak, Einheitliche Bewertung im Jahresabschluß von Kapitalgesellschaften, Frankfurt a. M. 1994, S. 30. 3 Vgl. Selchert, DB 1995, S. 1574. 4 Vgl. Selchert, DB 1995, S. 1574.
I. Auf den Konzernabschluß anwendbare Bewertungsmethoden
39
Verläßliche Bewertung bedeutet also für die Bilanzadressaten nachvollziehbare Bewertung. Dazu erscheint es aber geboten die vielfältigen Bewertungsgesichtspunkte eines Bewertungsobjektes auf ein übersichtliches Maß zu reduzieren. Dabei müssen für unwesentlich gehaltene wertbeeinflussenden Merkmale vernachlässigt werden, um Vergleichbarkeit hinsichtlich der verbliebenen und für wesentlich gehaltenen Merkmale herzustellen5 . Bei der bilanziellen Bewertung kommt es also nicht auf den möglichst genaueren Wert eines angesetzten Bilanzpostens an, sondern auf einen Wert, dessen Verläßlichkeit darauf beruht, daß die Bilanzadressaten wissen, daß er aufgrund von bestimmten, ihnen selbst bekannten Wertermittlungsverfahren ermittelt wurde. Die Verläßlichkeit der Daten des Jahresabschlusses wird dadurch erreicht, daß der Bewertende eine standardisierte Bewertung anwendet, die auf Regeln beruht, die für den Bilanzleser vertraut und nachvollziehbar sind. 2. Begriff der Bewertungsmethode
Grundlage der methodischen Bewertung ist ihre Nachvollziehbarkeit für den Bilanzleser. Voraussetzung hierfür ist aber die Formel, die dem Bilanzadressaten ermöglicht, von den im Zahlenwerk Jahresabschluß angesetzten Wertansätzen verläßliche Rückschlüsse auf die ihnen zugrundeliegenden Bewertungsobjekte zu ziehen: Grundlage der methodischen Bewertung ist also die Bewertungsmethode. Unter Methode (von griechisch methodos) versteht man ein nach Mittel und Zweck planmäßiges Verfahren6 • Als Methode wird in der wissenschaftlichen Praxis "das planmäßige Verfahren zur Erreichung eines gesetzten wissenschaftlichen Zieles" oder "ein einheitliches formales Verhalten gegenüber einer bestimmten Aufgabe,,7 bezeichnet. Nach anderer Definition sind Methoden "Verfahren, die für jedermann nachvollziehbare Regeln anwenden und bei deren Anwendung verschiedene Individuen zu gleichen Ergebnissen gelangen müssen"s. Wesentliches Element des Begriffs "Methode" ist also ihre Planmäßigkeit, ein System, das ihr zugrundeliegt und die Nachvollziehbarkeit ihrer Ergebnisse ermöglicht. So werden als Bewertungsmethoden "bestimmte, in Vgl. Selchert, DB 1995, S. 1574. Vgl. Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Mannheim 1980, S. 1778, Stichwort "Methode". 7 Vgl. Sandig, Kurt, Methodenprobleme, betriebs wirtschaftliche, in: Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, 3. Auflage, Stuttgart 1956, S. 3961. 8 Vgl. Reintges, Die einheitliche Bewertung im Konzernabschluß, WPg 1987, S. 282, 283. 5
6
40
Kap. B: Einheitlich Bewerten
ihrem Ablauf definierbare Verfahren der Wertfindung,,9 oder "ein planmäßiges Vorgehen zur Ermittlung von Bewertungsmaßstäben sowie deren Anwendung auf die einzelnen Posten und bei der Berücksichtigung späterer Wertminderungen,,10 bezeichnet. Genauso zutreffend ist die Definition der Bewertungsmethode als "die planmäßige Zuordnung eines in Geldeinheiten ausgedruckten Wertes zu einem Bewertungsobjekt, die in einer systematischen Folge von Verfahrensschritten für die Wertbemessung zum Ausdruck kommt"!!. Das Vorliegen einer Bewertungsmethode setzt also voraus, a), die Existenz definierter Verfahrensregeln, die besagen, nach welchen Kriterien bei der Bewertung vorzugehen ist, b), daß alle Verfahrensschritte durch andere Personen intersubjektiv nachvollziehbar (wiederholbar) und nachprüfbar sind, und c), daß das Ergebnis der Methodenanwendung "subjektivinvariant" sein muß, d. h. daß verschiedene Individuen bei den gleichen Ausgangsdaten zu gleichen Ergebnissen gelangen müssen 12. Nun ist weitgehend illusorisch zu glauben, daß bei Anwendung der gleichen Bewertungsmethoden verschiedene Bewertende immer zum gleichen Wertansatz gelangen müssen. In den meisten Fällen sind die intersubjektive Nachvollziehbarkeit und Subjektinvarianz grundsätzlich nur hinsichtlich des angewandten Verfahrens nicht aber hinsichtlich des ermittelten Wertansatzes gegeben 13. Die Bewertungsmethoden beschränken sich nur in ihrer einfachsten Form auf die Auswahl und Anwendung gesetzlich festgeschriebener wertmäßiger Eigenschaften (z. B. Anschaffungskosten, Nennwert) als betragsmäßig bereits fixierte Bewertungsmaßstäbe l4 . Häufig dagegen setzen sich Werte aus mehreren Komponenten zusammen und in diesem Fall kann das Gesetz alternative Wertansätze gestatten, z. B. Einbeziehung oder Nichteinbeziehung von Gemeinkosten in die Herstellungskosten (Wahlrechte) 15. Darüber hinaus können die geforderten oder wahlweise zulässigen Bewertungsmaßstäbe zwar gesetzlich festgelegt, ihre betragsmäßige Ermittlung aber durch Vorgabe alternativer Verfahren, die 9 Vgl. AlD/S, 6. Auflage, § 252 HGB Rn 105; Budde/Geißler, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 252 HGB, Rn 56. IO Vgl. Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung im Konzemabschluß, in: Mellwig/Moxter/Ordelheide (Hrsg.), Einzeiabschluß und Konzernabschluß, S. 123, 130. II Kupsch, Einheitlichkeit und Stetigkeit der Bewertung gemäß § 252 Abs. I Nr. 6 HGB, DB 1987, S. 1101, 1102. 12 Vgl. Pfleger, Zur Gestaltung der Bewertung im lahresabschluß als Mittel künftiger Bilanzpolitik, DB 1984, S. 785, 786. 13 Vgl. Patzak, Einheitliche Bewertung im lahresabschluß, S. 25. 14 Vgl. IDW, SABI 2/1987, WPg 1988, S. 49; Wohlgemuth, FS v. Wysocki, S. 45, 49. 15 Vgl. IDW, SABI 2/1987, WPg 1988, S. 49.
I. Auf den Konzernabschluß anwendbare Bewertungsmethoden
41
Schätzungen oder Ermessensentscheidungen erfordern, vom Rechnungslegenden noch vorzunehmen sein l6 . Eine Bewertungsmethode läßt sich somit in drei Teile zerlegen 17: (I)
Bestimmung der relevanten Wertkategorie für das Bewertungsobjekt (z. B. Herstellungskosten, niedrigerer Tageswert oder niedrigerer Wert, der auf steuerlich zulässigen Abschreibung beruht)
(11) verfahrensmäßige Fixierung der Wertkategorie (z. B. Einbeziehung
oder Nichteinbeziehung von Gemeinkosten und Zinsen für Fremdkapital, ferner Einzelbewertung, Verbrauchsfolgefiktion)
(III) betragsmäßige Festlegung der relevanten Wertkategorie auf der Grundlage des vorhandenen Datenmaterials (individueller Wertansatz des Bewertungsobjekts). Der so ermittelte individuelle Wertansatz (betragsmäßige Festlegung) hängt also wesentlich vom gewählten Verfahren ab. Die Nachvollziehbarkeit der ermittelten individueller Wertansätze ist aber insofern gegeben, als der Bilanzleser anhand der vorliegenden Wertansätze und der angewandten Bewertungsmethoden verläßliche Rückschlüsse auf die zugrundeliegenden Bewertungsobjekte ziehen kann. Bei Vorliegen zweier oder mehrerer Bewertungsvarianten (etwa wegen Vorliegen eines Wahlrechts) muß sich der gewählte Wertansatz aus einer dieser Methoden ergeben; dagegen ist unzulässig, einen beliebigen Wert zu wählen, der seinerseits innerhalb der Grenzen des höchst- und des niedrig-zulässigen Wertes liegt (Grundsatz der Methodenbestimmtheit) 18. Diese Nachvollziehbarkeit ist aber umso größer, desto geringer die Zahl der Bewertungsalternativen, d.h. der Bewertungswahlrechte in der Bilanz ist. Denn bei Vorliegen mehrerer Wahlrechte, insbesondere bei deren unterschiedlicher Ausübung in der Bilanz, ist es für den Bilanzleser sehr schwierig sowohl die angewandten Bewertungsmethoden in ihrer vollständigen Zusammensetzung, als auch und vor allem die der Anwendung dieser Methoden zugrundeliegenden Motive des Bewertenden nachvollziehen zu können. Fragen der einheitlichen Bewertung beziehen sich dabei vorwiegend auf diese Bewertungsmethoden und zielen auf die Ausübung bestehender Wahlrechte ab l9 . 16 Vgl. Wohlgemuth, FS v. Wysocki, S. 45, 49; vgl. auch AIDIS, 6. Auflage, Vorbemerkungen zu §§ 252 - 256 HGB, Rn 19. 17 Vgl. Kupsch, DB 1987, S. 1101, 1102. 18 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 252 HGB, Rn 124. 19 Dümpel, Der Grundsatz der einheitlichen Bewertung im Konzern und seine Problematik insbesondere bei Einbeziehung ausländischer Tochterunternehmen in den WeItabschluß, Krefeld 1991, S. 60.
42
Kap. B: Einheitlich Bewerten 3. Bewertungswahlrechte
Ein Wahlrecht liegt vor, wenn für die Abbildung eines gegebenen Sachverhalts in der Bilanz mindestens zwei eindeutig fixierte Alternativen bestehen, die sich gegenseitig ausschließen, und wenn der Bilanzierende bestimmten kann, welche von den beiden Anwendung finden so1l20. Solche Alternativen sind durch den Gesetzgeber vorgegeben, wenn er an einen im Gesetz bezeichneten Tatbestand zwei oder mehr gleichermaßen zulässige Vorgehensweisen anknüpft. Dann ist die Rede von gesetzlich kodifizierten (oder expliziten21 oder auch echten22 ) Wahlrechten 23 • Gesetzliche Wahlrechte treten zum einen dergestalt auf, daß die alternativen Rechtsfolgen vollständig in einer Norm geregelt sind. So stellt § 256 Satz 1 HGB verschiedene Möglichkeiten von Bewertungsvereinfachungsverfahren (Lifo-, Fifo-Methode usw.) zur Verfügung, zwischen denen der Rechnungslegende wählen kann. Zum anderen können Wahlrechte in der Form geregelt sein, daß die gesetzliche Vorschrift eine bestimmte Handlungs- oder Verfahrensweise zur Verfügung stellt und der Bilanzierende die Wahl hat, ob er sie nutzt oder nicht, wie z.B. in § 253 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. § 279 Abs. 1 HGB; hierbei kann der Bewertende Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens bei vorübergehender Wertminderung vornehmen. Ebenso zulässig ist aber auch den bisherigen Wertansatz beizubehalten24 . Unter den so beschriebenen Begriff des Wahlrechts fallen im Grunde alle Wahlrechte, die in den Vorschriften zur Bewertung im Einzelabschluß gewährt werden 25 . Sie finden sich in den §§ 252 - 256 und 279 - 283 HGB, sowie in den mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vereinbaren Abschreibungsmethoden 26 . Sie werden vom Gesetzgeber eingeräumt, um beispielsweise dem Aspekt der Wesentlichkeit 20 Vgl. Bauer, Rechnungspolitik der Unternehmung, Wiesbaden 1981, S. 66ff. und 72 ff.; Dietl, Zur Ausübung von gesetzlich eingeräumten Wahlrechten im Konzernabsch1uß, Frankfurt 1992, S. 4; Dieckmann, Steuerbilanzpolitik, Wiesbaden 1970, S. 20; Kamann, Bilanzansatzwahlrechte, StuW 1978, S. 108, 109; Kummer, Wahlrechte, Berlin 1966, S. 3; Selchertl Karsten, Konzernabschlußpolitik und Konzerneinheitlichkeit, DB 1989, S. 837. 21 Vgl. Chmie1ewicz, Vereinheitlichung der Rechnungslegung ... , ZfbF Sonderheft 10/980, S. 15, 23f. 22 Vgl. IDW, SABI 2/1987, Wpg 1988, S. 49. 23 Vgl. Dietl, Zur Ausübung ... , S. 4; SelchertIKarsten, DB 1989, S. 837. 24 Vgl. SelchertIKarsten, DB 1989, S. 837; vgl. auch Dietl, Zur Ausübung, S. 4. 25 Vgl. Meinho1d-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 66. 26 Vgl. Meinho1d-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 66; vgl. auch SABI 2/1987, WPg 1988, S. 48 f.; Schneeloch, Bewertungsstetigkeit in Hande1s- und Steuerbilanz, WPg 1987, S. 405, 406.
I. Auf den Konzernabschluß anwendbare Bewertungsmethoden
43
Rechnung zu tragen, die Anpassung der Bilanzierung an besondere betriebliche Verhältnisse zu ermöglichen, die Rechnungslegung zu vereinfachen oder durch die Minderung des steuerpflichtigen Gewinns wirtschaftspolitischen Zwecken zu verhelfen 27 • Allerdings lassen sich alternative Bewertungsmethoden, wie die Wahlrechte es sind, mit der Informationsfunktion der Rechnungslegung schwer vereinbaren. Sie erschweren den Perioden- und zwischenbetrieblichen Vergleich und stellen bedeutende bilanzpolitische Instrumente für den Bilanzierenden dar28 . Sie ermöglichen die von außen nicht erkennbare Bildung und Auflösung stiller Rücklagen und auf diese Weise beeinträchtigen sie die Informationsfunktion der Rechnungslegung 29 • Die so wichtige Nachvollziehbarkeit der methodischen Bewertung wird eben durch solche Bewertungsalternativen beeinträchtigt. a) Wahlrechte und Bewertungsspielräume
Von den gesetzlichen Bewertungswahlrechten sind die Bewertungsspielräume zu unterscheiden. Ein Bewertungsspielraum liegt vor, wenn entweder ein für die Rechnungslegung bedeutsamer Sachverhalt einem im Gesetz bestimmten Tatbestand nicht bzw. nicht eindeutig zuzuordnen ist (Subsumtionsspielraum) oder der Tatbestand einer Rechtsnorm mit einer bestimmten Rechtsfolge nicht eindeutig verknüpft werden kann (Konklusionsspielraum)30. Zur Entstehung von Bewertungsspielräumen führen also sowohl unbestimmte Rechtsbegriffe infolge der vom Gesetzgeber angestrebten Allgemeingültigkeit gesetzlicher Regelungen, deren Anwendung eine Begriffsausfüllung durch den Rechnungslegenden voraussetzt, als auch gesetzlich nicht geregelte Einzelfragen, die für die Rechnungslegung von Bedeutung sind3l . Spielräume unterscheiden sich von den gesetzlichen Wahlrechten vor allem dadurch, daß ein Wahlrecht durch genau bezeichnete Alternativen oder eine exakt begrenzte Bandbreite bestimmt ist, während ein Spielraum dem Ermessen des Rechnungslegenden in nicht eindeutig festgelegten oder festlegbaren Grenzen freien Raum läße 2 . So ist die Festlegung der Nut27 Vgl. Bauer, Zur Rechtfertigung von Wahlrechten in der Bilanz, BB 1981, S. 766, 768ff. 28 Vgl. Richter, Martin, Gewinnrealisierung bei langfristiger Fertigung, in: Ballwieser, (Hrsg.), US-amerikanische Rechnungslegung, Stuttgart 1995, S. 125, 148. 29 Vgl. Busse v. Colbe, Rechnungslegungsziele und Ansätze zur internationalen Harmonisierung der Rechnungslegung deutscher Unternehmen, in: Ballwieser (Hrsg.) US-amerikanische Rechnungslegung, Stuttgart 1995, S. 221, 231. 30 Vgl. Bauer, BB 1981, S. 766, 767. 31 Vgl. Diet!, Zur Ausübung ... , S. 6. 32 Vgl. Bauer, BB 1981, S. 766, 768.
Kap. B: Einheitlich Bewerten
44
zungsdauer eines Vermögens gegenstandes ein Ermessensspielraum, während die Wahl der Abschreibungsmethode an sich ein Wahlrecht ist33 . In der Bilanzierungspraxis haben sich mit Blick auf das Bedürfnis, die Rechnungslegung zu objektivieren, für einzelne unbestimmte Rechtsbegriffe standardisierte Auslegungen herauskristallisiert, die unabhängig von den Spezifika des jeweiligen Einzelfalles zur Anwendung gelangen können. Sie enthalten jeweils zwei oder mehr Auslegungsalternativen, die gleichermaßen ohne Berücksichtigung des Einzelfalles vom Bilanzierenden angewandt werden können 34 . So kann etwa die Höhe der Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften auf der Basis künftiger Voll- oder Teilkosten ermittelt werden 35 . Damit stehen dem Bilanzierenden Wahlrechte zur Verfügung, die nicht kodifiziert sind, sondern faktisch aus den standardisierten Auslegungen unbestimmter Rechtsbegriffe resultieren 36 . Für eine solche standardisierte Auslegung kommen grundsätzlich nur solche unbestimmte Rechtsbegriffe in Frage, die sich auf Verfahrensfragen beziehen, deshalb werden sie als Verfahrenswahlrechte37 oder Verfahrensspielräume38 bezeichnet. In den meisten Fällen hat sich aber keine so eindeutige standardisierte Auslegung für unbestimmte Rechtsbegriffe herausgebildet. Der Bewertende muß selber diejenigen Faktoren, welche die Lösung des Auslegungsproblems beeinflussen oder bestimmen, identifizieren und werten 39 . Die Gewichtung dieser Faktoren kann nur in Grenzen objektivierbar und interpersonell nachvollziehbar sein, denn das Erkennen von Einflußfaktoren und die Gewichtung der Einflüsse sind sowohl von der individuellen Erfahrung des Rechtsanwenders als auch von seinen Risiko- und Zielvorstellungen geprägt4o . So ist es nicht zu vermeiden, daß in die Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe ein Rest an subjektivem "Fürrichtighalten" einfließt41 , zumal der lahresabschluß nicht nur vergangenheitsbezogene, sondern auch zukünftige Entwicklungen berücksichtigen so1l42. Vgl. Küting, Grundlagen der Bilanzpolitik, BBK 1996, S. 787, 801. Vgl. Patzak, Einheitliche Bewertung im Jahresabschluß, S. 20f.; Pfleger, DB 1984, S. 785; Selchert/Karsten, DB 1989, S. 837f. 35 Vgl. Pfleger, DB 1984, S. 785. 36 Vgl. Selchert/Karsten, DB 1989, S. 837, 838. 37 Selchert/Karsten, ebenda. 38 Vgl. Pfleger, DB 1984, S. 785, 786; ders., Die neue Praxis der Bilanzpolitik, 4. Auflage, 1991, S. 34. 39 Vgl. Selchert/Karsten, DB 1989, S. 837, 838. 40 Vgl. Selchert/Karsten, DB 1989, S. 837, 838. 41 Vgl. Tipke, Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe, in: Leffson/Rückle/ Großfeld (Hrsg.), Handwörterbuch unbestimmter Rechtsbegriffe, S. 1,4. 42 Vgl. Marettek, Ermessensspielräume bei der Bestimmung wichtiger aktienrechtlichen Wertansätze. In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium 1976, S. 515; Baetge, Möglichkeiten der Objektivierung des Jahreserfolgs, Düsseldorf 1970, S. 18. 33
34
I. Auf den Konzernabschluß anwendbare Bewertungsmethoden
45
Soweit also die durch den Bewertenden vorzunehmende subjektive Würdigung der tatsächlichen Verhältnisse nicht zu einer einzigen und eindeutig bestimmten Lösung, sondern zu einer Bandbreite für zulässig gehaltener Lösungen führt, verbleibt bei der Ausfüllung des unbestimmten Rechtsbegriffs ein Ermessensspielraum, der vom Bewertenden genutzt werden kann43 . Obwohl also die Spielräume nicht (wie die gesetzlichen Wahlrechte) eingeräumt werden, um den Bilanzerstellern ein Potential zur zielgerichteten Beeinflussung des Jahresabschlusses zu eröffnen, sondern sich zwangsläufig aus der praktischen Unmöglichkeit einer vollständigen Normierung der wirtschaftlichen Wirklichkeit ergeben, stellen sie faktisch, ebenso wie die Wahlrechte, bilanzpolitische Mittel dar, die einen wesentlichen Einfluß auf das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft oder des Konzerns haben können44 . Angesichts der Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe und der im Einzelfall bestehenden inhaltliche Weite (etwa Festlegung der Nutzungsdauer [Rechengrößen] von Vermögensgegenständen bei der Aufstellung eines Abschreibungsplans45 ) der Spielräume sind sie sogar höher einzuschätzen, als die Bedeutung der zahlenmäßig weit geringerer kodifizierten Wahlrechte 46 . Deshalb und obwohl Spielräume nicht unmittelbar wie die Wahlrechte Gegenstand des Grundsatzes der einheitlichen Bewertung (§ 308 Abs. 1 Satz 1 HGB) sind, dürfen sie nicht vom Einheitlichkeitspostulat freigestellt werden. Vielmehr muß ihre Ausübung stets mit Blick auf die Generalnorm (§ 264 Abs. 2 Satz 1 bzw. § 297 Abs. 3 Satz 2 HGB) bei gleichartigen Sachverhalten einheitlich erfolgen 47 • b) Wahlrechte und Sachverhaltsgestaltungen
Bewertungswahlrechte müssen ferner auch von den Sachverhaltsgestaltungen abgegrenzt werden. Der Begriff der Sachverhaltsgestaltung gehört zu den Instrumentarien der Bilanzpolitik48 • Die Einsetzung von sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen kann Einfluß auf das Bild der Vermögens-, Vgl. Selchert/Karsten, DB 1989, S. 837, 838. Vgl. Küting, BBK 1996, S. 787, 800; Patzak, Einheitliche Bewertung im Jahresabschluß, S. 19. 45 Vgl. Reintges, WPg 1987, S. 282, 283. 46 Vgl. Selchert/Karsten, DB 1989, S. 837, 839; Nach Schedlbauer, Erfolgsbereinigung um stille Reserven, in: Coenenberg, Bilanzanalyse nach neuem Recht, 2. Auflage, S. 143, machen die Ermessenspielräume "getrost etwa 75 %" aller stillen Rücklagen im Jahres- bzw. Konzernabschluß aus. 47 Vgl. Baetge/Commandeur, in Küting/Weber, HdR, 4. Auflage, § 264 HOB, Rn 32ff. 48 V gl. Wenzel, Bilanzierung von Sachverhaltsgestaltungen mit Reserveauflösung im Anlagevermögen, Frankfurt a. M. 1987, S. 8. 43
44
46
Kap. B: Einheitlich Bewerten
Finanz- und Ertragslage des Unternehmens haben und steht somit der Ausübung von Bewertungswahlrechten ähnlich. Allerdings besteht die Sachverhaltsgestaltung in der Vornahme von Handlungen rechtlicher oder wirtschaftlicher Natur und deren Umsetzung in Geschäftsvorfälle vor dem Bilanzstichtag, um das Mengengerüst der zu bilanzierenden Vermögensgegenstände und Schulden zu beeinflussen49 . Die Sachverhaltsgestaltung nach dem Bilanzstichtag ist aus der Definition heraus nicht möglich 5o . Bewertung im bilanzrechtlichen Sinne ist aber die wertmäßige Abbildung von am Bilanzstichtag abgeschlossenen Sachverhalten. Darin besteht ein klarer Unterschied zu den Wahlrechten. Denn letztere knüpfen an gegebene Sachverhalte an und beeinflussen deren Darstellung im Jahresabschluß: Bewertungswahlrechte sind sachverhaltsabbildende Maßnahmen51 . Sachverhaltsgestaltungen gehören also nicht zu den Bewertungsmethoden und deshalb fallen sie trotz ihrer erhöhten Bedeutung für die Konzernbilanzpolitik nicht unter den Grundsatz der einheitlichen Bewertung. 4. Ansatzwahlrechte
Das HGB unterscheidet bis auf wenige Ausnahmen, wie z. B. § 308 Abs. 3 oder § 255 Abs. 4, eindeutig zwischen Ansatz und Bewertung52 . Denn bei den Ansatzvorschriften geht es um das "Ob" der Bilanzierung, bei den Bewertungsvorschriften aber um das "Wie". Beim Ansatz lautet die Frage was in die Bilanz wo aufzunehmen ist, bei der Bewertung wird entschieden, wie hoch die aufgenommenen Posten auszuweisen sind53 . Dennoch besteht eine enge Verknüpfung zwischen Ansatz und Bewertung: bewertet wird nur, was schon angesetzt wurde. Nach § 300 Abs. 2 Satz I HGB sind die Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Erträge und Aufwendungen der in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen unabhängig von ihrer Berücksichtigung in den Jahresabschlüssen dieser Unternehmen vollständig aufzunehmen, soweit nach dem Recht des Mutterunternehmens nicht ein Bilanzierungsverbot oder ein Bilanzierungswahlrecht besteht. Nach dem Recht des Mutterunternehmens zulässige Bilanzierungswahl49 Vgl. DietI, Zur Ausübung ... , S. 5; Hoffmann, Karsten, Einsatz von Sachverhaltsgestaltungen, DB 1996, S. 1245ff.; Wenzel, Bilanzierung von Sachverhaltsgestaltungen, S. 8. 50 Vgl. Wenzel, Bilanzierung von Sachverhaltsgestaltungen, S. 8. 51 Vgl. Küting, Grundlagen der Bilanzpolitik, BBK 1996, Fach 19, S. 787, 797; Pfleger, Bilanzpolitik, 4. Auflage, S. 33 ff. 52 Vgl. Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 8; Ordelheide, WPg 1985, S. 509,511f. 53 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 36, Rn 81.
I. Auf den Konzernabschluß anwendbare Bewertungsmethoden
47
rechte dürfen gemäß § 300 Abs. 2 Satz 2 HGB im Konzernabschluß unabhängig von ihrer Ausübung in den einbezogenen Einzelabschlüssen ausgeübt werden. Im Gegensatz zu § 308 fordert § 300 Abs. 2 HGB nicht explizit die einheitliche Ausübung von Bilanzierungswahlrechten, so daß die Ansicht vertreten wird, daß Ansatzwahlrechte im Konzernabschluß nicht einheitlich ausgeübt werden müssen 54 . Allerdings übersieht diese Auffassung, daß zwischen den Bilanzierungs- und den Bewertungswahlrechten ein enges Verhältnis besteht und daß der Zweck einer einheitlichen Bewertung nicht zu erreichen wäre, wenn bereits im vorhinein ein wichtiger Teil eines einheitlichen Bewertungskomplexes - nämlich die Ansatzwahlrechte - aus der Betrachtung ausgeschaltet würde 55 . Einheitliche Ausübung der Bewertungswahlrechte trotz Uneinheitlichkeit bei den Ansatzwahlrechten wäre möglicherweise kontraproduktiv im Sinne eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes. Denn die Zusammenkunft von uneinheitlichen Ansatzund einheitlichen Bewertungswahlrechten kann das Bild verzerren und nur eine flexible Bewertung könnte dieses Bild wiederum geraderücken56 . Auch ein Blick auf die Rechtsvergleichung bekräftigt diese Ansicht: Die Bewertungseinheitlichkeit ist ein Grundsatz, der aus dem angelsächsischen, vorwiegend aus dem englischen Rechtskreis stammt57 . Dort ist aber nicht nur die einheitliche Bewertung, sondern auch die einheitliche Anwendung aller Bilanzierungsmethoden vorgeschrieben 58 . Darüber hinaus wäre die unterschiedliche Ausübung von Ansatzwahlrechten bei gleichen Sachverhalten auch wegen des Willkürverbots unzulässig 59 . Dem Einheitlichkeitsgrundsatz zufolge müssen also gleiche Sachverhalte nicht nur gleich bewertet, sondern auch gleich angesetzt werden60 . Das deutlichste Argument liefert aber der neue § 300 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 HGB. Hiernach dürfen Ansätze, die auf der Anwendung von für Kre54 Vgl. etwa Dusemond, DB 1996, S. 538; Lederle, in: Beck'sches HdR, C 300, Rn 60ff.; Ordelheide, WPg 1985, S. 509, 511 f. 55 Vgl. Harms/Küting, BB 1984, S. 105, 109; Reintges, WPg 1987, S. 282, 287; a. A. Ordelheide, WPg 1985, S. 509, 511f., der aber an anderer Stelle (S. 510) für mangelnde Abstimmung im RegE zum BiRiLiG zwischen den Ansatz- und den Bewertungsvorschriften beklagt. 56 Vgl. Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 82; Reintges, WPg 1987, S. 282, 287; Klein, Konzernbilanzpolitik, Heidelberg 1989, S. 236f. 57 Vgl. Kapitel A, I. 2. dieser Arbeit. 58 SSAP 14 Gliederungspunkt 16 und para 3 von schedule 4A und para 11 von schedule 4 des Companies Act 1985. 59 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 138; Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 82. 60 Vgl. Baetge/Thomas-Meyer, Der Grundsatz der Einheitlichkeit in der Konzemrechnungslegung, BBK 1995, S. 485, 488.
48
Kap. B: Einheitlich Bewerten
ditinstitute oder Versicherungs unternehmen spezifischen Bewertungsvorschriften beruhen, im Konzernabschluß beibehalten werden. Die inhaltliche Gleichheit zum § 308 Abs. 2 Satz 3 HGB ist offenkundig. Dadurch, daß der Gesetzgeber die besondere Gruppe der Kreditinstitute und der Versicherungsunternehmen aus der Pflicht zur Vereinheitlichung der Ansatzwahlrechte im Konzernabschluß herausnimmt, ergibt sich klar, daß für die anderen Unternehmen eine solche Pflicht gegeben ist. Dafür spricht aber auch eine bisher weitgehend verkannte Tatsache: Im Gegensatz zum deutschen Recht, das streng zwischen Ansatz und Bewertung trennt, wird in vielen Ländern wie auch im Sprachgebrauch der EGBilanz-Richtlinien in der Regel pauschal der Begriff "Bewertung" als Oberbegriff für Ansatz und Bewertung im engeren Sinne verwendet61 . Dies wird in Art. 66 EG-Versicherungsbilanz-Richtlinie deutlich 62 : dort läßt der Richtliniengeber ausdrücklich die Ausnahme von der Vereinheitlichung für Bewertungswahlrechte von Versicherungsunternehmen zu, dagegen läßt er aber die Ansatzwahlrechte unerwähnt. Auf den ersten Blick wäre es so zu verstehen, daß die letzteren von den Ausnahme nicht erfaßt sind, daß also Ansatzwahlrechte von Versicherungsunternehmen zu vereinheitlichen sind. Der deutsche Nationalgesetzgeber nahm unter Hinweis auf den genannten unterschiedlichen Sprachgebrauch an, daß sich aus Art. 66 Nr. 6 Versicherungsbilanz-Richtlinie Auswirkungen auf Ansatz- und Bewertungsvorschriften "ergeben,,63. Die Rückschlüsse auf die Auslegung der 7. EG-Gesellschaftsrechts-Richtlinie und des Bilanzrichtlinien-Gesetzes dürften begründet sein. Auf der Ebene der 7. EG-Richtlinie wird dies deutlich, indem trotz der ausdrücklichen Verwendung der Begriffe Ansatz (Art. 18) und Bewertung (Art. 29) in der Protokollerklärung (Nr. 13) zu Art. 18 der 7. EG-Richtlinie festgestellt wird, daß "die vollständige Übernahme der Aktiva und Passiva sowie der Erträge und Aufwendungen nach denselben Regeln erfolgt, die gemäß Art. 29 Abs. 2 gelten,,64. Art. 29 der 7. Richtlinie regelt aber den Grundsatz der einheitlichen Bewertung mit der Maßgabe, daß nach Abs. 2 die Bewertungsmethoden anzuwenden sind, die auch das Mutterunternehmen auf seinen lahresabschluß anzuwenden hat. Diese Maßgeblichkeit des 61 Vgl. Luttennann, Konzernrechnungslegung der Versicherungsunternehmen, BB 1995, S. 191, 194; ferner Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 139. 62 Vgl. Richtlinie 91/674/EWG, vom 19.12.1991 (ABI. EG Nr. L 374 vom 31.12.1991, S. 7ff.). 63 Vgl. Regierungsentwurf zum Versicherungsbilanzrichtlinien-Gesetz vom 26.8.1993, BT-Drucks. 12/5587, S. 19 dem der Gesetzgeber insoweit unverändert gefolgt ist; vgl. auch Luttennann, BB 1995, S. 191, 194. 64 Abdruck der Protokollerklärung Nr. 13 in Biener/Berneke, BilanzrichtlinienGesetz, Düsse1dorf 1986, S. 856.
I. Auf den Konzemabschluß anwendbare Bewertungsmethoden
49
auf das Mutterunternehmen anzuwendenden Rechts bezüglich der Bewertung erstreckt sich somit auch auf die Ansatzvorschriften65 . 5. Bewertungsregeln des Mutterunternehmens
Auf theoretischer Basis bestehen für die Bewertung im Konzernabschluß mehrere Möglichkeiten. In Betracht kommen eigene Bewertungsvorschriften für den Konzernabschluß oder die Übernahme der Bewertungsvorschriften für den lahresabschluß der Kapitalgesellschaft oder des Kaufmanns 66 . Aus der Sicht der Europäischen oder internationalen Angleichung der Rechnungslegung erscheint die Anwendung konzerneigenen Bewertungsregeln sinnvoll, weil sie nicht durch die gewinn- und steuerbemessungsorientierte Prägung der Einzelabschlußregeln beeinflußt wären (zu denken ist vor allem an die sehr starke Beeinflussung der Bewertung im handelsrechtlichen lahresabschluß in Deutschland durch das in § 5 Abs. 1 EStG verankerte Maßgeblichkeitsprinzip )67. Trotzdem läßt die 7. EG-Richtlinie nur solche Vorschriften zu, die mit der 4. EG-Richtlinie übereinstimmen (Art. 29 Abs. 2 der 7. Richtlinie)68. Das HGB schränkt die für den Konzernabschluß geltenden Bewertungsregeln auf jenen Teil der mit der 4. EG-Richtlinie vereinbaren Bewertungsvorschriften ein, die ins deutsche HGB umgesetzt worden sind, namentlich auf die für Kapitalgesellschaften geltenden Bewertungsvorschriften des HGB (§ 308 Abs. 1 Satz 1 HGB). Somit wird durch § 300 Abs. 2 HGB für den Ansatz und § 308 Abs. 1 Satz 1 HGB für die Bewertung ein einheitlicher Rahmen für die Erfassung aller zum Konzern gehörenden Bewertungsobjekte (Bewertungsrahmen des Mutterunternehmens) festgelegt 69 . Nach § 308 Abs. 1 Satz 1 HGB sind die in die Konzernbilanz aufgenommenen Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten usw. nach den auf den lahresabschluß des Mutterunternehmens anwendbaren Bewertungsregeln zu bewerten. Letztere unterscheiden sich aber von den auf den lahresabschluß des Mutterunternehmens angewandten Bewer65 Vgl. Geib I Ellenbürger I Kölschbach, Ausgewählte Fragen zur EG-Versicherungsbilanz-Richtlinie, WPg 1992, S. 221, 230. 66 Vgl. Scherrer, in BoHR, § 308 HGB, Rn 6. 67 Vgl. Van Hulle/Van der Tas, European Union. Group Accounts, in: Ordelheide/KPMG (Hrsg.), Transnational Accounting, S. 1047, 1066. 68 Vgl. Van Hulle/Van der Tas, ebenda; vgl. aber auch den Entwurf zu einem sog. Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz, WPg 1996, S. 564 ff. und die Modifikationen, die er vorsieht (siehe dazu auch Kapitel F, H.3. dieser Arbeit). 69 Vgl. Ordelheide, Gennany. Group Accounts, in: Ordelheide/KPMG (Hrsg.), Transnational Accounting, S. 1547, 1592; Küting/Weber, Bewertung, einheitliche, in: Lück, Lexikon der Rechnungslegung und Abschlußprüfung, 2. Auflage, S. 137. 4 Xenides
50
Kap. B: Einheitlich Bewerten
tungsregeln dadurch, daß auch andere (nach dem Recht des Mutteruntemehmens zulässige) Bewertungswahlrechte hätten ausgeübt werden können7o . D.h. also: Das Mutteruntemehmen hätte in seiner Bilanz nach einer Anzahl von Bewertungsvorschriften bewerten müssen (bei zwingenden Bewertungsvorschriften) oder können (bei Bewertungswahlrechten). Im ersten Fall gibt es zwischen den angewandten und den anwendbaren Bewertungsregeln keinen Unterschied; im Konzernabschluß muß so bewertet werden wie auch im Jahresabschluß des Mutteruntemehmens71. Im zweiten Fall ist es dagegen anders; das Mutteruntemehmen hatte in seinem Einzelabschluß zwischen mehreren zulässigen Bewertungswahlrechten, sich für eines davon zu entscheiden. Diese Entscheidung ist aber für den Konzemabschluß nicht bindend, denn das Gesetz verlangt die Anwendung der "anwendbaren" Bewertungsregeln, also aller derjenigen, die auf den Jahresabschluß des Mutteruntemehmens hätten ausgeübt werden können. Diese Wahlrechte "können im Konzernabschluß unabhängig von ihrer Ausübung in den Jahresabschlüssen der in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen ausgeübt werden" (§ 308 Abs. 1 Satz 2 HGB). Wenn also das Mutteruntemehmen eine Kapitalgesellschaft ist, dann sind die §§ 252 - 256 und 279 - 283 HGB anzuwenden 72. Bei einem nach dem sog. Publizitätsgesetz73 zur Konzernrechnungslegung verpflichteten Unternehmen gilt folgendes: Gemäß § 13 Abs. 2 PublG ist u.a. § 298 HGB sinngemäß anzuwenden, d. h. unter Einbeziehung der für Kapitalgesellschaften geltenden Bewertungsvorschriften mit Ausnahme der §§ 279 Abs. 1 und 280 HGB, die gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 PublG nicht angewendet zu werden brauchen74. Dem publizitätspflichtigen Mutteruntemehmen ist es aber freigestellt, auf seinen Konzernabschluß die Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften in vollem Umfang anzuwenden, um die Befreiungsmöglichkeit nach § 291 HGB nutzen zu können und somit seine Töchtergesellschaften-Kapitalgesellschaften von der Pflicht zur Aufstellung eigener Teilkonzernabschlüsse zu befreien. Denn diese Erleichterung kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn im publizitätspflichtigen Konzernabschluß auch §§ 279 Abs. 1 und 280 HGB angewendet worden sind (§ 13 Abs. 3 Satz 3 PubIG)75. 70 Vg\. Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, Stuttgart 1991, S. 99; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HOB, Rn 13. 71 Vg\. Schnicke, Organisation der Erstellung und Prüfung des Konzernabschlusses, in: Mellwig/Moxter/Ordelheide (Hrsg.), Einzelabschluß und Konzernabschluß,
S. 153, 159.
72 Vg\. Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 99; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HOB, Rn 14. 73 Oesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und Konzernen vom 15. August 1969 (BOB\. I, S. 1189). 74 Vg\. Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HOB, Rn 14.
11. Einheitliche Ausübung der anwendbaren Bewertungsmethoden
51
11. Einheitliche Ausübung der anwendbaren Bewertungsmethoden
Die auf den lahresabschluß des Mutterunternehmens anwendbaren Bewertungsregeln stellen den Rahmen aller Bewertungsvorschriften dar, die auf der Ebene des Konzernabschlusses und für alle einbezogenen Unternehmen anzuwenden sind bzw. überhaupt angewendet werden können (§ 308 Abs. 1 Satz 1 HGB). Allerdings greift der Grundsatz der Einheitlichkeit der Bewertung erst auf der Ebene des Konzernabschlusses ein76 . Die Bewertung in den Einzelabschlüssen der einbezogenen Unternehmen unterliegt dagegen einer Fülle von rechtlichen (wie z. B. Rechtsform oder Nationalität des Unternehmens, die zur Anwendung verschiedenen Bewertungsregeln für den lahresabschluß zwingen können) oder tatsächlichen (Einsetzung von technischen Anlagen unter tropischen Klimabedingungen, Bilanzierung anhand einer Hochinflationswährung, politische und wirtschaftliche Unstabilität oder schlechte Zahlungs moral der Abnehmer) Gegebenheiten, die zu sehr differenzierten und miteinander wenig vergleichbaren Wertansätzen führen. Die Aussagefähigkeit des Konzernabschlusses ist aber nur dann garantiert, wenn die in ihm angesetzten Posten miteinander vergleichbar sind, wenn die in ihn aufgenommenen Vermögensgegenstände und Schulden anhand von einheitlichen Bewertungsmethoden bewertet werden. Die bloße Zusammensetzung von Wertansätzen, die auf unterschiedlicher Basis ermittelt wurden vermag dagegen nicht den vom Gesetz und der 7. EG-Richtlinie geforderten "true and fair view" zu vermitteln77. Andererseits sind die in den Konzernabschluß aufzunehmenden Vermögensgegenstände und Schulden in einem viel größeren Maße unterschiedlichen Umfeldbedingungen ausgesetzt, als die im lahresabschluß eines Einzelunternehmens angesetzten Posten. Dies ist bei der Bewertung im Konzernabschluß entsprechend zu berücksichtigen. Deshalb muß der Inhalt der Bewertungseinheitlichkeit im Konzernabschluß näher untersucht und vor allem die Frage geklärt werden, was unter der einheitlichen Ausübung der Bewertungswahlrechte im Konzernabschluß zu verstehen ist.
75 VgI. Biener, Stellungnahme zu § 308 HGB bei der Sachverständigenanhörung vor dem Unterausschuß-Bi1anzrichtiinien-Gesetz, in: Heimrich (Hrsg.), BiRiLiG, S. 232; Küting/Weber, § 308 HGB, Rn 14. 76 VgI. aber Vorschlag der Kommission für eine siebte Richtlinie, ABI. EG Nr. C 121 vom 2.6.1976, S. 2ff., Art. 15 Abs. 2, der die Pflicht zur einheitlichen Bewertung auch auf die Ebene der Jahresabschlüsse der einbezogenen Unternehmen ausdehnen wollte; dazu auch Wiesner, AG 1979, S. 275, 277. 77 VgI. Havennann, FS Döllerer, S. 185f.; Davies/Paterson/Wilson, UK-GAAP, 4. Auflage, S. 220. 4*
52
Kap. B: Einheitlich Bewerten
1. Leitlinien der Bewertungseinheitlichkeit im Konzern
a) Fiktion rechtlicher Einheit Nach § 297 Abs. 3 Satz 1 ist im Konzernabschluß die Vennögens-, Finanz- und Ertragslage der einbezogenen Unternehmen so darzustellen, als ob diese Unternehmen insgesamt ein einziges Unternehmen wären; der Konzern wird also nicht nur als wirtschaftliche, sondern auch als (gedachte) rechtliche Einheit behandelt (Fiktion der rechtlichen Einheit) 78. Auf diese Weise wird der in der 7. EG-Richtlinie und dem HGB etablierten "Einheitstheorie" Rechnung getragen 79. Dieser Theorie zufolge stellt der Konzern ein einheitliches Unternehmen dar, in dem die einzelnen Konzerngesellschaften unselbständigen Betriebsabteilungen dieses Unternehmens vergleichbar sind8o . Der Konzernabschluß stellt den Abschluß der gesamten Einheit Konzern dar, in dem alle Vennögensgegenstände und Schulden sämtlicher "Abteilungen" zusamrnengefaßt werden. Die konsolidierte Bilanz soll also grundsätzlich derjenigen Bilanz entsprechen, welche aufzustellen wäre, wenn das Mutterunternehmen und das/die einbezogene/n Tochterunternehmen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch juristisch ein einheitliches Unternehmen bilden würden 81 . 78
Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 229, Rn 556; Albrecht, BoHdRL,
§ 297 HGB, Rn 1Off.; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüse, 6. Auflage,
S. 19; Dusemond, Bilanzierung und Bewertung im Konzernabschluß, DB 1996, S. 537; Lück, Rechnungslegung im Konzern, Stuttgart 1994, S. 71; Niehus/Scholz, in Mayer/Landrut u.a., GmbHG, §§ 238 - 335 HGB, Rn 1069; a.A. AIDIS, 6. Auflage, § 297, HGB, Rn 40; Budde/Lust, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 297 HGB, Rn 14, die den Begriff "Fiktion rechtlicher Einheit" ablehnen und nur von einer "Fiktion wirtschaftlicher Einheit" sprechen wollen. 79 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 229, Rn 556; AIDIS, 6. Auflage, § 297, Rn 39; Biener/Schatzmann, Konzernrechnungslegung, S. 42; BuddelLust, Beck'scher BK, 3. Auflage, § 297, Rn 14; Havermann, FS Goerdeler, S. 173, 177; Lederle, Beck'sches HdR, C 300, Rn 5; Niehus, Vor-Bemerkungen zu einer Konzernbilanzrichtlinie, WPg 1984, S. 285, 286; Lück, Rechnungslegung im Konzern, S. 71 f.; Schildbach, Der handelsrechtliche Konzernabschluß, 4. Auflage, S. 47f.; Staks, in Küting/Weber, HdKRL, S. 124; Wöhe, Bilanzierung und Bilanzpolitik, 8. Auflage, S. 943ff.; a.A. Baetge, Konzernbilanzen, 1. Auflage, S. 48ff.; Ruppert, Währungsumrechnung im Konzernabschluß, 1993, S. 72 ff.; ders. Die Bedeutung des § 297 Abs. 3 Satz 1 HGB für die Konzernrechnungslegung, in Baetge (Hrsg.), Rechnungslegung und Prüfung 1994, S. 71, (101 ff.), die die Ansicht vertreten, daß § 297 Abs. 3 Satz 1 HGB nur für die Konsolidierungsvorgänge eine Rolle spielt und daß er darüber hinaus nicht als Grundlage für die Einheitstheorie gesehen werden sollte. 80 Vgl. Schildbach, Der handelsrechtliche Konzernabschluß, 4. Auflage, S. 47; Wöhe, Bilanzierung und Bilanzpolitik, 8. Auflage, S. 943. 81 Vgl. Edelkott, Der Konzernabschluß in Deutschland, eine Untersuchung über seine Aussagefähigkeit und seine zweckmäßige Gestaltung, Zürich 1963, S. 24; Wöhe, Bilanzierung und Bilanzpolitik, 8. Auflage, S. 943 ff.
11. Einheitliche Ausübung der anwendbaren Bewertungsmethoden
53
Hierbei werden die Minderheitsgesellschafter der einzelnen Unternehmen praktisch wie Gesellschafter des gesamten Konzerns angesehen, das von ihnen eingezahlte Kapital ist ebenso Eigenkapital des Konzerns wie das Kapital des Mehrheitsgesellschafters 82 . Den Gegensatz zur Einheitstheorie bildet die sogenannte "Interessentheorie", bei der der Konzernabschluß als erweiterter Einzelabschluß des Mutterunternehmens anzusehen ist und die Minderheitsgesellschafter der Tochterunternehmen aus der Sicht des Mutterunternehmens wie außenstehende Gläubiger behandelt werden 83 . Einwirkungen der Einheitstheorie lassen sich in mehreren HGB-Vorschriften zum Konzernabschluß feststellen: So verlangt § 294 Abs. 1 HGB, daß alle Tochterunternehmen, unabhängig von ihrem Sitz in den Konzernabschluß einbezogen werden. Ferner sieht § 307 Abs. 1 HGB vor, daß der Ausgleichsposten für Anteile Minderheitsgesellschafter als Sonderposten innerhalb des Eigenkapitals ausgewiesen wird. Darüber hinaus schreibt § 304 Abs. 1 HGB vor, daß die Verpflichtung zur Eliminierung konzerninterner Ergebnisse auf Verluste aus konzerninternen Lieferungen und Leistungen erweitert wird. Außerdem fordert § 301 HGB, daß bei der Kapitalkonsolidierung die sogenannte "echte angelsächsische Methode" angewandt wird. Last not least sieht das Gesetz vor, daß anstatt des Maßgeblichkeitsgrundsatzes (§ 331 Abs. 1 Nr. 1 AktG 1965) der Grundsatz einheitlicher Bilanzierung und Bewertung (§§ 300 Abs. 2, 308 HGB) tritt 84 . Vieles spricht also dafür, daß die Fiktion rechtlicher Einheit nicht nur für die Konsolidierungsverfahren im eigentlichen Sinne 85 , sondern ganz generell für die Zielsetzung des Konzernabschlusses bedeutend ist86 . Noch mehr, sie stellt eine wichtige Auslegungshilfe für die Generalnorm des § 297 Abs. 2 HGB dar und kann so als Maßstab für die Auslegung von Einzelvorschriften und als Orientierungshilfe für die Beantwortung von Fragen, die im Gesetz nicht geregelt sind, herangezogen werden 87 . Daher ist bei Zweifelsfragen eine sachgerechte Lösung im Rahmen der Fiktion der rechtlichen Einheit der Konzernunternehmen zu suchen 88 . Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 229, Rn 557. Vgl. BuddelLust, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 297 HGB, Rn 15. 84 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, Vorbemerkungen zu §§ 290 - 315, Rn 27. 85 So aber Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 52 ff. 86 Vgl. BienerlSchatzmann, Konzern-Rechnungslegung, S. 42; Lück, Rechnungslegung im Konzern, S. 71. 87 Vgl. Budde I Lust, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 297 HGB, Rn 16; Havermann, FS Goerdeler, S. 173, 177f.; Trützschler, in Küting/Weber, HdKR, S. 445; so auch AIDIS, 6. Auflage, § 297, Rn 42, die aber an der gleichen Stelle auch die Ansicht vertreten, daß sich die Fiktion rechtlicher (nach ihrer Terminologie wirtschaftlicher) Einheit nur auf die eigentliche Konsolidierung beschränkt. 88 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 229, Rn 556. 82 83
54
Kap. B: Einheitlich Bewerten
Da der Konzern für die Rechnungslegung als fiktive rechtliche Einheit angesehen wird, sind für ihn auch nur einheitliche Vorschriften für den Bilanzansatz und die Bewertung vorgesehen (§§ 300 Abs. 2, § 308 HGB), wie das für einen Einzelabschluß selbstverständlich ist89 . Der Grundsatz der Bewertungseinheitlichkeit ist mithin auch als eine Konsequenz der Fiktion rechtlicher Einheit des Konzerns anzusehen 9o . Dies wird auch durch die Gesetzesmaterialien bestätigt. So stellt der Bericht des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages zur HGB-Novelle 1985 zu § 308 HGB fest, daß " ... Bewertungswahlrechte nebeneinander nur ausgeübt werden können, soweit diese Möglichkeit auch für den lahresabschluß einer einzelnen Kapitalgesellschaft besteht,,91. Zu beachten ist jedoch, daß § 297 Abs. 3 Satz 1 HGB unter der Herrschaft der vorausgehenden Generalnorm des § 297 Abs. 2 Satz 2 HGB steht92 • Die der Einheitstheorie entspringende Einheitlichkeit bezieht sich auf das bilanzierende Unternehmen, nicht aber auf die zu bilanzierenden Vermögensgegenstände und Schulden. Letztere unterliegen zwar nicht mehr den rechtlichen wohl aber ihren tatsächlichen Gegebenheiten. So ist selbstverständlich, daß bei einem international operierenden Konzern verschiedene sowohl objektive als auch subjektive Faktoren bei der Beurteilung von bewertungsrelevanten Sachverhalten einen wesentlichen Einfluß ausüben können 93 . Der Fiktion rechtlicher Einheit entsprechend ist es nicht zulässig, daß gleiche Produkte desselben Konzerns aufgrund unterschiedlicher Produktionsstandorte oder nachgeordneter Merkmale unterschiedlich bewertet werden dürfen 94 . Andererseits können etwa Mehrschichtenbetrieb oder Produktion unter tropischen Bedingungen oder in einem politisch oder wirtschaftlich unstabilen Land doch einen Einfluß auf die Bewertung der Anlagen und der Produkte des betroffenen Tochterunternehmens haben 95 . 89 Vgl. Baetge/Kirsch, in Baetge (Hrsg.), Konzernrechnungslegung und -prüfung, 1990, S. 3ff. (14); BuddelLust, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 297 HOB, Rn 16; Havermann, FS Ooerdeler, S. 173, 189; Staks, in Küting/Weber, HdKR, S. 125; v. Wysocki/Wohlgemuth, Konzernrechnungslegung, 4. Auflage, S. 7. 90 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 308 HOB, Rn 14. 91 Vgl. Bericht der Abgeordneten HeImrich, Kleinert (Hannover) und Stiegler, BT-Drucks. 10/4268, S. 116. 92 Vgl. Oroßfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 229, Rn 557; Ruppert, Die Bedeutung des § 297 Abs. 3 Satz 1 HOB, S. 71, 114f. 93 Vgl. Oroßfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 289ff., Rn 715ff. 94 Vgl. Reintges, WPg 1987, S. 282, 285f.; Weirich, Die Bewertung im Konzernabschluß nach neuem Recht, WPg 1987, S. 77, 80. 95 Vgl. Reintges, WPg 1987, S. 282, 285f.; Weirich, WPg 1987, S. 77, 80f.; Müller, Eberhard, Der Konzernabschluß im Konfliktfeld verschiedener Interessen, S.232f.
11. Einheitliche Ausübung der anwendbaren Bewertungsmethoden
55
Ebenso wichtig können auch subjektive Faktoren sein. Die aus einem ausländischen Unternehmen stammenden Bilanzzahlen dürfen nicht ohne weiteres mit denen eines inländischen Unternehmens verglichen werden, denn Menschen werden maßgeblich durch die Kulturvorste11ungen ihres Landes geprägt96 • Dies wirkt sich auch auf die Rechnungslegung aus: Die Risikoeinste11ung der Menschen ist in verschiedenen Kulturkreisen entsprechend unterschiedlich. Das wirkt sich z. B. auf die Bewertung von Rückstellungen oder auf die Abschreibungen bei nur vorübergehender Wertminderung usw. aus: Abschlußzahl ist nicht gleich Abschlußzahl97 . Die Einheitstheorie zwingt damit zur einheitlichen (i. S. als ob der Konzern ein Einzelunternehmen wäre) nicht aber zur schematischen (i. S. einer übereinstimmenden, uniformen Ausübung von Wahlrechten) Bewertung. Ihre Wirkungsbreite wird durch die Generalnorm des § 297 Abs. 2 Satz 2 HGB beschränkt, die dem Spannungsverhältnis Konzern Rechnung trägt und vor einer Überdehnung der Fiktion rechtlicher Einheit schützt98 . b) Zeitliche und sachliche Stetigkeit In § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wird der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit normiert, der gemäß § 298 Abs. 1 HGB auch auf den Konzernabschluß Anwendung finden S01199 . Er beruht auf der Erkenntnis, daß sich eine völlig genaue Bestimmung des Jahreserfolgs nicht bestimmen läßt. Wohl aber lassen sich verläßliche Schlüsse auf seine Veränderung im Zeitablauf ziehen. Diese Veränderung sei jedoch nur erkennbar, wenn der Jahreserfolg stets anhand der gleichen Vorgehensweise ermittelt werde 100. Der Zweck des Stetigkeitsgrundsatzes besteht demnach darin, durch eine Bindungswirkung an die in den Vorjahren angewandten Bewertungsmethoden die 96 Vgl. Großfeld, Geography and Law, Michigan Law Review 1984, S. 151Off.; ders., Vergleichendes Bilanzrecht, AG 1995, S. 112ff.; ders., Bilanzziele und kulturelles Umfeld, WPg 1994, S. 795ff.; ders. Sprache und Recht, JZ 1984, S. 1 ff.; Großfeld/Yamauchi, Internationales Gesellschaftsrecht in Japan, AG 1985, S. 229ff. 97 Vgl. Müller, Eberhard, Der Konzernabschluß im Konfliktfeld verschiedener Interessen, S. 233. 98 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, § 556, S. 229. 99 Zum Charakter von § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB als Soll- oder Mußvorschrift siehe Heimrich, Umsetzung der Bilanz- und Konzernbilanzrichtlinie in das deutsche Recht, WPg 1984, S. 625, 628; Hafner, Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB, WPg 1985, S. 593, 595; Göllert/Ringling, Der Unterausschuß-Entwurf zum Bilanzrichtlinie-Gesetz, BB 1985, S. 966, 968; Eckes, Bewertungs stetigkeit - Muß- oder Sollvorschrift?, BB 1985, S. 1435ff.; Niessen, Bewertungsstetigkeit: Muß- oder Sollvorschrift? BB 1985, S. 1642; Wiedmann, BFuP 1988, S. 37, 46ff. 100 Vgl. Schmalenbach, Eugen, Dynamische Bilanz, 12. Auflage, Köln und Opladen 1956, S. 34.
56
Kap. B: Einheitlich Bewerten
Vergleichbarkeit der periodenbezogenen Informationen im Zeitablauf sicherzustellen und so die Aussagefähigkeit der Bilanz zu gewährleisten \01. Jahresabschlüsse sind lediglich nach Konventionen erstellte Zwischenrechnungen, die wegen der unsicheren Schätzungs- und Bewertungsmaßstäbe notwendig ungenau sind \02. Die Rolle jeder einzelnen Bewertungsmethode besteht im Grunde in der Reduzierung der Freiheit des Bewertenden durch die Anwendung von standardisierten Verfahren, in der Reduzierung der Vielfältigkeit der Bewertungsmerkmale und in der Ermittlung anhand eines planmäßigen Vorgehens intersubjektiv nachvollziebarer Werte \03. Es handelt sich mithin um konventionale Werte, um Werte deren Verläßlichkeit darauf beruht, daß sie auf Grund von bestimmten, den Bilanzadressaten bekannten und vertrauten Wertermittlungsverfahren herauskristallisiert wurden. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit geht darüber hinaus: Er greift dann ein, wenn es nebeneinander mehrere zulässige Bewertungsverfahren gibt oder wenn bei der Bewertung Schätzungsspielräume eingeräumt sind. Er engt so die Auswahl unter mehreren an sich möglichen Bewertungsmethoden auf eine ein, nämlich ceteris paribus auf die des Vorjahres \04. Wenn also die Anwendung von Bewertungsmethoden die Verläßlichkeit der Wertansätze dadurch erhöht, daß sie anhand einer übersichtlichen Zahl von bekannten und nachvollziehbaren Regeln ennittelt werden, dann besteht die Bedeutung des Stetigkeitsgrundsatzes darin, daß er selbst diesen übersichtlichen Rahmen von anwendbaren Bewertungsregeln noch weiter konkretisiert und in zeitlicher Hinsicht verbindlich festlegt. Der Stetigkeitsgrundsatz bezieht sich einerseits auf identische Sachverhalte. So müssen bereits in der Vorperiode vorhandene Vermögensgegenstände oder Schulden, deren Umfeldbedingungen sich im Zeitablauf nicht geändert haben, nach den gleichen Methoden bewertet werden (Grundsatz der Wertstetigkeit) \05. Andererseits werden aber vom Stetigkeitsgrundsatz auch solche Sachverhalte erfaßt, die gleichen wertbestimmenden Umfeldbedingungen ausgesetzt sind, und zwar unabhängig davon, ob sie in der Vor101 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 252 HGB, Rn 103; Kupsch, Einheitlichkeit und Stetigkeit der Bewertung gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB, WPg 1987, S. 1101; Selchert, in Küting/Weber, HdR, 4. Auflage, Rn 99; Weirich, WPg 1987, S. 77, 80. 102 Vgl. Großfeld, (Generalnorm) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, in: Leffson/Rückle/Großfeld (Hrs~.), Handwörterbuch unbestimmter Rechtsbegriffe, S. 192, 202; Clemm/Wenzel, Uberlegungen zur Konzembilanzpolitik, BFuP 1986, S. 341, 352. 103 Vgl. 1.1. und 2. dieses Kapitels und die dort zitierten Autoren. 104 Vgl. A/DIS, 6. Auflage, § 252 HGB, Rn 104f.; Leffson, WPg 1988, S. 443. 105 Vgl. Kupsch, DB 1987, S. 1157; Selchert, Grundsatz der Einheitlichkeit der Bewertung, WPg 1983, S. 447, 448.
11. Einheitliche Ausübung der anwendbaren Bewertungsmethoden
57
periode bereits zu berücksichtigen waren oder erst in der gegenwärtigen Abrechnungsperiode neu auftreten 106. Eine Wahlrechtsausübung beschränkt sich also nicht auf die ursprüngliche Bewertungsentscheidung, sondern hat weitergehende Konsequenzen für die Behandlung sowohl desselben Sachverhalts wie auch anderer gleichgelagerter Sachverhalte in folgenden Abrechnungsperioden 107. Es mag also sein, daß der Stetigkeitsgrundsatz nicht die einheitliche Bewertung zweier gleicher oder vergleichbarer Bewertungsgegenstände unmittelbar vorschreibt lO8 . Allerdings würde eine Einschränkung der Bewertungsstetigkeit nur auf die zeitliche Dimension ihre Zwecksetzung, nämlich die Gewährleistung der Aussagekraft des Abschlusses durch Steigerung der Vergleichbarkeit seiner Daten, unterlaufen. Denn es wäre möglich bei der Bewertung von in Folgeperioden erstmals zu berücksichtigenden Vermögensgegenständen und Schulden an differenzierte Bewertungsmethoden im Vorjahresabschluß anzuknüpfen 109. Art- und funktionsgleiche Bewertungsobjekte dürfen aber nicht willkürlich nach unterschiedlichen Methoden bewertet werden (sachliche Stetigkeit)llo. Somit erstreckt sich der Grundsatz der einheitlichen Bewertung auf die Bewertung von Sachverhalten innerhalb eines Geschäftsjahres, während der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit diese einheitliche Behandlung über mehrere Geschäftsjahre sicherstellt II 1. Bewertungseinheitlichkeit und Bewertungsstetigkeit verfolgen das gemeinsame Ziel, die Vergleichbarkeit der im Jahres- oder Konzernabschluß abgebildeten Sachverhalte zu gewährleisten. Sie erreichen es, indem sie die zeitlichen (die Stetigkeit) und sachlichen (die Bewertungseinheitlichkeit) Dimensionen der Wahlrechtsausübung reduzieren 112. c) Einzelbewertungsgrundsatz
Der Grundsatz der Einzelbewertung (gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB i. V. m. § 298 Abs. 1 HGB gültig auch für den Konzernabschluß) besagt, daß jeder Vermögensgegenstand und jede Schuld für sich zu bewerten ist, 106 Vgl. IDW IHFA, Entwurf einer Verlautbarung: Zum Grundsatz der Bewertungsstetigkeit, WPg 1996, S. 531, 532; Forster, Karl-Heinz, Bilanzpolitik und Bilanzrichtlinien-Gesetz, BB 1983, S. 32, 35. 107 Vgl. Dümpe1, Der Grundsatz der einheitlichen Bewertung, S. 78. 108 So etwa Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 75 f.; Schülen, S. 132ff.; Se1chert, in Küting/Weber, HdR, 4. Auflage, § 252 HGB, Rn 108. 109 Vgl. Kupsch, DB 1987, S. 1157, 1158. 110 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 252 HGB, Rn 107. 111 Vgl. Dümpel, Der Grundsatz der einheitlichen Bewertung, S. 80. 112 Vgl. Dümpel, Der Grundsatz der einheitlichen Bewertung, S. 79f.
58
Kap. B: Einheitlich Bewerten
d. h. unabhängig von den Wertverhältnissen anderer Vermögensgegenstände und Schulden 1l3 . So wird verhindert, daß Wertminderungen einzelner Vermögensgegenstände mit Wertsteigerungen bei anderen Vermögensgegenständen kompensiert werden 114. Deshalb darf die Ermittlung des Wertes, der den einzelnen Vermögensgegenständen und Schulden beizulegen ist, grundsätzlich nur anhand der individuellen Merkmale des einzelnen Bewertungsgegenstands erfolgen 115. Mit Blick hierauf wird argumentiert, daß der Grundsatz der Einzelbewertung der Einheitlichkeit der Bewertung entgegenstünde und daß deshalb der Grundsatz der Bewertungseinheitlichkeit eher als eine unverbindliche Empfehlung verstanden werde sollte 11 6. Wie schon am Anfang dieses Kapitels erläutert wurde, kann der möglichst genaue Wert eines Bewertungspostens nur ermittelt werden, wenn die Gesamtheit seiner individuellen Merkmale im Rahmen einer methodenfreien Bewertung angemessen berücksichtigt und gewogen wird. Ob eine solche Bewertung richtig ist, läßt sich nur schwer nachvollziehen und überprüfen. Deshalb wird die handelsrechtliche Bewertung nicht methodenfrei, sondern anhand von Bewertungsmethoden vorgenommen, die die Zahl der wertbeeinflussenden Merkmale reduzieren, ihre Gewichtung einem methodischen Plan anpassen und die Nachvollziehbarkeit ihrer Wertansätze gewährleisten. Dem steht der Einzelbewertungsgrundsatz auch nicht entgegen. Auch die einzeln ermittelten Wertansätze von Vermögensgegenständen sind höchstens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt worden (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB), vermindert um planmäßige Abschreibungen, wenn sie dem Anlagevermögen gehören und ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB), selbst wenn ihre Verkehrswerte inzwischen das vielfache der angesetzten Buchwerte entsprechen (so etwa bei den sogenannten stillen "Zwangsrücklagen", die vor allem bei Immobilien entstehen). Es handelt sich um methodisch ermittelte Werte, die auch dem Einzelbewertungsgrundsatz entsprechen. Darüber hinaus kennt das Gesetz mehrere Fälle, bei denen die Festlegung einiger Bewertungskomponenten in Ermangelung einer individuellen Zuordenbarkeit der Werte mit Hilfe von generellen Kriterien, also losgelöst vom individuellen Bewertungensobjekt erfolgt. Dies ist der Fall etwa bei der Kuppelproduktion oder den sog. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen. Die Beziehungen zwischen den Bewertungsobjekten, die in derartigen 113 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 252 HGB, Rn 48; Selchert, in Küting/Weber, HdR, 4. Auflage, § 252 HGB, Rn 45. 114 Vgl. A/D/S, ebenda, Rn 48; Selchert, ebenda, Rn 48. 115 A/D/S, ebenda, Rn 48. 116 Vgl. Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung, S. 123, 133f.
H. Einheitliche Ausübung der anwendbaren Bewertungsmethoden
59
Verteilungsmechanismen zum Ausdruck kommen, stehen dem Grundsatz der Einzelbewertung nicht entgegen 117. In anderen Fällen kommt der Einzelbewertungsgrundsatz gar nicht zur Anwendung, wenn spezielle gesetzliche Vorschriften eine abweichende Wertermittlung vorsehen: Als solche kommen die Sammelbewertungsverfahren der Gruppenbewertung (§ 256 Satz 1 i. V. m. § 240 Abs. 4 HGB), der Festbewertung (§ 256 Satz 2 i. V. m. § 240 Abs. 3 HGB) und der Verbrauchsfolgefiktionen (§ 256 Satz 1 HGB) in Betracht ll8 . Hierbei und vor allem in den ersten zwei Fällen wird der Einzelbewertungsgrundsatz nicht nur aus Vereinfachung sgriinden , sondern auch mit Blick auf die Erhöhung der Aussagefähigkeit des Jahresabschlusses durchbrochen l19 . Der Einzelbewertungsgrundsatz stellt also ein Glied des Normengefüges dar und führt nur durch seine Anbindung an das übrige Koordinatensystem der Bewertung zu vertretbaren und nachvollziehbaren Wertansätzen. Der Einzelbewertungsgrundsatz ermöglicht eine heterogene Inanspruchnahme gesetzlicher Bewertungswahlrechte, gebietet sie allerdings nicht. Ob entsprechende Bewertungsabweichungen auch sachlich begründet und damit zulässig sind, läßt sich aus dem Grundsatz der Einzelbewertung nicht ableiten 120. Vielmehr ist die einheitliche Ausübung solcher Wahlrechte geboten, wenn das ihnen zugrundeliegende Substrat von Bewertungsobjekten artund funktionsgleich ist l21 . Eine heterogene Ausschöpfung von Bewertungswahlrechten trotz art- und funktionsgleicher Bewertungsobjekten verstößt vielmehr gegen das Willkürverbot 122 . Die Einheitlichkeit der Bewertung verstößt also nicht gegen den Einzelbewertungsgrundsatz. Vielmehr bedeutet einheitliche Bewertung, daß mehrere gleiche Sachverhalte zwar einzeln, aber nach identischen Verfahren der Wertermittlung bewertet werden müssen l23 .
117 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 252 HOB, Rn 50; Selchert, in Küting/Weber, HdR, 4. Auflage, Rn 46. 118 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 252 HOB, Rn 58; Budde/OeißIer, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 252 HOB, Rn 26. 119 Vgl. Selchert, WPg 1983, S. 447, 448; Stobbe, Die konzerneinheitliche Bewertung, BB 1986, S. 1833, 1835 f. 120 Vgl. Selchert, WPg 1983, S. 447, 448; ders., in Küting I Weber, HdR, 4. Auflage, § 252, Rn 47; Wiedmann, Die Stetigkeit nach neuem Recht und ihr Einfluß auf Bilanzanalyse und Bilanzpolitik, BFuP 1988, S. 37, 46. 121 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 308 HOB, Rn 14ff. 122 Vgl. Selchert, in Küting/Weber, HdR, 4. Auflage, § 252, Rn 47; Stobbe, BB 198~S. 1833, 183~ 123 A/D/S, 6. Auflage, § 308 HOB, Rn 13.
60
Kap. B: Einheitlich Bewerten
d) Willkürverbot Um den Begriff der Einheitlichkeit der Bewertung im Konzernabschluß präzisieren zu können, ist ferner auch das sogenannte Willkürverbot zu beachten. Dieser im HGB nicht ausdrücklich aufgeführte Grundsatz, der auch als das Gebot der willkürfreien Bewertung bezeichnet wird, ergibt sich sowohl aus den GoB (§ 243 Abs. I HGB) wie auch aus den allgemeinen Bewertungsregeln des § 252 Abs. I Nr. 4 und 6 124 . Die Forderung nach Willkürfreiheit ist insbesondere in der Subjektivität des Bewertungsvorgangs begründet; die naturgegebene Subjektivität des Urteils verstößt weder gegen die Richtigkeit noch gegen die Willkürfreiheit, soweit sich der Bewertende bemüht, ein zutreffendes Erwartungsbild zu gewinnen 125. Deshalb hat der Bewertende, soweit individuelle Bewertungsspielräume vorhanden sind, nur solche Werte zu wählen, "die aus realitätsnahen und von ihm für zutreffend gehaltenen Hypothesen abgeleitet sind, so daß er persönlich die Bezeichnung der Posten und die Wertansätze für eine korrekte Aussage über die zugrundeliegenden Tatsachen hält,,126. Im wesentlichen wird also dem Grundsatz der Willkürfreiheit dann entsprochen, wenn die Bewertung frei von sachfremden Erwägungen, z. B. die Berücksichtigung von Auswirkungen auf die Ertrags- oder Kreditlage oder auf den ausschüttungsfähigen Gewinn, erfolgt und der Erstellung eines klaren, übersichtlichen und den GoB entsprechenden Abschlusses dient!27. Dies bedeutet, wenn mehrere Bewertungsalternativen bestehen, zwar nicht, daß nur eine Alternative dem Willkürverbot entsprechen kann. Andererseits kann aber das Vorhandensein gesetzlicher Wahlrechte nicht so verstanden werden, daß zwischen ihnen beliebig gewählt werden kann 128. Das wird in den Fällen deutlich, in denen Gesetz und GoB den Bilanzierenden Bewertungsspielräume einräumen 129. Auch der Bericht des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages zur HGB-Novelle 1985 verweist ausdrücklich auf das "Gebot der Willkürfreiheit" 130. Die Abbildung der wirtschaftlichen Realität einer Unternehmung im Jahresabschluß stößt sicherlich auf Grenzen. Umso mehr gilt das für den Welt124 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 252 HGB, Rn 126; Buddel Geißler, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 252 HGB, Rn 68. 125 Vgl. Leffson, Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, 7. Auflage, S. 202f. 126 Leffson, ebenda, S. 203. 127 Vgl. BuddelGeißler, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 252 HGB, Rn 68. 128 Vgl. Leffson, Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, S. 203. 129 Vgl. Leffson, Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, S. 204f. 130 Vgl. Bericht der Abgeordneten Heimrich, Kleinert (Hannover) und Stiegler, BT-Drucks. 10/4268, S. 100 Sp. 1 und Sp. 2.
11. Einheitliche Ausübung der anwendbaren Bewertungsmethoden
61
abschluß einer multinational operierenden Unternehmensgruppe. Hierbei verbirgt sich hinter der abstrakten Zahlensprache eine besonders vielschichtige Realität, die sich von verschiedenen klimatischen Bedingungen, verschiedenen Rechtssystemen, verschiedenen Währungen, unterschiedlichen Finanzsystemen und last not least unterschiedlichen Kulturen mit allen dazu gehörenden Elementen (Zeitvorstellungen, Prioritäten, Sprache, Schrift, Zahlenvorlieben usw.) bestimmen läßt 131 . Für die sachgerechte Abbildung eines so heterogenen Substrats reicht die bloße Anwendung der Bewertungsregeln des Mutterunternehmens nicht aus. Denn diese letzteren vermögen nicht eine Realität vollständig zu erfassen, für die sie gar nicht geschaffen worden sind. Bewertungsvorstellungen, Zeitvorstellungen, wirtschaftliche Vorstellungen überhaupt sind in den jeweiligen Rechts- und Wirtschaftskulturen anders geprägt 132. Deshalb reicht in einem Konzern-, in einem Weitabschluß noch mehr als im Jahresabschluß eines Unternehmens die bloße Anwendung der Bewertungsregeln des Mutterunternehmens nicht aus. Der Bilanzierende hat sich vielmehr zu bemühen, "ein nach seiner inneren Überzeugung relativ zum Sinn der Gesetze und der GoB richtiges und damit willkürfreies Bild der Wirklichkeit zu geben" 133. Ein willkürfreies Bild der wirtschaftlichen Realität des Konzerns läßt sich nur dann herstellen, wenn die jeweiligen bewertungsrelevanten Umfeldbedingungen berücksichtigt werden. Daraus ergibt sich, daß gleiche Bewertungsobjekte nach gleichen Bewertungsmethoden zu bewerten sind, wenn sie auch gleichen Umfeldbedingungen ausgesetzt sind 134. Dagegen scheidet die Möglichkeit der einheitlichen Bewertung von Bewertungsobjekten aus, wenn entweder ungleiche Gegenstände ungleichen Bedingungen ausgesetzt sind oder ungleiche Gegenstände gleichen Bedingungen oder gleiche Gegenstände ungleichen Bedingungen, da eine solche Bewertung als willkürlich anzusehen ist 135 . Auf unser Bild der durch die auf den Jahresabschluß des Mutterunternehmens anwendbaren Regeln begrenzten Zahl der Wahlrechte bedeutet das: Wenn der Bilanzierende bei einem Gegenstand eine Wahlmöglichkeit hatte 131 Vgl. Großfeld, Macht und Ohnmacht der Rechtsvergleichung, Tübingen 1984, S. 80ff., 134ff., 149ff.; ders., Zeichen und Zahlen im Recht, 2. Auflage, Tübingen 1995; ders., Bilanzziele und kulturelles Umfeld, WPg 1994, S. 795ff.; ders., Vergleichendes Bilanzrecht, AG 1995, S. 112ff., insbesondere 113ff. 132 Vgl. Großfeld, Kernfragen der Rechtsvergleichung, Tübingen 1996, S. 261 ff. 133 Vgl. Leffson, Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, S. 204. 134 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 14f.; Reintges, WPg 1987, S. 282, 284; Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung, S. 123, 134; Weirich, WPg 1987, S. 77, 80. 135 Vgl. Reintges, WPg 1987, S. 282, 285; Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung, S. 123, 134.
62
Kap. B: Einheitlich Bewerten
und sich zulässigerweise für eine Bewertungsmethode entschieden hat, hat er diese Methode für alle sachlich gleich gelagerten Fälle erneut anzuwenden. Würde er sich dagegen in diesen Fällen jeweils für eine andere Methode entscheiden, so verstieße das gegen das Willkürverbot l36 . Bei Vorliegen mehrerer Sachverhalte, die im Hinblick auf ihre Bewertung als gleich anzusehen sind, ist die Anwendung unterschiedlicher Bewertungsmethoden willkürlich und damit unzulässig 137. e) Wirtschaftlichkeit der Konzernrechnungslegung
Die Rechnungslegung ist ein kostspieliger Informationsbeschaffungs- und -verarbeitungsvorgang 138 . Aufgrund rechtsform-, größen-, geschäftszweigoder landesspezifischer Rechnungslegungsvorschriften ist es bei der Erstellung eines Weitabschlusses außerordentlich schwierig, das Konsolidierungserfordernis einer nicht nur formellen, sondern auch vor allem materiellen Einheitlichkeit der einzubeziehenden Einzelabschlüsse zu erzielen 139. Die Tatsache, daß der Konzernabschluß nur auf die Informationsfunktion gerichtet ist, führt zu einer weiteren Verschärfung des Spannungsverhältnises zwischen der geforderten Genauigkeit der im Konzernabschluß bereitgestellten Informationen und den Kosten seiner Erstellung 140. Zwischen diesen Kosten und dem Nutzen der durch sie vermittelten Informationen muß ein angemessenes Verhältnis bestehen 141. Der Gesetzgeber berücksichtigt den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Rechnungslegung meistens in Verbindung mit dem mit ihm verwandten Grundsatz der Wesentlichkeit. So fordert er in einer Reihe von Fällen Tatbestände außer Acht zu lassen, wenn sie von untergeordneter Bedeutung oder mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden sind. Dies ist der Fall etwa in § 303 Abs. 2, § 304 Abs. 2, § 304 Abs. 3, § 305 Abs. 2, § 311 Abs. 2 und nicht zuletzt § 308 Abs. 2 HGB I42 . Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Konzernrechnungslegung ergibt sich nur mittelbar, aus den im HGB genannten Fällen, wonach eine vollständige InformationsVgl. Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 76. Vgl. IDW /HFA, Stellungnahme 3/1988, WPg 1988, S. 483. 138 Vgl. Bauer, BB 1981, S. 766, 768; Trützschler, in Küting/Weber, HdKR, S. 445, Rn 967. 139 Vgl. Dümpel, Der Grundsatz der einheitlichen Bewertung, S. 315. 140 Vgl. Budde/Lust, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 297 HGB, Rn 18. 141 Vgl. Arbeitskreis "Externe Unternehmensrechnung", ZfbF 1987, Sonderheft 2111987, 2. Auflage, S. 35; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 42. 142 Vgl. Budde/Lust, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 297 HGB, Rn 18; Arbeitskreis "Externe Unternehmensrechnung", ZfbF Sonderheft 21/1987, 2. Auflage, S. 35 f. 136 137
11. Einheitliche Ausübung der anwendbaren Bewertungsmethoden
63
pflicht nur insoweit besteht, als die durch weitere Angaben zu gewinnenden, genaueren Aussagen in einem angemessenen Verhältnis zu den entstehenden Mehrarbeiten und Aufwendungen stehen müssen l43 . Zweck des Konzernabschlusses ist, durch zuverläßigen Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns wirtschaftlich relevante Informationen zu vermitteln. Demnach sind Konzernabschlußdaten von untergeordneter Bedeutung, wenn sie die Beurteilungen und Entscheidungen der Adressaten in der Regel nicht beeinflussen können 144. Solche nachrangige Informationszuwächse können sich auch aus der Vereinheitlichung leicht voneinander abweichender Bewertungsmethoden ergeben, so daß man in diesem Fall eventuell auf eine solche Vereinheitlichung hätte verzichten können. Die Vereinheitlichung der Bewertungsmethoden im Konzernabschluß kann je nach der Expansion der Unternehmung im Ausland und der Vielfalt der geschäftlichen Tätigkeiten eine enorme Leistung an Arbeit und Kosten erfordern 145. Allerdings wird der Wesentlichkeitsgrundsatz ausdrücklich in § 308 Abs. 2 Satz 3 HGB erwähnt; dort wird auch sein Anwendungsbereich festgelegt. Der wirtschaftlichkeitsbedingte Verlust an Informationen ist also nur tragbar, wenn es sich um unwesentliche Informationen handelt, die verlorengehen 146. Darüber hinausgehende Wirtschaftlichkeitsüberlegungen dürfen aber in der Regel nicht zu einer Einschränkung des Einheitlichkeitsgrundsatzes führen. Denn die einheitliche Bewertung führt trotz des unbestrittenen Mehraufwandes zu einer besseren und zuverlässigeren Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 147, da sie die Wertermittlungsmethoden auf ein übersichtliches und zwar einheitliches Maß reduziert und somit die Nachvollziehbarkeit der Wertansätze des Konzernabschlusses gewährleistet. Abgesehen davon ist die Wirtschaftlichkeit der Rechnungslegung nicht nur für die Konzernabschlußersteller, sondern auch für die Konzernbilanzadressaten von Bedeutung. Das, was sich die Ersteller durch Verzicht auf die Vereinheitlichung der Bewertungsmethoden ersparen, müssen die Analytiker aufwenden, um die durch eine differenzierte Bewertung verschlüsselten Informationen dem Konzernabschluß abzugewinnen. Allerdings ist zweifelhaft, ob trotz erhöhter Analyseaufwendungen das durch die differenzierte Vgl. BuddelLust, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 297, Rn 19. Vgl. Arbeitskreis "Externe Unternehmensrechnung", ZfbF Sonderheft 21/ 1987, 2. Auflage, S. 36. 145 Vgl. Müller, Eberhard, Der Konzernabschluß im Konfliktfeld verschiedener Interessen, S. 213, 220ff. 146 Vgl. Trützschler, in Küting/Weber, HdKR, S. 445, Rn 967. 147 Vgl. Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung, S. 123, 140. 143
144
Kap. B: Einheitlich Bewerten
64
Bewertung eingetretene Minus an Aussagekraft des Konzernabschlusses ausgeglichen werden kann. Deshalb stellt die Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsfaktoren bei der Vereinheitlichung der Bewertungsmethoden in der Konzernbilanz die Ausnahme dar und darf nur restriktiv in Anspruch genommen werden l48 . f) Wortsinnargument
Zur Präzisierung des Wesens und des Umfangs des Einheitlichkeitsbegriffs trägt ohne Zweifel maßgebend der Gesetzeswortlaut bei. Dies dürfte um so zutreffender sein, desto mehr § 308 HGB in den Vorarbeiten zum Bilanzrichtlinien-Gesetz mehrfach geändert worden ist. Zur Kernaussage der Bewertungseinheitlichkeit, nämlich zum Einheitlichkeitsgrundsatz von § 308 Abs. 1 Satz 1 HGB, sieht § 2730 Abs. 1 des Vorschlags zu einem Regierungsentwurf vom Mai 1984 149 vor, daß "auf den Konzernabschluß die auf den lahresabschluß des Mutterunternehmens angewendeten Bewertungsmethoden anzuwenden sind ... ". Genauso sieht § 289 Abs. 1 Satz 1 des Vorschlags zu einem Regierungsentwurf vom November 1984 150 vor, daß "auf den Konzernabschluß die für den lahresabschluß des Mutterunternehmens ... zulässigen Bewertungsmethoden anzuwenden sind", während der geltende § 308 Abs. 1 Satz 1 HGB deutlicher vorschreibt, daß "die in den Konzernabschluß '" übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden ... nach den auf den lahresabschluß des Mutterunternehmens anwendbaren Bewertungsmethoden einheitlich zu bewerten sind". Demnach erscheint die Ansicht, wonach die Einheitlichkeit der Bewertung nur als eine unverbindliche Empfehlung gesehen werden kann 151, wenig überzeugend. Am stärksten fällt aber ins Gewicht, daß im Regierungsentwurf zum Bilanzrichtlinien-Gesetz vom April 1985 152 der Einheitlichkeitsgrundsatz gerade als eine solche unverbindliche Empfehlung ausformuliert war oder mindestens Anlaß für eine solche Interpretation bestanden hat ("Auf den Konzernabschluß dürfen die für den lahresabschluß des Mutterunternehmens ... zulässige Bewertungsregeln angewendet werden") und der Gesetzgeber sich davon im verabschiedeten Gesetzestext - den Hinweisen des Schrifttums folgend - distanziert hat l53 . Vgl. Budde/Lust, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 297 HGB, Rn 19. Vgl. BMJ 3507 - 30310/84 (unveröffentlichter Entwurf). 150 Vgl. BMJ 3507/10 - 30946/84 (unveröffentlichter Entwurf). 151 So Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung, S. 123, 134; im Ergebnis so auch Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 90ff. 152 § 289 Abs. 1 S. 1 des Regierungsentwurfs (abgedruckt bei Biener/Bemeke, S. 361). 153 Vgl. dazu auch Ordelheide, WPg 1985, S. 509f.; ders., WPg 1985, S. 575f. 148 149
11. Einheitliche Ausübung der anwendbaren Bewertungsmethoden
65
Die Einheitlichkeit der Bewertung läßt sich also nicht auf die bloße Anwendung der Bewertungsregeln des Mutterunternehmens reduzieren 154. Denn dazu wäre der übrige Teil des Textes auch ohne das Wort "einheitlich" ausreichend 155. Die Gleichsetzung der Einheitlichkeit der Bewertung im Konzernabschluß mit der Anwendung des Rechts des Mutterunternehmens auf alle in den Konzernabschluß aufgenommenen Vermögensgegenstände und Schulden wäre eine bloße Tautologie l56 . Darüber hinaus wäre eine solche Auslegung aber auch deshalb abzulehnen, weil es Fälle gibt, in denen an der Spitze des Konzerns nicht ein operatives Unternehmen mit mehreren Tochterunternehmen (Stammhauskonzept) steht, sondern eine Holdinggesellschaft (Holdingkonzept), die selber nicht über ein geeignetes Sachanlagevermögen verfügt l57 . Das Mutterunternehmen kann nicht mehr die richtige Bezugseinheit für die Bewertung im Konzernabschluß sein, obwohl die für seine Rechtsform geltenden Bewertungsvorschriften angewendet werden müssen l58 . Vielmehr spricht vieles dafür, daß die Einheitlichkeit der Bewertung als eine Vorstufe der übereinstimmenden, uniformen Ausübung der Bewertungswahlrechte aufgefaßt werden sollte l59 . Letztere ist nur dann erlaubt aber auch geboten, wenn die zugrundeliegenden Sachverhalte, das zugrundeliegende Substrat auch übereinstimmend ist; eine gleichgerichtete Ausübung von Wahlrechten auf der Basis von ungleichen Sachverhalten entspricht aber in der Regel nicht dem Grundsatz der Bilanzwahrheit und liefert nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns (§ 297 Abs. 2 Satz 2)160. Anlaß für eine solche Auffassung über die Einheitlichkeit bietet sicherlich § 308 Abs. 2 Satz 1, der von einer übereinstimmenden Ausübung der Bewertungswahlrechte auszugehen scheint (... in Ausübung von Bewertungswahlrechten auf den Konzernabschluß angewendet werden ... ); dies dürfte aber nur in Zusammenhang mit der Gleichheit der Sachverhalte ge seSo z. B. Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 90ff. Vgl. Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 77. 156 Vgl. Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 77. 157 Vgl. Bruns, Die konzerneinheitliche Bilanzierung und Bewertung, in: Baetge (Hrsg.), Konzernrechnungslegung und -prüfung, Düsseldorf 1990, S. 139, 154. 158 Vgl. Bruns, ebenda, S. 154. 159 Vgl. Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 77; eine übereinstimmende ("gleichgerichtete", wie er sie nennt) Ausübung der Bewertungs- und Bilanzierungsparameter befürwortet Klein (Konzernbilanzpolitik, S. 239); allerdings stellt er an anderer Stelle fest (a. a. 0., S. 235 f.), daß die Einheitlichkeit der Bewertung keine Einschränkung für die Ausübung der Bewertungsparameter bedeuten soll. 160 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 308 HOB, Rn 12; Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung, S. 123, 134; Reintges, WPg 1987, S. 282, 285. 154 155
5 Xenides
66
Kap. B: Einheitlich Bewerten
hen werden 161. Andererseits wird damit aber auch klargestellt, daß sich die Ausübung der Bewertungswahlrechte im Konzernabschluß nicht nur durch die Anwendung des für das Mutterunternehmens vorgeschriebenen Bewertungsrahmens, sondern darüber hinaus auch durch sachliche, auf die Eigenart der zu bewertenden Vermögensgegenstände und Schulden gerichtete Faktoren beschränken läßt. 2. Bestimmung der BewertungseinheitIichkeit durch die Generalnorm
a) Generalnorm als" Overriding Principle" der Rechnungslegung In § 297 Abs. 2 Satz 2 HGB schreibt der Gesetzgeber für den Konzernabschluß (bzw. in § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB für den lahresabschluß der Kapitalgesellschaften) die Generalnorm vor, bekannt auch als Grundsatz des "true and fair view". Danach hat der Konzernabschluß "unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns zu verrniueln,,162. Der Grundsatz des "true and fair view" stammt aus dem englischen Recht (im US-amerikanischen Recht wird der ähnliche Grundsatz der "fair presentation" verwendet 163) 164; mit teilweise abweichender Formulierung wie ,,full and fair", ,,full and true" oder "true and correct view" läßt er sich bis zum Joint Stock Companies Act von 1844 zurückverfolgen 165. In seiner aktuellen Prägung ist er allerdings erstmals in section 149 subsection 1 des Companies Act 1948 gesetzlich verankert worden l66 . So heißt es dort: ,,Jede Bilanz muß einen true and fair view vom Stand der Angelegenheiten der Gesellschaft am Ende ihres Geschäftsjahres geben, und jede Gewinn- und Verlustrechnung einer Gesellschaft muß einen true and fair view von Gewinn und Verlust der Gesellschaft in dem Finanzjahr geben"167. 161 Siehe auch Kapitel C, III. 1.; für eine einschränkende Auslegung von § 308 Abs. 2 Satz 1 Ordelheide (WPg 1985, S. 575, 576). 162 Vgl. Großfeld, Generalnorm, S. 192; A/D/S, 6. Auflage, § 297, HGB, Rn 15. 163 Dazu Baetge/Roß, Was bedeutet "fair presentation", in:' Ballwieser (Hrsg.), US-amerikanische Rechnungslegung, S. 27 ff. 164 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 164, Rn 397; ders., Macht und Ohnmacht der Rechtsvergleichung, S. 66f.; ders., Bilanzrecht für Juristen, NJW 1986, S. 955, 959; ders., Europäisches Unternehmensrecht und internationaler Wettbewerb, FS Havermann, S. 183, 194. 165 Vgl. Hoffmann, Klaus-Jürgen, "True and fair view" aus englischer Sicht, Frankfurt a.M. 1989, S. 27ff.; Niehus, "True and fair View" - in Zukunft auch ein Bestandteil der deutschen Rechnungslegung?, DB 1979, S. 221, 222. 166 Vgl. Großfeld, Generalnorm, S. 192, 197; Streim, Die Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB, FS Moxter, S. 391, 393. 167 Übersetzung nach Großfeld, Generalnorm, S. 192, 197.
11. Einheitliche Ausübung der anwendbaren Bewertungsmethoden
67
Darüber hinaus wird in Subsection 3 des gleichen Absatzes festgelegt, daß von den gesetzlichen Vorschriften abgewichen werden muß, wenn diese den "true and fair view" nicht herzustellen vermögen und auch eine entsprechende Berichterstattung den Mangel nicht beseitigen kann l68 . Bei jedem Konflikt zwischen dem "true and fair view" und den Einzelbestimmungen geht die Generalnorm vor, sie hat den Rang eines "Overriding Principle" 169. Bei den Beratungen zur 4. EG-Richtlinie hat sich das britische Konzept des "true and fair view" - trotz anfänglicher Anlehnung an das deutsche Legalitätsprinzip des § 149 AktG 1965 170 - durchsetzen können (Art. 2 Abs. 3 - 5 der 4. Richtlinie) 171. Zu beachten ist, daß obwohl der "true and fair view" schon im Entwurf von 1974 enthalten war, die Pflicht zur Abweichung von den Einzelbestimmungen (Absatz 5) erst in der endgültigen Fassung von 1978 aufgenommen wurde. Es handelte sich hierbei also um eine bewußte Erweiterung des Anwendungsbereichs der Generalnorm, um ihre Anerkennung als "Overriding Principle,,172. Später wurde die Vorschrift auch in Art. 16 Abs. 3 - 5 der 7. Richtlinie übernommen. So heißt es dort 173 : ,,(3) Der konsolidierte Abschluß hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesamtheit der in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen zu vermitteln. (4) Reicht die Anwendung dieser Richtlinie nicht aus, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild im Sinne des Absatzes 3 zu vermitteln, so sind zusätzliche Angaben zu machen. (5) Ist in Ausnahmefällen die Anwendung einer Vorschrift der Artikel ... mit der in Absatz 3 vorgesehenen Verpflichtung unvereinbar, so muß von der betreffenden Vorschrift abgewichen werden, damit ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild im Sinne des Absatzes 3 vermittelt wird. Vgl. AID/S, 5. Auflage, § 264 HGB, Rn 38; Streim, FS Moxter, S. 391,394. Vgl. Chastney, True and Fair View, History, Meanings and the Aspects of the 4th directive, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London 1975, S. 18; Tubbesing, "A True and Fair View" im englischen Verständnis, AG 1979, S. 91, 92. 170 Vgl. Vorentwurf einer 4. Richtlinie der EG-Kommission vom 9.3.1968 (auf der Grundlage des Vorschlags der Studiengruppe Elmendorff) - ABI. EG, Nr. L 65, vom 14.3.1968, S. 8ff.; Großfeld, Generalnorm, S. 192, 195; van Hulle, "True and Fair View", im Sinne der 4. Richtlinie, FS Budde, S. 313 f.; Moxter, Zur Prüfung des "true and fair view", FS Ludewig, S. 671, 674. 171 Vgl. Biener, Auswirkungen der 4. Richtlinie, BFuP 1979, S. 1, 3; Großfeldl Junker, Die Prüfung des Jahresabschlusses im Lichte der 4. EG-Richtlinie, ZGR Sonderheft 2, S. 251, 266; Tubbesing, AG 1979, S. 91; van Hulle, FS Budde, S. 313, 314f. 172 Vgl. Alexander, A European true and fair view, in: European Accounting Review 1993, S. 59, 61. 173 ABI. EG 1983, Nr. L 193, S. 1 ff. 168
169
5*
68
Kap. B: Einheitlich Bewerten Eine solche Abweichung ist im Anhang zu erwähnen und hinreichend zu begründen; ihr Einfluß auf die Vennögens-, Finanz- und Ertragslage ist darzulegen. Die Mitgliedstaaten können die Ausnahmefälle bezeichnen und die entsprechende Ausnahmeregelung festlegen".
Die überragende Bedeutung der Generalnorrn wird schon damit bestätigt, daß sie in der Präambel sowohl der vierten wie auch der siebten Richtlinie in vollem Wortlaut genannt wird 174. Entsprechend heißt es ferner in der Begründung des Vorschlags der 4. Richtlinie 175: "Dieses Hauptziel (der "true and fair view", Anm. des Verf.) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie bei der Wahl zwischen den von den Gliederungs- und Bewertungsvorschriften gelassenen Alternativen stets im Auge zu behalten."
Allerdings ist die Generalnorrn vom deutschen Gesetzgeber nicht wortgetreu ins deutsche Recht umgesetzt worden. So fällt auf, daß der die Abweichung von den Spezialvorschriften begründende Absatz 5 des Artikels 16 der 7. Richtlinie (bzw. der Absatz 5 des Art. 2 der 4. Richtlinie) nicht in deutsches Recht transformiert wurde. Ferner ist Absatz 3 in § 297 Abs. 2 Satz 2 HGB (bzw. § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB) mit dem Zusatz "unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung" versehen, der im Text der Richtlinie fehlt 176. Mit Blick hierauf wird die Ansicht vertreten, daß die Generalnorrn der 7. bzw. 4. Richtlinie im Sinne eines "Overriding Principle" der Rechnungslegung im deutschen Recht gar nicht transformiert sei, daß die Einzelnorrnen im deutschen Recht über der Generalklausei stünden und daß die Generalnorrn lediglich zu verbalen Angaben im Anhang veranlassen könne (sog. "Abkopplungsthese")177. Nun ist diese Ansicht aus mehreren Gründen abzulehnen. Ein nationales Wahlrecht bestand bei der Umsetzung der Richtlinie nur insoweit, als der nationale Gesetzgeber die Ausnahmefälle bezeichnen und die entsprechenden Ausnahmeregelungen festlegen konnte (Art. 16 Abs. 5 Satz 3 der 7. Richtlinie bzw. Art. 2 Abs. 5 Satz 3 der 4. Richtlinie) 178. Ansonsten ist 174 Vgl. Präambel der 4. Richtlinie, ABI. EG 1978, Nr. L 222, S. IIff., Gedankenstrich 4; Präambel der 7. Richtlinie, ABI. EG 1983, Nr. L 193, S. Iff., Gedankenstrich 7. 175 ABI. EG 1972, Nr. C 7 vom 2.1.1972, S. 11. 176 Vgl. Großfe1d, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 166f., Rn 400; Beisse, Die Generalnonn des neuen Bilanzrechts, in: Mellwig/Moxter/Ordelheide (Hrsg.), Handelsbilanz und Steuerbilanz, S. 15, 23 ff. 177 Vgl. Beisse, Die neue Generalnonn des Bilanzrechts, S. 15, 23ff.; Moxter, Der Einfluß der EG-Bilanzrichtlinie auf das Bilanzsteuerrecht, BB 1978, S. 163Of.; ders., Zum Verhältnis von handelsrechtlichen Grundsätzen ... , FS Budde, S. 419, 426ff.; Schildbach, BFuP 1987, S. 1, 13; Streim, FS Moxter, S. 391, 396ff.; ders., BoHR, § 264 HGB, Rn 13 ff. 178 Vgl. AlD/S, 5. Auflage, § 264 HGB, Rn 50.
11. Einheitliche Ausübung der anwendbaren Bewertungsmethoden
69
er gemäß Art. 189 Abs. 3 EGV an die Ziele der Richtlinie gebunden 179. Der nationale Gesetzgeber kann nicht die Ziele der Richtlinie konterkarieren: Bei fehlerhafter Umsetzung führt die Richtlinie kraft ihres Vorrangs vor dem innerstaatlichen Recht zu dessen Unwirksamkeit, wenn nicht eine richtlinienkonforme korrigierende Auslegung möglich ist l80 . Das nationale Recht ist also so auszulegen, daß Friktionen mit der zu nationalem Recht gewordenen Vorgabe der Richtlinie vermieden werden \81. Nationales Recht und insbesondere ein zur Durchführung der Richtlinie erlassenes Gesetz ist stets im Lichte des Wortlauts und des Zwecks der Richtlinie auszulegen 182. Deshalb ist auch § 297 Abs. 2 bzw. § 264 Abs. 2 HGB Richtlinien-konform, Europarechts-konform auszulegen; denn der deutsche Gesetzgeber wollte seiner Verpflichtung aus der Richtlinie getreulich nachkommen 183. Diese Feststellung wird auch durch die Gesetzesmaterialien bestätigt. Der Regierungsentwurf sagt wörtlich dazu l84 : "Auf die ausdrückliche Übernahme von Art. 2 Abs. 5 der Vierten Richtlinie, der den Grundsatz enthält, daß gesetzliche Vorschriften zu durchbrechen sind, wenn sie in Ausnahmefallen mit der Verpflichtung unvereinbar sind, das geforderte Bild zu vermitteln, wurde verzichtet, weil nach allgemeinen Grundsätzen des deutschen Rechts die Anwendung gesetzlicher Vorschriften jeweils so zu erfolgen hat, daß der den gesetzlichen Vorschriften vom Gesetzgeber beigelegte Sinn und Zweck erfüllt wird".
Es ist also generalnorrnkonform auszulegen 185. Um so unverständlicher erscheint die vehemente Polemik gegen die in Abs. 5 des Art. 16 der 7. Richtlinie (bzw. des Art. 2 der 4. Richtlinie) vor179 Vgl. Beisse, Die neue Generalnorm des Bilanzrechts, S. 15, 24; vgl. auch Bleckmann, Europarecht, 5. Auflage, S. 94, Rn 169. 180 Vgl. Nicolaysen, Europarecht I, S. 166. 181 V gl. Ehricke, Die richtlinienkonforme und die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung nationalen Rechts, RabelsZ 1995, S. 599, 613f. 182 Vgl. EuGH 10.4.1984, - Rs. 14/83 (v. Colson und Kamann), Slg. 1984, S. 1891, 1909; EuGH 10.4.1984 - Rs. 79/83 (Harz), Slg. 1984, S. 1921, 1942; Everling, Zur Auslegung des durch EG-Richtlinien angeglichenen nationalen Rechts, ZGR 1992, S. 376, 378; Langenfeld, Zur Direktwirkung von EG-Richtlinien, DÖV 1992, S. 955, 964; Lutter, Zur Auslegung angeglichenen Rechts, JZ 1992, S. 593, 604f.; Zuleeg, Die Rechtswirkung europäischer Richtlinien, ZGR 1980, S. 466, 477 f.; abweichend Di Fabio, Richtlinienkonformität als ranghöchstes Auslegungsprinzip ?, NJW 1990, S. 947 ff. ; Brechmann, Die richtlinienkonforme Auslegung, Diss. München 1993, S. 247ff. 183 Vgl. Großfeld, Generalnorm, S. 192, 194; vgl. auch Grundmann, Richtlinienkonforme Auslegung im Bereich des Privatrechts, ZEuP 1996, S. 399, 420ff. 184 BR-Drucks. 257/83, S. 77. 185 Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 167, Rn 400.
70
Kap. B: Einheitlich Bewerten
gesehenen Abweichungspflicht von den Einzelvorschriften 186 , wenn gerade § 252 Abs. 2 HGB die Möglichkeit vorsieht, daß von den wichtigsten kodifizierten Bewertungsgrundsätzen des HGB in "begründeten Ausnahmefällen" abgewichen werden darf d87 . Hierbei kann es sich freilich schwer um einen anderen Fall handeln, als das Vorliegen außerordentlicher Umstände, die die Vermittlung eines "den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes" beeinträchtigen und eine Bewertung nach "true and fair view" gebieten. Diese Tatsache läßt sich auch nicht mit dem Argument bestreiten, in § 252 Abs. 2 HGB handele es sich - im Gegensatz zur Abweichungspflicht der Richtlinie - um freiwillige Bewertungsanpassungen, die im Ermessen des Kaufmanns liegen, da das Gesetz das Wort "darf' verwendet 188 . Vielmehr bedeutet das Wort "darf', daß es zwar von den gesetzlichen Bewertungsgrundsätzen nur unter den gegebenen außerordentlichen Umständen überhaupt abgewichen werden darf (und nicht beliebig), daß der Kaufmann aber seinerseits bei Vorliegen solcher Umstände zur Abweichung verpflichtet ist 189 . Insofern schränkt auch die Feststellung des Rats und der Kommission, daß es normalerweise ausreicht die Richtlinie anzuwenden, damit das gewünschte, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild entsteht 190 , nicht die Bedeutung der Generalklausei ein; es reicht eben normalerweise, aber der "Normalfall" vermag nicht die "Ausnahmefälle" entsprechend zu würdigen 191 • Ebenso wie bei § 252 Abs. 2 HGB verlangen solche Fälle eine besondere Berücksichtigung. Es geht nicht um die Anwendung einer Einzelnorm im Sinne eines vom Gesetz geforderten Minimums, sondern um die Richtigkeit des Gesamtbildes; die Generalnorm begrenzt die Möglichkeit, sich hinter dem Wortlaut einer technischen Norm zu verstecken 192. Die Abkopplungsthese vom Anhang als den eigentlichen Teil des Jahresoder Konzernabschlusses, der sich für eine teilweise Abwendung von der 186 Vgl. etwa Beisse, Die neue Generalnonn des Bilanzrechts, S. 15 ff.; Streim, FS Moxter, S. 391 ff.; Schildbach, BFuP 1987, S. 1ff. 187 Vgl. AIDIS, 5. Auflage, § 264 HGB, Rn 44. 188 In diesem Sinne aber AIDIS, 5. Auflage, § 264 HGB, Rn 47. 189 Insoweit dürfte auch an § 308 Abs. 1 HGB-Entwurf vom April 1985 erinnert werden, der ebenfalls von den "zulässigen Bewertungsmethoden", die angewendet werden "dürfen", sprach (abgedruckt bei Biener/Bemeke, BiRiLiG, S. 3610; vgl. dazu Orde1heide, WPg 1985, S. 509 f. 190 Erklärung Nr. 2 für das Ratsprotokoll über die Ratstagung am 25.7.1978, Anlage zum Ratsdokument R/1961178 (ES 93) vom 18.7.1978. 191 Vgl. A/D/S, 5. Auflage, § 264, HGB, Rn 41; Großfeld, NJW 1986, S. 955, 959; a. A. Biener, BFuP 1979, S. 1, 3. 192 Vgl. Großfeld, Generalnonn, S. 192, 197; Großfe1d I Reemann, Die neue Genossenschaftsbilanz, FS Goerdeler, S. 149, 159; Claussen, Zum Stellenwert des § 264 Abs. 2 HGB, FS Goerdeler, S. 79, 90.
11. Einheitliche Ausübung der anwendbaren Bewertungsmethoden
71
auf den Gläubigerschutz gerichteten und an sich informationsfeindlichen Zielsetzung der Einzelregeln der Bilanz eigne und einen besseren Blick in die Geschicke der Gesellschaft erlaube l93 , läßt sich auch mit Blick auf die Umsetzung der Richtlinie in anderen Mitgliedstaaten nicht halten. So schreibt etwa das englische Recht in Companies Act 1985, s. 228, subs. 2 die Generalnorm ausdrücklich sowohl für die Bilanz wie auch für die Gewinn- und Verlustrechnung vor l94 . Das griechische Recht, was in Art. 100 des Gesetzes 2190/1920 (GAktG) allgemein vom Konzernabschluß (also genau wie § 297 Abs. 2 Satz 2 oder § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB) spricht, sieht in Absatz 5 für den Konzernabschluß (bzw. Art. 42a Abs. 3 Satz 2 GAktG für den Einzelabschluß) die ausdrückliche Möglichkeit zum Abweichen von den Einzelregeln vor, wenn in Ausnahmefällen die Anwendung der Einzelregeln gegen die Generalnorm verstößt 195. Ebenso haben Frankreich und die Niederlande die Generalnorm ohne Einschränkungen ins nationale Recht umgesetzt 196. Maßgebend für die Geltung der Generalnorm auch in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ist aber die Rechtsprechung des EuGH. Der EuGH stellt fest, daß Hauptzielsetzung der angeglichenen nationalen Rechnungslegungsnormen ist, daß Abschlüsse von europäischen Unternehmen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft oder des Konzerns vermitteln müssen l97 . Deshalb sind die besonderen Bilanzierungsgrundsätze dem allgemeinen Grundsatz der Generalnorm untergeordnet 198. Andere Grundsätze wie der Grundsatz der Vorsicht stellen hierbei auch einen Teilaspekt des Grundsatzes der Bilanzwahrheit (true and fair view)199 dar; aber eben nur einen Teilaspekt des übergeordneten "Overriding Principle,,2oo. 193 So etwa, Schildbach, BFuP 1987, S. 1, 12ff.; Streim, in BoHR, § 264 HGB, Rn 15. 194 Vgl. Hoffmann, Klaus-Jürgen, "True and fair view" aus englischer Sicht, S. 39. 195 Vgl. Scholtissek, Die Reform des Gesellschaftsrechts in Griechenland, WPg 1988, S. 446. 196 Vgl. Niehus, 1993 - Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung in dem Einen Markt, in: Baetge (Hrsg.), Rechnungslegung und Prüfung 1994, S. 199, 209. 197 Vgl. EuGH, Rs. C-234/94, DB 1996, S. 1400, 1401 (Gedankenstrich 17); vgl. ferner Weber-Grellet, Bilanzrecht im Lichte, Bilanzsteuerrecht im Schatten des EuGH, DB 1996, S. 2089; Schüppen, Die ,,zuweisung von Gewinnen im Jahresabschluß" - Delphisches Orakel oder Salomonische Lösung?, DB 1996, S. 1481, 1482; Haselmann/Schick, Phasengleiche Aktivierung von Dividendenansprüchen: Das Verwirrspie1 im EuGH-Verfahren ist noch nicht beendet, DB 1996, S. 1529ff. 198 Vgl. Gelhausen, Hans F./Gelhausen, w., Die ,,zuweisung" des Gewinns eine neue bilanzrechtliche Kategorie?, WPg 1996, S. 573, 575. 199 Vgl. EuGH, Rs. C-234/94, DB 1996, S. 1400, 1401 (Gedankenstrich 18); vgl. auch Schlußantrag des Generalanwalts Thesauro, Rs. C-234/94, DB 1996, S. 316, 317; ferner Weber-Grellet, DB 1996, S. 2089.
72
Kap. B: Einheitlich Bewerten
Denn Zielsetzung der 7. EG-Richtlinie war die Vergleichbarkeit und Gleichwertigkeit der Konzernabschlüsse in der ganzen EU sicherzustellen. Als Prämisse dieser Gleichwertigkeit war neben der Anwendung gleicher Einzelbestimmungen die Ausrichtung der Konzemabschlüsse auf die Generalnorm gedacht 201 . Wenn die nationalen Gesetzgeber oder Gerichte aber nicht in der Lage sind, dieses vorrangige Ziel der Rechtsangleichung sicherzustellen, dann wird es der EuGH früher oder später tun. Es ist schließlich seine Aufgabe den richtlinienkonformen Inhalt des "true and fair view" für alle Mitgliedstaaten verbindlich klarzustellen 202 . Dieses - erste überhaupt im Bereich Rechnungslegung - Urteil des EuGH ist wegweisend: Die handeisrechtliche Rechnungslegung wird immer mehr vom Europäischen Recht geprägt, ihre Ergebnisse müssen in Zukunft mit der Zielsetzung der Richtlinien vereinbar sein203 . Dabei wird es für die informations schädliche Abkopplungsthese keinen Platz mehr geben 204 . b) Einheitliche Bewertung als Ausfluß der durch die Generalnorm determinierten Zweckbestimmung der Wertfindung
Die Generalnorm stellt also den obersten Maßstab dar, an dem die Aussagefähigkeit des Jahres- oder Konzemabschlusses und die Tauglichkeit seiner Mittel zu messen ist205 . In diesem Zusammenhang erscheint es geboten, den Einfluß der Generalnorm auf die Ausübung von Wahlrechten und Ermessensspielräumen im Hinblick auf ihre besondere Bedeutung bei der Bewertungseinheitlichkeit näher zu untersuchen. Schon unter der Geltung des § 149 Abs. 1 Satz 2 AktG 1965 (alte Generalnorm) vertrat Teil in der Literatur die Auffassung, daß Bewertungswahlrechte 200 Dies verkennt offensichtlich Kessler (Die Wahrheit über das Vorsichtsprinzip?, DB 1997, S. 1, 3), der an der Erwähnung des Vorsichtsprinzips im Urteil festhält, den Gesamtkontext der Aussage aber fehlinterpetiert. 201 Vgl. Flint, A True and Fair View in Consolidated Accounts, in: Gray I Coenenberg (Hrsg.), International Group Acounting, S. 15 ff. 202 Vgl. auch Ordelheide, True and fair view. A European and a German perspective, in: European Accounting Review 1993, S. 81, 82. 203 Vgl. Schulze-Osterloh, Vorabentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zum Handelsbilanzrecht, ZGR 1995, S. 170ff.; Hoffmann, Wolf-Dieter, Das deutsche Bilanzrechtsverständnis auf dem Prüfstand des EuGH, S. 1051 ff.; ders., Anmerkung zum Schlußantrag des Generalanwalts Thesauro in Rechtssache C-234/94 (BB 1996, S. 579 - 581), in: BB 1996, S. 581 f. 204 Vgl. Herzig, Anmerkung zum EuGH, Rs. C-234/94, DB 1996, S. 1400, 1401, in: DB 1996, S. 1401, 1402; Weber-Grellet, DB 1996, S., 2089, 2090. 205 Vgl. Großfeld, Konzernpublizität im deutschen und Europäischen Recht, RabelsZ 1985, S. 257, 265; Großfeld/Junker, Die Prüfung des Jahresabschlusses im Lichte der 4. EG-Richtlinie, ZGR Sonderheft 2, S. 251, 272; Großfeld/Reemann, Die neue Genossenschaftsbilanz, FS Goerdeler, S. 149, 158 f.
11. Einheitliche Ausübung der anwendbaren Bewertungsmethoden
73
entsprechend dem Primat der Generalnorm auszulegen und anzuwenden seien206 . Dennoch zog die eher praxisorientierte herrschende Meinung die Auffassung vor, daß die aktienrechtliche Generalnorm lediglich eine mißbräuchliche Ausnutzung der bestehenden Wahlrechte verbat, während die Wahlrechts- und Ermessensspielraumsausübung im Belieben des Bilanzierenden läge 207 • Schließlich forderte eine dritte Meinung eine sachgerechte Abwägung zwischen Wahlrechtsfreiheit und Generalklausel des § 149 AktG208 . Nun unterscheidet sich die neue Generalnorm in ihrem Wortlaut vom
§ 149 AktG 1965 nicht unwesentlich: So ist die Formulierung "im Rahmen
der Bewertungsvorschriften" entfallen und ferner statt eines "möglichst sicheren Einblicks" ist "ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild" zu vermitteln. Der erste sprachliche Eindruck deutet also auf verschärfte Anforderungen im Vergleich zum alten Recht hin 209 . Die Bedeutung der Generalnorm wird noch erhöht, indem an mehr als 20 Stellen im HGB auf sie verwiesen oder deren Wortlaut aufgegriffen wird2Io . Doch gibt es den objektiv "wahren" Abschluß nicht211 • Denn Abschlüsse sind lediglich nach Konventionen erstellte Zwischenrechnungen, die wegen der unsicheren Schätzungs- und Bewertungsmaßstäbe notwendig ungenau sind 212 . Die zur Wertermittlung herangezogenen Bewertungsmethoden stellen schließlich allgemein akzeptierte Konventionen, die zur Ermittlung nicht des "wahren" Wertes, sondern eines nachvollziehbaren Wertes führen 213 . Selbst in einem der Informationsfunktion verpflichteten Abschluß wie der Konzernabschluß stammen die Bewertungsmethoden aus dem Einzelabschluß (Bewertungsregeln des Mutterunternehmens) und sind von ihrer ursprünglichen doppelten Funktion als Informations- und Gewinnermittlungsregeln geprägt214 • Deshalb wird die Ansicht vertreten, daß auch unter 206
Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 1. Auflage, S. 32; Leffson, Zur Bedeutung des
§ 149 AktG und Art. 2 Abs. 3 der 4. EG-Richtlinie, ZfbF 1979, S. 213; Lutter,
Rechnungslegung nach künftigem Recht, OB 1979, S. 1292. 207 Vgl. A/O/S, 4. Auflage, § 149 AktG, Tz 94; Forster, WPg 1965, S. 585, 588. 208 Vgl. Claussen, in Kölner Komm. zum AktG, § 149, Anm. 9 - 11; Kropff, Bilanzwahrheit und Ermessensspielraum in den Rechnungslegungsvorschriften des Aktiengesetzes 1965, WPg 1966, S. 369ff. 209 Großfeld, Generalnorm, S. 192. 210 Vgl. Baetge/Commandeur, in Küting/Weber, HdR, 4. Auflage, § 264 Rn 31. 211 IDW, Stellungnahme zur Transformation der 4. EG(Bilanz-)Richtlinie, OB 1979, S. 1237; Großfeld/Junker, ZGR Sonderheft 2, S. 251, 272; Großfeld/Reemann, FS Goerdeler, S. S. 149, 158. 212 Vgl. Clemm, § 264 HGB und Wahlrechte, FS Budde, S. 335, 344; Clemm/ Wenzel, BFuP 1986, S. 341, 352. 213 Vgl. IDW, OB 1979, S. 1237; Selchert, OB 1995, S 1573, 1574f. 214 Vgl. Schildbach, BFuP 1987, S. 1, 12f.; Schruff, Einflüsse der 7. EG-Richtlinie auf die Aussagefähigkeit des Konzemabschlusses, S. 64; Streim, in BoHR § 264 HGB, Rn 15.
74
Kap. B: Einheitlich Bewerten
der neuen Generalnorm des "true and fair view" die Bewertungswahlrechte nicht eingeschränkt würden, denn ihre Ausübung in der Bilanz vermöge ohnehin nicht die Aussagefähigkeit des Abschlusses zu erhöhen; über die Wahlrechtsausübung unterrichte der Anhang den Bilanzleser ausreichend 215 . Diese Ansicht ist aus mehreren Gründen abzulehnen. Zunächst, weil bloße verbale Angaben im Anhang nicht die entsprechende Bewertung im eigentlichen Zahlenwerk Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung ersetzen können: mit Blick auf Gewinnansprüche von Minderheitsgesellschaftern bzw. -aktionären ist diese sogenannte "Abkopplungsthese" schon für den lahresabschluß abzulehnen 216 . Beim Konzernabschluß aber, wo die Informationsfunktion eindeutig im Vordergrund steht, muß die größtmögliche Aussagefähigkeit des Abschlusses angestrebt werden. Dies setzt aber wiederum entsprechende Berücksichtigung im Zahlenwerk des Abschlusses (also Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) voraus. Dafür sprechen gewichtige Gründe: Die Angaben im Anhang werden oft nicht zur Kenntnis genommen oder aber wegen der komplizierten Ausdrucksweise schlichtweg nicht verstanden 217 ; dagegen ist die Zahlen sprache - trotz ihrer etwaigen Schwächen und gelegentlichen Ungenauigkeiten 218 - die einzige Sprache, die auch von einem ausländischen Bilanzleser effektiv verstanden werden kann 219 . Letzteres dürfte seine Begründung nicht zuletzt aus den Harrnonisierungsbestrebungen der 4. und 7. EG-Richtlinien ableiten 220. Wenn aber die "tatsächlichen Verhältnisse" nicht nur in dem Anhang, sondern auch in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angemessen gewürdigt und zum Ausdruck gebracht werden müssen, dann kann nicht mehr davon die Rede sein, daß die Generalklausel keine Bedeutung für die Ausübung von Wahlrechten haben kann 221 . Daran kann auch die 215 Vgl. A/D/S, 5. Auflage, § 264 HGB, Rn 107; Biener, BFuP 1979, S. 1, 6; Biener/Berneke, BiRiLiG, S. 132; Niehus, BFuP 1979, S. 17, 23f.; ders., DB 1979, S. 221 ff.; Niehus/Scholz in Mayer-Landrut u. a., GmbHG, §§ 238 - 335 HGB, Rn 122; Budde/Karrig, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 264, Rn 29. 216 Vgl. BGH, GmbHR 1996, S. 456, 460f.; Großfeld, FS Havermann, S. 183, 195. 217 Vgl. Forster, Zur "Erwartungslücke" bei der Abschlußprüfung, FS Heimrich, S. 613,623. 218 Dazu Großfeld, Zeichen und Bilder im Recht, NJW 1994, S. 1911 ff.; ders., Zeichen und Zahlen im Recht, 2. Auflage, S. 212ff. 219 Vgl. Großfeld, FS Havermann, S. 183, 195f.; ders., Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 168f., Rn 402f.; Leffson, Bild der tatsächlichen Verhältnisse, in: Leffson/RückleiGroßfeld (Hrsg.), Handwörterbuch unbestimmter Rechtsbegriffe, S. 94, 103. 220 Vgl. Großfeld, FS Havermann, S. 183, 195f.; ders., Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 168f., Rn 402f.; Kirchner, Zur Funktion eines harmonisierten Konzernrechnungslegungsrechts, FS Moxter, S. 601, 619; ferner van Hulle, FS Budde, S. 313, 321. 221 So aber A/D/S, 5. Auflage, § 264 HGB, Rn 107; Streim, in BoHR, § 264 HGB, Rn 24.
H. Einheitliche Ausübung der anwendbaren Bewertungsmethoden
75
Feststellung der Begründung zum Regierungsentwurf nichts ändern, daß sich Inhalt und Umfang des Abschlusses in erster Linie aus den Einzelvorschriften von Gesetz und Verordnung ergeben 222 . Sie ergeben sich eben nur "in erster Linie" aus den Einzelvorschriften 223 . Andererseits steht aber die Generalnorm immer im Hintergrund, deren Ziel ist bei der Auslegung der Einzelvorschriften stets zu beachten224 . Die Fixierung auf Einzelvorschriften erlaubt mit anderen Worten keinen Ausstieg aus der Generalnorm, die vielen Detailregeln dürfen den Blick für das Ganze nicht verstellen 225 . Am deutlichsten wird dies in der Begründung zu Art. 9 des ursprünglichen Vorschlags einer 7. EG-Richtlinie bestätigt226 : "Der Konzemabschluß muß einen getreuen Einblick in die Lage des Konzerns geben. Von dieser Zielsetzung muß sich jeder leiten lassen, der verpflichtet ist einen Konzernabschluß zu erstellen. Die besonderen Vorschriften der Richtlinie stellen darauf ab, diese Aufgabe zu erleichtern. Soweit sie jedoch einen Ermessensspielraum für ihre Anwendung oder Wahlmöglichkeiten lassen, muß bei der praktischen Anwendung der Vorschriften der Richtlinie die Zielsetzung des getreuen Einblicks die Wahl der Lösungen bestimmen".
Auch unter der Geltung des "true and fair view" ist das "Tatsächliche" in weitem Umfang selbst das Ergebnis einer Wertung; es kommt darauf an, was das Gesetz noch oder schon als "tatsächlich" gelten läßt, was nach dem gesetzlichen Wertungszusammenhang als tatsächlich gelten soll, es geht um eine normative Tatsächlichkeit227 • Die Generalklausel wirkt also als Maßstab und Koordinator auf die Einzelregeln, zugleich wirken aber auch die Einzelregeln in die Generalklausei hinein; denn in den Einzelregeln kristallisieren sich die Einzelprobleme der Rechnungslegung, schlägt sich die Relativität des Wahrheitsprinzips nieder228 • Mithin stellt sich die Rechtslage ähnlich wie bei § 242 BGB dar: Die einzelne Regel ist im Hinblick auf das allgemeine Ziel entworfen, sie konkretisiert es; die Generalklausel behält aber eine "korrigierende Funktion" und bleibt Koordinator der Einzelregelungen229 . BT-Drucks. 10/317, S. 76. Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 167, Rn 401. 224 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 167, Rn 401; Großfeld/Reemann, FS Goerdeler, S. 149, 159; Großfeld/Junker, ZGR Sonderheft 2, S. 251, 272. 225 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 167. Rn 401. 226 Abgedruckt bei Biener/Schatzmann, Konzern-Rechnungslegung, 1983, S. 159f. 227 Großfeld, Generalnorm S. 192,202; Großfeld/Reemann, FS Goerdeler, S. 149, 158. 228 Großfeld, Generalnorm, S. 192, 202; Großfeld/Reemann, FS Goerdeler, S. 149, 159. 229 Großfeld, Generalnorm, S. 192, 201; vgl. auch Clemm, WPg 1989, S. 357, 365. 222 223
Kap. B: Einheitlich Bewerten
76
Darunter fällt aber auch die Ausübung von Wahlrechten und Spielräumen bei Ansatz und Bewertung23o . Denn das Ermessen findet seine Grenze dort, wo durch den Ansatz ermessensabhängiger Posten ein angemessenes Bild der tatsächlichen Verhältnisse nicht vermittelt wird 231 . Hierbei reicht die bloße Befolgung einzelner Gesetzesnormen ohne Blick auf das Ganze nicht für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes 232 . So räumt das Gesetz unterschiedliche Varianten bei der Ermittlung der Herstellungskosten oder der Wahl der Abschreibungsmethoden ein. Es steht sicherlich außer Frage, daß für sich genommen jede dieser vom Gesetz zugelassenen Methoden eine erlaubte Methode darstellt. Die Frage ist aber, ob die Wahl der einen und nicht der anderen Methode im konkreten Zusammenhang nicht zu einer mehr oder minder zutreffenderen Abbildung von der tatsächlichen Lage der Unternehmung oder des Konzerns führt. Hierbei würde es nicht dem Sinn und Zweck der Einzelvorschrift entsprechen, die Generalnorm unberücksichtigt zu lassen 233 . Denn es ist möglich, daß technisch alles gerade noch stimmen kann, daß aber viele "gerade noch" zusammen "gerade nicht mehr" ergeben 234 . Das Ganze ist eben mehr als nur die Summe seiner Teile 235 . Dies wird auch durch die Übernahme des "true and fair view"-Grundsatzes in dem Bestätigungsvermerk bestätigt: Der Abschlußprüfer hat nach § 322 Abs. 1 HGB nicht nur die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu bestätigen, sondern auch, daß der Abschluß als Ganzes "ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild" vermittelt236 • Dies kann aber nur erreicht werden, wenn sich die Beteiligten aus den Niederungen der Einzelheiten lösen, die gesamte Rechnungslegung ins Auge fassen und sich fragen, ob die Summe aller in dem Abschluß enthaltenen EinzelheiVgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 168, Rn 401. Vgl. Leffson, Bild der tatsächlichen Verhältnisse, S. 94, 98; ders. ZtbF 1979, S. 213, 215. 232 Vgl. Großfeld, FS Haverrnann, S. 183, 195; Claussen, FS Goerdeler, S. 79, 89f. 233 Vgl. Baetge/Commandeur, in Küting/Weber, HdR, 4. Auflage, § 264, Rn 34; Claussen, FS Goerdeler, S. 79, 90; Leffson, Bild der tatsächlichen Verhältnisse, S. 94, 99. 234 Vgl. Großfeld, FS Haverrnann, S. 183, 195; vgl. auch Leffson, Bild der tatsächlichen Verhältnisse, S. 94, \04; Flint, A True and Fair View in Consolidated Accounts, in Gray /Coenenberg (Hrsg.), International Group Accounting, S. 15, 21. 235 Vgl. Großfeld, FS Haverrnann, S. 183, 195; ders., Generalnorm, S. 192, 203; Großfeld/Reemann, FS Goerdeler, S. 149, 159; vgl. auch Lutter, DB 1979, S. 1292. 236 Vgl. Baetge/Commandeur, in Küting/Weber, HdR, 4. Auflage, § 264, Rn 15; vgl. weitergehende kritische Gedanken bei Großfeld, ZIP 1986, S. \023; Forster, FS Heimrich, S. 613ff.; ders., Gedanken zu einer Runderneuerung des Bestätigungsvermerks, FS Ludewig, S. 253ff.; auch Biener, Die Erwartungslücke - eine endlose Geschichte, FS Haverrnann, S. 37, 60f. 230 231
III. Einheitlichkeit der Bewertung im Jahresabschluß
77
ten das zutreffende Gesamtbild der Unternehmens- oder Konzernlage zeichnet237 • Das kann aber nur geschehen, wenn sowohl im Zahlen werk des Abschlusses als auch im Anhang und Lagebericht, ein von falschen und irreführenden Tatsachen freies Bild von der Lage der Unternehmensgruppe vermittelt wird, und vor allem, wenn ihre Ertragsentwicklung und ihre Perspektiven, gewürdigt werden 238 • Dazu braucht der Abschluß zwar nicht dem Bilanzadressaten den Eindruck von der Lage des Konzerns zu vermitteln, wie ihn die Konzernleitung selbst besitzt239 - das wäre unrealistisch und würde die Bilanzleser überfordern -, wohl aber jenen Eindruck, den sich die Konzernleitung gewünscht hätte, wenn sie an der Stelle des Bilanzadressaten wäre. Und dazu gehört auch, daß Wahlrechte und Spielräume dem "true and fair view" entsprechend bei gleichen Vermögensgegenständen gleich auszuüben sind 24o . III. Einheitlichkeit der Bewertung im Jahresabschluß
Nach überwiegender Meinung in der Literatur241 hat sich die Einheitlichkeit der Bewertung im Konzernabschluß an die Bewertung im Jahresabschluß einer Einzelgesellschaft zu richten, weil im Konzernabschluß "Bewertungswahlrechte nebeneinander nur ausgeübt werden können, soweit diese Möglichkeit auch für den Jahresabschluß einer einzelnen Kapitalgesellschaft besteht" 242. Überraschenderweise wird aber die Frage nach der Einheitlichkeit der Bewertung im Einzelabschluß als nicht abschließend geklärt betrachtet243 . In bezug auf ihre fehlende gesetzliche Regelung wird sie gelegentlich sogar verneint, um auf diese Weise auch die in § 308 HGB ausdrücklich normierte Pflicht zur einheitlichen Bewertung im Konzernabschluß auszuhöhlen 244 . Vgl. Lutter, DB 1979, S. 1292. Vgl. Clemm, WPg 1989, S. 357, 366; Leffson, Zur Generalnorm und zum Bestätigungsvermerk des Vorentwurfs eines Bilanzrichtliniengesetzes, WPg 1980, S. 289 f. 239 Vgl. Hoffmann, Klaus-Jürgen, "True and fair view" aus englischer Sicht, S. 37. 240 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 168, Rn 401; Claussen, FS Goerdeler, S. 79, 89f.; einschränkend Baetge/Commandeur, in Küting/Weber, HdR, 4. Auflage, § 264 HGB, Rn 34ff., die die gesetzlichen Wahlrechte vom Einheitlichkeitsgrundsatz für den Fall herauslösen wollen, daß sie vom Gesetzgeber aus "bilanzfremden" Gründen eingeräumt werden. 241 A/DIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 10; ScheITer, in BoHR, § 308 HGB, Rn 11; Klein, Konzernbilanzpolitik, S. 234. 242 Vgl. Bericht der Abgeordneten Heimrich, Kleinert (Hannover) und Stiegler, BT-Drucks. 10/4268, S. 116. 243 Vgl. ScheITer, in BoHR, § 308 HGB, Rn 11 m. W.N. 244 Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung im Konzernabschluß, S. 123, 133f.; vgl. auch A/DIS, 6. Auflage, § 252 HGB, Rn 130. 237 238
78
Kap. B: Einheitlich Bewerten
Nun verlangt die in § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB normierte Generalnorm, daß der 1ahresabschluß ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Kapitalgesellschaft vermittelt. Somit wird die Vermittlung qualifizierter Informationen über das bilanzierende Unternehmen zum obersten Ziel der handelsrechtlichen Bilanzierung245 . Diese Feststellung bleibt - trotz der weit verbreiteten Gegenansicht 246 - gültig auch mit Blick auf die Funktion des 1ahresabschlusses als Grundlage für die handelsrechtliche Gewinnermittlung; denn eine gerechte Gewinnverwendung - nicht zuletzt mit Blick auf die Interessen der Minderheitsgesellschafter - setzt voraus, daß der 1ahresabschluß in Übereinstimmung mit der Generalnorm in seinem Zahlenwerk den richtigen 1ahreserfolg aufweist247 • Somit wird deutlich, daß auch auf der Ebene des 1ahresabschlusses Bewertungswahlrechte nicht losgelöst von der Generalnorm ausgeübt werden können. Es ist mithin wichtig, daß nichts, was nicht real existiert, in den 1ahresabschluß gelangen darf. Ferner, daß derjenige, der einen 1ahresabschluß verantwortlich aufstellt, nur solche Werte wählt, die aus realitätsnahen und von ihm für zutreffend gehaltenen Hypothesen abgeleitet sind. Der 1ahresabschluß hat also den Grundsätzen der Richtigkeit und der Willkürfreiheit zu entsprechen 248 . In diesem Zusammenhang erscheinen rein bilanzpolitische Argumente für eine Differenzierung in der Ausschöpfung von Bewertungsspielräumen mit der Pflicht, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bild zu vermitteln, nicht vereinbar249 • Eine sachgerechte, nachprüfbare und insoweit gerade nicht willkürliche Bewertung verlangt aber, daß im Rahmen der Bewertungsvorschriften allenfalls durch die Vermögensart begründete Bewertungsdifferenzierungen auftreten dürfen 25o . Nach Wohlgemuth 251 läßt sich ein durch eine differenzierte Bewertung eingetretenes Informationsdefizit durch entsprechende verbale Angaben kompensieren. Dabei übersieht er aber, daß die einheitliche Bewertung zu 245 Vgl. Wohlgemuth, Der Grundsatz der Einheitlichkeit der Bewertung, in FS v. Wysocki, S. 45, 47. 246 Vgl. etwa Moxter, Bilanzlehre, Bd. 11: Einführung in das neue Bilanzrecht, 3. Auflage, Wiesbaden 1986, S. 64; Schildbach, BFuP 1987, S. 1, Ilff.; Streim, BoHR, § 264, Rn 12ff.; ders., FS Moxter, S. 391, 398ff. 247 Dazu statt aller Großfeld, Rücklagenbildung und Minderheitenschutz bei Personengesellschaften, WPg 1987, S. 698ff.; ders., Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 168, Rn 403; ders., FS Havermann, S. 183, 195. 248 Vgl. Leffson, Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, 7. Auflage, S. 200ff. 249 Vgl. Selchert, WPg 1983, S. 447,449. 250 Vgl. Selchert, WPg 1983, S. 447, 449. 251 Vgl. Wohlgemuth, FS v. Wysocki, S. 45, 48ff.; vgl. auch Stobbe, DB 1986, S. 1833, 1836.
III. Einheitlichkeit der Bewertung im lahresabschluß
79
einer besseren Vennittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes als Erläuterungen im Anhang führt und daß bei einer differenzierten Bewertung der Umfang der Berichtspflichten im Anhang so stark anstiege, daß die Einhaltung der in § 243 Abs. 2 HGB geforderten Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses gefährdet wäre 252 • Bewertungsuneinheitlichkeit unter Kompensation im Anhang vennag also in der Praxis nicht die durch das Zahlenwerk vennittelte Nachvollziehbarkeit zu ersetzen. Die Pflicht zur einheitlichen Bewertung im Jahresabschluß ergibt sich aber auch aus dem Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB). Der Zweck des Stetigkeitsgrundsatzes könnte durch eine differenzierte Anwendung von Bewertungsmethoden auf gleichartige Bewertungsobjekte wegen des daraus resultierenden Methodenwahlrechts für Neuzugänge unterlaufen werden. Deshalb erfüllt der Grundsatz der Bewertungseinheitlichkeit in zeitlich-vertikaler Hinsicht eine notwendige Komplementärfunktion für das zeitlich-horizontal angelegte Stetigkeitsprinzip bezüglich der Beibehaltung angewandter Bewertungsmethoden 253 • Wenn aber damit die Frage nach der Bewertungseinheitlichkeit im Einzelabschluß beantwortet zu sein scheint, bleibt noch offen, warum der Gesetzgeber die Bewertungseinheitlichkeit auch für den Jahresabschluß - genauso, wie er für den Konzernabschluß getan hat - nicht kodifiziert hat. Der Grund liegt wahrscheinlich darin, daß der Gesetzgeber die Einheitlichkeit der Bewertung im Jahresabschluß in der Fonn eines nicht kodifizierten Grundsatzes ordnungsmäßiger Buchführung als gegeben betrachtet hat254 . Dagegen ist es wichtig, im Konzernabschluß die Einheitlichkeit der Bewertung ausdrücklich zu betonen, da in diesem Fall mehrere rechtlich selbständige Unternehmen, die in der Regel unterschiedlichen Rechtsordnungen unterworfen und in unterschiedlichen Rechtsfonnen organisiert sind, zusammengefaßt werden255 • Es ist nicht zufällig, daß das AktG 1965, das den Grundsatz der Einheitlichkeit der Bewertung für den Konzernabschluß nicht vorsah, die Einbeziehung von ausländischen Tochterunternehmen verbat (§ 329 Abs. 2 Satz 1 und Satz 3 zweiter Halbsatz AktG 1965). Die seinerzeit aufgestellten freiwilligen Weltabschlüsse nahmen aber doch vor der Einbeziehung eine gewisse "Vereinheitlichung" auf der Basis der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für die Bilanzwerte der ausländischen Tochterunternehmen vor. Die in § 308 HGB kodifizierte Bewertungseinheitlichkeit sagt also aus, daß selbst bei so verschiedenartigen in den Konzernabschluß einbezogenen 252 253 254 255
Küting, DB 1984, S. 1,5; Kupsch, DB 1987, S. 1157, 1159. Kupsch, DB 1987, S. 1157, 1158; SeJchert, WPg 1983, S. 447, 448. Vgl. Reintges, WPg 1987, S. 282, 285; SeJchert, DB 1995, S. 1573, 1578. Vgl. Reintges, WPg 1987, S. 282, 285.
80
Kap. B: Einheitlich Bewerten
Unternehmen Vermögens gegenstände und Schulden einheitlich zu bewerten sind. Damit ist klargestellt, daß nicht einmal die Zugehörigkeit zu verschiedenen rechtlichen Subjekten als Gegenargument gegen die Einheitlichkeit der Bewertung gilt. Allein die Art der Bewertungsobjekte, ihre Funktion und andere wertbestimmende Faktoren vermögen die Einheitlichkeit der Bewertung zu begrenzen und die Anwendung abweichender Bewertungsmethoden zu begründen256 .
IV. Zwischenergebnis Grundlage für die wertmäßige Abbildung von Vermögensgegenständen und Schulden im lahresabschluß einer Unternehmung sind die Bewertungsmethoden. Diese führen zwar in der Regel nicht zur Ermittlung des absolut richtigen Wertes, der dem Bewertungsgegenstand zum Zeitpunkt der Bewertung am Markt zukommt, wohl aber zur Ermittlung eines Wertes, der für die Bilanzadressaten nachvollziehbar und deshalb verläßlich ist. Diese Nachvollziehbarkeit nimmt aber ab, wenn für die Bewertung eines Sachverhaltes mehrere zulässige Bewertungsalternativen in der Form von Bewertungswahlrechten oder -spielräumen vom Gesetz eingeräumt werden. In diesem Fall ist es für den Bilanzleser schwierig zu erkennen, welche Methoden angewandt wurden und vor allem aus welchen Gründen der Bewertende den angewandten Methoden den Vorzug gegeben hat. Gleiches gilt auch für die Ausübung der Ansatzwahlrechte. Dieser Verlust an Nachvollziehbarkeit der Wertansätze wird viel größer auf der Ebene des Unternehmensverbundes: Die verschiedenen Konzernunternehmen müssen gemäß der für sie geltenden nationalen oder rechtsformbedingten Bilanzrechtsvorschriften von einander abweichende Bewertungsmethoden anwenden, die zu völlig miteinander unvergleichbaren Wertansätzen führen und die Aussagefähigkeit des Konzernabschlusses stark beeinträchtigen. Es erscheint deshalb geboten bei der Bewertung im Konzernabschluß sachlich ungerechtfertigte Unterschiede auf der Einzelabschlußebene wie nationalrechtliche oder rechtsformbedingte Abweichungen zu beseitigen; der Ansatz- und Bewertungsrahmen des Konzernabschlusses wird einheitlich für alle Konzernunternehmen durch den Rahmen des Mutterunternehmens § 300 Abs. 2 i. V. m. § 308 HGB bestimmt. Der Konzernabschluß hat den Konzern so darzustellen, als ob er ein einziges Unternehmen wäre (§ 297 Abs. 3 Satz 1 HGB). Darüber hinaus ist für die Nachvollziehbarkeit der Wertansätze des Konzernabschlusses die Ausübung der Bewertungswahlrechte einzugrenzen und 256 Selchert, DB, 1995, S. 1573, 1578; vgl. auch Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 78 f.
III. Einheitlichkeit der Bewertung im lahresabschluß
81
vor allem an sachliche Differenzierungsgründe anzubinden. Alternative Bewertungsmethoden sind also einheitlich auszuüben, es sei denn sachliche Gründe erfordern eine differenzierte Ausübung von Bewertungswahlrechten im gleichen Jahres- oder Konzernabschluß. Hierbei steht der Begriff der Bewertungseinheitlichkeit unter dem Einfluß mehrerer anderer Grundsätze der Rechnungslegung, die zur Definition seines Inhalts und Umfangs beitragen: Leitlinien der Bewertungseinheitlichkeit sind also in diesem Sinne der gesetzliche Wortsinn, der Grundsatz der zeitlichen Stetigkeit, der Einzelbewertungsgrundsatz, das Willkürverbot, der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz und für den Konzernabschluß auch die Fiktion rechtlicher Einheit. Die größte Bedeutung als Leitlinie der Bewertungseinheitlichkeit im Konzernabschluß kommt aber der Generalnorm des Konzernabschlusses (§ 297 Abs. 2 Satz 2 HGB) zu. Der Einheitlichkeitsgrundsatz erfährt aber notwendige Einschränkungen durch die Internationalität des Konzernabschlusses. Denn durch die Internationalität entstehen sachliche Differenzierungen bei den Bewertungsobjekten in einem viel größeren Umfang als im Einzelabschluß eines nationalen Unternehmens. Um den Anforderungen der Generalnorm zu genügen, muß der Konzernabschluß solche Differenzierungen angemessen berücksichtigen und gegebenenfalls durch eine differenzierte Bewertung widerspiegeln.
6 Xenides
Kapitel C
Neubewertungspflicht I. Wiederaufleben der Bewertungswahlrechte - Handelsbilanz 11 1. Wiederaufleben der Bewertungswahlrechte
Wie schon im vorigen Kapital erläutert, besteht die Einheitlichkeit der Bewertung im Konzernabschluß in der Anwendung einheitlicher Bewertungsmethoden und vor allem in der einheitlichen Ausübung der Bewertungswahlrechte. Die Bewertungswahlrechte lassen sich aber in der Regel aus rechtlichen (z. B. Rechtsform, nationales Recht usw.) oder faktischen Gründen (z. B. Ausübung der Bewertungswahlrechte mit Blick auf die Höhe der Steuerlast oder der Dividendenbelastung des Unternehmens) nicht schon im lahresabschluß vereinheitlichen. Deshalb sieht das Gesetz vor (§ 308 Abs. I Satz 2 HGB), daß Bewertungswahlrechte, die nach den auf den Jahresabschluß des Mutterunternehmens anwendbaren Bewertungsmethoden zulässig sind, unabhängig von ihrer Ausübung in den Einzelabschlüssen der einbezogenen Unternehmen im Konzernabschluß neu ausgeübt werden könneni. 2. Parallel zu den Bewertungswahlrechten leben für den Konzernabschluß auch die Ansatzwahlrechte wieder auf3 • Die Neuausübung der Bewertungswahlrechte darf nicht nur zur Herstellung der nach § 308 Abs. 1 Satz 1 geforderten Einheitlichkeit der Bewertung vorgenommen werden, sondern auch dann, wenn eine einheitliche Bewertung in den Einzelabschlüssen durch eine andere in der Konzernbilanz ersetzt werden soll. Werden z. B. in den Einzelabschlüssen einheitlich I Vgl. Oroßfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 235, Rn 574; AIDIS, 6. Auflage, § 308 HOB, Rn 23; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 142; Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 85ff.; Scherrer, in BoHR, § 308 HOB, Rn 14; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HOB, Rn 24. 2 In § 308 Abs. 1 S. 2 HOB wurde das in Art. 29 Abs. 2 der 7. EO-Richtlinie
enthaltene (Mitgliedstaaten-)Wahlrecht ins deutsche Recht transformiert, allerdings nicht in seiner ganzen Dimension, denn es dürfen nicht alle mit der 4. EO-Richtlinie vereinbaren Bewertungsmethoden zugrunde gelegt werden, sondern nur die, die für das Mutterunternehmen nach dem HOB zulässig sind; damit hat sich die Erwartung, daß alle Jahresabschlüsse von Tochterunternehmen innerhalb der EO unverändert übernommen werden können nicht erfüllt (Vgl. Pankow/Kilgert, Beck'scher BK, 2. Auflage, § 308 HOB, Rn 12). 3 Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 142.
I. Wiederaufleben der Bewertungswahlrechte - Handelsbilanz II
83
Maschinen degressiv abgeschrieben, so kann im Konzernabschluß die Abschreibung nach der linearen Methode angewendet werden. Ebenso können unfertige oder fertige Erzeugnisse, die in den Einzelabschlüssen einheitlich zu Einzelkosten (Wertuntergrenze gemäß § 255 Abs. 2 Satz 2 HGB) bewertet worden sind, für den Konzernabschluß mit den Vollkosten (Wertobergrenze gemäß § 255 Abs. 2 Satz 2 - 4, Abs. 3 HGB) angesetzt werden (auf jeden Fall aber unter Beachtung des Willkürverbots und der Generalnorm des § 297 Abs. 2 Satz 2 HGB)4. Die Neuausübung der Bewertungswahlrechte wird jedoch in zweifacher Hinsicht begrenzt: Sie unterliegt erstens dem erwähnten Grundsatz der Einheitlichkeit der Bewertung und ferner auch dem Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 252 Abs. I Nr. 6 i. V. m. § 298 Abs. 1 HGB). Letzterer verlangt die Beibehaltung der auf den vorhergehenden Konzernabschluß angewandten Bewertungsmethoden5 . Demzufolge dürfen Bewertungswahlrechte nicht an jedem Stichtag neu ausgeübt werden; vielmehr besteht zur Sicherung der Vergleichbarkeit aufeinanderfolgender Konzernabschlüsse im Rahmen der Reichweite des Stetigkeitsgebots eine Bindung an die Entscheidungen der Vorjahre 6 . Wird die Bewertung im Konzernabschluß vereinheitlicht, kann die Konzernleitung grundsätzlich über folgende Bewertungswahlrechte neu entscheiden: 7 1. Bemessung der Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2. 2. Bestimmung der Abschreibungsmethode nach § 253 Abs. 2 Satz 2. 3. Abschreibungen auf Finanzanlagen bei voraussichtlich nur vorübergehender Wertminderung gemäß § 253 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. § 279 Abs. 1 Satz 2. 4. Abschreibungen auf den niedrigeren, nur steuerrechtlich zulässigen Wert nach § 254. 5. Berücksichtigung niedrigerer Werte beim Umlaufvermögen aufgrund von zu erwartenden Wertschwankungen in der nächsten Zukunft gemäß § 253 Abs. 3 Satz 3. 6. Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwerts nach § 255 Abs. 4 Satz 2 oder 3. 7. Auswahl des Zinssatzes zur Ermittlung des Barwertes der Pensionsrückstellungen gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2. 4 A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 23; Baetge/Thomas-Meyer, BBK 1995, S. 485, 490; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 24. 5 A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 24; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 144; Baetge/Thomas-Meyer, BBK 1995, S. 485, 490. 6 A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 26; Weirich, WPg 1987, S. 77, 80. 7 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 143; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 25. 6*
84
Kap. C: Neubewertungspflicht
Wenn der Konzernabschluß nach den Vorschriften des PublG aufgestellt wird, ergeben sich weitere Bewertungswahlrechte, da die strengeren Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 279 Abs. 1 und 280 nicht angewendet zu werden brauchen (§ 13 Abs. 3 Satz 1 PubIG). In diesem Fall dürfen zusätzlich 1. Willkürrücklagen gemäß § 253 Abs. 4 im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet werdenS; 2.
außerplanmäßige Abschreibungen bei nicht voraussichtlich dauernder Wertminderung am gesamten Anlagevermögen vorgenommen werden;
3. die niedrigeren Werte bei Wegfall der Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung beibehalten werden. Allerdings dürfen diese Wahlrechte in einem nach dem PublG aufgestellten Konzernabschluß nicht in Anspruch genommen werden, wenn letzterer befreiende Wirkung nach § 291 HGB erhalten so1l9. 2. Handelsbilanz 11
Theoretisch ist möglich, daß schon auf der Ebene der Jahresabschlüsse der Konzernunternehmen einheitlich bewertet werden kann. Dies gilt vor allem für Konzerne, deren Tochterunternehmen ausschließlich im Inland angesiedelt sind. Wenn aber nicht bereits bei der Erstellung der Jahresabschlüsse der Tochterunternehmen einheitlich bewertet werden kann, dann ist eine Überleitungsrechnung von dem offiziellen Jahresabschluß in den Abschluß für Konsolidierungszwecke (Jahres abschluß 11) erforderlich 10. Entsprechend ist die Rede von der Handelsbilanz 11 und der Gewinn- und Verlustrechnung 11 11. In der Praxis wird aber pauschal der Begriff Handelsbilanz 11 verwendet. 8 Zu den Einschränkungen bei der Bildung von Rücklagen nach § 253 Abs. 4 HGB siehe statt aller Großfeld, Rücklagenbildung und Minderheitenschutz bei Personenhandelsgesellschaften, WPg 1987, S. 698 ff. 9 Vgl. Arbeitskreis ,,Externe Unternehmensrechnung" der Schmalenbach-Gesellschaft, Aufstellung von Konzernabschlüssen, ZfbF Sonderheft 21/1987, Busse v. Colbe, Walter/Müller, Eberhard/Reinhard, Herbert, (Hrsg.), 2. Auflage, Düsseldorf 1989, S. 45; vgl. auch Biener, Stellungnahme zu § 308 HGB bei der Sachverständigenanhörung vor dem Unterausschuß-Bilanzrichtlinien-Gesetz, in: HeImrich (Hrsg.), BiRiLiG, S. 232. 10 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, Vorbemerkungen zu §§ 290 - 315, Rn 43; Baetgel Thomas-Meyer, Der Grundsatz der Einheitlichkeit in der Konzernrechnungslegung, BBK 1995, S. 485; Ferk, lahresabschluß und Prüfung von ausländischen Tochtergesellschaften, Stuttgart 1991, S. 23. 11 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 236, Rn 576; Förschle, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 300 HGB, Rn 27.
I. Wiederaufleben der Bewertungswahlrechte - Handelsbilanz 11
85
Die Handelsbilanz 11 ist das Bindeglied zwischen dem nach landesrechtlichen Vorschriften aufgestellten Jahresabschluß des einzelnen Konzernunternehmens und dem Konzernabschluß. Hierbei wird nicht nur die Bewertung vereinheitlicht, sondern auch der Ansatz und die Gliederung l2 . Der Handelsbilanz 11 kommt keine rechtliche Wirkung zu. Sie ist reines Konsolidierungs- bzw. Informationsinstrument und bildet weder die Grundlage für Gewinnausschüttungen noch für die Besteuerung oder für die Haftung gegenüber Dritten. Deshalb bedarf sie auch nicht der Feststellung und wird nicht offengelegt 13 . Dennoch hat der Konzernabschlußprüfer gemäß § 317 Abs. 2 Satz 1 HGB die Handelsbilanz 11 darauf zu prüfen, ob sie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht und ob die für die Übernahme in den Konzernabschluß maßgeblichen Vorschriften beachtet sind l4 . Ob eine zentrale oder dezentrale Organisationsform für die Erstellung der Handelsbilanz 11 vorzuziehen ist, läßt sich nur im jeweiligen Einzelfall beantworten. Die Entscheidung hängt unter anderem von der Unternehmensphilosophie, der Divisionalisierung, der Konzernstruktur, der Zahl der Tochteruntemehmen, der Zahl der verschiedenen Länder, in denen die Tochteruntemehmen ihren Sitz haben, sowie der verfügbaren EDV-Systeme etc. ab l5 . Ebenso muß im Einzelfall entschieden werden, ob die Handelsbilanzen 11 in der Praxis mit Hilfe von Ergänzungsrechnungen aus den Einzelbilanzen I abgeleitet werden oder ob bei jedem Konzernunternehmen eine parallele Buchführung 11 geführt werden sollte 16. Für den Fall, daß die Handelsbilanz 11 vor Ort erstellt wird, hat sich als sinnvoll und praktisch erwiesen, die konzerneinheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in einem mehrsprachigen "Accounting Manual" niederzulegen und die Tochteruntemehmen sowie ihre Prüfer dazu zu veranlassen, die jeweilige Handelsbilanz 11 auf der Grundlage dieses Accounting Manual aufzustellen und zu prüfen 17 . Dies setzt allerdings voraus, daß die Tochterunternehmen ihren Vorlageund Auskunftspflichten gemäß § 294 Abs. 3 HGB nachkommen. § 294 12
187.
Vgl. WP-Handbuch 1996, S. 905, Rn 271 ff.; Haverrnann, FS Döllerer, S. 185,
13 Vgl. WP-Handbuch 1996, S. 906, Rn 276; Ferk, Abschlußprüfung von ausländischen Tochtergesellschaften deutscher Konzerne, DB 1993, S. 337; Förschle, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 300 HGB, Rn 32; Haverrnann, FS Döllerer, S. 185, 188. 14 Vgl. Haverrnann, FS Döllerer, S. 185,201 f.; Ferk, lahresabschluß und Prüfung von ausländischen Tochtergesellschaften, S. 24. 15 Vgl. Arbeitskreis "WeItabschlüsse" der Schmalenbach Gesellschaft, - DGffi, ZfbF-Sonderheft 9/1979, S. 24ff.; v. Wysocki/Wohlgemuth, 4. Auflage, S. 9. 16 Vgl. Haverrnann, FS Döllerer, S. 185, 195 f. 17 Vgl. v. Wysocki/Wohlgemuth, Konzernrechnungslegung, 4. Auflage, S. 9f.
86
Kap. C: Neubewertungspflicht
Abs. 3 HGB findet aber nur auf inländische Konzernunternehmen Anwendung (denn er hat grundsätzlich keinen Anspruch auf extraterritoriale Wirkung). Seine Geltung auf ausländische Tochterunternehmen ist aber cum grano alis zu sehen; denn es sind völkerrechtliche und kollisionsrechtliche Grundsätze zu beachten l8 . Deshalb ist der Umfang von § 294 Abs. 3 HGB vor allem bei Tochtergesellschaften mit Sitz außerhalb der Europäischen Union an die ausländischen Verhältnisse anzupassen 19. 11. Freiwillige Neubewertung beim Mutterunternehmen Das Mutterunternehmen braucht in der Regel keine Handelsbilanz 11; denn es sind seine Bewertungsregeln, die im Konzernabschluß angewendet werden. In den Fällen, in denen zwingende Bewertungsregeln vorgeschrieben sind, werden die Wertansätze aus seinem lahresabschluß unverändert in den Konzernabschluß übernommen. Anders kann es aber bei den Bewertungswahlrechten sein; denn hier hat das Mutterunternehmen das Recht, die Bewertungswahlrechte für die Wertansätze aus dem eigenen lahresabschluß erneut auszuüben; die Bewertungswahlrechte leben wieder auf, auch für das Mutterunternehmen (§ 308 Abs. I Satz 2 HGB)20. Hierbei kann das Mutterunternehmen frei entscheiden, ob es für den Konzernabschluß die gleichen Bewertungswahlrechte beibehalten oder aber andere anwenden will; ein Ausnahmetatbestand wird nicht vorausgesetzt 21 . Allerdings unterliegt auch diese Möglichkeit für die Folgejahre dem Stetigkeitsgrundsatz (§ 252 Abs. I Nr. 6 i. V. m. § 298 Abs. I HGB), so daß einer bilanzpolitischen Willkür Grenzen gesetzt sind. Das Gesetz geht jedoch offenbar davon aus, daß die Bewertungsobjekte des Mutterunternehmens auch im Konzernabschluß in der Regel nach den gleichen Bewertungsmethoden bewertet werden müssen, die das Mutter18 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 291, Rn 723; ders., Management and Control of Marketable Share Companies, in: International Encyclopedia of Comparative Law, Tübingen/Paris 1972, Volume XIII, Chapter 4, S. 100ff.; ders. Multinationale Unternehmen und nationale Souveränität, JuS 1978, S. 73 ff.; ders., Internationales Gesellschaftsrecht, in Staudinger EGBGB/IPR, 13. Bearbeitung, 1993, Rn 512ff.; ders., Transnationale Unternehmensverfassung?, in ZGR 1987, S. 505 (515ff.); ders., Internationales und Europäisches Unternehmensrecht, 2. Auflage, 1995, S. 261 f.; ders., in: Heimrich, Bilanzrichtlinien-Gesetz, München 1986, S. 192f. 19 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 293, Rn 728. 20 Vgl. IDW, HFA 3/1988, WPg 1988, S. 483. 21 Vgl. AlD/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 29; Biener/Berneke, Bilanzrichtlinien-Gesetz, S. 360.
11. Freiwillige Neubewertung beim Mutterunternehmen
87
unternehmen in seinem Jahresabschluß angewendet hat22 . Zu diesem Schluß führt der Weg der historischen Auslegung 23 : Erstens ging die Kommission ursprünglich von einem Modell aus, in dem die Einheitlichkeit der Bewertung schon auf der Ebene der Einzelabschlüsse der Konzernunternehmen durchzuführen wäre. Dies hing mit ihrer Befürchtung zusammen, daß die Unternehmen die Neubewertung mißbrauchen würden, um niedrige Wertansätze in den zahlungsbemessungsorientierten Jahresabschlüssen auszuweisen und großzügig im für die Dividendenausschüttung und die Steuerbemessung irrelevanten Konzernabschluß zu bewerten, mit der Folge, daß die Seriosität des Konzernabschlusses abnehmen würde 24 . Diese strenge These wurde mit Rücksicht auf außereuropäische Konzernunternehmen, die eventuell in ihren Jahresabschlüssen von den Richtlinien abweichendes Recht anzuwenden haben, bei der Verabschiedung der Richtlinie aufgegeben. Es gibt aber wenige Gründe, diese Möglichkeit auch den ohnehin innerhalb des Geltungsbereichs der 4. Richtlinie ansässigen Mutterunternehmen uneingeschränkt zugute kommen zu lassen. Zweitens spricht dafür der Umsetzungsprozeß in Deutschland: So heißt es im Vorschlag zu einem Regierungsentwurf zum Bilanzrichtlinie-Gesetz vom November 198425 in § 289 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2: "eine Abweichung von den auf den lahresabschluß des Mutterunternehmens angewandten Bewertungsmethoden ist im Konzernanhang anzugeben und zu begründen". Daher verlangt § 308 Abs. I Satz 3 HGB Angaben und eine Begründung im Konzernanhang für den Fall, daß im Konzernabschluß von der Wahlrechtsausübung im Jahresabschluß des Mutterunternehmens abgewichen wird 26 . Diese Ansicht wird aber auch aus rechtsvergleichender Sicht bestätigt: Im US-amerikanischen Konzernabschluß ist die Neubewertung der Wertansätze aus dem Jahresabschluß des Mutterunternehmens nicht erlaubt 27 • 22 Vgl. IDW, HFA, 3/1988, WPg 1988, S. 483; AID/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 29; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 142f.; ScheITer, in BoHR, § 308 HGB, Rn 18; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 28. 23 Zum Wesen der historischen Auslegung siehe Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft/Studienausgabe, 2. Auflage Berlin 1991, S. 216ff.; zu ihrer Bedeutung im Bilanzrecht Großfeld, Generalnorrn, S. 192, 193. 24 Vgl. Commission of the European Communities, "Explanatory Memorandum to the 1976 Proposal for a Seventh Directive conserning group accounts", Bulletin EC, Suppl. 9176, S. 29. 25 Vgl. BMJ 3507/10 - 30946/84 (unveröffentlichter Entwurf). 26 A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 29; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 143; BaumbachlDuden/Hopt, 29. Auflage, München 1995, § 308 HGB, S. 788f., Tz. lc; Maas/Schruff, WPg 1986, S. 237, 238. 27 Vgl. Kubin, Konrad W., The United States and the Seventh Directive, in: International Group Accounting, Sidney J. Gray and Adolf G. Coenenberg (Hrsg.),
88
Kap. C: Neubewertungspflicht
Insofern kann der Ansicht von Lederle 28 nicht gefolgt werden, wenn er meint, daß die Begründungspflicht im Anhang gemäß § 308 Abs. 1 Satz 3 HGB den Fall betrifft, daß die einzelnen Konzernunternehmen in ihren Handelsbilanzen 11 die Bewertungswahlrechte unterschiedlich ausnutzen; diese Ansicht interpretiert § 308 Abs. 1 Satz 3 HGB falsch und übersieht, daß die Ausübung der Bewertungswahlrechte im Konzernabschluß einheitlich sein muß. Eine differenzierte Bewertung ist nur dann erlaubt, wenn den einzelnen Sachverhalten unterschiedliche bewertungsrelevante Umfeldbedingungen zugrundeliegen oder gesetzliche Ausnahmen (§ 308 Abs. 2 Satz 2 - 4, Abs. 3 HGB) eine differenzierte Wahlrechtsausübung gebieten oder rechtfertigen 29 • Problematisch ist dagegen der Fall, in dem an der Spitze des Konzerns eine Holding-Gesellschaft steht. Hierbei gibt es für viele Bilanzposten keine entsprechende Bewertungseinheit des Mutterunternehmens. Nach herrschender Meinung werden die Berichtspflichten nur begründet, wenn im Konzernabschluß Vermögens gegenstände oder Schulden des Mutterunternehmens anders als in seinem Einzelabschluß bewertet werden, nicht dagegen, wenn die Abweichung Vermögensgegenstände und Schulden der Tochterunternehmen betrifft3o . Die in § 308 Abs. 1 Satz 3 HGB für den Fall der Abweichung geforderten Angaben müssen die Posten, die im Konzernabschluß nach anderen Methoden bewertet worden sind, als im Jahresabschluß des Mutterunternehmens, sowie die im Konzernabschluß angewandte Bewertungsmethode nennen 3 !. Angaben über zahlenmäßige Auswirkungen auf das Konzernergebnis werden aber nicht verlangt 32 . Die Abweichungen sind neben der Nennung auch zu begründen. Dabei sind Gesichtspunkte anzuführen, die für die Bewertung mit Bewertungsmethoden, die von den auf den JahresabCroom Helm, London usw. 1988, S. 172; Baker/Rapaccioli/Solomon, United States of Amerika. Oroup Accounts, in: Ordelheide/KPMO (Hrsg.), Transnational Accounting, S. 3097, 3123. 28 Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 107. 29 Vgl. dazu Kapitel Bund D dieser Arbeit. 30 A/DIS, 6. Auflage, § 308 HOB, Rn 29; Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 108; Pohle, in Küting/Weber, HdR, § 308 HOB, Rn 30; Schnicke I Kilgert, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 308 HOB, Rn 16. 31 A/DIS, 6. Auflage, § 308 HOB, Rn 30; Schnicke/Kilgert, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 308 HOB, Rn 15; a.A. Scherrer, in BoHR, § 308 HOB, Rn 18: Es besteht keine Verpflichtung, die Bewertungsmethoden im einzelnen zu beschreiben - die Angaben im Konzernanhang können sich insoweit auf die Feststellung beschränken, daß sich die im Konzernabschluß angewandten Bewertungsmethoden von den auf den Jahresabschluß des Mutterunternehmens angewandten Methoden unterscheiden. 32 ScheITer, in BoHR, § 308 HOB, Rn 18; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HOB, Rn 31.
III. Abweichungen von den Bewertungsmethoden des Konzerns
89
schluß des Mutterunternehmens angewandten Bewertungsmethoden abweichen, entscheidend waren 33 . Denn es ist wichtig für den Bilanzleser zu wissen, welche Motive die Konzernleitung dazu bewegt haben, im Konzernabschluß von den Bewertungsmethoden abzuweichen, die im Einzelabschluß des Mutterunternehmens angewendet wurden 34 . III. Neubewertungspflicht bei Abweichungen von den Bewertungsmethoden des Konzerns 1. Pflicht zur Neubewertung - Inhalt und Ausmaß
Der in § 308 Abs. 1 Satz 1 HGB normierte Grundsatz der einheitlichen Bewertung wird durch die in Abs. 2 Satz I vorgesehene Neubewertungspflicht klar- und sichergestellt35 . Hierbei muß zwischen Wertansätzen unterschieden werden, die aufgrund einer zwingenden Bewertungsregel ergangen sind, und solchen, die auf die Anwendung von Wahlrechten beruhen. Bei den zwingenden Bewertungsregeln ("Methoden ... , die ... anzuwenden sind" nach der Terminologie des Gesetzes) handelt es sich um Methoden, bei denen ein Ermessensspielraum bezüglich der Bewertung nicht besteht, um Anpassungen an die gesetzlich vorgeschriebenen Bewertungsmaßstäbe36 • Neubewertungen in bezug auf zwingende Bewertungsregeln ergeben sich entweder aus der unterschiedlichen Rechtsform der Konzernunternehmen oder aufgrund abweichender ausländischen Bewertungsmethoden37 • Neben den Anpassungen an die vorgeschriebenen Bewertungsmaßstäbe ergeben sich Neubewertungen aber auch, wenn im Konzernabschluß Bewertungswahlrechte abweichend von den Einzelabschlüssen der einbezogenen Unternehmen ausgeübt werden sollen. Denn das Ziel der einheitlichen Bewertung ist die Vergleichbarkeit der Wertansätze im Konzernabschluß. Dafür müssen nicht nur Bewertungsunterschiede rückgängig gemacht werden, die auf unterschiedlichen nationalen Vorschriften oder unterschiedlichen Rechtsformen der einbezogenen Unternehmen beruhen, sondern auch Unterschiede bei der Wahlrechtsausübung, die auf die eigene Bilanzpolitik jedes Konzernunternehmens zurückzuführen sind38 . Denn die Bewertung im ScheITer, in BoHR, § 308 HOB, Rn 19. Vgl. Schnicke/Kilgert, Beck'scher BK, 3. Auflage, § 308 HOB, Rn 17. 35 Vgl. Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HOB, Rn 32; ScheITer, in BoHR, § 308 HOB, Rn 20. 36 ScheITer, in BoHR § 308 HOB, Rn 23; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HOB, Rn 33. 37 Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HOB, Rn 33. 38 Vgl. Ehrt, Die Einheitlichkeit der Bewertung im Konzern - Theorie und Konsolidierungswirklichkeit, in Küting/Weber, Das Rechnungswesen im Konzern, 1995, S. 153, 155 f. 33
34
90
Kap. C: Neubewertungspflicht
Konzernabschluß hat so zu erfolgen, als ob der Konzern insgesamt ein einziges Unternehmen wäre (§ 297 Abs. 3 Satz I HGB)39. Hierbei scheint aber der Gesetzeswortlaut problematisch: Wenn § 308 Abs. 2 Satz I HGB vorsieht, daß immer neuzubewerten ist, wenn die Bewertungsmethoden im lahresabschluß des einbezogenen Tochterunternehmens " ... sich von denen unterscheiden, die auf den Konzernabschluß ... von den gesetzlichen Vertretern des Mutterunternehmens in Ausübung von Bewertungswahlrechten auf den Konzernabschluß angewendet werden .. .", dann scheint in allen Fällen, in denen ein Wahlrecht besteht, seine übereinstimmende und nicht bloß einheitliche Ausübung für den ganzen Konzernabschluß erforderlich zu sein 4o . Die Ausübung der Bewertungswahlrechte im Konzernabschluß muß einheitlich nicht aber schematisch sein 41 . Vielmehr müssen die Bewertungsobjekte vergleichbar sein und in einem ähnlichen Nutzungs- oder Funktionszusammenhang stehen, damit sie nach einheitlichen Maßstäben bewertet werden können42 . Dies wird auch durch die Gesetzesmaterialien bestätigt, indem festgestellt wird, daß " ... Bewertungswahlrechte nebeneinander nur ausgeübt werden können, soweit diese Möglichkeit auch für den lahresabschluß einer einzelnen Kapitalgesellschaft besteht" 43 . In einem internationalen Konzern weichen aber die wertbestimmenden Bedingungen bei art- und funktionsgleichen Bewertungsobjekten eher voneinander ab als in einem inländischen Einzelunternehmen44 . Trotzdem spricht der Gesetzeswortlaut in § 308 Abs. 2 Satz I HGB für eine schematische Wahlrechtsausübung. Deshalb ist eine teleologische Reduktion bei der Auslegung der Vorschrift erforderlich45 . Diese Reduktion läßt sich aber nur mit Blick auf die Generalnorm (§ 297 Abs. 2 Satz 2 HGB) herbeiführen. Hierbei handelt es sich also gerade um jenen Fall, in dem das Allgemeine (§ 297 Abs. 2 Satz 2 HGB) als Maßstab und Koordinator auf das Besondere (hier § 308 Abs. 2 Satz 1 HGB) hineinwirkt und seine Bedeutung präzisiert46 . Vgl. IDW, HFA 3/1988, WPg 1988, S. 483. So etwa ScheITer, in BoHR, § 308 HGB, Rn 24. 41 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 235, Rn 573. 42 Vgl. Großfeld, ebenda. 43 Bericht der Abgeordneten Heimrich, Kleinert (Hannover) und Stiegler, BTDrucks. 10/4268, S. 116. 44 Vgl. Großfeld, Internationales und Europäisches Unternehmensrecht, 2. Auflage, 1995, S. 108ff.; ders., Kernfragen der Rechtsvergleichung, 1996, S. 261 ff.; ders., Einige Grundfragen des internationalen Unternehmensrechts, 1987, S. 22f.; A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 15. 45 Vgl. dazu Engisch, Einführung in das juristische Denken, 8. Auflage, S. 100ff.; Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft - Studienausgabe, 2. Auflage, S. 221 ff. 39
40
III. Abweichungen von den Bewertungsmethoden des Konzerns
91
2. Neubewertung bei inländischen Tochterunternehmen
Die Neubewertungspflicht erstreckt sich nicht nur auf ausländische, sondern auch auf inländische Konzernunternehmen. Bei den letzteren handelt es sich vorwiegend um Neubewertungen, die sich aus der unterschiedlichen Rechtsform der einbezogenen Unternehmen ergeben oder die auf die unterschiedliche Ausnutzung von Bewertungswahlrechten in ihren Jahresabschlüssen zurückzuführen sind. Wenn das Mutterunternehmen eine Kapitalgesellschaft ist, sind bei Vermögensgegenständen einbezogener Einzelunternehmen und Personenhandelsgesellschaften grundsätzlich folgende Neubewertungen vorzunehmen 47 : Rücknahme von Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gemäß § 253 Abs. 4 HGB (vgl. § 279 Abs. 1 Satz 1 HGB);
1.
2. Rücknahme von außerplanmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bei voraussichtlich nur vorübergehender Wertminderung gemäß § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB (vgl. auch § 279 Abs. 1 Satz 2 HGB); 3. Nachholung einer nach § 253 Abs. 5 HGB unterlassenen Zu schreibung bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (vgl. § 280 Abs. 1 HGB). Ferner sind die §§ 279 Abs. 2, 281 und 282 HGB anzuwenden. Allerdings dürfte ihre Bedeutung für die Neubewertungspflicht sehr gering sein48 : § 279 Abs. 2 hat in aller Regel keine praktische Bedeutung, da für alle nach § 254 HGB vorgenommenen Abschreibungen grundSätzlich die umgekehrte Maßgeblichkeit gilt. § 281 ist keine Bewertungsvorschrift im engeren Sinne, da er lediglich den Ausweis nur nach Steuerrecht zulässiger Wertansätze und zusätzliche Angaben im Anhang regelt. Schließlich ist § 282 zu beachten, wenn Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 300 Abs. 2 i. V. m. § 269 aktiviert werden sollen, d. h. auch aus dieser Vorschrift ergeben sich keine Neubewertungen. Ist das Mutterunternehmen ein Einzelkaufmann oder eine Personenhandelsgesellschaft und ist ein Konzernabschluß nach dem Publizitäts-Gesetz aufzustellen, dann sind im Vergleich zu den für alle Kaufleute geltenden Bewertungsvorschriften gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 PublG zusätzlich ledigVgl. Großfeld, Generalnonn, S. 192, 202. Vgl. ScheITer, in BoHR, § 308 HGB, Rn 23; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 34; Küting/Weber/Zündorf, Praxis der Konzernbilanzanalyse, Stuttgart 1990, S. 56 f. 48 Vgl. Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 35. 46 47
92
Kap. C: Neubewertungspflicht
lich die zuletzt genannten §§ 279 Abs. 2, 281 und 282 anzuwenden, während § 279 Abs. 1 und § 280 nicht angewendet zu werden brauchen. Damit bleiben alle Bewertungserleichterungen, die für alle Kaufleute gelten, erhalten 49 . Die strengeren Anforderungen beschränken sich im wesentlichen auf die Berichtspflicht gemäß § 281 Abs. 2, d. h. es sind keine Bewertungsanpassungen notwendig 5o . Bewertungsanpassungen können jedoch auch bei einem nach dem PublG aufgestellten Konzernabschluß vorzunehmen sein, wenn der Konzern nach seinen Grundsätzen außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen auch bei voraussichtlich nicht dauernder Wertminderung vornimmt (§ 253 Abs. 2 Satz 3) oder einen niedrigen Wertansatz, aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen beibehält, auch wenn die Gründe dafür nicht mehr vorliegen (§ 253 Abs. 5), oder im Konzernabschluß Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorgenommen werden (§ 253 Abs. 4 HGB)51. Sollten in einen solchen Konzernabschluß auch Kapitalgesellschaften einzubeziehen sein, dann ergeben sich wesentliche Bewertungsanpassungen, die insgesamt die Legung von stillen Rücklagen im Konzernabschluß auch bei den einbezogenen Kapitalgesellschaften ermöglichen. Dadurch aber wird der Informationswert eines nach dem PublG aufgestellten Konzernabschlusses noch geringer als er noch unter der Geltung des Maßgeblichkeitsgrundsatzes (§ 331 AktG a.F.) war52 . In der Praxis wird diese Gefahr aber dadurch begrenzt, daß, wenn die einbezogenen Kapitalgesellschaften eigene Teilkonzernabschlüsse aufstellen müssen, diese letzteren nur dann befreiende Wirkung nach § 291 HGB entfalten, sofern im publizitätspflichtigen Konzernabschluß die in § 13 Abs. 3 Satz 1 PublG vorgesehenen Erleichterungen nicht in Anspruch genommen worden sind53 . 3. Neubewertung bei ausländischen Tochterunternehmen
Von besonderer Bedeutung ist die Neubewertungspflicht für ausländische Tochterunternehmen54 . Zwar haben die 4. und 7. EG-Richtlinien die Rechnungslegungsregeln in der EU weitgehend angenähert, jedoch bleiben aufVgl. Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 36. Vgl. Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 36. 51 Vgl. Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 39. 52 Vgl. Busse v. Colbe, Stellungnahme zu § 308 HGB bei der Sachverständigenanhörung vor dem Unterausschuß-Bilanzrichtlinien-Gesetz, in: Helmrich (Hrsg.), BiRiLiG, S. 231; Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 102. 53 Vgl. Biener, Stellungnahme zu § 308 HGB bei der Sachverständigenanhörung vor dem Unterausschuß-Bilanzrichtlinien-Gesetz, in: Heimrich (Hrsg.), BiRiLiG, S.232. 49
50
III. Abweichungen von den Bewertungsmethoden des Konzerns
93
grund der unterschiedlichen Umsetzung der sogenannten nationalen Wahlrechte auch bei Gesellschaften mit Sitz in der Europäischen Union erhebliche Unterschiede bei den Bewertungsmethoden erhalten. So dürfen etwa in den Niederlanden höhere Wiederbeschaffungskosten angesetzt werden (Art. 33 der 4. EG-Richtlinie)55 und in Frankreich ist eine Aufwertung des Sachanlagevermögens über die historischen Anschaffungskosten hinaus sogar zwingend vorgeschrieben 56 . Ebenso zulässig ist in Großbritannien der Ansatz zu Tageswerten nach SSAP 16 "Current Cost Accounting,,57. In viel höherem Maße können allerdings Jahresabschlüsse ausländischer Tochterunternehmen mit Sitz außerhalb der EU Verstöße gegen deutsche Bewertungsregeln enthalten58 . Bewertungsanpassungen können in diesem Fall schon deshalb erforderlich sein, weil die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des § 252 Abs. 1 HGB nicht in allen Ländern in gleicher Weise gelten 59 . So wird nach HGB das Vorsichtsprinzip an den Grundsätzen des Gläubigerschutzes und der Kapitalerhaltung ausgerichtet. Seine Ausprägung ist das Imparitätsprinzip, das die Buchung unrealisierter Erträge verbietet (Realisationsprinzip), aber die sofortige Buchung von negativen Erfolgsbeiträgen bereits im Erkenntniszeitpunkt vorschreibt. Dagegen wird das Vorsichtsprinzip z. B. in den angelsächsischen Ländern nicht mit derselben Strenge gehandhabt wie in der Bundesrepublik6o . Auch der Grundsatz der Einzelbewertung hat nicht überall dieselbe strenge Ausprägung wie in Deutschland. Das gleiche gilt für den Stetigkeitsgrundsatz. Andererseits wird das going-concern-Prinzip strenger angewandt als in der Bundesrepublik61 . Anwendung und Nichtanwendung des going-concern-Prinzips haben allerdings einen großen Einfluß auf die Bestimmung der Wertansätze und können eine völlige Neubewertung der meisten Vermögensgegenstände erforderlich machen 62 . 54 A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 32; Meinho1d-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 73; Schü1en, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung, S. 123, 138. 55 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 32; WP-Handbuch 1996, S. 897, Rn 243; Poh1e, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 37. 56 Vgl. GebhardtlBergmann, Internationale Konzernabschlüsse, S. 36, Rn 94. 57 Meinho1d-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 73. 58 Vgl. WP-Handbuch 1996, S. 897, Rn 242. 59 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 145. 60 Vgl. Stellungnahme des Arbeitskreises "Rechnungslegungsvorschriften der EGKommission" der Gesellschaft für Finazwirtschaft in der Unternehmensführung e. V. (GEFlU), DB 1995, S. 1137ff., insbesondere 1140ff.; Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 125; Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung, S. 123, 139. 61 Vgl. Großfeld, Internationales und Europäisches Unternehmensrecht, 2. Auflage, 1995, S. 115 f. 62 Vgl. Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung, S. 123, 139.
94
Kap. C: Neubewertungspflicht
Darüber hinaus wird der Grundsatz der Periodenabgrenzung in verschiedenen Ländern weniger strikt angewandt als in Deutschland63 . In vielen Ländern werden die Aufwendungen aufgrund steuerlicher Vorteile nach Landesrecht erst im Zeitpunkt der Zahlung erfaßt. Daraus ergeben sich häufig Neubewertungen für den Konzernabschluß 64 . Bewertungsvereinfachungsverfahren sind in gewissen Ländern verbreiteter als in Deutschland. Bei der in den USA üblichen Lifo-Bewertung nach der sogenannten Dollar-Value-Method werden die Vorräte zu Preisen eines Basisjahrs bewertet, ohne daß es auf die Gleichartigkeit der Vermögensgegenstände ankommt. Eine solche Vorgehensweise ist kein nach deutschem Recht zulässiges Vereinfachungsverfahren zur Bestimmung der Herstellungs- oder Anschaffungskosten 65 . Ebenso unzulässig ist die in den USA unter bestimmten Umständen praktizierte Miteinbeziehung von Zinsen als Pflichtbestandteil der Herstellungskosten66 . Große Probleme dürften sich auch bei der Einbeziehung von Jahresabschlüssen von Unternehmen in Hochinflationsländern ergeben67 . Dort schreiben die nationalen Gesetze häufig vor, daß das Anlagevermögen laufend entsprechend der Inflationsrate oder einem vom Staat festgelegten Index aufgewertet wird 68 . Ob hier die Übernahme der in diesen Ländern vorgeschriebenen Indexwerte, verbunden mit dem Stichtagswährungskurs, oder der historische umgerechnete DM-Wert, gegebenenfalls vermindert um Abschreibungen, der geeignete Wertansatz ist, muß im Einzelfall entschieden werden69 . Auf jeden Fall stellt die Bewertung kurzfristiger Fremdwährungsforderungen im Jahresabschluß des Tochterunternehmens mit dem Kurs am Bilanzstichtag keine geeignete Basis für die Übernahme in den Konzernabschluß dar, wenn dieser höher ist als der Kurs bei Entstehen der Forderung, da ein solcher Ausweis unrealisierter Gewinne gegen das Imparitäts- und Anschaffungswertprinzip verstößt70 • Verbindlichkeiten sind nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB zu ihrem Rückzahlungsbetrag, Rentenverpflichtungen, für die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert, und Rückstellungen nur in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung Vgl. Schülen, ebenda. Vgl. Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 126. 65 Vgl. Baetge, Konzembilanzen, 2. Auflage, S. 145; Pohle, in Küting/Weber, HdKR § 308 HGB, Rn 37. 66 Vgl. Baetge, Konzembilanzen, 2. Auflage, S. 145. 67 Vgl. Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung, S. 123, 138; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 37. 68 Vgl. Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 129. 69 Vgl. Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung, S. 123, 138. 70 Vgl. Pohle, in Küting/Weber, HdKR § 308 HGB, Rn 37. 63
64
III. Abweichungen von den Bewertungsmethoden des Konzerns
95
notwendig ist. Auch von diesen Prinzipien weichen Abschlüsse ausländischer Konzernunternehmen häufig ab, so daß vor der Übernahme solcher Wertansätze in den Konzernabschluß ihre Anpassung oft notwendig ist71. Darüber hinaus lassen landesrechtliche Vorschriften beim Umlaufvermögen (§ 253 Abs. 3 HGB) oft teilweise die Bilanzierung zu höheren Marktwerten zu. Auch hier ist die Anpassung der Wertansätze notwendig 72 • Bewertungsanpassungen bei den Wertansätzen einbezogener ausländischen Tochterunternehmen sind notwendig auch dann, wenn in dem Jahresabschluß eines ausländischen Konzernunternehmens Beteiligungen nach der Equity Methode oder einer anderen Methode, die mit dem Anschaffungspreisprinzip unvereinbar ist, bewertet sind73 . Dies läßt sich damit begründen, daß für die Kapitalkonsolidierung nach der Buchwertmethode das anteilige konsolidierungspflichtige Eigenkapital nach einheitlichen Maßstäben ermittelt werden muß, während die Anwendung der Equity-Methode das Eigenkapital des beteiligten Unternehmens beeinflußt74 •
Vgl. Schnicke/Kilgert, Beck'scher BK, 3. Auflage, § 308 HGB, Rn 130. Vgl. Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn BI. 73 Vgl. Pohle, in Küting/Weber, HdKR § 308 HGB, Rn 37; WP-Handbuch 1996, S. 897, Rn. 243. Der deutsche Gesetzgeber hat die in Art. 59 der 4. EG-Richtlinie vorgesehene Equity-Methode für den Einzelabschluß nicht zugelassen. 74 Vgl. WP-Handbuch 1996, S. 897, Rn 243. 71
72
Kapitel D
Einschränkungstatbestände I. Abweichende Bewertung bei der Einbeziehung von Banken und Versicherungsunternehmen 1. Sachliche Differenzierungen bei der Rechnungslegung von Banken und Versicherungsunternehmen
Die besonderen Bewertungsvorschriften für Kreditinstitute (§§ 340e - g HGB) und für Versicherungsunternehmen (§§ 341 b - h HGB) gestatten mit Blick auf die besonderen Risiken der beiden Geschäftszweige diesen Unternehmen (niedrigere) Wertansätze, die nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Bewertungsvorschriften des HGB (gesetzlich vorgeschriebene Wertuntergrenzen l ) nicht zulässig sind 2 . Dementsprechend dürfen Unternehmen, die im Bereich der Kredit- oder der Versicherungswirtschaft tätig sind, nicht in einem einzigen Konzernabschluß mit einem Unternehmen aus dem industriellen Bereich zusammengefaßt werden, weil diese Vermischung die Aussagekraft hinsichtlich der konzerntypischen Tätigkeit beeinträchtigen würde 3 . Mit Blick darauf stellen die Vorschriften der 7. EG-Richtlinie und des HGB primär auf Konzerne ab, deren Tätigkeit dem industriellen Bereich gilt4 . Banken und Versicherungs unternehmen wurden seinerzeit von der 7. EG-Richtlinie und dem Bilanzrichtlinien-Gesetz mit dem Hinweis auf ihre spätere gesonderte Regelung ausgeklammert5 . Diese Regelung ist I Vgl. dazu Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 61, Rn 146; A/DIS, 6. Auflage, § 253 HGB, Rn 12. 2 Vgl. A/DIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 41. 3 Vgl. BT-Drucks. 10/4268, S. 114 (zu § 295 HGB); Ausschuß für Bilanzierung
des Bundesverbandes deutscher Banken, Bankkonzernbilanzierung nach neuem Recht, WPg 1994, S. 11, 12ff. (These 2); Biener, DB 1983, Beilage 19, S. 1,4; Angermayer lOser, Die Rechnungslegung im Versicherungskonzern, WPg 1996, S.457. 4 Vgl. BT-Drucks. 10/4268, S. 114 (zu § 295 HGB); Präambel der Richtlinie des Rates 86/635/EWG, Gedankenstrich 16; Biener, DB 1983, Beilage 7, S. 1,4. 5 Vgl. Art. 40 Abs. 1 der 7. EG-Richtlinie; BT-Drucks. 10/4268, S. 114 (zu § 295 HGB).
1. Abweichende Bewertung bei Banken und Versicherungs unternehmen
97
inzwischen durch die sogenannten EG-Bankbilanzrichtlinie6 und EG-Versicherungsbilanzrichtlinie 7 erfolgt. Beide Richtlinien sind inzwischen auch ins deutsche nationale Recht umgesetzt worden 8 . Somit besteht die Rechnungslegung von Banken und Versicherungsunternehmen nunmehr aus den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB (soweit sie den Besonderheiten des Geschäftszweigs entsprechend auf Kreditinstitute oder Versicherungsunternehmen angewendet werden können - §§ 340a Abs. 1 und 2, 341 a Abs. 1 und 2 HGB) sowie aus den besonderen Vorschriften der Paragraphen 340ff. HGB (Ergänzende Vorschriften für Kreditinstitute) und 341 ff. HGB (Ergänzende Vorschriften für Versicherungsunternehmen) und etwaige besondere Bestimmungen in anderen Gesetzen. Daraus ergibt sich, daß es zur Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den allgemeinen Konzernrechnungslegungsvorschriften des HGB (§§ 290ff.) oder aber eines Bankkonzernabschlusses (§§ 340i f. HGB) oder eines Versicherungsunternehmenskonzernabschlusses (§§ 341 i f. HGB) kommen kann. Für den ersten Fall erlaubt § 308 Abs. 2 Satz 2 HGB für die Einbeziehung von Jahresabschlüssen von Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen (sollte eine solche Einbeziehung überhaupt erlaubt sein § 295 HGB) die unveränderte Übernahme ihrer Wertansätze9 . 2. Übernahme von Wertansätzen der Banken
Grundsätzlich haben Kreditinstitute die für Kapitalgesellschaften vorgeschriebenen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 und 279 - 283 HGB (bis auf § 279 Abs. 1 Satz 2 HGB) anzuwenden 10. Allerdings besitzen sie 6 Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. 12. 1986 (ABI. EG Nr. L 372 vom 31.12.1986, S. 1 ff.). 7 Richtlinie 911674/EWG des Rates vom 19.12.1991 (ABI. EG Nr. L 374 vom 31.12.1991, S. 7ff.). 8 VgI. "Gesetz zur Durchführung der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften über den lahresabschluß und den konsolidierten Abschluß von Banken und anderen Finanzinstituten (Bankbilanzrichtlinie-Gesetz)", vom 30.11.1990, BGBI. 1 1990, S. 2570ff. (mit Geltung für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.1992 beginnen - Art. 30 Abs. 1 EGHGB) und "Gesetz zur Durchführung der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften über den lahresabschluß und den konsolidierten Abschluß von Versicherungsunternehmen (Versicherungsbilanzrichtlinie-Gesetz)", vom 24.6. 1994, BGBI. 1 1994, S. 1377 ff. (mit Geltung für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.1994 beginnen - Art. 32 Abs. 1 Satz 1 EGHGB). 9 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 41; ScheITer, in BoHR, § 308 HGB, Rn 25; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 41. 10 Vgl. § 340a Abs. 2 Satz 1 HGB; a.A. Hossfeld, Die Kompensationsmöglichkeiten in der Gewinn- und Verlustrechnung von Kreditinstituten nach der Transformation der EG-Bankbilanzrichtlinie, WPg 1993, S. 337, der die für alle Kaufleute geltenden Bewertungsregeln (§§ 252 - 256 HGB) auf die Kreditinstitute angewendet wissen will. 7 Xenides
98
Kap. D: Einschränkungstatbestände
zusätzlich die Möglichkeit, bankenspezifische stille Rücklagen zu bilden. Schon nach alter Rechtslage durften Kreditinstitute über § 26a KWG a. F. stille Rücklagen gegen die besonderen Risiken des Kreditgewerbes bilden und Wertpapiere und Kreditforderungen mit einem niedrigeren als dem handeisrechtlich zulässigen Wert ansetzen 11. Im gleichen Sinne ermächtigt § 340f Abs. I Satz I HGB die Kreditinstitute, Wertpapiere, die weder dem Anlagevermögen noch dem Handelsbestand angehören (Liquiditätsreserve I2 ), und Forderungen an Kreditinstitute und Kunden mit einem niedrigeren als nach dem nach § 253 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 vorgeschriebenen oder zugelassenen Wert anzusetzen "soweit dies nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Sicherung gegen die besonderen Risiken des Geschäftszweigs der Kreditinstitute notwendig ist". Diese zusätzlichen Vorsorgeabschreibungen dürfen nach § 340f Abs. 1 Satz 2 HGB insgesamt den Betrag von 4 % des Gesamtwertansatzes aller Buchforderungen und der Wertpapiere der Liquiditätsvorsorge nicht überschreiten\3. Allerdings wird diese quantitative Begrenzung zumindest für größere Kreditinstitute als keine echte Grenze eingeschätzt l4 . Noch mehr dürfen bis zum 31.12.1994 nach § 26a KWG a.F. gebildete höhere stille Rücklagen nach Art. 31 Abs. 2 Satz 2 EGHGB weiterhin zeitlich und dem Betrage nach unbegrenzt bestehen bleiben 15. Das Wahlrecht, abweichende Wertansätze aus den Einzelabschlüssen von Kreditinstituten in den Konzernabschluß (eines nicht Kreditinstituts-Mutterunternehmens) zu übernehmen, gilt nicht nur für deutsche Kreditinstitute, sondern auch für ausländische Kreditinstitute 16. Voraussetzung dafür ist, daß sie auf Vorschriften beruhen, die den Besonderheiten von Kreditinstituten Rechnung tragen. Beruhen die Abweichungen dagegen auf allgemeingültigen Vorschriften, die auch für Kreditinstitute gelten, dürfen die WertanII Köllhofer, Der Einfluß des Bankbilanzrichtlinie-Gesetzes auf die bilanzpolitischen Spielräume der Banken, FS Moxter, S. 739, 761; vgl. auch AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 38; Scherrer, in BoHR, § 308 HGB, Rn 25; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 42. 12 Zum Problemkreis der Abgrenzung von Wertpapieren des Anlagevermögens, der Liquiditätsreserve und des Handelsbestandes siehe Scharpf I Sohler, Leitfaden zum lahresabschluß nach dem Bankbilanzrichtlinie-Gesetz - Bilanz, GuV und Anhang, Düsseldorf, 1992, S. 75ff. I3 Vgl. Hossfeld, WPg 1993, S. 337, 338. 14 Köllhofer, FS Moxter, S. 739, 762; a.A. WP-Handbuch 1992, Bd. I, S. 721 Rn 246 wonach sich diese Möglichkeit jetzt nur in eingeschränktem Maß besteht; zur Bedeutung dieser zusätzlichen stillen Rücklagen für die Vertrauenssensibilität und der Bonität der Banken und die Notwendigkeit ihrer Übernahme auch ins neue Recht siehe Wegener, Stille Reserven bei Kreditinstituten, WPg 1981, S. 14, 16. 15 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 38. 16 AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 38; Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 116.
I. Abweichende Bewertung bei Banken und Versicherungsunternehmen
99
sätze nicht unverändert in den Konzernabschluß übernommen werden, weil sie insoweit nicht auf die Besonderheiten der Branche zugeschnitten sind 17. Nach Lederle dürfen Wertansätze von ausländischen Kreditinstituten auch dann in den Konzernabschluß nicht übernommen werden, wenn sie den deutschen GoB nicht entsprechen 18. Angesichts des besonderen Charakters der Bankenrechnungslegung und des auf der Bankbilanzrichtlinie beruhenden Vereinheitlichungsbestrebens sollte man aber die Übernahme solcher Wertansätze nicht von ihrer Übereinstimmung mit den GoB, sondern mit der EG-Bankbilanzrichtlinie abhängig machen. Das Problem kann sich aber auch in zwei anderen Formen stellen: Zum einen als Einbeziehung eines Kreditinstituts in einen Konzernabschluß eines Versicherungsunternehmens und zum anderen als Einbeziehung eines Industrie- oder Versicherungsunternehmens in einen Bankkonzernabschluß. Für den Fall der Einbeziehung eines Versicherungsunternehmens in den Bankkonzernabschluß oder der Einbeziehung eines Kreditinstituts in den Konzernabschluß eines Versicherungsunternehmens ergibt sich die Lösung leicht aus dem Gesetzeswortlaut von § 308 Abs. 2 Satz 2: Die Beibehaltung der abweichenden Wertansätze aufgrund der besonderen Vorschriften für Kreditinstitute oder Versicherungsunternehmen gilt nicht nur für den allgemeinen, sondern auch für den Versicherungs unternehmen- und Bankkonzernabschluß l9 . Nach Prahl/Naumann setzt aber die Einbeziehung eines Tochterunternehmens aus dem Bereich Industrie und Handel in den Bankkonzernabschluß die Umbewertung seiner Wertansätze anhand der für Kreditinstitute geltenden Bewertungsvorschriften - also die Legung von stillen Rücklagen in dem für Kreditinstitute erlaubten Masse - voraus, da in diesem Fall das Gesetz keine Ausnahme vorschreibt2o . Dieser Meinung ist nicht zuzustimmen. Die Bewertungsregeln für die Kreditinstitute sind nur Ausnahmeregeln und Ausnahmeregeln dürfen weder extensiv noch analog angewandt werden 21 . Darüber hinaus verbietet eine solche Lösung aber auch die Generalnorm des § 297 Abs. 2 Satz 2 HGB; denn die besonderen Bewertungsregeln für Kreditinstitute stellen eine bewußt vom Gesetzgeber mit Blick auf die Stabilität der Kreditinstitute hingenommene Einschränkung der Aussagefähigkeit ihres Jahresabschlusses. Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 42; Geib/König, WPg 1987, S. 668. Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 116. 19 Vgl. Prahl/Naumann, Bankkonzernrechnungsle~ung nach neuem Recht: Grundsätzliche Konzepte, wichtige Vorschriften zum Ubergang und andere ausgewählte Einzelfragen, WPg 1993, S. 235, 240. 20 Vgl. Prahl/Naumann, WPg 1993, S. 235, 240. 21 Vgl. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft - Studienausgabe, 2. Auflage 1991, S. 243f. 17
18
7'
100
Kap. 0: Einschränkungstatbestände
Aus den gleichen Gründen sowie mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit der Rechnungslegung wird bei der Einbeziehung von Kreditinstituten in einen "allgemeinen" Konzernabschluß das Beibehaltungswahlrecht von § 308 Abs. 2 Satz 2 HGB eingeräumt. Der Wortsinn des Begriffs "beibehalten" spricht aber dagegen, auch bisher nicht betroffene Unternehmen in die Sonderbehandlung einzubeziehen22 . Das Gesetz sieht schließlich für den Fall der unveränderten Übernahme von Wertansätzen, die auf Sondervorschriften für Kreditinstitute beruhen, eine Angabepflicht im Konzernanhang vor (§ 308 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz HGB). Eine darüber hinausgehende Erläuterung der betroffenen Posten sowie eine Begründung sind aber nicht erforderlich23 . 3. Übernahme von Wertansätzen der Versicherungsunternehmen
Vom Gebot der einheitlichen Bewertung werden ferner nach § 308 Abs. 2 Satz 2 auch Wertansätze ausgenommen, die auf der Anwendung von für Versicherungsunternehmen wegen der Besonderheiten des Geschäftszweigs geltenden Vorschriften beruhen. Hiermit sind gemeint die sogenannten versicherungstechnischen Rückstellungen 24 sowie die nach dem strengen Niederstwertprinzip zu bewertenden Wertpapiere (§ 341 b HGB)25. Das HGB enthält - wie auch die Versicherungsbilanzrichtlinie - keine Definition des Begriffs der versicherungstechnischen Rückstellungen. Man versteht aber darunter die Summe aller am Bilanzstichtag bestehenden Leistungsverpflichtungen, die unmittelbar auf der versicherungsspezifischen Risikoübernahme beruhen26 . Die einzelnen versicherungstechnischen Rückstellungen werden in den §§ 341e - h HGB aufgezählt. Nach § 341e Abs. 1 Satz 1 HGB haben Versicherungsunternehmen versicherungstechnische Rückstellungen auch insoweit zu bilden, wie dies nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Kreditgeschäften sicherzustellen (somit entspricht die Vorschrift weitgehend § 56 Abs. 3 VAG a. F. 27 ). Vgl. zu diesem letzten Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 95. AlD/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 43; Pohle, in BoHR, § 308 HGB, Rn 31. 24 Vgl. Geib/Ellenbürger/Kölschbach, Ausgewählte Fragen zur EG-Versicherungsbilanzrichtlinie, WPg 1992, S. 221, 230; Donath, Die EG-VersicherungsbilanzRichtlinie 9l/674/EWG, EuZW 1992, S. 719, 726; Perlet, FS Moxter, Zur Umsetzung der Versicherungsbilanzrichtlinie in deutsches Recht, S. 833, 844 ff.; vgl. für das alte Recht Scherrer, in BoHR, § 308 HGB, Rn 31; Richter I Geib, WPg 1987, S. 185f. 25 Vgl. Angerrnayer/Oser, WPg 1996, S. 457, 463. 26 Vgl. Perlet, FS Moxter, S. 833, 846. 27 Perlet, FS Moxter, S. 833, 846; vgl. für das alte Recht, Scherrer, in BoHR, § 308 HGB, Rn 31; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 45. 22 23
I. Abweichende Bewertung bei Banken und Versicherungsunternehmen
101
Demnach führt § 341e Abs. 1 Satz 1 im Vergleich zu § 249 HGB immer nur zu einer höheren Rückstellungsbildung28 . Allerdings trägt die neue Vorschrift noch stärker zur Bildung von stillen Rücklagen bei, da sie anstelle des früheren Wahlrechts eine Pflicht zur Bildung solcher Rückstellungen vorsieht29 . Obwohl aber der Wortlaut des § 308 Abs. 2 Satz 2 auch nach der Verabschiedung des Versicherungsbilanzrichtlinie-Gesetzes unverändert geblieben iseo, dürfte sein Anwendungsbereich jedoch nicht mehr der gleiche sein. Denn nach Art. 66 Nr. 6 der Versicherungsbilanz-Richtlinie ist beim Aktivvermögen als weitere Voraussetzung zu beachten, daß nur die Bewertung solcher Gegenstände beibehalten werden kann, "deren Wertänderungen (... ) Rechte von Versicherungsnehmern beeinflussen oder begründen". Ausgenommen vom Grundsatz der einheitlichen Bewertung werden somit nur die Kapitalanlagen, bei denen Wertänderungen die Rechte von Versicherungsnehmern aus der Beitragsrückerstattung beeinflussen 31 . Da die Versicherungsbilanz-Richtlinie nur von der Möglichkeit der Übernahme abweichenden Wertansätze nicht aber von der unveränderten Übernahme von Bilanzierungswahlrechten spricht, gab es Zweifel, ob die Richtlinie überhaupt eine Befreiung vom Gebot der einheitlichen Bilanzierung zuläßt32 • Der Gesetzgeber nahm mit Blick auf den Sprachgebrauch der EGRichtlinien, die nicht eindeutig zwischen Ansatz und Bewertung unterscheiden, an, daß sich aus Art. 66 Nr. 6 Versicherungsbilanz-Richtlinie Auswirkungen auf Ansatz- und Bewertungsvorschriften ergeben33 . Hinsichtlich der Einbeziehung von Versicherungsunternehmen in einen Bankkonzernabschluß und der Einbeziehung eines Industrieunternehmens in den Konzernabschluß eines Versicherungsunternehmens wie auch hinsichtlich der Übernahme von Wertansätzen von ausländischen Versicherungsunternehmen gilt das gleiche, was über die Wertansätze von Kreditinstituten schon gesagt wurde. Ebenso gilt das gleiche in bezug auf die Begründungspflicht im Konzernanhang34 . 28 29 30
31
Perlet, FS Moxter, S. 833, 845. Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 40. Vgl. Begründung zum VersBiRiLIG BT-Drucks. 12/5587, S. 19. Vgl. Geib/Ellenbürger/Kölschbach, WPg 1992, S. 220, 230; Luttermann, BB
1995, S. 191, 194.
32 Für eine Übernahme solcher Bilanzierungswahlrechte aufgrund einer Analogie zur einheitlichen Bewertung Geib/Ellenbürger/Kölschbach, WPg 1992, S. 221, 230; für eine strenge Einheitlichkeit des Ansatzes mit Zwang zur Neuausübung der Ansatzwahlrechte bei den Versicherungsunternehmen Donath, EuZW 1992, S. 719,
726.
33 Vgl. Regierungsentwurf zum VersBiRiLiG, BT-Drucks. 12/5587, S. 19; ferner Luttermann, BB 1995, S. 191, 194. 34 Vgl. AlD/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 43.
102
Kap. D: Einschränkungstatbestände
11. Wesentlichkeitsgrundsatz
Der Grundsatz der Einheitlichkeit der Bewertung im Konzern erfährt eine weitere Ausnahme durch § 308 Abs. 2 Satz 3 HGB, wonach auf eine einheitliche Bewertung verzichtet werden kann, wenn ihre Auswirkungen für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung ist (Wesentlichkeitsgrundsatz)35. Der Wesentlichkeitsgrundsatz, bekannt auch als Grundsatz der Materiality, stammt aus dem angloamerikanischen Bilanzrechtskreis36 . In den USA gehört Materiality zu den Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)37. In Großbritannien ist Materiality im Zusammenhang mit dem "true and fair view"-Prinzip von Bedeutung und in dieser Form ist sie durch die 4. und 7. EG-Richtlinien den übrigen EG-Mitgliedstaaten als Rechnungslegungsgrundsatz vorgeschrieben worden 38 . Der Wesentlichkeitsgrundsatz verlangt im allgemeinen, daß alle für die Adressaten des Jahres- oder Konzernabschlusses entscheidungsrelevanten Sachverhalte offengelegt, alle entscheidungsirrelevanten Tatbestände dagegen vernachlässigt werden sollen. So wird vermieden, daß wesentliche Inhalte des Konzernabschlusses gegenüber unwichtigen Informationen untergehen 39 und dadurch das Bilanzbild verfälscht wird. Dies macht den Charakter der Materiality als Komponente des "true and fair view" deutlich 4o . Ferner soll durch Beachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes ein günstiges Verhältnis zwischen den Aufbereitungskosten und dem Nutzen der Rechnungslegungsinformationen für den Adressaten gewährleistet werden. Denn der aus der Publikation eines Sachverhaltes erwachsende Informationsnutzen muß mit den Kosten der Selektion und analytischer Aufbereitung dieser Information abgleichen 41 . In diesem Zusammenhang erscheint die in 35 Vgl. WP-Handbuch 1996, S. 898, Rn 248; A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 44; Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 117; ScheITer, in BoHR, § 308 HGB, Rn 33; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 48; Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung, 123, 137. 36 Vgl. dazu ausführlich Lück, Materiality in der internationalen Rechnungslegung, Wiesbaden 1975. 37 Ossadnik, Materiality als Grundsatz externer Rechnungslegung, WPg 1995, S. 33, 34. 38 Vgl. Niehus, "Materiality" ("Wesentlichkeit") - Ein Grundsatz der Rechnungslegung auch im deutschen Recht?, WPg 1981, S. 1, 2ff.; Ossadnik, WPg 1995, S. 33, 34. 39 Ossadnik, WPg 1995, S. 33. 40 Vgl. Baetge/Kirsch, in Küting/Weber, HdKR, § 297 HGB, Rn 21; Möhlmann/Diethard, Zur Operationalisierung der "untergeordneten Bedeutung" in der Konzernrechnungslegung, WPg 1996, S. 205, 206; Niehus, WPg 1981, S. 1, 2ff. 41 Ossadnik, WPg 1995, S. 33.
1I. Wesentlichkeitsgrundsatz
103
§ 308 Abs. 2 Satz 3 HGB nonnierte Ausnahmevorschrift systemkonfonn und sinnvoll42 . In der Praxis stehen dem Bilanzierenden zwei alternative Vorgehensweisen zur Verfügung, um den Tatbestand der Wesentlichkeit festzustellen: Entweder bewertet man einheitlich um und entscheidet dann, ob man den Posten entsprechend in die Bilanz einstellt43 oder findet zuerst eine überschlägige Ermittlung der Wertansätze statt und dann wird die einheitliche Bewertung für alle nicht unwesentlichen Fälle vorgenommen 44 . Letztere Alternative ist vorzuziehen, da sonst die Zielsetzung der Vereinfachungsregel unterlaufen wäre. Darüber hinaus kann sich der Tatbestand der Materiality auf mehrere Ebenen beziehen. Unwesentliche Auswirkungen für die Vennögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns ergeben sich, wenn die Bewertungsdifferenz bei den einzelnen Posten gering ist, aber auch, wenn die betroffenen einbezogenen Unternehmen zusammen von untergeordneter Bedeutung sind und auf ihre Einbeziehung nach § 296 Abs. 2 verzichtet werden könnte oder aber, wenn die anzupassenden Bilanzposten dieser Unternehmen im Verhältnis zum Gesamtposten in der Konzernbilanz unbedeutend sind45 . Fraglich ist in den beiden letzteren Fällen, ob jeder Posten getrennt beurteilt werden kann oder ob eine Gesamtbetrachtung vorgenommen werden muß. Denn es ist möglich, daß Bewertungsdifferenzen, die für sich genommen unbedeutend sind, sich im Hinblick auf den gesamten Konzern so summieren, daß das Ziel "entsprechendes Bild" nur eingeschränkt erreicht werden kann. Richtig wäre in diesem Fall auf den Gesamtkonzern abzustellen und einheitlich zu bewerten46 . Dies würde dem Geist der Generalnonn (§ 297 Abs. 2 Satz 2 HGB) entsprechen47 • Darüber hinaus spricht dafür aber auch das in § 296 Abs. 2 Satz 2 HGB ähnlich gelagerte Problem, wonach mehrere an sich unwesentliche Konzernunternehmen in den Konsolidierungskreis einzubeziehen sind, wenn sie zusammen nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Eine analoge Anwendung dieser Regelung auch auf § 308 Abs. 2 Satz 3 läßt sich kaum bestreiten, da die Interessenlage Vgl. Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung, S. 123, 137. Vgl. ScheITer, in BoHR, § 308 HOB, Rn 33. 44 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 308 HOB, Rn 46; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HOB, Rn 49; Meinhold-Heeriein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 97; Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung, S. 123, 137. 45 Vgl. Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HOB, Rn 48. 46 Vgl. Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 97; Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung, S. 137; nach A/D/S, 6. Auflage, § 308 HOB, Rn 45, müssen Bewertunsanpassungen in genau so vielen Fällen erfolgen, daß die verbleibenden Abweichungen auch insgesamt unwesentlich sind. 47 Vgl. Schülen, ebenda. 42 43
104
Kap. D: Einschränkungstatbestände
und die Zielsetzung des Gesetzes in beiden Fällen vergleichbar ist48 . Die Wesentlichkeit der Bewertungsdifferenz ist also nur im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die gesamte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns zu beurteilen. Für die Wesentlichkeit einer Bewertungsanpassung sind stets die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gesondert zu betrachten. Bei Differenzen im Wertansatz auf der Aktivseite sind eher die Auswirkungen auf die Vermögens und Ertragslage zu beachten, bei solchen auf der Passivseite, sind die Konsequenzen bei den gesamten Schulden und der Ertragslage zu berücksichtigen49 . Nur dann, wenn der Verzicht auf eine einheitliche Bewertung für jede der drei erwähnten Lagen von untergeordneter Bedeutung ist, sind die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Materiality-Wahlrechts erfüllt50 . Nach Lederle ergeben sich Grenzen für die Anwendung des MaterialityGrundsatzes, wenn gegen die deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung verstoßen wird51 . Dieser Meinung ist nicht zuzustimmen. Denn die GoB sind nur im Zusammenhang mit der Generalnorm zu interpretieren52 . Der Wesentlichkeitsgrundsatz bezieht sich aber auf Fälle, die keinen erwähnenswerten Einfluß auf die Verläßlichkeit des Konzernabschlusses ausüben und dementsprechend auch das Bilanzbild nicht verzerren können. Aber letztlich kann der Wesentlichkeitsgrundsatz auch deshalb nicht von den GoB verdrängt werden, weil er gerade mit Blick auf ihre Existenz eine Ausnahme darstellt und insofern der Grundsatz "lex specialis derogat legi generali" gilt. Dies wird auch damit bestätigt, daß in § 308 Abs. 2 Satz 3 HGB als einzigen aus allen Ausnahmefällen zum Einheitlichkeitsgrundsatz keine Angaben im Konzernanhang verlangt werden 53 . IH. Abweichungen in Ausnahmefällen
Darüber hinaus sind Abweichungen von der einheitlichen Bewertung in nicht näher bezeichneten Ausnahmefällen zulässig (§ 308 Abs. 2 Satz 4 HGB). Die Vorschrift entspricht Art. 29 Abs. 3 Satz 2 der 7. Richtlinie. Mit 48 Zum Problem der analogen Anwendung von Rechtsnormen bei Vergleichbarkeit der Interessenlage siehe Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft - Studienausgabe, 2. Auflage, S. 269ff. 49 Vgl. Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 118. 50 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 44; Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 118; Schülen, Vereinheitlichung von Bilanzansatz und Bewertung, S. 123, 137. 51 Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 119. 52 Vgl. Großfeld, Generalnorm, S. 192, 202. 53 Vgl. WP-Handbuch 1996, S. 898, Rn 248.
III. Abweichungen in Ausnahmefällen
105
dieser Ausnahmeregelung soll in besonderen Fällen die Praktikabilität der Konsolidierung gewährleistet werden 54 . Ein solcher Ausnahmefall liegt z. B. vor, wenn ein Unternehmen erst kurz vor dem Abschlußstichtag erworben wurde und eine Anpassung an die einheitliche Bewertung aus zeitlichen Gründen bis zur Aufstellung des Konzernabschlusses nicht mehr möglich ist55 . In einem solchen Fall käme natürlich auch ein Verzicht auf die Einbeziehung in den Konzernabschluß in Betracht (§ 296 Abs. I Nr. 2 HGB). Allerdings könnte die daraus resultierende Unvollständigkeit des Konsolidierungskreises möglicherweise zu einer größeren Beeinträchtigung der Aussagefähigkeit des Konzernabschlusses führen als eine Einbeziehung mit abweichender Bewertung und entsprechender Erläuterung im Konzernanhang 56 . Sollte aber die Anpassung an die konzerneinheitlichen Grundsätze auf Dauer nicht durchgesetzt werden können, ist abzuwägen, ob doch der Verzicht auf die Einbeziehung gemäß § 296 Abs. 1 Nr. 2 die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns mehr beeinträchtigt, als die Einbeziehung mit abweichender Bewertung57 • Die Inanspruchnahme von § 308 Abs. 2 Satz 4 HGB könnte auch dann zu rechtfertigen sein, wenn aufgrund der Bewertungsanpassung Rückschlüsse auf bestimmte Sachverhalte im landesrechtlichen Abschluß zu befürchten sind, die zu finanziellen (vor allem steuerlichen oder devisenrechtlichen) Nachteilen führen können58 . Allerdings muß dieser Sachverhalt restriktiv gehandhabt werden. Die finanzielle, vor allem steuerliche Belastung muß erheblich sein; denn jeder mögliche steuerliche Nachteil darf nicht von vornherein dazu führen, daß das Ziel, dem Adressaten eine aussagekräftige Bilanz zu bieten, verwässert wird 59 . 54 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 50; Biener, DB 1983, Beilage 19, S. 1, 8; Niedner, in Heidelberger Kommentar, 4. Auflage, § 308 HGB, Rn 8; Schnicke/Kilgert, Beck'scher BK, 3. Auflage, § 308 HGB, Rn 32. 55 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 50; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 50. 56 Vgl. AIDIS, 6. Auflage § 308 HGB, Rn 50; Schnicke/Kilgert, Beck'scher BK, 3. Auflage, § 308 HGB, Rn 32. 57 Vgl. Pohle, in Küting I Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 50. 58 Vgl. Schmalenbach Gesellschaft - DGfB, Aufstellung von Konzernabschlüssen, ZfbF Sonderheft 21/1987, 2. Auflage 1989, S. 50; Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 120; AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 51; zur Problematik der steuerlichen Auswirkungen des Konzernabschlusses und zur "Unitary Taxation" siehe Großfeld, Multinationale Unternehmen und nationale Souveränität, JZ 1978, S. 73ff.; ders., Multinationale Unternehmen als Regelungsproblem, AG 1975, S. 1 ff.; ders., Basisgesellschaften im Internationalen Steuerrecht, 1974; ders., Einige Grundfragen des Internationalen Unternehmensrechts, 1987, S. 27ff.; ders., Internationales und Europäisches Unternehmensrecht, 2. Auflage, S. 245 ff. 59 Vgl. Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 99.
106
Kap. D: Einschränkungstatbestände
Demgegenüber reicht die Unvereinbarkeit der konzerneinheitlichen Bewertungsmethoden mit den handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften des ausländischen Tochterunternehmens allein nicht aus, die Inanspruchnahme des Ausnahmewahlrechts nach § 308 Abs. 2 Satz 4 HGB zu rechtfertigen. Denn gerade für solche Fälle hat der Gesetzgeber in § 308 Abs. 2 Satz 1 die Neubewertungspflicht vorgeschrieben 6o . Ferner ist die Ausnahmeregelung auch in den Fällen bedeutend, in denen die Neubewertung zu einem materiell falschen Wert der Vermögensgegenstände und Schulden führen würde, weil das Unternehmen nicht zu Fortführungswerten (going-concern-Prinzip - § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB), sondern zu Liquidationswerten bilanziert, da es sich im Abwicklungsverfahren befindet61 . Unter Umständen könnte unter § 308 Abs. 2 Satz 4 HGB auch der Fall einer inflationskorrigierten Bewertung bei Tochterunternehmen mit Sitz in einem Hochinflationsland subsumiert werden 62 . Durch seinen unbestimmten Wortlaut stellt § 308 Abs. 2 Satz 4 HGB geradezu ein sehr attraktives Mittel zum Mißbrauch, wenn seine Ausnahmeregelung extensiv ausgelegt wird. Die meisten der erwähnten Fälle hätten auch durch eine zutreffende Anwendung der Generalnorm (§ 297 Abs. 2 Satz 2 HGB) gelöst werden können; dies wäre systemkonform und hätte weniger Anlaß zum Mißbrauch gegeben 63 . Deshalb erscheint eine restriktive Handhabung dieser Ausnahmeregelung geboten, da der Informationsverlust bei abweichender Bewertung auch durch die damit verbundene Verpflichtung zur Angabe und Begründung im Anhang nur in Ausnahmefällen ausgeglichen werden kann 64 . Die Inanspruchnahme von § 308 Abs. 2 Satz 4 ist im Konzernanhang anzugeben und zu begründen. Eine pauschale Begründung genügt nicht; es muß vielmehr ersichtlich sein, welche Gründe für jede Abweichung im einzelnen bestehen 65 . Eine Quantifizierung der Bewertungsabweichung wird aber vom Gesetz nicht verlangt. Allerdings ist der Einfluß von Bewertungsabweichungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns gemäß § 313 Abs. 1 Nr. 3 HGB im Konzernanhang gesondert darzustellen 66 . Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 51. Vgl. Niehus/Scholz, in Heymann Handelsgesetzbuch, 1989, Bd. II1, § 308 HGB, Rn 13; Scherrer, in BoHR, § 308 HGB, Rn 35. 62 Vgl. Niehus/Scholz, in Heymann Handelsgesetzbuch, § 308 HGB, Rn 13. 63 Vgl. Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 100. 64 Vgl. IDW, HFA 3/1988, WPg 1988, S. 483, 484; Biener, DB 1983, Beilage 19, S. 1,8. 65 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 52; Schnicke/Kilgert, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 308 HGB, Rn 34. 60 61
IV. Übernahme von Wertansätzen nach steuerlichen Vorschriften
107
IV. Übernahme von Wertansätzen nach steuerlichen Vorschriften 1. Die Konzeption des § 308 Abs. 3 HGB
a) Die umgekehrte Maßgeblichkeit im deutschen Bilanzrecht Wertansätze, die von den konzerneinheitlich angewandten Bewertungsmethoden abweichen, dürfen unverändert in den Konzernabschluß übernommen werden, wenn es sich um nur steuerrechtlich zulässige Wertansätze handelt, deren Anerkennung bei der steuerlichen Gewinnermittlung davon abhängt, daß im handelsrechtlichen lahresabschluß ebenso bewertet wurde (§ 308 Abs. 3 Satz 1 HGB)67. Voraussetzung für die unveränderte Übernahme steuerrechtlicher Wertansätze und Posten in den Konzernabschluß ist also, daß im lahresabschluß die sogenannte "umgekehrte Maßgeblichkeit" gilt68 . Nach geltendem Steuerrecht stellt bei Gewerbetreibenden, die Bücher führen und regelmäßig Abschlüsse machen, die handelsrechtliche Ergebnisermittlung die Basis für die steuerrechtliche Gewinnermittlung dar; es besteht mit anderen Worten eine Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz (sog. Maßgeblichkeitsgrundsatz - § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG). Diese Maßgeblichkeit gilt sogar nicht nur für das Betriebsvermögen im Ganzen, sondern für jeden einzelnen Bilanzansatz69 . Das Steuerrecht gewährt aber aus konjukturpolitischen Gründen Bewertungsvergünstigungen in der Steuerbilanz, deren Voraussetzung aber grundsätzlich ist, daß die Vermögensgegenstände auch in der Handelsbilanz entsprechend niedrig ausgewiesen werden (§ 5 Abs. 1 Satz 2 EStGfo. Um eine solche Bewertung zu ermöglichen gestattet das Handelsrecht eine Anpassung der handelsbilanziellen Werte an die Werte der Steuerbilanz; das Verhältnis der beiden Bilanzen zueinander kippt also um: man spricht vom Prinzip der umgekehrten Maßgeblichkeit71 . 66 Vgl. WP-Handbuch 1996, S. 898 (Fn 368); Schnicke I Kilgert, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 308 HOB, Rn 34; gegen die Darstellung des Einflusses auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Anhang Pohle, in Küting I Weber, HdKR, § 308 HOB, Rn 51. 67 Vgl. IDW, HFA 311988, WPg 1988, S. 483, 484; AIDIS, 6. Auflage, § 308 HOB, Rn 54; Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 109; Scherrer, BoHR § 308 HOB, Rn 37. 68 Vgl. Küting I Haeger, Die Berücksichtigung steuerrechtlich bedingter Sachverhalte im Konzemabschluß, BB 1987, S. 1285, 1287. 69 Vgl. Oroßfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 27, Rn 57. 70 Vgl. Oroßfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 67, Rn 165. 71 Vgl. Oroßfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 67, Rn 165.
108
Kap. D: Einschränkungstatbestände
b) Das Mitgliedstaaten- Wahlrecht des Art. 29 Abs. 5 der 7. EG-Richtlinie
Die auf steuerrechtlichen Motiven basierende umgekehrte Maßgeblichkeit
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 EStG) beeinflußt die Aussagekraft des Jahresabschlusses
erheblich und verzerrt die Wertansätze der Handelsbilanz 72. Da der Konzern aber kein Steuerrechtssubjekt ist und der Konzernabschluß nicht als Grundlage der Steuerbemessung dient73 , erscheint eine steuerlich motivierte Bewertung im Konzernabschluß zweckfremd 74 . Daher verlangt Art. 29 Abs. 5 Satz 1 der 7. EG-Richtlinie eine grundsätzliche Eliminierungspflicht für solche Bewertungsmaßnahmen, die "allein für die Anwendung steuerlicher Vorschriften vorgenommen worden" sind 75 . Allerdings hat der EG-Richtliniengeber auf Drängen der deutschen Seite diesen Grundsatz in Art. 29 Abs. 5 Satz 2 relativiert. So hat er den Mitgliedstaaten das Recht eingeräumt, vorzuschreiben oder zu gestatten, daß solche Wertansätze auch ohne Wegfall der steuerlich motivierten Abschreibungen in den konsolidierten Abschluß übernommen werden können, sofern der Betrag dieser Abschreibungen im Konzernanhang angegeben und hinreichend begründet wird76 . Mit diesem nationalen Wahlrecht wurde den Mitgliedstaaten ein weiter Handlungsspielraum eingeräumt, der aber in einem so wichtigen Punkt der Konzernrechnungslegung das Konzernbilanzbild unnötig verfälscht und die Harrnonisierungsbestrebungen innerhalb der Europäischen Union in Frage stellt77 • Der deutsche Gesetzgeber hat mit der Umsetzung der 7. EG-Richtlinie in nationales Recht das in Art. 29 Abs. 5 Satz 2 enthaltene Mitgliedstaatenwahlrecht in vollem Umfang an die Unternehmen weitergegeben und sogar auf Wertansätze für Schulden ausgedehnt (§ 308 Abs. 3 HGB)78. 72 Vgl. Schruff, Einflüsse der 7. EG-Richtlinie auf die Aussageflihigkeit des Konzernabschlusses, Berlin 1984, S. 68. 73 Vgl. ausführlich dazu Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 285, Rn 705; Grotherr, Übertragung von Konzernrechnungslegungsgrundsätzen ins Konzernsteuerrecht?, WPg 1995, S. 81 m.w.N. 74 Vgl. Schruff, Einflüsse der 7. EG-Richtlinie, S. 68; relativierend Müller, Eberhard, DB 1980, S. 265, 268; Niehus, WPg 1984, S. 285, 287; Scherrer, in BoHR, § 308 HGB, Rn 41. 75 AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 53; Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1286; Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 107. 76 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 53; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse 6. Auflage, S. 109; Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1286; Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 107; Stobbe, DB 1986, S. 1833, 1838. 77 Vgl. auch Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1287 und 1292. 78 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 53; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 109; Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1287. Zu
IV. Übernahme von Wertansätzen nach steuerlichen Vorschriften
109
2. Steuerrechtlich zulässige niedrigere Wertansätze und Sonderposten
a) Unterlassene Zuschreibungen Nach § 280 Abs. 1 HGB dürfen Kapitalgesellschaften einen niedrigeren Wertansatz nicht beibehalten, sofern sich in einem späteren Geschäftsjahr herausstellt, daß der Grund für eine vorausgegangene außerplanmäßige Abschreibung in der Zwischenzeit entfallen ist (Wertaufholungsgebot)79. In § 280 Abs. 2 HGB wird allerdings dieser Grundsatz erheblich relativiert, indem eine Zu schreibung unterbleiben kann, falls daraus für den Bilanzierenden steuerliche Konsequenzen entstünden und letzterer diese Konsequenzen vermeiden will (Wertaufholungswahlrecht)8o. Wertaufholungen also, die im Jahresabschluß eines einbezogenen Konzernunternehmens bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens und des nicht abnutzbaren Anlagevermögens allein zwecks Wahrung der Steuerneutralität unterlassen wurden, führen somit zu einem "nur nach Steuerrecht zulässigen Wert" i. S. v. § 308 Abs. 3 Satz 1 HGB und dürfen im Rahmen der Konzernrechnungslegung beibehalten werden 8!.
b) Steuerrechtliche Abschreibungen Das Wahlrecht des § 308 Abs. 3 HGB wird am häufigsten angewandt, wenn es sich um die Beibehaltung jener niedrigeren Buchwerte von Vermögensgegenständen geht, die sich in der Handelsbilanz durch die Inanspruchnahme steuerrechtlicher Mehrabschreibungen i. S. v. § 254 HGB i. V. m. § 279 Abs. 2 HGB ergeben haben 82 . Hierunter fallen sämtliche Bewertungsmaßnahmen (Sonderabschreibungen, erhöhte Absetzungen, Bewertungsabschläge usw.), die zu einem niedrigeren Wertansatz von Vermögensgegenständen führen, als er sich nach rein handelsrechtlichen Bewertungsmethoden ergeben hätte und für deren Anerkennung bei der steuerlichen Gewinnermittlung ein entsprechender Wertansatz in der Handelsbilanz vorausgesetzt wird 83 . Dagegen ist § 308 Abs. 3 HGB nicht auf Fälle anwendden Negativen Auswirkungen der umgekehrten Maßgeblichkeit und der unveränderten Übernahme solcher Werte nach § 308 Abs. 3 HGB bei der aktuellen Frage nach der Kapitalmarktausrichtung des deutschen Bilanzrechts siehe ausführlicher in Kapitel F, 11. dieser Arbeit. 79 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 193, Rn 466. 80 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 194, Rn 468. 81 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 58; Küting I Haeger, BB 1987, S. 1285, 1287. 82 Vgl. Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1287. 83 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 57; Küting I Haeger, BB 1987, S. 1285, 1287.
110
Kap. 0: Einschränkungstatbestände
bar, in denen sich die Bewertung nach steuerrechtlichen Vorschriften mit einer handelsrechtlich zulässigen Bewertung deckt. Denn das Gesetz spricht von einem "nur nach Steuerrecht zulässigen Wert" 84. c) Steuerrechtliche Wertberichtigungen
Das Beibehaltungswahlrecht des § 308 Abs. 3 HGB gilt auch für solche Fälle, in denen in den Konzernabschluß einbezogene Unternehmen gemäß § 281 Abs. 1 HGB steuerrechtliche Mehrabschreibungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil eingestellt haben (sog. Bruttomethode) statt sie direkt, d. h. auf der Aktivseite zu berücksichtigen (sog. Nettomethode)85. Obwohl sachlich den Ansatzwahlrechten zuzuordnen, fällt das Wahlrecht zur Übernahme von Sonderposten mit Rücklageanteil unter die Anwendung von Vorschriften des Steuerrechts, die in der 4. und 7. EG-Richtlinie im Rahmen der Bewertungsvorschriften geregelt ist 86 . Für Kapitalgesellschaften ist nach § 273 Satz 1 HGB die Bildung solcher Sonderposten an die Voraussetzung umgekehrter Maßgeblichkeit geknüpft, so daß diese unverändert aus den Einzelabschlüssen übernommen werden können. Wenn aber bei Tochterunternehmen anderer Rechtsform im Jahresabschluß Sonderposten mit Rücklageanteil gebildet sind, ohne daß die Voraussetzung umgekehrter Maßgeblichkeit erfüllt ist (z. B. § 74 EStDV), dürfen sie nicht in den konsolidierten Abschluß übernommen werden87 . Fraglich ist allerdings, wie vorzugehen ist, wenn ein Teil der in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen nach der Brutto und ein anderer Teil nach der Nettomethode abgeschrieben hat. Bei einem solchen Fall sollte ein Nebeneinander von direkten und indirekten steuerrechtlichen Abschreibungen als mit der in § 297 Abs. 2 Satz 2 HGB normierten Generalnorm unvereinbar betrachtet werden, jedenfalls, wenn es sich um Wertansätze innerhalb ein und desselben Bilanzpostens handelt 88 . Ferner ist auch mit Blick auf die Einheitstheorie die parallele Übernahme von Werten nach der Brutto- und Nettomethode als unzulässig anzusehen 89 , obwohl die Möglichkeit der Übernahme steuerlicher Wertansätze in den Konzernabschluß überhaupt eine Durchbrechung des Einheitsgedankens darstellt und auf reinen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen beruht9o . 84 85 86 87 88
89 90
Vgl. Vgl. Vgl. V gl. Vgl. Vgl. Vgl.
AlD/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 57. Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1288. AlD/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 59. AlD/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 60. Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1288. Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1288. Schruff, Einflüsse der 7. EG-Richtlinie, S. 63f.
IV. Übernahme von Wertansätzen nach steuerlichen Vorschriften
111
d) Unversteuerte Rücklagen
Aus dem Wortlaut des § 308 Abs. 3 HGB ergibt sich nicht eindeutig, ob unter dem dort verwendeten Begriff der "Sonderposten" auch die in den Jahresabschlüssen gebildeten unversteuerten Rücklagen zu verstehen sind. Gegen eine solche Subsumption spricht sogar auf den ersten Blick sowohl der Gesetzes- als auch der Richtlinienwortlaut (Art. 29 Abs. 5 der 7. Richtlinie). Denn die Übernahme von unversteuerten Rücklagen ist grundsätzlich ein Problem aus dem Bereich der Ansatz- und nicht der Bewertungsvorschriften91 • Vorsichtigere Betrachtung führt aber zu anderem Ergebnis: wenn § 308 Abs. 3 Satz I HGB nicht für unversteuerte Rücklagen gelten sollte, so ergäbe Satz 2 der gleichen Vorschrift, nach dem im Falle einer Beibehaltung steuerrechtlich bedingter Sachverhalte der "Betrag der im Geschäftsjahr nach Satz 1 in den Jahresabschlüssen vorgenommenen ... Wertberichtigungen und Einstellungen in Sonderposten ... im Konzernanhang anzugeben" ist, keinen Sinn. Denn in diesem Fall handelte es sich bei den anzugebenden Wertberichtigungen und Einstellungen in den Sonderposten stets um identische Beträge, wenn die Zuführungen in den Sonderposten nicht auch diejenigen aus der Bildung unversteuerter Rücklagen beinhalten würden92 • Die Verpflichtung, neben den Wertberichtigungen auch die sonstigen nach Satz 1 vorgenommenen Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil anzugeben, deuten darauf hin, daß sich der Anwendungsbereich des § 308 Abs. 3 HGB auch die unversteuerten Rücklagen mit umgekehrter Maßgeblichkeit umfaßt93 . Dagegen vermag auch die Tatsache keine Rolle zu spielen, daß die unversteuerten Rücklagen in Art. 29 Abs. 5 der 7. EG-Richtlinie nicht erwähnt werden. Ohnehin nennen weder die 7. noch die 4. Richtlinie an irgendeiner Stelle ausdrücklich den Begriff des Sonderpostens mit Rücklageanteil bzw. den der unversteuerten Rücklagen 94 . 3. Nachholung steuerrechtlicher Sachverhalte
Nach § 308 Abs. 3 HGB kann die Konzernleitung steuerrechtlich zulässige Werte beibehalten oder rückgängig machen. Bei einer extensiven Auslegung des § 308 Abs. 1 und 3 HGB könnte man es auf den ersten Blick für zulässig halten, daß eine auf der Ebene der Jahresabschlüsse nicht in Vgl. Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1288. Vgl. Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1289. 93 Vgl. Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1289; vgl. auch ScheITer, in BoHR, § 308 HGB, Rn 38 ff. 94 Vgl. Küting/Haeger, BB 1987, S. 1289. 91
92
112
Kap. D: Einschränkungstatbestände
Anspruch genommene steuerrechtliehe Abschreibung allein für Zwecke der Konzernrechnungslegung fiktiv nachgeholt werden könnte. Denn ebenso wie der Gesetzgeber die Beibehaltung steuerrechtlich bedingter Sachverhalte gestattet, könnte man auch für den umgekehrten Fall die Auffassung vertreten, daß etwa die im Steuerrecht eingeräumten Wahlrechte hinsichtlich der Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen im Konzernabschluß in vollem Umfang wieder aufleben, sofern sie in den Einzelabschlüssen der einbezogenen Unternehmen nicht oder nicht vollständig ausgeschöpft wurden95 . Eine solche Argumentation ist jedoch aus folgenden Gründen abzulehnen 96: Zuerst läßt sich anführen, daß § 308 Abs. 1 und 2 HGB, die das Wiederaufleben der Bewertungswahlrechte in Verbindung mit der Bewertungseinheitlichkeit vorsehen, sich nur auf handelsrechtliehe Bewertungsmaßstäbe beziehen, die aus den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung abgeleitet wurden. Dagegen hat der Gesetzgeber für die Behandlung steuerrechtlicher Sachverhalte im Konzernabschluß die Spezial vorschrift des Abs. 3 geschaffen. Ferner erlaubt auch der Gesetzeswortlaut in § 308 Abs. 3 HGB eine solche Auslegung nicht, denn der Gesetzgeber spricht ausdrücklich von der Möglichkeit der "unveränderten Übernahme" eines nur steuerrechtlich zulässigen Wertansatzes und erlaubt somit nur dessen Beibehaltung oder Rückgängigmachung. Anders ist jedoch die Regelung in § 308 Abs. 1 und 2 HGB zu verstehen, die explizit darauf hinweist, daß die nach dem Recht des Mutterunternehmens bestehenden Bewertungswahlrechte "im Konzernabschluß unabhängig von ihrer Ausübung in den Jahresabschlüssen der in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen ausgeübt werden (dürfen, Anm. des Verfassers)". Daraus ergibt sich, daß rein handelsbilanzielle Wertansätze nicht nur beibehalten oder storniert, sondern auch in ihrer Höhe geändert werden können. Für steuerrechtliche Sachverhalte gilt hingegen nur die Alternative der Beibehaltung oder Rückgängigmachung. Darüber hinaus verstößt eine solche Nachholung auch gegen den Geist der 7. EG-Richtlinie. Diese hat die das Konzernbilanzbild verfälschende Beibehaltung steuerrechtlicher Wertansätze nur mit Blick auf Kosten- und Vereinfachnungsgründen für die Unternehmen zugelassen. Es hätte aber keinen Sinn, diese Ausnahme auch auf fiktive Vorteile auszudehnen. Schließlich spricht dagegen der Verweis in § 298 Abs. 1 HGB auf die §§ 273, 279 Abs. 2 und 280 Abs. 2. Danach dürfen steuerrechtliche Sach95 Vgl. Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1290; Pohle, § 308 HGB, Rn 56; Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 96 Vgl. Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1290; Pohle, § 308 HGB, Rn 56, Küting/Weber, Der Konzernabschluß,
in 3. in S.
Küting/Weber, HdKR, Auflage, 1991, S. 108. Küting/Weber, HdKR, 108.
IV. Übernahme von Wertansätzen nach steuerlichen Vorschriften
113
verhalte nur dann in Ansatz gebracht werden, wenn das Steuerrecht ihre Anerkennung bei der steuerrechtlichen Gewinnerrnittlung von einem entsprechenden Ansatz in der Handelsbilanz abhängig macht. Da der Konzern aber kein Steuersubjekt ist, können jene fiktiven Steuerkonsolidierungsbuchungen auch nicht damit begründet werden, daß sie wegen der umgekehrten Maßgeblichkeit zur Erlangung von Steuervorteilen notwendig sind. 4. Entsprechende Sachverhalte bei ausländischen Unternehmen und Personenhandelsgesellschaften
Wenngleich § 308 Abs. 3 HGB in erster Linie auf die deutschen steuerrechtlichen Vorschriften abstellt 97 , könnte die Rückgängigmachung steuerrechtlicher Wertansätze Bedeutung auch bei der Einbeziehung ausländischer Konzernunternehmen erlangen, für die nach der Verabschiedung des Bilanzrichtlinien-Gesetzes gemäß § 294 Abs. 1 HGB das Weitabschlußprinzip gilt98 . Das Beibehaltungswahlrecht ist daher auch auf Wertansätze im Jahresabschluß ausländischer Konzernunternehmen anwendbar, sofern das Steuerrecht des Auslandes die umgekehrte Maßgeblichkeit vorsieht99 . Allerdings ist dieser Grundsatz in ausländischen Steuergesetzen nur selten verankert 1OO • Wenn aber ein ausländisches Konzernunternehmen die umgekehrte Maßgeblichkeit nicht zu beachten braucht, dann dürfen seine Vermögensgegenstände nur mit ihrem handelsrechtlichen und nicht mit einem eventuell steuerrechtlich zulässigen Wert in den Konzernabschluß übernommen werden lO1 . Unternehmen, die keine Kapitalgesellschaften sind, können nach § 253 Abs. 5 HGB auch nach Wegfall des Grundes für eine außerplanmäßige handeisrechtliche Abschreibung den niedrigeren Wert beibehalten, der dann allerdings keinen "nur nach Steuerrecht zulässigen Wert" darstellt. Allerdings ist die handelsrechtliche Zulässigkeit von steuerrechtlichen Abschreibungen im Konzernabschluß nach den Vorschriften zu beurteilen, die für Kapitalgesellschaften gelten (§ 298 Abs. 1 HGB). Danach ist die Beibehaltung des niedrigeren Wertes im Konzernabschluß nur unter den Voraussetzungen des § 280 Abs. 2 HGB zulässig. § 280 Abs. 2 HGB gilt nur für Kapitalgesellschaften und deshalb können steuerlich motivierte AbschreiVgl. Biener I Berneke, Bilanzrichtlinien-Gesetz, S. 361. Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 62; Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1291. 99 Vgl. IDW, HFA 3/1988, WPg 1988, S. 483, 484; AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 62; Lederle, in Beck'sches HdR, C 300, Rn 110; Schnicke I Kilgert, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 308 HGB, Rn 37. 100 Vgl. WP-Handbuch 1996, S. 898, Rn 246. 101 Vgl. Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1291. 97
98
8 Xenides
114
Kap. D: Einschränkungstatbestände
bungen bei Personenhandelsgesellschaften nicht unverändert in den Konzernabschluß übernommen werden 102. 5. Angaben im Konzernanhang
Wenn nur nach Steuerrecht zulässige Wertansätze unverändert in den Konzernabschluß übernommen wurden (§ 308 Abs. 3 Satz 1 HGB), dann sind der ..Betrag der im Geschäftsjahr ... in den Jahresabschlüssen vorgenommenen Abschreibungen, Wertberichtigungen und Einstellungen in den Sonderposten sowie der Betrag der unterlassenen Zuschreibungen ... im Konzernanhang anzugeben; die Maßnahmen sind zu begründen" (§ 308 Abs. 3 Satz 2 HGB) 103. § 308 Abs. 3 Satz 2 HGB wird ergänzt durch die Vorschrift des § 314 Abs. 1 Nr. 5 HGB, nach der das Ausmaß, in dem das konsolidierte Jahresergebnis durch steuerrechtlich bedingte Maßnahmen beeinflußt wurde, im Konzernanhang anzugeben ist 104. Aus dem Wortlaut von § 308 Abs. 3 Satz 2 ergibt sich nicht eindeutig, ob in den angabepflichtigen Betrag nur die im Geschäftsjahr erstmals unterlassene Zuschreibungen einzubeziehen sind oder auch die bereits in Vorjahren unterlassenen, die aber noch nicht vollständig abgeschlossen sind und bis in die Berichtsperiode hineinwirken 105. Art. 29 Abs. 5 Satz 2 der 7. EGRichtlinie wie auch der vergleichbare Fall von Art. 39 Abs. 1 Buchst. c) der 4. EG-Richtlinie sprechen aber dafür, die Angabepflicht auf nur im gleichen Geschäftsjahr unterlassenen Zuschreibungen zu erstrecken 106 . Dies hat allerdings den Nachteil, daß auf dieser Weise der externe Bilanzleser ohne zusätzliche Angaben über die bilanziellen Auswirkungen steuerrechtlich bedingter Bewertungsmaßnahmen früherer Geschäftsjahre den tatsächlichen Buchwert einzelner Vermögensgegenstände oder Posten nicht ermitteln kann, der sich ohne die Inanspruchnahme dieser Vergünstigungen ergeben hätte 107. Der Gesetzeswortlaut in § 308 Abs. 3 Satz 2 HGB läßt ferner den Schluß zu, daß die nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommenen Abschreibungen, Wertberichtigungen, Einstellungen in den Sonderposten sowie die 102 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 61; Küting/Haeger S. 1285, 1287. 103 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 63; Küting I Haeger, S. 1285, 1289. 104 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 63; KütinglHaeger, S. 1285, 1289; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 63. 105 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 65; Küting I Haeger, S. 1285, 1289. 106 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 65. 107 Vgl. Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1289.
BB 1987, BB 1987, BB 1987, BB 1987,
IV. Übernahme von Wertansätzen nach steuerlichen Vorschriften
115
unterlassenen Zuschreibungen auch als Gesamtbetrag angegeben werden dürfen 108. Dies bedeutet aber weiteren Verlust an der Bedeutung der Angabepflicht. Denn die Zusammenfassung der Einzelbeträge bedeutet für den Bilanzleser zusätzliche Mühen, weil er diese Beträge in den Konzernabschluß hineinrechnen muß, um die vermögensmäßigen Auswirkungen steuerrechtlich bedingter Maßnahmen in den Konzernabschluß eliminieren zu können lO9 • Die Beibehaltung steuerrechtlicher Sachverhalte erschwert also die Bilanzanalyse und schränkt trotz der Angabepflichten im Konzernanhang die Aussagefähigkeit des Konzernabschlusses wesentlich ein. Das Gesetz verlangt ferner neben der Angabe von Beträgen die Begründung der Abschreibungen, Wertberichtigungen und Einstellungen in den Sonderposten sowie der unterlassenen Zuschreibungen (§ 308 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2). Als Begründung dürften der Hinweis auf die Beibehaltung steuerrechtlich bedingter Wertansätze und Sonderposten sowie die Nennung der steuerrechtlichen Vorschriften ausreichen 110. Eine detaillierte Aufgliederung der Steuervergünstigungen nach einzelnen Bilanzposten oder nach den zugrundeliegenden Vorschriften des Steuerrechts ist aber nicht erforderlich 111.
108 Vgl. Küting I Haeger, BB 1987, S. 1285, 1289; Scherrer, in BoHR, § 308 HGB, Rn 42; AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 64, allerdings mit der Einschränkung, daß der Betrag der unterlassenen Zuschreibungen gesondert anzugeben ist. 109 Vgl. Küting/Haeger, BB 1987, S. 1285, 1289; Orde1heide, WPg 1985, S. 515. 110 Vgl. IDW, HFA 3/1988, WPg 1988, S. 483, 484; WP-Handbuch 1996, S. 898, Rn 247; KütinglHaeger, BB 1987, S. 1285, 1290. 111 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 308 HGB, Rn 66; Küting I Haeger, BB 1987, S. 1285, 1290. 8*
Kapitel E
Erweiterungstatbestände I. Währungsumrechnung 1. Das Umrechnungsproblem
Der Konzernabschluß eines deutschen Mutterunternehmens ist nach § 298 Abs. 1 i. V. m. § 244 HGB in Deutscher Mark aufzustellen (es ist allerdings möglich, den Konzernabschluß zusätzlich in Europäischer Währungseinheit offenzulegen - § 328 Abs. 4 HGB)l. Da aber das Gesetz die Einbeziehung aller Konzernunternehmen ohne Rücksicht auf ihren Sitz außer den in den §§ 295, 296 HGB vorgesehenen Fällen in den Konsolidierungskreis vorschreibt (§ 294 Abs. 1 HGB), stellt sich somit für ein Mutterunternehmen mit Tochterunternehmen im Ausland das Problem der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse in die Währung des Mutterunternehmens 2 . Die Währungsumrechnung kommt natürlich in der Regel auch beim J ahresabschluß oder bei einem nationalen Konzernabschluß vor. Bei internationalen Konzernabschlüssen (Weitabschlüssen) gewinnt sie aber erheblich an Gewicht, weil außer den direkten Auslandstransaktionen der betroffenen inländischen Tochterunternehmen zusätzlich die Jahresabschlüsse der einzubeziehenden ausländischen Konzernunternehmen in Inlandswährung umzurechnen sind3 . Da bei der Währungsumrechnung im Grunde auch um die Zuordnung eines Geldbetrages zu Bewertungsobjekten geht, liegt der Verdacht nahe, daß es hierbei um einen Bewertungsprozeß handele. Dementsprechend erscheint notwendig, eine eventuelle Anwendung von § 308 HGB zu prüfen4 • Aller1 Vgl. WP-Handbuch 1996, S. 899, Rn 253; Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 294, Rn 731; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 152; Coenenberg, Jahresabschluß und Jahresabschlußanalyse, 15. Auflage, S. 379; Küting/Weber, Der Konzemabsch1uß, 3. Auflage, S. 112; Gebhardt, in Beck'sches HdR, C 310, Rn 1. 2 Das Problem der Währungsumrechnung hatte unter der Geltung des AktG 1965 einen bei weitem niedrigeren Stellenwert, da die Einbeziehung ausländischer Tochteruntemehmen in den Konzernabschluß nur als Wahlrecht ausgestaltet war (§ 329 Abs. 2 AktG 1965); vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 301, Rn 748; Küting/Weber, Der Konzernabschluß, S. 112. 3 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 294, Rn 731; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 379. 4 Vgl. Busse v. Colbe, Die neuen Rechnungslegungsvorschriften aus betriebswirtschaftIicher Sicht, ZfbF 1987, S. 191, 202; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 186.
I. Währungs umrechnung
117
dings ist die Umrechnung der Abschlüsse ausländischer Tochterunternehmen weder in der 7. EG-Richtlinie noch im HGB explizit geregelt, obwohl es sich hierbei um ein Feld mit bedeutender Auswirkung auf das Konzernbilanzbild und die Konzernbilanzpolitik handelt5 . Auch die zeitlich nach dem Bilanzrichtlinien-Gesetz erlassenen Art. 39 der Bankenbilanz-Richtlinie6 und § 340h HGB, die das Problem der Währungsumrechnung für den Bankenjahresabschluß regeln, liefern keine entscheidenden Argumente für das Problem der Währungsumrechnung im allgemeinen, da es sich dabei um eine branchenspezifische Regelung handelt, die sich allenfalls bei Währungspositionen analog anwenden läßt und nicht als ganzes auf andere Unternehmen übertragbar ist7 . Allerdings waren sich sowohl der Richtliniengeber wie auch der deutsche Gesetzgeber des Problems bewußt. Art. 34 Nr. I der 7. EG-Richtlinie verlangt Angaben im Anhang: "Für die in dem konsolidierten Abschluß angegebenen Beträge, welche auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, ist anzugeben, auf welche Grundlage sie in die Währung, in welcher der konsolidierte Abschluß aufgestellt wird, umgerechnet worden sind". Ferner müssen nach § 313 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 HGB im Konzernanhang "die Grundlagen für die Umrechnung in deutscher Mark angegeben werden, sofern der Konzernabschluß Posten enthält, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten". Aus beiden Vorschriften müssen wir entnehmen, daß sowohl der Richtlinien-Geber wie auch der deutsche Gesetzgeber die Regelung der Währungsumrechnung bewußt ausgeklammert haben, und daß sie ferner von mehreren zulässigen Methoden bei der Währungsumrechnung ausgehen 8 . 2. Umrechnungskurse - Umrechnungsmethoden
a) Umrechnungskurse
Die Auswahl eines geeigneten Umrechnungskurses erstreckt sich zum einen auf die Art des Umrechnungskurses und zum anderen auf dessen Zeitbezug 9 . Hinsichtlich der Art des Umrechnungskurses stellt sich zunächst 5 Vgl. Baetge/Thomas-Meyer, BBK 1995, S. 485; Busse v. Colbe, ZtbF 1987, S. 201; Busse v. Colbe I Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 123; Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 112. 6 ABI. EG vom 31.12.1986, Nr. L 372, S. 1 ff. 7 Vgl. IDW, Stellungnahme BFA 3/1995 (Währungsumrechnung bei Kreditinstituten), WPg 1995, S. 735; Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 303, Rn 752f.; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 184. 8 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 296, Rn 734f.; a.A. Busse v. Colbel Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 186. 9 Vgl. Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 379.
118
Kap. E: Erweiterungstatbestände
die Frage, ob der Geldkurs (Ankaufskurs der Bank) oder Briefkurs (Verkaufskurs der Bank) zu wählen ist. Für den Transfer von Zahlungsmitteln aus dem Ausland in das Inland ist somit der Geldkurs und in umgekehrte Richtung der Briefkurs maßgeblich 10. Es liegt demnach nahe, solche Posten des ausländischen Jahresabschlusses, die zu Zahlungen an das Inland führen oder führen können, zum Geldkurs und solche, die zu Zahlungen inländischer Unternehmen an das ausländische Konzernunternehmen führen, zum Briefkurs umzurechnen. Für Posten, die sich nicht diesen beiden Kategorien zuordnen lassen, bietet sich der Mittelkurs an. Aus Vereinfachungsgründen erscheint aber auch akzeptabel alle Positionen zum Mittelkurs umzurechnen 11. Eine weitere Frage hinsichtlich der Art des zu wählenden Kurses ergibt sich, wenn zum gleichen Zeitpunkt verschiedene amtliche Kurse (z. B. Import-, Export- oder Terminkurs) bestehen oder wenn in Ländern mit nicht frei konvertierbarer Währung oder, in denen bestimmte Devisentransaktionen verboten sind, neben dem offiziellen Kurs inoffizielle (freie) Kurse existieren 12. Im allgemeinen wird man hier den Kurs verwenden, zu dem die geschäftlichen Beziehungen mit dem betreffenden ausländischen Unternehmen überwiegend abgewickelt werden. Dies entspricht auch dem Geist der Generalnorm (§ 297 Abs. 2 Satz 2 HGB) am meisten 13. Dagegen stellen die Kaufkraftparitäten keinen geeigneten Kurs dar, weil sie gegen das in Deutschland geltende Nominalwertprinzip verstoßen 14 • Hinsichtlich des Zeitbezugs des zu verwendenden Umrechnungskurses unterscheidet man zwischen historischem Kurs, Stichtagskurs und Durchschnittskurs. Hierbei entspricht der erste dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung bzw. Entstehung eines Wertes oder der Abwicklung eines Geschäftes, längstens aber zum Zeitpunkt der Entstehung des Mutter-/Tochferverhältnisses, der zweite dem Wechselkurs am Stichtag des Konzernabschlusses und der dritte einem ungewichteten oder gewichteten Monats- oder Jahresdurchschnittskurs 15 . Die Bestimmung des Zeitbezugs des zu verwendenden Umrechnungskurses stellt das Hauptproblern der 10 Vgl. Busse v. Colbe I Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 126; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 379. 11 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 294, Rn 731; Busse v. Colbe I Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 127; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 379. 12 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 127; Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 130. 13 Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 294f., Rn 731; vgl. auch Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 130. 14 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 128. 15 Vgl. Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 380.
I. Währungsumrechnung
119
Währungsumrechnung dar l6 und ist mithin auch für die Frage entscheidend, ob § 308 HGB auch auf die Währungs umrechnung anzuwenden ist.
b) Umrechnungsmethoden Gäbe es einheitliche und konstante Austauschverhältnisse (Wechselkurse) zwischen den verschiedenen Währungen, so ließen sich die in fremder Währung aufgestellten Jahresabschlüsse ausländischer Konzernunternehmen linear in die Konzernwährung transformieren 17. In der Realität schwanken aber die Wechselkurse ständig. Das Umrechnungsproblem bei schwankenden Wechselkursen entsteht dadurch, daß der Jahresabschluß diverse Posten mit unterschiedlichem Zeitbezug enthält 18. So knüpfen etwa die Anschaffungskosten an den historischen Wert zum Erwerbszeitpunkt an, die Bewertung zum niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertvorschrift) stellt auf den Wert zum Bilanzstichtag ab, und für die Bewertung der Rückstellungen ist der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zu ermittelnde künftige Zahlungsbetrag maßgebend. Die Frage ist also, ob trotz schwankender Wechselkurse alle Abschlußposten mit einem einheitlichen Kurs umzuzrechnen sind oder ob eine differenzierte Umrechnung eher imstande ist, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns zu vermitteln 19. Im Hinblick hierauf haben sich mehrere Umrechnungsmethoden herausgebildet, die die äußerst schwierige Problematik der Währungsumrechnung im Konzernabschluß zu regeln versuchen. aa) Auf der globalen Theorie basierende Umrechnungsmethoden Ein Teil der Literatur fingiert für den gesamten Konzern eine einheitliche Währungs- und Rechtsordnung und hebt so die Einheitstheorie des § 297 Abs. 3 Satz 1 HGB besonders hervoro. Diese Betrachtungsweise wird auch als "globale Theorie" bezeichnet21 . Nach dieser Theorie werden ausländi16 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 295, Rn 731; Busse v. Co1be/Orde1heide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 128; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 380. 17 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 152. 18 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 152. 19 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 152. 20 Vgl. statt aBer Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 123ff. 21 Vgl. Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 113; Peemöller/Husmann, Stand und Entwicklung der Währungsumrechnung ausgewählter Konzerne in Deutschland, DB 1996, S. 101.
120
Kap. E: Erweiterungstatbestände
sche Tochtergesellschaften wie unselbständige Betriebsstätten des Mutterunternehmens angesehen; sämtliche Geschäftsvorfälle von einzubeziehenden ausländischen Tochterunternehmen sind so zu behandeln, als ob sie unmittelbar für Namen und für Rechnung des Mutterunternehmens getätigt worden wären22 • Danach ist der ausländische Abschluß so umzurechnen, daß die Zahlen des umgerechneten Abschlusses analog zu denen eines unmittelbar in DM aufgestellten Abschlusses interpretiert werden können 23 . Die Anforderungen der globalen Theorie können nur erfüllt werden, wenn zum Teil mit historischen Kursen, zum Teil mit Stichtagskursen umgerechnet wird 24 . (1) Fristigkeitsmethode (current - non current method)
Die Fristigkeitsmethode, auch als "current-noncurrent method" bezeichnet, betrachtet den Konzern aus der Sicht der globalen Theorie auf der Basis des Nominalwertprinzips25. Sie geht auf ein Gutachten des amerikanischen Instituts der Wirtschaftsprüfer aus dem Jahre 1931 zurück26 . Nach dieser Methode sind die Umrechnungskurse danach zu differenzieren, ob ein Aktiv- oder Passivposten dazu bestimmt ist, auf die Dauer oder nur kurzfristig dem Unternehmen zu dienen. Für die erste Gruppe von Positionen gelten die historischen Kurse in den Zeitpunkten des Erwerbs der Vermögensgegenstände oder der Entstehung der Kapitalpositionen, für die zweite Gruppe der Tageskurs am Bilanzstichtag 27 . Für die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung gelten monatliche Durchschnittskurse und die Umrechnungsdifferenzen sind bei geringen Wechselkurs schwankungen erfolgswirksam, bei größeren Änderungen der Währungsparitäten erfolgsneutral gegen die Kapitalrücklagen zu verrechnen 28 . 22 Vgl. Arbeitskreis "Weltbilanz" des IDW, Die Einbeziehung ausländischer Unternehmen in den Konzernabschluß ("Weltabschluß"), Düsseldorf 1977, S. 78. 23 Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 125 (im Text fett gedruckt). 24 Vgl. Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 113; Peemöller/Husmann, DB 1996, S. 1Ol. 25 Vgl. Küting/Weber, Der Konzemabschluß, 3. Auflage, S. 117. 26 American Institute of Accountants, Special Comittee on Accounting Procedure (Hrsg.) 1931: Foreign-exchange Losses, in: Bulletin of the American Institute of Accountants, December 15, 1931, Series B, No. 92, S. 1 - 3. 27 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 136; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 385; Friedrich, Die Problematik der Erstellung ... , S. 215; Müller, Herbert, Die Umrechnung der Jahresabschlüsse ausländischer Konzernunternehmen, Bochum 1986, S. 21; v. Wysocki/Wohlgemuth, Konzernrechnungslegung, 3. Auflage, 1986, S. 177; Wortmann, Fremdwährungsumrechnung im Konzernabschluß, Wien 1992, S. 38.
I. Währungsumrechnung
121
Die Kursdifferenzierung nach der Fristigkeit wurde offenbar unter relativ stabilen Wechselkurs verhältnissen entwickelt, die lediglich Schwankungen um einen stabilen Kurs kannten 29 . So beruht dieses Verfahren auf der Annahme, daß die Wechselkursschwankungen für die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände sich auf die Dauer ausgleichen. Deshalb sind diese zum historischen Kurs umzurechnen, während für die kurzfristigen Bilanzpositionen der Tageskurs als die beste Schätzung des für den Zeitpunkt der Liquidierung bzw. Fälligkeit gültigen Kurses betrachtet wird 3o . Die der Fristigkeitsmethode zugrunde liegende Prämisse trifft allerdings nicht oder mindestens nicht mehr zu: selbst wenn zur Zeit des Goldstandards von der Prämisse lediglich oszillativer Schwankungen des Wechselkurses um eine feste Parität ausgegangen werden durfte, ändern sich die Wechselkurse in heutiger Zeit jedoch durch Auf- und Abwertung einzelner Währungen oder infolge freier Kursbildung ständig3l . (2) Umrechnung nach dem Geldcharakter der Bilanzpositionen (monetary - non-monetary method)
Die Umrechnungs methode nach dem Geldcharakter, oder sonst Sachwertmethode genannt (monetary - non-monetary method), entstand aus der Kritik an der Fristigkeitsmethode und wurde insbesondere von der National Association of Accountants (NAA) befürwortet32 . Diese Kritik bezog sich hauptsächlich auf die Umrechnung der langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten und die Umrechnung der Vorräte33 . Die Umrechnungsmethode nach dem Geldcharakter unterteilt die Bilanzposten in Geldgrößen (monetäre Positionen) und Nicht-Geldgrößen (Sachwerte, Eigenkapital) und rechnet die ersten zu dem Tageskurs und die zweiten zum historischen Kurs 28 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 136; Treuarbeit (Hrsg.), "Konzernabschlüsse '89", S. 179, Rn 341. 29 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 136; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 385; Müller, Herbert, Die Umrechnung, S.25. 30 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 136; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 385. 31 Vgl. Busse v. Colbe I Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 136f.; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 386; Müller, Herbert, Die Umrechnung, S. 25 f. 32 Vgl. Hepworth, Samuel R.: Reporting Foreign Operations, Ann Arbor 1956, S. 8ft.; National Association of Accountants (NAA): Management Accounting Problems in Foreign Operations, Research Report No. 36, New York 1960; Kirchner, Christian, Weltbilanzen, Probleme der internationalen Konzernrechnungslegung, Wiesbaden 1978, S. 111. 33 Vgl. Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 119.
122
Kap. E: Erweiterungstatbestände
um. Erträge und Aufwendungen sind grundsätzlich zu Durchschnittskursen umzurechnen und Umrechnungsdifferenzen sind erfolgswirksam zu verrechnen 34 . Die Umrechnungsmethode nach dem Geldcharakter unterscheidet sich also von der Fristigkeitsmethode hauptsächlich durch die Umrechnung der Vorräte und Wertpapiere des Umlaufvermögens zum historischen Kurs und der langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten zum Stichtagskurs35 . Die Kursdifferenzierung nach dem Geldcharakter der Bilanzpositionen wurde entwickelt unter der Prämisse eines konstanten Werts der Konzernwährung und Abwertungen der ausländischen Währungen, wobei letztere auch mit starker Inflation verbunden waren; sie entsprach den Umständen der US-amerikanischen Konzerne zu den fünfzigern und frühen sechzigern Jahren 36 . Vor diesem Hintergrund wurde argumentiert, monetäre Vermögenspositionen seien von diesen Geldwertänderungen unmittelbar betroffen; durch die Umrechnung zum Stichtagskurs werde dieser Geldwertverlust erfaßt. Sachwerte seien von der Währungsänderung im allgemeinen nicht betroffen; die Abwertung einer Auslandswährung sei gewöhnlich mit einer Preissteigerung in dem betreffenden Land verbunden, so daß ihr Wert nominell steige 37 • Allerdings läßt sich die der Sachwertmethode zugrunde liegende Prämisse eines vollkommenen Gleichschritts von Inflation und Abwertung in der Praxis nicht bestätigen 38 • Darüber hinaus führt sie bei einer Aufwertung der Konzernwährung zu einem Ausweis unrealisierter Gewinne bei den Verbindlichkeiten und bei einer Abwertung der Konzernwährung bei den Forderungen und somit zu einem Verstoß gegen die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 39 •
34 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 138; Treuarbeit (Hrsg.), "Konzernabschlüsse '89", S. 179, Rn 342; v. Wysocki/Wohlgemuth, Konzernrechnungslegung, 4. Auflage, S. 235 f. 35 Vgl. Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 119. 36 Vgl. Busse v. Colbe, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 138; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 386f.; Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 120; Müller, Herbert, Die Umrechnung, S. 44f.; Wortmann, Fremdwährungsumrechnung, S. 41 ff. 37 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 138; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 387; Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 120. 38 Vgl. Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 387; Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 121; ausführlicher Müller, Herbert, 1986, S. 54 ff. 39 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 139.
I. Währungsumrechnung
123
(3) Zeitbezugsmethode (temporal principle of translation)
Im Gegensatz zu den bei den schon erwähnten Methoden, die eher der Vergangenheit angehören 4o, stellt die Zeitbezugsmethode eine der wichtigsten Umrechnungsmethoden in der gegenwärtigen Theorie und Praxis dar41 . Die Zeitbezugsmethode betont die Konzemeinheit42 • Die Posten in den Jahresabschlüssen der ausländischen Tochteruntemehmen werden so umbewertet und umgerechnet, als bilanzierte das ausländische Tochteruntemehmen von vornherein gemäß deutschem Recht und in Deutscher Mark43 . Im Ergebnis sollen die Transaktionen des ausländischen Konzernunternehmens in gleicher Weise in den Konzernabschluß einfließen, wie die einer unselbständigen ausländischen Betriebsstätte44. Nach ihren prominentesten Vertretern in Deutschland sieht die Zeitbezugsmethode in ihren Regelungen so aus45 : - Anschaffungswerte sind mit dem Kurs, der im Anschaffungszeitpunkt gegolten hat (historischer Kurs) - Tageswerte sind mit dem Kurs am Bilanzstichtag - bei Aufwendungen und Erträgen am Verbrauchs- oder Umsatztag - (Tageskurs) und - Zukunfts werte sind mit dem Kurs, der für den Realisationszeitpunkt erwartet wird (Zukunftskurs ) und in der Gewinn- und Verlustrechnung - Wertänderungen an Vermögensgegenständen (Abschreibungen, Zuschreibungen, Stoffverbrauch) sind zu denselben Kursen wie die entsprechenden Vermögensgegenstände und - alle übrigen Positionen sind zu Jahresdurchschnittskursen umzurechnen. Die Zeitbezugsmethode ist stark an die Bewertungsvorschriften des HGB orientiert46 . Sie stellt auf die strenge Einhaltung des Anschaffungswert- und Vgl. v. Wysocki/Wohlgemuth, Konzernrechnungslegung, 4. Auflage, S. 241. Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 296, Rn 736; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 153. 42 V gl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 298, Rn 741; Müller, Herbert, Die Umrechnung der Jahresabschlüsse ausländischer Tochteruntemehmen, RIW 1987, S. 847, 849. 43 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 298, Rn 741; Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 121; v. Wysocki/Wohlgemuth, Konzernrechnungslegung, 3. Auflage, S. 179. 44 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 154. 45 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 140. 46 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 298, Rn 741; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 140; Müller, Herbert, RIW 1987, S. 849. 40 41
124
Kap. E: Erweiterungstatbestände
des Niederstwertprinzips47. Dafür ennittelt man den Gegenwartswert der Vermögensgegenstände und Schulden und rechnet ihn mit dem Stichtagskurs um. Sodann vergleicht man den zu historischen Kursen umgerechneten Wert mit dem zu Stichtagskurs umgerechneten Gegenwartswert. Der jeweils niedrigere dieser bei den Werte wird angesetzt (sogenanntes [auf den Konzern] erweitertes Niederstwertprinzip)48. Auch die Zeitbezugsmethode ist nicht frei von Problemen. So räumen Busse v. Colbe/Ordelheide z.B. ein, daß in der Regel der Bilanzwert einer Forderung oder Verbindlichkeit im Fremdwährungsabschluß nicht eindeutig einem Zeitpunkt zugerechnet werden kann49 . Probleme bereitet auch die starre Anlehnung an das Niederstwertprinzip. Das erweiterte Niederstwertprinzip nimmt mechanisch Verluste vorweg, die mit weniger Wahrscheinlichkeit eintreten als im Iahresabschluß und auf dieser Weise werden Bewertungsregeln für inländische Verhältnisse im Bereich einer Währung auf eine internationale Situation übertragen5o . bb) Auf der lokalen Theorie basierende Umrechnungsmethoden Als Antipode zur globalen Theorie wird in Literatur und Praxis die sogenannte lokale Theorie vertreten. Danach wird der Tatsache, daß die ausländischen Tochterunternehmen in eigenen Rechts- und Währungskreisen operieren und weitgehend voneinander unabhängige, in sich geschlossene Umsatzprozesse in der jeweiligen Landeswährung durchführen, entscheidende Bedeutung beigemessen51 . Eine Devisenkursänderung hat keine besondere Auswirkung auf die Vermögens- und Ertragslage der ausländischen Tochtergesellschaft52 , ein Transfer von Vermögensgegenständen und Schulden des ausländischen Unternehmens in die Konzernwährung findet zumindest nicht laufend statt53 . Deshalb wird die Umrechnung des in ausländischer Währung aufgestellten Abschlusses nicht wie bei der globalen Theorie und insbesondere der Zeitbezugsmethode als Bewertungsvorgang, sondern als bloße Transformation angesehen 54. 47 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 140; Müller, Herbert, RIW 1987, S. 849. 48 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 298, Rn 741; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 155f. 49 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 141. 50 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 299, Rn 742. 51 Vgl. v. Wysocki/Wohlgemuth, Konzernrechnungslegung, 4. Auflage, S. 24Of.; Busse v. Colbe I Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 123. 52 Vgl. Kern, Die bilanzielle Abbildung des Unternehmungsprozesses in internationalen Konzernen, Zürich 1976, S. 158. 53 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 123. 54 Vgl. v. Wysocki/Wohlgemuth, Konzernrechnungslegung, 4. Auflage, S. 181.
I. Währungsumrechnung
125
Bei der lokalen Theorie wird die Fiktion der rechtlichen Einheit nicht im gleichen Maße wie bei inländischen Tochtergesellschaften angewandt55 . Andererseits wird die Gleichheit der Abschlußrelationen im Fremdwährungsabschluß und umgerechneten Abschluß gewährleistet, da der Einzelabschluß mit dem ihm zukommenden Gewicht in den Konzernabschluß eingehe56 . Folgerichtig wird von den Vertretern dieser Theorie die Umrechnung des gesamten Fremdwährungsabschlusses mit dem Stichtagskurs (closing rate method) befürwortee 7 • In der Praxis rechnen die meisten deutschen Konzerne die Jahresabschlüsse ihrer ausländischen Tochterunternehmen nach der lokalen Theorie um58 . (1) Reine Stichtagskursmethode
Bei der Reinform der Stichtagskursmethode werden alle Posten in der Bilanz der einbezogenen ausländischen Tochterunternehmen einheitlich mit dem Wechselkurs zum Bilanzstichtag (Stichtagskurs) umgerechnet59 . Sie baut - der lokalen Theorie entsprechend - darauf auf, daß die konzerneinheitlichen Bilanzierungsgrundsätze lediglich auf der Ebene der in der jeweiligen Landeswährung aufgestellten Einzelabschlüsse und somit nicht auf der Ebene der Währungsumrechnung zu beachten sind60 . Sie hat den eindeutigen Vorteil, daß sie im Gegensatz zu allen Umrechnungsmethoden mit differenzierten Kursen zu keine Umrechnungsdifferenzen führt und daß die Relationen des Fremdwährungsabschlusses auch in DM-Abschluß erhalten bleiben61 . Deshalb wird die Umrechnung des ausländischen Abschlusses als einfache lineare Transformation angesehen 62 . 55 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 124; Peernöller/Husmann, DB 1996, S. 101. 56 Vgl. Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 125. 57 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 124; Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 125. 58 Treuarbeit (Hrsg.), "Konzernabschlüsse '89", S. 180, Rn 345. 59 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 297, Rn 737; Baetge, Konzernbilan~ zen, 2. Auflage, S. 166; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 133; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 387; Treuarbeit (Hrsg.), "Konzernabschlüsse '89", S. 179, Rn 339. 60 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 166; v. Wysocki, Weltbilanzen als Planungsobjekte und Planungsinstrumente multinationaler Unternehmen, ZtbF 1971, S. 682, 692. 61 Vgl. v. Wysocki, Zum Informationsgehalt von Weltbilanzen deutscher Obergesellschaften, WPg 1973, S. 28ff.; v. Wysocki/Wohlgemuth, Konzernrechnungslegung, 3. Auflage, S. 181; Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 125; a.A. Csick/Schneck, WPg 1983, S. 330; Duckstein/Dusemond, DB 1995, S. 1674, die auf die Möglichkeit der Veränderung der Eigenkapitalquote durch Währungsschwankungen hinweisen.
126
Kap. E: Erweiterungstatbestände
Diese Methode weist allerdings den Nachteil auf, daß sie zu mit den Wechselkursänderungen schwankenden und damit ökonomisch nicht mehr sinnvoll interpretierbaren DM-Wertansätzen der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden führt 63 . So erscheinen diesselben Vermögensgegenstände und Schulden zu jedem Stichtag mit einem anderen Wert64, eine DM-Aufwertung bedeutet eine prozentual gleiche Abschreibung auf alle Vermögensposten, während eine DM-Abwertung einer prozentual gleichen Zuschreibung zu allen Vermögensposten gleichkommt65 . Ferner führen DMAufwertungen zum Ausweis unrealisierter Gewinne bei den Verbindlichkeiten und DM-Abwertungen zum Ausweis unrealisierter Gewinne bei den Forderungen66 . So führt diese Methode bei Tochterunternehmen in Hochinflationsländern innerhalb kurzer Zeit zu völlig unrealistischen Wertansätzen 67 . (2) Modifizierte Stichtagskursmethode
Diese Mängel der reinen Stichtagskursmethode versucht die modifizierte Stichtagskursmethode zu vermeiden, indem sie das Eigenkapital zum historischen Kurs umrechnet und die damit auftretende Umrechnungsdifferenz erfolgsneutral als Eigenposten beim Eigenkapital aufweist68 . Somit vermittelt sie besser den tatsächlichen Wert des Eigenkapitals als die reine Stichtagskursmethode. Allerdings führt sie zur Entstehung von Umrechnungsdifferenzen in der Bilanz, die in diesem Fall in direkter Beziehung zum Eigenkapital stehen 69 . Negativ fällt auch ins Gewicht, daß bei dieser Methode die Währungsumrechnung in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht zum Stichtagskurs, sondern mit gewichteten Durchschnittskursen umgerechnet werden kann 7o .
62 Vgl. v. Wysocki, ZtbF 1971, S. 682, 692f.; v. Wysocki/Wohlgemuth, Konzemrechnungslegung, 3. Auflage, S. 181. 63 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 135; Coenenberg, lahresabschluß, 15. Auflage, S. 387. 64 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 297, Rn 738. 65 Vgl. Coenenberg, lahresabschluß, 15. Auflage, S. 389. 66 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 135. 67 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 135; Coenenberg,lahresabschluß, 15. Auflage, S. 387. 68 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 133; Coenenberg,lahresabschluß, 15. Auflage, S. 388; Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 126. 69 Vgl. Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 127; Müller, Herbert, Die Umrechnung, S. 102 f. 70 Vgl. Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 127.
I. Währungsumrechnung
127
cc) Kombination von globaler und lokaler Theorie: Die funktionale Umrechnungsmethode Die funktionale Umrechnungsmethode wurde vom US-amerikanischen Financial Accounting Standards Board (FASB) in seinem Statement No. 52 als offizielle Umrechnungsmethode entwickelt71 . Dem sind auch das englische Accounting Standards Comitte in seinem SSAP No. 20 und das International Accounting Standards Committe (IASC) im lAS No. 21 sowie das vom Accountig Advisory Forum der Europäischen Union vorgelegte Arbeitspapier vom Juli 1992 gefolgt72 . Sie versucht eine Überbrückung der Stichtagskurs- und der Zeitbezugsmethode und somit der globalen und der lokalen Theorie zu erreichen, indem sie unterscheidet in Tochterunternehmen, die relativ selbständig und weitgehend in die Wirtschaft des Sitzlandes integriert sind und solche, die sehr stark in den übrigen Konzern integriert und als quasi verlängerte Werkbank der Muttergesellschaft tätig sind73 . Um die Unternehmen nun einer dieser Gruppen zuordnen zu können, wird der Begriff der funktionalen Währung eingeführt, wobei als funktionale die Währung gilt, in der eine Gesellschaft Mittel erwirtschaftet und ausgibt74 . Im ersten Fall gilt die Währung des Sitzlandes des Tochterunternehmens als funktionale Währung und die Umrechnung erfolgt mit der erfolgsneutralen Stichtagskursmethode. Im zweiten Fall gilt die Währung des Sitzlandes der Muttergesellschaft als die maßgebende funktionale Währung und die Umrechnung erfolgt mit der erfolgs wirksamen Zeitbezugsmethode75. Auch diese Methode läßt sich mehrfach kritisieren. Zunächst läßt sie durch die Unterscheidung in selbständigen und integrierten Tochterunternehmen den Gesichtspunkt der Konzerneinheit vielfach zurücktreten76 . Darüber hinaus dürfte es schwierig sein, die nach der Einheitstheorie von den nach der lokalen Theorie umzurechnenden Unternehmen willkürfrei zu trennen, zumal zu bezweifeln ist, ob weitgehend selbständige Unternehmen über71 FASB, SFAS No. 52, Foreign Currency Translation, Stamford I Connecticut 1981, S. 5ff. 72 Vgl. ausführlicher Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 142f.; Küting I Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 127; GEFIU, DB 1993, S. 745, 747. 73 Vgl. Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 390; Schönborn, Funktionale Währungsumrechnung im Konzernabschluß, Idstein 1993, S. 89 f. 74 Vgl. Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 127. 75 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 298, Rn 739; Busse v. ColbelOrdelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 142; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 389f. 76 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 298, Rn 740; Busse v. Colbe, FS v. Wysocki, S. 143, 150f.; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, 143f.
128
Kap. E: Erweiterungstatbestände
haupt zum Konsolidierungskreis gehören 77 • Zu ihren Nachteilen gehört ferner, daß es zu zwei Umrechnungsmethoden in einem Konzernabschluß kommt78 , wobei auch die erhöhte Gefahr besteht, daß die beiden Methoden von der Konzernleitung mißbräuchlich angewandt werden können 79. Die funktionale Umrechnungsmethode wurde nicht vom Hauptfachausschuß des IDW in die Liste der grundsätzlich zulässigen Methoden für deutsche Konzerne aufgenommen 8o . 3. Währungsumrechnung und konzerneinheitliche Bewertung
Nachdem die gebräuchlichen Umrechnungsmethoden in ihren Grundzügen dargestellt sind, ergibt sich die Frage, ob es sich dabei um Bewertungsvorgänge handelt und ob sie dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Bewertung unterliegen. Nach einer in der Literatur verbreiteten Meinung stelle die Währungsumrechnung einen Bewertungsvorgang dar 8l . Denn sie stelle wie bei der bilanziellen Bewertung die Zuordnung eines Geldbetrages in der Währung des Konzernabschlusses zu Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Bilanzierungshilfen dar. In diesem Sinne sei die Währungsumrechnung genauso eine Bewertungsvorgang wie die Bewertung eines Warenvorrates oder einer zweifelhaften Forderung 82 . Demzufolge wäre die Währungs umrechnung auch dem Einheitlichkeitsgebot von § 308 Abs. 1 HGB unterzuordnen 83 • Auch wenn die Währungsumrechnung auf den ersten Blick alle Elemente eines Bewertungsvorganges aufzuweisen scheint, gibt es doch mehrere Aspekte, die näher untersucht werden müssen. So fällt sofort auf, daß das Gesetz eindeutig zwischen Bewertung und Umrechnung unterscheidet. In § 284 Abs. 2 Nr. 1 spricht es für den Iahresabschluß die Bewertungsmethoden an, ebenso in Nr. 3. Dagegen werden die Grundlagen für die Umrechnung in Deutsche Mark in Nr. 2 eigens erwähnt. Genauso ist es auf der Ebene des Konzernabschlusses in § 313 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 3 einer77 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 298, Rn 740; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 390. 78 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 298, Rn 740; Busse v. Colbe, FS v. Wysocki, S. 143, 150. 79 Vgl. Schönborn, Funktionale Währungsumrechnung, S. 97. 80 Vgl. IDW HFA, Währungsumrechnung im Jahres- und Konzernabschluß, WPg 1986, S. 664, 666. 81 Vgl. Biener / Schatzmann, Konzem-Rechungslegung, 1983, S. 61; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 186; Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 90f. 82 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 186. 83 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 186.
I. Währungsumrechnung
129
seits für die Bewertung, Nr. 2 andererseits für die Umrechnung84 . Aus dieser gesetzlichen Trennungslinie ergibt sich klar, daß die Vorschriften über die Bewertung nicht ohne weiteres, sondern allenfalls analog auf die Umrechnung anwendbar sind85 . Es gibt aber auch andere gewichtige Gründe, die für eine Unterscheidung zwischen Bewertung und Währungsumrechnung sprechen. Man spricht von Bewertung, wenn ein Vermögens gegenstand an einem Wertmaßstab gemessen wird; dieser Wertmaßstab ist die jeweilige nationale Währung 86 . Die Bewertung vollzieht sich also innerhalb einer Gesamtordnung, die ihrerseits auf die Bewertungsregeln einwirkt. Ein Regelungskomplex also aus rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten, geprägt durch die eigene Kultur und ihre Wert-, Zeit- und Funktionsvorstellungen gehen in die Bewertungsregeln hinein und prägen ihren Inhalt87 . Aber auch die so wichtige Annahme der Währungsstabilität (DM = DM) auf der das Anschaffungskostenprinzip und das Imparitätsprinzip beruhen und die stillschweigend mitgedachte Basis aller Wertvergleiche für jeden deutschen Jahres- oder Konzernabschluß ist, funktioniert eben nur innerhalb eines und desselben Währungskreises88 . Bei der Währungs umrechnung im Weitabschluß handelt es sich aber nicht um das Messen von Vermögensgegenständen an einer Währung, sondern einer Währung an einer anderen; es werden zwei Wertmaßstäbe, zwei globale Steuerungssysteme miteinander verglichen 89 . Den Stellenwert, den ein Vermögensgegenstand in einem anderen Koordinatensystem besitzt, kann der Gesetzgeber des Sitzstaates des Mutterunternehmens nicht vorausschauend rniterfassen 90 . Die Schwierigkeiten beruhen zu einem großen Teil also eben darauf, daß im Weitab schluß internationale Verhältnisse an Vorstellungen gemessen werden müssen, die für nationale Verhältnisse zugeschnitten sind91 • Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 304, Rn 758. Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 304f. Rn 758. 86 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 305, Rn 760. 87 Vgl. Großfeld, Sprache und Recht, JZ 1984, S. 1 ff.; ders., Einige Grundfragen des int. Unternehmensrechts, Opladen 1987, S. 22; ders., Gemeinsame Grundlagen des Europäischen Bilanzrechts, WPg 1988, S. 419ff.; ders., Zur Geschichte des Europäischen Bilanzrechts, FS Habscheid, S. 131 ff.; ders. Bilanzziele und kulturelles Umfeld, WPg 1994, S. 795ff.; ders., Zeichen und Bilder im Recht, NJW 1994, S. 1911 ff.; ders., Vergleichendes Bilanzrecht, AG 1995, S. 112ff. 88 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 305, Rn 761. 89 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 306, Rn 762; a. A. GEFlU, Stellungnahme des Arbeitskreises "Rechnungslegungsvorschriften der EG-Kommission", DB 1993, S. 745, 747; Busse v. Colbe/Ordelheide, a.a.O., S. 187; Müller, Herbert, RIW 1987, S. 854f., die auf eine Funktionsgleichheit der Währungsumrechnung im Jahres- und Konzernabschluß bestehen. 90 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 306, Rn 762. 91 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 309, Rn 771; ders., Der Buchstabe des Gesetzes, JZ 1987, S. 1 ff. 84 85
9 Xenides
130
Kap. E: Erweiterungstatbestände
Daraus ergeben sich wesentliche Unterschiede zwischen der Währungsumrechnung im Jahres- und der im Weltabschluß 92 • Während die erste zu Geldtransaktionen führt, werden im Weltabschluß nur ausnahmsweise Gegenstände in die Konzernwährung umgewechselt93 . Letzteres erlangt wegen des Grundsatzes der Unternehmens fortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 298 Abs. 1 HGB) einen besonderen Stellenwert für die Belange der Umrechnung: Das ausländische Unternehmen ist in eine fremde Umwelt eingebettet. Währungsschwankungen, die nicht direkten Einfluß auf seine Produktivität oder Gewinnchancen ausüben können, sind im Grunde für die Dauer seines Fortbestehens von geringer Bedeutung. Sein Wert in DM wird nur dann interessant, wenn es um den Schutz der Gläubiger des Mutterunternehmens geht, wenn die Möglichkeit einer Liquidierung der Tochtergesellschaft unmittelbar bevorsteht. Solange aber der Grundsatz der Unternehmensfortführung uneingeschränkte Anwendung auf Jahres- und Konzernabschluß findet, besteht nicht die Notwendigkeit den umgerechneten Abschluß mehrfachen Niederstwerttests zu unterziehen, wie es bei der Zeitbezugsmethode der Fall ist94 • Vieles spricht somit dafür, daß der Gesetzgeber die Währungsumrechnung nicht ausdrücklich zu den Bewertungsvorgängen zuordnen wollte sowie daß tatsächliche Gegebenheiten einer solchen Zuordnung entgegenstehen. Es ist aber nicht zu übersehen, daß sie doch der Bewertung sehr nahe steht. Es handelt sich mithin um eine Bewertung besonderer Art95 oder anders gesprochen um eine Bewertung im weiteren Sinne96 • Eine direkte Anwendung von § 308 HGB auf sie kommt nicht in Frage, denn Wertansätze von ausländischen Jahresabschlüssen werden gemäß § 308 vereinheitlicht (auf der Ebene der Handelsbilanz 11), bevor sie in die Konzernwährung umgerechnet werden97 • Unstreitig dürfte aber sein, daß auf die Währungsumrechnung die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Anwendung finden. So sind bei ihr der Grundsatz des Willkürverbots sowie der Grundsatz der Stetigkeit zu beachten 98 . Und vielmehr kommt angesichts der fehlenden gesetzlichen Regelung zur Währungsumrechnung der Generalnorm (§ 297 Abs. 2 Satz 2 HGB) als 92 Diese These wird mittlerweile auch vom Accounting Advisory Forum der EUKommission geteilt; vgl. dazu Ordelheide, FS Budde, S. 483, 501 ff. 93 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 307, Rn 764. 94 Vgl. Schildbach, Der handelsrechtliche Konzernabschluß, 4. Auflage, S. 131. 95 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 306, Rn 762. 96 Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 90f. und Reintges, WPg 1987, S. 282, 287f., verstehen die Währungsumrechnung als Bewertung im weiteren Sinne und fordern einheitliche Umrechnungsmethoden. 97 Vgl. Peemöller/Husmann, DB 1996, S. 101, 103. 98 Vgl. Küting/Weber, Der Konzernabschluß, 3. Auflage, S. 112f.
11. Konsolidierungsvorgänge
131
"lex generalis" besondere Bedeutung zu; es ist diejenige Umrechnungsmethode zu wählen, die der Generalnonn am besten gerecht wird99 . Die Währungsumrechnung stellt also keinen "typischen" Bewertungsvorgang dar, der sich eindeutig unter den Tatbestand von § 308 HGB subsumieren läßt. Trotzdem ist ihre bewertungsähnliche Natur aber auch nicht zu übersehen. Angesichts der fehlenden gesetzlichen Regelung erscheint geboten die Währungsumrechnungsmethoden stets mit Blick die Generalnonn (§ 297 Abs. 2 Satz 2 HGB) auszuüben 100. Dann scheint aber die parallele Anwendung von mehr als nur einer Umrechnungsmethoden im gleichen Konzernabschluß zwar denkbar, wohl aber eher die Ausnahme zu sein. Prinzipiell ist also einheitlich umzurechnen 101 . 11. Konsolidierungsvorgänge
Eine bloße Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen - selbst bei Vereinheitlichung des Ansatzes (§ 300 Abs. 2 HGB) und der Bewertung (§ 308 HGB) sowie Umrechnung der in fremder Währung lautender Posten in die Konzernwährung - reicht nicht aus, um den Konzern so darzustellen, als ob er insgesamt ein einheitliches Unternehmen wäre (§ 297 Abs. 3 Satz 1 HGB) 102. Dies wird erst möglich, wenn vom Konzernabschluß alle Positionen ausscheiden, die auf Beziehungen zwischen den einbezogenen Unternehmen beruhen und die im Jahresabschluß eines einheitlichen Unternehmens nicht erscheinen dürfen 103 . Dazu sieht das Gesetz für die Konzernbilanz die Kapitalkonsolidierung (Vollkonsolidierung: §§ 301, 302 HGB [ferner §§ 310 und 311 f. für die anteilmäßige Konsolidierung und für die Konsolidierung nach der sogenannten Equity-Methode]), die Schuldenkonsolidierung (§ 303 HGB) und die Zwischenerfolgseliminierung (§ 304 HGB) und für die Konzern-GuV 99 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 302, Rn 749; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 153; Schönborn, Funktionale Währungsumrechnung, S. 30; Wortmann, Fremdwährungsumrechnung, S. 19. 100 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 302, Rn 749; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 153. 101 Vgl. "Arbeitskreis Weltbilanz des Instituts der Wirtschaftsprüfer", 1977, (Abgedruckt bei v. Wysocki/Wohlgemuth, S. 302, Nr. III 2); Busse v. Colbe, FS v. Wysocki, S. 143, 150. 102 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 236, Rn 577; Küting, Konzernrechnungslegung nach neuem Recht, BBK 1988, S. 695; Coenenberg, lahresabschluß, 15. Auflage, S. 396. 103 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 236, Rn 577; Küting, BBK 1988, S.695. 9*
132
Kap. E: Erweiterungstatbestände
die Aufwands- und Ertragskonsolidierung (§ 305 HGB) vor 104 • Die Konsolidierungsvorgänge sind der zentrale technische Vorgang bei der Aufstellung des Konzernabschlusses 105 und stellen einen der wichtigsten Mittel der Konzernbilanzpolitik dar 106 . Deshalb muß geprüft werden, ob sich der Grundsatz der einheitlichen Bewertung auch die Bewertung bei den Konsolidierungsvorgängen umfaßt. 1. Kapitalkonsolidierung
Im Summenabschluß werden sowohl das Eigenkapital der Tochterunternehmen als auch die Beteiligungen des Mutterunternehmens, die dieses Eigenkapital repräsentieren, ausgewiesen. Dies stellt aber eine unzulässige Doppelerfassung dar, denn in einem "einzigen Unternehmen" (§ 297 Abs. 3 Satz 1 HGB) gibt es keine Anteile an einer Abteilung; dazu sind die im Summenabschluß ausgewiesenen Beteiligungen des Mutterunternehmens mit dem auf die Beteiligungen entfallenden Eigenkapital der entsprechenden Tochterunternehmen zu verrechnen 107. Hierbei stellt das Gesetz zur Verfügung die in § 301 HGB kodifizierte Erwerbsmethode, bekannt auch als ,,reine angelsächsische Methode" oder "purchase-method" und unter ganz besonderen Voraussetzungen als Wahlrecht zur Erwerbsmethode die Interessenzusammenführungsmethode (pooling-of-interests-method) in § 302 HGB I08 . In der Praxis ist allerdings die Interessenzusammenführungsmethode kaum von Bedeutung 109 • Bei der Quotenkonsolidierung (§ 310 HGB) und der Equity-Bewertung für assoziierte Unternehmen (§ 311 HGB) findet nur die Erwerbsmethode - unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten dieser Fälle - Anwendung HO. Dagegen sind die nach § 331 AktG a. F. vorgesehenen "deutsche Methode" und "modifizierte angelsächsische Methode" mit dem neuen Recht nicht mehr vereinbarllI . 104 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 236 ff.: Rn 577 ff.; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 396f. 105 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 236, Rn 577. 106 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 223. 107 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 238f., Rn 584; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 175; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 191; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 396; Küting, BBK 1988, S. 695,696. 108 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 242ff. (255ff.), Rn 589ff. (616ff.); Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 175; Küting, BBK 1988, S. 695f. 109 Vgl. Treuarbeit (Hrsg.), "Konzernabschlüsse '89", S. 77, Rn 110. 110 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 205. 111 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 241 f., Rn 587f.; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 176f.
II. Konsolidierungsvorgänge
133
a) Kapitalkonsolidierung nach der Erwerbsmethode
Bei der Kapitalkonsolidierung nach der Erwerbsmethode werden der Beteiligungsbuchwert aus dem Einzelabschluß des Mutterunternehmens und der Wert des auf die Beteiligung entfallenden Eigenkapitals des Tochterunternehmens nur einmal und zwar bei der ersten Einbeziehung als Tochterunternehmen in den Konzernabschluß miteinander verrechnet (Erstkonsolidierung). Alle folgenden Veränderungen erscheinen dagegen unmittelbar als Veränderung des Vermögens und des Eigenkapitals in der Konzernbilanz (Folgekonsolidierung) 112. Hierbei wird im Gegensatz zur deutschen und modifizierten angelsächsischen Methode unterstellt, daß das Mutterunternehmen nicht lediglich die Anteile am Eigenkapital des Tochterunternehmens, sondern auch die Vermögensgegenstände und Schulden des Tochterunternehmens einzeln erwirbt (Annahme des Einzelerwerbs)ll3. Dies macht eine Neubewertung aller dieser Posten zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung erforderlich; für diese Posten werden also fiktive Einzel-Anschaffungskosten angesetzt, die in der Regel den Zeitwerten entsprechen (fiktive Anschaffungskosten des Konzerns)"4. Auf diese Weise werden die den Vermögensgegenständen zugrundeliegenden stillen Rücklagen und stillen Lasten offengelegt, die ersten allerdings nur, solange die Summe der angenommenen Anschaffungskosten nicht den vom Mutterunternehmen für die Beteiligung bezahlten Kaufpreis übersteigt (pagatorisches Prinzip - § 301 Abs. 1 Satz 4 HGB)ll5. Hierbei sieht das Gesetz zwei Vorgehensweisen vor: Die Kapitalkonsolidierung nach der Buchwertmethode (§ 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB) und die Kapitalkonsolidierung nach der Neubewertungsmethode (§ 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 HGB)"6.
112 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 243, Rn 589; vgl. auch Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 398. 113 Vgl. Ordelheide, Anschaffungskostenprinzip im Rahmen der Erstkonsolidierung gern. § 301 HGB, DB 1986, S. 493; Groß/Schroff/v. Wysocki, Der Konzernabschluß nach neuem Recht, 2. Auflage, S. 132. 114 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 242, Rn 589. 115 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 178f.; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 398. 116 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 243, Rn 590; Baetge, 2. Auflage, S. 179; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 200; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 400.
134
Kap. E: Erweiterungstatbestände
aa) Buchwertmethode Bei der Kapitalkonsolidierung nach der Buchwertmethode wird im ersten Teilschritt der Buchwert der Beteiligung des Mutterunternehmens an dem zu konsolidierenden Tochterunternehmen mit dem anteiligen Eigenkapital des betreffenden Tochterunternehmens verrechnet (§ 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB)!17. Das Eigenkapital des Tochterunternehmens wird angesetzt mit dem Buchwert der Handelsbilanz 11, nachdem das Vollständigkeitsgebot (§ 300 Abs. 2 HGB) und die einheitliche Bewertung (§ 301 Abs. I Satz 2 Nr. 1 a.E., § 308 Abs. 2 HGB) beachtet sind und - für ausländische Unternehmen - auch die Umrechnung in die Konzernwährung stattgefunden hat 118. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert nicht mit dem gesamten Eigenkapital des Tochterunternehmens verrechnet (trotz der Übernahme des gesamten Vermögens des Tochterunternehmens in den Konzernabschluß Vollkonsolidierung), sondern lediglich mit dem der Höhe der Beteiligung entsprechenden anteiligen Eigenkapital 119 . Da sich hierbei im Regelfall Beteiligungsbuchwert und anteiliges Eigenkapital nicht entsprechen, ergibt sich eine Aufrechnungsdifferenz, die aktiver (Beteiligungsbuchwert > anteiliges Eigenkapital) oder passiver (Beteiligungsbuchwert < anteiliges Eigenkapital) Natur sein kann 120. Bei einer aktivischen Differenz ist anzunehmen, daß beim Tochterunternehmen stille Rücklagen oder nicht bilanzierte oder nicht bilanzierungsfähige Vermögensgegenstände enthalten sind oder daß positive Zukunftschancen des Unternehmens (Geschäftswert, Goodwill) abgegolten wurden. Bei einer passivischen Differenz dagegen wurde ein geringerer Preis für das anteilige Eigenkapital bezahlt, als ihn die entsprechenden Buchwerte in der Handelsbilanz 11 des Tochterunternehmens ergeben würden; dies läßt sich auf eine Überbewertung von Aktiva oder Unterbewertung von Passiva im Einzelabschluß des Tochterunternehmens oder negative Zukunftschancen (Badwill) des erworbenen Unternehmens oder einen Erwerb unter dem tatsächlichen Wert (lucky buy) zurückführen 121 . Im zweiten Teilschritt wird die Aufrechnungsdifferenz den Bilanzposten des Tochterunternehmens insoweit zugerechnet, als deren Zwei werte höher oder niedriger sind als die in der Handelsbilanz 11 ausgewiesenen Buch117 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 188; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 401; Müller, Horst, Konzernabschluß nach neuem Bilanzrecht aus der Sicht des Analysten, in: Mellwig/Moxter/Orde1heide (Hrsg.), EinzeIabschluß und Konzemabschluß, S. 141, 147. 118 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 243, Rn 591. 119 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 180, 188. 120 Vgl. Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 401 f. 121 Vgl. Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 402.
II. Konsolidierungsvorgänge
135
werte. Hierbei wird ein aktivischer Unterschiedsbetrag durch die Aufdekkung von stillen Lasten (uneingeschränkt) erhöht, während die Aufdeckung von stillen Rücklagen zu seiner Verminderung führt 122. Allerdings darf eine aktivische Aufrechnungsdifferenz durch die Aufdeckung stiller Rücklagen nicht zu einer passivischen werden und genauso darf sich eine passivische Differenz nicht durch die Aufdeckung stiller Rücklagen erhöhen (Anschaffungskostenprinzip ) 123 . Wenn nach der Zuordnung einer aktivischen oder passivischen Aufrechnungsdifferenz zu den Vermögensgegenständen und Schulden ein Restbetrag bleibt, dann handelt es sich um einen Unterschiedsbetrag der in der Konzernbilanz als "Geschäfts- oder Firmenwert" bzw. als "Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung" auszuweisen ist l24 . bb) Neubewertungsmethode Im Gegensatz zur Buchwertmethode werden bei der Neubewertungsmethode gemäß § 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 HGB zunächst die stillen Rücklagen und stillen Lasten der in der Handelsbilanz 11 ausgewiesenen Bilanzposten in einer Handelsbilanz III aufgedeckt 125. Die Handelsbilanz III weist also die Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Bilanzierungshilfen und Sonderposten des Tochterunternehmens zu Zeitwerten und nicht - wie die Handelsbilanz 11 - zu Buchwerten aus l26 . Allerdings ist auch hier das Anschaffungskostenprinzip zu beachten, so daß eine vollständige Aufdeckung von stillen Rücklagen nur dann möglich ist, wenn das zu Zeitwerten angesetzte Eigenkapital des Tochterunternehmens nicht die Anschaffungskosten des Mutterunternehmens für die Beteiligung am Tochterunternehmen übersteigt l27 . Im Unterschied zur Buchwertmethode sind die Differenzen zwischen Zeitwerten und Buchwerten nicht nur anteilig, sondern in ihrer voller Höhe aufzudecken: Stille Rücklagen und stille Lasten wirken sich dadurch in voller Höhe auf das Eigenkapital des Tochterunternehmens aus, während bei der Buchwertmethode nur der Anteil der stillen Rücklagen und stiller Lasten zum Ausweis gelangt, der auf das Mutterunternehmen entfällt. Dies Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 189. Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 244, Rn 593; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 217. 124 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 244, Rn 595. 125 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 250ff., Rn 608ff.; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 200; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 406. 126 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 200; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 406f. . 127 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 251, Rn 609. 122 123
136
Kap. E: Erweiterungstatbestände
führt zu abweichenden Ergebnissen von der Buchwertmethode, wenn am Tochteruntemehmen auch Minderheitsgesellschafter beteiligt sind l28 . Im zweiten Teilschritt - also nach der Aufdeckung der stillen Rücklagen und stillen Lasten - wird das neubewertete Eigenkapital mit dem Beteiligungsbuchwert verglichen, wobei das Eigenkapital anteilig in Höhe der Beteiligung des Mutteruntemehmens an dem Tochteruntemehmen berücksichtigt wird l29 . Der nach dieser Aufrechnung verbleibende aktivische Unterschiedsbetrag ist als Geschäfts- oder Firmenwert auszuweisen (§ 301 Abs. 3 Satz 1 HGB); denn er entspricht dem Betrag, den das Mutterunternehmen über den Zeitwert der Aktiva und Passiva des Tochteruntemehmens hinaus für die Anteile gezahlt hat 130. Ein passivischer Unterschiedsbetrag kann bei der Neubewertungsmethode dagegen nicht entstehen, denn das neubewertete Eigenkapital des Tochteruntemehmens darf den Buchwert der Beteiligung nicht übersteigen (§ 301 Abs. 1 Satz 4 HGB)131. cc) Einheitliche Bewertung bei der Kapitalkonsolidierung nach der Erwerbsmethode Auch die Konsolidierungsvorgänge weisen also einen starken bewertungsrelevanten Charakter auf: Es handelt sich um eine Bewertung auf einer dritten Ebene (Handelsbilanz I, 11, III), deren Gegenstand die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden des Einzelunternehmens "Konzern" ist 132 . Hierbei ist vor allem an die Wahl zwischen Buchwert- und Neubewertungsmethode sowie an die Verteilung der stillen Rücklagen auf die einzelnen Vermögensposten nach der Bewertung zu Zeitwerten zu denken. Wie schon erläutert wurde, kann die Wahl zwischen der Buchwert- oder der Neubewertungsmethode erheblichen Einfluß auf die Höhe des Eigenkapitals des Tochterunternehmens und des Konzerns haben und bei Vorliegen von Minderheitsgesellschaftern auch den Ausweis ihrer Vermögensposition erheblich beeinflussen. Denn nur die Neubewertungsmethode führt zur Offenlegung der den Minderheitsanteilen entsprechenden stillen Rücklagen. Eine zumindest gleichförmige Ausübung der Wahlmöglichkeiten bei allen Tochterunternehmen erscheint von daher wünschenswert 133. 128 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 253f., Rn 612ff.; Küting, BBK 1988, S. 695, 700. 129 Vgl. Baetge, Konzembilanzen, 2. Auflage, S. 202. 130 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 252, Rn 610. 131 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 252, Rn 610; a.A. Coenenberg, lahresabschluß 15. Auflage, S. 407, der einen solchen Unterschiedsbetrag für möglich hält, wenn am Beteiligungsbuchwert zwischenzeitlich abgeschrieben worden ist. 132 Vgl. Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 86. 133 Vgl. Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 84.
11. Konsolidierungsvorgänge
137
Große Bewertungsspielräume existieren aber auch bei der Bestimmung der Zeitwerte der Vermögensgegenstände und Schulden sowie bei der Verteilung der aufgedeckten stillen Rücklagen und stillen Lasten auf die einzelnen Bilanzposten134. Selten werden nämlich für ein ganzes Unternehmen die Zeitwerte der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden im Detail zu ermitteln und damit objektivierbar sein 135. Es ist zwar möglich der Konsolidierung ein Bewertungsgutachten zugrundezulegen. Seine Objektivität ist allerdings nicht hinreichend gewährleistet,136 weil hierbei auch die Bewertungsregeln für den Erwerb ganzer Unternehmen ausscheiden 137. Sowohl bei der Buchwert- als auch bei der Neubewertungsmethode stellen die Anschaffungskosten der Beteiligung die Obergrenze für die Aufdekkung stiller Rücklagen dar (stille Lasten dürfen dagegen in voller Höhe aufgedeckt werden) 138. Somit stellt sich die Frage, wie zu verfahren ist, wenn die stillen Rücklagen den einzelnen Vermögensgegenständen und Schulden nicht vollständig zugeordnet werden dürfen. Das Gesetz stellt insofern keine eindeutigen Vorgaben 139. So werden im Schrifttum verschiedene Vorgehen vorgeschlagen, wie die Zuordnung des Unterschiedsbetrages zu den Bilanzposten nach deren Liquidierbarkeit oder nach deren Rentabilität oder nach der Bedeutung der stillen Rücklagen, die sich hinter den Bilanzposten verbergen (nicht aber nach der Bedeutung der angesetzten Posten, da Posten mit nur geringem Buchwert unter Umständen erhebliche stille Rücklagen verbergen können) oder aber proportional zu allen Bilanzposten 140. Hierbei handelt es sich um Bewertungsvorgänge, freilich auf einer anderen Ebene l41 . Das Problem stellt sich nicht wie bei der Handelsbilanz 11 aus der Sicht der Überwindung der rechtsform- oder bilanzpolitischbedingten Vielfalt bei der Bewertung, wohl aber gibt es eine Parallelität zur Bewertung im Einzelabschluß 142. Mithin muß bei den im Gesetz bestehen134 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 221 ff.; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 218. 135 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 223. 136 Baetge, ebenda. 137 Vgl. dazu Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 246, Rn 597; ders., Unternehmens- und Anteilsbewertung im Gesellschaftsrecht, 3. Auflage, Köln 1995; ders., Unternehmensbewertung als Rechtsproblem, JZ 1981, S. 641 ff. 138 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 221; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 218ff. 139 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 244, Rn 594; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 221. 140 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 223; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 218 ff. 141 Vgl. Reintges, WPg 1987, S. 282, 287. 142 Vgl. Reintges, WPg 1987, S. 282, 287.
138
Kap. E: Erweiterungstatbestände
den Ennessensspielräumen auch bei der Kapitalkonsolidierung einheitlich bewertet werden l43 . Die Tatsache, daß hierbei dem Gebot der Willkürfreiheit und vor allem der Generalnonn (§ 297 Abs. 2 Satz 2 HGB) besondere Bedeutung zukommt l44 , bestätigt es.
b) Kapitalkonsolidierung nach der Interessenzusammenjührungsmethode Durch die Umsetzung von Art. 20 der 7. EG-Richtlinie ist zum ersten Mal in Deutschland die Kapitalkonsolidierung bei Interessenzusammenführung (Interessenzusammenführungsmethode, in den USA bekannt als "pooling of interests method", in Großbritannien als "merger accounting") eingeführt worden 145. Im Gegensatz zur Erwerbsmethode wird bei ihr nicht von dem Erwerb aller Aktiva und Passiva des Tochterunternehmens durch das Mutterunternehmen, sondern von einer Fusion der bei den Unternehmen, von der Zusammenfassung der Ressourcen beider Unternehmen in einem Unternehmensverbund ausgegangen 146. Die als Wahlrecht zur Erwerbsmethode in HGB vorgesehene Interessenzusammenführungsmethode knüpft an drei Voraussetzungen an: (I)
Die Beteiligung des Mutterunternehmens muß mindestens 90 % des Nennbetrags bzw. des rechnerischen Wertes der Anteile des Tochterunternehmens betragen (§ 302 Abs. 1 Nr. 1 HGB)
(11) Die Beteiligung muß durch ein Anteilstausch erworben worden sein (§ 302 Abs. 1 Nr. 2 HGB) (III) Eine eventuelle Barabfindung darf 10% des Betrages der ausgegeben Anteile nicht übersteigen (§ 302 Abs. 1 Nr. 3 HGB) Bei der Interessenzusammenführungsmethode wird nicht der Beteiligungsbuchwert des Mutterunternehmens mit dem anteiligen Eigenkapital des Tochterunternehmens wie bei der Erwerbsmethode (§ 301 Abs. 1 Satz 1 HGB) verrechnet; es wird lediglich das anteilige gezeichnete Kapital des Tochterunternehmens mit dem Beteiligungsbuchwert verrechnet 147. Hierbei 143 Vgl. Busse v. Colbe I Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 220; Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 86f.; Reintges, WPg 1987, S. 282, 287. 144 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 244, Rn 594; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 221. 145 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 255, Rn 616; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 232; Busse v. Colbe/Ordelheide Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 312; Coenenberg, lahresabschluß, 15. Auflage, S. 414. 146 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 255, Rn 616; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 232 f. 147 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 255, Rn 618.
11. Konsolidierungsvorgänge
139
werden die Vennögensgegenstände und Schulden der bei den Unternehmen mit den Buchwerten der Einzelbilanz - vorbehaltlich ihrer Korrektur in der Handelsbilanz 11 - in die Konzernbilanz übernommen, ohne daß ihnen dabei Neuwerte zugewiesen und stille Rücklagen und stille Lasten aufgedeckt werden 148. Die Konsolidierungsbuchungen bleiben grundsätzlich auch bei den Folgekonsolidierungen identisch l49 . Somit wird deutlich, daß bei dieser Konsolidierungsmethode keine zusätzlichen Bewertungsprobleme auftauchen. Die Vereinheitlichung der Bewertungsmethoden erfolgt in der Handelsbilanz 11 (für den Fall, daß nicht schon in der Jahresbilanz einheitlich bewertet wurde) und die Werte werden lediglich für die Konsolidierungszwecke unverändert übernommen l50 . 2. Schuldenkonsolidierung
Der Fiktion der rechtlichen und wirtschaftlichen Einheit des Konzerns
(§ 297 Abs. 3 Satz 1 HGB) entsprechend sind Forderungen und Verbind-
lichkeiten zwischen den in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen wegzulassen. Ein rechtlich selbständiges Unternehmen kann in seiner Bilanz keine Forderungen oder Verbindlichkeiten gegen sich selber aufweisen (§ 303 Abs. 1 HGB)151. Der Begriff "Schulden" ist hierbei weit auszulegen, so daß § 303 Abs. 1 HGB alle Bilanzposten erfaßt, durch die Schuldverhältnisse zwischen den in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen abgebildet werden i52 . Wenn innerkonzernliche Ansprüche und Verbindlichkeiten ebenso hoch sind, wirkt sich die Schuldenkonsolidierung weder auf das Ergebnis noch auf das Eigenkapital aus; sie verkürzt lediglich die Bilanz 153. Doch können sich dabei auch (echte) Aufrechnungsdifferenzen ergeben, die sich durch die Anwendung konzerneinheitlicher Bewertungsmethoden in der Handelsbilanz 11 nicht venneiden lassen i54 . Sie sind meistens auf das Impa148 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 255, Rn 618; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 234. 149 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 246. 150 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 241 f. 151 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 257f., Rn 622; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 323; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 396; Küting, BBK 1988, S. 695, 710. 152 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 258, Rn 622; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 253; Biener/Bemeke, Bilanzrichtlinien-Gesetz, S. 340; Fischer, in Beck'sches HdR, C 420, S. 2, Rn 2. 153 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 259, Rn 626; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 260f. 154 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 263.
140
Kap. E: Erweiterungstatbestände
ritätsprinzip oder die Umrechnung von Fremdwährungsforderungen zurückzuführen 155 • Das Gesetz sieht nichts über die Behandlung dieser Differenzen vor. In der Praxis werden sie allerdings entweder erfolgswirksam in der KonzernGewinn- und Verlustrechnung verrechnet oder aber mit dem Eigenkapital verrechnet 156 oder aber in einem gesonderten Posten ausgewiesen l57 . Doch obwohl die Konzernbilanz je nach Behandlung der Differenzen unterschiedlich aussehen kann, handelt es sich dabei nicht um einen Bewertungsvorgang. Denn bei der Schuldenkonsolidierung werden keine Schulden und keine Forderungen neu bewertet, sondern sie werden mit den Werten aus der Handelsbilanz 11 unverändert übernommen und gegeneinander aufgerechnet. Aufrechnungsdifferenzen sind also keine vorhandenen Positionen, die erst bewertet werden müssen, sondern sie entstehen, wenn solche Positionen bewertet werden I58 . Bei der Schuldenkonsolidierung handelt es sich also um keinen Bewertungsvorgang. 3. Zwischenergebniseliminierung
Nach dem Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB) sind Güter und Leistungen, die ein Unternehmen selbsterstellt hat, solange mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen, bis sie durch Veräußerung das Unternehmen verlassen, sofern nicht ein niedrigerer Wert (etwa aus einer außerplanmäßigen Abschreibung auf den niedrigeren Stichtagswert) anzusetzen ist l59 • Da der Konzernabschluß aber gemäß der Einheitstheorie den Konzern so darstellen soll, als ob er ein einziges Unternehmen wäre (§ 297 Abs. 3 Satz 1 HGB), stellen innerkonzernliche Transaktionen aus der Konzernsicht keine wahre Realisation im Sinne von § 252 Abs. 1 Nr. 4 dar und die daraus stammenden Ergebnisse müssen aus der Konzernbilanz verschwinden 160. Aus der Sicht des Konzerns ist ein Ergebnis erst durch den Verkauf an einen Konzernfremden als realisiert anzusehen 161. Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 259 Rn 626. Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 259, Rn 626; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 444f. 157 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 328f. 158 Vgl. Meinhold-Heerlein, Der Einheitlichkeitsgrundsatz, S. 89. 159 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 33f., Rn 76; Baetge, Herstellungskosten: Vollaufwand versus Teilaufwand, FS Ludewig, S. 53, 58; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 29f.; BuddelGeißler, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 252 HGB, Rn 43 ff. 160 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 260, Rn 629; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 426. 161 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 260, Rn 629; AlD/S, 6. Auflage, § 304 HGB, Rn 1; Küting, BBK 1988, S. 695, 725; Weber, in Küting/Weber, HdKR, § 304 HGB, Rn 2. 155
156
H. Konsolidierungsvorgänge
141
Unter Zwischenergebnis ist also die Differenz zwischen dem Wertansatz eines konzernintern gelieferten Vermögensgegenstandes in der Handelsbilanz II eines einbezogenen Konzernunternehmens und dem Wert, der diesem Gegenstand aus Konzernsicht zukommt, zu verstehen 162. Das Gesetz schreibt die Eliminierung dieser Differenzen vor, indem es in § 304 Abs. 1 HGB anordnet, daß Vermögensgegenstände, die auf Lieferungen oder Leistungen zwischen in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen beruhen, in der Konzernbilanz mit einem Betrag anzusetzen sind, "zu dem sie ... angesetzt werden könnten, wenn die in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen auch rechtlich ein einziges Unternehmen bilden würden" (Konzernkosten). Konzernkosten sind in Anlehnung an die Begriffe des Jahresabschlusses die Konzernanschaffungs- und Konzernherstellungskosten (§ 298 Abs. 1 i. V. m. § 255 Abs. 1 - 3 HGB)163. Nach § 255 Abs. 1 i. v.m. § 298 umfassen die Konzernanschaffungskosten sämtliche Aufwendungen, die ein in den Konzernabschluß einbezogenes Unternehmen leisten muß, um ein Vermögensgegenstand von einem nicht einbezogenen Unternehmen zu erwerben und in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem einzelnen Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können; hierbei ergeben sich keine Ermessensspielräume 164. Konzernherstellungskosten (§ 255 Abs. 2 und 3 i. V. m. § 298 Abs. 1 HGB) sind direkt zurechenbare Ausgaben, die entstehen, wenn ein Vermögens gegenstand hergestellt, erweitert oder über seinen ursprünglichen Zustand hinaus wesentlich verbessert wird l65 . Bei deren Bestimmung besteht eine große Bahnbreite zwischen den angefallenen Einzelkosten als Mindestwertansatz und der Summe aus Einzel- und Gemeinkosten als Wertobergrenze 166. Konzernherstellungs- und Konzernanschaffungskosten entsprechen grundsätzlich den Kosten bei den einzelnen Konzernunternehmen (abgesehen natürlich von den in letzteren enthaltenen Zwischengewinnen und Zwischenverlusten). Differenzen ergeben sich allerdings aus der Tatsache, daß im Konzernabschluß als Abschluß des einheitlichen Unternehmens Konzern gewisse Kosten nicht aktivierungsfähig sind, während sie in den Einzelbi162 Vgl. Coenenberg, lahresabschluß, 15. Auflage, S. 427; vgl. auch ausführliche Begriffsbestimmung bei Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 277 f. 163 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 261, Rn 632; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 289ff.; Coenenberg, lahresabschluß, 15. Auflage, S. 428. 164 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 289 f.; Barteis, Zwischenergebniselirninierung und konzerneinheitliche Bewertung, WPg 1991, S. 739, 741; Coenenberg, lahresabschluß, 15. Auflage, S. 428. 165 Vgl. Biener / Bemeke, Bilanzrichtlinien-Gesetz, S. 346. 166 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 290f.; Barteis, WPg 1991, S. 739, 741; Coenenberg, lahresabschluß, 15. Auflage, S. 428.
142
Kap. E: Erweiterungstatbestände
lanzen der Konzernunternehmen durchaus ansatzfähig waren (Herstellungskostenminderungen - z. B. Lizenzgebühren) oder aber im Konzernabschluß ansatzfähig sind, während sie in den Einzelbilanzen nicht ansatzfähig waren (Herstellungskostenmehrungen - z. B. Transportkosten) 167. Damit wird deutlich, daß der Begriff "Zwischenergebnis" nicht nur aus einem "Gewinn" oder "Verlust", sondern auch aus bewertungsabhängigen Bestandteilen besteht 168 . Bei der Bestimmung der Konzernanschaffungsbzw. Konzernherstellungskosten handelt es sich um Bewertung i. S. d. §§ 252ff. HGB, wobei bewertungsrelevante Ermessensspielräume bei der Bestimmung der Konzernkosten nach einhelliger Meinung gemäß § 308 HGB einheitlich ausgeübt werden müssen 169 . Allerdings geht die herrschende Meinung davon aus, daß eine einheitliche Bewertung getrennt für die Handelsbilanz 11 der Konzernunternehmen und den Konzernabschluß erfolgen darf, so daß etwa in den Handelsbilanzen 11 zu Teilkosten, in der Konzernbilanz dagegen zu Vollkosten bewertet werden kann l7o . Eine solche Lösung gäbe der Konzernführung unzweifelhaft ein bedeutendes Instrument bei ihrer konzernbilanzpolitischen Überlegungen 171 . Nach diesem Konzept können Vermögensgegenstände zu einem Konzernhöchstwert, zu einem Konzernmindestwert oder zu einem Wert zwischen dem Konzernhöchst- und dem Konzernmindestwert bilanziert werden 172. Die Höhe des zu eliminierenden Zwischenergebnisses ergibt sich aus dieser Festlegung 173 . Demnach liegt ein eliminierungspflichtiger Gewinn vor, wenn der Wert in der Handelsbilanz 11 größer als der Konzernhöchstwert ist. Darüber hinaus kann aber auch ein eliminierungsfähiger Zwischengewinn vorliegen, wenn der Handelsbilanz lI-Wert auf einen zwischen Konzernhöchst- und Konzernmindestwert liegenden bestimmten Wert abgewertet werden soll174. Andererseits liegt ein eliminierungspflichtiger Zwischen167 Vgl. Oroßfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 261, Rn 632; Weber, in Kütingl Weber, HdKR, § 304 HOB, Rn 41. 168 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 281 ff.; Weber, in Küting/Weber, HdKR, § 304 HOB, Rn 52 ff. 169 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 299; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 384ff.; Coenenberg, lahresabschluß, 15. Auflage, S. 431; Küting/Weber, Einzelfragen der Eliminierung von Zwischenergebnissen, ZfB 1987, Ergänzungsheft 1, S. 299, 311. 170 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 304 HOB, Rn 29; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 384ff.; Küting/Weber, ZfB 1987, Sonderheft 1, S. 299, 311; Weber, in Küting/Weber, HdKR, § 304, Rn 62ff. 171 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 301. 172 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 295, 299. 173 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 299. 174 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 299f.; Küting, BBK 1988, S. 695, 726; Weber, in Küting I Weber, HdKR, § 304 HOB, Rn 52.
11. Konsolidierungsvorgänge
143
verlust vor, wenn der Wert in der Handelsbilanz 11 kleiner als der Konzernmindestwert ist 175 • Des weiteren besteht aber ein eliminierungsfähiger Zwischenverlust, wenn der Wert aus der Handelsbilanz 11 auf einen zwischen Konzernmindest- und Konzernhöchstwert liegenden Wert aufgewertet werden SOll176. Allerdings wird diese bilanzpolitisch großzügige Erweiterung des Ermessensspielraums auch auf eliminierungsfähige Zwischengewinne bzw. Zwischenverluste durch die zeitliche Stetigkeit auf nur die Erstkonsolidierung begrenzt 177. Vielmehr sollte aber davon ausgegangen werden, daß sich die Konzernwerte von den Handelsbilanz lI-Werten - neben den eigentlichen, auf konzerninternen Lieferungen und Leistungen beruhenden Zwischenerfolgen - lediglich um Herstellungskostenmehrungen bzw. Herstellungskostenminderungen unterscheiden. Sie sind also lediglich um solche Aufwendungen zu erhöhen, die aus Konzernsicht, nicht aber aus der Sicht des einzelnen Konzernunternehmens Herstellungskosten darstellen (z. B. Transportkosten), bzw. um solche Aufwendungen zu mindern, die aus der Sicht des Einzelunternehmens, nicht aber aus Konzernsicht die Herstellungskostendefinition erfüllen (z. B. Lizenzkosten) 178. Eine unterschiedliche Ausübung der Bewertungswahlrechte zwischen Handelsbilanz 11 und Konzernbilanz läßt sich aber nicht rechtfertigen 179. Die einheitliche Ausübung der Bewertungswahlrechte in den Handelsbilanzen 11 legt auch den Umfang der Konzernherstellungskosten fest 180 . Ausnahmen sind nur im Rahmen der für die konzerneinheitliche Bewertung vorgesehenen Ausnahmen möglich. 4. Aufwands- und Ertragskonsolidierung
Ebenso wie die Konzernbilanz ist auch die Konzern-Gewinn und -Verlustrechnung entsprechend der Fiktion der rechtlichen Einheit des Konzerns so darzustellen, als ob der Konzern ein einziges Unternehmen wäre 181 . Deshalb dürfen in der Konzern-Gu V außer den Bestandsveränderungen und 175 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 300; Weber, in Küting/Weber, HdKR, § 304, Rn 57. 176 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 300; Weber, in Küting/Weber, HdKR, § 304, Rn 57. 177 Vgl. Ruhnke, Zur Problematik der Bestimmung der Konzemherstellungskosten, WPg 1991, S. 377, 381. 178 Vgl. Barteis, WPg 1991, S. 739, 744. 179 Vgl. Barteis, WPg 1991, S. 739, 743; ähnliche Ansätze lassen sich auch bei Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 301, 315, feststellen. 180 Vgl. Barteis, WPg 1991, S. 739, 743f. 181 Vgl. Reinhard, in Küting/Weber, HdKR, § 305 HGB, Rn 4.
144
Kap. E: Erweiterungstatbestände
den anderen aktivierten Eigenleistungen nur die Aufwendungen und Erträge ausgewiesen werden, die aus dem wirtschaftlichen Verkehr mit konzernfremden Unternehmen entstanden sind (§ 305 HGB)182. Deshalb muß aber im ersten Schritt der Grundsatz der Einheitlichkeit von Ansatz (§ 300 Abs. 2 HGB) und Bewertung (§ 308 HGB) in einer Gewinn und Verlustrechnung 11 berücksichtigt werden 183 . Falls also die KonzernGu V nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt werden soll, müssen die Gewinn- und Verlustrechnungen der einbezogenen Unternehmen, die nach dem Umsatzkostenverfahren aufgestellt wurden in der GuV 11 nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt werden und umgekehrt; ebenso müssen kleine und mittelgroße Konzernunternehmen, die die Erleichterungen des § 276 HGB in Anspruch genommen haben, die zusammengefaßten Posten entschlüsseln. Darüber hinaus müssen die Gewinn- und Verlustrechnungen ausländischer Konzernunternehmen in die Konzernwährung umgerechnet werden I 84. Auf der Konsolidierungsebene besteht ebenso wie bei der Zwischenergebniseliminierung die Möglichkeit die selbsterstellten, konzernintern verkauften Vermögensgegenstände zu Konzernhöchstwerten, Konzernmindestwerten oder zu einem Wert zwischen Konzernmindestwert und Konzernhöchstwert anzusetzen. Hierbei kann der Ansatz solcher Vermögens gegenstände nach dem Gesamtkosten- oder nach dem Umsatzkostenverfahren bzw. zu Vollaufwand oder Teilaufwand unterschiedlichen Einfluß auf das Jahresergebnis in der Konzern-GuV haben 185 . Deshalb muß auch bei der Aufwands- und Ertragskonsolidierung in der Konzern-GuV einheitlich bewertet werden. III. Einheitliche Bewertung bei Gemeinschaftsunternehmen 1. Begriff des Gemeinschaftsunternehmens - Quotenkonsolidierung
In Ausübung des Mitgliedstaatenwahlrechts aus Art. 32 der 7. Richtlinie hat das HGB in § 310 für Gemeinschaftsunternehmen - andere Bezeichnungen sind joint ventures, Partnerschafts-Unternehmen, partnership investments oder jointly owned companies l86 - als Wahlrecht die anteilmäßige Vgl. AlD/S, 6. Auflage, § 305 HGB, Rn 5. Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 326. 184 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 326f. 185 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 349 ff. 186 Zu den termini vgl. Zündorf, Horst, Quotenkonsolidierung versus Equity-Methode, Stuttgart 1987, S. 6f.; ders., Zum Begriff des Gemeinschaftsunternehmens in § 310 HGB, in: BB 1987, S. 1910, 1911. 182 183
III. Einheitliche Bewertung bei Gemeinschaftsunternehmen
145
Konsolidierung (Quotenkonsolidierung) übernommen 187. Ein Gemeinschaftsunternehmen im Sinne von § 310 HGB liegt dabei vor, wenn ein in den Konzernabschluß einbezogenes Unternehmen gemeinsam mit einem oder mehreren nicht einbezogenen Unternehmen ein anderes Unternehmen führt 188 . Die gemeinsame Führung durch die Gesellschafterunternehmen fällt in der Regel mit paritätischer Beteiligung der Gesellschafterunternehmer je zur Hälfte, zu einem Drittel oder einem Viertel am Kapital des Gemeinschaftsunternehmens zusammen. Ein Gemeinschaftsunternehmen kann aber auch bei imparitätischer Beteiligung der Gesellschafterunternehmer vorliegen; dann ist allerdings eine vertragliche Vereinbarung über die Ausübung der Stimmrechte bei Gesellschafterbeschlüssen und der gemeinsamen Führung im Regelfall erforderlich 189. Bei den verschiedenen Abstufungen, die das Verhältnis eines abhängigen Unternehmens beim Übergang von Konzern zum Markt aufweisen kann, nehmen Gemeinschaftsunternehmen den zweiten Platz ein 190. Eine anteilmäßige Konsolidierung ist somit nur zulässig bei Unternehmen, die keine Tochterunternehmen im Sinne des § 290 Abs. 1 und 2 HGB sind l91 . Das Wort "darf' in § 310 Abs. 1 HGB gibt kein Wahlrecht im Verhältnis zur Vollkonsolidierung, vielmehr handelt es sich dabei um eine Alternative zur Equity-Methode gemäß §§ 311, 312 HGB I92 . Im übrigen aber erfolgen die Konsolidierungsvorgänge bei Gemeinschaftsunternehmen im Großen und Ganzen wie bei der Vollkonsolidierung, nur daß Vermögensgegenstände und 187 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 310 HGB, Rn 2; BuddelSuhrbier, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 310 HGB, Rn 1; Sigle, in Küting/Weber, HdKR, § 310 HGB, Rn I; Zum Begriff des Gemeinschaftsunternehmens nach lAS siehe, Ruhnke/Kluge, Gemeinschaftsunternehmen im Konzernabschluß nach International Accounting Standards und HGB, RlW 1996, S. 577ff. 188 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 271, Rn 663; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 359ff.; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 453f.; Coenenberg, lahresabschluß, 15. Auflage, S. 416. 189 Vgl. Busse v. Colbe I Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 458; Zündorf, BB 1987, S. 1910, 1913. 190 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 357; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 453. 191 Vgl. BT-Drucks. 10/3440, S. 40; a.A. Hoffmann-Becking/Rellermeyer, Gemeinschaftsunternehmen im neuen Recht der Konzemrechnungslegung, FS Goerdeler, S. 199, 211 ff., die eine gleichzeitige Anwendung von § 290 Abs. 1 HGB und § 310 HGB für zulässig halten. 192 Vgl. BT-Drucks. 10/4268, S. 116; Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 270, Rn 660; AIDIS, 6. Auflage, § 310 HGB, Rn 6; Biener, DB 1983, Beilage Nr. 19, S. 12; BienerlSchatzmann, Konzernrechnungslegung, S. 50; Biener I Berneke, Bilanzrichtlinien-Gesetz, S. 366; BuddelSuhrbier, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 310 HGB, Rn 2; Busse v. Colbe/Ordelheide, a.a.O., S. 453; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 416; a.A. Hoffmann-Becking/Rellermeyer, FS Goerdeler, S. 199,211 ff. 10 Xenides
146
Kap. E: Erweiterungstatbestände
Schulden einer Gemeinschaftsunternehmung quotal in den Konzernabschluß einzubeziehen sind 193. 2. Konzerneinheitliche Bewertung bei Gemeinschaftsunternehmen
Nach § 310 Abs. 2 HGB ist § 308 HGB auf anteilmäßig zu konsolidierende Unternehmen entsprechend anzuwenden. Daraus ergibt sich auch für solche Unternehmen eine Pflicht zur Vereinheitlichung der Bewertungsansätze 194. Wenn aber schon bei Tochterunternehmen, die der einheitlichen Leitung des Mutterunternehmens unterliegen, Ausnahmen vom Einheitlichkeitsgrundsatz zugelassen werden müssen (§ 308 Abs. 2 Sätze 2 - 4 HGB)195, umso mehr scheint es für die Gemeinschaftsunternehmen als geboten, eine etwas flexiblere Bewertung zuzulassen; denn anders als bei Tochterunternehmen mit einem Mutterunternehmen müssen Gemeinschaftsunternehmen den Weisungen mindestens zweier Mutterunternehmen folgen l96 • Hierbei ist möglich, daß die beiden Gesellschafterunternehmen nach unterschiedlichen Vorschriften ihren Konzernabschluß aufzustellen haben, wenn sie z. B. in verschiedenenen Ländern ihren Sitz haben, oder wenn sie wegen ihrer Rechtsform unterschiedliche Bewertungsmethoden konzerneinheitlich anwenden 197. Somit kann sich das Gemeinschaftsunternehmen gezwungen sehen, für jedes Gesellschafterunternehmen je eine Handelsbilanz 11 aufzustellen, wofür jeweils zusätzliche Angaben in der Anlagenbuchhaltung mit entsprechendem Aufwand erforderlich sind. Dies könnte mit Blick auf den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Rechnungslegung die Grenze der Zumutbarkeit für das Gemeinschaftsunternehmen überschreiten. Ob dann dafür die Ausnahmevorschrift des § 308 Abs. 2 Satz 4 HGB in Anspruch genommen werden kann, wonach eine Abweichung von der Einhaltung einheitlicher Bewertungsmethoden bei Angabe im Anhang zulässig ist, erscheint zweifelhaft 198. 193 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 453; Coenenberg, lahresabschluß, 15. Auflage, S. 417. 194 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 271, Rn 662; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 364; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 459; Coenenberg, lahresabschluß, 15. Auflage, S. 417; Sigle, in Kütingl Weber, HdKR, § 10 HGB, Rn 71 ff. 195 Vgl. C, I. - III. dieser Arbeit. 196 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 459; Sigle, in Küting/Weber, HdKR, § 310 HGB, Rn 73. 197 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 459. 198 Vgl. Sigle, in Küting/Weber, HdKR, § 310, Rn 74; Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 459; a.A. AlD/S, 6. Auflage, § 310 HGB, Rn 51, die eine allgemeine Anwendung von § 308 Abs. 2 Satz 4 HGB bei der Quotenkonsolidierung für zulässig halten.
IV. Einheitliche Bewertung bei Anwendung der Equity-Methode
147
Zu beachten ist ferner, daß die anteilmäßige Konsolidierung (also auch die Pflicht zur entsprechenden Anwendung von § 308 HGB) als Alternativlösung zur Equity-Methode steht. Bei der letzteren ist aber die einheitliche Bewertung nur ein Wahlrecht (§ 312 Abs. 5 Satz 1 HGB)199; auch das wirkt abschwächend auf den Grad der geforderten Einheitlichkeit. Andererseits aber sollte die Aushöhlung von § 308 HGB ausgeschlossen werden: wenn sich ein Gesellschafterunternehmen dazu entschließt, das Gemeinschaftsunternehmen quotal in seinen Konzernabschluß einzubeziehen, dann sollte es auch den Grundsatz der Bewertungseinheitlichkeit beachten. Anderenfalls hätte es auch die Equity-Methode anwenden können, allerdings mit den entsprechenden Pflichten auf Angaben im Anhang und dem allgemeinen Eindruck, den dies für die Konzernabschlußadressaten hätte (§ 312 Abs. 5 Satz 2 HGB). Die Anwendung von § 308 HGB bei der Quotenkonsolidierung hat also einen eigenen Stellenwert. Sie kann nicht das Ausmaß an Vereinheitlichung erreichen, das bei Vollkonsolidierung zu erwarten ist - schließlich besteht eine gesetzliche Auskunftspflicht wie bei den Tochterunternehmen gemäß § 294 Abs. 3 HGB in diesem Fall nicht2OO . Andererseits aber darf der Inhalt von § 308 HGB auch nicht ausgehöhlt werden: wenn die Quotenkonsolidierung gewählt wird, dann ist einheitlich zu bewerten, allerdings flexibel und den Umständen entsprechend.
IV. Einheitliche Bewertung bei Anwendung der Equity-Methode 1. Definition, Anwendungsbereich und Merkmale der Equity-Methode
Wenn bei einem Unternehmen die Kriterien der Voll- oder Quotenkonsolidierung (§§ 290 - 309 oder 310 HGB) nicht erfüllt sind, aber dennoch ein in den Konzernabschluß einbezogenes Unternehmen einen "maßgeblichen Einfluß" auf die Geschäfts- und Finanzpolitik dieses Unternehmens ausübt, so ist dieses Unternehmen als assoziiertes Unternehmen zu qualifizieren und die an ihm bestehende Beteiligung ist gesondert auszuweisen (§ 311 Abs. 1 Satz 1 HGB) und nach der Equity-Methode (§ 312 HGB) zu bewerten 201 . Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 459. Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 459. 201 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 271 f., Rn 663; AIDIS, 6. Auflage, § 311 HGB, Rn 1; Busse v. Colbe I Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 469; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 418. Dagegen hat der deutsche Gesetzgeber die Equity-Methode nicht für den Einzelabchluß (Wahlrecht aus Art. 59 der 4. EG-Richtlinie) zugelassen. 199
200
10*
148
Kap. E: Erweiterungstatbestände
Denn ausgehend von der Stufenkonzeption des Konzernabschlusses, wonach ein stufenweiser Übergang vom Kern der Unternehmensgruppe zur Umwelt unterstellt wird 202 , stellen Unternehmen, auf die von einem Konzernunternehmen nur ein maßgeblicher Einfluß ausgeübt wird, eine schwache Form der Einbindung zum Konzern dar und somit liegen die Voraussetzungen nicht vor, die - der Einheitstheorie entsprechend - ihr Vermögen auch nur quotal als Vermögen des Konzerns anzusehen erlauben würden203 . Man könnte nun daran denken, solche Beteiligungen im Konzernabschluß wie im Jahresabschluß nach der Anschaffungskostenmethode auszuweisen, wobei gemäß § 253 HGB die Anschaffungskosten auch in den Folgejahren die absolute Bewertungsobergrenze bilden würden204 . Auf diese Weise würden aber Gewinnakkumulationen in der Beteiligungsgesellschaft nicht in den Beteiligungsbuchwert eingehen, so daß letzterer vielfach stille Rücklagen enthalten würde, die sich erst bei einem Verkauf der Beteiligung auflösen würden 205 . Der Konzernabschluß zeigte also nicht, daß sich der Wert der Beteiligung erhöht ("Sparkasse im Ausland") und dies hätte zur Folge die Verfälschung des Konzernbildes als Ganzes 206 • Für den Ausweis einer solchen Beteiligung im Konzernabschluß ist also eine Methode zu wählen, die den Buchwert des Anteils am Eigenkapital des assoziierten Unternehmens spiegelt207 • Hierbei stellt das Gesetz wie bei der Vollkonsolidierung zwei unterschiedliche Verfahren zur Ermittlung des Equity-Wertes zur Verfügung: Die Buchwertmethode, wonach die Beteiligung im Jahr der ersten Berücksichtigung im Konzernabschluß mit dem Buchwert anzusetzen ist, mit dem sie in der Bilanz des Unternehmens geführt wird, das den maßgeblichen Einfluß ausübt, und die Kapitalanteilsmethode (Neubewertungsmethode), wonach die Beteiligung "mit dem Betrag, der dem anteiligen Eigenkapital des assoziierten Unternehmens entspricht" angesetzt wird. Hierbei wird das anteilige Kapital nicht auf Basis der Buchwerte, sondern (wie bei der Neubewertungsmethode 202 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 105f.; Busse v. Co1be/Chmielewitz, Das neue Bilanzrichtlinien-Gesetz, DBW 1986, S. 289, 326. 203 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 272, S. 664; AIDIS, 6. Auflage, § 311 HGB, Rn 4; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 387; Küting/Köthnerl Zündorf, in Küting/Weber, HdKR, § 311 HGB, Rn 1. 204 Vgl. Großfeld, 2. Auflage, S. 272, Rn 664; Busse v. Colbe I Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 469. 205 Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 469. 206 Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 272, Rn 664. 207 Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 272, Rn 665; Die Equity-Methode ähnelt der sog. Spiegelbildmethode zur Bewertung von Beteiligungen bei Personengesellschaften, vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 311 HGB, Rn 2; Budde I Raff, Beck'scher Bilanzkommentar, 3. Auflage, § 311 Rn 2.
IV. Einheitliche Bewertung bei Anwendung der Equity-Methode
149
bei Vollkonsolidierung) der beizulegenden Zeitwerte der Bilanzpositionen errechnet208 . Bei der Equity-Methode werden im Unterschied zur Vollkonsolidierung grundsätzlich keine Vermögensgegenstände und Schulden des assoziierten Unternehmens in den Konzernabschluß übernommen 209 . Deshalb wird die Ansicht vertreten, daß die Equity-Methode kein Konsolidierungsverfahren, sondern ein Verfahren zur Bewertung von Unternehmensanteilen ist21O • 2. Einheitliche Bewertung
Die Aussagefähigkeit des Konzernabschlusses ist nur dann gewährleistet, wenn die einbezogenen Abschlüsse aller Konzernunternehmen nach einheitlichen Methoden bewertet sind21l . Dies gilt auch für die nach der EquityMethode einbezogenen Unternehmen 212 . Allerdings ist die Einheitlichkeit der Bewertung in § 312 Abs. 5 Satz 1 HGB nur als Wahlrecht vorgesehen; bei Verzicht auf die Anpassung der Bewertung an die Bewertungsgrundsätze des Konzerns entsteht lediglich eine Angabepflicht für den Anhang (§ 312 Abs. 5 Satz 2 HGB)213. Dies ist bedeutend, um die Grenzen der konzerneinheitlichen Bewertung bei einem assoziierten Unternehmen zu konkretisieren. So muß davon ausgegangen werden, daß auch bei der Equity-Methode auf die anwendbaren Bewertungsmethoden des Mutterunternehmens als Bewertungsrahmen für den Konzernabschluß abzustellen ist, obwohl in § 312 Abs. 5 Satz 1 HGB von "auf den Konzernabschluß angewandten Bewertungsmethoden" die Rede ist und somit diese Vorschrift noch enger als der für vollkonsolidierte Unternehmen geltende § 308 Abs. 1 Satz 1 zu sein scheint. Denn es macht wenig Sinn, daß Abschlüsse von assoziierten Unternehmen strengeren Anforderungen unterworfen würden als die der vollkonsolidierten Unternehmen selber214 • Ebenso ist anzunehmen, daß die Ausnahmetatbestände von 208 Vgl. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 272, Rn 665; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 395f.; BuddelRaff, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 312 HGB, Rn 5ff., 20ff.; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 419f. 209 Vgl. etwa Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 395. 210 Streitig; so Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 472; Coenenberg, Jahresabschluß, 15. Auflage, S. 418; a. A. Großfeld, Bilanzrecht, 2. Auflage, S. 273, Rn 668. 211 Vgl. Küting/Zündorf, HdKR, § 312 HGB, Rn 193. 212 Vgl. A/D/S, 6. Auflage, § 312 HGB, Rn 128; Küting/Zündorf, in Kütingl Weber, HdKR, § 312 HGB, Rn 193. 213 Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 406; Küting/Zündorf, Die Equity-Methode im deutschen Bilanzrecht, BB 1986, Beilage 7, S. 1, 14. 214 Vgl. Küting/Zündorf, in Küting/Weber, HdKR, § 312 HGB, Rn 194; dies., BB 1986, Beilage 7, S. 1, 14.
150
Kap. E: Erweiterungstatbestände
§ 308 Abs. 2 Satz 2 - 4 und Abs. 3 HGB auch bei der Equity-Methode gelten, obwohl sie im Gesetz nicht ausdrücklich erwähnt werden 215 •
Im Unterschied zur einheitlichen Bewertung spricht das Gesetz die Frage des Ansatzes, wie es in § 300 Abs. 2 HGB für die Vollkonsolidierung tut, in § 312 Abs. 5 nicht an; hieraus könnte der Schluß gezogen werden, daß § 300 HGB im Rahmen der Equity-Methode nicht angewendet werden darf216 • Es gibt aber keine Anhaltspunkte für eine bewußte Differenzierung zwischen Bilanzansatz und Bewertung. Schließlich gehen von Bilanzansatz und Bewertung die gleichen Auswirkungen auf das Ergebnis, die Höhe des Eigenkapitals und den Aussagewert des Konzernabschlusses aus und beide sind hinsichtlich der Erläuterungspflichten bei Abweichungen gemäß § 313 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 gleichgestellt217 . Daher ist mit Blick auf die Generalnorm (§ 297 Abs. 2 Satz 2 HGB) auch eine Vereinheitlichung des Bilanzansatzes beim assoziierten Unternehmen als zulässig und zweckmäßig zu erachten218 • Allerdings werden - mit Blick auch auf die relativ schwache Stellung des den maßgeblichen Einfluß ausübenden Konzernunternehmens - die zur Beurteilung bisher nicht bilanzierter Sachverhalte benötigte Zusatzinformationen noch schwerer zugänglich sein als für Bewertungsanpassungen und die Fortschreibung bekannter Unterschiedsbeträge219 . Die Vereinheitlichung der Bewertung dürfte leichter ausfallen bei solchen Unternehmen, die gemäß dem in § 295 normierten Einbeziehungsverbot oder in Ausübung des Wahlrechts aus § 296 Abs. 1 Nr. 1 und 3 HGB (untypische assoziierte Unternehmen) nicht als vollkonsolidierte Tochterunternehmen in den Konzernabschluß einbezogen wurden 22o • Denn in diesem Fall ist die Anbindung des assoziierten Unternehmens an den Konzern in der Regel stark. Bei den meisten typischen assoziierten Unternehmen, vor allem bei solchen mit Sitz im Ausland, dürfte es aber fraglich sein, ob das Mutterunternehmen überhaupt Zugriff auf die notwendigen Angaben hat221 • Da die Vorlage- und Auskunftspflichten im Sinne des § 294 Abs. 3 HGB für assoziierte Unternehmen nicht gelten, kann das den maßgeblichen Einfluß 215 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 312 HOB, Rn 140ff.; Küting/Zündorf, in Kütingl Weber, HdKR, § 312 HOB, Rn 196. 216 Vgl. Küting/Zündorf, in Küting/Weber, HdKR, § 312 HOB, Rn 191. 217 Vgl. BuddelRaff, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 312, Rn 77. 218 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 312, Rn, 145; BuddelRaff, Beck'scher BK, 3. Auflage, § 312, Rn 77; Küting/Zündorf, in Küting/Weber, HdKR, § 312, Rn 191 f. 219 Vgl. BuddelRaff, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 312, Rn 77. 220 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 312 HOB, Rn 137; Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 406. 221 Vgl. Havennann, WPg 1987, S. 315, 318.
IV, Einheitliche Bewertung bei Anwendung der Equity-Methode
151
ausübende Unternehmen (Mutterunternehmen) solche Infonnationen für die Aufstellung des Konzernabschlusses auch nicht verlangen222 • Es läge also nahe, Wertansätze von solchen Unternehmen unverändert in den Konzernabschluß zu übernehmen und gemäß § 312 Abs. 5 Satz 2 darüber im Anhang zu berichten223 . Allerdings darf hierbei nicht übersehen werden, daß die Equity-Methode das anteilige Reinvennögen des assoziierten Unternehmens widerspiegeln soll. Sofern dieses aber nach Bewertungsregeln ermittelt wird, die mit den GoB nicht vereinbar sind, entspricht der Beteiligungsausweis im Konzernabschluß ohne eine Bewertungsanpassung möglicherweise nicht den GOB 224 . Hinzu kommt, daß die Leser des Konzernabschlusses die wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns vor dem Hintergrund der deutschen Rechnungslegungsregeln beurteilen. Lägen also dem Equity-Ansatz ausländische - ihnen meist nicht vertraute - Bilanzierungsregeln zugrunde, würde für sie die Aussagefähigkeit des Konzernabschlusses durch die fehlende Anpassung beeinträchtigt225 . Bei solchen Fällen sollte mit Blick auf die Generalnonn (§ 297 Abs. 2 Satz 2 HGB) die Anpassung der ausländischen Wertansätze an die GoB nicht nur als Wahlrecht, sondern als eine Pflicht verstanden werden 226 . Sollte der maßgebliche Einfluß aber nicht so weit gehen, daß die hierfür erforderlichen Angaben zu erhalten sind, so müßte eine Equity-Bewertung solcher ausländischen assoziierten Unternehmen unterbleiben 227 . Die Frage der Bewertungseinheitlichkeit ist aber auch für die Anwendung der Buchwert- oder der Kapitalanteilsmethode bei der Equity-Konsolidierung von Bedeutung. Der Grundsatz der Bewertungseinheitlichkeit wurde zwar für die Übernahme der Vennögensgegenstände aus den Einzelabschlüssen aufgestellt. Er könnte aber auch auf die eigentliche Equity-Konsolidierung angewendet werden, zumal er gemäß § 312 Abs. 5 HGB grundsätzlich auch für die Bestimmung des Eigenkapitals nach der EquityMethode gilt. Auch die Generalnonn (§ 297 Abs. 2 Satz 2 HGB) spricht für eine einheitliche Anwendung der Equity-Methode bei der Wahl zwischen Buchwert- und Neubewertungsmethode228 • Liegen mehrere assoziierte Unternehmen vor, muß also einheitlich nach der Buchwert- oder der Neubewertungsmethode konsolidiert werden 229 . Demnach ist auch ein sich 222 223 224 225 226 227 228 229
Vgl. Vgl. Vgl. Vgl. Vgl. Vgl. Vgl. Vgl.
A/D/S, 6. Auflage, § 312 HGB, Rn 139. etwa, Jonas, Heinrich, Die Equity-Methode, BFuP 1981, S. 550, 559. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 508. Busse v. Colbe/Orde1heide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 509. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 509. Müller, Eberhard, in Beck'sches HdR, 1987ff., C 511, S. 1 ff. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 488. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 489.
152
Kap. E: Erweiterungstatbestände
ergebender Unterschiedsbetrag entsprechend dem Grundsatz der Bewertungseinheitlichkeit fortzuführen (§ 312 Abs. 2 Satz 2 HGB)230. 3. Angaben im Konzernanhang
Im Konzernanhang ist anzugeben, wenn ein assoziiertes Unternehmen in seinem Jahresabschluß vom Konzernabschluß abweichende Bewertungsmethoden anwendet und ohne Anpassung seiner Wertansätze in den Konzernabschluß nach der Equity-Methode einbezogen wird (§ 312 Abs. 5 Satz 2)231. Die Angabepflicht bezieht sich auch auf abweichende Bilanzansatzmethoden; diese Gleichbehandlung läßt sich aus der in § 313 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 HGB vorgeschriebenen Angabe- und Begründungspflicht bei Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Konzernabschluß ableiten 232 . Die Angabe kann sich auf die Feststellung beschränken, daß das assoziierte Unternehmen in seinem Jahresabschluß abweichende Bewertungsmethoden angewendet hat und eine Anpassung an die konzerneinheitliche Bewertung nicht vorgenommen wurde; eine Begründung für die Nichtanpassung ist ebensowenig gefordert wie die Angabe der Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 233 . Dies läßt sich damit rechtfertigen, daß, wenn die Bewertung wegen fehlender Informationen (wegen der geringen Stärke des maßgeblichen Einflusses) nicht angepaßt wird, auch unmöglich sein muß, den Einfluß der (nicht bekannten) Bewertungsabweichungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage darzustellen234 . Dagegen löst die Anpassung der Wertansätze des assoziierten Unternehmens an die konzerneinheitliche Bewertung keine Angabepflicht im Sinne des § 312 Abs. 5 Satz 2 HGB aus 235 .
Vgl. Budde I Raff, Beck'scher BK, § 312 HGB, Rn 76. Vgl. Baetge, Konzernbilanzen, 2. Auflage, S. 406; Budde I Raff, in Beck'scher BK, § 312, Rn 85. 232 Vgl. WP-Handbuch 1996, Bd. I, Tz 450; AIDIS, 6. Auflage, § 312 HGB, Rn 146; BuddelRaff, Beck'scher BK, 3. Auflage, § 312 HGB, Rn 85. 233 Vgl. AIDIS, 6. Auflage, § 312 HGB, Rn 146; BuddelRaff, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 312, Rn 85. 234 Vgl. BuddelRaff, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 312, Rn 85. 235 Budde I Raff, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 312, Rn 85. Fraglich ist aber, ob bei der Bewertungsanpassung auch die Angabepflicht gemäß § 313 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 verdrängt wird. 230 231
Kapitel F
Einheitliche Bewertung und Konzernbilanzpolitik I. Konzerneinheitliche Bewertung als Instrument der Konzernbilanzpolitik 1. Möglichkeit für eine eigenständige Konzernbilanzpolitik
Konzernbilanzpolitik ist nach SchelTen 1 die Zusammenfassung aller Maßnahmen im Laufe des Geschäftsjahres sowie bei der Aufstellung des Konzernabschlusses zu seiner zielorientierter Beeinflussung und Gestaltung. Dabei werden alle im Rahmen der Legalität, durch den Gesetzgeber eingeräumten Bilanzierungs-, Konsolidierungs- und Bewertungswahlrechte, Ermessensspielräume und Sachverhaltsgestaltungen berücksichtigt. Ähnlich definiert Klein die Konzernbilanzpolitik als "die zielorientierte Ausgestaltung des Konzernabschlusses mittels Einsatzes der bei der Aufstellung des Konzernabschlusses existierenden Parameter" 2 . Nach Clemm / Wenzel 3 schließlich ist (Konzern)-Bilanzpolitik die zweckorientierte ("politische") Gestaltung der gesetzlich und/oder satzungsmäßig geforderten Rechnungsund Rechenschaftslegung durch Unternehmensleitungen gegenüber Unternehmenseignern, Gläubigern, Arbeitnehmern, dem Fiskus u. a. Adressaten, und dies vor allem im Rahmen legaler Möglichkeiten. Voraussetzung der Bilanzpolitik ist also, daß im Zuge der Erstellung des Konzernabschlusses im Hinblick auf die Erfassung und Bewertung von Vorgängen mehrere zulässige, also legale Alternativen existieren, die dann gezielt ausgewählt und mit Blick auf die Interessen des Konzerns eingesetzt werden4 • Deshalb stellen die gesetzlichen Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsvorschriften sowie die GoB ihren (äußersten) rechtlichen Rahmen dar. Bilanzpolitik wird erst möglich, wenn das Gesetz dem Bilanzierenden gewisse Handlungsfreiheiten oder Interpretationsfreiräume bezüglich seiner Entscheidungen einräumt. Dagegen fehlt es an bilanzpolitischem Scheren, Konzernabschlußpolitik, S. 25. Klein, Konzernbilanzpolitik, 1989, S. 19. 3 Clernrn/Wenzel, Überlegungen zur Konzernbilanzpolitik, BFuP 1986, S. 341; vgl. auch Clernrn, WPg 1989, S. 357, 358. 4 Vgl. Heinhold, Bilanzpolitik, in: Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, 5. Auflage, S. 526. 1
2
154
Kap. F: Einheitliche Bewertung und Konzernbilanzpolitik
Spielraum bei den Bilanzgeboten und Bilanzverboten oder bei fixierten Wertmaßstäben (etwa Anschaffungskosten)5. Grundsätzlich muß zwischen sachverhaltsgestaltenden und sachverhaltsabbildenden Maßnahmen unterschieden werden 6 . Bilanzpolitik im engeren Sinne stellen allerdings nur die Zweiten dar. Nur sie knüpfen an die vorhandenen Sachverhalte an, während sich die Ersten auf die Vornahme von (nicht immer gesetzlichen) geschäftlichen Aktivitäten vor dem Bilanzstichtag (etwa Verkauf von Grundstücken und anschließenden Abschluß von Leasing-Geschäften für die gleichen Grundstücke) erstrecken 7. Bei den sachverhaltsabbildenden Maßnahmen kommen mehrere Aspekte der Konzernabschlußerstellung in Betracht: Wahl des Abschlußstichtags, Abgrenzung des Konsolidierungskreises, Gliederung, Ausweis und Erläuterung von Abschlußposten, Wahl der Konsolidierungs- und Währungs umrechnungsmethoden und last not least Ausnutzung der Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte 8 . Hierbei bietet die Zulässigkeit, nach dem Recht des Mutterunternehmens gegebene Ansatz- und Bewertungswahlrechte losgelöst von den Jahresabschlüssen der Konzernunternehmen in den Jahresabschlüssen 11 neu auszuüben (§§ 300 Abs. 2 Satz 1 und 2, 308 Abs. 2 Satz 1 HGB), der Konzernleitung die Möglichkeit, eigenständige bilanzpolitische Ziele für den Konzernabschluß aufzustellen, vor allem die bilanzpolitischen Ziele des Konzernabschlusses völlig unabhängig von denen des Jahresabschlusses des Mutterunternehmens zu gestalten 9 . Da der Konzernabschluß der Informationsfunktion dient, kann die Konzernleitung losgelöst von steuer- und dividendenbedingten Überlegungen den Ausweis eines höheren Eigenkapitals anstreben, als es in den Einzelabschlüssen der Konzernunternehmen der Fall ist bzw. im Konzernabschluß nach dem AktG 1965 der Fall war lO . So können etwa die HerstellungsVgl. Küting, Grundlagen der Bilanzpolitik, BBK 1996, S. 787, 788. Vgl. Küting, BBK 1996, S. 787, 795ff. 7 Vgl. Kropff, Die Mobilisierung stiller Reserven nach neuem Recht, in: Baetge (Hrsg.), Rechnungslegung, Finanzen, Steuern und Prüfung in den neunziger Jahren, S. 65ff.; Küting, BBK 1996, S. 787, 798. 8 Vgl. Clemm/Wenzel, BFuP 1986, S. 341, 343f.; Heinhold, Bilanzpolitik, S. 526, 532. 9 Vgl. Busse v. Colbe IOrdelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 95 f.; Clemm/Wenzel, BFuP 1986, S. 341, 348; Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 68; Lederle, in Beck'sches KRL, C 300, Rn 16; Reuter, Analyse von Weitabschlüssen nach Bilanzrichtlinien-Gesetz, ZfB 1988, S. 285, 296; Schnicke I Kilgert, in Beck'scher BK, 3. Auflage, § 308 HGB, Rn 1. IO Vgl. Busse v. Colbe/Ordelheide, Konzernabschlüsse, 6. Auflage, S. 96; Reuter, ZfB 1988, S. 285, 296; Vgl. aber Vorbehalte der Kommission, in: Commission of 5
6
I. Konzerneinheitliche Bewertung als Instrument der Konzernbilanzpolitik 155
kosten auf der Ebene der Einzelabschlüsse zu Einzelkosten, im Konzernabschluß dagegen zu Vollkosten angesetzt werden. Sachanlagen können in den Einzelabschlüssen degressiv, im Konzernabschluß dagegen linear abgeschrieben werden. Ferner können außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen bei nur vorubergehender Wertminderung in den Einzelbilanzen vorgenommen werden, während im Konzernabschluß nicht von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird. Ebenfalls können mit Blick auf die Minimierung der Steuerlast in den Einzelabschlüssen steuerbedingte erhöhte Abschreibungen vorgenommen werden (§ 5 Abs. 1 EStG), die im Konzernabschluß wieder ruckgängig gemacht werden (§ 308 Abs. 3 HGB)ll. 2. Grenzen der konzernbilanzpolitischen Ausrichtung der Bewertung im Konzernabschluß
Nun ist allerdings weder Bilanzpolitik im allgemeinen noch Konzernbilanzpolik im besonderen eine harmlose Sache. Denn schließlich soll sie "die Informationsempfänger zu einem im Unternehmenssinne positiven Verhalten bewegen"I2. Deshalb beabsichtigt sie eine gewisse "Färbung" der im Rahmen der Rechnungslegung zu gebenden Informationen im Sinne einer "wunschgemäßen Selbstdarstellung des Unternehmens" mit Blick auf vermutbare Reaktionen aller oder einzelner Adressatengruppen 13. Daß dieser Aufgabe ein hoher Stellenwert zukommt, wird deutlich, indem nach einer in der Unternehmenspraxis verbreiteten Meinung "Bilanz-publicity" neben der "product-publicity" zu den wesentlichen Komponenten der Öffentlichkeitsarbeit eines Unternehmens gehört 14 • Der Wunsch eines Unternehmens, sein Bild in der Öffentlichkeit zu beeinflussen, ist verständlich 15. Schließlich werden die im Jahres- oder Konzernabschluß ausgewiesenen Werte von der Unternehmensleitung selbst ermittelt. Hierbei sind subjektive Schätzungen und Prognosen (wann ist z. B. eine Wertminderung nur vorubergehend oder wie genau läßt sich die Nutzungsdauer einer Maschine feststellen? usw.) unvermeidbar. Manchmal kann sogar eine gewisse "Glättung" von Bilanzergebnissen mit Blick auf the European Communities, "Explanatory Memorandum to the 1976 Proposal for a Seventh Directive concerning group accounts", Bulletin EC 1976, S. 19,29. II Vgl. Pohle, in Küting/Weber, HdKR, § 308 HGB, Rn 68. 12 Ehrt, Die Einheitlichkeit der Bewertung im Konzern, S. 153, 173. 13 Vgl. Baetge I Ballwieser, BFuP 1977, S. 199, 200ff.; C1emm, WPg 1989, S. 357, 358; Kropff, Sinn und Grenzen von Bilanzpolitik, in Baetge (Hrsg.), Der Konzernabschluß im Widerstreit der Interessen, S. 179, 191 ff. 14 Vgl. Clemm, WPg 1989, S. 357, 358; ferner, Küting/Hütten, Der Geschäftsbericht als Publizitätsinstrument, BB 1996, S. 2671. 15 Vgl. Ehrt, Die Einheitlichkeit der Bewertung, S. 153, 161.
156
Kap. F: Einheitliche Bewertung und Konzernbilanzpolitik
Überreaktionen der Fachpresse und des Anlagepublikums für gerechtfertigt gehalten werden l6 . Allerdings sind vom Gesetz der bilanzpolitischen Kunst eindeutige Grenzen gesetzt. Bilanzpolitik ist nur in dem Rahmen erlaubt, indem sie nicht vom Gesetz höher bewertete Interessen konterkariert und verletzt. Die erste Schranke ergibt sich freilich aus dem Grundsatz der einheitlichen Bewertung. Denn es mag sein, daß § 308 HGB den Konzernleitungen die Möglichkeit für eine eigenständige Konzernbilanzpolitik bietet: Tatsache bleibt, daß im Rahmen des Konzernabschlusses die Inanspruchnahme von Bewertungswahlrechten einheitlich und gegen jede Willkür zu erfolgen hat gleichartige Sachverhalte werden eben gleich behandelt. Undifferenzierte Wahlrechtsausübung bedeutet aber klare Einschränkung für die Bilanzpolitik und Erleichterung für die Bilanzanalyse 17 . Große Bedeutung kommt ferner dem durch das Bilanzrichtlinien-Gesetz stark aufgewerteten Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. § 298 Abs. I HGB) zu. Der Stetigkeitsgrundsatz beschränkt die Auswahl unter mehreren Bewertungsmethoden auf diejenige des Vorjahres, es sei denn, es liegt ein begründeter Ausnahmefall vor lS . So muß bei jeder bilanzpolitischen Maßnahme der Basiseffekt für das nächste Jahr beachtet werden. Manches, was aus der Sicht des Berichtsjahres wünschenswert wäre, kann ein Jahr später im Vorjahresvergleich zu Erklärungsschwierigkeiten führen (sog. Zweischneidigkeit der Bilanz) 19. Die Konzernleitung kann also nicht beliebig von Jahr zu Jahr ihre Bewertungsmethoden wechseln, um so die Bilanzkennzahlen im eigenen Interesse zu beeinflussen. Bilanzpolitik und Bewertungsstetigkeit stehen in Konkurrenz 20 . Grenzen für die Bilanzpolitik ergeben sich auch aus der Berichtspflicht im Anhang: So schreibt § 313 Abs. 1 Nr. 3 HGB vor, daß Abweichungen von Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden angegeben und begründet werden müssen; deren Einfluß auf die Vermögens-, Finanzund Ertragslage ist gesondert darzustellen. Der Wortlaut der Vorschrift spricht für eine uneingeschränkte Offenlegungspflicht21 . 16 Vgl. Clemm, WPg 1989, S. 357, 364ff.; Ehrt, Die Einheitlichkeit der Bewertung, S. 153, 161. 17 Vgl. Reuter, ZfB 1988, S. 285, 287. 18 Vgl. Clemm/Wenzel, BFuP 1986, S. 341, 350; Ehrt, Die Einheitlichkeit der Bewertung, S. 153, 173; Scheren, Konzernabschlußpolitik, S. 83. 19 Vgl. Ehrt, Die Einheitlichkeit der Bewertung, S. 153, 162; Küting, BBK 1996, S. 787, 795; Pfleger, Die neue Praxis der Bilanzpolitik, 4. Auflage, S. 55. 20 Vgl. Ehrt, Die Einheitlichkeit der Bewertung, S. 153, 173. 21 Vgl. Kropff, Die Mobilisierung stiller Reserven nach neuem Recht, in: Baetge (Hrsg.), Rechnungslegung, Finanzen, Steuern und Prüfung in den neunziger Jahren, S. 67, 84f.
I. Konzerneinheitliche Bewertung als Instrument der Konzernbilanzpolitik 157
Die wichtigste Schranke für die Konzernbilanzpolitik ergibt sich allerdings aus der Generalnorm (§ 297 Abs. 2 Satz 2 HGB)22. Hierbei mag das "tatsächliche" Bild des § 264 Abs. 2 oder 297 Abs. 2 HGB selber das Ergebnis einer Wertung und nur in Zusammenhang mit der normativen Tatsächlichkeit der pagatorischen Rechnungslegungsregeln zu sehen sein23 . Was sich aber mit Blick auf die Generalnorm als Anforderung an die Konzernbilanzpolitik verwirklichen läßt, ist der Anspruch auf die Konzernrechnungslegung, soweit wie möglich genaue Zahlen und ansonsten vernünftige Schätzungen zugrunde zu legen und diese so anzuordnen, daß sie innerhalb der Grenzen der derzeitigen Bilanzierungsregeln ein so objektives Bild wie möglich bieten, frei von der Absicht der Verfälschung, der Manipulation oder der Unterdrückung wesentlicher Fakten24 . Wichtig ist demnach, daß der tatsächliche Verlauf des Konzerns erkennbar wird, daß die Darstellungsmittel im Konzernabschluß Entwicklungstendenzen nicht verbergen oder sogar umkehren 25 . Der Abschluß darf also nicht Kontinuität der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vortäuschen, wo diese nur bilanziell besteht, weil etwa durch entsprechende Ausübung von Wahlrechten und die gerade noch zulässige Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe zum Stichtag wesentliche Änderungen oder Entwicklungen verborgen bleiben26 . Dies geschieht etwa dann, wenn die Schätzungen in Zeiten ungewöhnlich guter Ertragslage immer ungünstiger oder in Zeiten schlechter Ertragslage immer günstiger ausfallen und damit der Konzernabschluß Kontinuität aufweist, wo eigentlich große Veränderungen gegeben sind 27 . Etliche Fälle in der Unternehmenslandschaft aus jüngster Zeit stellen klare Beispiele für diese These dar28 . Bilanzpolitische Überlegungen bei der Bewertung im Konzernabschluß sind also nur unter diesen Gesichtspunkten erlaubt.
22
Vgl. Hoffmann, Karsten M., Jahresabschlußpolitik und die Generalnorm von
§ 264 Abs. 2 HGB, DB 1995, S. 1821, 1823f.
Vgl. Großfeld, Generalnorm, S. 192,202. Vgl. Clemm/Wenzel, BFuP 1986, S. 341, 353. 25 Vgl. AIDIS, 5. Auflage, § 264 HGB, Rn 99. 26 Vgl. AIDIS, 5. Auflage, 264 HGB, Rn 111. 27 Vgl. AIDIS, 5. Auflage, § 264 HGB, Rn 106; Ehrt, Die Einheitlichkeit der Bewertung, S. 153, 161; relativierend Clernm, Unternehmerische Rechnungslegung - Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen -, FS Goerdeler, S. 93, 106ff. 28 Vgl. "Wie es bei KHD zur "unglaublichen Katastrophe" kam", Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 7.6.1996, S. 20; "Allein gegen die Manipulateure", Süddeutsche Zeitung vom 7.6. 1996, S. 27. 23
24
158
Kap. F: Einheitliche Bewertung und Konzernbilanzpolitik
11. Konzerneinheitliche Bewertung und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung - Aufstellung von Konzernabschlüssen nach den US-GAAP oder lAS 1. Zwang zur Internationalisierung der Rechnungslegung
Die Frage einer bilanzpolitisch ausgerichteten Bewertung im Konzern hat in jüngster Zeit Bedeutung auch mit Blick auf einen ganz anderen Sachverhalt erlangt: Das ständige Zusammenwachsen der Märkte sowie die Privatisierung staatlicher Unternehmen haben den Kapitalbedarf der Unternehmen enorm gesteigert 29 • Hierbei vermag der deutsche Kapitalmarkt nicht mehr den Kapitalbedarf heimischer Großkonzerne - jedenfalls zu den ihnen gewünschten und bei der internationalen Konkurrenz üblichen Bedingungen - zu decken 3o . Um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können, sind also auch deutsche Großunternehmungen auf die Inanspruchnahme ausländischer Kapitalmärkte angewiesen 3l . Bisher zeigten sich allerdings Kapitalanleger immer zurückhaltend, was den Erwerb ausländischer - darunter auch deutscher - Aktien betrifft32 . Hierbei wird als einer der Gründe für die geringe Neigung der Investoren zu grenzüberschreitenden Kapitalanlagen die Heterogenität der Rechnungslegung angesehen 33 . Unterschiedliche Bilanzierungsnormen und -praktiken erschweren den Vergleich mit heimischen Wertpapieren. Deshalb sehen die Anleger Aktien ausländischer Emittenten als riskanter an und daher nehmen sie nur in geringem Umfang in ihre Portefeuilles aut3 4 • Außerdem bestehen in vielen Fällen auch gesetzliche Zutritts schranken für ausländische Emittenten beim Zugang zum Kapitalmarkt des Gastlandes. Dies trifft auf jeden Fall für den international wichtigsten 35 US-amerikanischen Kapitalmarkt zu: So ist die Zulassung zu den US-amerikanischen 29 Vgl. Küting/Hayn, Der internationale Konzernabschluß als Eintrittskarte zum weltweiten Kapitalmarkt, BB 1995, S. 662. 30 Vgl. Küting/Hayn, BB 1995, S. 662, 664. 31 Vgl. Biener, Bedeutung und Chancen der IASC-Vorschriften als internationale Rechnungslegungsnorm, in: Dörner/Wollmert (Hrsg.), IASC-Rechnungslegung, S. 9, 11; Luttermann, Über Buchführung und Bilanzrecht - 502 Jahre nach Erscheinen der "Summa der arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita" von Lucas Paciuolo, FS Ludewig, S. 595, 617. 32 Vgl. Förschle/Glaum/Mandel, US-GAAP, lAS und HGB: Ergebnisse einer Umfrage unter deutschen Rechnungslegungsexperten, BFuP 1995, S. 392, 395; Busse v. Colbe, Zur Anpassung der Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften an internationale Normen, BFuP 1995, S. 373, 375. 33 Vgl. Förschle/Glaum/Mandel, BFuP 1995, S. 392, 395. 34 Vgl. Förschle/Glaum/Mandler, BFuP 1995, S. 392, 395. 35 Vgl. statistische Angaben bei Norton, Foreign Issuer Listings on U. S. Securities Exchanges, ZBB 1995, S. 366, 367.
11. Konzerneinheitliche Bewertung u. kapitalmarktorientierte Rechnungslegung 159
Börsen nur dann erlaubt, wenn der Abschluß nach den dortigen Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) aufgestellt bzw. gemäß Form 20-F der Securities Exchange Commission (SEC) an die US-GAAP angepaßt worden ist 36 . Für Europa ist zwar anhand der durch die 4. und 7. EG-Richtlinien erfolgten Angleichung der Rechnungslegungsnormen die gegenseitige Anerkennung von Jahres- und Konzernabschlüssen und die ungehinderte Notierung an den verschiedenen europäischen Börsen garantiert 37 . Das Vertrauen des Anlagepublikums für ausländische Abschlüsse dürfte aber nicht immer gegeben sein, da aufgrund unterschiedlicher Ausnutzung von Mitgliedstaaten-Wahlrechten, unterschiedlicher Regelungen in nicht angeglichenen Bereichen (etwa Bilanzierung von Leasing-Geschäften, Währungsumrechnung u. a.) und unterschiedlicher Auslegung und Fortentwicklung der Richtlinien die Rechnungslegung in den verschiedenen Mitgliedstaaten immer noch sehr heterogen bleibes. Nicht besser dürfte es auch bei den übrigen Finanzplätzen aussehen, bei denen ausländische Konzernabschlüsse aufgrund des Reziprozitätsprinzips zugelassen werden. Deshalb gibt es schon seit Jahren Bestrebungen seitens wichtiger internationalen Organisationen, die Konzernrechnungslegung auf internationaler Basis zu vereinheitlichen oder mindestens die unterschiedlichen Rechnungslegungskonzepte einander näher zu bringen. Dazu zählen verschiedene Projekte im Rahmen der Vereinten Nationen, der Organization for Economic Cooperation and Developement (OECD), der International Organisation of Securities Commissions (lOSCO), des International Accounting Standards Comrnittee (IASC) und nicht zuletzt der Europäischen Union und des von ihr gegründeten Accounting Advisory Forums39 . 36 Vgl. Busse v. Colbe, BFuP 1995, S. 373, 375; von Rosen, Hannonisierung internationaler Bilanzierungsstandards - Ein weiter Weg, in FS Budde, S. 505, 512f.; Schildbach, BB 1995, S. 2635; Norton ZBB 1995, S. 366, 368. 37 Vgl. Biener, Wäre die Übernahme der allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze der Vereinigten Staaten von Amerika nachteilig, in: Baetge (Hrsg.), Die deutsche Rechnungslegung vor dem Hintergrund internationaler Entwicklungen, S. 123, 128; Ordelheide, Notwendigkeiten und Probleme der Weiterentwicklung der EG-Bilanzrichtlinien und des deutschen Konzernabschlußrechts, in: Baetge (Hrsg.), Die deutsche Rechnungslegung ... , S. 11, 18 ff. 38 Vgl. Mitteilung der Kommission der EG, Dok. KOM (95) 508 endg., Hannonisierung auf dem Gebiet der Rechnungslegung: Eine neue Strategie im Hinblick auf die internationale Harmonisierung, S. 5 (nicht veröffentlicht); Ordelheide, Notwendigkeiten und Probleme der Weiterentwicklung der EG-Bilanzrichtlinien, S. 11, 23ff.; ders., Entwicklung und Arbeit des Accounting Advisory Forums der EUKommission, in FS Budde, S. 483, 488f.; Luttennann, FS Ludewig, S. 595, 616; vgl. auch Küting/Hayn, Wesentliche Unterschiede der Rechnungslegung in Großbritannien und Deutschland, ZGR 1995, S. 111 ff. 39 Vgl. Biener, Bedeutung und Chancen der lASC-Vorschriften, S. 9, 15ff.; ders., Wäre die Übernahme ... , S. 123, 128ff.; ders., Rezeption der US GAAP über
160
Kap. F: Einheitliche Bewertung und Konzernbilanzpolitik
Allerdings drängen der in letzter Zeit stark gewachsene Kapitalbedarf der Unternehmen sowie die kompromißlose Haltung der US-amerikanischen Securities Exchange Commission zum schnellen Handeln und haben die Alternativen weitgehend begrenzt. Von besonderer Bedeutung erscheinen mithin für die weitere Entwicklung die angelsächsisch 40 geprägten International Accounting Standards (lAS) des IASC zu sein, vor allem seitdem der weltweite Zusammenschluß der Börsenaufsichtsbehörden (lOSCO) seinen Mitgliedern die Anwendung von lAS bei der Zulassung von in anderen Staaten emittierten Wertpapieren empfiehlt41 . Ferner wird als denkbare Lösung auch die Übernahme oder parallele Zulassung der US-GAAP in Betracht gezogen42 , Bezugspunkt der ganzen Diskussion ist dabei der Konzernabschluß 43 • Mittlerweile haben schon mehrere deutsche Großkonzerne angefangen, ihren Konzernabschluß den Forderungen der internationalen Kapitalmärkte anzupassen: Sie stellen entweder parallel zum Konzernabschluß nach HGB einen Sekundärabschluß unter Berücksichtigung der US-amerikanischen Generally Accepted Accounting Principles auf oder legen "duale Konzernabschlüsse" vor, die gleichzeitig sowohl den Vorschriften des HGB als auch denen der International Accounting Standards entsprechen sollen oder schließlich stellen ihren Konzernabschluß auf anhand einer "qualitative reconcilliation", eine Art Annäherung der Rechnungslegungssysteme, bei der im Grunde die Vorschriften des HGB angewendet werden, allerdings immer wenn es ein Wahlrecht vorliegt, wird es im Sinne des fremden Rechnungslegungssystems ausgeübt (z. B. der IAS)44, Ähnliche Zustände lassen sich auch in vielen anderen EG-Mitgliedstaaten beobachten45 . IOSCO und IASC?, in FS Budde, S. 87, 91 ff.; ders., Können die lAS als GoB in das deutsche Recht eingeführt werden?, FS Ludewig, S. 85ff.; Ordelheide, FS Budde, S. 483 ff. 40 Der Tenninus wird nur im Hinblick auf seine allgemeine Verwendung in der Fachliteratur benutzt. Zu den wesentlichen Unterschieden zwischen der US-amerikanischen und englischen Jurisprudenz siehe statt aller Großfeld, Macht und Ohnmacht der Rechtsvergleichung, S. 94ff. 41 Vgl. Kommission EG, Dok. (95) 508 endg., S. 4 (nicht veröffentlicht). 42 Vgl. Biener, Bedeutung und Chancen des IASC, S. 9, 16; ders., Wäre die Übernahme ... , S. 123, 127ff.; Leutheuser-Schnarrenberger, Wichtige unternehmensrechtliche Vorhaben in der 13. Wahlperiode, WM 1995, S. 1870, 1871; Mandler, Hannonisierung der Rechnungslegung: Bridging the GAAP?, ZfB 1996, S. 715ff. 43 Vgl. Biener, Bedeutung und Chancen der IASC-Vorschriften, S. 9, 23. 44 Vgl. Goebel, Die Konzernrechnungslegung nach HGB, lAS und US-GAAP, DB 1995, S. 2489; Goebel/Fuchs, Die Anwendung der International Accounting Standards in den Konzernabschlüssen deutscher Kapitalgesellschaften, BB 1995, S. 2363; Niehus, Die neue "Internationalität" deutscher Konzernabschlüsse, DB 1995, S. 1341 ff., jeweils mit Hinweisen auf die betreffenden Konzernabschlüsse. 45 Vgl. Kühnberger, Zur Bedeutung internationaler Rechnungslegungsstandards für deutsche Unternehmen, RIW 1996, S. 566, 570; Niehus, Zur Entwicklung von
II. Konzerneinheitliche Bewertung u. kapitalmarktorientierte Rechnungslegung 161
Die Aufstellung solcher "internationalen" Konzernabschlüsse ist mit erheblichen Problemen verbunden. So führt die Erstellung eines zweiten Konzernabschlusses (etwa nach US-GAAP) sowohl zu erheblichen Mehrkosten als auch zu abweichenden Eigenkapital- und Gewinngrößen in den beiden Konzernabschlüssen, die notwendigerweise Verwirrung und Unsicherheit über die wahre Lage des Konzerns auslösen werden46 . Problematisch kann ebenfalls die Aufstellung von "duallen Konzernabschlüssen" werden, wenn dabei die im HGB normierten Regeln mißachtet werden; die Erteilung des Bestätigungsvermerks scheint in diesem Zusammenhang nicht gerade selbstverständlich zu sein47. Bei der ganzen Diskussion kommt der Bewertung eine besondere Rolle zu, da sich viele der zwischen HGB, lAS und US-GAAP bestehenden Unterschiede auf die Bewertungsregelungen beziehen48 . Deshalb muß geprüft werden, wie sich die Bewertungsfrage mit der Steigerung der Aussagekraft des Konzernabschlusses vereinbaren läßt und ferner, ob die Aufstellung von mehr informationsfreundlichen Konzernabschlüssen de lege lata möglich ist. 2. Bewertungspolitischer Handlungsspielraum bei der Aufstellung internationaler Konzernabschlüsse
a) Bilanzieller Aussagewert als Voraussetzung für den gesellschaftsrechtlichen Gläubigerschutz
Das deutsche Bilanzrecht stellt nach wie vor der Rechtsangleichung durch die 4. und 7. EG-Richtlinien primär auf den Gläubigerschutz und die Unternehmenssicherung. Ausfluß dessen ist eine starke Prägung des VorKonzerneigenen GoB durch Paradigmawechsel, FS Moxter, S. 623, 631; Ordelheide, FS Budde, S. 483, 493; ders., Notwendigkeiten und Probleme der Weiterentwicklung der EG-Bilanzrichtlinien, S. 11, 38. 46 Vgl. Kommission EG, Dok. (95) 508 endg., S. 4 (nicht veröffentlicht); Biener, Bedeutung und Chancen der IASC-Vorschriften, S. 9, 24f. 47 Vgl. Grund, Internationale Entwicklung und Bilanzrecht - Reform oder Resignation?, DB 1996, S. 1293, 1295f.; Kirsch, Die "Anwendung" von International Accounting Standards in Konzernabschlüssen deutscher Mutteruntemehmen, DB 1995, S. 1773 ff.; Niehus, Bestätigungsvermerk von "dualen" Konzernabschlüssen, BB 1996, S. 893 ff.; Pellens I Füllbier I Ackermann, International Accounting Standards Comittee: Deutscher Einfluß auf Arbeit und Regelungen, DB 1996, S. 285; Helmschrott I Buhleier, Die Konsequenzen einer GoB-widrigen Anwendung internationaler Rechnungslegungsnormen aus der Perspektive des Handelsrechts und des strafrechts, WPg 1997, S. 10, 13. 48 Die Unterschiede beruhen vor allem auf der Bewertung und dem Ansatz; dagegen bestehen keine wesentlichen Probleme bei der Währungsumrechnung und den Konsolidierungsvorgängen (vgl. Ordelheide, Germany. Group Accounts, S. 1547, 1595). 11 Xenides
162
Kap. F: Einheitliche Bewertung und Konzernbilanzpolitik
sichtsprinzips, das seinerseits in das Realisations- und das Imparitätsprinzip konkretisiert wird49 . Hierbei spielt auch der hohe Anteil der Direkt- oder Fremdfinanzierung durch Banken sowie der Verbleib der Pensionsrückstellungen im Unternehmen eine Rolle 5o . Hinzu kommt die Bindung der Steuerbilanz an die Werte der Handelsbilanz (sog. "Maßgeblichkeitsgrundsatz" - § 5 Abs. I Satz I EStG), die mit Blick auf die Geringhaltung der Steuerlast und die sogenannte "umgekehrte Maßgeblichkeit" (§ 5 Abs. 1 Satz 2 EStG) zu einer noch "vorsichtigeren" Bewertung führt 51 . Das Ergebnis ist eine allgemeine Unterbewertung von Vermögensgegenständen und Überbewertung von Verbindlichkeiten und Rückstellungen, die zur Bildung von stillen Rücklagen führen und die Aussagefähigkeit des Jahresabschlusses mindern 52 . Dagegen sind die US-GAAP und die von ihnen beeinflußten lAS Ausdruck einer auf die Kapitalmarktfinanzierung orientierten Rechnungslegung. Sie stellen auf die Informationsbedürfnisse des Investors als primären Rechnungslegungsadressaten ab. Der US-amerikanische Abschluß hat in erster Linie die Aufgabe, den Investoren entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung zu stellen ("decision usefulness") und diese so zu präsentieren, daß ein möglichst sicherer Einblick in die finanzwirtschaftliehe Unternehmenslage möglich ist ("fair presentation,,)53. Dagegen kommt dem Vorsichtsprinzip ("Prudence") sowohl bei den US-GAAP als auch bei den lAS keine erstrangige Rolle ZU 54 . Diese unterschiedlichen Zielsetzungen in der Rechnungslegung werden durch weitere Unterschiede im Gesellschaftsrecht begründet. Nach deutschem Gesellschaftsrecht wird dem Gläubigerschutz dadurch Rechnung getragen, daß bei der Kapitalgesellschaft eine eigene wirtschaftliche Basis der Gesellschaft, nämlich das Gesellschaftskapital, besteht55 . Das Kapital stellt somit die auf einem sachlichen Vermögen beruhende Haftungsgrund49 Vgl. Biener, Wäre die Übernahme ... , S. 123, 129f.; Gross, Das Fell des Bären, FS Ludewig, S. 333, 338; Niehus, FS Moxter, S. 623, 643; Schruff, Die internationale Vereinheitlichung der Rechnungslegung nach den Vorschlägen des IASC, BFuP 1993, S. 400, 406f.; Schildbach, BB 1995, S. 1635,2637. 50 Vgl. Busse v. Colbe, BFuP 1995, S. 373f.; Clemm, BFuP 1993, Meinungsspiegel, S. 427, 428; Funk, BFuP 1993, Meinungsspiegel, S. 427, 430; Schildba
![Die Bewertung der Kapitallebensversicherung im Zugewinnausgleich [1 ed.]
9783428473021, 9783428073023](https://dokumen.pub/img/200x200/die-bewertung-der-kapitallebensversicherung-im-zugewinnausgleich-1nbsped-9783428473021-9783428073023.jpg)
![Die strafrechtliche Bewertung der Sterbehilfe im deutsch-ungarischen Vergleich [1 ed.]
9783428545377, 9783428145379](https://dokumen.pub/img/200x200/die-strafrechtliche-bewertung-der-sterbehilfe-im-deutsch-ungarischen-vergleich-1nbsped-9783428545377-9783428145379.jpg)


![Die Reform des Föderalismus im Wasserhaushaltsrecht: Zugleich ein Beitrag zur Funktionsbeschreibung und Bewertung der Abweichungsgesetzgebung [1 ed.]
9783428548552, 9783428148554](https://dokumen.pub/img/200x200/die-reform-des-fderalismus-im-wasserhaushaltsrecht-zugleich-ein-beitrag-zur-funktionsbeschreibung-und-bewertung-der-abweichungsgesetzgebung-1nbsped-9783428548552-9783428148554.jpg)
![Die Bewertung von Geruch im Immissionsschutzrecht [1 ed.]
9783428531646, 9783428131648](https://dokumen.pub/img/200x200/die-bewertung-von-geruch-im-immissionsschutzrecht-1nbsped-9783428531646-9783428131648.jpg)
![Die Einheitlichkeit der mitunternehmerischen Beteiligung an einer gewerblichen Personengesellschaft im Rahmen ausgewählter einkommen- sowie erbschaft- und schenkungsteuerrechtlicher Problemstellungen [1 ed.]
9783428583546, 9783428183548](https://dokumen.pub/img/200x200/die-einheitlichkeit-der-mitunternehmerischen-beteiligung-an-einer-gewerblichen-personengesellschaft-im-rahmen-ausgewhlter-einkommen-sowie-erbschaft-und-schenkungsteuerrechtlicher-problemstellungen-1nbsped-9783428583546-9783428183548.jpg)

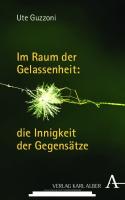

![Die Einheitlichkeit der Bewertung im Konzernabschluß [1 ed.]
9783428491490, 9783428091492](https://dokumen.pub/img/200x200/die-einheitlichkeit-der-bewertung-im-konzernabschlu-1nbsped-9783428491490-9783428091492.jpg)