Die Außenbeziehungen der Europäischen Union nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa: Eine Untersuchung aus kompetenzrechtlicher Sicht - mit Erläuterungen zu den Außenkompetenzen nach dem Vertrag von Nizza [1 ed.] 9783428522408, 9783428122400
Der Vertrag über eine Verfassung für Europa enthält grundlegende Neuerungen in Bezug auf das künftige Kompetenzsystem de
151 93 2MB
German Pages 408 Year 2007
Polecaj historie
Citation preview
Veröffentlichungen des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht an der Universität Kiel Band 164
Die Außenbeziehungen der Europäischen Union nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa Eine Untersuchung aus kompetenzrechtlicher Sicht – mit Erläuterungen zu den Außenkompetenzen nach dem Vertrag von Nizza
Von
Andreas Metz
asdfghjk Duncker & Humblot · Berlin
ANDREAS METZ
Die Außenbeziehungen der Europäischen Union nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Veröffentlichungen des Walther-Schücking-Instituts für Internationales Recht an der Universität Kiel Herausgegeben von J o s t D e l b r ü c k, T h o m a s G i e g e r i c h und A n d r e a s Z i m m e r m a n n Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht 164
Völkerrechtlicher Beirat des Instituts: Rudolf Bernhardt Heidelberg
Eibe H. Riedel Universität Mannheim
Christine Chinkin London School of Economics
Allan Rosas Court of Justice of the European Communities, Luxemburg
James Crawford University of Cambridge
Bruno Simma International Court of Justice, The Hague
Lori F. Damrosch Columbia University, New York Vera Gowlland-Debbas Graduate Institute of International Studies, Geneva Fred L. Morrison University of Minnesota, Minneapolis
Daniel Thürer Universität Zürich Christian Tomuschat Humboldt-Universität, Berlin Rüdiger Wolfrum Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg
Die Außenbeziehungen der Europäischen Union nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa Eine Untersuchung aus kompetenzrechtlicher Sicht – mit Erläuterungen zu den Außenkompetenzen nach dem Vertrag von Nizza
Von
Andreas Metz
asdfghjk Duncker & Humblot · Berlin
Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel hat diese Arbeit im Jahre 2005 als Dissertation angenommen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten # 2007 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme und Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Germany ISSN 1435-0491 ISBN 978-3-428-12240-0 Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier ∞ entsprechend ISO 9706 *
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Vorwort Die vorliegende Untersuchung wurde im Wintersemester 2005 / 2006 von der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Kiel als schriftliche Promotionsleistung angenommen. Die Arbeit befindet sich grundsätzlich auf dem Stand vom Sommer 2005. Über die Zukunft des Verfassungsvertrages ist noch nicht abschließend entschieden worden. Nach den ablehnenden Referenden in Frankreich und den Niederlanden hat sich die Europäische Union selbst eine „Reflexionsphase“ verordnet. Auf der Tagung des Europäischen Rates vom 15. / 16. Juni 2006 wurde dann ein zweigleisiger Ansatz in Bezug auf den Reformprozess vereinbart. Zum einen sollen – parallel zu dem laufenden Ratifizierungsprozess – die Möglichkeiten, die die derzeitigen Verträge bieten, bestmöglich ausgeschöpft werden. Zum anderen wird der Vorsitz dem Europäischen Rat in der ersten Jahreshälfte 2007 einen Bericht vorlegen, der sich auf ausführliche Konsultationen mit den Mitgliedstaaten stützt. Dieser Bericht soll eine Bewertung des Stands der Beratungen über den Verfassungsvertrag enthalten und mögliche künftige Entwicklungen aufzeigen. Auf Grundlage dieses Berichtes soll spätestens im zweiten Halbjahr 2008 entschieden werden, wie der Reformprozess fortgesetzt werden soll. Mit dem Beschluss des Europäischen Rates wurde zwar ein Zeitplan vereinbart, eine endgültige Entscheidung jedoch bewusst vermieden. Wie auch immer das weitere Schicksal des Verfassungsvertrages aussehen wird, werden sich künftige europäische Rechtsentwicklungen an dem vorliegenden Text und den darin enthaltenen Ideen und Neuerungen orientieren. Im Hinblick auf meine Dissertation gilt mein besonderer Dank Herrn Prof. Dr. Andreas Zimmermann, LL.M. (Harvard). Er hat mir bei auftretenden Problemen stets weiter geholfen. Seine äußerst fachkundige, freundliche und unkomplizierte Art der Diskussion dienen mir als Vorbild. Herrn Prof. Dr. Andreas Zimmermann wie auch Herrn Prof. Dr. Dr. Rainer Hofmann danke ich für die zügige und wohlwollende Abfassung des Erst- beziehungsweise Zweitgutachtens. Ebenfalls danken möchte ich Herrn Prof. Dr. Martin Burgi, der bereits in frühen Semestern mein Interesse am Europarecht geweckt hat, sowie Herrn Michael Gahler, MdEP, der mir Einblicke in die praktische Arbeit des Europäischen Parlaments gewährt und dadurch mein Verständnis für Europa vertieft hat. Besonderer Dank gilt meinem Vater, der das umfangreiche Manuskript Korrektur gelesen hat, sowie Herrn Dr. Steffen Kircher, dessen gründliche und durchaus
6
Vorwort
kritische Art der Analyse zu fruchtbaren Diskussionen und Anregungen geführt hat. Die Veröffentlichung der Dissertation wurde durch einen großzügigen Druckkostenzuschuss des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland erheblich erleichtert. Meinen Eltern möchte ich nicht nur für die finanzielle Unterstützung während meiner Dissertation danken, sondern vor allem für die Liebe und Zuneigung, die sie mir mein ganzes Leben lang geschenkt haben. Schließlich möchte ich meiner Frau Slávi danken, die mein Leben bereichert und die mir durch ihr Dasein und ihre Liebe Motivation und Kraft zur Fertigstellung der Arbeit gegeben hat. Möge der Verfassungsvertrag dazu beitragen, dass die Völker Europas friedlich zusammenwachsen. Brüssel, im Juli 2006
Andreas Metz
Inhaltsübersicht Erster Teil Einleitung und Gang der Darstellung
25
§ 1
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
§ 2
Gang der Darstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Zweiter Teil Außenbeziehungen der Europäischen Union (und der Europäischen Gemeinschaften) nach dem Vertrag von Nizza
29
§ 3
Die Völkerrechtsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
§ 4
Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
§ 5
Außenkompetenzen der Europäischen Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Dritter Teil Exkurs: Die Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf die Außenbeziehungen der Europäischen Union
§ 6
173
Die Außenkompetenzen der Europäischen Union nach der Osterweiterung . . . . . . . 173 Vierter Teil Außenbeziehungen der Europäischen Union nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
182
§ 7
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
§ 8
Völkerrechtspersönlichkeit (Art. I-7 EVV), Drei-Säulen-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
§ 9
Die Zuständigkeiten der Union (Art. I-11 bis Art. I-18 EVV), Kompetenzsystem . . 209
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
8
Inhaltsübersicht Fünfter Teil Zusammenfassung und Ergebnis
384
§ 11 Verbesserungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 § 12 Schwachstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 § 13 Grund- oder Leitprinzipien im Bereich der Außenkompetenzen der Europäischen Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Sachwortregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Inhaltsverzeichnis Erster Teil Einleitung und Gang der Darstellung
25
§ 1
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
§ 2
Gang der Darstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Zweiter Teil
§ 3
Außenbeziehungen der Europäischen Union (und der Europäischen Gemeinschaften) nach dem Vertrag von Nizza
29
Die Völkerrechtsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
I. Die Völkerrechtsfähigkeit nach klassischem Völkerrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
II. Die Völkerrechtsfähigkeit Internationaler Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
III. Die Völkerrechtsfähigkeit der EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
1. Rechtsnatur der EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
2. Rechtsfähigkeit der EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
a) Unionsinterne Völkerrechtsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
b) Unionsexterne Völkerrechtsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
aa) Implizite Völkerrechtssubjektivität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
bb) Verschmelzungstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
cc) Art. 24 und 38 EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
dd) Nachträgliche Praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
ee) Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
c) Innerstaatliche Rechtsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
IV. Die Völkerrechtssubjektivität der Europäischen Gemeinschaften (EG, EGKS, EAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
1. Bedeutung der Völkerrechtssubjektivität für die Gemeinschaften . . . . . . .
42
2. Die Völkerrechtssubjektivität der EGKS (Art. 6 Abs. 2 KS) . . . . . . . . . . . .
44
10
§ 4
Inhaltsverzeichnis 3. Die Völkerrechtssubjektivität der EAG (Art. 184 EA) und der EG (Art. 281 EG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
a) Gemeinschaftsinterne Völkerrechtssubjektivität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
b) Gemeinschaftsexterne Völkerrechtssubjektivität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
c) Innerstaatliche Rechtsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
I. Bedeutung der Außenbeziehungen für die EG (und die EU) . . . . . . . . . . . . . . . .
46
1. Allgemeine Bemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
2. Der rechtliche Standpunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
II. Die verschiedenen Vertragsschlussbefugnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
1. Bestehen einer Außenkompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
2. Art der Außenkompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
III. Ausdrückliche Vertragsschlussbefugnisse im Außenbereich . . . . . . . . . . . . . . . .
50
1. Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) – Art. 71 – 75 KS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
a) Generelle Vertragsschlusskompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
b) Grenzen der allgemeinen Vertragsschließungskompetenz . . . . . . . . . . .
52
aa) Art. 70 Abs. 5, 71 Abs. 1 KS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
bb) Art. 133 EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
c) Ausdrücklich zuerkannte Außenkompetenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
2. Europäische Atomgemeinschaft (EAG) – Art. 101 – 106 EA . . . . . . . . . . .
54
a) Prinzip der Parallelität von innerer und äußerer Gemeinschaftszuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
b) Umfang der Kompetenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
c) Art der Kompetenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
3. Europäische Gemeinschaft (EG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
a) Historische Entwicklung der Außenkompetenzen der EG – Von den Römischen Verträgen bis zum Vertrag von Nizza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
aa) Der Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWGV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
bb) Die Einheitliche Europäische Akte (EEA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
cc) Der Vertrag von Maastricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
dd) Der Vertrag von Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
ee) Der Vertrag von Nizza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Inhaltsverzeichnis
11
b) Handelsabkommen, Art. 133 EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
aa) Überblick und horizontale Abgrenzung zu anderen Politikfeldern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
bb) Begriff und Umfang der gemeinsamen Handelspolitik . . . . . . . . .
62
cc) Auf der Grundlage des Art. 133 EG geschlossene Abkommen .
65
dd) Ausschließliche Kompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
c) Assoziierungsabkommen, Art. 310 EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
aa) Begriff und Rechtsnatur von Assoziierungsabkommen . . . . . . . . .
68
bb) Arten von Assoziierungsabkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
d) Konstitutionelle Assoziierungsabkommen, Art. 182 EG . . . . . . . . . . . .
72
e) Währungspolitik, Art. 111 EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
aa) Förmliche Wechselkursvereinbarungen mit Drittstaaten (Abs. 1)
74
bb) Vereinbarungen auf dem Gebiet der Währungspolitik (Abs. 3)
74
cc) Verbliebene Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten (Abs. 5) . . . . . .
75
f) Entwicklungszusammenarbeit, Art. 177 – 181 EG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
aa) Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
bb) Art. 179 Abs. 1 EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
cc) Art. 180 EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
dd) Art. 181 EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
ee) Art. 181 Abs. 2 EG – scheinbarer Widerspruch zur AETRRechtsprechung (paralleles Problem im Rahmen des Art. 181 a EG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
g) Wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten, Art. 181 a EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
h) Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschung, Art. 170 EG i.V.m. 164 lit. b EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
aa) Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
bb) Internationale Zusammenarbeit und völkerrechtliche Verträge
82
cc) Rechtsformen der Zusammenarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
dd) Rahmenprogramme, Art. 166 EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
ee) Art der Außenkompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
i) Umweltpolitik, Art. 174 Abs. 4 EG i.V.m. 175 EG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
aa) Umfang und Abgrenzung der Art. 174, 175 EG zu anderen Kompetenzgrundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) Insbesondere Abgrenzung zu den Handelskompetenzen nach Art. 133 EG, Gutachten 2 / 00, Zuständigkeit zum Abschluss des Protokolls von Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87 87
88
12
Inhaltsverzeichnis bb) Verhältnis der Vertragsschlusskompetenzen der EG zu den Vertragsschlusskompetenzen der Mitgliedstaaten . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
cc) Querschnittsklausel, Art. 6 EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
IV. Ausdrückliche Kompetenzen der EG zur internationalen Zusammenarbeit
94
1. Bildungs-, Kultur- und Gesundheitspolitik (Art. 149 Abs. 3 EG, Art. 150 Abs. 3 EG, Art. 151 Abs. 3 EG und Art. 152 Abs. 3 EG) . . . . . .
94
2. Transeuropäische Netze (Art. 155 Abs. 3 EG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
3. Beziehungen zu internationalen Organisationen (Art. 302 – 304 EG) . . .
98
a) Beziehungen zu den Vereinten Nationen (Art. 302 Abs. 1 EG) . . . . . . 100 b) Zusammenarbeit mit dem Europarat (Art. 303 EG) . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 c) Zusammenwirken mit der OECD (Art. 304 EG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 V. Ausdrückliche Kompetenzen im Bereich der Wirtschaftssanktionen . . . . . . . . 102 1. Kapital- und Zahlungsverkehr, Art. 57, 59 f. EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 a) Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 b) Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit, Art. 57 EG . . . . . . . . . . . . . . 103 c) Kurzfristige Schutzmaßnahmen für das Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion, Art. 59 EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 d) Embargofälle, Art. 60 EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 2. Wirtschaftssanktionen aufgrund von GASP-Beschlüssen, Art. 301 EG
107
a) Entstehungsgeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 b) Völkerrechtliche Grenzen bei der Verhängung von Wirtschaftssanktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 c) Umfang der Wirtschaftssanktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 d) Verhältnis zu anderen Außenkompetenzen der Gemeinschaft aus dem EG-Vertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 VI. Implizite Vertragsschlussbefugnisse im Außenbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 1. Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und Europäische Atomgemeinschaft (EAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 2. Europäische Gemeinschaft (EG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 a) Ausgangspunkt: Wortlaut des Art. 300 Abs. 1 S. 1 EG . . . . . . . . . . . . . . 112 b) Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, Art. 5 EG . . . . . . . . . . . . . 113 c) Die Lehre von den implied powers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 d) EuGH-Rechtsprechung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Inhaltsverzeichnis
13
aa) AETR-Urteil 1971; erstmalige Begründung ungeschriebener Außenkompetenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 bb) Kramer-Urteil (Fischerei-Fangquoten, 1976); Einführung des Komplementaritätsprinzips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 (1) Prinzip der implied-powers und der Komplementarität . . . . . 119 (2) Differenzierung zwischen Existenz und Ausschließlichkeit der festgestellten Außenkompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 cc) Gutachten 1 / 76, Stilllegungsfonds; Erweiternde Präzisierung der bisherigen Rechtsprechung im Sinne des Komplementaritätsprinzips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 dd) Gutachten 2 / 91, ILO; Grundsätze zur Begründung einer ausschließlichen Außenkompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 ee) Gutachten 1 / 94, WTO; Einschränkende Präzisierung des Prinzips der Parallelität von Innen- und Außenkompetenz . . . . . . . . . . (1) Reichweite des Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG), explizite Außenkompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a) GATT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b) GATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c) TRIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) Implizite Außenkompetenzen der Gemeinschaft . . . . . . . . . . . (a) GATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b) TRIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) Verpflichtung zur Zusammenarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 125 126 126 127 128 128 130 130 131
ff) Gutachten 2 / 92, OECD; Bestätigung der WTO-Grundsätze zur ausschließlichen Zuständigkeit im Rahmen der ParallelismusThese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 gg) Gutachten 2 / 94, EMRK; Voraussetzungen für Außenkompetenzen nach Art. 308 EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 hh) Open-Skies-Urteil (05. 11. 2002); zur Frage, wann Gemeinschaftsrechtsnormen durch internationale Verträge der Mitgliedstaaten „beeinträchtigt“ werden können . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Bestehen einer ausschließlichen Außenkompetenz . . . . . . . . . (2) Bestehen einer ausschließlichen Außenkompetenz nach AETR-Maßstäben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136 136 137 140
e) Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 VII. Spezifische Probleme bei (echten oder klassischen) gemischten Abkommen 145 VIII. Verfahren zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 1. EAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
14
Inhaltsverzeichnis 2. EGKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 a) Verhandlungskompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 b) Abschlusskompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 3. EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 a) Verhandlungskompetenz (Art. 300 Abs. 1 EG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 b) Abschlusskompetenz (Art. 300 Abs. 2, 3 EG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
§ 5
Außenkompetenzen der Europäischen Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 I. Außenkompetenzen im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 1. Historische Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 2. Einordnung in das System der EG / EU, Drei- Säulen- Modell . . . . . . . . . . 155 3. Reichweite der Außenkompetenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 4. Aktionsmöglichkeiten im Rahmen der GASP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 a) Gemeinsame Erklärung, Demarche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 b) Bestimmung der Grundsätze und der allgemeinen Leitlinien für die GASP (Art. 12 1. Spiegelstr., Art. 13 Abs. 1 EU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 c) Gemeinsame Strategien (Art. 12 2. Spiegelstr., Art. 13 Abs. 2 EU) . . 158 d) Gemeinsame Aktionen (Art. 12 3. Spiegelstr., Art. 14 EU) . . . . . . . . . . 158 e) Gemeinsame Standpunkte (Art. 12 4. Spiegelstrich, Art. 15 EU) . . . . 159 5. Art. 24 EU im Rahmen der GASP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 a) Überblick zu Art. 24 EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 b) Abgrenzung zu anderen Ermächtigungsgrundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 c) Die Problematik des Vertragsschlusses „durch den Rat“ . . . . . . . . . . . . 161 d) Konkurrenz zwischen Art. 24 EU und den mitgliedstaatlichen Kompetenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 e) Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Art. 24 EU und Art. 300 EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 6. Bisherige Aktionen im Bereich der GASP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 7. Schwächen und Reformperspektiven der derzeit gültigen GASP-Bestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 II. Außenkompetenzen im Bereich der Polizeilichen und Justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 III. Exkurs: Die Westeuropäische Union (WEU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Inhaltsverzeichnis
15
IV. Kompetenzkonflikte im Bereich der Außenpolitik zwischen EG und EU (cross pillar mixity) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 1. Finanzbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 2. Wirtschaftssanktionen, insbesondere Handelsembargos . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Dritter Teil Exkurs: Die Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf die Außenbeziehungen der Europäischen Union § 6
173
Die Außenkompetenzen der Europäischen Union nach der Osterweiterung . . 173 I. Einbringung neuer oder teilweise anders gewichteter Interessen in die Europäische Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 II. Herausforderung durch den Anstieg der Mitgliederzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 III. Folgen der geografischen Erweiterung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 IV. Bestehende Verträge zwischen den Beitrittsstaaten und Drittstaaten . . . . . . . . 179 V. Insbesondere: Probleme mit gemischten Abkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Vierter Teil Außenbeziehungen der Europäischen Union nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
§ 7
182
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 I. Entstehungsgeschichte und Idee des Verfassungskonvents (Erklärung von Laeken, Post-Nizza-Prozess, die Zukunftsfähigkeit der Europäischen Union nach dem Erweiterungsprozess) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 II. Zusammensetzung und Arbeitsweise des Konvents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 III. Das Ergebnis des Verfassungskonvents und sein weiteres Schicksal . . . . . . . . 189 IV. Einfluss auf den Bereich der Außenbeziehungen der EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
§ 8
Völkerrechtspersönlichkeit (Art. I-7 EVV), Drei-Säulen-Modell . . . . . . . . . . . . . . 192 I. Bestehende Situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 II. Mandat, Vorschlag und Ergebnis der Konventsberatungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 1. Mandat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 2. Vorschläge und Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
16
Inhaltsverzeichnis III. Folgen der Anerkennung einer einheitlichen Rechtspersönlichkeit der Union für die Außenbeziehungen der Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 1. Schaffung einer Identität der Union auf internationaler Ebene – die Union als Völkerrechtssubjekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 2. Möglichkeit einer Vertragsfusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 3. Aufgabe des Drei-Säulen-Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 4. Vereinfachung, Transparenz, Rechtssicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 5. Implizierte Änderung der Kompetenzverteilung? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 6. Ersatzlose Streichung des Art. 24 Abs. 5 EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 7. Folgen für die Außenvertretung der Union in internationalen Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 8. Erstreckung der Kontrolle des Europäischen Gerichtshofs auf Abkommen nach den derzeitigen Titeln V und VI des EU-Vertrages nicht umgesetzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 9. Rechtliche Kontinuität und interne Rechtspersönlichkeit, Art. IV-438 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 a) Rechtsnachfolge gegenüber der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 b) Interne Rechtspersönlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 IV. Bewertung der Lösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
§ 9
Die Zuständigkeiten der Union (Art. I-11 bis Art. I-18 EVV), Kompetenzsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 I. Grundprinzipien: Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit, begrenzte Einzelermächtigung, Art. I-11 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 1. Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung, Art. I-11 Abs. 1, 2 EVV
211
2. Grundsatz der Subsidiarität, Art. I-11 Abs. 1, 3 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 a) Schaffung eines Frühwarnsystems in Form einer politischen ex-anteKontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 b) Ex-post-Kontrolle durch den EuGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 c) Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 3. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, Art. I-11 Abs. 1, 4 EVV . . . . . . . . . . . 218 II. Die einzelnen Kompetenztypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 1. Katalogartige Auflistung der Sachbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 2. Art. I-12 EVV als das Herzstück der neuen Kompetenzordnung . . . . . . . . 219
Inhaltsverzeichnis
17
3. Ausschließliche Zuständigkeiten, Art. I-12 Abs. 1, I-13 EVV . . . . . . . . . . 220 4. Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen, Art. I-12 Abs. 5, I-17 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 a) Bedeutung der unterstützenden Maßnahmen (ergänzende Zuständigkeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 b) Bereiche der unterstützenden Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 c) Ausschluss jeglicher Harmonisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 5. Geteilte Zuständigkeiten, Art. I-12 Abs. 2, I-14 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 6. Flexibilitätsklausel, Art. I-18 EVV (Art. 308 EG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 7. GASP, Art. I-16 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 8. Die Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik, Art. I-15 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 III. Achtung der nationalen Identität der Mitgliedstaaten, Art. I-5 EVV . . . . . . . . 231 IV. Weitere allgemeine Grundsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 § 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 I. Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 1. Das neue System und seine Ziele: Verständlichkeit, Klarheit, Kohärenz zwischen innen- und außenpolitischem Handeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 a) Die Bündelung der Vorschriften über das außenpolitische Handeln in einem besonderen Titel des Verfassungsvertrags (Art. III-292 bis III-329 EVV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 b) Die Schaffung einer neuen Ratsformation „Auswärtige Angelegenheiten“, Art. I-24 Abs. 3 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 2. Allgemeine Grundsätze und Ziele beim Auswärtigen Handeln der Union, Art. III-292 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 3. Strategische Interessen und Ziele der Union, Art. III-293 EVV . . . . . . . . . 239 II. Geschriebene Außenkompetenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 1. Zuständigkeit zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten je nach Politikbereich unterschiedlich abgegrenzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 2. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik GASP, Art. I-16, I-40, III-294 ff. EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 a) Bestehende Situation / Integration der ehemaligen 2. Säule des EUVertrags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 b) Art der Kompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 2 Metz
18
Inhaltsverzeichnis c) Keine genaue Festlegung der Befugnisse der Union . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 d) Ausdrückliche Vertragsschlusskompetenz, Art. III-303 EVV . . . . . . . 246 e) Entscheidende institutionelle Neuerung: die Schaffung des Amtes eines Außenministers der Union, Art. I-28 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 aa) Die verschiedenen Vorschläge der Arbeitsgruppe „Außenpolitisches Handeln“ des Verfassungskonvents zur Strukturreform der GASP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Status Quo – Zusammenlegung von Dienststellen, Synergien nutzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) Völlige Verschmelzung der beiden Ämter, vollständige Anwendung der Gemeinschaftsmethode auf den gesamten Bereich des auswärtigen Handelns der Union . . . . . . . . . . . . . . (3) Personalunion, Verbindung der Funktionen der beiden Ämter durch die Schaffung eines „Europäischen Vertreters für Auswärtiges“ (Doppelhut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) Schaffung eines „EU-Außenministers“, der dem Präsidenten des Europäischen Rates direkt unterstellt ist . . . . . . . . . . . . bb) Die tatsächlich in den Verfassungsvertrag aufgenommene Lösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Art und Umfang der Aufgaben des Außenministers der Europäischen Union, Art. I-28 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) Übertragung von Initiativrechten auf den Außenminister, Art. I-28 Abs. 2, III-296 Abs. 1 und III-299 Abs. 1 EVV . . . (3) Vereinbarkeit der beiden Funktionen des Außenministers („Doppelhut“) mit der Unabhängigkeit der Kommission gemäß Art. I-26 Abs. 7 und III-347 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247 247
248
248 249 250 250 254
255
cc) Bewertung der Lösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 f) Beschlussfassungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 aa) Völkerrechtliche Übereinkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 bb) Die neue Rechtsform der Europäischen Beschlüsse . . . . . . . . . . . . 259 cc) Grundsätzlich wie bisher: Einstimmigkeit, Art. III-300 Abs. 1 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 dd) Ausnahmsweise: Qualifizierte Mehrheit, Art. III-300 Abs. 2 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Einzelne Bereiche, in denen das Beschlussfassungsverfahren mit qualifizierter Mehrheit gilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) Ausnahme: Fortschreibung des Luxemburger Kompromisses von 1966, Art. III-300 Abs. 2 UAbs. 2 EVV . . . . . . . . . . . . (3) Immer Einstimmigkeit bei Beschlüssen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen, Art. III-300 Abs. 4 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) Einführung einer neuen Art von Initiativen, Art. III-293 Abs. 2 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261 261 263
264 264
ee) Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Inhaltsverzeichnis
19
g) Die Rolle des Europäischen Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 h) Die Rolle des Europäischen Parlaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 aa) Allgemeine Anhörungsrechte im GASP-Bereich . . . . . . . . . . . . . . . 268 bb) Anhörungsrecht bei völkerrechtlichen Übereinkommen im GASP-Bereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 i) Die Rolle der nationalen Parlamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 j) Politisches und Sicherheitspolitisches Komitee, Art. III-307 EVV . . 270 k) Verschärfte gegenseitige Konsultations- und Koordinationspflichten, Art. I-40 Abs. 5 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 l) Finanzierung der GASP Art. III-313 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 aa) Allgemeine Finanzierung der GASP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 bb) Sofortfinanzierung für die Vorbereitung von Operationen mit zivilem Charakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 cc) Sofortfinanzierung für die Vorbereitung von Operationen mit militärischem Charakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 m) Verhältnis zwischen Außenminister der Union und dem EU-Ratspräsidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 n) Möglichkeit der Verstärkten Zusammenarbeit, Art. I-44 und Art. III-416 ff. EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 o) Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 3. Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Art. I-41 EVV und Art. III-309 – Art. III-312 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 a) Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 b) Aufgaben und Umfang der Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 c) Beschlussfassungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 d) Errichtung einer Europäischen Verteidigungsagentur, Art. I-43 Abs. 3, Art. III-311 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 e) Ständige Strukturierte Zusammenarbeit, Art. I-41 Abs. 6, Art. III-312 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 f) Beistandsklausel nach Art. I-41 Abs. 7 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 g) Die Rolle des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees und des Europäischen Parlaments, Art. I-41 Abs. 8 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . 285 h) Exkurs: Einfügung einer Solidaritätsklausel, Art. I-43 in Verbindung mit Art. III-329 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 i) Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 4. Gemeinsame Handelspolitik, Art. III-314 f. EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 a) Art der Zuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 b) Umfang der Gemeinsamen Handelspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 2*
20
Inhaltsverzeichnis aa) Erweiterung des Begriffs der Handelspolitik, keine Notwendigkeit mehr für gemischte Abkommen im Dienstleistungsbereich und bei den Handelsaspekten des geistigen Eigentums . . . . . . . . . 289 bb) Aufnahme der ausländischen Direktinvestitionen . . . . . . . . . . . . . . 290 cc) Sonderregelungen für den Sektor Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 dd) Begrenzung der internen Implementierungskompetenz, Art. III-315 Abs. 2 und 6 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 ee) Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 c) Ziele und Kohärenzklausel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 d) Beschlussfassungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 e) Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 5. Assoziierungsabkommen, Art. III-324 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 6. Konstitutionelle Assoziierungsabkommen, Art. III-286 – III-291 EVV . . 296 7. Zusammenarbeit mit Drittländern und humanitäre Hilfe, Art. III-316 – III-321 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 a) Entwicklungszusammenarbeit, Art. III-316 – III-318 EVV . . . . . . . . . 297 aa) Art der Zuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 bb) Umfang der Zuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 b) Wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittländern, Art. III-319 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 aa) Art der Zuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 bb) Umfang der Zuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 c) Humanitäre Hilfe, Art. III-321 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 aa) Art der Zuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 bb) Umfang der Zuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 8. Ausdrückliche Kompetenzen im Bereich der Wirtschaftssanktionen (Restriktive Maßnahmen), Art. III-322 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 9. Ausdrückliche Kompetenzen im Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs, Art. III-159, III-160 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 10. Währungspolitik, Art. III-185 ff. EVV, Art. III-326 EVV . . . . . . . . . . . . . . . 310 a) Art der Zuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 b) Umfang der Zuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 aa) Außenvertretung der Eurozone, Art. III-196 EVV . . . . . . . . . . . . . . 312 bb) Sondervorschrift für völkerrechtliche Übereinkünfte, Art. III-326 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Inhaltsverzeichnis
21
11. Umweltabkommen, Art. III-233 Abs. 4 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 a) Art der Zuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 b) Umfang der Zuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 12. Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschung, technologischen Entwicklung und Raumfahrt, Art. III-252 Abs. 4 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 a) Art der Zuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 b) Umfang der Zuständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 13. Politik betreffend Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung, Art. III-267 Abs. 3 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 14. Ausdrückliche Kompetenzen der Union zur internationalen Zusammenarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 a) Öffentliche Gesundheit, Art. III-278 Abs. 3 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 b) Bereiche mit geteilter Zuständigkeit im öffentlichen Gesundheitssektor, Art. III-278 Abs. 4 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 c) Kultur, Art. III-280 Abs. 3 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 d) Allgemeine Bildung, Jugend, Sport und berufliche Bildung, Art. III-282 Abs. 2 und III-283 Abs. 2 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 e) Katastrophenschutz, Art. III-284 Abs. 1 UAbs. 2 lit. c EVV . . . . . . . . 320 f) Transeuropäische Netze, Art. III-247 Abs. 4 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 g) Verkehr, Art. III-236 Abs. 2 lit. a EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 h) Andere, neu in die Verfassung aufgenommene Bereiche . . . . . . . . . . . . 322 i) Beziehungen zu internationalen Organisationen und Drittländern; Delegationen der Union, Art. III-327 und III-328 EVV . . . . . . . . . . . . . 323 aa) Vollmitgliedschaft der Union in Internationalen Organisationen
323
bb) Auswirkungen auf den Status der Mitgliedstaaten . . . . . . . . . . . . . . 323 cc) Umfang und Umsetzung der Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 dd) Die Delegationen der Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 ee) Einrichtung eines Europäischen Auswärtigen Dienstes, Art. III-296 Abs. 3 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 15. Außenkompetenzen aus Teil I der Verfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 a) Beitritt zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte, Art. I-9 Abs. 2 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 b) Die Union und ihre Nachbarn, Art. I-57 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 16. Zusammenfassung und Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
22
Inhaltsverzeichnis III. Generelle Vertragsschlusskompetenz der Union, Art. III-323 EVV (derzeit: ungeschriebene oder implizite Außenkompetenzen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 1. Ausdrückliche Kompetenz, Art. III-323 Abs. 1 Var. 1 EVV in Verbindung mit Verfassungsvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 2. Generelle Vertragsschließungskompetenz, Art. III-323 Abs. 1 Var. 2, 3, 4 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 a) Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 aa) Die einzelnen Tatbestandsmerkmale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Im Rahmen der Politik der Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) Ein in der Verfassung festgesetztes Ziel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a) Zahlreiche und weitreichende Zielbestimmungen . . . . . . (b) Begrenzung durch die Art der Kompetenz . . . . . . . . . . . . . (3) Erforderlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a) Vergleich mit Art. 72 Abs. 2 GG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b) Erforderlichkeit als Suche nach dem milderen Mittel . . (c) Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
333 334 334 334 335 336 336 338 339
bb) Die Abkehr von dem bisher angewandten implied-powersGrundsatz zugunsten eines (eingeschränkten) Ziel-MittelSchlusses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 cc) Widerspruch zwischen dem Abschlussbericht der Arbeitsgruppe und dem tatsächlichen Wortlaut des Verfassungsentwurfs . . . 343 dd) „Überschießende“ Außenkompetenz (Parallele zur gemeinsamen Handelspolitik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 ee) Art der Kompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 b) Art. III-323 Abs. 1 Var. 3 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 c) Art. III-323 Abs. 1 Var. 4 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 d) Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 IV. Ausschließliche Kompetenzen, Art. I-13 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 1. Zollunion Art. I-13 Abs. 1 lit. a EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 2. Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarktes erforderlichen Wettbewerbsregeln, Art. I-13 Abs. 1 lit. b EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 3. Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, Art. I-13 Abs. 1 lit. c EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 4. Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik, Art. I-13 Abs. 1 lit. d EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 5. Gemeinsame Handelspolitik, Art. I-13 Abs. 1 lit. e EVV . . . . . . . . . . . . . . . 353
Inhaltsverzeichnis
23
6. Allgemeine Voraussetzungen für das Vorliegen einer ausschließlichen Außenkompetenz der Europäischen Union, Art. I-13 Abs. 2 EVV . . . . . . 353 a) Explizite Erwähnung des Abschlusses eines internationalen Übereinkommens in einem Gesetzgebungsakt der Union, Art. I-13 Abs. 2 Var. 1 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 aa) Kodifizierung der EuGH-Rechtsprechung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 bb) Verfassungsrechtlich problematische Wirkung des Sekundärrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 cc) Parallelen und Unterschiede zum AETR-Prinzip . . . . . . . . . . . . . . . 356 dd) Bewertung der Rechtslage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 b) Notwendigkeit einer ausschließlichen Kompetenz, damit die Union ihre interne Zuständigkeit ausüben kann, Art. I-13 Abs. 2 Var. 2 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 c) Beeinträchtigung eines internen Rechtsakts der Union durch den Abschluss eines internationalen Übereinkommens, Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 aa) Probleme hinsichtlich der Bestimmbarkeit des Begriffs „beeinträchtigen“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 bb) Probleme hinsichtlich der möglichen Reichweite des Art. I-13 Abs. 2 Var. 3. EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Sperrwirkung nach Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV nur für den Bereich der geteilten Zuständigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) Reduktion des Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV für die Bereiche der parallelen und der unterstützenden Kompetenzen sowie für den GASP-Bereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a) Parallele Zuständigkeiten nach Art. I-14 Abs. 3, 4 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b) Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungskompetenzen, Art. I-17 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c) GASP-Übereinkünfte, Art. I-16 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360 360
361 362 363 363
cc) Vergleich mit der im Konventsentwurf enthaltenen Fassung . . . . 365 dd) Bewertung der Regelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 V. Vergleichende Analyse von Art. I-13 Abs. 2 EVV und Art. III-323 Abs. 1 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 1. Art. I-13 Abs. 2 Var. 1 EVV und Art. III-323 Abs. 1 Var. 3 EVV . . . . . . . 367 2. Art. I-13 Abs. 2 Var. 2 EVV und Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV . . . . . . . 368 3. Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV und Art. III-323 Abs. 1 Var. 4 EVV . . . . . . . 368 4. Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 VI. Bindungswirkung, Art. III-323 Abs. 2 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
24
Inhaltsverzeichnis VII. Das Verfahren zum Abschluss völkerrechtlicher Abkommen, Art. III-325 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 1. Die Rolle des Ministerrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 2. Die Rolle des Europäischen Parlaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 a) Anhörungs- und Zustimmungsrechte des Europäischen Parlaments . . 373 aa) Allgemeine Abkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 bb) Handelsabkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 cc) Abkommen im Bereich der GASP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 3. Beschlussfassungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 4. Aufgabensplitting im Bereich der Verhandlungsvorschläge: EU-Außenminister für GASP-Bereich, Kommission für andere Bereiche des auswärtigen Handelns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 5. Übereinkommen, die unter verschiedene Themenbereiche fallen (ehemals säulenübergreifende oder „cross-pillar mixity“ Abkommen) . . . . . . 379 6. Sonderregelungen für Währungsabkommen, Art. III-326 EVV . . . . . . . . . 379 7. Sonderregelungen für die Gemeinsame Handelspolitik, Art. III-315 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 8. Gutachten nach Art. III-325 Abs. 11 EVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Fünfter Teil Zusammenfassung und Ergebnis
384
§ 11 Verbesserungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 § 12 Schwachstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 § 13 Grund- oder Leitprinzipien im Bereich der Außenkompetenzen der Europäischen Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Sachwortregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Erster Teil
Einleitung und Gang der Darstellung § 1 Einleitung Der Begriff „Außenpolitik“ im Sinne des Europarechts umfasst grundsätzlich alle Verhaltensweisen der EG, der Europäischen Union oder der gemeinsam handelnden Mitgliedstaaten, die dazu bestimmt oder geeignet sind, Wirkungen außerhalb der Union zu entfalten.1 Der Bereich der Außenkompetenzen steht im Spannungsfeld zwischen gemeinschaftlichen und mitgliedstaatlichen Interessen. So werden die Außenbeziehungen traditionell als integraler Bestandteil staatlicher Souveränität angesehen mit der Folge, dass die Mitgliedstaaten oft nur höchst ungern einer Übertragung von Kompetenzen auf die Union oder die Gemeinschaft zustimmen. Auf der anderen Seite wird die Europäische Union in wirtschaftlicher wie in politischer Hinsicht immer mehr zu einem sehr bedeutenden globalen Machtfaktor (Global Player), ein Umstand, der ein einheitliches und effektives Handeln nach außen – und damit Außenkompetenzen (mit entsprechenden Verfahrensregeln) – erforderlich macht. Kompetenzkonflikte sind vor allem Machtkonflikte. Sie haben einen Streit zum Gegenstand, den Rechtssubjekte oder Organe um die Wahrnehmung bestimmter Angelegenheiten austragen. In jedem System, in dem verschiedene Akteure nebeneinander Handlungsbefugnisse haben, sind derartige Konflikte vorhanden. Sie sind einerseits unvermeidbar, können andererseits aber auch befruchtend und integrierend wirken.2 Dabei ist nicht die Existenz von Kompetenzkonflikten das eigentliche Problem einer Rechtsordnung, sondern die Art und Weise, wie diese Konflikte gelöst werden sollen. Im Bereich des Europarechts existieren derzeit drei Akteure, welche sich auf dem Gebiet der Außenpolitik betätigen: es sind dies die beiden Europäischen Gemeinschaften, die Europäische Union und schließlich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das Bild wird noch komplexer, wenn man die einzelnen Ebenen innerhalb dieser Akteure in die Analyse einbezieht, insbesondere den Europäischen Rat, den Rat, das Europäische Parlament und die Kommission. Beim Zusammenwirken so vieler Rechtssubjekte und Organe kommt es naturgemäß zu Streitig1 2
Bieber / Epiney / Haag / Beutler, Die EU Rechtsordnung und Politik, S. 730. Nettesheim, EuR 1993, 243 (243).
26
1. Teil: Einleitung und Gang der Darstellung
keiten. Dabei sind vertikale Kompetenzstreitigkeiten solche zwischen Mitgliedstaaten und der EG (beziehungsweise der Union), horizontale Kompetenzstreitigkeiten solche zwischen den EG-Organen untereinander. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf Probleme und die Darstellung der vertikalen Kompetenzabgrenzung zwischen der Europäischen Union / Europäischen Gemeinschaft einerseits und den Mitgliedstaaten andererseits. Nur dort, wo es zum Verständnis der Machtstrukturen und des Kompetenzsystems notwendig erscheint (dies ist insbesondere im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Fall), muss auch auf die horizontale Kompetenzabgrenzung eingegangen werden.
§ 2 Gang der Darstellung Die Darstellung begreift sich als erstes Gedankengerüst oder als erste Gesamtschau der Außenkompetenzen der Europäischen Union nach dem neuen Verfassungsvertrag. Die Arbeit untersucht vergleichend zum einen anhand der derzeit gültigen Verträge (EU-Vertrag, EG-Vertrag) und der Rechtsprechung des EuGH, zum anderen anhand des Vertrags über eine Verfassung für Europa (und wo nötig auch des Konventsentwurfs) die Kompetenzen, die der Union im Außenbereich zustehen. Zentrale Bedeutung im Zweiten Teil der Arbeit kommt der Frage zu, inwieweit der Europäischen Gemeinschaft implizite Außenkompetenzen zustehen und nach welchen Kriterien das Bestehen und die Reichweite der jeweiligen Kompetenzen zu bestimmen sind.3 Die Arbeit beginnt mit dem Problem, inwieweit der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft Völkerrechtssubjektivität zukommt. Um internationale Verträge abschließen oder in anderer Form völkerrechtlich wirksam auftreten zu können, um also effektive Außenpolitik betreiben zu können, muss eine internationale Organisation – zumindest partiell – völkerrechtsfähig sein. Während das Bestehen der Völkerrechtsfähigkeit für die Europäische Gemeinschaft allgemein bejaht wird, ist dies für die Europäische Union heftig umstritten. Im Anschluss an die Untersuchung der Völkerrechtsfähigkeit stellen sich im Bereich der Außenkompetenzen zwei grundlegende Fragen: Zum einen diejenige nach dem Bestehen einer Außenkompetenz in einem bestimmten Bereich, zum anderen diejenige nach der Art der festgestellten Kompetenz. Die erste Frage lässt sich relativ problemlos beantworten, wenn die Europäischen Verträge eine kompetenzbegründende Norm enthalten (ausdrückliche Kom3 Zur Begründung von impliziten Zuständigkeiten stehen mehrere Rechtskonstruktionen, wie die Lehre von den implied powers, den Kompetenzen kraft Natur der Sache, des effet utile, sowie des Außenbezugs von intern gewährten Kompetenzen zur Verfügung, vgl. Nettesheim, EuR 1993, 243 (243).
§ 2 Gang der Darstellung
27
petenz); dann geht es vor allem um die Bestimmung des Umfangs der Kompetenz. Ist eine ausdrückliche Regelung jedoch nicht vorhanden, stellt sich die Frage, ob eine Außenkompetenz – trotz des Schweigens der Verträge – angenommen werden darf. Bejaht man dies, stellt sich ein weiteres Problem, nämlich das nach der rechtsdogmatischen Begründung dieser Konstruktion. Naturgemäß ist auch der Umfang einer solchen Kompetenz nicht leicht zu bestimmen. Die Rechtslage im Bereich der ungeschriebenen Außenkompetenzen wird derzeit maßgebend von wegweisenden Urteilen des Europäischen Gerichtshofs geprägt, welche im Rahmen der Arbeit dargestellt und analysiert werden sollen. Im Bereich der zweiten Frage (nach der Art der Kompetenz) kommen mehrere Kompetenzkategorien in Betracht. Im Bereich der Außenkompetenzen können parallele, konkurrierende (beziehungsweise geteilte) oder ausschließliche Kompetenzen angenommen werden. Die rechtliche Analyse wird dabei von dem Umstand erschwert, dass die derzeit gültigen Verträge weder eine Definition der genannten Kompetenzarten geben, noch bestimmte Politikfelder diesen Kompetenzen zuordnen. Darüber hinaus sind die Außenkompetenzen der EG und der EU über die gesamten Europäischen Verträge verteilt. Im Sinne eines Exkurses werden im Dritten Teil der Arbeit die Rechtsfolgen untersucht, die die am 1. Mai 2004 erfolgte Erweiterung der Union um 10 neue Mitgliedstaaten mit sich bringt. Auch hier liegt der Fokus der Untersuchung auf den Folgen für die Außenbeziehungen der Europäischen Union. Kurz dargestellt werden die Implikationen, welche die Erweiterung rechtlich, politisch und wirtschaftlich hat. Dem Vierten Teil der vorliegenden Arbeit stand nur eine begrenzte Anzahl von Sekundärliteratur zur Verfügung. Das lag zum einen daran, dass aufgrund der im Verhältnis zur Vorstellung des Verfassungsentwurfs am 18. Juli 2003 zeitnah begonnenen Untersuchung noch wenig juristische Fachliteratur fertiggestellt war. Zum anderen ist zu vermuten, dass einige Autoren auf den endgültigen Vertragstext warteten, der erst auf der Regierungskonferenz in Rom am 29. Oktober 2004 unterzeichnet und in überarbeiteter Version schließlich im Dezember 2004 im Internet zugänglich gemacht worden ist. Speziell im Bereich der Außenbeziehungen der Union wurden von der abschließenden Regierungskonferenz – wie sich erwies – aber kaum Änderungen am Verfassungsentwurf vorgenommen. Die von der Regierungskonferenz tatsächlich getroffenen Modifikationen bezogen sich hauptsächlich auf das Problem der „Doppelten Mehrheit“ und der Definition der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit. Der von einem Europäischen Konvent vorbereitete und von den Staats- und Regierungschefs der europäischen Mitgliedstaaten am 17. / 18. Juni 2004 verabschiedete Europäische Verfassungsvertrag bringt umwälzende Neuerungen mit sich. Welche Auswirkungen die Schaffung eines eigenen Kompetenztitels, eines besonderen Titels über die Außenbeziehungen der Union, des Amtes eines Außen-
28
1. Teil: Einleitung und Gang der Darstellung
ministers der Union und schließlich die Verleihung von Rechtspersönlichkeit an die (vereinte, mit der Europäischen Gemeinschaft verschmolzene) Europäische Union hat, soll im Vierten Teil der Arbeit dargestellt werden. Im letzten Teil der Arbeit soll – im Sinne einer abschließenden Bewertung – zum einen dargelegt werden, welche positiven Neuerungen der Verfassungsvertrag mit sich bringt und in welchen Bereichen (weiterhin) Schwachstellen bestehen. Zum anderen wird versucht, Grund- oder Leitprinzipien im Bereich der Außenkompetenzen der Europäischen Union aus dem Verfassungsvertrag herauszufiltern. Die Arbeit ist so aufgebaut, dass jeweils der Zweite, Dritte oder der Vierte Teil der Arbeit unabhängig voneinander gelesen werden kann, ohne dass die Lektüre der jeweils anderen Teile zum Verständnis unbedingt erforderlich wäre. Dies ermöglicht es dem Leser, sich zum Beispiel lediglich einen Überblick über die nach dem Verfassungsentwurf eintretende Rechtslage zu verschaffen. Daher werden im Vierten Teil der Arbeit, wo es aus Gründen der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit erforderlich ist, die Rechtslage und die zum Zweiten Teil vertretenen Thesen kurz wiederholt.
Zweiter Teil
Außenbeziehungen der Europäischen Union (und der Europäischen Gemeinschaften) nach dem Vertrag von Nizza § 3 Die Völkerrechtsfähigkeit I. Die Völkerrechtsfähigkeit nach klassischem Völkerrecht Völkerrechtsfähigkeit bedeutet grundsätzlich die Fähigkeit, Zuordnungssubjekt völkerrechtlicher Rechte und Pflichten zu sein.1 Unter einem Völkerrechtssubjekt versteht man ein Rechtssubjekt, dessen Rechte und Pflichten vom Völkerrecht bestimmt werden. Dabei wird zwischen ursprünglichen (originären oder geborenen) und abgeleiteten (derivativen) Völkerrechtssubjekten unterschieden.2 Erstere sind souveräne Subjekte, deren faktische Existenz allein ihre Völkerrechtsfähigkeit begründet; letztere hingegen werden entweder von schon bestehenden Völkerrechtssubjekten geschaffen und mit Völkerrechtsfähigkeit ausgestattet oder sie sind bereits existierende Rechtssubjekte nach innerstaatlichem Recht. In diesem Fall muss mindestens ein Völkerrechtssubjekt ihnen völkerrechtliche Rechte und Pflichten übertragen und sie so zu eigenständigen Völkerrechtssubjekten aufwerten.3 Die drei klassischen Betätigungsformen auf dem Feld der auswärtigen Beziehungen setzen Völkerrechtsfähigkeit voraus. Es handelt sich zum einen um das Missionsrecht in seiner Doppelgestalt als Recht zur Unterhaltung diplomatischer Vertretungen und als Recht der Teilnahme an der Arbeit internationaler Organisationen, zum anderen um das Recht zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge und schließlich um das Recht zum Schutz staatlicher Interessen auf internationalem Gebiet.4 1 Bieber / Epiney / Haag / Beutler, Die EU Rechtsordnung und Politik, S. 689; Schweitzer, Staatrecht III, S. 182. Die Begriffe „Völkerrechtsfähigkeit“ und „Völkerrechtssubjektivität“ werden synonym verwendet. 2 Fischer / Köck, Allgemeines Völkerrecht, S. 69. 3 Fischer / Köck, Allgemeines Völkerrecht, S. 69. 4 Reichardt, Auswärtige Beziehungen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu Drittstaaten und internationalen Organisationen, S. 79.
30
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
II. Die Völkerrechtsfähigkeit Internationaler Organisationen Grundsätzlich sind nur souveräne Staaten Träger aller völkerrechtlichen Rechte und Pflichten, souveräne Staaten werden auch als „geborene“ Völkerrechtssubjekte bezeichnet.5 Nach heute fast unbestrittener Meinung sind aber auch internationale Organisationen völkerrechtsfähig, wenn sie durch ihre Mitgliedstaaten ausdrücklich oder stillschweigend mit Völkerrechtssubjektivität ausgestattet worden sind (abgeleitete oder derivative Völkerrechtsfähigkeit).6 Bei der Völkerrechtspersönlichkeit wird zwischen der absoluten und der relativen internationalen Rechtspersönlichkeit unterschieden. Die absolute Völkerrechtsfähigkeit wird im Allgemeinen nur Staaten zugesprochen; das bedeutet, der betroffene Staat muss von jedem anderen als Rechtssubjekt mit eigenen Rechten und Pflichten anerkannt werden.7 Internationalen Organisationen wird hingegen nur eine relative Rechtspersönlichkeit zuerkannt. Sie sind demnach nur hinsichtlich des ihnen übertragenen Rechten- und Pflichtenkreises Träger völkerrechtlicher Rechte und Pflichten.8 Als einzige Ausnahme von der Regel der relativen Völkerrechtsfähigkeit internationaler Organisationen gelten seit dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) aus dem Jahre 1949 die Vereinten Nationen. Der Gerichtshof billigte den Vereinten Nationen eine objektive, also auch von Nichtmitgliedern zu respektierende Rechtspersönlichkeit zu; er begründete diese Ansicht mit der großen Anzahl an UN-Mitgliedstaaten, die ausreiche, um die Rechtspersönlichkeit der UN auch gegenüber Nichtmitgliedstaaten zur Geltung zu bringen.9 Eine Internationale Organisation ist ein von souveränen Staaten durch völkerrechtliche Willenseinigung (Gründungsvertrag) geschaffener, auf Dauer angelegter mitgliedschaftlicher Verband, der mit eigenen Organen ausgestattet ist und bestimmte hoheitliche Zwecke verfolgt.10 Im Gründungsvertrag geben die Gründungsmitglieder (zumeist Staaten) einen Teil ihrer eigenen völkerrechtlichen Rechts- und Handlungsfähigkeit an die neu gegründete Organisation ab. Daher spricht man auch von „abgeleiteter“ Völkerrechtsfähigkeit der neuen Organisation.11 Internationale Organisationen unterstehen unmittelbar der Völkerrechtsord5 Demnach sind Staaten die klassischen Völkerrechtssubjekte, vgl. dazu auch Art. 34 Abs. 1 StIGH (Sartorius II, Nr. 2) „Nur Staaten sind berechtigt, als Parteien vor dem Gerichtshof aufzutreten.“ 6 Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 281 EGV Rdnr. 2. 7 Fischer / Köck, Europarecht, S. 667. 8 Bieber / Epiney / Haag / Beutler, Die EU Rechtsordnung und Politik, S. 689. 9 ICJ Reports 1949, 174 ff. – Gutachten über Ersatz für im Dienste der Vereinten Nationen erlittene Schäden. 10 Wichard, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 1 EU Rdnr. 6; Schweitzer, Staatrecht III, S. 228. 11 Emmert, Europarecht, S. 451.
§ 3 Die Völkerrechtsfähigkeit
31
nung. Eine internationale Organisation muss einem bestimmten Zweck dienen und über eine institutionelle Struktur verfügen.12 Meistens existiert ein ständiges Sekretariat, ein Plenarorgan, mitunter auch ein enger zusammengesetztes Exekutivorgan, sowie in neuerer Zeit immer häufiger ein Streitschlichtungsorgan. Mitglieder internationaler Organisationen sind meist Staaten, es können aber auch Organisationen eine internationale Organisation gründen, soweit die Mitglieder (bzw. die Gründer) selbst Völkerrechtssubjekte sind. Sind sie dies nicht (z. B. Privatleute oder privatrechtliche Vereinigungen), spricht man von Non-Governmental Organisations (NGOs = Nichtregierungsorganisationen [NROs]). Solche Zusammenschlüsse, deren Mitglieder Einzelpersonen oder Verbände sind (z. B. amnesty international [ai] oder der World Wildlife Fund [WWF]), sind keine Völkerrechtssubjekte. Das Vorliegen der Rechtspersönlichkeit einer internationalen Organisation wird angenommen, wenn folgende drei Voraussetzungen vorliegen: Zum einen sollte die Organisation die Fähigkeit haben, in eigenen Organen einen eigenständigen Willen bilden zu können; zum anderen muss sie die Fähigkeit besitzen, einzelne Mitgliedstaaten notfalls auch gegen ihren Willen binden zu können, und schließlich muss ihr die Fähigkeit zukommen, gegenüber außenstehenden Völkerrechtssubjekten rechtswirksam handeln zu können.13 Internationale Organisationen besitzen daher nur insoweit eine (partielle) völkerrechtliche Rechts- und Handlungsfähigkeit, als ihre Gründungsstaaten sie damit ausstatten wollen. Mitgliedstaaten einer internationalen Organisation z. B. haben diese mit ihrem Beitritt zu der Organisation zumindest konkludent völkerrechtlich anerkannt.14 Die Rechtspersönlichkeit einer solchen Organisation erlischt wieder, wenn dies der eindeutige Wille ihrer Mitglieder ist.15 Eine direkt oder indirekt im Gründungsvertrag festgelegte Völkerrechtssubjektivität einer internationalen Organisation wirkt nur gegenüber den Mitgliedstaaten. Für Nichtmitgliedstaaten entsteht diese Völkerrechtssubjektivität nur, wenn sie sie ausdrücklich oder stillschweigend anerkennen.16 Ob Staatenverbindungen oder internationale Organisationen eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen und ob diese sie auch dazu ermächtigt, völkerrechtliche Verträge abzuschließen, ergibt sich aus ihrer Verfassung beziehungsweise aus ihren Gründungsverträgen.17 Aber auch wenn die Gründungsverträge hinsichtlich der Rechtspersönlichkeit keine eindeutigen Vorschriften enthalten, kann sich das Recht zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge aus den Umständen ergeben, z. B. aus 12 13 14 15 16 17
Kokott / Doehring / Buergenthal, Grundzüge des Völkerrechts, S. 35. Wichard, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 1 EU Rdnr. 6. Fischer / Köck, Europarecht, S. 667. Seidl-Hohenveldern, Völkerrecht, S. 191. Schweitzer, Staatrecht III, S. 231. Delbrück / Wolfrum, Völkerrecht, S. 528 f.
32
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
der Überlegung, dass die Arbeit der jeweiligen internationalen Organisation nicht sinnvoll oder uneffektiv wäre, falls sie nicht das Recht zum Vertragsabschluss besäße. Ein solcher Schluss wird mit dem sog. implied powers Grundsatz begründet.18 Die Völkerrechtsfähigkeit muss anhand ausdrücklicher Regelungen im Gründungsvertrag der jeweiligen internationalen Organisation oder aufgrund impliziter Regelungen (implied-powers-Lehre) bestimmt werden.19 Eine internationale Organisation besitzt nur eine partikuläre Völkerrechtspersönlichkeit, nämlich nur im Rahmen der Beziehungen mit ihren Mitgliedstaaten, sowie mit solchen Staaten, die ihre Rechtspersönlichkeit ausdrücklich oder stillschweigend anerkannt haben.20 Des Weiteren ist die Völkerrechtsfähigkeit insofern beschränkt, als sie nur so weit reicht, wie die Gründungsmitglieder eine solche ausdrücklich oder implizit übertragen haben. Hätten die internationalen Organisationen volle Völkerrechtsfähigkeit, würde es sich bei den gegründeten Organisationen um einen neuen souveränen Staat und bei den Gründungsmitgliedern nur noch um Gliedstaaten beziehungsweise unselbstständige Teile des neuen Ganzen handeln.21 Weiterhin muss zwischen der inneren und der äußeren Völkerrechtssubjektivität unterschieden werden, wobei die äußere nur vorliegen kann, wenn die innere Völkerrechtssubjektivität existiert. Die innere Völkerrechtssubjektivität betrifft die Frage, ob die Staatenverbindung im Innenverhältnis zu ihren Mitgliedstaaten Trägerin eigener, gründungsvertraglicher Rechte und Pflichten ist, also über eine ihr vertraglich zuerkannte sachlich beschränkte (partielle) Völkerrechtsfähigkeit verfügt, die für und gegen die Mitgliedstaaten wirkt.22 Die äußere Völkerrechtssubjektivität betrifft dagegen die Frage, ob die Staatenverbindung zur rechtsverbindlichen Vertretung im Außenverhältnis ermächtigt ist. Von der Völkerrechtsfähigkeit zu unterscheiden ist schließlich die Fähigkeit, innerstaatlich Träger privater und öffentlich-rechtlicher Pflichten zu sein. Diese innerstaatliche Rechtsfähigkeit wird meist ausdrücklich im Gründungsvertrag festgelegt.23
Delbrück / Wolfrum, Völkerrecht, S. 529. Emmert, Europarecht, S. 452. 20 Seidl-Hohenveldern, Völkerrecht, S. 192. 21 Emmert, Europarecht, S. 452. 22 Hillgruber, in: Kluth (Hrsg.), Die Europäische Union nach dem Amsterdamer Vertrag, 15 (21). 23 Z. B. Art. 104 SVN (Satzung der Vereinten Nationen). 18 19
§ 3 Die Völkerrechtsfähigkeit
33
III. Die Völkerrechtsfähigkeit der EU 1. Rechtsnatur der EU Die Frage der Rechtsnatur der EU ist von der Frage ihrer Rechtssubjektivität zu trennen, da die Völkerrechtssubjektivität Subjekten unterschiedlicher Qualität zukommen kann.24 Das Wesen der EU zu bestimmen, ist schwierig, da sie keinem der herkömmlichen Modelle von Staatenzusammenschlüssen entspricht. So ist sie weder ein Staatenbund (also auch keine internationale Organisation) noch ein (Bundes-)Staat.25 Über einen bloßen Staatenbund geht die Struktur der Union deutlich hinaus. Ein Staatenbund ist ein völkerrechtlicher Zusammenschluss von Staaten, die weder ihre Völkerrechtspersönlichkeit noch ihre rechtliche Unabhängigkeit und Gleichheit aufgegeben haben, sondern lediglich einzelne Staatsaufgaben (z. B. Wirtschaftspolitik oder Verteidigungspolitik) mit Hilfe verbandseigener Organe gemeinsam verfolgen.26 Angesichts des durch die Gemeinschaften als „Grundlage der Union“ erreichten Integrationsstandes kann mittlerweile nicht mehr von einer Übertragung lediglich einzelner Staatsaufgaben gesprochen werden.27 Von einem (Bundes-)Staat oder einer supranationalen Organisation (wie sie die EG darstellt) kann man in Bezug auf die Europäische Union allerdings ebenfalls nicht sprechen, da es (noch) an einer entsprechenden Organisationsdichte, einer entfalteten Organstruktur und eigenen Rechtsetzungsbefugnissen mit Durchgriffsund Vorrangwirkung gegenüber dem nationalen Recht sowie einer eigenen rechtsprechenden Gewalt fehlt.28 Schließlich ist die EU kein Bundesstaat, da sie nicht alle konstitutiven Merkmale einer souveränen Staatsgewalt aufweist. So fehlt es insbesondere an der Kompetenz-Kompetenz (der Fähigkeit, aus eigener Machtvollkommenheit eigene, neue Kompetenzen zu schaffen) und an einem originären Selbstorganisationsrecht.29 Die EU besitzt zudem keinen eigenen Haushalt, und Pechstein, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 1 EUV Rdnr. 9. Fischer / Köck, Europarecht, S. 256. 26 Stumpf, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 1 EUV Rdnr. 7. 27 Pechstein, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 1 EUV Rdnr. 11. 28 Stumpf, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 1 EUV Rdnr. 8. 29 Einige Autoren sehen in der EU nach dem Vertrag von Maastricht jedoch ein staatsähnliches Gebilde, welches mit Art. 6 Abs. 4 EU (Art. F Abs. 3 a. F.) eine Kompetenz-Kompetenz besitze und damit die Souveränität der Mitgliedstaaten untergrabe. Art. 6 Abs. 4 EU lautet: „Die Union stattet sich mit den Mitteln aus, die zum Erreichen ihrer Ziele und zur Durchführung ihrer Politiken erforderlich sind.“ Schachtschneider, JZ 1993, 750 (753), sieht „einen Paradigmenwechsel und ein Prinzip offener Ermächtigung der Gemeinschaftsorgane“. Auch Ress, JuS 1992, 785 (787) sieht „in Art. F Abs. 3 EUV [jetzt: Art. 6 Abs. 4 EU] eine mit der Regelung des Art. 235 EWGV [jetzt: Art. 308 EG] strukturell vergleichbare Generalermächtigung“. Andere Autoren verstehen die Union als eine internationale Organisation sui generis (Doehring, ZRP 1993, 98 [102] sieht „eine Rechtsgemeinschaft eigener Art, die bisher noch 24 25
3 Metz
34
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
auch die im EG-Vertrag geregelte Unionsbürgerschaft kann, schon aufgrund ihrer Anknüpfung an die Staatsbürgerschaft der Mitgliedstaaten, kein eigenes „Unionsvolk“ begründen.30 Das Bundesverfassungsgericht hat die EU als „Staatenverbund“ bezeichnet. Hierunter wird ein Zusammenschluss von Staaten verstanden, die zwar grundsätzlich unabhängig und souverän bleiben, sich aber entschlossen haben, einen Teil ihrer Aufgaben freiwillig in Übereinstimmung mit den Verträgen gemeinsam auszuüben.31 Dieser vom Bundesverfassungsgericht verwendete Begriff ist auf Kritik gestoßen, da er keine klaren Abgrenzungsmerkmale zu klassischen Kategorien des Völkerrechts bietet. Die Intention des Bundesverfassungsgerichts, einerseits die Souveränität der intergouvernemental handelnden Staaten herauszustellen und andererseits das vereinte Vorgehen der verschiedenen Kompetenzträger – Mitgliedstaaten und Gemeinschaften – innerhalb der Union einzufangen, ist jedoch durch die Wortneuschöpfung plastisch in Erscheinung getreten.32 Das Besondere der EU – und dies unterscheidet sie von internationalen Organisationen – ist ihre Konstruktion als rechtliches Dach der zwei Europäischen Gemeinschaften (EG und EAG)33, der ergänzenden Politiken und der Formen der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten (3-Säulen-Modell).34 Die erste Säule besteht aus den zwei35 Gemeinschaften als der Grundlage der Union. Diese Säule ist durch ihren supranationalen Charakter gekennzeichnet. Das bedeutet erstens, dass Beschlüsse in weiten Bereichen mehrheitlich gefasst werden können und teilweise unmittelbar anwendbares und direkt wirksames (der Einzelne kann sich vor nationalen Gerichten auf EG-Recht berufen) Recht (z. B. Verordnungen) schaffen. Zum zweiten ist diese Säule einer eigenen Gerichtsbarkeit, nämlich nicht bekannt war“ und bedauert gleichzeitig die Rechtsunsicherheit, die durch diese Konstruktion entsteht) oder stellen eine Verbindung zwischen Art. 6 Abs. 4 EU und Art. 308 EG her (Schweitzer, VVDStRL 53 [1993], 48 [55] spricht von einem „Art. 235 EGV [jetzt Art. 308 EG] in Großformat“; weitere Nachweise bei Friedrichs, Die Frage der Völkerrechtssubjektivität der EU, S. 17). 30 Ausführlicher zur Prüfung der Drei-Elementen-Lehre (Staatsvolk, Staatsgebiet, Staatsgewalt) Pechstein, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 1 EUV Rdnr. 10. 31 BVerfGE 89, 155 (187 f.) – Maastricht. 32 Pechstein, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 1 EUV Rdnr. 12; Koenig, EuR 1998, Beiheft 2, S. 139 ff. bezeichnet die Union als „bloßen materiellrechtlichen Verbundrahmen“. 33 Früher gehörte die EGKS noch zu den Europäischen Gemeinschaften. Der EGKS-Vertrag ist aber am 23. Juli 2002 ausgelaufen. 34 Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, S. 40. 35 Nachdem der EGKS-Vertrages am 23. Juli 2002 ausgelaufen ist (vgl. Art. 97 KS und den Beschluss des Rates vom 19. Juli 2002 über die Folgen des Außerkrafttretens des Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) für die von der EGKS geschlossenen internationalen Abkommen, 2002 / 596 / EG, ABl. L 194, 36), existieren nur noch zwei Gemeinschaften, nämlich die Europäische Gemeinschaft (EG) und die Europäische Atomgemeinschaft (EAG).
§ 3 Die Völkerrechtsfähigkeit
35
der des EuGH, unterworfen. Drittens gilt ein Anwendungsvorrang von EG-Recht gegenüber nationalem Recht (entgegenstehendes nationales Recht wird zwar vom EG-Recht nicht gebrochen, findet jedoch keine Anwendung). Die zweite Säule (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik – GASP) und die dritte Säule (Polizeiliche und Justitielle Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in Strafsachen – PJZS) sind Formen der traditionell-völkerrechtlich ausgestalteten intergouvernementalen Zusammenarbeit. Diese beiden Säulen werden im EU-Vertrag geregelt, supranationale Elemente sind hier nicht vorhanden. Beschlüsse werden grundsätzlich einstimmig gefasst; sie sind innerstaatlich wie Beschlüsse internationaler Organisationen zu behandeln. Sie bedürfen daher der innerstaatlichen Transformation, sind nicht unmittelbar anwendbar und damit auch nicht direkt wirksam. Bei Kollisionen von EU-Recht und nationalem Recht besteht kein automatischer Anwendungsvorrang für das EU-Recht.36 Die Rechtsordnung der EU ist im Vergleich zur EG-Rechtsordnung weitaus schwächer ausgestaltet. So gelten etwa die Grundsätze der Eigenständigkeit, der unmittelbaren Anwendbarkeit und des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts nicht für die beiden anderen neben der EG errichteten Säulen der EU.37 Die EU kann sich zwar gemäß Art. 5 EU38 zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Organe der EG bedienen. Diese Organe dürfen für die Union jedoch nur nach Maßgabe des Unionsvertrages tätig werden, das heißt nur im Rahmen der intergouvernementalen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der zweiten und dritten Säule. Die EU als solche verfügt lediglich über ein einziges eigenes Organ, den Europäischen Rat. Dieser besteht gemäß Art. 4 EU aus den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten sowie aus dem Präsidenten der Kommission. Der Europäische Rat tritt mindestens zweimal im Jahr unter dem Vorsitz des jeweiligen Ratsvorsitzenden zusammen. Er gibt die für die Union erforderlichen Impulse und legt die allgemeinen Zielvorstellungen für diese Entwicklung fest (vgl. Art. 4 EU). Die einen souveränen Staat kennzeichnende Allzuständigkeit und die Befugnis, neue Zuständigkeiten zu schaffen (Kompetenz-Kompetenz), fehlt hingegen der EU. Die EU ist jedoch auf der anderen Seite weitaus mehr als „nur“ eine internationale Organisation. So deutet der oben beschriebene teilweise Souveränitätsverzicht der Mitgliedstaaten auf (bundes-)staatsähnliche Strukturen hin. Im Übrigen Siehe zum Ganzen auch Fischer / Köck, Europarecht, S. 258 f. Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, S. 40. 38 Mit dem Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages am 01. 05. 1999 änderte der EuGH seine Zitierweise für die Bezeichnung der Verträge. Die Verträge in der ab dem 01. 05. 1999 geltenden Fassung tragen zu ihrer Bezeichnung zwei Buchstaben. Der Vertrag über die Europäische Union wird seither mit „EU“ (statt bisher mit „EUV“), der EG-Vertrag mit „EG“ (statt bisher mit „EGV“), der EGKS-Vertrag mit „KS“ („statt bisher mit „EGKSV“) und der EAG-Vertrag mit „EA“ (statt bisher mit „EAGV“) bezeichnet. Die vorliegende Darstellung schließt sich der genannten Zitierweise des EuGH an. 36 37
3*
36
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
bleibt festzuhalten, dass die EU auch nach dem Vertrag von Nizza noch kein fertiges Gebilde, sondern immer noch ein „System im Werden“ 39 ist.
2. Rechtsfähigkeit der EU Die Frage nach der Rechtsfähigkeit der EU ist umstritten, da der EU-Vertrag, anders als zum Beispiel Art. 281 EG für die EG, keine ausdrückliche Regelung für die Rechtspersönlichkeit der Union trifft. Da die Union kein Staat und damit kein „geborenes“ Völkerrechtssubjekt ist, kann sie Völkerrechtssubjektivität nur kraft ausdrücklicher oder konkludenter Anerkennung erlangen. Bei der Prüfung der Rechtsfähigkeit muss zwischen der Anerkennung der Vertragsstaaten (unionsinterne Völkerrechtsfähigkeit) und der Anerkennung durch andere Völkerrechtssubjekte (unionsexterne Völkerrechtsfähigkeit) unterschieden werden.40
a) Unionsinterne Völkerrechtsfähigkeit Umstritten ist bereits die Frage, ob die Mitgliedstaaten der Union dieser (mit Wirkung gegenüber sich selbst) Völkerrechtssubjektivität zugebilligt haben. Der EU-Vertrag enthält hierüber keine ausdrückliche Regelung. Fraglich ist daher, ob eine konkludente bzw. implizite Völkerrechtsfähigkeit für die Europäische Union bejaht werden kann. Teilweise wird vertreten, dass die Völkerrechtsfähigkeit unionsintern zu bejahen sei, weil die Mitgliedstaaten die Union gerade zur gemeinsamen Zielverwirklichung gegründet haben.41 Dieser Auffassung ist nicht zu folgen, da die Vertragsstaaten mit dem Unionsvertrag nicht hinreichend deutlich ihren Willen zum Ausdruck gebracht haben, dass sie ein – jedenfalls ihnen gegenüber – zur eigenständigen Willensbildung befähigtes Rechtssubjekt mit eigenen, ihnen gegenüber auszuübenden Kompetenzen schaffen wollten.42 Zwar spricht der Vertrag an vielen Stellen von „der Union“. Insofern könnte man auf eine gewisse Eigenständigkeit schließen, jedoch bleibt dieser Begriff inhaltlich unbestimmt. Die im EU-Vertrag vorgesehenen Handlungsmöglichkeiten bleiben zudem im intergouvernementalen Bereich und sind als Akte der Vertragsstaaten selbst zu interpretieren. Daher ist eine den Vertragsstaaten gegenüber rechtssubjektiv verselbstständigte Union nicht aus dem Vertragstext herleitbar. Bei der Frage nach der (impliziten) Rechtspersönlichkeit ist vor allem auf den Willen der vertragsschließenden Parteien abzustellen. Im Falle der Europäischen Union ist vor allem zu beachten, dass im Anschluss an den Vertrag von Maastricht 39 40 41 42
BVerfGE 22, 293. Vgl. Pechstein, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 1 EUV Rdnr. 15 ff. Stumpf, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 1 EUV Rdnr. 11. Pechstein, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 1 EUV Rdnr. 16.
§ 3 Die Völkerrechtsfähigkeit
37
auf der Regierungskonferenz 1996 zwei Vorschläge unterbreitet wurden, die darauf abzielten, der Union eine eigene Rechtspersönlichkeit einzuräumen. Der eine Vorschlag, den die irische Präsidentschaft dem Europäischen Rat für dessen Tagung in Dublin im Dezember 1996 vorgelegt hatte, ging dahin, die Rechtspersönlichkeit der Union neben die bestehenden Rechtspersönlichkeiten der Gemeinschaften zu stellen.43 Nach dem anschließenden Vorschlag des niederländischen Vorsitzes sollte eine einzige Rechtspersönlichkeit der Union geschaffen, die Rechtspersönlichkeiten der drei Gemeinschaften gleichsam verschmolzen werden.44 Diese Vorschläge wurden jedoch beide abgelehnt. Sie differenzierten zwar nicht zwischen der internen und der externen Völkerrechtsfähigkeit. Man muss jedoch davon ausgehen, dass sich die Ablehnung durch die Mitgliedstaaten auf beide Varianten der Völkerrechtspersönlichkeit erstreckte, da es den Vertragsstaaten bewusst war, dass die Schaffung einer internen Völkerrechtssubjektivität in der völkerrechtlichen Praxis die Anerkennung durch andere Völkerrechtssubjekte nach sich gezogen hätte.45 Die Folge der genannten Vorschläge wäre eine unionsexterne Völkerrechtssubjektivität gewesen. Da man sich auf eine solche gerade nicht einigen konnte, bleibt also festzuhalten, dass eine unionsinterne Völkerrechtssubjektivität von den Mitgliedstaaten nicht gewollt war.
b) Unionsexterne Völkerrechtsfähigkeit Eine unionsexterne Völkerrechtsfähigkeit kann streng genommen nur bejaht werden, wenn eine unionsinterne Völkerrechtssubjektivität existiert, da es andernfalls an einem Bezugspunkt für eine externe Anerkennung mangelt. Abgesehen davon ist die Fähigkeit der Europäischen Union, im Verhältnis zu dritten Völkerrechtssubjekten Träger von völkerrechtlichen Rechten und Pflichten zu sein, umstritten. Nach überwiegender Meinung besitzt die Union keine Rechtspersönlichkeit.46 Die EU kann daher im eigenen Namen keine Rechtsnormen erlassen, keine Verträge schließen, vor Gericht nicht klagen oder verklagt werden und kein Personal beschäftigen.47 Anstelle der EU handeln die Regierungen der Mitgliedstaaten (intergouvernementale Zusammenarbeit). Der Unionsvertrag ist lediglich ein Rahmenvertrag, der die institutionellen Voraussetzungen für die gemeinsame Durchführung der Politiken schafft und der die Abstimmung mit den durch die drei 43 Vgl. den Vorschlag der irischen Ratspräsidentschaft vom 5. 12. 1996 (Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, CONF / 2500 / 96, S. 90 ff.). 44 Dok. CONF / 2500 / 96 ADD 1 CAB, 20. März 1997, S. 47 ff. 45 Pechstein, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 1 EUV Rdnr. 16. 46 Vgl. Emmert, Europarecht, S. 453; Streinz, Europarecht, S. 45 f.; Oppermann, Zur Eigenart der Europäischen Union, in: Hommelhoff / Kirchhof (Hrsg.), Der Staatenverbund der Europäischen Union, S. 87 (90) m. w. N; zu den verschiedenen Ansichten vgl. Aschenbrenner, Menschenrechte in den Außenbeziehungen der Europäischen Union, S. 9 ff. 47 Emmert, Europarecht, S. 28.
38
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Gemeinschaften erfassten Materien herbeiführen will. Der Vertrag verleiht der EU selbst hingegen keine Völkerrechtssubjektivität.48 Hierzu werden jedoch verschiedentlich auch andere Meinungen vertreten.
aa) Implizite Völkerrechtssubjektivität Einige Autoren verweisen darauf, dass der EU-Vertrag zwar keine ausdrückliche Regelung zur Rechtspersönlichkeit der Union treffe, eine solche aber andererseits auch nicht ausdrücklich ausschließe. So wird der EU eine eigene implizite Völkerrechtspersönlichkeit zugebilligt. Dies ergebe sich im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten daraus, dass die EU die Ziele der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) durch die Errichtung einer systematischen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und durch die allmähliche Umsetzung gemeinsamer Aktionen (Art. 11 EU) verfolgen soll. Im Verhältnis zu den Drittstaaten ergebe sich die Völkerrechtssubjektivität daraus, dass ein Beitritt nur noch „zur Union“ und nicht mehr isoliert zur EG möglich ist (Art. 49 EU).49 Dieses Argument vermag nicht zu überzeugen. Als Gegenbeispiel kann der britische Commonwealth of Nations angeführt werden. Dieser ist ein Staatenverbund, der zwar Mitglieder besitzt, selbst aber über keine eigene Rechts- und Handlungsfähigkeit auf internationaler Ebene verfügt und nicht einmal auf einem Vertrag, wie es bei der EU gegeben ist, beruht.50 Wie bei der EU gibt es beim Commonwealth einen gemeinsamen Überbau51; hier wie dort steht die Mitgliedschaft souveränen Staaten offen. Allerdings fehlt sowohl dem Commonwealth of Nations als auch der EU die Fähigkeit, als selbstständige Rechts- und Handlungseinheit auf internationaler Ebene aufzutreten. Ein weiteres Argument gegen eine eigene Rechtspersönlichkeit der EU ist, dass nicht die EU, sondern die EG (am 01. 01. 1995) Gründungsmitglied der WTO geworden ist.52 Dem Argument der Befürworter einer eigenen Rechtspersönlichkeit der Union, wonach gemäß Art. 49 EU ein Beitritt nur noch zur „Union“ insgesamt erfolgen könne, wie der Wortlaut, jeder europäische Staat könne beantragen „Mitglied der Union“ zu werden, zeige, müssen einige Bedenken entgegengebracht werden. Erstens fehlt eine ausdrückliche Festlegung der Völkerrechtssubjektivität, und zum anderen werden der Union im Gründungsvertrag keine Kompetenzen verliehen, die nur einem Völkerrechtssubjekt zustehen können. Bei dieser Betrachtung müsKokott / Doehring / Buergenthal, Grundzüge des Völkerrechts, S. 48. Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, S. 40. 50 So Fischer / Köck, Europarecht, S. 256. 51 Beim Commonwealth of Nations ist dies die britische Krone. 52 Mit der Annahme des Abkommens wurden die Europäischen Gemeinschaften ex lege zu Gründungsmitgliedern der WTO, vgl. Art. XI Abs. 1 WTO-Abkommen. 48 49
§ 3 Die Völkerrechtsfähigkeit
39
sen die im Vergleich zur Union weiterreichenden Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaften außer Acht gelassen werden, da deren jeweilige Völkerrechtspersönlichkeit vom EU-Vertrag unberührt bleibt (Art. 47 EU). Deutlich wird die fehlende Völkerrechtspersönlichkeit der EU im Rahmen ihrer eigentlichen Betätigungsfelder. In den Politikbereichen der GASP und der PJZS wird die EU gemäß Art. 37 EU auf internationalen Konferenzen und in internationalen Organisationen „von den Mitgliedstaaten“ vertreten. Diese, und nicht etwa die Union selbst, vertreten die im Rahmen der genannten Politiken festgelegten gemeinsamen Standpunkte.53 Hiergegen spricht auch nicht, dass gemäß Art. 18 Abs. 1 EU „die Union“ – und nicht die Mitgliedstaaten – vom jeweiligen Vorsitz in Bereichen der GASP vertreten wird. Art. 18 EU wird nämlich durch Art. 19 Abs. 1 UAbs. 2 EU für die Fälle durchbrochen, in denen ein Mitgliedstaat einer internationalen Organisation nicht angehört. Insbesondere beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist dieser Fall gegeben. Hier gehen die Mitgliedstaaten von einem Fortbestehen der eigenen Zuständigkeit und nicht von der Ersetzung dieser Kompetenz im Wege der Funktionsnachfolge durch die Union aus.54 Zudem vertreten die Mitgliedstaaten – und nicht die EU – die in Titel VI des EU-Vertrages festgelegten gemeinsamen Standpunkte nach außen, Art. 37 EU. Damit fehlt ein konstitutives Element für das Vorliegen einer konkludenten (impliziten) Völkerrechtsfähigkeit: Es fehlt die Überzeugung der Mitgliedstaaten der EU (und zumindest eines Teiles der Drittstaaten), dass die Union selbst und nicht ihre Mitgliedstaaten völkerrechtliche Kompetenzen ausüben soll. Ebenso wenig liegt eine gewisse dauerhafte und zusammenhängende Ausübung eines einheitlichen „Unionswillens“ vor.55
bb) Verschmelzungstheorie Weiterhin wird die These vertreten, die drei Gemeinschaften seien in der EU aufgegangen beziehungsweise mit ihr verschmolzen (Verschmelzungsthese). Der einheitliche institutionelle Rahmen, den der EU-Vertrag vorgebe, zeige, dass die EU eine einheitliche Rechtspersönlichkeit darstelle, in der die drei ursprünglichen Rechtspersönlichkeiten der Gemeinschaften aufgegangen seien.56 Dem ist entgegenzuhalten, dass die EU aufgrund der fehlenden Kompetenzzuweisungen im Vgl. Streinz, Europarecht, S. 45. Streinz, Europarecht, S. 46. Eine solche Funktionsnachfolge hatte dagegen der EuGH für den Bereich des GATT hinsichtlich der EG in seiner Entscheidung, EuGH, Slg. 1972, 1219 (1227) – International Fruit Company festgestellt. 55 Streinz, Europarecht, S. 46. 56 v. Bogdandy / Nettesheim, NJW 1995, 2324 (2326 ff.) wollen daher zukünftig statt von „Gemeinschaft“ von „Union“ und statt von „Gemeinschaftsrecht“ von „Unionsrecht“ sprechen. Weitere Nachweise bei Aschenbrenner, Menschenrechte in den Außenbeziehungen der Europäischen Union, S. 11 ff. 53 54
40
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
EU-Vertrag nicht mehr ist als die Bündelung verschiedener Aktivitäten im Rahmen der europäischen Integration.57 Außerdem würde die Verschmelzung der Gemeinschaften in der EU eine Auflösung der Europäischen Gemeinschaften als internationale Organisationen und Völkerrechtssubjekte bedingen.58 Dies sieht aber der EU-Vertrag gerade nicht vor. Aus Art. 5 und 47 EU ergibt sich vielmehr, dass die Gründung der Europäischen Union die Rechtsgrundlagen und Kompetenzen der europäischen Gemeinschaften unberührt lässt und diese daher auch als selbstständige Rechtssubjekte erhalten bleiben.59 Ferner schreiben die Art. 184 EA und Art. 281 EG60 explizit das Fortbestehen der jeweiligen eigenen Rechtspersönlichkeit der Gemeinschaften fest. Die Väter des Maastrichter Unionsvertrages waren sich insbesondere in Bezug auf die Frage der Völkerrechtspersönlichkeit der Unvollkommenheit ihres Werkes bewusst, da sie in Art. N Abs. 2 EUV für 1996 eine Regierungskonferenz zur Revision des Vertrages zwingend vorschrieben. Auf dieser Konferenz wurde dann auch, wie bereits oben erwähnt, die Frage der Rechtspersönlichkeit der EU besprochen61; freilich konnte sich der Vorschlag, der EU ausdrücklich eine Rechtspersönlichkeit zu verleihen, nicht durchsetzen.62
cc) Art. 24 und 38 EU Als Beweis für das Vorliegen der unionsexternen Völkerrechtsfähigkeit wird von einigen Autoren auf Art. 24 und 38 EU verwiesen. Aus diesen Artikeln kann jedoch nicht auf eine Rechtspersönlichkeit der Union geschlossen werden. Es ist nämlich nicht davon auszugehen, dass diejenigen Mitgliedstaaten der Union, die ausdrücklich die Schaffung einer eigenen Rechtspersönlichkeit für die Union abgelehnt haben, ihre Zustimmung zu einer Vorschrift gegeben hätten, welche eine Völkerrechtssubjektivität für die Union gleichsam durch die Hintertür bedeutet hätte. Hobe, Europarecht, S. 22. Dörr, NJW 1995, 3162; auch Hillgruber, in: Kluth (Hrsg.), Die Europäische Union nach dem Amsterdamer Vertrag, S. 15 (19) lehnt die Verschmelzungstheorie als mit dem EU-Vertrag nicht vereinbar ab. 59 Hillgruber, in: Kluth (Hrsg.), Die Europäische Union nach dem Amsterdamer Vertrag, S. 15 (19). 60 Vor dem Auslaufen des EGKS-Vertrages auch Art. 6 Abs. 2 KS. 61 Vgl. den Bericht des Institutionellen Ausschusses des Europäischen Parlaments über die Funktionsweise des EUV vom 04. 05. 1995 (sog. Bourlanges / Martin Bericht), in dem gefordert wird, dass die EU eine eigene Rechtspersönlichkeit erhalten solle, DOC DE / RR / 273 / 273345, 11. 62 Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, Die Europäische Union zwischen heute und morgen. Anpassung der Europäischen Union zum Nutzen ihrer Bürger und Vorbereitung der Europäischen Union auf die Zukunft. Allgemeiner Rahmen für einen Entwurf zur Revision der Verträge, CONF / 2500 / 96, S. 90 ff.; vgl. auch den daran anschließenden Vorschlag der niederländischen Präsidentschaft, CONF / 2500 / 96 ADD. 1, S. 47 ff. 57 58
§ 3 Die Völkerrechtsfähigkeit
41
Daher wurde der Schlussakte der Konferenz eine Erklärung beigefügt, in der betont wurde, dass die Art. 24 und 38 EU und die auf ihrer Grundlage möglichen Abkommen keine Kompetenzübertragung von den Mitgliedstaaten auf die Union bedeute. Diese fehlende Vertragsschlusskompetenz lässt die Union als möglichen Vertragspartner für völkerrechtliche Abkommen ausscheiden.
dd) Nachträgliche Praxis Teilweise wird vertreten, die nachträgliche Praxis der Organe der Union habe (i. S. d. Art. 31 Abs. 3 lit. b WVK) zumindest zu einer partiellen unionsinternen und -externen Völkerrechtssubjektivität der Union geführt. Zur Begründung führt diese Ansicht die beiden bisher von der Union auf der Grundlage des Art. 24 EU geschlossenen Übereinkünfte an. Diese Abkommen betreffen die Tätigkeit der Überwachungsmission der Union in der Bundesrepublik Jugoslawien.63 In diesen Abkommen heißt es: „Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person zu bestellen, die befugt ist, das Abkommen rechtsverbindlich für die Europäische Union zu unterzeichnen.“ Aus dieser Formulierung folgt jedoch noch keine praktische Anerkennung der Völkerrechtssubjektivität der Union. Einer solchen Annahme ist nämlich entgegenzuhalten, dass sie gegen den ausdrücklichen Willen einiger Mitgliedstaaten sprechen würde. Außerdem muss angenommen werden, dass die Schaffung einer Rechtspersönlichkeit durch bloße nachträgliche Praxis Art. 48 EU (Vertragsänderungsverfahren) verletzen würde. Eine solche wesentliche Vertragsänderung, die das gesamte Unionsgefüge und die Außenvertretung der Union betrifft, bedarf nämlich des Vertragsänderungsverfahrens nach Art. 48 EU.64
ee) Zwischenergebnis Die EU besitzt keine Völkerrechtspersönlichkeit. Dies folgt zum einen daraus, dass der EU-Vertrag selbst keine ausdrückliche entsprechende Vorschrift enthält. Für eine implizite Anerkennung der Völkerrechtssubjektivität fehlen zwingende Anhaltspunkte im EU-Vertrag. Aufgrund der mehrfachen Ablehnung der Schaffung einer eigenen Rechtspersönlichkeit der Union auf den verschiedenen Regierungskonferenzen muss davon ausgegangen werden, dass eine implizite Anerkennung der Union als Völkerrechtssubjekt dem Willen der Mitgliedstaaten (als der „Herren der Verträge“) widersprechen würde. 63 Beschluss des Rates vom 09. 04. 2001 (2001 / 352 / GASP; ABl. L 125, 1) und Beschluss des Rates vom 30. 08. 2001 (2001 / 682 / GASP; ABl. L 241, 1). 64 Pechstein, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 1 EUV Rdnr. 19 legt die o.g. Abkommen der Union mit dem Grundsatz der „falsa demonstratio non nocet“ sogar dahingehend aus, dass mit der als Vertragspartner genannten EU in Wirklichkeit die kompetenziell zuständigen Unionsstaaten gemeint seien.
42
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
c) Innerstaatliche Rechtsfähigkeit Die innerstaatliche Rechtsfähigkeit ist von der Völkerrechtsfähigkeit völlig unabhängig, da sie allein vom jeweiligen nationalen Recht abhängt. Die EU verfügt über eine solche ausdrücklich durch Vertrag zuerkannte Rechtsposition im innerstaatlichen Recht nicht.65 Der Unionsvertrag enthält – anders als die Gemeinschaftsverträge in Art. 282 EG bzw. Art. 185 EA – keine Vorschriften, die eine innerstaatliche Rechtsfähigkeit vorsehen. Damit fehlt eine Zuerkennung der innerstaatlichen Rechtsfähigkeit durch den Vertrag.66 Dennoch könnte der EU sowohl im Hinblick auf das Privatrecht als auch im Hinblick auf das öffentliche Recht, vom innerstaatlichen Recht diese Rechtsfähigkeit eingeräumt werden. Dies ist in der Bundesrepublik Deutschland bislang jedoch nicht erfolgt.67
IV. Die Völkerrechtssubjektivität der Europäischen Gemeinschaften (EG, EGKS, EAG) 1. Bedeutung der Völkerrechtssubjektivität für die Gemeinschaften Die Frage der Völkerrechtspersönlichkeit ist eng verknüpft mit der Frage der Teilnahme der Europäischen Gemeinschaften an multilateralen Verträgen und der Mitgliedschaft in internationalen Organisationen. Denn ohne eine Rechtspersönlichkeit ist weder ein Vertragsschluss noch eine Mitgliedschaft in internationalen Organisationen möglich. Hierbei ist zunächst festzuhalten, dass ein Vertragsschluss beziehungsweise eine Mitgliedschaft in einer internationalen Organisation in jedem Falle dann ausgeschlossen ist, wenn eine solche nur für Staaten vorgesehen ist. Die Europäischen Gemeinschaften sind zwar supranationale Rechtsgebilde, aber eben (noch) keine Bundesstaaten.68 Auf der anderen Seite ist die Mitgliedschaft der Europäischen Gemeinschaften dort kein Problem, wo diese zu den Gründungsmitgliedern gehören.69 Ebenso problemlos ist die Parteistellung der Europäischen Gemeinschaften bei bilateralen Verträgen, die sie selbst mit anderen Staaten abschließen. Bei multilateralen Verträgen hingegen ist nach dem völkerrechtlichen Grundsatz der Parteienautonomie die Zustimmung aller anderen Vertragsparteien (in der Regel Staaten) notwendig. Dort, wo Entscheidungen per Mehrheitsbeschluss gefällt werden, können die EuroStreinz, Europarecht, S. 46. Stumpf, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 1 EUV Rdnr. 12. 67 Pechstein, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 1 EUV Rdnr. 20, der ein Bedürfnis hierfür auch ablehnt. 68 Fischer / Köck, Europarecht, S. 668. 69 Vgl. z. B. den bereits oben erwähnten Fall der WTO, wo die Europäischen Gemeinschaften ex lege zu Gründungsmitgliedern der WTO geworden sind, Art. XI Abs. 1 WTO-Abkommen. 65 66
§ 3 Die Völkerrechtsfähigkeit
43
päischen Gemeinschaften auch gegen den Willen der Minderheit als Vertragsparteien zugelassen werden. In diesem Falle können die opponierenden Staaten einen entsprechenden Vorbehalt gegen die Parteistellung der Europäischen Gemeinschaften äußern oder sich gänzlich von dem Vertragsschluss zurückziehen.70 Die Drohung mit dem vollständigen Rückzug kann die anderen Staaten dazu zwingen, ihre bisher positive Haltung gegenüber einer Parteistellung der Europäischen Gemeinschaften aufzugeben, um nicht den multilateralen Vertrag im Ganzen zu gefährden.71 Bei vielen multilateralen Verträgen ist bis zum heutigen Tag die „Nur-StaatenKlausel“ die Regel, sodass ein nachträgliches Einsteigen in internationale Organisationen für die Europäischen Gemeinschaften nahezu unmöglich ist. Ihnen verbleibt lediglich (wenn überhaupt) ein Beobachterstatus (analog zu jenem für Nichtmitgliedstaaten) oder ein Konsultativstatus (wie er beispielsweise NonGovernmental Organisations zukommt). Einen solchen Beobachterstatus hat die Europäische Gemeinschaft zum Beispiel bei den Vereinten Nationen und deren Spezialorganisationen sowie bei regionalen Organisationen wie dem Europarat oder der Organisation Amerikanischer Staaten. Eine aktive Teilnahme an der Arbeit der Organisation billigt die OECD der Europäischen Gemeinschaft zu. Bei der 1995 gegründeten Welthandelsorganisation (WTO) ist die Europäische Gemeinschaft selbst (neben den EG-Mitgliedstaaten) Gründungsmitglied und Partei des Gründungsvertrages geworden.72 In der Praxis hängt die Teilnahme der Europäischen Gemeinschaft jedoch allein davon ab, ob die Mitgliedstaaten dies erzwingen. Weigern sich nämlich die Mitgliedstaaten, sich an Verträgen oder Verhandlungen zu beteiligen, die sich auf Materien beziehen, die bereits in den Kompetenzbereich der Gemeinschaft übergegangen sind, so sind die Drittstaaten vor die Wahl gestellt, entweder mit der Gemeinschaft zu verhandeln oder gar kein Vertragsabschluss zu erreichen. Die Parteistellung der Europäischen Gemeinschaft ist damit weniger eine Frage der Anerkennung durch Drittstaaten, sondern eher eine Frage des politischen Willens der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften. Vgl. Fischer / Köck, Europarecht, S. 669. Die frühere Sowjetunion und andere Staaten des Ostblocks haben lange Zeit die völkerrechtliche Anerkennung der Europäischen Gemeinschaft verweigert und als Ansprechpartner auch für jene Materien, die schon von den Mitgliedstaaten auf die Gemeinschaften übergegangen waren, nur die jeweiligen Nationalstaaten akzeptiert, näher dazu Fischer / Köck, Europarecht, S. 668. 72 Vgl. Art. XI Abs. 1 WTO-Abkommen und den Beschluss des Rates 94 / 800 / EG, ABl. 1994 L 336,1; damit ist die Europäische Gemeinschaft Vollmitglied der WTO geworden und verfügt über so viele Stimmen wie die Anzahl ihrer Mitgliedstaaten, die ebenfalls WTO-Mitglieder sind. Im Übereinkommen ist ausgeführt, dass die Anzahl der Stimmen der EG und ihrer Mitgliedstaaten keinesfalls höher sein darf als die Anzahl der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft; anders als ihr Vorgänger (GATT) ist die WTO eine ständige Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit; weitere Informationen unter: http: //www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/r11010.thml. 70 71
44
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
2. Die Völkerrechtssubjektivität der EGKS (Art. 6 Abs. 2 KS) Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl bestimmte Art. 6 Abs. 2 KS, dass die Gemeinschaft im zwischenstaatlichen Verkehr die für die Durchführung ihrer Aufgaben und Erreichung ihrer Ziele erforderliche Rechts- und Geschäftsfähigkeit hat. Damit war die Völkerrechtsfähigkeit im Vertrag ausdrücklich geregelt.73 Der EGKS-Vertrag ist jedoch am 23. 07. 2002 ausgelaufen. Da der Vertrag nicht verlängert worden ist, gelten mit Wirkung vom 24. 07. 2002 die Regeln des EG-Vertrages auch für die Bereiche Kohle und Stahl.74 Mithin ist die Völkerrechtspersönlichkeit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl seit dem 23. Juli 2002 erloschen.75 3. Die Völkerrechtssubjektivität der EAG (Art. 184 EA) und der EG (Art. 281 EG) a) Gemeinschaftsinterne Völkerrechtssubjektivität Art. 281 EG und Art. 184 EA sprechen nur ganz allgemein von der „Rechtspersönlichkeit“ dieser Gemeinschaften. Ob hierbei die Völkerrechtsfähigkeit oder die innerstaatliche Rechtsfähigkeit gemeint ist, lässt sich allein vom Wortlaut ausgehend nicht erschließen. Da jedoch die jeweils folgenden Artikel (Art. 282 EG bzw. Art. 185 EA) die innerstaatliche Rechts- und Geschäftsfähigkeit regeln, kann es sich bei den Art. 281 EG und Art. 184 EA nur um die Völkerrechtsfähigkeit der jeweiligen Gemeinschaft handeln.76 Die genannten Vorschriften bestehen schon seit In-Kraft-Treten der Verträge in ihrem jetzigen Wortlaut. Damit verfügen beide Gemeinschaften über die Fähigkeit, im Rahmen der in den Verträgen aufgeführten Ziele selbstständig völkerrechtliche Rechte auszuüben und völkerrechtliche Verpflichtungen einzugehen. Hiernach steht ihnen das Recht zu, vor Gericht aufzutreten (bzw. Partei im Prozess zu sein), Privilegien und Immunitäten in Anspruch zu nehmen, Hoheitssymbole zu verwenden und Subjekt der aktiven und passiven völkerrechtlichen Haftungsregelungen zu sein.77 Der EG als supranationaler Organisation kommt, wie oben beschrieben, lediglich eine abgeleitete oder derivative Völkerrechtspersönlichkeit zu. Sie ist damit 73 Vgl. auch Reichardt, Auswärtige Beziehungen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu Drittstaaten und internationalen Organisationen, S. 78. 74 Vgl. dazu den Beschluss des Rates vom 19. Juli 2002 über die Folgen des Außerkrafttretens des Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) für die von der EGKS geschlossenen internationalen Abkommen, 2002 / 596 / EG, ABl. L 194, 36 und Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, S. 5. 75 Kokott, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 281 EGV Rdnr. 3. 76 Allgemein anerkannt, vgl. Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, S. 38 f.; Emmert, Europarecht, S. 452 f. 77 Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, S. 39.
§ 3 Die Völkerrechtsfähigkeit
45
nur Trägerin derjenigen Rechte und Pflichten, die ihr die Mitgliedstaaten durch den EG-Vertrag übertragen haben. Somit findet das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung auch für völkerrechtliches Gemeinschaftshandeln Anwendung. Art. 281 EG statuiert die Völkerrechtssubjektivität der EG als Verband, nicht diejenige ihrer Organe.78 Allerdings können Gemeinschaftsinstitutionen aufgrund anderer Vertragsbestimmungen Rechtspersönlichkeit besitzen.79
b) Gemeinschaftsexterne Völkerrechtssubjektivität Inwieweit die EG auch gegenüber Drittstaaten und internationalen Organisationen Völkerrechtsfähigkeit besitzt, hängt, wie bereits oben beschrieben, von ihrer Anerkennung als Völkerrechtssubjekt durch den jeweiligen Staat bzw. die jeweilige Organisation ab. Die EG konnte z. B. bis 1988 keine Verträge im eigenen Namen mit dem COMECON und den kommunistischen osteuropäischen Ländern schließen, da diese die EG nicht als Völkerrechtssubjekt anerkannten. Im Zuge der Auflösung der Sowjetunion und des Ostblocks hat sich diese Situation geändert. Heute ist die EG beinahe universell anerkannt, sei es ausdrücklich durch den Abschluss völkerrechtlicher Verträge oder konkludent durch die Ausübung des Gesandtschaftsrechts80.
c) Innerstaatliche Rechtsfähigkeit Wie bereits oben kurz erwähnt kommt der EAG und der EG gemäß Art. 185 EA und Art. 282 EG die Rechtsfähigkeit im innerstaatlichen Rechtsverkehr zu. Demnach ist die Handlungsfähigkeit der Gemeinschaften im innerstaatlichen Rechtsverkehr (z. B. durch den Abschluss von Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen usw.) gesichert.81
Kokott, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 281 EGV Rdnr. 6. So z. B. für die Europäische Zentralbank (EZB): Art. 107 Abs. 2 EG und die Europäische Investitionsbank (EIB): Art. 266 UAbs. 1 EG. 80 Bei der EG sind heute mehr als 160 Drittstaaten durch akkreditierte Vertretungen repräsentiert. 81 Herdegen, Europarecht, S. 61. 78 79
46
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften I. Bedeutung der Außenbeziehungen für die EG (und die EU) 1. Allgemeine Bemerkungen Der Einfluss der Europäischen Union auf das Weltgeschehen wächst. Der fortschreitende Integrationsprozess, die Einführung der gemeinsamen Währung und die Entwicklung einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik tragen dazu bei, der EU einen politischen und diplomatischen Status zu verleihen, der ihrem großen wirtschaftlichen und handelspolitischen Gewicht entspricht. Dabei stehen für die Union mehrere strategische Ziele im Vordergrund. Zum einen soll ein stabiles Europa geschaffen werden, dessen stärkere Stimme in der Welt mehr Gehör finden soll. Nach der am 01. 05. 2004 vollzogenen Osterweiterung der EU ist ein Binnenmarkt für über 500 Millionen Verbraucher entstanden. Als der weltweit größte Handelspartner ist die EU entschlossen, ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und durch eine weitere Liberalisierung der Welthandelsregeln den Welthandel zu fördern. Die Außenpolitik der EU umfasst vor allem drei Hauptelemente: die Handelspolitik, die Entwicklungshilfe und die so genannte politische Dimension.82 Hierdurch werden die Bereiche Handel, Wirtschaft und Diplomatie abgedeckt. Die EU engagiert sich aber zunehmend auch auf dem Gebiet der humanitären und friedenserhaltenden Maßnahmen sowie im Bereich der internationalen Sicherheit. Zudem beschäftigt sich die Union mit Fragen der Bekämpfung von Hungersnöten und der Ausbreitung von AIDS, der Lenkung von Migrationsströmen bis hin zu Kampagnen gegen Drogen und Terrorismus. Die wachsende Bedeutung der Außenbeziehungen für die EU lässt sich auch an der veränderten Organisationsstruktur einzelner Organe der EG erkennen. Vor rund 15 Jahren wurde das gesamte Spektrum der Außenbeziehungen von nur zwei Abteilungen der Kommission verwaltet, heute sind es sechs. Die generelle Koordinierung der Außenpolitik übernimmt das für Außenbeziehungen zuständige Mitglied der Kommission. Der Außenkommissar soll für einen kohärenten Ansatz in den Außenbeziehungen und für eine klare Identität nach innen wie nach außen sorgen. Er arbeitet eng mit seinen Kommissionskollegen zusammen, die für spezifische außenpolitisch relevante Politikbereiche zuständig sind, zum Beispiel für Entwicklung und humanitäre Hilfe, für die Erweiterung und für den Handel. Ferner steht 82 Um die Werte und Interessen der Union zu fördern kommen positive Instrumente (ein institutionalisierter politischer Dialog, der Abschluss von internationalen Übereinkommen, Investitionen oder Friedensmissionen) aber auch negative Instrumente (diplomatische Isolation, wirtschaftliche Sanktionen oder militärische Interventionen) in Betracht; vgl. Kietz / Uplegger, Integration 2005, 87 (93).
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
47
der Kommissar für Außenbeziehungen in engem Kontakt zum Generalsekretär des Rates und Hohen Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP).83 Aus der gerade beschriebenen Völkerrechtsfähigkeit der Europäischen Gemeinschaft folgt ihr aktives und passives Gesandtschaftsrecht.84 Die Gemeinschaft verfügt über ein weltweites Netz zur Unterstützung und Umsetzung ihrer Politik. Bei der EG sind über 160 ausländische Botschaften akkreditiert (passives Gesandtschaftsrecht). Ihr aktives Gesandtschaftsrecht übt die Gemeinschaft hingegen nicht aus und entsendet keine Diplomaten in Drittstaaten. Allerdings verfügt die Kommission über mehr als 150 eigene so genannte „Delegationen“ in Drittstaaten. Die Aufgabe einer solchen Delegation besteht darin, die bilateralen Kontakte der Gemeinschaft zu anderen Nationen zu pflegen, die politischen Werte und Aktivitäten der Union zu fördern und diese über aktuelle Entwicklungen vor Ort auf dem Laufenden zu halten. Unionsintern findet ein regelmäßiger Austausch zwischen Beamten, Ministern und Parlamentsmitgliedern statt, zusätzlich hält die EU ein- bis zweimal jährlich ein Gipfeltreffen mit ihren wichtigsten Partnern wie den USA, Japan, Russland und Kanada ab. Anfangs waren diese Gespräche stark auf den Handel konzentriert, mittlerweile wird ein breites Spektrum an Fragen, z. B. des Umweltschutzes, der Bekämpfung des internationalen Verbrechens und Drogenhandels sowie der Förderung der Menschenrechte abgedeckt. Zudem trägt die Union ihre Ansichten in verschiedenen multilateralen Foren, wie den Vereinten Nationen, der Weltbank, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), dem Europarat, der Westeuropäischen Union (WEU), der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO), der Food and Agriculture Organization (FAO) und der Welthandelsorganisation (WTO) vor.
2. Der rechtliche Standpunkt Wie gerade dargelegt, sind die Außenbeziehungen von großer Wichtigkeit für die EG; umso mehr stellt sich die Frage, was die EG im Bereich der Außenbeziehungen darf und was sie nicht darf, oder juristisch gefragt, nach den Kompetenzen der EG auf diesem Gebiet. Die Außenbeziehungen sind für die EG insbesondere im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Gemeinschaft von vitalem Interesse. Die Beziehungen der Gemeinschaft zu internationalen Organisationen und zu Drittländern hängen auf der einen Seite von der Aufteilung der Kompetenzen zwischen den Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft ab. Auf der anderen Seite ist der rechtliche Status der Ge83 Aktuelle Informationen abrufbar unter: http: //europa.eu.int/comm/external_relations/ index. 84 Koenig / Haratsch, Europarecht, S. 305.
48
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
meinschaft in der internationalen Rechtsgemeinschaft von Bedeutung dafür, welche Verträge die Gemeinschaft schließen und welche Rechte und welche Pflichten sie hierdurch eingehen darf. Die Komplexität der Materie und die ständigen Auseinandersetzungen auf diesem Gebiet haben mehrere Ursachen.85 Zum einen fehlt eine ausdrückliche Regelung im EG-Vertrag, sodass eine Situation der rechtlichen Ungewissheit entstanden ist. Zum anderen ist eine strikte Trennung von Bereichen mit Außenrelevanz, etwa Außenhandelspolitik und Außenpolitik, oft schwierig. So sind diese beiden Elemente z. B. bei der Entscheidung über Wirtschaftssanktionen eng miteinander verbunden. Hier hinein spielt die weitere Schwierigkeit, dass die Mitgliedstaaten ihre Kompetenzen im Bereich Handel weitgehend auf die EG übertragen haben; im Bereich der auswärtigen Beziehungen sind dagegen viele Mitgliedstaaten nicht bereit, Kompetenzen abzugeben, da sie der Auffassung sind, die Außenpolitik sei ein fundamentales Element ihrer Souveränität. Der EuGH hat in einer Reihe von Entscheidungen wertvolle Richtlinien für die Bewertung von Kompetenzstreitigkeiten gegeben, wobei noch keine stringente Theorie für die Lösung aller Fragen gefunden wurde. Die nachfolgende Darstellung zeichnet zunächst die historische Entwicklung der Außenkompetenzen der EG nach und widmet sich anschließend den geschriebenen Außenkompetenzen. Sodann fällt der Blick auf mögliche ungeschriebene Außenkompetenzen. Liegt eine Außenkompetenz der EG vor, so wird untersucht, ob diese ausschließlicher oder konkurrierender Art ist.
II. Die verschiedenen Vertragsschlussbefugnisse 1. Bestehen einer Außenkompetenz Wie bei den Innenkompetenzen bedürfen die Europäischen Gemeinschaften auch im Bereich der Außenkompetenzen für jedes Tätigwerden einer gemeinschaftsrechtlichen Kompetenzzuweisung. Dieser Grundsatz wird oft als „Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung“ bezeichnet. 86 Jedes darüber hinaus gehende Tätigwerden der Gemeinschaft stellt eine Handlung ultra vires und damit einen kompetenzwidrigen Akt dar. In den Gründungsverträgen sind einige (wenige) ausdrückliche Außenkompetenzen enthalten, so z. B. in Art. 133 EG für Zoll- und Handelsabkommen oder in Art. 310 EG für Assoziierungsabkommen. Im Laufe der Zeit hat sich allerdings aufgrund der Rechtsprechung des EuGH eine weitere, nämlich eine implizite Kompetenzzuweisung, herauskristallisiert. Diese implizite völkerrechtliche Vertragsschlusskompetenz der EG in Bereichen, in denen ihr intern eine Rechtsetzungs85 86
Frid, The Relations Between the EC and International Organizations, S. 58 ff. Statt vieler Hobe, Europarecht, S. 27.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
49
befugnis zusteht, wird im Anschluss an die Darstellung der geschriebenen Außenkompetenzen untersucht.
2. Art der Außenkompetenz An die Frage des Bestehens einer Außenkompetenz schließt sich unmittelbar die Frage nach ihrer Art an. Allerdings wird von den Gemeinschaftsverträgen keine klare Klassifizierung oder Kategorisierung von bestimmten Kompetenzarten vorgenommen. In der Rechtswissenschaft werden üblicherweise drei Kompetenzkategorien unterschieden, es handelt sich um die ausschließliche, die konkurrierende (beziehungsweise geteilte) und die parallele (beziehungsweise ergänzende) Kompetenz. Mangels ausdrücklicher Regelungen in den Verträgen müssen die Politikfelder nach ihrem Sinn und Zweck den einzelnen Kompetenzarten zugeteilt werden. Die Gemeinschaft verfügt über eine ausschließliche Zuständigkeit, wenn nur sie in einem bestimmten Bereich zum Erlass von Rechtsnormen befugt ist. Ein Tätigwerden der Mitgliedstaaten ist ausgeschlossen, außer im Falle einer Ermächtigung von Seiten der Gemeinschaftsorgane oder wenn das Gemeinschaftsrecht eine Lücke aufweist, die geschlossen werden muss.87 Die Funktion einer ausschließlichen Kompetenz für die Gemeinschaft besteht darin, die Einheit des Gemeinschaftsrechts und die Handlungsfreiheit der Gemeinschaftsorgane zu sichern.88 Auch der Begriff der konkurrierenden (oder geteilten) Zuständigkeit der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten ist im Gemeinschaftsrecht nicht definiert und daher unklar.89 Analog zur bundesstaatlichen Konstruktion handelt es sich dabei grundsätzlich um Bereiche, in denen die Mitgliedstaaten gesetzgeberisch tätig bleiben können, solange und soweit die Gemeinschaft nicht – wie es ihr ipso iure zusteht – Rechtsnormen erlassen und somit ihre Zuständigkeit wahrgenommen hat.90 Sobald die Gemeinschaft in dem betreffenden Bereich gesetzgeberisch tätig geworden ist, dürfen die Mitgliedstaaten auf dem unter die betreffende Normgebung fallenden Gebiet nur noch insoweit gesetzgeberisch tätig werden, als dies für die Umsetzung erforderlich ist. Somit wird die Zuständigkeit der Gemeinschaft Vgl. CONV 47 / 02, S. 20 ff. zur gegenwärtigen Rechtslage. Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 300 EGV, Rdnr. 8 89 Constantinesco, Das Recht der Europäischen Gemeinschaften, S. 243. 90 Bei den konkurrierenden Kompetenzen handelt es sich daher nicht um zwei verschiedene, tatsächlich miteinander konkurrierende Kompetenzen, sondern um die sukzessive Ausübung ein und derselben Kompetenz durch zwei verschiedene Träger. Streng genommen stellen die konkurrierenden Kompetenzen kein Kompetenzverteilungsprinzip dar, sondern eine zeitliche Regelung der Ausübung derselben Konkurrenz durch zwei verschiedene Träger, Constantinesco, Das Recht der Europäischen Gemeinschaften, S. 214. Auf jedem Gebiet, das Gegenstand eines gemeinsamen Handelns ist, sind die Kompetenzen damit grundsätzlich auf die Gemeinschaft übertragen worden. 87 88
4 Metz
50
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
durch ihre Wahrnehmung zu einer ausschließlichen Zuständigkeit. Bei der Ausübung ihrer Kompetenzen unterliegt die Gemeinschaft den Grundsätzen der Subsidiarität (die Gemeinschaft wird nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können) und der Verhältnismäßigkeit (die Maßnahmen der Gemeinschaft gehen nicht über das für die Erreichung der Ziele des Vertrags erforderliche Maß hinaus), Art 5 UAbs. 2, 3 EG.91 Eine parallele (oder ergänzende) Zuständigkeit der Gemeinschaft liegt vor, wenn für bestimmte Bereiche ausschließlich die Mitgliedstaaten zuständig sind (die Gemeinschaft kann sie in keiner Weise zur Vornahme von Änderungen an ihrer Gesetzgebung verpflichten), und die Gemeinschaft darauf beschränkt ist, Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu ergänzen oder zu unterstützen oder Förder- bzw. Koordinierungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Befugnis zum Erlass von Legislativnormen in diesen Bereichen bleibt in weitgehendem Maße den Mitgliedstaaten vorbehalten; wird die Gemeinschaft tätig, so bedeutet dies nicht, dass die Mitgliedstaaten nicht mehr tätig werden dürfen. Schließlich fallen unter die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten alle diejenigen Bereiche, für die die Union nicht zuständig ist, die also im Vertrag nicht angesprochen werden und folglich nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung nicht in die Zuständigkeit der EG, sondern nach wie vor in die der Mitgliedstaaten fallen. Hierzu gehören z. B. die interne Organisation der Staaten, die nationale Identität, die nationale Militärstruktur und die nationale öffentliche Verwaltung. Darüber hinaus werden einige Bereiche im Vertrag ausdrücklich den Mitgliedstaaten vorbehalten92, oder der EG-Vertrag verbietet es der Gemeinschaft, gesetzgeberisch tätig zu werden.93
III. Ausdrückliche Vertragsschlussbefugnisse im Außenbereich Eine allgemeine Kompetenzzuweisung für Außenbeziehungen existiert im EGVertrag nicht.94 Demgegenüber waren im Montanbereich in Art. 6 UAbs. 2 KS und Vgl. CONV 47 / 02, S. 20 ff. zur gegenwärtigen Rechtslage. Zum Beispiel die Öffentliche Ordnung und öffentliche Sicherheit, Anwendung des Strafrechts und Strafrechtspflege, Arbeitsentgelt, Koalitionsrecht, Streikrecht und Aussperrungsrecht, Organisation des Gesundheitswesens und medizinische Versorgung, Eigentumsordnung. 93 Zum Beispiel im Bereich der allgemeinen beruflichen Bildung, Kultur, Gesundheitswesen und Beschäftigung. 94 Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 131 ff. 91 92
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
51
sind im Bereich der Europäischen Atomgemeinschaft in Art. 101 EA allgemeine Außenkompetenzen geregelt, die durch Sonderregelungen (z. B. Art. 71 ff. KS zur Handelspolitik und Art. 10, 29, 64, 66 EA) präzisiert werden.95 1. Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) – Art. 71 – 75 KS a) Generelle Vertragsschlusskompetenz Da Art. 6 Abs. 1 KS der Gemeinschaft bereits Rechtspersönlichkeit verlieh, muss angenommen werden, dass Art. 6 Abs. 2 KS, wenn er überhaupt einen eigenständigen Regelungsgehalt haben sollte, der Gemeinschaft darüber hinaus weitere Rechte zuerkennen wollte.96 Art. 6 Abs. 2 KS enthielt daher eine inhaltlich nicht näher konkretisierte Zuständigkeit für den Bereich der auswärtigen Angelegenheiten der EGKS. Der EGKS-Vertrag räumte damit der Gemeinschaft eine generelle Vertragsschließungskompetenz ein, indem er in allgemeiner Form bestimmte, dass die Gemeinschaft im zwischenstaatlichen Verkehr für die Ausübung ihrer Funktionen und die Erreichung ihrer Ziele die erforderliche Rechts- und Geschäftsfähigkeit besaß.97 Die Außenkompetenzen der EGKS waren vor allem aufgrund der in Art. 2 und 3 KS genannten Aufgaben und Ziele der Gemeinschaft konkret bestimmbar.98 Art. 3 a und f KS nannten Beispiele von Aufgaben, die sich vor allem auf dritte Länder erstreckten. In Art. 5 KS und Art. 8 KS war festgelegt, dass die Gemeinschaft ihre Aufgabe durch begrenzte Eingriffe erfüllen sollte und dass die Verwirklichung der Zielsetzung des Vertrages nur unter den von diesem vorgesehenen Bedingungen erfolgen konnte. Die Befugnisse der Gemeinschaft konnten dabei nicht weiter gehen, als es die Verwirklichung des Gemeinschaftsziels, nämlich das Funktionieren des gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl zu sichern, erforderte. Die Außenkompetenz fand ihre Grenze allerdings nicht erst in den Zielen und Aufgaben der EGKS, denn sonst hätten die externen Kompetenzen weiter gereicht als die internen. Man musste daher zu dem Ergebnis kommen, dass Art. 6 Abs. 2 KS nur in Verbindung mit einer gemeinschaftsinternen Kompetenzgrundlage der EGKS die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge verlieh.99 Damit Zacker / Wernicke, Examinatorium Europarecht, S. 112. So auch Hallier, ZaöRV 1957, 428 (444); Vedder, Die auswärtige Gewalt des Europa der Neun, S. 80. 97 Vedder, Die auswärtige Gewalt des Europa der Neun, S. 80; Leopold, ICLQ 1977, 54 (72); i. E. auch MacLeod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Communities, S. 42, 400 f. 98 Vedder, Die auswärtige Gewalt des Europa der Neun, S. 81, mit Stellungnahme zur gegenteiligen Auffassung. 99 Vedder, Die auswärtige Gewalt des Europa der Neun, S. 82. Die Auffassung, wonach Art. 6 Abs. 2 KS eine positivrechtliche Bestätigung des implied-powers Grund95 96
4*
52
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
fand die generelle Vertragsschließungskompetenz der EGKS aus Art. 6 Abs. 2 KS einerseits an den im EGKS-Vertrag selbst enthaltenen Einschränkungen ihre Grenzen. Andererseits wurden auch spezielle Vertragsschließungskompetenzen ausdrücklich im Vertrag geregelt.100
b) Grenzen der allgemeinen Vertragsschließungskompetenz aa) Art. 70 Abs. 5, 71 Abs. 1 KS Die Grenzen der allgemeinen Befugnisse ergaben sich vor allem aus Art. 70 Abs. 5 KS und Art. 71 Abs. 1 KS. Hiernach behielt der Vertrag wichtige Materien ausdrücklich den Mitgliedstaaten vor, etwa die Verkehrs- und Handelspolitik, die Handhabung der Ein- und Ausfuhrlizenzen im Verkehr mit dritten Ländern und die Ordnung des Eigentums an den Unternehmen.101
bb) Art. 133 EG Das Verhältnis zwischen Art. 71 KS und Art. 133 EG (Außenhandelspolitik) klärte der EuGH anlässlich seines WTO-Gutachtens. Der Gerichtshof räumte in dieser Rechtssache Art. 133 EG für solche Abkommen Vorrang vor Art. 71 KS ein, die nicht spezifisch EGKS-Erzeugnisse betreffen. Teil des Streitgegenstandes war ein multilaterales Handelsabkommen, welches Kohle- und Stahlprodukte ebenso wie andere Produkte erfasste; es enthielt keine Spezifizierungen oder Sonderregelungen. Der Gerichtshof stellte fest, dass ein solches Abkommen unter die ausschließliche Kompetenz der Gemeinschaft nach Art. 133 EG fällt. Der Gerichtshof erklärte, dass zwar nach Art. 71 KS die Zuständigkeit der Regierung der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Handelspolitik durch die Anwendung des EGKS-Versatzes ist, kommt zum gleichen Ergebnis wie die hier vertretene Auffassung, vgl. ebenda, S. 80 ff. 100 Vedder, Die auswärtige Gewalt des Europa der Neun, S. 82; ähnlich auch Heinrichs, Die Auswärtigen Beziehungen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, S. 134; aufgrund der innervertraglichen Grenzen sind nach Reichardt, Auswärtige Beziehungen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu Drittstaaten und internationalen Organisationen, S. 78, die Rechte und Zuständigkeiten der Gemeinschaft auf dem Gebiet der auswärtigen Beziehungen wesentlich geringer, als dies ihren Aufgaben nach innen entspricht; MacLeod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Communities, S. 401 ff., plädieren für eine analoge Anwendung der AETR-Rechtsprechung auf den EGKS-Vertrag. 101 Art. 70 Abs. 5, Art. 71 Abs. 1, Art. 73 Abs. 1, Art. 83 KS. Reichardt, Auswärtige Beziehungen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu Drittstaaten und internationalen Organisationen, S. 79, meint, dass die Gemeinschaft damit innerhalb des wichtigsten Zweigs ihrer Aufgaben der Vollmacht, im eigenen Namen tätig zu werden, entbehrt. Die Materien, die nach Art. 71 Abs. 1 2. Hs. i.V.m. Art. 58, 59, 61, 72, 73, 74 KS geregelt sind, fallen wiederum in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaft.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
53
trages nicht berührt wird und dass nach Art. 232 EGV (jetzt Art. 305 EG) der EGVertrag die Bestimmungen des EGKS-Vertrages nicht ändert. Der EuGH führte aus: „Da jedoch der EGKS-Vertrag zu einer Zeit abgefasst wurde, da die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft noch nicht bestand, kann sich Art. 71 dieses Vertrages nur auf Kohleund Stahlerzeugnisse beziehen. Jedenfalls kann er eine Zuständigkeit der Mitgliedstaaten nur für Abkommen begründen, die spezifisch EGKS-Erzeugnisse betreffen. Dagegen ist die Gemeinschaft nach Art. 113 EGV [jetzt Art. 133 EG] allein zuständig für den Abschluss eines externen Abkommens allgemeiner Natur, d. h. eines Abkommens, das alle Arten von Waren einschließt, selbst wenn dazu auch EGKS-Erzeugnisse gehören.“102
Damit schloss der Gerichtshof aus, dass Art. 71 KS dem Art. 133 EG die Wirksamkeit nehmen oder die Zuständigkeit der Gemeinschaft zur Aushandlung und zum Abschluss internationaler Abkommen auf dem Gebiet der gemeinsamen Handelspolitik beschneiden konnte. c) Ausdrücklich zuerkannte Außenkompetenzen Der Montanvertrag gab keine Definition des Begriffs „auswärtige Beziehungen“. Allerdings statuierten einige Vorschriften des EGKS-Vertrages103 eine auswärtige Kompetenz für die Gemeinschaft. Kompetenzen der Gemeinschaft hinsichtlich einzelner handelspolitischer Befugnisse waren in Art. 57 KS erwähnt (handelspolitische Maßnahmen zur Beeinflussung der Erzeugung). Besondere Bestimmungen sahen die Art. 59 und 61 KS (Eingriff in die quantitative Entwicklung des Exports von Montanerzeugnissen, entsprechendes Recht zur Preisgestaltung) vor. Art. 74 KS regelte Maßnahmen jeder Art bei Dumping, Wettbewerbsverzerrung und Handelsverlagerung. Art. 93 KS gab der Hohen Behörde (später: der Kommission) die Vollmacht, alle zweckdienlichen Beziehungen mit den Vereinten Nationen und der OEEC (jetzt OECD) zu unterhalten. Nach Art. 94 KS konnten Verbindungen zwischen der Gemeinschaft und dem Europarat hergestellt werden.104 Daher durfte die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl solche Verbindungen eingehen, die einer fruchtbaren Zusammenarbeit zweckdienlich waren.105 102 EuGH, Slg. 1994, I-5267 (5396 f., Rdnr. 27) – Gutachten 1 / 94 WTO. (Hervorhebungen durch den Verfasser). 103 Zu den Kompetenzen nach dem Überleitungsabkommen (welches während der Übergangszeit galt), insbesondere zu § 14, siehe Hallier, ZaöRV 1957, 428 ff. 104 Art. 93 KS und Art. 94 KS ähnelten damit den heutigen Art. 302 –304 EG. 105 Hallier, ZaöRV 1957, 428 (435); die Gemeinschaft hatte von dieser Ermächtigung durch eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit der ILO Gebrauch gemacht (Amtsblatt der EGKS vom 14. 08. 1953, S. 167); die Hohe Behörde unterhielt weiterhin Verbindungen zur Organisation für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit (heute OECD) und zum GATT, jedoch sind diese Verbindungen nicht auf eine vertragliche Grundlage gestellt worden.
54
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Art. 49 i. V. m. Art. 6 des Protokolls über die Beziehungen zum Europarat gewährte vertragliche Kompetenzen für die Unterhaltung von Beziehungen zum Europarat. Eine weitere Vertragskompetenz enthielt Art. 14 des „Protokolls über Privilegien und Immunitäten der Gemeinschaft“. Hierdurch wurde die Hohe Behörde ermächtigt, „mit einem oder mehreren Mitgliedstaaten Zusatzabkommen zur Durchführung der Bestimmungen dieses Protokolls“ abzuschließen. Schließlich war die Gemeinschaft zum Abschluss von Anleiheverträgen gemäß Art. 49 KS ermächtigt.106 Dies entsprach der Kompetenz der Gemeinschaft auf fiskalischem Gebiet nach innen.
2. Europäische Atomgemeinschaft (EAG) – Art. 101 – 106 EA a) Prinzip der Parallelität von innerer und äußerer Gemeinschaftszuständigkeit Bereits in der Präambel des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft107 wird der Wunsch ausgedrückt, andere Länder an der Europäischen Atomgemeinschaft zu beteiligen und mit zwischenstaatlichen Einrichtungen zusammenzuarbeiten, die sich mit der friedlichen Entwicklung der Kernenergie befassen. Der Euratomvertrag enthält darüber hinaus, als einziger der Gemeinschaftsverträge, ein eigenes Kapitel über Außenbeziehungen. Die wichtigste Bestimmung im Kapitel X des Zweiten Abschnittes ist Art. 101 EA, der für das Euratomrecht das Konzept einer durchgängigen Parallelität von innerer und äußerer Gemeinschaftszuständigkeit vorsieht.108 Dies ist von allen Gemeinschaftsverträgen die einzige Vorschrift, die einen parallelen Verlauf der beiden Kompetenzen109 klar zum Ausdruck bringt.110 Nach Art. 2 lit. h EA soll die Gemeinschaft zur Erfüllung ihrer Aufgabe zu anderen Ländern und zwischenstaatlichen Einrichtungen alle Verbindungen herstellen, die geeignet sind, den Fortschritt bei der friedlichen Verwendung der Kernenergie zu fördern.111 106 Die Gemeinschaft hat, gestützt auf Art. 49 KS, ein Abkommen über die Gewährung einer Anleihe mit den Vereinigten Staaten geschlossen (Amtsblatt der EGKS vom 07. 05. 1954, S. 327). 107 Der Vertrag wird auch als „Euratomvertrag“ bezeichnet. 108 Werbke, NJW 1971, 2103 (2104 f.); Hartley, European Community Law, S. 178. 109 Auch lateinisch als in foro interno, in foro externo bezeichnet. 110 MacLeod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Communities, S. 44. 111 Vgl. hierzu die Abkommen zwischen der Euratom und den Regierungen der USA (vom 29.05. / 19. 06. 1958, ABl. 1959, 309 und vom 08. 11. 1958, ABl. 1959, 327) und dem Ver-
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
55
Die Art. 10, 29 Abs. 1, 46 Abs. 2 lit. e und 52 Abs. 2 lit. b EA ermächtigen die Kommission zum Abschluss von Abkommen in speziellen Bereichen. Nach Art. 10 EA kann die Kommission u. a. auch Drittstaaten damit beauftragen, bestimmte Teile eines Forschungsprogramms der Gemeinschaft durchzuführen. Art. 29 Abs. 1 EA ermächtigt die Kommission zum Abschluss von Verträgen über den Austausch wissenschaftlicher oder gewerblicher Kenntnisse auf dem Gebiet der Kernenergie. Verträge über eine mögliche Beteiligung von Drittstaaten oder zwischenstaatlichen Einrichtungen an der Finanzierung oder Geschäftsführung eines gemeinsamen Unternehmens ermöglicht Art. 46 Abs. 2 lit. e EA. Schließlich sieht Art. 52 Abs. 2 lit. b EA die Schaffung einer Agentur vor, die über das ausschließliche Recht verfügt, Verträge über die Lieferung von Erzen, Ausgangsstoffen oder besonderen spaltbaren Stoffen aus Ländern innerhalb oder außerhalb der Gemeinschaft abzuschließen. Im Euratomvertrag existiert mit Art. 206 EA eine Vorschrift, die Assoziierungen ermöglicht. In Art. 199 EA, Art. 200 EA und Art. 201 EA enthält der Euratomvertrag Vorschriften über die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, dem Europarat und der OECD, sowie mit allen Organisationen, zu denen Beziehungen zweckdienlich sind. Neben den Vertragsschlusskompetenzen wird die EAG auch im Bereich der Kontrolle der auswärtigen Beziehungen der Mitgliedstaaten tätig.112 Eine solche Kontrolle ist vom Euratomvertrag in drei Fällen vorgesehen. Zum einen gelten die vor Inkrafttreten des Euratomvertrages geschlossenen Verträge vollumfänglich weiter, soweit sie der Kommission gemäß Art. 105 EA mitgeteilt worden sind. Die Mitgliedstaaten sind jedoch verpflichtet, auf die Abänderung der Verträge zur Übertragung der Rechte und Pflichten auf die Gemeinschaft hinzuwirken (Art. 106 EA). Zweitens ist zu beachten, dass Art. 103 EA die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, der Kommission die Entwürfe von Abkommen vorzulegen, die den Anwendungsbereich des Euratomvertrages berühren.113 Enthält ein solcher Entwurf Bestimmungen, welche die Anwendung des Vertrages beeinträchtigen, so gibt die Kommission dem betreffenden Mitgliedstaat ihre Einwendungen bekannt. Der Mitgliedstaat kann das betreffende Abkommen erst dann abschließen, wenn er den Einwendungen abgeholfen hat oder einen Beschluss des EuGH herbeigeführt hat, der die Vereinbarkeit der Bestimmungen mit dem EAGV feststellt.114 Drittens einigten Königreich von Großbritannien und Nordirland (vom 04. 02. 1959, ABl. 1959, 341) über die Zusammenarbeit bei der friedlichen Verwendung der Kernenergie. 112 Siehe hierzu Drück, Die internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Verwendung der Atomenergie innerhalb Europas, S. 88 f. 113 Im EG-Vertrag gibt es dagegen keine Bestimmung, die präventiv verhindert, dass Mitgliedstaaten durch Abkommen mit Drittstaaten die auswärtigen Zuständigkeiten der Gemeinschaft beeinträchtigen. Die Kommission muss insoweit ein Vertragsverletzungsverfahren anstrengen, Bieber / Epiney / Haag / Beutler, Die EU Rechtsordnung und Politik, S. 697.
56
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
müssen sämtliche nichtvertraglichen Rechtshandlungen der Mitgliedstaaten gegenüber Drittstaaten mit dem Euratomvertrag vereinbar sein, was die Organe im Wege der allgemeinen Vertragskontrolle gemäß Art. 146 Abs. 1 EA erzwingen können. Der EAG sind neben den Art. 92 ff. EA keine außenhandelspolitischen Kompetenzen übertragen worden. Der EG-Vertrag kann gemäß Art. 305 Abs. 2 EG zur Lückenschließung herangezogen werden, soweit er die Bestimmungen des Euratomvertrages nicht beeinträchtigt. 115 Da der Euratomvertrag keine Regelungen hinsichtlich der Außenhandelspolitik enthält, stehen die Normen des EG-Vertrages über die gemeinsame Handelspolitik nicht im Widerspruch zum Euratomvertrag.116 Abkommen, die sich z. B. gemäß Art. 133 EG auf den Warenverkehr im Allgemeinen beziehen, gelten damit grundsätzlich auch für EAG-Waren, wobei der Handel mit solchen Waren in der Praxis eine sehr untergeordnete Rolle spielt.117 Zusammenfassend ist die Kommission daher mit einer Fülle von Aufgaben im auswärtigen Bereich betraut.118
b) Umfang der Kompetenzen Gemäß Art. 101 EA kann die Gemeinschaft im Rahmen ihrer Zuständigkeit Verpflichtungen durch Abkommen und Verträge übernehmen. Um dieses Ziel zu errei114 Vgl. EuGH, Slg. 1987, S. 2151 – Beschluss 1 / 78 nach Art. 103 Abs. 3 EAGV; Art. 75 EGKS-Vertrag begründete eine vergleichbare Mitteilungspflicht für Mitgliedstaaten, die internationale Abkommen im Montanbereich abschließen wollen, vgl. Bieber / Epiney / Haag / Beutler, Die EU Rechtsordnung und Politik, S. 697. 115 Carstens, ZaöRV 1957 / 1958, 459 (504). 116 Der EuGH führt in seinem WTO-Gutachten, Slg. 1994, I-5267 (5396, Rdnr. 24) – Gutachten 1 / 94, WTO, aus: „Nach Art. 232 Abs. 2 EG-Vertrag „beeinträchtigt [dieser Vertrag] nicht die Vorschriften des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft“. Da der Euratom-Vertrag keine Bestimmungen über den Außenhandel enthält, steht einer Erstreckung der gemäß Art. 113 EG-Vertrag geschlossenen Abkommen auf den internationalen Handel mit EuratomErzeugnissen nichts entgegen.“ Hartley, European Community Law, S. 170: „. . . where the Euratom Treaty is silent, the EC Treaty applies.“ 117 Vedder, Die auswärtige Gewalt des Europa der Neun, S. 94 f.; Carstens, ZaöRV 1957 / 1958, 459 (504); kritisch hierzu Cusack, CMLR 2003, 117 (142). 118 Drück, Die internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Verwendung der Atomenergie innerhalb Europas, S. 88, findet diese umfassende Kompetenz zunächst „überraschend“, begründet sie dann mit dem „bestimmenden Grundgedanken des Vertrags, der die sechs im Atombereich unterentwickelten Gemeinschaftsstaaten zu einem gleichwertigen Partner der weiterentwickelten Atommächte [USA, Großbritannien] erstarken möchte“. Außerdem habe sich „der Gedanke, durch gemeinsames Auftreten der Staaten als Pool, zu günstigeren Bedingungen zu gelangen, als sie einem Einzelstaat gewährt würden, beim Abschluss der Verträge USA-Euratom als richtig erwiesen“, ebenda, S. 89.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
57
chen, muss sich die Gemeinschaft an ihre Aufgaben nach Art. 2 EA halten. Hierzu zählen die Entwicklung der Forschung und die Verbreitung der technischen Kenntnisse, das Aufstellen von Sicherheitsnormen für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der Arbeitskräfte, Investitionsförderung, Sicherstellung der Versorgung mit Erzen und Brennstoffen, die Überwachung von Kernstoffen, die Ausübung des übertragenen Eigentumsrechts an spaltbaren Stoffen, die Sicherstellung eines ausgedehnten Absatzmarktes und die Herstellung von Verbindungen zu Drittstaaten und zwischenstaatlichen Einrichtungen, die den Fortschritt bei der friedlichen Verwendung der Kernenergie fördern. In Anbetracht dieser Fülle von Aufgaben hat die Europäische Atomgemeinschaft, trotz der Begrenztheit des Atombereichs, innerhalb dieses Sektors eine sehr weitgehende Kompetenz. Hiervon ausgenommen sind lediglich die militärische Atomtechnologie und Kompetenzen in Bezug auf Konstruktions- und Betriebsvorschriften für Nuklearbetriebe in den Mitgliedstaaten.119 Die Europäische Atomgemeinschaft hat vor allem mit den drei Hauptlieferanten spaltbarer Materialien (USA, Kanada, Australien) völkerrechtliche Verträge geschlossen120, sie arbeitet aber auch eng mit der IAEO zusammen.121 c) Art der Kompetenzen Die der Europäischen Atomgemeinschaft zustehende Kompetenz ist eine ausschließliche im Bereich der Versorgung mit Kernmaterial und des ordnungsgemäßen Funktionierens eines Gemeinsamen Marktes auf dem Kerngebiet.122 Auch im Bereich der Sicherheitsüberwachung (Kapitel VII) steht der Gemeinschaft eine ausschließliche Vertragsschlusskompetenz zu.123 Dies verdeutlichen die Art. 86 119 MacLeod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Communities, S. 393; zur Vertragspraxis der EAG siehe ebenda S. 394 ff.; zu den Europäischen Atomverträgen im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung siehe Haedrich, Europäische Atomverträge, S. 16 ff.; zu den einzelnen Befugnissen der Euratom siehe die Auflistung bei Drück, Die internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Verwendung der Atomenergie innerhalb Europas, S. 97. 120 Vgl. das Abkommen zwischen Euratom und Kanada vom 06. 10. 1959 (ABl. 1959, 60), das Abkommen zwischen Euratom und den Vereinigten Staaten von Amerika vom 19. 06. 1956 (ABl. 1959, 17), das Abkommen zwischen Euratom und Brasilien vom 09. 06. 1961 (ABl. 1969 L 79), das Abkommen zwischen Euratom und Argentinien vom 04. 09. 1962 (ABl. 1963, 186), das Abkommen zwischen Euratom und Australien vom 18. 09. 1980 (ABl. 1982 L 281, 8); zu Änderungen und Anpassungen der genannten Abkommen siehe Cusack, YEL 1983, S. 347 (360, Annex I). 121 Vgl. die Gemeinsame Aktion 2004 / 495 / GASP des Rates vom 17. 05. 2004 zur Unterstützung der Aktivitäten im Rahmen des Fonds für nukleare Sicherheit der IAEO über die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, ABl. 2004 L 182, 46. 122 EuGH, Slg. 1978, 2151 (2172, 2174, Rdnr. 14 a. E., 18) – Internationale Atomenergieorganisation. 123 EuGH, Slg. 1978, 2151 (2176, Rdnr. 23) – Internationale Atomenergieorganisation.
58
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
und 87 EA, die den Mitgliedstaaten zwar das unbeschränkte Nutzungs- und Verbrauchsrecht an spaltbaren Stoffen einräumen, jedoch gleichzeitig bestimmen, dass die Atomgemeinschaft Eigentümerin dieser Stoffe ist. Damit ist die Gemeinschaft alleinige Inhaberin der Vorrechte, die den wesentlichen Inhalt des Eigentumsrechts ausmachen. Sie behält letzten Endes das Verfügungsrecht über die besonderen spaltbaren Stoffe. Aus diesen Erwägungen ergibt sich die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft für Abkommen, die Versorgungs- oder Sicherheitssysteme betreffen.124
3. Europäische Gemeinschaft (EG) Der EG stehen mittlerweile zahlreiche, im Vertrag ausdrücklich verliehene Außenkompetenzen zu.
a) Historische Entwicklung der Außenkompetenzen der EG – Von den Römischen Verträgen bis zum Vertrag von Nizza aa) Der Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWGV) Der Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWGV)125, einer der so genannten „Römischen Verträge“ aus dem Jahre 1957, nannte in seinem ursprünglichen Wortlaut lediglich zwei Bereiche, in denen die Gemeinschaft mit Drittländern oder internationalen Organisationen Abkommen schließen durfte: einmal die gemeinsame Handelspolitik (vor und nach der Übergangszeit126) nach Art. 111, 113, 114 EWGV127 und zum anderen Assoziationsabkommen nach Art. 238 EWGV. Ferner sahen die Art. 229, 230 und 231 EWGV vor, dass die Kommission alle zweckdienlichen Beziehungen zu den Organen der Vereinten Nationen, ihrer Fachorganisationen und des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT), zu allen internationalen Organisationen und zum Europarat 124
EuGH, Slg. 1978, 2151 (2176 ff., Rdnr. 24 ff.) – Internationale Atomenergieorganisa-
tion. 125 Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWGV) vom 25. 03. 1957 (BGBl. 1957 II, 766). 126 Zur Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes war nach Art. 8 EWGV eine Übergangszeit von 12 Jahren vorgesehen. Sie begann mit der Inkraftsetzung des EWG-Vertrages am 01. 01. 1958 und endete am 31. 12. 1969. Sie war in drei aufeinander folgende Stufen von je vier Jahren eingeteilt, vgl. Constantinesco, Das Recht der Europäischen Gemeinschaften, S. 160 ff. 127 Ehle / Meier, EWG-Warenverkehr, S. 425 f., halten die Trennung von Außenpolitik und Handelspolitik und ihre Ausübung durch verschiedene Hoheitsträger auf die Dauer für „untragbar“, da sie nicht nur die Außenhandelspolitik als ein Instrument gemeinsamer Handelspolitik gefährde, sondern auch zu ständigen Kompetenzkonflikten führen müsse. Eine Koordinierung oder gar Vergemeinschaftung der Außenpolitik sei „unvermeidbar“.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
59
unterhalten soll. Bei diesen letztgenannten Artikeln ging es jedoch darum, „nützliche Verbindungen“ zu internationalen Organisationen zu errichten, nicht aber, mit ihnen oder innerhalb dieser Organisationen zusammen mit anderen Parteien Verträge abzuschließen.128 Die „nützlichen Verbindungen“ zum GATT fielen daher unter Art. 229 EWGV, die Aushandlung von z. B. Zollabkommen dagegen waren vom Anwendungsbereich des Art. 113 EWGV erfasst. Schließlich wurde in Art. 228 EWGV das Verfahren beim Abschluss völkerrechtlicher Verträge geregelt. Seit 1970 ist die Gemeinschaft befugt, völkerrechtliche Verträge auf dem Gebiet der Handelspolitik im Sinne von Art. 113 EWGV abzuschließen.129 Vor 1970 waren die Vertragsschließungskompetenzen gemäß Art. 111 EWGV auf eine Koordinierung der Handelsbeziehungen mit Drittstaaten beschränkt. Nach Ablauf der Übergangszeit am 31. 12. 1969 ging die Kompetenz zur Verhandlung und zum Abschluss von Handelsabkommen im Sinne einer ausschließlichen Zuständigkeit auf die Gemeinschaft über.130 Die Gemeinschaft hat, zusammen mit den Mitgliedstaaten, bereits früh auf der Basis der genannten Artikel eine Reihe von Handelsabkommen geschlossen.131
bb) Die Einheitliche Europäische Akte (EEA) Die Einheitliche Europäische Akte (EEA)132 aus dem Jahre 1986 fügte Außenkompetenzen im Bereich der Kooperation in Forschung und technologischer Entwicklung (Art. 130 m EWGV, jetzt Art. 170 EG) und im Bereich der Umweltpolitik (Art. 130 r Abs. 4 EWGV, jetzt Art. 174 Abs. 4 EG) hinzu.
cc) Der Vertrag von Maastricht Der Vertrag von Maastricht133 (1992) sah dann Vorschriften über die Währungspolitik im Rahmen der dritten Stufe der Währungsunion (Art. 109 Abs. 3 EGV 128 Schloh, in: Die Außenbeziehungen der Europäischen Gemeinschaft, Kölner Schriften zum Europarecht, Band 25, S. 85. 129 Fischer, in: Die Außenbeziehungen der Europäischen Gemeinschaft, Kölner Schriften zum Europarecht, Band 25, S. 3. 130 Vgl. Art. 133 Abs. 3 und Art. 114 EWGV und die Ratsentscheidung vom 16. 12. 1969, ABl. L 326, 39. 131 Internationales Kaffeeübereinkommen, ABl. 1976 L 309, 28; Internationales Kakaoübereinkommen, ABl. 1976 L 321, 29; Internationales Zinnübereinkommen, ABl. 1976 L 222, 1. 132 Sie wurde von den Staats- und Regierungschefs der damaligen 12 Mitgliedstaaten im Februar 1986 unterzeichnet und trat nach Abschluss des Ratifizierungsverfahrens am 01. 07. 1987 in Kraft, (BGBl. 1986 II, 1102). 133 „Vertrag über die Europäische Union“, kurz: EU-Vertrag, in Kraft seit 07. 02. 1992, (BGBl. 1992 II, 1251).
60
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
[jetzt Art. 111 EG]) und über die Entwicklungskooperation (Art. 130 y EGV [jetzt Art. 181 EG]) vor. Beide Vorschriften beinhalteten explizit auch die Möglichkeit, völkerrechtliche Verträge abzuschließen. Außerdem wurden Artikel eingefügt, die die Zusammenarbeit (nicht aber konkret den Abschluss völkerrechtlicher Verträge) mit Drittländern und internationalen Organisationen auf den Gebieten Erziehung, berufliche Ausbildung, Kultur und Gesundheit erlaubten (Art. 126 Abs. 3 EGV [jetzt Art. 149 Abs. 3 EG], 127 Abs. 3 EGV [jetzt Art. 150 Abs. 3 EG], Art. 128 Abs. 3 EGV [jetzt Art. 151 Abs. 3 EG] und Art. 129 Abs. 3 EGV [jetzt Art. 152 Abs. 3 EG]) gestatteten. Weiterhin wurden Kooperationen bei Projekten von gegenseitigem Interesse und der Sicherstellung der Interoperabilität von transeuropäischen Netzwerken ermöglicht (Art. 129 c Abs. 3 EGV [jetzt Art. 155 Abs. 3 EG]).
dd) Der Vertrag von Amsterdam Auch nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Amsterdam am 01. 05. 1999 verblieben viele Politikbereiche, in denen keine ausdrückliche Ermächtigung durch den Vertrag für die Ausübung der Außenkompetenz vorgesehen ist (etwa Binnenmarkt, Wettbewerb, Landwirtschaft, Fischerei, Transport, Steuern, Sozialpolitik).134
ee) Der Vertrag von Nizza Durch den Vertrag von Nizza (in Kraft getreten am 01. 02. 2003) wurden die Außenkompetenzen der Gemeinschaft im Bereich der Außenhandelspolitik (Art. 133 EG) teilweise erweitert. Hinzu kam eine weitere Kompetenz der Gemeinschaft für die wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittländern, die keine Entwicklungsländer sind (Art. 181 a EG). Anders als der Euratom-Vertrag (mit Kapitel X, Art. 101 – 106 EA) enthält der EG-Vertrag damit bis zum heutigen Tage keinen gesonderten Abschnitt über Außenbeziehungen. Die Außenkompetenzen bleiben eine fragmentarische Sammlung von Kompetenzen, die weder die Reichweite noch die politische und ökonomische Wichtigkeit der Gemeinschaftsaktivitäten angemessen widerspiegelt.135
Dashwood, in: Koskenniemi, International Law Aspects of the European Union, S. 115. Dashwood, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 123. 134 135
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
61
b) Handelsabkommen, Art. 133 EG aa) Überblick und horizontale Abgrenzung zu anderen Politikfeldern Die EG ist mit vielen Staaten durch bilaterale oder multilaterale völkerrechtliche Verträge verbunden. Rechtsgrundlage für einen Großteil dieser Verträge stellt Art. 133 Abs. 3 EG in Verbindung mit Art. 300 EG dar. Die EG ist aufgrund von Art. 3 lit. b EG verpflichtet, eine gemeinsame Handelspolitik gegenüber Drittstaaten zu entwickeln und sodann durchzuführen. Die hierzu erforderliche Kompetenz weist ihr Art. 133 EG zu. Früher enthielt Art. 116 EWGV eine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, in internationalen Organisationen mit wirtschaftlichem Charakter bei allen Fragen, die für den Gemeinsamen Markt von besonderem Interesse sind, gemeinsam vorzugehen. Diese Bestimmung wurde jedoch durch den EU-Vertrag aufgehoben. Seither ergibt sich die Pflicht zum koordinierten Vorgehen aus der allgemeinen Regelung des Art. 10 EG, der Verpflichtung zu gemeinschaftstreuem Verhalten.136 Abzugrenzen von den Handelsabkommen im Sinne des Art. 133 EG sind insbesondere die Assoziierungsabkommen (Art. 310 EG), welche einen größeren politischen Einschlag aufweisen. Jedoch ist Art. 133 EG die zentrale Kompetenznorm zum Abschluss zoll- und handelsrechtlicher Vereinbarungen.137 Eine klare Kollisionsregel ist Art. 32 Abs. 2 EG, der den Vorrang der Agrarpolitik gegenüber den Kompetenzen im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik bestimmt. Allerdings ist nach dem EuGH zu differenzieren: Soweit Abkommen mit Drittstaaten (auch) den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten erfassen, ist die gemeinsame Handelspolitik einschlägig.138 Soll aber der Agraraußenhandel im Wege autonomer Rechtsetzung geregelt werden, so ist ausschließlich Art. 37 EG die zutreffende Rechtsgrundlage, denn die Vorschriften über die gemeinsame Agrarpolitik beziehen sich grundsätzlich auch auf das Verhältnis zu dritten Staaten.139 Für den Bereich Verkehr hat der EuGH festgestellt, dass internationale Verkehrsabkommen nicht unter Art. 133 EG, sondern unter die in den Art. 70 – 80 EG geregelte gemeinsame Verkehrspolitik fallen, da die Normen im Verkehrssektor ein in sich geschlossenes Regelungssystem darstellen.140 In vielen anderen Bereichen fehlen klare Regelungen, was zu Abgrenzungsproblemen führt. Angesichts des typischen Zusammenfallens von Fragen des Handels 136 Weitere Nachweise bei Bieber / Epiney / Haag / Beutler, Die EU Rechtsordnung und Politik, S. 707. 137 Müller-Iboldt, in: Lenz, EG-Vertrag Kommentar, Art. 133 EG Rdnr. 54. 138 EuGH, Slg. 1979, 2871 (2914) – Gutachten 1 / 78, Internationales NaturkautschukÜbereinkommen. 139 EuGH, Slg. 1989, I-3743 – Kommission . / . Rat. 140 EuGH, Slg. 1994, I-5267 – Gutachten 1 / 94, WTO.
62
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
einerseits und Fragen des Schutzes anderer Rechtsgüter andererseits („Trade and . . .“ – Problemlagen) kommt es häufig zu konkurrierenden Kompetenzen.141 Die gemeinsame Handelspolitik muss zudem von den Embargomaßnahmen der Europäischen Union abgegrenzt werden, die nach den GASP-Bestimmungen des EU-Vertrages in Verbindung mit Art. 301 EG getroffen werden können.142 Außerdem bestehen Berührungspunkte zu Rechtsgrundlagen in der Entwicklungspolitik (Art. 181 und 181 a EG), zur Wechselkursfestlegung (Art. 111 Abs. 3 EG), zur Forschung und technologischen Entwicklung (Art. 170 EG), zu Bildung und Jugend (Art. 149 Abs. 3 EG), zur Kultur (Art. 151 Abs. 3 EG), zum Gesundheitswesen (Art. 152 Abs. 3 EG) und zu transeuropäischen Netzen (Art. 155 Abs. 3 EG). Diese Konflikte sind nach den allgemeinen vom EuGH aufgestellten Grundsätzen zu lösen.
bb) Begriff und Umfang der gemeinsamen Handelspolitik Der Umfang der Außenkompetenz der EG im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik gehört zu den klassischen Problemen des europäischen Gemeinschaftsrechts.143 Die Handelspolitik muss zum einen horizontal (im Verhältnis zu anderen Politikbereichen der Union) und zum anderen vertikal (in Verhältnis zu den Kompetenzen der Mitgliedstaaten144) abgegrenzt werden. Die Einordnung eines Themenbereiches in die gemeinsame Handelspolitik hat erstens zur Folge, dass der betreffende Bereich in die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft fällt, und zweitens, dass der Rat mit qualifizierter Mehrheit beschließt (Art. 133 Abs. 4 EG).145 Aus diesen Gründen ist die Bestimmung des Umfangs der gemeinsamen Handelspolitik von immenser praktischer Bedeutung. Der Begriff der gemeinsamen Handelspolitik ist im EG-Vertrag nicht definiert. In Art. 133 Abs. 1 EG werden jedoch Bereiche genannt, die unter die gemeinsame Handelspolitik fallen, nämlich die Änderung von Zollsätzen, der Abschluss von Zoll- und Handelsabkommen, die Vereinheitlichung der Liberalisierungsmaßnahmen, die Ausfuhrpolitik und handelspolitische Schutzmaßnahmen (zum Beispiel der Schutz der Gemeinschaftsindustrien vor Dumping und ausländischen Subventionen). Dabei stellt das Wort „insbesondere“ in der Vorschrift klar, dass es sich hierbei nicht um eine abschließende Aufzählung handelt. Der Begriff „gemein141 Nettesheim / Duvigneau, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 133 EGV Rdnr. 18; zu „trade and . . .“ – Problemlagen ausführlich Trachtman, EJIL 1998, 32 ff. und Howse, AJIL 2002, 94 ff. Zur Abgrenzung von Art. 133 EG zu den Außenkompetenzen der Gemeinschaft im Umweltbereich, vgl. unten, § 4 III. 3. i) aa) (2). 142 Dazu unten, § 4 V. 2. d). 143 Herrmann, EuZW 2001, 269. 144 Vgl. zu der maximalistischen Haltung der Kommission und der minimalistischen Haltung des Rates insbesondere Koutrakos, YEL 2003, 407. 145 Herrmann, CMLRev 2002, 7 (8).
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
63
same Handelspolitik“ ist nach dem EuGH weit zu verstehen und für neuere Entwicklungen offen, damit die gemeinsame Handelspolitik angesichts des sich verändernden internationalen Umfeldes nicht zur allmählichen Bedeutungslosigkeit verdammt wird.146 Allgemein wird angenommen, dass die der EG zugewiesene Kompetenz im Bereich der Handelspolitik gemäß Art. 133 Abs. 3 EG in Verbindung mit Art. 300 EG eine ausschließliche ist.147 Mit der Auslegung und Konkretisierung des Begriffs „Handelspolitik“ wird damit implizit über das Ausmaß einer ausschließlichen Zuständigkeit der Gemeinschaft entschieden.148 Der EuGH hat in seinem Gutachten 1 / 78 (Internationales NaturkautschukÜbereinkommen) ausgeführt, dass der Begriff der Handelspolitik nicht nur die herkömmlichen Aspekte des Außenhandels (zum Beispiel die bloße Liberalisierung des Handelsverkehrs) erfasst, sondern auch weiterentwickelte Mechanismen, die auf eine Regelung des Weltmarktes abzielen, mit einschließt.149 Im Gutachten 1 / 94 dehnte der Gerichtshof den Begriff der Handelspolitik noch weiter aus. Der offene Charakter der gemeinsamen Handelspolitik lässt es, so führt der EuGH aus, nicht zu, den Dienstleistungsverkehr von vornherein und grundsätzlich vom Anwendungsbereich des Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG) auszuschließen.150 Hiernach können neben Waren auch grenzüberschreitende Dienstleistungen Gegenstand der gemeinsamen Handelspolitik sein, allerdings nur soweit, als so genannte Korrespondenzdienstleistungen betroffen sind, d. h. nur die Dienstleistung selbst muss grenzüberschreitend sein, weder für den Dienstleistungserbringer noch für den Dienstleistungsempfänger darf ein grenzüberschreitender Ortswechsel erforderlich werden. Da diese Situation dem Warenverkehr, der zweifellos unter die gemeinsame Handelspolitik im Sinne des Vertrages fällt, nicht unähnlich ist, gibt es, dem EuGH folgend151, keinen Grund, eine solche Dienstleistung vom Begriff der gemeinsamen Handelspolitik auszuschließen. Internationale Verkehrsabkommen fallen hingegen nicht unter die gemeinsame Handelspolitik, sondern unter die Verkehrspolitik, welche im EG-Vertrag eine eigenständige Regelung erfahren hat.152 Auch die Binnenmarktregeln gehen Art. 133 EG als Sondervorschriften vor. So formulierte der Gerichtshof: 146 EuGH, Slg. 1979, 2871 (Rdnr. 44) – Gutachten 1 / 78, Internationales NaturkautschukÜbereinkommen; zu dem Spannungsverhältnis zwischen unionsrechtlichem Begriff der Handelspolitik und dem internationalen Begriffsverständnis siehe Nettesheim / Duvigneau, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 133 EGV Rdnr. 6 ff. 147 Vgl. unten, dd). 148 Geiger, JZ 1995, 973 (978). 149 Im konkreten Fall wurde auch die Errichtung von Ausgleichlagern durch Grundstoffabkommen als von Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG) erfasst angesehen. 150 EuGH, Slg. I-1994, 5267 (5401) – Gutachten 1 / 94, WTO. 151 Vgl. EuGH, Slg. I-1994, 5267 (5401) – Gutachten 1 / 94, WTO. 152 EuGH, Slg. I-1994, 5267 (5402) – Gutachten 1 / 94, WTO; vgl. jetzt auch Art. 133 Abs. 6 UAbs. 3 EG.
64
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza „Was die Teilnahme der unter ausländischer Kontrolle stehenden Unternehmen am innergemeinschaftlichen Handelsverkehr angeht, genügt die Feststellung, dass diese den Binnenmarktregeln der Gemeinschaft und nicht ihrer gemeinsamen Handelspolitik unterliegt.“153
Wie bereits erwähnt ist nach dem Auslaufen des EGKS-Vertrages am 23. 07. 2002 auch der Handel mit Kohle- und Stahlprodukten unter die gemeinsame Handelspolitik nach Art. 133 EG gefallen.154 Durch den am 01. 02. 2003 in Kraft getretenen Vertrag von Nizza wurden die Außenkompetenzen der Gemeinschaft im Bereich der Außenhandelspolitik teilweise erweitert. So weist der vollständig geänderte Art. 133 Abs. 5 EG der Gemeinschaft grundsätzlich auch die Zuständigkeit für Verhandlungen und den Abschluss von Verträgen betreffend den Handel mit Dienstleistungen und die Handelsaspekte des geistigen Eigentums zu. Da sich die Übertragung der Kompetenz ausschließlich auf das Außenverhältnis bezieht, ist Abs. 5 keine Kompetenz zum Erlass von gemeinschaftlichem Sekundärrecht. Die Kompetenz ist außerdem keine ausschließliche, weil Art. 133 Abs. 5 UAbs. 4 EG die Kompetenzen der Mitgliedstaaten für den Abschluss internationaler Übereinkommen in dem betreffenden Bereich bewahrt. Damit kann die Gemeinschaft ein Mitwirken der Mitgliedstaaten nicht verhindern. Die Folge hiervon ist, dass nun nicht mehr obligatorisch, wohl aber fakultativ gemischte Verträge die Regel sein werden.155 Ein Einrücken der EG in die Stellung der Mitgliedstaaten in den Bereichen GATS und TRIPS wird auch nicht durch den Vertrag von Nizza ermöglicht. Dieses Einrücken hatte der EuGH in seinem WTO-Gutachten unter die Voraussetzung einer ausschließlichen Gemeinschaftskompetenz gestellt. Ein solcher Kompetenzverlust der Mitgliedstaaten wird von Art 133 Abs. 5 UAbs. 4 EG jedoch gerade ausgeschlossen.156 Zudem werden die eingeräumten Kompetenzen durch Art. 133 Abs. 5 UAbs. 4 und Abs. 6 UAbs. 1, 2 EG im Bereich des Handels mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen sowie Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Soziales und Gesundheitswesen dahingehend eingeschränkt, dass sie in die gemischte Zuständigkeit der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten fallen.157 Aus der vorher nur impliziten und nicht umfassenden Kompetenz ist eine ausdrückliche und – allerdings durch das Maß der Innenkompetenz und den Ausschluss der Verkehrsdienstleistungen begrenzte – umfassende Kompetenz für die Bereiche Dienstleistungen und handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums geworden.158 Eine vollEuGH, Slg. I-1995, 521 (557) – Gutachten 2 / 92, OECD. Nettesheim / Duvigneau, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 133 EGV Rdnr. 12. 155 Herrmann, EuZW 2001, 269 (272). 156 Vgl. dazu Herrmann, EuZW 2001, 269 (272). 157 Der Begriff „gemischte Zuständigkeit“ wird damit erstmals primärrechtlich erwähnt, gleichzeitig werden die verfahrenrechtlichen Folgen geregelt (Art. 133 Abs. 6 UAbs. 2 EG). 153 154
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
65
ständige Kongruenz zwischen dem Regelungsgegenstand der WTO (GATT, GATS und TRIPS) und der Außenkompetenz der EG nach Art. 133 EG (im Sinne einer ausschließlichen Kompetenz, welche der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit unterliegt), wie sie noch im Vorschlag der Kommission vorgesehen war, ist dagegen nicht geschaffen worden. Damit wurde dem Wunsch Frankreichs entsprochen, in diesem Bereich nicht zu viele Kompetenzen der Gemeinschaft zu übertragen. Von dem in Art. 133 Abs. 4 EG festgelegten Grundsatz, wonach der Rat mit qualifizierter Mehrheit entscheidet, werden durch die Absätze 5 und 6 wichtige Ausnahmen gemacht. Art. 133 Abs. 5 EG legt den Parallelitätsgrundsatz fest, wonach solche Abkommen immer einstimmig beschlossen werden müssen, die Bereiche betreffen, bei denen für die Annahme interner Vorschriften Einstimmigkeit erforderlich ist. Auch horizontale Abkommen, also solche Übereinkünfte, für deren Abschluss mehrere Rechtsgrundlagen erforderlich sind, bedürfen der einstimmigen Beschlussfassung, soweit diese Abkommen auch Art. 133 Abs. 5 UAbs. 2 oder Art. 133 Abs. 6 UAbs. 2 betreffen. Art. 133 Abs. 7 EG ermöglicht, den Bereich des geistigen Eigentums durch einstimmigen Ratsbeschluss insgesamt in die Kompetenz der Gemeinschaft zu überführen. Diese Vorschrift bedeutet eine gewisse Flexibilisierung, da es ermöglicht wird, die betreffenden Bereiche – bei entsprechenden Stimmenverhältnissen im Rat – ohne aufwändiges Vertragsänderungsverfahren in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaft zu überführen. Bisher ist von dieser vertraglich vorgesehenen Möglichkeit jedoch noch kein Gebrauch gemacht worden. Abschließend ist festzuhalten, dass der Vertrag von Nizza die Kompetenzlage im Bereich der Handelspolitik nicht transparenter sondern vielmehr noch komplizierter gemacht hat.159
cc) Auf der Grundlage des Art. 133 EG geschlossene Abkommen Seit 1963 hat die EG eine große Anzahl handelspolitischer Abkommen geschlossen. Hierbei ist vor allem das als Ergebnis der Uruguay-Runde (1986 – 1994) geschlossene Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) zu nennen. Das zu diesem Vertrag im Anhang beigefügte Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen 1994 (GATT 1994160; als Nachfolger des „alten“ GATT 1947, dem die Gemeinschaft nicht förmlich beigetreten war, jedoch faktisch die Stellung einer Vertragspartei innehatte161) sowie das Allgemeine Übereinkommen über den 158 Herrmann, EuZW 2001, 269 (273), zu den neu gefassten Mehrheitserfordernissen, sonstigen Änderungen und Kritik an der Neuregelung siehe S. 273 f. 159 Insgesamt kritisch auch Herrmann, CMLRev 2002, 7 (28 f.). 160 ABl. 1994 L 336, 11. 161 EuGH, Slg. 1972, 1219 (Rdnr. 14, 18) – International Fruit Company.
5 Metz
66
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Handel mit Dienstleistungen (GATS162), das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS163) und das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen sind ebenfalls von besonderer Wichtigkeit. Daneben ist die EG Vertragspartei verschiedener völkerrechtlicher Übereinkommen über Rohstoffe.164 dd) Ausschließliche Kompetenz Die nach Art. 133 EG ausdrücklich verliehene Kompetenz ist eine ausschließliche. Das bedeutet, dass in diesem Bereich nur die Gemeinschaft handeln darf. Die Mitgliedstaaten dürfen grundsätzlich selbst dann nicht tätig werden, wenn die Gemeinschaftsorgane entsprechendes handelspolitisches Sekundärrecht noch nicht erlassen haben.165 Der Gerichtshof hat in seinem Gutachten 1 / 75 ausführlich dargelegt, aus welchen Gründen eine ausschließliche Kompetenz anzunehmen sei.166 Dem EuGH zufolge ist Hauptgrund für das Bestehen einer ausschließlichen Kompetenz die Ausgestaltung der Gemeinsamen Handelspolitik durch den Vertrag. Sinn und Zweck des Art. 133 EG sei es, das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes sicherzustellen und das Gesamtinteresse der Gemeinschaft zu schützen. Er führte weiter aus: „Die Sonderinteressen der Mitgliedstaaten müssen sich innerhalb des Rahmens, den das Gesamtinteresse setzt, einander anpassen. Mit dieser Konzeption wäre es ganz offensichtlich unvereinbar, wenn sich die Mitgliedstaaten unter Berufung auf eine parallele Zuständigkeit einen Freiraum vorbehalten könnten, um in den Außenbeziehungen die gesonderte Befriedigung ihrer Eigeninteressen zu suchen, auf die Gefahr hin, einen wirksamen Schutz der Gesamtinteressen der Gemeinschaft zu hintertreiben.“167
Der Gerichtshof macht deutlich, dass unterschiedliche Regelungen zu einer Wettbewerbsverzerrung zwischen den Unternehmen aus den unterschiedlichen Mitgliedstaaten führen würden und dass derartige Verzerrungen nur durch identiABl. 1994 L 336, 191. ABl. 1994 L 336, 214. 164 Etwa für Zucker (ABl. 1998 L 7, 28), Kaffee (ABl. 1994 L 222, 4, verlängert ABl. 1999 L 313, 8), Naturkautschuk (ABl. 1996 L 342, 2), Tropenholz (ABl. 1996, L 208, 4), Kakao (ABl. 1984 L 52, 4 und ABl. 1998 L 220, 1), Jute (ABl. 1989 L 29, 4), Olivenöl (ABl. 1987 L 214, 2 und ABl. 1993 L 298, 37), Weizen (ABl. 1986 L 195, 3) und Zinn (ABl. 1982 L 342, 1). 165 St. Rspr. EuGH, Slg. 1973, 897 – Hauptzollamt Bremerhaven / Massey-Ferguson; EuGH, Slg. 1975, 1363 – Gutachten 1 / 75, Lokale Kosten; EuGH, Slg. 1976, 1921 (1936) – Donckerwolcke; Hahn, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 133 EGV Rdnr. 6 m. w. N. Breitenmoser / Husheer, Europarecht II, S. 594; Müller-Huschke, in: Schwarze, EU-Kommentar, Vorbem. Art. 131 – 134 EGV Rdnr. 9 f. 166 EuGH, Slg. 1975, 1355 (1363) – Gutachten 1 / 75, Lokale Kosten. 167 EuGH, Slg. 1975, 1355 (1363) – Gutachten 1 / 75, Lokale Kosten. 162 163
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
67
sche Vorschriften zu unterbinden sind. Eine parallele Zuständigkeit würde zudem bedeuten, dass die Mitgliedstaaten in den Beziehungen mit Drittländern eine den Absichten der Gemeinschaft zuwiderlaufende Haltung einnehmen könnten; „damit würde das institutionelle Zusammenspiel verfälscht, das Vertrauensverhältnis innerhalb der Gemeinschaft erschüttert und die Gemeinschaft gehindert, ihre Aufgabe zum Schutz des Gemeinsamen Interesses zu erfüllen.“168 Damit besteht auf Gemeinschafts- wie auf internationaler Ebene keine Zuständigkeit der Mitgliedstaaten neben der Zuständigkeit der Gemeinschaft; die Gemeinschaftskompetenz ist eine ausschließliche.169 Hervorzuheben ist, dass die Ausschließlichkeit der Gemeinschaftskompetenz nicht aus der Ausübung ihrer Zuständigkeiten resultiert, vielmehr ist die Ausschließlichkeit von vornherein gegeben, sie folgt aus dem Sinn und Zweck der Regelung und besteht damit a priori.170 Aus dem Wortlaut des Art. 133 EG ist zwar kein klarer Hinweis auf die Ausschließlichkeit abzuleiten. Dass die Kompetenz nach Art. 133 EG ihrem Sinn und Zweck nach ausschließlicher Natur ist, ist jedoch ständige Rechtsprechung und in der Literatur unbestritten. Fraglich bleibt daher, ob aus anderen Bestimmungen des Vertrages ebenfalls eine ausschließliche Kompetenz hergeleitet werden kann und aufgrund welcher Kriterien dies geschehen könnte.171
c) Assoziierungsabkommen, Art. 310 EG Durch die Möglichkeit von Assoziierungen wurde eine besondere Form vertraglicher Beziehungen zu Drittstaaten geschaffen. Hierbei ist zwischen vertraglichen Assoziierungsabkommen, nämlich solchen zwischen der EG und beliebigen Drittstaaten, und konstitutionellen Assoziierungsabkommen, nämlich zwischen der EG und ehemaligen Kolonialgebieten der Mitgliedstaaten (Art. 182 EG172), zu unterscheiden.
EuGH, Slg. 1975, 1355 (1363) – Gutachten 1 / 75, Lokale Kosten. Auch die oben genannten Rohstoffabkommen sind sektorale handelspolitische Instrumente im Sinne des Art. 133 EG und damit grundsätzlich der ausschließlichen Zuständigkeit der Gemeinschaft zuzuordnen. Nur wenn die finanziellen Beiträge zu der Rohstofforganisation statt von der EG von den Mitgliedstaaten geleistet werden sollen, fallen die betreffenden Abkommen nicht mehr unter die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft sondern müssen als gemischte Abkommen abgeschlossen werden, EuGH, Slg. 1979, 2871 – Gutachten 1 / 79, Naturkautschuk-Abkommen. 170 Koutrakos, YEL 2003, 407 (409). 171 Tridimas / Eeckhout, YEL 1994, 143 (164). 172 s. unten, d). 168 169
5*
68
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
aa) Begriff und Rechtsnatur von Assoziierungsabkommen Die Regelungen über die Assoziierung nach Art. 310 EG ermöglichen der Gemeinschaft, völkerrechtliche Verträge abzuschließen, die über handelspolitische Vereinbarungen auf der Grundlage von Art. 133 EG hinausgehen.173 Bei einem Assoziierungsabkommen handelt es sich um einen völkerrechtlichen Vertrag, der besondere und privilegierte Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und einem oder mehreren Drittstaaten (oder einer internationalen Organisation) schafft.174 Diese Beziehungen sind allerdings unterhalb der Stufe einer Vollmitgliedschaft angesiedelt. Durch diesen Vertrag werden gegenseitige Rechte und Pflichten begründet. Zudem werden in der Regel eigene, paritätisch besetzte Organe geschaffen, die für die Vertragsparteien bindende Entscheidungen treffen können. Diese Organe sollen den Prozess der Assoziierung lenken und weiterentwickeln. Dem EuGH zufolge dienen Assoziierungsabkommen dazu, „besondere und privilegierte Beziehungen“ zu einem Drittland zu schaffen, wobei der Assoziationspartner „zumindest teilweise am Gemeinschaftssystem teilhaben muss“.175 Nach der Rechtsprechung des EuGH bilden die Assoziierungsabkommen einen integrierenden Bestandteil der Gemeinschaftsrechtsordnung.176 Ob einzelne Bestimmungen der Assoziierungsabkommen unmittelbar anwendbar sind, hängt von der Auslegung des Abkommens im Einzelfall ab. Auch die von den jeweiligen Beschlussgremien geschaffenen Rechtsakte sind hinsichtlich ihrer unmittelbaren Anwendbarkeit auszulegen. So hat der EuGH mehrfach die unmittelbare Anwendbarkeit von Assoziationsratsbeschlüssen bejaht.177 bb) Arten von Assoziierungsabkommen Die Terminologie im Rahmen des Art. 310 EG ist uneinheitlich. Es wird von Assoziierungsabkommen ebenso wie von Kooperationsabkommen gesprochen (obwohl diese auch auf Art. 133 i.V.m. Art. 308 EG beruhen können). Je nach Intention der Vertragsparteien wird zwischen Beitrittsassoziierungen, Freihandelsassoziierungen und Entwicklungsassoziierungen unterschieden. Beitrittsassoziierungen sind Abkommen, die einen künftigen Beitritt eines europäischen Staates zur EU vorbereiten sollen. Als ein solches Abkommen gilt beispielsweise das Assoziierungsabkommen zwischen der EG und Griechenland von 1961178 sowie das Abkommen mit der Türkei aus dem Jahre 1963179. Bieber / Epiney / Haag / Beutler, Die EU Rechtsordnung und Politik, S. 720. Schmalenbach, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 310 EGV Rdnr. 1. 175 EuGH, Slg. 1987, 3719 (Rdnr. 9) – Demirel . / . Stadt Schwäbisch Gmünd. 176 EuGH, Slg. 1987, 3791 (Rdnr. 7) – Demirel . / . Stadt Schwäbisch Gmünd. 177 Z. B. Assoziationsratsbeschluss EG-Türkei Nr. 1 / 80 – hinsichtlich der Rechtsstellung türkischer Arbeitnehmer, vgl. dazu nur etwa EuGH, Slg.1990, I-3461 (Rdnr. 13 ff.) – Sevince; EuGH, Slg. 1992, I-6781 (Rdnr. 27 ff.) – Kus. 173 174
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
69
Freihandelsassoziierungen sind Abkommen, die der Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen und dem Abbau tarifärer und nichttarifärer Handelshemmnisse dienen. Als Beispiel kann hier das EWR-Abkommen180 aus dem Jahre 1992 genannt werden. Die Mitgliedstaaten der EG und der EFTA schlossen das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EG und der Freihandelszone der EFTA-Staaten zu harmonisieren. Im EWR gelten in weiten Teilen die Regeln des EG-Vertrages über die Marktfreiheiten und die Wettbewerbsregeln. Dagegen gibt es keine gemeinsamen Außenzölle, keine gemeinsame Agrar- und Handelspolitik und keine Harmonisierung der indirekten Steuern.181 Das erwähnte Abkommen trat zum 01. 01. 1994 in Kraft. Vertragspartner sind einerseits die EG und ihre Mitgliedstaaten und andererseits die Drittstaaten Norwegen, Island und Liechtenstein. Österreich, Schweden und Finnland haben zunächst als EFTA-Mitgliedstaaten unterzeichnet, sind aber mittlerweile selbst Mitgliedstaaten der EU geworden. Die Schweiz hingegen hat sich in einer Volksabstimmung gegen eine Mitgliedschaft im EWR ausgesprochen.182 Unter Entwicklungsassoziierungen versteht man Abkommen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung anderer Staaten. Hierzu gehört gemäß Art. 177 Abs. 1 EG die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Entwicklungsländer. Gemäß Art. 177 Abs. 2 EG soll die Zusammenarbeit zwischen EG und Entwicklungsstaaten aber auch „das allgemeine Ziel einer Fortentwicklung und Festigung der Demokratie und des Rechtsstaats sowie das Ziel der Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ erfassen. Diesen beiden Zielen dient die Zusammenarbeit der EG und ihrer Mitgliedstaaten mit Drittländern innerhalb internationaler Organisationen und auf spezieller vertraglicher Grundlage (Art. 181 EG).183 Nach dieser Vorschrift dürfen auch Klauseln über Menschenrechte und Demokratie in Entwicklungsabkommen mit Drittstaaten aufgenommen werden.184 Ein wichtiges Element der Entwicklungspolitik der EG ist das Abkommen von Cotonou vom 23. 06. 2000185, das Beziehungen zu den Staaten in Afrika, im kariAbkommen vom 09. 07. 1961, ABl. 1963, 294. Abkommen vom 12. 09. 1963, ABl. 1964, 3685. 180 Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten sowie der Republik Österreich, der Republik Finnland, der Republik Island, dem Fürstentum Liechtenstein, dem Königreich Norwegen, dem Königreich Schweden und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, BGBl. 1993 II, 2266 = ABl. 1994 L 1, 3. 181 Herdegen, Europarecht, S. 360 f. 182 Siehe zum ganzen auch Hobe, Europarecht, S. 25 ff.; mit der Schweiz wurde mittlerweile eine weniger tiefgreifende Assoziierung begründet (ABl. 2002, L 114, 6, hier beruht die Assoziierung auf sieben bilateralen Abkommen, die seit 01. 06. 2002 in Kraft sind). 183 Herdegen, Europarecht, S. 357. 184 EuGH, Slg. 1996, I-6177 (Rdnr. 23 ff.) – Kooperationsabkommen mit Indien. 178 179
70
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
bischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP-Staaten) knüpft. Sein Vorläufer, das Lomé-Abkommen, wurde erstmals 1975 in Lomé, der Hauptstadt von Togo, unterzeichnet und regelmäßig aktualisiert (Lomé I – IV). Im Juni 2000 wurde dann das Abkommen von Cotonou in der Hauptstadt von Benin (Cotonou) abgeschlossen. Bei dieser Gelegenheit schlossen sich sechs neue Länder aus dem Pazifikraum den AKP-Mitgliedern an, sodass es nun 77 AKP-Länder gibt. Das Abkommen soll ein integrierter und umfassender Ansatz für die Entwicklung der Länder und den Ausbau des Handels und gleichzeitig für die Beseitigung der Armut sein. Ein politischer Dialog soll die Themen Konfliktverhütung, Menschenrechte, Demokratisierung und Migration umfassen. Zu den wichtigsten Neuerungen des Abkommens von Cotonou gehören Sanktionen und Verfahren bei gravierenden Menschenrechtsverstößen und bei schwerwiegenden Korruptionsfällen auf Seiten der AKP-Länder.186 Die Kompetenz, solche Menschenrechtsklauseln in völkerrechtliche Verträge aufzunehmen, verleiht Art. 177 Abs. 2 i.V.m. Art. 181 EG, andernfalls wäre die Gemeinschaft nicht in der Lage, die in Art. 177 Abs. 2 EG ausdrücklich gesteckten Ziele (Fortentwicklung und Festigung der Demokratie und des Rechtsstaats, Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten) wirksam zu verfolgen.187 Die sogenannten Europa-Abkommen, die die Gemeinschaft Anfang der 90er Jahre mit 10 mittel- und osteuropäischen Ländern abgeschlossen hat, sind weder echte Beitrittsabkommen noch Entwicklungsabkommen. Ziel der Abkommen war es vielmehr, diese Staaten während der Umbruchphase an wichtige Grundprinzipien der Gemeinschaft heranzuführen.188 Zum einen wurde eine wechselseitige Öffnung der Märkte vereinbart (Handelsliberalisierung), zum anderen sollten die mittelund osteuropäischen Staaten ihre Rechtsordnung an gemeinschaftsrechtliche Standards anpassen.189 185 Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, unterzeichnet in Cotonou am 23. Juni 2000, ABl. 2000 L 317, 1; näher zur historischen Entwicklung Zimmermann / Martenczuk, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 177 EGV, Rdnr. 2 ff. 186 Vgl. vor allem Art. 96 des Abkommens, welcher im Fall der Verletzung der Menschenrechte, demokratischer Grundprinzipien und des Rechtsstaatsprinzips (Art. 9 des Abkommens) durch einen Vertragspartner zunächst ein Konsultationsverfahren vorsieht; ist dieses nicht erfolgreich darf der andere Vertragspartner Reaktionsmaßnahmen ergreifen, die Suspendierung des Abkommens soll allerdings nur ultima ratio sein (Art. 96 II c des Abkommens); ausführlich zur Entstehungsgeschichte und Typisierung von Menschenrechts- und Demokratieklauseln, Hoffmeister, Menschenrechts- und Demokratieklauseln in den vertraglichen Außenbeziehungen der Europäischen Gemeinschaft, S. 7 ff.; zu Menschenrechten im Rahmen der auswärtigen Beziehungen der EG vgl. Brandtner / Rosas, EJIL 1998, 468. 187 Ausdrücklich bestätigt durch EuGH, Slg. 1996, I-6177 Rdnr. 23 ff. – Portugal . / . Rat.; vgl. auch Zimmermann / Martenczuk, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 177 EGV, Rdnr. 25. 188 Herdegen, Europarecht, S. 358. 189 Müller-Graff, in: Heusel (Hrsg.), Die Osterweiterung der Europäischen Union, S. 21 (37) spricht von einer „Einschienung“. Vgl. die einzelnen Europaabkommen: ABl 1993
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
71
Über die genannten Sachgebiete hinaus kann Gegenstand eines Assoziierungsabkommens auch das Wettbewerbsrecht, die Rechtsangleichung, Verbraucherschutz, Gesundheitsschutz, Umweltschutz und die Koordination der Wirtschaftspolitik sein.190 Keine Kompetenz zum Abschluss von Assoziierungsabkommen steht der Gemeinschaft jedoch auf Gebieten zu, die in der Kompetenz der Mitgliedstaaten verblieben sind, etwa im Bereich der 2. und 3. Säule des EU-Vertrages. Art. 310 EG ist eine eigenständige Kompetenznorm. Ihre Bedeutung erschöpft sich nicht darin, die der EG ohnehin zustehenden Kompetenzen zu bündeln und spezielle Verfahren und Organe vorzusehen. Da nur die EG, nicht aber die Mitgliedstaaten dazu ermächtigt sind, eine Assoziation zwischen der Gemeinschaft einerseits und einem Drittland oder einer internationalen Organisation andererseits abzuschließen, handelt es sich bei Art. 310 EG um eine ausschließliche Kompetenz.191 Obwohl Art. 310 EG der Gemeinschaft – wie gerade dargestellt – eine ausschließliche Kompetenz verleiht, werden in der Praxis nahezu alle Assoziierungsverträge unter Beteiligung der Mitgliedstaaten, also als gemischte Verträge, abgeschlossen.192 Ein derartiges Verfahren ist rechtlich dann nötig, wenn sich das Assoziierungsabkommen (auch) auf andere als die durch den EG-Vertrag der Gemeinschaft zugewiesene Sachgebiete erstreckt193; angesichts der oftmals auftretenden Unsicherheiten bezüglich der Reichweite des Art. 310 EG werden Assoziierungsabkommen in der Praxis aber auch dann als gemischte Abkommen geschlossen, wenn dies rechtlich nicht nötig wäre.194 Durch dieses Verfahren treten die zwischen der EG und den Mitgliedstaaten bestehenden Kompetenzkonflikte nicht deutlich zu Tage und können damit auch keiner gerichtlichen Klärung zugeführt werden. Darüber hinaus bringt der Rückgriff auf gemischte Verträge die Gefahr der Aushöhlung der Gemeinschaftskompetenzen mit sich, da die Mitgliedstaaten aufgrund ihrer Beteiligung an den Vertragsverhandlungen und dem Vertragsschluss Kontrolle über die Vertragspraxis der Gemeinschaft ausüben können.195 L 347, 2 (Ungarn), 1993 L 348, 2 (Polen), 1994 L 359, 2 (Slowakei), 1994 L 360, 2 (Tschechien), 1994 L 357, 2 (Rumänien), 1994 L 358, 2 (Bulgarien). 190 Herrnfeld, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 310 EGV Rdnr. 5. 191 Mögele, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 300 EGV Rdnr. 23; Herrnfeld, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 310 EGV Rdnr. 5; a.A. Heessen, EuR 1980, 36 (39 f.); Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 177, der seine Ansicht mit der Integrationsfunktion der Assoziierungsabkommen begründet. 192 Koenig / Haratsch, Europarecht, S. 306. 193 Beispielsweise wenn das Assoziationsabkommen die Einrichtung eines politischen Dialogs vorsieht, der außerhalb der Gemeinschaftskompetenzen liegt, vgl. Eeckhout, External Relations of the European Union, S. 106. 194 Herrnfeld, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 310 EGV Rdnr. 6. 195 Herrnfeld, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 310 EGV Rdnr. 6.
72
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
d) Konstitutionelle Assoziierungsabkommen, Art. 182 EG Die oben schon angesprochenen konstitutionellen Assoziierungsabkommen betreffen außereuropäische Länder und Hoheitsgebiete, die mit den Mitgliedstaaten besondere Verbindungen unterhalten. Im Unterschied zu den Vertragsassoziierungen196 werden durch die konstitutionellen Assoziierungsabkommen keine Beziehungen zu anderen Völkerrechtssubjekten hergestellt, da die Überseeischen Länder und Hoheitsgebiete (ÜLG) selbst keine souveränen Staaten sind. Bei Abschluss der Römischen Verträge verfügten Belgien, Frankreich, Italien und die Niederlande noch teilweise über große Kolonialgebiete. Aufgrund der Dekolonialisierung in der Folgezeit erlangten immer mehr Kolonien staatliche Unabhängigkeit und schieden somit aus dem Anwendungsbereich des Art. 182 EG aus.197 Von den verbliebenen 21 ÜLG (meist ehemalige Kolonien der Mitgliedstaaten) gehören elf zum Vereinigten Königreich, sechs zu Frankreich, zwei zu den Niederlanden und eines zu Dänemark; sie werden im Anhang II zum EG-Vertrag genannt.198 Die überseeischen Länder und Hoheitsgebiete fallen gemäß Art. 299 Abs. 3 UAbs. 1 EG grundsätzlich nicht in den Geltungsbereich des EG-Vertrags.199 Faktisch besitzen sie daher den Status von Drittländern.200 Diese Länder sind jedoch keine souveränen Staaten und damit völkerrechtlich nicht handlungsfähig. Sie werden auf internationaler Ebene von ihren Mutterländern vertreten.201 In dieser Funktion treten die Mutterstaaten nicht als Mitgliedstaaten der EG in Erscheinung und sind damit nicht in ihren Außenkompetenzen durch den EG-Vertrag beschränkt.202 Das Assoziierungsverhältnis zwischen der EG und den überseeischen Gebieten wird durch den vierten Teil des EG-Vertrages begründet, und daher wird die Assoziierung in der Literatur auch konstitutionelle Assoziierung genannt. Die konstitutionelle Assoziierung bedarf keiner weiteren völkerrechtlichen Vereinbarung; ihre ausschließliche Rechtsgrundlage ist der EG-Vertrag.203 Die Art. 182 ff. EG dienen vor allem entwicklungspolitischen Zielen sowie dem Schutz der Einwohner und s. o. unter cc). Martenczuk / Zimmermann, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 182 EGV Rdnr. 1 f. 198 Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft (Nizza), ABl. 2002 C 325, 159. Hierzu gehören Grönland, Neukaledonien, Französisch-Polynesien, Französische Südund Antarktisgebiete, Wallis und Futuna, Mayotte, St. Pierre und Miquelon, Aruba, die Niederländischen Antillen, Anguilla, Kaimaninseln, Falklandinseln, Südgeorgien und südliche Sandwichinseln, Montserrat, Pitcairn, St. Helena, Britisches Antarktis-Territorium, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Turks- und Caicos-Inseln, Britische Jungferninseln, Bermuda. 199 Pitschas, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 182 EGV Rdnr. 4. 200 EuGH, Slg. 1994, I-5267 (Rdnr. 17) – Gutachten 1 / 94, WTO. 201 Schmalenbach, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 182 EGV Rdnr. 2. 202 EuGH, Slg. 1979, 2871 (Rdnr. 62) – Gutachten 1 / 78, Internationales Naturkautschuk Übereinkommen; EuGH, Slg. 1994, I-5267 (Rdnr. 17) – Gutachten 1 / 94, WTO. 203 Schmalenbach, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 182 EGV Rdnr. 3; Martenczuk / Zimmermann, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 182 EGV Rdnr. 6. 196 197
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
73
ihrer Kultur und der Förderung der Selbstregierung und Selbstbestimmung der Einwohner.204 Inhalt der Assoziierung ist unter anderem die Ausdehnung des Handelsregimes der Gemeinschaft auf die ÜLG. Dies bedeutet vor allem eine Einfuhrliberalisierung für Waren aus diesen Ländern in die EG, aber auch Privilegien im Handelsbereich, die über diejenigen der AKP-Staaten hinausgehen.205
e) Währungspolitik, Art. 111 EG Art. 111 EG regelt die Kompetenzen im Bereich der Währungsaußenbeziehungen. Die Vorschrift gilt gemäß Art. 116 Abs. 3 UAbs. 2 EG ab Beginn der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), mithin seit dem 01. 01. 1999. Diejenigen Staaten, die nicht an der gemeinsamen Währung teilnehmen, also Schweden, das Vereinigte Königreich und Dänemark, sind weiterhin währungspolitisch souverän.206 Die Vertragsparteien der Euro-Zone haben ihre Zuständigkeit für die Geldpolitik („Währungsinnenpolitik“) dem Europäischen System der Zentralbanken (ESZB) übertragen. Seit Eintritt der dritten Stufe der Währungsreform ist die Währungsaußenpolitik, also die Gestaltungsmacht der teilnehmenden Staaten über die Beziehung der gemeinsamen Währung zu anderen Währungen, vollständig auf die Gemeinschaft übergegangen.207 Damit begründet Art. 111 EG für die Gemeinschaft eine völkerrechtliche Vertragsabschlusskompetenz.208 Art. 111 EG wird überwiegend als ausschließliche Kompetenz verstanden.209 Diese wird zwar nicht explizit zugewiesen, ist aber Ergebnis einer teleologischen Auslegung der Vorschrift:210 Die Währungsinnenpolitik ist aufgrund der Zuweisung zum ESZB (Art. 105 Abs. 2 EG) und der Eingliederung der nationalen Zentralbanken in die EZB eine ausschließliche. Würde diese Kompetenz nicht durch eine ausschließliche Außenkompetenz der EG ergänzt, könnten die Mitgliedstaaten 204 Pitschas, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 182 EGV Rdnr. 12 ff.; Schmalenbach, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 182 EGV Rdnr. 4 ff. m. w. N. 205 Martenczuk / Zimmermann, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 183 EGV Rdnr. 2; zur Rolle des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) siehe Rdnr. 4 ff. 206 Kempen, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 111 EGV Rdnr. 1. 207 So Weiß, EuR 2002, 165 (173) und Potacs, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 111 EG Rdnr. 4. Kempen, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 111 EG Rdnr. 2 verweist hingegen auf den Vorbehalt des Abs. 5. Zur Frage, ob die Kompetenzen auf die Gemeinschaft oder auf die EZB übertragen wurden Weiß, EuR 2002, 165 (168). 208 Weiß, EuR 2002, 165 (172); Kempen, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 111 EGV Rdnr. 2. 209 Martenczuk, ZaöRV 1999, 93 (105); Weiß, EuR 2002, 165 (173 ff.); a.A. Zilioli / Selmayr, CMLR 1999, 273 (297); Kempen, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 111 EGV Rdnr. 17. 210 Siehe zur Diskussion Weiß, EuR 2002, 165 (174 ff.); so wohl auch Selmayr, Das Recht der Wirtschafts- und Währungsunion I, S. 262 f.
74
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
durch völkerrechtliches Handeln die ausschließliche Innenkompetenz der Gemeinschaft vereiteln, denn der Vorrang des EG-Rechts im Innenverhältnis gilt nicht im Verhältnis zu Drittstaaten. Eine ausschließliche Außenkompetenz dient damit der Einheitlichkeit und Wirksamkeit der EG-Rechtsordnung. Ferner spricht Art. 4 Abs. 2 EG von einer „einheitlichen Geld- sowie Wechselkurspolitik“, die aber ein Auftreten nach außen mit einer Stimme erfordert. Dies ist nur mittels einer ausschließlichen Kompetenz für die Gemeinschaft gewährleistet. Für eine solche spricht auch der ähnliche Wortlaut des Art. 111 Abs. 3 EG und des Art. 133 Abs. 3 EG, wobei letzterer nach allgemeiner Meinung die ausschließliche Kompetenz der Gemeinschaft im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik zum Ausdruck bringt. Art. 111 Abs. 3 EG ist mit der Formulierung „Vereinbarungen im Zusammenhang mit Währungsfragen und Devisenregelungen“ weiter gefasst, während Art. 111 Abs. 1 EG als lex specialis „förmliche Vereinbarungen über ein Wechselkurssystem“ erfasst.
aa) Förmliche Wechselkursvereinbarungen mit Drittstaaten (Abs. 1) In Art. 111 Abs. 1 S. 1 EG wird die Etablierung eines Wechselkurssystems geregelt, während die Sätze 2 und 3 des Art. 111 Abs. 1 EG die Festlegung, Änderung oder Aufgabe von Euro-Leitkursen innerhalb eines bereits etablierten Wechselkurssystems zum Gegenstand haben.211 Unter einem Wechselkurssystem ist ein völkerrechtlicher Vertrag zu verstehen, dessen Ziel es ist, Währungsschwankungen zu vermeiden oder zumindest in einem vorher festgelegten Rahmen zu halten. Dabei dienen die Leitkurse dazu, die Grenzen zu bestimmen, jenseits derer die jeweiligen Staaten zur Intervention an den Devisen- und Finanzmärkten verpflichtet sind. Ein solches Abkommen ist bislang jedoch noch nicht geschlossen worden.
bb) Vereinbarungen auf dem Gebiet der Währungspolitik (Abs. 3) Die allgemeinere Vorschrift ist, systematisch wenig geglückt, in Art. 111 Abs. 3 EG zu finden. Sie weist die Verbandskompetenz zur Verhandlung und zum Abschluss aller völkerrechtlichen Vereinbarungen und sonstigen völkerrechtlich relevanten Rechtsakte mit Drittstaaten212 auf dem Gebiet der Währungspolitik der Gemeinschaft zu. Der Rat beschließt abweichend von Art. 300 EG mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung der EZB die Modalitäten für den Abschluss solcher Vereinbarungen. Diese Modalitäten sollen gewährleisten, dass die Gemeinschaft einen einheitlichen Standpunkt vertritt. Kempen, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 111 EGV Rdnr. 4. Unter Drittstaaten sind jedoch nicht (auch) diejenigen Mitgliedstaaten der EU zu verstehen, die nicht an der gemeinsamen Währung teilnehmen, denn Art. 111 EG verweist auf „Staaten“, nicht auf „Mitgliedstaaten“, Weiß, EuR 2002 165 (172, Fn. 40). 211 212
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
75
Auf der Grundlage von Art. 111 Abs. 3 EG hat sich bislang noch keine umfangreiche völkerrechtliche Praxis entwickelt, der Rat hat jedoch in einigen Fällen die Modalitäten für die währungspolitische Zusammenarbeit mit Drittstaaten geregelt.213 cc) Verbliebene Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten (Abs. 5) Nach Art. 111 Abs. 5 EG haben die Mitgliedstaaten das Recht, unbeschadet der Gemeinschaftszuständigkeit in internationalen Gremien Verhandlungen zu führen und völkerrechtliche Vereinbarungen zu treffen. Geht man wie hier davon aus, dass es sich bei Art. 111 EG um eine ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft handelt, dann haben die Mitgliedstaaten mit Eintritt in die dritte Stufe ihre Währungssouveränität – nach innen wie nach außen – vollständig an die Gemeinschaft verloren. Anders als man vom Wortlaut ausgehend zunächst annehmen könnte, gibt Abs. 5 daher den Mitgliedstaaten lediglich einen sehr eng begrenzten Handlungsspielraum. Fragen betreffend die Währungsunion sind hiervon ausgeschlossen. Abs. 5 kann sich daher nur auf vor Eintritt in die dritte Stufe der Währungsunion abgeschlossene völkerrechtliche Vereinbarungen auf währungspolitischem Gebiet beziehen, da diese mit dem Eintritt der dritten Stufe der Währungsreform weder automatisch erloschen sind noch die Gemeinschaft in diese eingetreten ist.214 Im Rahmen dieser „Altverträge“ müssen die Mitgliedstaaten wiederum die Kompetenzen der EG beachten und dürfen keine den EG-Maßnahmen widersprechenden Akte ergreifen, sondern müssen hinsichtlich ihrer sachlichen Entscheidungen den Vorgaben der EG folgen.215 Festzuhalten bleibt, dass der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Währungsaußenpolitik die ausschließliche Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Abkommen zusteht. f) Entwicklungszusammenarbeit, Art. 177 – 181 EG aa) Überblick Titel XX des EG-Vertrags regelt die gemeinschaftliche Entwicklungspolitik.216 Hierbei steht der Gemeinschaft eine Vielzahl von Handlungsformen zur Ver213 Vgl. etwa die Entscheidungen des Rates vom 23. 11. 1998 über Wechselkursfragen in Zusammenhang mit dem CFA-Franc und dem Komoren-Franc, ABl. 1998 L 320, 58 und die Entscheidungen zum Kap-Verde-Escudo, ABl. 1998 L 358, 11, sowie zu Monaco, San Marino und Vatikanstadt, ABl. 1999 L 30, 31 ff.; Kempen, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 111 Rdnr. 12 a. E. 214 Z. B. die an der einheitlichen Währung im Rahmen des IWF teilnehmenden Mitgliedstaaten, Potacs, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 111 EGV Rdnr. 4. 215 Weiß, EuR 2002, 165 (181, 191). 216 Einen kurzen informativen Überblick über die historische Entwicklung der gemeinsamen Entwicklungspolitik gibt Zimmermann, RIW 2004, 324 f.
76
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
fügung. Mutilaterale oder bilaterale völkerrechtliche Verträge spielen die Hauptrolle. Wie schon oben erwähnt enthalten einige auf Art. 310 EG gestützte Assoziierungsabkommen entwicklungspolitische Zielsetzungen. Als weitere Handlungsform stehen Kooperationsabkommen zur Verfügung. Solche Abkommen wurden z. B. mit den ASEAN-Gründungsstaaten217 (Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur und Thailand), mit China218, Indien219, Pakistan220, mit der Andengemeinschaft221 und seinen Mitgliedstaaten (Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Peru und Venezuela), mit dem Mercosur222 und seinen Teilnehmerstaaten (Argentinien, Brasilien Paraguay, Uruguay) und mit vielen weiteren Ländern abgeschlossen.223 Die EG kann auch völkerrechtlichen Übereinkünften beitreten. Diese Möglichkeit wurde oftmals zur Stabilisierung von Rohstoffpreisen genutzt.224 Ferner kann die Gemeinschaft auch ohne den Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages unilateral Hilfsprogramme ins Leben rufen. Solche Hilfsprogramme existieren etwa in den Bereichen der Ernährungssicherung und der Bevölkerungspolitik. Die EG gewährt überdies humanitäre Hilfe sowie Katastrophenhilfe und legt Programme zur Förderung des Umweltschutzes225 oder zur Bekämpfung des Drogenhandels226 auf. Die Entwicklungspolitik der Gemeinschaft wird schließlich durch die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und Nichtregierungsorganisationen (Art. 179, 302 EG) abgerundet. Ziele der Entwicklungszusammenarbeit sind die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung, die harmonische und schrittweise Eingliederung in die Weltwirtschaft, die Bekämpfung der Armut sowie die Einführung und Stärkung der Demokratie, des Rechtsstaats, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten.227 Bei der Entwicklungshilfepolitik der Gemeinschaft handelt es sich um eine Parallelkompetenz, nicht um eine ausschließliche Kompetenz der GemeinABl. 1980 L 144, 1. ABl. 1997 C 158, 42. 219 ABl. 1994 L 223, 23. 220 ABl. 1986 L 108, 1. 221 ABl. 1998 L 127, 11. 222 ABl. 1996 L 69, 4. 223 Weitere Nachweise bei Schmalenbach, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 181 EGV Fn. 6. 224 Internationales Naturkautschuk-Übereinkommen von 1995, ABl. 1996 L 324, 1; Internationales Kakao-Übereinkommen von 1993 ABl. 1994 L 52, 25; Internationales Zuckerübereinkommen von 1992 ABl. 1992 L 379, 15; Internationales Tropenholzübereinkommen von 1994 ABl. 1996 L 208, 1. 225 VO (EG) Nr. 722 / 97 des Rates vom 25. 04. 1997 über Umweltaktionen in den Entwicklungsländern, ABl. 1997 L 108, 1. 226 VO (EG) Nr. 2046 / 97 des Rates vom 21. 10. 1997 über die Nord-Süd-Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Drogen und Drogenabhängigkeit, ABl. 1997 L 287, 1. 227 Hierzu ausführlich Pitschas, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 177 EGV Rdnr. 12 ff. 217 218
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
77
schaft.228 Hierbei sollten sich die Politiken der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten möglichst ergänzen, was mit Hilfe eines umfassenden Koordinierungsprozesses gewährleistet werden soll (Art. 180 EG).229 bb) Art. 179 Abs. 1 EG Art. 179 Abs. 1 EG ermächtigt die EG zu Maßnahmen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Unter diesen Begriff fallen alle autonomen Instrumente der Entwicklungspolitik (z. B. die o.g. Hilfsprogramme) und Durchführungsmaßnahmen zu völkerrechtlichen Verträgen. Völkerrechtliche Abkommen selbst sind jedoch nicht von Art. 179 Abs. 1 EG erfasst, sondern von dem spezielleren Art. 181 EG.230 Die zu beschließenden Maßnahmen müssen inhaltlich den Zielen des Art. 177 EG entsprechen. Liegt der materielle Schwerpunkt der Maßnahme in anderen Politikbereichen (etwa der Handelspolitik), so sind andere Kompetenzvorschriften (etwa Art. 133 EG) einschlägig („unbeschadet der übrigen Bestimmungen“). cc) Art. 180 EG Art. 180 EG statuiert eine Koordinationspflicht zwischen den Mitgliedstaaten und der EG. Zudem wird deutlich, dass der EG auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit keine ausschließliche, sondern lediglich eine parallele Kompetenz zusteht, da Art. 180 EG gemeinsame Maßnahmen ermöglicht und dabei die Koordination der Maßnahmen fordert.231 Eine ausschließliche Kompetenz liegt nur dann vor, wenn der materielle Kern der Maßnahme z. B. in den Bereich der Handels- oder Agrarpolitik fällt. In diesem Fall ist aber bereits eine andere Ermächtigungs- beziehungsweise Kompetenzgrundlage einschlägig. Art. 180 Abs. 1 EG postuliert eine Pflicht zur Rücksichtnahme und gegenseitigen Abstimmung der jeweiligen Aktionen auf dem Gebiet der Entwicklungspolitik und ist damit eine spezielle Ausformung des in Art. 10 EG enthaltenen allgemeinen Gebotes der Gemeinschaftstreue.232 Beide Seiten sind verpflichtet, alle Maßnahmen zu unterlassen, die bestehenden Verträgen widersprechen könnten. Hat die 228 EuGH, Slg. 1994, I-653 (Rdnr. 26) – Parlament . / . Rat; Pitschas, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 177 EGV Rdnr. 28; Dashwood, ELRev 1998, 201 (212) „national and Union competencies are almost perfectly parallel“. 229 Siehe auch Zimmermann / Martenczuk, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 177 EGV Rdnr. 15. 230 Art. 179 Abs. 1 EG ist damit eine „Auffangvorschrift“ für alle anderen Maßnahmen, vgl. Pitschas, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 179 EG Rdnr. 7 a. E. 231 GA La Pergola, Schlussantrag zu EuGH, Slg. 1996, I-6177 (Rdnr. 16) – Portugal . / . Rat. 232 Zimmermann / Martenczuk, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 180 EGV Rdnr. 1.
78
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Gemeinschaft ein Entwicklungshilfeabkommen geschlossen, dürfen die Mitgliedstaaten die in diesem Abkommen enthaltenen Vereinbarungen nicht konterkarieren.233 Diese Koordinierungspflicht führt indirekt zu einer inhaltlichen Festlegung der Entwicklungshilfepolitik der Mitgliedstaaten, da deren Politik nicht derjenigen der Gemeinschaft widersprechen darf.234 Das Koordinierungsgebot hat in der Praxis oft zum Abschluss gemischter Abkommen geführt.235 Aus der parallelen Kompetenz folgt die Anwendbarkeit des Subsidiaritätsprinzips (Art. 5 Abs. 2 EG). Bei jeder Maßnahme ist zu prüfen, ob ihre Ziele auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können. In concreto stellt sich meist die Frage, ob eine entwicklungspolitische Maßnahme bei parallelem Tätigwerden die Mittel einzelner Mitgliedstaaten übersteigt.236 Nach Art. 180 Abs. 1 S. 2 EG können die Mitgliedstaaten und die EG gemeinsame Maßnahmen ergreifen. Diese Kooperationsmöglichkeit ist in das Ermessen der Beteiligten gestellt. Gemeinsame Maßnahmen können im faktischen gemeinsamen Vorgehen oder im Abschluss gemischter Abkommen mit Drittstaaten bestehen.237 Das Verfahren richtet sich dann nach den jeweils einschlägigen Vorschriften (Art. 181 Abs. 1 EG i. V. m. Art. 300 EG). dd) Art. 181 EG Die eigentliche Kompetenzgrundlage im Bereich der Entwicklungspolitik für ein Tätigwerden der Gemeinschaft nach außen, insbesondere zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge, stellt Art. 181 Abs. 1 S. 2 EG dar.238 Dieser bestimmt ausdrücklich, dass die Zusammenarbeit der Gemeinschaft mit Drittländern oder internationalen Organisationen Gegenstand völkerrechtlicher Abkommen sein kann. Die Ziele solcher Abkommen müssen denen des Art. 177 EG entsprechen. Solange diese Ziele der wesentliche Gegenstand des Abkommens sind, schadet auch die Einfügung von Menschenrechtsklauseln239 (Art. 177 Abs. 2 EG) und die Regelung besonderer Bereiche der Zusammenarbeit (Energie, Kultur, Drogenbekämpfung usw.) nicht der Qualifizierung als Abkommen i. S. d. Art. 181 Abs. 1 S. 2 EG. Im 233 Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 176. 234 Zimmermann / Martenczuk, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 177 EGV Rdnr. 14. 235 Pitschas, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 181 EGV Rdnr. 12; Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 177. 236 Schmalenbach, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 180 EGV Rdnr. 2. 237 Schmalenbach, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 180 EGV Rdnr. 8. 238 Zimmermann / Martenczuk, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 181 EGV Rdnr. 4. 239 EuGH, Slg. 1996, I-6177 (Rdnr. 24 ff.) – Portugal . / . Rat.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
79
letzteren Fall dürfen die Bestimmungen allerdings keine allgemeine Ermächtigung zur Ergreifung von Maßnahmen außerhalb der Zielsetzungen des Art. 177 EG enthalten.240 Auf der Ermächtigungsgrundlage des Art. 181 Abs. 1 S. 2 EG sind bereits viele Kooperationsabkommen mit entwicklungspolitischen Inhalten abgeschlossen worden.241 Nach der Querschnittsklausel des Art. 178 EG müssen die Ziele der Entwicklungspolitik der Gemeinschaft bei allen Maßnahmen der EG, also z. B. auch bei völkerrechtlichen Verträgen mit anderen Schwerpunkten, etwa auf dem Gebiet der Handels-, Umwelt- oder Agrarpolitik, berücksichtigt werden. Zusätzlich verpflichtet Art. 3 Abs. 2 EU die Union zur Achtung der Kohärenz aller außenpolitischen Maßnahmen im Rahmen der Außen-, Sicherheits-, Wirtschaftsund Entwicklungspolitik. Befasst sich also der Rat mit Fragen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, muss er die entwicklungspolitischen Zielsetzungen des Art. 177 EG berücksichtigen.242 Der EG steht im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten nur eine parallele Zuständigkeit zu; dies stellt Art. 181 Abs. 2 EG klar. Daher können sowohl die Mitgliedstaaten als auch die EG völkerrechtliche Verträge aushandeln und abschließen. Eine Grenze der parallelen Kompetenz liegt für die Mitgliedstaaten in dem Grundsatz der Effektivität des Gemeinschaftsrechts. Dort wo die völkerrechtlichen Aktivitäten der Mitgliedstaaten interne entwicklungspolitische Gemeinschaftsrechtsnormen beeinträchtigen können, endet die Kompetenz der Mitgliedstaaten. 243 Dies führt jedoch nicht dazu, dass bereits aufgrund der bloßen Möglichkeit einer Kollision von entwicklungspolitischen Abkommen der EG einerseits und der Mitgliedstaaten andererseits der Europäischen Gemeinschaft eine ausschließliche Kompetenz zukommt.244 ee) Art. 181 Abs. 2 EG – scheinbarer Widerspruch zur AETR-Rechtsprechung (paralleles Problem im Rahmen des Art. 181 a EG) Nach Art. 181 Abs. 2 EG berührt Art. 181 Abs. 1 EG nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien zu verhandeln und internationale Abkommen zu schließen. Demgemäß sollen die Vertragsschlusskompetenzen der Gemeinschaft und die der Mitgliedstaaten nebeneinander bestehen. Fraglich ist jedoch, was in diesem Zusammenhang die Erklärung Nr. 10 der Regierungskonferenz von Maastricht bedeutet. Hierin wurde bestimmt, dass Art. 181 Abs. 2 EG (sowie Art. 174 Abs. 2 EG und Art. 111 EG) „nicht die Grundsätze berühren, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs in der AETR-Rechtssache ergeben“. Nach 240 EuGH, Slg. 1979, 2871 (Rdnr. 56) – Gutachten 1 / 78, Internationales NaturkautschukÜbereinkommen; EuGH, Slg. 1996, I-6177 (Rdnr. 39) – Portugal . / . Rat. 241 S. oben, aa. 242 Schmalenbach, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 178 EGV Rdnr. 4. 243 Allg.: EuGH, Slg. 1971, 263 (Rdnr. 21 f.) – AETR. 244 Schmalenbach, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 181 EGV Rdnr. 6.
80
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
der AETR-Rechtsprechung geht die konkurrierende Außenkompetenz der Mitgliedstaaten in eine ausschließliche Kompetenz für die Gemeinschaft über, wenn die EG ihre innergemeinschaftlichen Kompetenzen wahrgenommen (aktualisiert) hat. Nachdem also die Gemeinschaft intern tätig geworden ist, kann es keine parallele Zuständigkeit der Mitgliedstaaten mehr geben245. Der scheinbare Widerspruch zwischen Art. 181 Abs. 2 EG, wonach ein paralleles Tätigwerden der Gemeinschaft einerseits und der Mitgliedstaaten andererseits möglich ist, und den AETRGrundsätzen kann jedoch aufgelöst werden.246 Zum einen handelt es sich bei der Entwicklungszusammenarbeit grundsätzlich um eine nach außen gerichtete Kompetenz, sodass die AETR-Rechtsprechung, die sich vor allem auf die Wahrnehmung der Innenkompetenz bezieht, nicht zur Anwendung kommt. Zum anderen dürfte die in der Erklärung der Regierungskonferenz geforderte Anwendung der AETR-Rechtsprechung im Hinblick auf Art. 181 EG den Sinn haben, dass, bei der Inanspruchnahme anderer Innenkompetenzen durch die Gemeinschaft, diese Rechtsprechung nicht durch Art. 181 Abs. 2 EG eingeschränkt wird. Kommt der Gemeinschaft also beispielsweise durch die Inanspruchnahme der Innenkompetenzen im Bereich der Landwirtschaft damit auch die ausschließliche Außenkompetenz zu, so kann dies durch Art. 181 Abs. 2 EG nicht wieder rückgängig gemacht werden.247 Zudem bedeutet die Bezugnahme auf die AETR-Rechtsprechung, dass die Mitgliedstaaten bei sich überschneidenden Zuständigkeiten im Rahmen von gemischten Abkommen gegenüber Dritten keine Verpflichtungen mehr eingehen dürfen, die die Durchführung dieses Teils des Gemeinschaftsrechts betreffen, wenn die Gemeinschaft zuvor dieses Rechtsgebiet durch Sekundärrechtsakte geregelt hat.248 In derselben Weise ist die Erklärung Nr. 10 der Regierungskonferenz von Maastricht in Bezug auf Art. 181 a EG zu verstehen. g) Wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten, Art. 181 a EG Art. 181 a EG ist eine durch den Vertrag von Nizza neu eingefügte Bestimmung.249 Der Artikel regelt die wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittländern. Bis zum Vertrag von Nizza war eine solche Zusammenarbeit nur mit Entwicklungsländern im Sinne von Art. 177 Abs. 1 EG möglich. Andere Länder, die aus politischen oder ökonomischen Gründen nicht als Entwick245 246 247 248 249
Ausführlich zu dieser Rechtsprechung unten, § 4 VI. 2. d). Zimmermann / Martenczuk, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 181 EGV Rdnr. 6. Zimmermann / Martenczuk, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 181 EGV Rdnr. 6. Pitschas, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 181 a EGV Rdnr. 25. Vgl. auch Zimmermann, RIW 2004, 324 (325).
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
81
lungsländer bezeichnet werden konnten, konnten nur mit Hilfe des Art. 308 EG (Vertragslückenschließungsverfahren) durch einstimmigen Ratsbeschluss Vertragspartner einer solchen Zusammenarbeit werden.250 Damit ist Art. 181 a EG künftig die Kompetenzgrundlage für wirtschaftliche, finanzielle und technische Hilfen der Gemeinschaft im Außenverhältnis, z. B. für Programme der Gemeinschaft für Mittel- und Osteuropa (TACIS251, PHASE252) sowie für den Mittelmeerraum (MEDA253).254 Für den Abschluss völkerrechtlicher Verträge ist Art. 181 a Abs. 3 UAbs. 1 S. 2 EG die spezielle Kompetenzgrundlage. Für alle anderen Maßnahmen, also gemeinschaftliche Rechtsakte (Art. 249 EG) und andere Handlungsformen auf sekundärrechtlicher Ebene ist Art. 181 a Abs. 1 UAbs. 1 S. 1 EG die einschlägige Kompetenzgrundlage. Wesentlicher Gegenstand der völkerrechtlichen Abkommen i. S. d. Art. 181 a Abs. 3 UAbs. 1 S. 2 EG muss die wirtschaftliche, finanzielle oder technische Hilfe für Drittländer sein; stellen diese Ziele lediglich einen Teil eines Assoziierungs-, Kooperations- oder Handelsabkommens dar, gelten die jeweiligen speziellen Kompetenzgrundlagen (Art. 310, 181 oder 133 EG). Art. 181 a Abs. 3 EG sieht zusätzlich eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Organisationen vor. Für die Zusammenarbeit mit dem Europarat und der OECD sind jedoch die Art. 303, 304 EG die spezielleren Vorschriften. Aufgrund der in Art. 181 a Abs. 3 S. 3 EG enthaltenen Unberührtheitsklausel ergibt sich eine Parallelkompetenz zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten und damit eine kumulative oder parallele Vertragsschlusskompetenz. Es gelten die für Art. 181 EG dargestellten Probleme auch im Rahmen von Art. 181 a EG. h) Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschung, Art. 170 EG i.V.m. 164 lit. b EG aa) Überblick Art. 170 EG räumt der Gemeinschaft eine ausdrückliche Zuständigkeit auf dem Gebiet der Außenbeziehungen ein.255 Art. 170 EG nimmt die Vorschrift des Art. 164 lit. b EG auf und ermächtigt die Gemeinschaft zu Maßnahmen zur Förde250 Z. B. VO (EG) Nr. 753 / 96 des Rates vom 22. April 1996 – Wirtschaftshilfe für Bosnien-Herzegowina. 251 VO (EWG) Nr. 2157 / 91, ABl. 1991 L 201, 2. 252 VO (EWG) Nr. 3906 / 89, ABl. 1989 L 375, 11. 253 VO (EWG) Nr. 1763 / 92, ABl. 1992 L 181, 5. 254 Schmalenbach, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 181 a EGV Rdnr. 2. 255 Trute, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 170 EGV Rdnr. 1.
6 Metz
82
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
rung der Zusammenarbeit mit dritten Ländern und internationalen Organisationen auf dem Gebiet der gemeinschaftlichen Forschung und technologischen Entwicklung.256 Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaft und zur Verbesserung der wissenschaftlich-technologischen Grundlagen soll eine selektive Zusammenarbeit mit Drittstaaten gefördert werden.257 Hierbei soll die Wissenschaft zur Lösung regionaler und weltweiter Probleme und zur Verbesserung der Lage in den mittel- und osteuropäischen Ländern beitragen. Die Forschungszusammenarbeit befindet sich dabei in Zielkonkurrenz zu anderen Gemeinschaftspolitiken. So beschränkt das in Art. 5 EG festgeschriebene Subsidiaritätsprinzip die Aktivitäten der Gemeinschaft. Aufgaben, die von der Privatwirtschaft besser wahrgenommen werden können, dürfen nicht von der öffentlichen Hand übernommen werden, und Aufgaben, die auf nationaler Ebene besser erfüllt werden können, sollen nicht auf Gemeinschaftsebene erfüllt werden.258 Auch mit dem Wettbewerbsrecht bestehen Zielkonflikte. So wird die Wettbewerbsposition von Firmen, die aufgrund von Forschungsprogrammen finanzielle Förderungen enthalten, gegenüber anderen Unternehmen deutlich verbessert. Die internationale Forschungszusammenarbeit ist auch ein Teil der gemeinschaftlichen Außenpolitik. So werden wissenschaftliche Projekte mit solchen Drittstaaten gefördert, mit denen eine Zusammenarbeit politisch gewünscht ist, auch wenn der wissenschaftliche Ertrag als gering einzustufen ist. Umgekehrt setzen außenpolitische Zwänge oder Interessen wissenschaftlich besonders reizvollen Projekten Grenzen.
bb) Internationale Zusammenarbeit und völkerrechtliche Verträge Nach Art. 170 UAbs. 1 EG kann die Gemeinschaft bei der Durchführung des mehrjährigen Rahmenprogramms eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der gemeinschaftlichen Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration mit dritten Ländern oder internationalen Organisationen vorsehen. Art. 170 EG gibt somit der Gemeinschaft eine explizite Zuständigkeit für die Außenbeziehungen im Bereich Forschung und technologische Entwicklung.259 Die Vorschrift betrifft jedoch nur die Durchführung eines bereits beschlossenen Rahmenprogramms und nicht die Schaffung eines Rahmenprogramms selbst.260 Dies ergibt sich aus Art. 166 EG, wonach alle Aktionen der Gemeinschaft auf dem Gebiet von Forschung und technologischer Entwicklung durch das Rahmenprogramm umfassend 256 Siehe zur Entwicklung und Bedeutung der EG-Forschungspolitik Schmidt-Aßmann, in: FS für Everling, Bd. II, S. 1281 ff. 257 Curtius, in: Lenz, EG-Vertrag Kommentar, Art. 164 EGV Rdnr. 6. 258 Curtius, in: Lenz, EG-Vertrag Kommentar, Art. 163 EGV Rdnr. 13. 259 Curtius, in: Lenz, EG-Vertrag Kommentar, Art. 170 EGV Rdnr. 1. 260 Trute, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 170 EGV Rdnr. 2.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
83
geregelt werden müssen. Die Kooperation mit Drittstaaten bedarf daher einer Rechtsgrundlage innerhalb des Rahmenprogramms.261 Nach Art. 170 UAbs. 2 EG können die Einzelheiten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschung Gegenstand völkerrechtlicher Abkommen der Gemeinschaft mit dritten Ländern oder internationalen Organisationen sein. Aber auch diese Abkommen müssen sich innerhalb eines bereits geschlossenen Rahmenprogramms bewegen und sich auf dieses beziehen. Die Außenkompetenz ist daher vom Vorhandensein und der Reichweite eines Rahmenprogramms abhängig. Die Gemeinschaft ist ermächtigt, bei der Umsetzung dieses Rahmenprogramms mit dritten Parteien zusammenzuarbeiten und die Einzelheiten dieser Zusammenarbeit vertraglich zu regeln.262 Solche Abkommen sind in den vergangenen Jahren in verschiedenen Formen263 abgeschlossen worden.
cc) Rechtsformen der Zusammenarbeit Abkommen über wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit (WTZ) bieten den Rahmen für eine solche Zusammenarbeit zwischen der EG und einem Drittland auf Gebieten von gemeinsamen Forschungsinteressen. Solche Abkommen legen die Art und Weise der Zusammenarbeit fest (z. B. regelmäßiger Meinungsaustausch, Koordinierung von Projekten, Durchführung von gemeinsamen Aktionen). Die konkrete Umsetzung wird meist in besonderen Durchführungsvereinbarungen geregelt. Eine internationale Forschungskooperation der Gemeinschaft kann auch auf ein intergouvernementales Programm zurückgehen. Dies ist der Fall beim Programm EUREKA, welches die Gemeinschaft, die Mitgliedstaaten und zahlreiche Drittstaaten umfasst und die dezentrale grenzüberschreitende Förderung marktnaher Hochtechnologie zum Ziel hat.264 Dem EUREKA-Programm ähnelt die Initiative COST („CoOpération européenne dans le domaine de la recherche Scientifique et Technique) welche durch einen Briefwechsel zwischen dem damaligen Ratspräsidenten und den verschiedenen Regierungen europäischer Drittstaaten begründet und offiziell auf der Ministerkonferenz 1971 bestätigt wurde. Ziel dieser Initiative ist die Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und technischen Forschung. 261 Das vom Rat beschlossene 6. Rahmenprogramm enthält, wie seine Vorgänger auch, einen Hinweis auf Art. 170 EG. 262 Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 143. 263 Siehe die Auflistung bei Curtius, in: Lenz, EG-Vertrag Kommentar, Art. 170 EGV Rdnr. 8 ff. 264 Kallmayer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 170 Rdnr. 2; siehe auch http: //www.eureka.be.
6*
84
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Neben diesen Programmen arbeitet die Europäische Gemeinschaft mit zahlreichen internationalen Organisationen zusammen, unter anderem mit der Europäischen Organisation für kernphysikalische Forschung (CERN) und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).265 Schließlich ist ein Memorandum of Understanding möglich. Dieses ist zwar völkerrechtlich nicht verbindlich, dennoch ist der Abschluss solcher Memoranda im Forschungssektor gebräuchlich. Solche Abkommen dienen z. B. als Grundlage für bestimmte Forschungen außerhalb der Gemeinschaftsprogramme im Rahmen von COST. Als weitere praktische Form der internationalen Zusammenarbeit, die auf der Grundlage des Art. 170 EG ergehen, ist vor allem die Zusammenarbeit mit den mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL) zu nennen. Zur Förderung des Wiederaufbaus, zur Erhaltung des wissenschaftlichen Potentials und zur Verbesserung des Lebensstandards wurden eine Vielzahl von Programmen ins Leben gerufen (teilweise wurden auch eigens internationale Organisationen gegründet). Das Entwicklungsprogramm PHARE (Poland Hungary Action for Economic Restructuring) wurde zunächst als Programm zur Umstrukturierung der Wirtschaft in Polen und Ungarn 1989 eingeführt und später auf alle MOEL-Staaten sowie die baltischen Staaten und Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien ausgedehnt. Das TACIS Programm (Technical Assistance for the Community of Independent States and Georgia)266 zielt auf die Bereitstellung von Know-how für die Förderung des Übergangs zur Marktwirtschaft und zur Festigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ab. Es soll unter anderem ordnungsgemäße Entsorgungsstrategien für Nuklearmüll unterstützen und zur sicheren Stilllegung des Unglücksreaktors von Tschernobyl beitragen. Das Programm wurde 1991 gestartet und verfügt nun für den Zeitraum von 2000 – 2006 über ein Budget von 3,138 Mrd. Euro. Das IWTZ (Internationales Wissenschafts- und Technologiezentrum) soll die Abwanderung von Wissenschaftlern verhindern, die sich bislang mit der Produktion und Erforschung von Massenvernichtungswaffen beschäftigt haben. Die INTAS (International Association for the Promotion of cooperation with scientists from the new independent states of the Former Soviet Union) ist eine non-profit Organisation, die ebenfalls die wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit mit den ehemaligen GUS-Staaten fördert. Die MEDA (Mediterranean Actions) sind aus der Erklärung von Barcelona 1995 zur Partnerschaft Europa – Mittelmeer267 entstanden und sollen eine EURO-Med Cooperation in der Forschung und technologischen Zusammenarbeit ermöglichen. 265 Kallmayer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 170 Rdnr. 2; siehe auch http: //www.belspo.be/cost und http: //www.esa.int. 266 An diesem Programm sind beteiligt die EU und die „Neuen Unabhängigen Staaten“ Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, die Republik Moldau, die Mongolei, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, die Ukraine und Usbekistan. 267 An der Partnerschaft nehmen teil: Die EU, Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten, Israel, Jordanien, die Palästinensische Autonomiebehörde, Libanon, Syrien, Türkei, Zypern
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
85
dd) Rahmenprogramme, Art. 166 EG Wie bereits oben erwähnt, verlangt Art. 166 EG als grundlegende Norm, dass jede Aktion der gemeinschaftlichen Forschungsförderung, also auch der Abschluss eines völkerrechtlichen Abkommens, auf einem Rahmenprogramm fußt.268 Der Rat muss daher in einem mehrjährigen Rahmenprogramm alle Aktionen der Gemeinschaft zusammenfassen. Die Durchführung dieses Rahmenprogramms erfolgt dann durch spezifische Programme der Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 3 EG). Als Beitrag zur Verwirklichung des „Europäischen Forschungsraumes“ haben das Europäische Parlament und der Rat im Jahre 2002 das auf Art. 166 Abs. 1 EG gestützte „Sechste Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration“ beschlossen.269 Der Höchstbetrag der finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft wurde hierin auf 16 Milliarden Euro festgesetzt.
ee) Art der Außenkompetenz Die der Gemeinschaft in Art. 170 EG zugewiesene Kompetenz ist keine ausschließliche, sondern eine parallele Kompetenz. Wie alle Außenkompetenznormen des EG-Vertrages bestimmt auch Art. 170 EG nicht ausdrücklich, in welchem Verhältnis die Gemeinschaftskompetenz zu derjenigen der Mitgliedstaaten steht. In Art. 164 EG wird jedoch geregelt, dass die Gemeinschaft durch bestimmte Maßnahmen die in den Mitgliedstaaten durchgeführten Aktionen ergänzen. Die Forschungs- und Technologiepolitik der Gemeinschaft soll demnach die Forschungsund Technologiepolitik der Mitgliedstaaten weder sofort noch schrittweise ersetzen.270 Vielmehr ist Aktionskern die Tätigkeit auf der Ebene der Mitgliedstaaten.271 Daneben soll sich eine eigenständige europäische Konzeption der Forschungs- und Technologiepolitik ausbilden.272 Hieraus ergibt sich, dass die Gemeinschaftskompetenz im Innenverhältnis weder ausschließlich noch alternativkonkurrierend ist, sondern vielmehr zu der mitgliedstaatlichen Kompetenz parallel verläuft.273 und Malta. Das Abkommen strebt die Schaffung einer Freihandelszone Europa-Mittelmeer bis 2010 an. Die Unterzeichner haben sich verpflichtet, eine Zone des Friedens und des gemeinsamen Wohlstands zu schaffen und das gegenseitige Verständnis zwischen ihren Völkern zu verbessern. 268 Vorderwülbecke, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 166 EGV Rdnr. 1. 269 Beschluss Nr. 2002 / 1513 / EG, ABl. 2002 L 232, 1. 270 Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 169. 271 Vorderwülbecke, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 164 EGV Rdnr. 2; Trute, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 164 EGV Rdnr. 2. 272 Trute, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 164 EGV Rdnr. 3.
86
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Liegt demnach im Innenverhältnis eine parallele Zuständigkeit vor, so muss eine solche auch im Außenverhältnis gegeben sein. Etwas anderes müsste sich jedenfalls ausdrücklich aus dem Primärrecht ergeben, was jedoch nicht der Fall ist.274 Aus dem allgemeinen Treueverhältnis (Art. 10 Abs. 2 EG) ergibt sich jedoch, dass die Mitgliedstaaten keine Forschungs- und Technologiepolitik betreiben dürfen, die der Gemeinschaftspolitik fundamental widerspricht.275 i) Umweltpolitik, Art. 174 Abs. 4 EG i.V.m. 175 EG Die Umweltaußenkompetenzen der EG werden von Art. 174 Abs. 4 i. V. m. Art. 175 EG geregelt.276 Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse mit dritten Ländern und den zuständigen internationalen Organisationen zusammen. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit können Gegenstand von völkerrechtlichen Abkommen sein, die nach Art. 300 EG ausgehandelt und geschlossen werden. Hierbei handelt es sich um eine sprachlich und inhaltlich unklare Regelung.277 Art. 174 EG enthält nur eine Aufgabenzuweisung und regelt die Art der Kompetenzwahrnehmung. Eine echte Außenkompetenz weist Art. 174 Abs. 4 EG der EG nicht zu, wie schon der Wortlaut „im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse“ deutlich macht.278 Die in 174 Abs. 4 UAbs. 1 S. 2 EG enthaltene Konkretisierung des Begriffs „Zusammenarbeit“ als Befugnis, die Handlungsform des völkerrechtlichen Vertrages verwenden zu dürfen (Handlungsformkompetenz), sowie der Verweis auf Art. 300 EG zu Verfahrensfragen sind deklaratorischer Natur. 273 Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 169. 274 Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 169. Pitschas, a. a. O., weist zu Recht darauf hin, dass der von MacLeod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Community, S. 314 f. vertretenen Auffassung, wonach eine ausschließliche Zuständigkeit für die Gemeinschaft nach dem Diktum des Gutachtens 1 / 94 (EuGH, Slg. 1994, I-5267 – Gutachten 1 / 94, WTO) dann besteht, wenn eine innergemeinschaftliche Norm der Gemeinschaft das Recht zu internationalen Verhandlungen zuerkennt, zum einen entgegengehalten werden muss, dass sekundäres Gemeinschaftsrecht nicht die primärrechtliche Kompetenzverteilung abändern kann und zum anderen die erwähnte Entscheidung des Gerichtshofs die stillschweigenden und nicht die ausdrücklichen Kompetenzen der Gemeinschaft betrifft. 275 Dieser Grundsatz gilt allgemein im Bereich der parallelen Kompetenzen, vgl. O‘Keeffe, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 197. 276 Siehe zur Entwicklung der Vertragsschlusskompetenzen der EG im Bereich des Umweltschutzes Breier, EuR 1993, 340 (343 ff.). 277 Calliess, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 174 EGV Rdnr. 48; ebenso unzufrieden Breier / Vygen, in: Lenz, EG-Vertrag Kommentar, Art. 174 EGV Rdnr. 22; von Horstig, Die Europäische Gemeinschaft als Partei internationaler Umweltabkommen, S. 5. 278 Breier, Die völkerrechtlichen Vertragsschlusskompetenzen der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten im Bereich des Umweltschutzes, EuR 1993, 340 (347); Kahl, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 174 EGV Rdnr. 108.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
87
Die eigentliche Kompetenznorm ist Art. 175 EG in Verbindung mit den in der AETR-Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen.279 Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit sind internationale umweltbezogene Maßnahmen auch auf Art. 179 EG gestützt worden.
aa) Umfang und Abgrenzung der Art. 174, 175 EG zu anderen Kompetenzgrundlagen (1) Grundlagen Fraglich und umstritten ist der Anwendungsbereich der Art. 174, 175 EG, denn Maßnahmen auf dem Gebiet des Umweltschutzes betreffen häufig auch andere EG-Aktionsbereiche (etwa die Harmonisierung von Rechtsvorschriften oder Handelsregelungen). Nach dem EuGH ist dann zu fragen, ob sich die betreffende Maßnahme wesentlich beziehungsweise spezifisch oder überwiegend auf einen Aktionsbereich bezieht und sich auf andere Politikbereiche nur beiläufig beziehungsweise zweitrangig auswirkt (Schwerpunkttheorie).280 Ist ein solcher Schwerpunkt bestimmbar, so muss der Rechtsakt (bzw. der Vertrag) auf dieser Rechtsgrundlage erlassen (beziehungsweise ausgehandelt) werden. Sind Maßnahmen dagegen gleichwertig und untrennbar auf zwei Politiken gerichtet (Mischcharakter), ohne dass ein Schwerpunkt zu ermitteln wäre, muss das jeweilige EG-Organ den Rechtsakt, soweit das verfahrensmäßig möglich ist, auf beide Ermächtigungsgrundlagen stützen (Doppelabstützung).281 Art. 175 EG ermächtigt den Rat, Maßnahmen zu erlassen, die zur Erreichung der in Art. 174 EG genannten Ziele erforderlich sind. Zu diesen Zielen gehört gemäß Art. 174 Abs. 1 4. Spiegelstr. EG auch die Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler und globaler Umweltprobleme.
279 Hierzu eingehend von Horstig, Die Europäische Gemeinschaft als Partei internationaler Umweltabkommen, S. 20 ff.; EuGH, Slg. 2001, I-779 (Rdnr. 45 ff.) – Donauschutzübereinkommen. 280 Kahl, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 175 EGV Rdnr. 73; z. B. EuGH, Slg. 1999, I-1139 (Rdnr. 14) – Parlament . / . Rat. Gegen die Gravitationstheorie des EuGH, wonach wie gerade beschrieben der Schwerpunkt der Maßnahme entscheidend ist, Trüe, ZaöRV 2004, 391 (394, 408 f.). Sie plädiert für die Herausarbeitung einer Rangfolge der Kompetenzgrundlagen, die auf der Integrationsintensität aufbaut. 281 Kahl, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 175 EGV Rdnr. 80 f.
88
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
(2) Insbesondere Abgrenzung zu den Handelskompetenzen nach Art. 133 EG, Gutachten 2 / 00, Zuständigkeit zum Abschluss des Protokolls von Cartagena282 Grundlegende Ausführungen über das Verhältnis von Art. 174, 175 EG zu Art. 133 EG enthält das Gutachten 2 / 00 des Europäischen Gerichtshofs.283 Das von der Kommission gemäß Art. 300 Abs. 6 EG beantragte Gutachten sollte zwei Fragen klären. Zum einen, ob Art. 133 EG oder Art. 174 EG als Ermächtigungsgrundlage für den Abschluss des Protokolls von Cartagena dienen kann, und zum anderen, ob den Mitgliedstaaten aufgrund ihrer Zuständigkeiten im Umweltbereich eine „Restzuständigkeit“ bei der Verhandlung und dem Abschluss des Protokolls verbleibt. Das Protokoll von Cartagena ist das Verhandlungsergebnis einer Konferenz, die am 29. 01. 2000 in Montreal (Kanada) stattfand. Grundlage des Protokolls ist die Vereinbarung über die biologische Vielfalt, welche im Rahmen der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) im Juni 1992 in Rio de Janeiro beschlossen wurde.284 Ziel des Protokolls von Cartagena ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt und der Schutz von Mensch und Umwelt bei der grenzüberschreitenden Verbringung, Handhabung und Verwendung von lebenden veränderten Organismen (sog. LVO).285 Der Gerichtshof führte zunächst allgemein aus, dass die Wahl der Rechtsgrundlage eines Rechtsakts nicht allein auf der Überzeugung seines Verfassers beruhen darf, sondern sich auf objektive, nachprüfbare Umstände gründen muss. Zu diesen Umständen gehören insbesondere das Ziel und der Inhalt des Rechtsakts.286 Verfolgt der Rechtsakt mehrere Ziele und lässt sich eines davon als wesentliches oder überwiegendes ausmachen, während das andere nur von untergeordneter Bedeutung ist, so ist der Rechtsakt nur auf die Rechtsgrundlage zu stützen, die das überwiegende Ziel erfordert.287 Werden dagegen mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt, die untrennbar miteinander verbunden sind, ohne dass das eine im Verhältnis zu dem anderen zweitrangig oder von geringerer Bedeutung ist, so kann der Rechtsakt ausnahmsweise auf die verschiedenen einschlägigen Rechtsgrundlagen gestützt werden. EuGH, Slg. 2001, I-9713 – Protokoll von Cartagena. Die Abgrenzung zwischen Handels- und Umweltkompetenzen wird außerdem im Urteil EuGH, Slg. 2002, I-12049 – Energy Star Agreement behandelt; hierzu Koutrakos, YEL 2003, 407 (430 ff.). 284 Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992, ABl 1993 L 309, S. 1 (=BGBl. 1993 II, S. 1742). 285 Ausführlicher zum Inhalt des Protokolls von Cartagena Schwarz, ZEuS 2003, 51 (61). 286 EuGH, Slg. 2001, I-9713 (9757, Rdnr. 22) – Protokoll von Cartagena unter Hinweis auf seine bisherige Rechtsprechung, EuGH, Slg. 2000, I-2257 (Rdnr. 43) – Spanien . / . Rat. 287 EuGH, Slg. 2001, I-9713 (9758, Rdnr. 23) – Protokoll von Cartagena unter Hinweis auf seine bisherige Rechtsprechung, EuGH, Slg. 1999, I-869 (Rdnr. 39 f.) – Abfallrichtlinie. 282 283
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
89
Bei der Prüfung der Frage, ob das Protokoll nach seinem Zusammenhang, seiner Zielsetzung und seinem Inhalt ein hauptsächlich im Bereich des Umweltschutzes geschlossener Vertrag ist, der Nebenwirkungen auf den Handel mit gentechnisch veränderten Lebewesen hat, ob es umgekehrt den Charakter eines Vertrages im Bereich der internationalen Handelspolitik hat, bei dem ergänzend bestimmte Umwelterfordernisse berücksichtigt werden, oder ob es in untrennbarer Weise sowohl den Umweltschutz als auch den internationalen Handel betrifft, verfährt der Gerichtshof nach Art. 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge, wonach „ein Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen ist“. Der Gerichtshof kam zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die wesentliche Zielsetzung des Protokolls der Schutz der biologischen Vielfalt vor den schädlichen Auswirkungen ist, die sich beim Umgang von gentechnisch veränderten Organismen ergeben. Damit konnte Art. 133 EG nicht als Rechtsgrundlage für den Vertragsschluss herangezogen werden.288 Der EuGH räumte zwar ein, dass auch handelsbezogene Aspekte, insbesondere bei der grenzüberschreitenden Verbringung von gentechnisch veränderten Organismen, durch das Protokoll geregelt werden, hielt aber fest, dass der Hauptzweck des Abkommens dem Umweltschutz gilt. Auch die weite Auslegung des Begriffs der gemeinsamen Handelspolitik in der bisherigen Rechtsprechung des Gerichtshofs konnte dieses Ergebnis nicht in Frage stellen. Andernfalls würde eine Maßnahme der Gemeinschaft, sobald sie (irgendwelche) Auswirkungen auf den Handelsverkehr hat, unter die gemeinsame Handelspolitik nach Art. 133 EG fallen. Die besonderen Bestimmungen des EG-Vertrages zur Umweltpolitik liefen dann leer.289 Der Gerichtshof wies ferner darauf hin, dass die Umweltpolitik in Art. 3 Abs. 1 lit. l EG ebenso ausdrücklich erwähnt wird wie die gemeinsame Handelspolitik in Buchstabe b dieser Bestimmung.290 Damit brachte der EuGH zum Ausdruck, dass kein Rangverhältnis zwischen beiden Rechtsgrundlagen besteht und dass Art. 133 EG daher nicht vorrangig herangezogen werden darf. Die praktischen Schwierigkeiten, die bei der Durchführung gemischter Abkommen, also solcher Abkommen, an deren Aushandlung und Abschluss nicht nur die EG, sondern auch die Mitgliedstaaten beteiligt sind, entstehen, können nicht die 288 Kritisch hierzu Schwarz, ZEuS 2003, 51 (66 f.), der von primär handelspolitischen Auswirkungen des Protokolls von Cartagena ausgeht. Zwar ziele das Protokoll auf den Schutz der Biodiversität ab, es bediene sich aber insoweit eines Instrumentariums, das in erster Linie in die grenzüberschreitende Verbringung lebender veränderter Organismen eingreife. 289 Schwarz, ZEuS 2003, 51 (68) sieht nicht die Gefahr, dass die Bestimmungen des EGV zur Umweltschutzpolitik ausgehöhlt würden. Vielmehr bestehe die Gefahr, „daß die gemeinsame Handelspolitik auf schleichendem Weg ihres materiellen Gehalts beraubt wird.“ Schwarz verweist darauf, dass „der Umweltschutz wegen der Querschnittklausel in Art. 6 EGV durchaus seine Wirkungen zu entfalten vermag, ohne dass von einem Vorrang des Umweltschutzes auszugehen ist ( . . . )“; ähnlich auch Herrmann, NVwZ 2002, 1168 (1173 f.) 290 EuGH, Slg. 2001, I-9713 (9763, Rdnr. 40) – Protokoll von Cartagena.
90
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Wahl der Rechtsgrundlage bestimmen, da die Frage der Rechtsgrundlage vorgelagert ist. Schließlich hielt der EuGH fest, dass Art. 174 EG die im Rahmen der Umweltpolitik zu verfolgenden Ziele festlegt, während Art. 175 EG die Rechtsgrundlage für Rechtsakte der Gemeinschaft ist. Zwar bestimmt Art. 174 Abs. 4 EG, dass „die Einzelheiten der Zusammenarbeit der Gemeinschaft“ mit dritten Ländern und internationalen Organisationen „Gegenstand von Abkommen . . . sein [können], die nach Art. 300 EG ausgehandelt und geschlossen werden“. Das Protokoll von Cartagena beschränkt sich jedoch nicht auf „Einzelheiten der Zusammenarbeit“ im Bereich des Umweltschutzes, sondern stellt detaillierte Regeln und Kontrollverfahren auf. Damit war Art. 175 EG als die richtige Rechtsgrundlage zum Abschluss des Protokolls von Cartagena heranzuziehen. Zur Frage der Ausschließlichkeit der Zuständigkeit nach Art. 175 EG hielt der Gerichtshof unter Hinweis auf sein AETR-Urteil fest, dass die im Geltungsbereich des Protokolls auf Gemeinschaftsebene bereits durchgeführte Harmonisierung diesen Bereich nur ganz partiell und unvollständig abdeckt.291 Daher ist die Zuständigkeit zum Abschluss des Protokolls von Cartagena zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten geteilt.292
bb) Verhältnis der Vertragsschlusskompetenzen der EG zu den Vertragsschlusskompetenzen der Mitgliedstaaten Die Vorschrift des Art. 174 EG gilt als verfehlt, da sie Zweifel aufkommen lässt, wie das Verhältnis der Außenkompetenzen zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten zu bestimmen ist und ob durch sie für die Umweltpolitik die AETR-Rechtsprechung außer Kraft gesetzt werden sollte.293 Mit diesem 291 Auch hierzu kritisch Schwarz, ZEuS 2003, 51 (70), der meint, dass der erreichte Integrationsstand durch die Vorgaben des sekundären Gemeinschaftsrechts deutlich stärker sei, als dies die Ausführungen des Gerichtshofs erkennen ließen. Schwarz führt für diese Behauptung zahlreiche Nachweise von gemeinschaftsrechtlichen Verordnungen und Richtlinien an. Wie weit der erreicht Integrationsstand reicht, dürfte letztlich eine Wertungsfrage sein. Schwarz geht jedenfalls – anders als der EuGH – davon aus, dass der Grad der Vergemeinschaftung durch Sekundärrechtsakte für eine nicht mehr nur ausschließliche Kompetenz in Teilbereichen, sondern für eine Außenkompetenz hinsichtlich der gesamten Materie spricht. 292 Herrmann, NVwZ 2002, 1168 (1174) bedauert dies und meint, das Gutachten füge sich in vorhersehbarer Weise in die Rechtsprechung des Gerichtshofs ein, welche in jüngerer Zeit eine deutlich zurückhaltende Linie erkennen lasse. Herrmann sieht dadurch die erforderliche einheitliche Vertretung der EG gefährdet. Seine Ausführungen lassen darauf schließen, dass er es für erforderlich hält, dass der Gerichtshof die Mitgliedstaaten zur Aufgabe von Teilen ihrer Souveränität zwingt, da sie im Bereich der Außenkompetenzen substanziellen Souveränitätsübertragungen nicht zustimmen – das kann und darf hingegen nicht die Aufgabe des EuGH sein. 293 von Horstig, Die Europäische Gemeinschaft als Partei internationaler Umweltabkommen, S. 33 ff.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
91
Problem konfrontiert, sahen sich die Regierungsvertreter genötigt, in einer Erklärung zur Regierungskonferenz (1986)294 festzustellen, dass die Grundsätze, die sich aus dem AETR-Urteil ergeben, von 174 Abs. 4 EG nicht angetastet werden sollten. Für die Weitergeltung der AETR-Grundsätze spricht zudem die systematische Auslegung. 174 Abs. 4 UAbs. 1 S. 1 EG verweist, wie oben dargestellt, auf die bestehende Kompetenzverteilung („im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse“). Danach dürfen die Mitgliedstaaten grundsätzlich selbst völkerrechtliche Verträge über Umweltbelange mit Drittstaaten abschließen, solange nach dem Prinzip des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts die Funktionsfähigkeit des gemeinschaftlichen Umweltrechts nicht durch die Wahrnehmung von mitgliedstaatlichen Außenkompetenzen beeinträchtigt wird. Hat die EG durch eigenes Tätigwerden einen Bereich abschließend geregelt, so ist ausschließlich die EG zuständig.295 Zu diesem Ergebnis kommt man auch, wenn man Art. 176 EG als Argumentationsgrundlage heranzieht.296 Zunächst wird aus Art. 174 Abs. 4 UAbs. 2 EG deutlich, dass der Gemeinschaft grundsätzlich nicht die ausschließliche Kompetenz zusteht, denn hiernach berührt Art. 174 Abs. 4 UAbs. 1 EG nicht das Recht der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien zu verhandeln und völkerrechtliche Abkommen zu schließen.297 Der Wortlautvergleich zu Art. 181 UAbs. 2 EG ließe den Schluss zu, dass es sich bei Art. 174 Abs. 4 EG um eine parallele Kompetenz handelt. Hier wird allerdings Art. 176 EG relevant, der es den Mitgliedstaaten gestattet, verstärkte Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Art. 176 EG gilt nach allgemeiner Auffassung auch in Bezug auf die Außenkompetenzen der Gemeinschaft.298 Dieser Artikel wäre überflüssig, handelte es sich bei Art. 174 Abs. 4 UAbs. 1 EG um eine parallele Zuständigkeit, denn dann bedürften die Mitgliedstaaten einer solchen Erlaubnis (nämlich verstärkte Schutzmaßnahmen trotz vorhandener Gemeinschaftsregelung zu ergreifen, Art. 176 EG) nicht. Folglich muss es sich bei Art. 174 Abs. 4 UAbs. 1 EG um eine alternativ-konkurrierende Kompetenz handeln.299 Die mitgliedstaatliche Kompetenz wird also verdrängt, sobald 294 Diese Erklärung wurde „wiederholt“ durch Nr. 10 der Erklärungen zum Vertrag von Maastricht, wonach Art. 174 Abs. 4 UAbs. 2 EG nicht die aus dem AETR-Urteil folgenden Grundsätze berührt, vgl. schon oben, § 4 III. 3. f) ee). 295 Zuleeg, NVwZ 1987, 280 (282 f.). 296 So Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 171 ff. 297 Zur weiteren Argumentation warum keine ausschließliche Außenkompetenz vorliegt, Frenz, Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften und der Mitgliedstaaten im Umweltbereich, S. 93 ff. 298 Jahns-Böhm, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 174 EGV Rdnr. 32 m. w. N. 299 A. A. Frenz, Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften und der Mitgliedstaaten im Umweltbereich, S. 98, der von einer kumulativ-konkurrierenden Kompetenz ausgeht, die er auch als „doppelte und ergänzende Zuständigkeit“ bezeichnet. Frenz begründet seine Ansicht damit, dass eine alternativ-konkurrierende Kompetenz im Wiederspruch zu Art. 174 EG stehe, wonach die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer je-
92
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
und soweit die Gemeinschaft von ihrer Kompetenz Gebrauch macht.300 Eine Besonderheit hierbei begründet jedoch wiederum Art. 176 EG, denn er erlaubt es den Mitgliedstaaten, auf Gebieten, auf denen bereits Gemeinschaftsregelungen existieren (mit der Folge einer ausschließlichen Kompetenz für die Gemeinschaft), dennoch eigene – allerdings nur schärfere – Vorschriften zu erlassen. Damit wird die alternativ-konkurrierende Kompetenz zu einer beschränkt alternativ-konkurrierenden Kompetenz301. Die Mitgliedstaaten dürfen demnach völkerrechtliche Übereinkommen im Umweltbereich treffen, wenn diese über die gemeinschaftsrechtlichen (Mindest-)Normen hinausgehen und verstärkte Umweltschutzmaßnahmen vorsehen. Die Anwendbarkeit des Art. 176 EG auf die Außenbeziehungen der Gemeinschaft wird auch von denjenigen Stimmen in der Literatur befürwortet, die die alternativ-konkurrierende Kompetenz aus den Grundsätzen der AETR-Rechtsprechung herleiten.302 Damit wird die alternativ-konkurrierende Kompetenz der Gemeinschaft im Interesse höherer Umweltschutzstandards dahingehend relativiert, dass die Mitgliedstaaten solche Abkommen schließen dürfen, die höhere Umweltschutzstandards vorsehen als die Mindeststandards nach EG-Recht.303 In der Praxis werden völkerrechtliche Verträge im Bereich des Umweltschutzes grundsätzlich in Form gemischter Abkommen geschlossen.304 An diesen Abkommen sind sowohl die EG als auch die einzelnen Mitgliedstaaten beteiligt. Internationale Übereinkommen zum Umweltschutz bestehen zur Luftreinhaltung305, zum Gewässerschutz306, zum Naturschutz307 und zu anderen Bereichen308. weiligen Befugnisse mit dritten Ländern und den zuständigen internationalen Organisationen zusammenarbeiten. Gegen diese Ansicht spricht jedoch bereits die Formulierung „im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse“. 300 So auch Herrmann, NVwZ 2002, 1168 (1169). 301 Nach Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 172 ff., muss diese, unter dem Aspekt der Rechtssicherheit seiner Meinung nach unbefriedigende Lösung, durch eine Abstimmungspflicht zwischen den Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft ergänzt werden. 302 Vgl. Kahl, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 174 EGV Rdnr. 112 und Art. 176 EGV Rdnr. 12; Krämer, EuGRZ 2002, 483 (492); Jahns-Böhm, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 174 EGV Rdnr. 32 m. w. N. 303 Jahns-Böhm, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 174 EGV Rdnr. 32. 304 Zur Problematik gemischter Abkommen unten, § 4 VII. 305 Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht vom 22. 02. 1985 sowie das Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, vom 16. 09. 1987 (Entscheidung 88 / 540 / EWG vom 14. 10. 1988 – ABl. L 297, 8) und die im Juni 1990 in London beschlossene Änderung des Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen (Entscheidung 91 / 690 / EWG vom 12. 12. 1991 – ABl. L 377, 28). 306 Übereinkommen über die Zusammenarbeit zum Schutz und zur verträglichen Nutzung der Donau (Beschluss 97 / 825 / EG vom 24. 11. 1997 – ABl. L 342, 18). 307 Übereinkommen zum Schutz der Alpen (Beschluss 96 / 191 / EG vom 26. 02. 1996 – ABl. L 61, 31).
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
93
cc) Querschnittsklausel, Art. 6 EG Weiterhin ist die so genannte „Querschnittsklausel“309 zu beachten, wonach die Erfordernisse des Umweltschutzes bei der Festlegung und Durchführung der Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen einbezogen werden müssen. Hieraus folgt, dass völkerrechtliche Verträge, die dem Umweltschutz dienen, auch aufgrund von anderen Kompetenzgrundlagen als den Art. 175, 174 EG geschlossen werden können.310 So wurden z. B. in die Assoziierungsverträge mit Polen und Ungarn eine Reihe von Umweltschutzbestimmungen aufgenommen.311 Die von der EEA eingeführte Querschnittsklausel verdeutlicht den besonderen Stellenwert des Umweltschutzes im Gemeinschaftsrecht.312 Durch die Bezugnahme des Art. 6 EG auf die in Art. 3 EG genannten Gemeinschaftspolitiken und aufgrund der Stellung der Klausel im Vertrag (jetzt ist sie mit Art. 6 EG dem Vertrag vorangestellt, früher war sie in Art 130 r Abs. 2 S. 3 EWGV) wird klargestellt, dass sich die Querschnittsklausel auf das gesamte Gemeinschaftshandeln bezieht.313
308 Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung von gefährlichen Abfällen und ihrer Entsorgung (ABl. 1993 L 39, 3) sowie Änderung des Abkommens auf der Grundlage der Entscheidung III / 1 der Konferenz der Vertragsparteien (Beschluss 97 / 640 / EG vom 22. 09. 1997 – ABl. L 272, 45); vgl. auch die weitergehenden Nachweise bei Breier / Vygen, in: Lenz, EG-Vertrag Kommentar, Art. 175 EG Rdnr. 75 ff.; die wichtigsten von der Gemeinschaft abgeschlossenen Umweltabkommen finden sich bei von Horstig, Die Europäische Gemeinschaft als Partei internationaler Umweltabkommen, S. 254 ff. (Anhang). 309 Begriff wohl geprägt von Scheuing, EuR 1989, 152 (176). 310 Der EuGH stellte fest, dass die Ziele des Umweltschutzes auch durch Maßnahmen verfolgt werden können, die nicht auf spezifischen umweltrechtlichen Ermächtigungsgrundlagen beruhen, EuGH, Slg. 1991, 2867 (Rdnr. 22) – Titandioxid; dazu auch Jahns-Böhm / Breier, EuZW 1992, 49 (50). 311 Z. B. Art. 68, 69 dieser Assoziierungsverträge – Angleichung von Umweltvorschriften an das Gemeinschaftsrecht, Art. 76, 77 – Einbeziehung von Umweltschutztechniken in der Landwirtschaft, Art. 79, 80 – Allgemeine Zusammenarbeit im Bereich des Umweltschutzes; weitere Nachweise bei Breier, EuR 1993, 340 (346). 312 Ob dadurch dem Belang Umweltschutz im Konfliktfall grundsätzlich Vorrang vor anderen Gemeinschaftszielen zukommt, muss hier nicht dargestellt werden, siehe dazu Scheuing, EuR 1989, 156 (176 f.); Jahns-Böhm, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 6 EGV Rdnr. 3 m. w. N. 313 Jahns-Böhm, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 6 EGV Rdnr. 10.
94
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
IV. Ausdrückliche Kompetenzen der EG zur internationalen Zusammenarbeit 1. Bildungs-, Kultur- und Gesundheitspolitik (Art. 149 Abs. 3 EG, Art. 150 Abs. 3 EG, Art. 151 Abs. 3 EG und Art. 152 Abs. 3 EG) Im Bereich der Bildungs-, Kultur- und Gesundheitspolitik enthält der EG-Vertrag eine Reihe gleichlautender Vorschriften (Art. 149 Abs. 3 EG, Art. 150 Abs. 3 EG, Art. 151 Abs. 3 EG und Art. 152 Abs. 3 EG). Diese Vorschriften besagen übereinstimmend, dass die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und den für die im Bildungsbereich beziehungsweise die berufliche Bildung, den Kulturbereich und das Gesundheitswesen zuständigen internationalen Organisationen fördern. Keine der genannten Normen verleiht der Gemeinschaft ausdrücklich eine Handlungsbefugnis zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge.314 Fraglich ist daher, ob der Abschluss völkerrechtlicher Verträge vom Wortlaut dieser Vorschriften („Zusammenarbeit mit dritten Ländern und Organisationen“) erfasst ist und, falls dies nicht der Fall sein sollte, ein Rückgriff auf die AETR-Rechtsprechung zulässig ist. 315 Von einigen Autoren wird eine eigenständige Vertragsabschlusskompetenz der Gemeinschaft aufgrund dieser Vorschriften verneint.316 Dies wird folgendermaßen begründet. In Art. 149 Abs. 3 EG, Art. 150 Abs. 3 EG, Art. 151 Abs. 3 EG und Art. 152 Abs. 3 EG wird die Möglichkeit des Abschlusses von völkerrechtlichen Verträge nicht genannt, lediglich die Förderung der „Zusammenarbeit“ mit dritten Ländern und Organisationen. Nun ließe es der Begriff der „Zusammenarbeit“ zwar zu, hierunter auch den Abschluss von völkerrechtlichen Verträgen zu subsumieren.317 Der Vergleich mit den der EG ausdrücklich Vertragsschlusskompetenzen einräumenden Vorschriften (Art. 111 Abs. 1, Abs. 3, 170, 174 Abs. 4, 181 EG) spreche jedoch gegen eine solche Subsumtion.318 Diese, durch den Vertrag von Maastricht eingefügten Vorschriften, sprechen zwar zunächst von einer internationalen „Zusammenarbeit“, wie dies auch in Art. 149 Abs. 3 EG, Art. 150 Abs. 3 EG, Art. 151 Abs. 3 EG und Art. 152 Abs. 3 EG der Fall ist. Anschließend stellen sie jedoch ausdrücklich klar, dass die Einzelheiten dieser ZusammenNiedobitek, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 149 EGV Rdnr. 29. Dies bejahend Simm, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 150 EGV Rdnr. 23; zweifelnd dagegen Niedobitek, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 149 EGV Rdnr. 29. 316 Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 188 ff. 317 Loman / Mortelmans / Post / Watson, Culture and Community Law, S. 198. 318 Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 188. 314 315
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
95
arbeit Gegenstand internationaler Verträge sein können. Der Verzicht auf diesen Zusatz in Art. 149 Abs. 3 EG, Art. 150 Abs. 3 EG, Art. 151 Abs. 3 EG und Art. 152 Abs. 3 EG zeige deutlich, dass der EG-Vertrag der Gemeinschaft, z. B. im Bereich der Bildungspolitik, keine Vertragsabschlusskompetenz einräumen wolle.319 Eine Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge lässt sich nach dieser Ansicht auch nicht mittels eines Rückgriffs auf die AETR-Rechtsprechung herleiten. Losgelöst von der Frage, ob die Gemeinschaft intern verbindliche Vorschriften in der Kultur- und Bildungspolitik erlassen darf320, müsse beachtet werden, dass die AETR-Rechtsprechung zu solchen Primärrechtsnormen erging, die zwar die Innenkompetenz der Gemeinschaft regelten, nicht jedoch ihre Außenkompetenz. Erst dieses Schweigen zur Außenkompetenz lasse es zu, auf implizite Außenkompetenzen zu schließen. Die hier in Rede stehenden Vorschriften dagegen räumten der Gemeinschaft eine Außenkompetenz ein, verzichteten jedoch auf die Handlungsform des völkerrechtlichen Vertrages. Diese im EG-Vertrag deutlich zum Ausdruck kommende Wertung schließe die Anwendung der AETR-Rechtsprechung auf solche Normen aus.321 Schließlich könne die bloße Zweckmäßigkeit einer Vertragsabschlusskompetenz eine solche nicht begründen. Hierbei müsse vor allem beachtet werden, dass das Aktionspotential der Gemeinschaft auch im Innenverhältnis sehr beschränkt sei.322 So werde die grundsätzliche Subsidiarität gemeinschaftlichen Handelns durch die Formulierungen in Art. 149 Abs. 1, 150 Abs. 1, 151 Abs. 2 EG speziell ausformuliert, wenn es dort heiße, die Gemeinschaft „unterstützt und ergänzt erforderlichenfalls“ die Tätigkeit der Mitgliedstaaten. Außerdem sei die Gemeinschaft gemäß Art. 149 Abs. 1 EG und 150 Abs. 1 EG verpflichtet, die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die jeweiligen Bereiche „strikt“ zu achten. Eine unter Anwendung der AETR-Rechtsprechung hergeleitete Vertragsschlusskompetenz würde dieses Prinzip der Nachrangigkeit untergraben und dazu führen, dass die internationale Zuständigkeit weiter reichte als die gemeinschaftsinterne Kompetenz.323 319 So Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 188. 320 Vgl. hierzu ausführlich Nowoczyn, Bildungspolitische Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft nach Maastricht, S. 117 ff.; Cludius, Die Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft für den Bereich der Bildungspolitik, S. 74 ff.; Niedobitek, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 149 EGV Rdnr. 37 ff. 321 Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 190; a.A. Fischer, in: Lenz, EG-Vertrag Kommentar, Art. 149 EGV Rdnr. 10. 322 Loman / Mortelmans / Post / Watson, Culture and Community Law, S. 199. 323 Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 191; Loman / Mortelmans / Post / Watson, Culture and Community Law, S. 200 halten jedoch aus Zweckmäßigkeitsgründen den Abschluss von gemischten Abkommen unter Wahrung des Subsidiaritätsgrundsatzes für möglich.
96
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Diese Ansicht ist jedoch abzulehnen. Zum einen muss grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass der EG eine Außenkompetenz kraft aktualisierter Innenkompetenz nach Maßgabe der AETR-Rechtsprechung zusteht. Im Sinne des effet utile ist eine Förderung der Zusammenarbeit, wie sie in den Art. 149 Abs. 3 EG, Art. 150 Abs. 3 EG, Art. 151 Abs. 3 EG und Art. 152 Abs. 3 EG im EG-Vertrag vorgesehen ist, ohne Vertragsschlusskompetenz für bi- oder multilaterale Verträge auf gesicherter Basis nicht möglich.324 Eine Außenkompetenz muss daher die Binnenkompetenzen der Gemeinschaft flankieren. Darüber hinaus wollten die vertragsschließenden Parteien durch den Vertrag von Maastricht an dem erreichten Stand des acquis communautaire nichts ändern. Zu diesem gemeinschaftsrechtlichen Besitzstand gehört vor allem auch die Anwendung der AETR-Rechtsprechung auf die Bereiche Bildung, Kultur und Gesundheit.325 Es muss daher im Sinne eines Erst-Recht-Schlusses argumentiert werden: Wenn der EuGH aus Normen, die keinen ausdrücklichen Bezug zum Außenbereich haben, eine implizierte Außenkompetenz zum Abschluss von Verträgen herleitet, so muss dies erst recht auch für Normen gelten, die die internationale Zusammenarbeit ausdrücklich erwähnen und damit in sich schon einen Bezug zum Außenbereich herstellen. Daher müssen die Vorschriften im Lichte ihrer jeweiligen Absätze 1 und 2 gelesen werden. Diese enthalten Aufgaben und Ziele der Gemeinschaft, die sowohl für die internen als auch für die externen Handlungen der Gemeinschaft gelten.326 Gleiches gilt für das Verbot von Harmonisierungsvorschriften in den jeweiligen Bereichen. Die Außenkompetenz der Gemeinschaft ist im Bereich der Bildungs-, Kultur- und Gesundheitspolitik eine parallele, da die Gemeinschaft die Maßnahmen der Mitgliedstaaten durch eigene Aktionen „unterstützt und ergänzt“, nicht aber verdrängen darf. Aus alldem folgt, dass in den Art. 149 Abs. 3 EG, Art. 150 Abs. 3 EG, Art. 151 Abs. 3 EG und Art. 152 Abs. 3 EG eine auswärts gerichtete Perspektive zu sehen ist, die der Gemeinschaft ein ungeschriebenes Recht einräumt, im Rahmen der jeweiligen Ziele und Aufgaben auch völkerrechtliche Verträge abzuschließen. 327 Im Hinblick auf das Verbot von Harmonisierungsmaßnahmen und den Subsidiaritätsgrundsatz darf dabei die Außenkompetenz der Gemeinschaft nicht weiter gehen als ihre interne Kompetenz.328 Sparr, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 151 EGV Rdnr. 54. Blanke, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 151 Rdnr. 13; nach Niedobitek, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 149 Rdnr. 29 und Art. 151 Rdnr. 42, kann die Anwendung der AETR Rechtsprechung offen bleiben, da Art. 149 Abs. 3 EG eine parallele Außenkompetenz der Gemeinschaft offenbar voraussetze. 326 Vgl. MacLeod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Communities, S. 297. 327 So Blanke, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 151 EGV Rdnr. 12; Fischer, in: Lenz, EG-Vertrag Kommentar, Art. 151 EGV Rdnr. 12; Niedobitek, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 149 EGV Rdnr. 29, Art. 150 EGV Rdnr. 8, Art. 151 EGV Rdnr. 42; anders hingegen Lurger, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 152 EGV Rdnr. 34. 324 325
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
97
Im Sinne dieser Meinung verfährt auch die Praxis.329 Im Hinblick auf die fortbestehende Außenkompetenz der Mitgliedstaaten (parallele Kompetenzen) werden völkerrechtliche Verträge zumeist in Form von gemischten Abkommen geschlossen.
2. Transeuropäische Netze (Art. 155 Abs. 3 EG) Nach Art. 155 EG i. V. m. Art. 154 EG trägt die Gemeinschaft zum Auf- und Ausbau transeuropäischer Netze in den Bereichen der Verkehrs-, Telekommunikations- und Energieinfrastruktur bei. Im Bereich der transeuropäischen Netze kann die Gemeinschaft zur Förderung von Vorhaben von gemeinsamen Interesse und zur Sicherstellung der Interoperabilität 330 mit Drittländern zusammenarbeiten. Die Formulierung „Zusammenarbeit“, ebenso wie die Nichterwähnung von völkerrechtlichen Verträgen in dieser Vorschrift, wirft die gleichen Probleme auf wie in der Bildungs-, Kultur- und Gesundheitspolitik (Art. 149 Abs. 3 EG, Art. 150 Abs. 3 EG, Art. 151 Abs. 3 EG und Art. 152 Abs. 3 EG). Unter Hinweis auf das absichtliche Weglassen der völkerrechtlichen Verträge im Rahmen der Handlungsformen des Art. 155 Abs. 3 EG wird wiederum vertreten, dass der Gemeinschaft in diesem Bereich keine treaty-making-power zukomme. Diese Ansicht ist aber aus den oben genannten Gründen abzulehnen. Aufgrund der bei den Mitgliedstaaten verbliebenen primären Zuständigkeit muss die Gemeinschaft die Belange der Mitgliedstaaten berücksichtigen und sie in 328 MacLeod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Communities, S. 47 und Fn. 56 ebenda. 329 Die Gemeinschaft ist nicht Partei eines multilateralen Vertrages, der ausschließlich die allgemeine und berufliche Bildung und Jugend betrifft, allerdings enthalten einige internationale Verträge unter anderem auch Regelungen zu diesem Gebiet, etwa das Lomé IV Abkommen in Art. 151 oder das European Economic Area (EEA) Agreement in den Art. 78 – 88 und dem Prot. 31, Art. 4. Das 1987 gemeinschaftsintern aufgelegte ERASMUS-Programm wurde 1991 auf die EFTA Staaten ausgedehnt (siehe die Entscheidungen 90 / 190 [Österreich], 90 / 191 [Finnland], 90 / 192 [Island], 90 / 193 [Norwegen], 90 / 194 [Schweden], 90 / 195 [Schweiz], alle abgedruckt in ABl 1990 L 102); bilaterale Verträge wurden unter anderem mit Argentinien (Art. 4 Abs. 2 f. – ABl. 1990 L 295, 66), Brasilien (Art. 27 – ABl. 1991 C 163, 20), Mexiko (Art. 36 – ABl. 1991 L 340, 1), Jemen (Art. 2 Abs. 2 – ABl. 1985 L 26, 1) und Sri Lanka (Art. 4 Abs. 3 und 4 – ABl. 1995 L 85, 22) geschlossen. Für den Bereich Kultur existieren ebenfalls keine speziellen Abkommen, wohl aber enthalten viele Assoziierungs- und Handelsabkommen Regelungen zur kulturellen Zusammenarbeit, etwa das Abkommen mit Indien (Art. 15 – ABl. 1994 L 223, 23), mit Sri Lanka (Art. 4 Abs. 3 und 12 – ABl. 1995 L 85, 32) und Brasilien (Art. 25 – ABl. 1992 C 163, 11). Eine ähnliche Situation liegt auch im Bereich des Gesundheitswesens vor, viele bilaterale Abkommen enthalten Reglungen zur Zusammenarbeit im Gesundheitswesen und in der Drogenbekämpfung, etwa die bilateralen Abkommen mit Albanien (Art. 15 Abs. 2 – ABl. 1992 L 343, 1) und Mexiko (Art. 28 f. – ABl. 1991 L 340, 1); vgl. zum Ganzen MacLeod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Communities, S. 47, 299 ff., 305 f., 309 ff. 330 D. h. grenzüberschreitende Nutzbarkeit einzelstaatlicher Netze / technische Verbundfähigkeit / Kompatibilität der einzelstaatlichen Netze.
7 Metz
98
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
ihre Aktivitäten einbeziehen. Den Mitgliedstaaten steht damit weiterhin ihre eigene Zuständigkeit zur Zusammenarbeit mit Drittstaaten (parallele Kompetenz) zu.331 Andererseits dürfen die Mitgliedstaaten aufgrund ihrer allgemeinen Treuepflicht (Art. 10 EG) keine internationalen Abkommen unterzeichnen, die mit Abkommen zwischen der EG und Drittstaaten kollidieren und die Netzpolitik der Gemeinschaft unterlaufen.332
3. Beziehungen zu internationalen Organisationen (Art. 302 – 304 EG) Die Art. 302 – 304 EG verpflichten die Gemeinschaft zur Pflege ihrer internationalen Kontakte, namentlich mit den Vereinten Nationen und ihren Fachorganisationen (Art. 302 Abs. 1 EG), dem Europarat (Art. 303 EG) und der OECD (Art. 304 EG). Darüber hinaus kann die EG gemäß Art. 302 Abs. 2 EG zu allen anderen internationalen Organisationen Beziehungen aufnehmen. Damit ist Art. 302 Abs. 2 EG lex generalis sowohl zu Art. 303 EG und Art. 304 EG als auch zu Art. 302 Abs. 1 EG. Die Art. 302 – 304 EG verleihen der Gemeinschaft eine begrenzte Außenkompetenz („Beziehungskompetenz“), die zwar Kontakte und Kooperationen aller denkbaren Ausgestaltungen ermöglicht (policy-making-power), jedoch keine Vertragsschlusskompetenz (treaty-making-power) darstellt.333 Unter die Beziehungskompetenz fällt jede Art internationaler Beziehungspflege, die unterhalb eines Beitritts oder eines völkerrechtlichen Abkommens angesiedelt ist.334 Demnach sind Informationskontakte möglich, es kann aber auch ein passiver oder aktiver Beobachterstatus vereinbart werden. Die Grundlage der Beziehungen kann informeller Art sein, sich aus einer Satzung335 oder einem Beschluss der jeweiligen internationalen Organisation336 ergeben oder auf konkreten Absprachen337 beruhen. Ein Beitritt zu einer internationalen Organisation ist zwar grundsätzlich möglich (und bei der FAO und der WTO bereits verwirklicht), bedarf aber einer entsprechenden Vertragsschlusskompetenz aus dem EG-Vertrag (z. B. Art. 133 EG).338 von Burchard, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 155 EGV Rdnr. 15. Schäfer, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 155 EGV Rdnr. 47 a. E. 333 Röttinger, in: Lenz, EG-Vertrag Kommentar, Art. 304 EGV Rdnr. 2; Schmalenbach, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 302 EGV Rdnr. 1. 334 Osteneck, in: Schwarze, EU Kommentar, Art. 302 EGV Rdnr. 3. 335 Z. B. Art. 75 der Geschäftsordnung des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen von 1983, UN-Doc E / 5715 / Rev.1. 336 Z. B. UN-Generalversammlung, Resolution 3208 (XXIX) vom 11. 07. 1974, General Assembly Official Records (GAOR), 29th Session, Supplement 31, S. 2. 337 Z. B. Briefwechsel zwischen den Europäischen Gemeinschaften und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Regelung der Zusammenarbeit, ABl. 2001 C 1, 7. 338 Osteneck, in: Schwarze, EU Kommentar, Art. 302 EGV Rdnr. 3. 331 332
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
99
Der EG steht zwar im Rahmen der Art. 302 – 304 EG grundsätzlich keine Vertragsschlusskompetenz zu. Ihr wird jedoch die Kompetenz zuerkannt, Verwaltungsabkommen (working arrangements) zur Regelung der Modalitäten der Beziehungspflege zu schließen. Eine solche Kompetenz ist zu bejahen, wenn das Verwaltungsabkommen als Grundlage oder im Rahmen der Beziehungspflege keine ins Gewicht fallenden Verpflichtungen und keinen über die Ausführung des Haushaltsplans hinausgehenden finanziellen Aufwand bedeutet sowie nach Gemeinschaftsrecht in den Zuständigkeitsbereich der Kommission fällt.339 Die Kommission hat von dieser Möglichkeit bereits mehrfach Gebrauch gemacht.340 Weiterhin hat die Kommission bei einigen internationalen Organisationen ständige Delegationen eingerichtet. 341 Der Begriff „internationale Organisationen“ ist weit zu verstehen und umfasst neben klassischen internationalen Organisationen342 mit partieller Völkerrechtssubjektivität auch internationale Konferenzen, die unter der Schirmherrschaft von Staaten oder internationalen Organisationen stehen und Kontakte zu Nichtregierungsorganisationen. Die Art. 302 – 304 EG sprechen jeweils von „zweckdienlichen Beziehungen“ bzw. „zweckdienlicher Zusammenarbeit“ und „enges Zusammenwirken“. Dabei ist zweckdienlich alles, was den Zielen des EG-Vertrages (Art. 2 – 4 EG) dient.343 Angesichts des Ermessens der Kommission bei der Beurteilung der Zweckdienlichkeit ist kaum eine internationale Organisation vorstellbar, zu der die Gemeinschaft nicht auf der Grundlage des Art. 302 Abs. 2 EG Beziehungen aufnehmen könnte.344 Die feinen Abstufungen im Wortlaut der verschiedenen Artikel haben in der Praxis keine Bedeutung. De facto ist es immer die Kommission, die auf internationaler Ebene handelt.345
339 Kokott, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 302 EGV Rdnr. 9; Frid, The Relations Between The EC And International Organizations, S. 129, 157; nach Vedder, Die auswärtige Gewalt des Europa der Neun, S. 169, dürfen solche Abkommen die Gemeinschaft nicht inhaltlich verpflichten; Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 192, verweist darauf, dass es sich bei Verwaltungsabkommen nicht um außenwirksame, sondern bloß um innenwirksame Rechtsakte handelt. 340 Osteneck, in: Schwarze, EU Kommentar, Art. 302 EGV Rdnr. 9 spricht von derzeit 70 solcher Verwaltungsabkommen. 341 So z. B. bei der OECD, UN, OPEC, UNIDO und der IAEO; vgl. hierzu auch MacLeod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Communities, S. 221 ff. 342 Kontakte bestehen zu Customs Co-operation Council (CCC); International Standardization Organization (ISO); International Council for the Exploration of the Sea (ICES); International Office for Epizootic (IOE); International Office for Legal Metrology (IOLM); Council for Mutual Economic Assistance (CMEA); World Tourism Organization (WTO) und zur Organisation für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). 343 Schmalenbach, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 302 EGV Rdnr. 1. 344 Osteneck, in: Schwarze, EU Kommentar, Art. 302 EGV Rdnr. 7 a. E. 345 Röttinger, in: Lenz, EG-Vertrag Kommentar, Art. 304 EGV Rdnr. 3.
7*
100
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
a) Beziehungen zu den Vereinten Nationen (Art. 302 Abs. 1 EG) Art. 302 Abs. 1 EG hebt die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen als der bedeutendsten internationalen Organisation besonders hervor. Weder die EG noch die EU sind Mitglieder der UN; allerdings sind alle EU-Mitgliedstaaten auch UN-Mitglieder. Die EG hat als Nichtmitglied in der Generalversammlung kein Stimmrecht, die Mitgliedstaaten koordinieren sich jedoch regelmäßig intern in New York oder Brüssel und stimmen erst anschließend ab.346 Die UN-Generalversammlung hat der Gemeinschaft 1974 unbeschränkten Beobachterstatus mit Rederecht eingeräumt.347 Dies beinhaltet das Recht zur Teilnahme an Beratungen der Generalversammlung und ihrer Hauptausschüsse. Die Gemeinschaft hat jedoch weder das Vorschlags- noch das Antragsrecht und das Rederecht steht ihr nur in den Hauptausschüssen zu.348 Die Gemeinschaft pflegt nicht nur zur Generalversammlung, sondern auch zu den übrigen Hauptorganen der UN349 Kontakte. Darüber hinaus ist die EG in vielen UN-Nebenorganen350, autonomen Unterorganen351, technischen352 und politischen353 Unterorganen und den UN-Fachorganisationen354 vertreten. Die Rederechte und die Rechte aus dem aktiven oder passiven Beobachterstatus werden von der Kommission und dem Rat gemeinsam wahrgenommen (sog. bizeKokott, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 44. Brückner, EJIL, 1990, 174 (176); Generalversammlung, Resolution 3208 (XXIX) vom 11. 07. 1974, General Assembly Official Records (GAOR), 29th Session, Supplement 31, S. 2. 348 Osteneck, in: Schwarze, EU Kommentar, Art. 302 EGV Rdnr. 12. 349 Sicherheitsrat, Sekretariat, Internationaler Gerichtshof, Wirtschafts- und Sozialrat, Treuhandrat. 350 Teilnahme an den Kommissionen des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen: Economic Commission for Europe (ECE); Economic Commission for Latin America and the Caribic (ECLAC); Economic Commission for Asia and the Pacific (ESPAP); Economic Commission for Africa (ECA); Economic Commission for West Asia (ECA). 351 United Nations Children’s Fund (UNICEF), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Fund for Population Activities (UNFPA), World Food Council (WFC). 352 United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 353 United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees (UNRWA). 354 International Monetary Fund (IMF), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Finance Corporation (IFC), International Maritime Organization (IMO), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), International Development Association (IDS); United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), International Civil Aviation Organization (ICAO), International Telecommunication Union (ITU), World Health Organization (WHO), World Postal Union (WPU), World Intellectual Property Organization (WIPO), World Meteorological Organization (WMO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Labour Organization (ILO); am 26. 11. 1991 ist die EG der United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) als Mitglied beigetreten. 346 347
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
101
phale Vertretung). Diese „doppelköpfige Vertretung“ wird durch eine Delegation aus Mitgliedern der Kommission und der Präsidialmacht, d. h. demjenigen Mitgliedstaat, der im Rat gerade den Vorsitz innehat, wahrgenommen.355 b) Zusammenarbeit mit dem Europarat (Art. 303 EG) Nach Art. 303 EG führt die Gemeinschaft jede zweckdienliche Zusammenarbeit mit dem Europarat herbei. Art. 303 EG ist lex specialis zu Art. 302 EG. Die wesentlichen Aufgaben des 1949 gegründeten Europarates sind die gemeinsame Förderung der Menschenrechte sowie des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts in Europa, vgl. Art. 1 der Satzung des Europarates.356 Wie auch im Fall der UN ist weder die EU noch die EG Mitglied der Organisation357. Die Zusammenarbeit zwischen EG und Europarat besteht vorrangig in der Koordination von EGMaßnahmen mit denjenigen des Europarates in überschneidenden Themenbereichen wie Erziehung, Jugend, Bildung, Gesundheit und Kultur.358 Ein Beitritt zur EMRK sowie zu den 70 weiteren Konventionen des Europarates ist auf Grundlage des Art. 303 EG nach einem Gutachten des EuGH zu dieser Frage nicht möglich.359 Die Kommission vertritt die Gemeinschaft im Europarat, ist jedoch wiederum zur Konsultation des Rates in Fragen der Zusammenarbeit verpflichtet.360 Eine Vereinbarung361 zwischen der Gemeinschaft und dem Europarat lässt einen Dokumentenaustausch sowie die Teilnahme der Kommission an den Arbeitsgruppen zu Konventionsentwürfen, den Treffen der Staats- und Regierungschefs362, den Sitzungen der Ministerkomitees363 sowie den Konferenzen der Fach355 Schmalenbach, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 302 EGV Rdnr. 6; Schloh, Die Stellung der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Organe in internationalen Organisationen, in: Kölner Schriften zum Europarecht, Bd. 25, S. 83 (94). Die Kommission als eigentliches Exekutivorgan der Gemeinschaft ist aber nicht nur durch diese doppelköpfige Vertretung in ihrer Handlungsmacht beschränkt, vielmehr wurde ihre Macht auch durch den Luxemburger Kompromiss von 1966 erheblich beschnitten. Nach diesem Kompromiss muss die Kommission den Rat bei Fragen der Zweckmäßigkeit, der Modalität und Art der Beziehungen zu internationalen Organisationen konsultieren. Diese Beschränkung besteht auch nach Inkrafttreten des Vertrags von Nizza fort. 356 Osteneck, in: Schwarze, EU Kommentar, Art. 303 EGV Rdnr. 1. 357 Einen Beitritt der Gemeinschaft verhindert schon Art. 4 der Satzung des Europarates (betreffend die Regelungen zum Beitritt): „Jeder europäische Staat . . .“. 358 Schmalenbach, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 303 EGV Rdnr. 2; durch den Vertrag von Maastricht wurden mit Art. 149 Abs. 3 EG und Art. 151 Abs. 3 EG ergänzende Vorschriften zur Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung und Kultur eingeführt. 359 EuGH, Slg. 1996, I-1763 (Rdnr. 27) – Gutachten 2 / 94, EMRK; außerdem können der EMRK nur Mitglieder des Europarates beitreten (Art. 59 EMRK), Mitglieder des Europarates können aber nach der Satzung des Europarates nur europäische Staaten werden (Art. 4 Satzung des Europarates, s. o., Fn. 357). 360 Bull. EU 9 – 1996, S. 115 f. 361 ABl. 1987 L 273, 35. 362 Bull. EG 10 – 1997, Ziff. 1. 3. 12.
102
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
minister zu. Eine „organverschränkende Zusammenarbeit“ findet durch eine gemeinsame Tagung der Beratenden Versammlung des Europarates und des Europäischen Parlaments einmal jährlich in Straßburg statt.
c) Zusammenwirken mit der OECD (Art. 304 EG) Schließlich postuliert Art. 304 EG ein enges Zusammenwirken zwischen der EG und der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Auch Art. 304 EG ist lex specialis zu Art. 302 EG. Die Ziele der EG und der OECD sind teilweise parallel.364 Daher hat sich die Gemeinschaft schon an der Gründung365 und an der Arbeit der OECD beteiligt. Die Kommission nimmt die Vertretung in den Gremien der OECD für die Gemeinschaft wahr und unterhält hierfür eine ständige Vertretung am Sitz der OECD in Paris. Die Kommission kann als Beobachterin ohne spezielle Einladung an allen Gremien, mit Ausnahme des Haushaltsausschusses, ohne spezielle Einladung teilnehmen und genießt das Redeund Vorschlagsrecht.366 Ein Beitritt zu den Vereinbarungen der OECD ist der Gemeinschaft jedoch nicht aufgrund des Art. 304 EG, sondern nur dann möglich, wenn eine ausdrückliche Sachkompetenz im EG-Vertrag gegeben ist.367
V. Ausdrückliche Kompetenzen im Bereich der Wirtschaftssanktionen 1. Kapital- und Zahlungsverkehr, Art. 57, 59 f. EG Im Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs gibt der EG-Vertrag der Gemeinschaft zwar keine Vertragsabschlusskompetenz (treaty-making-power), wohl aber Handlungskompetenzen in Bezug auf die Außenbeziehungen der Gemeinschaft. a) Grundlagen Art. 56 EG gewährleistet die Freiheit des Kapitalverkehrs. Die „vierte Marktfreiheit“ umfasst die einseitige Werteübertragung in Form von Sachkapital (ImmobiBull. EG 4 – 1997, Ziff. 11. 4. 20; Bull. EG 9 – 1997, Ziff. 1. 3. 13. Zu den Zielen der OECD gehören u. a. eine optimale Wirtschaftsentwicklung, Beschäftigung, steigender Lebensstandard und wirtschaftliches Wachstum, Art. 1 OECD Übereinkommen, BGBl. 1961 II, 1151. 365 Übereinkommen über die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von 1960, in Kraft getreten am 30. 09. 1961, abgedr. in BGBl. 1961 II, 1151. 366 Osteneck, in: Schwarze, EU Kommentar, Art. 304 EGV Rdnr. 3. 367 EuGH, Slg. 1975, 1355 (1361 f.) – Gutachten 1 / 75, Lokale Kosten. 363 364
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
103
lien, Unternehmensbeteiligungen) oder in Form von Geldkapital (gesetzliche Zahlungsmittel, Wertpapiere, Kredite) aus einem Mitgliedstaat in einen anderen, die regelmäßig zugleich eine Vermögensanlage darstellt.368 Art. 56 Abs. 2 EG statuiert die Freiheit des Zahlungsverkehrs („fünfte Marktfreiheit“). Diese Freiheit dient vor allem dem Funktionieren des freien Binnenmarktes bei der Erbringung von Gegenleistungen im Zusammenhang mit dem Waren- und Dienstleistungsverkehr.369 Die Grundfreiheiten sind prinzipiell nur in den Mitgliedstaaten gültig. Art. 56 EG ist insofern eine Ausnahme, als der Anwendungsbereich nach dem Wortlaut der Vorschrift auch Drittstaaten erfasst, also über das Gebiet der EU hinaus reicht (erga-omnes-Prinzip). Mit Hinweis auf den Wortlaut wird Drittstaatsangehörigen sogar gestattet, sich individuell auf diese Freiheit zu berufen.370 Die Ausdehnung der Kapitalverkehrsfreiheit auf Drittstaaten diente unter anderem dazu, die weltweite Verfügbarkeit des Euros sicherzustellen.371 Die Art. 57 – 60 EG ermöglichen Beschränkungen des grundsätzlich freien Kapitalverkehrs im Verhältnis zu Drittstaaten. Art. 57 EG statuiert Ausnahmen auf wirtschaftlich besonders sensiblen Gebieten. Art. 59 EG erlaubt befristete Schutzmaßnahmen und Art. 60 EG ermöglicht die Verhängung von Wirtschaftssanktionen.
b) Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit, Art. 57 EG Art. 57 EG ist eine Ausnahmevorschrift zu Art. 56 EG. Art. 57 Abs. 2 EG ermächtigt den Rat, den Anwendungsbereich der Kapitalverkehrsfreiheit zu beschränken; der Zahlungsverkehr ist dagegen nicht Gegenstand der Bestimmung.372 Da die Vorschrift keine Festlegung über die Art der Maßnahme oder die Wahl des Instrumentariums trifft, kann die Gemeinschaft durch beliebige Rechtsakte (z. B. Richtlinien oder Verordnungen)373 die Kapitalverkehrsfreiheit mit Drittstaaten beschränken. Die Vorschrift soll der Gemeinschaft eine eigenständige Verhandlungsführung einräumen und ihre Handlungsfähigkeit im Verkehr mit Drittstaaten sichern.374 Die Kompetenz nach Art. 57 EG ist eine ausschließliche Gemeinschaftskompetenz.375 Nach Inkrafttreten der zweiten Stufe der Wirtschafts- und Währungs368 369 370 371 372 373 374
Koenig / Haratsch, Europarecht, S. 262. Herdegen, Europarecht, S. 269. Bröhmer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 56 EGV Rdnr. 5. Bröhmer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 57 EGV Rdnr. 1. Weber, in: Lenz, EG-Vertrag Kommentar, Art. 57 EGV Rdnr. 1. Weber, EuZW 1992, 561 (566). Bröhmer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 57 EGV Rdnr. 8.
104
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
union am 01. 01. 1994 ist die Regelung des Kapitalverkehrs in die Gemeinschaftskompetenz übergegangen. Die Mitgliedstaaten dürfen zwar diejenigen Restriktionen aufrechterhalten, die sie vor Eintritt der zweiten Stufe beschlossen haben, jedoch ist der Kapitalverkehr mit Drittstaaten seit 1994 nunmehr Gegenstand der EG-Kompetenz. Dass diese Kompetenz eine ausschließliche sein muss und dass kein Raum für mitgliedstaatliche Maßnahmen besteht, verdeutlicht der Umstand, dass solche Maßnahmen direkt die anderen Mitgliedstaaten betreffen würden, nachdem alle Schranken zwischen den Mitgliedstaaten mit dem Eintritt der zweiten Stufe gefallen sind. Daher muss die Gemeinschaft ausschließlich für solche Maßnahmen zuständig sein. Ein Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion wäre nicht gewährleistet, wenn die Handlungskompetenz weiterhin bei den Mitgliedstaaten verbleiben würde.376
c) Kurzfristige Schutzmaßnahmen für das Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion, Art. 59 EG Art. 59 EG gibt der EG eine weitere Außenkompetenz: Er ermächtigt die EG, Schutzmaßnahmen gegen drohende oder schon eingetretene Gefahren für das Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion zu treffen. Diese Gefahren müssen aus Kapitalbewegungen von oder aus Drittländern resultieren. Die Vorschrift ist restriktiv zu verstehen: zum einen müssen die Abwehrmaßnahmen schwerwiegende Störungen betreffen, es müssen außergewöhnliche Umstände vorliegen, und die Maßnahmen müssen schließlich geeignet sein, die Gefahr abzuwenden oder zu mildern.377 Der Kommission, der das Vorschlagsrecht zusteht, kommt allerdings ein weiter Beurteilungs- und Prognosespielraum zu.378 Hinsichtlich der Art der Maßnahme hat der Rat die Wahlfreiheit. Hinsichtlich des Inhalts der Maßnahmen ist die EG aber zusehends durch Liberalisierungsverpflichtungen aus völkerrechtlichen Abkommen (OECD, WTO) beschränkt.
375 So auch Glaesner, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 57 EGV Rdnr. 6, der die Ausschließlichkeit bejaht aber auf das Verhältnismäßigkeitsprinzip hinweist; a.A. Weber, EuZW 1992, 561 (566). Nach der von Weber vertretenen Ansicht darf die Gemeinschaft gemäß dem Subsidiaritätsprinzip (Art. 5 EG) nur insofern und insoweit tätig werden, als die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht angemessen erreicht werden können und z. B. wegen ihres Umfanges oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene zu verwirklichen sind, Weber, in: Lenz, EG-Vertrag Kommentar, Art. 57 EGV Rdnr. 4. 376 Smits, Freedom of payments an capital movements under EMU, in: Weber (Hrsg.), FS für Hahn, S. 245 (256). 377 Siehe Smits, Freedom of payments an capital movements under EMU, in: Weber (Hrsg.), FS für Hahn, S. 245 (256 f.). 378 Bröhmer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 59 EGV Rdnr. 7.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
105
d) Embargofälle, Art. 60 EG Auch Art. 60 EG räumt dem Rat die Kompetenz ein, nach außen für die EG zu handeln. Im Unterschied zu Art. 59 EG, der Gefahren für das Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion bekämpfen soll, geht es bei Art. 60 EG um die Beschränkung des Kapital- und Zahlungsverkehrs aus politischen Gründen (Embargofälle).379 Art. 60 EG verweist auf die Voraussetzungen des Art. 301 EG und ist gleichzeitig lex specialis zu dieser Vorschrift.380 Somit findet eine Anbindung an die GASP statt. Ein Tätigwerden der Gemeinschaft kann also dann stattfinden, wenn gemeinsame Aktionen (Art. 14 EU) oder gemeinsame Standpunkte (Art. 15 EU), die nach den Bestimmungen des EU-Vertrags über die GASP angenommen worden sind, ein solches Tätigwerden ermöglichen. Fraglich ist indessen, ob dem Rat gemäß dem Wortlaut („kann . . . ergreifen“) ein Ermessenspielraum bezüglich des Ergreifens der Maßnahme zusteht oder nicht. Ein Ermessen wird von einigen Autoren mit dem Hinweis verneint, dass den nach den Vorschriften der GASP erlassenen Rechtsakten im Rahmen des Art. 60 EG sinnvoller Weise keine schwächere Wirkung zukommen kann als im Rahmen des Art. 301 EG.381 Andere Autoren halten zu Recht mit Hinweis auf den klaren Wortlaut der Vorschrift an einem Ermessensspielraum fest.382 Dies ist auch mit dem kleineren Anwendungsbereich des Art. 60 EG im Vergleich zu Art. 301 EG gerechtfertigt, denn Art. 60 EG erfasst nur einen bestimmten Ausschnitt an Wirtschaftssanktionen (nämlich den Kapitalund Zahlungsverkehr). Nach Art. 60 EG kann der Rat die „notwendigen Sofortmaßnahmen“ treffen. Das bedeutet, dass die zu ergreifenden Maßnahmen verhältnismäßig sein müssen. Dem Rat kommt allerdings ein weiter Beurteilungs- und Prognosespielraum zu. Des Weiteren ist bei der Auslegung des Art. 60 EG zu beachten, dass er den Mitgliedstaaten der Union ermöglichen soll, den Verpflichtungen nachzukommen, die die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen mit sich bringt, nämlich insbesondere der Umsetzung von im Sicherheitsrat beschlossenen Embargos. Damit kommt dem 379 Smits, Freedom of payments an capital movements under EMU, in: Weber (Hrsg.), FS für Hahn, S. 245 (257), nennt diese Möglichkeiten „freezing measures“, bzw. „financial freeze“. Maßnahmen, die aufgrund von Art. 60 EG erlassen wurden, sind z. B.: VO (EG) Nr. 2488 / 2000 des Rates vom 10. 11. 2000 über die Aufrechterhaltung des Einfrierens von Geldern betreffend Herrn Milosevic und Personen seines Umfeldes und die Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 1294 / 1999 und (EG) Nr. 607 / 2000 sowie des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 926 / 98, ABl. 2000 L 287, 19; VO (EG) Nr. 337 / 2000 des Rates vom 14. 02. 2000 über ein Flugverbot und das Einfrieren von Geldern und anderen Finanzmitteln der Taliban von Afghanistan, ABl. 2000 L 43, 1. 380 Bröhmer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 60 EGV Rdnr. 1. 381 Sedlaczek, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 60 EGV Rdnr. 10. 382 Kiemel, in: von der Groeben / Thiesing / Ehlermann, EG Kommentar, Art. 73g EGV Rdnr. 5; Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 200: „In diesem Entschließungsermessen des Rates liegt keine Systemwidrigkeit . . .“.
106
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Verhältnismäßigkeitsprinzip im Rahmen des Art. 60 EG keine entscheidende Bedeutung zu. Der Begriff „Sofortmaßnahme“ deutet nicht darauf hin, dass die EG nur vorläufige, nicht jedoch endgültige Maßnahmen treffen darf. Eine solche vorläufige „Eilzuständigkeit“ wäre nicht mit den Abs. 2 und 3 des Art. 60 EG vereinbar. Zum einen gilt die in Abs. 2 den Mitgliedstaaten eingeräumte Handlungsbefugnis nur „solange“, bis der Rat die erforderlichen Maßnahmen selbst ergreift. Zum anderen stehen die mitgliedstaatlichen Maßnahmen gemäß Abs. 3 unter einem Kontrollvorbehalt des Rates. Dies bedeutet, dass die Verbandskompetenz letztendlich bei der EG liegen und diese gerade nicht nur vorläufige Maßnahmen treffen soll.383 Wie gerade angesprochen ermöglicht es Art. 60 Abs. 2 EG den Mitgliedstaaten, unter engen Voraussetzungen Dringlichkeitsmaßnahmen selbst zu erlassen. Diese Möglichkeit besteht nur, solange erstens der Rat noch keine Maßnahmen nach Abs. 1 erlassen hat. Zweitens müssen schwerwiegende politische Umstände vorliegen, die Maßnahme darf also nicht der Protektion der eigenen Wirtschaft dienen. Drittens besteht eine Pflicht, die Kommission über die Maßnahme spätestens bei deren Inkrafttreten zu unterrichten. Darüber hinaus folgt aus dem Grundsatz der Gemeinschaftstreue (Art. 10 EG), dass der jeweilige Mitgliedstaat die Kommission so früh und so umfassend wie möglich von der beabsichtigten Maßnahme informieren muss.384 Der Rat kann schließlich mit qualifizierter Mehrheit beschließen, dass der betreffende Mitgliedstaat die von ihm beschlossene Maßnahme aufzuheben oder abzuändern hat (Art. 60 Abs. 2 S. 3 EG). Aus dem Wortlaut der Vorschrift ist indes nicht ersichtlich, ob die Befugnis der Mitgliedstaaten, eigene Maßnahmen zu ergreifen, erst dann endet, wenn der Rat positiv eigene Maßnahmen nach Abs. 1 beschließt oder ob die Kompetenz der Mitgliedstaaten bereits mit der Befassung des Rates, also auch bei einer möglichen negativen Entscheidung über die Maßnahme, endet. Für ein solch frühes Enden der mitgliedstaatlichen Kompetenz spricht Art. 60 Abs. 2 S. 3 EG, nach dem der Rat den Mitgliedstaat zur Aufhebung der Maßnahme zwingen kann. Dies weist auf ein Letztentscheidungsrecht der EG hin, welches umgangen werden würde, falls ein Mitgliedstaat trotz entgegenstehender Auffassung des Rates eigenmächtig Maßnahmen erlassen dürfte. Andererseits betrifft das Verhängen eines Embargos oder einer Sanktion den Kernbereich staatlicher Souveränität. Dies belegt auch die enge Verknüpfung mit der GASP, die mit dem Verweis auf Art. 301 EG bewirkt wird. In diesen Bereichen bedarf die Einschränkung mitgliedstaatlicher Kompetenzen einer besonderen Rechtfertigung und Begründung. Eine solche ist indes nicht gegeben, da der Gemeinschaftswille mit der Möglichkeit des Art. 60 Abs. 2 S. 3 EG (nach dem der Rat den Mitgliedstaat zur Aufhebung der Maßnahme zwingen kann) letztendlich doch durchgesetzt werden kann. Problematisch kann jedoch der Fall werden, dass der Rat beschließt, keine Maßnahmen zu ergreifen, ein Mitglied383 384
Bröhmer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 60 EGV Rdnr. 5. Bröhmer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 60 EGV Rdnr. 6.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
107
staat diese dann aber doch ergreift; in einem solchen Fall wäre ein gegebenenfalls politisch brisanter zweiter Ratsbeschluss nötig, der den betreffenden Mitgliedstaat zwingt, seine Maßnahmen aufzuheben oder abzuändern.385
2. Wirtschaftssanktionen aufgrund von GASP-Beschlüssen, Art. 301 EG a) Entstehungsgeschichte Mit Art. 301 EG verfügt die Gemeinschaft über eine explizite Kompetenzgrundlage zur Verhängung von Wirtschaftssanktionen.386 Die Vorschrift wurde durch den Vertrag von Maastricht erstmals in den Vertrag eingefügt (Art. 228 a EGV). Lange Zeit konnten Wirtschaftssanktionen nur (gegebenenfalls im Rahmen der EPZ koordiniert) von den einzelnen Mitgliedstaaten selbst erlassen werden, bis sich im Jahre 1982 der Rat entschloss, im Rahmen eines weiten Begriffsverständnis diese wegen ihres Bezuges zum handelspolitischen Instrumentarium unter die Außenhandelskompetenz nach Art. 113 EWG (jetzt Art. 133 EG) fallen zu lassen.387 Art. 301 EG begründet eine ausschließliche Gemeinschaftskompetenz, die jedoch durch den Erlass eines GASP-Beschlusses aufschiebend bedingt ist.388
b) Völkerrechtliche Grenzen bei der Verhängung von Wirtschaftssanktionen Unter den Begriff „Wirtschaftssanktionen“ fallen alle außenpolitischen Maßnahmen, die die Reduktion der Wirtschaftsbeziehungen zu einem rechtswidrig handelnden Völkerrechtssubjekt beinhalten und ergriffen werden, um dessen völkerrechtskonformes Verhalten zu erzwingen.389 Aus völkerrechtlicher Sicht darf die EG als internationale Organisation Wirtschaftssanktionen verhängen, wenn sie in Bröhmer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 60 EGV Rdnr. 7. Siehe zum Ganzen sehr instruktiv Osteneck, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 1 ff. 387 Vgl. zur Lage vor Einfügung des Art. 228 a EGV MacLeod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Communities, S. 352 ff.; Osteneck, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 1; Osteneck, Die Umsetzung von Wirtschaftssanktionen durch die Europäische Gemeinschaft, S. 139 ff. 388 Osteneck, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 3; zur Möglichkeit weiterer einzelstaatlicher Maßnahmen, falls der GASP-Beschluss einen Spielraum für mitgliedstaatliche Sanktionen gelassen hat oder UN-Sanktionen ersichtlich unvollständig oder falsch implementiert wurden, siehe Kokott, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 28 f. 389 Osteneck, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 4. 385 386
108
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
eigenen Rechten verletzt ist oder wenn eine Verletzung der Rechte ihrer Mitgliedstaaten vorliegt. Davon abgesehen ist die EG befugt, als ultima ratio Sanktionen als Reaktion auf die Verletzung von erga omnes Pflichten390 zu verhängen. Erlässt die EG Sanktionen zur Umsetzung von UN-Sicherheitsratsresolutionen, so sind diese völkerrechtlich unmittelbar aus dem Satzungsrecht der Vereinten Nationen gerechtfertigt.391 Wirtschaftssanktionen können als Retorsionen, als unfreundliche, interessenschädigende aber völkerrechtsmäßige Akte verhängt werden. An sich rechtswidrige Wirtschaftssanktionen können als Repressalien, also als nach erfolgloser Mahnung vorgenommene Reaktion auf eine Völkerrechtsverletzung des Sanktionsadressaten im Sinne eines verhältnismäßigen, unmittelbaren Eingriffs in dessen Rechtsgüter zur Wiederherstellung des Rechts gerechtfertigt sein.392
c) Umfang der Wirtschaftssanktionen Potenzielles Sanktionsobjekt von Wirtschaftssanktionen ist jeder Gegenstand, an dessen Austausch ein primär wirtschaftliches Interesse besteht.393 Wirtschaftssanktionen müssen sich nicht nur auf Handelssanktionen beschränken, sie können auch z. B. den Dienstleistungsverkehr und das Verkehrs- oder Transportwesen sowie zivilrechtliche sanktionsbegleitende Regelungen umfassen.394 Der Bezug auf „Wirtschaftsbeziehungen“ in Art. 301 EG macht deutlich, dass Sanktionen auch auf dem Gebiet von Waffen und militärischem Gerät erlassen werden können.395 Nicht erfasst werden dagegen Maßnahmen im Bereich der diplomatischen, kulturellen, wissenschaftlichen und sportlichen Beziehungen.396 Die Gemeinschaft darf Wirtschaftssanktionen gegenüber Drittstaaten sowie gegenüber Gebieten verhängen, die keine Staaten – oder noch keine Staaten – im Sinne des Völkerrechts sind. Sanktionen gegenüber anderen internationalen Organisationen sind jedoch ausgeschlossen. 390 Zur Frage, ob Bestimmungen der UN-Charta im Sinne einer „Weltverfassung“ mit absoluter Geltung eine Wirkung erga omnes haben können, vgl. Osteneck, Die Umsetzung von Wirtschaftssanktionen durch die Europäische Gemeinschaft, S. 300 ff. 391 Dem Sanktionsbeschluss des Sicherheitsrates kommt unmittelbare Legalisierungswirkung zu, Osteneck, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 4. 392 Kißler, Die Zulässigkeit von Wirtschaftssanktionen der Europäischen Gemeinschaft gegenüber Drittstaaten, S. 90. 393 Schneider, Wirtschaftssanktionen, S. 28. 394 Osteneck, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 5. 395 Osteneck, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 18, weist darauf hin, dass, obwohl GASP-Beschlüsse mit solchem Inhalt schon vorlagen, die Kommission von dieser Kompetenz in der Vergangenheit noch keinen Gebrauch gemacht hat; Kokott, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 15. 396 Schneider, Wirtschaftssanktionen, S. 28.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
109
Das Tätigwerden der Gemeinschaft ist an einen GASP-Beschluss gekoppelt. Dieser muss das „ob“ der Sanktionen enthalten, also insbesondere eine Festlegung hinsichtlich des Adressaten, des Ziels, der Reichweite und des ungefähren Inhalts der Maßnahme und grundsätzlich ein Tätigwerden der Gemeinschaft vorsehen. Ohne einen solchen Beschluss darf die Gemeinschaft nicht handeln. Wenn ein GASP-Beschluss vorliegt, kann die Gemeinschaft, meist in Form einer Verordnung, die Art und Weise der Durchführung (das „wie“) beschließen.397 Die wichtigste Form der Wirtschaftssanktion ist das Embargo.398
d) Verhältnis zu anderen Außenkompetenzen der Gemeinschaft aus dem EG-Vertrag Wie oben bereits erwähnt, ist Art. 60 EG für Wirtschaftssanktionen im Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs lex specialis zu Art. 301 EG. Ebenfalls schon angesprochen wurde die grundsätzliche Möglichkeit, aufgrund der in Art. 133 EG eingeräumten Außenhandelskompetenz Wirtschaftssanktionen gegenüber Drittstaaten zu erlassen. Liegt jedoch ein GASP-Beschluss vor, ist Art. 301 EG lex specialis zu Art. 133 EG. Eine subsidiäre Anwendbarkeit des Art. 133 EG in Fällen, in denen kein GASP-Beschluss (entweder noch nicht oder ein am Einstimmigkeiterfordernis gescheiterter) vorliegt und der Bereich der Handelspolitik betroffen ist, wird bejaht. Dies wird vor allem mit Art. 47 EU begründet, der besagt, dass der EU-Vertrag die Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie die nachfolgenden Verträge und Akte zur Änderung oder Ergänzung unberührt lässt.399 Weil Art. 133 EG durch das Inkrafttreten des EU-Vertrages unberührt blieb, ist er in vollem Umfang anwendbar. Für eine subsidiäre Anwendbarkeit des Art. 133 EG spricht auch dessen – im Verhältnis zu Art. 301 EG – kleinerer Anwendungsbereich. Wie gerade dargestellt, umfasst Art. 133 EG lediglich die Außenhandelspolitik, während Art. 301 EG die gesamte Wirtschaftspolitik umfasst. Damit ist auch das Argument aus dem Wege geräumt, bei einer Anwendbarkeit des Art. 133 EG sei Art. 301 EG zu einer Verfahrensvorschrift reduziert.400 Art. 301 EG stellt somit eine (nur) partiell verdrängende Sonderregelung zu Art. 133 EG dar.401 397 Zur umfangreichen Praxis der Gemeinschaft im Bereich der Wirtschaftssanktionen, vgl. Osteneck, Die Umsetzung von Wirtschaftssanktionen durch die Europäische Gemeinschaft, S. 357 ff.; zur Frage, ob die Gemeinschaft zu einem derartigen Durchführungsvorschlag verpflichtet ist, vgl. die Ausführungen unten. 398 Das Wort „Embargo“ leitet sich ab von dem spanischen Verb „embargar“, was soviel heißt wie „anhalten“ oder „beschlagnahmen“, siehe Schneider, Wirtschaftssanktionen, S. 35. 399 Osteneck, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 16. 400 Kokott, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 14. 401 Kokott, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 52.
110
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Im Ergebnis bleibt festzuhalten: Kann sich der Rat im Rahmen der GASP nicht auf einen Beschluss einigen, so ist die Gemeinschaft befugt, auf der Grundlage des Art. 133 EG Wirtschaftssanktionen zumindest auf dem Gebiet des Handelsverkehrs zu erlassen. Von Wirtschaftssanktionen aufgrund von GASP-Beschlüssen gemäß Art. 301 EG sind schließlich die handelspolitischen Schutzmaßnahmen nach Art. 133 EG abzugrenzen. Handelspolitische Schutzmaßnahmen (engl.: economic safeguard measures, franz.: mesures de défense commerciale) sind hoheitliche Vorschriften, die vorrangig zum Schutz der eigenen Wirtschaft ergriffen werden, um diese vor akuten oder drohenden Schädigungen durch unfaire Handelspraktiken zu schützen.402 Diese autonomen Instrumente der gemeinsamen Handelspolitik umfassen, wie bereits oben dargestellt403, Schutzmaßnahmen gegen Dumping und Subventionen.404 Sie gleichen den Wirtschaftssanktionen nach Art. 301 EG insofern, als sie ebenfalls eine Reaktion auf ein Verhalten von dritter Seite und eine für die wirtschaftlichen Interessen dieses Dritten schädliche Aktion darstellen. Der Unterschied zwischen ihnen liegt jedoch darin, dass es sich bei den Sanktionen nach Art. 301 EG um Aktionen gegen ein anderes Völkerrechtssubjekt handelt, wohingegen handelspolitische Schutzmaßnahmen nach Art. 133 EG sich meist gegen private Wirtschaftsteilnehmer richten, die sich durch Wettbewerbsverfälschungen (z. B. Dumping) Vorteile gegenüber Gemeinschaftserzeugern verschaffen.405 Wirtschaftssanktionen betreffen sowohl einheimische Wirtschaftsteilnehmer wie auch solche aus Drittländern, da der Außenwirtschaftsverkehr in beide Richtungen ganz oder teilweise unterbrochen wird. Handelspolitische Schutzmaßnahmen setzen dagegen direkt bei den ausländischen Wirtschaftsteilnehmern an, indem z. B. Ausgleichszölle erhoben werden.406 Kurz gesagt fehlt den handelspolitischen Schutzmaßnahmen nach Art. 133 EG eine über die Handelspolitik hinausgehende außenpolitische Zielsetzung.407 Einzelstaatliche Sanktionen nach Art. 297 EG sind, nachdem eine Gemeinschaftssanktion nach Art. 301 EG erlassen wurde, grundsätzlich unzulässig.408 Schneider, Wirtschaftssanktionen, S. 44. s. oben, § 4 III. 3. b). 404 Vgl. Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 202. 405 Müller-Huschke, in: Schwarze, EU-Kommentar, Vorbem. Art. 131 – 134 EGV; Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 204. 406 Im Fall von Dumping bis zur Höhe der Dumpingspanne, also der Differenz zwischen dem Normalpreis einer Ware im Herkunftsland und dem (gedumpten) Ausfuhrpreis, im Fall von Subventionen bis zur Höhe des sich aus den gewährten Subventionen ergebenden Vorteils; weitere Ausführungen bei Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 204 ff. 407 Schneider, Wirtschaftssanktionen, S. 44, der die wirtschaftlichen Motive und den Defensivcharakter dieser Maßnahmen betont. 402 403
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
111
Gleiches gilt für einzelstaatliche Waffenembargos nach Art. 296 Abs. 1 lit. b EG.409
VI. Implizite Vertragsschlussbefugnisse im Außenbereich Neben den gerade dargestellten geschriebenen Außenkompetenzen410 existieren im Bereich EG-Vertrag ungeschriebene oder implizite Vertragsschlusskompetenzen. Dies mag zunächst verwundern, hält man sich das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, eines der Hauptprinzipien des Europarechts, vor Augen. Dennoch bejaht der EuGH in ständiger Rechtsprechung mittlerweile schon seit Jahrzehnten eine derartige ungeschriebene Außenkompetenz. Diese Rechtsentwicklung ist umso interessanter als sie von Richterrecht geprägt worden ist und – bis zur Ratifizierung des Verfassungsvertrages – hiervon geprägt werden wird. Der Europäische Gerichtshof hatte sich erstmals Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts mit den ungeschriebenen Außenkompetenzen auseinanderzusetzen. Die verschiedenen Begründungslinien sowie die auslegungsfähigen Formulierungen in dieser wie auch in späteren Entscheidungen haben viele Diskussionen hervorgerufen.411 Daher lohnt es sich, die maßgebenden Gutachten und Urteile des EuGH einzeln zu analysieren, um festzustellen, wie der Gerichtshof die grundsätzliche Bejahung ungeschriebener (impliziter) Außenkompetenzen begründet.412 Im Anschluss soll die jeweilige Art der Außenkompetenz (ausschließliche, konkurrierende oder parallele Kompetenz) bestimmt werden. 1. Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und Europäische Atomgemeinschaft (EAG) Da sich nach der hier vertretenen Ansicht413 aus Art. 6 Abs. 2 KS bzw. aus Art. 101 EA ein Gleichlauf zwischen interner und externer Kompetenz ergibt, ist für die Herleitung von ungeschriebenen Außenkompetenzen kein Raum. 408 Eine andere Situation liegt nur vor, wenn die Gemeinschaftsmaßnahme die Mitgliedstaaten hierzu ermächtigt oder ersichtlich Raum für ergänzende mitgliedstaatliche Maßnahmen lässt, Kokott, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 53. 409 Osteneck, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 18, da es hier dann an der „Erforderlichkeit“ fehlt und die in Art. 301 EG der Gemeinschaft garantierte Zuständigkeit zur legislativen Umsetzung von GASP-Maßnahmen ansonsten vereitelt werden würde; vgl. auch Kokott, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 296 EGV Rdnr. 24 a. E. 410 s. oben, § 4 III. – V. 411 Ruffert, EuropaR 2004, 165 (189) spricht von einer „jahrzehntelangen Lektüre im Kaffeesatz kryptischer EuGH-Entscheidungen“. 412 Zur Begründung von impliziten Zuständigkeiten bedarf es Rechtskonstruktionen wie der Lehre von den implied powers, der Kompetenzen kraft Natur der Sache, des effet utile, sowie des Außenbezugs von intern gewährten Kompetenzen, vgl. Nettesheim, EuR 1993, 243 (243). 413 s. oben, § 4 III. 1. und 2.
112
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
2. Europäische Gemeinschaft (EG) a) Ausgangspunkt: Wortlaut des Art. 300 Abs. 1 S. 1 EG Bis zur Mitte der 70er Jahre wurde überwiegend die Auffassung vertreten, dass die Außenkompetenzen der Gemeinschaft im Primärrecht ausdrücklich zugewiesen sein müssten; darüber hinausgehende ungeschriebene Kompetenzen wären hingegen nicht denkbar.414 Vertreter dieser Auffassung führten als Argument den Wortlaut des Art. 228 EWG (jetzt Art. 300 Abs. 1 S. 1 EG) an, wonach ein Vertragsschluss nur zulässig ist, „soweit dieser Vertrag den Abschluss von Abkommen ( . . . ) vorsieht ( . . . )“. Neben diesem Textargument beriefen sie sich auf die Existenz des Art. 235 EWG (jetzt Art. 308 EG), nach dem die Möglichkeit einer punktuellen Erweiterung der vertraglich fixierten Kompetenzen besteht, soweit im Lichte der Ziele des Vertrages eine solche Erweiterung erforderlich ist. Nach der Rechtsprechung des EuGH415 ist diese Auffassung jedoch nicht mehr vertretbar. Wie bereits kurz dargestellt, kann eine Vertragsschlusskompetenz der Gemeinschaft nicht nur aus einer ausdrücklichen vertraglichen Ermächtigung resultieren, sondern sich auch implizit aus dem Vertrag ergeben. Dieser Grundsatz gehört mittlerweile zum acquis communautaire.416 Gegen diese, die impliziten Außenkompetenzen bejahende Auffassung des Gerichtshofs kann nicht der Wortlaut des Art. 300 Abs. 1 S. 1 EG angeführt werden, denn diese Vorschrift regelt nach allgemeiner Auffassung lediglich das Verfahren des Vertragsschlusses.417 Der Wortlaut („soweit“) lässt nämlich klar erkennen, dass die Vorschrift auf an anderer Stelle eingeräumte Vertragsschließungskompetenzen verweist.418 Eine implizite Vertragsschließungskompetenz ergibt sich aus der vorhandenen Völkerrechtssubjektivität und der Notwendigkeit der internationalen Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft. Hiernach müssen die Mitgliedstaaten die EG mit denjenigen Vertragsschließungskompetenzen ausstatten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zum Erreichen ihrer Ziele erforderlich sind. 414 Wohlfahrt, in: Wohlfahrt / Everling / Glaesner / Sprung, Kommentar zum EWG-Vertrag (1960), Art. 228 EWG Rdnr. 3 unter Hinweis auf den Wortlaut des Art. 228 EWG. In Rdnr. 12 spricht Wohlfahrt jedoch die Möglichkeit an, dass eine Kompetenz der Gemeinschaft durch ausdrückliche oder stillschweigende Ermächtigung durch die Mitgliedstaaten erweitert werden könne. Falls die Mitgliedstaaten es hinnähmen, wenn die Gemeinschaft in einem über den Wortlaut des Vertrages hinausgehenden Umfang Verträge schließt, läge darin die Entwicklung eines (völkerrechtlichen) Gewohnheitsrechts. Brunner, in: von der Groeben / von Boeckh, Kommentar zum EWG-Vertrag II (1960), Art. 228 EWG Rdnr. 1 bejaht dagegen schon die Möglichkeit von impliziten Vertragsschlussbefugnissen im Sinne von „necessarily implied powers“. 415 Beginnend mit EuGH, Slg. 1971, 263 – AETR. 416 Tridimas / Eeckhout, YEL 1994, 143 (172). 417 Hobe, Europarecht, S. 28; Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 300 EGV Rdnr. 3; Mögele, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 300 EGV Rdnr. 6. 418 Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 300 EGV Rdnr. 3.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
113
Unter den nicht ausdrücklichen Kompetenzen werden die subsidiären (Art. 308 EG, 203 EA, 95 UAbs. 1 KS) und die impliziten Kompetenzen unterschieden. Subsidiäre Kompetenzen ermächtigen die Gemeinschaft zu Maßnahmen, die nicht ausdrücklich in den Verträgen genannt, aber Konsequenz oder Voraussetzung der Verwirklichung der Vertragsziele sind.419 Implizite Kompetenzen, oder Kompetenzen kraft Sachzusammenhangs, knüpfen dagegen an eine vorhandene Kompetenz an. Bevor jedoch auf die impliziten Kompetenzen eingegangen werden kann, muss zunächst ein Grundprinzip der Gemeinschaftsrechtsordnung näher beleuchtet werden, nämlich das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung.
b) Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, Art. 5 EG Nach dem in Art. 5 Abs. 1 EG geregelten Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung420 darf die Gemeinschaft nur aufgrund ausdrücklicher Kompetenzzuweisungen durch den EG-Vertrag tätig werden. Das bedeutet, dass die Gemeinschaft nur über die Kompetenzen verfügt, welche ihr die Mitgliedstaaten durch die Gründungsverträge und die späteren Änderungen dieser Verträge übertragen haben.421 Dies macht wiederum den Unterschied zwischen der Allzuständigkeit eines souveränen Staates und der begrenzten Zuständigkeit der Gemeinschaft als internationale Organisation im Sinne des Völkerrechts deutlich. Die Gemeinschaft kann sich auch nicht mittels Sekundärrechts weitere Kompetenzen als die im Primärrecht genannten verschaffen. Damit besitzt die Gemeinschaft keine KompetenzKompetenz. Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung soll die Souveränität der Mitgliedstaaten wahren. Aus der Unterscheidung in Art. 5 EG zwischen Zielen und Befugnissen der Gemeinschaft ergibt sich die wichtige Folgerung, dass sich gemeinschaftliche Handlungsbefugnisse nicht aus reinen Zielvorgaben ableiten lassen.422 Anders ausgedrückt darf von einer Zielbestimmung in den Verträgen nicht (automatisch) auf eine dem Ziel angemessene Kompetenz der Gemeinschaft geschlossen werden.423 Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung gilt dabei sowohl für die Innenals auch für die Außenkompetenzen.424 419 Zacker / Wernicke, Examinatorium Europarecht, S. 113; EuGH, Slg. 1973, 897 (Rdnr. 3) – Massey-Ferguson. 420 Auch Zuständigkeit kraft Zuteilung oder engl.: principle of the attribution of powers, bzw. frz.: compétences d’attribution genannt. 421 Vgl. Hobe, Europarecht, S. 32. 422 Dörr, EuZW 1996, 39 (40). 423 So auch vom BVerfG in der „Maastricht-Entscheidung“ als verfassungsrechtliche Anforderung an das Europarecht statuiert, BVerfGE 89, 155 (210): „. . . so [wird] zu beachten sein, dass der Unions-Vertrag grundsätzlich zwischen der Wahrnehmung einer begrenzt eingeräumten Hoheitsbefugnis und der Vertragsänderung unterscheidet, seine Auslegung deshalb in ihrem Ergebnis nicht einer Vertragserweiterung gleichkommen darf; eine solche Auslegung von Befugnisnormen würde für Deutschland keine Bindungswirkung entfalten.“
8 Metz
114
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Aus den vorgenannten Erwägungen darf jedoch nicht geschlossen werden, dass das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und Art. 5 EG einer Ableitung ungeschriebener Kompetenzen aus den Gemeinschaftsverträgen a priori entgegensteht.425 Die genannten Beschränkungen verbieten gerade nicht die Auslegung einzelner Kompetenznormen, um deren wirklichen Inhalt und Umfang zu bestimmen.426 Hier setzt die Lehre von den implied powers an.
c) Die Lehre von den implied powers Die implied powers Lehre wurde zwischen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts im Verfassungsrecht der USA entwickelt427, um eine bestehende ausdrückliche Kompetenz der Zentralgewalt um einen ungeschriebenen Kompetenzbestandteil zu ergänzen.428 Sie ist eine Auslegungsmethode, die auf ausdrücklich gesetztes Recht angewendet wird.429 Nach dieser Methode steht eine implied power einem Hoheitsträger dann zu, wenn und soweit dies erforderlich sein sollte, um eine ausdrückliche Kompetenz wirksam und sinnvoll umzusetzen.430 Diese enge Anbindung an bestehende Kompetenzzuweisungen zeigt, dass die Lehre von den implied powers nicht auf die Schaffung neuer Kompetenzen abzielt, sondern eine sinnvolle Auslegung der ausdrücklichen Kompetenzzuweisungen darstellt.431 Die Lehre von den implied powers findet sich auch im Völkerrecht wieder.432 Sie ähnelt der deutschen Konstruktion der „Zuständigkeit kraft Sachzusammenhangs“.433 424 Mögele, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 300 EGV Rdnr. 12; Dashwood, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 116; Tridimas / Eeckhout, YEL 1994, 143 (154); EuGH, Slg. 1996, I-1759 (Rdnr. 23) – Gutachten 2 / 94, EMRK. 425 Vgl. Calliess, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 5 EGV Rdnr. 15. 426 Dörr, EuZW 1996, 39 (40). 427 Vgl. Supreme Court, Mc Culloch v. Maryland, 4 Wheat. 316, 4L.Ed. 579 (1819). 428 Dörr, EuZW 1996, 39 (40). 429 Grundlegend und sehr instruktiv Nicolaysen, EuR 1966, 129 (131). 430 Nach Nicolaysen, EuR 1966, 129 (134, 136) „besteht die bahnbrechende Leistung dieser Lehre in der Erkenntnis einer Selbstverständlichkeit: die verfassungsmäßig zugewiesenen Zuständigkeiten der Zentralgewalt enthalten gleichzeitig die Aufgaben und Mittel zu ihrer Ausführung.“ 431 Streitig ist hingegen oft, welchen Grad von Notwendigkeit oder Nützlichkeit die Begründung ergänzender Zuständigkeit erfordert, Nicolaysen, EuR 1966, 129 (132). 432 Hier wurde jedoch die strenge Orientierung an einer bestehenden ausdrücklichen Kompetenznorm nicht immer beibehalten, sodass sich die implied powers Lehre in einen reinen Ziel-Mittel-Schluss verwandelte (vgl. ICJ Reports 1949, 174 (180, 182) – Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations; ICJ Reports 1954, 47 (57) – Effect of Awards of Compensation Made by the UN Administrative Tribunal). Danach stehen einer internationalen Organisation ungeschriebene Kompetenzen zu, soweit sie zur Erreichung ihrer Ziele erforderlich oder auch nur geeignet („appropriate“) sind; weitere Nachweise bei Dörr, EuZW 1996, 39 (40).
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
115
Für das Gemeinschaftsrecht hat der EuGH die implied-powers-Lehre im Fédéchar-Urteil434 anerkannt. Hier spricht der Gerichtshof in Bezug auf die implied-powers-Lehre von einer anerkannten Auslegungsregel, „wonach die Vorschriften eines Vertrages oder eines Gesetzes zugleich diejenigen Vorschriften beinhalten, bei deren Fehlen sie sinnlos wären oder nicht in vernünftiger und zweckmäßiger Weise zur Anwendung gelangen könnten.“
Dieser Grundsatz ist mittlerweile ständige Rechtsprechung des EuGH. Im Jahre 1960 stellte der Gerichtshof im Fall einer ungeschriebenen Rechtsetzungsbefugnis der Hohen Behörde (später Kommission) fest, dass „die von einem völkerrechtlichen Vertrag aufgestellten Vorschriften zugleich diejenigen Rechtssätze in sich schließen, ohne welche sie nicht sinnvoll und vernünftig angewendet werden können.“435
In seinem Urteil zu sozialpolitischen Kompetenzen (Wanderungspolitik) der Kommission gemäß Art. 118 EWGV (jetzt Art. 137 EG) formulierte der EuGH folgendermaßen: „Weist eine Bestimmung des EWG-Vertrages der Kommission eine bestimmte Aufgabe zu, so ist davon auszugehen, dass sie ihr dadurch notwendigerweise auch die zur Erfüllung dieser Aufgabe unerlässlichen Befugnisse verleiht; andernfalls würde der Bestimmung jede praktische Wirksamkeit genommen.“436
Die implied-powers-Doktrin soll damit im Rahmen einer teleologischen Betrachtung zu einer sinnvollen und wirksamen Umsetzung des geschriebenen Rechts verhelfen. Allerdings beschränkt sie sich auf die Effektivierung einer bestimmten Kompetenznorm. Im Gegensatz dazu macht der vom EuGH an anderer Stelle angeführte Grundsatz des „effet utile“ in der Form, wie ihn der Gerichtshof gebraucht, allgemein die Gemeinschaftsziele und vor allem die praktische Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts zum Auslegungsmaßstab.437 Schließlich muss klar herausgestellt werden, dass Art. 308 EG nicht die Positivierung der implied-powers-Lehre darstellt. Denn beide Rechtsinstitute haben – trotz ihrer funktionellen Verwandtschaft – verschiedene Ausgangspunkte. Anknüpfungspunkt für die Lehre von den implied powers ist eine bereits vorhandene Kompetenznorm, für Art. 308 EG dagegen ein Ziel der Gemeinschaft. Die impliedpowers-Lehre stellt somit eine Auslegungstechnik dar. Damit gelten die Grundsätze der implied-powers-Lehre im Gemeinschaftsrecht neben Art. 308 EG.438 Wegen Nicolaysen, EuR 1966, 129 (131). EuGH, Slg. 1956, 297 – Fédéchar. 435 EuGH, Slg. 1960, 681 (708) – Italienische Republik . / . Hohe Behörde (zum EGKSVertrag); nahezu wortgleiche Formulierung in EuGH, Slg. 1960, 743 (781) – Königreich der Niederlande . / . Hohe Behörde. 436 EuGH, Slg. 1987, 3203 (3253 a. E.) – Bundesrepublik Deutschland u. a. . / . Kommission. 437 Dörr, EuZW 1996, 39 (40). 438 Constantinesco, Das Recht der Europäischen Gemeinschaften I, S. 282. 433 434
8*
116
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
ihrer Anknüpfung an ausdrückliche Kompetenznormen gehen die implied powers der Bestimmung des Art. 308 EG vor. Sie sind „im Vertrag selbst vorgesehene Befugnisse“ (Art. 308 EG). Hingegen werden unter den Voraussetzungen des Art. 308 EG bisher nicht gegebene Kompetenzen neu begründet.439
d) EuGH-Rechtsprechung Das derzeitige System der impliziten Außenkompetenzen der Gemeinschaft ist vor allem auf das vom EuGH geprägte Richterrecht zurückzuführen.440 Der EuGH hat zum Thema der Außenkompetenzen der EG einige grundlegende Entscheidungen getroffen, angefangen mit dem berühmten AETR-Urteil über das KramerUrteil bis hin zum WTO-Gutachten. Um das System und die Entwicklungslinien verstehen zu können, sind die Urteile in chronologischer Reihenfolge nachfolgend kurz geschildert.
aa) AETR441-Urteil 1971442; erstmalige Begründung ungeschriebener Außenkompetenzen Die Judikatur beginnt mit dem AETR-Urteil, dem als ersten Meilenstein zu bezeichnenden Urteil des EuGH zu den Außenkompetenzen der Gemeinschaft. Der Gerichtshof zitiert zunächst Art. 210 EWG („Die Gemeinschaft besitzt Rechtspersönlichkeit“, jetzt Art. 281 EG) und leitet aus dieser Vorschrift her, dass die Gemeinschaft in den Außenbeziehungen grundsätzlich die Fähigkeit hat, vertragliche Bindungen mit Drittstaaten einzugehen. Der Gerichtshof stellt dann fest, dass bei der Frage, ob die Gemeinschaft zum Abschluss internationaler Abkommen zuständig ist, auf das gesamte System der materiellen Vorschriften des Vertrages zurückgegriffen werden muss. „Eine solche [implizite Außen-]Zuständigkeit ergibt sich nicht nur aus einer ausdrücklichen Erteilung durch den Vertrag [ . . . ] sondern sie kann auch aus anderen VertragsRossi, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 308 EGV Rdnr. 44. Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. V (introduction) „entirely judge-made“. 441 AETR = „Accord Européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route“ = „Europäisches Übereinkommen über die Arbeit der Fahrzeugbesatzungen im internationalen Straßenverkehr“; in englischsprachiger Literatur oft auch als ERTA = „European agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in international road transport“ bezeichnet. 442 EuGH, Slg. 1971, 263 – AETR; das Verfahren war laut Sasse, EuropaR 1971, 208, das erste Organstreitverfahren der Europäischen Gemeinschaften; vgl. allgemein zum AETR-Urteil Temple Lang, YEL 1986, 183 ff.; Werbke, NJW 1971, 2103; Fuß, DVBl. 1972, 237; zum politischen Hintergrund des Urteils Hartley, European Community Law, S. 166. 439 440
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
117
bestimmungen und aus in ihrem Rahmen ergangenen Rechtsakten der Gemeinschaft fließen.“443
Damit lehnte der Gerichtshof die bis dahin überwiegende Meinung ab, wonach die Gemeinschaft nur die ihr im Vertrag ausdrücklich eingeräumten Befugnisse besitze444, und bejahte ausdrücklich das Bestehen von impliziten Vertragsschlusskompetenzen für die Gemeinschaft. Aufgrund der teilweise in verschiedene Richtungen verlaufenden Ausführungen der weiteren Urteilsgründe blieb jedoch umstritten, welche Begründung der EuGH für das Bestehen von impliziten Außenkompetenzen gab:445 In den Urteilsgründen lassen sich zum einen Belege für die Anwendung eines reinen Ziel-Mittel-Schlusses finden. Formulierungen in den Entscheidungsgründen wie „[ . . . ] die Inkraftsetzung der Verordnung [ . . . ] des Rates [ . . . ] hat jedoch zwangsläufig die Zuständigkeit der Gemeinschaft für alle Abkommen mit dritten Staaten nach sich gezogen, welche das in der Verordnung geregelte Sachgebiet betreffen“446 und „[ . . . ] durch die Verordnung Nr. 543 / 69 bewirkten Übergang der Zuständigkeit auf die Gemeinschaft“447
ließen vermuten, dass der Gerichtshof dem Erlass sekundärrechtlicher Vorschriften im Innenbereich (im vorliegenden Fall eine Verordnung) eine konstitutive Bedeutung für das Entstehen einer Außenkompetenz der Gemeinschaft zubilligte.448 Dies hätte zur Konsequenz, dass sich die Gemeinschaft durch den bloßen Erlass sekundärrechtlicher Vorschriften Kompetenzen im Außenbereich verschaffen könnte.449 Der Gerichtshof hätte dieser Auffassung zufolge die ungeschriebene Außenkompetenz der Gemeinschaft damit begründet, dass verhindert werden müsse, dass mitgliedstaatliche Aktionen auf internationaler Ebene mit gemeinschaftsinternen Maßnahmen kollidieren. In dieser Hinsicht würde die Argumentation des Gerichtshofs zum einen auf dem Loyalitätsprinzip fußen, welches (heute) in Art. 10 EG festgeschrieben ist, und zum anderen eine weite Interpretation des Grundsatzes des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts darstellen.450 So können auch die weiteren Äußerungen des Gerichtshofs verstanden werden: EuGH, Slg. 1971, 263 (274 f.) – AETR. Nachweise bei Sasse, EuropaR 1971, 208 (225); s. auch oben, § 4 VI. 2. a). 445 So auch Bleckmann, EuropaR 1977, 109 (109, 114 f.); Hartley, European Community Law, S. 165 (Fn. 24) und S. 166 unten. 446 EuGH, Slg. 1971, 263 (275 f.) – AETR (Hervorhebungen durch den Verf.). 447 EuGH, Slg. 1971, 263 (281) – AETR (Hervorhebungen durch den Verf.). 448 Dörr, EuZW 1996, 39 (41); Pescatore, CMLR 1979, 615 (619). 449 Nach Dörr, EuZW 1996, 39 (41) widerspräche eine solche „Kompetenz-Kompetenz“ allerdings dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung; a.A. Dashwood / Heliskoski, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 7, die diesen Ansatz als das „AETR-Prinzip“ betiteln, welches sich mit dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung vertrage, da die Gemeinschaft intern nur handeln könne, wenn sie hierzu ausdrücklich ermächtigt worden ist. 450 O’Keeffe, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 183. 443 444
118
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
„Zusammengenommen ergeben diese Bestimmungen [Art. 5 EWG, jetzt Art. 10 EG], dass die Mitgliedstaaten außerhalb des Rahmens der Gemeinschaftsorgane keine Verpflichtungen eingehen können, welche Gemeinschaftsrechtsnormen, die zur Verwirklichung der Vertragsziele ergangen sind, beeinträchtigen oder in ihrer Tragweite ändern können.“451
Andererseits findet sich in Formulierungen des AETR-Urteils ein anderer Argumentationsstrang wieder, welcher deutlich an die implied-powers-Lehre452 erinnert. Der Gerichtshof beschreibt zunächst die den Art. 74, 75 EWG (jetzt Art. 70, 71 EG) zugrunde liegenden Ziele und führte aus: „Diese Bestimmung [Art. 75 Abs. 1 EWG, jetzt Art. 71 Abs. 1 EG] betrifft für den innergemeinschaftlichen Streckenteil auch den Verkehr aus oder nach dritten Staaten. Sie setzt daher voraus, dass die Zuständigkeit der Gemeinschaft sich auf Beziehungen erstreckt, die dem internationalen Recht unterliegen, und schließt damit insoweit die Notwendigkeit ein, mit den beteiligten dritten Ländern Abkommen zu schließen.“453
Folgt man diesem Ansatz, so wird die Außenkompetenz der Gemeinschaft unter Anwendung der implied-powers-Lehre aus der primärrechtlichen Vorschrift des Art. 75 Abs. 1 EWGV (jetzt Art. 71 EG) begründet. Das gemeinschaftsintern erlassene Sekundärrecht spielte in diesem Fall keine Rolle bei der Begründung einer Außenkompetenz, sondern würde die mit dem implied-powers Grundsatz hergeleitete Außenkompetenz von einer konkurrierenden in eine ausschließliche Kompetenz umwandeln. Nach dieser Lesart ist das Urteil des Gerichtshof mit den Grundstrukturen der Gemeinschaft vereinbar und stellt einen Anwendungsfall der implied-powers-Doktrin dar.454 Fraglich bleibt jedoch, ob der Gerichtshof diese beiden unterschiedlichen Wege der Kompetenzbegründung bewusst parallel genannt hat, um eine möglichst breite Argumentationsbasis zu haben, oder ob die unterschiedlichen Begründungen z. B. auf ein unsauberes Zusammenschreiben zweier unterschiedlicher Urteilsentwürfe zurückzuführen sind.455
451 EuGH, Slg. 1971, 263 (275, Rdnr. 20 / 22) – AETR, wobei die letzte Alternative überflüssig erscheint, denn jede Norm, die die Tragweite einer Vorschrift ändert, beeinträchtigt diese auch gleichzeitig. 452 Dashwood / Heliskoski, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 8, sprechen vom effet-utile-Prinzip. 453 EuGH, Slg. 1971, 263 (275, Rdnr. 23 / 29) – AETR (Hervorhebungen durch den Verf.). 454 Dörr, EuZW 1996, 39 (41); nach Mögele, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 300 EGV Rdnr. 25, erinnern die Ausführungen des EuGH an den im Kontext der gemeinschaftlichen Binnenkompetenzen wohlbekannten Grundsatz der Gebietsbesetzung („terrain occupé“). 455 So zweifelnd Dashwood / Heliskoski, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 7 ff.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
119
bb) Kramer-Urteil (Fischerei-Fangquoten, 1976)456; Einführung des Komplementaritätsprinzips Im Kramer-Urteil ging es unter anderem um die Frage, ob die Gemeinschaft die (Außen-)Kompetenz besitzt, auf dem Gebiet der Erhaltung biologischer Schätze des Meeres völkerrechtliche Verpflichtungen einzugehen. Der Gerichtshof bestätigte seine im AETR-Urteil aufgestellten Grundsätze und stellte zunächst fest, dass der EWG-Vertrag auf dem Gebiet der Fischerei-Fangquoten keine ausdrücklichen Vorschriften enthält. Er führte weiter aus, dass auf das allgemeine System des Gemeinschaftsrechts zurückgegriffen werden müsse. Der EuGH zitierte (wie auch im AETR-Urteil) Art. 210 EWG (jetzt Art. 281 EG), wonach die Gemeinschaft Rechtspersönlichkeit besitzt, und folgerte hieraus, dass die Gemeinschaft in den Außenbeziehungen grundsätzlich die Fähigkeit besitzt, völkerrechtliche Verpflichtungen einzugehen, die im Rahmen der im ersten Teil des Vertrages genannten Ziele liegen. (1) Prinzip der implied-powers und der Komplementarität Um im Einzelfall zu ermitteln, ob der Gemeinschaft eine Außenkompetenz zusteht, muss, dem Gerichtshof zufolge, auf das System und auf die materiellen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts zurückgegriffen werden. Eine Außenkompetenz muss hierbei nicht ausdrücklich durch den Vertrag verliehen werden; sie kann auch aus anderen Bestimmungen des Vertrages und der Beitrittsakte sowie aus in deren Rahmen ergangenen Rechtsakten der Gemeinschaftsorgane fließen.457 Dieser letzte Halbsatz, wonach sich Kompetenzen auch aus Sekundärrecht ergeben können, ist irreführend, denn die weiteren Ausführungen zeigen, dass der Gerichtshof im Kramer-Urteil letztlich den implied-powers-Grundsatz anwendet. Aus Art. 43 EWGV (jetzt Art. 37 EG), aus Art. 102 der Beitrittsakte von 1972, aus Verordnungen zur gemeinsamen Strukturpolitik, die der Rat unter anderem mit dem Ziel der Förderung einer rationellen Nutzung der biologischen Schätze des Meeres und der Binnengewässer erlassen hatte, und in Übereinstimmung mit der vierten Begründungserwägung dieser Verordnung, wonach die Möglichkeit geschaffen werden sollte, gemeinschaftliche Maßnahmen zum Schutz der Fischbestände in den betreffenden Gewässern zu treffen, folgerte der Gerichtshof, dass die Gemeinschaft im Innenverhältnis befugt sei, alle Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Schätze des Meeres einschließlich der Festsetzung und Zuteilung von Fanquoten an die einzelnen Mitgliedstaaten zu treffen. Aus der Gesamtheit dieser Vorschriften sowie „aus der Natur der Sache“ ergebe sich des Weiteren, dass sich die Regelungsbefugnis der Gemeinschaft nicht nur auf ein geographisch be456 457
EuGH, Slg. 1976, 1279 – Kramer = NJW 1977, 999. EuGH, Slg. 1976, 1279 (1310) – Kramer.
120
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
grenztes Gebiet erstrecke, sondern auch die Fischerei auf hoher See erfasse.458 Weiterhin führt der Gerichtshof aus: „Die Erhaltung der biologischen Schätze des Meeres kann wirksam und zugleich gerecht nur durch eine Regelung sichergestellt werden, die für alle interessierten Staaten einschließlich der Drittländer verbindlich ist.“459
Damit begründet der Gerichtshof die ungeschriebene Außenkompetenz unter Zuhilfenahme der implied-powers-Lehre.460 Der EuGH schloss zwar von einer bestehenden Innenkompetenz auf eine Außenkompetenz. In diesem Urteil lassen sich jedoch weder Argumente für die Anwendung der Parallelismus-Doktrin461 noch für das Prinzip der Komplementarität462 finden. Die Außenkompetenz stellt keinen bloßen Reflex der Innenkompetenz dar, sondern besteht nur dann, wenn sie erforderlich ist, um ein bestimmtes Ziel einer Innenkompetenz zu erreichen. (2) Differenzierung zwischen Existenz und Ausschließlichkeit der festgestellten Außenkompetenz Im Kramer-Urteil unterschied der EuGH erstmals (wenn auch nicht ausdrücklich, so doch aufgrund des Aufbaus des Urteils erkennbar) zwischen dem Entstehen oder Vorhandensein einer Außenkompetenz und der Frage der Art (ausschließlich, konkurrierend oder parallel) dieser Kompetenz.463 In Ziffer 1 seines Urteils bejaht der Gerichtshof, wie oben beschrieben, die Außenkompetenz der Gemeinschaft im konkreten Fall. Sodann wendet er sich in Ziffer 2 der Frage nach der Ausschließlichkeit der Kompetenz zu. Der EuGH untersucht folgerichtig, ob die Gemeinschaft ihre Kompetenzen auch tatsächlich ausgeübt hat. Nur in diesem Fall könnte aus der konkurrierenden Außenkompetenz eine ausschließliche Gemeinschaftskompetenz werden. Dies verneint der EuGH letztendlich für den Zeitpunkt des von dem vorlegenden Gericht zu beurteilenden Geschehens. Er kommt zu dem Schluss, dass die dem Abkommen beigetretenen Mitgliedstaaten (im vorliegenden Fall die Niederlande) die Kompetenz besessen haben, Fangquoten festzulegen, um den Verpflichtungen aus dem Abkommen nachkommen zu können. Der Gerichtshof weist aber darauf hin, dass diese (konkurrierende) Kompetenz nur ÜbergangsEuGH, Slg. 1976, 1279 (1311) – Kramer. EuGH, Slg. 1976, 1279 (1311) – Kramer. 460 Dashwood / Heliskoski, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 10 gehen dagegen von der Logik des effet utile aus. 461 Vgl. Tridimas / Eeckhout, YEL 1994, 143 (151 f.); vgl. auch Leopold, ICLQ 1977, 54 (71). 462 Begriff angelehnt an Dashwood / Heliskoski, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 9 „principle of complementarity“. 463 Dashwood, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 115 nennen dies „the existence question“, bzw. „the exclusivity question“. 458 459
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
121
charakter hat, denn in dem unterzeichneten Abkommen ist geregelt, dass der Rat spätestens sechs Jahre nach dem Beitritt seine ihm in Artikel 102 der Beitrittsakte von 1972 auferlegten Verpflichtungen (nämlich Maßnahmen zur Erhaltung der Meeresschätze zu treffen) erfüllt haben muss.464 Laut dem Gerichtshof treffen die Mitgliedstaaten bereits schon während der Übergangszeit bestimmte Verpflichtungen: So müssen die Mitgliedstaaten nach Art. 5 EWGV (jetzt Art. 10 EG) alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen ergreifen, die sich aus dem EWG-Vertrag oder aus Handlungen der Organe der Gemeinschaft ergeben. Hiernach sind die Mitgliedstaaten nicht nur gehalten, im Rahmen dieser Übereinkommen keine Verpflichtungen einzugehen, welche die Gemeinschaft bei der Ausführung ihr in Artikel 102 der Beitrittsakte von 1972 übertragenen Aufgaben behindern könnten, sondern sie sind auch zum gemeinsamen Vorgehen innerhalb der Fischereikommission verpflichtet.465
cc) Gutachten 1 / 76, Stilllegungsfonds466; Erweiternde Präzisierung der bisherigen Rechtsprechung im Sinne des Komplementaritätsprinzips Der Grund für die Anforderung des Gutachtens 1 / 76 durch die Kommission war die Frage, ob die Gemeinschaft ein Übereinkommen über die Errichtung eines Europäischen Stilllegungsfonds abschließen darf. Der Fonds sollte an diejenigen Schiffseigentümer Ausgleichszahlungen leisten, die aufgrund von Überkapazitäten auf den Wasserwegen Rhein und Mosel ihre Binnenschiffe freiwillig stilllegten. Das Problem hierbei war, dass traditionell auch der Nichtmitgliedstaat Schweiz am Binnenschifffahrtshandel auf dem Rhein teilnahm. Eine innergemeinschaftliche Regelung war daher unzureichend und im Vorfeld auch nicht erlassen worden. Fraglich war somit erstens, ob die Gemeinschaft dieses Übereinkommen mit der Schweiz abschließen durfte, und zweitens, ob sie dies gegebenenfalls auch durfte, ohne zuvor innergemeinschaftliche Regeln zu erlassen. Der EuGH antwortete auf die erste Frage, dass sich die vorgesehene Regelung in die gemeinsame Verkehrspolitik einfüge, die gemäß Art. 3 EWGV (jetzt Art. 3 EG) zum Tätigkeitsfeld der Gemeinschaft zählt. Art. 75 EWGV (jetzt Art. 71 EG) ist die Rechtsgrundlage zur Verwirklichung dieser Politik im Innenverhält464 Folgerichtig stellte der EuGH in einem späteren Urteil fest, dass nach dem Ablauf der Übergangsfrist am 01. 01. 1979 „die Zuständigkeit für den Erlass von Maßnahmen zur Erhaltung der Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik vollständig und endgültig bei der Gemeinschaft liegt“ (und auch nicht durch die Untätigkeit der Gemeinschaftsorgane auf die Mitgliedstaaten zurückfällt), EuGH, Slg. 1981, 1045 (Rdnr. 17, 19 ff.) – Kommission . / . Vereinigtes Königreich. 465 EuGH, Slg. 1976, 1279 (1313) – Kramer. 466 EuGH, Slg. 1977, 741 – Gutachten 1 / 76, Stilllegungsfonds = NJW 1977, 2017.
122
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
nis.467 Für die Zuständigkeit der Gemeinschaft zum Abschluss einer solchen völkerrechtlichen Vereinbarung enthält der EWG-Vertrag jedoch keine Bestimmung. In seinen Erwägungen bezog sich der Gerichtshof auf seine Rechtsprechung im Kramer-Urteil und führte aus, „daß eine Zuständigkeit der Gemeinschaft zur Eingehung völkerrechtlicher Verpflichtungen sich nicht nur aus einer ausdrücklichen Verleihung durch den Vertrag ergeben, sondern auch stillschweigend aus seinen Bestimmungen fließen kann. Insbesondere hat er [der Gerichtshof] festgestellt, dass, wenn das Gemeinschaftsrecht den Gemeinschaftsorganen im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel im Innenverhältnis eine Zuständigkeit verleiht, die Gemeinschaft befugt ist, die zur Erreichung dieses Ziels erforderlichen völkerrechtlichen Verpflichtungen einzugehen, auch wenn eine ausdrückliche diesbezügliche Bestimmung fehlt.“468
Mit diesen Ausführungen hat der Gerichtshof die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Außenkompetenz erheblich gelockert und hat an Stelle der noch in den Urteilen AETR und Kramer geforderten Wirksamkeit der ausdrücklichen Innenkompetenz einen reinen Schluss von der Innen- auf die Außenkompetenz gesetzt.469 Besitzt die Gemeinschaft im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel die Kompetenz, im Innenverhältnis Regelungen zu erlassen, so ist sie auch dazu befugt, die zur Erreichung dieses Zieles erforderlichen völkerrechtlichen Verträge abzuschließen. In diesem Sinne schloss der EuGH von der Innenkompetenz auf die Außenkompetenz. Im Stilllegungsfonds-Gutachten finden sich daher Anhaltspunkte für die Geltung eines neuen Grundsatzes, nämlich für das Prinzip der Komplementarität470. Auch die zweite Frage, ob der Gemeinschaft die Außenkompetenz auch dann zusteht, wenn sie von ihrer Innenkompetenz noch keinen Gebrauch gemacht hat, bejaht der EuGH. Im zu begutachtenden Fall ergebe sich die Kompetenz der Gemeinschaft „dennoch stillschweigend aus den die interne Zuständigkeit begründenden Bestimmungen des Vertrages, sofern die Beteiligung der Gemeinschaft an der völkerrechtlichen Vereinbarung wie im vorliegenden Fall notwendig ist, um eines der Ziele der Gemeinschaft zu erreichen.“471
Diese doppelte Anknüpfung an die internen Kompetenzen und Ziele der Gemeinschaft verbunden mit einer Erforderlichkeitsprüfung führten dazu, dass man 467 Damit betreffen sowohl das AETR-Urteil als auch das Gutachten 1 / 76 die Verkehrspolitik und damit dieselbe Rechtsgrundlage, Art. 75 EWGV (jetzt Art. 71 EG). 468 EuGH, Slg. 1977, 741 (755) – Gutachten 1 / 76, Stilllegungsfonds (Hervorhebungen durch den Verf.). 469 Dörr, EuZW 1996, 39 (41) spricht von einem Ziel-Mittel-Schluss. 470 Begriff angelehnt an Dashwood / Heliskoski, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 9 „principle of complementarity“. Vgl. auch den Begriff „Parallelismus-Doktrin“ bei Tridimas / Eeckhout, YEL 1994, 143 (151 f.); vgl. ferner Leopold, ICLQ 1977, 54 (71). 471 EuGH, Slg. 1977, 741 (756) – Gutachten 1 / 76, Stilllegungsfonds.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
123
in der Literatur davon ausging, dass der Gerichtshof eine automatische Parallelität von Innen- und Außenkompetenzen statuiert habe.472
dd) Gutachten 2 / 91, ILO473; Grundsätze zur Begründung einer ausschließlichen Außenkompetenz Das von der Kommission angeforderte Gutachten 2 / 91 behandelte die Frage, ob das Übereinkommen Nr. 170 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über die Sicherheit bei der Verwendung chemischer Stoffe bei der Arbeit in die Zuständigkeit der Gemeinschaft fällt und ob diese Zuständigkeit gegebenenfalls ausschließlich ist. Der Gerichtshof ging in zwei Schritten vor und fragte zunächst, ob eine Außenkompetenz der Gemeinschaft besteht. Sodann beschäftigte er sich damit, ob diese Kompetenz eine ausschließliche ist. Damit trennte der EuGH (wie bereits schon im Kramer-Urteil) deutlich zwischen der Herleitung der Kompetenz und ihrer Art.474 Zur ersten Frage (bezüglich der Existenz einer Außenkompetenz) verwies der Gerichtshof auf sein Gutachten 1 / 76 und wiederholte, dass eine Außenkompetenz auch stillschweigend aus dem Vertrag folgen kann. Der EuGH führte weiter aus, dass das Übereinkommen Nr. 170 die Sicherheit bei der Verwendung chemischer Stoffe bei der Arbeit betrifft. Dieses Rechtsgebiet ist von Kapitel 1 des Titels III – Sozialpolitik – des Dritten Teils des EWG-Vertrags erfasst. Gemäß Art. 118 a EWGV (jetzt Art. 137 Abs. 1 lit. a EG) bemühen sich die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft, die Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zu fördern, um die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen. „Somit verfügt die Gemeinschaft über eine interne Rechtsetzungskompetenz auf dem Gebiet des Sozialrechts. Damit fällt das Übereinkommen Nr. 170, dessen Gegenstand sich im Übrigen mit demjenigen mehrerer nach Art. 118 a EWGV [jetzt Art. 137 Abs. 1 lit. a EG] erlassener Richtlinien deckt, in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaft.“475
Der Gerichtshof fuhr dann unmittelbar mit der Prüfung der Ausschließlichkeit fort. Dies macht deutlich, dass das Gericht direkt von der Innen- auf die Außenkompetenz schließt. Auf das noch im vorhergehenden Gutachten 1 / 76 – Still472 Geiger, JZ 1995, 973 (976 und Fn. 19), auf S. 980 spricht er vom „Prinzip der impliziten Annexkompetenz“; Dörr, EuZW 1996, 39 (42) verwendet den Begriff „ParallelismusThese“; Dashwood / Heliskoski, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 9 sprechen vom „complementarity principle“; Hartley, European Community Law, S. 167; vgl. zur Parallelität von Innen- und Außenkompetenz im deutschen Verfassungsrecht Bleckmann, NVwZ 1989, 311 ff. 473 EuGH, Slg. 1993, 1061 – Gutachten 2 / 91, ILO. 474 Dies macht der EuGH auch mit seinem Obersatz auf Seite 1078 der amtlichen Sammlung und dem weiteren Aufbau seines Gutachtens deutlich. 475 EuGH, Slg. 1993, 1061 (1078, Rdnr. 17) – Gutachten 2 / 91, ILO (Hervorhebungen durch den Verfasser).
124
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
legungsfonds aufgestellte Erforderlichkeitstatbestandsmerkmal geht der Gerichtshof nicht mehr ein. Das Bestehen einer Regelungskompetenz im Innenbereich führte also per se zu einer entsprechenden völkerrechtlichen Vertragsschlussbefugnis.476 Damit machte der Gerichtshof das im Gutachten 1 / 76 eingefügte Komplementaritätsprinzip zu dem allgemein anwendbaren Prinzip zur Begründung einer impliziten Außenkompetenz. Bei der weiteren Frage nach der Ausschließlichkeit der Zuständigkeit setzte der Gerichtshof neue Maßstäbe. Eine ausschließliche Zuständigkeit kann sich demzufolge erstens direkt aus dem Vertrag ergeben (z. B. Art. 113 EWG, jetzt Art. 133 EG). Ist dies nicht der Fall, so bestimmt sich die Frage, ob die Zuständigkeit der Gemeinschaft eine ausschließliche ist, danach, in welchem Umfang die Gemeinschaftsorgane Maßnahmen zur Durchführung des EG-Vertrages getroffen haben. Aufgrund solcher Maßnahmen können die Mitgliedstaaten Zuständigkeiten verlieren, welche sie zuvor übergangsweise innehatten (die konkurrierende Zuständigkeit verwandelt sich in eine ausschließliche). Die Ausübung der Innenkompetenz durch die Gemeinschaft führt jedoch nicht automatisch zur ausschließlichen Zuständigkeit der Gemeinschaft. Entscheidend ist, dass die Mitgliedstaaten keine konkreten völkerrechtlichen Verpflichtungen eingehen dürfen, welche Gemeinschaftsrechtsnormen477 „beeinträchtigen oder in ihrer Tragweite ändern können“478. Im konkreten Fall hatte die Gemeinschaft bereits aufgrund des Art. 118 a EWGV (jetzt Art. 138 EG) mehrere Richtlinien und Harmonisierungsmaßnahmen erlassen. Art. 118 a Abs. 3 EWGV sah jedoch vor, dass die Mitgliedstaaten befugt sind, strengere Vorschriften (als die Gemeinschaft sie beschlossen hat) zu erlassen. Eine entsprechende Regelung fand sich auch in der IAO-Verfassung wieder. Damit war gewährleistet, dass die Mitgliedstaaten das Gemeinschaftsrecht durch den Abschluss des Abkommens nicht beeinträchtigen konnten, da lediglich Mindeststandards vereinbart werden sollten.479 Eine ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft war also ausgeschlossen.
476 Dörr, EuZW 1996, 39 (42); a.A. Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 159 ff., der die Vorgehensweise des EuGH kritisiert und das Gutachten als „Ausreißer“ bezeichnet. 477 Hierbei stellte der Gerichtshof klar, dass alle Gemeinschaftsrechtsnormen gemeint sind und nicht etwa nur die im Rahmen einer gemeinsamen Politik erlassenen; unklar dagegen noch EuGH, Slg. 1971, 263 – AETR einerseits: Rdnr. 17 „. . . in denen die Gemeinschaft zur Verwirklichung einer vom Vertrag vorgesehenen gemeinsamen Politik Vorschriften erlassen hat . . .“ und andererseits Rdnr. 22: dass Mitgliedstaaten „. . . keine Verpflichtungen eingehen dürfen, welche Gemeinschaftsrechtsnormen, die zur Verwirklichung der Vertragsziele ergangen sind, beeinträchtigen . . .“ können, (Hervorhebungen durch den Verfasser). 478 EuGH, Slg. 1993, 1061 (1077, Rdnr. 9) – Gutachten 2 / 91, ILO. 479 Nach Dashwood / Heliskoski, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 17, liegt eine Situation vor, „where international commitments undertaken by the Member States may happily co-exist with Community rules“.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
125
Damit hat der EuGH folgende verschärfte Anforderung für das „Umschlagen“ einer konkurrierenden Kompetenz in eine ausschließliche Kompetenz der Gemeinschaft aufgestellt: Die konkurrierende Kompetenz wird (nur) dann zu einer ausschließlichen Kompetenz, wenn der Inhalt des von den Mitgliedstaaten abzuschließenden Abkommens geeignet ist, das bereits erlassene Gemeinschaftsrecht zu beeinträchtigen. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt und räumt der EG-Vertrag auch nicht ausdrücklich eine ausschließliche Zuständigkeit ein, verbleibt es bei der konkurrierenden Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.
ee) Gutachten 1 / 94, WTO480; Einschränkende Präzisierung des Prinzips der Parallelität von Innen- und Außenkompetenz Das WTO-Gutachten gehört zu den bedeutendsten Entscheidungen des Gerichtshofs. Neben der Bestimmung des Anwendungsbereichs des Art. 133 EG enthält das Gutachten grundlegende Ausführungen zu den impliziten Außenkompetenzen der Gemeinschaft. Die dem Gerichtshof von der Kommission vorgelegten Fragen betrafen das Problem, ob die Gemeinschaft zum Abschluss des Vertrages zur Gründung der Welthandelsorganisation (WTO481) ausschließlich zuständig oder ob die Zuständigkeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft geteilt sei. Problematisch waren hierbei vor allem die neuen Verhandlungsthemen, nämlich das Allgemeine Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS482) und das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS483). Das GATS-Abkommen verpflichtet die Vertragsparteien unter anderem zur Gewährung von Meistbegünstigung, Marktzugang und Inländergleichbehandlung, das TRIPS-Abkommen enthält Regelungen betreffend einen normativen Mindeststandard für den Schutz aller Erscheinungsformen des geistigen Eigentums. (1) Reichweite des Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG), explizite Außenkompetenz Der Frage, ob eine ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft vorliegt, ging der Gerichtshof nach, indem er zunächst prüfte, ob die genannten Bereiche von der gemeinsamen Handelspolitik nach Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG) erfasst sind und bereits daher eine ausschließliche explizite Außenkompetenz der EG vorliegt. 480 EuGH, Slg. 1994, I-5267 – Gutachten 1 / 94, WTO; ausführlich zur Vorgeschichte und zur Bedeutung des Gutachtens Emiliou, ELR 1996, 294 ff. und Bourgeois, CMLR 1995, 763, mit einigen kritischen Anmerkungen zur Urteilsbegründung (776 ff.). 481 Der Vertrag trat am 01. 01. 1995 in Kraft. 482 GATS = General Agreement on Trade in Services. 483 TRIPS = Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
126
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
(a) GATT Für die multilateralen Handelsübereinkünfte (GATT484) bejahte der Gerichtshof zum größten Teil die Anwendbarkeit des Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG) und damit eine ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft zum Abschluss dieses Abkommens.485 (b) GATS Im Bereich des GATS trennte der EuGH zwischen Dienstleistungen außerhalb des Verkehrssektors und besonderen Verkehrsdienstleistungen. Zu ersteren verwies der Gerichtshof auf seine Gutachten 1 / 75 und 1 / 78 und führte aus, dass die in Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG) enthaltene Aufzählung der Gegenstände der Handelspolitik als eine nicht abschließende Aufzählung anzusehen ist. Aufgrund des offenen Charakters der gemeinsamen Handelspolitik ist es daher nicht möglich, den Dienstleistungsverkehr von vornherein und grundsätzlich vom Anwendungsbereich des Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG) auszuschließen.486 Für die so genannten Korrespondenzdienstleistungen, bei denen (nur) die Dienstleistung, nicht jedoch der Dienstleistungserbringer oder der Dienstleistungsempfänger eine Grenze überschreitet, bejahte der Gerichtshof die Anwendbarkeit von Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG), da die Situation dem Warenverkehr (der zweifellos unter Art. 113 EGV [jetzt Art. 133 EG] fällt), sehr ähnlich ist. Die Anwendbarkeit des Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG) auf alle anderen Erbringungsweisen von Dienstleistungen (der Auslandserbringung, der gewerblichen Niederlassung und der Niederlassung natürlicher Personen) verneinte der EuGH.487 Zu den Dienstleistungen im Verkehrssektor verwies der Gerichtshof auf seine AETR-Rechtsprechung, wonach diese Dienstleistungen in einem besonderen Titel des Vertrages geregelt sind und daher nicht unter Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG) fallen.488 Der Gerichtshof unterschied auch nicht zwischen Sicherheitsregeln (wie sie Gegenstand des AETR-Urteils waren) und Abkommen, die den Handel betreffen. Hierbei verwies der Gerichtshof auf seine Stillegungsfonds-Rechtsprechung (Gutachten 1 / 76). Dort hatte der Gerichtshof diese Übereinkommen mit wirtschaftlichem Charakter ebenfalls dem Titel Verkehr zugeordnet.489 GATT = General Agreement on Tariffs and Trade. Für den Bereich der EGKS-Erzeugnisse und der Euratom-Waren wurde ebenfalls die Anwendbarkeit bejaht, vgl. die Ausführungen oben. 486 EuGH, Slg. 1994, I-5267 (5400 f.) – Gutachten 1 / 94, WTO. 487 EuGH, Slg. 1994, I-5267 (5401 f.) – Gutachten 1 / 94, WTO. 488 Der Gerichtshof wendet also die allgemeine Regel lex specialis derogat legi generali an. 489 EuGH, Slg. 1977, 741 – Gutachten 1 / 76, Stilllegungsfonds. 484 485
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
127
Als Ergebnis hielt der Gerichtshof fest, dass nur die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen im Sinne von Korrespondenzdienstleistungen in den Anwendungsbereich von Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG) fällt und dass die internationalen Verkehrsabkommen hiervon ausgeschlossen sind.490 (c) TRIPS Auch für den Bereich des TRIPS verneinte der EuGH die Anwendbarkeit des Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG). Der Gerichtshof räumte zwar ein, dass es einen Zusammenhang zwischen geistigem Eigentum und Warenverkehr gibt. Dieser solle jedoch nicht genügen, um das TRIPS in den Anwendungsbereich des Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG) fallen zu lassen, da die Rechte an geistigem Eigentum nicht spezifisch den internationalen Warenaustausch betreffen, sondern vielmehr den Binnenhandel im gleichen Maße wie den internationalen Handel, wenn nicht stärker als diesen, betreffen.491 Der EuGH führte bei der Begründung der Außenkompetenz der Gemeinschaft erstmals den Gedanken der Umgehung interner Verfahrensvorschriften an. Auf der Ebene der internen Rechtsetzung verfügt die Gemeinschaft im Bereich des geistigen Eigentums über eine Zuständigkeit zur Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften gemäß den Art. 100 und 100 a EGV (jetzt Art. 94 EG und Art. 95 EG). Sie kann auf der Grundlage von Art. 235 EGV (jetzt Art. 308 EG) neue Titel schaffen, die dann die nationalen Titel überlagern. Dies hat die Gemeinschaft zum Beispiel mit dem Erlass der Verordnung (EG) Nr. 40 / 94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke492 getan. Für den Erlass solcher Bestimmungen galten jedoch zum Zeitpunkt des Gutachtens 1 / 94 andere Abstimmungsvorschriften (Einstimmigkeit im Fall der Art. 100 EGV [jetzt Art. 94 EG] und 235 EGV [jetzt Art. 308 EG]) beziehungsweise Verfahrensvorschriften (Anhörung des Parlaments im Fall der Art. 100 EGV [jetzt Art. 94 EG] und 235 EGV [jetzt Art. 308 EG], Verfahren der Mitentscheidung im Fall des Art. 100 a EGV [jetzt Art. 95 EG]) als sie im Rahmen des Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG) galten. Der Gerichtshof folgerte hieraus: „Würde der Gemeinschaft eine ausschließliche Zuständigkeit zuerkannt, mit Drittländern Abkommen zur Harmonisierung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur gleichzeitigen Herstellung einer Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene zu schließen, so könnten sich die Gemeinschaftsorgane den Zwängen entziehen, denen sie intern hinsichtlich des Verfahrens und der Art der Beschlussfassung unterliegen.“493
Vgl. hierzu Tridimas / Eeckhout, YEL 1994, 143 (160 f.). EuGH, Slg. 1994, I-5267 (5405) – Gutachten 1 / 94, WTO. 492 ABl. L 1994, 1. 493 EuGH, Slg. 1994, I-5267 (5406) – Gutachten 1 / 94, WTO, Hervorhebungen durch den Verfasser. 490 491
128
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Festzuhalten bleibt somit, dass das TRIPS-Abkommen nicht in den Anwendungsbereich des Art. 133 EG fällt und der Gemeinschaft damit keine ausschließliche Zuständigkeit für Verträge über Rechte am geistigen Eigentum zusteht. (2) Implizite Außenkompetenzen der Gemeinschaft Nachdem der Gerichtshof die Anwendbarkeit des Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG) auf das GATS- und auf das TRIPS-Abkommen für weite Bereiche abgelehnt hatte, nahm er zu einer möglichen ausschließlichen stillschweigenden Abschlusskompetenz der Gemeinschaft Stellung. Gemäß dem Gutachtenantrag der Kommission prüfte der Gerichtshof die ausschließliche Kompetenz der Gemeinschaft, machte also keine Ausführungen zur Herleitung einer impliziten Außenkompetenz. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Gerichtshof die zweistufige Prüfung aufgegeben hätte (1. Entstehung der Außenkompetenz, 2. Umschlagen der geteilten Zuständigkeit in eine ausschließliche), er lässt vielmehr die erste Stufe der Prüfung aus, weil er offenbar davon ausgeht, dass die Außenkompetenz unstreitig vorliegt.494 Dies wird deutlich, wenn der Gerichtshof formuliert: „Nur in dem Maße, wie gemeinsame Vorschriften auf interner Ebene erlassen werden, wird die externe Zuständigkeit der Gemeinschaft zu einer ausschließlichen.“495
Der Gerichtshof gliederte das Gutachten in Ausführungen zum GATS-Abkommen und solchen zum TRIPS-Abkommen (die ausschließliche Zuständigkeit zum Abschluss des GATT-Abkommens wurde bereits, aufgrund der Anwendbarkeit des Art. 133 EG, bejaht). (a) GATS Die Kommission machte drei mögliche Quellen einer ausschließlichen externen Zuständigkeit der Gemeinschaft geltend. Sie führte zunächst an, dass aus den Befugnissen, die der Gemeinschaft auf interner Ebene zustehen, eine ausschließliche externe Befugnis folge. Dem entgegnend zitierte der Gerichtshof das AETR-Urteil: „Selbst im Verkehrssektor folgt jedoch die ausschließlich externe Zuständigkeit der Gemeinschaft nicht ohne weiteres aus ihrer Befugnis zum Erlass von Vorschriften auf interner Ebene. Nach dem Urteil AETR verlieren die Mitgliedstaaten, ob einzeln oder gemeinsam handelnd, das Recht zum Eingehen von Verpflichtungen gegenüber Drittstaaten nur in dem Maße, wie gemeinsame Rechtsnormen erlassen werden, die durch diese Verpflichtungen beeinträchtigt werden könnten.“496 494 So auch Dörr, EuZW 1996, 39 (42); a.A. Geiger, JZ 1995, 973 (979 ff.). Der Rat und die Mitgliedstaaten, die Stellungnahmen abgegeben haben, erkennen an, dass die Gemeinschaft über bestimmte Zuständigkeiten verfügt, bestreiten jedoch deren ausschließlichen Charakter, EuGH, Slg. 1994, I-5267 (5410, Rdnr. 72) – Gutachten 1 / 94, WTO. 495 EuGH, Slg. 1994, I-5267 (5411) – Gutachten 1 / 94, WTO. 496 EuGH, Slg. 1994, I-5267 (5411, Rdnr. 77) – Gutachten 1 / 94, WTO, Hervorhebungen durch den Verfasser.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
129
Im Unterschied zum Kapitel über den Verkehr enthalten die Kapitel über das Niederlassungsrecht und den freien Dienstleistungsverkehr keine Bestimmung, die die Zuständigkeit der Gemeinschaft ausdrücklich auf Beziehungen, die dem internationalen Recht unterliegen, erstreckt. Das einzige Ziel dieser Vorschriften ist vielmehr, das Niederlassungsrecht und den freien Dienstleistungsverkehr gemeinschaftsintern, also zugunsten der Angehörigen der Mitgliedstaaten, zu gewährleisten. Es ist daher ausgeschlossen, aus diesen Kapiteln von vornherein eine externe ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft für dieses Sachgebiet abzuleiten. Mit diesen Ausführungen wendete sich der Gerichtshof jedoch nicht von dem in seinen früheren Urteilen begründeten Komplementaritätsprinzip ab497, sondern stellte lediglich klar, dass der Gemeinschaft nicht bereits dann eine ausschließliche Kompetenz zusteht, wenn die Gemeinschaft einem völkerrechtlichen Abkommen beitreten will, um eines ihrer Ziele zu erreichen.498 Die Kommission machte zweitens geltend, die Notwendigkeit, ein Abkommen zu schließen, um ein Ziel der Gemeinschaft zu erreichen, verleihe der Gemeinschaft eine ausschließliche externe Zuständigkeit. Der Gerichtshof lehnte diese Argumentation ab. Er stellte klar, dass in der Situation, in der noch keine Sekundärrechtsakte erlassen worden sind, der Gemeinschaft nur ausnahmsweise eine ausschließliche Kompetenz zusteht. Dieser Fall ist gegeben, wenn eine völkerrechtliche Vereinbarung notwendig ist, um eine geplante innergemeinschaftliche Regelung sinnvoll und effektiv zu machen.499 Im Falle des GATS ist die Lage jedoch eine andere, da „die Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleitungsverkehrs zugunsten der Angehörigen der Mitgliedstaaten ( . . . ) nicht untrennbar mit der Behandlung von Angehörigen von Drittstaaten in der Gemeinschaft oder von Angehörigen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft in Drittstaaten verbunden [ist].“500
Die Kommission führte drittens die Art. 100 a EGV (jetzt Art. 95 EG) und Art. 235 EGV (jetzt Art. 308 EG) als Grundlage für eine ausschließliche externe Zuständigkeit an. Zu Art. 100 a EGV (jetzt Art. 95 EG) hielt der EuGH fest, dass, falls die Gemeinschaft von dieser Harmonisierungskompetenz Gebrauch gemacht hat, dies die Freiheit der Mitgliedstaaten zu Verhandlungen mit Drittstaaten begrenzen oder sogar beseitigen kann. Es sei jedoch ausgeschlossen, dass eine auf interner Ebene noch nicht ausgeübte Harmonisierungskompetenz dazu führt, dass der Gemeinschaft eine ausschließliche externe Zuständigkeit auf diesem Gebiet 497 So jedoch Dörr, EuZW 1996, 39 (42 f.) unter Verwendung des Begriffs „ParallelismusThese“. 498 Eine solche Annahme wurde teilweise von der Literatur unter Bezugnahme auf die Ausführungen in EuGH, Slg. 1977, 741 (755, Rdnr. 3, 4) – Gutachten 1 / 76, Stilllegungsfonds vertreten. 499 EuGH, Slg. 1994, I-5267 (5413) – Gutachten 1 / 94, WTO. 500 EuGH, Slg. 1994, I-5267 (5414) – Gutachten 1 / 94, WTO, Hervorhebungen durch den Verfasser.
9 Metz
130
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
zusteht. Daher ist im konkreten Fall keine ausschließliche Kompetenz aufgrund von Art. 100 a EGV (jetzt Art. 95 EG) gegeben. Art. 235 EGV (jetzt Art. 308 EG) erlaubt es der Gemeinschaft, kompetenzrechtliche Unzulänglichkeiten zur Verwirklichung ihrer Ziele auszugleichen. Art. 235 EGV (jetzt Art. 308 EG) kann, laut EuGH, als solcher jedoch keine ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft auf internationaler Ebene schaffen. Erforderlich hierzu wäre zumindest eine ausgeübte Innenkompetenz (abgesehen von dem Fall, in dem die Innenkompetenz wirksam nur zugleich mit der externen Zuständigkeit ausgeübt werden kann, wie im Fall des Gutachtens 1 / 76). Der Gerichtshof zählte damit die allgemeinen Erfordernisse zur Begründung einer ausschließlichen Zuständigkeit auf und merkte an, dass diese „erst recht“ auch für Art. 235 EGV (jetzt Art. 308 EG) gelten.501 Im konkreten Fall ergab sich somit keine ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft, es verblieb bei der zwischen den Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft geteilten Kompetenz. (b) TRIPS Für den Bereich des TRIPS verneinte der Gerichtshof ebenfalls eine ausschließliche Außenkompetenz nach der „Gutachten 1 / 76-Doktrin“502, da die Vereinheitlichung oder Harmonisierung des Schutzes des geistigen Eigentums im Rahmen der Gemeinschaft, um praktisch wirksam zu werden, nicht notwendig durch Abkommen mit Drittstaaten begleitet werden muss. Die Art. 100 a EGV (jetzt Art. 95 EG) und 235 EGV (jetzt Art. 308 EG) verleihen aus den gleichen Gründen wie beim GATS der Gemeinschaft keine ausschließliche Außenkompetenz. Der Gerichtshof prüfte schließlich, ob die von der Gemeinschaft erlassenen Rechtsakte dadurch im Sinne des AETR-Urteils beeinträchtigt werden könnten, dass die Mitgliedstaaten am Abschluss des TRIPS mitwirken. Eine solche Beeinträchtigung verneinte der EuGH mit dem Argument, dass jedenfalls nur eine teilweise Harmonisierung verwirklicht worden ist und dass in anderen Bereichen vom Vertrag keinerlei Harmonisierung vorgesehen ist. Der Gemeinschaft steht damit auch im Bereich des TRIPS keine ausschließliche Zuständigkeit zu. (3) Verpflichtung zur Zusammenarbeit Konsequenz der vom Gerichtshof festgestellten geteilten Zuständigkeit ist, dass sich die Mitgliedstaaten individuell zu allen anstehenden Fragen äußern und an EuGH, Slg. 1994, I-5267 (5414) – Gutachten 1 / 94, WTO. Der Gerichtshof verwendet selbst diesen Terminus in EuGH, Slg. 1994, I-5267 (541, Rdnr. 99) – Gutachten 1 / 94, WTO. 501 502
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
131
den Vertragsverhandlungen beteiligen können. Dies kann, falls kein Konsens erzielt wird, zu endlosen Diskussionen führen. Außerdem steht zu befürchten, dass das einheitliche Auftreten der Gemeinschaft nach außen untergraben und ihre Verhandlungsmacht erheblich geschwächt wird. Diese „völlig legitime Besorgnis“503 ändert jedoch nichts an der Beantwortung der Zuständigkeitsfrage, denn die Feststellung der Kompetenzen ist eine den (daraus resultierenden) praktischen Schwierigkeiten vorgelagerte Frage. Der Gerichtshof überging das dargestellte Problem jedoch nicht, sondern statuierte eine Pflicht zur Zusammenarbeit, die sich aus der Notwendigkeit einer geschlossenen völkerrechtlichen Vertretung der Gemeinschaft ergibt.504 Problematisch bleibt, dass der EuGH in seinem Urteil keine Anleitung gab, wie diese notwendige Zusammenarbeit in concreto sichergestellt und durchgeführt werden soll.505 (4) Zusammenfassung Bei der Analyse des WTO-Gutachtens muss sich der Leser immer wieder vergegenwärtigen, dass der Gerichtshof, gemäß dem Gutachtenantrag der Kommission, die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft prüft. Von einer grundsätzlichen (geteilten) Zuständigkeit der Gemeinschaft geht der Gerichtshof offenbar aus. Die Ausführungen des EuGH beziehen sich immer nur auf die Ausschließlichkeit dieser Außenkompetenz. Der Gerichtshof statuiert erstens, dass die ausschließlich externe Zuständigkeit der Gemeinschaft nicht ohne weiteres aus ihrer Befugnis zum Erlass von Vorschriften auf interner Ebene folgt. Unter Hinweis auf sein AETR-Urteil hält der EuGH fest, dass eine ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft nur in dem Maße besteht, wie bereits erlassene Gemeinschaftsrechtsnormen durch einseitiges Handeln der Mitgliedstaaten auf internationaler Ebene beeinträchtigt werden können. Sind keine internen Gemeinschaftsrechtsnormen vorhanden, können diese nicht beeinträchtigt werden. Zweitens macht der Gerichtshof deutlich, dass für den Fall, dass die Gemeinschaft noch nicht von ihrer internen Kompetenz Gebrauch gemacht hat, also noch keine Gemeinschaftsrechtsnormen existieren (die beeinträchtigt werden könnten), eine ausschließliche Außenkompetenz der Gemeinschaft nur unter hohen Voraussetzungen angenommen werden kann: Nur dann, wenn eine gemeinschaftsinterne Regelung, um praktisch wirksam zu sein, notwendig durch Abkommen mit DrittEuGH, Slg. 1994, I-5267 (5420) – Gutachten 1 / 94, WTO. Der EuGH verweist hierbei auf Beschluss 1 / 78 vom 14. November 1978, Slg. 1978, 2151 (Rdnr. 34 – 36) und auf das Gutachten 2 / 91, Slg. 1993, I-1061 (1083, Rdnr. 36) – Gutachten 2 / 91, ILO; vgl. auch Emiliou, ELR 1996, 294 (308 f.). 505 Emiliou, ELR 1996, 294 (309); Bourgeois, CMLR 1995, 763 (784). O‘Keeffe, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 199, geht daher davon aus, dass die nächsten gerichtlichen Auseinandersetzungen um die Pflicht zur Zusammenarbeit gehen werden. 503 504
9*
132
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
staaten begleitet werden muss, ist die Gemeinschaft zum Abschluss dieses Abkommens ausschließlich zuständig.506 Die Außenkompetenz muss, anders ausgedrückt, mit der auszuübenden Innenkompetenz „untrennbar verbunden sein“507. Die Ausführungen im Gutachten 1 / 76 ließen Zweifel aufkommen, ob sich eine ausschließliche Zuständigkeit nicht auch stillschweigend aus der internen Zuständigkeit ergeben kann, sofern die Beteiligung der Gemeinschaft an der völkerrechtlichen Vereinbarung „notwendig ist, um eines der Ziele der Gemeinschaft zu erreichen“.508 Mit den oben genannten hohen Anforderungen an das Vorliegen einer ausschließlichen Gemeinschaftskompetenz hat der Gerichtshof diese Zweifel ausgeräumt. 509 Die Folge dieser Rechtsprechung ist, dass aufgrund der Einschränkung der ausschließlichen Zuständigkeiten der Gemeinschaft und der damit verbundenen Ausweitung der konkurrierenden Kompetenzen zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten immer mehr Abkommen als gemischte Abkommen geschlossen werden müssen.510
ff) Gutachten 2 / 92, OECD511; Bestätigung der WTO-Grundsätze zur ausschließlichen Zuständigkeit im Rahmen der Parallelismus-These In dem vom Königreich Belgien angeforderten Gutachten geht der Gerichtshof der Frage nach, ob die Gemeinschaft zum Beitritt zu einem OECD-Beschluss be506 Der Gerichtshof führt das Beispiel der Einführung von Fischereifangquoten an, die wirkungslos sind, falls sie nur für die EU Mitgliedstaaten, nicht aber für Drittländer gelten, da die Drittländer die von den Mitgliedstaaten geschonten Bestände dann wieder abfischen würden. 507 EuGH, Slg. 1994, I-5267 (5414) – Gutachten 1 / 94, WTO. 508 EuGH, Slg. 1977, 741 (756, Rdnr. 3, 4) – Gutachten 1 / 76, Stilllegungsfonds; Tridimas, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 54. 509 Tridimas, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 54; Dörr, EuZW 1996, 39 (43) meint – m. E. unter Verkennung der Unterscheidung zwischen der Existenz und der Ausschließlichkeit der Außenkompetenz –, dass der Gerichtshof damit die Parallelität zwischen Innen- und Außenkompetenz aufgegeben und eine Kehrtwende in seiner bisher gemeinschaftsfreundlichen Rechtsprechung vollzogen habe; zur Begründung führt er an, dass die von Integrationsskepsis geprägte „Maastricht“ – Debatte sowie die indirekt, aber deutlich geäußerte Kritik des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 89, 155 [210]) an der großzügigen Herleitung impliziter Gemeinschaftskompetenzen hierzu beigetragen haben dürfte; Geiger, JZ 1995, 973 (981 f.) hält dies für einen Wandel in einem hierfür ungeeigneten Bereich und fordert, dass an der Einheit zwischen Innen- und Außenkompetenz – zumindest de lege ferenda – festgehalten werden solle. 510 Emiliou, ELR 1996, 294 (310); Bourgeois, CMLR 1995, 763 (786 f.) bedauert die „weniger integrationsfreundliche und minimalistische“ Haltung des Gerichtshofs. Auch Vedder / Folz, EJIL 1996, 112 (134), kritisieren das Urteil und meinen, es würde mehr Fragen aufwerfen als beantworten. 511 EuGH, Slg. 1995, I-521 – Gutachten 2 / 92, OECD.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
133
fugt ist und ob diese Kompetenz gegebenenfalls eine ausschließliche ist. Der Gerichtshof äußerte sich gutachtlich, dass die Gemeinschaft für den Beitritt zum dritten revidierten Beschluss der OECD zuständig ist, dass diese Zuständigkeit jedoch zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten geteilt ist. Bei dem betreffenden OECD-Beschluss zur Inländerbehandlung bekunden die OECD-Mitgliedstaaten ihre Absicht, Unternehmen, die Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaates gehören oder von diesen kontrolliert werden, eine Behandlung zu gewähren, die nicht weniger günstig ist als diejenige, die unter gleichen Umständen den inländischen Unternehmen zuteil wird, vorbehaltlich gewisser Ausnahmen und Abweichungen. Ferner verpflichten sich die Vertragsparteien, im Rahmen der OECD ein Notifizierungs- und Prüfungsverfahren für Maßnahmen einzuhalten, die Ausnahmen von der Inländerbehandlung darstellen. Der Gerichtshof prüft zunächst, ob der Beitritt der Gemeinschaft zu dem OECDBeschluss in den Bereich der gemeinsamen Handelspolitik nach Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG) fällt und daher eine ausschließliche Zuständigkeit nach sich zieht. Der EuGH verneint die Einschlägigkeit des Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG). Er stellt zunächst fest, dass der Grundsatz der Inländerbehandlung512 für zwei Bereiche gilt. Er betrifft hauptsächlich die Bedingungen für die Beteiligung der unter ausländischer Kontrolle stehenden Unternehmen am inländischen Wirtschaftsleben der Mitgliedstaaten. Der Grundsatz gilt jedoch auch für die Bedingungen der Teilnahme solcher Unternehmen am Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und Drittländern. Der letztgenannte Bereich ist Gegenstand der gemeinsamen Handelspolitik der Gemeinschaft. Der erstgenannte innergemeinschaftliche Handelsverkehr unterliegt jedoch den Binnenmarktregeln der Gemeinschaft – und damit nicht der gemeinsamen Handelspolitik gemäß Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG).513 Für den Bereich des Handelsverkehrs mit Drittstaaten verweist der Gerichtshof auf sein Gutachten 1 / 94514, wonach internationale Verkehrsabkommen nicht unter die gemeinsame Handelspolitik, sondern unter die gemeinsame Verkehrspolitik fallen. Damit ist der Anwendungsbereich von Art. 113 EGV (jetzt Art. 133 EG) nicht betroffen. Um festzustellen, ob eine ausschließliche oder eine geteilte Zuständigkeit vorliegt, prüft der Gerichtshof sodann Sekundärrechtsakte, die auf der Grundlage der Art. 57 Abs. 2 (jetzt Art. 47 Abs. 2 EG), Art. 75 (jetzt Art. 71 EG), Art. 84 (jetzt Art. 80 EG), Art. 100 a (jetzt Art. 95 EG) EGV erlassen wurden, und kommt zu dem Ergebnis, dass diese Rechtsakte unstreitig nicht alle Tätigkeitsbereiche erfas512 Der Grundsatz der Inländerbehandlung besagt, dass ausländische Unternehmen so behandelt werden sollen wie inländische; er soll für 5 Bereiche gelten, nämlich für: 1. öffentliche Aufträge, 2. öffentliche Beihilfen und Subventionen, 3. Zugang zu lokalen Krediten, 4. steuerliche Pflichten, 5. Regelungen für Investitionen mit Ausnahme der Direktinvestitionen und der von direkten Zweigniederlassungen, d. h. Zweigniederlassungen, deren Muttergesellschaft nicht gebietsansässig ist, vorgenommenen Investitionen. 513 EuGH, Slg. 1995, I-521 (557 a.E.) – Gutachten 2 / 92, OECD. 514 EuGH, Slg. 1994, I-5267 – Gutachten 1 / 94, WTO = EuZW 1995, 210.
134
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
sen, auf die sich der dritte Beschluss des OECD-Abkommens bezieht. Das bedeutet, dass kein umfassendes Gemeinschaftsrecht vorliegt, welches durch eigenmächtiges völkervertragliches Handeln der Mitgliedstaaten beeinträchtigt werden könnte. Daraus folgt, dass eine zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit für den Beitritt zum dritten revidierten Beschluss der OECD vorliegt. Das OECD-Gutachten des EuGH bestätigt damit im Wesentlichen die Aussagen des WTO-Gutachtens, insbesondere unterscheidet der Gerichtshof zwischen der primärrechtlich begründeten Außenkompetenz der Gemeinschaft (die hier auf die Ergänzung einiger interner Harmonisierungsbefugnisse gestützt werden konnte) und der Exklusivität oder Ausschließlichkeit der Kompetenz, die sich nach dem Vorhandensein und dem Inhalt sekundärrechtlicher Normen bestimmt.515 gg) Gutachten 2 / 94, EMRK516; Voraussetzungen für Außenkompetenzen nach Art. 308 EG Der vom Rat der Europäischen Union eingereichte Gutachtenantrag betraf die Frage, ob ein Beitritt der Gemeinschaft zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) mit dem EG-Vertrag vereinbar ist. Dies lehnte der Gerichtshof im Ergebnis ab. Der EuGH hielt zunächst fest, dass der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung sowohl für inneres als auch für völkerrechtliches Gemeinschaftshandeln gilt. Jedoch kann sich die Zuständigkeit der Gemeinschaft zur Eingehung völkerrechtlicher Verträge nicht nur aus ausdrücklichen Vertragsbestimmungen ergeben, sondern kann auch implizit aus diesen Bestimmungen folgen. Der EuGH verwies auf sein Gutachten 2 / 91 und stellte fest, „dass die Gemeinschaft immer dann, wenn das Gemeinschaftsrecht ihren Organen im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel im Innern eine Zuständigkeit verleiht, befugt ist, die zur Erreichung dieses Ziels erforderlichen völkerrechtlichen Verpflichtungen einzugehen, auch wenn insoweit eine ausdrückliche Bestimmung fehlt“517.
Allerdings verleiht keine Bestimmung des Vertrages der Gemeinschaft allgemein die Befugnis, Vorschriften auf dem Gebiet der Menschenrechte zu erlassen oder völkerrechtliche Verträge in diesem Bereich zu schließen. Damit verneinte der Gerichtshof sowohl eine ausdrückliche als auch eine implizite Zuständigkeit der Gemeinschaft. Das Hauptaugenmerk legte der EuGH auf die Prüfung, ob Art. 235 EGV (jetzt Art. 308 EG) Rechtsgrundlage für den Beitritt zur EMRK sein kann. Der GerichtsDörr, EuZW 1996, 39 (43). EuGH, Slg. 1996, I-1759 – Gutachten 2 / 94, EMRK. 517 EuGH, Slg. 1996, I-1759 (1787, Rdnr. 26) – Gutachten 2 / 94, EMRK (Hervorhebungen durch den Verf.). 515 516
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
135
hof führte zunächst zur allgemeinen Bedeutung des Art. 235 EGV (jetzt Art. 308 EG) aus, dass dieser einen Ausgleich in Fällen schaffen soll, in denen der Gemeinschaft ausdrückliche oder implizite Befugnisse fehlen und gleichwohl Befugnisse erforderlich erscheinen, damit die Gemeinschaft ihre Aufgaben im Hinblick auf die Erreichung eines der im Vertrag festgelegten Ziele wahrnehmen kann. Im Hinblick auf das grundlegende Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung kann Art. 235 EGV (jetzt Art. 308 EG) jedoch keine Grundlage dafür bieten, die Befugnisse der Gemeinschaft über den sich aus dem Vertrag ergebenden allgemeinen Rahmen hinaus auszudehnen. „Sie [die Bestimmung des Art. 235 EGV (jetzt Art. 308 EG)] kann jedenfalls nicht als Rechtsgrundlage für den Erlass von Bestimmungen dienen, die der Sache nach, gemessen an ihren Folgen, auf eine Vertragsänderung ohne Einhaltung des hierfür im Vertrag vorgesehenen Verfahrens hinausliefen.“518
Im konkreten Fall haben die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft in mehreren Erklärungen die Bedeutung der Menschenrechte betont. Auch in der Präambel der Einheitlichen Europäischen Akte und des EUV sowie in einigen Vorschriften des EUV und des EGV wird auf die Menschenrechte Bezug genommen. Zudem sichert der EuGH in ständiger Rechtsprechung die Einhaltung von Grundrechten, welche zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Gemeinschaftsrechts zählen. Die Grundrechtstandards werden aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten und aus völkerrechtlichen Verträgen hergeleitet, die die Mitgliedstaaten abgeschlossen haben. Hierbei fällt der EMRK nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs eine besondere Bedeutung zu.519 Trotz dieser Sachlage hätte der Beitritt der Gemeinschaft zur Konvention jedoch eine wesentliche Änderung des Gemeinschaftssystems zum Schutze der Menschenrechte zur Folge, da er die Gemeinschaft zur Einbindung in ein völkerrechtliches, andersartiges institutionelles System und zur Übernahme sämtlicher Bestimmungen der Konvention in die Gemeinschaftsrechtsordnung verpflichten würde. Eine solche grundlegende Änderung des Systems zum Schutze der Menschenrechte in der Gemeinschaft wäre jedoch von verfassungsrechtlicher Dimension und ginge daher ihrem Wesen nach über die Grenzen des Art. 235 EGV (jetzt Art. 308 EG) hinaus. Ein Beitritt zur EMRK kann somit nur im Wege der Vertragsänderung vorgenommen werden.520 Bei der Argumentation des Gerichtshofs ist zweierlei hervorzuheben. Zum einen verweist der EuGH bei der Frage nach der impliziten Zuständigkeit nicht auf sein aktuelleres WTO-Gutachten mit seinen oben geschilderten hohen Voraussetzungen für das Vorliegen einer ungeschriebenen ausschließlichen Außenkompetenz, sonEuGH, Slg. 1996, I-1759 (1788, Rdnr. 30) – Gutachten 2 / 94, EMRK. EuGH, Slg. 1991, I-2925 (Rdnr. 41) – ERT; vgl. hierzu auch Arnull, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 61 ff. 520 Zu den Folgen für den Menschenrechtsschutz innerhalb der Gemeinschaft siehe Arnull, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 61 (67 ff.). 518 519
136
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
dern auf das ILO-Gutachten. Dies ist auch insofern nachvollziehbar, als es im vorliegenden Fall um die Frage des Bestehens einer Außenkompetenz ging und nicht um deren Ausschließlichkeit. Unverständlich ist jedoch, warum der EuGH von einem Ziel-Mittel-Schluss unter Rückgriff auf das Tatbestandsmerkmal der Erforderlichkeit ausgeht und den implied-powers-Grundsatz mit keiner Silbe erwähnt. Zum anderen stellt der Gerichtshof bei der Frage nach der Außenkompetenz aus Art. 235 EGV (jetzt Art. 308 EG) als Grundlage für die Ablehnung der Beitrittskompetenz zur EMRK eine neue Überlegung an, nämlich ob die Gewährung einer Außenkompetenz zur Umgehung des Vertragsänderungsverfahrens führt. hh) Open-Skies-Urteil (05. 11. 2002)521; zur Frage, wann Gemeinschaftsrechtsnormen durch internationale Verträge der Mitgliedstaaten „beeinträchtigt“ werden können In diesem Urteil nahm der EuGH zur Frage Stellung, inwieweit einzelne Mitgliedstaaten der EU befugt waren, bilaterale Luftverkehrsabkommen mit den USA zu schließen. Die Kommission hatte Klage erhoben auf Feststellung, dass die Bundesrepublik Deutschland522 durch den Abschluss des Open-Skies-Abkommens mit den USA gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 5 EGV (jetzt Art. 10 EG) und Art. 52 EGV (jetzt Art. 43 EG) und den hierauf beruhenden Verordnungen verstoßen hat.523 Das Open-Skies-Abkommen gewährte unter anderem freien Zugang zu allen Routen, unbegrenzte Linien- und Verkehrsrechte, Preisfestlegung nach einem System „der doppelten Missbilligung“ für Luftverkehrsstrecken zwischen den Vertragsparteien sowie die Möglichkeit des „code sharing“. Der EuGH bejahte eine ausschließliche Außenkompetenz der EG für Bereiche, die gemeinschaftsrechtlich geregelt sind und stellte daher eine Vertragsverletzung durch die Bundesrepublik Deutschland fest. (1) Bestehen einer ausschließlichen Außenkompetenz Der Gerichtshof prüfte zunächst das Bestehen einer ausschließlichen Außenkompetenz gemäß seinem Gutachten 1 / 76. In Bezug auf Art. 84 Abs. 2 EGV (jetzt 521 EuGH, Slg. 2002, I-9855 (Rdnr. 105 f.) – Open-Skies = EuZW 2003, 82 (88, Rdnr. 105 f.). 522 Folgende Mitgliedstaaten sind vom EuGH in parallel gelagerten Verfahren ebenfalls verurteilt worden: Großbritannien (Rs. C-466 / 98), Dänemark (Rs. C-467 / 98), Schweden (Rs. C-468 / 98), Finnland (Rs. C-469 / 98), Belgien (Rs. C-471 / 98), Luxemburg (Rs. C-472 / 98) und Österreich (Rs. C-475 / 98). 523 Die Kommission hatte sich seit 1990 fortwährend darum bemüht, vom Rat ein Verhandlungsmandat zur Aushandlung eines einheitlichen Luftverkehrsabkommens mit den USA erteilt zu bekommen. Aufgrund des Widerstandes vor allem des Vereinigten Königreiches kam ein solches Mandat jedoch nicht zustande, vgl. Heffernan / McAuliffe, ELRev 2003, 601 (603).
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
137
Art. 80 EG) führte er aus, dass diese Vorschrift für sich alleine genommen der Gemeinschaft keine Außenkompetenz verschafft. Art. 84 Abs. 2 EGV (jetzt Art. 80 EG) räumt der Gemeinschaft eine Handlungsbefugnis ein, die von einer vorherigen Entscheidung des Rates abhängig ist. Der Rat kann damit aufgrund dieser Vorschrift der Gemeinschaft im Einzelfall die Befugnis zum Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages über den Luftverkehr zuerkennen, generell steht der Gemeinschaft eine solche Befugnis jedoch nicht zu. Eine implizite Außenkompetenz der Gemeinschaft besteht nicht nur in allen Fällen, in denen von der internen Kompetenz bereits Gebrauch gemacht worden ist, sondern auch dann, wenn die internen Maßnahmen erst anlässlich des Abschlusses und der Inkraftsetzung der völkerrechtlichen Vereinbarung ergriffen werden und die interne Zuständigkeit wirksam nur zugleich mit der Außenkompetenz ausgeübt werden kann. In diesem Fall muss der Abschluss der völkerrechtlichen Vereinbarung erforderlich sein, um Ziele des Vertrages zu verwirklichen, die sich durch Aufstellung interner Regeln nicht erreichen lassen.524 Diese Voraussetzungen stimmen mit den Gutachten 1 / 76 und 1 / 94 überein. Der Gerichtshof verneint jedoch im vorliegenden Fall das Vorliegen dieser Voraussetzungen. Nichts im Vertrag hat die Organe der Gemeinschaft daran gehindert, gemeinsame Vorschriften zum Beispiel gegenüber den USA zu erlassen, die Diskriminierungen oder Wettbewerbsverzerrungen verhindert hätten. Damit war nicht erwiesen, dass sich dieses Ziel durch Aufstellung gemeinschaftsinterner Regeln nicht hätte erreichen lassen. Der Gerichtshof verwies außerdem darauf, dass die Gemeinschaft 1992 ein Maßnahmenpaket zur Herstellung des freien Dienstleistungsverkehrs erlassen konnte, ohne dass es hierfür erforderlich gewesen wäre, mit den USA gleichzeitig ein Luftverkehrsabkommen zu schließen. (2) Bestehen einer ausschließlichen Außenkompetenz nach AETR-Maßstäben Im Anschluss prüfte der EuGH das Vorliegen einer Außenkompetenz nach der AETR-Rechtsprechung. Der Gemeinschaft steht eine implizite ausschließliche Außenkompetenz dann zu, wenn sie gemeinsame Rechtsvorschriften erlassen hat, die es den Mitgliedstaaten mittelbar verbieten, mit Drittstaaten Verpflichtungen einzugehen, die diese Normen beeinträchtigen oder in ihrer Tragweite ändern könnten. Der Gerichtshof bejahte die Gültigkeit dieser Voraussetzungen auch für den Spezialfall des Art. 84 Abs. 2 EGV (jetzt Art. 80 EG), nämlich dass eine Ermächtigungsnorm dem Rat die Kompetenz zuspricht, ob und inwieweit geeignete Vorschriften zu erlassen sind. „Stünde es den Mitgliedstaaten frei, völkerrechtliche Verpflichtungen einzugehen, die die auf Grund von Art. 84 Abs. 2 EGV [jetzt Art. 80 EG] erlassenen gemeinsamen Rechtsnormen beeinträchtigen, so würde dies die Verwirklichung des mit diesen Rechtsnormen 524
EuGH, Slg. 2002, I-9855 (Rdnr. 82) – Open-Skies = EuZW 2003, 82 (87, Rdnr. 82).
138
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
verfolgten Zieles gefährden und die Gemeinschaft folglich daran hindern, ihre Aufgabe bei der Verteidigung des gemeinsamen Interesses zu erfüllen. Daher gelten die Feststellungen, die der EuGH im AETR-Urteil getroffen hat, auch dann, wenn der Rat wie im vorliegenden Fall auf der Grundlage von Art. 84 Abs. 2 EGV [jetzt Art. 80 EG] gemeinsame Rechtsnormen erlassen hat.“525
Der Gerichtshof folgt damit konsequent dem Effektivitätsgrundsatz (effet utile), denn für die tatsächliche Gültigkeit einer Gemeinschaftsrechtsnorm im Außenverhältnis ist es irrelevant, ob diese von einer vorherigen Entscheidung des Rates abhängig waren oder nicht, wichtig ist vielmehr, dass eine Gemeinschaftsnorm existiert und dass die Ziele dieser Vorschrift nicht durch autonome internationale Verpflichtungen einzelner Mitgliedstaaten konterkariert werden. Anschließend fasste der Gerichtshof kurz die Voraussetzungen zusammen, nach denen der Gemeinschaft aufgrund der ausgeübten Innenkompetenz eine ausschließliche Außenkompetenz zukommt. Dies gilt zum einen für den Fall, dass die völkerrechtlichen Verpflichtungen in den Anwendungsbereich von Gemeinschaftsrechtsnormen fallen oder jedenfalls ein Gebiet erfassen, das bereits weitgehend von solchen Vorschriften erfasst ist, auch dann, wenn kein Widerspruch zwischen den völkerrechtlichen Verpflichtungen und den Gemeinschaftsvorschriften besteht. Zum anderen gilt dies, wenn die Gemeinschaft in ihre internen Rechtsetzungsakte Klauseln über die Behandlung von Angehörigen von Drittstaaten aufgenommen hat oder ihren Organen ausdrücklich eine Zuständigkeit zu Verhandlungen mit Drittstaaten übertragen hat. Selbst in dem Fall, in dem eine solche ausdrückliche Klausel, mit der Organe zu Verhandlungen mit Drittstaaten ermächtigt werden, fehlt, kommt der Gemeinschaft eine ausschließliche Außenkompetenz zu, wenn eine vollständige Harmonisierung auf einem bestimmten Gebiet bereits erfolgt ist, denn die insoweit erlassenen Rechtsnormen könnten beeinträchtigt werden, wenn die Mitgliedstaaten die Freiheit zu Verhandlungen mit Drittstaaten behielten.526 Der Gerichtshof prüfte dezidiert, welche von der Kommission aufgeführten gemeinsamen Rechtsnormen durch die völkerrechtlichen Verpflichtungen, die die Bundesrepublik Deutschland mit dem Open-Skies-Vertrag eingegangen ist, beeinträchtigt worden sein könnten. Der EuGH schloss zunächst eine Beeinträchtigung der Verordnungen (EWG) Nr. 2407 / 92527 und (EWG) Nr. 2408 / 92528 aus, da diese nur Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft betreffen und somit nicht durch völkerrechtliche Verpflichtungen mit Drittstaaten beeinträchtigt werden können. Außerdem lehnte es der Gerichtshof ab, die bisher erlassenen gemeinschaftlichen Regelungen als „umfassende Regelung“ anzusehen.529 525 EuGH, Slg. 2002, I-9855 (Rdnr. 105 f.) – Open-Skies = EuZW 2003, 82 (88, Rdnr. 105 f.). 526 EuGH, Slg. 2002, I-9855 (Rdnr.108 – 110) – Open-Skies = EuZW 2003, 82 (89, Rdnr. 108 – 110). 527 ABl. 1992 L 240, 1. 528 ABl. 1992 L 240, 8. 529 EuGH, Slg. 2002, I-9855 (Rdnr. 119) – Open-Skies = EuZW 2003, 82 (89, Rdnr. 119).
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
139
Eine Vertragsverletzung stellte der Gerichtshof jedoch in zwei Fällen fest: Zum einen regelt Art. 1 Abs. 3 der Verordnung VO (EWG) Nr. 2409 / 91530, dass nur Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft neuartige Leistungen oder Flugpreise anbieten dürfen, die niedriger sind als diejenigen für identische Leistungen. Hieraus ergibt sich mittelbar das Verbot für Drittländer, neuartige Leistungen oder Flugpreise anzubieten, die niedriger als diejenigen für identische Leistungen sind. Für diesen Bereich hat die Gemeinschaft damit die ausschließliche Zuständigkeit erlangt. Ein Verstoß gegen diese Zuständigkeit bleibt auch dann anzunehmen, wenn die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben in concreto in den völkerrechtlichen Vertrag aufgenommen worden sind (wie dies auf Betreiben Deutschlands geschehen war) und damit nicht verletzt werden konnten. Begründet wird dies damit, dass Deutschland seit dem Inkrafttreten der Regelung nicht mehr berechtigt war, alleine völkerrechtliche Verpflichtungen in Bezug auf die von Luftfahrtunternehmen von Drittländern auf innergemeinschaftlichen Strecken zu erhebenden Flugpreise einzugehen. Dies gilt ausdrücklich auch, wenn deren Inhalt dem Gemeinschaftsrecht nicht zuwiderläuft.531 Ein zweiter Verstoß der Bundesrepublik gegen Gemeinschaftsrecht ergibt sich aus der Bezugnahme von Art. 1 und 7 der Verordnung VO (EWG) Nr. 2299 / 89532 auf Drittstaatsangehörige, da nach dieser Regelung die Vorschrift (vorbehaltlich der Gegenseitigkeit) auch für Staatsangehörige von Drittstaaten gilt, wenn sie im Gebiet der Gemeinschaft ein CRS (Computergesteuertes System zur Buchung von Luftverkehrsprodukten) zur Benutzung anbietet oder benutzt. Damit hat die Gemeinschaft die Zuständigkeit erworben, durch Vereinbarungen mit Drittländern Verpflichtungen in Bezug auf die in ihrem Gebiet zur Benutzung angebotenen oder benutzten CRS einzugehen. Die Vertragsverletzung Deutschlands ergibt sich auch hier trotz des Umstandes, dass die eingegangene völkerrechtliche Verpflichtung dem Inhalt der Verordnung VO (EWG) Nr. 2299 / 89 nicht zuwiderlief, ja sogar nur unter dem Vorbehalt gelten sollte, dass sie mit dem von der EU aufgestellten Verhaltenskodex vereinbar ist, bereits aus der Tatsache, dass Deutschland (überhaupt) völkerrechtliche Verpflichtungen im Bereich der CRS eingegangen ist. Art. 5 EGV (jetzt Art. 10 EG) verpflichtet nämlich die Mitgliedstaaten, der Gemeinschaft die Erfüllung ihrer Aufgaben zu erleichtern und alle Maßnahmen zu unterlassen, die die Verwirklichung der Ziele des Vertrages gefährden. Im Bereich der auswärtigen Beziehungen wären die Aufgaben der Gemeinschaft und die Ziele des Vertrages gefährdet, wenn die Mitgliedstaaten völkerrechtliche Vereinbarungen eingehen könnten, deren Bestimmungen die von der Gemeinschaft erlassenen Rechtsnormen beeinträchtigen oder in ihrer Tragweite ändern könnten. ABl. 1992 L 240, 15. EuGH, Slg. 2002, I-9855 (Rdnr. 127 a. E.) – Open-Skies = EuZW 2003, 82 (90, Rdnr. 127 a. E.). 532 ABl. 1989 L 220, 1. 530 531
140
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Damit hat die Bundesrepublik Deutschland dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 5 EGV (jetzt Art. 10 EG) und den Verordnungen (EWG) Nr. 2409 / 92 und 2299 / 89 verstoßen, dass sie durch Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten von Amerika völkerrechtliche Verpflichtungen eingegangen ist, die Flugpreise der von den USA bezeichneten Luftfahrtunternehmen auf Strecken in der Gemeinschaft und die in Deutschland zur Benutzung angebotenen oder benutzten CRS betreffen. (3) Bewertung Mit seinen Ausführungen zu den ausschließlichen Außenkompetenzen der Gemeinschaft, die erst anlässlich einer völkerrechtlichen Verpflichtung entstehen, bleibt der Gerichtshof seiner restriktiven Linie aus dem ILO-Gutachten treu. Nur wenn ein Ziel aus dem EG-Vertrag allein durch den Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages wirksam erreicht werden kann, darf auf eine stillschweigende ausschließliche Außenkompetenz der Gemeinschaft geschlossen werden. Diese Konstellation ist somit ein Ausnahmefall.533 Sind bereits sekundärrechtliche Vorschriften erlassen, verdeutlicht der EuGH seine Rechtsprechung, indem er Kriterien aufstellt, wann gemeinschaftliches Sekundärrecht durch völkerrechtliche Verträge der Mitgliedstaaten „beeinträchtigt“ werden kann. Hierbei wird klar, dass eine teilweise Regelung eines Politikbereichs nicht ausreicht, um eine Tätigkeit der Mitgliedstaaten nach außen zu verhindern. Vielmehr muss genau geprüft werden, welche Vorschriften von der Gemeinschaft erlassen wurden. Nur soweit diese Rechtsetzung reicht, ist eine Beeinträchtigung der Rechtsnormen und damit eine ausschließliche Außenkompetenz der Gemeinschaft möglich. Die „Kompetenzsperre“534 für die Mitgliedstaaten geht also jeweils so weit, wie der jeweilige Politikbereich von Gemeinschaftsrechtsakten durchdrungen ist. Nur in den Bereichen, wo eine Harmonisierung nahezu vollständig erreicht ist, liegt eine ausschließliche Außenkompetenz der Gemeinschaft für den gesamten Bereich vor. Da der Fall einer vollständigen Regelung eines Politikbereichs eher die Ausnahme ist, werden völkerrechtliche Vereinbarungen in Zukunft oft in Form so genannter gemischter Verträge abgeschlossen werden müssen. Festzuhalten bleibt, dass bloß faktische Beeinträchtigungen oder Verzerrungen des Dienstleistungsverkehrs im Binnenmarkt, wie bereits im ILO-Gutachten angesprochen, keine Außenkompetenz der Gemeinschaft begründen. Der Gerichtshof hebt hier die Möglichkeit für die Gemeinschaft hervor, dass nichts im Vertrag sie daran hindert, im Rahmen der von ihr (intern) erlassenen gemeinsamen Vorschriften konzertierte Aktionen gegenüber Drittländern vorzusehen oder den Mitglied533 So auch Pitschas, EuZW 2003, 92, Anmerkung zu EuGH, EuZW 2003, 82 (Kommission . / . Bundesrepublik Deutschland). 534 Pitschas, EuZW 2003, 92 (93), Anmerkung zu EuGH, EuZW 2003, 82 (Kommission . / . Bundesrepublik Deutschland).
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
141
staaten ein bestimmtes Verhalten in ihren Außenbeziehungen vorzuschreiben.535 Der Gerichtshof macht sich somit eine formalisierte Sichtweise zu eigen, eine Beeinträchtigung des Gemeinschaftsrechts kann nur dann angenommen werden, wenn der betreffende völkerrechtliche Vertrag denselben personellen und sachlichen Anwendungsbereich hat wie das gemeinschaftliche Binnenrecht.536 Eine mittelbare Beeinträchtigung reicht demgegenüber nicht aus. Mit diesen Ausführungen grenzt der Gerichtshof den AETR-Grundsatz und damit den Umfang ausschließlicher Außenkompetenzen ein. Auffällig ist, dass die Mitgliedstaaten im Bereich der ausschließlichen Kompetenz der Gemeinschaft nicht einmal Abkommen abschließen dürfen, die mit dem Gemeinschaftsrecht völlig konform laufen oder sogar unter dem Vorbehalt stehen, dass sie mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind. Dies widerspricht nur auf den ersten Blick der ratio der Herleitung der Außenkompetenz. Es wird vertreten, ein solches völkerrechtliches Abkommen könne das Gemeinschaftsrecht im Sinne der AETR-Rechtsprechung nicht beeinträchtigen, der Gerichtshof räume damit dem Rechtsgut der Rechtssicherheit in den Außenbeziehungen einen herausragenden Stellenwert ein.537 Die Auffassung des Gerichtshof folgt jedoch einer strengen Logik und nicht wertenden Kriterien: Hat die Gemeinschaft Sekundärrecht in Bezug auf Außenbeziehungen erlassen, so kann dieses nach seinem Inkrafttreten potentiell durch eigenmächtiges Verhalten von Mitgliedstaaten beeinträchtigt werden. In diesem Moment wird daher die konkurrierende Zuständigkeit zu einer ausschließlichen der Gemeinschaft, und die Mitgliedstaaten verlieren jede Kompetenz, auf diesem Bereich irgendwelche Verpflichtungen einzugehen. Zudem kann die inhaltsgleiche Wiedergabe von Gemeinschaftsrecht in völkerrechtlichen Verträgen der Mitgliedstaaten das bestehende Gemeinschaftsrecht insoweit beeinträchtigen, als sie die autonome Entwicklungsmöglichkeit des Gemeinschaftsrechts gefährdet.538 Auch der Hinweis auf das ILO-Gutachten zwingt zu keinem anderen Ergebnis. Hier hatte der Gerichtshof den Mitgliedstaaten zugestanden, eine völkerrechtliche Verpflichtung in einem Bereich einzugehen, in dem innergemeinschaftlich bereits Mindeststandards festgelegt worden waren. Da aber auch in der völkerrechtlichen Vereinbarung die Möglichkeit gegeben wurde, schärfere Maßnahmen einzuführen oder beizubehalten, sah der Gerichtshof im Abschluss dieses Abkommens durch die Mitgliedstaaten keinen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht. Der Unterschied zwischen den Open-Skies-Abkommen und dem ILO-Abkommen ergibt sich 535 EuGH, Slg. 2002, I-9855 (Rdnr. 112) – Open-Skies = EuZW 2003, 82 (89, Rdnr. 112); näher hierzu Thym, EuropaR 2003, 277 (279 ff.). 536 Thym, EuropaR 2003, 277 (279). 537 Pitschas, EuZW 2003, 92 (93), Anmerkung zu EuGH, EuZW 2003, 82 (Kommission . / . Bundesrepublik Deutschland); anders noch, da die Schutzfunktion der Gemeinschaftskompetenz bei gemeinschaftsrechtskonformen Verhalten nicht aktualisiert werden müsse, Werbke, NJW 1971, 2103 (2107). 538 Thym, EuropaR 2003, 277 (280).
142
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
direkt aus den spezialgesetzlichen Vorschriften bezüglich Mindeststandards im Primärrecht (zum Beispiel für soziale Schutzvorschriften Art. 137 Abs. 4 2. Spiegelstrich EG und für den Umweltschutz Art. 176 EG: gemeinschaftliche Schutzmaßnahmen „hindern die einzelnen Mitgliedstaaten nicht daran, verstärkte Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen“). Auf Gemeinschaftsebene erlassene Vorschriften gelten zwar zunächst nur gemeinschaftsintern, müssen aber auch für den Außenbereich angewandt werden. Soweit primärrechtlich die Erlaubnis eingeräumt wird, auf mitgliedstaatlicher Ebene über die gesetzten Minimalstandards hinauszugehen, führt der Erlass von Minimalstandards durch sekundäres Gemeinschaftsrecht nicht zu einer ausschließlichen Außenkompetenz für die Gemeinschaft; den Mitgliedstaaten sind damit international nicht von vorneherein die Hände gebunden. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof Altverträge der Mitgliedstaaten539 gemäß Art. 307 EG nach dem Grundsatz pacta sunt servanda behandelt. Diese Verträge540 genießen zeitlich unbegrenzten Bestandsschutz. Allerdings umfasst dieser Bestandsschutz nicht etwaige Änderungsprotokolle zu den genannten Altverträgen, falls der Gemeinschaft für einzelne Bereiche in der Zwischenzeit eine ausschließliche Kompetenz zusteht. Damit trägt der EuGH der dynamischen Entwicklung des Gemeinschaftsrechts Rechnung und sichert die Effektivität der Außenkompetenzen der Gemeinschaft.541 Mit seinem Open-Skies-Urteil hat der Gerichtshof seine Rechtsprechung zu den Außenkompetenzen konsequent fortentwickelt und einige restriktive Entwicklungslinien der letzten Jahre bestätigt.542
e) Zusammenfassung Aus dem oben dargestellten case-law des Gerichtshofs lassen sich folgende Grundsätze festhalten: Erster Grundsatz Die Gemeinschaft hat gemäß Art. 281 EG grundsätzlich die Fähigkeit, im Rahmen der Ziele der Gemeinschaft völkerrechtliche Verpflichtungen einzugehen. 539 Also solche internationalen Übereinkünfte, die die Mitgliedstaaten vor dem Inkrafttreten der Römischen Verträge mit Drittstaaten abgeschlossen haben. 540 Im vorliegenden Fall das deutsch-amerikanische Luftverkehrsabkommen von 1955. 541 Thym, EuropaR 2003, 277 (282). 542 So auch Thym, EuropaR 2003, 277. Zur weiteren Entwicklung des „Single European Sky“ und der Rolle der Gemeinschaft, vgl. van Houtte, CMLRev 2004, 1595 ff. Die EUKommission hat inzwischen ein Vertragsverletzungsverfahren unter anderem gegen Deutschland eingeleitet, weil die vom Gerichtshof festgestellten Verstöße noch nicht behoben worden sind, vgl. Europa-Report, EuZW 2005, 67.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
143
Art. 281 EG ermächtigt die Gemeinschaft indes nicht, im Einzelfall international tätig zu werden. Hierfür ist jeweils eine besondere Ermächtigungsgrundlage erforderlich. Zweiter Grundsatz Die Außenkompetenz der Gemeinschaft ist in einem zweistufigen Prüfungsschritt zu untersuchen: 1. Besteht überhaupt eine Außenkompetenz der Gemeinschaft (Existenz-Frage)? 2. Falls ja, wird diese (dann grundsätzlich zunächst konkurrierende Zuständigkeit) zu einer ausschließlichen Zuständigkeit der Gemeinschaft (Ausschließlichkeits- / Exklusivitätsfrage). Zu 1. Eine Außenkompetenz der Gemeinschaft kann aufgrund einer ausdrücklichen Zuweisung durch den EG-Vertrag bestehen oder sich implizit aus dem Vertrag oder bereits erlassenem Sekundärrecht ergeben (implied-power). Zu 2. Die grundsätzlich konkurrierende Zuständigkeit wird zu einer ausschließlichen in folgenden Fällen: Entweder der Gerichtshof hat durch seine Entscheidungen einer bestimmten Norm a priori eine ausschließliche Zuständigkeit zugeschrieben (bisher im Falle der gemeinsamen Handelspolitik nach Art. 133 EG543 und im Falle der Erhaltung der Fischbestände544 geschehen; Art. 111 EG eröffnet darüber hinaus nach der hier vertretenen Auffassung eine ausschließliche Gemeinschaftskompetenz zum Abschluss von Wechselkursvereinbarungen mit Drittstaaten545) oder die Gemeinschaft hat ihre interne Kompetenz durch Erlass von Sekundärrecht bereits ausgeübt.546 In letzterem Fall muss547 weiter geprüft werden, ob die Gemeinschaftsrechtsnorm durch mitgliedstaatliches Verhalten beeinträchtigt werden kann. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Norm selbst ihre Ausschließlichkeit feststellt oder der Gemeinschaft das Recht verleiht, mit Drittländern zu verhandeln oder Regelun543 Nachdem die Übergangsfrist des Art. 113 EGV a. F. am 01. 01. 1970 abgelaufen ist, vgl. EuGH, Slg. 1975, 1355 (1363 f.) – Gutachten 1 / 75, Lokale Kosten. 544 Nachdem die Übergangsfrist des Art. 102 der Beitrittsakte von 1972 am 01. 01. 1979 ausgelaufen ist, vgl. EuGH, Slg. 1976, 1279 (Rdnr. 30 – 33) – Kramer und EuGH, Slg. 1981, 1045 (Rdnr. 17, 19 ff.) – Kommission . / . Vereinigtes Königreich. 545 So auch Schmalenbach, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 300 EGV Rdnr. 3. 546 Dashwood, ELRev 1998, 201 (212) spricht in einem solchen Fall – in Abgrenzung zur „a priori exclusivity“ – von der „pre-emptive exclusivity“. 547 Im Sinne einer formal-juristischen Subsumtion, Thym, EuropaR 2003, 277 (284).
144
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
gen trifft, die die Rechtsverhältnisse von Drittstaatsangehörigen betreffen; ferner wenn die Norm einheitliche Standards vorgibt (jedoch nicht im Fall von Minimaloder Maximalstandards), und schließlich dann, wenn die Gemeinschaft ein Rechtsgebiet (nahezu) vollständig harmonisiert hat. Hierbei ist es eine Frage der Auslegung jeder einzelnen Gemeinschaftsnorm, ob sie mitgliedstaatliche Maßnahmen zulässt und ob ihre Anwendung durch nationales Recht beeinträchtigt werden könnte.548 Ist eine solche ausschließliche Außenkompetenz der Gemeinschaft begründet, dürfen die Mitgliedstaaten in dem jeweiligen Bereich allein keine völkerrechtlichen Verträge abschließen, auch dann nicht, wenn sie (ausdrücklich) das Gemeinschaftsrecht respektieren. Dritter Grundsatz Der zweistufige Prüfungsschritt versagt lediglich in einem (Ausnahme-)Fall: Wenn die Gemeinschaft noch keinen Sekundärrechtsakt erlassen hat, eine gemeinschaftsinterne Regelung ohne Einbeziehung von Drittländern aber unwirksam und damit sinnlos wäre und die Regelung aufgrund der Ziele des Vertrages erforderlich ist, dann entsteht (direkt) eine ausschließliche Außenkompetenz der Gemeinschaft. Schließlich kann festgehalten werden, dass der Gerichtshof bei der Zubilligung einer konkurrierenden Kompetenz großzügig ist, eine ausschließliche Kompetenz der Gemeinschaft jedoch nur zurückhaltend einräumt. Dies hat zur Folge, dass immer mehr so genannte gemischte Abkommen, an denen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten beteiligt sind, abgeschlossen werden müssen, da ein „Flickenteppich“ von ausschließlichen und konkurrierenden Kompetenzfeldern entstanden ist.549 Ob der Gerichtshof durch seine Urteile eine pragmatische „goldene Balance“ zwischen den Außenkompetenzen der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten gefunden hat, erscheint fraglich, da es ebenso schwer festzulegen ist, ob der Gemeinschaft auf einem bestimmten Gebiet Kompetenzen zustehen, wie zu bestimmen, ob die Gemeinschaftskompetenz ausschließlich ist.550
Temple Lang, YEL 1986, 183 (212). Piris, ELR 1994, 449 (479) „shared powers are the rule, exclusive competence the exception“. 550 Tridimas / Eeckhout, YEL 1994, 143 (172). Zur Komplexität der Rechtsprechung auch Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (525) „Man muss insofern schon ein Experte des Europarechts sein, der die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs erkennt, um die Befugnisse der Europäischen Union adäquat beschreiben zu können.“ und Craig, ELRev 2004, 323 (328 f.) „The scope of the EU’s external competence [ . . . ] is complex to say the least“. 548 549
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
145
VII. Spezifische Probleme bei (echten oder klassischen) gemischten Abkommen Ein gemischtes Abkommen liegt vor, wenn sowohl die Gemeinschaft als auch die Mitgliedstaaten Parteien eines völkerrechtlichen Vertrages mit einem oder mehreren anderen Völkerrechtssubjekten werden.551 Gemischte Abkommen kommen dann zur Anwendung, wenn die Kompetenz der Gemeinschaft nicht vollumfänglich den Regelungsgegenstand des Abkommens abdeckt (obligatorisch gemischtes Abkommen) oder wenn die Gemeinschaftskompetenz nicht ausschließlich ist (fakultativ gemischtes Abkommen552). Ist die Gemeinschaft für den gesamten Bereich eines Abkommens ausschließlich zuständig, so verbietet das Gemeinschaftsrecht eine gemeinsame Beteiligung der EG und der Mitgliedstaaten an einem völkerrechtlichen Vertrag, ein gemischter Vertrag scheidet mithin aus.553 Haben Mitgliedstaaten einen völkerrechtlichen Vertrag auf einem Gebiet geschlossen, das im Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch zur ausschließlichen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten gehörte, mittlerweile aber in die Zuständigkeit der Gemeinschaft übergegangen ist, tritt die Gemeinschaft nicht automatisch neben die Mitgliedstaaten oder an Stelle dieser in den Vertrag ein. Erforderlich für einen solchen Eintritt wären jedenfalls die Zustimmung der anderen Vertragsparteien und gegebenenfalls eine Vertragsänderung, falls zum Beispiel der Gründungsvertrag einer internationalen Organisation nur Staaten als Mitglieder vorsieht.554 Lange Zeit waren im EG-Vertrag keine speziellen Vorschriften für die Aushandlung und den Abschluss gemischter Abkommen enthalten.555 Erst mit dem Vertrag 551 Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 237; vgl. Macleod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Communities, S. 142 ff.; Stein, Der gemischte Vertrag im Recht der Außenbeziehungen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, S. 21 ff. Zu den verschiedenen Arten von gemischten Verträgen Rosas, in: Koskenniemi, International Law Aspects of the European Union, S. 128 ff. Zur Frage, ob bereits das Völkerrecht den Abschluss gemischter Abkommen verlangt, vgl. Groux / Manin, Die Europäischen Gemeinschaften in der Völkerrechtsordnung, S. 82 ff. Der Begriff „gemischte Zuständigkeit“ wurde erstmals durch den Vertrag von Nizza in die Gemeinschaftsverträge aufgenommen (vgl. Art. 133 Abs. 6 UAbs. 2 EG, der zugleich die verfahrensmäßigen Folgen regelt). 552 In diesem Fall können die Mitgliedstaaten dem Abkommen beitreten, ohne dass die Gemeinschaft dies verhindern könnte, Herrmann, EuZW 2001, 269 (270); Rosas, in: Koskenniemi, International Law Aspects of the European Union, S. 131. In der Forschungs- und Technologiepolitik verlaufen die Außenkompetenzen der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten parallel, was zu fakultativ gemischten Abkommen führen kann, Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 238. 553 Dauses, EuR 1979, 138 (150). 554 Vgl. Dauses, EuR 1979, 138 (149 f.); Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 237, mit dem Hinweis auf das GATT 1947, das nach Ablauf der Übergangszeit in die ausschließliche Vertragsschlusskompetenz der EG fiel, EuGH, Slg. 1972, 1219 (1227).
10 Metz
146
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
von Nizza und der Einfügung des Art. 133 Abs. 6 UAbs. 2 EG wurde der Begriff der „gemischten Zuständigkeit“ in den Vertrag eingefügt und klargestellt, dass zur Aushandlung solcher Abkommen neben einem Beschluss der Gemeinschaft auch die einvernehmliche Zustimmung der Mitgliedstaaten erforderlich ist. Die Technik der gemischten Verträge hat bereits auf vielen Politikfeldern, etwa der Handelspolitik, der Umweltpolitik und der Entwicklungszusammenarbeit, Anwendung gefunden.556 So wurden alle Assoziationsabkommen der Gemeinschaft (bis auf diejenigen mit Zypern und Malta) in Form gemischter Abkommen geschlossen. Die Beurteilungen gemischter Verträge gehen weit auseinander. Einige Autoren sehen in diesen Abkommen große Vorteile und weisen darauf hin, dass gemischte Verträge das Interesse der Mitgliedstaaten an der Beteiligung an völkerrechtlichen Abkommen mit dem Streben der Gemeinschaft nach Autonomie miteinander verbinden und so zu einer konstitutionellen Balance führen.557 Außerdem sollen sie den Vorteil haben, dass ein gemeinschaftsrechtlicher Kompetenzkonflikt nicht auftreten kann, da sich die jeweiligen Zuständigkeiten einerseits der Gemeinschaft und andererseits der Mitgliedstaaten lückenlos aneinander anschließen.558 Andere Stimmen in der Literatur kritisieren die Schwerfälligkeit gemischter Abkommen. Diese erklärt sich einerseits durch die teilweise lange Suche nach Kompromissen und andererseits aus dem Erfordernis der Ratifikation durch alle Mitgliedstaaten.559 Außerdem wird die Beteiligung der Mitgliedstaaten als Gefahr für das einheitliche Auftreten der Gemeinschaft nach außen und für den weiteren Integrationsprozess gesehen. Durch die vermehrte Beteiligung der Mitgliedstaaten bestünde die Gefahr der Aushöhlung der Gemeinschaftskompetenzen. Auch die Suspendierung von Abkommen bereitet Probleme, falls die Kompetenzen im Rahmen 555
Im Euratomvertrag dagegen wurde mit Art. 102 EA eine besondere Regelung getrof-
fen. 556 Eine Liste aller gemischten Abkommen der Europäischen Gemeinschaft für den Zeitraum 1958 – 2000 findet sich bei Heliskoski, Mixed Agreements as a Technique for Organizing the International Relations of the European Community and its Member States, S. 249 ff. 557 Heliskoski, Mixed Agreements as a Technique for Organizing the International Relations of the European Community and its Member States, S. 27. 558 Dauses, EuR 1979, 138 (149). 559 Rosas, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 208 weist auf die unbefriedigende Situation sowohl für EU-Akteure als auch für Drittstaaten hin; er führt als Beispiel das Abkommen über eine Zusammenarbeit und eine Zollunion zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik San Marino an, welches bereits im Dezember 1991 unterzeichnet wurde. Aufgrund der fehlenden Ratifikation in allen Mitgliedstaaten und den Beitritten zur Union konnte das Abkommen lange Zeit nicht in Kraft treten. Erst am 28. 02. 2002 genehmigte der Rat das Zoll- und Kooperationsabkommen und beschloss (2002 / 245 / EG), dass das Abkommen für die Gemeinschaft und die 12 (alten) Mitgliedstaaten in Kraft treten soll. Für die 1995 beigetretenen Staaten Österreich, Finnland und Schweden kann das Abkommen allerdings erst nach Notifizierung und Abschluss des jeweiligen nationalen Ratifizierungsverfahrens in Kraft treten. Bis zum Inkrafttreten des Abkommens (ABl. 2002 L 84, 43) galt ein Interimsabkommen (ABl. 1992 L 359, 13).
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
147
dieses Abkommens geteilt waren. Dann ist unklar, wer die Suspendierung erklären darf, die Mitgliedstaaten oder der Rat oder beide zusammen.560
VIII. Verfahren zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge Das Verfahren gehört zwar streng genommen nicht unmittelbar zu den Außenkompetenzen der Gemeinschaft, soll hier jedoch wegen seiner großen praktischen Bedeutung kurz dargestellt werden. 1. EAG Der Euratomvertrag sieht mehrere Rechtsgrundlagen zum Abschluss von völkerrechtlichen Abkommen vor. Unter diesen ist Art. 101 EA mit Abstand die wichtigste. Art. 101 EA differenziert zwischen Abkommen, die der Zustimmung des Rates bedürfen (UAbs. 2), und solchen, bei denen das nicht der Fall ist (UAbs. 3). Ob ein Abkommen der Zustimmung des Rates bedarf, hängt von seinem Inhalt ab.561 Alle Abkommen, die interne Rechtsetzung erfordern oder außerplanmäßige Ausgaben betreffen, bedürfen intern der Mitwirkung des Rates. Da solche Abkommen die Mehrzahl sind, ist eine Zustimmung des Rates zu völkerrechtlichen Abkommen die Regel. In diesem Fall liegt die Verhandlungskompetenz bei der Kommission, wenn der Rat ihr hierzu das Mandat erteilt. Der Rat kann der Kommission auch Verhandlungsdirektiven erteilen. Die Kommission stimmt sich im Laufe der Verhandlungen regelmäßig mit den Mitgliedstaaten ab. Dem von der Kommission ausgehandelten und unterschriebenen Abkommen muss der Rat anschließend mit qualifizierter Mehrheit zustimmen. 562 Abkommen, deren Durchführung keine Mitwirkung des Rates erfordern (die Kommission also innergemeinschaftlich ohne den Rat handlungsfähig ist) und im Rahmen des betreffenden Haushaltsplanes möglich sind, kann die Kommission eigenständig aushandeln und abschließen.563 Der Rat muss über die Tätigkeit der Kommission ständig unterrichtet werden, seine Zustimmung ist aber zu keiner Zeit erforderlich. Das Europäische Parlament hat bei Verträgen nach Art. 101 EA keine vertraglich abgesicherte Rolle. Aufgrund informeller interinstitutioneller Vereinbarungen 560 Rosas, in: Dashwood / Hillion, The General Law of E.C. External Relations, S. 209; zu den Problemen bei der Durchführung von gemischten Abkommen, ebenda, S. 211 ff. 561 MacLeod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Communities, S. 108. 562 Zu den Mehrheitsverhältnissen vgl. Art. 118 Abs. 2 EA. 563 Berié / Miller, Gemeinsamer Markt und Euratom, S. 303 f. (und Fn. 5).
10*
148
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
wird das Parlament jedoch ständig unterrichtet und soll die Möglichkeit einer begrenzten Einflussnahme bekommen.564 Ein vollständig anderes Verfahren sieht Art. 206 EA für den Abschluss von Assoziationsabkommen vor. Solche Abkommen können nach Anhörung des Europäischen Parlaments vom Rat geschlossen werden. Das Erfordernis der einstimmigen Zustimmung durch den Rat stärkt dessen Rolle. Obwohl von der Kommission in Art. 206 EA nicht die Rede ist, ist es wohl ihre Aufgabe, die Aufnahme von Verhandlungen zu empfehlen, diese Verhandlungen selbst nach Maßgabe der Ratsdirektiven zu führen und schließlich dem Rat den Abschluss des Abkommens vorzuschlagen.565 Der Vollständigkeit halber sei noch auf Art. 29 EA hingewiesen. Hiernach ist ein Vertrag über den Austausch wissenschaftlicher oder gewerblicher Kenntnisse auf dem Kerngebiet zwischen einem Mitgliedstaat oder einer Person oder einem Unternehmen einerseits und einem dritten Staat oder einer zwischenstaatlichen Einrichtung oder einem Angehörigen eines dritten Staates andererseits von der Kommission zu schließen, falls das Abkommen bei einer Partei die Unterzeichnung durch einen Staat in Ausübung seiner Hoheitsrechte erfordert. Die Kommission kann jedoch auch eine Person, ein Unternehmen oder einen Staat ermächtigen, dieses Abkommen selbst zu schließen.
2. EGKS Außer für die Fälle der Kompetenzergänzung (Art. 95 KS) enthielt der EGKSVertrag keine Bestimmungen über das Verfahren bei der Verhandlung und dem Abschluss von Übereinkommen. Für den Abschluss von Abkommen mussten daher die generellen Vorschriften des Vertrags zum Erlass von Rechtsakten angewendet werden.566 Der Hauptunterschied zum EG-Vertrag war dabei die dominante Rolle, die die Kommission im Rahmen der Montanunion spielte. Dessen ungeachtet war es die Gemeinschaft, nicht die Kommission, die Verpflichtungen auf völkerrechtlicher Ebene einging.
564 U. a. zum so genannten „Luns-Westerterp-Verfahren“ (bzw. „Luns-Westerdorp-Verfahren“) vgl. MacLeod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Communities, S. 109 i. V. m. 98 ff. 565 So MacLeod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Communities, S. 110. 566 MacLeod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Communities, S. 106.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
149
a) Verhandlungskompetenz Die Kommission konnte selbst entscheiden, ob sie Verhandlungen zum Abschluss eines Vertrages aufnehmen wollte oder nicht. Ein Mandat vom Rat war – anders als im EG-Vertrag vorgesehen – nicht nötig. b) Abschlusskompetenz Wurde ein Abkommen auf der allgemeinen Grundlage des EGKS-Vertrages abgeschlossen, so lag die Abschlusskompetenz vollständig bei der Kommission. Der Rat musste nicht einmal formell konsultiert werden.567 Sollte ein Vertrag auf der Grundlage des Art. 95 KS geschlossen werden, bedurfte die Entscheidung der Kommission der Zustimmung des Rates, außerdem musste der Beratende Ausschuss angehört werden. Die Kommission übermittelte dem Rat ihren Entscheidungsentwurf zum Abschluss eines Abkommens. Diesem Entwurf musste der Rat einstimmig zustimmen. Einstimmigkeit im Rahmen des Art. 95 KS bedeutete gemäß Art. 28 Abs. 3 KS, dass sich die Stimmen aller Mitgliedstaaten für den Abschluss des betreffenden Abkommens aussprechen mussten.568 War die Zustimmung des Rates und die Anhörung des Beratenden Ausschusses erteilt, durfte die Kommission im Namen der EGKS das völkerrechtliche Abkommen abschließen. 3. EG Die heute maßgebliche Verfahrensnorm des Art. 300 EG liegt seit dem Vertrag von Maastricht in der jetzigen Fassung vor. Vorher wurde auf den damaligen Art. 228 EWG kaum Rückgriff genommen, denn die geschriebenen Außenkompetenzen enthielten spezielle Verfahrensvorschriften, und im Rahmen der ungeschriebenen Außenkompetenzen wurde dasjenige Verfahren angewandt, welches für die jeweilige innergemeinschaftliche Maßnahme einschlägig war. Erst durch die Streichung der meisten Verfahrensregeln in den jeweiligen Spezialvorschriften (z. B. in Art. 113 und 228 EWG) und durch die Konsolidierung des Art. 228 EWG (jetzt Art. 300 EG) durch den Vertrag von Maastricht wurde dieser Artikel zur effektiven Verfahrenvorschrift. Ausnahmen hierzu sind nur noch an wenigen Stellen im Vertrag zu finden.569 567 MacLeod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Communities, S. 107. 568 Vgl. im Gegensatz hierzu Art. 205 Abs. 3 EG und Art. 118 Abs. 3 EA, wonach die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedstaaten dem Zustandekommen von Beschlüssen des Rates, die Einstimmigkeit erfordern, nicht entgegenstehen. 569 Vgl. z. B. Art. 111 Abs. 3, 133 Abs. 3 – 7 EG. Besonders hinzuweisen ist hier auf die untergeordnete Rolle des Europäischen Parlaments in Bezug auf die – praktisch sehr wichti-
150
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Art. 300 EG keine abschließende Regelung des Vertragsschließungsverfahrens enthält. So ist die Beteiligung der jeweiligen Gemeinschaftsorgane nicht abschließend und eindeutig geklärt, außerdem trifft Art. 300 EG keine Regelung bezüglich der Kündigung oder sonstigen Beendigung von Abkommen.570 Art. 300 EG erfasst alle Arten völkerrechtlicher Handlungsformen, ohne dass es auf ihre Bezeichnung ankäme (Vertrag, Abkommen, Protokoll, Briefwechsel, förmliche Vereinbarung).571 Kurz zusammengefasst wird der Kommission das Vorschlagsrecht und die Verhandlungskompetenz zugewiesen, dem Rat steht die Entscheidungskompetenz zu; das Parlament wird im Vergleich zur innergemeinschaftlichen Kompetenzverteilung nur in abgeschwächter Form beteiligt.572
a) Verhandlungskompetenz (Art. 300 Abs. 1 EG) Die Verhandlungskompetenz liegt bei der Kommission. Das Mandat hierzu wird ihr auf ihren Vorschlag hin vom Rat erteilt (Art. 300 Abs. 1 EG). Der Rat beschließt, außer in den Fällen des Art. 300 Abs. 2 UAbs. 1 EG, mit qualifizierter Mehrheit. Die Kommission kann, wenn sie dies für nötig hält, Experten aus den Mitgliedstaaten an den Verhandlungen beteiligen. Bei den Verhandlungen ist die Kommission an die vom Rat vorgegebenen Prämissen gebunden. Außerdem finden regelmäßig Koordinierungstreffen zwischen Rat und Kommission statt, in denen der Rat der Kommission Verhandlungsrichtlinien geben kann. Der Rat kann jedoch nicht der Kommission einen Verhandlungsauftrag erteilen, ohne dass die Kommission zuvor eine Empfehlung hierfür gegeben hätte. Wie im Rahmen der Gemeinschaftsgesetzgebung hat die Kommission damit ein Vorschlagsmonopol.573 Die Kommission darf das Abkommen auch paraphieren und damit ihre Übereinstimmung über den Abschluss der Verhandlungen und die Authentizität des ausgehandelten Vertragstextes zum Ausdruck bringen.574 Dieser völkerrechtlich unverbindliche Akt ist von der Unterzeichnung eines Abkommens gemäß Art. 300 Abs. 2 UAbs. 1 EG zu unterscheiden. gen – internationalen Handelsübereinkünfte. Nach dem Primärrecht (Art. 133 EG) steht dem Parlament nicht einmal ein Anhörungsrecht zu. Aufgrund einer interinstitutionellen Vereinbarung wird das Europäische Parlament in diesen Fällen dennoch angehört, vgl. Anhang II der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission, Anlage XIII zur GOEP, ABl. 2003 L 61, S. 1 (122). 570 Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 300 EGV Rdnr. 2. 571 EuGH, Slg. 1994, I-3666 (Rdnr. 27); Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 300 EGV Rdnr. 11. 572 Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 300 EGV Rdnr. 15. 573 Mögele, in: Streinz: EUV / EGV Kommentar, Art. 300 EGV Rdnr. 40. 574 So jedenfalls die Praxis, vgl. Mögele, in: Streinz: EUV / EGV Kommentar, Art. 300 EGV Rdnr. 43; der Vertrag enthält hierzu jedoch keine ausdrückliche Regelung, Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 300 EGV Rdnr. 18.
§ 4 Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften
151
b) Abschlusskompetenz (Art. 300 Abs. 2, 3 EG) Die Abschlusskompetenz liegt grundsätzlich beim Rat, der auf Vorschlag der Kommission beschließt (Art. 300 Abs. 2 EG). Abweichend hiervon kann der Rat die Kommission ausnahmsweise gemäß Art. 300 Abs. 4 EG dazu ermächtigen, den Abschluss eines Abkommens selbst durchzuführen. In beiden Fällen schließen die jeweiligen Organe das Abkommen im Namen der Gemeinschaft. Der Rat beschließt grundsätzlich mit qualifizierter Mehrheit. Auch wenn der Rat den Vorschlag der Kommission abändern möchte, kann er dies gemäß Art. 300 Abs. 1 EG mit qualifizierter Mehrheit tun, Art. 250 Abs. 1 EG greift hier nicht ein. Von dem Grundsatz der qualifizierten Mehrheit für Ratsbeschlüsse macht Art. 300 Abs. 2 UAbs. 1 EG für zwei Bereiche eine Ausnahme. Der Rat muss einstimmig entscheiden, wenn entweder das Abkommen einen Bereich betrifft, in dem für die Annahme interner Vorschriften Einstimmigkeit vorgesehen ist575, oder wenn es sich um ein Assoziierungsabkommen handelt.576 Das Europäische Parlament ist grundsätzlich vor dem Abschluss eines Abkommens zu hören.577 Eine Anhörung muss dagegen nicht bei den praktisch sehr wichtigen Außenhandelsabkommen durchgeführt werden (Art. 300 Abs. 3 UAbs. 1 i. V. m. Art. 133 EG).578 Einer Zustimmung579 des Parlaments bedarf es hingegen in den Fällen des Art. 300 Abs. 3 UAbs. 2 EG, also bei Assoziierungsabkommen im Sinne des
575 Dies ist beispielsweise im Bereich der Unionsbürgerschaft (Art. 22 EG), der Harmonisierung von indirekten Steuern (Art. 93 EG), bei der Angleichung von Rechtsvorschriften im Sinne des Art. 94 EG, bei Handelsabkommen über Dienstleistungen und Aspekte des geistigen Eigentums (Art. 133 Abs. 5 UAbs. 2 EG), im Kulturbereich (Art. 151 EG) und teilweise im Umweltbereich (Art. 175 Abs. 2 EG) der Fall. 576 Zu beachten ist allerdings, dass gemäß Art. 205 Abs. 2 EG die Stimmenthaltung einzelner Mitglieder der Einstimmigkeit nicht entgegensteht. 577 Nach Mögele, in: Streinz: EUV / EGV Kommentar, Art. 300 EGV Rdnr. 55, sind die inhaltlichen Einwirkungsmöglichkeiten des Parlaments gering, da zum einen dessen Stellungnahmen im Anhörungsverfahren nicht bindend sind und zum anderen dem Europäischen Parlament auch im Zustimmungsverfahren (dazu sogleich) nur die Wahl zwischen (vollständiger) Annahme und (vollständiger) Ablehnung des fertig ausgehandelten Abkommens bleibt. 578 Zur Praxis eines informellen Anhörungsrechts des Parlaments in Bereichen, in denen der Vertrag keine Beteiligung des Parlaments vorsieht (Luns-Westerterp-Verfahren), vgl. MacLeod / Hendry / Hyett, The External Relations of the European Communities, S. 98 ff. In einer Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission vom 29. 06. 2000 heißt es in Anhang II, dass die Kommission das Parlament regelmäßig und umfassend über den Verlauf und den Abschluss internationaler Verhandlungen unterrichtet, wobei dies möglichst so rechtzeitig geschehen soll, dass das Parlament gegebenenfalls seinen Standpunkt zum Ausdruck bringen kann (Die Rahmenvereinbarung ist wiedergegeben als Anlage XIII zur GeschO des EP, ABl. 2003 L 61, 1 (122)). 579 Diese bedarf gemäß Art. 198 EG der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
152
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Art. 310 EG sowie bei Abkommen, die durch Einführung eines besonderen Zusammenarbeitsverfahrens einen besonderen institutionellen Rahmen schaffen (assoziierungsähnliche Abkommen), bei Abkommen mit erheblichen finanziellen Folgen für die Gemeinschaft580 und bei Abkommen, die eine Änderung eines nach dem Mitentscheidungsverfahren erlassenen Rechtsakts (Art. 251 EG) bedingen.581 Trotz dieser Einzelfälle besteht in Bezug auf die Mitwirkungsrechte des Europäischen Parlaments noch keine Parallele zum internen Entscheidungsverfahren. Nach demokratischen Maßstäben ist die Beteiligung des Europäischen Parlaments daher unbefriedigend.582
§ 5 Außenkompetenzen der Europäischen Union I. Außenkompetenzen im Bereich der Gemeinsamen Außenund Sicherheitspolitik (GASP) 1. Historische Entwicklung583 Der Ruf nach einem gemeinsamen außenpolitischen Kurs der EG ist so alt wie die Gemeinschaft selbst;584 eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gehörte von Anfang an zum Integrationsprogramm Europas.585 Allerdings erwies es sich als besonders schwierig, in diesem Bereich voller Traditionen, Symbolik und Emotionen eine gemeinsame Linie zu finden. So scheiterte der 1953 / 1954 unternommene Versuch der Errichtung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft an der Ablehnung durch die Französische Nationalversammlung. Auch das Konzept der Fouchet-Pläne (1961 / 1962), wonach die Außen- und Sicherheitspolitik zwar den nationalen Verantwortungsbereichen belassen, jedoch mit den in die Gemeinschaftskompetenz fallenden Bereichen verbunden werden sollte, war nicht konsensfähig. 580 Die finanzielle Bedeutung eines Abkommens misst der EuGH nicht an dem Gesamthaushalt der EG, sondern am Gesamtbetrag der zur Finanzierung der außenpolitischen Maßnahmen der Gemeinschaft bestimmten Mittel, EuGH, Slg. 1999, I-4741 (Rdnr. 31) – Parlament . / . Rat. 581 Siehe zum Entscheidungsverfahren im Rahmen der Außenbeziehungen der Gemeinschaft Pocar, in: Cannizzaro (Hrsg.), The European Union as an Actor in International Relations, S. 3 ff. 582 Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 300 EGV Rdnr. 20. 583 Vgl. umfassend Burkard, Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und ihre Berührungspunkte mit der Europäischen Gemeinschaft, S. 21 ff.; Semrau, Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, S. 5 ff.; Münch, Die gemeinsame Aktion als Mittel der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, S. 24 ff. 584 Helm-Busch, in: Coen / Hölscheidt / Pieper (Hrsg.), Europa’93 – Auf dem Weg zur Europäischen Union, FS für Bleckmann, S. 141 (143). 585 Bieber / Epiney / Haag / Beutler, Die EU Rechtsordnung und Politik, S. 732 f.
§ 5 Außenkompetenzen der Europäischen Union
153
Im Laufe der Zeit mussten die Mitgliedstaaten erkennen, dass ein gemeinsames Auftreten im internationalen Rahmen auch außerhalb des der EG übertragenen Bereichs der Außenpolitik notwendig ist, um gemeinschaftliche Regelungen sachgerecht verteidigen und um die Interessen der EG und ihrer Mitgliedstaaten auf internationaler Ebene effektiv zur Geltung bringen zu können. Auf der Haager Gipfelkonferenz im Jahre 1970 gelang es dann endlich, der politischen Zusammenarbeit im Bereich der Außenpolitik einen gemeinsamen Rahmen zu geben. Es wurde ein besonderer zwischenstaatlicher Kooperationsmechanismus in Form der „Europäischen Politischen Zusammenarbeit“ (EPZ) geschaffen. Diese Zusammenarbeit beruhte auf dem Davignon-Bericht586 und gestaltete eine rechtlich unverbindliche Gemeinsame Außenpolitik. Vorgesehen waren turnusmäßige Außenministertreffen der Mitgliedstaaten im Sinne einer regelmäßigen Unterrichtung und Konsultation sowie Harmonisierung und Abstimmung von Standpunkten und Haltungen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. 587 1972 wurde die Zahl dieser Treffen auf vier im Jahr erhöht. Eine Beteiligung von EG-Institutionen war nicht vorgesehen.588 Die EPZ wurde durch Titel III der EEA589 von 1987 erstmals vertraglich geregelt, wobei die festgelegten Bestimmungen ausdrücklich nicht zum Bestandteil des Gemeinschaftsrechts gemacht wurden (Art. 3 Abs. 2, 32 EEA). Die Vorschriften verpflichteten die Mitgliedstaaten zur gegenseitigen Konsultation, bevor sie ihre endgültige Haltung in außenpolitischen Fragen festlegten (Art. 30 Abs. 2 EEA). Die Beschlussfassung erfolgte nach dem Konsensverfahren durch den Rat der Außenminister. Sogar die Beachtung des Kohärenzgebots gegenüber dem Gemeinschaftsrecht wurde festgeschrieben (Art. 30 Abs. 5 EEA). Der Kommission und dem Europäischen Parlament wurden Beteiligungs- und Anhörungsrechte eingeräumt (Art. 30 Abs. 3 lit. b, 30 Abs. 4 EEA).590 Für die EPZ wurde ein eigenes Sekretariat in Brüssel (Art. 30 Abs. 10 lit. g EEA) eingerichtet.591 In Art. 1 Abs. 1 EEA wurde erstmals die Schaffung einer „Europäischen Union“ als Ziel herausgestellt. 586 Dieser Bericht eines Ausschusses hoher EG-Beamter erhielt den Namen des Ausschussvorsitzenden und späteren Vizepräsidenten der EG-Kommission Etienne Davignon. 587 Hobe, Europarecht, S. 261; die gemeinsam beschlossene Bekämpfung der südafrikanischen Apartheitspolitik, der israelisch-arabische Oktoberkrieg von 1973 und das Ölembargo der OPEC-Staaten gegen westliche Industrienationen verstärkten die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens, Helm-Busch, in: Coen / Hölscheidt / Pieper (Hrsg.), Europa’93 – Auf dem Weg zur Europäischen Union, FS für Bleckmann, S. 141 (145). 588 Bieber / Epiney / Haag / Beutler, Die EU Rechtsordnung und Politik, S. 730. 589 Die EEA wurde am 28. 02. 1986 verabschiedet und trat am 01. 07. 1987 in Kraft; der Vereinigung der Bestimmungen über die EPZ und den EWGV verdankt die EEA ihren Namen („Einheitliche Europäische Akte“). 590 Art. 30 EEA ist mittlerweile durch Art. 50 Abs. 2 EU aufgehoben worden. 591 Ausführlich zu Struktur und Verfahren der EPZ seit der EEA Helm-Busch, in: Coen / Hölscheidt / Pieper (Hrsg.), Europa’93 – Auf dem Weg zur Europäischen Union, FS für Prof. Bleckmann, S. 141 (146 ff.)
154
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Mit der Annahme des Vertrages über die Europäische Union im Jahre 1992 („Maastrichter Vertrag“) wurde ein neuer Rahmen geschaffen und die EPZ zur „Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ (GASP) ausgebaut, die bis heute einen Pfeiler der Europäischen Union bildet (Art. 2, 11 ff. EU). Sie bezweckt die Erweiterung und Verstärkung der zuvor praktizierten außenpolitischen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. Die gemeinsame Politik soll hiernach, neben den bestehenden Verfahren der Koordinierung und Konsultation, mit Hilfe besonderer Handlungsformen (Art. J 1 EUV, jetzt Art. 11 EU: „Grundsätze und allgemeine Leitlinien“, „Gemeinsame Standpunkte“, „Gemeinsame Aktionen“) durchgeführt werden. Gemäß Art. C – E EUV (jetzt Art. 3 – 5 EU) soll die Gemeinsame Außenund Sicherheitspolitik vom Rat und den Institutionen der EG entwickelt werden, wobei dem Europäischen Rat eine leitende Funktion zukommt. Ein entscheidender Schritt, der durch den Maastrichter Vertrag verwirklicht wurde, war zudem die Erschließung des Bereichs der Verteidigungspolitik für die GASP.592 Der Vertrag von Amsterdam (in Kraft seit 01. 05. 1999) schuf das Amt des „Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ (Art. J 16 EUV, jetzt Art. 26 EU) und legte die Zuständigkeit der Union für das Krisenmanagement deutlicher fest. Insbesondere durch die Schaffung des Amtes des Hohen Vertreters wurde die GASP erheblich gestärkt. Der Vertrag von Amsterdam ermächtigte die Union ferner, mit dritten Staaten und internationalen Organisationen Verträge abzuschließen. Solche Verträge gemäß Art. 24 EU bilden das formal bedeutsamste Instrument der GASP, in der Praxis sind aber auch einseitige Aktivitäten der EU sowie das koordinierte Vorgehen der Mitgliedstaaten in internationalen Organisationen (Art. 19 EU) von Bedeutung.593 Mit Art. J 4 EUV (jetzt Art. 13 und 17 EU) wurden Fragen der Verteidigung endgültig in den Vertrag einbezogen. Durch den mit dem Amsterdamer Vertrag eingeführten Art. 17 Abs. 2 EU wurde klargestellt, dass verteidigungspolitische Fragen auch humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze sowie Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen („Petersberg-Aufgaben“594) umfassen können. Aufgrund des von Art. 3 EU vorgeschriebenen einheitlichen institutionellen Rahmens ist die Verwirklichung der GASP den Institutionen der EG übertragen. Es gelten jedoch Ausnahmen und Besonderheiten vor allem für die Rolle des EuKaufmann-Bühler, in: Grabitz / Hilf, EU-Kommentar, Art. 11 EUV Rdnr. 13. Bieber / Epiney / Haag / Beutler, Die EU Rechtsordnung und Politik, S. 730. 594 Erklärung der WEU vom 19. 06. 1992, abgedruckt in Agence Europe, Dokumente Nr. 1787 vom 23. 06. 1992, S. 1; vgl. dazu auch den Beschluss 1999 / 321 / GASP des Rates vom 10. 05. 1999 über die praktischen Regelungen für die Beteiligung aller Mitgliedstaaten an Aufgaben nach Artikel 17 Abs. 2 EU, für welche die Union die WEU in Anspruch nimmt, ABl. 1999 L 123, S. 14. 592 593
§ 5 Außenkompetenzen der Europäischen Union
155
ropäischen Rates, für die parlamentarische Mitwirkung und die gerichtliche Kontrolle sowie für die Rechtswirkungen der im Rahmen der GASP erlassenen Akte. In der Erklärung Nr. 4 der von der Konferenz der Staats- und Regierungschefs in Amsterdam 1997 angenommenen Erklärungen zu den Art. 24 und 38 EUV wurde festgehalten, dass weder Art. 24 und Art. 38 EUV noch aufgrund dieser beiden Bestimmungen geschlossene Übereinkünfte eine Übertragung von Zuständigkeiten von den Mitgliedstaaten auf die EU bewirken.595 Der Vertrag von Nizza sieht in Art. 27a bis 27e EU die Möglichkeit einer verstärkten Zusammenarbeit einzelner Staaten im GASP-Bereich (jedoch nicht in der verteidigungspolitischen und militärischen Zusammenarbeit) vor. Außerdem ermächtigt Art. 24 Abs. 3 EU die Union dazu, völkerrechtliche Übereinkünfte im Bereich der GASP auch mit qualifizierter Mehrheit herbeizuführen. Nach dem neuen Art. 24 Abs. 6 EU „binden“ die nach Maßgabe des Art. 24 EU geschlossenen Übereinkünfte „die Organe der Union“.596
2. Einordnung in das System der EG / EU, Drei- Säulen- Modell Die GASP ist nach wie vor auf die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und damit grundsätzlich intergouvernemental angelegt. Das intergouvernementale Prinzip spiegelt sich sowohl im Grundsatz der Einstimmigkeit als auch in der begrenzten Rolle der Kommission, des Gerichtshofs und des Europäischen Parlaments wider.597 Damit sind die Strukturen der GASP völkerrechtlicher und nicht gemeinschaftsrechtlicher Natur.598 Da diese außenpolitische Kooperation aber in einem festen institutionellen und verfahrensmäßigen Rahmen, nämlich dem EUVertrag, stattfindet, trägt sie einen besonderen Charakter und kann damit nicht mehr als rein intergouvernemental qualifiziert werden.599 Der Unionsvertrag gibt sowohl für das Verfahren wie auch für die Inhalte der GASP einen Rahmen vor. Die allgemeinen Ziele des Art. 2 EU werden durch Art. 6 EU konkretisiert. Gemäß Art. 3 Abs. 2 S. 1 EU muss die EU auf die Kohärenz aller von ihr ergriffenen außenpolitischen Maßnahmen achten. Mit dem Kohärenzprinzip ist der Union ein Handlungs- und Rechtsgestaltungsprinzip aufgegeben.600 Das Kohärenzgebot zielt Breitenmoser / Husheer, Europarecht I, S. 322. Breitenmoser / Husheer, Europarecht I, S. 325, geben zu bedenken, dass nicht näher ausgeführt wird, was unter „den Organen der Union“ verstanden wird; allerdings ist davon auszugehen, dass hierunter, wie gemäß Art. 7 Abs. 1 EG üblich, das Europäische Parlament, der Rat, die Kommission, der Gerichtshof und der Rechnungshof zu verstehen sind, vgl. Fischer, Der Vertrag von Nizza, S. 93. 597 Aschenbrenner, Menschenrechte in den Außenbeziehungen der Europäischen Union, S. 95. 598 Kaufmann-Bühler, in: Grabitz / Hilf, EU-Kommentar, Vor Art. 11 – 28 EUV Rdnr. 17. 599 Kugelmann, EuR 1998, Beiheft 2, S. 99. 600 Kugelmann, EuR 1998, Beiheft 2, S. 99 (100). 595 596
156
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
auf widerspruchsfreie Einzelakte. Daher müssen sich die jeweils zuständigen Organe in ihren Politiken aufeinander abstimmen. Art. 2 Abs. 2 EU legt fest, dass das Subsidiaritätsprinzip des Art. 5 EG auch auf das Handeln der Union im GASP-Bereich Anwendung findet. Da das grundsätzlich geltende Einstimmigkeitsprinzip in der Regel verhindert, dass Maßnahmen auf Unionsebene ergriffen werden, die einige Mitgliedstaaten lieber durch nationales Vorgehen geregelt hätten, fungiert das Subsidiaritätsprinzip eher als politischer Filter, die GASP auf Bereiche zu konzentrieren, in denen tatsächlich ein Gemeinschaftsinteresse berührt ist und ein gemeinsames Vorgehen erforderlich ist und nicht lediglich nationale Interessen mit Hilfe der Union verfolgt werden.601
3. Reichweite der Außenkompetenzen Die Europäische Union verfügt potenziell über sehr weitgehende Außenkompetenzen. Diese Feststellung mag zunächst überraschen, aber im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik gibt es keine Begrenzungen, was den Geltungsbereich und die Intensität der Gemeinschaftsmaßnahmen anbelangt, die Politik der Union kann sich vielmehr auf „alle Bereiche der Außen- und Sicherheitspolitik“ (Art. 11 Abs. 1 EU) erstrecken.602 Aus der Kompetenzabgrenzung zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten lassen sich keine Hindernisse für gemeinschaftliche Maßnahmen nach dem EU-Vertrag ableiten. Demnach hängt es alleine von dem politischen Willen der Mitgliedstaaten ab, ob und inwieweit die Optionen, die der Unionsvertrag bietet, genutzt werden.603 Die Nichtanwendung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung kann so erklärt werden, dass im Bereich der GASP die Beschränkung der mitgliedstaatlichen Autonomie (zum Beispiel in Form von Mehrheitsentscheidungen) noch nicht weit fortgeschritten ist. Daher mag es den Vertragsparteien nicht so wichtig erschienen sein, die Kompetenz der Union genau zu bestimmen. Bezeichnenderweise wurden nach der Überführung (Vergemeinschaftung) des Bereichs Visa, Asyl und Einwanderung in den EG-Vertrag durch den Vertrag von Amsterdam genaue Kompetenzbestimmungen und spezifische Rechtsgrundlagen eingeführt, die die Kompetenzen der Gemeinschaft begrenzen.604 601 Marquardt, in: von der Groeben / Schwarze, EU / EG Kommentar I, Vorbem. zu den Artikeln 11 bis 28 EUV Rdnr. 13, spricht von einer „sinnvollen Konzentration auf das Wesentliche“. 602 Vgl. Dashwood, ELRev 1998, 201 (210); Krajewski, YEL 2003, 435 (457); so auch die Analyse der derzeit geltenden Rechtslage im Arbeitspapier des Präsidiums des Konvents zu den außenpolitischen Maßnahmen der EU, CONV 161 / 02, S. 6 (Rdnr. 18), ebenso CONV 47 / 02, S. 20. 603 CONV 161 / 02, S. 6 (Rdnr. 18) zur gegenwärtigen Rechtslage. 604 Dashwood, ELRev 1998, 201 (210).
§ 5 Außenkompetenzen der Europäischen Union
157
Grundsätzlich fällt der Bereich der GASP in die geteilte Zuständigkeit.605 Im Fall der Verteidigungspolitik (Petersberg-Aufgaben) sind die Zuständigkeiten der Union ergänzend; sie werden punktuell je nach Lage des Einzelfalls entweder von der Union allein oder von der Union und den Mitgliedstaaten gemeinsam wahrgenommen.606 Allerdings gibt es für die Union in einer anderen Richtung Kompetenzgrenzen, nämlich im Hinblick auf die EG (Art. 47 EU).607 Die nahezu unbegrenzten Außenkompetenzen der Union werden zudem in praktischer Hinsicht durch das in weiten Bereichen der GASP geltende Einstimmigkeitserfordernis begrenzt.
4. Aktionsmöglichkeiten im Rahmen der GASP Im Rahmen der GASP kann nicht auf diejenigen Instrumente zurückgegriffen werden, die im vergemeinschafteten Bereich zur Verfügung stehen. Die möglichen Handlungsformen auf dem Gebiet der GASP zählt Art. 12 EU auf. Die im Rahmen der GASP beschlossenen Akte gehen in ihrem Charakter über parallele, einseitig verpflichtende Willenserklärungen hinaus. Aufgrund der Bestimmungen des Unionsvertrages hinsichtlich Verfahren und Inhalten stellen diese Akte ein Indiz für die Entwicklung hin zur Eigenständigkeit der Union dar. Bis dahin sind die jeweiligen Beschlüsse im Bereich der GASP als Rechtsakte sui generis zu verstehen.608 Die Willensbildung der Union führt dabei vom Allgemeinen zum Konkreten.609
a) Gemeinsame Erklärung, Demarche Das Handlungsinstrument der Gemeinsamen Erklärung ist im Vertrag nicht ausdrücklich vorgesehen. Dennoch ist es das am häufigsten angewandte Instrument und war auch schon im Rahmen der EPZ gebräuchlich.610 Der Beschluss einer 605 Dies gilt ebenso für den Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen (Titel VI EU), lediglich der Teil, der den Aufbau gemeinsamer Einrichtungen wie Europol oder Eurojust betrifft, gehört zur ausschließlichen Zuständigkeit der Union, da diese Befugnis naturgemäß nicht durch die handelnden Mitgliedstaaten wahrgenommen werden kann; vgl. CONV 47 / 02, S. 7 (Rdnr. 9) zur gegenwärtigen Rechtslage. 606 Vgl. CONV 47 / 02, S. 20 zur gegenwärtigen Rechtslage. 607 Näher dazu unten, § 5 IV. 608 Marquardt, in: von der Groeben / Schwarze, EU / EG Kommentar I, Vorbem. zu den Artikeln 11 bis 28 EUV Rdnr. 14, „Völkerrecht auf dem Wege zum Gemeinschaftsrecht“; Cremer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 12 EUV Rdnr. 3; Kugelmann, EuR 1998, Beiheft 2, S. 99 (106). 609 Kugelmann, EuR 1998, Beiheft 2, S. 99 (105). 610 Fink-Hooijer, EJIL 1994, 173 (179); jährlich werden etwa 100 solcher Erklärungen veröffentlicht, vgl. CONV 161 / 02, S. 7 (Rdnr. 22).
158
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
solchen Erklärung erfordert zwar Einstimmigkeit, ist aber im Übrigen für die Mitgliedstaaten unverbindlich. Der Gemeinsamen Erklärung kommt daher regelmäßig nur deklaratorische Wirkung zu. Das Mittel der Demarche verwendet die Union, wenn sie ihre Ansichten den Betroffenen direkt vermitteln möchte. Solche Demarchen sind oft vertraulich, können jedoch in bestimmten Fällen auch veröffentlicht werden.611
b) Bestimmung der Grundsätze und der allgemeinen Leitlinien für die GASP (Art. 12 1. Spiegelstr., Art. 13 Abs. 1 EU) Die Grundsätze und allgemeinen Leitlinien für die GASP stellen den Rahmen für sämtliche Aktivitäten innerhalb der GASP dar. Hierbei sind auch Fragen mit verteidigungspolitischen Bezügen einzubeziehen. Bei der Entscheidung über die Grundsätze und allgemeinen Leitlinien kommt die entscheidende Bedeutung dem Europäischen Rat zu. c) Gemeinsame Strategien (Art. 12 2. Spiegelstr., Art. 13 Abs. 2 EU) Ein durch den Vertrag von Amsterdam neu geschaffenes Instrument ist der Beschluss Gemeinsamer Strategien. Diese werden, wie auch die Grundsätze und allgemeinen Leitlinien, durch den Europäischen Rat gefasst. In Bereichen, in denen wichtige gemeinsame Interessen der Mitgliedstaaten bestehen, sollen jeweils unter Angabe von Zielsetzung, Dauer und der Höhe der von der Union bereitzustellenden Mittel gemeinsame Strategien beschlossen werden. Der Konsens über eine gemeinsame Strategie ermöglicht es dem Rat, nach Art. 23 Abs. 2 EU gemeinsame Aktionen, Standpunkte und andere Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit anzunehmen.612 Dieses mehrstufige Verfahren gibt dem Europäischen Rat ein flexibles Handlungsinstrument an die Hand. Die gemeinsamen Strategien sind operationell gedacht und gehen über bloße Absichtserklärungen hinaus.613
d) Gemeinsame Aktionen (Art. 12 3. Spiegelstr., Art. 14 EU) Gemeinsame Aktionen dienen der Umsetzung von politischen Vorgaben in konkrete Maßnahmen und haben damit operativen Charakter. Mit Hilfe einer gemeinsamen Aktion bestimmt die Union ihre Politik hinsichtlich einer konkreten Situation.614 Der Rat beschließt zunächst, ob eine Angelegenheit Gegenstand einer 611 612 613 614
CONV 161 / 02, S. 7 (Rdnr. 22). Hobe, Europarecht, S. 264. Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 11 – 28 EUV Rdnr. 12. Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 11 – 28 EUV Rdnr. 13.
§ 5 Außenkompetenzen der Europäischen Union
159
Gemeinsamen Aktion wird. Über die Annahme und Durchführung einer Gemeinsamen Aktion entscheidet der Rat (nicht der Europäische Rat) einstimmig. Die Entscheidung ist für die Mitgliedstaaten völkerrechtlich verbindlich mit der Folge, dass die Mitgliedstaaten diejenigen Maßnahmen ergreifen müssen, die zur Durchführung der Gemeinsamen Aktion erforderlich sind.615 Aufgrund von Art. 14 EU wurden bereits zahlreiche Gemeinsame Aktionen beschlossen.616 Nach Art. 14 Abs. 6 EU dürfen die Mitgliedstaaten „bei zwingender Notwendigkeit aufgrund der Entwicklung der Lage und mangels einer Entscheidung des Rates“ selbst die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Diese „Notkompetenz“ macht deutlich, dass die Mitgliedstaaten nur in geringem Umfang den materiellrechtlichen Bindungen einer Gemeinsamen Aktion unterliegen.
e) Gemeinsame Standpunkte (Art. 12 4. Spiegelstrich, Art. 15 EU) Gemeinsame Standpunkte ähneln Gemeinsamen Erklärungen (s. o.). Erforderlich ist wiederum eine einstimmige Entscheidung des Ministerrats, und zwar über eine bestimmte Frage geographischer oder thematischer Art. Gemeinsame Standpunkte sind jedoch auf konzeptioneller, nicht auf operativer Ebene angesiedelt. Hierin liegt auch die Abgrenzung zur gemeinsamen Aktion. Außerdem müssen die Mitgliedstaaten gemäß Art. 19 EU (Koordinierung des Handelns der Mitgliedstaaten in internationalen Organisationen) nur die gemeinsamen Standpunkte, gemäß Art. 20 EU (Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten) dagegen sowohl gemeinsame Standpunkte als auch gemeinsame Aktionen beachten. Nach Art. 15 S. 3 EU haben die Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragen, dass ihre einzelstaatliche Politik mit den Gemeinsamen Standpunkten in Einklang steht. Diese Verpflichtung hat für die Mitgliedstaaten allerdings nur völkerrechtlich bindenden Charakter; eine Überprüfung durch den EuGH ist daher ausgeschlossen.617 Gemeinsame Standpunkte wurden aufgrund von Art. 15 EU schon des Öfteren angenommen.618 615 Hobe, Europarecht, S. 264, vgl. zur Verbindlichkeit der Gemeinsamen Aktion auch Art. 14 Abs. 3 EU. 616 Z. B. Beschluss des Rates vom 10. 05. 1999 betreffend einen Beitrag der EU zur Einsammlung und Vernichtung von Waffen in Albanien (ABl. 1999 L 123, 12) oder die Gemeinsame Aktion des Rates vom 17. 12. 1999 zur Verlängerung der Geltungsdauer und zur Änderung der Gemeinsamen Aktion 96 / 676 / GASP betreffend die Ernennung eines EU-Sonderbeauftragten für den Nahost-Friedensprozess (ABl. 1999 L 326, 71); eine komplette Aufzählung aller bisher geschlossenen Gemeinsamen Aktionen findet sich bei Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 11 – 28 EUV Rdnr. 14. 617 Hobe, Europarecht, S. 265. 618 Gemeinsamer Standpunkt vom 10. 05. 1999 betreffend zusätzliche restriktive Maßnahmen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (ABl. 1999 L 123, 1); Gemeinsamer Standpunkt
160
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
5. Art. 24 EU im Rahmen der GASP a) Überblick zu Art. 24 EU Art. 24 EUV hatte in seiner Fassung nach dem Vertrag von Amsterdam lediglich einen einzigen Absatz. Durch den Vertrag von Nizza wurden die Sätze 1 und 2 zu Absatz 1, Satz 3 wurde zu Absatz 5. Neu eingefügt wurden die Absätze 2 bis 4 und 6. Die angesprochenen Änderungen betreffen eine Klarstellung der Abstimmungsmodalitäten hinsichtlich Einstimmigkeit oder qualifizierter Mehrheit. Wichtig ist vor allem Abs. 6, nach dem alle Übereinkünfte, die nach Art. 24 EU geschlossen werden, die Organe der EU binden. Art. 24 Abs. 1 EU bestimmt, dass der Rat auf Empfehlung des Vorsitzes eine internationale Übereinkunft619 schließen darf, wenn dies zur Durchführung des Titels V über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik erforderlich ist. Die Ziele der GASP werden in Art. 11 EU aufgelistet. Hierunter fallen – die Wahrung der gemeinsamen Werte, der grundlegenden Interessen, der Unabhängigkeit und der Unversehrtheit der Union im Einklang mit den Grundätzen der Charta der Vereinten Nationen; – die Stärkung der Sicherheit der Union in allen ihren Formen; – die Wahrung des Friedens und die Stärkung der internationalen Sicherheit entsprechend den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen sowie den Prinzipien der Schlussakte von Helsinki und den Zielen der Charta von Paris, einschließlich derjenigen, welche Außengrenzen betreffen; – die Förderung der internationalen Zusammenarbeit; – die Entwicklung und Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten.
Nach der Definition des Art. 17 EU umfasst die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik sämtliche Fragen, welche die Sicherheit der Union betreffen, wozu auch die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte, falls der Europäische Rat dies beschließt. Art. 11 Abs. 2 EU enthält die Verpflichtung der Mitgliedstaaten die Außen- und Sicherheitspolitik der Union aktiv und vorbehaltlos im Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität zu unterstützen. Diese in Art. 11 EU festgeschriebenen Solidaritätspflichten kann man entsprechend dem in Art. 10 EG enthaltenen Grundsatz der „Gemeinschaftstreue“ als „Unionstreue“ bezeichnen.620 Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, sich jeder Handlung, die den des Rates vom 15. 11. 1999 über restriktive Maßnahmen gegen die Taliban (ABl. 1999 L 294, 1); weitere Nachweise bei Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 11 – 28 EUV Rdnr. 17. 619 Engl.: „an agreement“, frz.: „un accord“. 620 Hobe, Europarecht, S. 262.
§ 5 Außenkompetenzen der Europäischen Union
161
Interessen der Union zuwiderläuft oder ihrer Wirksamkeit als kohärente Kraft in den internationalen Beziehungen schaden könnte, zu enthalten. Angesichts dieser weiten Definitionen verbunden mit den Verpflichtungen aus Art. 11 Abs. 2 EU ist, wie bereits erwähnt, ein weiter Kompetenzbereich für die EU in ihren Außenbeziehungen eröffnet. Art. 24 EU macht deutlich, dass ein Vorgehen nach dieser Vorschrift stets akzessorisch zu einer intern beschlossenen Politik ist. Art. 24 EU stellt allerdings keine eigenständige Vertragsschließungskompetenz dar, die Kompetenz muss sich vielmehr aus anderen Vorschriften des Vertrags ergeben. Aufgrund des weit gesteckten Bereichs der GASP (Art. 11 EU) ist eine solche Kompetenz auf dem Gebiet der Außen- und Sicherheitspolitik jedoch unproblematisch gegeben. Diese umfassende Kompetenzübertragung auf die Union steht im krassen Gegensatz zu dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, welches im Gemeinschaftsrecht gilt. Jedoch verbleiben alle Gegenstände der Außenpolitik in der Kompetenz der Mitgliedstaaten, bis diese jeweils durch einen – einstimmigen – Ratsbeschluss eine gemeinsame außenpolitische Position festgelegt haben.621
b) Abgrenzung zu anderen Ermächtigungsgrundlagen Art. 24 EU ist für Beitrittsverträge nicht einschlägig, vielmehr ist hierfür Art. 49 EU lex specialis. Für den Abschluss von Assoziierungsverträgen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Drittstaaten ist mit Art. 310 EG ebenfalls eine Sondervorschrift vorhanden. In gemischten Abkommen ist regelmäßig eine Vereinbarung über die Einrichtung eines politischen Dialogs enthalten, die, wenn sie isoliert getroffen werden würde, in Art. 24 EU ihre Rechtsgrundlage hätte, in gemischten Verträgen jedoch im Gesamtabkommen aufgeht.
c) Die Problematik des Vertragsschlusses „durch den Rat“ Der Wortlaut des Art. 24 EU, wonach der Vertragsschluss „durch den Rat“622 geschehen soll, lässt sich rechtlich in zwei verschiedenen Weisen deuten. Entweder gibt der Rat anlässlich des Vertragsschlusses nach außen hin in Stellvertretung für die Mitgliedstaaten ein „Bündel“ einzelstaatlicher Annahmeerklärungen ab, wozu ihn die Mitgliedstaaten vorher durch Beschluss ermächtigt haben, oder die Union als solche schließt durch den handelnden Rat die Übereinkunft. In letzterem Fall wäre die Union Vertragspartei und damit Völkerrechtssubjekt.623 Art. 24 EU würde der Union konkludent Völkerrechtspersönlichkeit verleihen. Kaufmann-Bühler, in: Grabitz / Hilf, EU-Kommentar, Art. 24 EUV Rdnr. 2. Gemeint ist hier der Ministerrat, nicht der Europäische Rat. 623 Cremer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 24 EUV Rdnr. 7; siehe zu diesem Problem bereits die Darstellung oben, § 3 III. 2. b). 621 622
11 Metz
162
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Für letztere Sichtweise könnte der Wortlaut des Art. 24 Abs. 6 EU sprechen, der bestimmt, dass die Organe der Union an die geschlossenen Übereinkünfte gebunden sind. Dies kann so aufgefasst werden, dass Art. 24 Abs. 6 EU die völkervertragsrechtliche Bindung der Union als solche unterstreicht. Als weiteres Argument für diese Auffassung lässt sich die Möglichkeit qualifizierter Mehrheitsbeschlüsse zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge heranziehen.624 Aufgrund dieser Mehrheitsbeschlüsse werden auch die überstimmten Mitgliedstaaten an den Vertrag gebunden. Gegen die Stellung der Mitgliedstaaten als Vertragspartner wird ferner angeführt, dass der „Rat“ gemäß Art. 24 EU als Organ der Union – und nicht als Organ der Mitgliedstaaten – auftreten müsse.625 Aus praktischer Sicht ist zudem zu beachten, dass im Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Bundesrepublik Jugoslawien über die Tätigkeit der Überwachungsmission der Europäischen Union (EUMM) in der Bundesrepublik Jugoslawien626 die EU als eine von zwei Vertragsparteien auftritt. Damit hat die Bundesrepublik Jugoslawien konkludent die Völkerrechtsfähigkeit der Union anerkannt. Schließlich könnte die durch den Vertrag von Nizza vorgenommene Änderung einiger Wörter des Art. 24 EU für diese Auffassung sprechen. So lautete Art. 24 Abs. 1 S. 3 HS 2 EU a. F., dass die anderen Mitglieder des Rates übereinkommen können, „dass die Übereinkunft für sie vorläufig gilt“. Art. 24 Abs. 5 HS 2 EU n. F. regelt nun, dass die Mitgliedstaaten übereinkommen können, „dass die Übereinkunft dennoch vorläufig gilt“. Der Wegfall der Worte „für sie“ könnte darauf hindeuten, dass die Geltung des Vertrages nicht unmittelbar die Mitgliedstaaten erfasst, sondern die Europäische Union selbst.627 Dieses Argument wird beim Blick auf die englische Sprachfassung verstärkt. Auch hier finden sich die genannten Änderungen des Wortlautes wieder, die auf die Verbindlichkeit des Abkommens für die Union hinweisen. So lautet die alte Fassung des Art. 24 Abs. 1 S. 3 HS 2 EU: „the other members of the Council may agree that the agreement shall apply provisionally to them.“ Der Vertrag von Nizza regelt dagegen: „the other members of the Council may agree that the agreement shall nevertheless apply provisionally.“ Diese Ansicht vermag jedoch nicht zu überzeugen.628 Art. 24 Abs. 5 HS 2 EU kann nämlich auch in eine andere Richtung interpretiert werden. Das neu einge624 Marquardt, in: von der Groeben / Schwarze, EU / EG Kommentar I, Art. 24 EUV Rdnr. 4. 625 Marquardt, in: von der Groeben / Schwarze, EU / EG Kommentar I, Art. 24 EUV Rdnr. 4. 626 2001 / 352 / GASP, ABl. L 125, 1 f. (European Union Monitoring Mission, [EUMM]). 627 Cremer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 24 EUV Rdnr. 7. 628 Wie hier auch Kaufmann-Bühler, in: Grabitz / Hilf, EU-Kommentar, Art. 24 EUV Rdnr. 20; Cremer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 24 EU Rdnr. 4 und ohne jede Diskussion der Gegenmeinung Kugelmann, EuR 1998, Beiheft 2, S. 99 (112); zweifelnd dagegen Hilf / Pache, NJW 1998, 705 (709): „. . . ohne ausdrückliche Klarstellung, wer Vertragspartei
§ 5 Außenkompetenzen der Europäischen Union
163
fügte Wort „dennoch“ zeigt an, dass für die Geltung des Abkommens grundsätzlich die Zustimmung und Beteiligung des zunächst außen vor bleibenden Mitgliedstaates erforderlich ist. Eine „vorläufige“ Geltung ist nur im Vorfeld der völkerrechtlichen Verbindlichkeit denkbar. Wäre die Union selbst Vertragspartei, so wäre sie durch den Abschluss des Vertrages gebunden und völkerrechtlich zur Erfüllung des Vertrages verpflichtet. Der Hinweis auf Schwierigkeiten aufgrund internen Rechts wäre ihr völkerrechtlich durch Art. 27, 46 WÜV abgeschnitten. Die Mitgliedstaaten müssten kraft Unionsrecht das ihre zur Erfüllung des Vertrages beitragen. Wenn das Unionsrecht nun einem Mitgliedstaat unter den Voraussetzungen des Art. 24 Abs. 5 HS 1 EU erlaubt auszuscheren, dann trifft die Umsetzungsverpflichtung jedenfalls die anderen Mitgliedstaaten, welche das Abkommen vorbehaltlos zeichnen. Diese sind dann nicht nur „vorläufig“, sondern endgültig unbedingt und unbefristet verpflichtet.629 Das Wort „vorläufig“ macht jedoch dann einen Sinn, wenn die Mitgliedstaaten selbst Vertragsparteien sind. Diejenigen Staaten, die das Abkommen problemlos schließen können, vereinbaren mit dem Drittstaat (dessen Zustimmung vorausgesetzt) die vorläufige Geltung des Abkommens. Der zurückbleibende Mitgliedstaat, der aufgrund seiner Verfassung ein besonderes innerstaatliches Zustimmungsverfahren abhalten muss, kann, wenn dieses Verfahren erfolgreich zu Ende geführt wurde, zu den anderen Mitgliedstaaten stoßen und die endgültige Geltung des Abkommens herbeiführen. So verstanden bedeutet Art. 24 Abs. 5 HS 2 EU einen echten Gewinn an Handlungsfähigkeit und Flexibilität.630 Dass Art. 24 EU nur den Fall des Nicht-Gebundenseins der Mitgliedstaaten regelt, nicht aber (trotz der Parallelen zu Art. 300 Abs. 7 EG) die Bindung der Mitgliedstaaten ausdrücklich festlegt, lässt sich erklären, wenn man von den Mitgliedstaaten als den eigentlichen Parteien der Verträge ausgeht. In diesem Falle ist die mitgliedstaatliche Bindung nämlich eine Selbstverständlichkeit, die keiner Regelung mehr bedarf. Die Bedeutung des Art. 24 Abs. 6 EU liegt demnach darin, dass die vertragliche Bindung auf die Organe der Union (die nicht Vertragspartei sind) erstreckt wird.631 Nach der hier vertretenen Ansicht bewirkt Art. 24 Abs. 6 EU daher eine konstitutive Bindung der Organe der Union an den Vertragsinhalt.632 Im Hinblick darauf, dass die Union nur über ein eigenes Organ, nämlich den Europäischen Rat (Art. 4 EU) verfügt, bleibt die Frage, ob auch die Organe der Geder vom Rat im Rahmen der GASP geschlossenen Verträge sein soll – die Mitgliedstaaten, die EG, die EU?“. 629 Cremer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 24 EUV Rdnr. 9. 630 Cremer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 24 EUV Rdnr. 10. 631 Kaufmann-Bühler, in: Grabitz / Hilf, EU-Kommentar, Art. 24 EUV Rdnr. 20. 632 Regelsberger / Kugelmann, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 24 EUV Rdnr. 18. Diese Bindung ist vor allem auch für die Implementierung des jeweiligen Abkommens nötig, um die Kommission (aufgrund ihrer Zuständigkeit für die Entwicklungspolitik oder die humanitäre Hilfe) und das Europäische Parlament (aufgrund seiner haushaltsrechtlichen Kompetenzen) mit einzubeziehen. 11*
164
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
meinschaft an die völkerrechtlichen Verträge gebunden sind. Gemäß Art. 3 Abs. 1 EU verfügt die Union über einen einheitlichen institutionellen Rahmen. Handeln die Gemeinschaftsorgane auf Unionsebene, sind sie auch an die völkerrechtlichen Verträge gebunden, die in diesem Rahmen abgeschlossen werden. Eine weitergehende Bindung der Gemeinschaftsorgane (Rat, Kommission, Parlament, Gerichtshof, Rechnungshof) kommt dagegen nicht in Betracht (Art. 47 EU). Damit unterliegen die Gemeinschaftsorgane der Bindung nach Art. 24 Abs. 6 EU nur, soweit sie für die Union auftreten, nicht in ihrem Handeln für die Gemeinschaft.633 Mit Art. 24 Abs. 6 EU wird die integrierende Rahmenfunktion des EU-Vertrages vor dem Hintergrund der Gebote der Kohärenz (Art. 3 EU) und der Loyalität (Art. 11 Abs. 2 EU) nochmals betont.634 Schließlich muss der Wille der Vertragsparteien bei der Auslegung einer Vorschrift berücksichtigt werden. So wurde auf der Regierungskonferenz zur Revision des EU-Vertrags der Vorschlag gemacht, die Europäische Union ausdrücklich mit eigener Rechtspersönlichkeit auszustatten. Dies war für einige Mitgliedstaaten jedoch nicht akzeptabel, sodass eine solche Regelung nicht Eingang in den Vertrag finden konnte.635 Damit ist auch ausgeschlossen, dass durch Art. 24 EU gleichsam „durch die Hintertür“ der EU eine Rechtspersönlichkeit verliehen werden sollte. Mit Art. 24 EU wurde damit ein weiterer kleiner Baustein für die Annahme einer Rechtspersönlichkeit gelegt, der jedoch nicht eindeutig genug ist und damit für die tatsächliche Annahme einer Rechtspersönlichkeit nicht ausreicht.636
d) Konkurrenz zwischen Art. 24 EU und den mitgliedstaatlichen Kompetenzen Art. 24 EU verdrängt nicht die Vertragsschlusskompetenz der Mitgliedstaaten; er eröffnet vielmehr eine weitere Form „gemeinsamen“ Handelns.637 Die Mitgliedstaaten können auch außerhalb des Unionsvertrages völkerrechtliche Verträge mit Geltung für sich abschließen und dabei das Instrumentarium des EU-Vertrages nutzen.638 Der Vertragsschluss erfolgt in diesem Falle nicht durch den Rat, sondern durch die im Rat versammelten Mitgliedstaaten. Nach Abs. 4 gilt Art. 24 EU auch für Titel VI des Vertrages, also sind auch völkerrechtliche Übereinkommen im Bereich der Polizeilichen und Justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS, Art. 29 – 42 EU) möglich. Regelsberger / Kugelmann, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 24 EUV Rdnr, 19. Regelsberger / Kugelmann, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 24 EUV Rdnr, 18. 635 Marquardt, in: von der Groeben / Schwarze, EU / EG Kommentar I, Art. 24 EUV Rdnr. 2. 636 Regelsberger / Kugelmann, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 24 EUV Rdnr. 20. 637 Cremer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 24 EUV Rdnr. 2. 638 Kugelmann, EuR 1998, Beiheft 2, S. 99 (112 f.). 633 634
§ 5 Außenkompetenzen der Europäischen Union
165
Das erste Abkommen gemäß Art. 24 EU schloss die EU im Jahre 2001 mit der Bundesrepublik Jugoslawien639 betreffend die EU-Überwachungsmission in Jugoslawien. Ein weiterer Anwendungsfall von Abkommen nach Art. 24 EU sind Verträge zwischen der EU und der NATO, die die Zusammenarbeit beider Organisationen, etwa im Bezug auf den Austausch von Dokumenten oder auf Sicherheitsregeln, zum Gegenstand haben.640
e) Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Art. 24 EU und Art. 300 EG Die Struktur beider Artikel ist sehr ähnlich. Zunächst werden jeweils die Voraussetzungen für den Abschluss völkerrechtlicher Verträge geregelt, dann folgen die Ermächtigung zu Vertragsverhandlungen und schließlich Regelungen bezüglich des Einstimmigkeitserfordernisses beziehungsweise der Möglichkeit zu Mehrheitsentscheidungen. Allerdings bestehen im Rahmen der institutionellen Beteiligung erhebliche Unterschiede. So führt im Bereich der GASP der Rat, vertreten durch den Vorsitz, die Verhandlungen; im Gemeinschaftsbereich führt die Kommission, vom Rat ermächtigt, die Verhandlungen. In der Gemeinschaft sind Mehrheitsentscheidungen die Regel, in der GASP die Ausnahme. Das Europäische Parlament wird in Art. 24 EU nicht erwähnt, daher gilt die allgemeine Regelung des Art. 21 EU, wonach lediglich eine Anhörung und eine regelmäßige Unterrichtung stattzufinden hat. Art. 300 EG sieht hingegen die Anhörung, Unterrichtung und in wichtigen Fällen die Zustimmung des Europäischen Parlaments vor. Die Möglichkeit eines einseitigen opting out besteht nur im GASP-Bereich, nicht hingegen im Gemeinschaftsrecht. 6. Bisherige Aktionen im Bereich der GASP641 Die erste Gemeinsame Strategie nach Art. 13 Abs. 2 EU beschloss der Europäische Rat im Juni 1999 gegenüber Russland.642 Als Ziele wurden definiert: Festigung der Demokratie, des Rechtsstaats und der staatlichen Institutionen, Einbeziehung Russlands in den gemeinsamen europäischen Wirtschafts- und Sozialraum, Zusammenarbeit zur Stärkung der Stabilität und Sicherheit in Europa und darüber hinaus, Zusammenarbeit in den Bereichen Energiepolitik, nukleare Si2001 / 352 / GASP, ABl. L 125, 1 f. (European Union Monitoring Mission, [EUMM]). Marquardt, in: von der Groeben / Schwarze, EU / EG Kommentar I, Art. 24 EUV Rdnr. 6. 641 Siehe zum ganzen Bieber / Epiney / Haag / Beutler, Die EU Rechtsordnung und Politik, S. 734 ff. 642 1999 / 414 / GASP, ABl. L 157, 1. 639 640
166
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
cherheit, Umweltschutz und Bekämpfung der Kriminalität. Weitere Gemeinsame Strategien folgten im Jahr 1999 zur Ukraine643 und im Jahr 2000 zur Mittelmeerregion644. Gemeinsame Standpunke zur Orientierung des Handelns der Mitgliedstaaten gemäß Art. 15 EU verabschiedete der Rat unter anderem zu Waffenexporten in das ehemalige Jugoslawien645, zur Konfliktverhütung und Konfliktlösung in Afrika646, zur Nichtverbreitung von Kernwaffen und zur Vertrauensbildung in Südasien647, zu Afghanistan648 und zu einem Stabilitätspakt für Südosteuropa649. Gemeinsame Standpunkte sind die gebräuchlichsten Handlungsformen im Rahmen der GASP. Gemeinsame Aktionen nach Art. 14 EU betrafen z. B. ein Hilfsprogramm zur Unterstützung der palästinensischen Autonomiebehörde650, die Entsendung von Wahlbeobachtern nach Nigeria651 und ein Programm zur Abschaffung von Antipersonenminen652. Zu zahlreichen außenpolitischen Fragen hat die Präsidentschaft des Rates auf der Grundlage von Art. 18 EU Erklärungen abgegeben.653 Über die gerade genannten Aktionen hinaus müssen sich die Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß Art. 19 EU in internationalen Organisationen ständig koordinieren. Außerdem sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, sich für die in den gemeinsamen Standpunkten festgelegten Ziele der Union einsetzen.
7. Schwächen und Reformperspektiven der derzeit gültigen GASP-Bestimmungen Die Mischung von zwischenstaatlichen und gemeinschaftlichen Ansätzen im Rahmen der GASP hat Befürworter wie auch Gegner einer verstärkten GASP gleichermaßen enttäuscht.654 Die Skeptiker nehmen die GASP als „Eindringling“ in die gewachsenen zwischenstaatlichen Beziehungen wahr, die Befürworter sehen 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654
1999 / 877 / GASP, ABl. L 331, 1. 2000 / 458 / GASP, ABl. L 183, 5. 1996 / 184 / GASP, ABl. L 58, 1. 2001 / 374 / GASP, ABl. L 132, 3. 1998 / 606 / GASP, ABl. L 290, 1. 2001 / 56 / GASP, ABl. L 21, 1. 1999 / 345 / GASP, ABl. L 133, 1. 1997 / 289 / GASP, ABl. L 120, 2. 1998 / 735 / GASP, ABl. L 354, 1. 1997 / 817 / GASP, ABl. L 338, 1. Dokumentiert sind diese in den jährlichen Gesamtberichten der EU. Breitenmoser / Husheer, Europarecht I, S. 326.
§ 5 Außenkompetenzen der Europäischen Union
167
die geltende Regelung im Hinblick auf die Integration als unzureichend und ineffektiv. Ineffektivität wird der GASP vor allem wegen des in weiten Bereichen geltenden Einstimmigkeitsprinzips vorgeworfen.
II. Außenkompetenzen im Bereich der Polizeilichen und Justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS) Aufgrund der Rezeptionsklausel des Art. 24 Abs. 4 EU gilt die Vorschrift des Art. 24 EU auch für die PJZS. Nach Art. 38 EU kann die Union im Rahmen der PJZS Übereinkommen mit Drittstaaten oder internationalen Organisationen abschließen, um Angelegenheiten der PJZS zu regeln. Unschädlich ist, wenn sich solche Verträge zugleich auch auf Materien der GASP beziehen.655 Dagegen dürfen Verträge nach Art. 24 Abs. 4 i. V. m. Art. 38 EU nicht Materien der ersten Säule, nämlich solche des EG-Vertrages, erfassen.
III. Exkurs: Die Westeuropäische Union (WEU) Die Westeuropäische Union wurde durch den „Brüsseler Vertrag über die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Zusammenarbeit und über kollektive Sicherheit“ vom 17. 03. 1948 gegründet. Anlässlich der Beitritte der Bundesrepublik Deutschland und Italiens wurde der Anwendungsbereich des Vertrags durch das Pariser Protokoll vom 23. 10. 1954 erweitert. Ziel des Vertrages war die Errichtung eines Systems der westeuropäischen kollektiven Sicherheit und eine automatische Beistandspflicht. Durch die Erklärung vom Petersberg (19. 06. 1992) verpflichtete sich die WEU zur Durchführung von humanitären sowie friedensschaffenden und friedenserhaltenden Missionen. Mit der Einführung des Art. 17 EU durch den Vertrag von Amsterdam (im Jahre 1999), welcher die fortschreitende Eingliederung der WEU in die GASP vorsah, und durch die Erklärung von Marseille vom 13. 11. 2000 wurde eine nahezu vollständige Überführung der operativen Strukturen der WEU in die EU besiegelt. Im Rahmen der Verteidigungspolitik steht die Europäische Union allgemein vor dem Problem, dass die Union, die WEU und die NATO jeweils unterschiedliche Mitglieder und Aufgaben haben. Die Schwierigkeit besteht darin, einverständlich zu regeln, wie die Union einerseits mit eigenen verteidigungspolitischen Kompetenzen ausgestattet und wie andererseits die bestehenden Bündnisverpflichtungen einzelner Mitgliedstaaten bzw. die Neutralität anderer Mitgliedstaaten geachtet werden können.656 655 Dannecker, in: Streinz EUV / EGV Kommentar, Art. 38 EUV Rdnr. 1, weist darauf hin, dass solche Abkommen bereits im Rahmen der Terrorismusbekämpfung abgeschlossen worden sind.
168
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
IV. Kompetenzkonflikte im Bereich der Außenpolitik zwischen EG und EU (cross pillar mixity) Von cross pillar mixity-Abkommen spricht man, wenn in einem Abkommen sowohl Materien der Gemeinschaftsverträge als auch Materien der intergouvernementalen Zusammenarbeit behandelt werden.657 Wer in diesem Fall die Verhandlungen führt und welches Verfahren einzuhalten ist, richtet sich jeweils nach der einschlägigen Rechtsgrundlage. Allgemein prüft der EuGH in Verfahren, bei denen es um die Bestimmung der richtigen Rechtsgrundlage geht, ob eine Regelung für einen bestimmten Aktionsbereich getroffen werden soll, die lediglich Auswirkungen auf einen anderen Bereich hat, oder ob die Regelung für beide betroffenen Bereiche gleich wesentlich ist.658 Im ersten Fall reicht die Bezugnahme und Anwendung der Rechtsgrundlage aus, die den Schwerpunkt des Vertrags bildet, im zweiten Fall hingegen fordert der EuGH die Anwendung beider Vorschriften und damit die Verbindung von beiden einschlägigen Verfahren, soweit dies möglich ist. Eine Übertragung dieser Rechtsprechung auf cross pillar mixity-Abkommen bereitet Probleme, da die Verfahren des Art. 24 EU einerseits und des Art. 300 EG andererseits aufgrund der unterschiedlichen institutionellen Ausgestaltung kaum parallel durchführbar sind. Nahtstellen zwischen den GASP-Bestimmungen und solchen des EG-Vertrages ergeben sich ausdrücklich im Bereich der Finanzierung der GASP sowie im Bereich der Wirtschaftssanktionen.659 Diese „Berührungen“ der GASP-Bereiche mit dem Gemeinschaftsrecht stehen allgemein unter dem Vorzeichen des Kohärenzgebotes (Art. 3 EU).660 Art. 3 EU schreibt gleichzeitig die Wahrung und Weiterentwicklung des gemeinschaftlichen Besitzstandes fest. Dieses Spannungsverhältnis wird durch den einheitlichen institutionellen Rahmen nicht gemildert, sondern angesichts der sehr großen Rolle des Rates im GASP-Bereich eher noch verschärft.661 1. Finanzbereich Da der Finanzbereich nicht zu den Außenkompetenzen gehört, soll er hier nur kurz dargestellt werden. Gemäß Art. 28 Abs. 2, Abs. 3 EU gehen Verwaltungsausgaben und operative Ausgaben der GASP grundsätzlich zu Lasten des Haushaltes Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 11 – 28 EUV Rdnr. 33. Kaufmann-Bühler, in: Grabitz / Hilf, EU-Kommentar, Art. 24 EUV Rdnr. 6. 658 EuGH, Slg. 1999, I-1139 (1162) – Europäisches Parlament . / . Rat. 659 Allgemein zu Überlappungen zwischen EG- und EU-Kompetenzen im Außenbereich siehe Baratta, in: Cannizzaro (Hrsg.), The European Union as an Actor in International Relations, S. 51 ff. 660 Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 11 – 28 EUV Rdnr. 77. 661 Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 11 – 28 EUV Rdnr. 77. 656 657
§ 5 Außenkompetenzen der Europäischen Union
169
der Europäischen Gemeinschaften. Das Europäische Parlament und der Rat verständigen sich jedes Jahr über die Höhe der operativen Ausgaben. Anschließend kann die Kommission selbstständig Mittel umschichten, ohne dass das Parlament zustimmen muss. Der Betrag für Sofortmaßnahmen darf hierbei allerdings nicht 20% des Gesamtbudgets überschreiten. Diese Regelung wurde unter der Prämisse getroffen, dass eine effiziente GASP nur funktionieren kann, wenn die Bereitstellung der Mittel schnell und unkompliziert erfolgen kann.662
2. Wirtschaftssanktionen, insbesondere Handelsembargos Wirtschaftssanktionen gehören gemäß Art. 301 EG zum Kompetenzbereich der Gemeinschaft.663 Hiernach muss ein Tätigwerden der Gemeinschaft in einem gemeinsamen Standpunkt oder in einer gemeinsamen Aktion nach den GASPBestimmungen vorgesehen sein. Die Gemeinschaft kann dann diese Maßnahme – meist in Form einer Verordnung – in die Tat umsetzen. Fraglich ist jedoch, ob aus Art. 301 EG die unmittelbare Verpflichtung für die Kommission folgt, aufgrund der GASP-Maßnahme von ihrem Initiativrecht Gebrauch zu machen.664 Gegen eine Vorschlagspflicht der Kommission spricht ihre aus Art. 213 EG resultierende institutionelle Unabhängigkeit sowie ihr Initiativmonopol. Eine Handlungspflicht der Kommission ist jedoch aus folgenden Gründen zu bejahen: Zum einen folgt eine solche bereits aus dem Wortlaut. Während Art. 60 EG für den Bereich der Kapital- und Zahlungsverkehrssanktionen ausdrücklich den Organen eine Ermessen einräumt („kann“), spricht die Formulierung in Art. 301 EG („trifft der Rat . . . auf Vorschlag der Kommission“) für eine Handlungspflicht der Organe.665 Dies entspricht auch der Zielsetzung des Art. 301 EG, wonach den Mitgliedstaaten die außenpolitische Lagebeurteilung im Rahmen der GASP zugestanden wird, während die Gemeinschaft die handelspolitischen Instrumentarien zur Durchführung dieser Beschlüsse zur Verfügung stellt.666 Zudem muss das Kohärenzgebot (Art. 3 Abs. 2 EU) beachtet werden.667 Beschließt die EU in Form eines GASP-Beschlusses Wirtschaftssanktionen gegen einen bestimmten Staat, wäre es mit dem Kohärenzgebot unvereinbar, wenn die EG ihre handelspolitischen Beziehungen nicht entsprechend gestalten würde. Schließlich wird angeführt, dass die 662 Kugelmann, EuR 1998, Beiheft 2, S. 99 (110); Baratta, in: Cannizzaro (Hrsg.), The European Union as an Actor in International Relations, S. 51 (56 f.). 663 Vgl. oben, § 4 V. 2. 664 Dies bejahend Stein, EuR 1995, Beiheft 2, S. 69 (74); Cremer, in: Calliess / Ruffert, EG-Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 9; Pitschas, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, S. 198; a.A. Pechstein, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 47 EUV Rdnr. 3. 665 Osteneck, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 10. 666 Osteneck, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 10. 667 Cremer, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 10.
170
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Gemeinschaft aufgrund der Art. 14 Abs. 3 und Art. 15 S. 3 EU zumindest völkerrechtlich verpflichtet ist, die in der GASP beschlossenen Maßnahmen gemeinschaftsrechtlich umzusetzen.668 Diese Vorschlagspflicht soll jedoch dann entfallen, wenn die Kommission geltend machen kann, dass der GASP-Beschluss Europaoder Völkerrecht verletzt.669 In der Praxis ist dieses Problem jedoch nicht sehr relevant, da es sogar häufig vorkommt, dass ein Kommissionsvorschlag zeitlich vor der Verabschiedung des GASP-Beschlusses liegt.670 Problematisch wird das Ineinandergreifen von EG-Vertrag und EU-Vertrag, wenn die gemeinsame Aktion oder der gemeinsame Standpunkt auf GASP-Ebene nicht von allen Mitgliedstaaten getragen wird, also im Fall des opting out oder der Blockade nach Art. 23 EU. Muss z. B. nach Art. 23 Abs. 1 EU eine gemeinsame Aktion oder ein gemeinsamer Standpunkt einstimmig beschlossen werden, so bietet sich die Möglichkeit der konstruktiven Enthaltung (eine Stimmenthaltung steht dem Zustandekommen eines Beschlusses nicht entgegen, vgl. Art. 23 EU). Ergreift ein Mitgliedstaat diese Möglichkeit, so ist die Maßnahme auf Unionsebene wirksam erlassen und kann als Grundlage für Gemeinschaftsmaßnahmen nach Art. 301 EG dienen. Im Rahmen dieses gemeinschaftsrechtlichen Verfahrens kann der jeweilige Mitgliedstaat durch Mehrheitsbeschluss überstimmt werden, sodass er letztlich gemeinschaftsrechtlich verpflichtet ist (ihm steht auf Gemeinschaftsebene nicht die Möglichkeit des opting out zu), die Verordnung zu vollziehen.671 Die konstruktive Enthaltung im Rahmen der GASP hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit (oder den Abstimmungsmodus) von Gemeinschaftsrechtsakten. Das Problem wird jedoch dadurch abgemildert, dass die gemeinschaftsrechtliche Bindungswirkung im Vorfeld für jeden Mitgliedstaat absehbar ist und sich die Mitgliedstaaten auf GASP-Ebene entsprechend verhalten können, falls sie später nicht in eine Aktion eingebunden werden wollen. Zudem beruhten bisher die von der Union verhängten Sanktionen auf der Umsetzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. Da aber alle Mitgliedstaaten der Union auch solche der Vereinten Nationen sind und aufgrund der Charta der Vereinten Nationen zur Umsetzung von UN-Sanktionen verpflichtet sind, wird sich kein Mitgliedstaat finden, der eine gemeinsame Aktion in dieser Richtung verhindert oder nicht mit trägt.672 Kugelmann, EuR 1998, Beiheft 2, S. 99 (115), Stein, EuR 1995, Beiheft 2, S. 69 (75). Osteneck, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 10. 670 Trotz ihrer Vorschlagspflicht ist die Kommission nicht bloßes Werkzeug der GASP, sondern verkörpert das Gemeinschaftsinteresse der EG, Cremer, in: Calliess / Ruffert, EGKommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 10; Osteneck, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 11. 671 Vgl. zu diesem Fall Kugelmann, EuR 1998, Beiheft 2, S. 99 (115). 672 Zur Frage, ob eine innergemeinschaftliche Verpflichtung der Europäischen Gemeinschaft zur Umsetzung von UN-Wirtschaftssanktionen besteht, vgl. Osteneck, Die Umsetzung von Wirtschaftssanktionen durch die Europäische Gemeinschaft, S. 349 ff. Osteneck bejaht eine solche Verpflichtung letztlich aufgrund der Art. 307 EG und Art. 10 EG; ebenso Schneider, Wirtschaftssanktionen, S. 238. 668 669
§ 5 Außenkompetenzen der Europäischen Union
171
Im Anwendungsbereich des Art. 301 EG dürfen sich die Mitgliedstaaten nicht ausschließlich auf Art. 14 und 15 EU stützen, ohne auf die gemeinschaftsrechtliche Umsetzung zurückzugreifen. Eine direkte Verhängung von Wirtschaftssanktionen auf GASP-Ebene würde zu einer Vermischung der supranationalen mit der intergouvernementalen Ebene führen und die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft im Bereich der Außenhandelspolitik missachten.673 Eine solche Kompetenzübertragung ist aufgrund von Art. 47 EU unzulässig. Damit gilt das Verfahren der Art. 14, 15 EU nicht für die Verhängung von Wirtschaftssanktionen, hier ist vielmehr eine Ergänzung bzw. Durchführung durch einen Gemeinschaftsrechtsakt erforderlich. Aufgrund des geringeren Integrationsgrades der GASP wurde teilweise eine „ReIntergouvernementalisierung“ bereits vergemeinschafteter Politikbereiche durch eine „Flucht“ in die intergouvernementale Zusammenarbeit befürchtet.674 Es besteht nämlich ein Spannungsverhältnis zwischen der Kohärenzpflicht aus Art. 3 EU und der Absicherung des acquis communautaire gemäß Art. 3 Abs. 1 EU. Diese Befürchtungen sind bisher jedoch nicht wahr geworden. Eine solche Unterordnung des EG-Rechts entspräche auch nicht dem Geist und dem Wortlaut des Unionsvertrages. Dieser macht nämlich die Fortentwicklung des Integrationsprozesses innerhalb der Gemeinschaft zur Grundlage der Europäischen Union und räumt der Gemeinschaft eine vorrangige Bestands- und Entwicklungsgarantie gegenüber der intergouvernementalen Zusammenarbeit im Rahmen des EU-Vertrags ein. Dies zeigt sich in Art. 1 Abs. 3 EU, wonach Grundlage der Union die Europäischen Gemeinschaften sind, welche durch die mit dem EU-Vertrag eingeführten Politiken und Formen der Zusammenarbeit ergänzt werden. Überdies ist gemäß Art. 2 EU eines der Ziele der Union „die volle Wahrung des gemeinschaftlichen Besitzstandes“. Art. 47 EU regelt, dass der EU-Vertrag den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften unberührt lässt. Zur Verhinderung einer Aufweichung des bisher erreichten Integrationsstandes bestimmt Art. 47 EU, dass keine Höherrangigkeit des EU-Vertrages gegenüber den EG-Verträgen besteht (Unberührtheitsklausel).675 Art. 47 EU gewährt damit den Bestandsschutz für die den Gemeinschaften in den Gemeinschaftsverträgen eingeräumten Kompetenzen und verhindert eine etwaige Verdrängung des Gemeinschaftsrechts durch den allgemeinen Grundsatz lex posterior derogat legi priori.676 Einen Schutz der Gemeinschaftskompetenzen bewirkt auch die Möglichkeit der juristischen Kontrolle durch den Europäischen Gerichtshof. Laut Art. 220 EG und Osteneck, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 301 EGV Rdnr. 19. Stein, EuR 1995, Beiheft 2, S. 69 (81); Herrnfeld, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 47 EUV Rdnr. 9; Müller-Graff, CMLR 1994, 493 (500). 675 Pechstein, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 47 EUV Rdnr. 2; hierbei darf man sich nicht von der – eine Hierarchie suggerierenden – Drei-Säulen-Struktur mit der EU als Dach täuschen lassen. 676 Herrnfeld, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 47 EUV Rdnr.1, 9. 673 674
172
2. Teil: Außenbeziehungen der EU nach dem Vertrag von Nizza
Art. 136 EA (und früher Art. 31 KS) sichert der EuGH die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge. Gemäß Art. 47 EU berührt der Unionsvertrag diese Bestimmungen nicht. Der Gerichtshof hat entschieden, dass Maßnahmen, die im Bereich der dritten Säule erlassen wurden und eigentlich auf Vorschriften des EG-Vertrages hätten gestützt werden müssen, vom Gerichtshof für nichtig erklärt werden können.677 Eine solche Kontrollkompetenz hinsichtlich der Einschlägigkeit der richtigen Rechtsgrundlage wird dem Gerichtshof durch Art. 46 lit. e in Verbindung mit Art. 47 EU eingeräumt.678 Damit kann Übergriffen aus dem Bereich der zweiten und dritten Säule auf das Gemeinschaftsrecht Einhalt geboten werden. Festzuhalten bleibt somit, dass der eventuelle Versuch seitens der Regierungen, durch die Politiken und Formen der Zusammenarbeit im Rahmen der GASP gemeinschaftsrechtliche Entscheidungsprozesse von außen zu steuern und damit die Machtstruktur innerhalb des gemeinschaftlichen institutionellen Gefüges zu verändern, mit dem EU-Vertrag selbst unvereinbar ist.679
EuGH, Slg. 1998, I-2763 (Rdnr. 14 – 18) – Flughafentransit. Baratta, in: Cannizzaro (Hrsg.), The European Union as an Actor in International Relations, S. 51 (58); Herrnfeld, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 47 EUV Rdnr. 9 und Art. 46 EUV Rdnr. 18 f.; eine Prüfungskompetenz, ob eine Norm mit dem Unionsrecht vereinbar ist, wird dem EuGH jedoch weiterhin nicht eingeräumt. Ebenso besteht für den EuGH keine Zuständigkeit zur Überprüfung von Beschlüssen „der im Rat vereinigten Vertreter der Mitgliedstaaten“ (bloßes kollektives Zusammenwirken der Mitgliedstaaten außerhalb des Vertragswerkes der Union), vgl. EuGH, Slg. 1993, I-3685 (Rdnr. 12) – Bangladesh I. 679 Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 11 – 28 EUV Rdnr. 79. 677 678
Dritter Teil
Exkurs: Die Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf die Außenbeziehungen der Europäischen Union § 6 Die Außenkompetenzen der Europäischen Union nach der Osterweiterung Am 1. Mai 2004 sind der Europäischen Union zehn neue Länder beigetreten.1 Damit wuchs die Union in Bezug auf ihre Mitgliederzahl um zwei Drittel, von 15 auf 25 Mitgliedstaaten. Mit der Erweiterung stieg die Bevölkerungszahl der Union um 76 Millionen von 383 Millionen auf 459 Millionen Menschen an, die geografische Erweiterung umfasst etwa ein Drittel der bisherigen EU-Fläche. Allein aufgrund der Erweiterung wuchs damit das politische Gewicht der Europäischen Union in der Welt.2 Der Vertrag von Nizza sollte die Union bereit für die Osterweiterung machen.3 In Bezug auf viele Gegenstände wurde dieses Ziel nicht verwirklicht.4 Auch im Hinblick auf die Außenbeziehungen wurden keine besonderen Vorschriften in den Vertrag von Nizza aufgenommen. Der Beitrittsvertrag selbst, der Vertrag von Athen5, enthält keine institutionellen oder kompetenziellen Neuerungen, sondern 1 Es handelt sich um Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta und Zypern. Der Beitrittsvertrag ist zwar äußerlich ein einheitliches Dokument, rechtliche Grundlage sind jedoch zehn selbständige, voneinander unabhängige Beitritte, letztlich also eine Kumulation von zehn bilateralen Beitrittsverträgen, vgl. Niedobitek, JZ 2004, 360 (360). 2 Die Union umfasst nun 13 Prozent statt bisher knapp 8 Prozent der 191 UN-Mitgliedstaaten, vgl. Dauderstädt, Integration 2004, 28 (28). 3 Vgl. nur Verheugen, in: Heusel (Hrsg.), Die Osterweiterung der Europäischen Union, S. 7 (7); Wouters, in: Kellermann / Zwaan / Czuczai (Hrsg.), EU Enlargement – The Constitutional Impact at EU and National Level, S. 37 (38 f.). 4 Zu den sogenannten „left-overs“ gehört vor allem die Beibehaltung des Einstimmigkeitsprinzips in zentralen Punkten, Bergmann, ZEuS 2003, 103 (130 f.); vgl. auch Wouters, in: Kellermann / Zwaan / Czuczai (Hrsg.), EU Enlargement – The Constitutional Impact at EU and National Level, 37 (39 ff.), der auf die mangelhafte Legitimität der Europäischen Union hinweist; Edwards, in: Hillion, EU Enlargement: A Legal Approach, S. 23 (35 ff.). 5 http: //www.europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/treaty_of_accession2003/table_ of_content_en.htm; ABl. 2003 L 236, 17. Der Beitrittsvertrag an sich enthílt nur 3 Artikel, entscheidender ist die dem Vertrag beigef gte Akte, in der die Aufnahmebedingungen festgehalten sind.
174
3. Teil: Die Auswirkungen der EU-Osterweiterung
bestätigt im Wesentlichen die Übereinkünfte, die die Mitgliedstaaten in Nizza getroffen haben.6 Die nach dem Vertrag von Nizza ausstehenden Probleme wurden demnach nicht gelöst. Aus rechtlicher Sicht hat sich an dem Kompetenzgefüge innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, beziehungsweise der Europäischen Union, nichts geändert. Wesentliche Bedeutung kommt allerdings den innerinstitutionellen Veränderungen zu.7 Um die Arbeitsfähigkeit nach der Aufnahme von 10 neuen Mitgliedstaaten zu erhalten, wurden die Strukturen im Rat deutlich verändert, neue Mehrheitsbestimmungen sind eingeführt worden. Diese Neuerungen sind auch für den Abschluss völkerrechtlicher Verträge von Bedeutung.
I. Einbringung neuer oder teilweise anders gewichteter Interessen in die Europäische Union Die mittel- und osteuropäischen Beitrittsländer8 sind – bis auf Polen und Ungarn – staatsrechtlich neu gegründete Staaten, die ihre Unabhängigkeit erst Anfang der Neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts durch den Zerfall der Sowjetunion, Jugoslawiens oder der Tschechoslowakei erlangt haben. Aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte sind sie daher oft weniger bereit, ihre gerade erst erworbene Souveränität wieder an einen anderen Hoheitsträger – etwa die Europäische Union – abzugeben, als es die „alten“ Mitgliedstaaten sind. Hier wirken noch die leidvollen Erfahrungen aus den Weltkriegen und dem Kalten Krieg nach. Aufgrund ihrer historischen Erfahrungen nehmen die neuen Beitrittsländer häufig eine kompromisslosere Haltung gegenüber autoritären Regimen ein. Die postkommunistischen Länder Mitteleuropas sehen ihre Befreiung mehr als Ergebnis amerikanischen Drucks denn als Folge westeuropäischer Entspannungspolitik.9 Daher unterstützen diese Länder in Bezug auf den Umgang mit autoritären Regimen eher eine Konfrontationsstrategie als einen vorsichtigen Annäherungs- oder Vermittlungskurs, welchen die alten EU-Mitglieder oft vorziehen.10 Gerade im Verhältnis zu den USA besteht wenig Einigkeit zwischen den neuen und alten EU-Mitgliedern. Einige osteuropäische Länder halten die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten für eine unerlässliche Sicherheitsstrategie gegenüber der früheren Hegemonialmacht Russland, während zum Beispiel Frankreich und Deutschland um einen Ausgleich mit Moskau bemüht sind.11 Hillion, ELRev 2004, 583 (588). Hierzu Scheffer, Eine aktuelle Bestandsaufnahme der EU Osterweiterung, S. 157 ff. 8 Diese Länder werden oft mit der Bezeichnung „MOEL“ abgekürzt. 9 Dauderstädt, Integration 2004, 28 (33). 10 Siehe zum Beispiel den Artikel „Castro siegt im Cocktail-Krieg“ in der Süddeutschen Zeitung vom 01. 02. 2005, S. 1. 11 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 27. 04. 2004, S. 5, „Weltpolitik mit 25 Meinungen“. 6 7
§ 6 Die Außenkompetenzen der EU nach der Osterweiterung
175
Auch im Bereich der Entwicklungshilfepolitik ergeben sich Verschiebungen beziehungsweise Interessenabweichungen. Zum einen haben viele Beitrittsländer erst im Zuge der Beitrittsvorbereitungen begonnen, eine eigene Entwicklungshilfe aufzubauen – die in ihrer Masse zudem recht bescheiden ausfällt.12 Zum anderen ist die bisherige EU-Entwicklungshilfepolitik vor allem auf den Mittelmeerraum und die AKP-Länder ausgerichtet. Die neuen Beitrittsländer konzentrieren sich dagegen eher auf ihre postkommunistischen Nachbarn im Osten Europas und zum Teil auf Traditionspartner der alten kommunistischen Kooperation wie Laos, Vietnam oder Angola.13 Die zentrale Problematik, welche zu Interessenkollisionen führen kann, ist jedoch das Wohlstandsgefälle, welches zwischen den „alten“ und den „neuen“ EUMitgliedstaaten besteht.14 Trotz der Tatsache, dass einige Beitrittsländer zum Teil einen erheblichen Wirtschaftsaufschwung verzeichnen konnten, hinken doch fast alle Beitrittsländer dem EU-Durchschnitt hinterher. Es steht demnach zu befürchten, dass völkerrechtliche Verträge von – zumindest einem – Beitrittsland dann verhindert werden, wenn sie mit größeren Umsetzungskosten verbunden sind.
II. Herausforderung durch den Anstieg der Mitgliederzahl Der ungewöhnlich große numerische Mitgliederzuwachs zwingt zu Änderungen, die über die bisher angewandte Praxis der schlichten Vergrößerung der Gemeinschaftsorgane hinausgehen.15 Im Protokoll über die Erweiterung der Europäischen Union16 wurde ein neuer Ponderierungsschlüssel für Beschlüsse des Rates, die mit qualifizierter Mehrheit ergehen, festgelegt. Diese Bestimmungen sollten ursprünglich ab 1. Januar 2005 gelten. In Art. 3 dieses Protokolls werden nur die 15 „alten“ Mitgliedstaaten erwähnt, eine ausdrückliche Regelung für die neuen Mitgliedstaaten war nicht vorgesehen. Abgesehen von der Neugewichtung der Stimmen im Ministerrat wurde eine neue Variante eingeführt, wonach jedes Mitglied im Rat beantragen kann, dass bei der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit überprüft wird, ob die Mitgliedstaaten, die diese qualifizierte Mehrheit bilden, mindesten 62% der Unionsbevölkerung repräsentieren. Hier lassen sich deutliche Parallelen zu der doppelten Mehrheit finden, die durch den Verfassungsvertrag zum Regelverfahren erhoben wird.17 12 Der Anteil der Entwicklungshilfeausgaben reicht von 0,00025 bis 0,03% des BIP der jeweiligen Beitrittsländer, Dauderstädt, Integration 2004, 28 (32). 13 Dauderstädt, Integration 2004, 28 (32). 14 Hierzu Bergmann, ZEuS 2003, 103 (107 ff.), der zudem auf das Migrationsproblem hinweist; Dauderstädt, Integration 2004, 28 (28 ff.). 15 Müller-Graff, in: Heusel (Hrsg.), Die Osterweiterung der Europäischen Union, S. 21 (29). 16 BGBl. 2001 II, S. 1667.
176
3. Teil: Die Auswirkungen der EU-Osterweiterung
Eine im Hinblick auf den Beitritt abschließende und endgültige Regelung bezüglich der institutionellen und verfahrensrechtlichen Änderungen unter Einbeziehung der Beitrittsländer enthält die Beitrittsakte vom 23. 09. 2003.18 Hiernach galt für den Zeitraum ab dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten (1. Mai 2004) bis zum 31. Oktober 2004 eine Übergangsregelung19 für die Änderung der Gewichtung der Stimmen. Seit 1. November 2004 verfügen die einzelnen Länder über folgende Anzahl von Stimmen im Rat:20 – Deutschland, Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich: je 29, – Spanien und Polen: je 27, – Niederlande: 13, – Belgien, Tschechische Republik, Griechenland, Ungarn und Portugal: je 12, – Österreich und Schweden: je 10, – Dänemark, Irland, Litauen, Slowakei und Finnland: je 7, – Zypern, Estland, Lettland, Luxemburg und Slowenien: je 4, – Malta: 3.
Insgesamt werden demnach 321 Stimmen den einzelnen Mitgliedstaaten zugeordnet. Eine qualifizierte Mehrheit gilt als erreicht, wenn – die Mehrheit der Mitgliedstaaten zustimmt und – mindestens 232 befürwortende Stimmen abgegeben werden, das heißt 72,3% der Gesamtzahl.
Darüber hinaus kann jeder Mitgliedstaat – wie es auch im oben genannten Protokoll zur Erweiterung der Union festgelegt war – fordern, dass überprüft wird, ob durch die befürwortenden Stimmen mindestens 62% der Gesamtbevölkerung der EU vertreten werden.21 Kann dies nicht bestätigt werden, gilt der Beschluss als abgelehnt. 17 Nach dem Verfassungsvertrag ist jedoch kein Antrag auf Feststellung der repräsentierten Bevölkerungszahl nötig, vielmehr wird in jedem Fall ermittelt, ob das erforderliche Bevölkerungsquorum erreicht wird. 18 ABl. 2003 L 236, 33 ff.; die Beitrittsakte änderte damit einige Punkte des Vertrages von Nizza, die noch keine Wirksamkeit erlangt hatten, vgl. Niedobitek, JZ 2004, 369 (369). 19 ABl. 2003 L 236, 33 (36) – Art. 11 der Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge. 20 ABl. 2003 L 236, 33 (36) – Art. 12 der Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge.
§ 6 Die Außenkompetenzen der EU nach der Osterweiterung
177
Im Hinblick auf völkerrechtliche Übereinkünfte ergeben sich durch die Erweiterung Probleme in Bezug auf die Entscheidungs- und Gestaltungsfähigkeit des Rates. Zum einen erhalten diejenigen Sachbereiche neue, größere Brisanz, die dem Einstimmigkeitsprinzip unterliegen. Aber auch diejenigen Bereiche, in denen eine qualifizierte Mehrheitsentscheidung möglich ist, sind nicht unproblematisch. In Bezug auf die erstgenannten Bereiche entsteht ein enormes Blockadepotential, da bereits ein Mitgliedstaat (von 25) einen gesamten Beschluss verhindern kann. Es ist eine Verstärkung des Lähmungspotentials durch Partikularinteressen kleinerer Mitgliedstaaten22 zu befürchten.23 Dies ist insbesondere im Bereich der GASP entscheidend, da hier weitgehend nach wie vor das Einstimmigkeitsprinzip besteht. Nach der Erweiterung werden 25 Außenministerien, 25 Armeen und bis zu 25 unterschiedliche Interessenlagen in der Gemeinschaft existieren. Äußerst problematisch erscheint daher, wie die Europäische Union eine „Weltpolitik mit 25 Meinungen“24 kohärent und effektiv durchführen kann. Eine ähnliche Rechtslage wie im Bereich der GASP gilt nach Art. 34 EU für den Bereich der Polizeilichen und Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, wo ebenfalls für alle grundlegenden Beschlüsse Einstimmigkeit erforderlich ist.25 In vielen anderen – wenn auch nicht allen26 – Bereichen hat der Vertrag von Nizza die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit eingeführt. Aber auch im Bereich der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit beeinträchtigt die Ausweitung der Mitgliederzahl die positive Entscheidungsfähigkeit des Rates.27 Dies folgt daraus, dass die Erweiterung einen quantitativen Anstieg der für einen positiven Beschluss des Rates erforderlichen (Mindest-)Stimmenanzahl zur Folge hat. Kurz gesagt muss, um eine Entscheidung herbeizuführen, eine größere Anzahl von Mitgliedstaaten für den jeweiligen Beschluss stimmen. Dies erschwert die Entscheidungsfähigkeit des Rates.
21 Zum Vergleich: Der Verfassungsvertrag bestimmt, dass eine qualifizierte Mehrheit dann erreicht ist, wenn eine Mehrheit von mindestens 55% der Mitglieder des Rates, gebildet aus mindestens 15 Mitgliedern einem Beschluss zustimmt, sofern die befürwortenden Staaten mindestens 65% der Bevölkerung der Union ausmachen (Art. I-25 EVV). 22 Zudem bedeutet der überproportionale Zuwachs an kleineren Staaten im Hinblick auf deren privilegiertes Entscheidungsgewicht ein (demokratisches) Legitimationsproblem, vgl. Müller-Graff, in: Heusel (Hrsg.), Die Osterweiterung der Europäischen Union, S. 21 (33). 23 Bergmann, ZEuS 2003, 103 (130 f.) spricht von einer sicheren Selbstblockade, die zu einem erneuten Zeitalter der Eurosklerose führen werde. 24 So der Titel des Artikels in der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 27. 04. 2004, S. 5. 25 Bergmann, ZEuS 2003, 103 (119) weist darauf hin, dass dies zu einem schnellen Aus für manche rechtspolitische Initiative führen kann. 26 Weiterhin dem Einstimmigkeitsprinzip unterworfen sind zum Beispiel die Steuer-, Asylund Einwanderungspolitik. 27 Müller-Graff, in: Heusel (Hrsg.), Die Osterweiterung der Europäischen Union, S. 21 (31).
12 Metz
178
3. Teil: Die Auswirkungen der EU-Osterweiterung
III. Folgen der geografischen Erweiterung Die geografische Erweiterung der Union hat faktische Folgen für die Außenbeziehungen der Union. Durch die Osterweiterung rückt zum einen Russland an die Grenzen der Union heran. Zieht man in Betracht, dass Russland eine Großmacht ist und über bedeutende Energiereserven verfügt, zum anderen aber erhebliche innerstaatliche Probleme bestehen (Sicherung der Demokratie und der rechtsstaatlichen Strukturen, instabile Lage in Tschetschenien), steht die Union vor einer großen außenpolitischen Herausforderung. Weitere Probleme könnte ferner die russische Enklave um Königsberg auslösen. Ein neuer Ansatz ist auch insofern erforderlich, als Russland nicht den Beitritt zur Union anstrebt. Die bisher oftmals angewendete – und erfolgreiche – Strategie der Union, mittels der Beitrittsperspektive eigene Ziele durchzusetzen, kann hier nicht zum Erfolg führen und muss demnach überdacht werden. Ebenso verhält es sich in Bezug auf andere instabile oder undemokratische Staaten, wie die Republik Moldau und Weißrussland.28 Auch hier muss sich die Union mit ihren neuen Nachbarn arrangieren und neue außenpolitische Konzepte erarbeiten.29 Erste Ansätze hierzu hat die Europäische Kommission mit ihrer neuen Nachbarschaftsstrategie „A Wider Europe“ vorgestellt.30 Durch den Beitritt Zyperns und Maltas rückt zudem noch stärker der Mittelmeerraum (insbesondere die östlichen und südlichen Anrainerstaaten) ins Blickfeld der Union. Um die Nachbarschaftsverhältnisse der erweiterten Europäischen Union konstruktiv zu gestalten, sind auch hier neue Initiativen erforderlich. Positiv kann der Beitritt der neuen Mitgliedstaaten die Union politisch in die Lage versetzen, internationale Probleme wirksamer anzugehen. Dies folgt daraus, dass die Union zu einem immer größeren globalen Akteur wird. Die Kehrseite der Medaille ist, wie gesagt, dass ein für das Handeln nach außen erforderlicher Konsens immer schwieriger zu erreichen sein wird.
28 Wie die weiteren Entwicklungen in der Ukraine – nach der friedlichen Revolution – aussehen werden, ist noch ungewiss. 29 Siehe zur EU-Osterweiterung als politischen Prozess in Bezug auf die EU und Russland, die GUS und die nichtassoziierten Staaten auf dem Balkan Geistlinger, in: Heusel (Hrsg.), Die Osterweiterung der Europäischen Union, S. 149 ff. Zur Auswirkung der Osterweiterung auf das Verhältnis zu Russland und zur Ukraine vgl. Maresceau, in: Hillion (Hrsg.), EU Enlargement: A Legal Approach, S. 181 ff.; Klemin, in: Heusel (Hrsg.), Die Osterweiterung der Europäischen Union, S. 169 ff.; ausführlich zur Politik gegenüber den neuen Anrainern auch Stratenschulte, Integration 2004, 95. 30 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 11. 03. 2003: Größeres Europa – Nachbarschaft: Ein neuer Rahmen für die Beziehungen der EU zu ihren östlichen und südlichen Nachbarn, Brüssel 2003, KOM (03) 104 endgültig. In dem Strategiepapier wird zur Herstellung einer Zone der Prosperität und guter Nachbarschaft vorgeschlagen, abgestimmte Aktionspläne zu erarbeiten. Als Anreiz soll die Beteiligung an Gemeinschaftspolitiken und der Zugang zu Krediten der Europäischen Investitionsbank geboten werden.
§ 6 Die Außenkompetenzen der EU nach der Osterweiterung
179
IV. Bestehende Verträge zwischen den Beitrittsstaaten und Drittstaaten Bestehende Verträge zwischen Kandidatenstaaten und Drittstaaten sind kein spezifisches Problem der Osterweiterung. Ähnliche Konstellationen haben sich bei jeder bisherigen Beitrittsrunde gestellt. Bestehende Verträge, etwa Freihandelsoder Wirtschaftsabkommen mit Drittstaaten, genießen nach dem allgemeinen völkerrechtlichen Grundsatz „pacta sunt servanda“ Bestandsschutz. Diesem Umstand trägt Art. 307 UAbs. 1 EG Rechnung. Dort wird bestimmt, dass die Rechte und Pflichten aus Übereinkünften, welche vor dem Zeitpunkt des Beitritts zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten einerseits und einem dritten Land oder mehreren dritten Ländern andererseits geschlossen wurden, durch den EG-Vertrag nicht berührt werden.31 Allerdings postuliert Art. 307 EG, dass die Mitgliedstaaten diejenigen Teile der Übereinkünfte ändern müssen, die mit dem EG-Vertrag nicht vereinbar sind. Hierzu müssen die Beitrittsländer alle geeigneten Mittel anwenden; es entsteht somit ein politischer Anpassungsdruck dahingehend, die bestehenden völkerrechtlichen Verträge europarechtskonform zu machen.32 Eine dem Art. 307 EG entsprechende Regelung enthält Art. 6 der Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge (im Folgenden: die Akte33). Artikel 6 der genannten Akte begründet die Pflicht der neuen Mitgliedstaaten, den von der EG und der EU oder von der EG und den Mitgliedstaaten gemeinsam abgeschlossenen völkerrechtlichen Übereinkünften beizutreten.34 Mit Inkrafttreten der genannten Akte sind die neuen Mitgliedstaaten dem AKP-Vertrag von Cotonou vom 23. 06. 200035 beigetreten.36 Falls ein Beitrittsstaat Probleme bei der Anpassung eines bestehenden Abkommens bekommt, muss er sich notfalls aus dem betreffenden Abkommen zurückziehen.37 31 Zur Mitgliedschaft in internationalen Organisationen und zu internationalen Abkommen, die die Beitrittsländer abgeschlossen haben (GATT, WTO, NATO usw.), siehe Rantalater / Heegde / Labedzka, in: Ott / Inglis (Hrsg.), Handbook on European Enlargement, S. 75 ff.; zur EU-Osterweiterung und der WTO vgl. Gertler, in: Heusel (Hrsg.), Die Osterweiterung der Europäischen Union, S. 179 ff. 32 Müller-Graff, in: Heusel (Hrsg.), Die Osterweiterung der Europäischen Union, S. 21 (44). 33 ABl. 2003 L 236, 33 (35). 34 Interessant in dem Zusammenhang ist, dass bei diesen gemischten Abkommen die Kommission gemäß Art. 6 Abs. 2 UAbs. 2 der Akte die alleinige Verhandlungsführerin ist. 35 ABl. 2000 L 317, 3. 36 Vgl. Art. 6 Abs. 4 der oben genannten Akte. 37 Hillion, ELRev 2004, 583 (608).
12*
180
3. Teil: Die Auswirkungen der EU-Osterweiterung
Alle von der EG oder der EU im Rahmen von Art. 24 und 38 EU abgeschlossenen internationalen Abkommen sind gemäß Art. 6 der genannten Akte für die neuen Mitgliedstaaten (im Innenverhältnis zur Union) verbindlich.38 Die neuen Mitgliedstaaten müssen den von der EG bereits abgeschlossenen Abkommen beitreten.39 Hierbei ist zu beachten, dass der jeweilige Vertragspartner des völkerrechtlichen Vertrages natürlich einer solchen Anpassung beziehungsweise Erweiterung des Abkommens zustimmen muss. In dieser Hinsicht haben sich bei einigen Übereinkünften Probleme ergeben. So machte etwa die Zustimmung Russlands zur Anpassung des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens zwischen der EU und Russland Schwierigkeiten. Ähnliches galt auch für die Erweiterung des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)40 in Bezug auf Island, Liechtenstein und Norwegen.41 In beiden Fällen ging es darum, dass die jeweiligen Vertragspartner negative ökonomische oder geopolitische Folgen für sich befürchteten. Das im Rahmen der Welthandelsorganisation abgeschlossene GATT-Abkommen hat die Osterweiterung der EU nicht behindert, da die Grundlage der Gemeinschaft gemäß Art. 23 EG eine Zollunion ist, die sich auf den gesamten Warenaustausch erstreckt und damit die Ausnahmeklausel von der Meistbegünstigungsklausel für eine regionale Wirtschaftsintegration erfüllt.42 Auf das spezifische Problem, welches sich völkerrechtlich aus der Mitgliedschaft des noch immer geteilten Zyperns ergibt, kann in der vorliegenden Arbeit nicht eingegangen werden.43
Hillion, ELRev 2004, 583 (607 f., Fn. 87, 88). Besondere Erwähnung finden Textilabkommen, Stahlabkommen, Fischereiabkommen sowie bestimmte gemischte Abkommen. 40 Vgl. hierzu insbes. Evtimov, in: Ott / Inglis (Hrsg.), Handbook on European Enlargement, S. 155 ff. 41 Siehe weiterführend Hillion, ELRev 2004, 583 (608 ff.). 42 Vgl. hierzu Müller-Graff, in: Heusel (Hrsg.), Die Osterweiterung der Europäischen Union, S. 21 (44) und Gertler, in: Heusel (Hrsg.), Die Osterweiterung der Europäischen Union, S. 179 ff. 43 Siehe hierzu Hillion, ELRev 2004, 583 (610 ff.). Die Bemühungen der EU, durch zahlreiche Vermittlungen ein wiedervereinigtes Zypern als Neumitglied in die Union aufnehmen zu können, sind aufgrund des ablehnenden Referendums der Zypern-Griechen am 24. April 2004 gescheitert. Die Union hatte zuvor jedoch auf dem Kopenhagener Gipfel im Jahr 2002 klar gemacht, dass die Aufnahme Zyperns nicht an der bestehenden Teilung scheitern werde. Zypern wurde am 1. Mai 2004 schließlich als gesamter Staat in die Europäische Union aufgenommen, wobei Sonderregelungen für den Norden getroffen wurden (die Aufnahme nur des südlichen Teils Zyperns hätte de facto die Anerkennung des Nordteils als Völkerrechtssubjekt bedeutet und die „green line“ zwischen den beiden Teilen zur Außengrenze der Europäischen Union bestimmt). 38 39
§ 6 Die Außenkompetenzen der EU nach der Osterweiterung
181
V. Insbesondere: Probleme mit gemischten Abkommen Gemischte Abkommen spiegeln das Problem der Einstimmigkeit von Ratsentscheidungen wider. Zwar muss bei gemischten Abkommen nicht notwendigerweise eine einstimmige Ratsentscheidung herbeigeführt werden, aber – neben der Gemeinschaft – muss jeder einzelne Nationalstaat dem Abkommen zunächst zustimmen und sodann das jeweilige nationale Ratifizierungsverfahren in Gang setzen. Dies resultiert daraus, dass zumindest Teile des entsprechenden Abkommens im Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten verblieben sind. Die Folge ist, dass in Zukunft – neben der Gemeinschaft – nicht weniger als 25 Mitgliedstaaten einstimmig handeln müssen; im Anschluss daran stehen die nationalen Ratifizierungsverfahren an, die, abgesehen von dem Risiko eines erfolgreichen Abschlusses, auch eine sehr lange Zeit dauern.44 Dies verschärft das Problem, dass die Gemeinschaft aufgrund des Konsenszwangs deutlich in ihrer Verhandlungsposition geschwächt wird. Außerdem verliert der Vertragsabschluss mit der Gemeinschaft für Drittländer an Attraktivität, zum einen aufgrund des Zeitfaktors, zum anderen aufgrund der unabsehbaren Ratifikationsschwierigkeiten. Auch das Problem, wer letztendlich für Verstöße gegen ein gemischtes Abkommen verantwortlich gemacht werden kann, bleibt ungelöst. Selbst wenn ein angenommener Verstoß vollständig auf einen Gemeinschaftsakt zurückzuführen ist, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Vertragspartner (neben der Gemeinschaft) auch die einzelnen Mitgliedstaaten für den Vertragsbruch verantwortlich machen, da einige Staaten die gemischten Abkommen nicht als bilaterale, sondern als multilaterale Abkommen betrachten und somit die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten zusammen, aber auch jeweils einzeln und getrennt voneinander für die Einhaltung der Abkommen verantwortlich machen.45 Der Grund hierfür liegt darin, dass es von außen schwer zu erkennen ist, wer tatsächlich handelt. So nimmt die Gemeinschaft sogar in Fragen der Zollunion Rückgriff auf nationalstaatliche Behörden und überlässt die Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts weitgehend nationalen Richtern. Die Probleme mit gemischten Abkommen werden immer drängender, da gemischte Abkommen mittlerweile die Regel geworden sind.
44 Erschwerend kommt hinzu, dass die Verfassungen einiger Mitgliedstaaten die provisorische Anwendung von internationalen Verträgen nicht zulassen. Dies ist zumindest für die Mitgliedstaaten Österreich und Portugal der Fall, vgl. Editorial Comments, CMLRev 2004, 631 (631). 45 Editorial Comments, CMLRev 2004, 631 (631 f.).
Vierter Teil
Außenbeziehungen der Europäischen Union nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa § 7 Einleitung Eine Konstitutionalisierung bedeutet die Begrenzung und Legitimierung politischer Macht durch das Aufstellen bestimmter genereller Regeln und Standards.1 Nach dem Grundsatz des Vorrangs der Verfassung ist alle staatliche Gewalt an die Verfassung gebunden und dieser unterworfen. Im Bereich der Außenpolitik bestehen in der Theorie wie in der Praxis allerdings insofern einige Besonderheiten, als die Außenpolitik in vielen europäischen Verfassungen nicht bestimmten Regelungen unterworfen ist und die Regierungen damit – mehr oder weniger – autonom handeln können.2 Die Rolle der Parlamente ist oft nur auf die Ratifikation internationaler Verträge beschränkt, meist kommt ihnen weder ein Initiativ- noch ein Beteiligungsrecht an den Verhandlungen zu. Vor die Wahl gestellt, ein gesamtes Abkommen entweder vollständig abzulehnen oder vollständig anzunehmen, ist die Verweigerung der Ratifizierung oft keine wirkliche Option. Auch die direkte demokratische Legitimation bestimmter außenpolitischer Entscheidungen ist in den meisten europäischen Verfassungen nur schwach ausgeprägt.3 Ein ähnliches konstitutionelles Defizit besteht bei der gerichtlichen Kontrolle der auswärtigen Gewalt.4 Krajewski, YEL 2003, 435 (438); Craig, ELJ 2001, 125 (127 ff.). Zur historischen Komponente vgl. Krajewski, YEL 2003, 435 (438), der unter anderem John Locke zitiert: Foreign policy „is much less capable to be directed by ( . . . ) positive laws than the executive and so must be necessarily left to the prudence and wisdom of those whose hands it is in“. 3 Krajewski, YEL 2003, 435 (440); vgl. zur Lage in Deutschland Hailbronner, VVDStRL 56 (1997), 7 (35), dem es unbefriedigend erscheint, dass das Parlament von der politischen Kontrolle wesentlicher politischer Entscheidungen um Bereich der auswärtigen Gewalt ausgeschlossen bleibt. 4 Zu den Nachweisen vgl. Krajewski, YEL 2003, 435 (440 f.); Schweitzer, Staatrecht III, S. 247; das BVerfG (BVerfGE 55, 349 (365)) begründet die eingeschränkte juristische Kontrolle folgendermaßen: „Die Weite des Ermessens im auswärtigen Bereich hat ihren Grund darin, dass die Gestaltung auswärtiger Verhältnisse und Geschehensabläufe nicht allein vom Willen der Bundesrepublik Deutschland bestimmt werden kann, sondern vielfach von Unständen abhängig ist, die sich ihrer Bestimmung entziehen. Um es zu ermöglichen, die jeweiligen politischen Ziele der 1 2
§ 7 Einleitung
183
Der in den Außenbeziehungen bestehende und gerade beschriebene geringe Standard an verfassungsrechtlicher Regelung wird entweder mit dem Hinweis auf die „Natur der Sache“ oder mit dem Erfordernis begründet, der Staat dürfe nur „mit einer Stimme“ (nämlich der der Regierung) sprechen.5 Der Abschluss völkerrechtlicher Verträge wird gemeinhin zum Kernbestand der auswärtigen Gewalt gerechnet.6 In der Kompetenzfrage treffen alle Schlüsselfragen der Verfassungsdebatte zusammen.7 Sie ist der Weg zum vertieften Verständnis der Europäischen Integration und gleichzeitig ein europapolitischer Zankapfel.8 Die Verteilung von Kompetenzen definiert die wesentlichen Eigenarten eines jeden Systems, seine Aufgabenstellung und seine Finalität; damit verbunden ist immer auch eine Grundentscheidung über den zukünftigen Weg der Europäischen Union.9 Seit der Etablierung von Mehrheitsentscheidungen im Rat ist die Kompetenzordnung zwischen der Union und den Mitgliedstaaten ein juristisches und politisches Schlüsselthema.10 Aufgrund der bestehenden Probleme hinsichtlich der Kompetenzen der Gemeinschaft und Union besteht weiterer Klärungsbedarf.11 Im Verfassungsvertrag sind daher Bestimmungen über die vertikale Kompetenzordnung an vorderer Stelle platziert. Die Wahrung der europäischen Interessen im globalen Zusammenhang wird künftig eine zentrale Aufgabe der Europäischen Union sein.12 Das bisher introvertierte Europa muss extrovertierter werden, dafür müssen die Zuständigkeiten der EU nach außen gestärkt, nach innen hingegen können sie verschlankt werden.13 Die Effektuierung und Ausweitung der GASP ist eines der wichtigsten Projekte für die Zukunft der Europäischen Union.14 Gegenwärtig ist keine föderal aufgebaute Herrschaftsordnung bekannt, deren Kompetenzordnung nur ausschließliche Kompetenzen enthält, die also eine vollständige und randscharfe Trennung der Befugnisse vornehmen würde.15 Man mag Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des völkerrechtlich und verfassungsrechtlich Zulässigen durchzusetzen, gewährt das Grundgesetz den Organen der auswärtigen Gewalt einen sehr weiten Spielraum in der Einschätzung außenpolitisch erheblicher Sachverhalte wie der Zweckmäßigkeit möglichen Verhaltens.“ 5 Krajewski, YEL 2003, 435 (441). 6 Hailbronner, VVDStRL 56 (1997), 7 (25). 7 Ruffert, EuropaR 2004, 165 (187). 8 Ruffert, EuropaR 2004, 165 (187). 9 Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (511). 10 von Bogdandy / Bast / Westphal, Integration 2003, 414. 11 Vgl. Trüe, ZaöRV 2004, 391 (396) und die Erklärungen der Regierungskonferenzen von Nizza (Erklärung zur Zukunft Europas, veröffentlicht mit dem Vertrag von Nizza in ABl. 2001 C 80, 85 als 23. Erklärung zu dem Vertrag von Nizza) und Laeken (http: / / europeanconvention.eu.int / pdf / LKNDE.pdf). 12 Wuermeling, EuropaR 2004, 216 (217). 13 Wuermeling, EuropaR 2004, 216 (217). 14 Kugelmann, EuropaR 2004, 322 (324).
184
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
diese mangelnde Klarheit bedauern, andererseits muss berücksichtigt werden, dass konkurrierende oder geteilte Zuständigkeiten diskursive Verständigungen der Ebenen über sachangemessene Lösungen begünstigen oder erzwingen können und kein anderer Kompetenztypus eine derart flexible Bewältigung neuartiger Probleme ermöglicht.16 Diese Rahmenbedingungen vorausgesetzt, soll analysiert werden, ob der Vertrag über eine Verfassung für Europa Kompetenzverschiebungen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten – insbesondere im Bereich der Außenbeziehungen – bewirkt. Im Folgenden wird untersucht, welches Kompetenzsystem der Verfassungsvertrag statuiert und ob die Konstitutionalisierung insgesamt zu einem Zuständigkeitsgewinn für die Europäische Union führt.
I. Entstehungsgeschichte und Idee des Verfassungskonvents (Erklärung von Laeken, Post-Nizza-Prozess, die Zukunftsfähigkeit der Europäischen Union nach dem Erweiterungsprozess) Die Einberufung eines Konvents zur Zukunft Europas wurde am 15. 12. 2001 in der Erklärung von Laeken17 beschlossen.18 Dem Konvent sollte die Aufgabe zukommen, die wesentlichen Fragen zu prüfen, welche die künftige Entwicklung Europas aufwirft. Angesichts der Erweiterung Europas um zehn neue Mitgliedstaaten, der Globalisierung und der zunehmenden Gefahr durch Terror und religiösen Fanatismus sollten neue Mechanismen gefunden werden, die es einem geeinten Europa ermöglichen sollten, diesen Problemen effektiv zu begegnen. Außerdem sollten Vorschläge entwickelt werden, wie die Entscheidungsprozesse innerhalb der Union transparenter und effektiver gestaltet werden können. Schließlich waren Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (533). Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (533). 17 Anlage I der Schlussfolgerungen des Vorsitzes zum Europäischen Rat von Laeken am 14. und 15. 12. 2001, Dok. SN 300 / 01, http: //europa.eu.int/fututum/documents/offtext/ doc151201_de.htm, S. 5 f. oder http: //european-convention.eu.int/pdf/LKNDE.pdf. 18 Bereits in der am 09. 12. 2000 vom Europäischen Rat in Nizza verabschiedeten, auf einer deutsch-italienischen Initiative beruhenden „Erklärung zur Zukunft der Union“ zur Schlussakte der Regierungskonferenz (Erklärung Nr. 23 zur Schlussakte zum Vertrag von Nizza, ABl. 2001 C 80, 85) wird der Wunsch nach einer „Aufnahme einer eingehenderen und breiter angelegten Diskussion über die Zukunft der Europäischen Union“ geäußert (Ziffer 3 der Erklärung). Außerdem enthielt die Erklärung die Forderung, dass unter anderem den Fragen nachgegangen werden sollte, wie eine genauere, dem Subsidiaritätsprinzip entsprechende Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten hergestellt werden könne und wie eine Vereinfachung der Verträge, mit dem Ziel, diese klarer und verständlicher zu machen, aussehen könne (Ziffer 5 der Erklärung). In Ziffer 4 verweist die Erklärung auf den im Dezember 2001 abzuhaltenden Gipfel des Europäischen Rats in Laeken. 15 16
§ 7 Einleitung
185
Konzepte auszuarbeiten, wie Europas Rolle in einer neuen Weltordnung im Sinne des Eintretens für Demokratie und Menschenrechte definiert werden könnte.19 Zentrales Thema bei den Beratungen des Konvents waren die bessere Aufteilung und Festlegung der Zuständigkeiten der Union.20 Hierbei ging es um eine mögliche Gliederung in (1) ausschließliche Zuständigkeiten der EU, (2) solche der Mitgliedstaaten und (3) in zwischen beiden geteilte Zuständigkeiten. Geklärt werden sollte außerdem, wie eine kohärente Außenpolitik und Verteidigungspolitik entwickelt werden kann. Schließlich sollte darüber beraten werden, ob es zu einer Neuordnung der bisherigen Verträge kommen soll, ob die Union die Charta der Grundrechte in den Vertrag aufnehmen und ob die Union der Europäischen Menschenrechtskonvention beitreten sollte. Die grundsätzliche Frage der Schaffung einer Verfassung für die Europäische Union sollte ebenfalls diskutiert werden. Die bisherigen Änderungen der Europäischen Verträge (zum Beispiel Maastricht, Amsterdam, Nizza) wurden von Regierungskonferenzen und nicht von einem Konvent vorbereitet. Die Erfahrungen auf den Regierungskonferenzen zeigten jedoch, dass dieses Verfahren nicht immer befriedigend war. Die Regierungskonferenzen wurden von Regierungsbeamten vorbereitet, die weisungsabhängig waren. Weil die meisten Mitgliedstaaten nicht bereit waren, bereits auf dieser Ebene echte Kompromisse einzugehen, kam als Ergebnis dieser vorbereitenden Sitzungen oft nur der kleinste gemeinsame Nenner heraus. Dieser Minimalkompromiss auf Beamtenebene wurde dann auf den eigentlichen Regierungskonferenzen, an denen die Staats- und Regierungschefs teilnahmen, weiter durchlöchert, sodass von den jeweiligen Ergebnissen immer mehr Abstriche gemacht werden mussten. Hinzu kam der enorme Zeitdruck, unter dem die Regierungskonferenzen standen. Da die entscheidenden Fragen auf die Chefebene verschoben wurden, musste die Hauptarbeit innerhalb weniger Tage erledigt werden. Oft musste also mit der sprichwörtlichen „heißen Nadel“ gestrickt werden, es blieb keine Zeit für ausgefeilte Lösungen. Besonders auf der Regierungskonferenz, die zum Vertrag von Nizza führte, wurde deutlich, dass die Methode der Regierungskonferenzen an ihre Grenzen gestoßen war.21 Um bessere Ergebnisse erzielen zu können, wurde die Idee der Konventsmethode aufgegriffen.22 Mit dieser hatte man bereits bei der Ausarbeitung der Grundrechtscharta positive Erfahrungen gemacht.23 Man versprach sich 19 Näher hierzu Riedel, ZRP 2002, 241 (242); zu den Grundlagen und Bedingungen der Konventsarbeit Meyer / Hölscheidt, EuZW 2003, 613 f. 20 Diese Frage war bei der Regierungskonferenz von Nizza im Dezember 2000 ausgeklammert worden, Görlitz, DÖV 2004, 374 (374 f.); vgl. außerdem wiederum die Erklärung von Laeken und die Erklärung Nr. 23 zum Vertrag von Nizza. 21 Berg, ZEuS 2003, 353 (354); so auch Oppermann, DVBl. 2003, 1 (2). 22 Allgemein zur Arbeit des Europäischen Konvents siehe Busek / Hummer (Hrsg.), Der Europäische Konvent und sein Ergebnis – eine Europäische Verfassung, S. 15 ff. 23 Hobe, EuropaR 2003, 1 (11); Berg, ZEuS 2003, 353 (356). Die Konventsmethode ist überdies bekannt durch die Philadelphia Convention, welche die Verfassung der Vereinigten Staaten 1787 ausarbeitete und durch die Französische Konvention (1791 – 1797), welche die
186
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
davon eine gründlichere Aufbereitung der Probleme, einen breiteren Kompromiss, eine Mitwirkung von mehreren Akteuren und nicht zuletzt einen Maximalkompromiss, der die Bezeichnung „Verfassung für Europa“ verdiente. Nach Art. 48 EU ist für Vertragsänderungen eine Regierungskonferenz zwingend vorgeschrieben. Der Konvent konnte daher selbst keine Vertragsänderung „beschließen“, sondern lediglich Vorarbeiten leisten und entsprechende Vorschläge ausarbeiten.24 Der Entwurf, den der Europäische Konvent zu erarbeiten hatte, musste dann von einer Konferenz der Staats- und Regierungschefs angenommen werden und wird schließlich von allen EU-Mitgliedstaaten (als „Herren der Verträge“) ratifiziert werden müssen.25
II. Zusammensetzung und Arbeitsweise des Konvents In der Erklärung von Laeken ernannte der Europäische Rat Herrn Valéry Giscard d’Estaing zum Vorsitzenden des Konvents und die Herren Giuliano Amato und Jean-Luc Dehaene zu seinen stellvertretenden Vorsitzenden.26 Am Europäischen Konvent waren die wichtigsten Parteien für die Debatte über die Zukunft Europas beteiligt. Neben seinem Vorsitzenden und den beiden stellvertretenden Vorsitzenden gehörten dem Konvent 15 Vertreter der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten (ein Vertreter pro Mitgliedstaat), 30 Mitglieder der nationalen Parlamente (zwei pro Mitgliedstaat), 16 Mitglieder des Europäischen Parlaments und zwei Vertreter der Kommission an.27 Die 10 Bewerberländer, welche zum Zeitpunkt des Konvents noch keine Mitgliedstaaten der Union waren, wurden in vollem Umfang an den Beratungen des Konvents beteiligt. Sie waren in gleicher Weise wie die derzeitigen Mitgliedstaaten vertreten (ein Vertreter der Regierung und zwei Mitglieder des nationalen Parlaments) und konnten an den Beratungen teilnehmen, ohne freilich einen Konsens, der sich zwischen den Mitgliedstaaten abzeichnete, verhindern zu können. Auf diese Weise war der Konvent aus vier „Komponenten“ zusammengesetzt: Gewährleistet war die Mitwirkung der nationaerste französische republikanische Verfassung (1792) entwarf, vgl. Medina-Ortega, GJICL 2004, 393 (394). Auch die Europäische Union hat – wie bereits kurz erwähnt – positive Erfahrungen mit der Konventsmethode gesammelt: Auf dem Europäischen Rat in Köln im Frühjahr 1999 wurde die Einberufung eines Konvents zur Erarbeitung einer Grundrechtscharta beschlossen. Die im Jahr 2000 unter Vorsitz des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog ausgearbeitete Grundrechtscharta (welche auf der Regierungskonferenz von Nizza am 8. 12. 2000 feierlich proklamiert wurde) fand breite Anerkennung. 24 Riedel, ZRP 2002, 241 (242); Hobe, EuropaR 2003, 1 (16). 25 Riedel, ZRP 2002, 241 (242). 26 Verzeichnis aller Mitglieder des Europäischen Konvents in der Anlage 1 zu CONV 851 / 03, Bericht des Vorsitzes des Konvents an den Präsidenten des Europäischen Rates, S. 7. 27 Näher zur Zusammensetzung des Konvents Riedel, ZRP 2002, 241 (242 f.); Oppermann DVBl. 2003, 1165 (1166 f.).
§ 7 Einleitung
187
len Parlamente, des Europäischen Parlaments, der Kommission und der nationalen Regierungen. Als Beobachter wurden der Europäische Bürgerbeauftragte und drei Vertreter des Wirtschafts- und Sozialausschusses, drei Vertreter der europäischen Sozialpartner sowie sechs Vertreter im Namen des Ausschusses der Regionen (die von diesem aus den Regionen, den Städten und den Regionen mit legislativer Befugnis bestimmt wurden) eingeladen. Der Präsident des Gerichtshofs und der Präsident des Rechnungshofs durften sich auf Einladung des Präsidiums vor dem Konvent äußern. Zur Steigerung der Effektivität der Arbeiten des Konvents wurden mehrere Arbeitsgruppen eingerichtet, die zu bestimmten Fragen eingehend Stellung zu nehmen und einen Abschlussbericht für ihr jeweiliges Fachgebiet zu erstellen hatten. Insgesamt waren elf Arbeitsgruppen tätig, denen die verschiedenen Themen schließlich wie folgt zugeordnet wurden: Arbeitsgruppe I:
Subsidiarität
Arbeitsgruppe II:
Charta der Grundrechte
Arbeitsgruppe III:
Rechtspersönlichkeit
Arbeitsgruppe IV:
Einzelstaatliche Parlamente
Arbeitsgruppe V:
Ergänzende Zuständigkeiten
Arbeitsgruppe VI:
Ordnungspolitik
Arbeitsgruppe VII:
Außenpolitisches Handeln
Arbeitsgruppe VIII:
Verteidigung
Arbeitsgruppe IX:
Vereinfachung
Arbeitsgruppe X:
Freiheit, Sicherheit und Recht
Arbeitsgruppe XI:
Soziales Europa
Der Konvent trat jeden Monat im Gebäude des Europäischen Parlaments in Brüssel zu einer Plenartagung zusammen. Diese Tagungen waren öffentlich und erstreckten sich jeweils über zwei halbe Tage. Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Fachöffentlichkeit stellt ein Novum dar. Alle bisherigen Regierungskonferenzen fanden hinter verschlossenen Türen statt. An den Beratungen des Konvents konnte die Öffentlichkeit dagegen als Zuhörer teilnehmen, zudem wurden alle wichtigen Dokumente veröffentlicht.28 Insbesondere die Rolle des Präsidenten und des Präsidiums kristallisierte sich als entscheidend heraus. Auf die Berichte der einzelnen Arbeitsgruppen folgten Plenardebatten, in denen jedem Konventsmitglied ein dreiminütiges Rederecht zustand. Aus diesen Beiträgen „fischte“ das Präsidium die wichtigsten und – seiner 28 Sämtliche Konventsdokumente sind unter http: / / european-convention.eu.int im Internet einsehbar und können unproblematisch heruntergeladen werden.
188
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Auffassung nach – konsensfähigen Punkte heraus. Das Präsidium erstellte aus diesem Material Entwürfe, die dann wiederum innerhalb des Konvents zirkulierten. Falls sich gegen einen solchen Entwurf größere Widerstände formierten, änderte das Präsidium den Entwurf. Der endgültige Verfassungsentwurf wurde schließlich dem Plenum zur Abstimmung vorgelegt. Bei der Analyse dieser Vorgehensweise fällt die politische Rolle des Präsidiums auf. Es konnte Schwerpunkte setzen, und insbesondere die Beurteilung, ob ein Vorschlag eine Gefahr für die spätere Ratifizierung darstellte oder konsensfähig war, ließ einen weiten Spielraum für bestimmte Akzentuierungen offen. Die Beschlüsse des Konvents wurden im Konsens gefasst. „Konsens“ bedeutete im Rahmen der Konventsverhandlungen allerdings nicht, dass notwendig alle Mitglieder des Konvents zustimmen mussten. Das Präsidium erstellte vielmehr auch Vorschläge, die auf Widerstand bei einigen Konventsmitgliedern stießen. Entscheidend für die Aufnahme in den Verfassungsentwurf war, dass nach der Überzeugung des Präsidiums kein die Ratifizierung gefährdendes Hindernis bestand. Daraus folgt, dass sich das Präsidium in dem einen oder anderen Fall auch über Widerstände hinwegsetzte.29 Problematisch bei den Abstimmungen war ferner die unterschiedliche Legitimität der einzelnen Mitglieder des Konvents. Wie schon erwähnt, waren einige Konventsmitglieder entweder Parlamentsmitglieder der nationalen Parlamente oder des Europäischen Parlaments und damit von den Bürgern direkt legitimiert. Andere Konventsmitglieder wurden von den nationalen Regierungen entsandt, wieder andere kamen aus den Reihen der Europäischen Kommission. Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich die Konventsmethode bewährt hat. Insbesondere konnte ein Ergebnis erzielt werden, welches nicht den Charakter eines Minimalkompromisses aufweist.30 Aufgrund der Überlegenheit dieser Methode gegenüber den traditionellen Regierungskonferenzen wurde das Konventsverfahren als Regelverfahren zur Änderung der Europäischen Verfassung in den Vertragstext der Europäischen Verfassung aufgenommen (vgl. Art. IV-443 EVV31). 29 Dies führte teilweise zu heftiger Kritik, wie sie in dem „Gegenbericht Europa der Demokraten“ zu finden ist, vgl. CONV 851 / 03, Bericht des Vorsitzes des Konvents an den Präsidenten des Europäischen Rates (Anlage III), S. 21: „In dem mächtigen Präsidium, das den Tunnelsicht-Text verfasst hat, waren nur drei politische Richtungen vertreten.“ ( . . . ) „Nicht ein einziger Euro-Skeptiker oder „Eurorealist“ war befugt, an der Arbeit des Präsidiums oder der zuarbeitenden Sekretariate als Beobachter oder aktiver Beteiligter teilzunehmen.“ ( . . . ) „Demokratie und normale Abstimmungsverfahren wurden von Giscard im Konvent nicht zugelassen. Der Verfassungsentwurf läuft allen demokratischen Grundsätzen zuwider“. Diese Vorwürfe stammen freilich von der Fundamentalopposition. In den 15 Punkten, die die Verfasser des Gegenberichts den Regierungschefs und den europäischen Mitbürgern unterbreiten, heißt es unter Punkt 1: „Die Europäische Union (EU) darf keine Verfassung haben.“ (CONV 851 / 03, S. 23). 30 Schwarze, EuropaR 2003, 535 (570, 573) spricht von einer gelungenen Mischung aus Realitätssinn und Innovation. 31 Die Artikel (der endgültigen Fassung) des Verfassungsvertrages für Europa werden im Folgenden mit dem Zusatz EVV (Europäischer Verfassungsvertrag) versehen. Wird zu Ver-
§ 7 Einleitung
189
III. Das Ergebnis des Verfassungskonvents und sein weiteres Schicksal Die Eröffnungssitzung des Konvents fand am 1. März 2002 statt. Der Europäische Konvent hat seine Arbeit am 10. Juli 2003 abgeschlossen und am 18. Juli 2003 einen Entwurf eines Vertrages über eine Verfassung für Europa vorgelegt.32 Nachdem eine im Dezember 2003 zur Annahme des Verfassungsentwurfs anberaumte Regierungskonferenz am maßgeblichen Widerstand Spaniens und Polens sowie an der eigenwilligen Verhandlungsführung des damaligen italienischen Ratsvorsitzes unter Silvio Berlusconi gescheitert war33, trafen sich die Staats- und Regierungschefs im Juni 2004 erneut. Nach einem Regierungswechsel in Spanien konnte unter irischer Ratspräsidentschaft am 17. / 18. Juni 2004 in Brüssel endlich der Durchbruch erreicht werden; die Staats- und Regierungschefs der (mittlerweile34) 25 Mitgliedstaaten einigten sich auf einen Text für die zukünftige europäische Verfassung.35 Es mussten zwar einige Abstriche, insbesondere hinsichtlich des Katalogs der Gebiete, auf denen künftig eine Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit36 möglich sein sollte, hingenommen werden; der vom Europäischen Konvent vorgelegte Verfassungsentwurf ist jedoch in seiner Substanz erhalten geblieben.37 Eingedenk der Gründungsverträge der Europäischen Gemeinschaften gleichszwecken auf den vom Konvent vorgeschlagenen Entwurf eines Vertrages über eine Verfassung für Europa hingewiesen, so wird dieser mit KE-EVV (Konventsentwurf eines Vertrags über eine Verfassung für Europa) abgekürzt. Betreffend die Zitierweise des Verfassungsvertrages hat sich eingebürgert, dass vor die mit arabischen Ziffern genannte Zahl des Artikels derjenige Teil des Verfassungsvertrages mit römischen Ziffern benannt wird, aus dem die Vorschrift stammt. 32 Entwurf eines Vertrags über eine Verfassung für Europa, CONV 850 / 03, S. 1 ff.; insgesamt wurden 27 Plenarsitzungen abgehalten, auf denen es 1802 Redebeiträge gab. Das Präsidium tagte 50 mal. Es gibt insgesamt 848 Konventsdokumente, 5995 Änderungsanträge wurden gestellt. 11 Arbeitgruppen tagten in insgesamt 86 Sitzungen; das Zahlenmaterial stammt von Meyer / Hölscheidt, EuZW 2003, 613. Zur Rolle des Deutschen Bundestags bei den Konventsverhandlungen siehe Deutscher Bundestag Referat Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.), Eine Verfassung für Europa – Der Europäische Konvent und der Deutsche Bundestag, S. 15 ff. 33 Einen guten Überblick über die Gründe, warum der Gipfel scheiterte und welche Fragen offen blieben, gibt Hänsch, ZEuS 2004, 1 (3, 4 ff.). 34 Die zehn Beitrittskandidaten, die an den Beratungen des Konvents ohne Stimmrecht beteiligt waren, waren inzwischen zum 01. 05. 2004 offiziell der Europäischen Union beigetreten und mussten daher der Verfassung schließlich auch zustimmen. 35 Vgl. das Dokument der Regierungskonferenz über die „Vorläufige konsolidierte Fassung des Vertrags über eine Verfassung für Europa“, CIG 86 / 04. Zu den zuletzt streitigen Punkten siehe Editorial Comments, CMLRev. 2004, 899 (902). 36 Insbesondere die Definition der qualifizierten Mehrheit erwies sich als besonders schwieriger Verhandlungspunkt. Da das System der doppelten Mehrheit mittlerweile faktisch anerkannt war, wurde vor allem um die für das Zustandekommen einer qualifizierten Mehrheit erforderlichen Prozentpunkte gefeilscht, vgl. CIG 84 / 04, S. 8. 37 Mehr als 90% des vom Konvent vorgeschlagenen Textes wurden unverändert in die Verfassung übernommen, Editorial Comments, CMLRev. 2004, 899; davon abgesehen wurde
190
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
(„Römische Verträge“) ist die Europäische Verfassung mittlerweile am 29. Oktober 2004 in Rom offiziell von den Staats- und Regierungschefs der 25 EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet worden. Derzeit läuft das Ratifizierungsverfahren in den Mitgliedstaaten, welches bis zum 1. November 2006 abgeschlossen sein sollte.38 Nachdem der Verfassungstext bereits von mehreren Mitgliedstaaten erfolgreich ratifiziert worden war39, ist der Ratifikationsprozess jedoch aufgrund der negativen Volksabstimmungen in Frankreich40 und den Niederlanden41 ins Stocken geraten. Zur Zeit befindet sich die Europäische Union hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise in einer Denkpause. Fast alle europäische Staats- und Regierungschefs haben jedoch erklärt, dass sie weiterhin an einer Europäischen Verfassung festhalten wollen. Gleichzeitig soll die öffentliche Diskussion über die Vor- und Nachteile des Verfassungstextes gefördert werden, um das Verfassungsprojekt einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ob aufgrund dieser Diskussion der Verfassungsvertrag an der einen oder anderen Stelle noch geändert werden wird – etwa in Bezug auf das europäische Sozialmodell oder die künftige Erweiterungspolitik der Union – ist schwer abzuschätzen. Festzuhalten bleibt allerdings, dass die in der Verfassung getroffenen Regelungen bezüglich der Außenbeziehungen der Europäischen Union unstreitig sind. Insofern ist der jetzt vorliegende Verfassungsvertrag in jedem Fall und zumindest ein Maßstab, an dem sich gegebenenfalls ein künftiger Verfassungstext messen lassen muss. Inhaltlich ist der Vertrag über eine Verfassung für Europa eine Verfassung. Der juristischen Form nach ist er aber ein Vertrag, denn im Gegensatz zu nationalen Verfassungen rühren die Zuständigkeiten, die der Union übertragen werden, von den vertragsschließenden Parteien.42 Der Geltungsgrund des Verfassungsvertrags ist damit ein völkerrechtlicher. auch die Struktur der Verfassung nicht verändert. Positiv zum Konventsentwurf auch Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (513 f.), der ihm ein „hohes Niveau“ trotz gewisser „inhaltlicher Spannungen, Brüche und Redundanzen“ bescheinigt. Auch Skouris sieht in dem Verfassungsvertrag ein „ausgewogenes Instrument“ und eine „geeignete Grundlage für die nächsten Jahrzehnte“, er bezeichnet den Verfassungsvertrag als den „bislang am besten vorbereiteten und umfangreichsten Vorschlag für die nächsten Entwicklungsschritte der Europäischen Region“, vgl. den Festvortrag von Skouris anlässlich des 65. Deutschen Juristentags 2004, Pressemitteilung Nr. 8 / 2004, S. 16 f. Kritisch zum Verfassungsvertrag, Rupp, Süddeutsche Zeitung vom 25. 02. 2005, S. 2, Außenansicht: „Dominanz der Verfassung Europas“ und Rupp, JZ 2003, 18 ff. 38 Das Europäische Parlament hat den Verfassungsvertrag offiziell gebilligt und befürwortet rückhaltlos dessen Ratifizierung, vgl. die Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vertrag über eine Verfassung für Europa vom 12. 01. 2005 (2004 / 2129 (INI)), S. 6 (Schlussfolgerungen). 39 Der jeweils aktuelle Ratifikationsstand ist im Internet unter http: //europa.eu.int/constitution/ratification_en.htm abrufbar. 40 Referendum vom 29. 05. 2005, Wahlbeteiligung 69,34%, Neinstimmen 54,68 %. 41 Referendum vom 01. 06. 2005, Wahlbeteiligung 63%, Neinstimmen 61,7%.
§ 7 Einleitung
191
IV. Einfluss auf den Bereich der Außenbeziehungen der EU Nachdem zunächst nur Arbeitsgruppen für die Bereiche Subsidiarität, Europäische Charta der Grundrechte, Rechtspersönlichkeit, Einzelstaatliche Parlamente, Ergänzende Zuständigkeiten und Ordnungspolitik geplant waren, kamen später Gruppen für die vorliegend näher zu betrachtenden Bereiche „Außenpolitisches Handeln“ und „Verteidigung“ hinzu.43 Zusammen mit den Arbeitsgruppen „Rechtspersönlichkeit“, „Subsidiarität“ und „Vereinfachung“ lässt sich erkennen, dass die Außenpolitik und die Frage des einheitlichen Auftretens der Union nach außen einen deutlichen Schwerpunkt im Rahmen der Verfassungsberatungen einnahmen.44 Bezüglich der einzelnen Kompetenzen der Union muss festgehalten werden, dass der Konvent nicht jede einzelne Kompetenzgrundlage darauf überprüft hätte, ob sie notwendig ist oder ob eine Rückübertragung auf die Mitgliedstaaten erfolgen sollte. Aufgrund des Zeitmangels nahm der Konvent die bestehenden Kompetenzgrundlagen als gegeben an und konzentrierte sich eher auf die Fragen der Klarheit und der genaueren Umschreibung der Zuständigkeiten der Union, sowie auf Fragen von grundsätzlicher Bedeutung.45 Für den Bereich der Außenbeziehungen bedeutete dies, Lösungen für die Problembereiche Völkerrechtspersönlichkeit, generelle Vertragsschlusskompetenz, Kategorisierung von Kompetenzen, einheitliches Auftreten nach außen sowie für eine institutionelle Reform der GASP zu finden.
42 Dies wird schon aus Art. I-1 Abs. 1 EVV deutlich. Vgl. auch die Anmerkungen des Vorsitzenden des Konvents Giscard d’Estaing, CONV 601 / 03, S. 1 (Rdnr. 1); ähnlich der Festvortrag von Papier anlässlich des 65. Deutschen Juristentags 2004, Pressemitteilung Nr. 3 / 2004, S. 3. Weiterführend hierzu Lenaerts / Gerard, ELRev 2004, 289 (292 ff., 297 f.). Das ambivalente Verhältnis wird auch dadurch verdeutlicht, dass der Vertrag selbst mit „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ überschrieben ist; wird dagegen im Text auf den Vertrag Bezug genommen, heißt es durchweg „Verfassung“ (englisch: Constitution, französisch: Constitution, spanisch; Constitución), vgl. nur Art. I-1 Abs. 1 EVV. 43 Vgl. CONV 200 / 02, S. 1 (Rdnr. 2). 44 So auch Krajewski, YEL 2003, 435 (436); hinsichtlich der Intensität der Diskussion ist festzuhalten, dass bis zu den abschließenden Beratungen des Konvents 850 Änderungsvorschläge zu den Artikelentwürfen über das außenpolitische Handeln gestellt wurden, CONV 748 / 03, S. 9. 45 Craig, ELRev 2004, 323 (325).
192
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
§ 8 Völkerrechtspersönlichkeit (Art. I-7 EVV), Drei-Säulen-Modell I. Bestehende Situation Wie bereits oben46 dargelegt, besteht Einigkeit darüber, dass die zwei verbliebenen Europäischen Gemeinschaften (EG und EAG) aufgrund der jeweiligen Bestimmungen in ihren Gründungsakten Rechtspersönlichkeit besitzen.47 Was jedoch die Europäische Union betrifft, so enthält der EU-Vertrag keine Regelung, in der ausdrücklich festgestellt wird, dass die Union über eine Rechtspersönlichkeit verfügt. Wie bereits im Zweiten Teil48 diskutiert, gibt es in der Rechtsliteratur verschiedene Auffassungen zur Frage, ob die EU eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt.49 Einigkeit besteht darüber, dass sich die Anzeichen für eine eigene Rechtspersönlichkeiten im Laufe der Zeit immer mehr verdichtet haben (insbesondere durch die Aufnahme des Art. 24 EU in den EU-Vertrag). Ob die Schwelle zur Rechtspersönlichkeit hiermit bereits (konkludent) überschritten worden ist, bleibt jedoch umstritten. Damit ist die bestehende Situation geprägt von Unsicherheit. Diese mangelnde Eindeutigkeit führt zu einer unklaren Identität der Europäischen Union – nach innen wie nach außen.
II. Mandat, Vorschlag und Ergebnis der Konventsberatungen 1. Mandat Die Arbeitsgruppe III des Konvents („Rechtspersönlichkeit“) sollte zunächst Empfehlungen abgeben, ob eine ausdrückliche Feststellung der Rechtspersönlichkeit der Union sinnvoll und ob gegebenenfalls eine Verschmelzung der Rechtspersönlichkeiten der Union und der Gemeinschaften zweckmäßig wäre. Zudem sollte untersucht werden, welcher Art die Auswirkungen auf die derzeitige Abgrenzung der Zuständigkeiten und auf die Verfahren wären. Schließlich musste die Arbeitsgruppe prüfen, ob die Union durch die Zuerkennung der Rechtspersönlichkeit auf internationaler Ebene handlungsfähiger werden würde, ob dies Auswirkungen auf den Status der Union in internationalen Organisationen hätte und ob hiermit ein Beitrag zur Vereinfachung der Verträge geleistet werden könnte.50 § 3 IV. 3. Vgl. Art. 281 I EG, Art. 184 EA, (Art. 6 I KS). 48 § 3 III. 2. b). 49 Lenaerts / Gerard, ELRev 2004, 289 (308 f.); Obwexer, in: Busek / Hummer (Hrsg.), Der Europäische Konvent und sein Ergebnis – eine Europäische Verfassung, S. 103 (104 f.) m. w. N. 50 Vgl. zum Mandat der Arbeitsgruppe III CONV 73 / 02. 46 47
§ 8 Völkerrechtspersönlichkeit
193
2. Vorschläge und Ergebnis Der Verfassungsvertrag51 bestimmt – in Anlehnung an den Wortlaut des Art. 281 EG – schlicht und eindeutig: Artikel I-7 EVV Rechtspersönlichkeit Die Union besitzt Rechtspersönlichkeit.
Damit wurde dem Vorschlag der Arbeitsgruppe III gefolgt, die sich nahezu einhellig (mit nur einer Gegenstimme) dafür ausgesprochen hatte, der Union künftig eine Rechtspersönlichkeit zuzuerkennen.52 Dabei handelt es sich um eine einzige Rechtspersönlichkeit, die an die Stelle der bestehenden Rechtspersönlichkeiten tritt.53 Die Option, wonach neben die Rechtspersönlichkeiten der Gemeinschaft und Euratom eine eigene Rechtspersönlichkeit der Union tritt, wurde – zu Recht – mit dem Argument verworfen, dass diese Lösung nicht hinreichend zur erforderlichen Klarstellung und Vereinfachung im Rahmen der Außenbeziehungen der Union beitragen würde.54 Außerdem wurde auf die Schwierigkeiten verwiesen, die bei Verträgen, die unter verschiedene Säulen fallen (säulenübergreifende oder crosspillar-mixity-Abkommen), auftreten. In diesen Fällen hätte Europa gegebenenfalls unter zwei verschiedenen Rechtspersönlichkeiten (etwa EU und EG) handeln und Verträge abschließen müssen. Die nun gefundene Lösung vereinfacht die Strukturen maßgeblich. Aufgrund der (einzigen) Rechtspersönlichkeit ist die neue Europäische Union das Völkerrechtssubjekt, welches an die Stelle der Europäischen Gemeinschaft und der jetzigen Europäischen Union tritt. Weitere Gründe für die gewählte Lösung waren die größere Effizienz, Rechtssicherheit und der Gewinn an Transparenz, den eine einzige Rechtspersönlichkeit mit sich bringt. Aufgrund der genannten Argumente ist die Schaffung einer einzigen Rechtspersönlichkeit für die Europäische Union sehr zu begrüßen.55 Als Folge der Schaffung einer einheitlichen Rechtspersönlichkeit der Union entstand die Möglichkeit, die verschiedenen, Europa begründenden Verträge (EU-Vertrag, EG-Vertrag, Euratomvertrag) in einem einzigen Vertrag zusammenzufassen. Eine solche Fusion der beiden Hauptverträge, nämlich des EU-Vertrags und des EG-Vertrags (nicht jedoch des Euratomvertrags), wurde vom Konvent schließlich 51 Nach dem Konventsentwurf hat die Vorschrift exakt denselben Wortlaut, vgl. Art. I-6 KE-EVV. 52 Auch auf der Plenartagung vom 27. 02. 2003 zeigte sich ein breiter Konsens für die Aufnahme dieser Bestimmung, CONV 601 / 03, S. 8. Zu den im Wesentlichen gleichen Vorschlägen des Europäischen Parlaments und der Kommission siehe Obwexer, in: Busek / Hummer (Hrsg.), Der Europäische Konvent und sein Ergebnis – eine Europäische Verfassung, S. 103 (111 f.). 53 Medina-Ortega, GJICL 2004, 393 (414). 54 CONV 305 / 02, S. 4. 55 So auch Thym, ELJ 2004, 5 (6 f.).
13 Metz
194
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
auch beschlossen und von der Regierungskonferenz gebilligt, vgl. Art. IV-437 EVV („Aufhebung der früheren Verträge“). Zwar wäre eine Verschmelzung der Rechtspersönlichkeiten auch ohne eine Vertragsfusion möglich gewesen (nämlich durch eine Klausel, wonach die Union an die Stelle der Europäischen Gemeinschaften tritt und deren Nachfolgerin ist, ohne dass der EG-Vertrag geändert worden wäre), doch gelangte die Gruppe zu dem Schluss, dass eine Fusion zu einer bedeutenden Vereinfachung der bisherigen Rechtslage führen würde. Die Zusammenfassung der Verträge sollte zudem die europäische Identität stärken und das europäische System für die Bürger verständlicher machen. Eine Zusammenführung eröffnete die Möglichkeit einer grundsätzlichen Neugestaltung des Systems der Verträge. Damit rückte die Schaffung eines grundlegenden Verfassungsvertrages ins Blickfeld. Schließlich empfahl die Gruppe, den neuen einheitlichen Vertrag in zwei Teile zu gliedern, nämlich in einen grundlegenden (ersten) Teil, der neue oder aus den derzeitigen Verträgen übernommene verfassungsrechtliche Bestimmungen enthalten sollte, und in einen zweiten Teil mit weiteren aus dem EG- und EU-Vertrag übernommenen Bestimmungen. Der schließlich verabschiedete Verfassungstext sieht eine Gliederung in vier Teile vor, wobei die Grundrechtscharta als Teil II und ein Teil IV (Allgemeine und Schlussbestimmungen) neben die beiden von der Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Teile gestellt wurden. Die vier Teile enthalten insgesamt 448 Artikel, hinzukommen zwei Anhänge sowie 36 Protokolle. Teil I enthält die grundsätzlichen Bestimmungen über die Union (Grundwerte, Zuständigkeiten, Entscheidungsverfahren, Handlungsinstrumente)56, Teil II enthält die auf der Tagung des Europäischen Rates von Nizza im Dezember 2000 verkündete (bisher rechtlich unverbindliche) Charta der Grundrechte. Teil III übernimmt im Wesentlichen die Bestimmungen des EG-Vertrages (Politikbereiche und Maßnahmen der EU), und in Teil IV sind schließlich die Allgemeinen und Schlussbestimmungen enthalten. Der Verfassungsvertrag enthält damit das gesamte Primärrecht der Union, ohne dass etwa Teil I wegen seines grundsätzlichen Charakters über Teil III stehen würde.57
Teil I bleibt jedoch (als einziger) ohne amtliche Überschrift. Vgl. den Festvortrag von Skouris anlässlich des 65. Deutschen Juristentags 2004, Pressemitteilung Nr. 8 / 2004, S. 7. 56 57
§ 8 Völkerrechtspersönlichkeit
195
III. Folgen der Anerkennung einer einheitlichen Rechtspersönlichkeit der Union für die Außenbeziehungen der Union 1. Schaffung einer Identität der Union auf internationaler Ebene – die Union als Völkerrechtssubjekt Die Anerkennung einer Rechtspersönlichkeit der Union löst das mit dem Vertrag von Maastricht entstandene und seither immer drängender gewordene Problem der Völkerrechtssubjektivität der Union im Sinne einer ausdrücklichen Klarstellung. Die Union wird zu einem eigenständigen „gekorenen“ Völkerrechtssubjekt und kann in dieser Eigenschaft alle Instrumente des internationalen Handelns nutzen.58 Die Union kann Europa damit offiziell in der Welt vertreten, völkerrechtliche Verträge unterzeichnen, vor (internationalen) Gerichten auftreten und internationalen Organisationen beitreten. Darüber hinaus hat die Europäische Union das Recht, Immunitäten zu genießen und das Gesandtschaftsrecht auszuüben. Damit einher geht die Schaffung einer Identität der Union auf internationaler Ebene. Die „Greifbarkeit“ der Union im Außenverhältnis ermöglicht eine größere Effizienz bei der Vertretung europäischer Interessen und gewährleistet Rechtssicherheit innerhalb und außerhalb Europas. Gleichzeitig stärkt sie das Profil der Union und trägt dazu bei, dass sich die europäischen Bürger leichter mit der Europäischen Union identifizieren können. Wie schon Art. 281 EG ist auch Art. I-7 EVV keine kompetenzbegründende Norm, sondern legt nur die Kompetenzträgerschaft der Union, also die Möglichkeit, Kompetenzen verliehen zu bekommen, fest. Die explizite Zuerkennung der Völkerrechtssubjektivität an die Union bindet lediglich die Mitgliedstaaten.59 Drittstaaten und internationale Organisationen sind daran nur gebunden, wenn sie die Völkerrechtssubjektivität der Europäischen Union anerkennen. Es ist davon auszugehen, dass diese Anerkennung explizit oder implizit (zum Beispiel durch die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen oder durch den Abschluss von völkerrechtlichen Verträgen) von der großen Mehrheit der Drittstaaten und internationalen Organisationen erfolgen wird. 2. Möglichkeit einer Vertragsfusion Die gewünschte Verschmelzung der Rechtspersönlichkeiten von Gemeinschaft und Union führt dazu, dass die Gemeinschaft keine eigene Rechtspersönlichkeit mehr besitzt. In dem Maße jedoch, wie die Gemeinschaft keine eigene Rechts58 Obwexer, in: Busek / Hummer (Hrsg.), Der Europäische Konvent und sein Ergebnis – eine Europäische Verfassung, S. 103 (113). 59 Obwexer, in: Busek / Hummer (Hrsg.), Der Europäische Konvent und sein Ergebnis – eine Europäische Verfassung, S. 103 (114).
13*
196
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
persönlichkeit mehr hat, verliert auch die Unterscheidung zwischen EU-Vertrag und EG-Vertrag ihre Berechtigung und führt lediglich zu unnötigen Komplikationen.60 Dies gilt umso mehr, als die bisherigen Unterschiede zwischen EU und EG, zum Beispiel in Verfahrensfragen und bei Mehrheitsregelungen, ebenso gut in Spezialvorschriften innerhalb ein- und desselben Vertrages eingebettet werden konnten. Wie oben bereits angesprochen, führten diese Gründe schließlich zu einer Vertragsfusion. Es wurde ein einheitlicher Verfassungsvertrag entworfen, der die Bestimmungen des EU- und EG-Vertrages zusammenfasste. Dort, wo Sonderregelungen für bestimmte Bereiche nötig wurden, sind sie in die Verfassung eingefügt worden (zum Beispiel Art. I-40 in Verbindung mit Art. III-294 ff. EVV). 3. Aufgabe des Drei-Säulen-Modells Eng mit der gerade genannten Vertragsfusion verknüpft ist die Aufgabe des Drei-Säulen-Modells. Weder die beabsichtigte Verschmelzung der Rechtspersönlichkeiten noch die Fusion der Verträge per se hätten zwar Auswirkungen auf die bisherige Säulenstruktur der Union gehabt, jedoch hätte die Säulenstruktur „anachronistisch“ (und aufgrund der Art. 1, 28, 41, 47 EU-Vertrag obsolet) gewirkt, da die in ihr zum Ausdruck kommenden institutionellen und verfahrenstechnischen Besonderheiten der beiden zwischenstaatlichen Säulen (GASP und Zusammenarbeit in Strafsachen), an denen festgehalten werden sollte, auch in anderer Weise im Verfassungsvertrag beibehalten werden konnten.61 Für die „Dachkonstruktion“ beziehungsweise „Tempelkonstruktion“ der Europäischen Union bestand demnach kein Bedarf mehr. Der Konvent entschied sich folgerichtig für die Aufgabe des Drei-Säulen-Modells.62 Gleichzeitig entwickelte er eine Lösung, die für bestimmte Politikbereiche Sonderregelungen vorsieht, welche aber in den Gesamtvertrag integriert werden konnten. Solche Bestimmungen finden sich zum Beispiel im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wieder (Art. I-40 in Verbindung mit Art. III-294 ff. EVV); auf diese wird später einzugehen sein. Hervorzuheben ist, dass die Auflösung der Säulenstruktur nicht zu einer Vereinheitlichung der Verfahren – oder anders ausgedrückt einer vollständigen Vergemeinschaftung – führt.63 4. Vereinfachung, Transparenz, Rechtssicherheit Die Zusammenfassung der Verträge bedeutet eine nicht zu unterschätzende Vereinfachung der Struktur der Europäischen Union. Das Recht der Europäischen 60 61 62 63
CONV 305 / 02, S. 4 (Rdnr. 14). CONV 305 / 02, S. 6 (Rdnr. 18). Cremona, CMLRev 2003, 1347 (1350) spricht von „maximum integration“. So auch WG VII – WD 39 S. 2 f. (Lamberto Dini).
§ 8 Völkerrechtspersönlichkeit
197
Union ist damit zukünftig grundsätzlich in einem einzigen Vertrag zu finden.64 Außerdem gehören Zuordnungsschwierigkeiten, welcher Akteur in concreto auf internationaler Ebene auftritt (die Europäische Union oder die Europäische Gemeinschaft), der Vergangenheit an. Dies bedeutet einen entscheidenden Schritt in Richtung Rechtssicherheit. Diese Rechtssicherheit bedeutet gleichzeitig einen Gewinn an Transparenz, sowohl für die Bürger als auch für die ausländischen Partner der Europäischen Union. Mit Inkrafttreten der Europäischen Verfassung wird einzig und allein die „Europäische Union“ das handelnde Subjekt sein. Ein Wermutstropfen verbleibt allerdings: Die nicht gelungene Integration des Euratomvertrages; dieser Vertrag wird in einem Protokoll lediglich geändert, besteht aber als eigenständiger Vertrag weiter fort.65 5. Implizierte Änderung der Kompetenzverteilung? Die ausdrückliche Anerkennung einer (einzigen) Rechtspersönlichkeit der Union hat per se keine Auswirkungen auf die Kompetenzverteilung.66 Besonders wichtig festzuhalten ist, dass weder die Aufteilung der Kompetenzen zwischen der derzeitigen Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten noch das Kompetenzsystem zwischen der Gemeinschaft und der Union durch die bloße Ausstattung der Union mit Völkerrechtspersönlichkeit geändert werden. Um die Kompetenzverteilung genau zu regeln, wurden spezielle Vorschriften in den Verfassungsvertrag aufgenommen (Art. I-11 ff. EVV), die an späterer Stelle untersucht werden. Insbesondere Teil III der Verfassung legt den Umfang und die Reichweite der Kompetenzen der Union fest. Teil II, welcher die Grundrechtscharta enthält, dehnt weder den Geltungsbereich des Unionsrechts aus, noch begründet er neue Zuständigkeiten oder Aufgaben der Union oder ändert die in anderen Teilen der Verfassung festgelegten Zuständigkeiten und Aufgaben (Art. II-111 EVV). Auch das inter-institutionelle Kompetenzverhältnis im Hinblick auf die Einleitung, die Aushandlung und den Abschluss völkerrechtlicher Abkommen wird 64 Vgl. zur Ausnahme des (in praktischer Hinsicht nicht überragend wichtigen) EuratomVertrages die folgenden Ausführungen. 65 Der Fortbestand des Euratom-Vertrages ist maßgeblich auf die Haltung der Bundesregierung zurückzuführen. Aufgrund der von Deutschland verfolgten Ausstiegspolitik war die Bundesregierung der Auffassung, der Euratom-Vertrag sei überholt und müsse grundlegend geändert werden. Daher sollte der Euratom-Vertrag nicht in seiner derzeit geltenden Form in die neue europäische Verfassung übernommen werden. Der Konvent war allerdings der Auffassung, dass er „weder den Auftrag noch die Zeit hat“, die Bestimmungen des Euratom-Vertrages zu prüfen und zu aktualisieren. Die Zukunft von Euratom sei daher eine Frage, mit der sich der Europäische Rat zu gegebener Zeit zu befassen habe, vgl. CONV 851 / 03, Bericht des Vorsitzes des Konvents an den Präsidenten des Europäischen Rates, S. 5 (Rdnr. 13). Durch die Beibehaltung einer „separierten“ EAG mit eigener Rechtspersönlichkeit wird der Austritt aus dem Euratomvertrag erleichtert, vgl. Hummer, in: Busek / Hummer (Hrsg.), Der Europäische Konvent und sein Ergebnis – eine Europäische Verfassung, S. 33 (39). 66 So auch Thym, ELJ 2004, 5 (7).
198
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
durch die ausdrückliche Anerkennung der Rechtspersönlichkeit der Union nicht verändert oder verschoben. Die Begründung einer einheitlichen Rechtspersönlichkeit bedeutet eine begrüßenswerte Klarstellung in Hinblick auf die künftige Kompetenzträgerschaft. Mit Ausnahme der unter den Euratom-Vertrag fallenden Bereiche kann künftig also einheitlich von „EU-Kompetenzen“ gesprochen werden.67 Die nach geltender Rechtslage übliche und notwendige Differenzierung zwischen EG-Kompetenzen und intergouvernementalen Handlungsfeldern (im Rahmen des EU-Vertrages, die so genannte zweite und dritte Säule) ist folglich nicht mehr nötig. 6. Ersatzlose Streichung des Art. 24 Abs. 5 EU Der Verfassungsvertrag hat vollständig darauf verzichtet, eine dem Art. 24 Abs. 5 EU entsprechende Regelung zu übernehmen. Als Vorschrift unter Titel V des EU-Vertrages gilt Art. 24 EU derzeit unmittelbar für Übereinkommen mit dritten Staaten im GASP-Bereich und – über die Verweisung in Art. 38 EU – auch für den Bereich polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen. Des besseren Verständnisses der folgenden Ausführungen wegen sei die Vorschrift hier wiedergegeben: Art. 24 Abs. 5 EU Ein Mitgliedstaat, dessen Vertreter im Rat erklärt, dass in seinem Land bestimmte verfassungsrechtliche Vorschriften eingehalten werden müssen, ist durch eine solche Übereinkunft nicht gebunden; die anderen Mitglieder des Rates können übereinkommen, dass die Übereinkunft dennoch vorläufig gilt.
Mit dieser derzeit geltenden Formulierung wären nach der beschlossenen Verschmelzung der Rechtspersönlichkeiten und der Fusionierung der Verträge zwei Probleme aufgetreten: Zum einen kann der Wortlaut des Art. 24 Abs. 5 EU so ausgelegt werden, dass ein Staat ein Verfahren zur Ratifizierung eines internationalen Übereinkommens durch sein Parlament (oder gegebenenfalls durch ein Referendum) einleiten kann, bevor dieses Abkommen für die Union verbindlich geworden ist. Dies ist gerechtfertigt für Abkommen, deren Gegenstand im Sinne eines klassischen gemischten Abkommens (zum Beispiel im Umweltbereich) teilweise in die ausschließliche Zuständigkeit der Union und teilweise in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. In diesem Fall müssen die Mitgliedstaaten nach ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften dem betreffenden Teil des Abkommens zustimmen. Fällt das Abkommen jedoch in die alleinige Zuständigkeit der Union, ist die Rechtslage anders. Wenn und sobald die Union eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, sind solche nationalen Ratifizierungsverfahren nicht mehr erforderlich68, da die Union die Abkommen (im eigenen Namen) selbst abschließt.69 67
Görlitz, DÖV 2004, 374 (376).
§ 8 Völkerrechtspersönlichkeit
199
Zum anderen birgt die jetzige Situation die Gefahr der Rechtsunsicherheit im Bereich der vorläufigen Geltung von Abkommen. Nach dem Wortlaut des Abs. 5 gilt ein Abkommen, bei dem ein Mitgliedstaat erklärt, er müsse zunächst ein innerstaatliches Referendum abhalten, und die anderen Mitgliedstaaten übereinkommen, dass das Abkommen dennoch gelten solle, nur vorläufig.70 Streng genommen würde daher, bei einem negativen Votum in einem Mitgliedstaat, die vorläufige Geltung enden, und das Abkommen wäre gescheitert. Dieser Fall ist in der Praxis zwar bisher noch nicht vorgekommen, ein solcher Mechanismus stünde jedoch im offensichtlichen Widerspruch zur Rechtspersönlichkeit der Union und könnte die Kohärenz der Außenpolitik der Union ernsthaft beeinträchtigen. 71 Die durch den Verfassungsvertrag vorgenommene Streichung der genannten Regelung löst die beiden oben angesprochenen Probleme. Gleichzeitig wird hiermit nicht, wie man auf den ersten Blick vielleicht vermuten könnte, die Bedeutung der nationalen verfassungsrechtlichen Verfahren geschmälert. Bei echten gemischten Abkommen ist wie bisher auch die Ratifizierung durch die nationalen Parlamente erforderlich. Für den GASP-Bereich wurde darüber hinaus der so genannte „Luxemburger Kompromiss“ von 1966 in die Verfassung übernommen. Im Bereich der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit besteht für die Mitgliedstaaten daher noch immer eine „Notbremse“; sie können durch solche Beschlüsse nicht gegen ihren Willen verpflichtet werden. Die aus Art. 23 Abs. 2 UAbs. 2 EU bekannte Formulierung findet sich nun mit kleineren Korrekturen am Wortlaut in Art. III-300 Abs. 2 EVV wieder. Jedes nationale Parlament hat zudem weiterhin das Recht, das Abstimmungsverhalten seiner Regierung im Rat politisch zu kontrollieren. Die beschriebene parlamentarische beziehungsweise mitgliedstaatliche Kontrolle von Ratsbeschlüssen muss jedoch geschehen, bevor der Rat den Abschluss des betreffenden völkerrechtlichen Abkommens beschlossen hat. Beide dargestellten Möglichkeiten, einen Ratsbeschluss zu verhindern, betreffen das interne Beschlussfassungsverfahren im Rat. Hat der Rat erst einmal den Abschluss des Abkommens beschlossen, so ist die Übereinkunft für die Union völkerrechtlich bindend. Die Mitgliedstaaten können diese Verpflichtung dann nicht mehr durch einseitiges Verhalten rückgängig machen. Schließlich ist zu erwähnen, dass die Möglichkeit der „konstruktiven Enthaltung“, die bisher in Art. 23 Abs. 1 EU zu finden war, nun an allgemeiner Stelle zur grundsätzlichen Regel wird. Dass eine Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern dem Zustandekommen von Ratsbeschlüssen, zu denen Einstimmigkeit erforderlich ist, nicht entgegensteht, wird nun für Beschlüsse des 68 Jedenfalls dann, wenn das Abkommen keine Bereiche betrifft, die in die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen. 69 CONV 305 / 02, S. 9 (Rdnr. 30); Thym, ELJ 2004, 5 (14). 70 s. oben, § 5 I. 5. c). 71 CONV 305 / 02, S. 10 (Rdnr. 32).
200
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Europäischen Rates in Art. III-341 Abs. 1 UAbs. 2 EVV und für Beschlüsse des Ministerrats in Art. III-343 Abs. 3 EVV allgemein geregelt.72
7. Folgen für die Außenvertretung der Union in internationalen Organisationen Die derzeit gültigen Verträge sehen eine unterschiedliche Vertretung der Union und der Gemeinschaft bei den verschiedenen internationalen Organisationen vor.73 Die Arbeitsgruppe III wies darauf hin, dass, sobald mehr als ein Vertreter bei internationalen Verhandlungen auftrete, ein effizientes Verhandeln der Union erschwert sei und ein solches Vorgehen auf Unverständnis oder sogar auf Widerstände seitens der Partner in den internationalen Beziehungen stoße. Daher forderte die Arbeitsgruppe, dass im Vertrag Mechanismen vorgesehen werden sollten, die es der Union ermöglichen, einen einheitlichen Standpunkt zu vertreten.74 Selbst in den Fällen, in denen es aufgrund der geteilten Zuständigkeit rechtlich geboten ist, dass neben den Vertretern der Union auch solche der Mitgliedstaaten an den Vertragsverhandlungen teilnehmen, solle es ermöglicht werden, dass nur eine einzige Delegation die Verhandlungen führt. Die durch Art. I-7 EVV erfolgte Verleihung einer Völkerrechtspersönlichkeit für die Europäische Union bewirkt jedoch per se nicht, dass die von der Arbeitsgruppe erwünschten Ergebnisse erzielt werden. Hierfür bedarf es weiterer Handlungsmechanismen und institutioneller Änderungen. Inwiefern zum Beispiel die Schaffung des Amtes eines Europäischen Außenministers zur Erreichung der oben genannten Ziele beiträgt, wird in einem speziellen Kapitel untersucht. Im Verfassungsvertrag werden die Beziehungen der Union zu internationalen Organisationen in Art. III-327 EVV zusammengefasst.
72 Im Konventsentwurf war trotz einer solchen allgemeinen Regelung (Art. III-244 Abs. 1 UAbs. 2 und Art. III-246 Abs. 3 KE-EVV) überflüssigerweise die Regelung nochmals in Art. III-201 Abs. 1 KE-EVV wiederholt worden. Schon im EG-Vertrag besteht die Möglichkeit der konstruktiven Enthaltung nach Art. 205 Abs. 3 EG für Ratsbeschlüsse; im EU-Vertrag findet sich eine solche Regelung in Art. 7 Abs. 5 S. 2 EU (Verfahren gegen einen Mitgliedstaat) und – wie erwähnt – in Art. 23 Abs. 1 EU (GASP-Beschlüsse). 73 Nach Art. 18 I EU vertritt „der Vorsitz die Union in Angelegenheiten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“. Nach Art. 19 I EU „koordinieren die Mitgliedstaaten ihr Handeln in internationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen. Sie treten dort für die gemeinsamen Standpunkte ein“. Nach Art. 302 EG „unterhält die Kommission alle zweckdienlichen Beziehungen zu den Organen der Vereinten Nationen und ihrer Fachorganisationen. Sie unterhält ferner, soweit zweckdienlich, Beziehungen zu allen internationalen Organisationen.“ 74 CONV 305 / 02, S. 11, (Rdnr. 37).
§ 8 Völkerrechtspersönlichkeit
201
8. Erstreckung der Kontrolle des Europäischen Gerichtshofs auf Abkommen nach den derzeitigen Titeln V und VI des EU-Vertrages nicht umgesetzt Für völkerrechtliche Abkommen, die nicht die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betreffen, bleibt es bei der Möglichkeit der präventiven Kontrolle durch den Gerichtshof in Form eines Gutachtens, Art. III-325 Abs. 11 EVV (derzeit Art. 300 Abs. 6 EG). Darüber hinaus besteht – wie bisher – nachträglicher Rechtsschutz in Form der Nichtigkeitsklage (Art. III-365 EVV, derzeit Art. 230 EG)75 und in Form des Vorabentscheidungsverfahrens gemäß Art. III-369 EVV (derzeit Art. 234 EG). Die Arbeitsgruppe „Rechtspersönlichkeit“ empfahl im Zuge der Einführung einer Rechtspersönlichkeit der EU und der Inkorporation der GASP in einen einzigen Verfassungsvertrag, die Rechtsprechungsgewalt des EuGH auf die bisherige Zweite und Dritte Säule der Union, also auf die GASP und die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen auszuweiten.76 Hierbei sollte in der Verfassung sowohl ein Verfahren ex ante (nach dem bisherigen Muster des Konsultationsverfahrens nach Art. 300 Abs. 6 EG) als auch ein Verfahren ex post für Vorabentscheidungen (Art. 234 EG), Nichtigkeitsklagen (Art. 230 EG) und Schadensersatzklagen (Art. 235, 288 II EG) vorgesehen werden.77 Begründet wurde dies mit dem Argument, dass bereits nach derzeitiger Rechtslage in Art. 6 EU vorgesehen ist, dass die Union auf den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit beruht und dass sie die Grundrechte als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts achtet.78 Diese Empfehlung der Arbeitsgruppe wurde indes nicht umgesetzt.79 Art. III-376 UAbs. 1 EVV sieht ausdrücklich vor, dass der Gerichtshof nicht zuständig ist in Bezug auf Art. I-40 und I-41 EVV, also die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Außerdem ist das gesamte Kapitel II des Titels V in Teil III (Art. III-294 bis III-313 EVV) von der Gerichtsbarkeit des EuGH ausgenommen. Beschlüsse des Europäischen Rates zur Festlegung von strategischen Interessen und Zielen der Union fallen ebenfalls nicht unter die Rechtsprechungsgewalt des EuGH, soweit sie die GASP betreffen.80 Diese weitreichenden Einschränkungen stehen in gewissem 75 Gegenstand der Nichtigkeitsklage kann hierbei nicht das Abkommen selbst sein, sondern lediglich der Rechtsakt, mit dem das betreffende Organ das Abkommen geschlossen hat, vgl. EuGH, Slg. 1984, I-3641, Rdnr. 14, 15 – Frankreich . / . Kommission. 76 CONV 305 / 02, S. 13, (Rdnr. 44); siehe auch WG VII – WD 32, S. 11 (Teija Tiilikainen). 77 CONV 305 / 02, S. 13, (Rdnr. 44). 78 CONV 305 / 02, S. 12, (Rdnr. 40). 79 Bedauernd insoweit Cremona, CMLRev. 2004, 553 (571); ebenso Krajewski, YEL 2003, 435 (452 f.), der allerdings auf die Problematik von politischen Entscheidungen hinweist, die einer gerichtlichen Kontrolle nicht zugänglich sind.
202
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Widerspruch zu der Bestimmung des Art. I-29 Abs. 1 EVV, wonach der Gerichtshof die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verfassung sichert. Diese Vorschrift sieht nämlich keine Einschränkungen hinsichtlich des GASP-Bereichs vor, was umso bedeutender ist, als sich damit aus Teil I der Verfassung keine Kompetenzbeschränkungen für den EuGH ergeben. Bei dieser Feststellung ist jedoch zu beachten, dass Art. I-29 Abs. 3 EVV bezüglich des Umfangs der Kompetenzen des Gerichtshofs ausdrücklich auf Teil III der Verfassung verweist. Allerdings räumt der Verfassungsvertrag mit der Bestimmung des Art. III-376 UAbs. 2 in Verbindung mit Art. III-308 EVV dem EuGH eine Rechtsprechungskompetenz für die Abgrenzung der Zuständigkeiten nach Art. I-13 bis I-15 und Art. I-17 EVV einerseits und Art. I-16 EVV andererseits ein.81 Der EuGH soll demnach darüber wachen, dass die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik nach Art. I-16 EVV unberührt bleibt von der Durchführung der Politik, die unter die ausschließliche (Art. I-13 EVV) oder geteilte (Art. I-14 EVV) Zuständigkeit der Gemeinschaft fällt, die Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik (Art. I-15 EVV) oder Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen (Art. I-17 EVV) betrifft. Umgekehrt darf die Durchführung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik nach Art. I-16 EVV die Zuständigkeiten nach den genannten Artikeln nicht beeinträchtigen. Damit ist die Regelung des Verfassungsvertrags genauer als diejenige des Konventsentwurfs. Nach der jetzigen Regelung darf die Durchführung der GASP die Anwendung der Verfahren und den jeweiligen Umfang der Befugnisse der Organe nach den Art. I-13 bis I-15 und Art. I-17 EVV nicht beeinträchtigen. 82 Der EuGH wird damit ausdrücklich zum Wächter über die gesamte Zuständigkeitsverteilung innerhalb der Union. Erschwert wird die Aufgabe des Gerichtshofs dadurch, dass der Verfassungsvertrag selbst keine Einordnung der GASP in eine bestimmte Kompetenzkategorie vorgenommen hat. Aus Art. III-308 EVV lässt sich erkennen, dass weiterhin Unterschiede zwischen den nach altem Recht vergemeinschafteten Politiken und denjenigen aus dem EUVertrag fortbestehen sollen. Bewerkstelligt wird das durch die Festlegung unterschiedlicher Verfahrensvorschriften. Diese Trennung zwischen den ehemaligen Säulen soll vom EuGH kontrolliert werden. In Art. 47 EU ist derzeit vorgesehen, dass die Bestimmungen des EU-Vertrages den EG-Vertrag „unberührt“83 lässt. Der 80 Diese letztgenannte Einschränkung war im Konventsentwurf noch nicht enthalten, vgl. Art. III-282 KE-EVV. Damit reagierte die Regierungskonferenz auf Kritik aus dem Schrifttum, vgl. Cremona, CMLRev. 2004, 553 (571 f.). 81 Auch hiermit wird auf die teilweise geäußerte Kritik reagiert, aufgrund der Auslassung des Hinweises auf Art. I-16 EVV sei der Umfang der Ausnahme unklar, vgl. Cremona, CMLRev. 2004, 553 (571 f.). 82 Im Konventsentwurf war die beschriebene Kompetenz des EuGH noch in Art. III-209 UAbs. 2 KE-EVV geregelt. Es ist begrüßenswert, dass der Verfassungsvertrag die Kompetenzen des EuGH jetzt in dem dafür vorgesehenen Abschnitt umfassend regelt. 83 Die gleiche Wortwahl wird auch in Art. III-308 EVV getroffen.
§ 8 Völkerrechtspersönlichkeit
203
Verfassungsvertrag stellt klar, dass diese Unberührtheitsgarantie künftig wechselseitig gilt. Demnach lässt auch die Durchführung der Politik nach Art. I-13 bis I-15 und Art. I-17 EVV diejenige nach Art. I-16 EVV unberührt. Freilich ist eine solche Bestimmung streng genommen überflüssig, denn immer wenn die Union über ihre Zuständigkeit nach Art. I-13 bis I-15 und Art. I-17 EVV hinausgeht oder ein falsches Verfahren für den Erlass eines Rechtsakts wählt, ist der Gerichtshof bereits nach Art. III-365 EVV für die Kontrolle der Rechtmäßigkeit zuständig. Mit Art. III-376 UAbs. 2 EVV wird im Vergleich zur jetzigen Rechtslage keine materielle Rechtsänderung herbeigeführt, sondern lediglich klargestellt, dass die beiden Politikstränge – einerseits nach Art. I-13 bis I-15 und Art. I-17 EVV und andererseits nach Art. I-16 EVV – sich wechselseitig unberührt lassen. Der Verfassungsvertrag will unmissverständlich Befürchtungen begegnen, die ESVP könne aufgrund der Wahl einer falschen Rechtsgrundlage „vergemeinschaftet“ werden, beziehungsweise die gemeinschaftlichen Aufgaben könnten umgekehrt „re-intergouvernementalisiert“ werden.84 Nach den bisherigen Bestimmungen sichert der Gerichtshof gemäß Art. 136 EA und Art. 220 EG85 die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge. Gemäß Art. 47 EU berührt der EU-Vertrag diese Bestimmungen nicht. Auch wenn der Gerichtshof nicht für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zuständig ist86, so bleibt er doch zur Wahrung des Gemeinschaftsrechts im umfassenden Sinne zuständig. Daher kann der Gerichtshof in Fällen entscheiden, die eine Beeinträchtigung des Gemeinschaftsrechts befürchten lassen.87 Verlangen Maßnahmen aus dem GASP-Bereich eine Umsetzung durch Gemeinschaftsrechtsakte, befindet man sich im Bereich der klassischen Rechtskontrolle durch den Gerichtshof. Dieser prüft, ob der Gemeinschaftsrechtsakt mit höherrangigem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist. Das kann mit Hilfe der Nichtigkeitsklage oder mit Hilfe des Vorabentscheidungsverfahrens geschehen. Somit wird lediglich der Gemeinschaftsrechtsakt überprüft. Unwesentlich hierbei ist, dass dieser seine „Wurzeln“ im zwischenstaatlichen Bereich, also der GASP, hatte. Ebenso verhält es sich im Fall (mitglied-) staatlicher Rechtsakte, die ihren Ursprung im GASP-Bereich haben und der Umsetzung von GASP-Beschlüssen dienen. In diesem Fall kann der EuGH die Vereinbarkeit staatlichen Rechts mit Gemeinschaftsrecht prüfen, da wiederum lediglich der nationale Rechtsakt überprüft wird. Damit gibt es keinen Rechtsakt, der angesichts seiner Entstehungsgeschichte im zwischenstaatlichen Bereich „gerichtsimmun“ wäre.88 Folglich musste bisher die Kontrolle von GASP-Beschlüssen auf Gemeinschaftsrechtskonformität den Umweg über die – gemeinschaftsrechtlichen oder mitgliedstaatlichen – Umsetzungsrechtsakte nehmen. CONV 727 / 03, S. 52. Früher auch Art. 31 KS. 86 Art. 46 EU sieht die Erstreckung der Zuständigkeit des EuGH auf Titel V des EU-Vertrages (GASP) gerade nicht vor. 87 Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 11 – 28 EUV, Rdnr. 89. 88 Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 11 – 28 EUV, Rdnr. 90. 84 85
204
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Mit der Einführung des Art. III-376 UAbs. 2 in Verbindung mit Art. III-308 EVV hat sich an dieser mittelbaren gerichtlichen Kontrolle nichts geändert. Eine direkte Kontrolle von GASP-Rechtsakten durch den EuGH würde gegen Art. III-376 UAbs. 1 EVV verstoßen. Abschließend ist demnach festzuhalten, dass der Europäische Gerichtshof gemäß Art. III-376 UAbs. 2 in Verbindung mit Art. III-308 EVV – wechselseitig – für Kompetenzverletzungsstreitigkeiten (einerseits Art. I-13 bis I-15 und I-17 EVV sowie andererseits Art. I-16 EVV) zuständig ist. Eine Neuerung und gleichzeitig die einzige Erweiterung der Kompetenzen des EuGH im GASP-Bereich sieht Art. III-376 UAbs. 2 Var. 2 EVV vor. Hiernach erstreckt sich die Überwachungskompetenz des EuGH auch auf die Rechtmäßigkeit Europäischer Beschlüsse über restriktive Maßnahmen gegenüber natürlichen oder juristischen Personen, die der Rat auf der Grundlage von Titel V Kapitel II (Art. III-294 bis III-313 EVV)89 erlassen hat. Wenn eine GASP-Maßnahme eine natürliche oder juristische Person direkt und unmittelbar betrifft, kann diese die betreffende Maßnahme vor dem EuGH anfechten. Eine ähnliche Bestimmung ist in den bisherigen Verträgen nicht zu finden. Damit war eine Rechtsschutzlücke in den Fällen entstanden, in denen eine Umsetzung von GASP-Rechtsakten mittels EG-Rechtsakten nicht erforderlich war, weil sie direkt wirkten.90 Dieser (einzige) Fall einer direkten Überprüfung einer GASPMaßnahme durch den Gerichtshof korrespondiert mit Art. II-107 EVV, welcher jeder Person, die in ihren durch das Recht der Europäischen Union garantierten Rechten verletzt worden ist, ein Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf gewährt. Mit der Aufnahme dieser Bestimmung entsprechen der Konvent und der Verfassungsgeber dem Wunsch der Arbeitsgruppe „Rechtspersönlichkeit“ nach individuellem Rechtsschutz, da eine Häufung individuell belastender Rechtsakte festgestellt worden war.91 Nach Art. III-376 UAbs. 2 Var. 2 in Verbindung mit Art. III-365 Abs. 4 EVV können natürliche oder juristische Personen eine Nichtigkeitsklage gegen restrikti89 Im Konventsentwurf wurde in Art. III-282 UAbs. 2 KE-EVV lediglich auf Art. III-193 KE-EVV verwiesen; dieser Verweis erscheint jedoch unrichtig, da Art. III-193 KE-EVV allein keine Kompetenzvorschrift darstellt und keine Liste der zulässigen Handlungsformen enthält. 90 In dem Moment, in dem die Gemeinschaft (nach Art. 301 EG) tätig geworden wäre, hätte ein Gemeinschaftsrechtsakt vorgelegen, und der Weg einer Individualklage von natürlichen oder juristischen Personen nach den Voraussetzungen des Art. 230 UAbs. 4 EG hätte offen gestanden. 91 CONV 305 / 02, S. 13, (Rdnr. 43). Die Gruppe führte als Beispiel für Rechtsakte, die die Rechte des Einzelnen unmittelbar oder mittelbar berühren, an (Fn. 17): Fall eines Offiziers, der die Haftung der Union für in Bosnien-Herzegowina erlittene körperliche Verletzungen geltend machte; Fall eines Unternehmens, das die außervertragliche Haftung der Union für aufgrund von Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien erlittene Schäden geltend machte; Fall jugoslawischer Staatsangehöriger, die die Haftung der Union für erlittene Schäden aufgrund des auf der Grundlage einer Gemeinsamen Aktion des Rates erlassenen Verbots einer Visaerteilung geltend machten.
§ 8 Völkerrechtspersönlichkeit
205
ve Maßnahmen einreichen, die ihre Grundlage in GASP-Beschlüssen haben, soweit diese sie unmittelbar betreffen und keine Durchführungsmaßnahmen nach sich ziehen. Der Kontrollumfang erstreckt sich auf die Prüfung der Zuständigkeit, der Verletzung wesentlicher Formvorschriften, der Verletzung der Verfassung oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm und auf die Prüfung von Ermessensfehlern. Es muss sich bei den genannten Europäischen Beschlüssen im GASP-Bereich um Maßnahmen mit restriktivem Charakter handeln. Restriktiven Maßnahmen ist in Titel V (Auswärtiges Handeln der Union) ein eigenes Kapitel gewidmet (Kapitel V, Art. III-322 EVV). Grundsätzlich kann ein nach den Bestimmungen über die GASP erlassener Europäischer Beschluss die Aussetzung, Einschränkung oder vollständige Einstellung der Wirtschafts- und Finanzbeziehungen zu einem Drittland oder zu mehreren Drittländern vorsehen. Gemäß Art. III-322 in Verbindung mit Art. III-294 ff. EVV können auch spezielle restriktive Maßnahmen gegen natürliche oder juristische Personen sowie Gruppierungen oder nichtstaatliche Einheiten erlassen werden. Trifft die Union restriktive Maßnahmen entweder gegen Drittstaaten oder gegen natürliche oder juristische Personen, so müssen in diesen Rechtsakten jeweils Bestimmungen über den (individuellen) Rechtsschutz vorgesehen sein (Art. III-322 Abs. 3 EVV). Vorstellbar ist beispielsweise, dass eine Aktion der Union gemäß Art. III-294 Abs. 3 lit. b i) EVV in Verbindung mit Art. III-297 EVV einen Handelsboykott vorsieht und dass ein Unternehmen, welches in seinem Geschäftsbereich betroffen ist und die jeweiligen Güter in das betreffende Land nicht mehr im- oder exportieren kann, eine Klage gegen die betreffende, auf der Grundlage von Art. III-322 EVV erlassene Maßnahme vor dem EuGH einreicht. Wie oben festgestellt, ist eine solche Klage nach geltendem Recht dann nicht möglich, wenn sie sich direkt gegen die GASP-Maßnahme richtet. Der Verfassungsvertrag sieht nun eine Erweiterung der EuGH-Kompetenzen und eine Verbesserung der Rechtsschutzmöglichkeiten für natürliche und juristische Personen vor.
9. Rechtliche Kontinuität und interne Rechtspersönlichkeit, Art. IV-438 EVV a) Rechtsnachfolge gegenüber der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft Durch Art. I-7 EVV („Die Union besitzt Rechtspersönlichkeit“) allein wird nicht hinreichend deutlich, dass die Rechtspersönlichkeit der Union die derzeitige Rechtspersönlichkeit der bestehenden Gemeinschaft ersetzt. Die neu geschaffene Europäische Union muss jedoch uneingeschränkt alle Verpflichtungen, die die bisherigen Organisationen eingegangen sind, übernehmen. Daher sieht Art. IV-438 Abs. 1 EVV ausdrücklich vor, dass die durch den Verfassungsvertrag geschaffene
206
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Europäische Union die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft und der bisherigen Europäischen Union antritt.92 In Bezug auf völkerrechtliche Übereinkommen war der Konventsentwurf indes genauer, denn er bestimmte, dass die neu geschaffene Union die Rechtsnachfolge der jetzigen EU und EG „in allen ihren internen und aus internationalen Übereinkommen erwachsenden Rechten und Pflichten, die sich vor Inkrafttreten des Vertrags über die Verfassung aus früheren Verträgen, Protokollen und Rechtsakten ergeben haben [antritt]“.93 Der endgültige Wortlaut des Verfassungsvertrags nimmt nicht mehr explizit auf internationale Übereinkommen Bezug.94 Man könnte jedoch internationale Verträge unter „Rechtsakte der Organe“ der früheren Union oder Gemeinschaft subsumieren, wodurch nach Art. IV-438 Abs. 3 EVV eine Fortgeltung der bisherigen Verträge erreicht werden würde. Damit ist von einem vollständigen Eintritt in die externen Rechte und Pflichten auszugehen. Der Verfassungsvertrag beschäftigt sich nunmehr vor allem mit der Übernahme innergemeinschaftlicher Regelungen und Vereinbarungen, insbesondere mit der Übernahme des Besitzstandes der Gemeinschaft und der Union (acquis) und der Fortgeltung von interinstitutionellen Vereinbarungen und anderen Beschlüssen, Entschlüssen oder Stellungnahmen, die bisher getroffen worden sind. Sie sollen so lange weiter gelten, bis sie aufgehoben oder geändert werden. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs soll ebenfalls fortgelten (Art. IV-438 Abs. 4 EVV). Im Vergleich zum Konventsentwurf ist diesbezüglich die jetzige Regelung weitaus genauer, denn es wird zum einen auch die Rechtsprechung des Gerichtshofs erster Instanz erwähnt, zum anderen wird nicht mehr lediglich bestimmt, dass die Rechtsprechung weiterhin maßgeblich ist, sondern geregelt, dass die Rechtsprechung „sinngemäß“ maßgeblich bleibt für die verbindliche Auslegung, „insbesondere vergleichbarer Bestimmungen der Verfassung“. Mit Art. IV-438 EVV wird deutlich, dass die Europäische Union in Form einer Universalsukzession in den gesamten Besitzstand der beiden untergegangenen „Alt-Organisationen“ eintritt.95 Gleichzeitig bestimmt Art. IV-437 Abs. 1 EVV, dass am Tag des Inkrafttretens des Vertrages über die Verfassung für Europa der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und der Vertrag über die Europäische Union aufgehoben werden.96 Allerdings bleiben die Bestimmungen in den Protokollen betreffend Vgl. auch CONV 677 / 03, S. 10. Vgl. Art. IV-3 UAbs. 1 KE-EVV. Auch die Arbeitsgruppe Außenbeziehungen empfahl, es müsse festgestellt werden, dass die Europäische Union in alle internationalen Verpflichtungen der Union und der EG eintreten müsse, CONV 305 / 02, S. 14 Rdnr. 46. 94 Vorhanden ist lediglich ein Hinweis darauf, dass Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten, welche auf Grundlage der bisherigen Verträge abgeschlossen wurden, weiterhin Rechtswirkung behalten (Art. IV-438 Abs. 3 EVV). 95 Hummer, in: Busek / Hummer (Hrsg.), Der Europäische Konvent und sein Ergebnis – eine Europäische Verfassung, S. 33 (40). 92 93
§ 8 Völkerrechtspersönlichkeit
207
die Beitrittsverträge zur ursprünglichen Gemeinschaft der Sechs weiterhin in Kraft. Der Euratomvertrag dagegen wird durch das „Protokoll zur Änderung des Euratom-Vertrages“97 lediglich modifiziert. Größtenteils werden dabei die Verweisungen auf das Gemeinschaftsrecht an die neue Rechtslage nach dem Verfassungsentwurf angepasst; materielle Änderungen sind demgegenüber nicht vorgesehen.98
b) Interne Rechtspersönlichkeit Art. III-426 EVV regelt die innerstaatliche Rechtsfähigkeit der Europäischen Union. Hiernach besitzt die Union in jedem Mitgliedstaat die weitest gehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt ist. Insbesondere kann sie bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern sowie vor Gericht stehen. Zu diesem Zweck wird sie von der Kommission vertreten. Die Regelung des Art. III-426 EVV entspricht bis auf wenige grammatikalische Verbesserungen derjenigen des Konventsentwurfs.99 Abgesehen von ihrem letzten Halbsatz ist sie mit der Bestimmung des Art. 282 EG für die jetzige Europäische Gemeinschaft identisch. Die innerstaatliche Rechtsfähigkeit der Europäischen Union besagt jedoch noch nichts über die Rechtsfähigkeit der einzelnen Organe der Union. Diesen muss jeweils in gesonderten Bestimmungen die Rechtsfähigkeit zuerkannt werden. Entgegen dem Vorschlag der Arbeitsgruppe III100 wurde nicht allen Organen der Union Rechtsfähigkeit zuerkannt. So verleiht lediglich Art. I-30 Abs. 3 EVV der Europäischen Zentralbank (derzeit Art. 107 II EG) und Art. III-393 UAbs. 1 EVV der Europäischen Investitionsbank (derzeit Art. 266 UAbs. 1 EG) Rechtspersönlichkeit.101 Alle anderen Organe der Europäischen Union verfügen mangels einer ausdrücklichen Regelung nicht über eine eigene Rechtspersönlichkeit. 96 Auch diese Regelung ist im Verfassungsvertrag weitaus umfangreicher als die sinngemäße Bestimmung des Konventsentwurfs (Art. IV-2 KE-EVV). 97 Die Protokolle sind gemäß Art. IV-442 EVV Bestandteil des Vertrags. Dem Verfassungsvertrag angefügt sind über das genannte Protokoll hinaus weitere 35 Protokolle, unter anderem das „Protokoll über die Rolle der Nationalen Parlamente in der Europäischen Union“, das „Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ und das „Protokoll betreffend die EURO-Gruppe“. 98 Vgl. bereits oben, Fn. 65. 99 Vgl. hierzu Art. III-332 KE-EVV. 100 CONV 305 / 02, S. 14 (Rdnr. 46). 101 Der offensichtliche Fehler im Konventsentwurf, der Europäischen Zentralbank gleich zweimal Rechtspersönlichkeit einzuräumen (Art. I-29 Abs. 3 KE-EVV einerseits und ArtIII-79 Abs. 2 KE-EVV andererseits), wurde durch den Verfassungsvertrag beseitigt.
208
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
IV. Bewertung der Lösung Wie gerade dargestellt, hat die durch den Verfassungsvertrag der Europäischen Union verliehene eigenständige Rechtspersönlichkeit weitreichende und wichtige Konsequenzen. Die Europäische Union bleibt jedoch weiterhin eine supranationale Integrationsgemeinschaft eigener Art.102 Sie wird insbesondere nicht zu einem Bundesstaat.103 Aufgrund der Beibehaltung der verschiedenen Institutionen besteht weiterhin eine gegenseitige Verschränkung der Macht. Die Europäische Union kann als „Bürger- und Staatenunion“ bezeichnet werden, da sie zum einen auf den Bürgern, zum anderen auf den Staaten beruht.104 Durch die Wahlen zum Europäischen Parlament verfügen die europäischen Bürger über eine unmittelbare demokratische Kontrolle. Andererseits sind die Bürger einem unmittelbaren demokratischen Herrschaftsverhältnis unterworfen, welches sich beispielsweise im Erlass unmittelbar anwendbarer Europäischer Gesetze (Art. I-34 EVV) äußert. Die Europäische Union bleibt eine Staatenunion, denn die souveräne Existenz der Nationalstaaten besteht unangetastet fort (vgl. Art. I-5 Abs. 1 EVV). Zwar wird die staatliche Souveränität partiell auf eine höhere Ebene übertragen, doch die einen eigenständigen Staat auszeichnende Kompetenz-Kompetenz steht der Europäischen Union auch nach Inkrafttreten der Europäischen Verfassung nicht zu. Vielmehr bleibt das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Art. I-11 Abs. 1 EVV) weiterhin der tragende Grundsatz des Europarechts. Die Schaffung einer einheitlichen Rechtspersönlichkeit für die künftige Europäische Union in Verbindung mit der Einigung auf eine gemeinsame Verfassung verdeutlicht, dass die Union eine Rechts- und Wertegemeinschaft ist, die auf einer umfassenden Werteordnung und einem ausformulierten Wertekatalog basiert. Eine Zielbestimmung in dem Sinne, welchen Endzustand die Europäische Union einmal erreichen sollte, wurde in der Verfassung nicht vorgenommen.105 Die Frage der Finalität wurde bewusst nicht abschließend entschieden, sodass die Entwicklung der Europäischen Union auch weiterhin ein Prozess bleibt. Inwieweit dieser Prozess künftig von einer immer weiter voranschreitenden Integration geprägt sein wird, wird in erster Linie von der Integrationsbereitschaft der europäischen Bürger abhängen.106 102 Oppermann, DVBl. 2003, 1165 (1168) spricht von einem „intensiven Staatenverbund besonderer Art“. 103 Der Zusatz „in föderaler Weise“, wie er von einigen Mitgliedern des Verfassungskonvents im Rahmen des Art. I-1 KE-EVV vorgeschlagen worden war, wurde früh abgelehnt. Insbesondere die mittelosteuropäischen (Beitritts-)Länder befürchteten imperiale Machtbestrebungen, welche sie aufgrund ihrer leidvollen Erfahrungen mit der UdSSR unbedingt verhindern wollten. Ihre in den 90er Jahren gerade erst zurückgewonnene nationalstaatliche Souveränität wollten diese Staaten nicht gleich wieder aufgeben; vgl. Plenartagung vom 27. 02. 2003, CONV 601 / 03, S. 2. 104 Vgl. auch Art. I-1 Abs. 1 S. 1 EVV. 105 Bezüglich der Geltungsdauer wird jedoch festgehalten, dass der Verfassungsvertrag auf unbegrenzte Zeit gilt (Art. IV-446 EVV).
§ 9 Die Zuständigkeiten der Union
209
Die Verleihung einer einzigen Rechtspersönlichkeit der Europäischen Union schafft vor allem Rechtssicherheit. Der lange schwelende Streit über die Rechtspersönlichkeit der (alten) Europäischen Union ist somit eindeutig gelöst. Gleichzeitig werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Union auf internationaler Ebene als eigenständiger Akteur auftreten kann. Die Europäische Union kann in Zukunft völkerrechtliche Verpflichtungen durch Vertrag oder einseitiges Rechtsgeschäft107 übernehmen. Mit der Möglichkeit des Eintritts in internationale Organisationen und vor allem mit dem Abschluss völkerrechtlicher Verträge können europäische Interessen auf internationaler Ebene effizienter und transparenter vertreten werden. Das durch den Zusammenschluss der beiden Hauptverträge gewonnene deutlichere Profil der Union trägt dazu bei, dass sich die Bürger leichter mit der Union identifizieren können. Bedauerlich ist zwar, dass der Euratomvertrag nicht in die Fusion der Verträge einbezogen wurde, jedoch muss man bei dieser Bewertung dessen kleinen Anwendungsbereich in Betracht ziehen. Die Eigenständigkeit des Euratomvertrages neben der zukünftigen Verfassung ist daher nicht geeignet, die gewonnene Transparenz und Rechtssicherheit ernsthaft zu beeinträchtigen. Insgesamt sind die Rechtspersönlichkeit und die Verschmelzung der Verträge zu begrüßen. Welche Änderungen oder Anpassungen dadurch für die Kompetenzverteilung notwendig werden, wird im Folgenden untersucht.
§ 9 Die Zuständigkeiten der Union (Art. I-11 bis Art. I-18 EVV), Kompetenzsystem Mit dem Kompetenzverteilungssystem im neuen Verfassungsvertrag beschäftigte sich vor allem die Arbeitsgruppe V „Ergänzende Zuständigkeit“. Anders als der Name vermuten lässt, wurden in dieser Gruppe alle Fragen zur Zuständigkeit erörtert, nicht nur solche betreffend die ergänzenden Zuständigkeiten. Die Gruppe empfahl zunächst, in den künftigen Vertrag einen gesonderten Titel „Zuständigkeit“ aufzunehmen, in dem sämtliche Fragen der Zuständigkeit geregelt werden sollten.108 Im Interesse von Transparenz und Klarheit sollten in dem künftigen Vertrag die Unionszuständigkeiten in drei Kategorien eingeteilt werden. Unter demselben Gesichtspunkt sollte die Art der Zuständigkeit für jeden Handlungsbereich in kurzer, knapper und leicht verständlicher Weise abgegrenzt werden. Eine detaillier106 Gemäß der Präambel des Verfassungsvertrags sollen die Völker Europas „immer enger vereint ihr Schicksal gemeinsam [ . . . ] gestalten.“ 107 Abhängige einseitige Rechtsgeschäfte sind: Angebot und Annahme, Vorbehalt, Beitritt, Kündigung, Vertragsbeendigung, Suspendierung, Unterwerfungserklärung; selbstständige einseitige Rechtsgeschäfte sind: Anerkennung, Protest, Verzicht, Versprechen, vgl. Schweitzer, Staatsrecht III, S. 94 ff. 108 CONV 375 / 1 / 02 REV 1, S. 2.
14 Metz
210
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
te Regelung der gesamten Unionszuständigkeit wäre dagegen, nach den Vorstellungen der Arbeitsgruppe V, zu Lasten der Klarheit und Transparenz gegangen. Da es das oberste Anliegen war, den Bürgern die Kompetenzverteilung in kurzer, knapper und verständlicher Form zu vermitteln, sollte in diesem Sinne eine grundlegende Abgrenzung der Zuständigkeit erfolgen. Diesen Wünschen folgte der Konvent und fügte mit Titel III „Die Zuständigkeiten der Union“ (Art. I-11 bis Art. I-18 EVV) in Teil I der Verfassung einen eigenen Titel über die Zuständigkeit in den Verfassungsentwurf ein. Hinsichtlich der Arten von Zuständigkeiten einigte man sich auf ausschließliche (Art. I-13 EVV) und geteilte (Art. I-14 EVV) Zuständigkeiten, sowie auf Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen (Art. I-17 EVV). Zusätzlich wurden Kompetenzbestimmungen im Bereich der Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten (Art. I-15 EVV), der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Art. I-16 EVV) und der schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik (ebenfalls Art. I-16 EVV) eingefügt. Detaillierte Bestimmungen hinsichtlich des Umfangs der Zuständigkeiten und den Einzelheiten bei ihrer Ausübung enthält gemäß Art. I-12 Abs. 6 EVV Teil III der Verfassung. Um zu erfahren, welche Kompetenzen der Union tatsächlich zustehen, muss also in den 321 Artikeln des Teils III der Verfassung nachgeschlagen werden. Man kann daher der Auffassung sein, dass das Ziel der Vereinfachung und Transparenz nur unzureichend erfüllt wurde. Andererseits spiegelt die akribische Auflistung und Umschreibung der Zuständigkeiten der Union einen zentralen Grundsatz der europäischen Rechtsordnung wider, nämlich das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Die detaillierte Kompetenzregelung ist daher notwendige Voraussetzung und Indiz dafür, dass die Mitgliedstaaten auch weiterhin die „Herren der Verträge“ bleiben und dass eine Kompetenz-Kompetenz für die Europäische Union nicht gewollt ist.109 Abgesehen davon gibt Teil I der Verfassung einen guten Überblick über die grundsätzliche Kompetenzverteilung. Hervorzuheben ist, dass die Verfassung erstmals klar zwischen Zielen als politische Willensbekundungen und Kompetenzen (Zuständigkeiten) der Union unterscheidet.110 Art. 3 in Verbindung mit Art. 308 EG differenzierte nicht zwischen Zielen und Zuständigkeiten der Gemeinschaft und bot daher Raum für dynamische Kompetenzerweiterungen.111 Der Verfassungsvertrag enthält mit Art. I-3 EVV einen eigenständigen Zielkatalog und mit den Art. I-11 bis I-18 EVV in Verbindung mit Teil III der Verfassung eine in sich geschlossene Kompetenzordnung. Freilich wurde mit Art. I-18 EVV eine dem Art. 308 EG vergleichbare Flexibilitätsklausel in die Verfassung aufgenommen.112 109 Vgl. den Festvortrag von Papier anlässlich des 65. Deutschen Juristentags 2004, Pressemitteilung Nr. 3 / 2004, S. 7. 110 Oppermann, DVBl. 2003, 1165 (1169). 111 Oppermann, DVBl. 2003, 1165 (1169). 112 Siehe dazu die Ausführungen unten, § 9 II. 6.
§ 9 Die Zuständigkeiten der Union
211
Um die Kompetenzverteilung nach dem Verfassungsvertrag verstehen zu können, muss man sowohl Teil I der Verfassung als auch die Vorschriften des Teils III der Verfassung berücksichtigen.113 Da erstmals ein eigenständiger Titel „Zuständigkeit“ in den Vertrag aufgenommen wurde und die verschiedenen Zuständigkeitsarten benannt und definiert werden, soll nachfolgend ein kurzer Überblick hierüber gegeben werden. Wie sich das neue Kompetenzsystem speziell auf die Außenkompetenzen der Union auswirkt, wird dann im Anschluss untersucht.
I. Grundprinzipien: Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit, begrenzte Einzelermächtigung, Art. I-11 EVV Art. I-1 Abs. 1 EVV macht deutlich, dass nicht die Verfassung selbst die Zuständigkeiten der Union begründet, sondern dass diese ihr von den Mitgliedstaaten übertragen worden sind.114 Der erste Artikel des Titels „Zuständigkeiten der Union“ fasst die Grundsätze zusammen, die für die Wahrnehmung der Unionszuständigkeiten gelten. Art. I-11 Abs. 2 EVV legt den Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung, Abs. 3 das Subsidiaritätsprinzip und Abs. 4 den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit fest. Ausdrücklich in den Verfassungstext aufgenommen wurde auch der Anwendungsbereich der genannten Grundprinzipien. Nach Art. I-11 Abs. 1 EVV gilt das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung für die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union (im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten), die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit dagegen – in einem gedachten „zweiten Schritt“ – bei der Ausübung der Zuständigkeiten der Union. Dies war schon von der Rechtswissenschaft für Art. 5 EG herausgearbeitet worden und fand nun im Sinne einer Klarstellung Eingang in die Verfassung.
1. Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung, Art. I-11 Abs. 1, 2 EVV Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung115 garantiert den Mitgliedstaaten den Fortbestand ihrer Souveränität sowie die demokratische Legitimation der Europäischen Union.116 Eine symbolische Wahrung der Souveränität der Mitgliedstaaten ist bereits in Art. I-1 Abs. 1 S. 1 EVV zu finden. Dort wird bestimmt, dass Craig, ELRev 2004, 323 (344). Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (216). 115 Englisch: principle of conferral, vgl. auch die sehr instruktive Darstellung bei Dashwood, CMLRev 2004, 355 (357 ff.). 116 Trüe, ZaöRV 2004, 391 (396). 113 114
14*
212
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
die Verbandkompetenz nicht von der Verfassung „begründet“, sondern von den Mitgliedstaaten „übertragen“ wird.117 Der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung war schon bisher ein tragendes Prinzip des Unionsrechts und in Art. 5 UAbs. 1 EG, Art. 7 Abs. 1 EG und Art. 5 EU verankert. In Art. I-11 Abs. 1, 2 EVV wird nun erstmals das Prinzip beim Namen genannt.118 Klarstellende Funktion hat zudem Art. I-11 Abs. 2 Satz 2 EVV, wonach ausdrücklich festgestellt wird, dass alle Zuständigkeiten, die der Vertrag nicht der Union überträgt, bei den Mitgliedstaaten verbleiben.119 Diese Ergänzung soll die Vermutung einzelstaatlicher Zuständigkeit stützen.120 Die ausdrückliche Benennung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung ist der deutlichste Hinweis darauf, dass der Europäischen Union keine KompetenzKompetenz zusteht und sie daher über das entscheidende Merkmal eines souveränen Staates nicht verfügt. An der Position der Mitgliedstaaten als „Herren der Verträge“ ändert sich somit nichts.121 Die Tatsache, dass der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung als erstes Prinzip im Rahmen der neuen Kompetenzbestimmungen der Verfassung genannt ist, macht deutlich, dass eine allzu extensive Auslegung von Kompetenznormen nicht in Betracht kommen kann.122 Im Rahmen der Auslegung des Unionsrechts müssen daher die Rechte der Mitgliedstaaten gewahrt werden. 2. Grundsatz der Subsidiarität, Art. I-11 Abs. 1, 3 EVV Der Grundsatz der Subsidiarität, bisher in Art. 5 UAbs. 2 EG geregelt, wird durch Art. I-11 Abs. 3 EVV fast wortgleich in die Verfassung überführt. Damit bleibt das Nebeneinander von Erforderlichkeitsprüfung und Effizienzprüfung erhalten. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass das Subsidiaritätsprinzip nur in den 117 Nach langem Ringen entschied sich der Konvent für die dargestellte Fassung, vgl. von Bogdandy / Bast / Westphal, Integration 2003, 414 (415). Auch in der sprachlichen Ausdrucksweise findet sich damit das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung wieder. Im Konventsentwurf hieß es noch, dass die Verfassung der Union eine Zuständigkeit „zuweist“ (vgl. beispielsweise Art. I-11 Abs. 2 KE-EVV). Der jetzige Wortlaut, wonach die Verfassung Zuständigkeiten „überträgt“, macht dagegen noch deutlicher, dass partiell Kompetenzen von einem Hoheitsträger auf einen anderen verlagert werden. 118 Zudem wird Teil III der Verfassung mit dem ausdrücklichen Hinweis auf das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung eingeleitet (Art. III-115 Abs. 1 EVV). Der ausdrücklichen Erwähnung des Grundsatzes der begrenzten Einzelermächtigung kann insoweit ein eigenständiger rechtlicher Gehalt beigemessen werden, als hierdurch die von Teilen des Schrifttums befürwortete inhaltliche Bedeutung des Art. 5 Abs. 1 EG als „Auslegungsprinzip“ unterstützt wird, vgl. Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (217). 119 Auch in Art. III-115 EVV, der ersten Bestimmung des Teils III der Verfassung, wird auf den Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung verwiesen. 120 CONV 375 / 1 / 02 REV 1, S. 10. 121 Oppermann, DVBl. 2003, 1165 (1171). 122 Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (218).
§ 9 Die Zuständigkeiten der Union
213
Bereichen gilt, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen. Zusammen mit der ausdrücklichen Regelung der Zuständigkeit in Art. I-13 EVV bedeutet das eine begrüßenswerte Klarstellung.123 Dem bisherigen Wortlaut wird hinzugefügt, dass die Union tätig werden darf, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten „weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene“ ausreichend verwirklicht124 werden können. Die angesprochenen Ebenen waren jedoch auch schon nach dem EG-Vertrag vom Begriff des „Mitgliedstaats“ erfasst, somit bedeutet die Einfügung keine materielle Änderung, sondern lediglich eine Klarstellung der Rechtslage.125 Die ausdrückliche Erwähnung der regionalen und lokalen Ebenen könnte jedoch auf die Anhörungspraxis der Kommission und auf die Begründungserfordernisse im Rahmen von Rechtsetzungsvorschlägen Auswirkungen haben.126 Die beiden in Art. I-11 Abs. 3 EVV enthaltenen Voraussetzungen werden in der Neufassung mit dem Wort „vielmehr“ statt mit dem Wort „daher“ (Art. 5 EG) verknüpft. Das bedeutet, dass sich aus der Erfüllung der ersten Bedingung nicht kausal die Erfüllung der zweiten Bedingung ergibt.127 Vielmehr müssen beide kumulativ vorliegen, was zu einer klaren zweistufigen Prüfung anhand materieller Kriterien führt.128 Unter anderem wird auch ein größerer Begründungsaufwand erforderlich werden, warum ein Ziel besser durch das Handeln auf Unionsebene zu erreichen ist. Die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, nämlich der Grundsatz, dass die Europäische Union von unten nach oben aufgebaut und gestaltet wird129, soll künftig auf zwei Ebenen sichergestellt werden.130 123 Craig, ELRev 2004, 323 (342). Zu den Argumenten, die für die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips auch auf die ausschließlichen Zuständigkeiten sprechen, vgl. CONV 624 / 03, S. 2 (Rdnr. 3). 124 Zu dem im Konventsentwurf verwendeten Wort „erreicht“ (Art. I-9 Abs. 3 KE-EVV) besteht, soweit ersichtlich, kein Bedeutungsunterschied. 125 Mager, ZEuS 2003, 471 (478); so auch Schröder, JZ 2004, 8 (11). 126 So auch Mager, ZEuS 2003, 471 (478). 127 Wuermeling, EuropaR 2004, 216 (224). 128 von Bogdandy / Bast / Westphal, Integration 2003, 414 (419); skeptischer Schröder, JZ 2004, 8 (11). 129 Meyer, ZRP 2003, 104 (105). Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit der kleineren, bürgernäheren Einheit der Vorrang gegenüber der größeren Einheit zukommen soll. Als politisches Prinzip soll es dem Auffinden der geeignetsten Ebene dienen, vgl. Mager, ZEuS 2003, 471 (473, 484) m. w. N. 130 Derzeit existieren zur Einhaltung der Kompetenzabgrenzung und des Subsidiaritätsprinzips ebenfalls zwei Kontrollmechanismen, die aber im Vergleich zum Verfassungsvertrag zum Teil unterschiedlich ausgestaltet sind: die politische Kontrolle wird größtenteils von den am Gesetzgebungsprozess beteiligten Unionsorganen selbst wahrgenommen, die gerichtliche Kontrolle erfolgt durch den EuGH, welcher im Rahmen des EG-Vertrags umfassend, im Rahmen von Titel VI des EU-Vertrages begrenzt und im Rahmen von Titel V des EU-Vertrages gar nicht zur Kontrolle dieser Prinzipien zuständig ist, vgl. CONV 47 / 02, S. 10 (Rdnr. 12).
214
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Die aus dem Subsidiaritätsprinzip resultierende Rechtsfolge ist nicht die (Rück-)Übertragung von Kompetenzen auf die Mitgliedstaaten. Vielmehr bedeutet das Subsidiaritätsprinzip eine Schranke, die bei der Ausübung vorhandener Kompetenzen wirkt.131
a) Schaffung eines Frühwarnsystems in Form einer politischen ex-ante-Kontrolle Neu ist der Verweis auf das „Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ im Anhang zur Verfassung. Dieses Protokoll132 ist nicht identisch mit dem bisherigen Protokoll gleichen Namens aus dem Jahre 1997. In Art. 1 des Protokolls wird zunächst geregelt, dass jede Institution stets für die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips Sorge zu tragen hat.133 Besondere Beachtung verdient das durch das Protokoll neu eingerichtete Verfahren, nach welchem den nationalen Parlamenten das Recht eingeräumt wird, auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zu achten. Die nationalen Parlamente sind an der Wahrung des Subsidiaritätsprinzips besonders interessiert, da die Missachtung des Prinzips in den allermeisten Fällen zu Lasten der mitgliedstaatlichen Gesetzgebung geht.134 Dieses Verfahren wurde aufgrund der Erfahrung, dass der Gerichtshof bisher noch nie eine Verletzung des Subsidiaritätsprinzips festgestellt hat und angesichts von Bedenken hinsichtlich der Durchsetzung des Subsidiaritätsprinzips eingeführt.135 Nach Art. 5 des oben genannten Protokolls soll jeder Entwurf eines Europäischen Gesetzgebungsaktes136 einen Vermerk mit detaillierten Angaben enthalten, die es ermöglichen zu beurteilen, ob die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit eingehalten worden sind. Die Kommission wird verpflichtet, alle ihre Gesetzgebungsvorschläge gleichzeitig den Parlamenten der MitgliedstaaKönig / Lorz, JZ 2003, 167 (167). Es handelt sich hier um das Protokoll Nr. 2 „Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“. 133 Ausführlich zu dem genannten Protokoll Schröder, JZ 2004, 8 (11 ff.). 134 Schröder, JZ 2004, 8 (12). 135 Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (220). Der zurückhaltende Prüfungsansatz des EuGH wird in der Entscheidung EuGH, Slg. 1996 I-5755 (Rdnr. 47) – Arbeitszeitrichtlinie deutlich. Weitere Beispiele für die vom EuGH ausgeübte geringe Kontrolldichte bilden EuGH, Slg. 2001, I-7079 (Rdnr. 39 ff.) – Biopatentrichtlinie und EuGH, Slg. 2002, I-11453 (Rdnr. 181 ff.) – Tabakproduktrichtlinie. 136 Nach Art. 3 des Protokolls sind das die Vorschläge der Kommission, die Initiativen einer Gruppe von Mitgliedstaaten, die Initiativen des Europäischen Parlaments, die Anträge des Gerichtshofs, die Empfehlungen der Europäischen Zentralbank und die Anträge der Europäischen Investitionsbank, die den Erlass eines Europäischen Gesetzgebungsaktes zum Ziel haben. (Eine entsprechende Definition war in dem vom Konvent verfassten Protokoll noch nicht enthalten). 131 132
§ 9 Die Zuständigkeiten der Union
215
ten und dem Unionsgesetzgeber zu übermitteln.137 Dadurch wird ein politischer „Frühwarnmechanismus“ geschaffen, nach dem die einzelstaatlichen Parlamente sich zunächst zur Konformität der Rechtsetzungsvorschläge der Europäischen Kommission mit dem Subsidiaritätsprinzip äußern können.138 Eine solche Auseinandersetzung bedingt es, dass sich die nationalen Parlamente intensiver mit der Europapolitik beschäftigen müssen. Der Verfassungsvertrag bestellt die nationalen Parlamente damit gleichsam zu „Hütern des Subsidiaritätsprinzips“.139 Insgesamt ist daher in Zukunft von einer „Europäisierung“ der Debatten in den nationalen Parlamenten auszugehen.140 Die Überlegung bei der Einrichtung dieses Frühwarnmechanismusses ging dahin, dass dem Subsidiaritätsprinzip umso besser Geltung verschafft werden kann, je früher ihm im Verlauf des Rechtsetzungsprozesses Rechnung getragen wird.141 Daher wurde ein System gewählt, welches eine politische Kontrolle im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens vorsieht. Auf die im Rahmen dieses Verfahrens vorgebrachten Argumente kann daher flexibler reagiert werden, indem Einwänden vor Verabschiedung des Rechtsaktes Rechnung getragen wird. Der Zustand der Rechtsunsicherheit, der während einer schwebenden Nichtigkeitsklage besteht, soll damit weitgehend verhindert werden.
b) Ex-post-Kontrolle durch den EuGH Wird Bedenken der nationalen Parlamente hinsichtlich des Subsidiaritätsprinzips nicht Rechnung getragen, so können die einzelstaatlichen Parlamente in einem zweiten Schritt, nach Annahme des Rechtsakts durch den Unionsgesetzgeber, den Gerichtshof wegen Verletzung des Subsidiaritätsprinzips anrufen.142 Neben den bisherigen Klageberechtigten können Nichtigkeitsklagen wegen Verletzung des Subsidiaritätsprinzips gemäß Art. 8 UAbs. 1 des Protokolls über die Anwendung 137 Diese frühzeitige Unterrichtung deckt sich mit den Vorschlägen der Arbeitsgruppe IV „Einzelstaatliche Parlamente“, vgl. CONV 353 / 02, S. 10 (Rdnr. 23). 138 Siehe das Merkblatt der Arbeitsgruppe I „Subsidiarität“, S. 1. Nach Art. 6 des Protokolls können die nationalen Parlamente binnen sechs Wochen nach dem Zeitpunkt der Übermittlung des Entwurfs eines Europäischen Gesetzgebungsakts in einer begründeten Stellungnahme darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. Insbesondere zur Rolle der nationalen Parlamente Lais, ZEuS 2003, 187 (203 ff.). 139 Bezeichnung angelehnt an Mager, ZEuS 2003, 471 (478). 140 So ausdrücklich Meyer, ZRP 2003 104 (106). Erreicht die Anzahl der begründeten Stellungnahmen, wonach der Entwurf eines Europäischen Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang steht, mindestens ein Drittel der Gesamtzahl der den nationalen Parlamenten zugewiesenen Stimmen, dann muss der Entwurf überprüft werden (Art. 7 des Protokolls). Zur Klagemöglichkeit vor dem EuGH vgl. die folgenden Ausführungen. 141 CONV 286 / 02, S. 4. 142 Siehe hierzu insbesondere Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (541 ff.).
216
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit auch von den nationalen Parlamenten oder einzelnen Kammern dieser Parlamente143 veranlasst werden.144 Die Klage muss entsprechend den jeweiligen nationalen Vorschriften von dem Mitgliedstaat im Namen seines Parlaments oder der Kammer des Parlaments erhoben werden. Daneben sieht Art. 8 UAbs. 2 des Protokolls eine Klagebefugnis des Ausschusses der Regionen in Bezug auf solche Europäische Gesetzgebungsakte vor, für deren Erlass die Anhörung des Ausschusses der Regionen von der Verfassung vorschrieben ist. Trotz teilweise geäußerter Bedenken hinsichtlich der Justiziabilität des Subsidiaritätsprinzips ist zu hoffen, dass durch die oben beschriebene Ausweitung des Kreises der Klageberechtigten eine intensivere Kontrolle der Rechtsakte der Union in Bezug auf die Verletzung des Subsidiaritätsprinzips stattfinden wird.145 Die Einrichtung eines ad-hoc-Gremiums politischer oder gerichtlicher Art zur Überwachung der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips hat der Konvent – zu Recht – abgelehnt.146 Ein solches mit nationalen Richtern besetztes ad-hoc-Gericht hätte eine weitgehende Entmachtung des EuGH bedeutet. Die Schaffung eines weiteren Gerichts hätte zur Unübersichtlichkeit der europäischen Institutionen beigetragen; außerdem bestand das Risiko der Schaffung einer Superrevisionsinstanz.147 Eine Trennung zwischen Kompetenzfragen und dem Umfang beziehungsweise der Reichweite einer eingeräumten Kompetenz wäre zudem kaum möglich gewesen. Daneben stand die Einrichtung eines aus Vertretern der nationalen Parlamente zusammengesetzten ad-hoc-Organs zur Debatte, welches aber 143 Auch der deutsche Bundesrat ist als „Kammer“ im Sinne des Subsidiaritätsprotokolls anzusehen und damit klagebefugt, Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (542). Die einzelnen Bundesländer sind dagegen nicht klagebefugt. Das Präsidium des Konvents hat sich dagegen entschieden, Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen ein Klagerecht beim Gerichtshof bei Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip einzuräumen, CONV 724 / 03, S. 148. 144 Die nationalen Parlamente sind auch klagebefugt, wenn sie im Vorfeld keine begründete Stellungnahme abgegeben haben. Damit folgte der Konvent und auch die Regierungskonferenz, gegen die Empfehlungen der Gruppe I „Subsidiarität“ (CONV 286 / 02, S. 7), den Vorschlägen der Arbeitsgruppe IV „Einzelstaatliche Parlamente“, vgl. CONV 353 / 02, S. 11 (Rdnr. 25). 145 Daneben setzt der Konvent, wie oben beschrieben, durch die Einbeziehung der nationalen Parlamente auf eine politische Kontrolle im Vorfeld von Unionsrechtsakten (ex-anteÜberwachung). Die Arbeitsgruppe I wies auf den weiten Ermessensspielraum der Europäischen Organe bei der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips hin. Da es sich bei dem Subsidiaritätsprinzip um ein im Wesen politisches Prinzip handele (Beurteilung, ob die europäische oder eine andere Ebene „besser“ zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele geeignet ist), sei eine politische Kontrolle im Vorfeld sinnvoll, CONV 286 / 02, S. 2. Zur Gefahr, dass das Verfahren „zu einer inhaltslosen Routine verkommt“, Mager, ZEuS 2003, 471 (483). Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (543) sieht das Klageverfahren eher als „latente Mahnung im Hintergrund des diskursiv angelegten Frühwarnsystems“. 146 Der Frage, ob ein Europäisches Kompetenzgericht nötig ist, widmen sich Goll / Kenntner, EuZW 2002, 101 ff. 147 Jennert, NVwZ 2003, 936 (942); anders König / Lorz, JZ 2003, 167 (172).
§ 9 Die Zuständigkeiten der Union
217
ebenfalls abgelehnt wurde.148 Daher bleibt es dabei, dass dem EuGH die Rechtsprechungskompetenz in Bezug auf die wichtige, dem Subsidiaritätsprinzip zugrunde liegende Kompetenzfrage zusteht. c) Bewertung Der in den letzten Jahren zu beobachtende Kompetenzverlust der regionalen Ebene, insbesondere der deutschen Bundesländer, dürfte durch die Neuregelung zumindest aufgehalten werden. In Zukunft wird der Bundesrat zur selben Zeit wie die Bundesregierung die Gesetzgebungsvorschläge unmittelbar von der Kommission zugeleitet bekommen. Seine Auffassung bezüglich des Subsidiaritätsprinzips im konkreten Fall kann der Bundesrat in eigener Verantwortung und, ohne sich mit der Bundesregierung vorher abstimmen zu müssen, der Kommission vortragen. Sieht die Kommission sich mit erheblichem Widerstand seitens der regionalen Ebene konfrontiert, bestünde die Möglichkeit, dass sie den Bedenken der Regionen Rechnung trägt und ihren Gesetzgebungsvorschlag ändert. Zumindest muss sich die Kommission mit einem gesteigerten Begründungsaufwand auseinandersetzen. Wird der Rechtsakt unverändert erlassen, kann der Bundesrat künftig – gemäß den innerstaatlichen Regeln149 – eine Nichtigkeitsklage vor dem EuGH erheben. Insgesamt wird also deutlich, dass die Möglichkeiten der politischen Einflussnahme der regionalen Gebietskörperschaften im Vorfeld europäischer Rechtssetzungsakte erheblich verbessert werden. Allerdings darf man nicht verkennen, dass letztlich die Entscheidungskompetenz – wie bisher auch – unangetastet bei den Gemeinschaftsorganen verbleibt.150 Mit der Neuregelung ist das Subsidiaritätsprinzip in seinem materiellrechtlichen Gehalt leicht gestärkt worden. Zudem wurden die Darlegungs- und Begründungs148 CONV 47 / 02, S. 19 (Rdnr. 34). Ablehnend in Bezug auf neue ständige oder ad-hocGremien die Arbeitsgruppe IV „Einzelstaatliche Parlamente“, vgl. CONV 353 / 02, S. 11 (Rdnr. 24). 149 § 7 des Gesetzes über die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern sieht eine grundsätzliche Verpflichtung zur Klageerhebung auf Wunsch des Bundesrates – unter Wahrung der gesamtstaatlichen Verantwortung – vor, Wuermeling, EuropaR 2004, 216 (225). Eine entsprechende Vorschrift im Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union fehlte bislang (vgl. Schröder, JZ 2004, 8 (12)). Am 12. 05. 2005 hat der Bundestag einstimmig ein Gesetz über Mitwirkungs- und Klagemöglichkeiten in Subsidiaritätsfragen beschlossen. Es sieht vor, dass der Bundestag gegen europäische Maßnahmen vor dem EuGH Klage erheben kann, falls ein Fraktion dies beantragt und der Bundestag nicht mit Zweidrittelmehrheit gegen einen solchen Antrag stimmt, Art. 1 § 3, vgl. BT-Drucksache 15 / 5492 und BR-Drucksache 340 / 05. Außerdem wird die Bundesregierung verpflichtet, dem Bundestag und dem Bundesrat bestimmte Gesetzgebungsvorschläge der Europäischen Union frühzeitig zu übermitteln. Nach Art. 3 des Gesetzes tritt es jedoch erst an dem Tag in Kraft, an dem der Vertrag über eine Verfassung für Europa gemäß seinem Art. IV-447 Abs. 2 in Kraft tritt. 150 Mager, ZEuS 2003, 471 (481) spricht von einer „Prozeduralisierung“, mit der eine Legitimation durch Verfahren bewirkt werde.
218
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
lasten der Kommission weiter ausgedehnt. Als entscheidende Verbesserung zum derzeitigen System kann die Einbeziehung der nationalen Parlamente und der regionalen Gebietskörperschaften („politisches Frühwarnsystem“) gewertet werden. Das eingeführte primär prozedural ausgerichtete Schutzkonzept, welches sicherlich zu einer erhöhten Präsenz der unteren Ebenen auf der europäischen Bühne führen wird151, darf jedoch nicht den Blick auf die strukturelle Schwäche des Subsidiaritätsprinzips verstellen. Letztendlich ist die Beurteilung der Subsidiarität nämlich in erheblichem Umfang eine Frage des politischen Ermessens.152 Wie weit die vom EuGH praktizierte Kontrolldichte in Zukunft reichen wird, muss abgewartet werden. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass der EuGH dem Subsidiaritätsprinzip in materieller Hinsicht Konturen gibt und damit für eine wirksame Kontrolle sorgt. 3. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, Art. I-11 Abs. 1, 4 EVV Auch das bisher in Art. 5 UAbs. 3 EG geregelte, allgemein als gelungen angesehene153 Verhältnismäßigkeitsprinzip wurde nahezu wortgleich im Verfassungsvertrag übernommen. Ergänzt wurde, dass die Maßnahmen der Union weder inhaltlich noch formal über das für die Erreichung der Ziele der Verfassung erforderliche Maß hinausgehen dürfen. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip gilt damit nicht nur für den Inhalt einer Maßnahme, sondern auch für die Wahl der Handlungsform. In Art. I-11 Abs. 4 UAbs. 2 EVV wird ebenfalls auf das Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit Bezug genommen. Auch hier kommt damit eine ausdifferenzierte Beteiligung nationaler Parlamente im Sinne einer Legitimationskontrolle europäischer Entscheidungsfindung zum Zug.154
II. Die einzelnen Kompetenztypen 1. Katalogartige Auflistung der Sachbereiche Wenn durch den Verfassungsvertrag auch kein vollständig ausformulierter Kompetenzkatalog installiert worden ist, so wurden doch die meisten Sachmaterien in Auch dem Ausschuss der Regionen wird ein eigenständiges Klagerecht eingeräumt. von Bogdandy / Bast / Westphal, Integration 2003, 414 (419). „The Court of Justice is understandably reluctant to apply in a robust way a principle which is so heavily political“, Dashwood, CMLRev 2004, 355 (368); Schwarze, EuropaR 2003, 535 (548). Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (219) meint zudem, es sei nicht gelungen, den Inhalt des Subsidiaritätsprinzips materiellrechtlich zu konkretisieren und damit justiziabler zu gestalten; zweifelnd hinsichtlich justiziabler materiellrechtlicher Strukturen auch Papier, Festvortrag anlässlich des 65. Deutschen Juristentags 2004, Pressemitteilung Nr. 3 / 2004, S. 8. 153 Oppermann, DVBl. 2003, 1 (8). 154 Müller-Graff, Integration 2004, 186 (199). 151 152
§ 9 Die Zuständigkeiten der Union
219
übersichtlicher Weise in Art. I-13 ff. EVV aufgelistet.155 Darin liegt eine wesentliche, nicht nur optische Vereinfachung.156 Den Bürgern wird erschließbar, in welchen Bereichen die Union handlungsbefugt ist. Der Vertrag weist erstmals der Europäischen Union selbst und nicht nur den jeweiligen Organen bestimmte Kompetenzen zu. Auch hier tritt die mit Art. I-7 EVV neu gewonnene Kompetenzträgerschaft der Europäischen Union deutlich zu Tage. Die Notwendigkeit, Verbandskompetenzen über Organkompetenzen erschließen zu müssen, entfällt damit.157 Anders als die Kompetenzvorschriften in Teil III der Verfassung sind jene aus Teil I nicht kompetenzbegründender, sondern lediglich beschreibender beziehungsweise kategorisierender Natur. Durch die Kategorisierung der Kompetenzen wird mehr Transparenz geschaffen. Bei der Neuordnung der Zuständigkeiten stand der Konvent vor einem grundlegenden Problem, die künftige Kompetenzordnung sollte zwar möglichst präzise aber doch noch flexibel sein.158 Bei allen Überlegungen zur Problematik der Kompetenzverteilung musste dieser Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zwischen einer gewissen Flexibilität und einer präzisen Abgrenzung zu finden, Rechnung getragen werden. Dabei weisen alle bestehenden Verfassungen – auch diejenigen, die sich auf einen Katalog von Kompetenzen stützen – Grauzonen auf, und die Fragen im Zusammenhang mit den daraus resultierenden Kompetenzkonflikten müssen von den jeweiligen nationalen Verfassungsgerichten entschieden werden.
2. Art. I-12 EVV als das Herzstück der neuen Kompetenzordnung Art. I-12 EVV in Verbindung mit den Art. I-13 bis I-17 EVV bilden das Herzstück der neuen Kompetenzordnung. Art. I-12 EVV definiert die Art der Kompetenzen und die Folgen, die sich daraus ergeben. Bezüglich des Umfangs der Zuständigkeiten verweist Art. I-12 Abs. 6 EVV auf Teil III der Verfassung. Dort finden sich allerdings die in Teil I vorgegebenen Kompetenzgruppen nicht wieder159, die Tätigkeitsfelder der Union werden nach anderen Gesichtpunkten (zum Beispiel Unionsbürgerschaft, Auswärtiges Handeln der Union) geordnet. 155 Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (526 f.). Im Laufe der Konventsberatungen wechselten einige Bereiche oftmals die Kompetenzkategorie, „The ,walls‘ between the categories shifted significantly“, Craig, ELRev 2004, 323 (326). 156 Festvortrag von Papier anlässlich des 65. Deutschen Juristentags 2004, Pressemitteilung Nr. 3 / 2004, S. 6; Görlitz, DÖV 2004, 374 (375). 157 Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (527). 158 CONV 47 / 02, S. 10 (Rdnr.13). 159 Eine Ausnahme bildet hier der Bereich, in dem die Union beschließen kann, eine Unterstützungs-, Koordinierungs- oder Ergänzungsmaßnahme durchzuführen, vgl. Kapitel V des Teils III des Verfassungsvertrags, Art. III-278 bis III-285 EVV.
220
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Im Stil eines allgemeinen Teils der Kompetenzen werden die genannten Vorschriften gleichsam vor die Klammer gezogen.160 Die einzelnen Kompetenzarten, die Art. I-12 EVV definiert, werden im Folgenden dargestellt. 3. Ausschließliche Zuständigkeiten, Art. I-12 Abs. 1, I-13 EVV Prägend für ausschließliche161 Zuständigkeiten ist, dass in diesen Bereichen die Mitgliedstaaten nur mit vorheriger Erlaubnis der Union tätig werden dürfen. Es handelt sich somit um Fälle, in denen die Mitgliedstaaten grundsätzlich nicht gesetzgeberisch handeln dürfen, auch wenn auf Unionsebene keine Lösung gefunden werden kann.162 Die Mitgliedstaaten dürfen in dem betreffenden Bereich jedoch dann tätig werden, wenn sie von der Union hierzu ermächtigt werden, oder um Rechtsakte der Union durchzuführen. Die erste Ausnahme erklärt sich von selbst, die zweite bedarf näherer Betrachtung. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Union den betreffenden Sachbereich abschließend regelt und daher kein nationales Ergänzungsrecht notwendig ist, da die Mitgliedstaaten ohnehin keine Kompetenz zur Rechtssetzung mehr haben.163 Allerdings übt die Europäische Union – auch im Bereich der ausschließlichen Kompetenzen – fast keine eigene Verwaltungstätigkeit aus. Die Vollzugskompetenzen liegen in den meisten Gebieten vielmehr nahezu ausschließlich bei den Mitgliedstaaten.164 Somit besteht die sachliche Notwendigkeit, dass die Mitgliedstaaten zur Durchführung der von der Union erlassenen Rechtsakte Maßnahmen erlassen können. Die ausschließliche Zuständigkeit der Union umfasst daher den Sachbereich minus das erforderliche Durchführungsrecht.165 Dieser Tatsache trägt Art. I-12 Abs. 1 a. E. EVV Rechnung, der bestimmt, dass die Mitgliedstaaten tätig werden dürfen, „um Rechtsakte der Union durchzuführen“. von Bogdandy / Bast / Westphal, Integration 2003, 414 (421). Im Konvent wurde diskutiert, ob die Begriffe „eigene“ oder „zugewiesene“ Zuständigkeiten oder einfach „Zuständigkeiten der Union“ besser geeignet wären, man kam jedoch zum Schluss, dass der Begriff „ausschließliche Zuständigkeit“ der aus juristischer Sicht präziseste sei, vgl. CONV 624 / 03, S. 5 (Rdnr. 14). 162 Die von einem Teil der Arbeitsgruppe vertretene Ansicht, wonach die ausschließliche Zuständigkeit in „Zuständigkeit der Union“ umbenannt werden und alle Bereiche erfassen sollte, in denen die Union „uneingeschränkt oder in erster Linie verantwortlich“ ist, wurde dagegen nicht übernommen. Diese politischen Kriterien wurden zu Recht als zu ungenau abgelehnt und stattdessen der bisherigen rechtlichen Betrachtungsweise der Vorzug gegeben, vgl. CONV 375 / 1 / 02 REV 1, S. 6 f.; Dashwood differenziert zwischen „pre-emptive exclusivity“ und „a priori exclusivity“, Dashwood, CMLRev 2004, 355 (370). 163 Trüe, ZaöRV 2004, 391 (418). 164 Allerdings bedient sich die Union in zunehmendem Maße unionseigener Einrichtungen und Agenturen, um unionale Verwaltungsaufgaben auf europäischer Ebene wahrzunehmen. Zu dieser Problematik, insbesondere zur fehlenden Regelung durch den Verfassungsvertrag, vgl. Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (522 f.). 165 Vgl. Trüe, ZaöRV 2004, 391 (418) und den Wortlaut des Art. I-12 Abs. 2 EVV „. . . so kann nur die Union gesetzgeberisch tätig werden“. 160 161
§ 9 Die Zuständigkeiten der Union
221
Offen lässt der Verfassungsvertrag, inwieweit die Mitgliedstaaten mit Mitteln der nichtrechtlichen Steuerung operieren dürfen.166 Der Wortlaut legt nahe, dass es den Mitgliedstaaten auch verwehrt ist, politische Ziele mit Mitteln anzustreben, die unterhalb der Rechtsnormqualität liegen.167 Gemäß Art. I-11 Abs. 3 EVV gilt das Subsidiaritätsprinzip im Bereich der ausschließlichen Zuständigkeit nicht, denn es wäre unsinnig, in Bereichen, in denen die Mitgliedstaaten nicht befugt sind, selbst tätig zu werden, zu prüfen, ob die Maßnahmen der Union auf Unionsebene besser erreicht werden können als auf mitgliedstaatlicher Ebene. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt jedoch weiterhin auch im Bereich der ausschließlichen Zuständigkeit.168
4. Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen, Art. I-12 Abs. 5, I-17 EVV a) Bedeutung der unterstützenden Maßnahmen (ergänzende Zuständigkeit) Gleich zu Beginn ihres Schlussberichts weist die Arbeitsgruppe darauf hin, dass der Ausdruck „ergänzende Zuständigkeit“169 irreführend ist, da er die Art der Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und der Union nicht hinreichend klar wiedergibt. Insbesondere suggeriert er eine hohe Intensität der Maßnahmen, die die Union ergreifen darf. Befürwortet wurde stattdessen die Formulierung „Maßnahmen der Union in Bereichen, für die die Mitgliedstaaten uneingeschränkt zuständig sind“. Um eine kurze und prägnante Formulierung vorweisen zu können, einigte sich die Gruppe auf den Ausdruck „unterstützende Maßnahmen“. Der Konvent schließlich – und ihm folgend die Regierungskonferenz – betitelte Art. I-16 EVV mit „Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen“. Solche Maßnahmen können folgendermaßen definiert werden: Unterstützende Maßnahmen dürfen in jenen Politikbereichen erlassen werden, in denen die Zuständigkeiten weiterhin bei den Mitgliedstaaten liegen, die Union jedoch Maßnahmen mit geringer Intensität erlassen darf. Solche Maßnahmen dienen dazu, die Politik der Mitgliedstaaten in Fällen zu unterstützen und zu ergänzen, in denen dies im gemeinsamen Interesse der Union und der Mitgliedstaaten liegt. Bei unterstützenden Maßnahmen handelt es sich meist um unverbindliche Entschließungen, Empfehlungen, Aktionsprogramme oder um andere nicht zwingende Rechtsakte. Der genannte Kompetenztyp ist grundsätzlich nicht regulativ angelegt.170 166 167 168 169 170
Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (529). Im Ergebnis anders Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (529). CONV 724 / 03, S. 63. So der Name der Arbeitsgruppe V. Schröder, JZ 2004, 8 (9).
222
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Üblich sind best-practice Richtlinien.171 Ausnahmsweise kann auch auf rechtsverbindliche Maßnahmen zurückgegriffen werden, etwa auf solche, die eine bestimmte Entwicklung anstoßen sollen.172 Diese Maßnahmen binden dann die Mitgliedstaaten wie jeder andere von der Union erlassene Rechtsakt. Der Umfang der Bindungswirkung bestimmt sich nach der Art der Maßnahmen. Allerdings unterliegen rechtlich bindende Rechtsakte der Einschränkung, dass sie keine Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten beinhalten dürfen (Art. I-12 Abs. 5 UAbs. 2 EVV).173 In Sachbereichen, in denen die Union unterstützt, koordiniert oder Ergänzungsmaßnahmen trifft, kann – aufgrund des Wesens der Kompetenz nach Art. I-12 Abs. 5 EVV – keine Ausschließlichkeit der Kompetenz bestehen, weder für die Union noch für die Mitgliedstaaten.174
b) Bereiche der unterstützenden Maßnahmen Dem Konvent ging es vor allem darum, durch eine genaue Zuordnung der Bereiche möglichst viel Klarheit zu schaffen.175 Dabei sollten die rechtlichen Zuständigkeiten der Union in den betreffenden Bereichen nicht verändert werden. Dieses Ziel ist mit der Auflistung der Zuständigkeiten nach Art. I-17 lit. a-g EVV erreicht worden. Zudem wird in Teil III des Verfassungsvertrages unter Titel III ein Kapitel mit „Bereiche, in denen die Union beschließen kann, eine Unterstützungs-, Koordinierungs- oder Ergänzungsmaßnahme durchzuführen“, überschrieben.176 Diese Bereiche entsprechen den in Art. I-17 lit. a-g EVV aufgezählten Politiken. Der Konvent ordnete die Bereiche Industrie, Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit, allgemeine Bildung, Jugend, Sport und berufliche Bildung, Kultur und Katastrophenschutz in die unterstützenden Maßnahmen nach Art. I-17 EVV ein.177 Die Regierungskonferenz fügte dieser Liste schließlich noch die Bereiche Verwaltungszusammenarbeit und Tourismus178 hinzu. 171 Nicht im rechtstechnischen Sinne einer EG-Richtlinie, sondern im Sinne eines „persuasive soft law“, vgl. Craig, ELRev 2004, 323 (337). 172 So genannte „legal incentive measures“, zum Beispiel im Bereich des Schutzes und der Verbesserung der menschlichen Gesundheit, Craig, ELRev 2004, 323 (337). 173 Ob es sich bei den Unterstützungs- und Ergänzungsmaßnahmen strukturell um geteilte Zuständigkeiten handelt (so Nettesheim, EuropaR 2004, 511 [529]), kann dahinstehen, da der besondere Charakter der genannten Zuständigkeiten eine eigene Kompetenzkategorie rechtfertigt. 174 Trüe, ZaöRV 2004, 391 (406). 175 CONV 375 / 1 / 02 REV 1, S. 8. 176 Vgl. Teil III, Titel III, Kapitel V (Art. III-278 bis III-285 EVV). Auffällig ist das insofern, als weder den ausschließlichen noch den geteilten Zuständigkeiten ein eigenes Kapitel zugeordnet wird.
§ 9 Die Zuständigkeiten der Union
223
Die Arbeitsgruppe V schlug vor, außer den genannten Bereichen auch die Beschäftigungspolitik, die Forschungs- und Entwicklungspolitik und die transeuropäischen Netze in den Katalog aufzunehmen. Die letztgenannten Politikfelder wurden jedoch in besonderen Bestimmungen aufgenommen. So ist die Union gemäß Art. I-12 Abs. 3 in Verbindung mit Art. I-15 EVV zuständig im Hinblick auf die Förderung und Gewährleistung der Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik. Art. I-15 EVV sieht vor, dass die Union insbesondere für die Ausarbeitung von Leitlinien in der Beschäftigungspolitik zuständig ist. Weitere Vorschriften sind in Art. III-203 ff. EVV enthalten. Der Bereich Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt wurde dagegen der geteilten Zuständigkeit zugewiesen (Art. I-14 Abs. 3 EVV). Die Union darf demgemäß Maßnahmen treffen und insbesondere Programme erstellen und durchführen, ohne dass die Ausübung dieser Zuständigkeit der Union die Mitgliedstaaten hindert, ihre Zuständigkeiten auszuüben. Art. III-248 ff. EVV regeln die Kompetenzen der Union in der Forschung und technologischen Entwicklung im Detail. Auch der Bereich transeuropäische Netze fällt nach dem Verfassungsvertrag in den Bereich mit geteilter Zuständigkeit (Art. I-14 Abs. 2 lit. h EVV). In Art. III-246 f. EVV sind weitere Vorschriften zu transeuropäischen Netzen zu finden. Probleme können sich grundsätzlich in Bezug auf die Abgrenzung zwischen den in Art. I-17 EVV genannten Bereichen und den geteilten Zuständigkeiten ergeben. Die Regulierung der Medien könnte etwa unter die Binnenmarktkompetenz fallen, welche eine geteilte Zuständigkeit ist, oder sie könnte unter die Kulturkompetenz fallen, wo nur Unterstützungsmaßnahmen zulässig sind.179
c) Ausschluss jeglicher Harmonisierung Die von der Union erlassenen Unterstützungs- und Ergänzungsmaßnahmen dürfen gemäß Art. I-12 Abs. 5 UAbs. 2 EVV keine Harmonisierung der Rechtsund Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten beinhalten. 177 Durch die genaue Aufzählung der Bereiche, die mit unterstützenden Maßnahmen begleitet werden dürfen, wurde es versäumt, der Vorschrift mehr Flexibilität zu geben, CONV 624 / 03, S. 7 (Rdnr. 20). 178 In der Arbeitsgruppe bestand dagegen weitgehendes Einvernehmen, dass der Bereich Fremdenverkehr überhaupt nicht in den Kompetenzkatalog aufgenommen werden sollte, vgl. CONV 375 / 1 / 02 REV 1, S. 15. Der Grund hierfür war, dass es die Gruppe für unlogisch befand, dass der Fremdenverkehr in Art. 3 lit. u EG zwar aufgeführt, im Vertrag jedoch kein entsprechender Artikel über die politischen Ziele und Zuständigkeiten der Gemeinschaft zu finden war. Da der Verfassungsvertrag nun in Art. III-281 EVV einen Abschnitt betreffend den Tourismus eingefügt hat, sind die Bedenken der Arbeitsgruppe gegenstandslos geworden. 179 CONV 724 / 03, S. 83; Craig, ELRev 2004, 323 (335). 180 CONV 375 / 1 / 02 REV 1, S. 6.
224
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
5. Geteilte Zuständigkeiten, Art. I-12 Abs. 2, I-14 EVV Unter die geteilte Zuständigkeit fallen diejenigen Sachbereiche, die weder den unterstützenden Maßnahmen noch der ausschließlichen Zuständigkeit der Union zuzuordnen sind.180 Diese „Restkategorie“181 wird in Art. I-14 Abs. 2 lit. a-k EVV durch eine Aufzählung der Hauptbereiche mit geteilter Zuständigkeit näher bestimmt.182 Allerdings sind die Bereiche, in denen für die Union eine geteilte Zuständigkeit besteht, nicht abschließend aufgezählt.183 Um diesen Umstand noch besser zur Geltung zu bringen, hätte man in Abs. 2 einfügen sollen, dass sich die geteilte Zuständigkeit insbesondere auf die folgenden Hauptbereiche erstreckt. Die Kategorisierung bestimmter Bereiche in die geteilte Zuständigkeit sagt noch nichts über die Reichweite und den Umfang der jeweiligen Kompetenz aus.184 Wie bereits festgestellt, bestimmt sich der Umfang der Kompetenz nach den Vorschriften in Teil III der Verfassung. Insofern ergeben sich signifikante Unterschiede für die mögliche Regelungsdichte, vergleicht man zum Beispiel die Kompetenzen im Rahmen des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts185 mit denjenigen im Bereich des Binnenmarkts186. Geteilte Zuständigkeiten stehen der Union schlicht zur Verfügung; eine Regel, die ihr Entstehen verhindern könnte, gibt es nicht.187 Ein tatsächliches Vorgehen der Union aufgrund geteilter Zuständigkeiten wird lediglich durch die Kompetenzausübungsklausel des Subsidiaritätsprinzips gesteuert, dem insoweit ein besonderes Gewicht zukommt. Das Subsidiaritätsprinzip ist damit praktisch das einzige Mittel, um den Kompetenzeinsatz der Union zu steuern und zu begrenzen.188 Das Wesen der geteilten Zuständigkeit besteht darin, dass die Mitgliedstaaten ihre Zuständigkeit wahrnehmen können, sofern und soweit189 die Union ihre Zu-
181 Vgl. zu diesem Begriff CONV 624 / 03, S. 6 (Rdnr. 17), CONV 601 / 03, S. 12 (Rdnr. 25). Craig bezeichnet die geteilten Kompetenzen als „default position“, Craig, ELRev 2004, 323 (333). 182 Dies sind namentlich: a) Binnenmarkt, b) Sozialpolitik hinsichtlich der in Teil III genannten Aspekte, c) wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt, d) Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen die Erhaltung der biologischen Meeresschätze, e) Umwelt, f) Verbraucherschutz, g) Verkehr, h) transeuropäische Netze, i) Energie, j) Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, k) gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen Gesundheit hinsichtlich der in Teil III genannten Aspekte. 183 So auch Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (229). 184 Craig, ELRev 2004, 323 (333). 185 Art. I-14 Abs. 2 lit. j EVV in Verbindung mit Art. III-257 ff. EVV. 186 Art. I-14 Abs. 2 lit. a EVV in Verbindung mit Art. III-130 ff. EVV. 187 Schröder, JZ 2004, 8 (9). 188 Schröder, JZ 2004, 8 (9, 11).
§ 9 Die Zuständigkeiten der Union
225
ständigkeit nicht ausgeübt hat (Art. I-12 Abs. 2 EVV). Mitgliedstaaten und Union wirken demnach nicht dauerhaft Seite an Seite, sondern konkurrieren um die Zuständigkeit, wobei der Union, falls sie tätig wird, Vorrang eingeräumt wird. Der Verfassungsgeber legt diesbezüglich eine echte Sperrwirkung fest.190 Damit nimmt nicht mehr die Vorrangwirkung des gesetzten Sekundärrechts den Mitgliedstaaten das Recht zu handeln, sondern die Verfassungsbestimmung selbst.191 In der Sache handelt es sich daher bei den „geteilten Zuständigkeiten“ um konkurrierende Kompetenzen, denn die Ausübung der Zuständigkeit durch den Hoheitsträger Europäische Union hindert die Zuständigkeitsausübung durch die Mitgliedstaaten.192 Damit ist die Kompetenzkategorie der „geteilten Zuständigkeit“ kein Kompetenzverteilungsprinzip, sondern stellt eine zeitliche Regelung der Ausübung derselben Kompetenz durch zwei verschiedene Träger dar. Der Unterschied wird deutlich, wenn man zwischen Kompetenzübertragung und Kompetenzausübung unterscheidet und davon ausgeht, dass dieselbe Kompetenz nacheinander von verschiedenen Trägern ausgeübt werden kann. Die Mitgliedstaaten sind dazu ermächtigt, die geteilten Kompetenzen zeitweise auszuüben – unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Union diese Kompetenzen nicht für sich beansprucht. Die scheinbare Folge der beschriebenen Sperrwirkung ist, dass die Union über kurz oder lang alleinig zuständig ist für diejenigen Bereiche, die unter die geteilte Kompetenz fallen. Je dichter das Regelungsgefüge der Union wird, desto weniger können die Mitgliedstaaten selbst regeln. Dieser Eindruck ist im Prinzip richtig, muss aber in zweierlei Hinsicht eingeschränkt werden. Zum einen sind die Mitgliedstaaten nur „sofern und soweit“193 eingeschränkt, wie die Union Maßnahmen erlassen hat. Die Union kann damit nicht durch partielle Regelung einen gesamten Regelungsbereich gleichsam „besetzen“. Überdies muss sich die Union in dem jeweils in Teil III der Verfassung abgesteckten Kompetenzrahmen halten. Zum anderen gibt es verschiedene Intensitätsgrade, mit denen die Union eine Regelung erlassen kann. Wählt sie etwa das Mittel der Minimalharmonisierung, setzt also lediglich Minimalstandards fest, dann bleibt es den Mitgliedstaaten unbenommen, weiter gehende, schärfere Maßnahmen zu erlassen.194 Bestimmt die Union nur Wert- oder Zielvorstellungen, bleibt ebenfalls Raum für mitgliedstaatliche Regelungen. Schließlich regeln, wie bereits oben angesprochen, die Absätze 3 und 4 die Kompetenzen der Union in den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung 189 Die Mitgliedstaaten sind zur Gänze von der Rechtsetzung ausgeschlossen, wenn die Union eine erschöpfende Regelung getroffen hat. Ob eine erschöpfende Regelung getroffen wurde ist, ist einer Gesamtwürdigung des betreffenden Normenkomplexes zu entnehmen. 190 Ähnlich Art. 72 GG, vgl. Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (529). 191 Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (529). 192 Weber, EuropaR 2004, 841 (848). 193 Vgl. Art. I-12 Abs. 2 EVV. 194 Craig, ELRev 2004, 323 (334 f.).
15 Metz
226
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
und Raumfahrt und in der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe in spezieller Form.195 Bereits hier sei darauf hingewiesen, dass sich hinter Art. I-14 Abs. 2 und Art. I-14 Abs. 3, 4 EVV zwei verschiedene Kompetenzkategorien verbergen. In den Fällen des Art. I-14 Abs. 1, 2 EVV handelt es sich um die in der Dogmatik der deutschen Rechtswissenschaft so bezeichnete konkurrierende Zuständigkeit196, in den Fällen des Art. I-14 Abs. 3, 4 EVV dagegen um parallele Kompetenzen.197 6. Flexibilitätsklausel, Art. I-18 EVV (Art. 308 EG) Mit Art. I-18 EVV wurde eine Vorschrift für unvorhergesehene Fälle im Verfassungsvertrag verankert. Um die bestehenden Kompetenzen dynamisch und flexibel handhaben zu können, wurde eine Flexibilitätsklausel in den Verfassungsvertrag eingeführt. Die Kompetenzen nach Art. I-18 EVV knüpfen an die Ziele der Verfassung und damit nicht an die Rechtsfigur der „implied powers“ an.198 Art. I-18 EVV ähnelt dem derzeit geltenden Art. 308 EG. Trotz der teilweise geäußerten Befürchtungen, der Artikel lade zum Missbrauch ein oder unterlaufe das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, wurde Art. I-18 EVV in die Verfassung eingefügt, um ein gewisses Maß an Flexibilität im Vertragssystem zu wahren. Nach Auffassung der Arbeitsgruppe durfte die Flexibilität jedoch nicht auf einen Mangel an Transparenz oder Klarheit aufbauen. Daher sollten die Bedingungen für die Anwendung des Artikels im Vergleich zur derzeitigen Rechtslage präzisiert und strenger gefasst werden.199 Da das Subsidiaritätsprinzip auch für Art. I-18 EVV uneingeschränkt gilt, war es überflüssig zu regeln, dass Art. I-18 EVV nur Anwendung findet, wenn ein Tätigwerden der Gemeinschaft erforderlich ist, also wenn ein zufrieden stellendes Ergebnis durch ein Tätigwerden auf einzelstaatlicher Ebene nicht erreicht werden kann. Im Hinblick auf Art. 308 EG sollte die neue Vorschrift verbessert werden. Es wurden insoweit zwei Optionen vorgeschlagen: In Art. I-18 EVV sollte ausdrücklich bestimmt werden, dass dieser Artikel keine Grundlage dafür bieten kann,
195 Ein Tätigwerden der Union in diesen Bereichen hat keine Sperrwirkung für die Mitgliedstaaten zur Folge. 196 So auch Görlitz, DÖV 2004, 374 (375). 197 So auch von Bogdandy / Bast / Westphal, Integration 2003, 414 (422); Görlitz, DÖV 2004, 374 (375). 198 Trüe, ZaöRV 2004, 391 (411 f.) nennt die Flexibilitätsklausel eine „Zielkompetenz“. 199 CONV 375 / 1 / 02 REV 1, S. 14; auf der Plenarsitzung vom 15. Mai 2002 sprachen sich einige Mitglieder sogar für die Streichung von Art. 308 EG aus, vgl. CONV 47 / 02, S. 15.
§ 9 Die Zuständigkeiten der Union
227
(1) „den Bereich der [Unions-]Befugnisse über den allgemeinen Rahmen [des Vertrags] hinaus auszudehnen“ oder Bestimmungen zu erlassen, „die der Sache nach, gemessen an ihren Folgen, auf eine Vertragsänderung“ hinausliefen200, oder (2) Harmonisierungsmaßnahmen in den Politikbereichen zu erlassen, in denen die Union eine Harmonisierung ausschließe.201 Der Konvent entschied sich für die zweite Möglichkeit und fügte einen entsprechenden Absatz 3 dem Art. I-18 EVV an.202 Damit wurden die vom EuGH vorgegebenen Grenzen für die Heranziehung des Art. 308 EG in den Verfassungsvertrag aufgenommen. Im Vergleich zu Art. 308 EG bleibt das Erfordernis der einstimmigen Entscheidung des Ministerrates bestehen. Allein dieses Einstimmigkeitserfordernis wird im Hinblick auf eine Union mit 25 (oder künftig noch mehr) Mitgliedstaaten zu einer faktischen Zurückdrängung von Unionsmaßnahmen führen, die sich auf Art. I-18 EVV stützen. Neu ist, dass das Europäische Parlament nun nicht mehr nur angehört werden, sondern einer Regelung nach Art. I-18 EVV zustimmen muss. Dies bedeutet eine wichtige demokratische Kontrolle im Bereich der Kompetenzen der Union. Dagegen wurde die derzeitige Einschränkung des Art. 308 EG, wonach ein Tätigwerden der Gemeinschaft erforderlich ist, um „im Rahmen des Gemeinsamen Marktes“ eines ihrer Ziele zu verwirklichen, durch die Formulierung ersetzt: „Erscheint ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in Teil III festgelegten Politikbereiche erforderlich, um eines der Ziele der Verfassung zu verwirklichen, . . .“. Der entsprechende Halbsatz in Art. 308 EG entfaltet jedoch nach derzeitiger Praxis faktisch keine einschränkende Wirkung, da er so ausgelegt wird, dass hierdurch allein solche Vorschriften verhindert werden sollen, die negative Auswirkungen auf das System des Gemeinsamen Marktes haben.203 Die fehlende Bezugnahme 200 Die Arbeitsgruppe V zitierte hier das Gutachten 2 / 94 des EuGH (EuGH, Slg. 1996, I-1759 – Gutachten 2 / 94, EMRK). 201 Die Arbeitsgruppe V nahm hier Bezug auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates (Edinburgh) von 1992. Nach Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (521) ist die Aufnahme dieser Klausel „im Lichte des Grundsatzes systematischer Interpretation eigentlich eine Selbstverständlichkeit, deren Betonung aber politisch wichtig“. 202 Hierzu ausführlich Ludwig, ZEuS 2004, 211 (238 ff.). Art. I-18 Abs. 3 EVV lautet: „Die auf diesem Artikel beruhenden Maßnahmen dürfen keine Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in den Fällen beinhalten, in denen eine solche Harmonisierung nach der Verfassung ausgeschlossen ist.“ 203 Unter Hinweis auf die anderen Sprachfassungen des EG-Vertrags auch Ludwig, ZEuS 2004, 211 (238). In der Praxis wurden über die Jahre hinweg in allen Bereichen des EG-Vertrages Maßnahmen auf Art. 308 EG gestützt, zum Beispiel in den Bereichen Zahlungsbilanzbeihilfen für Drittstaaten, Rechte des geistigen Eigentums, Energie, Katastrophenschutz, Schaffung von Einrichtungen. Siehe auch Wuermeling, EuropaR 2004, 216 (228).
15*
228
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
auf den Gemeinsamen Markt führt daher nicht zu einer Erweiterung der Befugnisse der Union im Vergleich zu Art. 308 EG.204 Man kann sogar im Gegenteil von einer Beschränkung der Befugnisse der Union ausgehen, da nun mit dem Hinweis auf Teil III der Verfassung ein Rahmen für den Anwendungsbereich des Art. I-18 EVV gesteckt wurde.205 In Zukunft ist es daher nicht möglich, den Bereich der Unionsbefugnisse – durch die Schaffung neuer Politikbereiche – über den allgemeinen, durch Teil III festgesetzten Rahmen hinaus auszudehnen.206 Demgegenüber ist zu beachten, dass Art. I-18 EVV auch auf die GASP als einem ausdrücklich in Teil III geregelten Politikbereich Anwendung finden kann.207 Diese Erstreckung auf den GASP-Bereich wird aber praktisch wenig relevant, da die Kompetenzen der Union in diesem Bereich ohnehin sehr weit gehen und außerdem die Flexibilisierungsinstrumente (zum Beispiel die „Verstärkte Zusammenarbeit“) durch den Verfassungsvertrag deutlich ausgebaut worden sind. Dem Vorschlag, eine gerichtliche Vorabprüfung nach dem Beispiel des Art. 300 Abs. 6 EG oder des Art. 95 Abs. 3, 4 KS in der Verfassung zu installieren, kam der Konvent nicht nach. Damit kann ex ante kein Gutachten des Gerichtshofs bezüglich des Vorliegens der Voraussetzungen des Art. I-18 EVV eingeholt werden. Der jeweilige Kläger ist auf nachträglichen Rechtsschutz angewiesen. Ebenso vom Konvent verworfen wurde die Idee, wonach Rechtsakte, die auf der Grundlage von Art. I-18 EVV (einstimmig) erlassen worden sind, mit qualifizierter Mehrheit wieder aufhebbar gewesen wären.208 Hinzuweisen ist schließlich auf Art. I-18 Abs. 2 EVV. Dieser neu eingefügte Absatz verpflichtet die Kommission, die nationalen Parlamente von Maßnahmen, die aufgrund von Art. I-18 EVV ergriffen werden sollen, zu unterrichten. Diese Informationspflicht soll den nationalen Parlamenten die Möglichkeit eröffnen, möglichst frühzeitig ein gerichtliches Verfahren zur Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips in Erwägung ziehen zu können. Damit kann die oben beschriebene politische Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips auch im Bereich von Art. I-18 EVV stattfinden. Aus integrationspolitischer Sicht ist es sicherlich begrüßenswert, dass der Union auch weiterhin ein Instrument an die Hand gegeben wird, damit sie auf unvor204 Zweifelnd hingegen Görlitz, DÖV 2004, 374 (382), der eine „möglicherweise kompetenzerweiternde Modifizierung“ sieht. 205 Die Kommission sprach sich gegen die Begrenzung auf Materien des Teils III der Verfassung aus, Wuermeling, EuropaR 2004, 216 (228). 206 Ludwig, ZEuS 2004, 211 (238); zweifelnd Trüe, ZaöRV 2004, 391 (424). 207 von Bogdandy / Bast / Westphal, Integration 2003, 414 (417). 208 Im Konvent wurde sogar angeregt, dass künftig Flexibilität in beide Richtungen möglich sein sollte, dass also eine bereits bestehende Zuständigkeit der Union auch eingeschränkt werden kann, CONV 624 / 03, S. 7 (Rdnr. 21); dieser Vorschlag wurde jedoch verworfen. Ebenso erging es einem anderen Vorschlag, der vorsah, die Anwendung von Rechtsakten, die nach diesem Verfahren angenommen wurden, zeitlich zu begrenzen („sunset clause“), CONV 601 / 03, S. 13 (Rdnr. 29).
§ 9 Die Zuständigkeiten der Union
229
hergesehene Situationen flexibel reagieren kann.209 Gleichzeitig wird die Flexibilitätsklausel an die Beteiligung des Europäischen Parlaments, der nationalen Parlamente und an das Einstimmigkeitsprinzip zurückgebunden. Insgesamt ist sie im Vergleich zur derzeitigen Regelung näher präzisiert und eingeschränkt worden.210 Die prinzipielle Schwierigkeit bei der Schaffung einer Flexibilitätsklausel, ein Gleichgewicht zwischen der erforderlichen Flexibilität für Maßnahmen auf europäischer Ebene und der notwendigen Achtung der Grenzen für die Zuständigkeiten der Union herzustellen, wurde mit der Formulierung des Art. I-18 EVV gut gelöst.
7. GASP, Art. I-16 EVV Die Zuständigkeit im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik nimmt – ebenso wie die Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik nach Art. I-15 EVV – eine Sonderstellung im Rahmen des neu geschaffenen Kompetenzgefüges der Union ein. Der Konvent konnte sich nicht darauf einigen, den betreffenden Bereich in die geteilte Zuständigkeit aufzunehmen.211 Im Zusammenhang mit den ebenfalls in Teil I der Verfassung enthaltenen besonderen Bestimmungen über die GASP (Art. I-40 f. EVV) sind hier demnach noch Überreste der ehemaligen Säulenstruktur vorhanden.212 Aus systematischer Sicht scheint es wenig überzeugend, die GASP (und die Koordinierung der Wirtschaftspolitik) in eigenständigen Artikeln im Rahmen des Kompetenztitels zu erwähnen, da es sich hier nicht um eine Zuständigkeitsart im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr um eine Einzelermächtigung handelt.213 Die Konsequenzen der Schaffung einer eigenen Rechtsgrundlage bleiben unklar, da sich Art. I-12 Abs. 4 EVV lediglich darauf beschränkt, den Bereich der GASP zu nennen, ohne besondere Folgen an diese „Kategorie“ zu knüpfen. 209 Papier, Festvortrag anlässlich des 65. Deutschen Juristentags 2004, Pressemitteilung Nr. 3 / 2004, S. 7, meint demgegenüber, die Flexibilitätsklausel sei verfassungspolitisch fragwürdig. Er gibt zu bedenken, ob angesichts der jahrzehntelangen Erfahrung mit dem Vollzug des Primärrechts derartige Klauseln nicht entbehrlich seien. 210 Schwarze, EuropaR 2003, 535 (545). 211 Einige Mitglieder des Konvents schlugen (ohne Erfolg) vor, diesen Artikel zu streichen, was zur Folge gehabt hätte, dass die GASP nach allgemeinen Regeln in den Bereich der geteilten Zuständigkeit gefallen wäre, vgl. CONV 624 / 03, S. 6 (Rdnr. 19). 212 Der Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, der nach dem EU-Vertrag noch die „dritte Säule“ der Union bildet, wurde durch den Verfassungsvertrag in die Vorschriften des Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts eingereiht und findet sich nun in Art. III-270 ff. EVV. Diesbezügliche Sonderregeln in Teil I der Verfassung existieren nur in Art. I-42 Abs. 3 EVV, wonach den Mitgliedstaaten ein Initiativrecht im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen eingeräumt wird. 213 Siehe zu diesem Problem weiterführend unten, § 10 II. 2. b) und CONV 624 / 03, S. 4 (Rdnr. 11).
230
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Im Verfassungsvertrag ist erstmals von dem Begriff der „Zuständigkeit“ im Rahmen der GASP die Rede. Auch wenn die Handlungsermächtigung schon nach jetziger Regelung im EU-Vertrag die gesamte Außenpolitik der Union umfasst, so macht Art. I-16 EVV sprachlich noch deutlicher, dass keinerlei Begrenzungen bezüglich des Umfangs der Kompetenzen der Union im Bereich der Außenpolitik bestehen. Hinsichtlich der Art der Maßnahmen gibt es allerdings eine Beschränkung: Im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sind Europäische Gesetze und Rahmengesetze ausgeschlossen (Art. I-40 Abs. 6 EVV).
8. Die Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik, Art. I-15 EVV Bereits nach dem EG-Vertrag zielt die Tätigkeit der Gemeinschaft vor allem darauf ab, die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten dadurch zu koordinieren, dass die Gemeinschaft Empfehlungen zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten abgibt und die Entwicklung der Haushaltslage und der Höhe des öffentlichen Schuldenstands in den Mitgliedstaaten überwacht.214 Die Durchführung der Wirtschaftspolitik in den Mitgliedstaaten obliegt dagegen den Mitgliedstaaten selbst. Ähnliches gilt für den Bereich Beschäftigung. Hier trägt die Gemeinschaft zu einem hohen Beschäftigungsniveau bei, indem sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert und deren Maßnahmen in diesem Bereich unterstützt und erforderlichenfalls ergänzt. Die Zuständigkeit im Beschäftigungsbereich verbleibt bei den Mitgliedstaaten, eine Harmonisierung vonseiten der Gemeinschaft ist ausgeschlossen.215 Der Bereich der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik unterfällt somit zur Zeit den ergänzenden Zuständigkeiten der Gemeinschaft. Insofern ist es – wie auch im Bereich der GASP – aus systematischer Sicht unverständlich, warum diese Kompetenz nicht in das neu geschaffene Kompetenzsystem eingeordnet wurde.216 Die Gründe sind wohl eher politischer als rechtlicher Natur. Der Konvent konnte sich weder darauf einigen, den genannten Bereich in die geteilte Zuständigkeit einzuordnen, da dies bei einer Regelung durch die Union einen Ausschluss mitgliedstaatlicher Kompetenz zur Folge gehabt hätte, noch sollte der Bereich in den UnCONV 47 / 02, S. 26. CONV 47 / 02, S. 27. 216 Das Präsidium begründete die Einordnung folgendermaßen: „Der Konvent ist der Auffassung, dass aufgrund des besonderen Charakters der Koordinierung der Politiken der Mitgliedstaaten in den Bereichen Wirtschaft und Beschäftigung eine gesonderte Bestimmung erforderlich ist.“ CONV 724 / 03, S. 68 (Rdnr. 25). Was den „besonderen Charakter“ der Politik ausmacht, wird nicht genauer ausgeführt. Kritisch daher auch Craig, ELRev 2004, 323 (337 f.). 214 215
§ 9 Die Zuständigkeiten der Union
231
terstützungsmaßnahmen zugeschlagen werden, da einige Konventsmitglieder diese Kategorie für zu schwach hielten.217 Im Übrigen betrifft die Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik nur innergemeinschaftliche Fragestellungen, sodass eine vertiefte Auseinandersetzung im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht angezeigt ist.
III. Achtung der nationalen Identität der Mitgliedstaaten, Art. I-5 EVV Die Arbeitsgruppe V forderte, dass deutlich gemacht werden müsse, dass die Union bestimmte wesentliche Befugnisse der Mitgliedstaaten achtet. Trotz des Bezugs zu den Zuständigkeitsfragen entschloss sich der Konvent, eine solche Vorschrift nicht Titel III „Die Zuständigkeiten der Union“, sondern Titel I „Definition und Ziele der Union“ zuzuordnen. Der betreffende Grundsatz wurde bisher kurz und knapp in Art. 6 Abs. 3 EU „Die Union achtet die nationale Identität ihrer Mitgliedstaaten.“ geregelt. Fraglich blieb jedoch, welches die wesentlichen Bestandteile der nationalen Identität der Mitgliedstaaten, die die Union bei der Wahrnehmung ihrer Zuständigkeiten zu achten hat, sind.218 Zur Beantwortung dieser Frage lassen sich die identitätsstiftenden Kompetenzen in zwei Kategorien einteilen, und zwar einmal in grundlegende Strukturen und wesentliche Aufgaben eines Mitgliedstaates und zum anderen in grundlegende Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Ordnung und der gesellschaftlichen Werte eines Mitgliedstaates. Art. I-5 Abs. 1 EVV verpflichtet nun die Union zum einen, die grundlegenden politischen und verfassungsrechtlichen Strukturen einschließlich der regionalen und kommunalen Selbstverwaltung (erste Kategorie) sowie die territoriale Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der nationalen Sicherheit zu achten (zweite Kategorie).219 Entgegen dem ausdrücklichen Vorschlag der Arbeitsgruppe V wurde die Präzisierung der nationalen Identität im Verfassungsvertrag nicht auf die Bereiche Staatsangehörigkeit, rechtlicher Status der Kirchen und Glaubengemeinschaften, Wahl der Sprachen, Politik der Einkommensverteilung, Erhebung und Einzug der direkten Steuern, System der Sozialleistungen, Bildungswesen, öffentliches Gesundheitswesen, Erhaltung und Entwicklung des Kulturgutes, Wehrpflicht und Ersatzdienst ausgedehnt.220 Craig, ELRev 2004, 323 (338). Bereiche, die im EG-Vertrag ausdrücklich den Mitgliedstaaten vorbehalten werden, sind vor allem: öffentliche Ordnung und öffentliche Sicherheit, Anwendung des Strafrechts und Strafrechtspflege, Arbeitsentgelt, Koalitionsrecht, Streikrecht und Aussperrungsrecht, Eigentumsordnung, Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung. 219 Die Regierungskonferenz fügte dem Konventsentwurf schließlich noch hinzu, dass die Union die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor der Verfassung achtet. 217 218
232
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Mit Art. I-5 EVV wurde Art. 6 EU zu einer Garantie „föderaler Grundrechte“ fortentwickelt.221 Der genannte Artikel bedeutet ferner eine wichtige Konkretisierung des allgemeinen Prinzips der Unionstreue. Sinn des Art. I-5 Abs. 1 EVV ist es, im Verfassungsvertrag ausdrücklich die Rolle und Bedeutung der Mitgliedstaaten zu garantieren und gleichzeitig den erforderlichen Spielraum für Flexibilität im europäischen System zu schaffen.
IV. Weitere allgemeine Grundsätze Entsprechend den Empfehlungen der Arbeitsgruppe V wurde, neben den oben beschriebenen Prinzipien, mit Art. I-6 EVV der Grundsatz des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts in den Verfassungsvertrag aufgenommen, welcher bisher zwar zum acquis communautaire gehörte, als Richterrecht aber nicht in den Primärverträgen verankert war. Nicht in Titel III über die Zuständigkeiten der Union, wohl aber in Titel I (Definition und Ziele der Union) wurde der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit im Verfassungsvertrag festgeschrieben (Art. I-5 Abs. 2 UAbs. 1 EVV). Teilweise sind hierbei Formulierungen aus Art. 10 EG übernommen worden. Ebenso wurde zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus der Verfassung oder aus Handlungen der Organe der Union ergeben, der Grundsatz der Umsetzung und Durchführung durch die Mitgliedstaaten durch Art. I-5 Abs. 2 UAbs. 2 EVV in den Vertrag eingefügt.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union I. Einführung Die besondere Bedeutung der Außenbeziehungen für die Europäische Union ist bereits im Zweiten Teil der Arbeit dargestellt worden. Ebenso wurden die Probleme dargelegt, die aufgrund der vielfältigen Interessen innerhalb der Union, der zahlreichen Repräsentationspersonen und Entscheidungsträger und nicht zuletzt aufgrund der auf verschiedene Akteure verteilten Kompetenzen entstehen. Es wurde deutlich, dass ein gemeinsames Auftreten der Union in der Welt große Vorteile 220 Die Mehrheit der Redner auf der Plenartagung vom 15. 04. 2002 nannte (exemplarisch) die folgenden Bereiche, die auch weiterhin in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen sollten, CONV 40 / 02 S. 4 (Rdnr. 5): interne Organisation der Staaten, öffentlicher Dienst, Kultur, Sozialversicherung. 221 So Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (536) unter Bezugnahme auf einen Vorschlag von Ingolf Pernice.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
233
mit sich brächte. Internationale Entwicklungen lassen sich von einzelnen Staaten weitaus schwerer beeinflussen als durch ein vereintes Vorgehen. Da der europäische Einigungsprozess dazu geführt hat, dass immer mehr gemeinsame Interessen und Werte vorhanden sind, ist ein integriertes Konzept zu deren Verteidigung nötig geworden.222 Hierbei ist zu beachten, dass ein gemeinsames globales Handeln weitgehend von dem politischen Willen und von der Solidarität unter den Mitgliedstaaten abhängt. Aus der Sicht einer integrierten europäischen Außenpolitik ist es problematisch, dass die Mitgliedstaaten noch immer die Außenpolitik als Kernstück ihrer nationalen Souveränität ansehen. Internationale Ereignisse rufen von Land zu Land unterschiedliche Reaktionen beziehungsweise Reaktionen von unterschiedlicher Intensität hervor; dies macht Mechanismen nötig, die die Konvergenz der Standpunkte und den Sinn für Solidarität fördern.223 Die beschriebenen Probleme sind schon seit langem bekannt; eine Lösung konnte im Rahmen der bisherigen Integration Europas noch nicht gefunden werden. Der Konvent nahm sich dieser Problematik ausdrücklich an und erstellte neue Konzepte für interessengerechte Lösungen. Im Folgenden soll untersucht werden, inwiefern der Verfassungsvertrag neue Wege vorzeichnet und wie erfolgreich diese sein können.
1. Das neue System und seine Ziele: Verständlichkeit, Klarheit, Kohärenz zwischen innen- und außenpolitischem Handeln a) Die Bündelung der Vorschriften über das außenpolitische Handeln in einem besonderen Titel des Verfassungsvertrags (Art. III-292 bis III-329 EVV) Die für den Bereich „Außenpolitisches Handeln“ zuständige Arbeitsgruppe unterstrich zunächst, dass die dem gesamten Bereich der Außenpolitik der Union zugrunde liegenden Prinzipien und Gesamtziele in einer für die Bürger und die Partner der Union verständlichen und nachvollziehbaren Weise formuliert werden müssten.224 Außerdem sollten die Artikel der geltenden Verträge, die das außenpolitische Handeln der Union betreffen, in wenigen Vorschriften gebündelt werden. Ziel war es, die Kohärenz225 und Effizienz des außenpolitischen Handelns der 222 So auch die weitaus überwiegende Meinung in der Gruppe VII „Außenpolitisches Handeln“, CONV 459 / 02, S. 12 (Rdnr. 5). 223 CONV 459 / 02, S. 12 (Rdnr. 6). 224 Siehe sogleich unten, § 10 I. 2. 225 Kohärent = zusammenhängend (von cohaerens, Part. Präs. von cohaerere, lat. „zusammenhängend“) Kohärenz = Zusammenhang von cohaerentia, lat. „Zusammenhang, das Zusammenhängen“, vgl. Duden, Das große Fremdwörterbuch, Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. Bei dem Wort „Kohärenz“ sind linguistische Schwierigkeiten zu beachten; während in der deutschen, französischen und spanischen Sprachfassung der gleiche Wortstamm verwendet wird („Kohärenz“, „cohérence“ und „coherencia“), ist in der englischen Version von „consistency“ die Rede (vgl. nur Art. I-19 EVV). Laut Duden heißt Konsistenz
234
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Union zu maximieren, insbesondere im Hinblick auf die unterschiedlichen Zuständigkeiten zwischen der Union und den Mitgliedstaaten und auf die verschiedenen Beschlussfassungsverfahren.226 Mit der Einfügung eines eigenen Titels V „Auswärtiges Handeln der Union“ in Kombination mit den an den Anfang der Verfassung gestellten Kompetenzvorschriften ist dieses Ziel weitgehend erreicht worden.227 Auch wenn für eine exakte Kompetenzbestimmung auch weiterhin die Analyse der einzelnen Bestimmungen des jeweiligen Politikbereichs notwendig sein wird, so ist doch der große Rahmen der Außenpolitik der Union übersichtlich in einigen wenigen Vorschriften abgesteckt worden. Die neu geschaffene Struktur gewährt eine klare und kohärente Übersicht darüber, wie die Union auf internationaler Ebene handeln kann. Dabei führt diese Struktur nicht zu einer Harmonisierung von Instrumenten oder Verfahren, da weiterhin für die einzelnen Politikbereiche unterschiedliche Modalitäten gelten.228 Angestrebt und letztlich auch verwirklicht wurde ein koordiniertes Vorgehen bei der Planung, Umsetzung und Kontrolle des außenpolitischen Vorgehens innerhalb des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission. Die Rolle des Europäischen Rates bei der Festlegung der allgemeinen und strategischen Leitlinien der EU-Außenpolitik als ein wesentlicher Faktor für die Gesamtkohärenz des Handelns der EU auf internationaler Ebene sticht hierbei hervor. Eine Stärkung des Europäischen Parlaments wurde zwar von weiten Teilen des Konvents gefordert, eine wesentliche Macht- beziehungsweise Kompetenzerweiterung des Parlaments konnte sich im Konvent jedoch nicht durchsetzen.229 Der Vorschlag der Arbeitsgruppe Außenpolitisches Handeln, eine spezifische Ratsformation „Außenpolitisches Handeln“ zu bilden, wurde indes mit Art. I-24 Abs. 3 EVV umgesetzt. b) Die Schaffung einer neuen Ratsformation „Auswärtige Angelegenheiten“, Art. I-24 Abs. 3 EVV Nach derzeitigem Recht tagt der Ministerrat, dem Beschluss des Europäischen Rates von Sevilla folgend, in der Ratsformation „Allgemeine Angelegenheiten und = 1. Dichtigkeit; Zusammenhang 2. Widerspruchslosigkeit (von consistere, lat. „sich setzen, dicht werden“). Auf die Unterschiedlichkeit der Begriffe im Hinblick auf Art. 3 EU weist Gauttier, ELRev. 2004, 23 (25 f.) hin. Ihm zufolge bedeutet consistency die Abwesenheit von Widersprüchen zwischen einzelnen Aspekten verschiedener Politikbereiche, coherence dagegen die Schaffung von Synergie zwischen den genannten Aspekten. 226 Zur Frage, ob das europäische Recht allgemein mit einer einzigen „Stimme“ sprechen kann, vgl. Besson, ELJ 2004, 257 ff. 227 Positiv auch Kietz / Uplegger, Integration 2005, 87 (87). 228 CONV 727 / 03, S. 50. Die Bündelung der Vorschriften über das außenpolitische Handeln selbst führt nicht zu einem Kompetenzzuwachs für die Union; missverständlich insoweit Kietz / Uplegger, Integration 2005, 87 (94). 229 Eine gewisse Ausnahme bildet das dem Europäischen Parlament vom Verfassungsvertrag eingeräumte Zustimmungsrecht für internationale Übereinkommen im Handelsbereich, vgl. Art. III-315 EVV.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
235
Außenbeziehungen“.230 Die angesprochene Formation griff der Konvent auf und ging über diesen Beschluss hinaus, indem er die Aspekte des außenpolitischen Handelns formell vom Aspekt der allgemeinen Angelegenheiten trennte; demzufolge wurden zwei eigenständige Ratsformationen geschaffen, zum einen ein Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ (Art. I-24 Abs. 2 EVV), zum anderen ein Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ (Art. I-24 Abs. 3 EVV).231 Damit wird die Union künftig über zwei ständige Ratsformationen verfügen.232 Der Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ gestaltet das auswärtige Handeln der Union entsprechend den strategischen Vorgaben des Europäischen Rates. Er befasst sich nicht mit allgemeinen Angelegenheiten der Union. Der Ministerrat ist, ebenso wie der Europäische Rat, dazu verpflichtet, die Kohärenz des Handelns der Union zu achten. Die Schaffung der Ratsformation „Auswärtige Angelegenheiten“ birgt die Chance für den Außenminister der Union, mittel- und langfristige Zielsetzungen zu verfolgen, um die Außenpolitik effektiver zu gestalten und einen neuen Einflussbereich zu schaffen.233 2. Allgemeine Grundsätze und Ziele beim Auswärtigen Handeln der Union, Art. III-292 EVV Die derzeitige Europäische Union verfügt zwar mit Art. 2 EU und Art. 2, 3 EG über Zielbestimmungen, diese betreffen jedoch nicht die Außenbeziehungen der Union. Diesbezüglich enthält lediglich Art. 2 2. Gedankenstr. EU den bloßen Hinweis darauf, dass die Union ihre Identität auf internationaler Ebene behaupten soll. Welcher Natur diese Identität sein soll, bleibt allerdings offen.234 Die impliziten Außenkompetenzen werden von den Zielen und der Reichweite der internen Kompetenzen bestimmt. Die Handelspolitik zum Beispiel hat jedoch andere Ziele als die Entwicklungshilfepolitik, welche wiederum andere Ziele hat als die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Insofern gibt es keine einheitliche Außenpolitik, sondern eine Vielzahl von Politiken, die nach außen gerichtet sind und unterschiedliche Ziele verfolgen. Der Verfassungsvertrag versucht nun, diese verschiedenen Zielvorstellungen aufzubrechen und einen einheitlichen und systematischen Rahmen von Zielen für das auswärtige Handeln der Union zu setzen.235 Mit Art. Vgl. Art. 2 der Geschäftsordnung des Rates vom 22. 7. 2002. Dies schließt nicht aus, dass die Mitgliedstaaten in beiden Ratsformationen von ein und demselben Minister vertreten werden können, CONV 459 / 02, S. 18 (Rdnr. 25). 232 Schwarze, EuropaR 2003, 535 (551). Von der geplanten Schaffung eines Rates „Gesetzgebung“ wurde dagegen abgesehen. Damit verbleibt es bei dem bisherigen Konzept der „Fachräte“ in der jeweiligen bisherigen Zusammensetzung. Jede Formation wird auch weiterhin Legislativbefugnisse wahrnehmen können. 233 Thym, ELJ 2004, 5 (9). 234 Cremona, CMLRev. 2004, 553 (566). 235 Diesem Ziel dient auch die Schaffung eines einzigen Titels, der die verschiedenen Aspekte des außenpolitischen Handelns betrifft (Titel V Auswärtiges Handeln der Union, Art. III-292 ff. EVV). 230 231
236
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
III-292 EVV sind die dem außenpolitischen Handeln der Union zugrunde liegenden Ziele, Werte und Prinzipien erstmals an einer einzigen Stelle vertraglich niedergelegt worden. Die neue Vorschrift entspricht in Teilen den Art. 11 und 12 EU, geht an vielen Stellen aber über diese hinaus. Art. III-292 EVV gilt, als erster Artikel unter dem Kapitel I „Allgemein anwendbare Bestimmungen“, für alle folgenden Kapitel des Titels V „Auswärtiges Handeln der Union“ und stellt damit einen horizontalen Artikel dar.236 In einigen Vorschriften der Verfassung wird – ungeachtet der allgemeinen Geltung des Art. III-292 EVV – zusätzlich auf die Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union Bezug genommen.237 Wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung soll Art. III-292 EVV hier kurz wiedergegeben werden: Artikel III-292 EVV (1) Die Union lässt sich bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene von den Grundsätzen leiten, welche für ihre eigene Entstehung, Entwicklung und Erweiterung maßgebend waren und denen sie auch weltweit zu stärkerer Geltung verhelfen will: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Achtung der Menschenwürde, der Grundsatz der Gleichheit und der Grundsatz der Solidarität sowie die Achtung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts. Die Union strebt an, die Beziehungen zu Drittländern und zu regionalen oder weltweiten internationalen Organisationen, die die in Unterabsatz 1 aufgeführten Grundsätze teilen, auszubauen und Partnerschaften mit ihnen aufzubauen. Sie setzt sich insbesondere im Rahmen der Vereinten Nationen für multilaterale Lösungen bei gemeinsamen Problemen ein. (2) Die Union legt die gemeinsame Politik sowie Maßnahmen fest, führt diese durch und setzt sich für ein hohes Maß an Zusammenarbeit auf allen Gebieten der internationalen Beziehungen ein, um a) ihre Werte, ihre grundlegenden Interessen, ihre Sicherheit, ihre Unabhängigkeit und ihre Unversehrtheit zu wahren; b) Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte und die Grundsätze des Völkerrechts zu festigen und zu fördern; c) nach Maßgabe der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen sowie der Prinzipien der Schlussakte von Helsinki und der Ziele der Charta von Paris, einschließlich derjenigen, die die Außengrenzen betreffen, den Frieden zu erhalten, Konflikte zu verhüten und die internationale Sicherheit zu stärken; d) die nachhaltige Entwicklung in Bezug auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in den Entwicklungsländern zu fördern mit dem vorrangigen Ziel, die Armut zu beseitigen; e) die Integration aller Länder in die Weltwirtschaft zu fördern, unter anderem auch durch den schrittweisen Abbau internationaler Handelshemmnisse;
CONV 685 / 03, S. 3 (Rdnr. 5). So zum Beispiel in Art. III-315 Abs. 1 EVV für die gemeinsame Handelspolitik, außerdem in Art. III-316 Abs. 1 EVV, Art. III-319 Abs. 1 EVV, Art. III-321 Abs. 1 EVV. 236 237
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
237
f) zur Entwicklung von internationalen Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Umwelt und der nachhaltigen Bewirtschaftung der weltweiten natürlichen Ressourcen beizutragen, um eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen; g) den Völkern, Ländern und Regionen, die von Naturkatastrophen oder von vom Menschen verursachten Katastrophen betroffen sind, zu helfen; und h) eine Weltordnung zu fördern, die auf einer verstärkten multilateralen Zusammenarbeit und einer verantwortungsvollen Weltordnungspolitik beruht. (3) Die Union wahrt bei der Ausarbeitung und Umsetzung ihres auswärtigen Handelns in den verschiedenen unter diesen Titel fallenden Bereichen sowie der externen Aspekte der übrigen Politikbereiche die in den Absätzen 1 und 2 genannten Grundsätze und Ziele. Die Union achtet auf die Kohärenz zwischen den einzelnen Bereichen ihres auswärtigen Handelns sowie zwischen diesen und ihren übrigen Politikbereichen. Der Rat und die Kommission, die vom Außenminister der Union unterstützt werden, stellen diese Kohärenz sicher und arbeiten zu diesem Zweck zusammen.
Art. III-292 Abs. 1 EVV spiegelt viele der Werte und Ziele der Union wider, die in Teil I der Verfassung, insbesondere in Art. I-2 und I-3 Abs. 4 EVV, genannt sind.238 Art. III-292 Abs. 2 EVV spezifiziert die genannten Ziele in Form einer Auflistung (lit. a-h). Hierin sind bereits bekannte Zielbestimmungen, vor allem aus den derzeitigen Bestimmungen über die GASP (Art. 11 EU), die gemeinsame Handelspolitik (Art. 131 EG), die Entwicklungszusammenarbeit (Art. 177 EG) und die Umweltpolitik (Art. 174 EG) enthalten.239 Darüber hinaus werden neue Zielvorstellungen, etwa ein hohes Maß an Zusammenarbeit auf allen Gebieten der internationalen Beziehungen oder eine verantwortungsvolle Weltordnungspolitik in den Katalog aufgenommen. Auch wenn viele Werte und Prinzipien bekannt vorkommen, macht die Zusammenstellung in einer Vorschrift klar, dass diese Ziele künftig alle Aspekte des auswärtigen Handelns betreffen. Die gemeinsame Handelspolitik wird daher in Zukunft nicht mehr nur das Ziel haben, zur schrittweisen Beseitigung von Handelsschranken beizutragen, sondern sie wird gleichzeitig auch das Mandat haben (müssen), zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen und Menschenrechte zu achten.240 Die Festlegung eines allgemeingültigen Rahmens für die Außenpolitik verschafft der Union eine Identität, die nach innen wie nach außen wirkt.241 Die expliziten Ziele tragen zu mehr Transparenz im Verhältnis zu den europäischen Bürgern wie auch zur übrigen Welt bei. Schließlich enthält Art. III-292 Abs. 3 EVV eine zweifache Kohärenzbestimmung. Dessen Unterabsatz 1 regelt, dass die genannten Grundsätze und Ziele der 238 Teil I der Verfassung unterteilt die Vorschriften indes nicht in solche mit und solche ohne Außenbezug ein. Die Vorschriften in Teil I betreffend die Kompetenzen, den institutionellen Rahmen und die Ziele der Union gelten für das gesamte Unionshandeln. 239 Cremona, CMLRev. 2004, 553 (568). 240 Cremona, CMLRev. 2004, 553 (568); neben Art. III-292 Abs. 3 EVV legt Art. III-315 Abs. 1 EVV ausdrücklich fest, dass die gemeinsame Handelspolitik im Rahmen der Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union gestaltet wird. 241 Cremona, CMLRev 2003, 1347 (1348).
238
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Union nicht nur auf die rein außenpolitischen Themenbereiche Anwendung finden sollen, sondern auch dann, wenn es um externe Aspekte der internen Politikbereiche der Union geht. Unterabsatz 2 gestaltet das Kohärenzgebot in doppelter Hinsicht aus242; es wird zum einen auf die auswärtigen Politikbereiche untereinander, zum anderen aber auch auf das Verhältnis der Handlungen der Union zwischen den auswärtigen und den internen Politikbereichen der Union erstreckt. Der gemeinsame Zielkatalog ist damit die Rechtsgrundlage für eine kohärente Außenpolitik der Union und legt die grundsätzlichen Ziele der Politik explizit fest. Diese Funktion ist im Hinblick auf eine erweiterte Union, die in immer unterschiedlicheren Politikfeldern tätig wird, nicht zu unterschätzen.243 Die umfassende Definition der Ziele und Grundsätze des auswärtigen Handelns der Union soll nicht zuletzt für die Bürger und die Partner der Union Transparenz schaffen. Die Kehrseite der umfassenden Zielbestimmungen ist, dass die genannte Liste aufgrund ihrer Länge und Ausführlichkeit nicht zu einer Fokussierung auf bestimmte Bereiche führen wird. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass der Katalog des Art. III-292 EVV keine Prioritäten festlegt und auch keine Mechanismen vorsieht, wie Zielkonflikte gelöst werden sollen. Weder die einheitliche Zielbestimmung noch die Kohärenzbestimmung garantieren tatsächlich eine kohärente Außenpolitik, erforderlich wird vielmehr sein, dass in der Praxis ein gerechter Ausgleich potenziell konkurrierender Ziele und Interessen gefunden werden kann. Will man die Zielbestimmungen nicht als bloße „Vertragskosmetik“ abtun, so erscheinen sie auch kompetenztheoretisch nicht unproblematisch.244 Das Problem liegt weniger in der damit einhergehenden Moralisierung der Kompetenzordnung, welche die Freiheit politisch-verantwortlicher Entscheidung beeinträchtigt. Trägt man nämlich dem Gedanken des Vorrangs der Verfassung Rechnung, so muss man eine derartige Determinierung des politischen Gesetzgebers akzeptieren, eine solche liegt sogar in dem Wesen einer Verfassung begründet. Problematischer erscheint jedoch, dass die weit gefassten Zielbestimmungen als Einladung zu Kompetenzausgriffen gelesen werden können.245 Um einer solchen Interpretation entgegenzuwirken, muss auf die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts, insbesondere auf das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, und auf eine Kontrolle durch den EuGH verwiesen werden. 242 In Art. III-115 EVV, der ersten Vorschrift des Teils III der Verfassung, wird grundsätzlich geregelt, dass die Union auf die Kohärenz zwischen der Politik und den Maßnahmen in den verschiedenen Politikbereichen zu achten hat. 243 Cremona, CMLRev. 2004, 553 (568). Positiv hinsichtlich des konstitutiven und verpflichtenden Charakters der außenpolitischen Ziele der Union auch Risse, Integration 2003, 564 (566). Zweifelnd, ob mit dem ausformulierten Zielkatalog eine neue Qualität der europäischen Außenpolitik verbunden ist, dagegen Kadelbach, in: Hofmann / Zimmermann, Eine Verfassung für Europa, S. 145 (155). 244 Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (539) zu den Diskriminierungsverboten. Der Gedanke trägt aber auch im Bereich der Ziele des auswärtigen Handelns. 245 Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (539).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
239
3. Strategische Interessen und Ziele der Union, Art. III-293 EVV Während in Art. III-292 EVV die allgemeinen Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union festgelegt wurden, enthält Art. III-293 EVV Regelungen über die strategischen Interessen und Ziele der Union. Die Vorschrift ist in Kapitel I des Titels V „Auswärtiges Handeln der Union“ enthalten und gilt damit als allgemeine Bestimmung für das gesamte auswärtige Handeln der Union. Wie Art. III-292 EVV ist damit auch Art. III-293 EVV ein horizontaler Artikel.246 Die Bestimmung der strategischen Interessen und Ziele der Union ist nicht auf den GASP-Bereich beschränkt; diese können vielmehr als integrativer Ansatz sowohl die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik als auch andere Bereiche des auswärtigen Handelns der Union betreffen. In der Vergangenheit wurde vielfach die mangelnde oder zu schwammige Zielsetzung der Union kritisiert, die oft dazu führte, dass Europa im Vergleich zu den kohärent formulierten und teilweise offensiv vertretenen strategischen Interessen anderer Akteure (zum Beispiel der USA) ins Hintertreffen geraten ist. Der Europäische Rat soll in Zukunft klare europäische Interessen definieren. Diese können die Beziehungen der Union zu einem Land oder einer Region oder ein bestimmtes Thema betreffen. Da reine Zielsetzungen ohne Konzepte zu ihrer Erreichung ineffektiv sind, muss die Vorschrift auch die Befugnis enthalten, zielführende Strategien für deren Umsetzung zu entwickeln. Für dahingehende Vorschläge wurde eine neue Art von Initiativen geschaffen (Abs. 2). Der Außenminister der Union und die Kommission sollen in Zukunft gemeinsame Initiativen für strategische Interessen und Ziele der Union entwerfen. Im Rahmen dieses gemeinsamen Vorschlages ist eine Aufgabenteilung vorgesehen: der Außenminister ist im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die Kommission in den anderen Bereichen des auswärtigen Handelns zuständig.247 Aufgrund von Art. III-293 EVV kann der Europäische Rat die Union ermächtigen, Rechtsakte aus unterschiedlichen Politikbereichen heranzuziehen, um den strategischen Ansatz der Union in Bezug auf ein Land, eine Region oder ein Thema konkret umzusetzen. Im Vergleich zu Art. 11 und 13 EU haben sich durch die Einführung des Art. III-293 EVV rechtlich jedoch wenige Änderungen ergeben. Nach Art. 13 Abs. 2 EU ist es bereits möglich, dass der Rat gemeinsame Strategien beschließt. Diese Möglichkeit ist zwar bisher im EU-Vertrag im Bereich der GASP geregelt, solche gemeinsame Strategien können aber auch außenpolitische Maßnahmen der Gemeinschaft betreffen.248 Insofern stellt Art. III-293 EVV keine Neuerung dar, weil nach wie vor das gesamte auswärtige Handeln der Union für ein bestimmtes strateCONV 685 / 03, S. 3 (Rdnr. 5). Vgl. zu einem anderen Fall eines „Aufgabensplittings“ zwischen Außenminister und Kommission Art. III-325 Abs. 3 EVV und die Ausführungen unten, § 10 VII. 4. 248 Insoweit missverständlich Cremona, CMLRev. 2004, 553 (569). 246 247
240
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
gisches Ziel zur Verfügung steht. Die Möglichkeit des Art. 13 Abs. 2 EU wurde in der Praxis bisher kaum genutzt.249 Mit der Einführung des Art. III-293 EVV verband der Konvent die Hoffnung, dass auf dieses Instrument in Zukunft vermehrt zurückgegriffen wird. Um auf internationaler Ebene effizient handeln zu können, muss die Union nämlich bei der Verfolgung eines gemeinsamen strategischen Ziels Instrumente einsetzen können, die verschiedene Politikbereiche abdecken.250 Der integrative Ansatzpunkt des Art. III-293 EVV verspricht eine Stärkung des Kohärenzgedankens im Rahmen der Unionspolitik. Werden mehrere Politiken zu einer einheitlichen Strategie zusammengefasst, so ist zu erwarten, dass dadurch mehr für eine einheitliche und kohärente Politik getan wird als durch die bloße Forderung in Art. III-292 Abs. 3 EVV. Durch Art. III-293 EVV wird die führende Rolle des Europäischen Rates im Bereich des Auswärtigen Handelns der Union betont. Über die strategischen Interessen und Ziele der Union beschließt der Rat einstimmig. Ob mit der intensiveren Nutzung der Gemeinsamen Strategien eine Verschiebung der Machtbalance zugunsten des Europäischen Rates verbunden ist, scheint indes zweifelhaft.251 Zum einen besteht schon heute nach Erlass einer Gemeinsamen Strategie die Möglichkeit, diese im Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit auszugestalten. Bei dieser Ausgestaltung werden oft die praktisch relevantesten Fragen geregelt. Zum anderen behält die Kommission ihr Vorschlagsrecht, und der Außenminister der Union ist ebenfalls in den Entstehungsprozess der Gemeinsamen Strategien einbezogen. Mit Art. III-293 Abs. 2 EVV ist jetzt auch die innovative Möglichkeit einer gemeinsamen Initiative von Kommission und Außenminister in den Verfassungsvertrag aufgenommen worden.252
249 Seit 1997 wurden nur drei Gemeinsame Strategien beschlossen und zwar in Bezug auf Russland, die Ukraine und den Mittelmeerraum. Der seltene Gebrauch könnte auf die notwendige einstimmige Beschlussfassung zurückzuführen sein. Möglich ist aber auch, dass sich der Europäische Rat ungern durch den Beschluss einer formalen Strategie festlegt, sondern lieber flexibel auf verschiedene Situationen reagieren will. Es ist außerdem vorstellbar, dass wenige Gemeinsame Strategien beschlossen worden sind, weil zu ihrer Durchführung die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit ausreicht, was einige Mitglieder des Europäischen Rates möglicherweise verhindern wollten. Cremona, CMLRev. 2004, 553 (569) gibt schließlich zu bedenken, dass die Kommission ihre Initiative zur Politikbestimmung beibehalten wollte und insofern gegen Gemeinsame Strategien arbeitete. 250 CONV 727 / 03, S. 51; CONV 748 / 03, S. 11. 251 So aber Cremona, CMLRev. 2004, 553 (569), allerdings ohne nähere Begründung. 252 Dazu unten, § 10 II. 2. f) dd) (4).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
241
II. Geschriebene Außenkompetenzen 1. Zuständigkeit zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten je nach Politikbereich unterschiedlich abgegrenzt Wie bereits oben dargestellt253, ist der neuen Verfassung ein Kompetenzkatalog vorangestellt. Hierin werden die verschiedenen Zuständigkeitsbereiche der Union in die Kompetenzkategorien ausschließliche Zuständigkeit, geteilte Zuständigkeit und Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen (parallele Zuständigkeit) gegliedert. Daneben finden sich Spezialvorschriften in Bezug auf die Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik, die GASP, sowie eine Flexibilitätsklausel. Die jeweiligen Bereiche werden in einer bestimmten Kategorie schlagwortartig genannt. Der Umfang und die Tragweite der Kompetenz ergeben sich dann aus den jeweils passenden Bestimmungen in Teil III der Verfassung (Art. I-12 Abs. 6 EVV). Unterschiedliche Politikbereiche unterfallen demnach – wie schon bisher – unterschiedlichen Kompetenzkategorien, mit dem Unterschied, dass die Art der Kompetenzen nun explizit benannt wird. Hierbei wird nicht zwischen internen und externen Politikbereichen unterschieden. Die „Ausführungsvorschriften“ des Teils III geben nähere Auskunft über die Einzelheiten der Zuständigkeiten – einschließlich möglicher Vertragsschlusskompetenzen. So ermöglicht zum Beispiel Art. III-233 Abs. 4 EVV für den Bereich der Umweltpolitik den Abschluss internationaler Verträge über die Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Organisationen. Grundsätzlich zählt der Umweltbereich gemäß Art. I-14 Abs. 2 lit. e EVV zur geteilten Zuständigkeit der Union. Wichtige Politikbereiche mit außenpolitischem Bezug finden im Kompetenzkatalog vor allem in Art. I-16 EVV (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich der Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik) und in Art. I-13 Abs. 1 lit. e EVV (gemeinsame Handelspolitik) im Rahmen der ausschließlichen Zuständigkeit Erwähnung. 2. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik GASP, Art. I-16, I-40, III-294 ff. EVV a) Bestehende Situation / Integration der ehemaligen 2. Säule des EU-Vertrags Nach derzeit geltendem Recht ist die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP254) im EU-Vertrag unter Titel V (Art. 11 bis 28 EU) geregelt. Die 253
Vgl. § 9 II.
16 Metz
242
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ist als „zweite Säule“ innerhalb der Unionsarchitektur weitgehend intergouvernemental ausgestaltet. Die Europäische Union besitzt, anders als die Europäische Gemeinschaft, nach der hier vertretenen Auffassung (noch) keine Rechtspersönlichkeit. Sie kann daher rechtlich betrachtet weder als Zuordnungssubjekt für Rechte noch für Pflichten angesehen werden. Die im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik möglichen Handlungsformen (Art. 12 EU) werden durch ein Zusammenarbeiten der Regierungen der Mitgliedstaaten ermöglicht. Für die Entscheidungsprozesse der Union herrscht weitgehend das Einstimmigkeitsprinzip vor, dass heißt, eine einzige Gegenstimme eines Mitgliedstaats („Veto“) verhindert das Zustandekommen des ganzen Rechtsakts oder des gesamten Abkommens, auch wenn unter allen anderen Staaten Konsens besteht. Im Bereich der GASP wird oft über fehlende Kohärenz und Konsistenz geklagt.255 Im Kontrast zu der beschränkten tatsächlichen Tätigkeit umfasst der potentielle Aktionsradius der GASP den gesamten außenpolitischen Politikbereich. Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung ist daher wegen der umfangreichen Handlungsformen und der weit gesteckten Ziele (Art. 11 EU) praktisch nicht anwendbar. Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, wird mit der Schaffung eines einheitlichen Verfassungsvertrages die jetzige Säulenstruktur der Union aufgelöst. Die Vorschriften über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sind in Teil III Titel V Kapitel II des Verfassungsvertrages (Art. III-294 ff. EVV) integriert worden. Durch die Zusammenfassung nahezu aller Rechtsgrundlagen in einem Titel wird ein kohärenter Überblick über die verschiedenen, der Union auf internationaler Ebene zur Verfügung stehenden Instrumente ermöglicht. Die angesprochene Zusammenfassung der Artikel bedeutet jedoch nicht, dass für die verschiedenen Politikbereiche im Rahmen des außenpolitischen Handelns einheitliche Modalitäten gelten würden.256 Für den Bereich der GASP sind nämlich an mehreren Stellen der Verfassung Sonderregelungen eingezogen worden (vgl. Art. I-16, Art. I-40, ArtIII-294 ff. EVV). Die angesprochenen Spezialregelungen bestehen vorrangig aus dem grundsätzlichen Einstimmigkeitserfordernis und der untergeordneten Rolle des Europäischen Parlaments und der Kommission.257 Der Europäische Rat, welcher aus den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten zusammengesetzt ist, bestimmt die Leitlinien der Politik; unmittelbar wirksame Europäische Gesetze sind im Bereich der GASP ausgeschlossen. Behält man diese Sondervorschriften im Blick, so kann man sagen, dass die GASP in faktischer Hinsicht in den Händen 254 In europäischen Dokumenten wird oft die englische Bezeichnung: „Common Foreign and Security Policy (CFSP)“ gebraucht. 255 Hierzu insbesondere Gauttier, ELRev 2004, 23 (24 ff.). 256 CONV 748 / 03, S. 10. 257 Weder der EuGH noch das Europäische Parlament erhalten wesentlich neue Kompetenzen.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
243
der Mitgliedstaaten verblieben ist. Ein qualitativer Sprung hin zu einer echten Vergemeinschaftung des GASP-Bereichs hat damit nicht stattgefunden.258 Während die bereits heute vergemeinschafteten Politikbereiche der Außenpolitik – etwa die Handels-, Entwicklungs- und Umweltpolitik – keine große Beachtung fanden, konzentrierten sich die Diskussionen im Konvent auf die Reform der Strukturen und Verfahren der GASP.259
b) Art der Kompetenz Wie schon festgestellt, konnte sich der Konvent nicht dazu durchringen, die GASP ausdrücklich entweder der ausschließlichen Kompetenz nach Art. I-13 EVV oder der geteilten Kompetenz nach Art. I-14 EVV zuzuordnen.260 Die Unschlüssigkeit oder besser die Hilflosigkeit des Konvents, eine Einordnung zu treffen, wird aus folgendem Zitat deutlich: „Die Art der Zuständigkeit der Union in diesem Bereich macht es in der Tat schwierig, diesen Absatz entweder der geteilten Zuständigkeit oder dem Bereich, in dem die Union unterstützend tätig ist, zuzuordnen.“261
Die Schaffung des Art. I-16 EVV stellt lediglich eine Flucht vor den Konsequenzen dar, die eine Einordnung in das gerade erst aufgestellte Kompetenzsystem bedeutet hätte. Damit werden zwei Auslegungsvarianten möglich. Zum einen kann man Art. I-16 EVV in den Bereich der geteilten Zuständigkeiten einordnen, zum anderen könnte man eine gesonderte Kompetenzkategorie für die GASP annehmen.262 Erstere Ansicht ließe sich nach allgemeinen Regeln am Wortlaut des Art. I-14 EVV begründen.263 Hiernach liegt eine geteilte Zuständigkeit der Union vor, „wenn ihr die Verfassung außerhalb der in den Artikeln I-13 und I-17 genannten Bereiche eine Zuständigkeit überträgt“. Hier werden nur die Kompetenztitel Art. I-13 EVV und Art. I-17 EVV genannt, nicht dagegen Art. I-13 EVV bis Art. I-17 EVV. Da die GASP weder in Art. I-13 EVV noch in Art. I-17 EVV genannt ist, kann man argumentieren, dass sie unter die geteilte Zuständigkeit nach Art. I-14 EVV fallen müsse.264 Görlitz, DÖV 2004, 374 (379). Thym, ELJ 2004, 5 (7). 260 Dies führte in den Arbeitsgruppen teilweise zu heftiger Kritik. Es wurde angeführt, dass durch die fehlende Kategorisierung der GASP in einen Kompetenzbereich die Säulenstruktur de facto beibehalten werde, obwohl sie der Konvent doch abschaffen wolle; vorgeschlagen wurde stattdessen die Abschaffung der Unterscheidung zwischen der Außenpolitik (external action) und der GASP, es wurde angeregt, diese Kategorie in die geteilte Zuständigkeit einzuteilen, vgl. WG VII – WD 32, S. 5 (Teija Tiilikainen). 261 CONV 724 / 03, S. 68. 262 Ludwig, ZEuS 2004, 211 (235); Cremona, CMLRev 2003, 1347 (1354): „Thus we are left with something ,special‘ or sui generis.“ 263 So auch Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (530). 258 259
16*
244
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Gegen die gerade dargestellte Ansicht spricht jedoch die Systematik des Art. I-12 EVV, der klar zwischen der geteilten Zuständigkeit und dem Bereich der GASP trennt. Will man in den Art. I-13 bis I-17 EVV ein abgestuftes System in Form einer Abfolge sich abschwächender Kompetenztypen sehen, so kann man davon ausgehen, dass der Bereich der GASP (Art. I-16 EVV) noch nicht unter die geteilte Zuständigkeit (Art. I-14 EVV) der Gemeinschaft fällt, andererseits aber stärker ist als eine bloße Unterstützungskompetenz nach Art. I-17 EVV.265 Das berechtigte Argument, dass es bei dieser Lösung nicht ersichtlich ist, welcher Art eine solche Kompetenzkategorie sein soll, führt zu einem dritten, vermittelnden Lösungsansatz. Den Unsicherheiten, die die Annahme einer sui generis Kompetenzkategorie mit sich bringt, lässt sich folgende Überlegung entgegenhalten. Den Beratungen des Konvents kann man entnehmen, dass grundsätzlich die Einteilung der GASP in den Bereich der geteilten Zuständigkeit beabsichtigt war. Es bestand jedoch kein Konsens darüber, dass ein Tätigwerden der Union die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten ausschließt. Die Einteilung der GASP in den Bereich der unterstützenden Maßnahmen hätte den Vorteil gehabt, dass ein Handeln der Union nicht zu einer ausschließlichen Zuständigkeit geführt hätte, erschien aber unbefriedigend, weil sie nicht hinreichend den Wunsch der Union zum Ausdruck gebracht hätte, eine eigene gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu entwickeln.266 In Anbetracht dieser Lage bietet es sich an, denjenigen Weg zu wählen, den der Konvent bei der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe beschritten hat. Dieser Politikbereich wurde grundsätzlich der geteilten Zuständigkeit zugewiesen; andererseits wurde bestimmt, dass die Ausübung der Zuständigkeit der Union die Mitgliedstaaten nicht daran hindert, ihre Zuständigkeit auszuüben (Art. I-14 Abs. 4 EVV). Durch eine solche Einteilung wird die Kompetenz der Europäischen Union hinreichend deutlich, eine eigene Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickeln zu können. Andererseits wird es den Mitgliedstaaten nicht von vornherein verwehrt, in Bereichen, in denen die Union tätig geworden ist, weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Freilich sind die Mitgliedstaaten zur Loyalität und vollständigen Koordinierung und Abstimmung gemäß Art. I-5 Abs. 2, Art. I-40 Abs. 5 und Art. III-294 Abs. 2 EVV verpflichtet. Die vorgeschlagene Kompetenzeinteilung bietet zudem den Vorteil, dass nicht eine Kompetenz sui generis angenommen werden muss, deren Konturen vollständig unklar bleiben, sondern dass eine in sich verständliche Einteilung vorliegt. Die so gefundene Rechtslage entspricht damit derjenigen nach dem EU-Vertrag. Auch hier sind die Zuständigkeiten der Union und die der Mitgliedstaaten parallel 264 Auch von Bogdandy / Bast / Westphal, Integration 2003, 414 (422) sprechen sich für diese Lösung aus, wenn man den Wortlaut der Vorschrift ernst nehme; gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass eine solche Lösung schlecht in die Systematik passe. Nach ihrer Meinung bleibt diese Kompetenz „klassifikatorisch im Nebel“. 265 So Kadelbach, in: Hofmann / Zimmermann, Eine Verfassung für Europa, S. 145 (161). 266 Cremona, CMLRev 2003, 1347 (1354).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
245
– außer im Fall der Verteidigungspolitik, wo die Zuständigkeit der Union eine ergänzende ist.267 Nach bisheriger Regelung führt die Ausübung der Zuständigkeiten durch die Union ebenfalls nicht zu einer ausschließlichen Zuständigkeit für die Union.
c) Keine genaue Festlegung der Befugnisse der Union Die Kompetenz der Europäischen Union ist im Bereich der GASP potentiell sehr umfangreich. Sie erstreckt sich nach Art. I-16 EVV „auf alle Bereiche der Außenpolitik sowie auf sämtliche Fragen im Zusammenhang mit der Sicherheit der Union, einschließlich der schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik, die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen kann“. Im Zusammenhang mit den ebenfalls sehr umfangreichen allgemeinen außenpolitischen Zielen der Union aus Art. III-292 EVV ergibt sich eine sehr weitreichende Kompetenz, welche nicht durch irgendwelche materiellen Vorschriften des Verfassungsvertrages eingeschränkt wird.268 Eine Einschränkung der Kompetenz besteht jedoch in rein faktischer Hinsicht: Die Beschlüsse im Rahmen der GASP haben grundsätzlich einstimmig zu erfolgen. Interessante Parallelen ergeben sich beim Vergleich zu nationalen verfassungsrechtlichen Regelungen betreffend den außenpolitischen Bereich. Hier zeigt sich, dass die Exekutive im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik in allen Mitgliedstaaten eine starke Stellung innehat und weitreichende Freiheiten genießt, ohne dass detaillierte Beschränkungen in den jeweiligen Verfassungen enthalten wären.269 Der Bereich der GASP ist überdies rechtlich schwer regelbar, da er stark politisch geprägt ist. Insofern hält sich die weite Kompetenzbefugnis, die im Europäischen Verfassungsvertrag zu finden ist, in der Tradition der mitgliedstaatlichen Verfassungen. Wie bereits oben erwähnt, tritt die Europäische Union, da sie gemäß Art. I-7 EVV nun mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet worden ist, als selbstständige Kompetenzträgerin auf. Dies wird durch den Wortlaut des Verfassungsvertrags nochmals bestätigt. Art. I-15 Abs. 1 EVV legt die „Zuständigkeit der Union in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ 270 fest, Abs. 2 bestimmt, dass die CONV 47 / 02, S. 20. Eine materielle Erweiterung der Kompetenzen ist indes nicht erkennbar. Schon nach derzeitiger Rechtslage ist die Kompetenz der Union nicht begrenzt, sondern erstreckt sich gemäß Art. 11 Abs. 1 EU ebenfalls auf „alle Bereiche der Außen- und Sicherheitspolitik“. Dies verkennt Görlitz, DÖV 2004, 374 (379), der von einer materiellen Erweiterung der Kompetenzen ausgeht, dabei aber nur auf die allgemein anwendbare Bestimmung des Art. III-292 EVV, nicht jedoch auf die spezielle GASP-Vorschrift des Art. III-294 EVV, Bezug nimmt. 269 Kugelmann, EuropaR 2004, 322 (325 f.). 270 Hervorhebung durch den Verfasser. 267 268
246
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Mitgliedstaaten „das Handeln der Union“271 unterstützen müssen. Diese Festlegung stellt in rechtlicher Hinsicht einen qualitativen Sprung im Vergleich zum jetzigen EU-Vertrag dar.272
d) Ausdrückliche Vertragsschlusskompetenz, Art. III-303 EVV Art. III-303 EVV räumt der Union eine explizite Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Übereinkünfte im Bereich der GASP ein. Wie gerade gesehen, umfasst der Bereich der GASP alle Aspekte der Außenpolitik. Damit ist die Vertragsschlussbefugnis nahezu unbegrenzt. Inhaltlich gibt Art. III-303 EVV die Rechtslage nach Art. 24 Abs. 1 EU wieder. Lediglich die verfahrensrechtlichen Bestimmungen und insbesondere Art. 24 Abs. 5 EU273 werden nicht übernommen. Für das Verfahren zum Abschluss völkerrechtlicher Übereinkommen im GASPBereich gilt grundsätzlich Art. III-325 EVV. Spezialvorschriften finden sich innerhalb des genannten Artikels (vgl. Art. III-325 Abs. 3, Abs. 6 UAbs. 2 EVV).
e) Entscheidende institutionelle Neuerung: die Schaffung des Amtes eines Außenministers der Union, Art. I-28 EVV Neben der Einführung einer langfristigen Präsidentschaft des Europäischen Rates274 ist die sichtbarste und vielleicht wichtigste institutionelle Neuerung die Einrichtung des Postens eines Außenministers der Europäischen Union.275 Die Schaffung und Ausgestaltung dieses Amtes war einer der Hauptstreitpunkte im Rahmen der Konventsberatungen. Bereits an dieser Stelle ist festzuhalten, dass die Schaffung des Amtes eines Außenministers der Union als solche nicht die vertikale Kompetenzordnung der Union berührt, sondern lediglich eine institutionelle Neuverteilung der künftigen EU-Kompetenzen beinhaltet.276 Gleichwohl ist die Einführung eines solchen Amtes und die daraus resultierenden Folgen eine wesentliche und weitreichende Neuerung im Bereich der Außenbeziehungen, die der Verfassungsvertrag festlegt.
Hervorhebung durch den Verfasser. Görlitz, DÖV 2004, 374 (379). 273 Siehe hierzu bereits oben, § 8 III. 6. 274 Der Präsident des Europäischen Rates wird mit qualifizierter Mehrheit für die Dauer von zweieinhalb Jahren vom Europäischen Rat gewählt, Art. I-22 Abs. 1 EVV. 275 Lenz / Borchardt, Vertrag über eine Verfassung für Europa, Einführung, S. 20. 276 Görlitz, DÖV 2004, 374 (379). 271 272
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
247
aa) Die verschiedenen Vorschläge der Arbeitsgruppe „Außenpolitisches Handeln“ des Verfassungskonvents zur Strukturreform der GASP Ein Hauptanliegen des Verfassungsentwurfs war die Reform der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Bei den Bemühungen um eine Maximierung der Kohärenz und Effizienz des außenpolitischen Handelns der Union stellte sich die Frage, ob die bisherige Spaltung des außenpolitischen Bereichs aufgehoben werden sollte.277 Nach derzeitiger Rechtslage existiert zum einen der Hohe Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik278 und zum anderen ein Kommissionsmitglied, welches für die Außenbeziehungen der Gemeinschaft zuständig ist.279 Zur Neustrukturierung der Außenpolitik der Union wurden teils fundamental unterschiedliche Vorschläge gemacht, die im Folgenden kurz dargestellt werden sollen. (1) Status Quo – Zusammenlegung von Dienststellen, Synergien nutzen Dieser integrationspolitisch am wenigsten weitgehende Vorschlag sah vor, die Funktionen des Hohen Vertreters für Auswärtiges und des für Außenbeziehungen zuständigen Kommissionsmitgliedes beizubehalten.280 Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die Schaffung des Postens des Hohen Vertreters gute Ergebnisse erbracht habe, da dieses Amt dazu beigetragen habe, eine klarere Linie in der Außenpolitik zu definieren und zu verfolgen. In Zukunft sollten die Synergien mit den Arbeiten der Kommission verstärkt werden, zum Beispiel durch die Anerkennung eines Vorschlagsrechts für den Hohen Vertreter, durch die Teilnahme des Hohen Vertreters an allen Sitzungen der Kommission betreffend das außenpolitische Handeln und durch die Bereitstellung angemessener Mittel für den Hohen Vertreter zur Erfüllung seiner Aufgaben. Außerdem war eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem Hohen Vertreter und dem für Außenbeziehungen zuständigen Kommissionsmitglied, einschließlich der Vorbereitung gemeinsamer Initiativen, die dem Rat unterbreitet werden sollen, sowie gemeinsamer Ansprachen auf Tagungen des Europäischen Parlaments, geplant gewesen. Schließlich wurden eine Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen der Kommission und des Ratssekretariats sowie eine mögliche Zusammenlegung von Dienststellen in bestimmten Bereichen angeregt. Dieser Vorschlag wurde von einem Großteil der Mitglieder des Konvents als nicht ausreichend kritisiert, um die horizontale Kohärenz im Bereich des außenCONV 459 / 02, S. 16, Rdnr. 19. Welcher zugleich Generalsekretär des Rates ist, vgl. zu dessen Funktionen Art. 26, 18 Abs. 3, 27 d EU. 279 Wobei die Aufteilung der inneren Zuständigkeit (interne Organisation) der Kommission dem Kommissionspräsidenten obliegt, Art. 217 Abs. 1, 2 EG. 280 CONV 459 / 02, S. 19 f. (Rdnr. 29 f.). 277 278
248
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
politischen Handelns der EU sicherzustellen. Um das Ziel einer stärkeren Kohärenz zu erreichen, mussten einschneidendere institutionelle Veränderungen vorgenommen werden.281 (2) Völlige Verschmelzung der beiden Ämter, vollständige Anwendung der Gemeinschaftsmethode auf den gesamten Bereich des auswärtigen Handelns der Union Diese sehr weitgehende Option sah die völlige Verschmelzung des Amtes des Hohen Vertreters mit dem Amt des für Außenbeziehungen zuständigen Kommissionsmitgliedes vor.282 Durch diese Verschmelzung sollte eine einzige, bei der Kommission angesiedelte Zentrale für die Vorbereitung politischer Maßnahmen im Bereich des außenpolitischen Handelns einschließlich der Gemeinsamen Außenund Sicherheitspolitik entstehen. Zudem sollte die Gemeinschaftsmethode auf alle Bereiche des außenpolitischen Handelns ausgeweitet werden. Es wurde vorgeschlagen, dass die Kommission dafür zuständig sein sollte, Vorschläge zu unterbreiten und die beschlossenen Politiken durchzuführen, sowie die Union in allen Bereichen des außenpolitischen Handelns nach außen zu vertreten. Entscheidungen im Bereich des gesamten außenpolitischen Handelns (einschließlich der GASP) seien, wie derzeit in Gemeinschaftsangelegenheiten, im Rahmen des Ministerrates oder des Europäischen Rates, also von den europäischen Regierungen, zu treffen. Zudem sollte eine uneingeschränkte parlamentarische Kontrolle für den Bereich der Außenpolitik eingeführt werden. Für diese Option sprach vor allem die größtmögliche Effizienz und Kohärenz im Bereich des auswärtigen Handelns der Union. Der aus dem Vorschlag folgende weitgehende Souveränitätsverzicht für die Mitgliedstaaten war jedoch nicht konsensfähig und führte daher schnell zur Ablehnung dieser Option. (3) Personalunion, Verbindung der Funktionen der beiden Ämter durch die Schaffung eines „Europäischen Vertreters für Auswärtiges“ (Doppelhut) Die von der Mehrheit der Arbeitsgruppe „Außenbeziehungen“ favorisierte Lösung stellt die dritte Option dar, welche einen Kompromiss zwischen der ersten und zweiten Option bedeutet. Diese Lösung sieht eine Kombination der Funktionen des Hohen Vertreters für die GASP einerseits und des für Außenbeziehungen zuständigen Kommissionsmitgliedes andererseits vor. Die Funktionen sollten jedoch von ein und derselben Person ausgeübt werden.283 Die Person, die die Funk281 282 283
CONV 459 / 02, S. 20 (Rdnr. 30). CONV 459 / 02, S. 20 (Rdnr. 31). CONV 459 / 02, S. 20 ff. (Rdnr. 33 ff.).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
249
tionen der beiden Ämter verbindet, sollte den Titel „Europäischer Vertreter für Auswärtiges“284 tragen. Dieser Europäische Vertreter für Auswärtiges sollte vom Europäischen Rat mit Zustimmung des Kommissionspräsidenten und Billigung des Europäischen Parlaments ernannt werden. Er sollte direkte Mandate vom Rat erhalten und dem Rat gegenüber in GASP-Fragen Rechenschaft ablegen müssen. Gleichzeitig sollte der Europäische Vertreter für Auswärtiges auch Vizepräsident der Kommission sein. In seiner Funktion als Hoher Vertreter hätte er ein formelles, wenn auch nicht ausschließliches, Initiativrecht im Rat. Übte er dieses Initiativrecht im GASP-Bereich aus, sollte die Kommission keine konkurrierenden Initiativen ergreifen. Der Europäische Vertreter für Auswärtiges müsste für GASP-Initiativen nicht die vorherige Zustimmung der Kommission einholen. Allerdings hätte er kein Stimmrecht im Rat. Die Verfahren in GASP-Angelegenheiten einerseits und in Gemeinschaftsangelegenheiten andererseits sollten auch weiterhin getrennt bleiben. Im Rahmen von Gemeinschaftsangelegenheiten sollten die üblichen Verfahren beibehalten werden; der Europäische Vertreter für Auswärtiges hätte volles Stimmrecht in diesem Bereich. Außerdem sollte eine unnötige Verdoppelung von Dienststellen vermieden werden. Daher wurde vorgeschlagen, eine gemeinsame Dienststelle bestehend aus Beamten der Generaldirektion Außenbeziehungen, Beamten des Ratssekretariats und abgeordnetem Personal der nationalen diplomatischen Dienste einzurichten. Im Hinblick auf die Außenvertretung der Union solle der Europäische Vertreter für Auswärtiges die Troika285 nach dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Union ersetzen und als nach außen erkennbarer Repräsentant der Union auftreten. Bedenken gegenüber dieser Option wurden insbesondere im Hinblick auf den für eine Person sehr großen Zuständigkeitsbereich geäußert. Die Tatsache, dass der Europäische Vertreter für Auswärtiges zwei Kollegien, nämlich zum einen im Rat, zum anderen in der Kommission angehören würde, sei zudem – nach den Kritikern – mit dem Kollegialitätsprinzip schwer vereinbar. (4) Schaffung eines „EU-Außenministers“, der dem Präsidenten des Europäischen Rates direkt unterstellt ist Als vierte und letzte Option wurde die Schaffung eines EU-Außenministers vorgeschlagen, der direkt dem Präsidenten des Europäischen Rates unterstellt sein 284 Im Rahmen der Beratungen innerhalb der Gruppe Außenbeziehungen wurden auch andere Titel vorgeschlagen, etwa „EU-Minister für auswärtige Angelegenheiten“ oder „EUAußenminister“. Jedoch war die vorherrschende Ansicht, der Titel „Europäischer Vertreter für Auswärtiges“ biete den Vorteil, dass er keinem auf nationaler Ebene bereits verwendeten Titel entspricht, CONV 459 / 02, S. 20 Fn. 4. 285 Bestehend aus dem jeweils amtierenden Ratspräsidenten, dem Hohen Repräsentanten für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und dem Kommissar für Außenbeziehungen.
250
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
sollte.286 Auch diese Position würde die Funktionen des Hohen Vertreters und des für Außenbeziehungen zuständigen Mitgliedes der Kommission in sich vereinen. Strukturell unterscheidet sich dieser Vorschlag von der dritten Option dadurch, dass der Außenminister ausschließlich im Umfeld des Rates287 angesiedelt und dem Europäischen Rat direkt unterstellt wäre. Dies wurde mit dem Hinweis auf die starke Rolle des Europäischen Rates bei der Festlegung der Ausrichtung und der allgemeinen Leitlinien der EU-Außenpolitik sowie auf die Schlüsselstellung des Ministerrates in Bezug auf die Umsetzung der Außenpolitik begründet. Ziel dieses Vorschlages war wiederum die Schaffung einer größeren Kohärenz der vom Rat gebilligten politischen Leitlinien und der Durchführungsbefugnisse der Kommission im Außenbereich. Dieser Vorschlag schien jedoch im Hinblick auf eine drohende Intergouvernementalisierung der Außenpolitik und im Hinblick auf eine Störung der sensiblen Machtbalance zwischen Rat und Kommission problematisch. bb) Die tatsächlich in den Verfassungsvertrag aufgenommene Lösung (1) Art und Umfang der Aufgaben des Außenministers der Europäischen Union, Art. I-28 EVV Der Konvent – und im Anschluss daran die Regierungskonferenz – hat sich faktisch für die von der Arbeitsgruppe „Außenbeziehungen“ vorgestellte dritte Option288 entschieden. In formeller Hinsicht ist zunächst festzuhalten, dass der Konvent als Bezeichnung für den neu einzurichtenden Posten den Begriff „Außenminister der Union“ gewählt und damit die von der Arbeitsgruppe ursprünglich vorgeschlagene Bezeichnung „Europäischer Vertreter für Auswärtiges“ abgelehnt hat.289 Der Begriff „Außenminister der Union“ taucht im Verfassungsentwurf an mehreren Stellen explizit auf. Bereits die Häufigkeit der Erwähnung290 lässt die CONV 459 / 02, S. 22 f. (Rdnr. 38 f.) Und gerade nicht zugleich auch Kommissionsvizepräsident wäre. 288 Vgl. oben unter (3). 289 Zur Auswahl standen ferner „Sekretär der Union“, „Vertreter der EU für auswärtige Angelegenheiten“ oder „Sekretär der EU für auswärtige Angelegenheiten“, vgl. CONV 748 / 03, S. 10. Die Wahl der Terminologie darf indes nicht zu einer Verwechslung mit der gerade dargestellten vierten Option führen; diese wurde nicht umgesetzt. 290 Der Außenminister wird in folgenden Vorschriften (teils mehrfach) erwähnt: Art. I-21 Abs. 2 EVV, Art. I-22 Abs. 2 EVV, Art. I-25 Abs. 2 EVV, Art. I-26 Abs. 5, 6, 8 EVV, Art. I-27 Abs. 2 UAbs. 2, Abs. 3 EVV, Art. I-28 EVV, Art. I-40 Abs. 4, 6 EVV, Art. I-41 Abs. 4 EVV, Art. I-44 Abs. 4 UAbs. 5 EVV, Art. I-59 Abs. 5 UAbs. 3 EVV, Art. III-292 Abs. 3 UAbs. 2 EVV, Art. III-293 Abs. 2 EVV, Art. III-294 Abs. 2 UAbs. 3 EVV, Art. III-296 EVV, Art. III-299 EVV, Art. III-300 Abs. 2 UAbs. 1 lit. b, Abs. 2 UAbs. 2 EVV, Art. III-301 Abs. 1 EVV, Art. III-302 EVV, Art. III-304 EVV, Art. III-305 EVV, Art. III-307 EVV, Art. III-309 Abs. 2 EVV, Art. III-310 Abs. 1 EVV, Art. III-312 EVV, Art. III-313 Abs. 3 UAbs. 3 EVV, Art. III-322 Abs. 1 EVV, Art. III-325 Abs. 3, 9 EVV, Art. III-327 Abs. 2 EVV, Art. III-328 Abs. 2 EVV, Art. III-329 Abs. 2 EVV, Art. III-340 EVV, Art. III-348 Abs. 4 EVV, Art. III-400 286 287
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
251
große Aufgabe erahnen, die dem neuen Außenminister der Europäischen Union in Zukunft zukommen wird. Der Außenminister der Union wird bereits in Teil I der Verfassung unter Titel IV genannt; ihm kommt jedoch, da er nicht in Art. I-19 EVV aufgeführt wird, keine Organqualität zu.291 Zentrale Vorschrift ist Art. I-28 EVV, welcher zunächst die Ernennung des Außenministers regelt. Konstruktiv betrachtet wurde die so genannte „Doppelhut-Lösung“292 gewählt: der Außenminister der Union leitet einerseits die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Union (Art. I-28 Abs. 2 EVV) und ist andererseits einer der Vizepräsidenten der Kommission (Art. I-28 Abs. 4, I-26 Abs. 5, 6 EVV) und dort mit den Außenbeziehungen und der Koordinierung der übrigen Aspekte des auswärtigen Handelns der Union betraut. Bildlich gesprochen trägt der Außenminister daher sozusagen „zwei Hüte“.293 Der „Doppelhutträger“ nimmt in Personalunion zugleich die Aufgaben des früheren Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und diejenigen des Kommissars für Außenbeziehungen wahr.294 Der Außenminister ist zwar in Zukunft einer der Vizepräsidenten der Kommission, wird aber nicht mehr – wie bisher – das Amt des Generalsekretärs des Rates wahrnehmen. Der Außenminister der Union wird vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit und mit Zustimmung des Kommissionspräsidenten ernannt. Ihm steht das Initiativrecht im Bereich der gemeinsamen Außenpolitik zu, und ihm obliegt es, diese Politik im Auftrag des Ministerrates durchzuführen. Gleiches gilt für den Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das Initiativrecht des Außenministers hat auch Bedeutung für das Zustandekommen einer qualifizierten Mehrheit. Erfolgt nämlich ein Beschluss des Europäischen Rats oder des Ministerrats nicht auf eine Initiative des Außenministers (oder der Kommission), so sind die Anforderungen an eine qualifizierte Mehrheit höher, als wenn diesem Beschluss eine solche Initiative zugrunde liegt (Art. I-25 Abs. 1, 2 EVV). Die besondere Verantwortung des Außenministers bei der Durchführung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wird nochmals in Art. I-40 Abs. 4 EVV hervorgehoben. Abs. 1 lit. a EVV, Art. III-418 Abs. 2 EVV, Art. III-419 Abs. 2 EVV, Art. III-420 Abs. 2 EVV. 291 Obwexer, in: Busek / Hummer (Hrsg.), Der Europäische Konvent und sein Ergebnis – eine Europäische Verfassung, S. 103 (118). 292 Der Begriff „Doppelhut“ geht nach Thym, ELJ 2004, 5 (19, Fn. 83) auf ein Kompromisspapier des Auswärtigen Amtes zurück. Der Begriff kann mit „Personalunion“ gleichgesetzt werden. Im Konvent wurde der Begriff erstmals von Peter Glotz auf der Plenarsitzung am 11. Juli 2002 benutzt. Nachfolgend wurde der Begriff vom gesamten Konvent zur Bezeichnung der komplexen Zusammenlegung der Funktionen von Außenkommissar und Hohem Repräsentanten verwendet. 293 Siehe auch Lenz / Borchardt, Vertrag über eine Verfassung für Europa, Einführung, S. 20. 294 WG VII – WD 17, S. 2 (Gunter Pleuger).
252
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Der Außenminister der Union nimmt an den Arbeiten295 des Europäischen Rates teil (Art. I-21 Abs. 2 EVV). Obwohl ihm kein Stimmrecht zusteht, ist die bloße Teilnahme an dem Gremium, welches sich aus den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten sowie dem Präsidenten des Europäischen Rates und dem Präsidenten der Kommission zusammensetzt, ein deutliches Indiz für den Einfluss, welcher dem Amtsinhaber zukommen wird. Zudem bleibt festzuhalten, dass der Außenminister an allen Beratungen des Europäischen Rates teilnimmt, keineswegs nur an den Beratungen, welche die auswärtigen Beziehungen betreffen. Damit ist der Außenminister auf höchster Ebene über alle aktuellen Entscheidungen sowohl auf dem Gebiet der internen wie auch der externen Politiken informiert. Der Außenminister führt den Vorsitz in der neu eingerichteten Ratsformation „Auswärtige Angelegenheiten“ (Art. I-28 Abs. 3 EVV, Art. III-296 Abs. 1 EVV). Außerdem unterstützt er den Ministerrat und die Kommission darin, die Kohärenz zwischen den einzelnen Bereichen des auswärtigen Handelns der Union sowie zwischen diesen und den übrigen Politikbereichen sicherzustellen (Art. III-292 Abs. 3 EVV). Dass der Außenminister nicht nur für die Außenbeziehungen zuständig ist, sondern ebenfalls alle externen Aspekte interner Politikbereiche zu betreuen hat, ergibt sich aus Art. I-28 Abs. 3 EVV. Hiernach ist der Außenminister mit den Außenbeziehungen der Union und der Koordinierung der übrigen Aspekte des auswärtigen Handelns der Union betraut. Dies erfordert einen Überblick über alle internen Entscheidungen, welche Auswirkungen auf die Außenbeziehungen der Gemeinschaft haben. Im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik hat der Außenminister wichtige Repräsentativ- und Identifikationsfunktionen. So wird die Union nach außen vom Außenminister vertreten. Dieser führt im Namen der Union den politischen Dialog und vertritt den Standpunkt der Union in internationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen (Art. III-296 Abs. 2, 3 EVV). Der Außenminister der Union soll (gemeinsam mit dem Ministerrat) gemäß Art. III-294 Abs. 2 UAbs. 3 EVV dafür Sorge tragen, dass die Mitgliedstaaten, wie vom Verfassungsvertrag vorgesehen, die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik loyal unterstützen und sich jeder Handlung enthalten, welche den Interessen der Union zuwiderläuft oder das kohärente Auftreten der Union nach außen schwächen könnte. Zur Erfüllung seiner Aufgaben steht dem Außenminister ein neu zu gründender Europäischer Auswärtiger Dienst zur Verfügung. Der Außenminister der Union ist außerdem ein Bindeglied zwischen dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat beziehungsweise dem Europäischen Rat. 295 Nach dem Konventsentwurf nimmt der Außenminister der Union an den „Beratungen“ des Europäischen Rates teil, Art. I-20 Abs. 2 KE-EVV. Der Verfassungsvertrag macht durch die Verwendung des Wortes „Arbeiten“ deutlich, dass der Außenminister der Union vollumfänglich an allen Arbeitsschritten des Europäischen Rates zu beteiligen ist.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
253
Der Außenminister hört gemäß Artikel III-304 EVV das Europäische Parlament zu den wichtigsten Fragen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und achtet darauf, dass die Auffassungen des Europäischen Parlaments gebührend berücksichtigt werden. In regelmäßigen Abständen unterrichtet der Außenminister das Parlament über die Entwicklungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Außerdem ist der Außenminister Ansprechpartner für Anfragen oder Empfehlungen des Europäischen Parlaments. Die Mitgliedstaaten der Union müssen ihr Handeln in internationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen koordinieren und dort für die Standpunkte der Union eintreten. Als „Hüter der Kohärenz“ sorgt der Außenminister dafür, dass diese Koordinierung organisatorisch reibungslos funktionieren kann (Art. III-305 EVV). Außerdem fungiert der Außenminister als „Sprachrohr“ der Union bei Sitzungen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, jedenfalls dann, wenn die Union einen Standpunkt zu einem Thema festgelegt hat, das auf der Tagesordnung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen steht und die dort vertretenen Mitgliedstaaten eine Äußerung des Außenministers beantragt haben (Art. III-305 Abs. 2 UAbs. 3 EVV). Im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Union sorgt der Außenminister für die Koordinierung der zivilen und militärischen Aspekte der möglichen Missionen (Art. III-309 Abs. 2 EVV). Die Durchführung jeder zweckdienlichen Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, dem Europarat, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie mit anderen internationalen Organisationen obliegt gemäß Art. III-327 EVV dem Außenminister der Union und der Kommission gemeinsam. Die Europäische Union wird auch weiterhin Delegationen in Drittländern unterhalten. Diese Delegationen der Union werden vom Außenminister der Union geleitet (Art. III-328 Abs. 2 EVV). Gemäß Art. III-296 Abs. 3 EVV soll der Außenminister bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben von einem neuen gemeinsamen Dienst unterstützt werden, welcher dem Außenminister unterstellt ist. Dieser „Europäische Auswärtige Dienst“ soll sich aus Beamten der einschlägigen Dienststellen des Generalsekretariats des Ministerrates und der Kommission und aus abgestelltem Personal der diplomatischen Dienste der Mitgliedstaaten zusammensetzen.296 Im EU-Vertrag heißt es noch in Art. 18 Abs. 1 EU, dass der Vorsitz des Rates die Union in Angelegenheiten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vertritt. Hierbei sollte ihn, gemäß Abs. 3 derselben Vorschrift, der Generalsekretär 296
Näher dazu unten, § 10 II. 14. i) ee).
254
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
des Rates, welcher die Aufgabe eines Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wahrnimmt, unterstützen. Der Vorsitz kann von dem Mitgliedstaat, der den nachfolgenden Vorsitz wahrnimmt, unterstützt werden, zudem soll die Kommission an allen Aufgaben beteiligt werden. Diese „Troika“297 wird durch den Verfassungsvertrag zugunsten der Position eines Außenministers der Union aufgelöst; Art. III-296 Abs. 2 EVV bestimmt, dass der Außenminister die Union in den Bereichen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vertritt. Zudem führt der Außenminister im Namen der Union den politischen Dialog und vertritt den Standpunkt der Union in internationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen. Der EU-Vertrag sieht dagegen in Art. 26 EU vor, dass der Hohe Vertreter den Rat lediglich unterstützt und nur auf Ersuchen des Vorsitzes im Namen des Rates den politischen Dialog mit Dritten führt. (2) Übertragung von Initiativrechten auf den Außenminister, Art. I-28 Abs. 2, III-296 Abs. 1 und III-299 Abs. 1 EVV Nach Art. 22 EU können derzeit nur die Mitgliedstaaten und die Kommission dem Rat Vorschläge betreffend die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik unterbreiten; der Hohe Vertreter ist dagegen nicht erwähnt. Die Neuregelung des Art. I-28 Abs. 2 EVV in Verbindung mit Art. III-296 Abs. 1 EVV beinhaltet nun ein Vorschlagsrecht für den Außenminister bezüglich der Festlegung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Auch durch Art. III-299 EVV wird der Kreis der Vorschlagsberechtigten auf den Außenminister298 ausgeweitet. Damit steht dem Außenminister, wie von der Arbeitsgruppe „Außenbeziehungen“ gefordert, ein formelles, jedoch nicht ausschließliches Initiativrecht zu.299 Er kann durch seine Initiativen Einfluss auf die Festlegung und die Durchführung der GASP ausüben. Der Außenminister hat die Wahl, ob er seine Initiative eigenständig einreicht oder um die Unterstützung der Kommission wirbt. Im ersteren Fall kann der Außenminister unabhängig handeln, bedarf also nicht der vorherigen Zustimmung des Kollegiums der Kommissionsmitglieder; im letzteren Falle hat seine Initiative durch die Unterstützung der gesamten Kommission umso mehr Gewicht. In der Übertragung des Initiativrechts auf den Außenminister liegt keine Schwächung der Kommission, der dieses Recht bisher zusteht, da der Außenminister der Kommission als deren Vizepräsident angehört.300
297 298 299 300
Vgl. Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 11 – 28 EUV, Rdnr. 55. Daneben besteht ein gemeinsames Vorschlagsrecht mit der Kommission. CONV 459 / 02, S. 5 (Rdnr. 5). Kugelmann, EuropaR 2004, 322 (334).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
255
(3) Vereinbarkeit der beiden Funktionen des Außenministers („Doppelhut“) mit der Unabhängigkeit der Kommission gemäß Art. I-26 Abs. 7 und III-347 EVV Nach Art. III-347 EVV301 üben die Mitglieder der Kommission ihr Amt in voller Unabhängigkeit aus und dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen einer Regierung oder einer anderen Stelle weder anfordern noch entgegennehmen. Diese Vorschrift ist auch auf den Außenminister, als Kommissionsvizepräsident und Kommissar für Außenbeziehungen, anwendbar. Da der Außenminister zum einen für die GASP verantwortlich ist, zum anderen aber auch Mitglied der Kommission ist, könnten sich Probleme für die Unabhängigkeit des Außenministers ergeben. Es wird des öfteren die Situation auftreten, dass der Außenminister in verschiedenen Gremien, zum einen im Europäischen Rat oder Ministerrat, zum anderen in der Kommission, zu einer bestimmten Frage Stellung nehmen muss und in den verschiedenen Gremien gegebenenfalls unterschiedliche Beschlüsse getroffen werden. Das Problem wird jedoch dadurch entschärft, dass der Außenminister – soweit es sich um Gegenstände aus dem Zuständigkeitsbereich der Kommission handelt – an eine im Ministerrat getroffene Entscheidung nicht gebunden ist; er kann vielmehr auf Kommissionssitzungen seine eigene Position vertreten.302 Damit wird es dem Rat erschwert, mittelbar – über den Außenminister (und Außenkommissar) – Einfluss auf die Kommission auszuüben. Anders verhält es sich lediglich in Politikfeldern, in denen der Außenminister die Funktion des derzeitigen Hohen Vertreters wahrnimmt. Hier ist der Außenminister an die Weisungen des Ministerrates oder des Europäischen Rates, etwa im Rahmen der Durchführung des politischen Dialogs, gebunden (Art. III-296 Abs. 2 EVV). In diesem Bereich kann es aber kaum zu Konflikten mit Kommissionszuständigkeiten kommen, da der Kommission nur eine untergeordnete Rolle zukommt. Jedenfalls stünde der Kommission kein Weisungsrecht gegenüber dem Außenminister im genannten Aufgabengebiet zu. Dadurch, dass dem Außenminister im Ministerrat und im Europäischen Rat kein Stimmrecht zusteht, ist es nicht möglich, dass die Kommission Einfluss auf Ratsentscheidungen erlangen kann. Kurz gesagt muss sich der Außenminister bei der Ausarbeitung der GASP / ESVP nicht nach den Auffassungen der Kommission richten, an Kommissionsbeschlüsse im Bereich der anderen Außenbeziehungen ist er dagegen gebunden.
cc) Bewertung der Lösung Zunächst ist festzuhalten, dass die bisher von zwei verschiedenen Personen wahrgenommenen Ämter, das des Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außenund Sicherheitspolitik und das des Außenkommissars in der Kommission, künftig 301 302
Eine entsprechende Vorschrift findet sich in Art. 213 Abs. 2 EG. So auch WG VII – WD 53, S. 2 (Hans Martin Bury).
256
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
von einem Amtsinhaber wahrgenommen werden (Personalunion, Doppelhut). Dadurch besteht die Chance, dass die Außenpolitik der Union insgesamt kohärenter, das heißt in sich widerspruchsfreier wird. Die Aufgabenvereinigung in einer Person führt dazu, dass nicht mehr zwei unterschiedliche Politikstile aufeinanderprallen können, dass nicht verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden können, dass weniger „Reibungsverluste“ bei der internen Abstimmung der Politiken auftreten und schließlich, dass kein Kompetenzgewirr oder gar Kompetenzstreitigkeiten entstehen können. Zudem wird der Außenminister der Union nicht mehr Generalsekretär des Rates sein303 und kann sich daher voll und ganz auf seine außenpolitischen Aufgaben konzentrieren. Bereits diese Vorteile rechtfertigen die Schaffung des neuen Amtes.304 Mit den genannten Vorzügen hat es aber noch nicht sein Bewenden, es entstehen durch die Neufassung andere begrüßenswerte Vorteile. Entscheidend ist, dass die Außenpolitik der Europäischen Union ein einheitliches „Gesicht“ bekommt. Dies ist ansatzweise schon durch die Schaffung des Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik geschehen.305 Der Hohe Vertreter stand jedoch bisher immer im Schatten des Ratsvorsitzes, welcher oft die Außenvertretung der Union wahrnahm. Zudem war eine Abgrenzung zum Außenkommissar schwierig. Künftig ist nur eine Person für die ehemals vergemeinschaftete Außenpolitik sowie für die Außenpolitik nach dem (alten) EU-Vertrag, somit für alle Fragen der internationalen Beziehungen zuständig. Die fundamentale Schwäche der bisherigen Regelung, nämlich das Fehlen von Kontinuität, deren Wurzeln zum einen die sechsmonatliche Rotation der Ratspräsidentschaft und zum anderen die zu große Anzahl von Akteuren (Troika) waren, wird aufgelöst. In Zukunft vertritt der Außenminister die Union – auf der Ebene unterhalb des Europäischen Rats – alleine. Dies hat den Vorteil, dass sich Drittstaaten an eine einzige Person innerhalb der Union wenden können und dass diese Person für eine längere Zeit das Amt wahrnimmt – eine notwendige Voraussetzung, um persönliches Vertrauen, welches in internationalen Beziehungen besonders wichtig ist, aufbauen zu können. Der oft beklagte fehlende Ansprechpartner oder die Unklarheit, welcher der richtige / zuständige Gesprächs- oder Verhandlungspartner auf europäischer Ebene ist, wird damit beseitigt. Mit allen auswärtigen Angelegenheiten können sich ausländische Partner an den Außenminister der Europäischen Union wenden.306 303 Der Generalsekretär wird zukünftig gemäß Art. III-344 Abs. 2 EVV vom Ministerrat ernannt. 304 Verhaltener Risse, Integration 2003, 564 (567), der zwar von einem institutionellen Fortschritt spricht, gleichzeitig die gefundene Lösung aber für weniger revolutionär hält, als sie zunächst erscheinen mag. Risse meint, bereits heute habe die Kommission ein gewichtiges Wort bei der GASP mitzureden. 305 Javier Solana, der erste Hohe Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, wurde oft „Mr. GASP“ genannt. 306 Das von Henry Kissinger ironisch beklagte Fehlen einer „europäischen Telefonnummer“ könnte damit der Vergangenheit angehören, so jedenfalls Meyer, ZRP 2003, 104 (106).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
257
Die Bündelung der Aufgaben in einer Hand hat zudem den Vorteil, dass auch die Europäischen Bürger einen Vertreter für alle auswärtigen Angelegenheiten identifizieren können. Die Arbeitweise der Union wird damit transparenter, die Bürger können leichter verstehen, wie die Union funktioniert. Dies ist eine grundlegende Voraussetzung dafür, Vertrauen in den europäischen Integrationsprozess fassen zu können. Dieses Vertrauen kann später in die gewünschte Identifikation mit einem europäischen Außenminister und letztlich in einem geeinten Europa münden. Trotz der Einführung des Amtes eines Außenministers der Union ist das Gleichgewicht zwischen Kommission, dem Rat und den Mitgliedstaaten weitgehend erhalten geblieben. Als problematisch könnte es sich erweisen, dass der Außenminister in zwei unterschiedlichen Gremien tätig wird. Neben den oben erwähnten Schwierigkeiten mit dem Kollegialitätsprinzip entsteht eine Grauzone von politischen Verantwortlichkeiten, unter der die interinstitutionellen Kontrollmechanismen leiden könnten.307 Ebenso ist zu befürchten, dass der Außenminister isoliert wird, weil er vom Rat und von der Kommission verdächtigt werden könnte, ein „trojanisches Pferd“ des jeweils anderen Organs zu sein.308 Ob schließlich die Schaffung des Amtes eines Außenministers der Union die Machtbalance innerhalb der Union verändern wird, ist noch nicht absehbar.309 Durch Art. I-28 Abs. 2, III-296 Abs. 1, III-299 Abs. 1 EVV wird dem Außenminister ein Initiativ- beziehungsweise Vorschlagsrecht für den Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik eingeräumt, welches vorher dem Hohen Vertreter nach dem EU-Vertrag nicht zustand. Damit werden die Kompetenzen des Außenministers gestärkt. Mittels des eigenen Initiativrechts kann der Außenminister daher eine strukturierte Außenpolitik betreiben, ohne auf Vorschläge der Mitgliedstaaten oder der Kommission angewiesen zu sein. Im Sinne einer kohärenten und effektiven Außenpolitik können an zentraler Stelle Vorschläge ausgearbeitet und später dem Entscheidungsorgan, dem Ministerrat „Auswärtige Angelegenheiten“ (Art. I-24 Abs. 3 EVV), unterbreitet werden. Dies trägt zu einer kohärenten, an den Zielen der Außenpolitik ausgerichteten Politik bei. Auch die Einführung einer neuen Art von Initiativen, nämlich die gemeinsamen Initiativen von Außenminister und Kommission, ist zu begrüßen. Diese auf eine Anregung der Gruppe „Außenbeziehung“ zurückgehende Lösung310 bietet den Vorteil, dass die verschiedenen Entscheidungsträger und Umsetzungsorgane bereits in einem frühen Stadium zusammenarbeiten und sich so auf eine gemeinsame Linie verständigen können. Dadurch werden Reibungsverluste vermieden, und Thym, ELJ 2004, 5, (21). Thym, ELJ 2004, 5, (21); insgesamt kritisch zur Idee eines Außenministers der Union (aufgrund des Kollegialitätsprinzips) Dashwood, in: Hillion (Hrsg.), EU Enlargement: A Legal Approach, S. 45 (52 f.). 309 So auch Cremona, CMLRev 2003, 1347 (1355). 310 Siehe hierzu die Ausführungen in CONV 459 / 02, S. 25 f. (Rdnr. 48 f.). 307 308
17 Metz
258
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
durch die frühe Einbeziehung vieler Akteure wird die Akzeptanz des Arbeitsergebnisses gesteigert. Für schnell auszuarbeitende Initiativen steht ferner die Möglichkeit des eigenständigen Tätigwerdens zur Verfügung. Der Außenminister ist als einer der Vizepräsidenten der Kommission maßgeblich in der Kommission angesiedelt. Damit konnte die teilweise befürchtete ReIntergouvernementalisierung durch die Verschiebung von Kompetenzen, von der Kommission hin zum Rat, verhindert werden. Problematisch könnte schließlich der große Zuständigkeitsbereich werden, welcher dem Außenminister zugewiesen ist. Die weit reichenden Kompetenzfelder, die sich von der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik über die gemeinsame Handelspolitik bis hin zur Zusammenarbeit mit Drittländern und humanitäre Hilfe und grundsätzlich auch auf alle externen Aspekte interner Politiken erstrecken, könnten dazu führen, dass nicht alle Politikbereiche gleich intensiv ausgearbeitet und durchgeführt werden können. Dies würde dann das Hauptziel der Schaffung des neuen Amtes konterkarieren, nämlich die Steigerung der Kohärenz in den Außenbeziehungen. Die vollständige Verschmelzung der beiden Ämter, welche die größte Kohärenz und Effizienz mit sich gebracht hätte, war für einige Mitgliedstaaten nicht akzeptabel und somit im Rahmen des Konvents nicht durchsetzbar. Bei dem derzeitigen Integrationsstand und politischen Willen war es nicht realistisch, Zuständigkeiten im militärischen Bereich und im Bereich der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf die Kommission zu übertragen. Aufgrund der Tatsache, dass dem Rat in der Außenpolitik eine zentrale Rolle zukommt, ist es begrüßenswert, dass der Außenminister der Union durch seine Beteiligung an den Sitzungen des Europäischen Rates und des Ministerrates seine speziellen Beziehungen zu den Regierungen und Außenministern nicht verliert.311 Mit dem vom Konvent erreichten Kompromiss scheint damit das derzeitige Maximum an Synergiegewinn verwirklicht.312
f) Beschlussfassungsverfahren aa) Völkerrechtliche Übereinkommen Wie bereits oben313 dargestellt, gilt, nachdem eine dem Art. 24 EU entsprechende Verfahrensbestimmung nicht in den Verfassungsvertrag übernommen wurde, für So auch einige Konventsmitglieder, CONV 473 / 02, S. 8 (Rdnr. 21). WG VII – WD 17, S. 2 (Gunter Pleuger); Dini spricht wohlwollend von einer gelungenen Rationalisierung der beiden Funktionen, WG VII – WD 39, S. 2 f. (Lamberto Dini); Schwarze, EuropaR 2003, 535 (549). 313 Vgl. § 8 III. 6. 311 312
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
259
völkerrechtliche Verträge im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Art. III-303 EVV) grundsätzlich das Verfahren nach Art. III-325 EVV. Zu untersuchen bleibt, nach welchen Verfahren die übrigen Handlungsformen im Bereich der GASP beschlossen werden.
bb) Die neue Rechtsform der Europäischen Beschlüsse Die bisherigen Handlungsformen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik (zum Beispiel Gemeinsame Standpunkte, Gemeinsame Aktionen, Art. 12 EU) werden beibehalten, nach der neuen Nomenklatur heißen sie jetzt (verkürzt) „Standpunkte“ beziehungsweise „Aktionen“. Die Neuerung, die der Verfassungsvertrag mit sich bringt, ist, dass die Aktionen und Standpunkte und die Beschlüsse zu deren Umsetzung in der neuen Rechtsform des Europäischen Beschlusses314 ergehen (Art. I-40 Abs. 3 EVV). Beschlüsse nach dem EU-Vertrag sind bisher Beschlüsse sui generis und nicht mit Beschlüssen auf Gemeinschaftsebene vergleichbar.315 Durch die Integration der Beschlüsse im GASP-Bereich in das allgemeine System der Rechtsakte der Union ist eine Vereinfachung des Unionsrechts gelungen.316 Die Neuregelung drückt zudem den Wunsch nach einem höheren Grad an Verbindlichkeit aus.317 Die bisherige mangelnde Effektivität der GASP ist allerdings weniger darauf zurückzuführen, dass die Mitgliedstaaten einmal erlassene Beschlüsse missachtet hätten, sondern eher auf unüberwindliche Meinungsverschiedenheiten im Vorfeld gemeinsamer Entscheidungen.318 Das Initiativrecht für Beschlüsse im Rahmen der GASP steht den Mitgliedstaaten und dem Außenminister zu. Der Außenminister kann seine Vorschläge alleine vorlegen, oder er kann solche Vorschläge mit Unterstützung der Kommission unterbreiten. Der letztere Fall ist nicht zu verwechseln mit dem „gemeinsamen Vorschlag“ (Art. III-293 Abs. 2 EVV), bei dem der Minister für die Aspekte des gemeinsamen außenpolitischen Handelns, welche die GASP betreffen, und die Kommission für die anderen Aspekte des gemeinsamen außenpolitischen Handelns zuständig ist. Ein Europäischer Beschluss ist ein Rechtsakt ohne Gesetzescharakter, der aber in allen seinen Teilen verbindlich ist (Art. I-33 Abs. 1 UAbs. 5 EVV).319 Der GroßArt. I-33 Abs. 1 UAbs. 5, Art. I-35 Abs. 1 EVV. Kadelbach, in: Hofmann / Zimmermann, Eine Verfassung für Europa, S. 145 (162, Fn. 43), Beschlüsse im Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen stellen dagegen nach Art. 34 Abs. 2 lit. c EU eine kategorisierte Rechtsform dar; diese Beschlüsse sind verbindlich, aber nicht unmittelbar wirksam. 316 A. A. Cremona, CMLRev 2003, 1347 (1356). 317 Kadelbach, in: Hofmann / Zimmermann, Eine Verfassung für Europa, S. 145 (162). 318 Jopp / Regelsberger, Integration 2003, 550 (552). 319 Oppermann, DVBl. 2003, 1234 (1238), spricht lediglich von einem „rudimentären Rechtsetzungsverfahren“. 314 315
17*
260
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
teil der zu treffenden Entscheidungen im Bereich der GASP ergeht in Form Europäischer Beschlüsse (Aktionen, Standpunkte und deren Umsetzungsbeschlüsse, Art. III-294 Abs. 3 lit. b EVV). Daneben werden allgemeine Leitlinien vom Europäischen Rat bestimmt. Gemäß Art. I-40 Abs. 6 EVV sind Europäische Gesetze und Rahmengesetze im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik durch die Verfassung ausdrücklich ausgeschlossen. Die GASP muss ferner vor dem Hintergrund der Schaffung einer Rechtspersönlichkeit für die Europäische Union (Art. I-7 EVV) gesehen werden. Beschlüsse in der GASP sind damit der Union nicht nur politisch, sondern künftig auch rechtlich eindeutig zurechenbar.320
cc) Grundsätzlich wie bisher: Einstimmigkeit, Art. III-300 Abs. 1 EVV Das Einstimmigkeitserfordernis für Europäische Beschlüsse in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wird gleich doppelt abgesichert. Das Einstimmigkeitsprinzip wird nicht nur in Art. I-40 Abs. 6 EVV, sondern auch in Art. III-300 Abs. 1 EVV festgeschrieben. Zu beachten ist jedoch die Möglichkeit der „konstruktiven Enthaltung“. Nach diesem Prinzip verhindert eine Stimmenthaltung nicht das Zustandekommen des jeweiligen Beschlusses. Das Prinzip der konstruktiven Enthaltung gilt gemäß Art. III-341 Abs. 1 UAbs. 2 EVV, Art. III-343 Abs. 3 EVV nicht nur für den Bereich der GASP, sondern grundsätzlich für alle Beschlüsse des Europäischen Rates und des Ministerrates.321 Eine konstruktive Enthaltung ist nach bisherigem Recht gemäß Art. 23 Abs. 1 UAbs. 1 EU zwar möglich, wurde jedoch nicht häufig genutzt. Die Arbeitsgruppe „Außenbeziehungen“ rief die Mitgliedstaaten dazu auf, diese Möglichkeit verstärkt zu nutzen. Dies würde einer größeren politischen Solidarität entsprechen, gegenseitiges Vertrauen schaffen und es erleichtern, einen Konsens zu erzielen. Die Mitgliedstaaten sollten sich nur bei „lebenswichtigen nationalen Interessen“ einem Beschluss entgegenstellen.322 Dieser Appell der Arbeitsgruppe ist freilich rechtlich keineswegs verbindlich. Den Mitgliedstaaten steht es demnach frei, nach eigenem Kugelmann, EuropaR 2004, 322 (338). Die grammatikalischen Wortlautabweichungen von einerseits Art. III-341 Abs. 1 UAbs. 2 EVV und andererseits Art. III-343 Abs. 3 EVV haben keine Bedeutung. Dies zeigt sich auch beim Vergleich mit der englischen Sprachfassung, wo es in den beiden Vorschriften jeweils übereinstimmend heißt: „Abstentions by members present in person or represented shall not prevent the adoption by the [European] Council of acts which require unanimity.“ Wortgleich sind auch die Formulierungen in spanischer und französischer Sprachfassung. Warum sich der Wortlaut der beiden Regelungen in der deutschen Sprachfassung nicht entspricht, ist umso rätselhafter, als man im Konventsentwurf noch eine übereinstimmende Formulierung findet, vgl. Art. III-244 Abs. 1 UAbs. 1 und III-246 Abs. 3 KE-EVV. 322 CONV 459 / 02, S. 26 (Rdnr. 50). 320 321
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
261
Ermessen von der Möglichkeit der konstruktiven Enthaltung Gebrauch zu machen – oder auch nicht. Eine Besonderheit im GASP-Bereich liegt in Art. III-300 Abs. 1 UAbs. 2 EVV begründet. Nach dieser Vorschrift kann jedes Mitglied bei Stimmenthaltung eine Erklärung abgeben, wonach es nicht zur Durchführung des getroffenen Beschlusses verpflichtet ist, gleichzeitig aber anerkennt, dass der betreffende Rechtsakt für die Union verbindlich ist. Diese Vorschrift entspricht sinngemäß Art. 23 Abs. 1 UAbs. 2 EU. Allerdings können nicht eine beliebig große Anzahl von Mitgliedstaaten eine solche Erklärung abgeben, ohne dass das Zustandekommen des Beschlusses scheitert. Vertreten die Mitglieder des Rates, die bei ihrer Stimmenthaltung eine solche Erklärung abgegeben haben, mindestens ein Drittel der Mitgliedstaaten, die wiederum mindestens ein Drittel der Unionsbevölkerung ausmachen, so wird der Beschluss nicht erlassen. Eine solche Obergrenze besteht schon nach Art. 23 Abs. 1 UAbs. 2 EU. Neu hingegen ist die Anknüpfung an die doppelte Mehrheit, einerseits der Stimmen im Rat, andererseits der tatsächlichen Bevölkerungszahl.323 dd) Ausnahmsweise: Qualifizierte Mehrheit, Art. III-300 Abs. 2 EVV (1) Einzelne Bereiche, in denen das Beschlussfassungsverfahren mit qualifizierter Mehrheit gilt Dem Grundsatz der Einstimmigkeit stehen einige Bereiche der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit324 entgegen. Diese werden von Art. III-300 Abs. 2 lit. a-d EVV geregelt, wobei die unter den Buchstaben a), c) und d) aufgeführten Fälle der bisherigen Gesetzeslage nach dem EU-Vertrag entsprechen. Hiernach kann der Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit entscheiden, wenn er Europäische Beschlüsse über Aktionen oder Standpunkte der Union erlässt, die zur Grundlage einen Europäischen Beschluss des Europäischen Rates über die strategischen Interessen und Ziele der Union nach Art. III-293 Abs. 1 EVV haben (lit. a)325. Eine qualifizierte Mehrheit ist für einen Europäischen Beschluss ebenfalls ausreichend, wenn dieser zur Durchführung einer Aktion oder eines Standpunktes der Union dient (lit. c) oder wenn ein Sonderbeauftragter nach Art. III-302 EVV zu ernennen ist (lit. d). Den Fällen lit. a und c ist gemeinsam, dass vor den betreffenden Beschlüssen jeweils ein einstimmiger Europäischer Beschluss gefasst worden ist, die Einstimmigkeit daher schon im Vorfeld erzielt werden musste.326 Der Fall von lit. d 323 Art. 23 Abs. 1 UAbs. 2 EU knüpft dagegen nur an die Stimmenanzahl im Rat (die nach Art. 205 Abs. 2 EG gewogen wird) an. Vgl. auch Kugelmann, EuropaR 2004, 322 (336). 324 In vielen Konventsdokumenten wird dieser Begriff mit „BQM“ (englisch: „Qualified Majority Voting, QMV“) abgekürzt. 325 Die nach dem EU-Vertrag entsprechende Möglichkeit einer Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit (gem. Art. 23 Abs. 2, 1. Gedankenstr. EU) wurde bisher nicht genutzt, vgl. CONV 459 / 02, S. 24 (Rdnr. 44) und S. 25 (Rdnr. 47).
262
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
ist von eher geringer Bedeutung, da der Sonderbeauftragte nach Art. III-302 EVV keine besonderen Kompetenzen besitzt und sein Mandat unter der Leitung des Außenministers ausübt. Neu dagegen ist die Fallgruppe nach lit. b. Hiernach sind Ministerratsbeschlüsse mit qualifizierter Mehrheit zu treffen, wenn es sich um Beschlüsse über Aktionen oder Standpunkte der Union handelt, welche vom Außenminister dem Ministerrat unterbreitet wurden und auf ein spezielles Ersuchen des Europäischen Rates zurückgehen. Auch hier geht der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit ein einstimmiger Beschluss (im Rahmen des Europäischen Rates) voraus. Eine völlig neue Option räumt Art. III-300 Abs. 3 EVV (in Verbindung mit Art. I-40 Abs. 7 EVV) ein.327 Der Europäische Rat kann hiernach einstimmig beschließen, dass der Ministerrat in anderen als den (in Abs. 2) genannten Fällen mit qualifizierter Mehrheit entscheidet. Damit wird eine deutliche Flexibilisierung erreicht. Ein Konsens auf mitgliedstaatlicher Ebene, in bestimmten Bereichen der GASP künftig mit qualifizierter Mehrheit zu entscheiden, bedarf damit nicht mehr eines langwierigen Vertragsänderungsverfahrens, sondern ist durch einfachen (aber einstimmigen) Beschluss des Europäischen Rates durchführbar. Die Passerelle-Klausel328 ist nicht auf einen bestimmten Themenbereich begrenzt; sie kann allgemein geografische oder thematische Bereiche erfassen. Vorstellbar ist etwa der Übergang zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit in dem Bereich der Förderung und Wahrung von Demokratie und Menschenrechten oder einer europäischen Politik gegenüber Russland oder der Region der großen Seen in Afrika.329 Inwieweit diese Möglichkeit genutzt werden wird, bleibt der Zukunft überlassen; allein die Schaffung einer solchen Option stellt allerdings schon einen Flexibilitätsgewinn und einen Schritt in Richtung einer immer weitergehenden Integration der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik dar.330 326 In Fall a) muss im Vorfeld ein einstimmiger Beschluss über strategische Interessen und Ziele der Union gefasst werden, in Fall c) zuvor einstimmig eine Aktion oder ein Standpunkt der Union verabschiedet werden. 327 Die genannten Vorschriften entsprechen dem „Vereinfachten Vertragsänderungsverfahren“ nach Art. IV-444 EVV, nach dem ebenfalls durch einstimmigen Europäischen Beschluss ein Bereich, für den das Einstimmigkeitserfordernis gilt, in einen Bereich mit Beschlussfassungsverfahren mit qualifizierter Mehrheit „umgewandelt“ werden kann (Passerelle-Klausel). Als allgemeine Vorschrift gilt Art. IV-444 EVV per se auch für die GASP; die nochmalige Regelung in Art. III-300 Abs. 3 EVV sollte wohl sicherstellen, dass die Passerelle-Klausel auch im GASP-Bereich gilt. 328 Passerelle = erleichterte autonome Vertragsänderungen (Übergangsbestimmung), Oppermann, DVBl. 2003, 1234 (1245); vgl. auch die allgemeine Passerelle-Klausel in Art. IV-444 EVV. 329 Thym, ELJ 2004, 5 (11). 330 Im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer solchen Passerelle-Klausel nach dem Grundgesetz bestehen keine Bedenken. Art. III-300 Abs. 3 EVV gestattet es nämlich gerade nicht, im Sinne einer Generalermächtigung neue Kompetenzen für die Union zu begründen, welche bei der Ratifikation durch das nationale Parlament nicht absehbar
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
263
Festzuhalten bleibt, dass die Option nach Art. III-300 Abs. 3 EVV gemäß Abs. 4 nicht für Beschlüsse mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen gilt.331 Damit hat die abschließende Regierungskonferenz noch eine wichtige Klarstellung im Hinblick auf den Konventsentwurf vorgenommen, welcher in Art. I-24 Abs. 4 UAbs. 2 KE-EVV eine solche Einschränkung nicht vorsah, gleichzeitig aber mit Art. III-201 Abs. 4 KE-EVV den Bereich der Verteidigungspolitik von der Passerelle-Bestimmung ausnahm.332 (2) Ausnahme: Fortschreibung des Luxemburger Kompromisses von 1966, Art. III-300 Abs. 2 UAbs. 2 EVV In den Bereichen, in denen eine Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit möglich ist, können die Mitgliedstaaten unter bestimmten Voraussetzungen eine Abstimmung im Rat und damit eine drohende Abstimmungsniederlage verhindern. Diese Möglichkeit geht auf den Luxemburger Kompromiss von 1966 zurück und steht den Mitgliedstaaten auch derzeit nach dem EU-Vertrag zu (Art. 23 Abs. 2 UAbs. 2 EU).333 Im Vergleich zur geltenden Fassung haben sich nur marginale Änderungen ergeben. Um eine Abstimmung zu verhindern, muss sich der betreffende Staat auf „wesentliche“ (Art. 23 EU verlangt „wichtige“) Gründe der nationalen Politik berufen. Da diese Gründe aber einer politischen Beurteilung unterliegen und vom EuGH ohnehin nicht überprüft werden können, wird diesem marginal geänderten Wortlaut in der Praxis keine Bedeutung zukommen.334 Mit der Option nach Art. III-300 Abs. 2 UAbs. 2 EVV steht also jedem Mitgliedstaat die Möglichkeit offen, eine Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit zu verhindern und damit eine „Notbremse“335 zu ziehen. Nimmt ein Mitgliedstaat diese Möglichkeit wahr, kann – wie bisher auch – die betreffende Frage dem Europäischen Rat zur einstimmigen Beschlussfassung vorgelegt werden, in der Hoffnung, dass auf dieser höheren Ebene ein Konsens erreicht werden kann. Neu ist, dass der Verfassungsvertrag wären. Die Vorschrift lässt lediglich den Übergang von der einstimmigen Entscheidung zur Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit auf solchen Gebieten zu, die bereits im Kompetenzbereich der Europäischen Union liegen. Eine ähnliche, allerdings etwas eingegrenztere Passerelle-Klausel enthält im Übrigen schon der EG-Vertrag in Art. 133 Abs. 7 EG. 331 Auch diese Bestimmung wird in Art. IV-444 Abs. 1 UAbs. 2 EVV wiederholt. 332 Indes war nicht zu erwarten gewesen, dass Art. I-24 Abs. 4 UAbs. 2 KE-EVV die Regierungskonferenz überstehen würde, da diese Bestimmung über die „red lines“ des britischen Außenministers hinausging, vgl. Thym, ELJ 2004, 5 (11). 333 Erstmals primärrechtlich wurde diese Regelung im Vertrag von Amsterdam aufgenommen. 334 Interessant ist jedoch die unterschiedliche Schwerpunktsetzung. Der Konventsentwurf sah noch vor, dass der betreffende Staat aus „ganz wesentlichen“ Gründen der nationalen Politik eine Abstimmung verhindern möchte (Art. III-201 Abs. 2 UAbs. 2 KE-EVV). Der Verfassungsvertrag streicht das Wort „ganz“ und verlangt nur noch, wie gesagt, „wesentliche“ Gründe der nationalen Politik. 335 Siehe zu diesem Begriff CONV 459 / 02, S. 24 (Rdnr. 45).
264
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
dem europäischen Außenminister vor diesem Schritt die Aufgabe zuteilt, mit dem betroffenen Mitgliedstaat eine für diesen Mitgliedstaat annehmbare Lösung zu finden. Mit der beschriebenen Schutzklausel ist die Gefahr verbunden, dass in dem ohnehin schon kleinen Bereich, in dem die Möglichkeit der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit besteht, eine rasche Entscheidungsfindung behindert wird. Auf der anderen Seite könnte die Beibehaltung des Luxemburger Kompromisses den Übergang zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit in weiteren Bereichen erleichtern (durch die Nutzung der Passerelle-Klausel), weil sich die Mitgliedstaaten sicher sein dürfen, im Notfall nicht einfach überstimmt werden zu können.336 (3) Immer Einstimmigkeit bei Beschlüssen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen, Art. III-300 Abs. 4 EVV Weder die beschriebenen Fallgruppen der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit nach Abs. 2 noch die Möglichkeit zur Ausweitung der qualifizierten Mehrheit nach Abs. 3 sind auf Beschlüsse mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen anwendbar. Gemäß Art. III-300 Abs. 4 EVV müssen solche Beschlüsse immer einstimmig ergehen. Diese Einschränkung wurde bereits von der Arbeitsgruppe „Außenbeziehungen“ so vorgeschlagen.337 (4) Einführung einer neuen Art von Initiativen, Art. III-293 Abs. 2 EVV Eine verfahrensrechtliche Spezialvorschrift enthält Art. III-293 Abs. 2 EVV. Sollen Europäische Beschlüsse des Europäischen Rates über die strategischen Interessen und Ziele der Union gefasst werden, sieht Art. III-293 Abs. 2 EVV ein gemeinsames Vorschlagsrecht von Kommission und Außenminister vor. Betreffen die Vorschläge den Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, so ist der Außenminister zuständig; sollen Ziele und strategische Interessen der Union in anderen Bereichen des auswärtigen Handelns definiert werden, so ist für die betreffenden Vorschläge die Kommission zuständig. Diese neuartige Initiative im Bereich des außenpolitischen Handelns der EU geht auf die gleichlautenden Vorschläge des Hohen Vertreters Solana und des Kommissionsmitglieds Patten zurück, welcher sich die Arbeitsgruppe Außenbeziehungen annahm.338 Die neuartigen Initiativen bieten die Möglichkeit eines integrierten Ansatzes für außenpolitische Aspekte des Unionshandelns. Der Vorteil solcher Initiativen besteht in einem doppelten Synergieeffekt. Zum einen werden die verschiedenen Instrumente der Außenbeziehungen (einerseits der GASP, andererseits der übrigen Aspekte der 336 337 338
Thym, ELJ 2004, 5 (11). CONV 459 / 02, S. 24 (Rdnr. 45). CONV 459 / 02, S. 25 (Rdnr. 48).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
265
Unionspolitik, also diejenigen, die jetzt noch im EG-Vertrag zu finden sind) zu einem einheitlichen Vorgehen verbunden. Zum anderen werden, da für den Bereich der GASP der Außenminister, für die übrigen Bereiche des auswärtigen Handelns die Kommission zuständig ist, die jeweils kompetenten Personen und Organe in die Ausarbeitung der Initiativen einbezogen. Die gemeinsamen Initiativen von Kommission und Außenminister sollen in der Festlegung von strategischen Zielen und Interessen nach Art. III-293 EVV münden, die allgemeine Grundlage für das auswärtige Handeln der Union sind. Im Konvent war angedacht, dass für solche gemeinsamen Initiativen Verfahrenserleichterungen in Bezug auf den Abstimmungsmodus gelten sollen.339 Der Konvent konnte sich allerdings nicht darauf einigen, die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit generell auch auf die genannten Initiativen auszuweiten.340 Art. III-293 Abs. 1 UAbs. 3 EVV bestimmt, dass der Europäische Rat einstimmig beschließen muss. ee) Bewertung Das Festhalten am Einstimmigkeitserfordernis bedeutet eine große Gefahr für das Funktionieren der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Union. Nach der EU-Osterweiterung muss künftig ein Konsens zwischen 25 verschiedenen Mitgliedstaaten gefunden werden, ein nahezu unmögliches Unterfangen, wenn man sich die Schwierigkeiten betrachtet, die die Union beim Finden einer gemeinsamen Haltung mit den bisherigen 15 Mitgliedstaaten bereits hatte.341 Aus diesem Grunde plädierte eine große Mehrheit in der Arbeitsgruppe Außenbeziehungen für die Ausdehnung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit auf den GASPBereich.342 Diese Stimmen wurden, wie gerade beschrieben, nicht gehört. Damit 339 Von diesen gemeinsamen Initiativen sind die Vorschläge des Außenministers nach Art. III-300 Abs. 2 lit. b EVV zu unterscheiden, die tatsächlich die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit zur Folge haben. Zu beachten ist jedoch, dass diese Initiativen wiederum von einem „speziellen Ersuchen des Europäischen Rates“ abhängig sind. 340 CONV 459 / 02, S. 26 (Rdnr. 49). Eine Ausweitung wurde mit dem Argument befürwortet, dass die genannten gemeinsamen Initiativen „wahrscheinlich einem gemeinsamen Interesse der EU entsprechen und bei den einzelnen Mitgliedstaaten die allergrößte Unterstützung finden würden“; vgl. auch CONV 748 / 03, S. 11; CONV 727 / 03, S. 51, 58; einige Mitglieder des Konvents führten diesbezüglich das Argument an, „dass es aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht angemessen sei, das Verfahren für einen GASP-Beschluss davon abhängig zu machen, ob er mit einem einen anderen Politikbereich betreffenden Kommissionsvorschlag in Verbindung stehe“. Als Beispiel für eine ablehnende Haltung siehe CONV 741 / 03, S. 6 ff. (Bericht des engeren Ausschusses des britischen Oberhauses über die Europäische Union). 341 Kritisch auch Jopp / Regelsberger, Integration 2003, 550 (558), die von einer drastischen Erhöhung potentieller Vetospieler sprechen. 342 Insbes. WG VII – WD 11, S. 1 ff. (Adrian Severin) „Promoting the community method in the External actions of the EU“; CONV 459 / 02, S. 24, Rdnr. 45. Siehe auch den
266
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
wurde verkannt, dass allein die Möglichkeit der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit ein letzter Ausweg aus einer festgefahrenen Situation sein und die Konsensbildung im Rat positiv beeinflussen kann. Auch die Erfahrungen in den bereits vergemeinschafteten Bereichen, in denen nur sehr selten eine (Kampf-)Abstimmung vorgenommen wird, wurden vom Konvent nicht in Betracht gezogen. Dadurch, dass der Verfassungsentwurf das Einstimmigkeitserfordernis festschreibt, wird die Handlungsfähigkeit der Union eingeschränkt. Die Politik im GASP-Bereich wird so vom Standpunkt derjenigen geprägt sein, die den geringsten Ehrgeiz zeigen.343 Die Gegner einer Ausdehnung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit, führten zur Begründung ihrer Meinung an, dass es für einen Mitgliedstaat nicht einfach sei, in Fragen, in denen seine nationalen Interessen auf dem Spiel stünden, zu einer Minderheit zu gehören und überstimmt zu werden; dieses Argument ist indes umso unverständlicher, als es – wie bereits beschrieben – bei der Regelung des „Luxemburger Kompromisses“ bleibt. Hiernach kann sich jeder Mitgliedstaat in Ausnahmefällen auf lebenswichtige nationale Interessen berufen, um eine Abstimmung im Ministerrat zu verhindern (Art. III-300 Abs. 2 UAbs. 2 EVV). Umso bedauerlicher ist, dass der Konvent trotz dieser Klausel keinen Konsens darüber erzielen konnte, die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit als allgemeine Regel für den GASP-Bereich aufzustellen. Im Bereich der einstimmigen Beschlussfassung soll eine Lähmung der Union durch die Möglichkeit der „konstruktiven Enthaltung“ nach Art. III-300 Abs. 1 UAbs. 2 EVV verhindert werden. Mitgliedstaaten, die einen Europäischen Beschluss nicht vorbehaltlos unterstützen (wollen), sollen sich enthalten können und so den Weg frei machen für diejenigen Mitgliedstaaten, die einen Konsens erzielt haben. Das Konzept der „konstruktiven Enthaltung“ verspricht jedoch nur dann Erfolg, wenn der betreffende Mitgliedstaat das Zustandekommen eines bestimmten Beschlusses nicht bewusst verhindern will. Ansonsten wird der betreffende Mitgliedstaat gegen den Beschluss stimmen und ihn damit verhindern. Der im Konvent bestehende Konsens darüber, dass die Möglichkeit der „konstruktiven Enthaltung“ besser genutzt werden müsse344, wird in der Praxis nicht weiterhelfen, da ein Mitgliedstaat rechtlich nicht dazu gezwungen werden kann, die Option der konstruktiven Enthaltung öfter zu nutzen, um den anderen Mitgliedstaaten nicht im Wege zu stehen. Mit der weitgehenden Beibehaltung des status quo im Bereich der Mehrheitserfordernisse im Beschlussfassungsverfahren hat sich die Union der Chance beraubt, schnell und flexibel auf außenpolitische Herausforderungen und Probleme reagieren zu können. Damit bleibt es weiterhin bei einem langwierigen, auf Kon„Deutsch-französischen Beitrag zum Europäischen Konvent über die institutionelle Architektur der Union“, CONV 489 / 03, S. 6. 343 CONV 459 / 02, S. 24, Rdnr. 45. 344 CONV 473 / 02, S. 5 (Rdnr. 12) – Synthesebericht über die Plenartagung vom 20. 12. 2002.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
267
sens abzielenden Abstimmungsprozess, der auf den kleinsten gemeinsamen Nenner hinauslaufen wird. Behält man im Auge, dass die Europäische Union in Zukunft mindestens 27 Mitgliedstaaten haben wird, ist zu erwarten, dass die Konsensfindung immer schwieriger und eine Einigung – wenn überhaupt – auf einem immer geringeren Niveau stattfinden wird. Kann dagegen überhaupt keine Lösung gefunden werden, so entsteht durch das Fehlen einer klaren Politik der Union ein Vakuum, welches mitunter durch widersprüchliches Verhalten der Mitgliedstaaten aufgefüllt werden wird.345 Selbst wenn schließlich ein Konsens gefunden werden kann, hat das Einstimmigkeitsprinzip oftmals die Beschlussfassung erheblich verzögert, weil lange Zeit um einen Kompromiss gerungen werden musste. Dies ist vor allem problematisch in Situationen, in denen eine unverzügliche Reaktion erforderlich ist. Als Ausweg aus der „Einstimmigkeitsfalle“ bietet sich die in Art. III-300 Abs. 3 EVV enthaltene Möglichkeit an, wonach der Europäische Rat einstimmig beschließen kann, dass der Ministerrat in anderen als den in der Verfassung ausdrücklich genannten Fällen mit qualifizierter Mehrheit beschließt (Passerelle-Klausel). Ob und inwieweit der Europäische Rat diese Möglichkeit nutzen wird, ist allerdings ungewiss. Auch die oft schon beschwörend anmutenden Appelle, die bisher bestehenden (und im Verfassungsvertrag übernommenen) Möglichkeiten der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit besser zu nutzen346, sind nicht rechtsverbindlich und ihre Befolgung wiederum vom politischen Willen der Mitgliedstaaten abhängig. Daher bleibt es bei einem ernüchternden Blick auf die künftige Handlungsfähigkeit der Europäischen Union im GASP-Bereich.347
g) Die Rolle des Europäischen Rates Der Europäische Rat nimmt auch weiterhin eine zentrale Rolle im Machtgefüge der GASP ein. Ihm steht es zum einen zu, gemäß Art. III-293 EVV die allgemeinen strategischen Interessen und Ziele der Union festzulegen. Diese gelten nicht nur für den Bereich der GASP, sondern für das gesamte auswärtige Handeln der Union. Damit können die allgemeinen und strategischen Interessen und Ziele über die GASP hinaus einen wesentlichen Faktor für die Gewährleistung der Gesamtkohärenz des Handelns der Union auf internationaler Ebene darstellen.348 Zum anderen bestimmt der Europäische Rat die allgemeinen Leitlinien der GASP, und zwar auch bei Fragen mit verteidigungspolitischen Bezügen (Art. III-295 Abs. 1 345 So schon die Warnungen des Konvents in einem frühen Stadium seiner Tätigkeit, vgl. CONV 200 / 02, S. 4 (Rdnr. 10) – Synthesebericht über die Plenartagung vom 11. / 12. 7. 2002. 346 Vgl. nur CONV 459 / 02, S. 25 (Rdnr. 46). 347 Kritisch auch Risse, Integration 2003, 564 (567), der die Beibehaltung des Konsensprinzips im GASP-Bereich zu den wichtigsten Schwächen des Verfassungsvertrages zählt. 348 CONV 459 / 02, S. 17 (Rdnr. 24).
268
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
EVV).349 Insgesamt ist der Europäische Rat damit das zentrale Gremium im Bereich der Bestimmung der Außenpolitik der Union. Art. III-295 Abs. 1 UAbs. 2 EVV legt erstmals ausdrücklich fest, dass, wenn es eine internationale Entwicklung erfordert, der Präsident des Europäischen Rates eine außerordentliche Tagung des Europäischen Rates einberufen kann. Derzeit enthält Art. 22 EU eine ähnliche Bestimmung, die allerdings nur den Rat betrifft. Bislang ist der Europäische Rat nur nach Art. 4 EU mit Organstatus versehen (im EG-Vertrag ist er nicht erwähnt), nun rückt er in der Aufzählung des Art. I-19 EVV an die zweite Stelle hinter das Europäische Parlament. Nach Art. I-40 Abs. 6 EVV ergehen die Beschlüsse des Europäischen Rates grundsätzlich einstimmig.
h) Die Rolle des Europäischen Parlaments aa) Allgemeine Anhörungsrechte im GASP-Bereich Allgemein bestimmt Art. III-304 EVV in Verbindung mit Art. I-40 Abs. 8 und Art. I-41 Abs. 8 EVV, dass der Außenminister der Union das Europäische Parlament zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden Weichenstellungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, anhört und darauf achtet, dass die Auffassungen des Parlaments gebührend berücksichtigt werden. Zudem wird das Europäische Parlament vom Außenminister der Union regelmäßig über die Entwicklungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, unterrichtet.350 Durch den Verfassungsvertrag wird das Anhörungsrecht des Parlaments auch auf die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ausgedehnt. Zudem wird der Außenminister der Union in die Aufgaben nach Art. III-304 EVV einbezogen, er übernimmt die Rolle des Vorsitzes351 nach Art. 21 EU. Das Parlament muss vom Außenminister (nach derzeitiger Rechtslage vom Vorsitz und von der Kommission) über die Entwicklungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, unterrichtet werden.352 Neu 349 Beide Funktionen des Europäischen Rates werden nochmals in Art. I-40 Abs. 2 EVV betont. 350 Nach Art. III-304 Abs. 1 EVV „unterrichtet“ der Außenminister das Europäische Parlament, nach Art. III-40 Abs. 8 und Art. III-41 Abs. 8 EVV hält er es „auf dem Laufenden“. 351 Im Vergleich zur jetzigen Rechtslage ist dies die Rolle des Vertreters der Regierung desjenigen Mitgliedstaates, der im Rat den Vorsitz hat. 352 Ähnliche Vorschriften finden sich in Art. I-40 Abs. 8 und Art. I-41 Abs. 8 EVV wieder, in denen dem Parlament allgemein zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden Weichenstellungen im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und dem Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik ein regelmäßiges Anhörungsrecht eingeräumt und ihm zugesichert wird, dass es jeweils „auf dem Laufenden“ gehalten wird;
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
269
in den Verfassungstext eingefügt wurde die Bestimmung, wonach Sonderbeauftragte in die Unterrichtung des Europäischen Parlaments einbezogen werden können.353 Darüber hinaus kann das Europäische Parlament Anfragen und Empfehlungen an den Ministerrat und den Außenminister der Union richten. Die Aussprache über die Fortschritte bei der Durchführung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (Art. III-304 Abs. 2 EVV), wird nicht wie bisher einmal (Art. 21 EU), sondern zweimal jährlich geführt werden. Erwähnenswert ist schließlich, dass sich der Außenminister als Mitglied der Europäischen Kommission gemäß Art. I-27 Abs. 2 UAbs. 2 EVV dem Zustimmungsvotum des Europäischen Parlaments stellen muss. Neben den genannten Ergänzungen beinhaltet der Verfassungsvertrag keine weiteren Kompetenzzuwächse für das Europäische Parlament.354 Im Wesentlichen verbleibt es daher bei den bisherigen Beteiligungsrechten (Information und Konsultation) für das Europäische Parlament bezüglich der wichtigsten Aspekte und grundlegenden Weichenstellungen im Bereich der GASP.355 Damit hat der Verfassungsvertrag das Europäische Parlament nicht aus seiner untergeordneten Rolle in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik herausgehoben. Das Budgetrecht, das dem Parlament in vielen Bereichen ein beachtliches Mitspracherecht einräumt, muss im GASP-Bereich nicht notwendigerweise wirksam werden, da eine Finanzierung von operativen Maßnahmen – am Parlament vorbei – durch Beiträge der Mitgliedstaaten möglich ist (Art. III-313 Abs. 2 S. 1 EVV).356
bb) Anhörungsrecht bei völkerrechtlichen Übereinkommen im GASP-Bereich Bei Verträgen im GASP-Bereich besteht weiterhin nicht einmal ein Anhörungsrecht für das Europäische Parlament. Somit bleibt die Rolle des Europäischen Parlaments weit hinter derjenigen zurück, die es in anderen Politikbereichen spielt. Nach Art. III-325 Abs. 6 UAbs. 2 EVV ist eine Anhörung des Europäischen Pardamit ist das Anhörungs- und Informationsrecht des Europäischen Parlaments doppelt abgesichert. 353 CONV 727 / 03, S. 52. 354 Dies entspricht der Ansicht der Gruppe „Außenbeziehungen“, „( . . . ) dass der gegenwärtige Artikel 21 EUV im Zusammenhang mit der GASP zufrieden stellend ist.“, CONV 259 / 02, S. 8 (Rdnr. 10). Kritisch dazu mit guter Begründung Krajewski, YEL 2003, 435 (450 ff.). 355 Thym, ELJ 2004, 5 (13). 356 Kadelbach, in: Hofmann / Zimmermann, Eine Verfassung für Europa, S. 145 (159).
270
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
laments ausgeschlossen, wenn eine Übereinkunft die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betrifft. Die Beschränkung des Anhörungsrechts gilt jedoch nur so weit, wie die Übereinkunft ausschließlich die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betrifft. Folglich steht dem Europäischen Parlament dann ein Anhörungs- oder gegebenenfalls ein Zustimmungsrecht zu, wenn das völkerrechtliche Abkommen neben einer Regelung im GASP-Bereich auch andere Gegenstände der Kompetenz der Union betrifft.
i) Die Rolle der nationalen Parlamente Nach bisheriger Rechtslage finden die nationalen Parlamente im EU-Vertrag keine Erwähnung.357 Nach den Empfehlungen der Arbeitsgruppe Außenbeziehungen sollte für einen regelmäßigen Gedankenaustausch zwischen dem Europäischen Parlament und den einzelstaatlichen Parlamenten über Fragen der GASP gesorgt werden sollte.358 Eine solche Bestimmung fand indes keinen Eingang in den Verfassungsvertrag. Das dem Verfassungsvertrag beigefügte „Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union“ sieht nun eine umfassende Unterrichtung der nationalen Parlamente über Initiativen vor, die den Erlass eines Europäischen Gesetzgebungsaktes zum Ziel haben. Im Bereich der GASP sind allerdings nur Europäische Beschlüsse zulässig, Europäische Gesetze und Rahmengesetze sind ausgeschlossen (Art. I-40 Abs. 6 EVV). Gemäß Art. I-33 Abs. 1 UAbs. 5 EVV sind Europäische Beschlüsse Rechtsakte ohne Gesetzescharakter. Damit läuft die von dem oben genannten Protokoll begründete Unterrichtungspflicht für den Bereich der GASP leer. Relevant für die GASP bleibt damit nur Art. 10 des Protokolls, welcher die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Parlamenten regelt. Hiernach kann eine Konferenz der Europa-Ausschüsse der Parlamente auch interparlamentarische Konferenzen zur Erörterung von Fragen der Gemeineinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, organisieren. Die Beiträge dieser Konferenz binden jedoch die nationalen Parlamente ausdrücklich nicht und greifen auch nicht deren Standpunkt vor.
j) Politisches und Sicherheitspolitisches Komitee, Art. III-307 EVV Die Rolle des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees bleibt unverändert359, es verfasst an den Ministerrat gerichtete Stellungnahmen zur Festlegung 357 Zur Bedeutung der einzelnen nationalen Parlamente auf mitgliedstaatlicher Ebene, insbesondere in Bezug auf militärische Einsätze im Ausland, vgl. Thym, ELJ 2004, 5 (14). 358 CONV 459 / 02, S. 29, Rdnr. 60. 359 Vgl. Art. 25 EU.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
271
der Politik der Union. Außerdem nimmt das Komitee – unter der Verantwortung des Ministerrates und des Außenministers – die politische Kontrolle und strategische Leitung von Krisenbewältigungsoperationen wahr.
k) Verschärfte gegenseitige Konsultations- und Koordinationspflichten, Art. I-40 Abs. 5 EVV Die gegenseitigen Konsultations- und Koordinationspflichten der Mitgliedstaaten werden durch Art. I-40 Abs. 5 EVV sehr viel weitgehender spezifiziert, als dies noch im EU-Vertrag der Fall ist.360 Durch Art. I-40 Abs. 5 EVV (und Art. III-297 Abs. 3 EVV) werden die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, sich auf EU-Ebene zunächst abzustimmen und zu unterrichten, bevor sie auf internationaler Bühne eine Position von allgemeiner Bedeutung vertreten. Dies soll einen Beitrag dazu leisten, dass ein „europäischer Reflex“ geschaffen, dass Konfrontationsrisiken auf internationaler Ebene vermindert und gemeinsame Positionen ausgearbeitet werden.361 Problematisch ist jedoch, dass die Einhaltung dieser Bestimmung – wie bisher auch nach Art. 11 EU – der Ministerrat kontrolliert (Art. III-294 Abs. 2 UAbs. 3 EVV). Der Ministerrat muss sich daher selbst kontrollieren.362 Allerdings kommt hier der Außenminister der Union ins Spiel, der gemäß Art. III-294 Abs. 2 UAbs. 3 EVV ebenfalls für die Einhaltung der Grundsätze der GASP Sorge tragen soll. Damit weist die Verfassung dem Außenminister für den Bereich der GASP eine ähnliche Rolle zu, wie sie der Kommission als „Hüterin der Verträge“ für die Europäische Union insgesamt zukommt – allerdings ohne die Möglichkeit, den Europäischen Gerichtshof anzurufen.363 Einem unilateralen Verhalten von Mitgliedstaaten kann der Außenminister lediglich mit der Strategie des „Anprangerns und Beschämens“ (naming and shaming) entgegentreten.364
l) Finanzierung der GASP Art. III-313 EVV aa) Allgemeine Finanzierung der GASP Der Konvent war sich einig, dass die Effizienz im GASP-Bereich eng mit der Frage angemessener Ressourcen – sowohl was deren Umfang als auch was das Risse, Integration 2003, 564 (569 f.). CONV 748 / 03, S. 11. 362 Zur alten Frage der Staats- und Rechtsphilosophie: Wer bewacht die Wächter „Quis custodiet custodes ipsos?“ im Rahmen der (derzeitigen) Kompetenzordnung der Europäischen Union, Everling, EuZW 2002, 357. 363 Kadelbach, in: Hofmann / Zimmermann, Eine Verfassung für Europa, S. 145 (160); Risse, Integration 2003, 564 (570). 364 Risse, Integration 2003, 564 (571). 360 361
272
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
betreffende Verfahren betrifft – verknüpft ist.365 Die für die GASP bestimmten Haushaltsmittel haben sich nach Auffassung der Gruppe „Außenbeziehungen“ als unzureichend für die Umsetzung der zur Unterstützung der EU-Außenpolitik als notwendig erachteten Maßnahmen erwiesen.366 Hinsichtlich des Umfangs der Finanzmittel im GASP-Bereich sind jedoch keine Bestimmungen in die Verfassung aufgenommen worden. Damit muss der für die GASP bestimmte Teil des Haushalts in den Haushaltsberatungen jeweils neu festgelegt werden. Was das gegenwärtige Finanzierungssystem und -verfahren betrifft, entspricht die Regelung des Art. III-313 Abs. 1 und 2 EVV derjenigen des Art. 28 Abs. 2 und 3 EU. Die Verwaltungsausgaben, die den Organen bei der Durchführung der GASP entstehen, gehen zulasten des Haushalts der Union. Ebenso verhält es sich mit operativen Ausgaben, soweit sie nicht Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen umfassen oder soweit nicht der Ministerrat etwas anderes beschließt. Die Übernahme von Kosten militärischer Operationen durch den Unionshaushalt bleibt demnach grundsätzlich untersagt. bb) Sofortfinanzierung für die Vorbereitung von Operationen mit zivilem Charakter Neue Regelungen sieht der Verfassungsvertrag allerdings für die Sofortfinanzierung in Eilfällen vor (Art. III-313 Abs. 3 EVV). Eine solche Sofortfinanzierung ist nach dem derzeit üblichen Verfahren nicht möglich.367 Da für die Einleitung von Operationen – ziviler oder militärischer Art – ein schneller Zugriff auf die benötigten Finanzmittel erforderlich ist, erscheint die Neuregelung sinnvoll.368 Art. III-313 Abs. 3 EVV regelt insbesondere die Finanzierung der Vorbereitung, nicht der Durchführung von Missionen. Innerhalb des einschlägigen Art. III-313 Abs. 3 EVV wird zwischen Missionen, die zulasten des Haushaltes der Union gehen (UAbs. 1), und solchen, die nicht zulasten des Haushaltes der Union gehen (UAbs. 2, 3), differenziert. Für Fälle nach UAbs. 1 soll der Ministerrat einen Europäischen Beschluss fassen, der den schnellen Zugriff auf die Haushaltsmittel der Union regelt. Von dem Verweis in UAbs. 1 auf Vorbereitungen für Missionen nach Art. I-41 Abs. 1 und Art. III-309 EVV sind lediglich Operationen mit zivilem oder vorwiegend zivilem Charakter erfasst. Missionen mit militärischem Charakter werden von UAbs. 2 geregelt. Durch Art. III-313 Abs. 3 UAbs. 1 EVV wird eine Sofortfinanzierung für die Vorbereitungsphase einer zivilen Mission nach Art. I-41 EVV ermöglicht. Bisher CONV 459 / 02, S. 28. Zur Finanzierung der GASP und der Bedeutung von interinstitutionellen Abkommen zwischen Europäischem Parlament, Kommission und Rat vgl. WG VII – WD 24 (Michel Barnier). 367 CONV 685 / 03, S. 50. 368 CONV 461 / 02, S. 17. 365 366
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
273
gilt ein schwerfälliges Verfahren, das dazu führt, dass viel (von der für den Start der Operation kostbaren) Zeit verloren geht.369 Durch den nach Art. III-313 Abs. 3 UAbs. 1 EVV möglichen Europäischen Beschluss kann eine besondere Haushaltslinie geschaffen werden, die nach einem speziellen Verfahren verwaltet wird, welches einen schnellen Zugriff auf die Mittel ermöglicht.370 Damit wird es in Zukunft wohl zu einer Lockerung des üblichen Verfahrens, etwa zum Verzicht auf das Ausschreibungsverfahren, kommen. Neben den zivilen Missionen nach Art. I-41 Abs. 1 EVV ist auch die Sofortfinanzierung von anderen Initiativen im GASP-Bereich erfasst, soweit sie vom Haushalt der Union finanziert werden.
cc) Sofortfinanzierung für die Vorbereitung von Operationen mit militärischem Charakter Art. III-313 Abs. 3 UAbs. 2 und 3 EVV regelt speziell die Finanzierung der Vorbereitungsphase von Missionen mit militärischem Charakter nach Art. I-40 Abs. 1 EVV. Für diese Fälle soll ein Anschubfonds durch Europäischen Beschluss gebildet werden. Mittels ausgestaltender Europäischer Beschlüsse sollen Regelungen über die Finanzierung, Verwaltung und Finanzkontrolle dieses neuen Instruments getroffen werden. Die gerade genannten Europäischen Beschlüsse kommen auf Vorschlag des Außenministers zustande. Hervorzuheben ist, dass der Außenminister der Union für Missionen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit militärischem Charakter eine tragende Rolle übernimmt. Der Außenminister wird vom Ministerrat ermächtigt, auf den Anschubfonds zuzugreifen. Damit soll für eine effiziente und schnelle Inanspruchnahme des Fonds gesorgt werden. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme des Fonds bedeutet eine gewisse Autonomie des Außenministers, allerdings muss er dem Rat regelmäßig Bericht über die ihm übertragenen Aufgaben erteilen. Da der Anschubfonds zunächst aus mitgliedstaatlichen Mitteln gespeist wird, entzieht er sich den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Union und damit auch der Einbeziehung des Europäischen Parlaments.371 Dies bedeutet eine weitere Intergouvernementalisierung der GASP bei militärischen Maßnahmen.
CONV 685 / 03, S. 50. Vgl. auch den Vorschlag der Arbeitsgruppe „Außenbeziehungen“ (CONV 459 / 02, S. 29), wonach ein größerer Anteil (von 5 – 10 %) an den wichtigsten Hilfsprogrammen nicht einem konkreten Zweck zugewiesen werden solle, damit die Union in die Lage versetzt werde, im Falle unerwarteter Krisen umgehend reagieren zu können. 371 Jopp / Regelsberger, Integration 2003, 550 (559). 369 370
18 Metz
274
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
m) Verhältnis zwischen Außenminister der Union und dem EU-Ratspräsidenten Das Verhältnis zwischen dem Außenminister der Union und dem EU-Ratspräsidenten lässt der Verfassungsvertrag ungeklärt. Hier prallen zwei institutionelle Neuerungen aufeinander. Der Ratspräsident, der für zweieinhalb Jahre gewählt werden wird, nimmt gemäß Art. I-22 Abs. 2 UAbs. 2 EVV die Außenvertretung der Union „unbeschadet der Befugnisse des Außenministers der Union“ in Angelegenheiten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wahr. Dies wird teilweise als eingebauter Rollenkonflikt im Institutionsgefüge der neuen Europäischen Union interpretiert.372 Der Ratspräsident wird jedoch kein einzelstaatliches Amt mehr innehaben (Art. I-22 Abs. 3 EVV), und es wird damit leichter für ihn sein, den Standpunkt der Union gegenüber den mitgliedstaatlichen Einzelinteressen zu fördern.373 Außerdem steht dem Ratspräsidenten gegenüber dem Außenminister – anders als in nationalen Strukturen – kein Weisungsrecht zu.374 Dem Ratspräsident kommt überall dort eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Außenpolitik zu, wo der Europäische Rat starke Kompetenzen besitzt, nämlich bei der Festlegung der Agenda, bei der Ausrichtung der Leitlinien und bei der Vermittlung zwischen den Mitgliedstaaten.375 Außerdem trifft ihn im Krisenfall eine besondere Verantwortung für den Zusammenhalt der Union, weshalb er außerordentliche Sitzungen anberaumen kann (Art. III-295 Abs. 1 UAbs. 2 EVV).376 Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass die Rolle des Ratspräsidenten weniger operativ als repräsentativ konzipiert ist.377 Der Wortlaut des Verfassungsvertrages spricht für ein Rollenmodell, wie es oft in internationalen Foren vorgefunden werden kann. Demnach repräsentieren der Ratspräsident, wenn sich die Staats- und Regierungschefs treffen, und der Außenminister, wenn die nationalen Außenminister zusammenkommen.378 Grundsätzlich ist es aber der Außenminister, der als Ansprechpartner für alle Aspekte der Außenpolitik sowie alle externen Aspekte interner Maßnahmen fungiert und für die Kohärenz der genannten Bereiche untereinander Sorge zu tragen hat. Nicht zuletzt wird das Verhältnis der beiden Ämter wesentlich von den jeweiligen Personen abhängen, die die Ämter bekleiden werden.379 Um ein dem System inhärentes Konkurrenzverhältnis auszuschließen, werden enge und kontinuierliche Risse, Integration 2003, 564 (571); Thym, ELJ 2004, 5 (21). Risse, Integration 2003, 564 (571). 374 Kadelbach, in: Hofmann / Zimmermann, Eine Verfassung für Europa, S. 145 (157). 375 Kadelbach, in: Hofmann / Zimmermann, Eine Verfassung für Europa, S. 145 (156). 376 Kugelmann, EuropaR 2004, 322 (335). 377 Einem, EuropaR 2004, 202 (209). Sowohl der Außenminister als auch der Ratspräsident nehmen aber beide Arten von Aufgaben wahr, Kugelmann, EuropaR 2004, 322 (335). 378 Thym, ELJ 2004, 5 (21). 379 Kugelmann, EuropaR 2004, 322 (335). 372 373
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
275
Absprachen zwischen dem Außenminister und dem Ratspräsidenten erforderlich sein.380 n) Möglichkeit der Verstärkten Zusammenarbeit, Art. I-44 und Art. III-416 ff. EVV Die Art. 27 a bis e EU sehen – seit dem Vertrag von Nizza – für die jetzige Union die Möglichkeit einer verstärkten Zusammenarbeit einzelner Staaten vor.381 Eine solche verstärkte Zusammenarbeit ist jedoch auf die Durchführung einer gemeinsamen Aktion oder die Umsetzung eines gemeinsamen Standpunktes beschränkt.382 Diese Beschränkungen fallen nach der Neuregelung weg, wodurch der gesamte Bereich der GASP für eine Verstärkte Zusammenarbeit geöffnet wird. Von Art. I-44 EVV, Art. III-419 Abs. 2 und III-420 Abs. 2 EVV werden spezielle Bedingungen für eine Verstärkte Zusammenarbeit im GASP-Bereich festgelegt.383 Diese Verstärkte Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. III-422 EVV bedeutet ein zweifaches Flexibilisierungsinstrument.384 Zum einen wird es Mitgliedstaaten ermöglicht, im Rahmen der Union eine engere Zusammenarbeit zu begründen (Art. III-419 EVV), zum anderen wird eine Passerelle-Klausel auch für diejenigen Bereiche eingeführt, in denen eine Verstärkte Zusammenarbeit bereits begründet wurde (Art. III-422 EVV).385 Die letztgenannte Möglichkeit des Übergangs zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit bedeutet einen weitreichenden Forschritt im Bereich der Flexibilisierung.386 Die Begründung einer Verstärkten Jopp / Regelsberger, Integration 2003, 550 (561). Dieselbe Möglichkeit besteht gemäß Art. 40 ff. EU für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen und gemäß Art. 11 f. EG für den Gemeinschaftsbereich. 382 Bisher wurde diese Möglichkeit von den Mitgliedstaaten der Union nicht wahrgenommen, die Regelungen sind bisher „toter Buchstabe“ geblieben, Kugelmann, EuropaR 2004, 322. Die Beschränkung auf Durchführungsmaßnahmen führt in der Praxis zur Nichtanwendung des Instruments, da kaum ein Grund ersichtlich ist, eine gemeinsam beschlossene Maßnahme nicht auch gemeinsam durchzuführen, so Kugelmann, EuropaR 2004, 322 (341). 383 Dementsprechend regeln Art. III-419 Abs. 1 und III-420 Abs. 1 EVV die Bedingungen für eine Verstärkte Zusammenarbeit in allen anderen Bereichen der Verfassung (mit Ausnahme derjenigen, in denen der Union die ausschließliche Kompetenz zusteht). Diese abweichenden Regelungen sind ein Relikt der durch den Verfassungsvertrag grundsätzlich überwundenen Säulenstruktur. Siehe allgemein zur verstärkten Zusammenarbeit in der GASP Kugelmann, EuropaR 2004, 322 und Jopp / Regelsberger, Integration 2003, 550 (555 f.). 384 Thym, ELJ 2004, 5 (11). 385 Beschlüsse mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen sind von dieser Passerelle-Klausel ausgenommen. Insofern wird dieser Bereich konsequent und unumstößlich dem Konsensprinzip unterworfen. Vgl. auch Art. III-300 Abs. 4 EVV und Art. III-444 Abs. 1 UAbs. 2 EVV. 386 Problematisch erscheint hier jedoch das Verfahren, nach dem diese Flexibilisierungsbestimmungen Eingang in den Konventsentwurf gefunden haben. Es gab weder eine Arbeitsgruppe „Flexibilisierung“ noch beschäftigte sich die Arbeitsgruppe „Außenbeziehungen“ mit diesem Thema. Das Präsidium brachte schließlich den genannten Vorschlag in der letzten 380 381
18*
276
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Zusammenarbeit ebenso wie der Übergang zur qualifizierten Mehrheit bedarf jeweils der einstimmigen Beschlussfassung des Rates (Art. III-419 Abs. 2 UAbs. 2 EVV und Art. III-422 Abs. 1 EVV).387 Eine Verstärkte Zusammenarbeit kann nur begründet werden, wenn sich mindestens ein Drittel der Mitgliedstaaten hierzu bereit finden (Art. I-44 Abs. 2 EVV).388 Der Ausbau der Verstärkten Zusammenarbeit ist vor allem ein Instrument zur Effektivierung der GASP.389 In einer Union mit 25 (und mehr) Mitgliedstaaten bietet die Verstärkte Zusammenarbeit die Chance, Bewegung in politisch festgefahrene Situationen zu bringen. Die Verstärkte Zusammenarbeit beinhaltet aber auch Risiken, sie kann den Rahmen der Union sprengen und damit zur Gefahr für den Zusammenhalt der Union werden.390
o) Bewertung Insgesamt gesehen wurde mit dem Verfassungsvertrag kein revolutionärer Integrationssprung nach vorne für den Bereich der GASP erreicht.391 Insbesondere die Beibehaltung des Einstimmigkeitserfordernisses stellt ein großes Blockadepotential in diesem Politikbereich dar. Dagegen lässt die starke Rolle des Außenministers der Union hoffen, dass der Außenpolitik der Union künftig ein Gesicht verliehen wird, dass die Politik künftig kohärenter und beständiger sein wird.392 Ob Arbeitssitzung des Konvents am 09. 07. 2003, einen Tag, bevor der Konventsentwurf einstimmig verabschiedet wurde, ein. Vgl. CONV 847 / 03 und Thym, ELJ 2004, 5 (11). Die abschließende Regierungskonferenz stellte die genannten Regelungen im Grundsatz jedoch nicht in Frage. 387 In diesem Punkt schuf die Regierungskonferenz Klarheit. Der Konventsentwurf enthielt nämlich keine eindeutige Regelung bezüglich des Abstimmungsmodus. Zu dieser strittigen Rechtslage vgl. Kadelbach, in: Hofmann / Zimmermann, Eine Verfassung für Europa, S. 145 (163 f.) und Kugelmann, EuropaR 2004, 322 (339), der für die Anwendung der allgemeinen Regeln und damit für die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit plädiert. 388 Dieses Kriterium bedeutet eine Erleichterung, denn nach bisherigem Recht müssen mindestens die Hälfte der 15 Mitgliedstaaten (also mindestens 8) an der verstärkten Zusammenarbeit teilnehmen, Art. 43 lit. g EU, die Festlegung auf ein Drittel der Mitgliedstaaten bedeutet (bei gegenwärtig 25 Mitgliedstaaten) den Zusammenschluss von mindestens 9 Mitgliedstaaten. In CONV 200 / 02, S. 4 (Rdnr. 11) wird – etwas unglücklich – von einer „Koalition der Handlungswilligen“ gesprochen. Treffender scheint dagegen die Formulierung „Pioniergruppe“, spöttisch auch als „Europa à la carte“ bezeichnet, vgl. Oppermann, DVBl. 2003, 1234 (1239 f.). 389 Kugelmann, EuropaR 2004, 322 (324). 390 Kugelmann, EuropaR 2004, 322 (325, 342); Kugelmann hält daher die Verstärkte Zusammenarbeit nicht für ein geeignetes Instrument der Außenpolitik, vielmehr plädiert er für die Einführung der Mehrheitsentscheidung – anders im Bereich der Verteidigungspolitik. Jopp / Regelsberger, Integration 2003, 550 (555), bezeichnen die Verstärkte Zusammenarbeit dagegen als einen „echten Durchbruch“. 391 Risse, Integration 2003, 564 (572 f.).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
277
durch die einheitliche Repräsentation auch eine einheitliche Politik geschaffen werden kann, bleibt abzuwarten. Darüber hinaus wirft die Verschmelzung der ehemaligen Säulen Probleme auf. Einerseits ist der Politikbereich der GASP formal nicht von den anderen Politikbereichen getrennt, andererseits bestehen durchgängig spezielle Verfahrensregeln. Der Grundsatz des Vorrangs des Unionsrechts wurde jetzt in Art. I-6 EVV ausdrücklich kodifiziert. Als allgemeine Regel beansprucht dieser Rechtsgrundsatz auch Geltung für den Bereich der GASP. Da bezüglich der unmittelbaren Wirkung des Unionsrechts keine Sonderregelungen bestehen, findet die ursprünglich für das Gemeinschaftsrecht entwickelte Rechtsfigur nun ebenfalls für den Bereich der GASP Anwendung.393 Aufgrund des Inhalts der im Rahmen der GASP erlassenen Regelungen werden jedoch nur sehr selten Fälle auftreten, in denen ein GASPBeschluss unmittelbare Wirkung entfalten könnte. Die Tatsache, dass die GASP weitgehend der Rechtsprechungsgewalt des EuGH entzogen ist, wirft darüber hinaus die Frage nach einer wirksamen Kontrolle der beiden Prinzipien auf. Festzuhalten bleibt, dass der Politikbereich der GASP auch künftig einen Sonderbereich darstellt, der faktisch nach wie vor stark von den Mitgliedstaaten dominiert wird. Dies ergibt sich aus institutionellen und verfahrensrechtlichen Vorkehrungen, die die GASP gerade nicht der Gemeinschaftsmethode unterwerfen.394
3. Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Art. I-41 EVV und Art. III-309 – Art. III-312 EVV a) Grundlagen Die Gemeinsame Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP)395 ist weiterhin integraler Bestandteil der GASP. Auch wenn eine formelle Trennung zwischen GASP und ESVP durch die Einteilung in verschiedene Abschnitte der Verfassung stattgefunden hat, machen Art. I-16 EVV und vor allem Art. I-41 Abs. 1 EVV deutlich, dass GASP und ESVP eine Einheit bilden. Während im EU-Vertrag nur in einem einzigen Artikel von der Gemeinsamen Verteidigungspolitik die Rede ist (Art. 17 EU)396, ist die Regelung im Verfassungs392 Nach Risse, Integration 2003, 564 (572 f.) soll der Außenminister der Union die Rolle des „Hüters der GASP“ übernehmen. 393 Zweifelnd dagegen, unter Hinweis auf die fortbestehenden Verfahrensunterschiede, Cremona, CMLRev 2003,1347 (1356 f.). 394 Görlitz, DÖV 2004, 374 (382 f.). 395 Der Ausdruck „Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ ist zwar derzeit nicht im Unionsvertrag festgeschrieben, wird aber seit der Tagung des Europäischen Rates im Juni 1999 in Köln geläufig verwendet. In europäischen Dokumenten wird oft die englische Bezeichnung European Security and Defence Policy (ESDP) gebraucht.
278
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
vertrag ausführlicher und detaillierter ausgestaltet geworden; es wurde zudem – wie gerade erwähnt – ein gesonderter Abschnitt „Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ (ESVP) geschaffen. Interessant ist der Wortlautvergleich der Neuregelungen mit Art. 17 EU. Heißt es dort noch, dass zur GASP auch die Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte, geht Art. I-16 EVV davon aus, dass die Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik zu einer gemeinsamen Verteidigung führen kann, in Art. I-41 Abs. 2 EVV heißt es sogar „diese [die Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik] führt zu einer gemeinsamen Verteidigungspolitik“.397 Letzteres steht allerdings unter dem Vorbehalt einer einstimmigen Entscheidung des Europäischen Rates, damit erscheint die Formulierung in Art. I-41 Abs. 2 EVV eher eine politische Absichtserklärung als eine rechtliche Verpflichtung.398 Mit der ESVP verfügt die Union über militärische Optionen, die das zivile Instrumentarium der Krisenverhütung und -bewältigung ergänzen.399 Darüber hinaus kommt multilateralen Abrüstungsbemühungen eine herausragende Rolle zu. Der Bereich, in dem die Union Maßnahmen ergreifen darf, ist geografisch nicht eingegrenzt. Die ESVP verleiht der Union operative Kapazität, bei den militärischen Mitteln, auf die die Union zur Durchführung dieser Politik zurückgreifen kann, handelt es sich indes um einzelstaatliche Mittel.400 Während Art. 17 Abs. 4 EU noch ausdrücklich festhält, dass die Gemeinsame Verteidigungspolitik nicht einer engeren Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten im Rahmen der Westeuropäischen Union entgegensteht, ist der Hinweis auf die WEU im Verfassungsvertrag völlig entfallen. Damit könnte auch das juristische Ende der WEU eingeläutet worden sein.401 Im Gegensatz dazu steht der wiederholte Hinweis auf die NATO (Art. I-41 Abs. 2 UAbs. 2 EVV, Art. I-41 Abs. 7 UAbs. 2 EVV), wonach die ESVP im Einklang mit den NATO-Verpflichtungen einiger Mitgliedstaaten bleibt. Allgemein muss beachtet werden, dass die Verteidigungspolitik ihrem Wesen nach zu den sensibelsten Bereichen der mitgliedstaatlichen Souveränität gehört.402 396 Vgl. zur bisherigen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik Stein, in: Hofmann / Zimmermann, Eine Verfassung für Europa, S. 179 (180 ff.). 397 In der englischen Sprachfassung heißt es zweimal „might“ und schließlich „will“, auch hier tritt der Unterschied also deutlich hervor. 398 Zumal selbst ein entsprechender Beschluss des Europäischen Rates bloß eine „Empfehlung“ an die Mitgliedstaaten wäre, welche den Beschluss gemäß ihrer verfassungsmäßigen Ordnung zunächst umsetzen müssten, vgl. Cremona, CMLRev 2003, 1347 (1359). 399 CONV 461 / 02, S. 4 (Rdnr. 6). 400 CONV 685 / 03, S. 18. 401 Andererseits wird im Protokoll zu Art. I-41 Abs. 2 der Verfassung bestimmt, dass die Union zusammen mit der WEU Regelungen über eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der WEU erarbeiten soll.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
279
Mit dieser Feststellung korrespondieren einige Sonderregelungen, die für die ESVP, nicht aber für die GASP gelten. Anzuführen sind hier die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit nach Art. I-41 Abs. 6 EVV in Verbindung mit Art. III-312 EVV sowie die unumstößliche Einstimmigkeitsregel, welche durch Art. III-300 Abs. 4 EVV abgesichert ist; der genannte Artikel regelt, dass die – ohnehin schon seltenen – Ausnahmen vom Einstimmigkeitsprinzip im Bereich der GASP für die ESVP nicht gelten.403 Das gleiche gilt für die Passerelle-Klausel in Art. III-300 Abs. 3 EVV.404
b) Aufgaben und Umfang der Maßnahmen Der ESVP liegt ein multilateraler Ansatz zugrunde; die Union setzt sich gemäß der Charta der Vereinten Nationen für den Frieden und die Stärkung der internationalen Sicherheit ein. Dabei erkennt sie an, dass es zuvörderst die Aufgabe des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ist, für die Einhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu sorgen.405 Wichtig war es der Arbeitsgruppe „Verteidigung“ festzuhalten, dass es für die internationale Glaubwürdigkeit der Union essentiell sei, über eine effektive und kohärente Sicherheits- und Verteidigungspolitik verfügen zu können. Um ihre Ziele und Werte verteidigen und im Sinne des Völkerrechts zu Frieden und Stabilität in der Welt beitragen zu können, müsse die Union mit den entsprechenden Instrumenten ausgestattet werden.406 Die ESVP soll der Union eine operative Kapazität verleihen.407 Das Hauptaugenmerk der Arbeitsgruppe „Verteidigung“ lag zum einen beim Krisenmanagement und der Begegnung terroristischer Bedrohungen, 402 Wichtige Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten ergeben sich aus dem verschiedenen Status der einzelnen Staaten (betreffend NATO-Mitgliedschaft, WEU-Mitgliedschaft, Neutralität), außerdem im Bereich der Rüstungsindustrie, der finanziellen Ausstattung der Streitkräfte, bei der Frage Wehrpflicht oder Berufsheer und bei der Frage betreffend das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von nuklearen Fähigkeiten. Schließlich besteht schon in erheblichem Umfang eine engere Zusammenarbeit zwischen einzelnen Mitgliedstaaten auf unterschiedlichen militärischen Bereichen. 403 Damit wurde die Rechtslage nach dem EU-Vertrag fortgeschrieben, vgl. Art. 23 Abs. 2 UAbs. 3 EU. 404 Hinsichtlich der Finanzierung der ESVP gibt der Verfassungsvertrag die geltende Rechtslage nach dem EU-Vertrag wieder. Wie bisher nach Art. 23 Abs. 2 EU sind die operativen Ausgaben für Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen grundsätzlich von den Mitgliedstaaten zu tragen („costs lie where they fall“), vgl. Art. III-313 Abs. 2 EVV. Zur Sofortfinanzierung von vorbereitenden Maßnahmen ziviler oder militärischer Operationen, vgl. oben, § 10 II. 2. l). 405 CONV 461 / 02, S. 9 (Rdnr. 27). 406 CONV 461 / 02, S. 15 f. (Rdnr. 50); neben der Glaubwürdigkeit sei die Effizienz der entscheidende Gesichtspunkt. 407 CONV 685 / 03, S. 18.
280
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
zum anderen bei den institutionellen Rahmenbestimmungen und den militärischen Fähigkeiten. Im Rahmen des Krisenmanagements stehen der Union sowohl zivile als auch militärische Mittel zur Verfügung. Die zivile Krisenbewältigung umfasst schwerpunktmäßig die Bereiche Polizei, Rechtsstaatlichkeit, Bevölkerungsschutz und Zivilverwaltung. Die in Art. 17 Abs. 2 EU enthaltenen „Petersberg-Aufgaben“ werden durch den Verfassungsvertrag aktualisiert und erweitert. Die bisherigen Aufgaben werden beibehalten und durch die Erwähnung anderer, den Einsatz militärischer Mittel erfordernder Aufgaben ergänzt. Zu diesen neuen Aufgaben zählen (gemäß Art. III-309 Abs. 1 EVV) die Konfliktverhütung, gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen, militärische Beratung sowie Unterstützung und Stabilisierungsmaßnahmen nach Konflikten. Mit allen Missionen kann die Union zur Bekämpfung des Terrorismus beitragen und Drittländer – auch auf deren Territorium – bei der Bekämpfung des Terrorismus unterstützen. Bei der Durchführung der ESVP steht dem Außenminister der Union ein Initiativrecht zu; die Kommission dagegen verfügt über ein solches nicht. Der Außenminister kann vorschlagen, auf die militärischen, zivilen und diplomatischen Fähigkeiten der Mitgliedstaaten zurückzugreifen, wobei er vorher die Mitgliedstaaten konsultieren muss.408 Gemeinsam mit der Kommission kann der Außenminister auch die Inanspruchnahme anderer Instrumente der Union (zum Beispiel technische Unterstützung, Entwicklungshilfe) vorschlagen. Art. I-41 Abs. 5 in Verbindung mit Art. III-310 EVV sieht die Möglichkeit einer engeren Zusammenarbeit zur Ausführung einer ganz bestimmten Mission vor, wenn sich nicht alle Mitgliedstaaten an der Durchführung der Operation beteiligen wollen.409 In diesen Fällen sind bestimmte Staaten zwar mit der Einleitung einer Operation einverstanden, wollen aber nicht an der Durchführung der Maßnahme mitwirken oder können es nicht, weil sie nicht über ausreichende Fähigkeiten verfügen. In einem solchen Fall kann der Rat einstimmig die Einleitung der betreffenden Operation, deren Ziel und Tragweite nach Art. I-41 Abs. 4 EVV beschließen. Dadurch wird die Maßnahme zu einer EU-Operation. Für die Durchführung der Aktion gilt dann Art. III-310 EVV. Art. I-41 Abs. 5 EVV bedeutet eine Flexibilisierung in der europäischen Verteidigungspolitik.410 Art. I-41 Abs. 3 S. 2 EVV ermöglicht schließlich die Integration der von einigen Mitgliedstaaten gebildeten multinationalen Truppenverbände in die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik.411 CONV 685 / 03, S. 20 (Rdnr. 4). CONV 685 / 03, S. 20 (Rdnr. 6). 410 Jopp / Regelsberger, Integration 2003, 550 (552). 411 Zu nennen sind hier vor allem das Eurocorps (Landstreitkräfte: Deutschland, Belgien, Spanien, Frankreich, Luxemburg), Eurofor (Landstreitkräfte: Spanien, Frankreich, Italien, 408 409
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
281
c) Beschlussfassungsverfahren Die Vorschriften hinsichtlich des Beschlussfassungsverfahrens im GASP-Bereich gelten als gemeinsame Bestimmungen auch für die ESVP. Insofern wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. Europäische Beschlüsse zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik ergehen immer einstimmig (Art. I-41 Abs. 4 EVV). Es ist nicht möglich, einzelne Bereiche in das Beschlussfassungsverfahren mit qualifizierter Mehrheit zu überführen (Art. IV-444 Abs. 1 UAbs. 2 EVV).
d) Errichtung einer Europäischen Verteidigungsagentur, Art. I-43 Abs. 3, Art. III-311 EVV Eine weitere Neuerung bringt Art. I-41 Abs. 3 EVV in Verbindung mit Art. III-311 EVV, der die Schaffung einer Europäischen Verteidigungsagentur vorsieht. Die Mitgliedstaaten haben allerdings nicht erst die Ratifikation des Verfassungsvertrages abgewartet, sondern sind gleich, auf der Grundlage von Art. 14 EU und dem Auftrag des Europäischen Rates von Thessaloniki (19.-20. 06. 2003) entsprechend, zur Tat geschritten und haben eine Europäische Verteidigungsagentur gegründet.412 In den Erwägungsgründen zur Einrichtung der Agentur (Ziffer 6) ebenso wie in Artikel 27 des Beschlusses wird auf den Verfassungsvertrag Bezug genommen. Rechtsgrundlage für die Errichtung der Agentur ist Art. 17 Abs. 1 UAbs. 3 EU: „Die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik wird in einer von den Mitgliedstaaten als angemessen erachteten Weise durch eine rüstungspolitische Zusammenarbeit zwischen ihnen unterstützt.“
Die Europäische Verteidigungsagentur ist eine besondere Form flexibler Integration.413 Ihr fällt vor allem die Aufgabe zu, den operativen Bedarf von Militäraktionen zu decken und eine abgestimmte Beschaffungspolitik der Mitgliedstaaten zu fördern sowie die verteidigungstechnische Forschung zu unterstützen. Außerdem soll die industrielle und technologische Basis des Verteidigungssektors gestärkt und damit ein wirkungsvollerer Einsatz der Verteidigungsausgaben erreicht werden.414 Portugal), Euromafor (Seestreitkräfte: Spanien, Frankreich, Italien, Portugal), die European Air Group (Deutschland, Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich), die Multinationale Division (Mitte) (Deutschland, Belgien, Niederlande, Vereinigtes Königreich) und der Stab des I. Deutsch-Niederländischen Korps (Deutschland, Niederlande, Vereinigtes Königreich). 412 Siehe hierzu die Gemeinsame Aktion des Rates 2004 / 551 / GASP vom 12. 07. 2004 über die Einrichtung der Europäischen Verteidigungsagentur, ABl. L 245, 17. 413 Kugelmann, EuropaR 2004, 322 (339). 414 Die bereits bestehenden Rüstungskooperationen OCCAR (Gemeinsame Organisation für die Rüstungskooperation; Kooperationspartner sind Deutschland, Frankreich, Italien, Ver-
282
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
e) Ständige Strukturierte Zusammenarbeit, Art. I-41 Abs. 6, Art. III-312 EVV Ein Novum des Verfassungsvertrags stellt die Möglichkeit einer Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit dar. Im EU-Vertrag war eine verstärkte Zusammenarbeit gemäß Art. 27 a ff. EU zwar generell für die GASP möglich, für Fragen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen war sie jedoch ausgeschlossen (Art. 27 b EU). Voraussetzung für eine Ständige Strukturierte Zusammenarbeit nach Art. I-41 Abs. 6 und III-312 Abs. 2 EVV ist, dass die Mitgliedstaaten anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf die militärischen Fähigkeiten erfüllen und im Hinblick auf Missionen mit höchsten Anforderungen untereinander weiter gehende Verpflichtungen eingegangen sind oder eingehen wollen. Die Anforderungen hinsichtlich der militärischen Fähigkeiten und die einzugehenden Verpflichtungen sind in einem an die Verfassung angefügten Protokoll415 festgelegt.416 Zur Begründung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit erlässt der Rat einen Beschluss nach Art. III-312 Abs. 2 EVV. Dieser Beschluss wird mit qualifizierter Mehrheit gefasst.417 Teilnehmer dieser Zusammenarbeit sind dann diejenigen Staaten, die dies ausdrücklich wünschen und die (per Europäischen Beschluss noch festzulegenden) Voraussetzungen erfüllen.418 Ein späteres „Aufspringen“ aneinigtes Königreich) und LOI (Letter of Intent; Kooperationspartner sind Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich, Schweden) sind in diese Agentur einzugliedern. Vgl. auch die Erwägungsgründe der Gemeinsamen Aktion, ABl. L 245, 17 (Ziffer 6). 415 Vgl. das „Protokoll über die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit gemäss Artikel I-41 Absatz 6 und Artikel III-312 der Verfassung“. 416 Hiernach müssen sich die Mitgliedstaaten verpflichten, ihre Verteidigungsfähigkeiten auszubauen, sich an den wichtigsten europäischen Ausrüstungsprogrammen zu beteiligen und die Tätigkeit der Europäischen Verteidigungsagentur hinsichtlich der Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Ausrüstung zu unterstützen (Art. 1 lit. a). Ferner müssen die Mitgliedstaaten bis spätestens 2007 über die Fähigkeit verfügen, entweder als nationales Kontingent oder als Teil von multinationalen Truppen bewaffnete Einheiten bereitzustellen, die auf die in Aussicht genommenen Missionen ausgerichtet sind. Innerhalb von 5 bis 30 Tagen müssen Missionen nach Art. III-309 EVV aufzunehmen sein, um insbesondere dem Ersuchen der Vereinten Nationen nachzukommen; solche Missionen müssen zunächst für die Dauer von 30 Tagen, die bis auf 120 Tagen ausgedehnt werden können, aufrechterhalten werden können (Art. 1 lit. b). Art. 2 des Protokolls sieht unter anderem eine möglichst weitgehende Angleichung des Verteidigungsinstrumentariums vor. Dies umfasst vor allem die Harmonisierung des militärischen Bedarfs, die gemeinsame Nutzung der Verteidigungsmittel und -fähigkeiten und gegebenenfalls eine Spezialisierung auf den Gebieten der Ausbildung und Logistik. 417 Um die Frage, ob die genannten Beschlüsse einstimmig oder mit qualifizierter Mehrheit zu fassen sein sollten, wurde im Konvent und auf den Regierungskonferenzen heftig gestritten. 418 Auf der abschließenden Regierungskonferenz wurden die Modalitäten der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit dahingehend geändert, dass die Liste der teilnehmenden
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
283
derer Mitgliedstaaten ist jederzeit möglich, sofern die genannten Voraussetzungen vorliegen. Auch eine Beendigung der Zusammenarbeit beziehungsweise die Aussetzung der Teilnahme einzelner Mitgliedstaaten an der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit ist geregelt (vgl. Art. III-312 Abs. 4, 5 EVV). Mit Ausnahme der Beschlüsse nach Art. III-312 Abs. 2 – 5 EVV müssen die Beschlüsse zur Durchführung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit einstimmig erfolgen. Wie von der Arbeitsgruppe Verteidigung empfohlen, wurde dem Außenminister der Europäischen Union eine bedeutende Rolle zugewiesen.419 Im Rahmen von Art. 17 EU kommt dem Hohen Vertreter noch keine ausdrückliche Aufgabe im Rahmen der Gemeinsamen Verteidigungspolitik zu. Im Verfassungsvertrag sind dagegen bestimmte Funktionen dem Außenminister explizit zugewiesen. Der Außenminister sorgt gemäß Art. III-309 Abs. 2 EVV unter Aufsicht des Rates und im engen und ständigen Benehmen mit dem Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee für die Koordinierung der zivilen und militärischen Aspekte der Missionen. Wird nach Art. III-310 EVV einer Gruppe von Mitgliedstaaten die Durchführung einer Mission übertragen, müssen die betreffenden Mitgliedstaaten in Absprache mit dem Außenminister der Union die Ausführung der Mission vereinbaren. Auch im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit kommt dem Außenminister eine koordinierende Funktion zu. Mitgliedstaaten, die an der Zusammenarbeit teilnehmen wollen, teilen diese Absicht dem Außenminister mit. Vor der Begründung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit muss der Außenminister gehört werden. Die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit ist ein Flexibilisierungsinstrument, das es ermöglicht, Operationen, an denen sich die Mitgliedstaaten gegenwärtig über eine „Koalition der Handlungswilligen“ beteiligen, zu institutionalisieren. 420 Der zusätzliche Nutzen besteht darin, dass die genannten Operationen in den Rahmen der Union einbezogen und von der politischen Unterstützung aller Mitgliedstaaten getragen werden. Es kann somit verhindert werden, dass einzelne kooperationswillige Mitgliedstaaten auf die völkerrechtliche Ebene ausweichen.421
Staaten nicht mehr durch eine Erklärung im Anhang zur Verfassung, sondern durch einen Beschluss des Rates festgelegt wird. 419 Da im Zeitpunkt der abschließenden Beratungen der Gruppe noch nicht fest stand, ob überhaupt das Amt eines Außenministers der Europäischen Union durch die Verfassung geschaffen werde, sprach die Gruppe von der Stärkung der Rolle des Hohen Repräsentanten, vgl. CONV 461 / 02, S. 24 (Rdnr. 71). 420 CONV 685 / 03, S. 20 (Rdnr. 6). 421 Kugelmann, EuropaR 2004, 322 (343).
284
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
f) Beistandsklausel nach Art. I-41 Abs. 7 EVV Im Rahmen des Art. I-41 EVV sind Regelungen für den Fall eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats getroffen worden. Aufgrund ihres fundamentalen und verfassungsrechtlichen Charakters musste die Beistandsklausel im Ersten Teil der Verfassung Aufnahme finden. Sie findet sich nun in den Bestimmungen über die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Union wieder. Die Regierungskonferenzen, die sich mit Art. I-41 Abs. 7 EVV im Anschluss an den Konventsentwurf befassten, änderten den Wortlaut des Abs. 7 noch maßgeblich.422 Nach dem Konventsentwurf war eine Beistandspflicht im Fall eines bewaffneten Angriffs für diejenigen Staaten vorgesehen, die sich an einer „engeren Zusammenarbeit“ im Bereich der gegenseitigen Verteidigung beteiligen wollten. Die Folge wäre eine Spaltung Europas gewesen, in Staaten, die sich eine gemeinsame Verteidigung wünschen, und solche, die dies nicht tun.423 Das Modell einer „engeren Zusammenarbeit“ wurde indes nicht in den Verfassungsvertrag übernommen.424 Die gegenseitige Verteidigung beruht damit nicht mehr auf einer besonderen Zusammenarbeit, sondern auf einer grundsätzlichen Forderung, wonach alle Mitgliedstaaten im Falle eines bewaffneten Angriffs auf einen Mitgliedstaat „alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung leisten“ müssen. Die Beistandspflicht erstreckt sich auf sämtliche Mitgliedstaaten. Mit dem von der Regierungskonferenz hinzugefügten Hinweis, dass die aus Art. I-41 Abs. 7 EVV resultierende Verpflichtung den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt lässt, wird vor allem den Vorbehalten der neutralen Mitgliedstaaten Rechnung getragen. Der gegenseitige Beistand nach Art. I-41 Abs. 7 EVV muss darüber hinaus, wie oben bereits erwähnt, mit den im Rahmen der NATO eingegangenen Verpflichtungen der NATO-Staaten vereinbar sein.425 422 Zum Vergleich Art. I-40 Abs. 7 KE-EVV, auch die Ausführungsvorschrift des Art. III-214 KE-EVV wurde grundlegend umgestaltet. Die Regierungskonferenz von Neapel im November 2003 strich Art. III-214 KE-EVV vollständig und formulierte den Art. I-40 Abs. 7 KE-EVV grundlegend um. Zur Rechtslage nach dem Konventsentwurf etwa Jopp / Regelsberger, Integration 2003, 550 (553 ff.). 423 Siehe hierzu ausführlich Einem, EuropaR 2004, 202 (212 ff.). Diese Lösung kam denjenigen Mitgliedstaaten entgegen, die keinen Verteidigungspakt in der Union wünschten, unter anderen Schweden und Irland. 424 Diese Streichung kommt vor allem auch der Übersichtlichkeit der einzelnen Zusammenarbeitsverfahren zugute. Nach dem Konventsentwurf gab es gleich drei Typen der Zusammenarbeit: Zum einen die strukturierte Zusammenarbeit nach Art. I-40 Abs. 6 KE-EVV (heute: Ständige Strukturierte Zusammenarbeit, Art. I-41 Abs. 6 EVV), zum anderen die „normale“ verstärkte Zusammenarbeit nach Art. I-43 in Verbindung mit Art. III-322 bis III-329 KE-EVV (heute: Art. I-44 EVV in Verbindung mit Art. III-416 bis III-423 EVV) und schließlich die gerade erwähnte engere Zusammenarbeit im Bereich der gegenseitigen Verteidigung, Art. I-40 Abs. 7 KE-EVV (heute: gestrichen). 425 Dieser Zusatz resultiert ebenfalls aus den Beratungen der Regierungskonferenz von Neapel vom November 2003; damit ist der Hinweis auf die NATO-Verpflichtungen gleich doppelt, nämlich in Art. I-41 Abs. 2 UAbs. 2 EVV und in Art. I-41 Abs. 7 EVV enthalten.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
285
Der Verweis in Art. I-41 Abs. 7 EVV auf Art. 51 der Charta der Vereinten Nationen426 scheint indessen missglückt, denn nach dieser Bestimmung ist die Verteidigung erlaubt und gerade keine Pflicht.427 Die Beistandspflicht nach dem Verfassungsvertrag umfasst alle in der Macht der Mitgliedstaaten stehende Hilfe und Unterstützung. Im Verfassungsvertrag sind die im Konventsentwurf428 noch enthaltenen Wörter „militärische und sonstige“ Hilfe gestrichen worden. Damit bleibt Art. I-41 Abs. 7 EVV sowohl hinter Art. 5 des Brüsseler Vertrags (WEU) als auch hinter Art. 5 des NATO-Vertrages zurück.429 Ausgehend vom Konventsentwurf schien es noch so, als sei das Ende der WEU eingeläutet worden. Die Dubliner Regierungskonferenz beschloss allerdings – wie oben angesprochen – noch einige Änderungen und fügte Art. I-41 Abs. 2 EVV das Protokoll Nr. 24 hinzu. Dessen einziger Artikel bestimmt: „Die Union erarbeitet zusammen mit der Westeuropäischen Union Regelungen für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Westeuropäischen Union.“ Damit wurde die WEU noch einmal „wiederbelebt“, weil sich niemand bereit fand, Art. 5 des Brüsseler Vertrags mit der darin enthaltenen gegenseitigen Verteidigungsgarantie aufzuheben.430 Der zusätzliche Verweis auf die NATO-Verpflichtungen macht deutlich, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach wie vor nicht bereit sind, sich kollektive Verteidigungsanstrengungen zu versprechen.431
g) Die Rolle des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees und des Europäischen Parlaments, Art. I-41 Abs. 8 EVV Mit Art. I-41 Abs. 8 EVV wird sichergestellt, dass das Europäische Parlament im Bereich der ESVP regelmäßig gehört und unterrichtet wird,432 weiter gehende Rechte enthält der Verfassungsvertrag dagegen nicht. Artikel 51 UN Charta: „Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält.“ 427 Stein, in: Hofmann / Zimmermann, Eine Verfassung für Europa, S. 179 (189). 428 Vgl. Art. I-40 Abs. 7 KE-EVV. 429 Stein, in: Hofmann / Zimmermann, Eine Verfassung für Europa, S. 179 (189). Der Wortlaut der Vorschrift („alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung“) lässt allerdings auch die militärische Hilfe zu. Aufgrund der oben genannten Streichung der militärischen Hilfe kann aber nicht von einer militärischen Beistandspflicht ausgegangen werden. 430 Stein, in: Hofmann / Zimmermann, Eine Verfassung für Europa, S. 179 (189). 431 Stein, in: Hofmann / Zimmermann, Eine Verfassung für Europa, S. 179 (189). Vgl. zum Verhältnis der Europäischen Union zur NATO von Buttlar, ZEuS 2003, 399 ff. 426
286
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Sondervorschriften bezüglich des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees oder über Sonderbeauftragte enthält der Abschnitt über die ESVP nicht. Da die ESVP integraler Bestandteil der GASP ist, gelten die Vorschriften im Bereich der GASP aber auch für die ESVP (insbesondere Art. III-307 EVV).
h) Exkurs: Einfügung einer Solidaritätsklausel, Art. I-43 in Verbindung mit Art. III-329 EVV Die Solidaritätsklausel nach Art. I-43 EVV gehört weder zum Bereich der GASP noch zu dem der ESVP, sie ist jedoch, aufgrund des ähnlichen eingesetzten Instrumentariums, mit den genannten Bereichen verwandt. Wegen ihrer systematischen Stellung im Verfassungsvertrag ist sie als eigenständige Vorschrift aufzufassen.433 Sie umfasst nur die gegenseitige Hilfe der Mitgliedstaaten untereinander, ist also nicht nach außen gerichtet. Art. I-43 EVV soll die Antwort auf neue Bedrohungen sein, mit denen sich die Europäische Union konfrontiert sieht. Aufgrund von Art. I-43 EVV wird es den Mitgliedstaaten ermöglicht, durch den Einsatz des gesamten notwendigen – militärischen und zivilen – Instrumentariums434 auf terroristische Bedrohungen reagieren zu können. Der Einsatz aller zivilen wie militärischen Mittel ist auch bei Naturkatastrophen oder von Menschen verursachten Katastrophen möglich. Damit können militärische Mittel und die ursprünglich für die Bewältigung der Petersberg-Aufgaben geschaffenen Strukturen sowie die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit und der Zivilschutz als Instrumente gegen terroristische Bedrohungen mobilisiert werden.435 Diese verschiedenen Mittel machen den interdisziplinären Charakter des Unionsansatzes deutlich. Zum anderen treten hier auch die Unterschiede zu einem Militärbündnis zu Tage. Die Einzelheiten der Anwendung der Solidaritätsklausel regelt Art. III-329 EVV. Obwohl die Solidaritätsklausel nur dann eingreift, wenn ein Mitgliedstaat von einer Katastrophe betroffen ist, also nur bei interner Betroffenheit der Union, wurde Art. III-329 EVV unter Titel V der Verfassung „Auswärtiges Handeln der Union“ gefasst. Abs. 1 der Vorschrift legt einen Automatismus zwischen der eingetretenen Katastrophe und der Unterstützung der anderen Mitgliedstaaten fest. Für das Eintreten der Solidaritätspflicht ist neben dem auslösenden Ereignis lediglich die Anforderung des betroffenen Mitgliedstaats erforderlich. Die Mitgliedstaaten 432 Nach dem EU-Vertrag muss das Europäische Parlament über die Entwicklungen in der GASP unterrichtet werden. In der Praxis informieren der Vorsitz und der Hohe Vertreter das Parlament bei dieser Gelegenheit über die im ESVP-Bereich erzielten Fortschritte und gefassten Beschlüsse sowie über die Leitlinien für die Zukunft. 433 Wegen ihres fundamentalen und verfassungsrechtlichen Charakters muss sie in Teil I der Verfassung stehen. 434 Die Gruppe „Verteidigung“ empfahl, dass „( . . . ) mit dem synergetischen Einsatz des gesamten Instrumentariums reagiert werden muss ( . . . )“, CONV 461 / 02, S. 20 (Rdnr. 56). 435 CONV 461 / 02, S. 20 (Rdnr. 57).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
287
beschließen im Rat nicht, ob sie überhaupt helfen, sondern sprechen sich ab, wie die Aktionen und Mittel zu koordinieren sind, um Abhilfe zu schaffen. Da Art. I-43 EVV die Anwendung aller der Union zur Verfügung stehender Mittel – einschließlich der militärischen Mittel – vorsieht, muss der Vorschlag, der die Einzelheiten für die Anwendung der Solidaritätsklausel regelt, von der Kommission und vom Außenminister gemeinsam ausgehen. Aus demselben Grunde ist es auch nicht möglich, einen einheitlichen Beschlussfassungsmodus für die Nutzung aller Mittel vorzuschreiben. Grundsätzlich kann mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden, in besonderen Fällen, etwa beim Einsatz der Streitkräfte, muss dagegen einstimmig beschlossen werden. Dies regelt jetzt Art. III-329 Abs. 2 EVV besser als es noch Art. III-321 KE-EVV tat. Art. III-329 Abs. 2 UAbs. 2 EVV sieht ausdrücklich vor, dass die Vorbereitungen der Arbeiten im Rat vom Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee sowie vom Ständigen Ausschuss für die Innere Sicherheit nach Art. III-261 EVV unterstützt werden. Damit die Stellungnahmen der beiden Gremien kohärent und aufeinander abgestimmt sind, müssen beide Gremien gemeinsame Stellungnahmen abgeben.436 Art. I-43 EVV ist keine kollektive Verteidigungsklausel, die zum militärischen Beistand verpflichtet, denn es werden ausschließlich Bedrohungen durch nichtstaatliche Einheiten erfasst. Ferner sind Aktionen der Union im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates nur dann möglich, wenn von diesem ein Ersuchen an die Union gerichtet wird. Damit ein präventives Abwehrsystem beziehungsweise ein Frühwarnsystem funktionieren kann, ist es erforderlich, dass der Europäische Rat die Bedrohungslage in regelmäßigen Abständen einschätzt.437 i) Bewertung Mit der Neuregelung sind die Bestimmungen der ESVP deutlich flexibilisiert worden. Aufgrund der neu geschaffenen Instrumente können (kleinere oder größere) Gruppen von Mitgliedstaaten anspruchsvollere und weiter gehende Verpflichtungen eingehen als bisher. Eine solche Zusammenarbeit wird sowohl auf langfristiger Basis als auch von Fall zu Fall möglich sein. Ein entscheidender Vorteil der Neuregelung ist, dass die Mitgliedstaaten künftig unter dem „Dach“ der Union gemeinsame Maßnahmen ergreifen können. Mit den neuen Bestimmungen werden unterschiedlichen Traditionen und Fähigkeiten der einzelnen Mitgliedstaaten pragmatisch Rechnung getragen.438 Begrüßenswert ist auch die Erweiterung und Präzisierung der Petersberg-Aufgaben im Sinne einer modernen und effizienten Konfliktvermeidungs- und Konfliktbewältigungspolitik. CONV 685 / 03, S. 73. Art. III-329 Abs. 3 EVV entspricht damit der von der Gruppe „Verteidigung“ abgegebenen Empfehlung (CONV 461 / 02, S. 20 (Rdnr. 58)). 438 Cremona, CMLRev 2003, 1347 (1361). 436 437
288
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
4. Gemeinsame Handelspolitik, Art. III-314 f. EVV Wie bereits im Zweiten Teil der Arbeit erwähnt, ist die gemeinsame Handelspolitik439 eines der relevantesten und praktisch wichtigsten Felder, auf denen die Europäische Union extern tätig ist.440
a) Art der Zuständigkeit Gemäß Art. I-13 Abs. 1 lit. e EVV fällt die gesamte gemeinsame Handelspolitik in den Bereich mit ausschließlicher Zuständigkeit für die Union. Damit ist vom Grundsatz her keine Änderung zur bisherigen Rechtslage eingetreten, denn der EuGH ordnete die gemeinsame Handelspolitik (in ihren Grenzen bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Nizza)441 ebenfalls der ausschließlichen Zuständigkeit zu. Die Ausschließlichkeit einer Zuständigkeit bedeutet, dass die Mitgliedstaaten in einem bestimmten Bereich nicht mehr tätig werden dürfen (Art. I-12 Abs. 1 EVV). Die Mitgliedstaaten sind daher von Verfassungs wegen daran gehindert, Abkommen im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik zu schließen. Ist es den (mindestens) 25 Mitgliedstaaten künftig nicht möglich, sich auf ein bestimmtes gemeinsames Vorgehen zu einigen, können folglich weder die Union noch die Mitgliedstaaten Abkommen schließen; der gesamte europäische Wirtschaftsraum kann dann keine internationalen Handelsabkommen eingehen. Folge der ausschließlichen Zuständigkeit der Union ist außerdem, dass die mitgliedstaatlichen Parlamente internationalen Handelsabkommen der Europäischen Union nicht zustimmen müssen. Der fehlenden nationalen parlamentarischen Kontrolle steht jedoch die Möglichkeit gegenüber, dass die Mitgliedstaaten die gemeinsame Handelspolitik der Union im Rahmen des Rates kontrollieren können. Entscheidend für die Reichweite der ausschließlichen Kompetenz ist jedoch der Umfang der Handelspolitik. Je weiter der Anwendungsbereich der gemeinsamen Handelspolitik reicht, desto weiter greift die ausschließliche Kompetenz der Union.
Englisch: Common Commercial Policy, oft abgekürzt als „CCP“. Krajewski, CMLRev 2005, 91 (92) meint, „the common commercial policy was and still is the most important constitutional battleground for European external relations . . .“. 441 CONV 47 / 02, S. 6. 439 440
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
289
b) Umfang der Gemeinsamen Handelspolitik aa) Erweiterung des Begriffs der Handelspolitik, keine Notwendigkeit mehr für gemischte Abkommen im Dienstleistungsbereich und bei den Handelsaspekten des geistigen Eigentums Im Vergleich zu Art. 133 Abs. 1 EG ist die Definition des Begriffs „Handelspolitik“ erweitert worden.442 Alle bisherigen Gegenstände der Handelspolitik wurden übernommen, eingefügt wurde jedoch, dass Handelsabkommen nicht nur den Handel mit Waren, sondern auch mit Dienstleistungen betreffen können, und dass auch Handelsaspekte des geistigen Eigentums erfasst sind. Durch diese Einbeziehung unterfallen zum Beispiel auch diejenigen Gegenstände der gemeinsamen Handelspolitik, die bisher, etwa im Rahmen der WTO-Verhandlungen (TRIPSund GATS-Abkommen), nicht von ihr erfasst waren.443 Damit wurde die Kompetenz der Union erheblich erweitert; die Union kann nach dem Verfassungsvertrag als einziger Akteur auf internationaler Ebene auftreten.444 Die Union ist demnach auf die bislang notwendigen gemischten Abkommen fortan nicht mehr angewiesen. Die Erweiterung des Sachbereichs der gemeinsamen Handelspolitik und die Streichung einiger Passagen des Art. 133 EG erweitert den status quo des Umfangs der Gemeinsamen Handelspolitik, der maßgeblich durch das WTO-Gutachten des EuGH geprägt ist. Mit Art. I-13 Abs. 1 lit. d EVV wird nämlich die gesamte gemeinsame Handelspolitik in die ausschließliche Zuständigkeit der Union überführt. Art. III-315 Abs. 1 EVV regelt, dass die gemeinsame Handelspolitik nach einheitlichen Grundsätzen zu gestalten ist und insbesondere die Änderung von Zollsätzen, den Abschluss von Zoll- und Handelsabkommen betreffend den Handel mit Waren und Dienstleistungen sowie die Handelsaspekte des geistigen Eigentums umfasst. Damit sind erstmals auch die Bereiche des GATS und des TRIPS in die ausschließliche Zuständigkeit der Union aufgenommen worden. Dies bedeutet, dass die Union nach der Ratifizierung der Verfassung in künftigen Welthandelsrunden in der Lage sein wird, als einzige Verhandlungsführerin auf Unionsseite alle außenwirtschaftlichen Themen zu vertreten. Rechtlich gesehen sind daher auf dem Gebiet des GATS und des TRIPS fortan keine gemischten Verträge mehr erforderlich. Erschwert wird die alleinige Vertretungsbefugnis jedoch dadurch, dass die Europäische Kommission445 immer im Hinterkopf behalten muss, dass das Ergebnis der Verhandlungen in den genannten Bereichen noch die Hürde einer einstim442 Grundlegend und instruktiv zur Rechtslage im Bereich der Gemeinsamen Handelspolitik nach der Verfassung Krajewski, CMLRev 2005, 91 ff. 443 Kietz / Uplegger, Integration 2005, 87 (88). 444 Hinsichtlich der Beschlussfassungsmodalitäten (Einstimmigkeit oder qualifizierte Mehrheit) gelten jedoch besondere Regeln, vgl. dazu unten, § 10 VII. 7. 445 Als Verhandlungsführerin auf Unionsseite.
19 Metz
290
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
migen Entscheidung im Rat nehmen muss, soweit das Abkommen Bestimmungen enthält, bei denen für die Annahme interner Vorschriften Einstimmigkeit erforderlich ist (Art. III-315 Abs. 4 UAbs. 2 EVV). Daher behalten die Mitgliedstaaten weiterhin faktisch eine starke Einflussmöglichkeit. Bisher fallen Übereinkünfte betreffend den Handel mit Dienstleistungen des sozialen, des Bildungs- und des Gesundheitssektors nach Art. 133 Abs. 6 UAbs. 2 EG ausdrücklich in die gemischte Zuständigkeit der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten.446 Gemischte Abkommen in diesen Bereichen sind künftig nicht nötig, denn solche Abkommen können nun unter Dienstleistungsabkommen subsumiert werden, mit der Folge, dass eine ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft vorliegt.447 bb) Aufnahme der ausländischen Direktinvestitionen Neu aufgenommen in die Bestimmungen zur Gemeinsamen Handelspolitik wurden auch die Abkommen über ausländische Direktinvestitionen.448 Diese sind bisher nicht im EG-Vertrag erwähnt. Mit der Aufnahme soll anerkannt werden, dass die Finanzströme den Güterverkehr ergänzen und heute einen großen Teil des weltweiten Handels ausmachen.449 Die genannte Ausdehnung wurde bereits auf den Regierungskonferenzen in Amsterdam und Nizza diskutiert, dort konnte man jedoch keine Einigung erzielen.450 Die Erweiterung der Gemeinsamen Handelspolitik um ausländische Direktinvestitionen hat das Potenzial, ein völlig neues Kompetenzgebiet für die Union zu eröffnen.451 cc) Sonderregelungen für den Sektor Verkehr Auch wenn der Sektor Verkehr Bezüge zur gemeinsamen Handelspolitik aufweist, soll weiterhin für den Abschluss von internationalen Abkommen im Ver446 Die in Art. 133 Abs. 7 EG vorgesehene Möglichkeit, die Vorschriften betreffend internationale Warenabkommen auf Dienstleistungsabkommen beziehungsweise Abkommen über Rechte des geistigen Eigentums auszudehnen, wurde im Verfassungsvertrag nicht übernommen, da der Verfassungsgeber selbst – wie gerade gezeigt – die genannten Materien dem Begriff der Gemeinsamen Handelspolitik unterstellt hat (Art. III-315 Abs. 1 EVV). 447 Diese scheinbar weitgehende Unionskompetenz wird freilich wie erwähnt durch Art. III-315 Abs. 4 lit. a EVV relativiert, wonach für den Abschluss einer solchen Übereinkunft ein einstimmiger Ratsbeschluss nötig ist. 448 Diese Erweiterung korrespondiert mit der Erweiterung des Art. III-314 EVV, welcher ebenfalls um das Ziel einer schrittweisen Beseitigung der Beschränkungen bei ausländischen Direktinvestitionen ergänzt wird. 449 CONV 685 / 03, S. 52, 54. Außerdem wird im Rahmen der WTO und der OECD versucht, multilaterale Abkommen über Direktinvestitionen auszuhandeln. 450 Krajewski, CMLRev 2005, 91 (111). 451 Krajewski, CMLRev 2005, 91 (112 ff.).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
291
kehrsbereich der Verweis auf den Abschnitt Verkehr gelten (Art. III-315 Abs. 5 EVV).452 Damit wird an der bisherigen Rechtsprechung und Vertragspraxis festgehalten. Die besondere Erwähnung des Sektors Verkehr hat wiederum historische Wurzeln. Im AETR-Urteil hat der Gerichtshof festgestellt, dass sich die Zuständigkeit der Gemeinschaft zum Abschluss internationaler Abkommen „nicht nur aus einer ausdrücklichen Erteilung durch den Vertrag wie der in den Artikeln 113 und 114 für die Zoll- und Handelsabkommen und in Artikel 238 für Assoziierungsabkommen ausgesprochen [ergibt], sondern [ . . . ] auch aus anderen Vertragsbestimmungen [ . . . ] fließen [kann].“453
Diesen Gedanken griff der EuGH im WTO-Gutachten unter Bezugnahmen auf das AETR-Urteil erneut auf und führte aus: „Dieser Rechtsprechung liegt der Gedanke zugrunde, dass die internationalen Verkehrsabkommen nicht unter Artikel 113 fallen.“454
Mit Art. III-315 Abs. 5 EVV wird demgemäß an der bisherigen Rechtsprechung und Vertragspraxis nichts geändert.
dd) Begrenzung der internen Implementierungskompetenz, Art. III-315 Abs. 2 und 6 EVV Art. III-315 Abs. 2 EVV räumt der Europäischen Union die Kompetenz ein, die für die Durchführung der abgeschlossenen internationalen Handelsübereinkünfte notwendigen internen Maßnahmen zu erlassen. Der externen Kompetenz nach Art. III-315 Abs. 1 EVV wird demnach eine interne Implementierungskompetenz zur Seite gestellt. Die interne Kompetenz nach Art. III-315 Abs. 2 EVV gilt jedoch nicht schrankenlos, sie wird durch Art. III-315 Abs. 6 EVV begrenzt.455 Dadurch wird verhindert, dass durch den Abschluss völkerrechtlicher Übereinkünfte die betreffenden Bereiche unionsintern einer Harmonisierung zugeführt werden, obwohl dies von der Verfassung ausgeschlossen ist. Art. III-315 Abs. 6 EVV begrenzt lediglich die Innen-, nicht dagegen die Außenkompetenzen der Union im Bereich der Gemeinsamen Handelspolitik. Würde man die Beschränkung auch auf die Außenkompetenzen beziehen, bedeutete dies, dass die mit Art. III-315 Abs. 1 EVV vollzogene Erweiterung des Begriffs der Handelspolitik wieder rückgängig gemacht werden würde. So würde etwa die Einbeziehung aller Aspekte des Dienstleistungsverkehrs in den Bereich der Handelspolitik mit Abs. 6 wieder aufgehoben, da der Union nicht in allen Bereichen eine interne Kompetenz zusteht.456 Die genannte Auslegung führt zwar zu einer Inkongruenz 452 453 454 455
19*
Einen entsprechenden Verweis enthält Art. 133 Abs. 6 UAbs. 3 EG. EuGH, Slg. 1971, 263, Rdnr. 16. EuGH, Slg. 1994, I-5267, 5402, Rdnr. 48 – WTO. Krajewski, CMLRev 2005, 91 (110).
292
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
zwischen Innen- und Außenkompetenzen, widerspricht aber nicht dem AETRPrinzip. Dieses Prinzip findet nämlich nur dann Anwendung, wenn bereits interne Kompetenzen bestehen, es schließt mit anderen Worten nicht die Möglichkeit aus, dass eine externe Kompetenz ohne ein internes „Gegenstück“ bestehen kann.457 Bejaht man eine solche „überschießende“ Außenkompetenz, muss der Union die Pflicht auferlegt werden, vor Abschluss eines solchen völkerrechtlichen Übereinkommens die Mitgliedstaaten in Kenntnis zu setzen. Eine Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit lässt sich aus Art. I-5 EVV ableiten. Nach dessen Abs. 1 muss die Europäische Union die Identität der Mitgliedstaaten sowie deren grundlegende politische und verfassungsrechtliche Struktur achten. Noch relevanter für die vorliegende Konsultationspflicht ist Art. I-5 Abs. 2 EVV, wonach sich die Union und die Mitgliedstaaten nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit gegenseitig achten und unterstützen. Allerdings ist zu beachten, dass die Union völkerrechtlich für die von ihr abgeschlossenen Übereinkommen verantwortlich ist. Daraus resultiert ein hoher politischer Druck auf die Mitgliedstaaten, die von der Union geschlossenen Abkommen zu implementieren. 458
ee) Sonstiges Hinzuweisen ist schließlich darauf, dass die Art. 132 und 134 EG nicht in den Verfassungsvertrag übernommen worden sind. Art. 132 EG wurde nicht herangezogen, zumal er ohnehin durch Art. 133 Abs. 1 EG und damit auch durch Art. III-315 Abs. 1 EVV abgedeckt ist. Auf Art. 134 EG ist seit 1993 nicht mehr zurückgegriffen worden, weil er sich nicht mit dem Binnenmarkt (in dem es keine Binnengrenzen mehr gibt) vereinbaren lässt.459 Insofern war eine Übernahme in den Verfassungsvertrag überflüssig.
c) Ziele und Kohärenzklausel Bislang werden die Ziele der Gemeinsamen Handelspolitik in Art. 131 EG bestimmt. Hiernach sollen die Mitgliedstaaten zur harmonischen Entwicklung des Welthandels, zur schrittweisen Beseitigung der Beschränkungen im internationalen 456 Krajewski, CMLRev 2005, 91 (116) meint, dies würde zu einer nicht überzeugenden „one step forward, one step backward“ – Auslegung führen. 457 Der Vergleich mit anderen föderalen Systemen zeigt, dass ein Auseinanderfallen von externen und internen Kompetenzen nicht atypisch ist, vgl. Krajewski, CMLRev 2005, 91 (117, 119). 458 Krajewski, CMLRev 2005, 91 (118) befürchtet daher, dass von den mitgliedstaatlichen Kompetenzen nicht viel mehr als eine administrative Kompetenz verbleibt. 459 CONV 685 / 03, S. 55.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
293
Handelsverkehr und zum Abbau der Zollschranken beitragen. Mit Art. 133 Abs. 3 S. 2 EG fügte der Vertrag von Nizza eine Kohärenzklausel ein, wonach die Handelspolitik nicht im Widerspruch zu den internen Politiken und Vorschriften der Gemeinschaft stehen darf. Art. III-314 EVV gibt leicht modifiziert den Wortlaut des Art. 131 EG wieder, lediglich die schrittweise Beseitigung der Beschränkungen bei den ausländischen Direktinvestitionen wird neu hinzugefügt.460 Obwohl die Ziele und Werte aus Art. III-292 EVV für das gesamte außenpolitische Handeln der Union gelten, ebenso wie sich die allgemeine Kohärenzklausel in Art. III-292 Abs. 3 UAbs. 2 EVV auch auf die gemeinsame Handelspolitik erstreckt, ist mit Art. III-315 Abs. 1 S. 2 EVV nochmals ein Verweis auf die allgemeinen Ziele und Grundsätze des auswärtigen Handelns der Union eingefügt worden. Darin liegt zum einen die Betonung einer kohärenten und widerspruchsfreien Außenpolitik, zum anderen wird damit auch der Horizont der Handelspolitik auf Bereiche jenseits der handelsspezifischen Ziele erweitert.461 Art. III-315 Abs. 1 S. 2 EVV in Verbindung mit Art. III-292 EVV verpflichtet die Union nicht mehr nur zu den Zielen der Liberalisierung des Welthandels, sondern (gleichzeitig) auch unter anderem dazu, den Umweltschutz zu fördern und zu einer nachhaltigen Entwicklung in den Entwicklungsländern beizutragen. Im Hinblick darauf, dass viele Handelsabkommen zugleich auch Umweltschutzaspekte oder entwicklungspolitische Bereiche tangieren, muss die Handelspolitik künftig noch sorgfältiger mit anderen Politikbereichen der Union abgestimmt werden. Der Verweis auf die umfassenden außenpolitischen Ziele und Werte der Union in Verbindung mit Art. III-292 Abs. 3 EVV ist damit ein nochmaliger Beweis für das vom Verfassungsvertrag vorrangig verfolgte Ziel: der Stärkung der Kohärenz zwischen den außenpolitischen Politikbereichen untereinander wie auch derjenigen zwischen den internen und externen Aspekten der Politiken der Union.
d) Beschlussfassungsverfahren Für den Abschluss von völkerrechtlichen Übereinkommen im Bereich der Handelspolitik beschließt der Rat gemäß Art. III-315 Abs. 4 EVV grundsätzlich mit qualifizierter Mehrheit.462 Von diesem Grundsatz gibt es jedoch wichtige Ausnahmen. Obwohl ein großer Teil der Arbeitsgruppe Außenpolitik sich dafür aussprach, die Anwendung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit auf alle Bereiche der Handelspolitik einschließlich der Dienstleistungen und der Handelsaspekte des geistigen Eigentums auszudehnen463, konnte hierüber auf der abDies entspricht der Ausdehnung des Begriffs der Handelspolitik in Art. III-315 EVV. Krajewski, CMLRev 2005, 91 (107). 462 Näher zu den Verfahrensbesonderheiten im Bereich der internationalen Handelsübereinkünfte unten, § 10 VII. 7. Interne Maßnahmen im Bereich der Handelspolitik können seit dem Inkrafttreten des Römischen Vertrags mit qualifizierter Mehrheit angenommen werden, CONV 685 / 03, S. 54. 460 461
294
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
schließenden Regierungskonferenz keine Einigung erzielt werden. Ausnahmen zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit sind in Art. III-315 Abs. 4 lit. a und b EVV zu finden.464 Außenhandelsvereinbarungen über kulturelle und audiovisuelle Dienstleistungen setzen weiterhin Einstimmigkeit voraus. Diese exception culturelle wurde in letzter Minute von französischer Seite im Konvent durchgesetzt.465 Eine einstimmige Beschlussfassung des Rates ist ferner dann erforderlich, wenn ein Abkommen über den Dienstleistungsverkehr, über Handelsaspekte des geistigen Eigentums oder über ausländische Direktinvestitionen geschlossen werden soll, wenn das betreffende Abkommen Bestimmungen enthält, bei denen für die Annahme interner Bestimmungen Einstimmigkeit erforderlich ist.466 Damit bleibt den Mitgliedstaaten faktisch eine starke Einflussmöglichkeit erhalten.467 Hervorzuheben ist allerdings, dass es die allgemeine Passerelle-Klausel nach Art. IV-444 EVV („Vereinfachtes Änderungsverfahren“) ermöglicht, auch diejenigen Bereiche der qualifizierten Mehrheitsentscheidung zuzuführen, die nach dem jetzigen Verfassungstext noch der Einstimmigkeit bedürfen. Damit ist ein wichtiger Baustein für eine weitere Flexibilisierung der europäischen Handelspolitik gelegt worden. Wäre eine solche Option nicht in den Verfassungsvertrag aufgenommen worden, hätte dies zur Folge gehabt, dass das Einstimmigkeitserfordernis in den oben genannten Bereichen in jedem Fall bis zur nächsten Vertragsänderung festgeschrieben gewesen wäre. Dies wäre hinsichtlich des gerade vollendeten Beitritts von 10 weiteren Mitgliedstaaten äußerst bedenklich gewesen und hätte zu einer dauerhaften Unflexibilität, wenn nicht gar Lähmung der Union in den betreffenden Bereichen der Gemeinsamen Handelspolitik geführt. Betont werden muss, dass der Verfassungsvertrag die Rolle des Europäischen Parlaments deutlich stärkt. Für Maßnahmen, mit denen der Rahmen für die Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik bestimmt wird, gilt gemäß Art. III-315 Abs. 2 EVV das ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Für alle autonomen Rechtsakte (also alle internen Maßnahmen, die keinen Vertragsabschluss erfordern) im Bereich der Handelspolitik steht dem Europäischen Parlament damit ein Mitentscheidungsrecht zu. 463
CONV 459 / 02, S. 7; siehe auch die Plenartagung vom 15. 05. 2003, CONV 748 / 03,
S. 15. 464 Damit bleibt die Kritik des Kommissionsmitgliedes Lamy ungehört, die jetzige „sonderbare Situation“, nach der nicht für alle Bereiche die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit gilt, sei ein Hindernis für die Effizienz der Union in multi- und bilateralen Handelsverhandlungen, CONV 459 / 02, S. 26 (Rdnr. 52). 465 Schwarze, EuropaR 2003, 535 (565). 466 Die Einschränkungen bezüglich der Harmonisierungen in internen Politikfeldern bestehen auch nach dem EG-Vertrag. Hieran sollte nach den Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Außenbeziehungen“ durch den Verfassungsvertrag nichts geändert werden, CONV 459 / 92, S. 26 (Rdnr. 52). 467 Görlitz, DÖV 2004, 374 (379).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
295
Da gemäß Art. III-315 Abs. 2 EVV das ordentliche Gesetzgebungsverfahren für den gesamten Bereich der Handelspolitik gilt, erstreckt sich das Zustimmungsrecht des Europäischen Parlaments nicht nur auf die gerade erwähnten autonomen Maßnahmen zur Umsetzung der Handelspolitik, sondern auch auf internationale Übereinkünfte im Bereich der Handelspolitik.468 Damit wird eine erstaunliche Wende vollzogen, denn nach Art. 133 EG ist derzeit nicht einmal eine Anhörung des Europäischen Parlaments erforderlich, der Verfassungsvertrag räumt dem Parlament – wie gesehen – nicht nur ein Anhörungs-, sondern sogar ein Zustimmungsrecht ein. Infolgedessen müssen dem Parlament sämtliche Handelsabkommen zur Genehmigung vorgelegt werden. Die demokratische Legitimität der Gemeinsamen Handelspolitik wird damit erheblich gesteigert. Nach der allgemeinen Regel des Art. III-325 Abs. 10 EVV ist das Europäische Parlament zudem laufend über den Stand der Verhandlungen über Handelsabkommen zu unterrichten.469 e) Bewertung Der Verfassungsvertrag bringt für den Bereich der Gemeinsamen Handelspolitik eine Reihe wichtiger Änderungen mit sich. Der Begriff der Handelspolitik wird erweitert, sodass nun der gesamte Handel mit Waren und Dienstleistungen sowie die Handelsaspekte des geistigen Eigentums umfasst sind. Alle Bereiche des derzeitigen multilateralen Handelssystems werden somit von den Außenkompetenzen der Union erfasst. Darüber hinaus sind die ausländischen Direktinvestitionen in den Begriff der Handelspolitik einbezogen worden. Der gesamte Bereich der Handelspolitik wird ausdrücklich der ausschließlichen Zuständigkeit der Union unterstellt. Zusammen mit den zuvor genannten Änderungen bedeutet dies, dass die Union künftig nicht mehr auf den Abschluss (problematischer) gemischter Abkommen angewiesen ist. Damit einher geht ein Kompetenzverlust der mitgliedstaatlichen Parlamente, da deren Mitwirkung nicht mehr erforderlich sein wird. Dieser Verlust an demokratischer Legitimität wird teilweise durch das neu eingeräumte Zustimmungsrecht des Europäischen Parlaments ausgeglichen. Im Kontrast zur erheblichen Ausweitung der Außenkompetenzen sind die Innenkompetenzen der Union zur Implementierung der Handelsabkommen beschränkt. Dies macht eine Abstimmung zwischen der (im Außenverhältnis zuständigen) Union und den (für die interne Umsetzung zuständigen) Mitgliedstaaten erforderlich. Die Beibehaltung des Einstimmigkeitserfordernisses in einigen Bereichen bedeutet schließlich, dass die Kommission nach außen zwar als alleiniger Verhandlungspartner auftreten kann, sich nach innen jedoch jeweils absichern muss, um die Zustimmung der Mitgliedstaaten nicht zu gefährden. 468 Krajewski, CMLRev 2005, 91 (124 f.); fraglich ist jedoch, ob das Zustimmungsrecht auch für diejenigen Fälle gilt, in denen interne Umsetzungsmaßnahmen nicht erforderlich sind. 469 Zusätzlich wird das Europäische Parlament gemäß Art. III-315 Abs. 3 UAbs. 3 S. 2 EVV von der Kommission regelmäßig über den Stand der Verhandlungen unterrichtet.
296
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
5. Assoziierungsabkommen, Art. III-324 EVV Art. III-324 EVV entspricht bis auf einige grammatikalische Änderungen der bisherigen Textfassung des Art. 310 EG. Daher ergeben sich keine Neuerungen gegenüber der bisherigen Situation. Erstmals wird der Begriff „Assoziierungsabkommen“ explizit im Primärrecht genannt. Für das Abschlussverfahren gilt die allgemeine Vorschrift des Art. III-325 EVV, der in Abs. 6 UAbs. 2 lit. a i) und in Abs. 8 UAbs. 2 vorsieht, dass der Rat Assoziierungsabkommen einstimmig beschließen und das Europäische Parlament zustimmen muss.
6. Konstitutionelle Assoziierungsabkommen, Art. III-286 – III-291 EVV Die Vorschriften über die Assoziierung der überseeischen Länder und Hoheitsgebiete wurden – systematisch korrekt – nicht in Titel V „Auswärtiges Handeln der Union“ integriert, sondern erhielten einen eigenständigen Titel IV im Verfassungsvertrag. Aus völkerrechtlicher Sicht gehören die betreffenden Gebiete zu dem Staatsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaats, weshalb Beziehungen zu diesen Gebieten streng genommen keine Außenbeziehungen darstellen.470 Die Vorschriften im Verfassungsvertrag übernehmen weitgehend wörtlich – bis auf sprachliche Glättungen und aufgrund der neuen Struktur erforderlich gewordene Anpassungen – die bisherigen Bestimmungen der Art. 182 ff. EG. Besonders anzumerken ist lediglich, dass Art. III-291 EVV nun für die Ausgestaltung des Assoziationsregimes die durch die Verfassung neu geschaffenen Handlungsinstrumente Europäische Gesetze, Rahmengesetze und Verordnungen vorsieht. Damit werden die bislang gefassten „Beschlüsse“, die sich nicht unter die bekannten Rechtsformen aus Art. 249 EG subsumieren ließen, obsolet.471 Stattdessen kann die Assoziierung mit den in Art. I-33 ff. EVV vorgesehen Rechtsakten ausgestaltet werden. Für zu erlassende Gesetze und Rahmengesetze wird das Anhörungsrecht des Europäischen Parlaments betont. Damit verbleibt es bei dem Umfang der Kompetenz, welcher der Union schon nach dem EG-Vertrag zusteht.
7. Zusammenarbeit mit Drittländern und humanitäre Hilfe, Art. III-316 – III-321 EVV Die Entwicklungszusammenarbeit nach Titel XX des EG-Vertrages (Art. 177 ff. EG) und die wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Dritt470 471
Vgl. bereits die Ausführungen im Zweiten Teil. Hierzu Zimmermann, RIW 2004, 324 (327).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
297
ländern nach Titel XXI EG-Vertrag (Art. 181a EG) sind im Verfassungsentwurf in Kapitel IV unter der Überschrift „Zusammenarbeit mit Drittländern und humanitäre Hilfe“ zusammengefasst worden. Hinter diese beiden Abschnitte wurde ein dritter Abschnitt „Humanitäre Hilfe“ eingefügt. In allen drei Abschnitten wird jeweils auf die „Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union“ verwiesen, welche den Rahmen für den jeweiligen Politikbereich bilden sollen (Art. III-316 Abs. 1, Art. III-319 Abs. 1, Art. III-321 Abs. 1 EVV). Dies bedeutet einen Verweis auf die Vorschrift des Art. III-292 EVV, welche – als allgemein anwendbare Bestimmung – ohnehin schon für das gesamte auswärtige Handeln der Union gilt.472 Die Betonung der einheitlichen Grundsätze für den gesamten Bereich des auswärtigen Handelns der Union verdeutlicht, wie wichtig es dem Konvent war, mit dem Verfassungsvertrag eine in sich kohärente Außenpolitik zu schaffen.473 Aufgrund von Art. I-53 EVV wird der Europäische Entwicklungsfonds (EEF) in den Gesamthaushaltsplan der Union einbezogen. Damit unterliegt dieser Fonds zukünftig den gleichen Verfahren wie andere Bereiche der Finanzhilfe.474
a) Entwicklungszusammenarbeit, Art. III-316 – III-318 EVV aa) Art der Zuständigkeit Der Bereich Entwicklungszusammenarbeit ist in Art. I-14 EVV genannt, welcher die geteilte Zuständigkeit regelt. Dies bedeutet zunächst, dass sowohl die Union als auch die Mitgliedstaaten die Befugnis haben, in diesem Bereich tätig zu werden. Allerdings fällt die Entwicklungszusammenarbeit nicht unter den „klassischen“ Bereich der geteilten Zuständigkeit (Abs. 2), vielmehr wurde in Art. I-14 Abs. 4 EVV eine Sonderregelung475 getroffen. Die Ausübung der Zuständigkeit im 472 Der noch im Konventsentwurf in Kapitel IV durchgehend enthaltene Hinweis (Art. III-219 Abs. 2 S. 2, III-219 Abs. 3 S. 2, III-223 Abs. 4 S. 2 KE-EVV), dass das Vertragsschließungsverfahren nach der allgemeinen Vorschrift des Art. III-227 KE-EVV abzulaufen hat, wurde von der Regierungskonferenz gestrichen. Diese Streichungen sind rechtlich gesehen nicht von Bedeutung, sie befreien den Verfassungsvertrag vielmehr von unnötigem „Ballast“, da es nicht nötig ist, auf die allgemein geltende Bestimmung des Art. III-325 EVV zu verweisen. 473 Vgl. auch die ähnliche Klausel für den Bereich der gemeinsamen Handelspolitik, Art. III-315 Abs. 1 S. 1 EVV. 474 Die Arbeitsgruppe „Außenbeziehungen“ forderte, dass diese Einbeziehung mit einer größeren Wirksamkeit und besseren Ausrichtung der EG-Entwicklungsprogramme auf die Armutsbekämpfung einhergehen müsse, vgl. hierzu CONV 459 / 02, S. 8 (Rdnr. 9 und 56). Vgl. auch den Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Vereinfachung“, CONV 424 / 02, S. 19 (Fn. 2). 475 Oppermann, DVBl. 2003, 1165 (1172) spricht von einer „unglücklichen Zwittereinordnung“.
298
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit durch die Union hat nicht zur Folge, dass die Mitgliedstaaten ihre Zuständigkeit einbüßen, wie dies gemäß Art. I-12 Abs. 2 S. 2 EVV der Regelfall bei geteilten Zuständigkeiten ist. Die Entwicklungszusammenarbeit ist damit ein Sonderfall der geteilten Zuständigkeit.476 Die Sonderregelung ließe sich so verstehen, dass der EU bindende Rechtsetzung in dem genannten Bereich untersagt ist. In diesem Fall handelte es sich aber nicht um geteilte, sondern um Unterstützungskompetenzen, und die Einordnung in Art. I-14 EVV wäre widersprüchlich.477 Die andere mögliche Interpretation, wonach die Union zur Rechtsetzung befugt ist, dieses Recht aber für die Mitgliedstaaten keine Bindungswirkung entfaltet, ist mit den Grundsatz des effektiven Gemeinschaftsrechts nicht zu vereinbaren. Vielmehr ist Art. I-14 Abs. 4 EVV dahingehend zu verstehen, dass die Mitgliedstaaten auch dann Programme zur Entwicklungszusammenarbeit verfolgen können, wenn die Union solche Programme bereits ins Leben gerufen hat. Man kann hier also von einer „parallelen“ Zuständigkeit sprechen, da die Union und die Mitgliedstaaten ihre Zuständigkeiten im Grundsatz unabhängig voneinander ausüben können und die Ausübung der Zuständigkeit grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Kompetenzverteilung zwischen der Union und den Mitgliedstaaten hat.478 Natürlich muss auch hier beachtet werden, dass die Mitgliedstaaten nach Art. I-5 Abs. 2 EVV zur loyalen Zusammenarbeit mit der Union verpflichtet sind und alle Maßnahmen zu unterlassen haben, welche die Verwirklichung der in der Verfassung genannten Ziele gefährden können. Dies bedeutet, dass die Mitgliedstaaten zwar grundsätzlich eine eigene Entwicklungspolitik betreiben können, diese darf aber nicht im fundamentalen Gegensatz zu der von der Union verfolgten Entwicklungspolitik stehen. Insoweit haben sich im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit keine Veränderungen im Vergleich zur Rechtslage nach dem EG-Vertrag ergeben. Hier wie dort besteht eine „parallele“ Kompetenz (Art. 181 EG beziehungsweise Art. I-14 Abs. 4 EVV), welche lediglich durch allgemeine Bestimmungen (Art. 10 EG beziehungsweise Art. I-5 Abs. 2 EVV) begrenzt ist.
bb) Umfang der Zuständigkeit Die Durchführung der Entwicklungspolitik soll künftig durch Europäische Gesetze und Rahmengesetze geregelt werden. Diese können Mehrjahresprogramme für die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern oder thematische Programme betreffen (Art. III-317 Abs. 1 EVV). 476 Ähnliches gilt gemäß Art. I-13 Abs. 3 EVV für den Bereich Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt sowie gemäß Art. I-13 Abs. 4 EVV für den Bereich der humanitären Hilfe. 477 Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (530). 478 Zimmermann, RIW 2004, 324 (325).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
299
Hinsichtlich internationaler Abkommen enthält Art. III-317 Abs. 2 EVV, wie schon Art. 181 EG, eine Spezialermächtigung. Die Union ist nach dem Verfassungsvertrag ermächtigt, alle Abkommen zu schließen, die „zur Verwirklichung der Ziele gemäß Art. III-292 EVV und Art. III-316 EVV beitragen“.479 Der Wortlaut klingt weiter als der des Art. 181 EG, wonach „die Einzelheiten der Zusammenarbeit der Gemeinschaft“ Gegenstand von Abkommen sein können. Praktisch ergeben sich jedoch keine Unterschiede, da in dem Wort „Einzelheiten“ bislang keine Einschränkung der Vertragskompetenz erblickt wurde.480 Dies ist auch richtig, denn die Vorschrift impliziert, dass grundsätzlich Abkommen im gesamten Bereich der Entwicklungshilfe geschlossen werden und dass die Einzelheiten vertraglich fixiert werden können. Der Vorbehalt aus Art. 181 Abs. 2 EG („Unberührtheitsklausel“481), wonach die Vertragsschlusskompetenz für die EG nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien zu verhandeln und internationale Abkommen zu schließen, berührt, wurde in Art III-317 Abs. 2 UAbs. 2 EVV übernommen. Dies ist letztlich nichts anderes als das Gegenstück zur Bestimmung des Art. I-14 Abs. 4 EVV, nach der die Ausübung der Zuständigkeiten der Union die Mitgliedstaaten nicht hindert, ihre eigenen Zuständigkeiten auszuüben. Die Regelung stellt damit eine Zementierung der parallelen Zuständigkeit dar. Bisher enthält Art. 177 EG eine ausführliche Umschreibung der Ziele der gemeinsamen Entwicklungspolitik. Art. III-316 Abs. 1 EVV nimmt dagegen im Wesentlichen nur noch auf die in Art. III-292 EVV aufgeführten allgemeinen Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union Bezug, wobei der Schwerpunkt insbesondere beim Ziel der nachhaltigen Entwicklung (lit. d), der Integration aller Länder in die Weltwirtschaft (lit. e) und der Hilfe bei Naturkatastrophen oder bei von Menschen verursachten Katastrophen (lit. g) liegt.482 Bemerkenswert ist, dass neben diesem allgemeinen Verweis auf die Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union in Art. III-316 Abs. 2 UAbs. 2 EVV explizit ein Hauptziel genannt wird, nämlich die Beseitigung der Armut.483 Diese ist nach dem EG-Vertrag noch eines unter vielen Zielen der Entwicklungspolitik und in Art. 177 Abs. 1 3. Spiegelstrich EG genannt. Der Verfassungsvertrag geht über das bisherige Ziel der Armutsbekämpfung hinaus und setzt der Union auf längere Sicht das noch ehrgeizigere Ziel der Armutsbeseitigung. 479 Der Hinweis auf die eigene Zielbestimmung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit war im Konventsentwurf noch nicht enthalten, vgl. Art. III-219 Abs. 2 KE-EVV. 480 Vgl. Pitschas, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar, Art. 181 Rdnr. 7. 481 Schmalenbach, in: Calliess / Ruffert, EU-Kommentar, Art. 181 Rdnr. 5. 482 Zimmermann, RIW 2004, 324 (326). 483 Damit schloss sich der Konvent den Vorschlägen der Arbeitsgruppe Außenpolitik an, die in ihrem Abschlussbericht empfahl, dass die Bekämpfung der Armut „das zentrale Ziel der Entwicklungspolitik der Union“ bilden müsse, CONV 459 / 02, S. 27 (Rdnr. 53); die Beseitigung der Armut ist abermals in Art. III-292 Abs. 2 lit. d) EVV als Ziel genannt.
300
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Die schon nach dem EG-Vertrag bestehende Koordinierungspflicht (Art. 180 Abs. 1 EG) zwischen der Union und den Mitgliedstaaten wurde ebenfalls in den Verfassungsvertrag integriert (Art. III-318 EVV). Hinzugefügt wurde lediglich die Zielbestimmung, wonach die Koordinierung dazu dient, dass die Maßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten einander besser ergänzen und wirksamer sind. Dieser Zusatz ist jedoch rechtlich gesehen ohne Bedeutung, er besitzt lediglich erklärenden Charakter. Art. III-318 EVV konkretisiert letztlich für den Bereich der Entwicklungszusammenarbeit die allgemeine Bestimmung über die Unionstreue (Art. I-5 Abs. 2 EVV).484 Schließlich ist zu erwähnen, dass der Hinweis auf die Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas, des karibischen Raumes und des Pazifischen Ozeans im Rahmen des AKP-EG-Abkommens entfallen ist. Dieser in Art. 179 Abs. 3 EG enthaltene Hinweis sollte sicherstellen, dass nach dem Inkrafttreten der Art. 177 ff. EG durch den Maastrichter Vertrag die Zusammenarbeit mit den AKP-Ländern auch weiterhin nur auf der Grundlage des Art. 310 EG (Assoziierungsabkommen) erfolgen sollte. Dies hatte zur Folge, dass entsprechende Verträge in Form von gemischten Abkommen geschlossen werden mussten und dass die Finanzierung – außerhalb des Gemeinschaftshaushaltes – durch den Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) erfolgte.485 Nun könnte man annehmen, dass der in Art. 179 Abs. 3 EG enthaltene Hinweis ohnehin überflüssig ist, da kein Grund ersichtlich ist, warum Art. 179 EG die Zusammenarbeit zwischen den AKP-Ländern und der EG berühren oder in irgendeiner Form einschränken könnte. Aus Art. 179 Abs. 3 EG lässt sich weder ableiten, dass das AKP-EG-Abkommen in seiner bisherigen Form aufrecht zu erhalten ist, noch verbietet er eine parallele Zusammenarbeit mit anderen Staaten oder Staatengruppen.486 Dennoch ist die Streichung dieses Absatzes rechtlich nicht ohne Belang. Der Wegfall dieser Norm wirft die Frage auf, ob der bisherige Rahmen für die Zusammenarbeit beibehalten werden kann.487 Insbesondere die bisherige Finanzierung im Rahmen des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) wird im Hinblick auf Art. I-53 EVV in Zukunft unzulässig sein, da Art. I-53 Abs. 1 EVV explizit vorsieht, dass alle Ausgaben der Union gemäß den Bestimmungen von Teil III in den Haushaltsplan einzusetzen sind.488 Auch die so genannte Querschnitts- oder Kohärenzklausel des bisherigen Art. 178 EG wurde in den Verfassungsvertrag aufgenommen (Art. III-316 Abs. 1 EVV). Dabei wäre es möglich gewesen, die bisherige Kohärenzklausel des Art. 178 EG entfallen zu lassen, da sie streng genommen in der allgemeinen Kohärenzklausel des Art. III-292 Abs. 3 UAbs. 2 EVV aufgeht.489 Die im Verfassungsvertrag Zimmermann, RIW 2004, 324 (326). Zimmermann, RIW 2004, 324 (326). 486 Zimmermann / Martenczuk, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 179 EGV, Rdnr. 9. 487 Zimmermann, RIW 2004, 324 (326). 488 Vgl. zur Frage, ob die Zusammenarbeit mit den AKP-Ländern einer gesonderten Politik oder Finanzierung bedarf, CONV 685 / 03, S. 57. 484 485
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
301
vorgesehene Bestimmung enthält nun die Formulierung, dass die Union den Zielen der Entwicklungszusammenarbeit „Rechnung tragen muss“; nach Art. 178 EG muss die Union die Auswirkungen anderer Politiken auf Entwicklungsländer „berücksichtigen“. Die Neuregelung stellt keine qualitative Änderung dar. Bisher ist es so, dass sich die Gemeinschaft über die entwicklungspolitischen Konsequenzen ihrer Tätigkeit oder Untätigkeit in anderen Politikbereichen klar werden muss.490 Dies bedeutet zumindest, dass im Rahmen einer Erläuterung eines Vorschlags für einen Rechtsakt auf die in Art. 177 EG genannten Zielvorgaben einzugehen ist.491 Die Neuregelung, wonach die Union den entwicklungspolitischen Zielen „Rechnung tragen muss“, kommt der Querschnittsklausel für den Umweltbereich nahe, welche verlangt, dass die Erfordernisse des Umweltschutzes bei der Festlegung und Durchführung der Gemeinschaftspolitiken „einbezogen werden müssen“ (Art. 6 EG; im Verfassungsvertrag: Art. II-97 EVV, Art. III-119 EVV). Allerdings ist Art. III-316 Abs. 1 EVV nicht – anders als die gerade erwähnte Umweltschutzklausel – in den Anfangsbestimmungen des Teils III des Verfassungsvertrages genannt.492 Die Union muss also alle ihre Entscheidungen und Planungen dahingehend überprüfen, welche Auswirkungen sie auf Entwicklungsländer haben. Dass die Union den Zielen der Entwicklungszusammenarbeit Rechnung tragen muss, bedeutet in diesem Fall nicht nur, dass sie sich der Folgen ihrer Aktionen bewusst werden, sondern auch, dass sie die entwicklungspolitischen Ziele in ihre Abwägung einstellen muss. Die Entwicklungshilfe soll dabei als ein Element der Gesamtstrategie der Union gegenüber Drittstaaten angesehen werden.493 Inwieweit die Ziele tatsächlich einbezogen werden, liegt aber im Ermessen des jeweiligen europäischen Organs.494 Schließlich verbietet Art. III-292 Abs. 3 UAbs. 2 EVV, dass die Union durch unterschiedliche Maßnahmen Ziele verwirklicht, die sich widersprechen. Dieses allgemeine Gebot besagt, dass die Union auf die Kohärenz zwischen den einzelnen Bereichen ihres auswärtigen Handelns sowie auf die Kohärenz zwischen internen und externen Politikbereichen achten muss. 489 So zu Recht auch Zimmermann, RIW 2004, 324 (326), der auf die Parallelführung der allgemeinen außenpolitischen Ziele der Union mit den speziellen, bislang in Art. 177 EG verankerten Zielen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit verweist. Nach Art. III-292 Abs. 3 EVV muss Kohärenz sowohl in Bezug auf die auswärtigen Ziele der Union als auch zwischen den einzelnen Politikbereichen angestrebt werden, vgl. dazu CONV 748 / 03, S. 11. 490 Zimmermann / Martenczuk, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 178 EGV, Rdnr. 1. 491 Zimmermann / Martenczuk, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 178 EGV, Rdnr. 1. 492 Die umweltschutzrechtliche Querschnittsklausel gilt für das gesamte Gemeinschaftshandeln; ihr kommt aufgrund der Tatsache, dass sie vor die Klammer gezogen ist, eine besondere Bedeutung zu, vgl. auch Jahns-Böhm, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 6 EGV, Rdnr. 10; die gleiche Argumentation trifft auch auf den Verfassungsvertrag zu. 493 CONV 459 / 02, S. 8 und 28 (Rdnr. 9 und 55). 494 So auch zur Regelung des Art. 178 EG Zimmermann / Martenczuk, in: Schwarze, EUKommentar, Art. 178 EGV, Rdnr. 2.
302
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Wie ein wirklicher Zielkonflikt zwischen einzelnen Politikbereichen, etwa der gemeinsamen Handelspolitik und der Entwicklungshilfepolitik, zu überbrücken und zu lösen ist, regelt allerdings keine Vorschrift der Verfassung.
b) Wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittländern, Art. III-319 EVV aa) Art der Zuständigkeit Anders als die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe ist die wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten nicht explizit in Art. I-14 EVV genannt. Die wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten wird aber auch in keiner anderen Kompetenzvorschrift erwähnt. Demnach fällt sie in die geteilte Zuständigkeit, da Art. I-14 Abs. 1 EVV einschlägig ist: die Verfassung weist der Union eine Zuständigkeit zu, welche außerhalb der in Art. I-13 und I-17 EVV genannten Bereiche liegt. Fraglich ist jedoch, ob diese Zusammenarbeit eine „echte“ geteilte Zuständigkeit darstellt, oder eine (hier so genannte) „parallele“ Zuständigkeit, wie sie von Art. I-14 Abs. 3 und 4 EVV für die Bereiche Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt sowie für die Bereiche Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe festgelegt wird. Denkbar wäre es, den Verweis in Art. I-14 Abs. 4 EVV auf die Bereiche Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe als Verweis auf das gesamte Kapitel IV des auswärtigen Handelns der Union aufzufassen. Dann wäre auch der Bereich der wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Zusammenarbeit mit Drittstaaten von der parallelen Zuständigkeit erfasst. Eine solche Vorgehensweise stünde jedoch im Widerspruch zum Wortlaut des Verfassungsvertrages. Kapitel IV ist mit „Zusammenarbeit mit Drittländern und humanitäre Hilfe“ überschrieben. Der Verweis in Art. I-14 Abs. 4 EVV lautet jedoch „In den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe“. Zieht man in Betracht, dass die Abschnitte 1 und 3 mit „Entwicklungszusammenarbeit“ beziehungsweise „Humanitäre Hilfe“ überschrieben sind, sich also vollständig mit dem Verweis in Art. I-14 Abs. 4 EVV decken, kann man eine sprachliche Ungenauigkeit in Art. I-14 Abs. 4 EVV ausschließen. Argumentiert man mit dem Wortlaut, muss man feststellen, dass der Abschnitt 2 „Wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittländern“ gerade nicht von dem Verweis in Art. I-14 EVV erfasst werden sollte. Dies bestätigt auch der Vergleich mit anderen Sprachfassungen des Verfassungsvertrages. Im englischen Wortlaut heißt es in Art. I-14 Abs. 4 EVV „In the areas of development cooperation and humanitarian aid“, dieser Verweis entspricht jeweils der Überschrift der section 1 „Development Cooperation“ und der section 3 „Humanitarian Aid“, nicht jedoch der Überschrift des Chapter IV, welche lautet „Cooperation with Third Countries and Humanitarian Aid“. Derselbe
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
303
Befund zeigt sich beim Blick auf die spanische Sprachfassung. Der Verweis in Art. I-14 Abs. 4 EVV lautet „En los ámbitos de la cooperación para el desarollo y de la ayuda humanitaria“, das Capítulo IV ist hingegen überschrieben mit „Cooperación con Terceros Países y Ayuda Humanitaria“. Demgegenüber ist Sección 1 ist mit „Cooperación para el Desarollo“ und Sección 3 mit „Ayuda Humanitaria“ überschrieben. Dennoch sprechen gute Argumente dafür, die wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit als eine parallele Zuständigkeit zu betrachten und die genannte Zusammenarbeit in Art. I-14 Abs. 4 EVV hineinzulesen. Dies zeigt sich vor allem bei einem strukturellen Vergleich zwischen den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe einerseits mit der wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Zusammenarbeit mit Drittstaaten andererseits. Entscheidend dürfte vor allem die gleiche Interessenlage zwischen den in Art. I-14 Abs. 4 EVV genannten Bereichen und der wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Zusammenarbeit mit Drittstaaten sein. Alle drei genannten Bereiche sind in einem Kapitel, nämlich Kapitel IV, zusammengefasst. Sinn dieses Kapitels ist es, die Entwicklungshilfe und die Zusammenarbeit mit Drittländern möglichst effektiv zu gestalten. Dem widerspräche es, wenn man es den Mitgliedstaaten verböte, ihre Zuständigkeiten in diesem Bereich auszuüben, sofern und soweit die Union ihre Zuständigkeit ausgeübt hat.495 Die Folge wäre nämlich, dass sich die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene nicht (mehr) für die wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit engagieren dürften, sondern lediglich auf Unionsebene vorgehen könnten, sobald die Union Teile der Entwicklungspolitik durch eigenes Handeln für sich „besetzt“ hat. Ein solches „Abwürgen“ mitgliedstaatlicher Aktivitäten kann von der Verfassung nicht gewollt sein, wenn man bedenkt, dass die Verfassung selbst fordert, dass die Maßnahmen der Union und die Maßnahmen der Mitgliedstaaten sich ergänzen und gegenseitig verstärken sollen (Art. III-319 Abs. 1 S. 3 EVV). Trägt man weiterhin der Tatsache Rechnung, dass von der gesamten weltweit geleisteten Hilfe der Anteil der Union 10%, derjenige (aus den nationalen Haushaltsmitteln aufgewendete) Anteil der Mitgliedstaaten einen weitaus größeren Prozentsatz von 45% ausmacht496, dann muss man, um überhaupt eine effektive Politik in der Zusammenarbeit mit Drittländern zu erreichen, von einer parallelen Zuständigkeit ausgehen. Einen deutlichen Hinweis für eine nebeneinander bestehende Kompetenz gibt auch Art. III-319 Abs. 3 UAbs. 2 EVV, wonach völkerrechtliche Abkommen, welche die Union geschlossen hat, nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten berühren, in internationalen Gremien zu verhandeln und völkerrechtliche Abkommen zu schließen. Zum selben Ergebnis führt der Vergleich mit der Rechtslage nach dem EG-Vertrag. Die herrschende Meinung zur Kompetenzverteilung im Rahmen des Art. 181a 495 Dieses Verbot, als wesentlicher Charakter der geteilten Zuständigkeit, beinhaltet Art. I-12 Abs. 2 EVV. 496 Das Zahlenmaterial stammt aus dem Konventsdokument CONV 459 / 02, S. 27 (Rdnr. 54).
304
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
EG, der ebenfalls die wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittländern regelt, geht davon aus, dass es sich um eine parallele Kompetenz handelt. Da sich durch die Übernahme des Art. 181a EG in die Verfassung im Wortlaut der Vorschrift keine wesentlichen Änderungen ergeben haben, besteht kein Anhaltspunkt dafür, auf eine Änderung der Kompetenzverteilung zu schließen. Damit muss es sich bei Art. III-319 EVV um eine echte nebeneinander bestehende (parallele) Zuständigkeit handeln, also um eine Zuständigkeit, welche grundsätzlich kumulativ, zum einen von der Union, zum anderen von den Mitgliedstaaten ausgeübt werden darf.497 Eine ausdrückliche Klarstellung, zum Beispiel durch die Aufnahme der wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Zusammenarbeit mit Drittländern in Art. I-14 Abs. 4 EVV wäre dennoch wünschenswert gewesen. Geht man folglich von einer parallelen Zuständigkeit aus, stellt Art. III-319 Abs. 1 S. 3 EVV die allgemeine Grenze dieser parallelen Zuständigkeit auf. Hiernach sollen sich die Maßnahmen der Union und die Maßnahmen der Mitgliedstaaten gegenseitig ergänzen und verstärken – was sie nur können, wenn sie sich nicht widersprechen. Darüber hinaus begrenzt auch der Grundsatz der Unionstreue aus Art. I-5 Abs. 2 EVV die Kompetenzen der Mitgliedstaaten. Mitgliedstaatliche Programme dürfen demnach nicht den Zielen der Union nach Art. III-292 EVV widersprechen oder konkrete europäische Programme konterkarieren.
bb) Umfang der Zuständigkeit Art. III-319 Abs. 1 EVV stellt zunächst klar, dass sich die wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit auf Drittländer erstreckt, die keine Entwicklungsländer sind. Dieser Hinweis fehlt noch in Art. 181a EG. Da es jedoch der Sinn und Zweck der Einführung dieses Artikels (durch den Vertrag von Nizza) war, eine Ermächtigung im EG-Vertrag für die Zusammenarbeit mit Ländern zu begründen, die keine Entwicklungsländer sind, geht die herrschende Meinung bereits jetzt davon aus, dass der Artikel die Zusammenarbeit mit Nicht-Entwicklungsländern betrifft.498 Gleichzeitig legt Art. III-319 Abs. 1 EVV fest, dass die Vorschriften zur Entwicklungszusammenarbeit nicht verdrängt werden („unbeschadet“). Auch Art. III-319 EVV verweist auf die Grundsätze und Ziele, die für die Union im Rahmen ihres auswärtigen Handelns gemäß Art. III-292 EVV gelten. Die inter497 Für echte, nebeneinander bestehende Kompetenzen auch Zimmermann, RIW 2004, 324 (327) unter Hinweis auf sich entsprechende Formulierungen in Art. III-319 Abs. 1 S. 3, Abs. 3 S. 1 und Abs. 3 UAbs. 2 EVV einerseits und Art. III-316 Abs. 1 S. 2, III-318 Abs. 3 und III-317 Abs. 2 UAbs. 2 EVV andererseits. 498 Vor Einführung des Art. 181a EG musste die Zusammenarbeit mit Nicht-Entwicklungsländern auf der Grundlage des Art. 308 EGV (Flexibilitätsklausel) stattfinden, woraus sich die Notwendigkeit der Einstimmigkeit ergab.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
305
ne Durchführung der Zusammenarbeit erfolgt durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze. Abs. 3 enthält eine Außenkompetenz für die Gemeinschaft zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge. Auffällig hierbei ist, dass es sich nicht um eine ebenso weite Formulierung handelt, wie sie in Art. III-317 Abs. 2 EVV zur Entwicklungspolitik enthalten ist. Dort heißt es, die Union kann „alle Übereinkünfte schließen, die zur Verwirklichung der Ziele des Art. III-292 EVV beitragen“. Art. III-319 Abs. 3 EVV entspricht dagegen nahezu wörtlich Art. 181a Abs. 3 EG; er verweist zunächst auf die Zuständigkeitsverteilung bei der Zusammenarbeit zwischen Union und Mitgliedstaaten mit internationalen Organisationen und regelt dann, dass die „Einzelheiten der Zusammenarbeit der Union in Übereinkünften zwischen dieser und den betreffenden Parteien geregelt werden“ können. Allerdings kann die Formulierung „im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten“ nicht als Kompetenzschranke für die Union begriffen werden, denn diese ist (neben den Mitgliedstaaten) gemäß Art. III-319 Abs. 1 EVV vollumfänglich für die wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittländern zuständig. Die Einzelheiten dieser potenziell weiten Zusammenarbeit kann die Union in internationalen Verträgen regeln. Inhaltlich besteht damit kein Unterschied zu der Formulierung in Art. III-319 Abs. 3 EVV; fraglich bleibt, warum unterschiedliche Formulierungen innerhalb des Kapitels IV verwendet wurden. Schließlich enthält Art. III-320 EVV eine besondere Rechtsgrundlage für Fälle, in denen es erforderlich ist, mittels Finanzhilfen schnell zu handeln. In der Erklärung Nr. 10, die der Schlussakte zum Vertrag von Nizza beigefügt ist, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Zahlungsbilanzbeihilfen für Drittländer nicht unter Art. 181a EG fallen. Als Konsequenz müssen solche Hilfen derzeit auf der Grundlage von Art. 308 EG – und damit einstimmig – beschlossen werden.499 Mit Art. III-320 EVV schafft der Verfassungsvertrag eine spezifische Rechtsgrundlage für die beschriebenen Fälle und führt die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit ein, um der Dringlichkeit der genannten Hilfe besser Rechnung tragen zu können.
c) Humanitäre Hilfe, Art. III-321 EVV Eine eigene Ermächtigungsnorm bezüglich humanitärer Hilfe ist im Vertrag von Nizza nicht vorhanden. Insofern ist die Schaffung eines expliziten Kompetenztitels für humanitäre Hilfe ein Novum. Allerdings gehört auch nach derzeitiger Rechtslage die humanitäre Hilfe zu den Instrumenten der Entwicklungshilfe, derer sich die Gemeinschaft bedient.500 Die Gemeinschaft finanziert Nahrungsmittelhilfen CONV 685 / 03, S. 60. Zimmermann / Martenczuk, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 177 EGV, Rdnr. 13. Die humanitäre Hilfe wird derzeit nach den in der Verordnung (EG) Nr. 1257 / 96 des Rates vom 20. Juni 1996 (Rechtsgrundlage: Art. 179, ex-Artikel 130w EGV) festgelegten Modalitäten durchgeführt, vgl. CONV 685 / 03, S. 61. 499 500
20 Metz
306
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
und Hilfsaktionen in humanitären Krisensituationen, die insbesondere durch das European Community Humanitarian Office (ECHO501) koordiniert und durchgeführt werden.502 Die bereitgestellten Mittel können für die Soforthilfe bei Naturkatastrophen oder bei vom Menschen herbeigeführten Krisensituationen eingesetzt werden. Bei den derzeitigen Verfahren im Bereich der humanitären Hilfe liegt die Entscheidungsbefugnis bis zu einem gewissen Grade beim ECHO-Direktor beziehungsweise beim zuständigen Kommissionsmitglied.503
aa) Art der Zuständigkeit Der Bereich humanitäre Hilfe ist (gemeinsam mit der Entwicklungszusammenarbeit) in Art. I-14 Abs. 4 EVV genannt. Daher fällt die humanitäre Hilfe unter eine besondere Kategorie der geteilten Zuständigkeit, die hier parallele Zuständigkeit genannt wird. Im Übrigen gelten die Ausführungen zur Entwicklungszusammenarbeit.504
bb) Umfang der Zuständigkeit Auch im Rahmen der humanitären Hilfe ist die Union an die Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns gebunden.505 Humanitäre Hilfsprogramme sollen dazu dienen, humanitäre Notlagen, die von Naturkatastrophen oder von Menschen verursacht wurden, zu mildern. Dabei ist es irrelevant, ob es sich bei dem betreffenden Drittland um ein Entwicklungsland handelt oder nicht.506 Der Bereich humanitäre Hilfe wurde nicht den EU-Krisenmanagement-Instrumenten untergeordnet, wie dies bei den Konventsverhandlungen im Gespräch war. Der Grund hierfür ist, dass die humanitäre Hilfe zwar durchaus zu den externen Handlungen der Union zählt, diese aber auf eigenständigen Gründen beruht. Hu501 Das ECHO wurde 1992 gegründet. Es hat ein durchschnittliches Budget von 500 Millionen A und führt Programme in mehr als 60 Ländern durch, von denen 40 bis 50 Millionen Menschen jährlich profitieren, vgl. WG VII – WD 48, S. 3 (Poul Nielson). 502 Vgl. etwa die Verordnung des Rates Nr. 1257 / 96 über die humanitäre Hilfe, ABl. 1996 L 163, 1. 503 CONV 459 / 02, S. 29 (Rdnr. 59). 504 Siehe auch Görlitz, DÖV 2004, 374 (380), sowie oben, § 10 II. 7. a). 505 Siehe hierzu die Forderungen des Konventsmitglieds Hain, WG VII – WD 27, S. 2 ff. (Peter Hain). 506 Zimmermann, RIW 2004, 324 (327); nach der Einschätzung von Kommissar Nielson sind die bisherigen humanitären Hilfsprogramme eine „Erfolgsstory“ der gemeinschaftlichen Außenbeziehungen, sie seien Ausdruck der humanitären Werte, auf die sich die Gemeinschaft gründet. Außerdem demonstriere die humanitäre Hilfe eine weltweite Solidarität mit den Menschen in Not. Die humanitäre Hilfe werde des Weiteren von einem breiten Konsens der europäischen Bürger getragen, (WG VII – WD 48, S. 3 (Poul Nielson)).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
307
manitäre Hilfe wird entsprechend der Not der betroffenen Menschen geleistet, wobei auf die Schwächsten, nämlich Kinder, Frauen, Behinderte und Flüchtlinge, besondere Rücksicht genommen wird. Daher darf diese Hilfe nicht von politischen Erwägungen beeinflusst oder geleitet werden. Außerdem können nach dem Vertrag von Nizza Hilfsprogramme innerhalb kürzester Zeit eingeleitet werden; diese Geschwindigkeit und Effizienz wäre bei einer Eingliederung in das EU-Krisenmanagement in den Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik aller Wahrscheinlichkeit nach verloren gegangen.507 Der Hinweis auf die Unparteilichkeit und die Neutralität508 der humanitären Hilfsmaßnahmen in Art. III-321 Abs. 2 EVV bestätigt die Trennung zwischen der Sicherheitspolitik und der humanitären Hilfe. Eine Vermischung von militärischen und humanitären Kräften könnte dazu führen, dass die Helfer als Handlanger der Soldaten und damit als potenzielle Feinde betrachtet werden. Dies könnte das gesamte Hilfsprogramm in Frage stellen und zudem die Mitarbeiter der Hilfswerke gefährden.509 Zudem muss die humanitäre Hilfe auf der Grundlage der Nichtdiskriminierung der Opfer, unabhängig von Rasse, Ethnie, Religion, Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit oder politischer Zugehörigkeit gewährt werden.510 Mit Art. III-321 EVV wird der Union weiterhin die Möglichkeit gegeben, humanitäre Hilfe auch Menschen in solchen Ländern zukommen zu lassen, deren Regierungen mit Sanktionen belegt worden sind.511 Ein Novum ist das durch Art. III-321 Abs. 5 EVV eingeführte Europäische Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe. Zweifelhaft ist jedoch, ob dieses Freiwilligenkorps – wie die Stellung des Art. III-321 Abs. 5 EVV nahe legt – nur im Bereich der Humanitären Hilfe, nicht jedoch im Rahmen der allgemeinen Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt werden soll.512
8. Ausdrückliche Kompetenzen im Bereich der Wirtschaftssanktionen (Restriktive Maßnahmen), Art. III-322 EVV Art. III-322 EVV fasst die beiden Artikel über Sanktionen aus den geltenden Verträgen in einem einzigen Artikel zusammen.513 Im Vergleich zur Regelung So auch Kommissar Nielson, in: WG VII – WD 48, S. 3 (Poul Nielson). Das Wort „Neutralität“ wurde von der Regierungskonferenz hinzugefügt. 509 CONV 459 / 02, S. 28 (Rdnr. 57); Kommissar Nielson forderte, dass gemäß der OsloRichtlinien eine militärische Intervention zu humanitären Zwecken nur auf ausdrückliche Anforderung von humanitären Hilfskräften hin erfolgen dürfe, WG VII – WD 48, S. 6 (Poul Nielson). 510 CONV 685 / 03, S. 62. 511 Cremona, CMLRev 2003, 1347 (1364). 512 Zimmermann, RIW 2004, 324 (327). 513 CONV 685 / 03, S. 8. 507 508
20*
308
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
nach dem EG-Vertrag gibt Art. III-322 EVV jedoch nur teilweise die Rechtslage nach Art. 301 EG wieder. Wie bisher ist der Erlass von Wirtschaftssanktionen an (grundsätzlich einstimmig zu treffende) Beschlüsse im Rahmen der GASP gekoppelt. Trotz der Abschaffung der Säulenstruktur ist damit weiterhin – neben dem GASP-Beschluss – ein „Umsetzungsbeschluss“ erforderlich. Dieser ergeht auf gemeinsamen Vorschlag des Außenministers der Union und der Kommission. Die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit wurde beibehalten, eine Unterrichtung des Europäischen Parlaments dagegen neu eingefügt. Nach bisheriger Fassung des Art. 301 EG war es umstritten, ob der Rat einen solchen Beschluss treffen muss oder die Kommission zur Ausarbeitung eines Beschlussvorschlages verpflichtet ist. Nach herrschender Auffassung wurde eine solche Pflicht aufgrund des Wortlauts der Vorschrift („trifft der Rat“) angenommen. Nach Art. III-322 Abs. 1 EVV „erlässt der Rat die erforderlichen Europäischen Verordnungen oder Beschlüsse“. Sinngemäß verbleibt es daher bei dem bisherigen Inhalt, wonach ein Beschlussvorschlag beziehungsweise ein Beschluss nicht erlassen werden kann, sondern erlassen werden muss. Art. III-322 Abs. 1 EVV konkretisiert die „erforderlichen Sofortmaßnahmen“ aus Art. 301 EG und schreibt den Erlass von Europäischen Verordnungen oder Beschlüssen vor. Der Umfang der möglichen restriktiven Maßnahmen wird leicht erweitert, er reicht von der Aussetzung über die Einschränkung bis hin zur vollständigen Einstellung der Wirtschaftsbeziehungen zu einem Drittland oder mehreren Drittländern. Ein Hinweis auf die Finanzbeziehungen wird eingefügt, um die unter Art. 60 EG fallenden Bereiche abzudecken.514 Neu ist Art. III-322 Abs. 2 EVV, wonach die Union restriktive finanzielle und wirtschaftliche Maßnahmen auch gegenüber Gruppierungen, nichtstaatlichen Einrichtungen und natürlichen oder juristischen Personen (also nicht nur gegenüber Staaten) erlassen kann. Damit wird der Adressatenkreis der genannten Maßnahmen erweitert. Zwar ist es auch nach dem EG-Vertrag möglich, solche Sanktionen gegen nichtstaatliche Strukturen zu erlassen, der Beschluss hierzu muss aber auf Art. 308 EG basieren und ist daher immer einstimmig zu treffen. Die Erweiterung der Ermächtigungsgrundlage des Art. III-322 Abs. 2 EVV hat daher vor allem verfahrensrechtliche Erleichterungen zur Folge. Der genannten Erweiterung des Adressatenkreises entspricht Art. III-322 Abs. 3 EVV515, der – als Folge der möglichen Sanktionen nach Abs. 2 – erstmals vorsieht, dass in den betreffenden Rechtsakten der Union auch die erforderlichen Bestimmungen über den Rechtsschutz enthalten sein müssen.516 Damit soll der Rechtsschutz gegen Maßnahmen CONV 685 / 03, S. 63. Eine entsprechende Vorschrift war im Konventsentwurf noch nicht enthalten, vgl. Art. III-224 KE-EVV. 514 515
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
309
transparenter gestaltet werden, die natürliche oder juristische Personen konkret und individuell betreffen. Eine Bezugnahme auf Grundrechte enthält der Artikel indes nicht.517 Eine solche wäre auch nicht erforderlich gewesen, da mit der Aufnahme der Grundrechtscharta in Teil II des Verfassungsvertrages die Grundrechte ohnehin für das gesamte Unionshandeln gelten.518 Ferner enthält der horizontale Art. III-292 EVV Bezugnahmen auf die Achtung der Menschenrechte und des Völkerrechts. Bei Visumbeschränkungen wurde eine Erweiterung des Art. III-322 Abs. 2 EVV abgelehnt. Es wurde befürchtet, dass es ansonsten zu unerwünschten Verzögerungen bei der Anwendung restriktiver Maßnahmen komme. Daher gilt, dass ein nach den GASP-Bestimmungen angenommener Rechtsakt, der Visumbeschränkungen einführt, in den Mitgliedstaaten unmittelbar gilt.519 Neu hinzugefügt wird schließlich die Bestimmung, wonach das Europäische Parlament zu unterrichten ist (Art. III-322 Abs. 1 S. 2 EVV).
9. Ausdrückliche Kompetenzen im Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs, Art. III-159, III-160 EVV Wie nach derzeit geltendem Recht kann die Union auch künftig den Kapitalund Zahlungsverkehr zu Drittländern unter bestimmten Bedingungen einschränken (Art. III-159 EVV). Neu eingeführt wird, dass die Union künftig das Recht erhält, zur Verhütung und Bekämpfung der organisierten Kriminalität, des Terrorismus und des Menschenhandels einen Rahmen für Maßnahmen im Bereich von Kapitalbewegungen und Zahlungen zu schaffen.520 Art. III-160 EVV verweist auf die Ziele, die für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts gelten (Art. III-257 EVV). Zu den zulässigen Verwaltungsmaßnahmen gehören das Einfrieren von Geldern, finanziellen Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Erträgen. Parallel zu den restriktiven Maßnahmen nach Art. III-322 EVV können Adressat der Maßnahmen nach Art. III-160 EVV auch natürliche oder juristische Personen sowie Gruppierungen und nichtstaatliche Einheiten sein. Allerdings müssen auch hier die erforderlichen Bestimmungen über den Rechtsschutz in den jeweiligen Rechtsakten enthalten sein (Art. III-160 UAbs. 3 EVV). Der Rahmen für die angesprochene Einschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit wird durch Europäisches Gesetz geschaffen. Zu dessen Durchführung er516 Die prinzipielle Kompetenz des Gerichtshofs, solche Maßnahmen zu kontrollieren ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass die genannten Sanktionen keine GASP-Maßnahmen darstellen, sondern der allgemeinen Rechtskontrolle des EuGH unterliegen. 517 Siehe hierzu bereits oben, § 8 III. 8. 518 CONV 727 / 03, S. 54 f. 519 CONV 727 / 03, S. 55. 520 Görlitz, DÖV 2004, 374 (380).
310
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
lässt der Rat auf Vorschlag der Kommission Europäische Verordnungen oder Beschlüsse.
10. Währungspolitik, Art. III-185 ff. EVV, Art. III-326 EVV Die institutionellen Bestimmungen über die Europäische Zentralbank wurden teilweise umgestaltet.521 Aus systematischen Gründen entschied sich der Konvent, eine Bestimmung über die EZB in die Regelungen des Teils I über die sonstigen Organe der Union einzufügen (Art. I-30 EVV).522 In dem neuen Art. I-30 EVV werden die bisherigen Art. 8, 105 bis 108, 110 und 112 EG übersichtlich zusammengefasst und die Struktur und die Ziele der EZB an systematisch richtiger Stelle definiert. Es wird festgehalten, dass die EZB ein Organ der Union ist und Rechtspersönlichkeit besitzt. Mit Art. III-191 EVV wird eine neue endgültige Rechtsgrundlage für die Geldpolitik der EZB geschaffen.523
a) Art der Zuständigkeit Nach Art. I-13 Abs. 1 lit. c EVV fällt der Bereich der Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, in die ausschließliche Zuständigkeit der Union. Indes behalten, wie in Art. I-30 Abs. 4 EVV geregelt, die Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, sowie deren Zentralbanken, ihre Zuständigkeiten im Währungsbereich. Das Wesen der ausschließlichen Zuständigkeit besteht nach Art. I-12 Abs. 1 EVV darin, dass nur die Union tätig werden darf, den Mitgliedstaaten ist ein Handeln grundsätzlich verwehrt (es sei denn, sie sind von der Union ausdrücklich hierzu ermächtigt worden). Hiervon ausgehend ist es verwunderlich, warum mit Art. III-326 Abs. 4 EVV die Regelung des Art. 111 Abs. 5 EG in den Verfassungsver521 Beschlüsse, die ausschließlich den Euro-Raum betreffen, werden künftig vom Rat (ECOFIN) – nur mit den Stimmen der teilnehmenden Mitgliedstaaten – gefasst, vgl. Art. III-194 ff. EVV. Ferner wird der Abschnitt betreffend die Übergangsregelungen neu gestaltet (vgl. Art. III-197 ff. EVV). Als informelles Diskussionsforum wird die Euro-Gruppe erhalten und erstmals im Primärrecht erwähnt, vgl. Art. III-195 EVV und das „Protokoll betreffend die Euro-Gruppe“. Informelle Beratungen innerhalb der Gruppe sind wichtig, da der EuroGruppe nach der Erweiterung der Union (zumindest für eine Übergangszeit) nicht mehr die breite Mehrheit der Mitgliedstaaten angehören. 522 Anders noch der Textentwurf für die Abschnitte des Teils III der Verfassung vom 27. 05. 2003, CONV 727 / 03, S. 9. Der Konvent begründete seine Ablehnung erstens damit, dass allgemeiner Konsens darüber bestehe, keine Änderungen in Bezug auf den Status oder die Funktionen der EZB vorzunehmen. Zweitens wäre es nach Ansicht des Konvents sehr schwierig, jene Bestimmungen zu ermitteln, die rein institutionellen Charakter haben, da die Rolle der EZB untrennbar mit den Bestimmungen über die Geld- und Währungspolitik verknüpft sei. 523 CONV 727 / 03, S. 8.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
311
trag übernommen wurde. Schon nach bisheriger Rechtslage geht die herrschende Meinung davon aus, dass die Kompetenz im Rahmen der Währungspolitik für die zwölf Mitgliedstaaten, die dem Euro-Währungsgebiet angehören, ausschließlich der Europäischen Gemeinschaft zusteht.524 Art. III-326 Abs. 4 EVV räumt den Zuständigkeiten der Union Vorrang vor den Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten ein („unbeschadet der Zuständigkeiten und der Übereinkünfte der Union im Bereich der Wirtschafts- und Währungsunion“). Geht man davon aus, dass die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, vollständig auf die Union übergegangen ist, so kann Art. III-326 Abs. 4 EVV nur für diejenigen Mitgliedstaaten gelten, die den Euro (noch) nicht eingeführt haben. Einer Betonung der Kompetenzen der Nicht-Euro-Staaten hätte es angesichts des Art. I-30 Abs. 4 EVV allerdings nicht bedurft. Insoweit erscheint die Vorschrift des Art. III-326 Abs. 4 EVV überflüssig. Auch der Fall, dass ein Handeln der Mitgliedstaaten des Euro-Raumes erforderlich wird, weil eine internationale Organisation als Mitglieder nur Staaten, nicht aber die Europäische Union als bloßen Staatenverbund akzeptiert, zwingt zu keinem anderen Ergebnis. Sollen bestimmte Beschlüsse eines solchen internationalen Gremiums bewirkt werden, können zwar nur die Mitgliedstaaten (und nicht die Union selbst) handeln, weil nur ihnen ein Stimmrecht zusteht. Ein kooperatives Vorgehen von Union und Mitgliedstaaten ist jedoch bereits aufgrund von Art. I-12 Abs. 1 EVV möglich, wonach die Union im Bereich ihrer ausschließlichen Zuständigkeit die Mitgliedstaaten zum Handeln ermächtigen kann. Damit bedarf es auch für diese Konstellation nicht einer Vorschrift, wie sie Art. III-326 Abs. 4 EVV darstellt. Art. III-326 Abs. 4 EVV bezieht sich auf den gesamten „Bereich der Wirtschafts- und Währungsunion“ und damit auf die Vorschriften der Art. III-177 ff. EVV.525 Insofern also der Bereich der Wirtschaftspolitik (Art. III-178 bis III-184 EVV) betroffen ist, stellt Art. III-326 Abs. 4 EVV klar, dass die Mitgliedstaaten weiterhin zum Abschluss internationaler Abkommen zuständig sind. Allerdings ist auch diese Klarstellung überflüssig, da es unstrittig ist, dass die Koordinierung der Wirtschaftspolitik weder in die ausschließliche Zuständigkeit der Union noch in die der Mitgliedstaaten fällt (vgl. nur Art. I-15 EVV). Zusammenfassend kann damit gesagt werden, dass die Zuständigkeit der Europäischen Union für die Währungspolitik der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, sowohl nach innen wie nach außen eine ausschließliche ist.526 524 Vgl. dazu bereits die obigen Ausführungen, § 4 III. 3. e); CONV 357 / 02, S. 2; CONV 47 / 02, S. 6 (Rdnr. 9). 525 Auch wenn Kapitel II mit „Wirtschafts- und Währungspolitik“ und nicht mit „Wirtschafts- und Währungsunion“ überschrieben ist, geht aus dem Zusammenspiel von Art. III-177 UAbs. 1 und UAbs. 2 EVV hervor, dass der Verweis auf dieses Kapitel gerichtet ist. Der Begriff „Wirtschafts- und Währungsunion“ kommt in der Verfassung ferner in Art. III-159, Art. III-179 Abs. 4 EVV, Art. III-194 Abs. 1, Art. III-196 Abs. 1, Art. III-197 Abs. 2 lit. i, Art. III-198 Abs. 1 und eben in Art. III-326 Abs. 4 EVV vor.
312
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
b) Umfang der Zuständigkeit Der Umfang der Zuständigkeiten im Währungsbereich richtet sich nach den Art. III-185 ff. EVV. Für die Außenbeziehungen der Union sind vor allem folgende Bestimmungen wichtig:
aa) Außenvertretung der Eurozone, Art. III-196 EVV Mit Art. III-196 EVV wird im Verfassungsvertrag ein neuer Artikel über die Außenvertretung des Euro aufgenommen. Nach Art. III-196 Abs. 1 EVV kann der Rat, um die Stellung des Euro im internationalen Währungssystem sicherzustellen, einen Europäischen Beschluss zur Festlegung gemeinsamer Standpunkte erlassen. Dieser Beschluss betrifft Fragen, die für die Wirtschafts- und Währungsunion, innerhalb der zuständigen internationalen Einrichtungen und Konferenzen im Finanzbereich, von besonderem Interesse sind. Art. III-196 Abs. 2 EVV betrifft die einheitliche Vertretung der Euro-Staaten bei internationalen Einrichtungen und Konferenzen im Finanzbereich. Der Rat kann nach Anhörung der Europäischen Zentralbank Maßnahmen mit dem Ziel einer einheitlichen Vertretung erlassen. Wem hierbei die Aufgabe der einheitlichen Vertretung übertragen wird, legt der Verfassungsvertrag selbst nicht fest, sondern überlässt diese Entscheidung dem Rat. Die angesprochene Vertretung könnte der Präsident des ECOFIN-Rates, der Vorsitzende der Euro-Gruppe oder die Kommission übernehmen. Letzteres würde wohl am meisten im Einklang mit der Verfassung stehen, da der Union für die Währungspolitik in Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben, die ausschließliche Zuständigkeit zusteht. Art. III-196 Abs. 2 EVV bietet die Grundlage für eine einzige Vertretung des Euro-Raums in den Internationalen Finanz-Institutionen, wie es bereits die Arbeitsgruppe „Außenbeziehungen“ empfohlen hatte.527 Bei den Maßnahmen nach Art. III-196 Abs. 1, 2 EVV sind nur diejenigen Mitgliedstaaten stimmberechtigt, deren Währung der Euro ist. Hinsichtlich der qualifizierten Mehrheit und der Sperrminorität trifft Art. III-196 Abs. 3 EVV spezielle Regelungen. Mit Art. III-196 EVV soll die Vertretung des Euro-Raums in internationalen Gremien wirksamer gemacht werden. Eine solche Vertretung fußt derzeit auf informellen Vereinbarungen, die darauf zurückgehen, dass die Bestimmungen von Art. 111 Abs. 4 EG nicht umgesetzt wurden.528
526 527 528
So auch Cremona, CMLRev 2003, 1347 (1361 f.). CONV 459 / 02, S. 10 (Rdnr. 13). CONV 357 / 02, S. 8.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
313
Für den Bereich der internationalen Zusammenarbeit ist ferner die Satzung der ESZB zu beachten.529 Nach Artikel 6 dieser Satzung entscheidet im Bereich der internationalen Zusammenarbeit die EZB, wie das Europäische System der Zentralbanken vertreten wird. Die EZB und, soweit diese zustimmt, die nationalen Zentralbanken sind befugt, sich an internationalen Währungseinrichtungen zu beteiligen. Artikel 6 der Satzung findet unbeschadet der Regelungen des Art. III-196 EVV Anwendung. Nach Art. 23 der Satzung der ESZB ist es der EZB außerdem gestattet, Geschäfte mit dritten Ländern und internationalen Organisationen zu tätigen. Die EZB kann insbesondere mit Zentralbanken und Finanzinstituten in dritten Ländern, und, soweit zweckdienlich, mit internationalen Organisationen Beziehungen aufnehmen (lit. a), alle Arten von Devisen und Edelmetallen kaufen (lit. b) und alle Arten von Bankgeschäften, einschließlich der Aufnahme und Gewährung von Krediten, im Verkehr mit dritten Ländern sowie internationalen Organisationen tätigen (lit. d).
bb) Sondervorschrift für völkerrechtliche Übereinkünfte, Art. III-326 EVV Abkommen im Bereich der Währungspolitik werden bisher auf der Grundlage von Art. 111 EG geschlossen. Dieser Artikel wird nun aus den Vorschriften über die Währungspolitik herausgelöst und – systemgetreu – dem Titel über das Auswärtige Handeln der Union zugeordnet. Der Sinn des Art. III-326 EVV liegt vor allem darin, verfahrensrechtliche Spezialvorschriften für den Abschluss völkerrechtlicher Übereinkünfte in Währungsfragen festzulegen. Damit enthält Art. III-326 EVV Abweichungen in Bezug auf die Grundnorm des Art. III-325 EVV. Strukturell gesehen werden die Absätze 1, 2, 3 und 5 des Art. 111 EG sinngemäß übernommen. Art. 111 Abs. 4 EG erfährt, wie bereits gezeigt, durch Art. III-196 EVV eine Erweiterung im Sinne einer wirksameren Außenvertretung des Euro. In Art. III-326 EVV werden verschiedene Anhörungsmodalitäten und Vorschlagsrechte geregelt. Der Rat beschließt über Abkommen nach Art. III-326 Abs. 1 EVV einstimmig, bei Übereinkommen nach Art. III-326 Abs. 3 EVV mit qualifizierter Mehrheit.530
529 Vgl. das im Anhang des Verfassungsvertrages zu findende „Protokoll zur Festlegung der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank“. 530 Näher zu den verfahrensrechtlichen Besonderheiten bei Übereinkünften nach Art. III-326 EVV unten, § 10 VII. 6.
314
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
11. Umweltabkommen, Art. III-233 Abs. 4 EVV Zunächst ist festzuhalten, dass der Grundsatz der Kohärenz und der Integration des Umweltschutzes in einer horizontalen Bestimmung (Art. III-119 EVV), die alle Politikbereiche des Teils III der Verfassung betrifft („mainstreaming“), festgelegt worden ist.531 Davon abgesehen ist der Umweltschutz in der Zielbestimmung des Art. I-3 Abs. 3 EVV und sogar in Teil II der Verfassung, nämlich in Art. II-97 EVV, verankert.
a) Art der Zuständigkeit Nach Art. I-14 Abs. 2 lit. e EVV fällt der Bereich des Umweltschutzes in die geteilte Zuständigkeit. Dies gilt grundsätzlich auch für die externen Aspekte der Umweltpolitik. Folglich können die Union und die Mitgliedstaaten in diesem Bereich tätig werden. Die Mitgliedstaaten dürfen ihre Zuständigkeit jedoch nur wahrnehmen, sofern und soweit die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat, Art. I-12 Abs. 2 EVV. Die Regelung spiegelt damit die derzeitige Rechtslage wider, welche nun durch Art. I-14 Abs. 2 lit. e EVV kodifiziert wird.
b) Umfang der Zuständigkeit Der Umfang der Zuständigkeit im Umweltbereich wird von den Art. III-233 ff. EVV bestimmt. Über den Bereich Umwelt gab es im Konvent kaum Diskussionen, sodass es auch zu keinen nennenswerten Änderungen im Vergleich zum EG-Vertrag gekommen ist. Die Vertragsschlusskompetenz nach Art. III-233 Abs. 4 EVV entspricht derjenigen nach Art. 174 Abs. 4 EG. Art. 176 EG wurde in Art. III-234 Abs. 6 EVV überführt, sodass es den Mitgliedstaaten weiterhin möglich ist, verstärkte Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen. Setzt die Union in einem völkerrechtlichen Vertrag bestimmte Standards fest, können die Mitgliedstaaten solche Über531 Der Verfassungsvertrag führt damit die „Tradition“ des Art. 6 EG fort. Eine weitere mainstreaming – Bestimmung findet sich in Art. III-316 EVV (bisher Art. 3 Abs. 2 EG) betreffend die Gleichstellung von Frauen und Männern. Neu eingefügt wurde Art. III-117 EVV (Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie ein hohes Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes) und Art. III-118 EVV (Bekämpfung von Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung). Zu allgemein anwendbaren Bestimmungen „hochgestuft“ wurde der Verbraucherschutz (Art. III-120 EVV, bisher Art. 153 Abs. 2 EG) und der Tierschutz (Art. III-121 EVV, bisher nur im Protokoll betreffend den Schutz der Tiere zu finden).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
315
einkommen treffen, die über die festgelegten Standards (zum Beispiel Grenzwerte) hinausgehen. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Art. 174 EG im Zweiten Teil dieser Arbeit.532
12. Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschung, technologischen Entwicklung und Raumfahrt, Art. III-252 Abs. 4 EVV Der Verfassungsvertrag enthält einige Neuerungen gegenüber den Vorgängerregelungen der Art. 163 ff. EG. Art. III-248 Abs. 1 EVV nennt zum Beispiel erstmals die Schaffung eines Europäischen Raums für Forschung533. Die Vorschrift betont die Notwendigkeit der Freizügigkeit für Forscher; gleichzeitig sollen wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologien frei ausgetauscht werden. Nach Absatz 2 sollen Forscher ungehindert über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten können. Diese Regelungen beziehen sich alle auf eine innereuropäische Zusammenarbeit. Beibehalten werden ebenfalls die mehrjährigen Rahmenprogramme, welche mittels spezifischer Maßnahmen durchgeführt werden. Eine neue Flexibilität schafft Art. III-251 Abs. 4 EVV, wonach ergänzend zu den in einem mehrjährigen Rahmenprogramm vorgesehenen Aktionen, diejenigen Maßnahmen festgelegt werden können, die für die Verwirklichung des Europäischen Raums der Forschung notwendig sind.
a) Art der Zuständigkeit Der Bereich Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt unterfällt nicht dem klassischen Hauptbereich der geteilten Zuständigkeit nach Art. I-14 Abs. 2 EVV. Stattdessen erfährt er eine Sonderregelung in Art. I-14 Abs. 3 EVV. Von der Union erlassene Maßnahmen führen demgemäß nicht dazu, dass die Mitgliedstaaten ihre Zuständigkeit auf den betreffenden Gebieten an die Union verlieren. Damit fällt ein wesentliches Charakteristikum der geteilten Zuständigkeit weg. Die Mitgliedstaaten und die Union können nebeneinander tätig werden, sodass sich der Vergleich mit einer anderen Kompetenzkategorie, nämlich der parallelen Zuständigkeit, aufdrängt, die jedoch vom Verfassungsvertrag nicht explizit genannt oder definiert wird. Kompetenzrechtlich vergleichbar ist der Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und Raumfahrt mit dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe, für den Art. I-14 Abs. 4 EVV dieselben Rechtsfolgen wie Abs. 3 vorsieht.534 Vgl. oben, § 4 III. 3. i). Der Europäische Raum der Forschung wird nochmals in Art. III-251 Abs. 4 EVV erwähnt. 534 Siehe dazu die Ausführungen oben, § 10 II. 9. 532 533
316
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
b) Umfang der Zuständigkeit Die Regelungen, welche die Zusammenarbeit mit Drittländern betreffen, wurden unverändert beibehalten. So sieht Art. III-249 lit. b EVV weiterhin die Zusammenarbeit der Union mit Drittländern vor (bisher Art. 164 lit. b EG), und Art. III-252 Abs. 4 EVV übernimmt nahezu wortgleich die Regelung des Art. 170 EG. Demnach darf die Union wie bisher schon völkerrechtliche Übereinkünfte im Bereich der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschung und technologischen Entwicklung schließen. Vom Wortlaut des Art. III-252 Abs. 4 EVV nicht erfasst ist der neu geschaffene Kompetenztitel über die Raumfahrt, Art. III-254 EVV. Zum einen erwähnt Art. 252 Abs. 4 EVV lediglich die „Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration“, nicht jedoch die Raumfahrt. Zum anderen steht Art. III-254 EVV systematisch hinter Art. III-252 Abs. 4 EVV, sodass die Raumfahrt nicht von dem Verweis „diese Zusammenarbeit“ in Art. III-252 Abs. 4 UAbs. 2 EVV erfasst werden kann. In Art. III-254 EVV selbst ist nicht von weitergehenden internationalen Kooperationen die Rede, es ist lediglich vorgesehen, dass zweckdienliche Verbindungen zur Europäischen Weltraumorganisation hergestellt werden können. Die Möglichkeit, völkerrechtliche Übereinkünfte im Bereich der Raumfahrt schließen zu können, eröffnet in allgemeiner Hinsicht allerdings Art. III-323 EVV. Als Kompetenzgrundlage kann erstens Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV gewählt werden, denn mit Einfügung der Vorschrift des Art. III-254 EVV ist die Durchführung einer europäischen Raumfahrtpolitik ein in der Verfassung festgesetztes Ziel.535 Zweitens ist es möglich, dass die Union mittels eines Europäischen Gesetzes oder Rahmengesetzes zum Beispiel ein Europäisches Raumfahrtprogramm gründet, in dessen Rahmen eine Kooperation mit Drittstaaten vorgesehen ist. In diesem Fall greift Art. III-323 Abs. 1 Var. 3 EVV, denn dann ist eine internationale Zusammenarbeit in einem verbindlichen Rechtsakt der Union vorgesehen. Am Beispiel der Raumfahrtpolitik erkennt man deutlich, wie weitgehend die Vorschrift des Art. III-323 Abs. 1 EVV ist und dass die Union kaum Probleme haben wird, ihre Tatbestandsvoraussetzungen zu erfüllen.536
13. Politik betreffend Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung, Art. III-267 Abs. 3 EVV Nachdem bereits mit den Verträgen von Amsterdam und Nizza wichtige Bereiche der damaligen dritten Säule in den EG-Vertrag überführt worden sind537, sieht Vgl. zu Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV unten, § 10 III. 2. a). So auch CONV 727 / 03, S. 115; hiernach können Inhalt der Maßnahme der Union die Ausarbeitung und Durchführung eines europäischen Raumfahrtprogramms sein, „ohne dass andere Formen des Tätigwerdens (beispielsweise im Bereich der internationalen Zusammenarbeit) ausgeschlossen sind“. 535 536
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
317
nun der Verfassungsvertrag vor, auch den letzten noch in der dritten Säule verbliebenen Bereich, die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, zu vergemeinschaften (Art. III-270 ff. EVV).538 Eine neue Vertragsschlusskompetenz verleiht Art. III-267 Abs. 3 EVV für den Bereich Asyl und Einwanderung, also einem Bereich, der nach geltender Rechtslage in Art. 63 EG zu finden – und damit schon vergemeinschaftet – ist. Art. III-267 Abs. 3 EVV sieht vor, dass die Europäische Union Verträge mit Drittstaaten über die Rückübernahme von Drittstaatsangehörigen in ihr Ursprungs- und Herkunftsland schließen kann, falls diese die Voraussetzungen für die Einreise in das Hoheitsgebiet eines der Mitgliedstaaten oder die Anwesenheit oder den Aufenthalt in diesem Gebiet nicht oder nicht mehr erfüllen.539 Damit findet sich eine explizite Außenkompetenz der Europäischen Union für den Bereich der Einwanderungspolitik im Verfassungsvertrag wieder.
14. Ausdrückliche Kompetenzen der Union zur internationalen Zusammenarbeit a) Öffentliche Gesundheit, Art. III-278 Abs. 3 EVV Art. 152 Abs. 3 EG betreffend die Außenbeziehungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit540 ist nahezu wörtlich541 in den Verfassungsvertrag übernommen worden. Nach wie vor fördert die Union daher die Zusammenarbeit mit Drittländern und den für das Gesundheitswesen zuständigen internationalen Organisationen (Art. III-278 Abs. 3 EVV). Die Handlungsform des völkerrechtlichen Vertrags ist indes nicht genannt. Damit gilt im Gesundheitsbereich die allgemeine Regelung des Art. III-323 EVV bezüglich Vertragsschlusskompetenzen im Außenbereich. 537 Hierbei handelt es sich um den Titel IV des EG-Vertrags, „Visa, Asyl, Einwanderung und andere Politiken betreffend den freien Personenverkehr“, Art. 61 – 69 EG. 538 Es verbleiben zwar noch einige verfahrenstechnische Besonderheiten, etwa ein Initiativrecht für die Mitgliedstaaten (Art I-42 Abs. 3 in Verbindung mit Art. III-264 EVV) oder ein spezifisches Beteiligungs- und Kontrollrecht der nationalen Parlamente (Art. III-259 EVV), zum Beispiel in den Bereichen Eurojust und Europol, diese Sonderregelungen sind jedoch bei weitem nicht so umfassend wie diejenigen, die für den Bereich der GASP gelten. Zu den (auch materiellen) Neuerungen des Konventsentwurfs im Bereich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts vgl. Görlitz, DÖV 2004, 374 (376 ff.). 539 Sinngemäß wird damit die Vorschrift des Konventsentwurfs übernommen (vgl. Art. III-168 III KE-EVV), wobei der unschöne Ausdruck „illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger“ durch die grammatikalisch bessere und genauere oben wiedergegebene Formulierung ersetzt worden ist. 540 Im EG-Vertrag ist der Bereich mit „Gesundheitswesen“ statt mit „Öffentlicher Gesundheit“ betitelt, ebenso im Konventsentwurf. 541 Das Wort „Gemeinschaft“ wurde durch „Union“ ersetzt und die Worte „mit dritten Ländern“ durch „mit Drittländern“.
318
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Soweit dort auf die in der Verfassung festgesetzten Ziele Bezug genommen wird, sind vor allem die in Art. III-278 Abs. 1 EVV festgelegten Ziele zu beachten. Übernahm der Konventsentwurf noch größtenteils den Wortlaut des Art. 152 Abs. 1 EG542, so hat die Regierungskonferenz zahlreiche Erweiterungen und Änderungen im Rahmen des Art. III-278 EVV vorgenommen. Neben der Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, der Verhütung von menschlichen Krankheiten und der Beseitigung von Ursachen für die Gefährdung der körperlichen und geistigen Gesundheit wurde unter Art. III-278 Abs. 1 lit. b EVV die Beobachtung, frühzeitige Meldung und Bekämpfung schwerwiegender grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren neu in den Zielkatalog aufgenommen. Damit wird die Bekämpfung länderübergreifender Gesundheitsprobleme wie zum Beispiel SARS oder Bioterrorismus ermöglicht.543 Zu beachten ist dabei, dass die öffentliche Gesundheit – bis auf die Maßnahmen nach Art. III-278 Abs. 4 EVV544 – gemäß Art. I-17 lit. a EVV in die Kompetenzkategorie der Unterstützung-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen fällt.545 Die Union kann also völkerrechtliche Übereinkünfte schließen, welche die Politik der Mitgliedstaaten ergänzen und im Rahmen der Ziele nach Art. III-278 Abs. 1 EVV liegen.
b) Bereiche mit geteilter Zuständigkeit im öffentlichen Gesundheitssektor, Art. III-278 Abs. 4 EVV Abweichend von Art. I-17 lit. a EVV unterfällt gemäß Art. III-278 Abs. 4 EVV und Art. I-14 Abs. 2 lit. k EVV der Teil des Gesundheitswesens, der gemeinsame Sicherheitsanliegen betrifft, der geteilten Zuständigkeit der Union. Auch hier hat sich im Vergleich zum EG-Vertrag und zum Konventsentwurf eine Erweiterung des Zuständigkeitsbereiches ergeben. Zu den bisherigen Fallgruppen sind jene Bereiche des Art. III-278 Abs. 4 lit. c und d EVV hinzugekommen, so dass die Union auch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze zur Festlegung hoher Qualitätsund Sicherheitsstandards für Arzneimittel und Medizinprodukte sowie zur Beobachtung, frühzeitigen Meldung und Bekämpfung schwerwiegender grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren erlassen kann. Auch in diesem Bereich kann die Union völkerrechtliche Verträge nach Art. III-323 EVV schließen.
Vgl. Art. III-179 KE-EVV. Lenz / Borchardt, Vertrag über eine Verfassung für Europa, Einführung, S. 23. 544 Vgl. diesbezüglich Art. I-14 Abs. 2 lit. k EVV. 545 Vgl. auch die Einordnung der Öffentlichen Gesundheit in Titel III Kapitel V des Teils III der Verfassung (Art. III-278 ff. EVV). 542 543
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
319
c) Kultur, Art. III-280 Abs. 3 EVV Der gesamte Art. III-280 EVV entspricht nahezu wörtlich dem bisherigen Art. 151 EG. Der Umfang der europäischen Kulturpolitik ist demnach unverändert geblieben. Allerdings wird das Einstimmigkeitserfordernis des Art. 151 Abs. 5 EG im Verfassungsvertrag nicht aufgegriffen. In Zukunft können daher Fördermaßnahmen im kulturellen Bereich mit qualifizierter Mehrheit erlassen werden. Hinsichtlich der Außenkompetenz besteht weiterhin die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Organisationen, insbesondere dem Europarat (Art. III-280 Abs. 3 EVV). Völkerrechtliche Verträge im Kulturbereich können geschlossen werden, wenn die Voraussetzungen des Art. III-323 EVV vorliegen. Entsprechend den Kompetenzen im Gesundheitsbereich gilt auch hier, dass lediglich Ergänzungs- und Unterstützungsmaßnahmen zulässig sind. Dies ergibt sich zum einen aus Art. I-17 lit. c EVV und zum anderen aus der systematischen Stellung innerhalb des Verfassungsvertrages (Teil III, Titel III, Kapitel V). Da nach dem Verfassungsvertrag für interne Maßnahmen die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit nun möglich ist, gilt dies auch für den Abschluss völkerrechtlicher Übereinkünfte.
d) Allgemeine Bildung, Jugend, Sport und berufliche Bildung, Art. III-282 Abs. 2 und III-283 Abs. 2 EVV Im Vergleich zu Art. 149 und 150 EG ist vor allem erwähnenswert, dass der Bereich Sport mit in den die allgemeine und berufliche Bildung und die Jugend betreffenden Abschnitt 5 des Teils III, Titel III, Kapitel V aufgenommen wurde.546 Nach Art. III-282 Abs. 1 UAbs. 2 und UAbs. 3 lit. g EVV trägt die Union zur Förderung der europäischen Aspekte des Sports bei und fördert die Entwicklung der europäischen Dimension des Sports. Diese Vorschrift ist auf die grenzüberschreitenden Auswirkungen zu beschränken, die ein Handeln auf europäischer Ebene rechtfertigen, da die Freizügigkeit der Sportler unter die Bestimmungen über den Binnenmarkt fällt.547 Ansonsten hat sich an den bisherigen Kompetenzen nichts geändert, lediglich Art. III-283 Abs. 3 EVV ist der Struktur des Art. III-282 Abs. 3 EVV (und der des Art. III-280 Abs. 5 EVV) angepasst worden. Hinsichtlich der internationalen Zusammenarbeit verbleibt es bei der Zusammenarbeit einer546 Eine ähnliche Vorschrift ist bereits im Konventsentwurf enthalten (Art. III-182 KE-EVV). Dies verwundert angesichts des Abschlussberichts der Arbeitsgruppe „Ergänzende Zuständigkeiten“, wonach der Vorschlag, die Annahme unterstützender Maßnahmen für den internationalen Sport vorzusehen, „keine große Zustimmung“ fand, vgl. CONV 375 / 1 / 02 REV 1, S. 9. Im weiteren Verlauf des Konvents hielt es das Präsidium jedoch für angezeigt, einen Hinweis beziehungsweise eine Rechtsgrundlage für den Sport zu schaffen, „da es sich beim Sport um einen Aspekt dieses umfassenden Bereichs [Bildung und Jugend] handelt“, CONV 727 / 03, S. 109. 547 CONV 727 / 03, S. 109.
320
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
seits mit Drittländern, andererseits mit den für den Bildungsbereich und die berufliche Bildung zuständigen internationalen Organisationen. Hervorzuheben ist jedoch, dass auch die Zusammenarbeit mit den für den Sport zuständigen internationalen Organisationen in Art. III-282 Abs. 2 EVV aufgenommen worden ist.548 Hieraus könnte sich eine internationale Zusammenarbeit zwischen der Union und internationalen Organisationen oder Drittländern bei der Bekämpfung des Dopings entwickeln. Völkerrechtliche Verträge sind wiederum nach der allgemeinen Vorschrift des Art. III-323 EVV möglich. Für den Bereich der allgemeinen Bildung, Jugend, Sport und beruflichen Bildung gilt angesichts von Art. I-17 lit. e EVV das zu Art. III-278 und III-280 EVV Gesagte.
e) Katastrophenschutz, Art. III-284 Abs. 1 UAbs. 2 lit. c EVV Mit Art. III-284 EVV ist erstmals ein ausführlicher Artikel über den Katastrophenschutz im europäischen Primärrecht verankert worden. Zwar sind bisher in Art. 3 Abs. 1 lit. u EG auch Maßnahmen im Bereich des Katastrophenschutzes im EG-Vertrag enthalten, doch entspricht dieser Zielvorstellung keine konkretisierende Ermächtigungsnorm im Vertrag. Die Arbeitsgruppe „Ergänzende Zuständigkeiten“ empfahl, um den wiederholten Rückgriff auf Art. 308 EG zu vermeiden, spezifische Rechtsgrundlagen für diesen Bereich im Vertrag zu schaffen, falls die Union hier weiterhin tätig sein will.549 Dieser Empfehlung wurde mit der Einfügung des Art. III-284 EVV Rechnung getragen, sodass Art und Umfang der Kompetenz nun aus dem Verfassungsvertrag hervorgeht. Art. III-284 EVV ist primär auf die bessere Zusammenarbeit innerhalb der Union ausgerichtet. Allerdings bestimmt Art. III-284 Abs. 1 UAbs. 2 lit. c EVV, dass ein Ziel der Union auch die Verbesserung der Kohärenz der Katastrophenschutzmaßnahmen auf internationaler Ebene ist. Diese Zielbestimmung ermächtigt die Union in Verbindung mit Art. III-323 EVV auch zum Abschluss internationaler Übereinkommen, sofern der Inhalt der Abkommen unterstützende oder ergänzende Maßnahmen vorsieht. Nach Art. I-17 lit. f EVV ist der Katastrophenschutz nämlich ein Bereich, in dem lediglich Unterstützungs-, Ergänzungs- und Koordinierungsmaßnahmen zulässig sind. Für den Bereich Katastrophenschutz gilt gemäß Art. III-284 Abs. 2 EVV das normale Gesetzgebungsverfahren (mit Ausnahme allerdings von Harmonisierungsmaßnahmen). Gemäß Art. III-325 Abs. 8 EVV gilt dies dann auch für den Abschluss internationaler Übereinkünfte. 548 Die Zusammenarbeit mit internationalen Sportorganisationen war im Konventsentwurf noch nicht vorgesehen, obwohl die Entwicklung einer europäischen Dimension des Sports bereits in Art. III-182 Abs. 1 UAbs. 2 und Abs. 2 lit. g KE-EVV ausdrücklich genannt war, vgl. Art. III-182 Abs. 3 KE-EVV. 549 CONV 375 / 1 / 02 REV 1, S. 15.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
321
Art. III-284 EVV ist in Zusammenhang mit der Solidaritätsklausel nach Art. I-43 EVV und den Durchführungsmaßnahmen nach Art. III-329 EVV zu sehen. Dieser zweifache Ansatz hat zur Folge, dass – wie gerade angesprochen – im Rahmen des Art. III-284 EVV das einfache Gesetzgebungsverfahren gilt, währenddessen im Rahmen der Solidaritätsklausel aufgrund des Rückgriffs auf militärische Mittel dem Außenminister der Union eine tragende Rolle zugewiesen worden ist.550 f) Transeuropäische Netze, Art. III-247 Abs. 4 EVV Anders als die gerade unter den Gliederungspunkten a bis e genannten Bereiche fällt der Bereich der transeuropäischen Netze nicht unter Art. I-17 EVV, sondern in die geteilte Zuständigkeit der Union (Art. I-14 Abs. 2 lit. h EVV). Im Vergleich zur Rechtslage nach dem EG-Vertrag (Art. 154 bis 156 EG) sind die ehemals drei Vorschriften zu zwei Vorschriften verschmolzen worden. Inhaltlich haben sich jedoch keine Änderungen ergeben. Zur Ausgestaltung der Außenbeziehungen der Union können weiterhin Kooperationen mit Drittländern eingegangen werden, wenn dies der Förderung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse sowie zur Sicherstellung der Interoperabilität der Netze dient, Art. III-247 Abs. 4 EVV. Neben dieser Zusammenarbeit können, insbesondere in Bezug auf die Außengrenzen der Union, gemäß Art. III-246 EVV und Art. III-323 EVV internationale Abkommen zur Sicherstellung der Interoperabilität der Netze in den Bereichen der Verkehrs-, Telekommunikations- und Energieinfrastruktur geschlossen werden. Die Beschlussfassung erfolgt gemäß Art. III-247 Abs. 2 EVV mit qualifizierter Mehrheit. g) Verkehr, Art. III-236 Abs. 2 lit. a EVV Die Art. 70 ff. EG wurden durch den Verfassungsvertrag nicht wesentlich umgestaltet. Wie bereits bisher551 gehört der Bereich Verkehr zur geteilten Zuständigkeit der Union (Art. I-14 Abs. 2 lit. g EVV). Art. III-236 Abs. 2 lit. a EVV enthält (wie schon Art. 71 Abs. 1 lit. a EG) die Ermächtigung, durch interne Maßnahmen – nach dem Verfassungsvertrag sind es Europäische Gesetze oder Rahmengesetze – gemeinsame Regelungen für den internationalen Verkehr aus oder nach dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder für den Durchgangsverkehr durch das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten aufzustellen. Im genannten Artikel ist weder die Ermächtigung zur internationalen Zusammenarbeit noch zum Vertragsabschluss enthalten. Will die Union daher externe Abkommen über die Verkehrspolitik schließen, muss sie auf die allgemeine Vorschrift des Art. III-323 EVV Rückgriff nehmen.552 CONV 727 / 03, S. 111. Vgl. nur das Arbeitspapier des Präsidiums des Konvents zu den gegenwärtigen Außenkompetenzen der Gemeinschaft, CONV 161 / 02, S. 5 (Rdnr. 13). 550 551
21 Metz
322
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
h) Andere, neu in die Verfassung aufgenommene Bereiche Neben dem bereits oben beschriebenen Katastrophenschutz wurden weitere Bereiche in den Verfassungsvertrag neu aufgenommen. Es ist dies zum einen der Sektor Energie (Art. III-256 EVV553) und zum anderen der Sektor Tourismus (Art. III-281 EVV554). Beide Bereiche waren bisher schon in der Zielbestimmung des Art. 3 Abs. 1 lit. u EG genannt, jedoch nicht weiter im EG-Vertrag mit Leben ausgefüllt worden. Die Folge war, dass die Gemeinschaft immer öfter auf die Flexibilitätsklausel des Art. 308 EG zurückgriff.555 Um diesen Mechanismus zu durchbrechen und um mehr Rechtssicherheit in diesem Bereich zu gewährleisten, wurden in Teil III der Verfassung besondere Bestimmungen über den Umfang der jeweiligen Kompetenz aufgenommen.556 Während der Bereich Energie unter die geteilte Zuständigkeit nach Art. I-14 Abs. 2 lit. i EVV fällt, sind im Bereich Tourismus lediglich Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen zulässig (Art. I-17 lit. d EVV). Weder Art. III-256 EVV noch Art. III-281 EVV enthalten Bestimmungen über die Außenkompetenzen der Union. Will die Union insoweit internationale Abkommen schließen, müssen die Voraussetzungen des Art. III-323 EVV erfüllt sein.557
552 Vgl. zur bisherigen impliziten Außenkompetenz im Verkehrsbereich grundlegend EuGH, Slg. 1971, 263 ff. – AETR. 553 Förderung des Zugangs zur öffentlichen Versorgung, der Versorgungssicherheit, der Entwicklung erneuerbarer Energiequellen und von Energieeinsparungen. Dabei deckt die Rechtsgrundlage die Maßnahmen ab, die bislang von der Gemeinschaft vorgenommen worden sind, „ohne dabei eine zu starke Detailgenauigkeit aufzuweisen, die nicht gewünscht wird“, CONV 727 / 03, S. 110. 554 Schaffung eines „günstigen Umfelds“ für die Entwicklung von Unternehmen im Tourismussektor. 555 CONV 47 / 02, S. 8; Energiepolitische Maßnahmen wurden des Weiteren auf Rechtsgrundlagen des Wettbewerbs- und Umweltrechts, auf die Binnenmarktkompetenz des Art. 95 EG oder auf Bestimmungen des Politikbereichs „Transeuropäische Netze“ gestützt, vgl. Görlitz, DÖV 2004, 374 (380). 556 Der Konvent fügte eine besondere Kompetenzbestimmung bezüglich des Tourismus in den Konventsentwurf ein, obwohl laut dem Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Ergänzende Zuständigkeiten“ ein „weitgehendes Einvernehmen darüber [bestand], dass es keinen gesonderten Vertragsartikel geben sollte“, CONV 375 / 1 / 02 REV 1, S. 15. 557 Was den ebenfalls neu in den Verfassungsvertrag aufgenommenen Art. III-285 EVV über die Verwaltungszusammenarbeit betrifft, ist nicht ersichtlich, wie hier eine Außenkompetenz in Betracht kommen könnte, da es sich per se um eine innergemeinschaftliche Zusammenarbeit handelt. Im Übrigen fällt die Verwaltungszusammenarbeit unter die Ergänzungsmaßnahmen nach Art. I-17 lit. g EVV.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
323
i) Beziehungen zu internationalen Organisationen und Drittländern; Delegationen der Union, Art. III-327 und III-328 EVV Anders als die oben unter den Gliederungspunkten a bis h aufgeführten Bereiche wurde das Kapitel, welches die Beziehungen der Union zu internationalen Organisationen und Drittländern sowie die Delegationen der Union betrifft, in Titel V des Verfassungsvertrages (Auswärtiges Handeln der Union) eingegliedert. aa) Vollmitgliedschaft der Union in Internationalen Organisationen Wie oben bereits beschrieben hat die der Europäischen Union durch den Verfassungsvertrag verliehene Rechtspersönlichkeit keinen unmittelbaren Einfluss auf den Status der Union in internationalen Organisationen.558 In solchen Organisationen, in denen die Gemeinschaft bisher Mitglied ist, wird die Europäische Union deren Nachfolge antreten. In denjenigen Organisationen, in denen die Gemeinschaft bisher noch nicht Mitglied ist, besteht nun die Möglichkeit einer Mitgliedschaft der gesamten Europäischen Union. Weiterhin bestehen bleibt jedoch das Problem, dass Satzungen einiger Organisationen nur die Mitgliedschaft von Staaten vorsehen. Da die Europäische Union aber kein Staat im völkerrechtlichen Sinne ist, wird ihr die Mitgliedschaft in diesen Organisationen weiterhin verwehrt sein. Die Arbeitsgruppe „Außenbeziehungen“ empfahl, dass sich die Union gegebenenfalls um Satzungsänderungen von internationalen Organisationen bemühen sollte, damit eine Mitgliedschaft der Union ermöglicht werde.559 Weiterhin solle die Union einen formalen Status oder möglichst die Vollmitgliedschaft in den einschlägigen Sonderorganisationen anstreben – so die Empfehlungen der Arbeitsgruppe.560 bb) Auswirkungen auf den Status der Mitgliedstaaten Durch die Mitgliedschaft der Union in internationalen Organisationen wird die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten als Völkerrechtssubjekte und ihr Status in internationalen Organisationen nicht berührt. cc) Umfang und Umsetzung der Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen Der Verfassungsvertrag fasst die bisherigen Art. 302 bis 304 EG in einer einzigen Bestimmung, nämlich in Art. III-327 EVV zusammen. Den Umfang der Zu558 559 560
21*
Vgl. oben, § 8 III. 7. CONV 459 / 02, S. 10. CONV 459 / 02, S. 10.
324
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
sammenarbeit betreffend, sind kaum Änderungen festzustellen. Nach wie vor werden explizit die Beziehungen zu den Organen der Vereinten Nationen561, zum Europarat und zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) genannt. Die Zusammenarbeit mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wird erstmals ausdrücklich genannt. Diese Bezugnahme wurde angefügt aufgrund der Beziehungen, die die Union bisher bei der Entwicklung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik hergestellt hat.562 Über die genannte Zusammenarbeit hinaus sind auch Beziehungen zu anderen internationalen Organisationen möglich, soweit diese zweckmäßig sind (Art. III-327 Abs. 1 UAbs. 2 EVV). Der Vorschlag aus den Reihen des Konvents, nähere Ausführungen zur Gestaltung der Vertretung der Union in internationalen Organisationen und in ihren Beziehungen zu Drittländern zu machen, wurde vom Präsidium mit der Begründung abgelehnt, dass dies nicht notwendig sei und detailliertere Bestimmungen in vielen Fällen nur den Verwaltungsaufbau beträfen.563 Die einheitliche Vertretung der Euro-Zone in den internationalen Finanzinstituten wird – systematisch richtig – speziell in Kapitel II über die Wirtschafts- und Währungspolitik im Rahmen der besonderen Bestimmungen für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, geregelt (Art. III-196 EVV).564 Die Durchführung der genannten Zusammenarbeit obliegt nicht mehr nur der Kommission, sondern auch dem Außenminister der Union. Die derzeitige Situation in bilateralen Beziehungen im Rahmen des politischen Dialogs ist insofern unbefriedigend, als der Standpunkt der Union durch zu viele Personen (Vorsitz, Hoher Vertreter, Troika, Kommission, Mitgliedstaaten) zum Ausdruck gebracht wird.565 Um eine Verbesserung der derzeitigen Regelungen im Sinne von mehr Klarheit zu erreichen, wurde die diplomatische Vertretung der Union im Wesentlichen in die Hände des Außenministers gelegt. Dies soll dazu beitragen, dass die Union weltweit besser wahrgenommen wird und ihr Auftreten an Eindeutigkeit und Kontinuität gewinnt.
dd) Die Delegationen der Union In Art. III-328 EVV wird erstmals detailliert geregelt, wer die Außenvertretung der Union in Drittstaaten und bei internationalen Organisationen wahrnimmt. Es 561 Der Zusatz „und denen der VN-Sonderorganisationen“ ist lediglich eine sprachliche Klarstellung. Die Gemeinschaft unterhält bereits heute Beziehungen auch zu den VN-Sonderorganisationen. 562 CONV 685 / 03, S. 71. 563 CONV 727 / 03, S. 56. 564 Vgl. dazu bereits oben, § 10 II. 11. b) aa). 565 CONV 459 / 02, S. 32 (Rdnr. 67).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
325
sollen dies die Delegationen der Union sein, die der Leitung des Außenministers der Union unterstellt sind. Bereits heute unterhält die Kommission Delegationen in zahlreichen Drittländern und bei vielen internationalen Organisationen. Mit dem Verfassungsvertrag finden diese Delegationen erstmals Erwähnung im Primärrecht. Nach dem Verfassungsvertrag sind es Delegationen „der Union“, derzeit werden sie als Delegationen „der Kommission“ bezeichnet.566 Diese neue Bezeichnung ist Folge der Völkerrechtspersönlichkeit der Europäischen Union und als Konsequenz des Bestrebens nach einer transparenteren und kohärenteren Außenvertretung der Union anzusehen. Dass die Vertretungen der Union „Delegationen“ und nicht „Botschaften“ der Union heißen, macht wiederum den supranationalen Charakter der Europäischen Union deutlich, die im völkerrechtlichen Sinne kein „Staat“ ist. In funktioneller Hinsicht jedoch ist die Tätigkeit der Delegationen durchaus mit der Tätigkeit von Botschaften zu vergleichen. Künftig könnten die Delegationen der Union damit beauftragt werden, den Dienst für die Mitgliedstaaten zu versehen, die in dem betreffenden Land über keine eigene Vertretung verfügen.567 Die Missionen der Mitgliedstaaten könnten ferner verpflichtet werden, mit den EU-Delegationen zusammenzuarbeiten und den Außenminister der Union zu unterstützen und mit Informationen zu versorgen. Mit welchen zusätzlichen Aufgaben die Delegationen in Zukunft betraut werden, regelt der Verfassungsvertrag nicht; es bleibt der Rechtsentwicklung in der Europäischen Union überlassen, welche Aufgaben die Mitgliedstaaten von ihren eigenen diplomatischen Vertretungen auf die Delegationen der Union übertragen wollen.
ee) Einrichtung eines Europäischen Auswärtigen Dienstes, Art. III-296 Abs. 3 EVV Eng mit den Delegationen der Union verknüpft ist die Frage nach der Einrichtung eines Europäischen Auswärtigen Dienstes.568 Ein solcher Dienst wurde von der Arbeitsgruppe „Außenbeziehungen“ vorgeschlagen569 und fand zunächst als 566 Die Umwandlung der derzeitigen Außenstellen der Kommission in EU-Außenstellen entspricht den Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Außenbeziehungen“, vgl. CONV 459 / 02, S. 33 (Rdnr. 69). 567 Im Rahmen der derzeitigen Regeln über die Unionsbürgerschaft müssen die Mitgliedstaaten untereinander nach Art. 20 EG jedem Unionsbürger diplomatischen und konsularischen Schutz gewähren. Hiernach genießt jeder Unionsbürger im Hoheitsgebiet eines dritten Landes, in dem der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, nicht vertreten ist, den diplomatischen und konsularischen Schutz eines jeden Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen wie die Staatsangehörige dieses Staates. Vgl. hierzu den Beschluss der im Rat vereinigten Vertreter der Mitgliedstaaten vom 19. 12. 1995 über den Schutz der Bürger der Europäischen Union durch die diplomatischen und konsularischen Vertretungen (95 / 553 / EG, ABl. L 314, 73). 568 Engl.: European External Action Service, (EEAS). 569 CONV 459 / 02, S. 33 (Rdnr. 69).
326
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
„Erklärung über die Einrichtung eines Europäischen Auswärtigen Dienstes“ Eingang in den Konventsentwurf. Die Regierungskonferenz hat schließlich klargestellt, dass sich der Europäische Außenminister bei der Erfüllung seines Auftrags auf einen Europäischen Auswärtigen Dienst stützen kann. Der Verweis auf eine Erklärung im Anhang an die Verfassung wurde gestrichen. Stattdessen werden mit Art. III-296 Abs. 3 EVV die erforderlichen Regelungen direkt im Verfassungsvertrag verankert. Der Dienst soll sich aus Beamten aus den einschlägigen Abteilungen des Generalsekretariats des Rates und der Kommission sowie abgeordnetem Personal der nationalen diplomatischen Dienste zusammensetzen. Durch die zeitlich befristete Entsendung von Mitarbeitern der nationalen diplomatischen Dienste soll die Synergie mit den Mitgliedstaaten verstärkt und die Fähigkeit zur politischen Analyse weiter ausgebaut werden.570 Der Europäische Auswärtige Dienst arbeitet mit den diplomatischen Diensten der Mitgliedstaaten zusammen. Weitere Regelungen über die Organisation und die Arbeitsweise des Dienstes legt der Rat mittels eines Europäischen Beschlusses fest.571 Idealerweise soll durch die Zusammenarbeit der drei genannten Säulen ein Synergieeffekt erzielt werden, ohne dass dabei die jeweiligen Institutionen abgeschafft oder verschmolzen würden.572 Mit der Zusammensetzung des Europäischen Auswärtigen Dienstes könnte andererseits aber auch der Keim eines neuen interinstitutionellen Konflikts angelegt sein.573 Mit der Einrichtung eines Europäischen Auswärtigen Dienstes wird dem Außenminister der Union ein ausreichender Mitarbeiterstab in Brüssel zur Verfügung gestellt. Der übergeordnete Leitgedanke bei der Einrichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes ist, dass der Außenminister mit Hilfe des Dienstes eine kohärente Außenpolitik der Union sicherstellen kann. Die Zusammenlegung der außenpolitischen Generaldirektionen des Generalsekretariates des Rates und der Kommission ist eine entscheidende Voraussetzung für die Durchführbarkeit einer kohärenten europäischen Außenpolitik.574 Durch die Zusammenlegung können die vorhandenen Ressourcen optimiert werden.575 Außerdem kann eine größere Einheitlichkeit bei der Vertretung von Interessen und Werten erzielt werden.576 Bei der Ausgestaltung des Europäischen Auswärtigen CONV 459 / 02, S. 31 (Rdnr. 64). Der Konventsentwurf enthielt neben ähnlich lautenden Bestimmungen noch den Hinweis, dass das Personal der Delegationen der Union aus diesem Dienst bereitgestellt wird. Ferner war der Konvent der Ansicht, dass die erforderlichen Vorkehrungen für die Einrichtung des gemeinsamen Dienstes innerhalb des ersten Jahres nach Inkrafttreten des Vertrags über eine Verfassung für Europa getroffen werden sollten, vgl. ABl. 2003 C 169, 99. 572 Thym, ELJ 2004, 5 (18). 573 Kadelbach, in: Hofmann / Zimmermann, Eine Verfassung für Europa, S. 146 (158). 574 Risse, Integration 2003, 564 (567). 575 Derzeit unterstehen knapp 300 Mitarbeiter dem Hohen Vertreter, die Kommission hat in ihren außen- und entwicklungspolitischen Dienststellen und Büros in 123 Ländern der Welt weitaus mehr Man-Power, Süddeutsche Zeitung vom 17. 01. 2005, Seite 3. 570 571
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
327
Dienstes wird noch entschieden werden müssen, ob es sich um eine neu zu schaffende Institution auf Ratsseite (europäisches Außenministerium) oder um eine institutionelle Verflechtung mit Schwerpunkt auf Kommissionsseite handeln wird.577 Je nach Interessenlage wird daher gewarnt, eine Ansiedelung des Dienstes zwischen beiden Institutionen könne zu einer „unabhängigen Super-Administration“ führen, die ein „unkontrollierbares Eigenleben“ entwickele. Die Kommission müsse voll einbezogen werden; andernfalls verkomme sie zu einem „Binnenmarktsekretariat“.578 Eine vollständige Verlagerung auf die Kommission ist jedoch ausgeschlossen, da in der Außen- und Sicherheitspolitik viele Bereiche noch in der intergouvernementalen Sphäre liegen. Es ist davon auszugehen, dass es bezüglich der Positionierung des Dienstes zu einem Kompromiss kommen und das Personal in einem relativ ausgewogenen Verhältnis aus den drei genannten Institutionen stammen wird.579 Bereits seit Ende 2004 sind die praktischen Vorbereitungen zur Planung des Europäischen Auswärtigen Dienstes angelaufen. Es zeichnet sich ab, dass die drei beteiligten Institutionen um möglichst viel Einfluss streiten. Der Verfassungsvertrag selbst gibt keine näheren Anhaltspunkte, wie der Dienst letztendlich zu gestalten ist.580 Schon jetzt besteht allerdings Konsens, dass es nicht zu einer Verdoppelung von Dienststellen kommen soll. Insgesamt werden 5000 bis 7000 Menschen im Auswärtigen Dienst der Union beschäftigt sein.581 Aufgrund der Inhomogenität des Personals des Dienstes werden verschiedene Maßnahmen notwendig sein, etwa die Gründung einer Europäischen Diplomatenschule. So wird für Europäische Beamte eine Schulung in Diplomatie notwendig sein, für die Diplomaten aus den Mitgliedstaaten eine Fortbildung im Bereich europäische Angelegenheiten. Bis November 2006 – dem angenommenen Datum des Inkrafttretens des Verfassungsvertrages – sollen ein Statut und ein Organigramm des Dienstes aufgestellt sein. Zur Begründung des Europäischen Auswärtigen Dienstes ist zunächst ein Vorschlag des Außenministers der Union erforderlich, welcher durch einstimmigen Ratsbeschluss angenommen werden muss. Zuvor ist das Europäische Parlament zu konsultieren, und die Zustimmung der Kommission ist ebenfalls erforderlich.582 Das Europäische Parlament hat ebenfalls ein Wort mitzureden, weil ihm das Budgetrecht über die Verwaltungsausgaben des Rates und der Kommission zusteht. WG VII – WD 51, S. 3 (Danuta Hübner). Jopp / Regelsberger, Integration 2003, 550 (560). 578 Vgl. zu den verschiedenen Argumenten euobserver vom 28. 02. 2005. 579 So auch die Forderung des Europäischen Parlaments, vgl. den Draft Report des Europäischen Parlaments vom 22. 02. 2005 (2004 / 2207(INI)), S. 6, 8 f. 580 Ratsexperten merkten deshalb an, es bestehe „some margin for manœuvre“, vgl. euobserver vom 16. 03. 2005. 581 Vgl. euobserver vom 28. 02. 2005. 582 Vgl. den Draft Report des Europäischen Parlaments vom 22. 02. 2005 (2004 / 2207 (INI)), S. 5. 576 577
328
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Auch wenn in absehbarer Zukunft die meisten nationalen Botschaften erhalten bleiben werden, besteht die Möglichkeit, dass einige kleinere Staaten künftig (zumindest in Teilbereichen) Verantwortung den EU-Delegationen übertragen oder nur noch konsularische Dienste ausüben werden. Über die besondere Bedeutung des Europäischen Auswärtigen Dienstes besteht jedoch kein Zweifel.583
15. Außenkompetenzen aus Teil I der Verfassung Abweichend von dem oben beschriebenen System, wonach bestimmte Politikbereiche in Teil I der Verfassung einer Kompetenzkategorie zugeordnet werden und die nähere Umschreibung der Kompetenzen in Teil III der Verfassung erfolgt, existieren zwei Außenkompetenzen, die vollumfänglich in Teil I der Verfassung ausgestaltet werden.
a) Beitritt zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte, Art. I-9 Abs. 2 EVV Art. I-9 Abs. 2 EVV enthält einen doppelten Anachronismus. Zum einen wird im Teil I des Verfassungsvertrages eine spezielle Vertragsschlussermächtigung eingeräumt, anstatt dem System entsprechend die Kompetenzgrundlage in Teil III der Verfassung zu stellen. Zum anderen handelt es sich bei Art. I-9 Abs. 2 EVV nicht nur um eine Ermächtigungsgrundlage, sondern sogar um eine Pflicht zum Abschluss eines völkerrechtlichen Übereinkommens; die Europäische Union wird verpflichtet, der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte beizutreten. Eine solche Verpflichtung zum Beitritt war nach dem Konventsentwurf nicht vorgesehen, stattdessen sollte die Union einen solchen Beitritt lediglich „anstreben“ (Art. I-7 Abs. 2 KE-EVV). Im Vergleich zu anderen Außenkompetenzen stellt Art. I-9 Abs. 2 EVV mit seiner Abschlusspflicht einen einzigartigen Sonderfall dar. Die Kompetenz zum Beitritt zur EMRK steht der Gemeinschaft nach derzeitigem Recht (nämlich allein auf der Grundlage des Art. 308 EG) nach ausdrücklicher Stellungnahme des EuGH nicht zu.584 Allerdings sieht Art. 17 des 14. Zusatzprotokolls zur EMRK vor, Art. 59 EMRK um einen Absatz 2 zu ergänzen, welcher ausdrücklich den Beitritt der Europäischen Union ermöglicht.585 Mit die583 „It will be much more important to be the EU ambassador than a national ambassador“, so ein ehemaliger Ratsdirektor, euobserver vom 16. 03. 2005. 584 Vgl. EuGH, Slg. 1996, I-1759 (1762, 1787 ff.) – Gutachten 2 / 94, EMRK und Görlitz, DÖV 2004, 374 (380). 585 Das 14. Zusatzprotokoll wurde am 12. Mai 2004 vom Ministerkomitee beschlossen und am 13. Mai 2004 in Straßburg zur Unterzeichnung aufgelegt; bisher ist es noch nicht in Kraft getreten, da noch nicht alle Mitgliedstaaten das Protokoll ratifiziert haben.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
329
ser Änderung wurde nicht nur der Weg für einen Beitritt der Union geebnet, sondern gewissermaßen schon vorgezeichnet. Der Verfassungsvertrag nimmt diesen Faden konsequent auf, legt aber andererseits eindeutig fest, dass der Beitritt zur Konvention nicht die in der Verfassung festgelegten Zuständigkeiten der Union ändert. Schließlich ist auf das Protokoll zu Art. I-9 Abs. 2 der Verfassung über den Beitritt der Union zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuweisen. Nach Art. 2 des Protokolls soll in der Übereinkunft über den Beitritt insbesondere sichergestellt werden, dass der Beitritt der Union die Zuständigkeiten der Union und die Befugnisse ihrer Organe unberührt lässt. b) Die Union und ihre Nachbarn, Art. I-57 EVV Mit der Erweiterung der Union von 15 auf 25 Mitgliedstaaten stellt sich immer deutlicher die Frage, wo letztlich die Grenzen der Europäischen Union liegen.586 Der Verfassungsvertrag muss daher das Beitrittsverfahren und mögliche besondere Beziehungen zu den nahen Nachbarn der Union regeln. Vor Europas Türen stehen Bulgarien, Rumänien, die jugoslawischen Nachfolgestaaten587 und die Türkei. Auch Island, Norwegen und die Schweiz bleiben potenzielle Beitrittsstaaten. Geografisch gehören die Ukraine, Weißrussland und größere Teile Russlands ebenfalls zu Europa.588 Allerdings setzen Wirtschaft und Demographie der Beitrittsfähigkeit der Union Grenzen.589 Um unabhängig von einer Beitrittsperspektive mit den genannten Ländern gutnachbarschaftliche Beziehungen im Geiste der Werte der Union eingehen zu können, sieht der Verfassungsvertrag eine neue Rechtsgrundlage für solche Abkommen vor. Diese Abkommen sind als neue Form dauerhafter Assoziierung ohne Beitrittsperspektive zu verstehen.590 Mit Art. I-57 EVV wird ein lockerer, aber kohärenter Rahmen für die Beziehungen der Union zu ihren Nachbarländern geschaffen. Der Artikel begründet keine neuen Verpflichtungen, erkennt jedoch erstmals die Bedeutung der Nachbarstaaten für die Union an.591 Die Union unterhält bereits jetzt vertragliche Beziehungen zu den meisten ihrer unmittelbaren Nachbarstaaten.592 Auch wenn in den derzeitigen Verträgen keine vergleichbare Vorschrift aufzufinden ist, kann die gewählte ForOppermann, DVBl. 2003, 1234 (1241). Abgesehen von Slowenien, welches seit 01. 05. 2004 Bereits Mitglied der Europäischen Union ist. 588 Cremona, ELRev 2005, 3 (7 ff.). 589 „Dinosaurier sterben an ihrer schieren Größe“, so Oppermann, DVBl. 2003, 1234 (1242). 590 Oppermann, DVBl. 2003, 1234 (1242). 591 CONV 649 / 03, S. 1. 592 Zu den „European Partnerships“ und zur „European Neighbourhood Policy“, vgl. Cremona, ELRev 2005, 3 (7 ff.). 586 587
330
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
mulierung ohne Abstriche auf die derzeitige Situation angewandt werden. Art. I-57 EVV kommt damit zumindest formal ein innovativer Charakter593 zu, da erstmals ausdrücklich ein Rahmen für die Beziehungen zwischen der Union und ihren Nachbarländern abgesteckt wird, wenngleich die Union faktisch bereits heute durch den Abschluss von Assoziationsabkommen die mit Art. I-57 EVV beabsichtigten Ziele erreichen kann. In Art. I-57 Abs. 2 EVV sind deutliche Parallelen zu Art. 310 EG zu finden. So stammt beispielsweise der Hinweis auf gegenseitige Rechte und Pflichten aus Art. 310 EG; darüber hinaus finden die in der Norm erwähnten regelmäßigen Konsultationen üblicherweise im Rahmen von Assoziierungsabkommen, zum Beispiel über einen Assoziationsrat oder -ausschuss statt. Um zu verdeutlichen, dass die von Art. I-57 EVV ermöglichten Beziehungen auf der Achtung demokratischer Grundsätze, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte beruhen müssen, wurde ein Passus in die Vorschrift eingefügt, wonach der durch Verträge nach Art. I-57 EVV zu schaffende Raum des Wohlstands und der guten Nachbarschaft auf den Werten der Union aufbaut.594 Bei den erwähnten Werten der Union handelt es sich um eine Verweisung auf Art. I-2 EVV. Auf eine Bezugnahme auf die Rolle des Europarates als Mittler zwischen der Union und ihren Nachbarländern wurde verzichtet, da einige Nachbarländer der Union nicht dem Europarat als Mitglied angehören.595 Systematisch gesehen hätte Art. I-57 EVV eigentlich unter die Vorschriften des Auswärtigen Handelns der Union (Art. III-292 ff. EVV) eingeordnet werden müssen. Die Konventsmitglieder vertraten jedoch mehrheitlich die Auffassung, dass die Beziehungen der Union zu ihren Nachbarn hinreichend wichtig seien, um ihnen einen eigenen Titel und Artikel in Teil I der Verfassung zu widmen.596 Abschließend ist festzuhalten, dass der Union mit Art. I-57 EVV ausdrücklich die Möglichkeit gegeben wird, eine eigene „Nachbarschaftspolitik“ einzuführen.597 Damit wird dem Spektrum der Verträge, welche die Union schließen kann, ein weiteres Element hinzugefügt, das insbesondere als Ergänzung zu Assoziierungsabkommen zu verstehen ist.
593 Zum innovativen Charakter der Vorschrift vgl. den stellvertretenden Vorsitzenden des Konvents Dehaene, CONV 677 / 03, S. 9. 594 CONV 724 / 03, S. 129. 595 CONV 724 / 03, S. 129. Zu diesem Vorschlag CONV 671 / 03, S. 3. 596 CONV 696 / 03, S. 9. 597 Zu den Problemen einer neuen Nachbarschaftspolitik („Wandel durch Annäherung – oder Selbstaufgabe“), Stratenschulte, Integration 2004, 95 ff.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
331
16. Zusammenfassung und Bewertung Bei der Festlegung geschriebener Kompetenzen besteht ein Zielkonflikt zwischen dem Wunsch nach einem weiterhin flexiblen System und demjenigen nach mehr Präzision. Wie bereits in den Konventsberatungen zum Ausdruck kam, sollte an der bestehenden Verteilung der Zuständigkeiten insgesamt eher festgehalten werden.598 Daher überwiegen bei einer abschließenden Betrachtung der geschriebenen Außenkompetenzen der Union die inhaltlichen Kontinuitätselemente. 599 Wesentliche Änderungen wurden hauptsächlich im Bereich der Gemeinsamen Handelspolitik durch die Erweiterung der Definition in Art. III-315 Abs. 1 EVV vorgenommen. Zu begrüßen ist zudem die Schaffung einer besonderen Außenkompetenz betreffend die humanitäre Hilfe (Art. III-321 EVV). Zudem wird der Beitritt zur Europäischen Menschenrechtskonvention ermöglicht (Art. I-9 Abs. 2 EVV). Die bisher ausschließlich der Kommission zugeordneten Delegationen werden in „Delegationen der Union“ umbenannt. Schließlich wird ein Europäischer Auswärtiger Dienst eingerichtet (Art. III-296 Abs. 3 EVV). Insgesamt ergeben sich damit keine revolutionären Neuerungen; die Außenkompetenzen werden vielmehr ausgehend von bestehenden Kompetenzen „abgerundet“. Die Protokolle zum Vertrag über eine Verfassung für Europa enthalten – abgesehen von den erwähnten Protokollen Nr. 1, 2, 4, 23, 32, 36 – keine für die Außenkompetenzen der Union relevanten Regelungen.600
CON 60 / 02, S. 9. Zu den wichtigen institutionellen Änderungen im Bereich der GASP wurde bereits oben Stellung genommen, vgl. oben, § 10 II. 2. e). 600 Nach Art. 2 des Protokolls Nr. 8 betreffend die Verträge und die Akten über den Beitritt des Königreichs Dänemark, Irlands sowie des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, der Hellenischen Republik, des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik, der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden treten die genannten Staaten den noch in Kraft befindlichen Übereinkünften bei, die vor dem jeweiligen Beitritt zwischen den anderen Mitgliedstaaten geschlossen wurden und sich auf den EG-, den EA- oder den EU-Vertrag stützen, sowie denjenigen Abkommen, die von der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten mit Drittländern geschlossen wurden. Gleiches gilt für das Protokoll Nr. 9 betreffend den Vertrag und die Akte über den Beitritt der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik (vgl. Art. 6). Das Protokoll über die Außenbeziehungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich des Überschreitens der Außengrenzen (Nr. 21) bestimmt in seinem einzigen Artikel, dass die (Innen-)Kompetenz der Union nach Art. III-265 Abs. 2 EVV nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Aushandlung und den Abschluss von Übereinkünften mit Drittländern berührt, sofern die ausgehandelten Abkommen mit dem Unionsrecht und anderen in Betracht kommenden internationalen Übereinkommen in Einklang stehen. 598 599
332
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
III. Generelle Vertragsschlusskompetenz der Union, Art. III-323 EVV (derzeit: ungeschriebene oder implizite Außenkompetenzen) Eine entscheidende Neuerung des Verfassungsvertrages bringt Art. III-323 EVV mit sich. Diese Bestimmung regelt erstmals ausdrücklich diejenigen Voraussetzungen, unter denen die Union allgemein mit Drittstaaten oder internationalen Organisationen Übereinkünfte abschließen darf. Die Bestimmung lautet folgendermaßen: Artikel III-323 EVV (1) Die Union kann mit einem oder mehreren Drittstaaten oder einer oder mehreren internationalen Organisationen eine Übereinkunft schließen, wenn dies in der Verfassung vorgesehen ist oder wenn der Abschluss einer Übereinkunft im Rahmen der Politik der Union entweder zur Verwirklichung eines der in der Verfassung festgesetzten Ziele erforderlich oder in einem verbindlichen Rechtsakt der Union vorgesehen ist oder aber gemeinsame Vorschriften beeinträchtigen oder deren Anwendungsbereich ändern könnte. (2) Die von der Union geschlossenen Übereinkünfte binden die Organe der Union und die Mitgliedstaaten.
1. Ausdrückliche Kompetenz, Art. III-323 Abs. 1 Var. 1 EVV in Verbindung mit Verfassungsvorschriften Art. III-323 Abs. 1 Var. 1 EVV bringt zunächst eine Selbstverständlichkeit zum Ausdruck: Wenn die Verfassung dies so vorsieht, ist die Union zum Abschluss internationaler Übereinkommen ermächtigt. Dies entspricht den bereits oben erörterten geschriebenen Außenkompetenzen. Inhalt und Umfang der jeweiligen Vertragsschlusskompetenz richtet sich in diesen Fällen nach den jeweils einschlägigen Normen des Verfassungsvertrags, welche in Teil III der Verfassung zu finden sind.
2. Generelle Vertragsschließungskompetenz, Art. III-323 Abs. 1 Var. 2, 3, 4 EVV Neben dem gerade erwähnten Verweis auf ausdrückliche Außenkompetenzen trifft Art. III-323 EVV vor allem Regelungen hinsichtlich einer allgemeinen Vertragsschlusskompetenz der Union im Außenbereich. Wie bereits oben erwähnt, liegt damit zum ersten Mal eine allgemeine ausdrückliche Rechtsgrundlage für diesen Bereich im Primärrecht vor. Fraglich ist indes, ob die – im Zweiten Teil der Arbeit dargelegten – bisherigen maßgeblich durch Richterrecht geprägten Grundsätze zum Entstehen und Umfang ungeschriebener Außenkompetenzen durch Art. III-323 Abs. 1 EVV schlicht kodifiziert worden sind oder ob die im Verfassungsvertrag getroffene Regelung inhaltliche Änderungen mit sich bringt. Aufschluss hierüber gibt der Vergleich zwischen den vom EuGH aufgestellten Voraussetzun-
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
333
gen für das Vorliegen einer impliziten Vertragsschließungskompetenz und denjenigen, die nun im Verfassungsvertrag niedergelegt sind. Zunächst ist festzuhalten, dass nicht der – durchaus denkbare – Weg gewählt wurde, einfach auf die Rechtsprechung des EuGH zu verweisen.601 Abgesehen von den in der Verfassung ausdrücklich genannten Vertragsschließungskompetenzen sieht Art. III-323 Abs. 1 EVV drei Varianten einer generellen Außenkompetenz der Union vor. Zu beachten ist, dass die Kompetenzvorschrift des Art. III-323 Abs. 1 EVV lediglich die Frage betrifft, ob eine Außenkompetenz besteht, nicht, wie diese ausgestaltet ist.602 Kommt man zum Ergebnis, dass eine solche Kompetenz besteht, kann man zunächst davon ausgehen, dass es sich um eine konkurrierende Kompetenz handelt. Die Frage nach Art und Umfang der Kompetenz kann letztlich jedoch erst in einem zweiten Schritt beantwortet werden, nämlich bei der Frage, ob ein Fall des Art. I-13 Abs. 2 EVV und damit eine ausschließliche Kompetenz vorliegt, ob lediglich unterstützende Maßnahmen der Union gestattet sind oder ob aufgrund des Sinns und Zwecks der Kompetenz eine parallele Kompetenz anzunehmen ist. a) Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV Nach der neuen Regelung in Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV steht der Union eine Vertragsschlusskompetenz zu, wenn der Abschluss einer Übereinkunft im Rahmen der Politik der Union zur Verwirklichung eines der in der Verfassung festgesetzten Ziele erforderlich ist. aa) Die einzelnen Tatbestandsmerkmale Zur Begründung einer Außenkompetenz wird zum einen auf die Politik und die Ziele der Union und zum anderen auf ein Erforderlichkeitskriterium abgestellt. Es ergeben sich damit folgende Tatbestandsmerkmale: – im Rahmen der Politik der Union, – ein in der Verfassung festgesetztes Ziel, – Erforderlichkeit. 601 Der Vorschlag von Peter Hain, Mitglied des Konvents, ging genau in diese Richtung, er wollte die Außenkompetenzen der Union an die bisherige Rechtsprechung des EuGH koppeln; sein Änderungsvorschlag sah vor: „the Treaty could indicate that the Union is competent, to the extent recognised by the established jurisprudence of the ECJ, to conclude agreements dealing with issues falling under its internal competences“ (Hervorhebungen durch den Verfasser), vgl. WG VII – WD 66, S. 4 (Peter Hain); ähnlich WG VII – WD 64, S. 3 (McDonagh). Ein ausdrücklicher Hinweis auf die bisherige EuGH-Rechtsprechung (etwa in Form eines Protokolls oder einer Erklärung im Anhang an den Verfassungsvertrag) fehlt in der endgültigen Fassung vollständig. 602 CONV 685 / 03, S. 65.
334
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
(1) Im Rahmen der Politik der Union Da die Politiken der Union mittlerweile nahezu alle denkbaren Politikbereiche – zumindest teilweise – erfassen, wird es kaum vorkommen, dass sich der Abschluss eines internationalen Übereinkommens nicht „im Rahmen der Politik der Union“ bewegt. Dieses Tatbestandsmerkmal grenzt die allgemeine Vertragsschlusskompetenz der Union daher nur sehr unzureichend ein. (2) Ein in der Verfassung festgesetztes Ziel (a) Zahlreiche und weitreichende Zielbestimmungen Die Erwähnung der Ziele der Europäischen Union greift zunächst auf die in Teil III der Verfassung in nahezu jedem Politikbereich zu findenden Zielbestimmungen zurück. Zu nennen sind hier beispielsweise Art. III-314 EVV (für den Bereich der gemeinsamen Handelspolitik) oder Art. III-254 Abs. 1 EVV (für den Bereich der Raumfahrt). Im Rahmen des in Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV enthaltenen Verweises auf die Ziele der Union erlangt zudem die Vorschrift des Art. III-292 EVV zentrale Bedeutung, die als allgemein anwendbare Bestimmung die Ziele für das auswärtige Handeln der Union festschreibt. Wie bereits oben erwähnt, sind diese Ziele bei näherer Betrachtung eher allgemeiner Natur und öffnen aufgrund ihrer Weite603 einen sehr großen Bereich für mögliche Außenkompetenzen. Ausdrücklich ausformulierte Zielbestimmungen enthält zudem Art. I-3 EVV. Als Artikel, der die überwölbenden Ziele des Verfassungsvertrages beschreibt604, enthält er wiederum sehr weit gesteckte Ziele, zu deren Erreichung eine große Anzahl von Mitteln denkbar ist.605 603 In Art. III-292 Abs. 1 EVV sind zunächst die allgemeinen Ziele wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Achtung der Menschenwürde, der Grundsatz der Gleichheit und der Solidarität sowie die Achtung der Grundsätze der Vereinten Nationen und des Völkerrechts genannt. Art. III-292 Abs. 2 lit. a bis h EVV setzt diesen Zielkatalog fort, zu dem unter anderem die Förderung und Festigung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, von Menschenrechten und von Grundsätzen des Völkerrechts gehören, sowie die nachhaltige Entwicklung in Bezug auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in den Entwicklungsländern, mit dem vorrangigen Ziel, die Armut zu beseitigen. 604 Müller-Graff, Integration 2004, 186 (201). 605 So ist es beispielsweise das Ziel der Union, den Frieden und das Wohlergehen ihrer Völker zu sichern (Art. I-3 Abs. 1 EVV). In ihren auswärtigen Beziehungen (Art. I-3 Abs. 4 EVV) leistet die Union einen Beitrag zu Frieden, Sicherheit, globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den Völkern, freiem und gerechtem Handel, Beseitigung der Armut und Schutz der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterentwicklung des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
335
Auffällig ist, dass Art. III-323 Abs. 1 EVV zur Herleitung einer allgemeinen Außenkompetenz einerseits auf die Verwirklichung eines in der Verfassung festgesetzten Ziels verweist, andererseits fordert gerade die Bestimmung des Art. I-3 EVV, in der die Ziele der Union benannt werden in Abs. 5, dass die genannten Ziele der Union gemäß „mit geeigneten Mitteln entsprechend den Zuständigkeiten, die ihr in der Verfassung übertragen sind“ verfolgt werden sollen. Dies kann nur so verstanden werden, dass gemäß dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung zur Begründung einer Kompetenz eine ausdrückliche Kompetenzgrundlage erforderlich ist mit der Konsequenz, dass die genannten Ziele alleine keine Kompetenz begründen können. Durch den Verweis in Art. III-323 Abs. 1 EVV soll das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung sicherlich nicht außer Kraft gesetzt werden. Dies wird schon aus der Tatsache deutlich, dass das Prinzip ein eherner Grundsatz des Europarechts ist und in der Verfassung ausdrücklich kodifiziert wurde (Art. I-11 Abs. 1, 2 EVV). Da Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV nicht auf die gesamte Bestimmung des Art. I-3 EVV (und damit auch auf dessen Abs. 5), sondern lediglich allgemein auf die Ziele der Union verweist, liegt in dem Verweis auch kein Zirkelschluss begründet. Dennoch bleibt festzuhalten, dass der Hinweis auf die Ziele in einer kompetenzbegründenden Vorschrift in gewissem Widerspruch zum Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung steht.606 Zur Begründung einer Außenkompetenz muss demnach zunächst auf die konkret im Rahmen der einzelnen Politikbereiche bezeichneten Ziele und dann, falls solche nicht gefunden werden können, auf die allgemeinen im Verfassungsvertrag genannten Ziele Bezug genommen werden. Wie gezeigt sind die im Verfassungsvertrag aufgestellten Ziele äußerst weit gefasst. Als selbstständiger Anknüpfungspunkt für eine generelle Vertragsschließungskompetenz sind sie im Hinblick auf eine Eingrenzung nur sehr bedingt geeignet. Daraus ergibt sich, dass das Kriterium der Zielbestimmungen der Union viele Möglichkeiten bietet, nach außen hin tätig zu werden. Aufgrund der umfassenden Weite der Zielbestimmungen im Verfassungsvertrag wird die Union keine Probleme haben, außenpolitische Aktivitäten unter eines oder gleich mehrere der im Vertrag genannten Ziele zu subsumieren. (b) Begrenzung durch die Art der Kompetenz Fraglich ist, ob die Ziele der Union durch die von der Verfassung festgelegte Art der Zuständigkeit begrenzt wird. Eine solche Begrenzung ist insbesondere in den Bereichen angezeigt, in denen die Union beschließen kann, Unterstützungs-, Koordinierungs- oder Ergänzungsmaßnahmen durchzuführen. So ist – zum Beispiel für den Bereich der öffentlichen Gesundheit – anzunehmen, dass es das Ziel der Union nur sein kann, die Maßnahmen der Mitgliedstaaten, die unter die Zielbestimmungen des Art. III-278 Abs. 1 EVV fallen, zu unterstützen beziehungsweise zu ergän606
Vgl. dazu sogleich unter bb).
336
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
zen. Dies kommt im Wortlaut der Vorschrift zum Ausdruck, wo es heißt, dass die Tätigkeit der Union die Politik der Mitgliedstaaten „ergänzt“. Ziel der internen Unionspolitik ist es daher, Maßnahmen zur Ergänzung mit bestimmten gesundheitspolitischen Zielsetzungen zu treffen. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies: die Union darf nicht mit einem bestimmten Ziel den genannten Bereich umfassend und abschließend regeln, sondern sie darf nur unterstützend mit einem bestimmten Ziel tätig werden. Die Ergänzungsfunktion der Unionsmaßnahmen kann damit als Begrenzung der Ziele der Union begriffen werden. Diese interne Beschränkung der Kompetenz wirkt sich über die Bezugnahme in Art. III-323 EVV auf die Zielbestimmung der Verfassung auch auf die externen Kompetenzen der Union aus. Aufgrund dieser Überlegungen korrespondiert im Bereich des Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV die Innenkompetenz mit der Außenkompetenz, obwohl dies nicht ausdrücklich in der Vorschrift formuliert worden ist. Die genannten Argumente können jedoch nur für die Kompetenzkategorie der Unterstützungs-, Koordinierungs- oder Ergänzungsmaßnahmen gelten. (3) Erforderlichkeit Es verbleibt damit als letztes und entscheidendes Tatbestandsmerkmal das Merkmal der „Erforderlichkeit“. Was zur Erreichung eines Zieles erforderlich ist, kann naturgemäß, je nach Interessenlage und Überzeugung, sehr unterschiedlich definiert werden. Unklar ist daher, wie das Kriterium „erforderlich“ bestimmt werden soll. (a) Vergleich mit Art. 72 Abs. 2 GG Festzuhalten ist zunächst, dass der Verfassungsvertrag den Begriff „erforderlich“ und nicht das Wort „notwendig“ wählt.607 Andererseits muss angenommen werden, dass das Wort „erforderlich“ mehr verlangt als lediglich ein „Bedürfnis“ für eine europäische Regelung. An dieser Stelle könnte man eventuell an einen Vergleich mit Art. 72 Abs. 2 GG denken. Nach dieser Regelung steht dem Bund die Kompetenz zu, wenn bestimmte Gründe eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich machen.608 Der vor dem Jahr 1994 geltende Art. 72 Abs. 2 GG verlangte lediglich ein Bedürfnis für eine bundesgesetzliche Regelung.609 Das Vorliegen Anders in Art. I-13 Abs. 2 Var. 2 EVV. Vgl. hierzu die Änderung des Art. 72 Abs. 2 GG durch das Gesetz vom 27. 10. 1994, BGBl. I, 3146. 609 Die alte Fassung des Art. 72 Abs. 2 GG lautete: „Der Bund hat in diesem Bereiche das Gesetzgebungsrecht, soweit ein Bedürfnis nach bundesgesetzlicher Regelung besteht, weil 1. eine Angelegenheit durch die Gesetzgebung einzelner Länder nicht wirksam geregelt werden kann oder 2. die Regelung einer Angelegenheit durch ein Landesgesetz die Interessen anderer Länder oder der Gesamtheit beinträchtigen könnte oder 607 608
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
337
eines Bedürfnisses im Sinne des Art. 72 Abs. 2 GG a. F. wurde vom Bundesverfassungsgericht als Ermessensfrage behandelt, die nur einer beschränkten gerichtlichen Prüfung unterlag.610 Das BVerfG erachtete lediglich im (hypothetischen) Falle eines evidenten Missbrauchs die Inanspruchnahme einer Kompetenz durch den Bund für verfassungswidrig.611 Die Bedürfnisklausel galt damit als „eines der Haupteinfallstore für die Auszehrung der Länderkompetenzen“.612 Sachlich wurde die Gesetzgebungsbefugnis des Bundes durch die Bedürfnisklausel des Art. 72 Abs. 2 GG a. F. nicht eingeschränkt.613 Die Neuregelung des Art. 72 Abs. 2 GG, die auf das Merkmal der Erforderlichkeit abstellt, hat die Rechtsprechung des BVerfG „föderaler“ gemacht, also die Länderkompetenzen gestärkt.614 Auf europäischer Ebene bedeutet „Erforderlichkeit“ jedenfalls, dass eine europäische Regelung die genannten Ziele zu fördern geeignet ist, während mitgliedstaatliche Regelungen dies nicht in gleichem Maße sind. Diese Definition der Erforderlichkeitsklausel bringt aber keine entscheidende Verschärfung der Anforderungen an die europäischen Außenkompetenzen mit sich. Anzunehmen ist jedenfalls, dass der Union eine erhöhte Darlegungslast hinsichtlich ihrer Voraussetzungen obliegt. Die Erforderlichkeit einer Regelung zur Erreichung eines in der Verfassung festgesetzten Ziels, ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Man muss davon ausgehen, dass der Kommission beziehungsweise der Europäischen Union daher eine Einschätzungsprärogative verbleibt.615 Ein dynamisches Verständnis des Erforderlichkeitskriteriums ist damit zumindest möglich. Problematisch ist insbesondere, ob graduelle Unterschiede für bestimmte Politikbereiche im Rahmen des Begriffs „erforderlich“ gemacht werden müssen und wie der Begriff „erforderlich“ gegebenenfalls vom EuGH rechtlich zu überprüfen ist. Fraglich ist hier ebenfalls, ob und inwiefern der EuGH den Einschätzungs- und Prognosespielraum einschränken wird.
3. die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit, insbesondere die Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse über das Gebiet eines Landes hinaus sie erfordert.“ 610 BVerfGE 1, 264 (272 f.); 2, 213 (224); 65 1 (63); 78, 249 (270); vgl. auch Maunz, in: Maunz / Dürig, Grundgesetz Kommentar II, Art. 72, Rdnr. 14. 611 Stein, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland I, S. 679. 612 BT-Drs. 12 / 6000, 33, zitiert nach Pieroth, in: Jarass / Pieroth, Grundgesetz Kommentar, Art. 72, Rdnr. 7. 613 Vgl. Degenhart, in: Sachs, Grundgesetz Kommentar, Art. 72 Rdnr. 9. 614 Vgl. die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Juniorprofessur, BVerfG, 2 BvF 2 / 02 vom 27. 7. 2004. 615 Für das deutsche Recht bejaht das BVerfG einen solchen Einschätzungs- und Prognosespielraum. Das BVerfG verneint die Erforderlichkeit einer Maßnahme nur dann, wenn „die sachliche Gleichwertigkeit zur Zweckerreichung [ . . . ] bei dem als Alternative vorgeschlagenen geringeren Eingriff in jeder Hinsicht eindeutig“ feststeht, BVerfGE 30, 292 (319). 22 Metz
338
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
(b) Erforderlichkeit als Suche nach dem milderen Mittel Als Bestimmungsversuch des Merkmals der Erforderlichkeit könnte die Auslegung desselben Begriffs durch das Bundesverfassungsgericht dienen. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung im weiteren Sinne entnimmt das Bundesverfassungsgericht dem Grundsatz der Erforderlichkeit das Gebot, unter mehreren für die Verwirklichung des angestrebten Ziels in Betracht kommenden, gleichermaßen geeigneten Maßnahmen die am geringsten belastende Maßnahme zu wählen.616 Selbst wenn man diese Definition der Erforderlichkeit, welche (als Teilelement des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes) eigentlich für Eingriffsakte im Verhältnis zwischen Staat und Bürger gilt617, auf das Verhältnis zwischen der Union und den Mitgliedstaaten übertragen wollte, hilft der Ansatz nicht recht weiter. Als milderes Mittel im oben genannten Sinne könnte zunächst eine Regelung unterhalb der Schwelle eines völkerrechtlichen Vertrages, etwa unverbindliche Absprachen, angesehen werden. Abgesehen von der Frage, unter welchen rechtlichen Voraussetzungen die Union unterhalb des Eingehens von vertraglichen Verpflichtungen außenpolitisch aktiv werden kann, ist jedoch festzuhalten, dass nur die Rechtsform des völkerrechtlichen Vertrages genügend Rechtssicherheit hinsichtlich der Verbindlichkeit einer Vereinbarung bietet. Aufgrund ihres verbindlichen Charakters ist der Abschluss völkerrechtlicher Übereinkünfte daher in fast allen Fällen erforderlich, um die Außenbeziehungen der Union auf eine feste Grundlage zu stellen. Damit sind Übereinkünfte unterhalb der Vertragsschwelle in weiten Bereichen des auswärtigen Handelns der Union unzweckmäßig und können auch nicht als Alternative für einen geringeren Eingriff taugen. Des Weiteren käme – als milderes Mittel im Vergleich zu einer Außenkompetenz der Union – die Möglichkeit der Aufstellung autonomer Regelungen (auf Unionsebene) in Betracht.618 Dann stellt sich die Frage, ob die mit der Übereinkunft verfolgten Ziele nicht ebenso gut mit unionsinternen Maßnahmen erreicht werden können.619 Aufgrund der dichten Vernetzung der Gesellschaften, der Glo616 Degenhart, Staatsrecht I, S. 153 Rdnr. 395, bezeichnet den Grundsatz der Erforderlichkeit auch als das Prinzip des geringstmöglichen Eingriffs; nach Epping, Grundrechte, S. 19, muss unter mehreren Mitteln mit gleicher Erfolgseignung dasjenige gewählt werden, welches die geringste Eingriffsintensität aufweist. 617 Degenhart, Staatsrecht I, S. 56 Rdnr. 142. Im Bund-Länder-Verhältnis ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip (und damit auch das Prinzip des geringstmöglichen Eingriffs) grundsätzlich nicht anwendbar, vgl. BVerfGE 81, 310 (338). 618 In diese Richtung weisen etwa vereinzelte Ausführungen des EuGH, wonach der Abschluss einer völkerrechtlichen Vereinbarung erforderlich sein muss, um Ziele des Vertrages zu verwirklichen, die sich durch die Aufstellung autonomer Regeln nicht verwirklichen lassen. EuGH, EuZW 2003, 82 (88, Rdnr. 83). 619 Die Frage, ob sich bestimmte Ziele des Vertrages nicht auch durch die Aufstellung autonomer Regelungen erreichen lassen, oder ob die interne Zuständigkeit wirksam nur zugleich mit der Außenkompetenz ausgeübt werden kann, stellte sich, wie im Zweiten Teil der Arbeit dargelegt, im Gutachten 1 / 76 (EuGH 1977, 741); hierbei ging es jedoch nicht um
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
339
balisierung und anderer Interdependenzen620 wird jedoch selten eine Situation auftreten, in der die Union ihre außenpolitischen Ziele allein durch innenpolitische Maßnahmen gleich wirksam erreichen kann. Insofern kann in innergemeinschaftlichen Regelungen oft kein milderes Mittel gesehen werden, welches die Erforderlichkeit ausschließen würde. Dem Merkmal der Erforderlichkeit kommt in dieser Hinsicht kaum eine einschränkende Funktion zu. Schließlich könnte die Erforderlichkeit dann verneint werden, wenn der Vertragsabschluss durch die Mitgliedstaaten selbst möglich und ebenso effektiv wie ein Handeln auf Unionsebene wäre. Will man das Tatbestandsmerkmal der Erforderlichkeit auf diese Weise definieren, dann steht das Erforderlichkeitsmerkmal in unmittelbarer „Konkurrenz“ zum Subsidiaritätsprinzip. Begreift man also das Erforderlichkeitsmerkmal in dem Sinne, dass ein internationaler Vertrag, welcher von einem Mitgliedsstaat abgeschlossen wird, ein milderes Mittel im Vergleich zum Abschluss dieses Vertrages auf Unionsebene darstellt, so besagt das Kriterium der Erforderlichkeit nichts anderes als das Subsidiaritätsprinzip. Als allgemeines Grundprinzip gilt das Subsidiaritätsprinzip gemäß Art. I-11 Abs. 1, 3 EVV für das gesamte Unionshandeln, also auch für die auswärtigen Beziehungen der Europäischen Union. Wie bereits oben dargelegt, darf die Union demgemäß nur handeln, wenn die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahme von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können, sondern wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser erreicht werden können. Dem Erforderlichkeitskriterium käme nach dieser Interpretation keine eigenständige Bedeutung zu, es würde im allgemeinen Subsidiaritätsprinzip aufgehen. In praktischer Hinsicht ist zudem zu beachten, dass (zwar parallele aber) unkoordinierte Vertragsverhandlungen durch (mindestens) 25 Mitgliedstaaten nur ausnahmsweise geeignet sein werden, das jeweilige Unionsziel überall und in untereinander harmonierender Weise zu verwirklichen. Meist wird daher ein Tätigwerden der Union erforderlich sein.621 (c) Bewertung Im Rahmen des Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV muss geprüft werden, welche Vertragsschlüsse im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel erforderlich sind. Hier zeigt sich, dass das Merkmal der Erforderlichkeit einen stark wertungsabhängigen Charakter besitzt. Eine genaue Definition ist nicht möglich. Vielmehr muss eine die Frage des Bestehens einer Außenkompetenz, sondern um die Abgrenzung, ob eine (bereits bestehende) Außenkompetenz eine ausschließliche ist oder nicht. 620 Diese wechselseitigen Abhängigkeiten bestehen im Besonderen im Bereich des Umweltschutzes („Schadstoffe machen vor Grenzen nicht halt“), vor allem aber auch in der Handelspolitik, dem Subventionsrecht und dem Vergaberecht. 621 So Schwartz, in: von der Groeben / Schwarze, EU / EG Kommentar IV, Art. 308 EG Rdnr. 180 zur Regelung des Art. 308 EG. 22*
340
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Lösung für den jeweiligen Einzelfall gefunden werden. Was zur Erreichung eines bestimmten Ziels erforderlich ist, wird je nach Interessenlage unterschiedlich eingeschätzt werden. Im Rahmen der Überprüfbarkeit des Begriffs der Erforderlichkeit wird es damit zu ähnlichen Problemen wie im Bereich des Subsidiaritätsprinzips kommen. Ob das Entstehen einer Außenkompetenz nach Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV justiziabel sein wird, wird die Zukunft erweisen. Es ist jedoch anzunehmen, dass der Gerichtshof der Kommission einen weiten Einschätzungs- und Ermessensspielraum hinsichtlich der Bestimmung der Erforderlichkeit zugestehen wird. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die neue Bestimmung des Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV eine sehr weitgehende Außenkompetenz statuiert. Damit wird der Union in nahezu allen Politikbereichen eine (konkurrierende) Außenkompetenz eingeräumt. Lediglich dann, wenn es sich um ein „nicht erforderliches“ internationales Abkommen handelt, steht der Union keine Außenkompetenz zu. Dieser Fall wird jedoch selten auftreten. Da nach Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV nicht nur die in Teil III der Verfassung festgelegten Ziele, sondern sämtliche Ziele der Union (die auswärtigen Ziele gemäß Art. III-292 EVV und die allgemeinen Ziele gemäß Art. I-3 EVV) als Grundlage für die Begründung einer Außenkompetenz dienen können,622 wird klar, dass der Union künftig eine weite außenpolitische Handlungsermächtigung eingeräumt wird.
bb) Die Abkehr von dem bisher angewandten implied-powers-Grundsatz zugunsten eines (eingeschränkten) Ziel-Mittel-Schlusses Wie gerade aufgezeigt, kann die Union gemäß Art. III-323 EVV grundsätzlich das Mittel des völkerrechtlichen Vertrags einsetzen, wenn sie ein in der Verfassung bestimmtes Ziel erreichen möchte. Diese Möglichkeit des Vertragsschlusses wird zwar durch das Tatbestandsmerkmal der Erforderlichkeit eingeschränkt (wie weit diese Einschränkung in concreto reicht, ist hier nicht relevant), rechtlich gesehen handelt es sich jedoch um einen Ziel-Mittel-Schluss. Die fehlende Bezugnahme in Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV auf bestehende Kompetenznormen schließt eine Positivierung des implied-power Grundsatzes aus. Nach der implied-powers Lehre liegen ungeschriebene Zuständigkeiten dann vor, wenn eine Materie, für die eine Zuständigkeit besteht, nicht sinnvoll geregelt werden kann, ohne dass eine nicht ausdrücklich geregelte Materie mitgeregelt wird.623 Die neue Bestimmung knüpft – wie gesehen – nicht an bestehende Kompetenzen, sondern direkt an die Ziele der Union an und weist daher strukturelle Ähnlichkei622 Freilich immer unter der Voraussetzung, dass ein außenpolitisches Handeln „erforderlich“ ist. 623 Weber, EuropaR 2004, 841 (849).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
341
ten zu der Flexibilitätsklausel des Art. I-18 EVV auf, welche ebenfalls die Ziele der Union als Ausgangspunkt einer (allerdings internen) Unionskompetenz nennt.624 Beiden Vorschriften gemeinsam ist des Weiteren das einschränkende Tatbestandsmerkmal der Erforderlichkeit. Die Neuregelung, die rechtsdogmatisch auf einem Ziel-Mittel-Schluss, also auf einer Divergenz zwischen vertraglicher Zielvorgabe und Kompetenzausstattung fußt, stellt damit eine Abkehr von der traditionellen EuGH-Rechtsprechung zu den ungeschriebenen Außenkompetenzen dar.625 Der Gerichtshof hatte bisher zu deren Begründung die implied-powers Lehre angewendet und in mehreren Urteilen und Gutachten bestätigt.626 Dies zeigt die Analyse des AETR-Urteils sowie des Kramer-Urteils und des Stilllegungsfonds-Gutachtens. Neben dem so genannten AETR-Prinzip, welches eine ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft für Fälle begründet, in denen Gemeinschaftsrechtsnormen durch völkerrechtliche Verträge der Mitgliedstaaten beeinträchtigt werden könnten, griff der EuGH zur Begründung einer ungeschriebenen Außenkompetenz in seiner bisherigen Rechtsprechung – wenn auch nicht expressis verbis, so doch implizit – auf den impliedpowers Grundsatz zurück: Der Gerichtshof erwähnte zunächst die Ziele des Art. 74 EWGV auf dem Gebiet des Verkehrswesens und nannte sodann die Kompetenzgrundlage des Art. 75 EWGV, welche den Rat ermächtigte, gemeinsame Regeln aufzustellen und alle sonstigen zweckdienlichen Vorschriften zu erlassen. Der Gerichtshof führte aus: „Nach Buchstabe a der gleichen Bestimmung sind diese Regeln aufzustellen für den internationalen Verkehr aus oder nach dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder für den Durchgangsverkehr durch das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten. Diese Bestimmung betrifft für den innergemeinschaftlichen Streckenteil auch den Verkehr aus oder nach dritten Staaten. Sie setzt daher voraus, dass die Zuständigkeit der Gemeinschaft sich auf Beziehungen erstreckt, die dem internationalen Recht unterliegen, und schließt damit insoweit die Notwendigkeit ein, mit den beteiligten dritten Ländern Abkommen zu schließen.“627
Hiermit knüpfte der Gerichtshof an eine interne Kompetenz (Art. 75 EWGV) eine für ihre Erfüllung notwendige Außenkompetenz und wendete damit den implied-powers Grundsatz an. Die implied-powers Doktrin zur Herleitung der Außen624 Art. I-18 EVV grenzt die Zielbestimmung allerdings noch auf die „im Rahmen der in Teil III festgelegten Politikbereiche“ ein. 625 Unklar Görlitz, DÖV 2004, 374 (380), der davon spricht, dass die bestehenden Kompetenzen „formal erweitert“ worden seien. Andererseits führt Görlitz aus, die Neuregelung „scheint die in der sogenannten AETR-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs entwickelte Parallelität von Innen- und Außenkompetenz der Europäischen Gemeinschaft nunmehr auch im Vertragstext festzuschreiben.“ 626 Siehe dazu die Ausführungen im Zweiten Teil der Arbeit, § 4 VI. 2. d), sowie Weber, EuropaR 2004, 841 (849). 627 EuGH, Slg. 1971, 263 (275 f., Rdnr. 23 / 29, Hervorhebungen durch den Verfasser) – AETR.
342
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
kompetenz wurde auch durch spätere Äußerungen des Gerichtshofs bestätigt. Im Kramer-Urteil heißt es: „Aus den Pflichten und Befugnissen, die das Gemeinschaftsrecht im Innenverhältnis den Gemeinschaftsorganen zugewiesen hat, ergibt sich daher die Zuständigkeit der Gemeinschaft, völkerrechtliche Verpflichtungen zur Erhaltung der Meeresschätze einzugehen.“628
Dieser Rückgriff auf die Pflichten und Befugnisse (und gerade nicht auf die Ziele) im Innenverhältnis lassen auf die Anwendung des implied-powers Grundsatzes schließen, da die Außenkompetenz aus internen Kompetenzen hergeleitet wird; um die jeweiligen internen Kompetenzen sinnvoll erfüllen zu können, wird ihnen eine Außenkompetenz zur Seite gestellt. Auch im Stilllegungsfonds-Gutachten wurde die implied-powers Lehre vom EuGH angewendet: „Insbesondere hat er [der Gerichtshof] festgestellt, dass, wenn das Gemeinschaftsrecht im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel im Innenverhältnis eine Zuständigkeit verleiht, die Gemeinschaft befugt ist, die zur Erreichung diese Ziels erforderlichen völkerrechtlichen Verpflichtungen einzugehen, auch wenn eine ausdrückliche diesbezügliche Bestimmung fehlt.“629
Die Formulierung des Gerichtshofs nennt zwar wie die neue Regelung im Verfassungsvertrag als Voraussetzung für eine generelle Außenkompetenz das Ziel und die Erforderlichkeit, knüpft jedoch vor allem an die im Innenverhältnis bereits vorhandene Zuständigkeit an, was der Verfassungsvertrag nicht tut. Die Neuregelung bezieht sich namentlich auf die Ziele der Gemeinschaft, und zwar nicht nur auf die für ihr außenpolitisches Handeln geltenden Ziele, sondern auch auf die allgemeinen Ziele der Union. Damit bewegen sich die Ziele in einem weit gesteckten Rahmen; die Außenkompetenz ist nicht an eine explizite (auszulegende) Innenkompetenz gebunden, sondern von den Vertragszielen abhängig. Der Verfassungsentwurf dehnt damit die Außenkompetenz der Union im Sinne eines Ziel-MittelSchlusses weiter aus.630 Der gerade festgestellte „Systemwechsel“, nämlich der Übergang von der implied-powers Lehre zu einem Ziel-Mittel-Schluss, ist umso erstaunlicher, als der Verfassungsvertrag kaum Instrumente zur Eingrenzung der Außenkompetenz an die Hand gibt. Dies fällt insbesondere beim Vergleich mit der – wie bereits angedeutet – strukturell ähnlichen Flexibilitätsklausel (Art. I-18 EVV) auf. Diese sieht zumindest vor, dass alle auf der Vorschrift beruhenden Maß628
EuGH, Slg. 1976, 1279 (1311, Rdnr. 33, Hervorhebungen durch den Verfasser) – Kra-
mer. 629 EuGH, Slg. 1977, 755 (755, Rdnr. 3 a. E., Hervorhebungen durch den Verfasser) – Stilllegungsfonds. 630 Die in der Judikatur der EuGH vereinzelt zu findende Bedingung, wonach der Abschluss einer völkerrechtlichen Vereinbarung erforderlich sein muss, um Ziele des Vertrages zu verwirklichen, die sich durch die Aufstellung autonomer Regeln nicht verwirklichen lassen, EuGH, EuZW 2003, 82 (88, Rdnr. 83) – Open-Skies, kann dagegen, wie oben gezeigt, in das Erforderlichkeitskriterium im Rahmen des Art. III-323 EVV hineingelesen werden.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
343
nahmen einstimmig zu erlassen sind. Außerdem beschränkt Art. I-18 EVV die möglichen Maßnahmen auf die in Teil III genannten Politikbereiche. Darüber hinaus gibt Art. I-18 Abs. 2 EVV der Kommission auf, die nationalen Parlamente über diejenigen Vorschläge zu informieren, die sich auf den genannten Artikel stützen. Schließlich regelt Abs. 3 ein Harmonisierungsverbot. All diese formalen und materiellen Einschränkungen werden in Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV nicht genannt. Unverständlich bleibt daher auch, warum der Verfassungsvertrag diesen Systemwechsel vollzieht. Implied-powers als integrale Bestandteile der geschriebenen Kompetenzen ermöglichen es nämlich, den zugewiesenen Kompetenzen umfassend gerecht zu werden, sei es im Sinne einer Annex-Kompetenz, sei es im Sinne eines herzustellenden Sachzusammenhangs mit einer benachbarten Materie oder im Sinne einer Kompetenzabrundung kraft Natur der Sache zu Gunsten der Union.631 Insofern hätte es eines Rückgriffs auf die Ziele der Verfassung nicht bedurft. Sicherlich gibt es auch im Bereich der Kompetenzbegründung mit Hilfe der implied-powers Lehre Abgrenzungsschwierigkeiten. Allerdings ist dem implied-powers Grundsatz eine Einschränkung immanent, nämlich dass er nur dann gilt, wenn bereits geschriebene Kompetenzen bestehen und wenn die ungeschriebenen Befugnisse notwendigerweise miterfasst sein müssen, um diese (bestehende) Kompetenz sachgerecht wahrnehmen zu können. Eine solche immanente Kompetenzbeschränkung liegt dem Wesen des Ziel-Mittel-Schlusses gerade fern. Dadurch werden die Außenkompetenzen der Union schwer bestimmbar, eine sehr weitgehende Auslegung der Außenkompetenzen wird zumindest ermöglicht.
cc) Widerspruch zwischen dem Abschlussbericht der Arbeitsgruppe und dem tatsächlichen Wortlaut des Verfassungsentwurfs Die Einführung eines Ziel-Mittel-Schlusses widerspricht den Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Außenpolitisches Handeln“. Im Abschlussbericht dieser Gruppe heißt es, dass man übereingekommen sei, die zu den impliziten Außenkompetenzen der Union ergangene Rechtsprechung im Vertragstext zu berücksichtigen. Dies sollte jedoch nicht die bisherige Kompetenzabgrenzung zwischen der Union und den Mitgliedstaaten berühren.632 Wie gerade dargestellt, bedeutet die Einführung eines Ziel-Mittel-Schlusses rechtsdogmatisch eine Abkehr von der implied-powers Lehre. Fraglich ist, wie mit der Diskrepanz zwischen den Intentionen der Arbeitsgruppe (Kodifizierung der bekannten EuGH-Rechtsprechung, fußend auf dem Prinzip der implied-powers) und dem Wortlaut der Regelung (ausdrückliche Festlegung eines Ziel-Mittel-Schlusses) umzugehen ist. 631 632
Schröder, JZ 2004, 8 (10). CONV 459 / 02, S. 15 f. (Rdnr. 18).
344
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Zu klären ist zunächst, inwiefern die Ausführungen der Arbeitsgruppen rechtliche Relevanz besitzen und in die Interpretation des Verfassungstextes einbezogen werden können. Diese Frage wird ein grundsätzliches Problem bei der künftigen Verfassungsauslegung sein und ist damit nicht auf die vorliegend untersuchten Außenkompetenzen der Union beschränkt. Der Verfassungsentwurf selbst enthält zu diesem Problem keinerlei Ausführungen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die sog. „travaux préparatoires“ – anders als die Vorarbeiten zu den bisherigen Vertragskonferenzen (etwa von Maastricht oder Nizza) – veröffentlicht wurden. Dies könnte für eine Einbeziehung der Dokumente in die klassische Auslegungstrias Wortlaut, Sinn und Zweck und historische Auslegung sprechen. Andererseits stimmen die von den Arbeitsgruppen gemachten Vorschläge nicht immer mit der vom Konvent beziehungsweise von der Regierungskonferenz verabschiedeten Endfassung überein. Über weite Strecken bleibt unklar, inwieweit sich der Konvent auf die Erwägungen der Arbeitsgruppen tatsächlich bezogen hat. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass den Staats- und Regierungschefs im Rahmen des Europäischen Rates die Entscheidung über den maßgeblichen Wortlaut zusteht und dass anlässlich dieser Regierungskonferenz tatsächlich einige (zum Teil auch wesentliche) Änderungen am Konventsentwurf vorgenommen worden sind. Die Beratungen des Europäischen Rates wurden indes nicht veröffentlicht, sodass keine Begründungen oder Erwägungen vorliegen, warum der Vertragstext schließlich den endgültigen Wortlaut erhielt, und ob sich die Staats- und Regierungschefs bei ihrer Entscheidung auf die Gründe der Arbeitsgruppe oder des Präsidiums des Konvents oder auf eigenständige Gründe stützten. Aus den aufgeführten Überlegungen ergibt sich, dass die „travaux préparatoires“ allenfalls eine untergeordnete Bedeutung bei der Auslegung des Verfassungsvertrages haben können. Eine Grundregel im Bereich der Auslegungslehre besagt überdies, dass jede Auslegung an der Wortlautgrenze enden muss. Im Bereich der generellen Außenkompetenz der Union ergibt sich aus Art. III-323 EVV eine derart klare und eindeutige Festlegung auf einen Ziel-Mittel-Schluss, dass kein Raum für eine Auslegung besteht. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass die von der Arbeitsgruppe Außenbeziehungen vorgeschlagene Positivierung des implied-power Grundsatzes vom Konvent und anschließend von der Regierungskonferenz abgelehnt und stattdessen ein Ziel-Mittel-Schluss kodifiziert worden ist.
dd) „Überschießende“ Außenkompetenz (Parallele zur gemeinsamen Handelspolitik) Die Folge des gerade dargestellten, durch Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV kodifizierten Ziel-Mittel-Schlusses ist, dass der Europäischen Union nach außen potenziell mehr Kompetenzen zustehen als nach innen. In Bereichen, in denen der Union keine internen Kompetenzen zur Umsetzung oder Durchführung von völkerrechtlichen Verträgen zustehen, bedarf es daher der Abstimmung mit den Mitglied-
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
345
staaten. Etwa in Bereichen, in denen die Union lediglich Unterstützungs-, Koordinierungs- oder Ergänzungsmaßnahmen durchführen darf (Art. III-278 ff. EVV), kann sie nach Art. III-323 EVV zwar internationale Verträge in diesen Bereichen eingehen, intern muss sie sich aber aufgrund des Loyalitätsprinzips (Art. I-5 EVV) und des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung (Art. I-11 Abs. 1, 2 EVV) mit den Mitgliedstaaten abstimmen. Diese Konstellation ähnelt derjenigen, die auch im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik vorliegt. Bevor die Union daher internationale Verträge eingeht, an die sie gebunden ist und zu deren Umsetzung sie völkerrechtlich verpflichtet ist, muss intern eine Abstimmung mit den Mitgliedstaaten erfolgen, welche sich gegebenenfalls auf die Vertragsverhandlungen im Außenverhältnis auswirkt. Die genannte Abstimmung kann entweder in Form interner Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten oder durch den Abschluss (fakultativ) gemischter Verträge erreicht werden. ee) Art der Kompetenz Grundsätzlich muss beachtet werden, dass die Kompetenz nach Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV eine geteilte Kompetenz ist, sofern sich nicht aus den Art. I-13 oder I-17 EVV ein anderes ergibt. Die Mitgliedstaaten sind daher weiterhin solange zum Abschluss völkerrechtlicher Übereinkommen befugt, wie die Union nicht eigene völkerrechtliche Verträge abgeschlossen und damit das Terrain gewissermaßen okkupiert hat. Wann dagegen von vornherein eine ausschließliche Kompetenz vorliegt (vgl. insbesondere Art. I-13 EVV), wird in einem späteren Kapitel untersucht. b) Art. III-323 Abs. 1 Var. 3 EVV Gemäß der dritten Variante des Art. III-323 Abs. 1 EVV darf die Union ferner internationale Übereinkünfte schließen, falls dies in einem verbindlichen Rechtsakt der Union vorgesehen ist. Damit entspricht Art. III-323 Abs. 1 Var. 3 EVV teilweise den Tatbestandvoraussetzungen des Art. I-13 Abs. 2 EVV633, der die ausschließliche Außenkompetenz regelt. Dies hat zur Folge, dass – falls der Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages in einem Gesetzgebungsakt der Union vorgesehen ist – die Union nicht nur grundsätzlich für den betreffenden Vertrag zuständig ist, sondern diesen alleine, ohne Mitbestimmungsrechte der Mitgliedstaaten, aushandeln und abschließen darf. Zu beachten ist hier, dass eine sekundärrechtliche Generalklausel nicht ausreichen kann, einen gesamten Bereich in die Zuständigkeit der Union zu überführen. 633 „Die Union hat ferner ausschließliche Zuständigkeit für den Abschluss internationaler Übereinkünfte, wenn der Abschluss einer solchen Übereinkunft in einem Gesetzgebungsakt der Union vorgesehen ist [ . . . ].“ Zu einer weitergehenden vergleichenden Analyse der beiden Vorschriften vgl. die Ausführungen unten, § 10 V.
346
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Die Entstehung einer Zuständigkeit nach Art. III-323 Abs. 1 Var. 3 EVV kann nur angenommen werden, wenn völkerrechtliche Bestimmungen einen hinreichend bestimmten Bezug zu bestehendem Unionsrecht haben. Der Verfassungsvertrag konkretisiert diesen besonderen Bezug jedoch nicht, wodurch die Rechtssicherheit im völkerrechtlichen Verkehr beeinträchtigt und Grauzonen der Unsicherheit hinsichtlich des Umfangs europäischer und mitgliedstaatlicher Zuständigkeit nicht beseitigt werden.634 Auffallend ist schließlich, dass in Art. III-323 Abs. 1 Var. 3 EVV von „verbindlichen Rechtsakten“ der Union die Rede ist, in Art. I-13 EVV dagegen von „Gesetzgebungsakten“.635 Verbindliche Rechtsakte sind gemäß Art. I-33 EVV Europäische Gesetze, Europäische Rahmengesetze, Europäische Verordnungen und Europäische Beschlüsse (Empfehlungen und Stellungnahmen sind gemäß Art. I-33 Abs. 1 UAbs. 6 EVV unverbindlich). Gesetzgebungsakte sind nach Art. I-34 EVV nur Europäische Gesetze und Europäische Rahmengesetze. Damit fallen Europäische Gesetze und Europäische Rahmengesetze in die Schnittmenge beider Vorschriften. Diese Gesetzgebungsakte können sowohl die Kompetenzgrundlage für internationale Übereinkünfte nach Art. III-323 EVV als auch den Rechtsgrund für eine ausschließliche Zuständigkeit nach Art. I-13 Abs. 2 EVV bilden. Europäische Verordnungen und Europäische Beschlüsse indes können nur Grundlage für eine Kompetenz nach Art. III-323 EVV sein.
634 Ähnlicher Gedanke bei Thym, EuropaR 2003, 277 (283) betreffend das Open-Skies-Urteil des EuGH. 635 Das Problem hat sich nach der Regierungskonferenz größtenteils entschärft. Im Konventsentwurf war noch in Art. I-11 KE-EVV von „bindenden“ Rechtsakten, in Art. III-225 Abs. 1 KE-EVV dagegen lediglich von „Rechtsakten“ die Rede. Nach den Verfassungsbestimmungen kann die Union gemäß Art. I-33 EVV mittels folgender Rechtsakte ihre in der Verfassung übertragenen Zuständigkeiten ausüben: durch Europäische Gesetze, Europäische Rahmengesetze, Europäische Verordnungen, Europäische Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen. Von diesen Rechtsakten sind nur die Empfehlungen und Stellungnahmen der Organe nicht rechtlich bindend (Art. I-33 Abs. 1 UAbs. 6 EVV). Demgemäß hätte der Union nach dem Konventsentwurf keine Außenkompetenz nach Art. III-225 KE-EVV zugestanden, falls der Abschluss eines internationalen Übereinkommens lediglich in einer Empfehlung oder Stellungnahme vorgesehen gewesen wäre, dagegen wären (widersprüchlicherweise) die Tatbestandsvoraussetzungen einer ausschließlichen Kompetenz nach Art. I-12 KE-EVV erfüllt gewesen. Da es unsinnig ist, für das Vorliegen einer ausschließlichen Außenkompetenz (mit ihren weit einschneidenderen Folgen für die Souveränität der Mitgliedstaaten) geringere Anforderungen zu stellen als für das Vorliegen einer generellen (geteilten) Außenkompetenz, wäre es wohl sinnvoll gewesen, das Tatbestandsmerkmal „bindend“ auch in Art. I-12 Abs. 2 Var. 1 KE-EVV hineinzulesen. Solche vergleichsweise schwachen Rechtsakte wie Empfehlungen und Stellungnahmen hätten nämlich nicht derart weitreichende Folgen bewirken dürfen, wie es die Einräumung einer ausschließlichen Zuständigkeit darstellt. Aufgrund der Korrektur des Wortes „Rechtsakt“ durch „Gesetzgebungsakt“ wurde das Verhältnis zwischen beiden Vorschriften wieder zurechtgerückt.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
347
c) Art. III-323 Abs. 1 Var. 4 EVV Schließlich steht der Union eine Außenkompetenz zu, wenn der Abschluss einer Übereinkunft gemeinsame Vorschriften der Union beeinträchtigen oder deren Anwendungsbereich ändern könnte.636 Auch diese Formulierung findet sich in ähnlicher Weise in Art. I-13 EVV, genauer gesagt in Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV, wieder. Ist dieses Tatbestandsmerkmal erfüllt, so hat die Union ebenso wie im Fall des Art. III-323 Abs. 1 Var. 4 EVV nicht nur eine Außenkompetenz, sondern sogar eine ausschließliche Außenkompetenz. Die strukturellen Ähnlichkeiten zwischen Art. III-323 Abs. 1 Var. 4 EVV und Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV werden in einem gesonderten Abschnitt untersucht.637
d) Bewertung Geht man davon aus, dass der Zuständigkeitsbereich einer internationalen Organisation nach verschiedenen Gesichtpunkten bestimmt werden kann, etwa in Form einer Aufzählung bestimmter Gegenstände oder anhand der von der Organisation verfolgten Zielsetzung638, so zeigt sich, dass der Verfassungsvertrag im Rahmen der Außenkompetenz der Union beide Möglichkeiten in ungewöhnlicher Weise miteinander verknüpft. Zum einen benennt er konkrete Gegenstände, die eine Außenkompetenz begründen (etwa im Bereich der Handelspolitik), zum anderen hält er eine „Auffangkompetenz“ (Art. III-323 Abs. 1 Var. 2, 3, 4 EVV) bereit, welche sich vor allem auf die Ziele der Europäischen Union bezieht. Aufgrund der Weite der Tatbestandsmerkmale des Art. III-323 Abs. 1 EVV und der neuartigen Festlegung eines Ziel-Mittel-Schlusses zur Begründung einer generellen Außenkompetenz der Union sind die Außenkompetenzen der Europäischen Union erweitert worden, ohne jedoch klar bestimmt zu werden. Auch wenn alle Bemühungen um Schärfung und Präzisierung der Kompetenzbestimmungen des Unionsrechts schnell auf natürliche, in den Eigenarten der Sprache und in der Natur der Sache liegenden Grenzen stoßen639, ist es bedauerlich, dass die Außenkompetenzen der Europäischen Union vom Verfassungsvertrag an einigen Stellen nicht sorgfältig formuliert wurden. Sicherlich muss die Kompetenzabgrenzung in gewissem Umfang als diskursiver Prozess verstanden wer636 Die noch im Konventsentwurf enthaltene Einschränkung, wonach die Beeinträchtigung interner Rechtsakte der Union notwendig ist, ist in der endgültigen Fassung des Verfassungsvertrages nicht mehr enthalten, vgl. Art. III-225 Abs. 1 Var. 4 KE-EVV einerseits und Art. III-323 Abs. 1 Var. 4 EVV andererseits. 637 Siehe unten, § 10 V. 3. 638 So zum Beispiel Heinrichs, Die Auswärtigen Beziehungen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, S. 131. 639 Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (536).
348
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
den, in dem es um die Vermittlung und den Ausgleich der supranationalen mit den nationalen Interessen geht und die Kompetenzabgrenzung insofern eine Rationalisierung des Diskurses über derartige Interessen bedeutet.640 Allerdings wäre es sinnvoll gewesen, wenn der Verfassungsvertrag dem Rechtsanwender detailliertere und kontrastreichere Abgrenzungsmerkmale an die Hand gegeben hätte. Im Bereich der allgemeinen Außenkompetenzen steht demnach zu befürchten, dass Kompetenzfragen auch in Zukunft in weiten Teilen der politischen Entscheidung überlassen bleiben, weil rechtliche Fixierungen fehlen.641 Bei Verhandlungen im Rahmen von völkerrechtlichen Übereinkommen muss im Vorfeld klar sein, ob die Europäische Union oder die Mitgliedstaaten zuständig sind, einen bestimmten Bereich vertraglich zu regeln. Hierzu sind klare Abgrenzungskriterien nötig. Die juristische Definition der Reichweite der Außenkompetenzen dem EuGH zu überlassen, ist keine befriedigende Lösung. Eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten ist nicht nur im eigenen Interesse der EU und der Mitgliedstaaten notwendig, um effektiv handeln zu können. Im Bereich der Außenkompetenzen müssen zudem auch die Rechte der Vertragspartner geschützt werden.642 Im Hinblick auf die notwendige Wahrung der Rechtssicherheit im Völkerrechtsverkehr wären damit möglichst trennscharfe Abgrenzungskriterien notwendig gewesen.
IV. Ausschließliche Kompetenzen, Art. I-13 EVV Die Frage nach der Ausschließlichkeit der Außenkompetenz ist von entscheidender Bedeutung für die Handlungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten. Wird der Union eine ausschließliche Außenkompetenz eingeräumt, so ist, wie der Begriff schon sagt, ausschließlich die Union Akteur auf internationaler Ebene, die Mitgliedstaaten sind gleichsam zum Zuschauen verdammt (pre-emptive exclusivity oder a priori exclusivity643).644 Ihnen steht kein Mitentscheidungsrecht, wie etwa bei gemischten Verträgen, zu. Die Mitgliedstaaten können ferner zu keiner Zeit rechtlich verbindliche Akte erlassen.645 Die ausschließliche Zuständigkeit wird nun in Art. I-13 EVV erstmals zentral geregelt. Art. I-13 EVV regelt die ausschließliche Zuständigkeit nicht nur für die 640 641
Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (536). Wuermeling, EuropaR 2004, 216 (228); weniger kritisch Ruffert, EuropaR 2004, 165
(189). Thym, EuropaR 2003, 277 (285). Vgl. zu diesen Begriffen Dashwood, CMLRev 2004, 355 (370) m. w. N. 644 Eine Nebenfolge der ausschließlichen Zuständigkeit nach Art. I-13 EVV ist zudem, dass in den betreffenden Bereichen eine verstärkte Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten untereinander nach Art. I-44 und Art. III-416 bis III-423 EVV nicht möglich ist. 645 Craig, ELRev 2004, 323 (329). 642 643
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
349
internen, sondern auch für die externen Kompetenzen. In der vorliegenden Untersuchung ist jedoch nur auf die ausschließlichen Außenkompetenzen der Union einzugehen. Wie im Zweiten Teil bereits dargestellt, beruhten bisher die Bedingungen für das Bestehen einer ausschließlichen Kompetenz auf Richterrecht.646 Daher ist es schon aus dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit und -klarheit zu begrüßen, dass nunmehr die Voraussetzungen für die Begründung von ausschließlichen Zuständigkeiten auf primärrechtlicher Ebene geregelt worden sind. Die Vorschrift lautet folgendermaßen: Art. I-13 EVV Bereiche mit ausschließlicher Zuständigkeit (1) Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit in folgenden Bereichen: a) Zollunion, b) Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln, c) Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, d) Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik, e) gemeinsame Handelspolitik. (2) Die Union hat ferner ausschließliche Zuständigkeit für den Abschluss internationaler Übereinkünfte, wenn der Abschluss einer solchen Übereinkunft in einem Gesetzgebungsakt der Union vorgesehen ist, wenn er notwendig ist, damit sie ihre interne Zuständigkeit ausüben kann, oder soweit er gemeinsame Regeln beeinträchtigen oder deren Tragweite verändern könnte.
Art. I-13 EVV zählt zunächst in seinem Abs. 1 lit. a bis e enumerativ diejenigen Bereiche konkret auf, die unter die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen.647 Es ist davon auszugehen, dass es sich um eine abschließende Auflistung handelt.648 Art. I-13 Abs. 1 EVV regelt grundsätzlich die internen ausschließlichen Kompetenzen649, wenngleich einzelne Aspekte auch dem Auftreten der Union nach außen zugeordnet werden müssen. Der Katalog aus Abs. 1 soll hier daher nur kurz erwähnt werden. Er entspricht weitgehend dem bisherigen Verständnis des Primärrechts.650 In Art. I-13 Abs. 2 EVV schließlich werden allgemein die VorausSiehe oben, § 4 VI. 2. d); vgl. auch Dashwood, CMLRev 2004, 355 (371). Der Inhalt der in die Liste der ausschließlichen Zuständigkeiten aufzunehmenden Sachbereiche änderte sich im Laufe der Konventsberatungen fortwährend. So waren auch schon die vier Grundfreiheiten auf dieser Liste zu finden. Angesichts der weitreichenden und in der Kürze der Zeit nicht abzuschätzenden Folgen einer ausschließlichen Zuständigkeit in diesen Bereichen plädierte der Konvent jedoch schließlich dafür, dass die Grundfreiheiten in einer eigenen Vorschrift aufgenommen werden sollten (Art. I-4 EVV). 648 So auch die Ansicht des Präsidiums des Konvents, CONV 724 / 03, S. 70; anders offenbar Görlitz, DÖV 2004, 374 (375), der von der „Nennung einiger exemplarischer Zuständigkeiten“ spricht. 649 Craig, ELRev 2004, 323 (329). 646 647
350
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
setzungen genannt, unter denen die Union ausschließlich zuständig ist für den Abschluss internationaler Übereinkünfte.
1. Zollunion Art. I-13 Abs. 1 lit. a EVV Die Zollunion ist einerseits in den Bereich des Binnenmarktes651 und dort in den Bereich des Warenverkehrs einzuordnen. Sie umfasst vor allem das Verbot, zwischen den Mitgliedstaaten Ein- und Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wirkung zu erheben. Andererseits fällt die Zollunion in Gestalt des gemeinsamen Außenzolls in den Bereich der europäischen Handelspolitik. Dieser zählt zu den wesentlichen Merkmalen der europäischen Zollunion. Er besteht darin, dass auf die aus Drittländern eingeführten Waren ein einheitlicher Zollsatz erhoben wird, und zwar unabhängig davon, welcher Mitgliedstaat Empfänger der Waren ist. Der gemeinsame Außenzoll bewirkt einen einheitlichen Schutz aller Mitgliedstaaten gegenüber Drittländern und stellt de facto eine Gemeinschaftspräferenz her (da auf die Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten kein Zoll erhoben wird, werden sie automatisch günstiger behandelt als Importe aus Drittländern). Die Vorschrift zur Schaffung einer Zollunion (bisher Art. 131 EG) wurde etwas verändert. Art. III-314 EVV ergänzt die Zielsetzung der Zollunion dahingehend, dass sie auch die schrittweise Beseitigung der Beschränkungen bei den ausländischen Direktinvestitionen und anderer Schranken umfasst. Damit soll anerkannt werden, dass die Finanzströme den Güterverkehr ergänzen und heute einen großen Teil des Handels ausmachen.652 Im Übrigen enthält der Verfassungsvertrag keine Neuerungen.
2. Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarktes erforderlichen Wettbewerbsregeln, Art. I-13 Abs. 1 lit. b EVV Die Kompetenz nach Art. I-13 Abs. 1 lit. b EVV ist lediglich relevant für den Binnenmarkt. Kurz angemerkt sei hier, dass sich die genannte Kompetenz nur auf die Festlegung beziehungsweise Schaffung von Wettbewerbsregeln erstreckt, nicht auf deren Anwendung.653 Die ungenaue Formulierung des Verfassungsvertrages hat bereits zu Auseinandersetzungen darüber geführt, was unter der „Festlegung 650 Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (529); allerdings wird entgegen der bisherigen Auffassung der Kommission (Agence Europe vom 30. 10. 1992, Nr. 1804 / 05) insbesondere der Bereich Agrarpolitik nicht als ausschließliche Zuständigkeit der Union behandelt. 651 Zu Problemen, insbesondere zur Abgrenzung zu Binnenmarktkompetenzen, die weitestgehend geteilte Kompetenzen darstellen, vgl. Craig, ELRev 2004, 323 (328). 652 CONV 685 / 03, S. 52. 653 Craig, ELRev 2004, 323 (328).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
351
der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln“ zu verstehen ist. Problematisch ist die Abgrenzung welche Fälle unter Art. I-13 Abs. 1 lit. b EVV subsummiert werden können und damit in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen und welche Fälle zum „Binnenmarkt“ nach Art. I-14 Abs. 2 lit. a EVV und damit zur geteilten Zuständigkeit gehören. So ist insbesondere fraglich, ob Art. I-13 Abs. 1 lit. b EVV auch den Bereich der Art. III-161 und III-162 EVV (derzeit Art. 81 und 82 EG) in die ausschließliche Zuständigkeit der Union überführt, oder ob sich der genannte Verfassungsartikel allein auf die Rechtsetzungskompetenz nach Art. III-163 EVV bezieht.654 Unstreitig gehört jedenfalls die Rechtsangleichung zur Beseitigung von Wettbewerbsverfälschungen nach Art. III-172 EVV (derzeit Art. 95 EG) zum Bereich der geteilten Zuständigkeit gemäß Art. I-14 Abs. 2 lit. a EVV.655 3. Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, Art. I-13 Abs. 1 lit. c EVV In lit. c ordnet Art. I-13 Abs. 1 EVV die Währungspolitik in die ausschließliche Zuständigkeit der Union ein. Aufgrund des weiten Wortlautes muss davon ausgegangen werden, dass damit sowohl die Währungsinnenpolitik (als wichtigster Regelungsbereich) als auch die Währungsaußenpolitik in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fällt. In gewissem Widerspruch hierzu steht Art. III-326 Abs. 4 EVV, welcher nahezu wortgleich die Vorschrift des Art. 111 Abs. 5 aus dem EG-Vertrag übernimmt, wonach die Mitgliedstaaten das Recht haben, unbeschadet der Gemeinschaftszuständigkeit und der Gemeinschaftsvereinbarungen über die Wirtschafts- und Währungsunion in internationalen Gremien Verhandlungen zu führen und internationale Vereinbarungen zu treffen. Damit wurde die Chance versäumt, letzte Unklarheiten656 bezüglich eventuell bei den Mitgliedstaaten verbliebener Kompetenzen im Bereich der Währungsaußenpolitik zu beseitigen. Nach der hier vertretenen Ansicht kann sich Art. 111 Abs. 5 EG nämlich nur auf die Zeit vor Eintritt in die dritte Stufe der Währungsunion beziehen, denn nach Eintritt dieser Stufe haben die Mitgliedstaaten ihre Währungssouveränität verloren.657 Aus dem Sinn und Zweck der Währungsunion ergibt sich, dass kein Raum mehr für eigenständige mitgliedstaatliche Aktivitäten im Bereich der Währungspolitik verbleiben kann. Selbst diejenigen Abkommen, die einzelne Mitgliedstaaten vor Eintritt der dritten Stufe der Währungsunion abgeschlossen haben, dürfen von den Mitgliedstaaten nicht autonom geändert werden. Hierzu ist eine Ermächtigung durch den Rat erforderlich.658 654 Vgl. zur Diskussion Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (226 ff.), Craig, ELRev 2004, 323 (327 f.); anders Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (531), der von einem Ende der Streitigkeiten spricht. 655 Ludwigs, ZEuS 2004, 211 (226). 656 Vgl. hierzu bereits oben, § 4 III. 3. e). 657 Potacs, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 111 EGV, Rdnr. 4; vgl. oben, § 4 III. 3. e).
352
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Es sind demnach keine Bereiche vorstellbar, in denen diejenigen Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, währungsaußenpolitisch alleine tätig werden dürften. Damit ist ausschließlich die Europäische Union befugt, völkerrechtliche Verträge im Bereich der Währungsaußenpolitik abzuschließen.659 In Bezug auf Währungsabkommen ist weiterhin die spezielle Verfahrensvorschrift des Art. III-326 EVV zu berücksichtigen.660
4. Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik, Art. I-13 Abs. 1 lit. d EVV Auch diese Fallgruppe verdankt ihre Erwähnung der EuGH-Judikatur. Der EuGH musste in der Rechtssache Kramer661 prüfen, inwieweit die Mitgliedstaaten berechtigt waren, nationale Fangquoten aufzustellen.662 Der Gerichtshof urteilte, dass die Mitgliedstaaten zur Zeit des zu beurteilenden tatsächlichen Geschehens noch befugt waren, internationale Verpflichtungen zu übernehmen. Diese Kompetenz hatte jedoch nur Übergangscharakter und lief gemäß Art. 102 der zitierten Beitrittsakte von 1972 spätestens mit dem sechsten Jahr nach dem Beitritt aus.663 Hieraus folgt, dass die Gemeinschaft spätestens zu dem genannten Zeitpunkt für die Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik ausschließlich zuständig wurde.664 Damit hatte der EuGH ausdrücklich eine Fallgruppe für eine ausschließliche Zuständigkeit genannt, die er auch in späteren Entscheidungen immer wieder aufgriff. Diese Fallgruppe blieb in der Literatur auch weitgehend unbestritten665, und daher war es abzusehen, dass sie nun vom Verfassungsvertrag übernommen und damit ausdrücklich kodifiziert werden sollte.
658 So auch Potacs, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 111 EGV, Rdnr. 4 zur jetzigen Rechtslage unter Verweis auf die Entscheidung 683 / 98 des Rates über Wechselkursfragen im Zusammenhang mit dem CFA-Franc und dem Komoren-Franc (ABl. 1998 L 320, 58) und die Entscheidung 744 / 98 des Rates über Wechselkursfragen im Zusammenhang mit dem KapVerde-Escudo (ABl. 1998 L 358, 111). 659 So auch Cremona, CMLRev 2003, 1347 (1361 f.). 660 Siehe hierzu unten, § 10 VII. 6. 661 EuGH, Slg. 1976, 1279 – Kramer. 662 Siehe zu einer ausführlichen Besprechung dieses Urteils bereits oben, § 4 VI. 2. d) bb). 663 Die Übergangsfrist lief am 01. 01. 1979 aus. 664 EuGH, Slg. 1976, 1279 (1312, Rdnr. 40 f.) – Kramer. 665 Siehe zu einer vertiefteren Auseinandersetzung für den Fischereibereich Nolte, Die völkerrechtliche Vertragspraxis der EG und die Haftung der Mitgliedstaaten am Beispiel der Fischereipolitik, S. 38 f.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
353
5. Gemeinsame Handelspolitik, Art. I-13 Abs. 1 lit. e EVV Art. I-13 Abs. 1 lit. e EVV kodifiziert die langjährige und weithin anerkannte Rechtsprechung des EuGH zu Art. 133 EG. Es wird klargestellt, dass die Europäische Union auf dem Gebiet der gemeinsamen Handelspolitik ausschließlich zuständig ist. Mit der Regelung soll verhindert werden, dass die bereits vergemeinschaftete Handelspolitik durch internationale Abkommen der Mitgliedstaaten konterkariert wird. Zudem wird die Position der Union gestärkt, da sie auf internationaler Ebene tatsächlich mit einer Stimme sprechen kann. Dass der Union im Rahmen der Gemeinsamen Handelspolitik eine ausschließliche Zuständigkeit zusteht, war weithin unbestritten. Entscheidend für die Bedeutung dieser ausschließlichen Kompetenz ist jedoch, wie weit der Begriff „Gemeinsame Handelspolitik“ zu interpretieren ist. Ob durch den Verfassungsentwurf die gemeinsame Handelspolitik einen weiteren Anwendungsbereich erhält als durch die jetzige höchstrichterliche Auslegung, die im Wesentlichen durch das WTOGutachten geprägt ist, wurde bereits oben in einem speziellen Abschnitt behandelt.666
6. Allgemeine Voraussetzungen für das Vorliegen einer ausschließlichen Außenkompetenz der Europäischen Union, Art. I-13 Abs. 2 EVV Neben der Aufzählung von spezifischen Bereichen, in denen die Union ausschließlich zuständig ist, bestehen nach Art. I-13 Abs. 2 EVV drei Varianten der grundsätzlichen ausschließlichen Zuständigkeit der Union zum Abschluss völkerrechtlicher Abkommen.
a) Explizite Erwähnung des Abschlusses eines internationalen Übereinkommens in einem Gesetzgebungsakt der Union, Art. I-13 Abs. 2 Var. 1 EVV Diese Fallgruppe des Entstehens einer ausschließlichen Zuständigkeit mag zunächst überraschen, bedeutet sie doch, dass die Union mit Hilfe eines (internen) Gesetzgebungsakts eine ausschließliche Außenkompetenz begründen kann.667 Gesetzgebungsakte sind gemäß Art. I-34 Abs. 1 EVV Europäische Gesetze und Rahmengesetze; sie werden nach dem Verfahren des Art. III-396 EVV auf Vorschlag der Kommission vom Europäischen Parlament und dem Rat gemeinsam erlassen. Die Europäische Union kann demnach durch ein Gesetz oder Rahmengesetz Vgl. oben, § 10 II. 4. Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (532 f.) nennt die Regelung daher auch „inhaltlich unklar und rechtspolitisch fragwürdig“. 666 667
23 Metz
354
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
regeln, dass zu einem bestimmten Themenbereich der Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages vorgesehen ist. Alleine durch diese Regelung fällt der betreffende Themenbereich in die ausschließliche Zuständigkeit der Union. Zu beachten ist jedoch, dass die Union nicht einfach weite Rechtsgebiete durch den bloßen Erlass eines Gesetzes in die gemeinschaftliche ausschließliche Zuständigkeit „überführen“ kann. Vielmehr muss in dem jeweiligen Gesetz ausdrücklich festgehalten werden, über welchen Gegenstand die Union eine internationale Übereinkunft abschließen soll. Für eine solche Regelung wäre es aber ausreichend, wenn die Union in einem bestimmten Bereich die Zuständigkeit für Verhandlungen mit Drittstaaten einem Unionsorgan überträgt. Die Entstehung einer ausschließlichen Zuständigkeit kann nur angenommen werden, wenn der Unionsrechtsakt einen hinreichend bestimmten Bezug zu den zu treffenden völkerrechtlichen Bestimmungen aufweist. Diese Voraussetzung wird aus dem Wortlaut der Vorschrift nicht deutlich, der Verfassungsvertrag hat es versäumt, hinreichend konkrete Kriterien aufzustellen, an die sich der Rechtsanwender halten kann. Es ist demnach zu erwarten, dass dem EuGH die Aufgabe zukommen wird, nähere Kriterien für die Annahme einer Zuständigkeit nach Art. I-13 Abs. 2 Var. 1 EVV aufzustellen. Eine rechtliche Klärung dieser Frage ist erforderlich, damit die Rechtssicherheit im völkerrechtlichen Verkehr gewahrt und Grauzonen der Unsicherheit hinsichtlich des Umfangs europäischer und mitgliedstaatlicher Zuständigkeiten begrenzt werden.668
aa) Kodifizierung der EuGH-Rechtsprechung Art. I-13 Abs. 2 Var. 1 EVV entspricht den vom EuGH entwickelten Grundsätzen und der derzeit geltenden Rechtslage. Der EuGH hat in seinem Open-Skies Urteil festgehalten: „Hat die Gemeinschaft in ihre internen Rechtsetzungsakte Klauseln über die Behandlung der Angehörigen von Drittstaaten aufgenommen oder hat sie ihren Organen ausdrücklich eine Zuständigkeit zu Verhandlungen mit Drittstaaten übertragen, erwirbt sie somit eine ausschließliche Außenkompetenz nach Maßgabe des von diesen Rechtsakten erfassten Bereichs.“669
Dies setzt natürlich zunächst voraus, dass der Union zum Erlass einer solchen Vorschrift die Binnenkompetenz zusteht, andernfalls wäre dieser Rechtsakt ungültig. Gleichzeitig bedeutet dies jedoch auch, dass sich die Union (falls ihr die ent668 So Thym, EuropaR 2003, 277 (283) in seiner Besprechung des Urteils zum OpenSkies-Abkommen. Der Gedanke lässt sich aber auch auf die Rechtslage nach dem Verfassungsvertrag übertragen. 669 EuGH, EuZW 2003, 82 (89, Rdnr. 109) = EuGH, Slg. 2002, I-9855, Rdnr. 109 – OpenSkies-Abkommen; wortgleiche Ausführungen enthält auch EuGH, Slg. 1994, I-5267 (5416, Rdnr. 95) – WTO; inhaltlich übereinstimmend ebenfalls EuGH, Slg. 1995, I-521 (559 f., Rdnr. 33) – OECD.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
355
sprechende Innenkompetenz zusteht) bei entsprechendem Unionswillen selbst eine ausschließliche Außenzuständigkeit verleihen kann. Insofern kann man von einer „Selbstermächtigungsklausel“ sprechen670, die schon deshalb problematisch ist, weil durchaus nicht in allen Fällen, in denen sekundärrechtlich der Abschluss internationaler Abkommen vorgesehen ist, ein sofortiger Ausschluss mitgliedstaatlichen Handelns geboten ist. Wenn der geplante Abschluss von internationalen Übereinkünften in einem internen Rechtsakt geregelt wird, sind für diesen Akt die jeweils vorgeschriebenen Mehrheitsverhältnisse erforderlich, also keineswegs immer Einstimmigkeit, sondern regelmäßig die (qualifizierte) Mehrheitsentscheidung. Eine ausschließliche externe Zuständigkeit ist damit potentiell in allen Binnenkompetenzen angelegt. Jedoch kann von der Innenkompetenz nicht automatisch auf eine ausschließliche Außenkompetenz geschlossen werden, da für eine solche Kompetenz, wie erwähnt, ein entsprechender Handlungswille der Union in einem Gesetzgebungsakt explizit zum Ausdruck kommen muss.
bb) Verfassungsrechtlich problematische Wirkung des Sekundärrechts Problematisch erscheint hier das Verhältnis von Sekundärrecht zum Verfassungsrecht der Union. Letztlich wirkt nämlich ein Sekundärrechtsakt kompetenzbegründend, zumindest ändert er die Art der Kompetenz.671 Da der Union jedoch nicht die – nur für souveräne Staaten charakteristische – Kompetenz-Kompetenz zusteht, sondern die Mitgliedstaaten die „Herren der Verträge“672 bleiben müssen, widerspricht Art. I-13 Abs. 2 Var. 1 EVV – soweit ein Sekundärrechtsakt kompetenzbegründend wirken soll – Grundprinzipien der Verfassung. Ändert der Sekundärrechtsakt lediglich die Art der Kompetenz, liegt strukturell ein ähnlicher Fall vor, wie er in Art. I-12 Abs. 2 S. 2 EVV (für die geteilten Zuständigkeiten) geregelt ist. Eine potenziell so weitgehende Ausdehnung der ausschließlichen Zuständigkeit der Union, wie sie in Art. I-13 Abs. 2 Var. 1 EVV vorgesehen ist, wäre überdies gar nicht notwendig gewesen, da es bereits das Loyalitätsprinzip aus Art. I-5 EVV den Mitgliedstaaten verbietet, Verträge abzuschließen, die zur Beeinträchtigung von Unionsrecht führen können.673
Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (533). Auch Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (533), spricht von einer Überdehnung der Wirkweise von Sekundärrecht. Er weist zu Recht darauf hin, dass Sekundärrecht nicht kompetenzbegründend sein kann. Ob es jedoch einen Unterschied macht, dass die „sekundärrechtliche Programmatik“ zur ausschließlichen Zuständigkeit führt oder ob es letztlich das Sekundärrecht selbst ist, ist zu bezweifeln. 672 Heute richtiger: Die „Herren des Verfassungsvertrags“. 673 Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (533). 670 671
23*
356
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
cc) Parallelen und Unterschiede zum AETR-Prinzip Zum so genannten AETR-Prinzip674 bestehen strukturelle Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Beiden Prinzipien gemeinsam ist, dass die Ausübung einer internen Kompetenz zu einer ausschließlichen Kompetenz im Außenverhältnis führt. Das AETR-Prinzip setzt jedoch bestehende interne Rechtsnormen voraus, die konkret beeinträchtigt werden können. Die ausschließliche Zuständigkeit nach Art. I-13 Abs. 2 Var. 1 EVV kann dagegen schon dann ansetzen, wenn die Union (in einem Rechtsakt) lediglich ihre Absicht geäußert hat, ein bestimmtes Gebiet mit Hilfe völkerrechtlicher Verträge zu regeln.
dd) Bewertung der Rechtslage Mit Art. I-13 Abs. 2 Var. 1 EVV wird es der Union ermöglicht, durch – in Rechtsakten aufgenommene – Absichtserklärungen ein Politikfeld bereits im Vorfeld zu besetzen, ohne dass vorher hierzu abschließende innergemeinschaftliche Vorschriften erlassen werden müssten. Der Vorteil für die Union besteht darin, dass sie sich zeitaufwändige, weil detaillierte Regelungen ersparen kann, vor allem aber auch in der größeren Flexibilität. So kann die Union einzelne Politikfelder in ihre ausschließliche Zuständigkeit überführen und sich so gegen mitgliedstaatliches Handeln „absichern“. Auf diese Weise wird zwar einerseits Rechtssicherheit geschaffen, da in einem Gesetz deutlich nachlesbar sein wird, welche Bereiche in Zukunft von der Union international geregelt werden sollen und damit in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen. Wählt die Union dieses Mittel, so muss künftig nicht mehr geprüft werden, ob innergemeinschaftliche Vorschriften den Regelungsgehalt eines internationalen Abkommens vollkommen abdecken, oder ob aufgrund eines abgelegenen Bereichs noch immer eine Teilzuständigkeit bei den Mitgliedstaaten verblieben ist.675 Andererseits kann die genannte Regelung einen weitgehenden Kompetenzverlust für die Mitgliedstaaten bedeuten. In allen Politikfeldern, die der geteilten Zuständigkeit der Union angehören, sind die Mitgliedstaaten grundsätzlich befugt, auch völkerrechtliche Verträge abzuschließen (soweit sie nicht ausdrücklichem EU-Recht widersprechen). Diese Möglichkeit wird den Mitgliedstaaten genommen, wenn sich die Union dazu entschließt, eine internationale Regelung in einem Vertrag treffen zu wollen. Eine solche Vorgehensweise durch die Union ist durch keine Vorschrift der Verfassung begrenzt. Sicherlich können die Mitgliedstaaten innerhalb des Rates einer solchen Regelung 674 Wonach der Gemeinschaft eine ausschließliche Zuständigkeit zusteht, weil es den Mitgliedstaaten verwehrt sein muss, mit Drittstaaten Verpflichtungen einzugehen, die bereits erlassene Gemeinschaftsnormen beeinträchtigen könnten. 675 In EuGH, Slg. 1994, I-5267 (5411, Rdnr. 77) – WTO, führt der Gerichtshof aus: „Nur in dem Maße, wie gemeinsame Vorschriften auf interner Ebene erlassen werden, wird die externe Zuständigkeit der Gemeinschaft zu einer ausschließlichen. Bisher sind jedoch noch nicht alle den Verkehr betreffenden Fragen durch gemeinsame Vorschriften geregelt.“
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
357
widersprechen, es bestehen jedoch keine kompetenzbegrenzenden Normen innerhalb des Verfassungsvertrages. Mit einer ähnlichen Begründung, wie sie in Art. I-13 Abs. 2 Var. 1 EVV enthalten ist, müsste theoretisch auch eine ausschließliche Außenkompetenz der Union herzuleiten sein, wenn ihr im Primärrecht, also im Verfassungsvertrag selbst, eine Vertragsschlusskompetenz eingeräumt wird. Der klare Wortlaut des Art. I-13 Abs. 2 EVV macht einen solchen Schluss indes unmöglich, da hier lediglich von Gesetzgebungsakten der Union und nicht von Vorschriften der Verfassung die Rede ist. Dies führt zu dem interessanten Ergebnis, dass die Union durch bloße Erwähnung völkerrechtlicher Übereinkünfte in Gesetzgebungsakten (Sekundärrecht) ausschließliche Kompetenzen selbst schaffen kann, die Erwähnung von Außenkompetenzen in der Verfassung jedoch nicht zu einer ausschließlichen Zuständigkeit führt.676 Eine solche muss vielmehr durch die Subsumtion unter Art. I-13 EVV ausdrücklich festgestellt werden. Wichtig ist es, darauf hinzuweisen, dass die Neuregelung in keiner Weise an interne Kompetenzen anknüpft, etwa in der Weise, dass die Union nur auf denjenigen Gebieten eine externe ausschließliche Kompetenz zustehen kann, auf denen ihr auch eine interne ausschließliche Kompetenz zukommt.677 Dies führt zu einer vollständigen Abkopplung bezüglich der Art der Außenkompetenz von der Art der Innenkompetenz. Fraglich erscheint jedoch, ob nicht eine Verknüpfung zwischen der Innen- und der Außenkompetenz hergestellt werden muss. Steht der Union intern nur eine Unterstützungs-, Koordinierungs- oder Ergänzungszuständigkeit zu, so ist es sinnvoll, wenn auch internationale Abkommen in diesen Bereichen nicht über solche Maßnahmen hinausgehen dürfen. Damit würden sich die Beschränkungen im Innenverhältnis auch auf das Außenverhältnis auswirken. Die Notwendigkeit einer solchen Verknüpfung zeigt sich, wenn man zum Beispiel die Vorschrift des Art. I-14 Abs. 3, 4 EVV ernst nimmt. Für den Bereich der Entwicklungszusammenarbeit regelt Art. I-14 Abs. 4 EVV eindeutig, dass Maßnahmen der Union nicht die Mitgliedstaaten daran hindern, ihre Zuständigkeit auszuüben. Wollte man es der Union nach Art. I-13 Abs. 2 Var. 1 EVV ermöglichen, durch den Erlass von Sekundärrecht die Zuständigkeit im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit in die ausschließliche Zuständigkeit zu überführen, wäre Art. I-14 Abs. 4 EVV sinnentleert. Eine Beschränkung des Art. I-13 Abs. 2 Var. 1 EVV in dem Sinne, dass er für die in Art. I-14 Abs. 3 und 4 EVV genannten Bereiche nicht gilt, ist damit zwar nicht eindeutig aus dem Wortlaut der Verfassung ersichtlich, jedoch zwingend geboten, um das Kompetenzsystem nicht ad absurdum zu führen.
676 Vgl. nur die wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittländern gemäß Art. III-319 EVV. 677 So auch Craig, ELRev 2004, 323 (330).
358
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
b) Notwendigkeit einer ausschließlichen Kompetenz, damit die Union ihre interne Zuständigkeit ausüben kann, Art. I-13 Abs. 2 Var. 2 EVV Nach Art. I-13 Abs. 2 Var. 2 EVV steht der Union eine ausschließliche Außenkompetenz zu, wenn der Abschluss eines internationalen Übereinkommens notwendig ist, damit die Union „ihre interne Zuständigkeit ausüben kann“. Hiermit kann nicht gemeint sein, dass die Union ohne den Abschluss eines internationalen Abkommens schlicht nicht fähig wäre, ihre interne Kompetenz auszuüben. Vielmehr ist die Situation gemeint, in der die Union zwar faktisch gemeinschaftsinterne Regeln erlassen kann, diese aber aufgrund der Natur des zu regelnden Problemkreises ohne die Einbeziehung von Drittstaaten nicht sinnvoll oder uneffektiv wären. Klassisches Beispiel ist die Festsetzung von Fangquoten im Fischereibereich.678 Die Begrenzung von Fangquoten ist natürlich ohne die Einbeziehung von Fischfang betreibenden Drittstaaten sinnlos, da die von den einheimischen Fischern geschonten Kontingente sofort von Drittstaatsfischern abgefischt werden würden. Ein anderes Beispiel aus der Rechtsprechung des EuGH ist das im Zweiten Teil bereits besprochene Stilllegungsfonds-Gutachten.679 Hier ging es darum, eine auf dem Rhein bestehende Überkapazität von Binnenschiffen durch Stilllegung abzubauen. Da aber auch der Nichtmitgliedstaat Schweiz an der Binnenschifffahrt auf dem Rhein beteiligt war, musste dieser ebenfalls mit in die neue Regelung einbezogen werden. In seinem Stilllegungsfonds-Gutachten, bestätigt im WTO-Gutachten, räumte der EuGH der Gemeinschaft eine ausschließliche Zuständigkeit für Fälle ein, in denen zuvor keine internen Regelungen erlassen worden sind, eine Regelung aber den Zielen der Gemeinschaft entspricht und ohne die Einbeziehung von Drittstaaten wirkungslos wäre. Damit wird deutlich, dass Art. I-13 Abs. 2 Var. 2 EVV der Rechtsprechung des Gerichtshofs nachgebildet werden sollte, wobei der neue Artikel aber unsauber formuliert ist.680 Nimmt man den Wortlaut des Artikels ernst, handelt es sich um eine misslungene Umsetzung der Rechtsprechung des EuGH.681 Erforderlich ist es daher, in die Variante 2 der Vorschrift die Adjektive „sinnvoll und effektiv“ hineinzulesen. Dann steht der Union eine ausschließliche Kompetenz zu, wenn der Abschluss eines internationalen Übereinkommens notwendig ist, damit die Union ihre interne Zuständigkeit sinnvoll und effektiv ausüben kann.682 Denkbar scheint es, die oben genannten Voraussetzungen, in das im Verfassungstext vorhandene Wort „notwendig“ hineinzulesen. Auf diese Weise würde eine allzu extensive Auslegung Vgl. EuGH, Slg. 1976, 1279 – Kramer. EuGH, Slg. 1977, 741 – Stilllegungsfonds. 680 Vgl. zu diesem Problem auch Dashwood, CMLRev 2004, 355, (372 f.). 681 So auch Dashwood, CMLRev 2004, 355, (372). 682 Dashwood schlägt vor, den Artikel dergestalt zu verändern, dass der Abschluss einer internationalen Übereinkunft „inextricably linked to the exercise of an internal competence of the Union“ sein müsse, Dashwood, CMLRev 2004, 355, (372). 678 679
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
359
dieser Vorschrift verhindert, und sie könnte im Sinne der EuGH-Rechtsprechung angewendet werden. Ähnliche Bedenken macht Craig geltend.683 Er räumt zwar ein, dass die EuGHRechtsprechung weitgehend der jetzt getroffenen Regelung entspricht, meint aber zugleich, dass diese Voraussetzungen im Lichte des neuen Kompetenzgefüges gesehen werden müssten. So stellt Craig richtigerweise fest, dass die Außenkompetenz in keiner Weise an die Art der Innenkompetenz gekoppelt ist,684 mit der Folge, dass bei wörtlicher Anwendung des Art. I-13 Abs. 2 Var. 2 EVV eine ausschließliche Außenkompetenz aus einer geteilten oder gar parallelen Innenkompetenz folgen könnte.685 Craig kommt ebenfalls – im Sinne der gerade dargestellten Ansicht – zu dem Schluss, dass diese Folgen insoweit abgemildert werden müssen, als man hohe Anforderungen an die Auslegung des Wortes „notwendig“ stellt.
c) Beeinträchtigung eines internen Rechtsakts der Union durch den Abschluss eines internationalen Übereinkommens, Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV Diese Variante kodifiziert das älteste zu den Außenkompetenzen aufgestellte Prinzip, nämlich das AETR-Prinzip. Es fußt auf dem Gedanken, dass die Mitgliedstaaten der Union außerhalb des Rahmens der Gemeinschaftsorgane keine Verpflichtungen eingehen dürfen, welche Gemeinschaftsrechtsnormen beeinträchtigen könnten. Diesen Grundsatz leitete der Gerichtshof unter anderem aus Art. 10 EG her.686 Das an die Mitgliedstaaten gerichtete Verbot, auf Gebieten, die von Gemeinschaftsrechtsnormen bereits geregelt sind, internationale Verpflichtungen einzugehen, bedeutet umgekehrt, dass der Union auf diesen Gebieten eine ausschließliche Zuständigkeit zusteht.687
Craig, ELRev 2004, 323 (330 f.). Zum gleichen Ergebnis führt auch die wörtliche Auslegung des Art. I-13 Abs. 2 Var. 1 EVV, siehe dazu bereits oben unter a). 685 Craig, ELRev 2004, 323 (330 f.). 686 Vgl. EuGH, Slg. 1971, 263 (275, Rdnr. 20 / 22) – AETR (damals noch Art. 5 EWGV). Zu dem zweiten Begründungsstrang zur Herleitung einer Außenkompetenz siehe oben, § 4 VI. 2. d) aa). 687 Trüe, ZaöRV 2004, 391 (414) meint dagegen, diese „Umwandlung“ der Kompetenz verstoße gegen das Wesen der geteilten Zuständigkeit nach Art. I-12 Abs. 2 EVV. Sie argumentiert mit dem Wortlaut der Vorschrift und meint, dass die (Sperrwirkung entfaltende) Unionsrechtssetzung lediglich die Wahrnehmung der mitgliedstaatlichen Kompetenz verhindert und nicht ihre Existenz verändert. Trüe schlägt vor, die den Mitgliedstaaten zustehende Kompetenzart beizubehalten und eine Sperrwirkung in der Verfassung festzuschreiben. In der Sache ändert sich hierdurch nichts: Die Mitgliedstaaten sind daran gehindert, eigene Regelungen zu erlassen. 683 684
360
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Zunächst muss die etwas unglückliche Formulierung des Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV klargestellt werden: Es ist nicht der Abschluss eines Abkommens durch die Union, welcher einen internen Rechtsakt der Union beeinträchtigen könnte, vielmehr ist gemeint, dass der Abschluss eines bestimmten Übereinkommens durch einen oder mehrere allein handelnde Mitgliedstaaten eine gemeinsame Regel beeinträchtigen oder deren Tragweite verändern könnte.
aa) Probleme hinsichtlich der Bestimmbarkeit des Begriffs „beeinträchtigen“ Ein Problem mit der Formulierung des Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV ist, dass sie Raum für Spekulationen eröffnet, da nicht klar abgegrenzt werden kann, wann eine Beeinträchtigung gemeinsamer Regeln vorliegt oder wann eine Übereinkunft die Tragweite einer gemeinsamen Regel verändert. Denkbar sind direkte oder indirekte, starke oder schwache, wesentliche oder unwesentliche, signifikante oder lediglich periphere Beeinträchtigungen. Nach Nettesheim ist die genannte Formulierung eng auszulegen, die Mitgliedstaaten seien nur dann und nur insoweit am Handeln gehindert, wie das von ihnen in Aussicht genommene internationale Abkommen die Regelungswirkung eines EU-Aktes hinreichend greifbar konterkariere.688 Problematisch erscheint hier der Vergleich zur Open-Skies Rechtsprechung, denn nach dieser Rechtsprechung ist es den Mitgliedstaaten selbst dann verwehrt, völkerrechtliche Übereinkommen abzuschließen, wenn sie durch ausdrückliche Klauseln sicherstellen, dass das Unionsrecht durch das Abkommen nicht beeinträchtigt werden darf.
bb) Probleme hinsichtlich der möglichen Reichweite des Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV Ein ähnliches Problem wie bei Art. I-13 Abs. 2 Var. 1 und 2 EVV stellt sich auch im Rahmen des Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV. Auch hier kann bei wörtlicher Anwendung der 3. Variante eine ausschließliche Außenkompetenz aus einem internen Rechtsakt der Union resultieren, selbst wenn dieser Rechtsakt aus dem Bereich der parallelen oder unterstützenden Kompetenzen stammt. (1) Sperrwirkung nach Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV nur für den Bereich der geteilten Zuständigkeiten Die gerade genannte Konsequenz kann jedoch nur für den Bereich der geteilten Zuständigkeiten von der Verfassung gewollt sein, wie der Vergleich von Art. I-12 688
Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (532).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
361
Abs. 2 S. 2 EVV und Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV ergibt. Hier zeigen sich strukturelle Ähnlichkeiten. Genau genommen regeln Art. I-12 Abs. 2 S. 2 EVV und Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV denselben Fall. Grundsätzlich sind die Union und die Mitgliedstaaten berechtigt, ihre Zuständigkeiten wahrzunehmen und bestimmte Regelungen zu treffen oder Verträge auszuhandeln. In dem Moment, in dem allerdings die Union tätig wird, entfaltet dieses Handeln Sperrwirkung, und die Mitgliedstaaten dürfen in Zukunft nicht mehr ihre früheren Kompetenzen wahrnehmen. Aus Sicht der Mitgliedstaaten ist es nicht relevant, ob sie nicht mehr handeln dürfen, weil die Union eine geteilte Zuständigkeit ausgeübt hat, oder weil der Union formal (aufgrund von innerunionalen Regelungen) eine ausschließliche Zuständigkeit zum Abschluss internationaler Übereinkünfte zugewiesen wurde. Gewissermaßen erstreckt Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV die von Art. I-12 Abs. 2 S. 2 EVV für das innerunionale Verhältnis festgelegte Sperrwirkung auf völkerrechtliche Übereinkommen. Betrachtet man Art. I-12 Abs. 2 S. 2 EVV und Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV synoptisch, so lässt sich – zumindest für den Bereich der geteilten Zuständigkeiten – festhalten, dass ein Handeln der Union zum einen die Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene ausschließt (Wirkung des Art. I-12 Abs. 2 S. 2 EVV) und zum anderen den Mitgliedstaaten auch den Abschluss völkerrechtlicher Abkommen unmöglich macht (Wirkung des Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV). Zu beachten ist, dass jedes Handeln der Union per se ein (weiteres) Tätigwerden der Mitgliedstaaten ausschließt. Dies ergibt sich für die Binnenkompetenzen unmittelbar aus dem Wortlaut des Art. I-12 Abs. 2 S. 2 EVV, für den Bereich der Außenbeziehungen folgt dies aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs. Der EuGH prüft nämlich nicht, ob ein Abkommen gemeinsame Regeln tatsächlich beeinträchtigt, sondern geht davon aus, dass in den Bereichen, in denen die Gemeinschaft gehandelt hat, jedes Handeln der Mitgliedstaaten potentiell gegen die Zuständigkeit der Gemeinschaft verstößt und damit unzulässig ist.689 (2) Reduktion des Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV für die Bereiche der parallelen und der unterstützenden Kompetenzen sowie für den GASP-Bereich Interne Regelungen in den Bereichen der parallelen oder unterstützenden Kompetenzen müssen nicht zwangsläufig dazu führen, dass der Union im Außenverhältnis eine ausschließliche Zuständigkeit zusteht, wie es der Wortlaut des Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV nahe legt. Statt den Mitgliedstaaten jegliches Handeln auf internationaler Ebene zu verbieten (dies ist die „scharfe“ Folge der ausschließlichen Zuständigkeit), reicht es zur Vermeidung von Widersprüchen zum Unions689 Vgl. EuGH, EuZW 2003, 82 (90, Rdnr. 127) – Open-Skies, nach dem allein der Erlass einer Verordnung durch die Gemeinschaft die Bundesrepublik Deutschland daran hindert, internationale Verpflichtungen einzugehen, auch wenn deren Inhalt dem Gemeinschaftsrecht nicht zuwiderläuft.
362
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
recht aus, wenn sich die Mitgliedstaaten an das allgemeine Loyalitätsprinzip aus Art. I-5 EVV halten. Bereits dadurch wird sichergestellt, dass existierende Unionsregeln nicht durch externe Handlungen der Mitgliedstaaten konterkariert werden. Der Sinn und Zweck der parallelen und unterstützenden Kompetenzkategorien schließt es sogar aus, dass interne Regelungen eine ausschließliche externe Zuständigkeit der Union begründen. (a) Parallele Zuständigkeiten nach Art. I-14 Abs. 3, 4 EVV Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV hat seinem Wortlaut nach einen umfassenden Anwendungsbereich. Wie oben festgestellt, wächst der Union damit in dem Maße eine ausschließliche Außenkompetenz zu, wie sie selbst Vorschriften erlässt oder Verträge abschließt. Die ratio des Art. I-13 Abs. 2 EVV liegt darin, dass Rechtsakte der Union durch eigenmächtiges Auftreten der Mitgliedstaaten nach außen beeinträchtigt werden könnten und daher mittels der Einräumung ausschließlicher Zuständigkeiten „geschützt“ werden müssen. Vom Wortlaut des Art. I-13 Abs. 2 EVV erfasst sind grundsätzlich auch die Bereiche Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt (Art. I-14 Abs. 3 EVV), sowie die Bereiche Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe (Art. I-14 Abs. 4 EVV). Streng genommen müsste daher ein Handeln der Union zu einer ausschließlichen Zuständigkeit für die Union in den genannten Bereichen führen. Diese Folge schließt allerdings Art. I-14 Abs. 3 und 4 EVV jeweils ausdrücklich aus, denn dort ist geregelt, dass die Ausübung der Zuständigkeit durch die Union die Mitgliedstaaten nicht daran hindert, ihre Zuständigkeit auszuüben. Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass Art. I-13 Abs. 2 EVV lediglich für die externen Kompetenzen gelte, Art. I-14 EVV dagegen für interne Kompetenzen. Eine solche Differenzierung zwischen internen und externen Kompetenzen kommt nicht in Betracht, wie sich am Beispiel der Entwicklungshilfepolitik zeigt. Diese richtet sich notwendigerweise nach außen und ist mit dem Abschluss völkerrechtlicher Verträge verbunden. Art. I-14 Abs. 4 EVV kann sich damit nicht auf interne Aspekte der Zuständigkeit beziehen. Damit entfällt die Begründung für die Einräumung einer ausschließlichen Zuständigkeit, denn der Verfassungsvertrag selbst verzichtet auf einen Kompetenzschutz für die Union. Die in Art. I-14 Abs. 3 und 4 EVV genannten Bereiche können folglich nicht von Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV erfasst sein. Dasselbe gilt für die wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittländern nach Art. III-319 EVV. Nach der hier vertretenen Auffassung muss dieser Politikbereich nach seinem Sinn und Zweck in Art. I-14 Abs. 4 EVV hineingelesen und damit in die parallele Zuständigkeit eingeordnet werden. Damit gelten die obigen Ausführungen für Art. III-319 EVV entsprechend; Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV ist auf die wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittländern nicht anwendbar.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
363
(b) Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungskompetenzen, Art. I-17 EVV Ähnliche Überlegungen wie die zuvor genannten gelten auch für die Kompetenzen nach Art. I-17 EVV. Diese sind in der Rangfolge der Kompetenzkategorien des Verfassungsvertrages die schwächsten. Art. I-12 Abs. 5 EVV regelt ausdrücklich, dass die Ausübung der Zuständigkeit der Union in diesen Bereichen nicht dazu führt, dass die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten verdrängt werden. Auch für den Bereich der Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungskompetenzen muss demnach gelten, dass die Ausübung der internen Zuständigkeit nicht zu einer externen ausschließlichen Kompetenz führt. Auch hier ist es ausreichend, die Mitgliedstaaten auf den allgemeinen Loyalitätsgrundsatz aus Art. I-5 EVV zu verpflichten. Damit ist gewährleistet, dass einerseits die Unionsregeln auch im Außenverhältnis respektiert werden, andererseits dem Anliegen der Mitgliedstaaten Rechnung getragen werden kann, international als Akteur aufzutreten. Diese Regelung entspricht dem Sinn und Zweck der Kompetenzen nach Art. I-17 EVV am meisten. (c) GASP-Übereinkünfte, Art. I-16 EVV Speziell für den Bereich der GASP ist die Anwendbarkeit des Art. 13 Abs. 2 Var. 3 EVV problematisch. Art. I-16 EVV ist eine der Nahtstellen, welche sich durch die Verschmelzung der derzeitigen Säulen ergeben haben. Einerseits kommt der GASP im Vergleich zu anderen Politiken formal gesehen keine Sonderstellung zu690, insofern müsste Art. 13 Abs. 2 Var. 3 EVV eigentlich Anwendung finden. Andererseits gelten für den Bereich der GASP über weite Strecken verfahrensrechtliche Spezialnormen. Es ist demnach fraglich, ob der Abschluss eines GASP-Abkommens durch die Union zum Entstehen einer ausschließlichen Zuständigkeit führt. Vom Wortlaut der Vorschrift aus gesehen ergeben sich keine Bedenken, denn Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV sieht keine Ausnahmen vom Anwendungsbereich vor und gilt damit allgemein. Probleme entstehen aus der Tatsache, dass der Konvent und die Regierungskonferenz keine eindeutige Zuordnung der GASP in eine Kompetenzkategorie getroffen haben. Die GASP wird in einem „Sonderartikel“ (Art. I-16 EVV) geregelt, dieser gibt jedoch keinen Aufschluss darüber, welche Rechtsfolgen ein Tätigwerden der Union für die Kompetenzen der Mitgliedstaaten hat. Besondere Brisanz erhält das Problem dadurch, dass der Bereich der GASP von der Rechtsprechungsgewalt des Europäischen Gerichtshofs ausgeschlossen ist. Weil ein gerichtlicher Mechanismus zur Klärung dieser Kompetenzfrage damit 690 Die Vorschriften über die GASP sind unter Titel V „Auswärtiges Handeln der Union“ eingereiht (in Kapitel II ist die GASP, in Kapitel III die Handelspolitik und in Kapitel IV die Zusammenarbeit mit Drittländern und humanitäre Hilfe geregelt).
364
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
nicht existiert, kann der EuGH nicht feststellen, welcher Art die Kompetenz im GASP-Bereich ist. Im Hinblick auf den Abschluss internationaler Abkommen wird argumentiert, dass die geteilte Zuständigkeit im GASP-Bereich selbst dann nicht in eine ausschließliche Zuständigkeit umschlage, wenn ein Fall des Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV vorliege.691 Der Grund hierfür sei der, dass Art. I-16 EVV eine abschließende Sonderregelung darstelle, die die Anwendung von Art. I-13 Abs. 2 EVV ausschließe. Diese Sonderrolle sei damit zu erklären, dass es den Mitgliedstaaten derzeit politisch ausgeschlossen erscheine, der Union im Bereich der GASP ausschließliche Kompetenzen einzuräumen und damit eigene Handlungsbefugnisse zu verlieren.692 Allerdings bestehe auch im Bereich der GASP weiterhin die Pflicht, die von der Union erlassenen Maßnahmen zu beachten. Darüber hinaus bestehe im Verhältnis zwischen Mitgliedstaaten und Union auch im Außenbereich eine gegenseitige Loyalitätspflicht (Art. I-5 EVV), die unter anderem zu gegenseitiger Abstimmung verpflichte. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt man, wenn man in Art. I-16 EVV keine abschließende Sonderregelung sieht, sondern den Bereich der GASP in die parallele Zuständigkeit einordnet.693 Da Art. I-16 EVV gerade keine Regelungen über die Art der Zuständigkeit oder die Rechtsfolgen eines Tätigwerdens der Union trifft, kann in dieser Vorschrift nach der hier vertretenen Ansicht auch keine abschließende Sonderregelung gesehen werden. Wie bereits gezeigt694, würde der Abschluss einer GASP-Übereinkunft unter strenger Anwendung des Wortlautes des Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV zum Entstehen einer ausschließlichen Kompetenz für die Union in diesem Bereich führen. Wie oben dargestellt, würde eine solche Lösung nicht der Systematik des Verfassungsvertrages und erst recht nicht den politischen Gegebenheiten entsprechen. Es ist daher eine Einordnung in die parallele Zuständigkeit vorzunehmen mit der Folge, dass sowohl die Union als auch die Mitgliedstaaten internationale Verträge auf dem Gebiet der GASP abschließen dürfen. Dabei sind die Mitgliedstaaten in jedem Fall zur Loyalität und gegenseitiger Abstimmung im Außenbereich verpflichtet. Das ergibt sich – wie schon ausgeführt – aus Art. I-5 Abs. 2 EVV und speziell im Bereich der GASP aus Art. I-16 Abs. 2, Art. I-40 Abs. 5 EVV sowie Art. III-294 Abs. 2 EVV. Bereits hieraus folgt, dass die Mitgliedstaaten keine internationalen Übereinkommen abschließen dürfen, die Maßnahmen oder Abkommen der Union widersprechen.
691 692 693 694
Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (530 f.). Nettesheim, EuropaR 2004, 511 (530 f.). So die hier vertretene Ansicht, vgl. oben, § 10 II. 2. b). Vgl. oben, § 10 II. 2. b).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
365
cc) Vergleich mit der im Konventsentwurf enthaltenen Fassung Einen noch im Konventsentwurf bestehenden Mangel hat die Regierungskonferenz beseitigt. Der Konventsentwurf bestimmte, dass eine ausschließliche Kompetenz für die Union vorliegt, wenn der Abschluss eines Übereinkommens „einen internen Rechtsakt der Union beeinträchtigt“. 695 Wörtlich betrachtet musste man zu dem Schluss kommen, dass der gesamte internationale Vertrag in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fällt, wenn (auch nur) ein Teil des Vertrages mit Gemeinschaftsregeln in Konflikt kommen könnte. Dies hätte weitreichende Folgen, insbesondere für gemischte Verträge gehabt. Insoweit stand der Konventsentwurf auch im Widerspruch zum bisherigen case-law des EuGH.696 Die Endfassung des Verfassungsvertrages beseitigt nun das beschriebene Problem. Mit der Einfügung des Wortes „soweit“ wird klargestellt, dass die ausschließliche Kompetenz der Union nur so weit reicht, wie das Abkommen tatsächlich mit bestehendem Sekundärrecht kollidieren könnte.697 Alle anderen Teile des Abkommens verbleiben in der Kompetenz der Mitgliedstaaten, sodass gegebenenfalls ein gemischtes Abkommen notwendig wird. Neben der genannten Änderung beseitigt der Verfassungsvertrag das Erfordernis, dass ein interner Rechtsakt der Union beeinträchtigt werden muss.698 Folglich ist die Beeinträchtigung jeder gemeinsamen Regel ausreichend, um eine ausschließliche Zuständigkeit der Union herbeizuführen.
dd) Bewertung der Regelung Das nun in Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV kodifizierte Prinzip erscheint grundsätzlich sinnvoll, denn es ist nicht hinnehmbar, dass ein Mitgliedstaat durch den Abschluss völkerrechtlicher Verpflichtungen die Ziele und Maßnahmen der Union konterkariert. Dies würde zum einen in Bezug auf das entgegengesetzte Verhalten – einerseits innerhalb der Union, andererseits außerhalb der Union – ein widersprüchliches Verhalten des Staates darstellen und zum anderen die Ziele der Union gefährden. Wie oben dargelegt, kann Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV nur auf den Bereich der geteilten Zuständigkeiten Anwendung finden. Der Charakter der geteilten Zuständigkeit liegt darin, dass die Ausübung einer Kompetenz durch die Union zum Ausschluss der mitgliedstaatlichen Zuständigkeit führt. Aus diesem Charakter folgt, Vgl. Art. I-12 Abs. 2 KE-EVV. Dashwood, CMLRev 2004, 355, (372). 697 Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV lautet nun: „. . . soweit er gemeinsame Regeln beeinträchtigen oder deren Tragweite verändern könnte“ (Hervorhebung durch den Verfasser). 698 Vgl. Art. I-12 Abs. 2 KE-EVV; gleiches gilt für die Vorschrift des Art. III-225 Abs. 1 Var. 4 KE-EVV. 695 696
366
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
dass sich die Union gemäß Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV durch den Erlass interner Normen eine ausschließliche Außenkompetenz schaffen kann. In dem Maße, wie die Gemeinschaftsrechtsetzung fortschreitet, kann nur noch die Gemeinschaft internationale Verpflichtungen eingehen.699 Wie gesehen kann diese Konsequenz nicht für die parallelen und die unterstützenden Kompetenzen sowie für den Bereich der GASP gelten. Die Anwendung des Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV würde dem Charakter der genannten Zuständigkeiten widersprechen, wie sich etwa aus Art. I-14 Abs. 4 EVV eindeutig ergibt. Es ist daher bedauerlich, dass Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV keine Differenzierung bezüglich der Art der Kompetenzen trifft. Schließlich ließe sich überlegen, ob die Regelung des Art. I-13 Abs. 2 EVV überhaupt notwendig ist oder ob ausschließliche Kompetenzen für bestimmte Bereiche ausdrücklich und von vornherein (im Sinne einer a priori Ausschließlichkeit, wie in Art. I-13 Abs. 1 EVV) festgelegt werden sollen.700 Wie bereits oben erwähnt, ist Abs. 2 eine Kodifizierung der AETR-Rechtsprechung und des Gutachtens 1 / 76 (Kramer) des EuGH. Die Ausführungen des Gerichtshofs stellen eine (speziell auf die Außenbeziehungen der Gemeinschaft bezogene) Anwendung des Loyalitätsgrundsatzes (Art. 10 EG) und des Prinzips des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts dar. Insofern könnte man die Auffassung vertreten, dass die Regelung des Art. I-13 Abs. 2 EVV überflüssig sei, behält man im Auge, dass der Loyalitätsgrundsatz in Art. I-5 Abs. 2 EVV und das Prinzip des Vorrangs des Unionsrechts in Art. I-6 EVV Niederschlag in der Verfassung gefunden haben.701 Für den Bereich der geteilten Zuständigkeiten ist zu beachten, dass Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV in weiten Bereichen eine klarstellende Funktion hat. Eine Nichtregelung dieses speziellen Aspekts der langjährigen EuGH-Rechtsprechung zur Außenkompetenz und zur Ausschließlichkeit hätte die Frage aufgeworfen, warum gerade dieser Teil der Rechtsprechung nicht kodifiziert worden ist, wo doch in weiten Teilen versucht wurde, die Rechtsprechung zu den Außenkompetenzen in den Verfassungsvertrag zu übernehmen. Hinsichtlich der genannten Ungenauigkeiten in der Formulierung wird es wohl dem EuGH anheim fallen, im Einzelfall zu entscheiden, ob die Beeinträchtigung einer gemeinsamen Regel ausreichend intensiv ist, um das betreffende Übereinkommen in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen zu lassen.702 699 In diesem Sinne auch EuGH, EuZW 2003, 82 (88, Rdnr. 103 a. E.) = EuGH, Slg. 2002, I-9855, Rdnr. 103 a. E. – Open-Skies. 700 Dashwood, CMLRev 2004, 355 (372 f.) plädiert für eine Streichung des Absatzes. 701 Vgl. die harsche Kritik an dem Wortlaut der Vorschrift von Dashwood, CMLRev 2004, 355 (372 f.). 702 So auch Craig, ELRev 2004, 323 (329, 331): „vague and unclear“. Hinzuweisen ist darauf, dass die Verfassung nicht dem Wortlaut des Konventsentwurfs entspricht. Der Konventsentwurf bestimmte hinsichtlich der dritten Variante: „. . . wenn er einen internen Rechtsakt der Union beeinträchtigt“. Die jetzige Fassung: „. . . soweit er gemeinsame Regeln beein-
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
367
V. Vergleichende Analyse von Art. I-13 Abs. 2 EVV und Art. III-323 Abs. 1 EVV Grundsätzlich soll Art. III-323 EVV die Existenz einer Außenkompetenz regeln und Art. I-13 EVV die Ausschließlichkeitsfrage. Diese Aufteilung orientiert sich an der Systematik des Gerichtshofs, der in seiner bisherigen Urteils- und Gutachtenpraxis in einem ersten Schritt das Bestehen einer Außenkompetenz untersucht und (gegebenenfalls) in einem zweiten Schritt die Natur dieser Außenkompetenz bestimmt hat. Dies entspricht der im Zweiten Teil dargestellten Unterteilung in „the existence question“ und in „the exclusivity question“. Der Verfassungsgeber greift die Vorgehensweise des Gerichtshofs nun auf. Der grundlegenden Systematik des Verfassungsvertrages folgend wird in Teil III der Verfassung geregelt, ob und in welchem Umfang eine Kompetenz in einem bestimmten Bereich gegeben ist, in Teil I wird dagegen bestimmt, welcher Natur diese Kompetenz ist. Dieses System hat notwendigerweise Wiederholungen zur Folge.
1. Art. I-13 Abs. 2 Var. 1 EVV und Art. III-323 Abs. 1 Var. 3 EVV Eine solche Wiederholung von jeweils zwei Tatbestandsmerkmalen zeigt sich zunächst beim Vergleich von Art. III-323 Abs. 1 EVV mit Art. I-13 Abs. 2 EVV. Gemeint sind die Merkmale „wenn der Abschluss einer solchen Übereinkunft in einem verbindlichen Rechtsakt beziehungsweise Gesetzgebungsakt der Union vorgesehen ist“. Auffallend ist, dass der Wortlaut in den jeweiligen Vorschriften nicht übereinstimmt. Erklärbar ist der bereits erwähnte Unterschied zwischen „Gesetzgebungsakt“ in Art. I-13 EVV einerseits und „verbindlichen Rechtsakt“ in Art. III-323 EVV andererseits. Hier kann argumentiert werden, dass für das Entstehen einer – grundsätzlich geteilten – Zuständigkeit ein verbindlicher Rechtsakt (also auch Europäische Verordnungen und Europäische Beschlüsse) ausreichend ist, wohingegen für die Begründung einer – weit einschneidenderen – ausschließlichen Zuständigkeit ein Europäisches Gesetz oder ein Europäisches Rahmengesetz erforderlich ist.
trächtigen oder deren Tragweite verändern könnte“ (Hervorhebungen jeweils vom Verfasser) trägt nicht zur Klarheit der Vorschrift bei. Die Verwendung des Konjunktivs („könnte“) in der endgültigen Fassung statt des Indikativs hat jedoch zur Folge, dass bereits die Möglichkeit einer Beeinträchtigung gemeinsamer Regeln für die Erfüllung der Voraussetzungen des Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV ausreicht. Dies entspricht der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu den derzeitigen Verträgen.
368
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
2. Art. I-13 Abs. 2 Var. 2 EVV und Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV Der unterschiedliche Wortlaut zwischen Art. I-13 Abs. 2 Var. 2 EVV und Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV leuchtet unmittelbar ein. Er spiegelt den Gegensatz wider, der zwischen einer generellen (und damit zunächst grundsätzlich geteilten) und einer ausschließlichen Außenkompetenz der Union besteht. Aufgrund der weitreichenden Folgen der ausschließlichen Zuständigkeiten ist es folgerichtig, dass die Voraussetzungen für das Entstehen einer solchen höher sein müssen als diejenigen für das Entstehen einer allgemeinen Außenkompetenz. Der gerade dargestellte Gedanke wird bestätigt, wenn man die jeweiligen Formulierungen miteinander vergleicht. Die schärfere Voraussetzung aus Art. I-13 Abs. 2 Var. 2 EVV verlangt, dass der Abschluss einer internationalen Übereinkunft „notwendig“ sein muss, damit die Union „ihre interne Zuständigkeit ausüben kann“. Dagegen verlangt Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV lediglich, dass der Abschluss einer internationalen Übereinkunft „zur Verwirklichung eines der in der Verfassung festgesetzten Ziele erforderlich“ sein muss. Deutlich wird der Unterschied zwischen beiden Fassungen insbesondere an den Worten „notwendig“ und „erforderlich“ und andererseits daran, dass Art. I-13 Abs. 2 EVV an die internen Zuständigkeiten der Union anknüpft, während Art. III-323 Abs. 1 EVV auf die in der Verfassung festgesetzten Ziele rekurriert. Art. I-13 Abs. 2 Var. 2 EVV fußt damit auf der impliedpowers-Lehre, in Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV dagegen kommt – wie gesehen – ein Ziel-Mittel-Schluss zur Anwendung. Die Voraussetzungen einer Kompetenz nach Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV liegen damit deutlich niedriger als diejenigen nach Art. I-13 Abs. 2 Var. 2 EVV.703
3. Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV und Art. III-323 Abs. 1 Var. 4 EVV Auch der Wortlaut von Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV und Art. III-323 Abs. 1 Var. 4 EVV betreffend die Beeinträchtigung interner Regeln deckt sich nicht vollständig. Diese Diskrepanz ist unverständlich. Nach Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV besteht eine ausschließliche Außenkompetenz, „soweit704 er [der Abschluss einer internationalen Übereinkunft] gemeinsame Regeln beeinträchtigen oder deren Tragweite verändern könnte.“ Eine geteilte Außenkompetenz nach Art. III-323 Abs. 1 Var. 4 EVV besteht, wenn der Abschluss einer Übereinkunft „gemeinsame Vorschriften beeinträchtigen oder deren Anwendungsbereich ändern könnte“. In Bezug auf das nur in Art. I-13 EVV vorhandene Wort „soweit“ muss festgehalten werden, dass dies eine weitere Einschränkung des Ausschließlichkeitstatbestandes bedeutet. Beeinträchtigt eine internationale Übereinkunft nur spezifische 703 Dies verkennt Ruffert, EuropaR 2004, 165 (189), wenn er meint, dass es implizite nicht-ausschließliche Außenkompetenzen nach dieser Regelung nicht geben könne. 704 Diejenigen Tatbestandsmerkmale, die nicht übereinstimmen, sind jeweils kursiv gesetzt.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
369
Teile einer gemeinschaftlichen Regelungsmaterie, so besteht die ausschließliche Kompetenz eben nur für diesen spezifischen Teil und nicht etwa auch für den weiteren Regelungszusammenhang oder gar den gesamten Vertrag. Andererseits ist nicht ersichtlich, warum diese Einschränkung nicht für Art. III-323 Abs. 1 EVV gelten soll. Nach dem Wortlaut dieser Vorschrift besteht eine Außenkompetenz, wenn eine Übereinkunft gemeinsame Vorschriften beeinträchtigt. Dort, wo keine Vorschriften beeinträchtigt werden, besteht auch keine Kompetenz. Insoweit ergeben sich aus den verschiedenen Textfassungen keine unterschiedlichen Rechtsfolgen, in Art. I-13 Abs. 2 EVV ist die Regelung lediglich eindeutiger ausgefallen als in Art. III-323 Abs. 1 EVV. Die zweite Diskrepanz im Wortlaut zeigt sich an den Begriffen „Regeln beeinträchtigen“ beziehungsweise „Vorschriften beeinträchtigen“. Hier ist jedoch kein rechtlich relevanter Unterschied auszumachen, beide Begriffe werden synonym verwendet. Ähnliches gilt für die dritte Wortlautabweichung, nämlich für „Tragweite verändern“ beziehungsweise „Anwendungsbereich ändern“. Diese Formulierungen entstammen der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs, der seinerseits diese Begriffe gleichrangig nebeneinander verwendet. Schon daraus lässt sich schließen, dass der Verfassungsvertrag nicht von unterschiedlichen Bedeutungen ausgeht. Davon abgesehen besteht kein Bedürfnis, neben das Beeinträchtigungserfordernis ein weiteres Tatbestandsmerkmal zu stellen. Denn in jedem Fall, in dem eine Übereinkunft den Anwendungsbereich einer gemeinsamen Vorschrift ändert, beeinträchtigt sie diesen auch. Ebenso wird jede Übereinkunft, die die Tragweite einer gemeinsamen Regel verändert, diese auch beeinträchtigen.705 Auch der Blick auf andere Sprachversion des Verfassungsvertrages zeigt kein einheitliches Bild. Die englische Sprachfassung706 beinhaltet zwar keine Unterschiede zwischen „Regeln“ und „Vorschriften“, hier heißt es sowohl in Art. I-13 705 Mit der Übernahme der Diktion des EuGH sollte wohl klargemacht werden, dass an der bisherigen Rechtsprechung festgehalten werden soll und dass diese schlicht kodifiziert werden sollte. 706 Zum besseren Überblick und zum leichteren Vergleich der Textversionen sei nachfolgend die englische Textfassung abgedruckt: Article I-13 Areas of exclusive competence (1) [ . . . ] (2) The Union shall also have exclusive competence for the conclusion of an international agreement when its conclusion is provided for in a legislative act of the Union or is necessary to enable the Union to exercise its internal competence, or insofar as its conclusion may affect common rules or alter their scope. Article III-323 (1) The Union may conclude an agreement with one or more third countries or international organisations where the Constitution so provides or where the conclusion of an agreement is necessary in order to achieve, within the framework of the Union’s policies, one of the objectives referred to in the Constitution, or is provided for in a legally binding Union act or is likely to affect common rules or alter their scope. (2) [ . . . ].
24 Metz
370
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
EVV als auch in Art. III-323 EVV „common rules“. Ebenso verhält es sich im Vergleich zu den weiteren Unstimmigkeiten in der deutschen Fassung; wo hier von „Tragweite verändern“ beziehungsweise „Anwendungsbereich ändern“ die Rede ist, heißt es in der englischen Fassung übereinstimmend „affect common rules or alter their scope“. Ferner besteht in der spanischen Fassung kein Unterschied zwischen „Anwendungsbereich“ und „Tragweite“, hier ist übereinstimmend von „ . . . pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas“ die Rede. Gleiches gilt für die französische Fassung, in der es ebenfalls übereinstimmend „. . . est susceptible d’affecter des régles communes ou d’en altérer la portée“ heißt. Hier fällt demnach lediglich die deutsche Sprachfassung aus dem Rahmen. Allerdings stimmen auch die englischen Fassungen von Art. I-13 Abs. 2 a. E. EVV und Art. III-323 Abs. 1 a. E. EVV nicht völlig überein. Ebenso wie in der deutschen Version wird in der englischen nur in Art. I-13 EVV das Wort „insoweit“ („insofar“) verwendet, in Art. III-323 EVV dagegen nicht. In der spanischen Textfassung ist ebenfalls nur in Art. I-13 Abs. 2 EVV die Einschränkung „en la medida en que“ enthalten. Dies ist jedoch, wie gerade erwähnt, lediglich als Klarstellung zu verstehen. Die einzige Unstimmigkeit in der englischen Fassung tritt in der deutschen Fassung nicht auf. Wo die Möglichkeit einer Beeinträchtigung von Gemeinschaftsregeln im Deutschen übereinstimmend mit dem Konjunktiv ausgedrückt wird („könnte“707), wird in der englischen Fassung zum einen von „may affect common rules“ (Art. I-13 Abs. 2 EVV), zum anderen von „is likely to affect common rules“ (Art. III-323 Abs. 1 EVV) gesprochen. Der Vergleich zur deutschen Fassung und vor allem die sehr ähnliche Wortbedeutung lassen jedoch vermuten, dass diesem Unterschied in der englischen Fassung keine Bedeutung zukommt. Dieses Ergebnis bestätigt sich beim Blick auf die spanische Sprachfassung. Auch hier wird der Konjunktiv („Subjuntivo“) einheitlich verwendet. In der französischen Fassung wird sowohl in Art. I-13 Abs. 2 EVV als auch in Art. III-323 Abs. 1 EVV die Formulierung „est susceptible d’affecter“ verwendet. Die wechselseitigen Unterschiede zwischen den verschiedenen Sprachfassungen machen deutlich, dass die geringfügigen Wortlautabweichungen zwischen Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV und Art. III-323 Abs. 1 Var. 4 EVV keine Bedeutung haben. Zur Rechtsklarheit hätte es demnach beigetragen, wenn die Formulierungen in Art. I-13 Abs. 2 Var. 3 EVV und Art. III-323 Abs. 1 Var. 4 EVV sich jeweils entsprechen würden.
707 Im Verfassungsentwurf dagegen wurde noch – sowohl im damaligen Art. I-12 KE-EVV als auch im Art. III-225 KE-EVV – übereinstimmend der Indikativ verwendet („beeinträchtigt“).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
371
4. Bewertung Wie dargelegt, kommen an einigen Stellen, insbesondere beim Vergleich von Art. I-13 Abs. 2 Var. 2 EVV und Art. III-323 Abs. 1 Var. 2 EVV, die grundlegenden Unterschiede zwischen der ausschließlichen Zuständigkeit und der generellen Vertragsschließungskompetenz deutlich zum Ausdruck. Beim Vergleich von Art. I-13 Abs. 2 Var. 1 und 3 EVV mit der entsprechenden Variante des Art. III-323 EVV bleibt jedoch unverständlich, warum auf einem so wichtigen Gebiet wie den Außenkompetenzen der Union und insbesondere bei der sehr sensiblen Ausschließlichkeitsfrage nicht mehr Sorgfalt auf die einzelnen Formulierungen in den jeweiligen Artikeln verwendet wurde.
VI. Bindungswirkung, Art. III-323 Abs. 2 EVV Art. III-323 Abs. 2 EVV stellt klar, dass alle von der Union geschlossenen Übereinkünfte sowohl die Organe der Union als auch die Mitgliedstaaten binden. Eine ähnliche Bestimmung ist in dem bisherigen Art. 24 Abs. 6 EU zu finden. Diese Regelung bezieht sich jedoch nur auf den GASP-Bereich und – über die Verweisung in Art. 38 EU – auch auf die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen. Des Weiteren sieht diese Bestimmung eine Bindungswirkung lediglich für die Organe der Union, nicht aber explizit für die Mitgliedstaaten vor. Dass jedoch auch die Mitgliedstaaten an die betreffenden Vereinbarungen gebunden sind, ergibt sich bei derzeitiger Rechtslage aus völkerrechtlichen Grundsätzen. Nach der hier vertretenen Meinung, wonach der Union nach geltender Rechtslage keine Völkerrechtssubjektivität zukommt, schließt die Union internationale Übereinkünfte als Stellvertreterin im Namen der Mitgliedstaaten, sodass die Mitgliedstaaten die eigentlichen Vertragspartner – und damit völkerrechtlich gebunden – sind.708 Eine vertragliche Erstreckung der Bindungswirkung auf die Mitgliedstaaten ist daher nach jetziger Rechtslage nicht erforderlich. Wird der Union, wie im Verfassungsvertrag vorgesehen, eine eigene Rechtspersönlichkeit verliehen, dann schließt die Union künftig alle völkerrechtlichen Verträge im eigenen Namen. Aufgrund von Art. III-323 Abs. 2 EVV sind die Mitgliedstaaten dann zumindest qua Europarecht an die von der Union abgeschlossenen Verträge gebunden. Für den Gemeinschaftsbereich enthält derzeit Art. 300 Abs. 7 EG eine weitgehend dem neuen Art. III-323 Abs. 2 EVV entsprechende Bestimmung, wonach die Bindungswirkung sowohl die Organe der Gemeinschaft als auch die Mitgliedstaaten erfasst. Dies ergibt sich daraus, dass die Gemeinschaft schon nach bisheriger Rechtslage Völkerrechtspersönlichkeit besitzt und daher in eigenem Namen Verträge abschließen kann. 708 Siehe zum Ganzen bereits den Zweiten Teil sowie Krück, in: Schwarze, EU-Kommentar, Art. 11 – 28 EUV, Rdnr. 20 a. E.
24*
372
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Zu beachten ist bei alledem, dass Art. III-323 Abs. 2 EVV (wie auch der jetzige Art. 300 Abs. 7 EG) lediglich eine innergemeinschaftliche Vertragserstreckung darstellt. Im Verhältnis zu Drittstaaten hat die Bestimmung als res inter alios acta keine Geltung, die Mitgliedstaaten selbst sind daher völkerrechtlich durch sie nicht an die jeweiligen Abkommen gebunden.
VII. Das Verfahren zum Abschluss völkerrechtlicher Abkommen, Art. III-325 EVV Die grundlegende Verfahrensvorschrift für den Abschluss völkerrechtlicher Abkommen zwischen der Union und Drittstaaten oder internationalen Organisationen ist Art. III-325 EVV. Daneben bestehen besondere Bestimmungen betreffend die gemeinsame Handelspolitik (Art. III-315 Abs. 3 bis 5 EVV) und Währungsabkommen (Art. III-326 EVV). Beachtlich in diesem Zusammenhang ist, dass im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zwar Spezialvorschriften hinsichtlich der jeweiligen Handlungsformen (zum Beispiel Europäische Beschlüsse, Art. I-40 Abs. 3 EVV in Verbindung mit Art. III-300 EVV) bestehen, dass aber aufgrund von Art. III-303 EVV völkerrechtliche Abkommen grundsätzlich nach dem in Art. III-325 EVV vorgesehenen Verfahren abgeschlossen werden. Im Verfassungsentwurf (Art. III-204 KE-EVV) war noch eine ausdrückliche Verweisung auf die allgemeine Verfahrensvorschrift Art. III-227 KE-EVV (heute Art. III-325 EVV) enthalten. Da nach jetziger Fassung keine Sonderregelung für den GASP-Bereich eingeführt worden ist, gilt auch hier die allgemeine Vorschrift des Art. III-325 EVV. Wie später noch genauer ausgeführt wird, besteht allerdings für Abkommen im GASP-Bereich innerhalb des Art. III-325 EVV eine Regelung, die Einstimmigkeit vorsieht (Abs. 8). Insofern existieren keine der jetzigen Säulenstruktur entsprechende eigenständige verfahrenstechnische Spezialnormen. Vielmehr sind in der Vorschrift des Art. III-325 EVV die bisherigen Verfahren nach Art. 300 EG und Art. 24, 38 EU integriert worden.709 Damit ist in Art. III-325 EVV das Verfahren zum Abschluss völkerrechtlicher Abkommen für nahezu alle Politikbereiche geregelt.
1. Die Rolle des Ministerrats Der Ministerrat hat eine zentrale Rolle im Rahmen des Abschlusses völkerrechtlicher Übereinkommen inne. Er erteilt die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen, legt die Verhandlungsrichtlinien fest, genehmigt die Unter709 Obwexer, in: Busek / Hummer (Hrsg.), Der Europäische Konvent und sein Ergebnis – eine Europäische Verfassung, S. 103 (130).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
373
zeichnung710 und schließt letztendlich die Übereinkünfte (Art. III-325 Abs. 2 EVV). Die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen umfasst auch die klassischen gemischten Abkommen. Eigentlich würden bei solchen Abkommen alle Mitgliedstaaten und die Kommission verhandeln, in der Praxis wird es jedoch weitgehend so gehandhabt, dass der Rat der Kommission die Verhandlungsführung überträgt, um ein einheitliches Auftreten der Union nach außen zu gewährleisten. Eben dieses Verfahren wird jetzt von Art. III-325 Abs. 2 EVV vorgeschrieben. Wie schon nach Art. 300 EG legt die Kommission grundsätzlich dem Ministerrat Empfehlungen über die Aufnahme von Verhandlungen über völkerrechtliche Verträge und deren gewünschten Inhalt vor, über die der Ministerrat entscheiden muss. Geht es bei der Übereinkunft im Schwerpunkt um die Gemeinsame Außenund Sicherheitspolitik, legt dagegen der Außenminister der Union dem Ministerrat Empfehlungen vor (Art. III-325 Abs. 3 EVV). Die Entscheidung des Ministerrats über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen ergeht durch Europäischen Beschluss. In diesem Europäischen Beschluss wird gleichzeitig ein Verhandlungsführer oder ein Leiter des Verhandlungsteams bestimmt, welchem der Rat Verhandlungsrichtlinien erteilen kann. Auf Vorschlag des Verhandlungsführers kann der Ministerrat, ebenfalls durch Europäischen Beschluss, den Weg zur Unterzeichnung der Übereinkunft und gegebenenfalls deren vorläufige Anwendung freigeben. Schließlich erlässt der Ministerrat einen Europäischen Beschluss über den Abschluss der Übereinkunft (Abs. 6).
2. Die Rolle des Europäischen Parlaments a) Anhörungs- und Zustimmungsrechte des Europäischen Parlaments Nach den bisherigen Verträgen stand dem Europäischen Parlament grundsätzlich ein Anhörungsrecht für völkerrechtliche Abkommen zu. Dieses Recht wurde jedoch durch wichtige Ausnahmen – zum einen bei Handelsabkommen nach Art. 133 EG (Art. 300 Abs. 3 EG) zum anderen im Rahmen der zweiten und dritten Säule der EU – durchlöchert. Diese hinsichtlich des Demokratieprinzips äußerst unbefriedigende Situation wird nun durch den Verfassungsvertrag teilweise behoben, indem in einigen Bereichen weiter gehende Rechte zugunsten des Europäischen Parlaments primärrechtlich verankert werden.
710 Dieser Zusatz wurde von der Regierungskonferenz zur Klarstellung der Konventsfassung hinzugefügt.
374
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
aa) Allgemeine Abkommen Für allgemeine Abkommen auf völkerrechtlicher Ebene sieht Art. III-325 Abs. 6 lit. b EVV grundsätzlich eine Anhörung des Parlaments vor. Dies entspricht der bisherigen Regelung nach Art. 300 Abs. 3 EG.711 Fälle, in denen eine Zustimmung des Parlaments erforderlich ist, werden in Art. III-325 Abs. 6 lit. a EVV enumerativ aufgelistet. Hierzu zählen: i)
Assoziierungsabkommen;
ii) der Beitritt der Union zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK); iii) Übereinkünfte, die durch Einführung von Zusammenarbeitsverfahren einen besonderen institutionellen Rahmen schaffen; iv) Übereinkünfte mit erheblichen finanziellen Folgen für die Union; v) Übereinkünfte in Bereichen, für die das ordentliche Gesetzgebungsverfahren712 oder, wenn die Zustimmung des Europäischen Parlaments erforderlich ist, das besondere Gesetzgebungsverfahren713 gilt. Die Bereiche (i), (iii) und (iv) entsprechen den heutigen Regelungen in Art. 300 Abs. 3 EG. Neu ist das Zustimmungserfordernis (ii), welches den Beitritt zur EMRK betrifft. Verfahrensregeln, die den Beitritt zur EMRK betreffen, wurden nötig, da der Verfassungsentwurf den Beitritt zur EMRK erstmals ausdrücklich (verpflichtend) festschreibt.714 Das Zustimmungserfordernis im Bereich (v) wurde an die neuen Regeln bezüglich des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens angepasst. Dies bringt eine teilweise Erweiterung der Zustimmungspflicht mit sich, denn bisher ist sogar im Bereich des Verfahrens nach Art. 251 EG lediglich eine Anhörung vorgesehen. Eine Zustimmung das Parlaments war nach Art. 300 Abs. 3 EG nur dann erforderlich, wenn eine Änderung eines bereits nach Art. 251 EG erlassenen Rechtsakts durch eine völkerrechtliche Übereinkunft erforderlich wurde. Nach dem Verfassungsvertrag bedürfen nunmehr alle Abkommen, die einen Bereich betreffen, der intern dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren zugeordnet ist, der Zustimmung durch das Europäische Parlament. Zudem kommt dem Europäischen Parlament für völ711 Zu der bisherigen Praxis der Einbeziehung des Europäischen Parlaments auch in den Bereichen, in denen der Vertrag keine Anhörung oder Beteiligung des Parlaments vorsieht, insbesondere zum Luns-Westerderp-Verfahren, siehe oben, § 4 VIII. 3. b). 712 Vgl. Art. I-34 Abs. 1 und Art. III-396 EVV. 713 Vgl. Art. I-34 Abs. 2 EVV. 714 Nach einem Gutachten des EuGH hat die Union nach jetzigem Stand der Europaverträge nicht die Kompetenz, der EMRK beizutreten (vgl. EuGH, Slg. 1996, I-1763 (Rdnr. 27) – Gutachten 2 / 94, EMRK). Das noch im Konventsentwurf enthaltene Einstimmigkeitserfordernis für den Beschluss über den Beitritt zur Konvention (Art. III-227 Abs. 9 KE-EVV) wurde in der Endfassung nicht übernommen; vgl. außerdem oben, § 10 II. 15. a).
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
375
kerrechtliche Abkommen ein Zustimmungsrecht dann zu, wenn ihm auch (im Rahmen eines von der Verfassung vorgesehenen besonderen Gesetzgebungsverfahrens) ein Zustimmungsrecht für interne Rechtsakte zustehen würde.715 Damit erstreckt der Verfassungsvertrag die internen Zustimmungsrechte erstmals vollständig auf völkerrechtliche Übereinkommen. Art. III-325 Abs. 6 lit. a v) EVV beinhaltet eine erhebliche Stärkung des Europäischen Parlaments im Bereich der völkerrechtlichen Abkommen. Darüber hinaus bestimmt Art. III-325 Abs. 10 EVV, dass das Europäische Parlament in allen Phasen des Verfahrens zum Abschluss von Übereinkünften zwischen der Union und Drittstaaten oder internationalen Organisationen unverzüglich und umfassend unterrichtet werden muss.
bb) Handelsabkommen Für Handelsabkommen gelten zwar gemäß Art. III-315 EVV verfahrensrechtliche Besonderheiten. Diese betreffen jedoch nicht die Rechte des Europäischen Parlaments, sondern sind zu einem Großteil differenzierte Regelungen über die Mehrheitserfordernisse bei Ratsentscheidungen.716 Aufgrund der Verweisung in Art. III-315 Abs. 3 EVV auf die Vorschrift des Art. III-325 EVV steht dem Europäischen Parlament gemäß Art. III-325 Abs. 6 UAbs. 2 lit. a v) EVV ein Mitentscheidungsrecht auch im Bereich der Handelspolitik zu, wenn das ordentliche Gesetzgebungsverfahren (nach Art. III-396 EVV) Anwendung findet. Gemäß Art. I-34 Abs. 1 und Art. III-315 Abs. 2 EVV gilt für (interne) Implementierungsmaßnahmen das ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Für die genannten autonomen Rechtsakte im Bereich der Handelspolitik steht dem Europäischen Parlament damit ein Mitentscheidungsrecht zu. Das völkerrechtliche Vertragsschlussverfahren nach Art. III-315 Abs. 1 EVV läuft naturgemäß nicht nach dem „ordentlichen Gesetzgebungsverfahren“ ab. Es würde jedoch unplausibel erscheinen, wenn man dem Europäischen Parlament im Rahmen des Art. III-315 Abs. 2 EVV ein Zustimmungsrecht einräumen würde, im Rahmen des Vertragsschlussverfahrens nach Art. III-315 Abs. 1 EVV jedoch nicht.717 Hier ist insbesondere auch die Intention des Konvents zu berücksichtigen, die Rechte des Europäischen Parlaments zu stärken. Da intern gemäß Art. III-315 Abs. 2 EVV das ordentliche Gesetzgebungsverfahren für den gesamten Bereich der Handelspolitik gilt, muss sich das Zustimmungsrecht des Europäischen Par715 An dieser Stelle ist der Verfassungsvertrag genauer, als es der Konventsentwurf ist (vgl. Art. III-227 Abs. 7 UAbs. 3 lit. e KE-EVV, welcher undifferenziert von „Gesetzgebungsverfahren“ spricht). 716 Lediglich Art. III-315 Abs. 3 UAbs. 3 S. 2 EVV bestimmt, dass das Europäische Parlament von der Kommission regelmäßig über den Stand der Verhandlungen zu unterrichten ist. Vgl. zum allgemeinen Beschlussfassungsverfahren sogleich unter 3. 717 Krajewski, CMLRev 2005, 91 (124 f.).
376
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
laments nicht nur auf die gerade erwähnten autonomen Maßnahmen zur Umsetzung der Handelspolitik, sondern auch auf völkerrechtliche Übereinkünfte im Bereich der Handelspolitik erstrecken. Wie bereits mehrfach erwähnt, hat der EG-Vertrag im Bereich der Handelspolitik bisher dem Europäischen Parlament nicht einmal ein Anhörungsrecht eingeräumt (Art. 300 Abs. 3 EG).718 Das nun primärrechtlich eingeführte allgemeine Zustimmungsrecht bedeutet eine erhebliche Aufwertung des Europäischen Parlaments, denn die internationalen Handelsabkommen sind praktisch sehr wichtig. Künftig müssen alle Handelsabkommen dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt werden.
cc) Abkommen im Bereich der GASP Wie gerade gesehen, muss das Europäische Parlament grundsätzlich vor Erlass des Europäischen Beschlusses über den Abschluss der Übereinkunft angehört werden. Dies bestimmt Art. 325 Abs. 6 UAbs. 2 lit. b EVV („in den übrigen Fällen“). Eine Ausnahme besteht jedoch für jene Politikbereiche, die ausschließlich die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betreffen (Art. III-325 Abs. 6 UAbs. 1 EVV). Zu beachten ist, dass hier, im Gegensatz zu Art. III-325 Abs. 3 EVV, nicht von „ausschließlich oder hauptsächlich“, sondern lediglich von „ausschließlich“ gesprochen wird. Bei Übereinkünften, die ausschließlich die Gemeinsame Außenund Sicherheitspolitik betreffen, ist demnach eine Anhörung719 des Parlaments nicht erforderlich. Dies entspricht der gegenwärtigen Rechtslage, sieht der EU-Vertrag doch in Art. 24 EU keine Anhörung des Parlaments vor. Allerdings muss nach Art. 21 EU das Europäische Parlament zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden Weichenstellungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik angehört werden.720 Eine entsprechende Bestimmung ist auch im Verfassungsentwurf enthalten: Art. III-304 Abs. 1 EVV verpflichtet den Außenminister der Union zur Anhörung und Unterrichtung721 des Europäischen Parlaments bei den wichtigsten Aspekten und grundlegenden Weichenstellungen der Gemeinsamen 718 Vgl. aber die Selbstverpflichtung der Kommission zur Unterrichtung des Parlaments auch in Bezug auf internationale Handelsabkommen, Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments, Anhang 2 Nr. 2, ABl. 2003 L 61, 123. 719 Dies gilt natürlich erst recht für die Zustimmung. 720 Die Arbeitsgruppe Außenbeziehungen war der Meinung, dass „der gegenwärtige Artikel 21 EUV im Zusammenhang mit der GASP zufriedenstellend ist“, CONV 459 / 02, S. 8, Rdnr. 10. 721 Das Erfordernis der „Unterrichtung“ wurde von der Regierungskonferenz dem Konventsentwurf angefügt. Allerdings führte das nicht zu einer materiellen Erweiterung der Kompetenzen des Parlaments, da schon nach Art. I-39 Abs. 8 und Art. I- 40 Abs. 8 KE-EVV das Parlament über die Entwicklungen „auf dem Laufenden“ gehalten werden musste (heute Art. I-40 Abs. 8, Art. I-41 Abs. 8 EVV). Die jetzige Fassung ist damit lediglich genauer, als es noch der Konventsentwurf war.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
377
Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.722 Festzuhalten bleibt, dass es der Verfassungsvertrag versäumt, dem Europäischen Parlament ein Anhörungsrecht für solche Abkommen einzuräumen, die ausschließlich den GASP-Bereich betreffen. Dieses Festhalten am status quo ist im Hinblick auf die angestrebte weitergehende Demokratisierung der Europäischen Union bedauerlich.
3. Beschlussfassungsverfahren Die Beschlüsse des Ministerrates ergehen grundsätzlich im Verlauf des gesamten Verfahrens723 mit qualifizierter Mehrheit (Art. III-325 Abs. 8 EVV). Einstimmigkeit ist jedoch erforderlich, wenn die Übereinkunft einen Bereich betrifft, in dem für den Erlass eines Rechtsakts der Union Einstimmigkeit vorgesehen ist. Damit bewegt sich der Verfassungsentwurf in der Tradition des (durch den Vertrag von Nizza eingefügten) Art. 300 Abs. 5 UAbs. 2 EG, welcher für den Abschluss einer internationalen Übereinkunft ebenfalls Einstimmigkeit vorschreibt, wenn das Abkommen einen Bereich betrifft, in dem für die Annahme interner Vorschriften Einstimmigkeit vorgesehen ist. In Bezug auf die Beschlussfassung im Rat gilt damit weiterhin der Grundsatz der Parallelität der Formen.724 Wichtigstes Beispiel hierfür ist die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Nach Art. III-300 Abs. 1 EVV werden die Europäischen Beschlüsse zur GASP nämlich grundsätzlich einstimmig erlassen.725 Überdies werden außerhalb der in Teil III genannten Fälle die 722 Vgl. zur Rolle des Europäischen Parlaments in allgemeinen Fragen der GASP bereits oben, § 10 II. 2. h). 723 Beschluss über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen (in diesem Rahmen erfolgt auch die Benennung des Verhandlungsführers), Beschluss über die Unterzeichnung der Übereinkunft (und gegebenenfalls deren vorläufige Anwendung), Beschluss über den Abschluss der Übereinkunft. Auch ein Beschluss zur Aussetzung der Anwendung einer Übereinkunft ist möglich sowie der Beschluss zur Festlegung der Standpunkte, die im Namen der Union in einem durch eine Übereinkunft eingesetzten Gremium (zum Beispiel einem Assoziationsrat) festgelegt werden, soweit dieses Gremium rechtswirksame Akte, mit Ausnahme von Rechtsakten zur Ergänzung oder Änderung des institutionellen Rahmens der betreffenden Übereinkunft, zu erlassen hat. 724 Das Einstimmigkeitserfordernis gilt unter anderem bei Art. I-18 Abs. 1 EVV (Flexibilitätsklausel), Art. I-58 Abs. 2 EVV (Verfahren für den Beitritt zur Union), Art. III-210 Abs. III in Verbindung mit Abs. 2 lit. c, d, f, g EVV (verschiedene Elemente des Arbeitnehmerschutzes), Art. III-234 Abs. 2 EVV (bestimmte Aspekte des Umweltschutzes), Art. III-256 Abs. 3 EVV (steuerliche Aspekte des Energiemarktes), Art. III-269 Abs. 3 EVV (grenzüberschreitende Aspekte des Familienrechts), Art. III-270 Abs. 2 lit. d EVV (spezifische Aspekte des Strafverfahrensrechts), Art. III-271 Abs. 1 UAbs. 3 EVV (Mindeststrafen für bestimmte Kriminalitätsbereiche), Art. III-275 Abs. 3 EVV (polizeiliche Zusammenarbeit). 725 Zu den Ausnahmen nach Art. III-300 Abs. 2 EVV, nach denen eine qualifizierte Mehrheit ausreichend ist, vgl. oben, § 10 II. f) dd).
378
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Europäischen Beschlüsse im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ebenfalls einstimmig verabschiedet (Art. I-40 Abs. 6 EVV). Der Ministerrat muss außerdem einstimmig beschließen, falls das Abkommen ein Assoziierungsabkommen nach Art. III-324 EVV ist. Auch hier hält der Verfassungsentwurf an den Vorschriften in Art. 300 EG fest. Im Konventsentwurf war noch das Einstimmigkeitserfordernis für den Beitritt zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten enthalten. Dieses Erfordernis ist in der endgültigen Verfassung nicht mehr enthalten. Damit kann der Beitritt zur Europäischen Menschenrechtskonvention durch einen Europäischen Beschluss mit qualifizierter Mehrheit erfolgen. Anstelle des Beitritts zur EMRK wurden solche Übereinkommen in die Einstimmigkeitsregelung aufgenommen, welche die wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittländern betreffen (Art. III-325 Abs. 8 UAbs. 2 Var. 3 in Verbindung mit Art. III-319 EVV), sofern diese Länder zukünftig der Europäischen Union beitreten wollen. Will die Union mit beitrittswilligen Staaten künftig solche Verträge schließen, muss dies also einstimmig geschehen.
4. Aufgabensplitting im Bereich der Verhandlungsvorschläge: EU-Außenminister für GASP-Bereich, Kommission für andere Bereiche des auswärtigen Handelns Nach Art. III-325 Abs. 3 EVV legt grundsätzlich die Kommission Empfehlungen zur Aufnahme von Vertragsverhandlungen vor. Bezieht sich die Übereinkunft jedoch ausschließlich oder hauptsächlich auf die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, so ist der Außenminister der Union für die Ausarbeitung eines Verhandlungsvorschlages zuständig. Diese Vorschrift bewirkt ein Aufgabensplitting zwischen Kommission und Außenminister.726 Die Besonderheit des Art. III-325 EVV liegt darin, dass er die bisher zwischen EG und EU getrennten Verfahren für den Abschluss von völkerrechtlichen Übereinkünften, also Art. 300 EG einerseits und Art. 24 EU andererseits, in einer Vorschrift vereinigt. Vor allem aufgrund der Schaffung des neuen Amtes des Außenministers der Union ergeben sich zwischen der alten und der neuen Regelung Unterschiede. Nach dem EU-Vertrag ist der Ratsvorsitz, welcher gegebenenfalls von der Kommission unterstützt wird, für den Vorschlag von Vertragsverhandlungen und deren Durchführung zuständig727, die Neuregelung sieht hingegen die Einbeziehung des Außenministers vor.
726 Art. III-325 Abs. 3 EVV ist nicht zu verwechseln mit der neuen Art von Initiativen gemäß Art. III-293 Abs. 2 EVV, welche das gemeinsame Handeln von Außenminister und Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Festlegung von strategischen Interessen und Zielen der Union betreffen. 727 Vgl. Art. 24 Abs. 1 EU.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
379
5. Übereinkommen, die unter verschiedene Themenbereiche fallen (ehemals säulenübergreifende oder „cross-pillar mixity“ Abkommen) Für Verträge, die zugleich unter den derzeitigen Gemeinschaftsbereich und unter die derzeitigen Titel V oder VI EU-Vertrag fallen, wurde mit Art. III-325 Abs. 3 EVV eine explizite Regelung getroffen. Wie oben ausführlich beschrieben, löst der Verfassungsvertrag die „Pfeilerstruktur“ der jetzigen Union auf. Dies ändert indes nichts daran, dass es weiterhin verschiedene Tätigkeitsbereiche der Union mit unterschiedlichen Regelungen gibt. Für bereichsübergreifende Abkommen bestimmt Art. III-325 Abs. 3 EVV, dass der Ministerrat, je nach dem Gegenstand der künftigen Übereinkunft, den Verhandlungsführer oder den Leiter des Verhandlungsteams der Union benennt.728 Dies deutet darauf hin, dass nicht zwei voneinander getrennte Übereinkünfte geschlossen werden sollen, sondern möglichst ein einziges, welches alle Bereiche abdeckt. Je nach Gegenstand und Schwerpunkt des Abkommens sollen demnach Hauptverhandlungspartner ernannt werden, allerdings müssen auch Vertreter aus den anderen Bereichen an den Verhandlungen beteiligt werden. Ziel ist damit, ein einziges Abkommen im Namen der Union abschließen zu können. Da themenübergreifende Abkommen nicht ausschließlich die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, sondern gerade auch andere Politikbereiche erfassen, gilt für das parlamentarische Beschlussfassungsverfahren die allgemeine Regelung nach Art. III-325 Abs. 6 UAbs. 2 EVV. Der Rat dagegen muss über das gesamte themenübergreifende Abkommen gemäß Art. III-325 Abs. 8 UAbs. 2 EVV einstimmig beschließen, falls ein (separater) GASP-Beschluss ebenfalls einstimmig ergehen müsste. Durch die Wahl eines themenübergreifenden Abkommens kann demnach nicht das Einstimmigkeitserfordernis, welches grundsätzlich im GASPBereich gilt, umgangen werden.
6. Sonderregelungen für Währungsabkommen, Art. III-326 EVV Art. III-326 EVV übernimmt nahezu alle Bestimmungen des Art. 111 EG. Bis auf einige redaktionelle Änderungen und sprachliche Glättungen (der Begriff „Drittlandswährungen“ wird durch die Formulierung „andere als den in der Union als gesetzliches Zahlungsmittel bestehenden Währungen“ ersetzt, der noch vom Vertrag von Nizza verwendete Begriff „ECU“ wird durch die heute gängige Bezeichnung „Euro“ ersetzt, einige Sätze werden zur Klarstellung umgestellt) ergeben sich wenige Neuerungen im Vergleich zur derzeit geltenden Rechtslage. Art. III-326 EVV ist sowohl eine Kompetenz- als auch eine Verfahrensvorschrift. 728 Obwexer, in: Busek / Hummer (Hrsg.), Der Europäische Konvent und sein Ergebnis – eine Europäische Verfassung, S. 103 (130).
380
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
Hinsichtlich des Verfahrens ist festzuhalten, dass abweichend von der Grundregel aus Art. III-325 EVV besondere Bestimmungen gelten. Zunächst muss zwischen Art. III-326 Abs. 1 EVV „Vereinbarungen über ein Wechselkurssystem“ und Art. III-326 Abs. 3 EVV „Vereinbarungen im Zusammenhang mit Währungsfragen oder Devisenregelungen“ unterschieden werden. Wechselkurssystemvereinbarungen nach Abs. 1 werden nach dem Verfahren des Abs. 3 derselben Vorschrift getroffen. Demgemäß beschließt der Ministerrat auf Empfehlung der Europäischen Zentralbank oder der Kommission (nach Anhörung der Europäischen Zentralbank) die Einzelheiten für die Aushandlung und den Abschluss solcher Vereinbarungen. Der Beschluss muss einstimmig erfolgen, außerdem ist die Anhörung des Europäischen Parlaments erforderlich. Vereinbarungen im Zusammenhang mit Währungsfragen oder Devisenregelungen (Abs. 3) werden vom Ministerrat ebenfalls auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung der Europäischen Zentralbank geschlossen. Diese Beschlüsse ergehen – anders als nach Abs. 1 – mit qualifizierter Mehrheit und ohne Anhörung des Europäischen Parlaments. Art. 111 Abs. 4 EG, der Verfahrensvorschriften über gemeinsame Standpunkte der Gemeinschaft auf internationaler Ebene zu Fragen, die von besonderer Bedeutung für die Wirtschafts- und Währungsunion sind, enthält, wurde nicht in Art. III-326 EVV überführt. Die Regelung wurde jedoch keineswegs gestrichen, sondern findet sich an anderer Stelle wieder. In Kapitel II Wirtschafts- und Währungspolitik, Abschnitt 4 wurde Art. III-196 EVV eingefügt. Dieser besagt in seinem Abs. 1, dass der Ministerrat – auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung der Europäischen Zentralbank – mit Hilfe der neuen Handlungsform des Europäischen Beschlusses eine Festlegung hinsichtlich eines gemeinsamen Standpunktes zu den Fragen, die für die Wirtschafts- und Währungsunion von besonderem Interesse sind, treffen kann. Erklärtes Ziel ist es, die Stellung des Euro im internationalen Währungssystem sicherzustellen. In Art. III-196 Abs. 2 EVV kommt einer der Leitgedanken der neuen Verfassung zum Vorschein, nämlich das Streben nach einer einheitlichen internationalen Vertretung der europäischen Interessen. Der Ministerrat kann hiernach auf Vorschlag der Kommission geeignete Maßnahmen mit dem Ziel annehmen, eine einheitliche Vertretung bei den internationalen Einrichtungen und Konferenzen im Finanzbereich sicherzustellen. Die Verfahrensvorschriften hierfür sind die gleichen wie diejenigen aus Art. III-196 Abs. 1 EVV. Art. III-196 Abs. 3 EVV wurde von der Regierungskonferenz noch grundlegend umgestaltet. Im Vergleich zum Konventsentwurf729 wurden feste Prozentbestimmungen in die Verfassung eingeführt und die Modalitäten einer Sperrminorität genau geregelt. Art. 111 EG enthält gar keine Regelung hinsichtlich der Mehrheitsverhältnisse bei Abstimmungen. Im neuen Art. III-196 Abs. 3 EVV wird jetzt die qualifizierte Mehrheit als eine Mehrheit von mindestens 55% der stimmberechtig729
Vgl. Art. III-90 Abs. 2 KE-EVV.
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
381
ten730 Mitglieder des Rates definiert, sofern diese Mitglieder Mitgliedstaaten vertreten, die mindestens 65% der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten ausmachen. Eine Sperrminorität ist erreicht, wenn die Mindestzahl der Mitglieder des Rates, die zusammen mehr als 35 % der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, zuzüglich eines Mitglieds, gegen einen Beschluss stimmen.731
7. Sonderregelungen für die Gemeinsame Handelspolitik, Art. III-315 EVV Art. III-315 Abs. 3 UAbs. 1 EVV verweist grundsätzlich auf die einschlägigen Verfahrensvorschriften in Art. III-325 EVV, soweit nicht besondere Bestimmungen getroffen werden. Nach Art. III-315 Abs. 3 UAbs. 2 EVV legt die Kommission dem Ministerrat ihre Empfehlungen bezüglich eines Aspektes der Gemeinsamen Handelspolitik vor. Der Ministerrat ermächtigt dann die Kommission zur Aufnahme der erforderlichen Verhandlungen. Zur Unterstützung der Kommission bestellt der Ministerrat einen Sonderausschuss. Die Kommission führt dann die Verhandlungen mit Drittstaaten oder internationalen Organisationen nach den Vorgaben und Richtlinien, die ihr der Ministerrat erteilen kann. Über den Stand der Verhandlungen muss die Kommission dem Sonderausschuss und dem Europäischen Parlament regelmäßig Bericht erstatten. Die wichtigsten verfahrensrechtlichen Sonderregelungen in Art. III-315 EVV betreffen die Mehrheitsverhältnisse bei Abstimmungen im Rat. Nach der Grundregel des Art. III-325 Abs. 8 EVV beschließt der Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit. Einen ähnlichen Grundsatz stellt Art. III-315 Abs. 4 EVV für den Bereich der Gemeinsamen Handelspolitik auf, wenngleich dieser Grundsatz von zahlreichen Ausnahmen durchlöchert wird. Dem Vorschlag des Kommissionsmitgliedes Lamy, die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit auf alle Bereiche der Handelspolitik auszudehnen, wurde nicht Rechnung getragen. Trotz „großer Unterstützung“732 in der Gruppe für diesen Vorschlag scheiterte er an dem Wider730 Stimmberechtigt im Rat sind naturgemäß nur solche Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, vgl. Art. III-196 Abs. 1 UAbs. 1 EVV. 731 Eine ähnliche Bestimmung mit gleichen Prozentzahlen hinsichtlich einer qualifizierten Mehrheit und einer Sperrminorität ist in Art. I-44 Abs. 3 UAbs. 3, 4 EVV (Verstärkte Zusammenarbeit), Art. I-59 Abs. 5 UAbs. 3 EVV (Aussetzung bestimmter mit der Zugehörigkeit zur Union verbundener Rechte), Art. III-179 Abs. 4 UAbs. 3 und 4 EVV (Wirtschaftspolitik), ebenso in Art. III-184 Abs. 6 UAbs. 3, 4 und Abs. 7 UAbs. 3, 4 EVV (Defizitverfahren), Art. III-194 Abs. 2 UAbs. 2, 3 EVV (Wirtschafts- und Währungspolitik), Art. III-197 Abs. 4 UAbs. 2, 3 EVV (Übergangsbestimmungen), Art. III-198 Abs. 2 UAbs. 3 EVV (Übergangsbestimmungen), Art. III-312 Abs. 3 UAbs. 3, 4 und Abs. 4 UAbs. 3, 4 EVV (Strukturierte Zusammenarbeit im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik) enthalten. Die grundlegende Vorschrift hinsichtlich der Definition einer qualifizierten Mehrheit findet sich in Art. I-25 EVV. 732 CONV 459 / 02, S. 26, Rdnr. 52.
382
4. Teil: Außenbeziehungen nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa
stand einiger Konventsvertreter. Daher gilt in zahlreichen Fällen das Einstimmigkeitserfordernis. Eine einstimmige Beschlussfassung des Rates ist demnach zum einen erforderlich, wenn ein Abkommen über den Dienstleistungsverkehr733, über Handelsaspekte des geistigen Eigentums oder über ausländische Direktinvestitionen geschlossen werden soll, sofern das betreffende Abkommen Bestimmungen enthält, bei denen für die Annahme interner Bestimmungen Einstimmigkeit erforderlich wäre. Den durch den Vertrag von Nizza festgelegten Grundsatz des Parallelismus zwischen internen und externen Beschlussfassungsregeln hält der Verfassungsvertrag damit aufrecht (Art. III-315 Abs. 4 UAbs. 2 EVV). In Bezug auf den Dienstleistungsverkehr und die Handelsaspekte des geistigen Eigentums haben sich keine Änderungen im Vergleich zu Art. 133 Abs. 5 UAbs. 1, 2 EG ergeben. Neu aufgenommen in die Bestimmungen der gemeinsamen Handelspolitik wurden dagegen die Abkommen über ausländische Direktinvestitionen.734 Gemäß Art. III-315 Abs. 4 UAbs. 3 lit. a EVV beschließt der Ministerrat ebenfalls einstimmig im Falle eines Abkommens über den Handel mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen, wenn dieses Abkommen die kulturelle und sprachliche Vielfalt in der Union beeinträchtigen könnte. Das Erfordernis im letztgenannten Hauptsatz ist im derzeit geltenden EG-Vertrag nicht zu finden. Der Begriff „kulturelle und sprachliche Vielfalt“ wird weder im EG-Vertrag noch in der Verfassung definiert. Indes ist zu bezweifeln, ob dieses Merkmal eine merkliche Kraft entwickeln wird, das Einstimmigkeitserfordernis wiederum einzuschränken. Aufgrund der großen kulturellen und sprachlichen Vielfalt und der daraus resultierenden Sensibilität auf diesem Gebiet einerseits und der Weite des Tatbestandsmerkmals „beeinträchtigen“ andererseits, wird diese Einschränkung nicht allzu weit reichen.735 Ferner ist nicht abzusehen, nach welchen Maßstäben das „Risiko“ der Beeinträchtigung kultureller und sprachlicher Vielfalt abzuschätzen ist.736 733 Der noch im Konventsentwurf enthaltene Zusatz: „. . . , der mit dem Grenzübertritt von Personen verbunden ist,“ (Art. III-217 Abs. 4 KE-EVV) ist in der endgültigen Fassung richtigerweise nicht mehr vorhanden. Dieser Zusatz war aufgrund des WTO-Gutachtens des EuGH aufgenommen worden, wonach die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen, die nicht mit dem Grenzübertritt von Personen verbunden ist (Korrespondenzdienstleistungen), dem „Warenverkehr“ derart ähnlich ist, dass es keinen Grund gebe, sie von dem Begriff der gemeinsamen Handelspolitik auszuschließen, vgl. EuGH, Slg. 1994, I-5267, 5401, Rdnr. 44 – WTO. Diese Einschränkung ist indes nicht mehr nötig, da die Handelspolitik nach dem Verfassungsvertrag nun auch ausdrücklich jede Form des Handels mit Dienstleistungen erfasst, vgl. Art. III-315 Abs. 1 EVV (auch schon Art. III-217 Abs. 1 KE-EVV). Die Regierungskonferenz hat damit einen überflüssigen Zusatz aus dem Verfassungstext entfernt. 734 Nach dem Konventsentwurf gehörten ausländische Direktinvestitionen zwar erstmals zum Umfang der Handelspolitik (Art. III-217 Abs. 1 KE-EVV), wurden jedoch nicht bei den einstimmig zu verabschiedenden Politikbereichen aufgelistet (Art. III-217 Abs. 4 KE-EVV), vgl. auch oben, § 10 II. 4. b) bb). 735 Auf der anderen Seite ist zu beachten, dass Abkommen, die eine solche Beeinträchtigung vorsehen, gegen die Ziele der Union aus Art. I-3 Abs. 3 UAbs. 4 EVV verstoßen
§ 10 Außenkompetenzen der neuen Europäischen Union
383
Nach Art. III-315 Abs. 4 UAbs. 3 lit. b EVV muss eine internationale Übereinkunft auch dann einstimmig gebilligt werden, wenn sie den Handel mit Dienstleistungen des sozialen, des Bildungs- und des Gesundheitssektors zum Gegenstand hat, sofern dieses Abkommen die einzelstaatliche Organisation dieser Dienstleistungen ernsthaft stören und die Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten für ihre Erbringung beeinträchtigen könnte. Die gerade genannten Abkommen fallen bisher nach Art. 133 Abs. 6 UAbs. 2 EG in die gemischte Zuständigkeit der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten und bedürfen daher der einvernehmlichen Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Im Konventsentwurf wurde noch darauf verzichtet, solche Abkommen dem Einstimmigkeitsregime zu unterstellen, eine Bestimmung des Inhalts des Art. III-315 Abs. 4 UAbs. 3 lit. b EVV war folglich nicht vorhanden.737 Dies hätte zur Folge gehabt, dass Übereinkünfte in diesem Bereich mit qualifizierter Mehrheit hätten abgeschlossen werden können. Die abschließende Regierungskonferenz konnte sich jedoch nicht auf eine solche Konsequenz einigen. Der Regierungskonferenz ist es zu verdanken, dass die extrem unübersichtliche Regelung in Art. 133 EG, welche schon durch den Konventsentwurf738 leicht verbessert worden war, schließlich zu einer gut verständlichen und übersichtlichen Vorschrift herangereift ist.
8. Gutachten nach Art. III-325 Abs. 11 EVV Wie bereits oben kurz erwähnt739, besteht die Möglichkeit des Gutachtenverfahrens vor dem EuGH weiterhin fort. Jede von der Union zu schließende völkerrechtliche Übereinkunft kann demgemäß vorab dem EuGH vorgelegt werden. Entsprechend Art. 300 Abs. 6 EG kann ein Mitgliedstaat, das Europäische Parlament, der Ministerrat oder die Kommission vor dem Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages den Gerichtshof anrufen, mit dem Anliegen, die geplante Übereinkunft gutachtlich dahingehend zu untersuchen, ob sie mit der Verfassung vereinbar ist. Der Wortlaut des Art. III-325 Abs. 11 EVV entspricht sinngemäß demjenigen des Art. 300 Abs. 6 EG. Für Abkommen im Bereich der GASP besteht die Möglichkeit eines gerichtlichen ex-ante-Verfahrens vor dem EuGH gemäß Art. III-376 Abs. 1 EVV demgegenüber nicht.740
würden. Görlitz, DÖV 2004, 374 (379) geht daher davon aus, dass die Einstimmigkeitsregel faktisch leer laufen könnte. 736 Krajewski, CMLRev 2005, 91 (121 f.). 737 Vgl. Art. III-217 Abs. 4 KE-EVV. 738 Vgl. Art. III-217 KE-EVV. 739 § 8 III. 8. 740 Vgl. dazu oben, § 8 III. 8.
Fünfter Teil
Zusammenfassung und Ergebnis Fasst man die Ergebnisse der Untersuchung zusammen, ergibt sich eine überwiegend positive Bilanz. Der Vertrag über eine Verfassung für Europa hat der Europäischen Union einen neuen Rahmen für ihre Außenbeziehungen gegeben. Abschließend soll der Versuch unternommen werden zu beurteilen, welche Änderungen und Neuerungen sinnvoll und welche veränderungswürdig erscheinen.
§ 11 Verbesserungen Als entscheidende positive Neuerung stellt sich die Schaffung einer einheitlichen Völkerrechtspersönlichkeit für die Europäische Union dar, welche durch Art. I-7 EVV bewirkt wird. Ferner ist die damit möglich gewordene Verschmelzung der Verträge und die Abschaffung der Säulenstruktur sehr zu begrüßen. Die Verleihung einer einzigen Rechtspersönlichkeit der Europäischen Union schafft vor allem Rechtssicherheit. Der lange schwelende Streit über die Rechtspersönlichkeit der (alten) Europäischen Union ist somit eindeutig gelöst. Art. I-7 EVV schafft die Voraussetzungen, dass die Union auf internationaler Ebene als eigenständiger Akteur auftreten und Partei internationaler Übereinkommen werden kann. Die Europäische Union kann mit dem nun möglichen Beitritt zu internationalen Organisationen ihr politisches Gewicht und ihren Einfluss in der Welt steigern. Als Kompetenzträger wird die Union mit dem Abschluss völkerrechtlicher Verträge europäische Interessen auf internationaler Ebene künftig effizient und transparent vertreten können. Das durch den Zusammenschluss der beiden Hauptverträge gewonnene deutlichere Profil der Union trägt dazu bei, dass sich die Bürger leichter mit der Union identifizieren können. Auch für Drittländer ist die künftige klare Kompetenzträgerschaft von Vorteil, da der jeweils richtige Ansprechpartner nach außen deutlicher erkennbar wird. Die Verleihung einer einheitlichen Rechtspersönlichkeit und die Verschmelzung der Verträge sind somit wesentliche Elemente, die der Bekräftigung der Identität der Union auf der internationalen Bühne dienen. Das gegenwärtige System ist im Hinblick auf das äußere Erscheinungsbild erheblich vereinfacht worden. Die derzeit häufig zu beobachtende Verwechslung der Begriffe „Europäische Gemeinschaft“ und „Europäische Union“ wird in Zu-
§ 11 Verbesserungen
385
kunft nicht mehr vorkommen können, weil die Europäische Union zu einem einheitlichen Rechtssubjekt und einer einheitlichen Struktur wird. Insgesamt kann die Union künftig als internationaler Akteur und Kompetenzträger deutlich effektiver in Erscheinung treten und ihre gewachsene Verantwortung in der Welt wahrnehmen. Als weiterer klarer Vorteil der Neuregelung durch die Verfassung stellt sich die Schaffung eines eigenständigen Titels über das auswärtige Handeln der Union (Art. III-292 bis Art. III-329 EVV) dar. Die bisher vorhandene Fragmentierung der Zuständigkeiten, Verfahren und Organe1 konnte zum Teil überwunden werden. Dadurch wird ein einheitlicher Rahmen geschaffen, welcher die im EG- und im EU-Vertrag verstreuten Außenkompetenzen bündelt und in übersichtlicher Weise zusammenstellt. Eng mit dem gerade genannten Punkt verbunden ist die Einbeziehung der GASP (und der ESVP) unter den Titel „Auswärtiges Handeln der Union“. Der politisch wichtige Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik wird in das System der Außenbeziehungen der Union integriert und damit den allgemeinen Zielen und Werten der Union unterworfen. Innerhalb des gerade genannten Titels „Auswärtiges Handeln der Union“ sind die gleichsam vor die Klammer gezogenen allgemein anwendbaren Bestimmungen von besonderer Bedeutung. Insbesondere Art. III-292 EVV legt einen klaren und kohärenten Rahmen mit Zielbestimmungen für den gesamten Bereich der Außenpolitik der Union fest. Da es eine Vielzahl von Politiken gibt, die nach außen gerichtet sind, dabei aber unterschiedliche Zwecke verfolgen (die Handelspolitik etwa verfolgt primär andere Ziele als die Entwicklungshilfepolitik, welche wiederum andere Ziele verfolgt als die GASP), ist ein einheitlicher und systematischer Rahmen von Zielen für das auswärtige Handeln der Union nötig. Die maßgeblichen Ziele, Werte und Prinzipien, die für die Außenpolitik der Union gelten sollen, werden mit Art. III-292 EVV erstmals an einer Stelle im Vertrag niedergelegt. Im Bereich der GASP ist insbesondere die Einbeziehung der GASP-Instrumente in die allgemeine Systematik zu begrüßen. Mit der Festlegung auf die einheitliche Anwendung des Rechtsaktstyps „Europäischer Beschluss“ werden Rechtsakte eigener Art aus dem Verfassungsvertrag verbannt. Besonders wichtig ist die Schaffung des neuen Amtes eines Außenministers der Europäischen Union (Art. I-28 EVV). Dieser vereinigt – wie dargestellt – die Funktionen des Hohen Repräsentanten für die GASP mit denjenigen des Kommissars für Außenbeziehungen. Die Zusammenlegung der beiden Ämter kann Doppelarbeit verhindern. Dem Außenminister der Union kommt die schwierige Aufgabe zu, die Lücke zwischen dem Rat und der Kommission einerseits und der GASP und den anderen Bereichen der Europäischen Außenpolitik andererseits zu überbrücken. Vorteilhaft erscheint insbesondere das schärfere Profil, welches die Union 1
So Kietz / Uplegger, Integration 2005, 87 (94).
25 Metz
386
5. Teil: Zusammenfassung und Ergebnis
mit der Etablierung eines einzigen Vertreters auf internationaler Ebene gewinnt. Nimmt man darüber hinaus die zweieinhalbjährige Amtszeit des gewählten Präsidenten des Europäischen Rates ins Blickfeld, so zeigt sich, dass die Neuregelungen eine besondere Chance für eine neue Art von Kontinuität in den Außenbeziehungen der Union bieten. Trotz der aufgezeigten möglichen Probleme (etwa des nicht geklärten Verhältnisses zwischen dem Präsidenten des Europäischen Rates und dem Außenminister oder der möglichen Kompetenzverschiebung im Kräfteverhältnis zwischen Kommission und Rat) besteht die Aussicht, dass mit der Verschmelzung der Funktionen des Hohen Vertreters für die GASP und des Außenkommissars in einem Amt die Kohärenz in der Außenpolitik der Union deutlich gesteigert wird. Der Außenminister der Union wird unterstützt von EU-Delegationen (früher Kommissionsdelegationen) und einem Europäischen Auswärtigen Dienst, welcher durch den Verfassungsvertrag geschaffen wird. Letzterer ist notwendiger Bestandteil einer effektiven Arbeit des Außenministers. Die Zusammenlegung der außenpolitischen Generaldirektionen des Generalsekretariates des Rates und der Kommission sowie die Einbeziehung mitgliedstaatlicher Diplomaten ist eine entscheidende Voraussetzung für die Durchführbarkeit einer kohärenten europäischen Außenpolitik. Schließlich tragen die ausführlicheren Bestimmungen über die GASP zu einem besseren Verständnis bei. Die Möglichkeit der engeren Zusammenarbeit in verschiedenen Formen (Art. I-41 Abs. 6, Art. III-416, Art. III-419 Abs. 2 EVV) ist ein entscheidender Gewinn an Flexibilität und kann die Gefahr der Blockade oder Lähmung einer europäischen Außenpolitik, welche durch die Beibehaltung des Einstimmigkeitsprinzips entsteht, in gewissem Maße abmildern. Insbesondere die Fähigkeit der Union, im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik gemeinsame Strukturen zu entwickeln (Art. I-41 Abs. 6 in Verbindung mit III-312 EVV), wird mit der (aufgrund der bestehenden unterschiedlichen verteidigungspolitischen Konzepte der Mitgliedstaaten) notwendigen Flexibilität gestärkt. Im Bereich der bisherigen Gemeinschaftspolitiken ist insbesondere die Vereinfachung der Vorschrift über die gemeinsame Handelspolitik (Art. III-315 EVV) zu begrüßen. Einen entscheidenden Vorteil bietet zudem die Erweiterung des Begriffs der Handelspolitik. Weder im Bereich der Dienstleistungen oder der ausländischen Direktinvestitionen noch im Bereich der Handelsaspekte des geistigen Eigentums sind (schwerfällige) gemischte Verträge erforderlich. Im Sinne einer effektiven europäischen Handelspolitik ist es sicherlich bedauernswert, dass das Beschlussfassungsverfahren mit qualifizierter Mehrheit nicht auf alle Bereiche der gemeinsamen Handelspolitik ausgedehnt worden ist. Allerdings besteht die Hoffnung, dass dieser Makel im Wege des vereinfachten Vertragsänderungsverfahrens nach Art. IV-444 EVV behoben wird. Ein Mangel der bisherigen Bestimmungen, nämlich die fehlende Pflicht, das Europäische Parlament zu beteiligen, wird durch eine erstaunliche Kehrtwende beseitigt. Künftig steht dem Europäischen Parlament
§ 12 Schwachstellen
387
nicht nur ein Anhörungs-, sondern sogar ein Zustimmungsrecht für völkerrechtliche Übereinkommen betreffend die gemeinsame Handelspolitik zu. Darüber hinaus ist es sinnvoll, dass eine neue Rechtsgrundlage für humanitäre Hilfe geschaffen wurde (Art. III-321 EVV). Damit erübrigt sich der Rückgriff auf die Flexibilitätsklausel, und der Handlungsrahmen der Union wird ausdrücklich erweitert. Schließlich ist der Beitritt zur EMRK erwähnenswert, welcher aufgrund von Art. I-9 Abs. 2 EVV zu bewirken ist. Auch die einheitliche Vertretung der Euro-Staaten bei internationalen Einrichtungen und Konferenzen im Finanzbereich, die nun ausdrücklich vertraglich verankert ist (Art. III-196 Abs. 2 EVV), bedeutet einen erheblichen Fortschritt. Einen Erfolg für die Transparenz und Rechtssicherheit stellt allgemein die Schaffung eines Kompetenzsystems dar (Art. I-11 ff. EVV). Dieser Fortschritt betrifft nicht nur die Außenkompetenzen, sondern vor allem auch die internen Zuständigkeiten der Union. Erstmals werden die bisher über den Vertrag verstreuten Kompetenzgrundlagen systematisch kategorisiert. In einem einzigen Artikel werden die Rechtsfolgen der jeweiligen Kompetenzarten bestimmt (Art. I-12 EVV). Darüber hinaus hebt der Verfassungsvertrag an zentraler Stelle die Bedeutung der Grundprinzipien, nämlich die Grundsätze der begrenzten Einzelermächtigung und der Verhältnismäßigkeit sowie das Subsidiaritätsprinzips hervor (Art. I-11 EVV). Damit wird der Einstieg in eine klare Kompetenzordnung vollzogen. Mit Art. III-323 EVV wird grundsätzlich kodifiziert, dass implizite Außenkompetenzen der Europäischen Union bestehen. Solche impliziten Kompetenzen im Außenbereich existieren zwar nach ständiger – und weithin nicht angezweifelter – Rechtsprechung des EuGH bereits nach den derzeit gültigen Verträgen; die unbefriedigende Situation, dass die Voraussetzungen impliziter Außenkompetenzen nur aus Richterrecht herleitbar sind, wird jedoch verbessert. Grundsätzlich begrüßenswert erscheint es daher, dass künftig anhand der Tatbestandsvoraussetzungen des Art. III-323 EVV zu bestimmen sein wird, ob der Union eine Außenkompetenz zusteht oder nicht. Wie die Rechtsprechung des EuGH handwerklich in den Verfassungsvertrag umgesetzt wurde, steht auf einem anderen Blatt. Dies führt unmittelbar zu den Schattenseiten, die der Verfassungsvertrag unzweifelhaft auch aufweist.
§ 12 Schwachstellen Veränderungswürdig erscheint vor allem die gerade angesprochene Umsetzung des bisherigen Richterrechts zu den Außenkompetenzen der Union. Hier wird bedauernswerter Weise nicht auf den Grundsatz der implied-powers zurückgegriffen, stattdessen wird ein Ziel-Mittel-Schluss kodifiziert. Dies birgt die Gefahr einer Überdehnung der Außenkompetenzen der Europäischen Union. Wie oben dargestellt, ergibt sich unter Rückgriff auf die Ziele der Union eine sehr weitgehende 25*
388
5. Teil: Zusammenfassung und Ergebnis
Außenkompetenz, die nur unzureichend mit dem unbestimmten Begriff der „Erforderlichkeit“ eingegrenzt wird. Auch die Festlegung, wann der Union für den Abschluss internationaler Verträge eine ausschließliche Kompetenz zusteht, ist stellenweise ungenau (Art. I-13 Abs. 2 EVV) und könnte in der Praxis zu einer erheblichen Ausweitung derjenigen Bereiche führen, in denen nur noch die Union handeln darf. Ebenso bedauerlich ist die mangelnde Abgrenzung der Reichweite der ausschließlichen Zuständigkeit nach Art. I-13 Abs. 2 EVV zu anderen Bereichen, etwa den Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen (Art. I-17 EVV) oder der GASP. Im Bereich der allgemeinen Außenkompetenzen der Union und der Frage der Ausschließlichkeit von Unionskompetenzen ist damit aufgrund von ungenauen Formulierungen das Ziel der Vereinfachung, der Klarheit und der Transparenz im neuen Verfassungsvertrag nicht verwirklicht worden. In diesem Kontext ist ein weiterer schwerer Mangel zu konstatieren: Die Unfähigkeit des Konvents und der Regierungskonferenzen, eine klare Festlegung der Art der Kompetenz der GASP zu treffen. Die Annahme, Art. I-16 EVV begründe eine Kompetenzkategorie sui generis, führt nicht weiter, da Kriterien für ein solche Kompetenzart fehlen. Daher ist man auf Hilfskonstruktionen angewiesen, die mittels einer ausdrücklichen Regelung hätten vermieden werden können. Das Versäumnis, die Rechtsprechungsgewalt des EuGH auf den GASP-Bereich auszudehnen, trübt zudem die gelungene Verschmelzung der Verträge und die Abschaffung der Säulenstruktur. Mögen spezielle Verfahrensregeln für den Bereich der GASP aufgrund der politischen Gegebenheiten noch unumgehbar sein, so hätte doch eine umfassende Rechtskontrolle durch den EuGH zur Einheitlichkeit der europäischen Rechtsordnung beigetragen. Die gerade angesprochene Frage etwa, welcher Art die Kompetenz nach Art. I-16 EVV ist, oder inwieweit eine ausschließliche Zuständigkeit im Bereich der GASP dadurch entstehen kann, dass die Union bestimmte Maßnahmen trifft, ist der Rechtsprechungsgewalt des EuGH und damit einer Klärung entzogen. Ein weiterer Makel liegt in der Tatsache begründet, dass im Bereich der GASP nicht umfassend zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit übergegangen worden ist. Neben marginalen Erweiterungen der Anwendungsfälle, in denen mit qualifizierter Mehrheit abgestimmt wird, ist weiterhin das Einstimmigkeitsprinzip die Regel. Daraus folgt bei einer Europäischen Union mit (mindestens) 25 Mitgliedstaaten und damit einhergehend 25 verschiedenen Interessenlagen die konkrete Möglichkeit, dass Maßnahmen der Union aufgrund des Vetos auch nur eines einzigen Mitgliedstaates blockiert werden. Die daraus resultierende Gefahr der Lähmung der Europäischen Union in ihren Außenbeziehungen ist unübersehbar. Auch wenn die Durchführung der Außenpolitik – richtigerweise – immer noch als mächtiges Symbol für die Souveränität eines Staates und die Staatlichkeit an sich angesehen wird2, ist es bedauerlich, dass sich die Mitgliedstaaten nicht auf kons2
Cremona, CMLRev 2003, 1347 (1352).
§ 13 Grund- oder Leitprinzipien im Bereich der Außenkompetenzen
389
truktivere und effektivere Verfahrensregeln einigen konnten. Es bleibt deshalb nur zu hoffen, dass die Handlungsfähigkeit der Union im Bereich der GASP aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips nicht allzu stark eingeschränkt wird. Einen Lichtblick bietet immerhin die allgemeine Passerelle-Klausel gemäß Art. IV-444 EVV, wonach der Europäische Rat einstimmig beschließen kann, auch im Bereich der GASP (mit Ausnahme der Beschlüsse mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen) von der einstimmigen zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit überzugehen.
§ 13 Grund- oder Leitprinzipien im Bereich der Außenkompetenzen der Europäischen Union In dem neuen Verfassungsvertrag für Europa zeichnet sich ein zentraler Gedanke ab, der sich für den Bereich der Außenbeziehungen der Union als tragend erwiesen hat. Vor allem dem Konvent, aber auch der abschließenden Regierungskonferenz ging es maßgeblich darum, dass die Union mit der Europäischen Verfassung zu einem kohärenten und effektiven Auftreten nach außen befähigt werde. Das Ziel der Kohärenz wird bereits in der ersten Vorschrift des Teils III der Verfassung (Art. III-115 EVV) genannt. Der derzeit in Art. 1 Abs. 3 EU und in verstreuten Querschnittsklauseln des EG-Vertrages genannte Kohärenzgedanke wird mit den Art. III-115 ff. EVV zum „allgemeinen, wechselseitig verzahnenden Klammergedanken“3 für die Politikbereiche und Arbeitsweise der neuen Europäischen Union.4 Neben dieser allgemeinen Querschnittsklausel, die per se auch für die Außenpolitik der Union gilt, wird der Kohärenzgedanke nochmals – diesmal speziell für den Bereich der Außenbeziehungen – in Art. I-28 Abs. 4 S. 2 EVV betont. Nach dieser Vorschrift soll der Außenminister der Union für die Kohärenz des auswärtigen Handelns der Union Sorge tragen. Das Hauptziel im Bereich der Außenbeziehungen, Kohärenz zwischen den einzelnen außenpolitischen Bereichen untereinander, aber auch im Verhältnis zu den internen Politiken der Union herzustellen, kommt zudem sehr anschaulich in der zweifachen Kohärenzbestimmung des Art. III-292 Abs. 3 UAbs. 2 EVV zum Ausdruck. Dem genannten Hauptzweck gilt insbesondere auch die Einführung einer allgemeinen Zielbestimmung für das auswärtige Handeln (Art. III-292 EVV). Der Verfassungsvertrag rückt die generelle und grundsätzliche Wertorientierung der Union in den Vordergrund. Neben der Statuierung „universeller Werte“ in der Präambel ist das erklärte Oberziel der Außenpolitik der Union die Förderung der So Müller-Graff, Integration 2004, 186 (199). Gemäß Art. I-19 Abs. 1 EVV verfügt die Union über einen institutionellen Rahmen, der – in seiner Gesamtheit – unter anderem den Zweck hat, „die Kohärenz, Effizienz und Kontinuität ihrer Politik und ihrer Maßnahmen sicherzustellen“. 3 4
390
5. Teil: Zusammenfassung und Ergebnis
gemeinsamen Werte und Ziele (Art. I-3 Abs. 4 S. 1 EVV), welche zuvor in Art. I-2 EVV und Art. I-3 EVV festgelegt worden sind. Die Betonung der Werte insbesondere in Bezug auf die Außenpolitik der Union soll eine „nach außen gewandte Offenheit zur Welt“5 demonstrieren. Die Schaffung des Amtes eines Europäischen Außenministers, der der europäischen Außenpolitik ein Gesicht verleihen soll, dient ebenfalls der Präsenz, Kohärenz und Effizienz des auswärtigen Handelns der Union. Die Koordinierungsfunktion des Außenministers kommt speziell in der Personalunion (Doppelhut) von Hohem Vertreter und Außenkommissar zum Ausdruck. Wesentliches Element für ein aktives und eigenverantwortliches Tätigwerden der Union ist das Bestehen von Völkerrechtspersönlichkeit, welche der Union mit Art. I-7 EVV eingeräumt wurde. Die Schaffung des Amtes eines (auf zweieinhalb Jahre gewählten) Präsidenten des Europäischen Rates kann darüber hinaus zu einer zielleitenden Koordinierung der mittlerweile 25 Staats- und Regierungschefs beitragen.6 Der gemeinsame Zielkatalog, der die grundsätzlichen Ziele der Politik explizit festlegt, ist die Rechtsgrundlage für eine kohärente Außenpolitik der Union. Zusammen mit der zuvor genannten doppelten Kohärenzbestimmung ist das Ziel der Union, eine zusammenhängende, widerspruchsfreie Außenpolitik zu schaffen, transparent und plastisch im Verfassungsvertrag niedergelegt worden. Das genannte Ziel – ein widerspruchsfreies Gesamthandeln – ist zwar gerichtlich kaum einklagbar, dennoch werden wichtige Grundsteine für ein solches Handeln gelegt. Die genannten Oberziele der Kohärenz, Effizienz und Präsenz vereinigt mit einer Profilierung der europäischen Wertorientierung sind die nach dem Verfassungsvertrag tragenden Säulen des auswärtigen Handelns der Union. Eine starke Rolle der Europäischen Union in der Welt scheiterte bisher vor allem an der Inkohärenz der Außenbeziehungen.7 Es ist zu hoffen, dass mit den vom Verfassungsvertrag geschaffenen Strukturen die Union befähigt wird, künftig ihr volles Gewicht in die Waagschale der Weltpolitik werfen zu können.8 Ob die Union in Zukunft – wie schon seit langem gefordert9 – „mit einer Stimme“ sprechen wird, bleibt abzuwarten. „Der Sinn dieses einheitlichen Auftretens ist das Bekenntnis und der Wille Europas zur Teilhabe an einer weltweiten Verantwortung.“10 Die Beratungen des Konvents und der Regierungschefs haben gezeigt, dass das BeMüller-Graff, Integration 2004, 186 (200 f.). Müller-Graff, Integration 2004, 186 (199). 7 Kietz / Uplegger, Integration 2005, 87 (94). 8 Ob die Verfassung ein „Meilenstein auf dem Weg zur weiteren europäischen Integration“ sein wird, so Bundeskanzler Schröder in seiner Regierungserklärung, vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 03. 07. 2004, S. 4, wird vor allem vom politischen Willen der Mitgliedstaaten und ihrer Bürger abhängen. 9 Die Behauptung einer „europäischen Identität gegenüber der übrigen Welt“ wurde bereits in der Kopenhagener Erklärung von 1973 gefordert. 10 So bereits Hallstein, Die Europäische Gemeinschaft, S. 241, im Jahre 1973. 5 6
§ 13 Grund- oder Leitprinzipien im Bereich der Außenkompetenzen
391
wusstsein Europas, mehr Verantwortung in der Welt übernehmen zu müssen, mittlerweile vorhanden ist.11 Der Verfassungsvertrag bietet der Europäischen Union durch die gelungene Integration der Ziele, der Politikbereiche und der rechtlichen Instrumente einen effektiven Mechanismus, um in internationalen Beziehungen eine tragende Rolle wahrnehmen zu können. Bei all dem ist jedoch zu beachten, dass viele Schwächen der GASP und des gesamten äußeren Auftretens der Union oft nicht auf unzureichende Instrumentarien oder Verfahren zurückzuführen sind, sondern vielmehr auf einen mangelnden politischen Willen.12 So ist beispielsweise ein Europäischer Außenministers als gemeinsamer Sprecher nur dann effektiv und sinnvoll, wenn auch eine einheitliche europäische Botschaft existiert. Abgesehen von der unpräzisen Ausformulierung der impliziten Außenkompetenzen wird mit dem Verfassungsvertrag ein stabiler und dauerhafter Rahmen für die künftige Entwicklung der Europäischen Union geschaffen, der die Grundlage für eine größere Effizienz und eine gestärkte Rolle der Europäischen Union in der Welt legt und die Sichtbarkeit der Union und ihre Fähigkeit als globaler Akteur erheblich stärkt. Im Hinblick auf den ins Stocken geratenen Ratifikationsprozess bleibt daher zu hoffen, dass sich der Satz Papiers: „Wie auch immer das weitere Schicksal des Konventsentwurfs [Verfassungsvertrages] verlaufen wird, wird es künftig keinen Weg an ihm vorbei und wohl auch keinen Weg hinter ihn zurück geben“13, zumindest für den Bereich der Außenbeziehungen der Europäischen Union bewahrheiten wird.
11 Vgl. Bermann, ELRev 2004, 363 (370), nach dem ein gemeinsames Eigeninteresse und genügend Bewusstsein darüber besteht, wie dringend erforderlich es ist, in den Außenbeziehungen mit einer Stimme zu sprechen. 12 In dieser Richtung auch Oppermann, DVBl. 2003, 1234 (1235), dem es zweifelhaft erscheint, ob der fehlende Wille zur gemeinsamen europäischen Außenpolitik durch institutionelle Vorkehrungen ersetzt werden kann; vgl. auch Kietz / Uplegger, Integration 2005, 87 (94). Nach Müller-Graff, Integration 2004, 186 (199) schaffen Institutionen zwar eine „raison d’être“, ersetzen aber nicht den politischen Willen. 13 Vgl. den Festvortrag von Papier anlässlich des 65. Deutschen Juristentags 2004, Pressemitteilung Nr. 3 / 2004, S. 2.
Literaturverzeichnis Aschenbrenner, Jo Beatrix: Menschenrechte in den Außenbeziehungen der Europäischen Union, 2000, Frankfurt am Main. Berg, Axel: Nizza und die Ergebnisse des Konvents, ZEuS 2003, 353. Bergmann, Jan: Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf das öffentliche Leben und Recht, ZEuS 2003, 103. Berié, Hermann / Miller, Rudolf: Gemeinsamer Markt und Euratom, 2. Auflage 1959, Berlin. Bermann, George A.: Editorial: The European Union as a Constitutional Experiment, ELRev 2004, 363. Besson, Samantha: From European Integration to European Integrity: Should European Law Speak with Just One Voice?, ELJ 2004, 257. Bieber, Roland / Epiney, Astrid / Haag, Marcel / Beutler, Bengt: Die Europäische Union – Rechtsordnung und Politik, 5. Auflage 2001, Baden-Baden, zitiert als: Bearbeiter, in: Bieber / Epiney / Haag / Beutler, Die EU Rechtsordnung und Politik. Bleckmann, Albert: Die Kompetenz der Europäischen Gemeinschaft zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge, EuropaR 1977, 109. – Der Grundsatz der Parallelität der Innen- und Außenkompetenz im deutschen Verfassungsrecht, NVwZ 1989, 311. Borchardt, Klaus-Dieter: Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, 2. Auflage 2002, Heidelberg. Bourgeois, Jacques H. J.: The EC in the WTO and Advisory Opinion 1 / 94: An Echternach Procession, CMLR (32) 1995, 763. Brandtner, Barbara / Rosas, Allan: Human Rights and the External Relations of the European Community: An Analysis of Doctrine and Practice, EJIL 1998, 468. Breier, Siegfried: Die völkerrechtlichen Vertragsschlusskompetenzen der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten im Bereich des Umweltschutzes, EuropaR 1993, S. 340. Breitenmoser, Stephan / Husheer, André: Europarecht I – Institutionelle Grundlagen von EU und EG, 2. Auflage 2002, Zürich, Basel, Genf. – Europarecht II – Binnenmarkt- und Außenwirtschaftsrecht der EG, Europäischer Grundrechtsschutz (EU, Europarat, OSZE), 2. Auflage 2002, Zürich, Basel, Genf. Brückner, Peter: The European Community and the United Nations, EJIL 1990, 174. Burkard, Johannes: Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und ihre Berührungspunkte mit der Europäischen Gemeinschaft, 2001, Berlin.
Literaturverzeichnis
393
Busek, Erhard / Hummer, Waldemar (Hrsg.): Der Europäische Konvent und sein Ergebnis – eine Europäische Verfassung, 2004, Wien, Köln, Weimar. Calliess, Christian / Ruffert, Matthias: Kommentar des Vertrages über die Europäische Union und des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft – EUV / EGV –, 2. Auflage 2002, Neuwied, Kriftel, zitiert als: Bearbeiter, in: Calliess / Ruffert, EG Kommentar. Cannizzaro, Enzo (Hrsg.): The European Union as an Actor in International Relations, 2002, Den Haag, London, New York. Carstens, Karl: Die Errichtung des gemeinsamen Marktes in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Atomgemeinschaft und Gemeinschaft für Kohle und Stahl, ZaöRV 1957 / 1958, 459. Carstens, Karl / Börner, Bodo: Die Außenbeziehungen der Europäischen Gemeinschaft, Kölner Schriften zum Europarecht, Band 25, 1974, Köln, Berlin, Bonn, München. Cludius, Stefan: Die Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft für den Bereich der Bildungspolitik, 1995, Frankfurt a.M. Coen, Martin / Hölscheidt, Sven / Pieper, Stefan Ulrich (Hrsg.): Europa ’93 – Auf dem Weg zur Europäischen Union, Festschrift für Prof. Dr. Dr. Albert Bleckmann zum 60. Geburtstag, 1993, Herne / Berlin. Constantinesco, Léontin-Jean: Das Recht der Europäischen Gemeinschaften, 1977, BadenBaden. Craig, Paul: Constitutions, Constitutionalism, and the European Union, ELJ 2001, 125. – Competence: clarity, conferral, containment and consideration, ELRev 2004, 323. Cremona, Marise: The Draft Constitutional Treaty: External Relations and External Action, CMLRev 2003, 1347. – The Union As A Global Actor: Roles, Models And Identity, CMLRev 2004, 553. – EU enlargement: solidarity and conditionality, ELRev 2005, 3. Cusack, Thomas F.: External Relations of the European Atomic Energy Community in the Fields of Supply and Safeguards; Background and Developments in 1982 and 1983, YEL 1983, 347. – A Tale of Two Treaties: An Assessment of the Euratom Treaty in Relation to the EC Treaty, CMLR 2003, 117. Dashwood, Alan: States in the European Union, ELRev 1998, 201. – The Relationship Between The Member States And The European Union / European Community, CMLRev 2004, 355. Dauderstädt, Michael: Das erweiterte Europa in einer bedrohlichen Welt, Integration 2004, 28. Dauses, Manfred A.: Die Beteiligung der Europäischen Gemeinschaften an multilateralen Völkerrechtsübereinkommen, EuropaR 1979, 138. Degenhart, Christoph: Staatsrecht I, Staatsorganisationsrecht, 17. Auflage 2001, Heidelberg.
394
Literaturverzeichnis
Delbrück, Jost / Wolfrum, Rüdiger: Völkerrecht – Band I / 3, Die Formen des völkerrechtlichen Handelns; Die inhaltliche Ordnung der internationalen Gemeinschaft, 2. Auflage 2002, Berlin. Deutscher Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.): Eine Verfassung für Europa – Der Europäische Konvent und der Deutsche Bundestag, Berichte und Dokumentationen mit einer Einleitung von Jürgen Meyer und Sylvia Hartleif (Zur Sache; 1 / 2003), 2004, Berlin. Doehring, Karl: Staat und Verfassung in einem zusammenwachsenden Europa, ZRP 1993, 98. Dörr, Oliver: Noch einmal: Die Europäische Union und die Europäischen Gemeinschaften, NJW 1995, 3162. – Die Entwicklung der ungeschriebenen Außenkompetenzen der EG, EuZW 1996, 39. Drück, Helmut: Die internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Verwendung der Atomenergie innerhalb Europas, 1959, Frankfurt a.M., Berlin. Duden: Das große Fremdwörterbuch, Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter, (herausgegeben und bearbeitet vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion), 2. Auflage 2000, Mannheim und Leipzig. Editorial Comments: Where do we go with Community external relations after accession? CMLRev 2004, 631. – A Constitution for Europe, CMLRev 2004, 899. Eeckhout, Piet: External Relations of the European Union, Legal and Constitutional Foundations, 2004, Oxford, New York. Ehle, Dietrich / Meier, Gerd: EWG-Warenverkehr, Außenhandel – Zölle – Subventionen, 1971, Köln. Einem, Caspar: Eine Verfassung für Europa – Anmerkungen zu ausgewählten Aspekten des Verfassungsentwurfs, EuropaR 2004, 202. Emiliou, Nicholas: The Death of Exclusive Competence?, ELRev (21) 1996, 294. Emmert, Frank: Europarecht, 1996, München. Epping, Volker, in Zusammenarbeit mit Lenz, Sebastian, Leydecker, Philipp: Grundrechte, 2. Auflage 2004, 2005, Berlin, Heidelberg. Europa-Report: EU-Kommission verteidigt „Open-Sky“-Rechtsprechung, EuZW 2005, 67. Everling, Ulrich: Quis custodiet custodes ipsos? Zur Diskussion über die Kompetenzordnung der Europäischen Union und ein Kompetenzgericht, EuZW 2002, 357. Fink-Hooijer, Florika: The Common Foreign and Security Policy of the European Union, EJIL 1994, S. 173. Fischer, Klemens H.: Der Vertrag von Nizza – Text und Kommentar, 2. Auflage 2003, BadenBaden. Fischer, Peter / Köck, Heribert Franz: Allgemeines Völkerrecht, 4. Auflage 1994, Wien. – Europarecht einschließlich des Rechts supranationaler Organisationen, 3. Auflage 1997, Wien.
Literaturverzeichnis
395
Frenz, Walter: Außenkompetenzen der Europäischen Gemeinschaften und der Mitgliedstaaten im Umweltbereich, 2001, Berlin. Frid, Rachel: The Relations Between The EC And International Organizations – Legal Theory and Practice, 1995, Den Haag. Friedrichs, Jörg: Die Frage der Völkerrechtssubjektivität der Europäischen Union, 1998, Trier. Fuß, Ernst-Werner: Die Befugnis der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge mit Drittstaaten, DVBl. 1972, 237. Gauttier, Pascal: Horizontal Coherence and the External Competences of the European Union, ELRev 2004, 23. Geiger, Rudolf: Vertragsschlusskompetenzen der Europäischen Gemeinschaft und auswärtige Gewalt der Mitgliedstaaten, JZ 1995, 973. Goll, Ulrich / Kenntner, Markus: Brauchen wir ein Europäisches Kompetenzgericht? Vorschläge zur Sicherung der mitgliedstaatlichen Zuständigkeiten, EuZW 2002, 101. Görlitz, Niklas: Europäischer Verfassungsvertrag und künftige EU-Kompetenzen – Materielle Kompetenzverschiebungen zwischen Europäischer Union und EU-Mitgliedstaaten nach den Vorgaben des Konventsentwurfs eines künftigen EU-Verfassungsvertrages –, DÖV 2004, 374. Grabitz, Eberhard / Hilf, Meinhard (Hrsg.): Das Recht der Europäischen Union – Kommentar, München, Stand August 2003, zitiert als: Bearbeiter, in: Grabitz / Hilf, EU-Kommentar. Groux, Jean / Manin, Philippe: Die Europäischen Gemeinschaften in der Völkerrechtsordnung, 1984, Luxemburg. Haedrich, Heinz: Europäische Atomverträge im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 1966, Baden-Baden. Hailbronner, Kai: Erster Beratungsgegenstand: Kontrolle der auswärtigen Gewalt, VVDStRL 56 (1997), 7. Hallier, Hans-Joachim: Die Vertragsschließungsbefugnis der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, ZaöRV 1957, 428. Hallstein, Walter: Die Europäische Gemeinschaft, 1973, Düsseldorf, Wien. Hänsch, Klaus: Die Verfassung für die Europäische Union – nach der Regierungskonferenz, ZEuS 2004, 1. Hartley, T. C.: The Foundations of European Community Law, 5. Auflage 2003, Oxford. Heffernan, Liz / McAuliffe, Conor: External relations in the air transport sector: the Court of Justice and the open skies agreements, ELRev 2003, 601. Heinrichs, Armin: Die Auswärtigen Beziehungen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 1961, Bonn. Heliskoski, Joni: Mixed Agreements as a Technique for Organizing the International Relations of the European Community and its Member States, 2002, Den Haag, London, New York. Herdegen, Matthias: Europarecht, 3. Auflage 2001, München.
396
Literaturverzeichnis
Herrmann, Christoph: Vom misslungenen Versuch der Neufassung der gemeinsamen Handelspolitik durch den Vertrag von Nizza, EuZW 2001, 269. – Common Commercial Policy After Nice: Sisyphus Would Have Done A Better Job, CMLRev 2002, 7. – Die EG-Außenkompetenzen im Schnittbereich zwischen internationaler Umwelt- und Handelspolitik, NVwZ 2002, 1168. Heusel, Wolfgang (Hrsg.): Die Osterweiterung der Europäischen Union, Schriftenreihe der Europäischen Rechtsakademie Trier (Band 34), 2002, Köln. Hilf, Meinhard / Pache, Eckhard: Der Vertrag von Amsterdam, NJW 1998, 705. Hillgruber, Christian: in: Kluth, Winfried (Hrsg.), Die Europäische Union nach dem Amsterdamer Vertrag, 2000, Baden-Baden. Hillion, Christophe: The European Union is dead. Long live the European Union . . . A commentary on the Treaty of Accession 2003, ELRev 2004, 583. – EU Enlargement: A Legal Approach, 2004, Oxford. Hobe, Stephan: Europarecht, 2002, München. – Bedingungen, Verfahren und Chancen europäischer Verfassungsgebung: Zur Arbeit des Brüsseler Verfassungskonvents, EuropaR 2003, 1. Hoffmeister, Frank: Menschenrechts- und Demokratieklauseln in den vertraglichen Außenbeziehungen der Europäischen Gemeinschaft, 1998, Berlin, Heidelberg, New York. Hofmann, Rainer / Zimmermann, Andreas (Hrsg.): Eine Verfassung für Europa – die Rechtsordnung der Europäischen Union unter dem Verfassungsvertrag, Vortragsreihe am WaltherSchücking-Institut für Internationales Recht an der Universität Kiel im Wintersemester 2003 / 4 und Sommersemester 2004, 2005, Berlin. Howse, Robert: From Politics to Technocracy – and Back Again: The Fate of the Multilateral Trading Regime, AJIL 2002, 94. Jahns-Böhm, Jutta / Breier, Siegfried: Die umweltrechtliche Querschnittsklausel des Art. 130 r II 2 EWGV. Eine Untersuchung am Beispiel der Güterkraftverkehrspolitik der Europäischen Gemeinschaft, EuZW 1992, 49. Jarass, Hans D. / Pieroth, Bodo: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Kommentar, 3. Auflage 1995, München, zitiert als: Bearbeiter, in: Jarass / Pieroth, Grundgesetz Kommentar. Jennert, Carsten: Die zukünftige Kompetenzabgrenzung zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten, NVwZ 2003, 936. Jopp, Matthias / Regelsberger, Elfriede: GASP und ESVP im Verfassungsvertrag – eine neue Angebotsvielfalt mit Chancen und Mängeln, Integration 2003, 550. Kellermann, Alfred E. / de Zwaan, Jaap W. / Czuczai, Jenö (Hrsg.): EU Enlargement – The Constitutional Impact at EU and National Level, 2001, The Hague. Kietz, Daniela / Uplegger, Silvia: TAGUNG – Weltmacht Europa?, Integration 2005, 87. Kißler, Klaus-Peter: Die Zulässigkeit von Wirtschaftssanktionen der Europäischen Gemeinschaft gegenüber Drittstaaten, 1984, Frankfurt a. M.
Literaturverzeichnis
397
Koenig, Christian: Die Europäische Union als bloßer materiellrechtlicher Verbundrahmen, EuropaR 1998, Beiheft 2, 139. Koenig, Christian / Haratsch, Andreas: Europarecht, 4. Auflage 2003, Tübingen. Koenig, Christian / Lorz, Ralph Alexander: Stärkung des Subsidiaritätsprinzips, JZ 2003, 167. Kokott, Juliane / Doehring, Karl / Buergenthal, Thomas: Grundzüge des Völkerrechts, 3. Auflage 2003, Heidelberg. Koskenniemi, Martti: International Law Aspects of the European Union, 1998, Den Haag, London, New York. Koutrakos, Panos: „I Need to Hear You Say It“: Revisiting the Scope of the EC Commercial Policy, YEL 2003, 407. Krajewski, Markus: Foreign Policy and the European Constitution, YEL 2003, 435. – External Trade Law And The Constitution Treaty: Towards A Federal And More Democratic Common Commercial Policy?, CMLRev 2005, 91. Krämer, Ludwig: Die Rechtsprechung der EG-Gerichte zum Umweltrecht 2000 und 2001, EuGRZ 2002, 483. Kugelmann, Dieter: Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, EuropaR 1998, Beiheft 2, 99. – „Kerneuropa“ und der EU-Außenminister – die verstärkte Zusammenarbeit in der GASP, EuropaR 2004, 322. Lais, Martina: Die Rolle der nationalen Parlamente in einer künftigen europäischen Verfassung, ZEuS 2003, 187. Lenaerts, Koen / Gerard, Damien: The structure of the Union according to the Constitution for Europe: the emperor is getting dressed, ELRev 2004, 289. Lenz, Carl Otto: EG Vertrag: Kommentar zu dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften, 2. Auflage 1999, Köln, zitiert als: Bearbeiter, in: Lenz, EG-Vertrag, Kommentar. Lenz, Carl Otto / Borchardt, Klaus-Dieter: Vertrag über eine Verfassung für Europa, Einführung – Text der Verfassung – Protokolle und Erklärungen, 2005, Köln. Leopold, Patricia M.: External Relations Power of EEC in Theory and in Practice, ICLQ 1977, 54. Loman, J. M. E. / Mortelmans, K. J. M. / Post, H. H. G. / Watson, J. S.: Culture and Community Law, 1992, Deventer, Boston. Ludwigs, Markus: Die Kompetenzordnung der Europäischen Union im Vertragsentwurf über eine Verfassung für Europa, ZEuS 2004, 211. Macleod, Ian / Hendry, I. D. / Hyett, Stephen: The External Relations of the European Communities, 1996 Oxford. Mager, Ute: Die Prozeduralisierung des Subsidiaritätsprinzips im Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents – Verbesserter Schutz vor Kompetenzverlagerung auf Gemeinschaftsebene?, ZEuS 2003, 471.
398
Literaturverzeichnis
Martenczuk, Bernd: Die Außenvertretung der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Währungspolitik, ZaöRV 1999, 93. Maunz, Theodor / Dürig, Günter / Herzog, Roman / Scholz, Rupert / Lerche, Peter / Papier, Hans-Jürgen / Randelzhofer, Albrecht / Schmidt-Assmann, Eberhard: Grundgesetz Kommentar Band II, Stand: Lfg. 20, November 1982, zitiert als: Bearbeiter, in: Maunz / Dürig, Grundgesetz Kommentar II. Medina-Ortega, Manuel: A Constitution for an Enlarged Europe (Comment), GJICL 2004, 393. Meessen, Karl Matthias: Das Abkommen von Lomé als gemischter Vertrag, EuropaR 1980, 36. Meyer, Jürgen: „Europa wird ein Staatenbund sein“ – ZRP-Rechtsgespräch mit Professor Dr. Jürgen Meyer, ZRP 2003, 104. Meyer, Jürgen / Hölscheidt, Sven: Die Europäische Verfassung des Europäischen Konvents, EuZW 2003, 613. Müller-Graff, Peter-Christian: Strukturmerkmale des neuen Verfassungsvertrages für Europa im Entwicklungsgang des Primärrechts, Integration 2004, 186. – The Legal Bases of the Third Pillar and its Positions in the Framework of the Union Treaty, CMLR 1994, 493. Münch, Lars: Die gemeinsame Aktion als Mittel der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, 1997, Berlin. Nettesheim, Martin: Die Kompetenzordnung im Vertrag über eine Verfassung für Europa, EuropaR 2004, 511. – Horizontale Kompetenzkonflikte in der EG, EuropaR 1993, 243. Nicolaysen, Gert: Zur Theorie von den implied powers in den EG, EuropaR 1966, 129. Niedobitek, Matthias: Völker- und europarechtliche Grundfragen des EU-Beitrittsvertrages, JZ 2004, 369. Nolte, Jeanette: Die völkerrechtliche Vertragspraxis der EG und die Haftung der Mitgliedstaaten am Beispiel der Fischereipolitik, Kölner Schriften zu Recht und Staat, Band 21, 2004, Frankfurt a. M. Nowoczyn, Oliver: Bildungspolitische Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft nach Maastricht, 1996, Frankfurt a. M. Oppermann, Thomas: in: Hommelhoff, Peter / Kirchhof, Paul, (Hrsg.), Der Staatenverbund der Europäischen Union, 1994, Heidelberg. – Vom Nizza-Vertrag 2001 zum Europäischen Verfassungskonvent 2002 / 2003, DVBl. 2003, 1. – Eine Verfassung für die Europäische Union – Der Entwurf des Europäischen Konvents – 1. Teil, DVBl. 2003, 1165. – Eine Verfassung für die Europäische Union – Der Entwurf des Europäischen Konvents – 2. Teil, DVBl. 2003, 1234.
Literaturverzeichnis
399
Osteneck, Kathrin: Die Umsetzung von UN-Wirtschaftssanktionen durch die Europäische Gemeinschaft, 2004, Heidelberg. Ott, Andreas / Inglis, Kirstyn: Handbook on European Enlargement – A Commentary on the Enlargement Process, 2002, The Hague. Papier, Hans-Jürgen: Festvortrag anlässlich des 65. Deutschen Juristentags in Bonn, 2004, Pressemitteilung Nr. 3 / 2004. Pescatore, Pierre: External Relations in the Case-Law of the Court of Justice of the European Communities, CMLR 1979, 615. Piris, Jean-Claude: After Maastricht, are the Community Institutions More Efficacious, More Democratic and More Transparent?, ELRev 1994, 449. Pitschas, Christian: Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, 2001, Berlin. – Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 5. 11. 2002 – Rs. C-476 / 98 (EG-Kommission / Bundesrepublik Deutschland), EuZW 2003, 92. Reichardt, Hans Wilhelm: Auswärtige Beziehungen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu Drittstaaten und internationalen Organisationen, 1961, Köln. Ress, Georg: Die Europäische Union und die neue juristische Qualität der Beziehungen zu den Europäischen Gemeinschaften, JuS 1992, 985. Riedel, Norbert K.: Der Konvent zur Zukunft Europas – Die Erklärung von Laeken zur Zukunft der Europäischen Union, ZRP 2002, 241. Risse, Thomas: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Außenpolitik? Der Verfassungsvertragsentwurf und die europäische Außen- und Sicherheitspolitik, Integration 2003, 564. Ruffert, Matthias: Schlüsselfragen der Europäischen Verfassung der Zukunft, Grundrechte – Institutionen – Kompetenzen – Ratifizierung, EuropaR 2004, 165. Rupp, Hans Heinrich: Anmerkungen zu einer Europäischen Verfassung, JZ 2003, 18. Sachs, Michael: Grundgesetz Kommentar, 2. Auflage 1999, München, zitiert als: Bearbeiter, in: Sachs, Grundgesetz Kommentar. Sasse, Christoph: Zur auswärtigen Gewalt der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EuropaR 1971, 208. Schachtschneider, Karl Albrecht / Emmerich-Fritsche, Angelika / Beyer, Thomas C. W.: Der Vertrag über die Europäische Union und das Grundgesetz, JZ 1993, 751. Scheffer, Markus: Eine aktuelle Bestandsaufnahme der EU-Osterweiterung unter besonderer Berücksichtigung der Unionsbürgerschaft und ihrer sozialrechtlichen Ansprüche, Studien zum Völker- und Europarecht, Band 3, 2004, Hamburg. Scheuing, Dieter H.: Umweltschutz auf der Grundlage der Einheitlichen Europäischen Akte, EuropaR 1989, 152. Schloh, Bernhard: Die Stellung der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Organe in internationalen Organisationen, in: Kölner Schriften zum Europarecht, Band 25, herausgegeben von Karl Carstens und Bodo Börner, 1974, Limburg. Schmidt-Aßmann, Eberhard: in: Festschrift für Ulrich Everling, Band II, 1995, Baden-Baden.
400
Literaturverzeichnis
Schneider, Henning C.: Wirtschaftssanktionen, Die VN, EG und Bundesrepublik Deutschland als konkurrierende Normgeber beim Erlaß paralleler Wirtschaftssanktionen, 1999, Berlin. Schröder, Meinhard: Vertikale Kompetenzverteilung und Subsidiarität im Konventsentwurf für eine europäische Verfassung, JZ 2004, 8. Schwarz, Kyrill-A.: Die Außenkompetenzen der Gemeinschaft im Spannungsfeld von internationaler Umwelt- und Handelspolitik – zugleich eine Anmerkung zum Gutachten 2 / 00 des EuGH vom 6. 12. 2001, ZEuS 2003, 51. Schwarze, Jürgen (Hrsg.): EU-Kommentar, 2000, Baden-Baden, zitiert als: Bearbeiter, in: Schwarze, EU-Kommentar. – Ein pragmatischer Verfassungsentwurf – Analyse und Bewertung des vom Europäischen Verfassungskonvent vorgelegten Entwurfs eines Vertrags über eine Verfassung für Europa –, EuropaR 2003, 535. Schweitzer, Michael: Europäische Union: Gefahr oder Chance für den Föderalismus in Deutschland, Österreich und der Schweiz?, VVDStRL 53 (1993), 48. – Staatsrecht III, Staatsrecht, Völkerrecht, Europarecht, 7. Auflage 2000, Heidelberg. Seidl-Hohenveldern, Ignaz: Völkerrecht, 8. Auflage 1994. Selmayr, Martin: Das Recht der Wirtschafts- und Währungsunion, Band I, 2004, BadenBaden. Semrau, Stephan: Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, 1998, Frankfurt am Main. Skouris, Vassilios: Festvortrag anlässlich des 65. Deutschen Juristentags in Bonn, 2004, Pressemitteilung Nr. 8 / 2004. Stein, Klaus: Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band I, Grundbegriffe und Grundlagen des Staatsrechts, Strukturprinzipien der Verfassung, 2. Auflage 1984, München. – Der gemischte Vertrag im Recht der Außenbeziehungen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 1986, Berlin. Stein, Torsten: Das Zusammenspiel von Mitgliedstaaten, Rat und Kommission bei der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, EuropaR 1995, Beiheft 2, 69. Stratenschulte, Eckart D.: Wandel durch Annäherung – oder Selbstaufgabe? Die Politik der „neuen Nachbarschaft“ und die Europäische Union, Integration 2004, 95. Streinz, Rudolf: Europarecht, 4. Auflage 1999, Heidelberg. – EUV / EGV – Vertrag über die Europäische Union und Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 2003, München, zitiert als: Bearbeiter, in: Streinz, EUV / EGV Kommentar. Temple Lang, John: The ERTA judgement and the Court’s case-law on competence and conflict, YEL 1986, 183.
Literaturverzeichnis
401
Thym, Daniel: Der Binnenmarkt und die „Freiheit der Lüfte“ – Anmerkungen zum Urteil des Gerichtshofs vom 5. 11. 2002, Rs. C-476 / 98 (Kommission gegen Deutschland) – EuropaR 2003, 277. – Reforming Europe’s Common Foreign and Security Policy, ELJ 2004, 5. Trachtman, Joel P.: Trade and . . . Problems, Cost-Benefit Analysis and Subsidiarity, EJIL 1998, 32. Tridimas, Takis / Eeckhout, Piet: The External Competence of the Community and the CaseLaw of the Court of Justice: Principle versus Pragmatism, YEL (14) 1994, 143. Trüe, Christiane: Das System der EU-Kompetenzen vor und nach dem Entwurf eines Europäischen Verfassungsvertrages, ZaöRV 2004, 391. van Houtte, Ben: The Single European Sky: EU Reform Of Air Traffic Management, CMLRev 2004, 1595. Vedder, Christoph Wilhelm: Die auswärtige Gewalt des Europa der Neun, 1980, Göttingen. Vedder, Christoph / Folz, Hans-Peter: A Survey of Principal Decisions of the European Court of Justice Pertaining to International Law in 1994, EJIL 1996, 112. von Bogdandy, Armin / Bast, Jürgen / Westphal, Dietrich: Die vertikale Kompetenzordnung im Entwurf des Verfassungsvertrags, Integration 2003, 414. von Bogdandy, Armin / Nettesheim, Martin: Die Verschmelzung der Europäischen Gemeinschaften in der Europäischen Union, NJW 1995, 2324. von Buttlar, Christian: The EU’s new relations with NATO shuttling between reliance and autonomy, ZEuS 2003, 399. von der Groeben, Hans / Schwarze, Jürgen, (Hrsg.): Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, Band 1, 6. Auflage, 2003, Baden-Baden, zitiert als: Bearbeiter, in: von der Groeben / Schwarze, EU / EG Kommentar I. – Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, Band 4, 6. Auflage, 2004, Baden-Baden, zitiert als: Bearbeiter, in: von der Groeben / Schwarze, EU / EG Kommentar IV. von der Groeben, Hans / von Boeckh, Hans: Kommentar zum EWG-Vertrag in zwei Bänden – Band II, 1960, Baden-Baden, Bonn, zitiert als: Bearbeiter, in: von der Groeben / von Boeckh, Kommentar zum EWG-Vertrag II (1960). von Horstig, Barbara: Die Europäische Gemeinschaft als Partei internationaler Umweltabkommen, 1997, Bonn. Weber, Albrecht: Zur föderalen Struktur der Europäischen Union im Entwurf des Europäischen Verfassungsvertrags, EuropaR 2004, 841. Weber, Albrecht / Gramlich, Ludwig / Häde, Ulrich / Zehetner, Franz (Hrsg.): Währung und Wirtschaft, Das Geld im Recht, Festschrift für Prof. Dr. Hugo J. Hahn zum 70. Geburtstag, 1997, Baden-Baden. Weber, Stefan: Kapitalverkehr und Kapitalmärkte im Vertrag über die Europäische Union, EuZW 1992, 561. 26 Metz
402
Literaturverzeichnis
Weiß, Wolfgang: Kompetenzverteilung in der Währungspolitik und Außenvertretung des Euro, EuropaR 2002, 165. Werbke, Axel: Staatliche und gemeinschaftliche Kompetenz zum völkerrechtlichen Handeln, NJW 1971, 2103. Wohlfahrt, Ernst / Everling, Ulrich / Glaesner, Hans Joachim / Sprung, Rudolf: Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Kommentar zum Vertrag, 1960, Berlin, Frankfurt, zitiert als: Bearbeiter, in: Wohlfahrt / Everling / Glaesner / Sprung, Kommentar zum EWG-Vertrag (1960). Wuermeling, Joachim: Kalamität Kompetenz: Zur Abgrenzung der Zuständigkeiten in dem Verfassungsentwurf des EU-Konvents, EuropaR 2004, 216. Zacker, Christian / Wernicke, Stephan: Examinatorium Europarecht, Grundlagen, Institutionelles Recht, Materielles Recht, Rechtsschutz, 3. Auflage 2004, Köln, Berlin, Bonn, München. Zilioli, Chiara / Selmayr, Martin: The External Relations of The Euro Area: Legal Aspects, CMLR 1999, 273. Zimmermann, Andreas: Gemeinschaftliche Entwicklungspolitik im Entwurf des Vertrages über eine Verfassung für Europa, RIW 2004, 324. Zuleeg, Manfred: Vorbehaltene Kompetenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiete des Umweltschutzes, NVwZ 1987, 2.
Sachwortregister 3-Säulen-Modell 34 – Aufgabe 196 a priori exclusivity siehe Ausschließliche Kompetenzen 348 A Wider Europe 178 Abkommen von Cotonou 69 Abrüstungsbemühungen siehe ESVP 278 Abschlusskompetenz 151 Achtung der nationalen Identität der Mitgliedstaaten 231 AETR-Prinzip 341, 356, 359 AETR-Urteil 116 AKP-Staaten 70, 300 Allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport 319 Assoziierungsabkommen 67, 296 – Art der Kompetenz 71 – Arten 68 – Begriff 68 – konstitutionelle 72 Asyl siehe Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung 317 Aufgabensplitting zwischen Kommission und Außenminister 378 Ausdrückliche Außenkompetenzen – Bewertung 331 – Historische Entwicklung 58 Ausschließliche Außenkompetenzen, Kodifizierung der EuGH Rechtsprechung 354 Ausschließliche Kompetenzen 220, 348 – allgemeine Voraussetzungen 353 Außenkompetenz – Art der 49 – der EG, Bedeutung 46 – im Bereich der GASP 152 – im Bereich der PJZS 167 Außenkompetenzen aus Teil I der Verfassung 328
Außenminister der Union 246, 250, 326, 385 – Bewertung der Lösung 255 – Initiativrechte 254 – Verhältnis zum EU-Ratspräsidenten 274 Außenpolitik 25 Außenvertretung der Eurozone 312 Auswärtiges Handeln der EU – Allgemeine Grundsätze und Ziele 235 – Strategische Interessen und Ziele 239 Beistandsklausel 284 Beschlussfassungsverfahren 377 Beziehungen der Union zu internationalen Organisationen 98, 323 Beziehungen zu den Vereinten Nationen 100 Bildungs-, Kultur- und Gesundheitspolitik 94 – Art der Kompetenz 96 Bildungspolitik siehe Bildungs-, Kultur- und Gesundheitspolitik 94 Bindungswirkung völkerrechtlicher Übereinkünfte 371 Cross-Pillar-Mixity Abkommen 168, 193, 379 Delegationen der Union 323, 324 Doppelhut-Lösung 251, 390 Dumping 110 ECHO 306 Effektivitätsgrundsatz siehe effet utile 138 effet utile 115, 138 Einschränkung des Kapital- und Zahlungsverkehrs 309 Einstimmigkeitserfordernis 227, 242, 260, 279, 319, 378, 382, 383, 386, 388 – Bewertung 265 Embargofälle 105
404
Sachwortregister
EMRK 101, 134, 374, 378, 387 – Beitrittspflicht 328 EMRK-Gutachten 134 Energie 322 Entwicklungszusammenarbeit 75, 297 – Art der Kompetenz 77 – Kompetenzgrundlage 78 – und AETR-Rechtsprechung 79 Entwurf eines Vertrages über eine Verfassung für Europa 189 EPZ 153 Erforderlichkeitsprüfung 336 Erhaltung der biologischen Meeresschätze 352 Erklärung von Laeken 186 ESVP 277 – Beistandsklausel 284 – Beschlussfassungsverfahren 281 – Bewertung 287 – Ständige Strukturierte Zusammenarbeit 282 ESZB 313 EuGH – Fortgeltung der bisherigen Rechtsprechung 206 – Rechtsprechungsgewalt 201, 388 Europäische Beschlüsse 259 Europäische Verfassung 190 Europäische Verteidigungsagentur 281 Europäischer Auswärtiger Dienst 325, 386 Europäischer Entwicklungsfonds 300 Europäischer Rat 234, 240, 267 Europäisches Parlament 227, 234, 253, 268, 294, 327, 373 Europarat 324 – Zusammenarbeit mit dem 101 exclusivity question 367 existence question 367 EZB 310, 313 Flexibilitätsklausel 226, 342 Fusion siehe Verschmelzung der EU-Verträge 193 GASP 152, 229, 241, 388 – Aktionsmöglichkeiten 157 – Art. 24 EU 160 – Beschlussfassungsverfahren 258
– Bewertung 276 – bisherige Aktionen 165 – Einstimmigkeitsprinzip 260 – Europäischer Rat 267 – Europäisches Parlament 268 – Finanzierung 271 – neue Art von Initiativen 264 – parallele Zuständigkeit 364 – Reichweite der Außenkompetenzen 156 – Verstärkte Zusammenarbeit 275 – Vertragsschlusskompetenz 246 GASP-Abkommen 363, 376 GATS 126, 289 – implizite Kompetenzen 128 GATT 126 Gemeinsame Aktionen 158 Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik siehe GASP 152 Gemeinsame Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik siehe ESVP 277 Gemeinsame Handelspolitik 61, 288, 353, 386 – Beschlussfassungsverfahren 293 – Bewertung 295 Gemeinsame Handelspolitik siehe auch Handelsabkommen 288 Gemeinsame Initiative 240 Gemeinsame Standpunkte 159 Gemeinsame Strategien 158 Gemischte Abkommen 145, 181, 373 Generelle Vertragsschließungskompetenz 332 – Bewertung 347 Geschriebene Außenkompetenzen 241 Gesundheitspolitik siehe Bildungs-, Kulturund Gesundheitspolitik 94 Geteilte Zuständigkeit 224 Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung 316 Grund- oder Leitprinzipien im Bereich der Außenkompetenzen 389 Grundprinzipien der neuen Kompetenzordnung 211 Grundsätze und allgemeine Leitlinien 158 Gutachten 1 / 76 siehe StilllegungsfondsGutachten 121 Gutachten 1 / 94 siehe WTO-Gutachten 125 Gutachten 2 / 91 siehe ILO-Gutachten 123
Sachwortregister Gutachten 2 / 92 siehe OECD-Gutachten 132 Gutachten 2 / 94 siehe EMRK-Gutachten 134 Gutachtenverfahren 383 Handelsabkommen 61, 375 – Abgrenzung 61 – ausschließliche Kompetenz 66 – Beispiele 65 – Umfang 62 – Verfahren 381 Handelsabkommen siehe auch Gemeinsame Handelspolitik 288 Handelsembargo 169 Handelspolitische Schutzmaßnahmen 110 Humanitäre Hilfe 305 ILO-Gutachten 123 Implied-Powers-Lehre 114, 118, 119, 340, 343, 368, 387 Implizite Außenkompetenzen – der EG 112 – Zusammenfassung 142 Implizite Außenkompetenzen siehe Ungeschriebene Außenkompetenzen 332 Innerstaatliche Rechtsfähigkeit, der EU 42 Intergouvernementalität 155 Internationale Zusammenarbeit 317 Kampf gegen den Terrorismus siehe ESVP 280, 309 Kapital- und Zahlungsverkehr 102 Katastrophenschutz 320 Kohärenz 233, 237, 252, 320, 389 Kompetenz-Kompetenz 35, 212, 355 Kompetenzkonflikte 25 – zwischen EU und EG 168 Kompetenzordnung 183, 209, 387 – Herzstück 219 – Kategorisierung 218 Komplementaritätsprinzip 122, 124, 129 Konstitutionalisierung 182 Konstitutionelle Assoziierungsabkommen 72, 296 Konstruktive Enthaltung 170, 199, 260, 266 Konsultationspflichten 271 Konvent siehe Verfassungskonvent 186
405
Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik 230 Kramer-Urteil 119, 352 Krisenverhütung und -bewältigung siehe ESVP 278 Kulturpolitik siehe Bildungs-, Kultur- und Gesundheitspolitik 94, 319 Loyalitätsprinzip 345, 362, 364, 366 Luxemburger Kompromiss 199, 263 Ministerrat 372, 382 Nachbarschaftspolitik 329 Nationale Parlamente 270 NATO 278, 284 OECD 324 – Zusammenarbeit mit der 102 OECD-Gutachten 132 Öffentliche Gesundheit 317 Open-Skies-Urteil 136, 354, 360 – Bewertung 140 Opting Out 170 Osterweiterung 173 OSZE 324 Parallele Zuständigkeit 315, 362 Parallelitätsprinzip 54 Passerelle-Klausel 262, 275, 279, 294, 389 Petersberg-Aufgaben 154, 157, 280 PJZS 316 Politisches und Sicherheitspolitisches Komitee 270 Präsident des Europäischen Rates 390 Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung 113, 211, 345, 387 Protokoll von Cartagena siehe Umweltpolitik 88 Qualifizierte Mehrheit, nach der Osterweiterung 175 Rat Auswärtige Angelegenheiten 235 Ratifikationsprozess 391 Ratifizierung 190 Rechtsnachfolge 206 Rechtspersönlichkeit, interne 207
406
Sachwortregister
Repressalien 108 Restriktive Maßnahmen 307 Retorsionen 108 Sanktionen siehe Wirtschaftssanktionen 102, 307 Schluss von der Innen- auf die Außenkompetenz 122 Solidaritätsklausel 286 Sperrwirkung des Handelns der Union 361 Staatenverbund 34 Ständige Strukturierte Zusammenarbeit 282 Stilllegungsfonds-Gutachten 121, 342, 358 Subsidiaritätsprinzip 212, 339, 387 Tourismus 322 Transeuropäische Netze 97, 321 travaux préparatoires 344 TRIPS 127, 289 – implizite Kompetenzen 130 Troika 249, 254, 324 Umweltabkommen 314 Umweltpolitik 86 – Abgrenzung zu den Handelskompetenzen 88 – Art der Kompetenz 90 – Protokoll von Cartagena 88 UN siehe Vereinte Nationen 100 Ungeschriebene Außenkompetenzen 332, 387 Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen 221, 363 Vereinte Nationen 324 – Beziehungen zu 100 Verfahren zum Abschluss völkerrechtlicher Abkommen 147, 372 Verfassungskonvent – Ergebnis 189 – Geschichte 184 – Konsens 188 – Zusammensetzung 186 Verfassungsvertrag siehe Europäische Verfassung 190 Verhältnismäßigkeitsprinzip 218, 387 Verhandlungskompetenz 150 Verkehr 321
Verschmelzung der EU-Verträge 193, 195 Verstärkte Zusammenarbeit 275 Vertrag von Athen 173 Vertragsschlusskompetenz – der EAG 54 – der EGKS 51 Völkerrechtsfähigkeit – allgemein 29 – aufgrund der implied powers Lehre 32 – der EU 33 – einer Internationalen Organisation 30 – unionsexterne 37 – unionsinterne 36 Völkerrechtspersönlichkeit 384 – der EAG und der EG 44 – der EGKS 44 – der Europäischen Gemeinschaften 42 – nach dem Verfassungsvertrag 192 Völkerrechtssubjektivität siehe Völkerrechtsfähigkeit 30 Vollmitgliedschaft 323 Währungsabkommen, Verfahren 379 Währungspolitik 73, 310, 351 – völkerrechtliche Übereinkünfte 313 Westeuropäische Union 167 Wettbewerbsregeln für den Binnenmarkt 350 WEU 278, 285 Wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten 302 Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) siehe Währungspolitik 73 Wirtschaftssanktionen 102, 169 – aufgrund von GASP-Beschlüssen 107 – Verhältnis zu anderen Außenkompetenzen der EG 109 WTO-Gutachten 125 – Zusammenfassung 131 WWU siehe Währungspolitik 312 Ziel-Mittel-Schluss 117, 341-342, 347, 368, 387 Zollunion 350 Zusammenarbeit – mit dem Europarat 101 – mit der OECD 102 – mit Internationalen Organisationen 324
Sachwortregister Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschung 81 – Art der Kompetenz 85 – Rechtsformen 83, 315 Zusammenarbeit mit Drittländern und humanitäre Hilfe 297
407
Zusammenarbeit mit Drittstaaten, wirtschaftliche, finanzielle und technische 80 Zusammenfassung und Ergebnis 384 Zuständigkeit kraft Sachzusammenhangs siehe Implied-Powers-Lehre 114 Zustimmungspflicht 374
![Der Konventsentwurf für einen Vertrag über eine Verfassung für Europa: Eine britische Sicht [1 ed.]
9783428523917, 9783428123919](https://dokumen.pub/img/200x200/der-konventsentwurf-fr-einen-vertrag-ber-eine-verfassung-fr-europa-eine-britische-sicht-1nbsped-9783428523917-9783428123919.jpg)


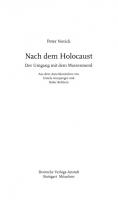
![Demokratie in der Europäischen Union: Eine Untersuchung der demokratischen Legitimation des europäischen Integrationsprozesses vom Vertrag von Amsterdam bis zum Entwurf einer Europäischen Verfassung [1 ed.]
9783428517176, 9783428117178](https://dokumen.pub/img/200x200/demokratie-in-der-europischen-union-eine-untersuchung-der-demokratischen-legitimation-des-europischen-integrationsprozesses-vom-vertrag-von-amsterdam-bis-zum-entwurf-einer-europischen-verfassung-1nbsped-9783428517176-9783428117178.jpg)
![Die Hamburgische Bürgerschaft: Eine Untersuchung ihrer verfassungsrechtlichen Stellung nach der Verfassung von 1952 [1 ed.]
9783428478460, 9783428078462](https://dokumen.pub/img/200x200/die-hamburgische-brgerschaft-eine-untersuchung-ihrer-verfassungsrechtlichen-stellung-nach-der-verfassung-von-1952-1nbsped-9783428478460-9783428078462.jpg)

![Die Nutzenbewertung von Arzneimitteln nach dem AMG und dem SGB V: Eine Untersuchung zur Erzeugung administrativer Wissensgrundlagen und ihrer gerichtlichen Kontrolle [1 ed.]
9783428552207, 9783428152209](https://dokumen.pub/img/200x200/die-nutzenbewertung-von-arzneimitteln-nach-dem-amg-und-dem-sgb-v-eine-untersuchung-zur-erzeugung-administrativer-wissensgrundlagen-und-ihrer-gerichtlichen-kontrolle-1nbsped-9783428552207-9783428152209.jpg)
![Zeitwertbilanzierung in Jahresabschlüssen nach dem ADHGB von 1861 und nach den IAS/IFRS: Eine empirische Analyse aus Kapitalgebersicht [1 ed.]
9783896449412, 9783896732446](https://dokumen.pub/img/200x200/zeitwertbilanzierung-in-jahresabschlssen-nach-dem-adhgb-von-1861-und-nach-den-ias-ifrs-eine-empirische-analyse-aus-kapitalgebersicht-1nbsped-9783896449412-9783896732446.jpg)

![Die Außenbeziehungen der Europäischen Union nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa: Eine Untersuchung aus kompetenzrechtlicher Sicht - mit Erläuterungen zu den Außenkompetenzen nach dem Vertrag von Nizza [1 ed.]
9783428522408, 9783428122400](https://dokumen.pub/img/200x200/die-auenbeziehungen-der-europischen-union-nach-dem-vertrag-ber-eine-verfassung-fr-europa-eine-untersuchung-aus-kompetenzrechtlicher-sicht-mit-erluterungen-zu-den-auenkompetenzen-nach-dem-vertrag-von-nizza-1nbsped-9783428522408-9783428122400.jpg)