Der Vertrag in der Lehre Otto Mayers [1 ed.] 9783428512348, 9783428112340
Obgleich in der deutschen Rechtswissenschaft letztmals zu Anfang des 20. Jahrhunderts die Auffassung vertreten wurde, de
135 57 753KB
German Pages 146 Year 2004
Polecaj historie
Citation preview
Schriften zur Rechtsgeschichte Heft 107
Der Vertrag in der Lehre Otto Mayers Von
Ralf Michael Dewitz
asdfghjk Duncker & Humblot · Berlin
RALF MICHAEL DEWITZ
Der Vertrag in der Lehre Otto Mayers
Schriften zur Rechtsgeschichte Heft 107
Der Vertrag in der Lehre Otto Mayers Von
Ralf Michael Dewitz
asdfghjk Duncker & Humblot · Berlin
Die Juristische Fakultät der Freien Universität Berlin hat diese Arbeit im Jahre 2003 als Dissertation angenommen.
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten # 2004 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: Klaus-Dieter Voigt, Berlin Druck: WB-Druck GmbH & Co., Rieden im Allgäu Printed in Germany ISSN 0720-7379 ISBN 3-428-11234-2 Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier ∞ entsprechend ISO 9706 *
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Vorwort Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2002/03 von der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Freien Universität Berlin als Dissertation angenommen. Mein Lehrer, Herr Professor Dr. Walter Krebs, hat die Arbeit betreut. Für seine vielfältige Unterstützung und Förderung danke ich ihm sehr. Herrn Professor Dr. Philip Kunig danke ich für die schnelle Erstattung des Zweitgutachtens. Besonderen Dank sage ich auch Frau Professor Dr. Barbara Remmert, die mir durch ihre stete Diskussionsbereitschaft sehr geholfen hat. Berlin, im September 2003
Ralf Dewitz
Inhaltsverzeichnis Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Kapitel
Die Regelungsmöglichkeiten des Staates durch Vertrag
16
A. Die Regelungsmöglichkeit des Staates durch öffentlich-rechtlichen Vertrag . 16 I. Der öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen Staat und „Untertan“ . . . . . . . 16 II. Der öffentlich-rechtliche Vertrag zur Regelung von Verhältnissen, in denen die „öffentliche Gewalt zwischen Gleichwertigen“ erscheint . . . . . 23 B. Der privatrechtliche Vertrag zwischen dem Staat und dem Bürger . . . . . . . . . 25 C. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2. Kapitel
Die Grundlagen der Vertragsdogmatik Otto Mayers
30
A. Das Verwaltungsrecht als eigentümliche Rechtsdisziplin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 B. Die Gründe der Forderung nach einem eigentümlichen Verwaltungsrecht . . I. „Polizeistaat“ und „Rechtsstaat“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. „Rechtsstaat“ und „moderne Staatsidee“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Das Vorbild anderer rechtswissenschaftlicher Disziplinen . . . . . . . . . . . . IV. Das Vorbild der Verwaltungsrechtswissenschaft in Frankreich. . . . . . . . .
. . . . .
33 34 39 42 44
C. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3. Kapitel
Die „moderne Staatsidee“ Otto Mayers
48
A. Die Grundlagen des Staates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 B. Die „Undenkbarkeit“ eines Bundesstaates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 C. Der „juristische“ Begriff vom Staate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Der Staat als juristische Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Das Volk als der Staat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Der Staat als Anstalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
55 55 57 58
8
Inhaltsverzeichnis
D. Der Zweck des Staates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 E. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 4. Kapitel
Das Methodenverständnis Otto Mayers A. Die „juristische“ Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Die Erkenntnis aus dem System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Der Begriff des Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Die Produktivität der Rechtswissenschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Das Recht als System apriorischer Begriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Der Sinn und Zweck eines Systems apriorischer Begriffe . . . . . . . . . . . . VI. Die Grundlagen eines Systems apriorischer Begriffe. . . . . . . . . . . . . . . . .
65 . . . . . . .
66 66 69 74 77 78 84
B. Die „juristische“ Methode Otto Mayers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 I. Die Gemeinsamkeiten mit der „juristischen“ Methode . . . . . . . . . . . . . . . . 89 II. Die Eigenart der Methode Otto Mayers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 C. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 5. Kapitel
Das Verhältnis des Staats- zum Methodenverständnis
104
A. Der Einfluß des Methodenverständnisses auf die Begriffe vom Staat und Vertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 B. Staats- und Methodenbegriff als einander bedingende Begriffe . . . . . . . . . . . . 106 C. Ergebnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 6. Kapitel
Die Bedeutung der Vertragsdogmatik Otto Mayers für die Gegenwart
113
A. Einwände gegen den Vertragsbegriff Otto Mayers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 B. Einwände gegen Otto Mayers Definition des öffentlichen Rechts . . . . . . . . . . 115 C. Die Anerkennung des öffentlich-rechtlichen Vertrages durch den Gesetzgeber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 D. Einwände gegen die von Otto Mayer postulierte Omnipotenz des Staates . . . 120 Zusammenfassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Sachwort- und Namenregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Abkürzungsverzeichnis a. A. a. a. O. ABR Allg. AöR Aufl. Bd. BlAdmPraxis BVerfG BVerfGE BVerwG BVerwGE dens. ders. DJT DJZ DLitZ DÖD DÖV DVBl. DZKirchenR ebd. f. ff. FG Fn. FS FZPraxisGesVerw HdBFinanzWiss HbStR HistVjS HRG Hrsg. hrsgg. i.V. m.
anderer Ansicht am angegebenen Ort Archiv für Bürgerliches Recht Allgemeiner Archiv des öffentlichen Rechts Auflage Band Blätter für administrative Praxis Bundesverfassungsgericht Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Bundesverwaltungsgericht Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts denselben derselbe Deutscher Juristentag Deutsche Juristenzeitung Deutsche Litteraturzeitung Der öffentliche Dienst Die öffentliche Verwaltung Deutsches Verwaltungsblatt Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht ebenda folgende fortfolgende Festgabe Fußnote Festschrift Fischers Zeitschrift für Praxis und Gesetzgebung der Verwaltung Handbuch der Finanzwissenschaft Handbuch des Staatsrechts Historische Vierteljahresschrift Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte Herausgeber herausgegeben in Verbindung mit
10 JLitBl. JW JZ m. w. N. Niemeyers Zeitschrift NJW NVwZ ÖstZÖffentR PreußVBl. PrOVG Quaderni Fiorentini Rez. RGSt RGZ RHistJ Rn. S. SächsArchR Schmollers Jahrbuch SchweizJZ scil. StR Verf. VerwArch vgl. VVDStRL z. B. ZFranzCivilR ZgesHandelsR ZgesStaatsWiss ZSavignyStR
Abkürzungsverzeichnis Juristisches Literaturblatt Juristische Wochenschrift Juristenzeitung mit weiteren Nachweisen Niemeyers Zeitschrift für Internationales Recht Neue Juristische Wochenschrift Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht Preußisches Verwaltungs-Blatt Preußisches Oberverwaltungsgericht Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno Rezension Reichsgericht Strafsachen Reichsgericht Zivilsachen Rechtshistorisches Journal Randnummer Seite Sächsisches Archiv für Rechtspflege Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft Schweizerische Juristenzeitung scilicet Staatsrecht Verfassung Verwaltungsarchiv vergleiche Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer zum Beispiel Zeitschrift für Französisches Civilrecht Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte
Einleitung Das vertragliche Handeln der Verwaltung auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts wurde bis zum Beginn der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts von rechtsdogmaticher Skepsis begleitet.1 Nicht nur wurde unter Hinweis auf eine fehlende Vereinbarkeit mit den Grundsätzen vom Vorrang2 und Vorbehalt3 des Gesetzes die Zulässigkeit des verwaltungsrechtlichen Vertrages4 in Frage gestellt.5 Schon bestritten wurde auch, daß ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, den die Verwaltung mit dem einzelnen schließt, seinem Begriff nach überhaupt möglich ist.6 Daß eine positive Antwort auf die Frage, ob ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Verwaltung und dem Bürger begrifflich möglich ist, noch immer als einer näheren Begründung bedürftig angesehen wird,7 obwohl die in Deutschland8 erschienenen Werke, welche dem öffentlich-recht1 Vgl. Spannowsky, Verträge und Absprachen, S. 26, m. w. N. in Fn. 20. Zur Geschichte des öffentlich-rechtlichen Vertrages vgl.: Pakeerut, Vertrag, S. 19 ff.; Stern, VerwArch 49 (1958), S. 106 (109 ff.); Bullinger, Vertrag, S. 168 ff.; Maurer, DVBl. 104 (1989), S. 798 (799 ff.). 2 So Bullinger, Vertrag, S. 17 f., 254 f.; Burmeister, VVDStRL 52 (1993), S. 190 (226 f.). In diese Richtung auch, mit Blick auf das Gleicheitsgebot: Grimm, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 52 (1993), S. 324 (325 f.). 3 Vgl. dazu statt aller für die fernere Vergangenheit beginnend im ausgehenden 19. Jahrhundert: Pakeerut, Vertrag, S. 40 ff., 51 f.; zur jüngeren Vergangenheit und Gegenwart vgl. Erichsen, in: ders./Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht12, § 26 Rn. 10 ff.; Krebs, in: Schmidt-Aßmann/Krebs, Verträge, S. 177 ff. 4 Vgl. zur Terminologie: Schlette, Vertragspartner, S. 18 ff. 5 Daß mit dem Begriff der „Zulässigkeit“ lediglich die Vereinbarkeit des Vertrages mit höherrangigem Recht angesprochen ist, vertritt zu Recht etwa Bullinger [Vertrag, S. 31, 40.]. 6 Gerber, Ueber öffentliche Rechte (1852), S. 32 f.; Haenel, Studien zum Deutschen Staatsrechte (1873), S. 31 f. i.V.m. S. 33; O. Mayer, Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 292; ders., Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (42); ders., Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 137 Fn. 3; ders., Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 262; ders., Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 148 f.; ders., Staatsrecht (1909), S. 40, 234 f.; G. Meyer, Verwaltungsrecht I2 (1893), S. 34; Zorn, Staatsrecht I2 (1895), S. 399; Bornhak, Preußisches Staatsrecht II2 (1912), S. 17, 19, 30; ders., Verwaltungsrecht5 (1916), S. 33 f.; Kormann, System (1910), S. 29 f., 36 f.; Meyer/Anschütz, Staatsrecht7 (1919), S. 577. 7 Vgl. für das Jahr 1958 die Schriften von Salzwedel [Vertrag, S. 40 ff.] und Imboden [Vertrag, S. 41 ff.], für das Jahr 1966 die Entscheidung des BVerwG vom 4. Februar 1966 [BVerwGE 23, S. 213 (215 f.).], für das Jahr 1973 das Lehrbuch
12
Einleitung
lichen Vertrag die begriffliche Existenzberechtigung absprechen, ausnahmslos in die Zeit der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert datieren,9 ist maßgeblich darauf zurückzuführen, daß es auch, oder besser, vor allem10 Otto Mayer (1846–1924) war,11 der den Standpunkt vertrat, daß „wahre Verträge des Staates auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts überhaupt nicht denkbar“ sind.12 Denn dem Werk,13 wie auch der Person14 Otto Mayers wurde von Forsthoff [Verwaltungsrecht I10, S. 275 f.], und für das Jahr 2000 die Habilitationsschrift von Schlette [Vertragspartner, S. 34 ff.]. 8 In Österreich wurde die begriffliche Möglichkeit eines Verwaltungsvertrages noch 1954 [etwa von: Adamovich, Verwaltungsrecht I5, S. 81 f., 82; Antoniolli, Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 200 f.], in der Schweiz noch 1960 [von: Giacometti, Verwaltungsrecht, S. 442 f., 448.] bestritten. 9 Vgl. Fn. 6. Die Ansicht von Gurlit [Verwaltungsvertrag, S. 75.], daß die Lehre jener Werke in Burmeister ihren „Nachfolger“ gefunden habe, geht wohl zu weit. Denn Burmeister erachtet den Verwaltungsvertrag nicht als in jeder Hinsicht begrifflich undenkbar [Vgl. dens., VVDStRL 52 (1993), S. 190 (227 f., 229 f.).]. Zudem sind seine Grundgedanken andere. Er versucht, das „klassische Legalitätsprinzip [. . .] zu retten“, Grimm, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 52 (1993), S. 324 (324 f.). Auch Bullinger [Vertrag, S. 18 f.], Pieper [DVBl. 82 (1967), S. 11 (18 f.).], Schmidt-Salzer [VerwArch 62 (1971), S. 135 (145 f.).] und Püttner [DVBl. 97 (1982), S. 122 (125 f.).] hegen zwar Vorbehalte unterschiedlicher Art gegen den verwaltungsrechtlichen Vertrag, erachten ihn jedoch nicht als in jeder Hinsicht begrifflich undenkbar. 10 Vgl. Fn. 6. 11 Zumindest ähnlich sind die Einschätzungen von Apelt [AöR 84 (1959), S. 249 (251 f.).], Salzwedel [Vertrag, S. 4.], Stern [VerwArch 49 (1958), S. 106 (109 f.).], Henke [JZ 39 (1984), S. 441 (441).], Maurer [Allgemeines Verwaltungsrecht14, § 14 Rn. 21.], Krebs [in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen, S. 41 (46).], Gurlit [Verwaltungsvertrag, S. 73 f.; Jura 23 (2001), S. 659 (659).], und Schlette [Vertragspartner, S. 30.]. Zur „paradigmatischen“ Bedeutung der Verwaltungslehre Otto Mayers allgemein: Schmidt-De Caluwe, Verwaltungsakt, S. 21 m. w. N. 12 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (42). Vgl. auch: Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 292; Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 137 Fn. 3; Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 262; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 148 f.; Staatsrecht (1909), S. 40, 234 f. 13 Vgl. G. Meyer, Rez. Mayer, DLitZ 29 (1896), S. 918 (922): „Es wird künftighin Niemand über deutsches Verwaltungsrecht schreiben können, ohne von dem Vf. gelernt zu haben.“; G. Jellinek, Rez. Mayer, VerwArch 5 (1897), S. 304 (304): „Die zwei Bände des Verwaltungsrechts von Otto Mayer [. . .] gehören zu den bedeutsamsten und eigenartigsten Erscheinungen der neueren publizistischen Literatur.“; Seydel, Rez. Mayer, BlAdmPraxis 48 (1898), S. 143 (143): „Das deutsche Verwaltungsrecht von Otto Mayer ist die bedeutendste Erscheinung, welche die Literatur dieses Rechtsgebietes in den letzten Jahrzehnten aufzuweisen hat.“; Goldschmidt, Rez. Mayer, VerwArch 11 (1903), S. 340 (344): „[. . .] Meister des deutschen Verwaltungsrechts [. . .].“; Schelcher, Rez. Mayer, FZPraxisGesVerw 29 (1905), S. 346 (346): „[. . .] des epochemachenden ,Deutschen Verwaltungsrechts‘ von Otto Mayer [. . .].“; ders., Rez. Mayer, FZPraxisGesVerw 44 (1915), S. 247 (248): „Die hervorragende Größe und Einzigartigkeit des Werkes Otto Mayers [. . .].“; Piloty, Rez. Mayer, JLitBl. 22 (1910), S. 46 (46): „Einer Schrift Otto Mayers entgegentreten zu müssen,
Einleitung
13
bereits zu Lebzeiten die größte Hochachtung entgegengebracht. Schon damals durfte „an Otto Mayer [. . .], wer sich seitdem irgendwie wissenschaftlich mit dem deutschen Verwaltungsrechte beschäftigte, nicht mehr vorübergehen, sondern mußte zu seinen Ansichten Stellung nehmen, zustimmend, oder, wenn er sich ablehnend verhalten wollte, mit eingehender Begründung.“15 Nicht minder galt dies nach seinem Tode,16 zumal die veröffentlichten Nachrufe die Verdienste, die sich Otto Mayer um die Verwaltungsrechtswissenschaft erworben hatte, weiter hervorhoben,17 indem sie ihn als den Begründer der modernen deutschen Verwaltungsrechtswissenschaft bezeichneten,18 als der er bis heute verehrt wird.19
fällt demjenigen besonders schwer, der in Otto Mayer den hervorragendsten Förderer der deutschen Verwaltungslehre erblickt.“; Laun, Rez. Mayer, ÖstZÖffentR 3 (1918), S. 588 (588): „Otto Mayers ,Deutsches Verwaltungsrecht‘ ist ein Werk von solcher Bedeutung, daß es nicht als Aufgabe dieser Zeilen betrachtet werden kann, es in seiner Totalität zu würdigen.“; Krazeisen, Rez. Mayer, BlAdmPraxis 68 (1918), S. 62 (62): „[. . .] dieses für die Entwicklung der wissenschaftlichen Behandlung des deutschen Verwaltungsrechts bedeutsamsten Meisterwerkes [. . .].“; Meier, Rez. Mayer, SächsArchR 13 (1918), S. 54 (54): „Ein allseitig so geschätztes und als hervorragend anerkanntes Werk wie Otto Mayers Verwaltungsrecht bedarf keiner besonderen Empfehlung.“; Bühler, Rez. Mayer, VerwArch 27 (1919), S. 283 (284): „[. . .] des führenden wissenschaftlichen Werkes, von Otto Mayers Deutschem Verwaltungsrecht [. . .].“; Triepel, Rez. Mayer, DJZ 30 (1925), S. 125 (125): „Ueber die Bedeutung des Buches und seine außerordentliche Wirkung auf Literatur und Praxis ist heute kein Wort mehr zu verlieren.“ Besonders nachdrücklich lobt auch Laband [DJZ 21 (1916), S. 315.] das Werk Otto Mayers. 14 Vgl. W. Jellinek, Verwaltungsrecht 3 (1931), S. 106: „Wer Otto Mayer persönlich kannte, dem wird die Erinnerung an den immer gutgelaunten, witzigen, sprühenden, dabei innerlich wahrhaft frommen Mann unvergeßlich sein. Wenn das Leipziger Dozentenzimmer von fröhlichem Lachen widerhallte, konnte man sicher sein, daß Otto Mayer gerade eine seiner Schnurren zum besten gegeben hatte. Als Lehrer stellte er hohe Anforderungen an das Auffassungsvermögen, war aber bei den klügeren Studenten sehr beliebt.“ 15 Schultzenstein, JW 44 (1915), S. 734 (735). 16 Die aus dem Jahre 1958 stammenden Schriften von Salzwedel [Vertrag, S. 4.] und Imboden [Vertrag, S. 9 ff.], aber auch die Entscheidung des BVerwG vom 4. Februar 1966 [BVerwGE 23, S. 213 (215 f.).] zitieren fast ausschließlich Otto Mayer. 17 Vgl. nur: E. Kaufmann, Otto Mayer, VerwArch 30 (1925), S. 377 ff.; Fleiner, Otto Mayer, SchweizJZ 21 (1924/25), S. 77 ff. 18 Abraham, Otto Mayer, Das Recht 28 (1924), S. 329; Fleiner, Otto Mayer, SchweizJZ 21 (1924/25), S. 77 (77). 19 Apelt, AöR 84 (1959), S. 249 (251); Forsthoff, Verwaltungsrecht I10, S. 51; Spannowsky, Verträge und Absprachen, S. 25. Vgl. auch: Püttner, DVBl. 97 (1982), S. 122 (126): „Wer den oben dargestellten Befund unvoreingenommen betrachtet, wird jedenfalls von der zeitweise üblichen euphorischen Betrachtung des öffentlichrechtlichen Vertrages Abschied nehmen wollen und statt dessen Neigung verspüren, einen Kranz niederzulegen am Grabe Otto Mayers.“
14
Einleitung
Ungeachtet der Tatsache jedoch, daß die Vertragsdogmatik Otto Mayers bis heute Bezugspunkt der wissenschaftlichen Auseinandersetzung über den Verwaltungsvertrag ist, existiert bislang keine Abhandlung, die diese Dogmatik zum Gegenstand einer eingehenden Untersuchung erhebt.20 Das rechtfertigt, warum die vorliegende Arbeit den Gedankengang, den Otto Mayer wider die Möglichkeit eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen Staat und Bürger richtete, bis hin zu dessen Ausgangspunkt verfolgt und detailliert nachzeichnet. Da die Rechtswissenschaft erst jüngst aus der Annahme, daß Otto Mayer mit seinem ablehnenden Verdikt über den öffentlich-rechtlichen Vertrag im Staat-Bürger-Verhältnis auch heute noch „irgendwie“ Recht habe, eine Idee hergeleitet hat, anhand derer sich die bislang zur Dogmatik des Verwaltungsvertrages angesammelten Erkenntnisse zu einem System formen lassen könnten,21 wird sodann der Frage nachgegangen, ob Otto Mayer tatsächlich auch heute noch „irgendwie“ Recht hat, oder ob nicht die Vertragsdogmatik Otto Mayers durch die „moderne Verwaltungsrechtswissenschaft [. . .] eindeutig widerlegt worden“ ist.22 Verwendung findet in der vorliegenden Arbeit nahezu ausschließlich Primärliteratur. Grund dafür ist der Umstand, daß, wenngleich Leben und Werk Otto Mayers bereits Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung waren, diejenigen Aussagen Otto Mayers, die für das tiefere Verständnis von dessen Vertragsdogmatik unerläßlich sind, keinesfalls erschöpfend analysiert wurden.23 Um dem Leser eine eigene Entscheidung darüber zu eröff20 Eher nur beiläufig erwähnt wird die Lehre Otto Mayers etwa von: Achterberg, JA 11 (1979), S. 357 (357 f.); Apelt, AöR 84 (1959), S. 249 (251 f.); Bauer, Die Verwaltung 25 (1992), S. 301 (303); Bonk, NVwZ 20 (2001), S. 636 (638); Brohm, in: Bauer/Breuer/Degenhart/Oldiges (Hrsg.), 100 Jahre Allgemeines Baugesetz Sachsen, S. 457 (459); Büchner, Bestandskraft, S. 1; Butterwegge, Verwaltungsvertrag, S. 56; Efstratiou, Bestandskraft, S. 109 f.; Gurlit, Jura 23 (2001), S. 659 (659); dies., Verwaltungsvertrag, S. 73 f.; Imboden, Vertrag, S. 9 ff.; Kawalla, Verwaltungsvertrag, S. 1 f.; Rottmann, in: Bauer/Breuer/Degenhart/Oldiges (Hrsg.), 100 Jahre Allgemeines Baugesetz Sachsen, S. 487 (488); Salzwedel, Vertrag, S. 4; Schimpf, Vertrag, S. 16; Schmitz, NVwZ 19 (2000), S. 1238 (1240); Spannowsky, Verträge und Absprachen, S. 25. Eine ausführlichere, aber keineswegs erschöpfende Darstellung der Lehre Otto Mayers geben etwa: Krebs, in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen, S. 41 (44 ff.); Pakeerut, Vertrag, S. 27 ff.; Stern, VerwArch 49 (1958), S. 106 (109 ff.); Bullinger, Vertrag, S. 241 ff. 21 Krebs, in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen, S. 41 ff. 22 So das BVerwG [BVerwGE 23, S. 213 (215 f.).]. Vgl. auch: Schimpf, Vertrag, S. 17. 23 Vgl. die Darstellung der Vertragsdogmatik Otto Mayers durch die in Fn. 20 erwähnten Autoren. Vgl. die Kurzdarstellungen von Leben und Werk Otto Mayers von: Fleiner, Otto Mayer, SchweizJZ 21 (1924/25), S. 77 ff.; Abraham, Otto Mayer, Das Recht 28 (1924), S. 329; Jönsson/Wolfes, in: Bautz (Hrsg.), BiographischBibliographisches Kirchenlexikon, Sp. 991 ff.; Eyrich, in: Staatslexikon der Görres Gesellschaft, Sp. 629 f.; Kleinheyer/Schröder, Deutsche Juristen3, S. 178 ff.; Pauly,
Einleitung
15
nen, inwieweit er mit der durch die vorliegende Arbeit gegebenen Interpretation der Aussagen Otto Mayers übereinstimmen will, sowie zu dem Zweck, dem Leser die viel gerühmte Sprache Otto Mayers24 vor Augen zu führen, werden die meisten Quellen in ihrem Wortlaut wiedergegeben.
in: Stolleis (Hrsg.), Juristen, S. 418 f. Vgl. die Darstellung der Konzeption von Otto Mayers Deutschem Verwaltungsrecht beziehungsweise der Methode Otto Mayers von: Hueber, Methode; Meyer-Hesemann, Methodenwandel, S. 20 ff.; ders.; Rechtstheorie 12 (1982), S. 496 ff.; Stolleis, Geschichte II, S. 403 ff.; ders., in: Jeserich/ Pohl/Unruh (Hrsg.), Deutsche Verwaltungsgeschichte III, S. 98 ff.; Friedrich, Geschichte, S. 312 ff.; Bachof, VVDStRL 30 (1972), S. 193 (203 ff.); E. Kaufmann, Otto Mayer, VerwArch 30 (1925), S. 377 ff.; Badura, Verwaltungsrecht; Dennwitz, Systeme des Verwaltungsrechts, S. 122 ff.; Forsthoff, Verwaltungsrecht I10, S. 51 ff.; Glitza, DÖV 80 (1965), S. 329 ff.; Bernet/Förster, Staat und Recht 31 (1988), S. 1017 ff.; Fioravanti, RHistJ 4 (1985), S. 89 ff.; Schmidt-De Caluwe, Verwaltungsakt. Vgl. zur Anstaltslehre Otto Mayers: Rüfner, Die Verwaltung 17 (1984), S. 19 ff. Zum Gesetzesbegriff Otto Mayers vgl.: Böckenförde, Gesetz2, S. 321 ff. Zu Otto Mayers Lehre über die fachliche Weisung im Beamtenverhältnis vgl.: Günther, DÖD 53 (2000), S. 169 ff., 227 ff., 248 ff., 278 ff. Zu den „geistigen Grundlagen“ Otto Mayers vgl.: Heyen, Otto Mayer; ders., in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 16, S. 550 ff.; ders., ZSavignyStR 96 (1979), S. 239 ff.; ders., Quaderni Fiorentini 8 (1979), S. 275 ff.; ders., VerwArch 71 (1980), S. 44 ff.; ders., Der Staat 19 (1980), S. 444 ff. 24 Vgl. Rehm, AöR 12 (1897), S. 590 (595); Bühler, VerwArch 27 (1919), S. 283 (305); E. Kaufmann, Otto Mayer, VerwArch 30 (1925), S. 377 (379 f.); W. Jellinek, Verwaltungsrecht3 (1931), S. 105.
1. Kapitel
Die Regelungsmöglichkeiten des Staates durch Vertrag A. Die Regelungsmöglichkeit des Staates durch öffentlich-rechtlichen Vertrag I. Der öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen Staat und „Untertan“ In seiner Abhandlung „Zur Lehre vom öffentlichrechtlichen Vertrage“ schreibt Otto Mayer, daß „wahre Verträge des Staates auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts überhaupt nicht denkbar“ seien.1 Otto Mayer bezieht sich in diesem Satz auf die vertragliche Regelung öffentlich-rechtlicher Verhältnisse zwischen dem Staat und dem Bürger. In diesen Verhältnissen sind für ihn wahre Verträge undenkbar, weil hier die Begriffe „öffentlichrechtlich“ und „Vertrag“ logisch nicht miteinander vereinbar sind.2 Ein Vertrag setzt für ihn begrifflich voraus, daß „der Rechtserfolg des Vorgangs getragen“ werde „von gleichwertig zusammenwirkenden Willenserklärungen beider Teile“.3 Das „öffentliche Recht“ jedoch sieht er an „als die Ord1 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (42). Ähnlich: Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 292, 157; Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 262. Vgl. auch: Staatsrecht (1909), S. 40: „Die Abmachungen, welche zwischen dem Staat und den Untertanen getroffen werden über die Ausübung der öffentlichen Gewalt, können ihrer rechtlichen Natur nach keine echten Verträge sein [. . .]“. Hervorhebung nicht im Original. 2 „Dieses Rechtsgeschäft ist gerade deshalb, weil es öffentlichrechtlich ist, kein Vertrag nach der Rechtsgestalt des civilrechtlichen Vertrages.“, Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 137 Fn. 3. 3 Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 262; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 148; ähnlich: Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (40). Vgl. auch: Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 292: „Der öffentlichrechtliche Vertrag ist kein wahrer Vertrag; die hoheitliche Natur des einen Kontrahenten schliesst die im Begriffe eines solchen liegende Rechtsgleichheit aus.“ Hervorhebung nicht im Original. Ein Vertrag gedeihe also nur auf dem Boden der Gleichheit, Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 262. Vgl. auch: Staatsrecht (1909), S. 40: „[. . .] denn der Vertrag setzt die rechtliche Gleichheit der Vertragsschließenden voraus, deren übereinstimmender Wille gemeinsam den Rechtserfolg zu tragen hat.“ Vgl. auch: ebd., S. 268 Fn. 5: „Das privatrechtliche Verhältnis zum Staat bedeutet eben die Gleichheit und damit das Gegenteil des ordentlichen Untertanenrechts.“
A. Regelungsmöglichkeit durch öffentlich-rechtlichen Vertrag
17
nung von Verhältnissen, an welchen ein Träger öffentlicher Gewalt als solcher und damit die öffentliche Gewalt selbst beteiligt ist.“4 Dort aber, wo die öffentliche Gewalt im Verhältnis zwischen dem Staat und dem Bürger selbst beteiligt sei, führe das zu einer „grundsätzlichen Ungleichwertigkeit“ der Rechtssubjekte.5 Denn die Kraft der Staatsgewalt bedeute ein allgemeines Recht, der höhere, maßgebende, einseitig aus sich selbst heraus6 bindende7 Wille zu sein.8 Dies sei Ausdruck der Souveränität eines Staates. Souveränität nämlich heiße, daß der „Wille [des Staates] innerhalb seines Gebietes keinem rechtlich gleichwertigen“ begegne, „keinen höheren über sich“ habe „und andererseits unwiderstehlich“ sei „gegenüber allen menschlichen Lebensäußerungen, die auf seinem Gebiet erscheinen“.9 Der Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 16; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 15. Vgl. auch: Staatsrecht (1909), S. 266: „Verhältnisse des öffentlichen Rechts werden wir überall anzunehmen haben, wo an einem solchen die öffentliche Gewalt selbst beteiligt ist.“ 5 Rez. Apelt, AöR 40 (1921), S. 244 (245). Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 67: „Das Verhältnis zwischen Staat und Unterthan ist das einer rechtlichen Ungleichheit: der Staat hat auf seiner Seite die öffentliche Gewalt. Gewalt bedeutet die Fähigkeit eines rechtlich überwiegenden Willens.“ 6 Dies heißt, daß die bindende Wirkung nicht aus einem Gesetz, auch nicht aus der Verfassung abgeleitet ist, vgl. Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 97 f. mit Fn. 3 und 4. Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 100; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 97. 7 Die Bindung bezeichnet eine Rechtsbindung und bezieht sich auf den Untertanen und die Verwaltung, vgl. etwa: Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 157: „So sahen wir Rechte der Einzelnen entstehen durch jeden Rechtssatz oder Einzelakt, der ihr Verhältniss zum Staat bestimmt, weil der darauf folgende erklärende Verwaltungsakt gebunden ist, nicht weniger zu gewähren oder nicht mehr zu nehmen.“ Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 95 und 98; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 93 und 96: „[. . .] der Verwaltungsakt, ein der Verwaltung zugehöriger obrigkeitlicher Ausspruch, der dem Untertanen bestimmt, was für ihn Rechtens sein soll.“ „Er bestimmt für den, über welchen er ergeht, was dieser soll und darf. Aber nicht bloß für ihn: die bindende Kraft ist hier zweiseitig [. . .]. Dem, was über den betroffenen Untertanen bestimmt wird, entspricht eine rechtliche Gebundenheit der vollziehenden Gewalt in allem, was sie eadem re gegen eandem personam vornehmen wird, Gebundenheit nach den Regeln der Vollziehung.“ Siehe zudem: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 95 und 99. 8 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 30; Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 67; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 65; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 64; Finanzwirtschaft, in: Gerloff/Meisel (Hrsg.), HdBFinanzWiss 1 (1926), S. 86 (87). Vgl. auch: Rez. Jellinek, AöR 9 (1894), S. 280 (285): „Uns sind Staat und Unterthan von Natur rechtlich ungleich, der verfassungsmässig geäusserte Staatswille ist immer der bessere, stärkere, der den Anderen rechtlich bindet.“ 9 Staat und Kirche, in: Hauck (Hrsg.), Realencyklopädie 183 (1906), S. 707 (714). Ähnlich: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 65; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 15 f., 65; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 15, 64; Völkerrecht und Völkermoral, AöR 38 (1918), S. 1 (23); Rechtskraft, AöR 21 (1907), S. 1 (39 Fn. 56). 4
18
1. Kapitel: Die Regelungsmöglichkeiten des Staates durch Vertrag
Staat sei daher wie überall im Verwaltungsrecht der Handelnde, der Einzelne nur das Objekt, auf das eingewirkt werde.10 Es bestehe infolgedessen eine allseitige Subjektion des Inidividuums,11 ein allgemeines Subjektionsverhältnis,12 ein „grosses Gewaltverhältnis“. 13 „Das Wort Untertan“ bezeichne deshalb auch „ganz gut das Verhältnis des Menschen im Staate zum Staate“.14 Die Tatsache, daß sich in den meisten deutschen Ländern Verfassungen in Kraft befinden, welche die Individualsphäre des einzelnen absichern, indem sie Grundrechte normieren und/oder Eingriffe in Freiheit und Eigentum einem Gesetzesvorbehalt unterstellen,15 ändert in den Augen Otto Mayers nichts an dem Umstand, daß der einzelne dem Staat gegenüber in einem allgemeinen Gewaltverhältnis steht. Denn die verfassungsrechtlich geschützte Freiheit begründe keine staatsfreie Sphäre. „Nicht eine staatsfreie und eine unfreie Sphäre des Individuums stehen sich getrennt gegenüber, sondern der Unterthan ist dem Staate stets unterworfen, aber eben unterworfen, nur sofern der Staat in verfassungsmässiger Weise ihm gegenübertritt. Der Unterthan ist nie staatsfrei, in jedem Augenblick kann er mit der Staatsgewalt in Berührung kommen, aber andererseits hört er nicht auf Persönlichkeit und verfassungsmäßig frei zu sein, auch wenn ihm gesetzmässig etwas befohlen wird.“16 Schließlich sei die Freiheit des einzelnen nach den Verfassungstexten „durch das Gesetz beschränkbar“,17 ohne daß der Gesetzgeber an sie gebunden sei. Das Gesetz könne alles.18 „Der Staatswille jedenfalls, der in Form des Gesetzes erscheint [. . .] hat seinen Untertanen gegenüber keine rechtlichen Schranken; er kann schlechthin bestimmen, was er will.“19 Da nun das „Gesetz [. . .] aber auch der Staat“ sei,20 liege die Bedeutung des verfassungsrechtlich abgesicherten Eigenbe10
Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 292. Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 262 Fn. 11; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 149 Fn. 9. 12 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (30). Vgl. auch: Trennung (1919), S. 3. 13 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (53, 81); Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 108 Fn. 13. 14 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 14 Fn. 2; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 13 Fn. 2. Hervorhebung nicht im Original. 15 Jesch [Gesetz2, S. 124 mit Fn. 100 ff.] weist im einzelnen nach, welche Verfassungen Grundrechte und welche Vorbehaltsklauseln enthielten. Den Nachweis, daß Grundrechte und Vorbehaltsklauseln im Hinblick auf den Schutz der Individualsphäre des einzelnen funktionsgleich waren, erbringen: Jesch, Gesetz2, S. 125 ff.; Krebs, Vorbehalt, S. 29 f.; Remmert, Übermaßverbot, S. 136. 16 Rez. Jellinek, AöR 9 (1894), S. 280 (284). 17 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 71 f. Fn. 12; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 70 Fn. 18. 18 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 71 Fn. 12; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 70 Fn. 18. 11
A. Regelungsmöglichkeit durch öffentlich-rechtlichen Vertrag
19
reiches folglich nicht darin, „dem Einzelnen ein unantastbares Freiheitsgebiet zu sichern gegenüber der Staatsgewalt überhaupt“. Sondern der Schutz liege „lediglich in der verhältnismäßigen Erschwerung des staatlichen Eingriffs.“21 „Diese Freiheitsrechte bedeuten sämtlich [nur] die Unterstellung bestimmter Seiten der Freiheit des Einzelnen unter die Herrschaft des Gesetzes.“22 Die „allseitige Untertanenschaft“ werde folglich „durch die Ordnungen des Verfassungs- und Rechtsstaates“ nur „gehemmt“, könne also durch ein Gesetz „sofort wieder frei“ werden.23 Mit den Ordnungen des Verfassungs- und Rechtsstaates gemeint ist der „Vorbehalt des Gesetzes“,24 der in den Verfassungen nicht allein durch die Aufstellung sogenannter Grund- und Freiheitsrechte wiedergegeben werde, sondern auch durch Bestimmungen, daß ohne Zustimmung der Stände kein die Freiheit und das Eigentum betreffendes Gesetz erlassen werden dürfe, und selbst dann Geltung beanspruche, wenn Verfassungen, wie die deutsche Reichsverfassung von 1871, „überhaupt nichts von einem solchen Vorbehalte“ sagten.25
19 Schiffahrtsabgaben II (1910), S. 53. Vgl. auch: Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (30): „Unser Staat vermag rechtlich schlechthin Alles“. Vgl. ebenso: Staatsrecht (1909), S. 40, 170 Fn. 14; Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 79, 87; Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 5; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 3; Rez. Arndt, AöR 18 (1903), S. 96 (97). 20 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 71 Fn. 12; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 70 Fn. 18. 21 Staatsrecht (1909), S. 163 Fn. 18. Rez. Brie, AöR 5 (1890), S. 418 (419): „Man muss sich nur die ganze Reihe dieser sogenannten Menschenrechte einmal ansehen. Alle sagen sie: dies und jenes darf den Menschen von der Staatsgewalt nicht geschehen, und alle fügen sie hinzu: es sei denn, dass das Gesetz es thut oder dazu ermächtigt. Es sind lauter Vorbehalte des Gesetzgebers gegenüber der vollziehenden Gewalt, nichts anderes.“ 22 Staatsrecht (1909), S. 31. Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 75 Fn. 11; Rez. Brie, AöR 5 (1890), S. 418 (419 f.). Vgl. überdies: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 113 Fn. 19: „Die Freiheit ist kein subjektives Recht; ein gesetzwidriger Eingriff darin begründet gleichwohl ein ,Recht auf Zurücknahme der Verfügung‘ [. . .]; ist diesem Recht durch Zurücknahme genügt, so ist es erloschen und es besteht wieder bloss die verfassungsmäßig geschützte Freiheit, die kein Recht ist.“ So auch schon in: Rez. Jellinek, AöR 9 (1894), S. 280 (284). Vgl. ebenso: Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 111; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 108; Concurrence, ZgesHandelsR 26 (1881), S. 363 (435). Zum subjektiven öffentlichen Recht siehe auch: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 110; Rechtskraft, AöR 21 (1907), S. 1 (33 ff.). 23 Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 262 Fn. 11; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 149 Fn. 9. 24 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 75. Schon in: Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 19, finden sich die Termini „[. . .] Vorbehalt des Gesetzes und [. . .] Vorrang desselben [. . .].“ 25 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 75 f. Vgl. auch: Rez. Hatschek, JW 51 (1922), S. 1570 (1571); Rez. Brie, AöR 5 (1890), S. 418 (419 f.).
20
1. Kapitel: Die Regelungsmöglichkeiten des Staates durch Vertrag
Fehle es an einer gesetzlichen Grundlage, werde das „allgemeine Subjektionsverhältnis“ auch durch die Einwilligung des Betroffenen wieder hergestellt:26 „Der Vorbehalt des Gesetzes, wie er namentlich in den sogenannten Freiheitsrechten formuliert wird, ist zu Gunsten des Einzelnen gemeint und wirkt für ihn; eine Verletzung dieses Vorbehaltes zu seinem Nachteil ist ein Unrecht gegen ihn. Die Freiheit selbst wäre aber verleugnet, wenn dieser Schutz unbedingt gemeint wäre; eine Verfügungsfähigkeit des Geschützten muss bestehen bleiben, die denn auch in gewissen Grenzen anerkannt ist behufs Übernahme von persönlichen Pflichten, Zahlungsverbindlichkeiten und dgl. Insofern haben die verfassungsmässigen Vorbehalte, welche die Belastung ohne Gesetz ausschliessen, die stillschweigende Klausel: es sei denn, dass der Betroffene zulässiger Weise seine Einwilligung erklärt.“27 Die Einwilligung des Betroffenen stelle dabei allerdings „nur eine Voraussetzung dar, die den Mangel eines ermächtigenden Gesetzes“ ersetze.28 Sie sei ein bloßes „ja“, eine Unterwerfung, um „das Hindernis wegzuräumen, welches der verfassungsmässige Vorbehalt des Gesetzes der Macht und Zuständigkeit der Regierung setzt“.29 Nicht aber sei sie eine der staatlichen Willensäußerung gleichberechtigte Willenserklärung. Folglich handle es sich in Fällen, in denen der Betroffene seine Einwilligung gebe, nicht um eine Willenseinigung Gleichberechtigter, wie sie der Begriff des Vertrages voraussetze.30 Ist demnach die Einwilligung des Betroffenen prinzipiell nicht mit der Willenseinigung Gleichberechtigter in eins zu setzen, so könnte es aber dennoch sein, daß die Rechtsordnung in bestimmten Fällen bereit ist, dem Bürger eine Rechtsmacht zur Abgabe einer „echten“ Willenserklärung einzuräumen. Otto Mayer fragt sich deshalb, ob es „überhaupt denkbar“ ist, „dass ein Gesetz ein solches echtes Mitwirkungsrecht verliehe?“ Die Antwort lautet: nein. Denn wie bereits erörtert, ist das öffentliche Recht für Otto Mayer „die Ordnung von Verhältnissen, an welchen ein Träger öffentlicher Gewalt als solcher und damit die öffentliche Gewalt selbst beteiligt ist.“31 Da seiner Auffassung nach der Wille der öffentlichen Gewalt der 26 Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 262 Fn. 11; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 149 Fn. 9. 27 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 98. 28 Rez. Jellinek, AöR 9 (1884), S. 280 (285). 29 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (39). Vgl. dazu auch: Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 1 ff. (bes. 4 ff.; 18 f.); Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 67 ff., 98; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 65 ff.; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 64 ff. 30 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (39 f.). 31 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 16; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 15. Vgl. auch: Staatsrecht (1909), S. 266: „Verhältnisse des öffentlichen
A. Regelungsmöglichkeit durch öffentlich-rechtlichen Vertrag
21
stets mit höherer Kraft ausgestattete, folglich einseitig bestimmende ist, kann im Bereich des öffentlichen Rechts dem einzelnen der Staatsgewalt selbst gegenüber auch durch ein Gesetz kein echtes Mitwirkungsrecht verliehen werden: „Wenn von vornherein der Wille des staatlichen Organs für sich allein fähig ist, Rechtsverhältnisse zu erzeugen“, dem Schutz des Einzelnen zudem vollauf genügt wird „in der Form, dass die Zuständigkeit jener Organe zur Vornahme des Aktes abhängig gemacht wird von Gesuchen und Annahmeerkärungen des Einzelnen“, wäre ein Gesetz, „welches überflüssiger Weise die Einwilligung zu einer förmlichen Mitwirkung an der Erzeugung des Rechtsverhältnisses im Sinne des Vertrages steigerte, nur um einen wahren Vertrag zu haben“, „eine leere juristische Liebhaberei“.32 Unterwirft sich also nach Meinung Otto Mayers der betroffene Bürger in Fällen die Freiheit beeinträchtigender, eines ermächtigenden Gesetzes indes ermangelnder Maßnahmen durch seine Einwilligung der Verwaltung gegenüber nur, gibt er folglich nicht eine gleichwertige Willenserklärung ab, und wird demzufolge von der Verwaltung auch bei Vorliegen einer Einwilligung einseitig bestimmt, was für den Untertan im Einzelfall „Rechtens sein soll“, wird verständlich, warum Otto Mayer die rechtliche Natur dieser Vorgänge umschreibt mit der Bezeichnung „Verwaltungsakt auf Unterwerfung“.33 Denn der Verwaltungsakt wird von ihm verstanden als „ein der Verwaltung zugehöriger obrigkeitlicher Ausspruch, der dem Unterthanen gegenüber im Einzelfall bestimmt, was für ihn Rechtens sein soll“.34 Werde die „rechtliche Natur“35 eines sich äußerlich als Vertragsschluß gebärdenden Vorganges, in welchem dem einzelnen gegenüber mit seiner Einwilligung ein Verwaltungsakt erlassen wird, zwar durch die Bezeichnung als „Verwaltungsakt auf Unterwerfung“ richtig wiedergegeben, sei der Name „öffentlichrechtlicher Vertrag“ aber „immer noch am zweckmässigsten“, „um die Eigenart [. . .] gegenüber anders gearteten Rechtsgeschäften des öffentlichen Rechts passend zu bezeichnen“;36 denn die „öffentlichrechtlichen Verwaltungsakte auf Unterwerfung halten sich nun in ihrem stofflichen Inhalt an das, was auch ein civilrechtlicher Vertrag an VerpflichRechts werden wir überall anzunehmen haben, wo an einem solchen die öffentliche Gewalt selbst beteiligt ist.“ 32 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (41 f.). 33 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895) S. 98; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 100; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 98; Selbstdarstellung (1924), S. 11 f. 34 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 95; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 95; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 93. 35 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (20). 36 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (44). Vgl. auch: ebd., Fn. 63: „Wo sollen wir überhaupt eine Terminologie herbekommen, wenn wir nicht wagen, sie vom Civilrecht zu entlehnen.“
22
1. Kapitel: Die Regelungsmöglichkeiten des Staates durch Vertrag
tungen, Belastungen, Abtretungen auferlegen könnte. Deshalb führen sie die Bezeichnung Vertrag, obwohl sie ja keine Verträge im strengen Sinne des Wortes sind. Zum Unterschied von den echten Verträgen des Civilrechts spricht man von einem öffentlichrechtlichen Vertrag. Soweit eine solche stoffliche Anlehnung an einen entsprechenden civilrechtlichen Vertrag nicht möglich wäre, müsste auch die Zulässigkeit einer Unterwerfung und somit die Gültigkeit eines Aktes auf Unterwerfung bestritten werden können. Darin liegt die Wichtigkeit des Begriffs des öffentlichrechtlichen Vertrags.“37 Deshalb auch möge der Name dazu dienen, „die Dinge anschaulicher zu machen“.38 In Otto Mayers „Theorie des Französischen Verwaltungsrechts“ finden sich folgende Beispiele für einen „öffentlich-rechtlichen Vertrag“: die Anstellung der Beamten im öffentlichen Dienst,39 Verdingungen öffentlicher Arbeiten, „umfassend Werkverdingung, Dienstmiethe und Lieferungsverträgen für öffentliche Anstalten“,40 die Beleihung,41 die Verleihung von Nutzungen,42 Verfügungen über das Staatsvermögen wie beispielsweise der Verkauf von Staatsgut,43 die sich an die Erteilung der Erlaubnis zum Anbau von Tabak anschließende Regelung des Verhältnisses zwischen dem Fiskus und dem Pflanzer44 sowie das Rechtsverhältnis der Geistlichen.45 Für das deutsche Verwaltungsrecht gibt Mayer als Beispiele „öffentlichrechtlicher Verträge“: die Beamtenanstellung,46 die Einräumung des Gleis37 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 98 Fn. 5. Vgl. ebd., S. 137 Fn. 3: „Dieses Rechtsgeschäft ist gerade deshalb, weil es öffentlichrechtlich ist, kein Vertrag nach der Rechtsgestalt des civilrechtlichen Vertrages. [. . .] Allein es ist doch wohl eine Thatsache, dass unsere Wissenschaft ohne civilrechtliche Ausdrücke, die sie in ihrem Sinne versteht, nicht auskommt.“ Weiter heißt es dann jedoch, er, Otto Mayer, wolle „den Namen öffentlichrechtlicher Vertrag, nachdem er seinen Dienst gethan, ohnehin nicht weiter verwerten [. . .].“ 38 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 104; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 101. 39 Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 106 f., 294, 308 ff., 405, 476. 40 Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 106 f., 127 f., 294, 295 ff., 405. 41 Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 302 ff. 42 Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 333 f. 43 Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 379, 382 ff. 44 Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 395. 45 Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 506. 46 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 98 Fn. 5: „Hauptbeispiel“. Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 100; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 98: „Das wichtigste Beispiel solcher ,Verwaltungsakte auf Unterwerfung‘ bietet die Anstellung im öffentlichen Dienst.“ Vgl. auch: Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (26 ff.); Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 220 f.; Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 260 ff.; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 147 ff. Vgl. überdies: Staatsrecht (1909), S. 234 f. mit Fn. 10; Anmerkung zu RGZ v. 14. 3. 1922, JW 51
A. Regelungsmöglichkeit durch öffentlich-rechtlichen Vertrag
23
rechts an eine Straßenbahnunternehmung,47 die Eingemeindung, welche die Behörde unter Zustimmung der Beteiligten verfügt,48 die Beleihung,49 die Begründung einer sogenannten Vorzugslast,50 die Auferlegung von Steuerpflichten51 sowie die sich auf dem Gebiet der Zollvergünstigung findende, einen Unterfall der Finanzstrafe bildende sogenannte Konventional- beziehungsweise Vertragsstrafe.52 II. Der öffentlich-rechtliche Vertrag zur Regelung von Verhältnissen, in denen die „öffentliche Gewalt zwischen Gleichwertigen“ erscheint Wahre Verträge des Staates mit dem Bürger auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts erachtet Otto Mayer für undenkbar, weil für ihn ein Vertrag nur auf dem Boden der Gleichheit gedeiht, während das öffentliche Recht die Ordnung der Verhältnisse darstellt, in denen der Staat als solcher, mithin aufgrund der einseitig bindenden Kraft seines Willens handelt, so daß die Rechtssubjekte dieser Verhältnisse zwangsläufig ungleich sind. Dementsprechend sind für ihn wahre öffentlich-rechtliche Verträge dort grundsätz(1922), S. 1385 (1386); Anmerkung zu PrOVG v. 10. 11. 1921, JW 51 (1922), S. 610 (610). 47 Rez. Apelt, AöR 40 (1921), S. 244 (245). 48 Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 645 f.; Deutsches Verwaltungsrecht 3 II (1924), S. 359 f.; Rez. Apelt, AöR 40 (1921), S. 244 (245). 49 Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 307: „Die Verleihung ist ein Verwaltungsakt auf Unterwerfung wie die Anstellung im Staatsdienste, ein Vertrag so wenig wie diese.“ Ähnlich: Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 451; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 255. 50 Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 281 mit Fn. 6; Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 408, 412; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 233, 235. Unter einer „Vorzugslast“ versteht Otto Mayer einen Unterfall der öffentlichen Last, welche „die dem Untertanen obliegende Pflicht“ darstelle, einem öffentlichen Unternehmen „als die Einheit eines durch seinen bestimmten Zweck abgegrenzten Stückes öffentlicher Verwaltung“ durch „Leistung an den Unternehmer Mittel zu gewähren, deren es zur Erfüllung seines Zwecks bedarf“ [Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 217 f.]. Werde die öffentliche Last „dem Einzelnen auferlegt [. . .] mit Rücksicht auf eine besondere Beteiligung an dem öffentlichen Unternehmen“, handele es sich um eine Vorzugslast [Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 219.]. „Wo die Erfüllung der Vorzugslast durch eine Geldzahlung an den Herrn des Unternehmens erfolgt“, werde sie „Beitrag“ genannt [Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 231.]. Beiträge erhöben beispielsweise Entwässerungsanlagen von den Besitzern, denen ihre Herstellung zugute komme [Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 231 f.]. 51 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 426 f.; Deutsches Verwaltungsrecht 2 I (1914), S. 351 f.; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 336 f. 52 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 448 f.; Deutsches Verwaltungsrecht 2 I (1914), S. 375 f.; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 359.
24
1. Kapitel: Die Regelungsmöglichkeiten des Staates durch Vertrag
lich möglich, wo „die öffentliche Gewalt zwischen Gleichwertigen“ erscheint.53 Für Otto Mayer ist dies im Bereich des Völkerrechts der Fall.54 Aber auch „im Staatsrecht bei dem Aufbau der Verfassung und inneren Einrichtung des Staates“55 erscheine die öffentliche Gewalt zwischen Gleichwertigen.56 Überdies stehe die Handlungsform des öffentlich-rechtlichen Vertrages im Bereich der Selbstverwaltungsordnung grundsätzlich zur Verfügung.57 Hier allerdings scheitere die Annahme eines Vertrages zumeist daran, daß es an dem für einen Vertrag zwingend notwendigen Rechtssatz fehle.58 Der geeinigte Wille der Vertragsparteien wirke schließlich nur deswegen, weil er die Anerkennung der Rechtsordnung besitze.59 Dessen ungeachtet beruhten zwischen Selbstverwaltungskörpern einvernehmlich getroffene Regelungen 53
Rez. Apelt, AöR 40 (1921), S. 244 (245). Vetrag, AöR 3 (1888), S. 3 (11, 42 Fn. 59); Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 458 f.; Selbstdarstellung (1924), S. 12; Rez. Apelt, AöR 40 (1921), S. 244 (245). Vgl. zu Staatsverträgen auch: Staatsrecht (1909), S. 187 ff. 55 Was hiermit gemeint ist, erläutert Otto Mayer nicht und erschließt sich auch nicht dem mit den Schriften Otto Mayers vertrauten Leser. Kein Beispiel hierfür jedenfalls ist der Sachverhalt, den Otto Mayer in: Staatsrecht (1909), S. 169 ff., schildert. Mayer schreibt dort, daß das sächsische Staatsrechts zur Sicherung des Zustandekommens eines Gesetzes auf dem Wege zum Erlaß des Gesetzes zwischen König und Landtag gewisse rechtliche Gebundenheiten entstehen lasse, indem es beispielsweise in § 90 der Verfassungsurkunde bestimme, daß nach Annahme eines königlichen Gesetzentwurfes durch die Stände der König diesen nicht mehr zurücknehmen könne. Dies würdigt Mayer wie folgt, [ebd., S. 172 Fn. 20.]: „Mit Grundsätzen des Allgemeinen Staatsrechts und mit dem Schreckbild des ,privatrechtlichen‘ Vertrages läßt sich gegen diese bestehende Rechtseinrichtung nicht aufkommen. Soll doch einmal Naturrecht angerufen werden, so möchten wir behaupten, daß es danach geradezu selbstverständlich sein muß, daß der König an sein den Ständen gegebenes Wort: ich werde erlassen, ich werde veröffentlichen, auch gebunden sei. Darauf das, was er zusagt, ihn ernstlich verpflichtet, beruht ja die ganze Verfassung. Natürlich ist vorausgesetzt, daß die anderen einverstanden gewesen seien; ob man dem nun den Namen Vertrag oder Vereinbarung gönnen will, wird weniger wichtig sein; gewisse Grundgedanken des Vertragsrechts kommen offenbar zur Anwendung.“ Hervorhebung nicht im Original. 56 Rez. Apelt, AöR 40 (1921), S. 244 (245). 57 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 137 Fn. 3; Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 430 ff.; Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 682 ff.; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 380 ff.; Selbstdarstellung (1924), S. 12; Rez. Apelt, AöR 40 (1921), S. 244 (245). 58 Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 431; Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 684 Fn. 2, 693 f.; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 381 Fn. 2; Rez. Apelt, AöR 40 (1921), S. 244 (246). 59 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (49); Wert des Völkerrechts (1915), in: Otto Mayer-Kl. Schriften II, S. 16 (19); Völkerrecht und Völkermoral, AöR 38 (1918), S. 1 (8); Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 431; Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 683, 687 Fn. 8; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 381, 383 Fn. 7. 54
B. Der privatrechtliche Vertrag zwischen dem Staat und dem Bürger
25
daher mehr auf einer „tatsächlichen Ordnung“, die sich aufrecht erhalte „durch die kluge Rücksicht auf den eigenen Vorteil und das gute Einverständnis [. . .], unterstützt durch die Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde und die allgemeinen Rechtsgrundsätze über öffentlichrechtliche Entschädigung“.60 Die Bezeichnung derlei Übereinkommen als „Abkommen, Vereinbarung, Übereinkunft“ sei daher angebrachter.61 Die Annahme eines echten Vertrages zwischen Selbstverwaltungskörpern begegne ohnehin auch deswegen Bedenken, weil es „dem Geiste der öffentlichen Verwaltung mehr entsprechen“ könne, „derartige Verhältnisse nicht in starre Gebundenheit zu pressen, wie die echte vertragliche Regelung“ beziehungsweise allgemein die Form des Zivilrechts sie bedeute.62 „Zum Unterschied von der strengen und etwas förmlichen Frau Justitia“ müsse „die Verwaltung sich dem Reichtum des Lebens, dem sie gegenübersteht, freier und leichter anschmiegen können“.63
B. Der privatrechtliche Vertrag zwischen dem Staat und dem Bürger Obwohl wahre Verträge zwischen dem Staat und dem „Untertan“ auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts von Otto Mayer für undenkbar angesehen werden, bejaht er für den Staat die Möglichkeit, zivilrechtliche Verträge mit dem einzelnen zu schließen. Der Staat könne, „seine Natur verleugnend, sich herunterbegeben [. . .] zum gewöhnlichen Privatmann, um wie ein solcher und in privatwirtschaftlicher Weise seine Geschäfte zu besorgen.“64 Ungeachtet der unbedingten Übermacht der Staatsgewalt sei „die Möglichkeit eröffnet, in gewissem Masse das [. . .] auf die Verhältnisse der Einzelnen unter einander berechnete Civilrecht auf den Staat zur Anwendung zu bringen und die zur Erledigung von bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten bestimmten Gerichte gegen ihn anzurufen“.65 Dabei sei „die Anwen60 Rez. Apelt, AöR 40 (1921), S. 244 (246). Hervorhebung nicht im Original. Ähnlich: Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 683; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 381. 61 Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 683; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 381. Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 137 Fn. 3. 62 Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 683; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 381. Vgl. auch: Entschädigungspflicht (1904), S. 23; Eisenbahn II, AöR 16 (1901), S. 38 (52 f.). 63 Urteil (1906), S. 34. Ähnlich: Rechtskraft, AöR 21 (1907), S. 1 (22, 65 f.); Finanzwirtschaft, in: Gerloff/Meisel (Hrsg.), HdBFinanzWiss 1 (1926), S. 86 (86 f.). 64 Haftung, SächsArchR 8 (1913), S. 1 (5). 65 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 53 f. Vgl. auch: ebd., S. 137 ff.; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 56, 118 ff.; Deutsches Verwaltungsrecht I3
26
1. Kapitel: Die Regelungsmöglichkeiten des Staates durch Vertrag
dung des Civilrechts auf den Staat [. . .] nichts Selbstverständliches, sondern eine geschichtliche Errungenschaft“. Sie sei zudem kein Widerspruch mit der reinen Staatsidee. Es handele sich nicht etwa nur um öffentlich-rechtliche Akte, die lediglich vermöge einer vom Staate ausgesprochenen Rechtsfiktion nach den Normen des Privatrechts behandelt werden. Denn „was [. . .] nach dem Willen des Staates als privatrechtlich behandelt werden soll, i s t für uns privatrechtlich.“66 Wenngleich die grundsätzliche Möglichkeit bestehe, Rechtsverhältnisse zwischen dem Staat und dem einzelnen in zivilrechtlicher Form zu begründen, müsse jedoch die Anwendung des Zivilrechts auf den Staat die eng begrenzte Ausnahme bleiben:67 „Unser heutiger Standpunkt für die Abgrenzung ist grundsätzlich der umgekehrte: das öffentliche Recht [. . .] ist das dem Staate und seinem Verhältnis zu den Untertanen eigentlich entsprechende, das ihm angeborene; die Anwendung des bürgerlichen Rechts ist hier die begrenzte Ausnahme, nur geltend, soweit der besondere Grund dafür reicht, der Umstand nämlich, daß der Staat, seine Natur verleugnend, sich herunterbegeben hat zum gewöhnlichen Privatmann, um wie ein solcher und in privatwirtschaftlicher Weise seine Geschäfte zu besorgen.“68 „Wie weit solche Ausnahme Platz greift“, dafür ist Otto Mayer jedoch „maßgebend keine beliebig gewählte Abgrenzungsformel“.69 Eine solche gibt es, ungeachtet der mehrfach betonten Notwendigkeit der „scharfen“ Trennung des zivilen vom öffentlichen Recht,70 seiner Ansicht nach nicht. (1924), S. 54 f., 115 ff.; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 274; Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 153. 66 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 54 Fn. 2. Hervorhebung im Original. 67 Vgl. Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 153 f.: „Zum Wesen des Verwaltungsrechtes gehört ferner, dass der Staat dem Einzelnen gegenüber trete als h o h e i t l i c h e M a c h t , [. . .]. [. . .] Diese Anwendbarkeit des Civilrechts, darüber gibt es nur e i n e Meinung, ist nicht das Selbstverständliche, sondern die eng begränzte Ausnahme. Von Natur handelt der Staat dem Unterthanen gegenüber immer hoheitlich und nur in der Weise des Verwaltungsrechts bestimmt.“ Hervorhebung im Original. 68 Haftung, SächsArchR 8 (1913), S. 1 (5). Vgl. auch: Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (81): „Auf dem Gebiete des öffentlichen Rechtes, wo seine eigene Natur zu Tage tritt, kann der Staat [. . .].“ Daß die Anwendung des Zivilrechts auf Verhältnisse zwischen dem Staat und dem Untertan die Ausnahme bleiben müsse, wird auch betont in: Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 118; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 115; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 274. In: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 141, heißt es: „[. . .] bezeichnen wir [. . .] die ganze Masse der Verwaltung, welche der Staat nicht als Privatunternehmer betreibt, als öffentliche Verwaltung. [. . .] Nur von der öffentlichen Verwaltung gilt der Satz, dass das öffentliche Recht für den Staat das natürliche, selbstverständliche ist. Deshalb streitet hier für dessen Anwendbarkeit die V e r m u t u n g .“ Hervorhebung im Original. 69 Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 274.
B. Der privatrechtliche Vertrag zwischen dem Staat und dem Bürger
27
Wenn Otto Mayer schreibt, der Staat handele zivilrechtlich, wenn er wie ein einzelner privatwirtschaftlich auftrete,71 und öffentlich-rechtlich, wenn er als solcher, also als die öffentliche Gewalt selbst handele,72 so ist ihm bewußt, daß damit kein sicherer Maßstab gewonnen ist, „mit welchem sich nun alle Grenzstreitigkeiten von selbst lösten“,73 weil „die Frage [. . .] vorher entschieden sein [muß]: nicht weil die bindende Kraft des Staatswillens darin wirksam wird, wird der Akt als ein öffentlichrechtlicher anerkannt, sondern weil er aus irgendeinem andern Grunde zum öffentlichen Rechte gehört, rechnet man bei seiner juristischen Behandlung mit jener Kraft“.74 Vorher entschieden werde die Frage indes nicht dadurch, daß „öffentliche Interessen in Frage sind“.75 Denn dieser Begriff sei für eine trennscharfe Scheidung beider Rechtsgebiete „zu verschwommen“.76 Zudem, wolle man das „Zivilrecht für ausgeschlossen erklären, wo der Staat im öffentlichen Interesse tätig erscheint“, könne „man auch gleich sagen: wo seine öffentliche Gewalt bemerkbar wird; denn darum handelt es sich doch eigentlich: man vermeidet es nur, es so zu nennen, weil sonst zu rasch deutlich wird, daß mit solcher Umkehr der Fragestellung nichts gewonnen ist.“77 Die genaue Abgrenzung könne sich erst konkret daraus ergeben, „was wir in Brauch und Handhabung des geltenden Rechts tatsächlich verwirklicht sehen“.78 „Wir legen also, wo es zweifelhaft ist, ob ein civilrechtliches oder öffentlichrechtliches Rechtsinstitut gegeben ist, an die Wirklichkeit seiner Erscheinung die beiden bekannten [scil.: privates und öffentliches Recht jeweils kennzeichnenden] Maßstäbe an. Mit welchem von beiden alle gegebenen Einzelheiten natürlicher, unmittelbarer, widerspruchsloser sich erklären lassen, das ist der richtige. Das geltende Recht hat uns je nachdem ein civilrechtliches oder ein öffentlichrechtliches Rechtsinstitut geliefert.“79 Eine Rolle spielten dabei auch Fragen der Vernunft: „Unter Vgl. Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 53, 136 f.; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 56, 249 Fn. 1; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 55, 239 Fn. 1. 71 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (35 f.); Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 139. 72 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 16; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 15; Staatsrecht (1909), S. 266. 73 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 139. 74 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (34). 75 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (35, 51); Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 142 Fn. 8: „Zu weit gehen also die Versuche, das öffentliche Interesse unmittelbar zur Abgrenzung des öffentlichen und des Civilrechts zu verwerten [. . .].“ 76 Rez. Apelt, AöR 40 (1921), S. 244 (245). 77 Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 116. Vgl. auch: ebd., S. 15 Fn. 6. 78 Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 274. Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 476 f. 70
28
1. Kapitel: Die Regelungsmöglichkeiten des Staates durch Vertrag
diesen Umständen wird es gestattet sein, dass wir unseren Maßstab auch einmal zu holen suchen aus dem, was hinter allen Rechtseinrichtungen steht: sie sollen doch den Menschen dienen in bestimmter Weise und dieser Absicht angemessen, d. h. vernünftig sein. Sie werden also vernünftiger Weise nur so weit und ganz so weit gelten, als hiernach angemessen erscheint.“80 Keineswegs rekurriert Otto Mayer damit auf naturrechtliches Gedankengut. „Wir glauben an kein Naturrecht, kein Vernunftrecht mehr im alten Sinn. Aber wir verzichten nicht auf die Forderung, daß das Recht vernünftig und zweckmäßig sei [. . .].“81 Zu fragen sei lediglich, ob es für die Menschen zweckmäßiger82 sei, eine Sachmaterie nach privatem Recht zu begreifen oder „dem Spiel des privatrechtlichen Verkehrs zu entziehen“.83 Die Anstellung im Staatsdienst beispielsweise „passe“ so, wie sie im Reichsbeamtengesetz geregelt sei, eher zu einem „öffentlichrechtlichen Vertrage“ als zu einem zivilrechtlichen.84 Denn es sei „für den Staat durchaus nicht gleichgiltig, ob das Recht, das da für die Verwaltung gehandhabt wird, von einleuchtender Vernünftigkeit ist oder nicht. Die fehlt gänzlich, wenn die Anstellung im Staatsdienst nach Art des civilrechtlichen Vertrages aufgefasst wird, wobei S. Majestät durch Zustellenlassen der Bestellungsurkunde eine Vertragsofferte macht, die der andere nun vielleicht annimmt, vielleicht auch nicht.“85 Da Otto Mayer indes darum weiß, daß mit der „Vernünftigkeit“ der Rechtsordnung kein Kriterium gewonnen ist, das eine trennscharfe Abgrenzung beider Rechtsgebiete ermöglicht, gesteht er zu, daß die Anstellung im Staatsdienst „nicht nothwendig öffentlichrechtlich behandelt werden [muß]“; wenn sie „Jemand civilrechtlich auffassen will, so können wir keinen zwingenden rechtswissenschaftlichen Grundsatz entgegenhalten, wonach das nicht zulässig wäre.“86 Er wolle darum auch nicht die Möglichkeit ausschließen, für die Anstellung im Staatsdienst die einseitig bindende Kraft des Staatswillens zu verneinen. Otto Mayer betont jedoch, daß „der 79 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 140; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 119; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 116 f. 80 Eisenbahn II, AöR 16 (1901), S. 38 (66). Daß „die Rechtsordnung [. . .] um der Menschen willen da“ sei, wird betont auch in: Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 366; Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1914), S. 572; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 322. 81 Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 75. 82 Dazu, daß vernünftig im Sinne von zweckmäßig gemeint ist, vgl. auch: Eisenbahn II, AöR 16 (1901), S. 38 (43); Eisenbahn III, AöR 16 (1901), S. 203 (237); Stand des öffentlichen Eigentums, AöR 21 (1907), S. 499 (507). 83 Eisenbahn II, AöR 16 (1901), S. 38 (43). 84 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (61 ff.). 85 Justiz (1902), S. 24. 86 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (37).
C. Zusammenfassung
29
auf solche Weise ermöglichte Vertrag notwendig eine civilrechtliche Grundlage bekommt“.87
C. Zusammenfassung Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß Otto Mayer einen öffentlichrechtlichen Vertrag zwischen dem „Staat“ und dem „Untertanen“ aufgrund einer hier bestehenden Gegensätzlichkeit der Begriffe „Vertrag“ und „öffentlich-rechtlich“ für undenkbar erachtet. Als – jedenfalls begrifflich – möglich sieht er hingegen öffentlich-rechtliche Verträge dort an, wo die öffentliche Gewalt unter Gleichwertigen erscheint, also im Völker- und Staatsrecht, sowie im Recht der Selbstverwaltungsordnung. Den Abschluß eines zivilrechtlichen Vertrages zwischen dem Staat und dem „Untertanen“ betrachtet er als erdenklich, zugleich aber als die eng begrenzte Ausnahme.88
87
Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (48). An dieser Stelle sei die Anmerkung erlaubt, daß sich entgegen der Auffassung einiger Stimmen in der Literatur [vor allem: Henke, JZ 39 (1984), S. 441 (441); aber auch: Bauer, Die Verwaltung 25 (1992), S. 301 (303); Stolleis, Geschichte II, S. 375; Gurlit, Verwaltungsvertrag, S. 5.] in den Schriften Otto Mayers der Satz „Der Staat paktiert nicht.“ nicht findet [ebenso: Schlette, Vertragspartner, S. 29 Fn. 109.]. 88
2. Kapitel
Die Grundlagen der Vertragsdogmatik Otto Mayers A. Das Verwaltungsrecht als eigentümliche Rechtsdisziplin Sucht man nach einer Erklärung dafür, warum Otto Mayer den Begriffen „öffentliches Recht“ und „Vertrag“ Inhalte beilegt, aufgrund deren der zusammengefügte Begriff des „öffentlich-rechtlichen Vertrages“ im Staat-Bürger-Verhältnis einen Widerspruch in sich bildet, findet man diese Erklärung in der Idee, das Verwaltungsrecht zu einem eigentümlichen, selbständigen Rechtsgebiet zu entwickeln.1 Otto Mayer gibt dies deutlich zu erkennen, indem er seine Abhandlung „Zur Lehre vom öffentlichrechtlichen Vertrage“ mit den Worten einleitet: „Soll die Verwaltungrechtswissenschaft als gleichberechtigte juristische Disciplin neben die älteren Schwestern treten, so muss sie ein System von eigenthümlichen Rechtsinstituten der staatlichen Verwaltung sein.“2 Gerichtet sind die zitierten Worte an Paul Laband. Dieser nämlich hatte kurz zuvor in einer Rezension von Otto Mayers „Theorie des Französischen Verwaltungsrechts“ die Behauptung aufgestellt, daß das „V e r w a l t u n g s r e c h t [. . .] n i c h t e i n e s p e z i f i s c h e A r t v o n R e c h t “ sei, sondern „die Summe derjenigen Rechtssätze, welche die öffentliche Ver1 So auch – allerdings ohne nähere Begründung – Forsthoff, Verwaltungsrecht I10, S. 51 f.; Bullinger, Öffentliches Recht und Privatrecht, S. 66; Fioravanti, RHistJ 4 (1985), S. 89 (92); Maurer, DVBl. 104 (1989), S. 798 (800); Hennecke, in: Knack, Verwaltungsverfahrensgesetz7, Vor § 54 Rn. 14; ders., DÖV 50 (1997), S. 768 (774 f.); De Wall, Privatrechtliche Vorschriften, S. 14 f.; Stolleis, Geschichte II, S. 375, 412; Gurlit, Verwaltungsvertrag, S. 74 mit Fn. 67; Schlette, Vertragspartner, S. 30, 53 Fn. 242. 2 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (3). Hervorhebung nicht im Original. Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 14; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 14: „Ob es [scil.: das Verwaltungsrecht] eigenartig genug ist und reich genug entfaltet, um eine besondere Darstellung zu verlohnen, das muß diese selbst zeigen.“ Und ebd., Fn. 3: „Sie wird auch von selbst die Widerlegung jener älteren Auffassung werden, die da glaubte, dem Verwaltungsrecht seinen eigenen Platz an der Sonne versagen zu können [. . .].“
A. Das Verwaltungsrecht als eigentümliche Rechtsdisziplin
31
waltung betreffen, wie die Begriffe des Landwirtschaftsrechts, Handelsrechts, Seerechts, Militärrechts keine d o g m a t i s c h e n R e c h t s begriffe“ seien, sondern nur dazu dienten, „um Rechtsmaterien, welche auf einen gewissen Kreis von Personen oder Lebensverhältnissen Anwendung finden und auf ihn sich beziehen, zusammenzufassen. Das Bestreben, aus dem Verwaltungsrecht ein besonderes eigenartiges genus von Rechtssätzen zu machen und es in einen begrifflichen Gegensatz zu Privatrecht, Strafrecht, Prozessrecht und Staatsrecht zu bringen, anstatt es als ein K o n g l o m e r a t v e r s c h i e d e n a r t i g e r Rechtssätze zu erkennen und bei jedem seiner Bestandtheile der spezifischen Natur desselben gerecht zu werden“, sei seines Erachtens „das schwerste Hindernis einer befriedigenden Dogmatik des Verwaltungsrechts. Denn bei der wissenschaftlichen Erörterung eines jeden Rechtsinstituts und Rechtssatzes“ ergebe „sich das unabweisbare Bedürfnis, die Zusammenhänge mit den höheren Rechtsbegriffen, die Beziehungen zu den parallel laufenden Rechtsbildungen aufzusuchen und die daraus sich ergebenden Ergänzungen, Einschränkungen, Modifikationen, Wechselwirkungen zu ermitteln“. „Spezifische, dem Verwaltungsrecht eigenartige Rechtsprinzipien“ gebe „es aber nicht“.3 Darum auch sei die von Otto Mayer in dessen „Theorie des Französischen Verwaltungsrecht“4 entwickelte Lehre vom „öffentlichrechtlichen Vertrage“ am „bedenklichsten“.5 Denn solle „die Bezeichnung Machtäußerung, Herrschaftsakt eine besondere juristische Qualifikation staatlicher Handlungen sein“, so müsse „sie in einem engeren Sinne genommen werden“. „Die einzelnen staatlichen Handlungen“ seien „nur dann Aeusserungen der Macht, des imperium, wenn sie einen Befehl, einen Zwang“ enthielten; [. . .].“6 Um dieser Auffassung Labands entgegenzutreten, die das Verhältnis zwischen dem verwaltenden Staat und dem Bürger, sofern diesem nichts befohlen wird, nur unter Rückgriff auf das Recht der anderen, althergebrachten Rechtsgebiete, und zwar ganz überwiegend des Zivilrechts, als ein Rechtsverhältnis zu konstruieren vermag,7 veröffentlicht Otto Mayer die oben erwähnte Abhandlung und begründet in ihr die These, daß es „in dem Verhältnisse der Verwaltung zu den Untertanen“ nicht nur den Befehl als die „einzige eigenthümlich öffentlichrechtliche Form staatlicher Einwirkung“ gebe, mithin dem staatlichen Willen auch außerhalb der Form des Befehls die Kraft zukommen müsse, dem einzelnen zu bestimmen, was für ihn rechtens sein soll, unter anderem schlicht wie folgt: Es könne sich für eine Wissenschaft des Verwaltungsrechts eben nicht allein darum handeln, 3 4 5 6 7
Rez. Mayer, AöR 2 (1887), S. 149 (155 f.). Hervorhebung im Original. Französisches Verwaltungsrecht (1886), bes. S. 290 ff. Rez. Mayer, AöR 2 (1887), S. 149 (157). Rez. Mayer, AöR 2 (1887), S. 149 (159). Dazu im einzelnen in diesem Kapitel unter B. I.
32
2. Kapitel: Die Grundlagen der Vertragsdogmatik Otto Mayers
„,Conglomerate‘ zu machen aus den Begriffen, Formen und Rechtsinstituten, welche die anderen wahren rechtswissenschaftlichen Disciplinen fertig liefer[te]n, Conglomerate aus viel Zivilrecht, etwas Strafrecht und Process und dazwischen das staatsrechtliche Rechtsinstitut des Befehls“.8 Vielmehr gelte es, ein System von eigentümlichen Rechtsinstituten der staatlichen Verwaltung zu entwickeln. Zu diesem Zweck müsse die „besondere Kraft des Staatswillens“ als die „einheitliche Grundlage“ [scil.: das „dem Verwaltungsrecht eigenartige Rechtsprinzip“, wie Laband es genannt hatte] aufgefaßt werden, deren ein „selbständiger Zweig der Rechtswissenschaft“ bedürfe.9 Die Vorstellung, daß das Verwaltungsrecht ein „System eigenthümlicher Rechtsinstitute der staatlichen Verwaltung“ sein müsse, korreliert dabei mit der Ansicht, daß das öffentliche Recht eine gegenüber dem Zivilrecht eigene „Rechtsart“ darstellt.10 Das öffentliche Recht ist für Otto Mayer vom privaten Recht „scharf“ geschieden.11 Nicht nur bezeichnen öffentliches und privates Recht einander ausschließende Eigenschaften von Rechtsnormen; auch das Rechtshandeln folgt zwingend dieser Dichotomie. „Es gibt keine dem öffentlichen und Privatrecht g e m e i n s a m e n R e c h t s i n s t i t u t e .“12 Denn die Rechtsgebiete werden beherrscht von diametralen Prinzipien. Die Verwaltungsrechtswissenschaft stellt den Begriff des öffentlichen Rechts auf die Erscheinung der öffentlichen Gewalt mit ihrer einseitig bindenden Kraft.13 Die Zivilrechtswissenschaft hingegen, die am „Zivilrecht die Grenzen der rechtlichen Willensmacht der Einzelnen gegeneinander“ untersucht, findet ihren Grundbegriff im subjektiven Recht.14 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (3 ff.). Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 14 Fn. 3; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 14 Fn. 3. 9 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (86). Hervorhebung nicht im Original. 10 Vgl. Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 15; Deutsches Verwaltungsrecht 3 I (1924), S. 14: „Das also abgegrenzte Verwaltungsrecht ist zu keinem Teile etwa nur ein besonders gestaltetes Zivilrecht, von dem gewöhnlich geltenden nur durch gewisse Abweichungen ausgezeichnet. Sondern es ist diesem gegenüber eine andere R e c h t s a r t : es gehört dem ö f f e n t l i c h e n R e c h t e an.“ Hervorhebung im Original. 11 Vgl. Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 53, 136 f.; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 56, 249 Fn. 1; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 55, 239 Fn. 1. Daß Otto Mayer kein Kriterium zu nennen weiß, mit dem sich im Einzelfall die Rechtsgebiete trennscharf voneinander scheiden lassen, wurde bereits im 1. Kapitel unter B. erörtert. 12 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 120; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 117. Hervorhebung im Original. 13 Vgl. Rez. Apelt, AöR 40 (1921), S. 244 (245). Vgl. auch: Neues vom öffentlichen Eigentum, AöR 39 (1920), S. 77 (94): „Und ein anderes brauchbares Merkmal des öffentlichen Rechts als das der Erscheinung der öffentlichen Gewalt wird auch nicht wohl zu finden sein.“ 8
B. Die Gründe der Forderung nach einem eigentümlichen Verwaltungsrecht 33
Infolgedessen sind alle ihre Rechtsinstitute Arten subjektiver Rechte,15 und damit gebaut auf dem Boden der Gleichheit der Rechtssubjekte.16 Der Vertrag ist ein dem Zivilrecht angehörendes Rechtsinstitut.17 Deshalb setzt er die Übereinstimmung zweier gleichberechtigter Willenserklärungen voraus. Im öffentlichen Recht, das infolge der hier herrschenden einseitig bindenden Kraft des Staatswillens durch die Ungleichheit der Rechtssubjekte charakterisiert ist, ist er „undenkbar“.
B. Die Gründe der Forderung nach einem eigentümlichen Verwaltungsrecht Es erhebt sich die Frage, wodurch Otto Mayer zu der Auffassung gelangt, daß öffentliches und privates Recht durch voneinander entgegengesetzten Prinzipien beherrscht werden und das Verwaltungsrecht demnach ein System von „eigenthümlichen Rechtsinstituten der staatlichen Verwaltung“ zu sein hat. Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 135; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 116; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 113. 15 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 135; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 116; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 113. Vgl. auch: Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 21: „Die Rechtsinstitute des Civilrechts haben zum Mittelpunkte das subjektive Recht, die Befugniss, welche für das einzelne Rechtssubjekt erworben, ausgeübt, verloren wird. Ein derartiges System von Befugnissen vermag die Verwaltungsrechtswissenschaft aus ihrem Gegenstande nicht zu bilden; [. . .]. Der Staat, in diesen Verhältnissen, erwirbt und verliert nicht Befugnisse, sondern übt nur die eine grosse Befugniss aus, die er als gesetzgebende und vollziehende Gewalt aus dem Verfassungsrecht mitbringt: die hoheitliche Macht über die Einzelnen.“ 16 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 136 f.: „Der Umstand, dass in dem zu ordnenden Verhältnis die öffentliche Gewalt beteiligt ist mit ihrem rechtlich überwiegenden, das andere Subjekt einseitig bestimmenden Willen, wird massgebend für die Gestalt des Rechtsinstitutes in allen Einzelheiten und scheidet es scharf von den auf dem Boden der Gleichheit der Rechtssubjekte gebauten Rechtsinstituten des Civilrechts“. Vgl. auch: Stand des öffentlichen Eigentums, AöR 21 (1907), S. 499 (501): „Wir unterscheiden ein solches [scil.: öffentlich-rechtliches Rechtsinstitut] von seinen zivilrechtlichen Seitenstücken dadurch, dass es gebaut ist auf der Grundlage der Ungleichheit der beteiligten Rechtssubjekte, des Staates und des Untertan.“ Vgl. zudem: Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 73; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 40: „Ein öffentlichrechtliches Rechtsinstitut wird dadurch erkennbar, daß alle seine Einzelheiten nach den Gesichtspunkten der Beteiligung der öffentlichen Gewalt und der Ungleichheit der Rechtssubjekte sich gestalten müssen.“ 17 Das sagt so Otto Mayer nicht. Gleichwohl ging die Rechtswissenschaft seiner Zeit gemeinhin davon aus, vgl. Buddeberg, AöR 47 (1925), S. 85 (99). 14
34
2. Kapitel: Die Grundlagen der Vertragsdogmatik Otto Mayers
Eine Antwort auf diese Frage könnte in der Idee des Rechtsstaates liegen.18 Denn neben der Idee des Verfassungsstaates ist es vor allem die Idee des Rechtsstaates, die Otto Mayer als Argument gegen die Vorstellung ins Felde führt, derzufolge es sich, wie Paul Laband es ausdrückte, bislang im Bereich des Verwaltungsrechts nur darum handelte, „Conglomerate zu machen aus den Begriffen und Formen, welche die anderen wahren rechtswissenschaftlichen Disziplinen“, vor allem das Zivilrecht, „fertig liefern“. I. „Polizeistaat“ und „Rechtsstaat“ Welcher Lehre die soeben erwähnte Vorstellung erwächst, zeigt eine Äußerung, in der Otto Mayer viele Jahre nach Erscheinen seiner Lehre vom „öffentlichrechtlichen Vertrage“ zu der dieser gegenüber ablehnenden Auffassung Paul Labands wie folgt Stellung bezieht: „Er selbst war nämlich noch stark in altpreußischer Betrachtungsweise befangen und suchte sich, wie die meisten damals, den Stoff des Verwaltungsrechts überall, wo etwas Vermögensrechtliches herausschaute, in privatrechtlichem Sinn zurechtzulegen, wenn er auch mit der Titulatur ,öffentlichrechtlich‘ nicht kargte. Es galt, diese Phalanx zu brechen, um für andere Anschauungen Raum zu schaffen.“19 Die „altpreußische Betrachtungsweise“, die Otto Mayer hier anspricht, meint die in der Zeit des Polizeistaates entwickelte sogenannte „Fiskustheorie“. Sie ist es, mit deren Hilfe Otto Mayers Meinung zufolge das Zivilrecht vielfältig auf den Staat zur Anwendung gebracht und infolgedessen die Entwicklung eines selbständigen Verwaltungsrechts behindert wurde. So schreibt er, daß die Verwaltungsrechtswissenschaft als eine junge Wissenschaft ihre Rechtsinstitute nur habe herausarbeiten können „in beständigem Kampfe“ mit der eigenen Vergangenheit, der „Rechtsanschauung des Polizeistaates“, diesem „grossen Gegner“,20 sowie, daß die „Entwicklung des deutschen Rechts [. . .] wesentlich auf Zurückdrängung zivilrechtlicher Anschauungen“ hinausgelaufen sei.21 18
So wohl: Fioravanti, RHistJ 4 (1985), S. 89 (91 f., 93). Selbstdarstellung (1924), S. 11. Vgl. auch: Anmerkung zu PrOVG v. 10. 11. 1921, JW 51 (1922), S. 610 (610): „Bei dem führenden Mann, Laband, [. . .]“, dessen „Staatsdienstverhältnis [. . .] ja geradewegs auf einen Vertrag gegründet sein [sollte], der nach allen Regeln des Zivilrechts gestaltet war; es kam also nun darauf an, ihm doch irgendwie eine öffentlich-rechtliche Farbe zu geben, oder wenigstens eine nicht ganz so zivilrechtliche.“ 20 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 135; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 117; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 114. Vgl. auch: Völkerrecht und Völkermoral, AöR 38 (1918), S. 1 (16 Fn. 24): „Der Befreiungskampf gegenüber den alles beherrschenden privatrechtlichen Anschauungen war vor allem auf dem Boden des Verwaltungsrechts zu führen.“ 21 Neues vom öffentlichen Eigentum, AöR 39 (1920), S. 77 (94 f.). 19
B. Die Gründe der Forderung nach einem eigentümlichen Verwaltungsrecht 35
Gegen die Fiskustheorie und die ihr anhängende „konservative Rechtswissenschaft, welche das Gebiet der eigenthümlichen Formen des öffentlichen Rechts auf einen möglichst kleinen Spielraum beschränkt“,22 streitet Otto Mayer daher von Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn an.23 Sie sei ein „Gespenst“, an das niemand mehr glauben wolle.24 Entstanden sei sie aus dem „Widerstreit zweier mächtiger Ideen, der seinen Ausgleich“ habe finden sollen: „der Idee des allgewaltigen Staates, die sich eben erst durch Zerstörung der Grenzen der Hoheitsrechte bewährt“ habe, „und der Idee des Rechts [. . .]“, welche „die einzig ihr [damals] zu Gebote stehende Form für Recht und Rechtsordnung“, nämlich das Zivilrecht,25 „möglichst weit vorwärts“ habe tragen wollen „in die Lebensbeziehungen zwischen Staat und Untertan hinein“. Da der allgewaltige Staat, wo er als solcher handelte, nicht dem [Zivil]recht habe unterstehen können, habe „die Lösung der Polizeistaat in jener eigentümlichen Lehre vom Fiskus gefunden“. Diese habe in dem Staat noch eine zweite Persönlichkeit erblickt, in welcher der Staat als der gewöhnliche Privatmann aufgetreten sei, und folglich in den Formen des Zivilrechts gehandelt habe: den Fiskus als selbständige juristische Person des Privatrechts.26 Es sei nun freilich nichts leichter, als die Grundidee, auf welcher die Fiskuslehre beruhe, von „unserem heutigen Standpunkte aus wissenschaftlich 22 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (59). Die Fiskustheorie und die ihr anhängende Lehre habe seiner Lehre vom öffentlich-rechtlichen Vertrag entgegengestanden, Selbstdarstellung (1924), S. 11. Vgl. auch: Stand des öffentlichen Eigentums, AöR 21 (1907), S. 499 (499): „Vor zwanzig Jahren, als meinem Versuch, die Mannigfaltigkeit des Verwaltungsrechts darzulegen, der ,machtvolle einheitliche Begriff des Befehls‘ in den Weg gestellt werden sollte, mussten mir die contrats administratifs und die pacta censoria zu Hilfe kommen, beides obrigkeitliche Verfügungen und doch ob ihrer äusseren Vertragsgestalt von der starren Form des Befehls so weit entfernt als möglich.“ Vgl. auch: Anmerkung zu PrOVG v. 10. 11. 1921, JW 51 (1922), S. 610 (610). 23 Vgl. etwa: Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (57); Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 46 ff., 132 f., 141 ff.; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 47 ff., 118 ff.; Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 386 ff.; Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 513 Fn. 32, 581 ff.; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 294 f. Fn. 23, 327 ff.; Eisenbahn I, AöR 15 (1900), S. 511 (519); Eisenbahn II, AöR 16 (1901), S. 38 (49 ff.); Justiz (1902), S. 20; Stand des öffentlichen Eigentums, AöR 21 (1907), S. 499 (514 ff.); Haftung, SächsArchR 8 (1913), S. 1 (2, 4); Rez. Lassar, JW 51 (1922), S. 76 (76); Selbstdarstellung (1924), S. 11 f. 24 Selbstdarstellung (1924), S. 12. 25 Vgl. Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 135; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 117; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 114: „Der Polizeistaat kannte natürlich kein Verwaltungsrechtsinstitut. Außerhalb des Civilrechts herrscht die Allgewalt der Behörden. Der Wille der Obrigkeit ist einfach Befehl; weiter zu unterscheiden hat keinen Zweck.“ 26 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 47 ff.; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 50 ff.; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 48 ff.
36
2. Kapitel: Die Grundlagen der Vertragsdogmatik Otto Mayers
zu bekämpfen“.27 Denn der zu Zeiten des Polizeistaates geltende Satz: „das öffentliche Recht ist kein Recht“,28 habe keine Gültigkeit mehr: „Wir haben vor uns die Thatsache eines wirklichen öffentlichen Verwaltungsrechts, welches gleichwertig dem daneben noch auf die Verwaltung Anwendung findenden Civilrechte gegenübersteht.“29 Die Voraussetzung hierfür habe der Verfassungsstaat geschaffen. Hierunter versteht Otto Mayer einen Staat, in dem „einer Volksvertretung Anteil“ gegeben ist an „der Staatsgewalt durch Mitwirkung bei der Gesetzgebung“, in dem also – infolgedessen – die Gewalten getrennt sind.30 Der Grundsatz der Gewaltenteilung schließlich habe die Bindung der Verwaltung an das Gesetz und damit ein Verwaltungsrecht erst ermöglicht: „Nun läßt sich aber die Erkenntnis nicht abweisen, dass auch im Gesetze nichts anderes wirkt als wiederum der Staat, dessen Wille darin erscheint. So gelangt man dazu, die Wirkung des Gesetzes zu erklären als eine S e l b s t b i n d u n g d e s S t a a t e s . In dieser Weise einfach hingestellt, ist die Selbstbindung des Staates ein geheimnisvoller Vorgang, den man glauben soll, aber nicht verstehen kann. Innerhalb eines einheitlich gedachten Wesens kann ein sich Gegenüberstehen in rechtlichen Beziehungen, wie die Gebundenheit sie bedeuten würde, gar nicht gedacht werden.“31 Daher sei „jene Selbstbindung des Staates [. . .] nur eine verkehrte Ausdrucksweise. Die Theorie findet das richtige Wort nicht, weil ihr das Verständnis der Trennung der Gewalten fehlt, auf der unsere ganze Ordnung des öffentlichen Rechts beruht. Es ist thatsächlich mit der Selbstbindung des Staates nicht so unbedingt gemeint, wie es lautet. [. . .] Gebunden soll sein aller auf irgend welche andere Weise [scil.: als in Form des Gesetzes] erscheinender Staatswille“.32 Als Ursache dafür, daß der im Gesetz erscheinende Staatswille allen in anderer Weise erscheinenden Staatswillen binden könne, gibt Otto Mayer an, daß jener von unterschiedlicher „rechtlicher Eigenschaft“, von stärkerer „Kraft“ sei.33 Diese stärkere Kraft beruhe darauf, daß „durch die AnteilDeutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 52; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 55; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 53. 28 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 45; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 47. 29 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 54. 30 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 1 f.; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 1 f., 57; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 1 f., 55. Vgl. auch: Staatsrecht (1909), S. 186: „Denn auf der Besonderheit des Rechtssatzes und auf seiner eigentümlichen Zusammengehörigkeit mit dem verfassungsmäßigen Gesetze beruht wesentlich der ganze Haushalt des öffentlichen Rechtes unserer Zeit.“ 31 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 86. Hervorhebung im Original. 32 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 87. 33 Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 5 f. 27
B. Die Gründe der Forderung nach einem eigentümlichen Verwaltungsrecht 37
nahme des Volkes“ bei der Gesetzgebung der auf „solche Weise geäußerte Staatswille“ als „unschädlich gemacht“ gelte.34 Ist somit der Verfassungsstaat für Otto Mayer der Grund dafür, daß die These des Polizeistaates, der Staat als solcher könne rechtlich nicht gebunden werden, ihre Widerlegung erfahren hat, ist er für ihn gleichwohl nur die „Voraussetzung“ einer Existenz des öffentlichen Rechts der Verwaltung.35 Die „Forderung“, daß von dem durch die Verfassung bereitgestellten „Mittel des Rechtssätze liefernden Gesetzes“ ein „reichlicher Gebrauch gemacht“ werde, entstamme vielmehr der Idee des Rechtsstaates.36 Sie erst 34
Finanzwirtschaft, in: Gerloff/Meisel (Hrsg.), HdBFinanzWiss 1 (1926), S. 86
(87). Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 1 f.; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 1 f., 57; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 1 f., 55. Daß Otto Mayer eine Bindung der Verwaltung an das Gesetz aus dem Prinzip der Gewaltenteilung herleitet, und daß er zudem in der Begründung der Grundsätze vom Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, mithin in der „Sicherung der Freiheit der Staatsuntertanen“ [Rez. Laun, AöR 25 (1909), S. 485 (485).] den Zweck des Verwaltungsrechts sieht, demzufolge der Frage nach dem Zustandekommen und Inhalt der die Verwaltung bindenden Gesetze eine eher untergeordnete Bedeutung beimißt [Remmert, Übermaßverbot, S. 170.], erklärt den vielleicht berühmtesten Ausspruch Otto Mayers: „,Verfassungsrecht vergeht, Verwaltungsrecht besteht‘;“ [Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), Vorwort.]. Denn nach der Auffassung Otto Mayers ist das Prinzip der Gewaltenteilung allen Verfassungen immanent. So ist zu lesen [Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 57.]: „Die konstitutionelle Monarchie erfüllt diese Forderung durch die mit einem Anteil an der gesetzgebenden Gewalt ausgestattete Volksvertretung, während die vollziehende Gewalt dem Fürsten verblieb [. . .]. In der Republik geht zwar alle Gewalt vom Volk oder seiner Vertreterversammlung aus; aber die lebendige, immer und überall gegenwärtige Handhabung der vollziehenden Gewalt muß es jener besonderen Trägerschaft der laufenden Staatsgeschäfte überlassen, an deren Spitze die Regierung steht [. . .]. Auch hier also läßt sich die Grundidee durchführen.“ Im Anschluß an den berühmten Satz schreibt Otto Mayer überdies, daß man den in der Vergänglichkeit liegenden Unterschied zwischen Verfassungs- und Verwaltungsrecht „anderwärts schon längst beobachtet“ habe. Gemeint ist Frankreich. In seiner „Theorie des Französischen Verwaltungsrechts“ von 1886 äußert denn auch Otto Mayer [ebd., S. 2 f.]: „Darauf beruht die grosse Bedeutung der Trennung der Gewalten für das französische Staatswesen. Alle Umwälzungen seit 1789 betrafen nur die Gewaltträger selbst und ihr gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Dagegen hält jede Verfassung thatsächlich fest an der Form der zwei nach dem obigen Merkmal unterscheidbaren Funktionen, durch welche die Thätigkeit der Gewaltträger hindurch geht, und der Inhalt der Machtvertheilung zwischen diesen Funktionen bleibt im Wesentlichen der alte. Das genügt, um die K o n t i n u i t ä t zu wahren in der Wirksamkeit der Staatsgewalt.“ Hervorhebung im Original. Sodann heißt es [ebd., S. 3 Fn. 6.]: „Vom französischen Standpunkt aus ist es ein ganz natürlicher Gegensatz, dass Verfassungsrecht wechselt, Verwaltungsrecht dauert; man sieht dieses survivre à l’effrondrement successif des lois constitutionelles; Ducroq u. 4.“ Hervorhebung im Original. 36 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 59 f.; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 58. Ähnlich: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 62 f. 35
38
2. Kapitel: Die Grundlagen der Vertragsdogmatik Otto Mayers
verlange, daß die Verwaltung der Justiz angeglichen werde, indem sie wie diese sowohl „die Beherrschtheit durch den gesetzlichen Rechtssatz“ als auch eine dem Urteil vergleichbare Einrichtung aufweise, nämlich eine Einrichtung, die wie das Gesetz eine Rechtsgewähr für den einzelnen sei, weil sie für den Einzelfall ausspreche, was ihm Rechtens sein soll: den Verwaltungsakt.37 Denn ein „Staat, der für seine Verwaltung kein Gesetz hat und keinen Verwaltungsakt“, sei „kein Rechtsstaat“.38 Erst mit der „Entwicklung des Rechtsstaates“ werde es überdies „bedeutsam, festzustellen, was gewollt werden konnte, was dadurch rechtlich gewirkt ist, was aufgrund davon weiter geschehen kann. Das Rechtsbewußtsein“ werde „empfindlich für alle weiteren Unterscheidungen. Der obrigkeitliche Befehl“ werde „ein bestimmt umgrenztes Rechtsinstitut, in sich wieder nach Arten zerlegt, und“ erhalte „an seine Seite gestellt verschiedenartige Formen obrigkeitlicher Einwirkungen, die in ihrer rechtlichen Besonderheit den Reichtum der Erscheinungen der öffentlichen Gewalt entfalten. Andererseits“ [!] falle „jetzt auch [. . .] hinweg [. . .] die große Ausdehnung des Civilrechts.“39 Es ändere „sich von selbst [!] auch der grundsätzliche Standpunkt für die A b g r e n z u n g d e s U m f a n g s , i n w e l c h e m C i v i l r e c h t a u f d e n S t a a t z u r A n w e n d u n g g e l a n g t . Das Civilrecht ist nicht mehr das alleinige und selbstverständliche Recht, das nur da nicht gilt, wo der Staat mit seiner Befehls- und Zwangsgewalt es durchbricht und sich dadurch als der über allem Recht Stehende zu erkennen gibt. Im Gegenteil, das ihm eigentümliche öffentliche Recht ist für den Staat das natürliche, im Zweifel anzuwendende. Es bedarf einer besonderen Begründung, wenn er dem Civilrecht unterliegen soll.“40 Kennzeichen eines Rechtsstaates im Sinne von Otto Mayer ist mithin die Existenz eines Verwaltungsrechts. Gleichwohl ist die Idee des Rechtsstaates, wie der folgende Abschnitt zeigt, nicht der Grund für die Existenz eines spezifischen Rechts der Verwaltung, mithin keineswegs die Antwort auf die zu Beginn des zweiten Abschnittes41 aufgeworfene Frage.
37 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 62 f., 64 f.; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 59 f., 62 f.; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 58 f., 61 f. 38 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 66. 39 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 135; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 117; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 114. 40 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 54. Hervorhebung im Original. 41 Vgl. unter B. im ersten Absatz.
B. Die Gründe der Forderung nach einem eigentümlichen Verwaltungsrecht 39
II. „Rechtsstaat“ und „moderne Staatsidee“ Der oben42 begründeten Annahme, daß es möglicherweise die Idee des Rechtsstaates ist, derentwegen Otto Mayer zu der Auffassung gelangt, daß öffentliches und privates Recht durch einander entgegengesetzte Prinzipien beherrscht werden und das Verwaltungsrecht demnach ein System von eigentümlichen Rechtsinstituten der staatlichen Verwaltung sein muß, widerspricht namentlich die folgende Aussage, in der es heißt: „Wenn aber etwas [scil.: in Deutschland] zur Nachahmung empfohlen werden könnte, so wäre es viel mehr noch der Geist des Ganzen, jener grossartige Zug von Achtung vor der hoheitlichen Natur der Thätigkeit des Staates, der in der kräftigen Ausbildung jenes Rechts sich bezeugt. Bei uns überwiegt von jeher die Neigung, den Staat im Verhältnis zu seinen Bürgern einfach wie ein Rechtssubjekt des Civilrechts zu behandeln. [. . .] Es ist aber nicht gleichgültig, wie ein Volk durch die täglich wirkende Rechtsordnung gelehrt wird, seinen Staat zu betrachten. Das lebhafte Staatsbewusstsein, um welches wir noch unsere Nachbarn beneiden können, ist ebensogut ein Erzeugnis als eine Ursache ihres Verwaltungsrechts.“43 An anderer Stelle ist zu lesen, daß für eine Darstellung des allgemeinen Verwaltungsrechts der „lebendige[] Staat mit seinem eignen Wollen und Handeln mehr in den Mittelpunkt“ gerückt werden müsse, da einem „Verwaltungsrecht ohne Staat [. . .] sein erstes und vornehmstes Rechtssubjekt“ fehle.44 Überdies schreibt Otto Mayer, es gelte von der öffentlichen Verwaltung der Satz, „dass das öffentliche Recht für den Staat das natürliche“, also seiner Natur entsprechende sei, „für dessen Anwendbarkeit die V e r m u t u n g “ streite.45 Zudem müsse das „Gewand der Rechtsordnung“, ohne das der „Staat [. . .] auch in der Verwaltung nicht mehr [. . .]“ sein 42
Vgl. unter B. im zweiten Absatz. Französisches Verwaltungsrecht (1886), Vorwort S. VIII f. Hervorhebung nicht im Original. Vgl. auch: Entschädigungspflicht (1904), S. 26: „Denn es ist keineswegs gleichgültig, in welcher Rolle der Staat dem Volke tagtäglich dargestellt wird, das ihn mit Ehrfurcht betrachten soll.“ 44 Rez. Bernatzik, AöR 1 (1886), S. 720 (725). 45 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 141. Nur die Hervorhebung durch Kursivschrift findet sich nicht im Original. Vgl. bereits: Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 153 f.: „Von Natur handelt der Staat dem Unterthanen gegenüber immer hoheitlich und nur in der Weise des Verwaltungsrechts bestimmt.“ Vgl. auch: Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (81): „Auf dem Gebiete des öffentlichen Rechtes, wo seine eigene Natur zu Tage tritt, kann der Staat [. . .].“ Siehe auch: Haftung, SächsArchR 8 (1913), S. 1 (5): Der Staat könne, „seine Natur verleugnend, sich herunterbegeben [. . .] zum gewöhnlichen Privatmann, um wie ein solcher und in privatwirtschaftlicher Weise seine Geschäfte zu besorgen.“ 43
40
2. Kapitel: Die Grundlagen der Vertragsdogmatik Otto Mayers
könne, „passend“ sein, „die Bewegungen nicht hemmen noch verrenken, sondern sich ihnen harmonisch anschliessen und sie mit schönem Masse umgeben“.46 Ist es demnach ein bestimmter Begriff vom Staate, der aus der Sicht Otto Mayers nach der Entwicklung eines Systems eigentümlicher Rechtsinstitute der staatlichen Verwaltung verlangt, käme der Idee des Rechtsstaates nur dann die Bedeutung zu, für die Vorstellung von einem eigenständigen Verwaltungsrecht verantwortlich zu zeichnen, besäße sie für Otto Mayer Einfluß auf diesen Begriff vom Staate. Daß dies jedoch nicht der Fall ist, wird offenkundig bereits daran, daß Otto Mayer zwischen der „Idee des Rechtsstaates“47 und der – „neuzeitlichen“ 48 – „Staatsidee“ trennt,49 und im Zusammenhang mit der Existenz eines eigenständigen Verwaltungsrechts ausschließlich von der modernen „Staatsidee“ spricht.50 Darüber hinaus versteht Otto Mayer – anders als die Lehre zu früheren Zeiten51 – unter einem „Rechtsstaat“52 nicht einen Vernunft- oder Verstandesstaat und infolgedessen auch nicht eine eigene Staatsgattung. Vielmehr 46
Justiz (1902), S. 25. Vgl. Rechtskraft, AöR 21 (1907), S. 1 (39 Fn. 56). 48 Vgl. Staatsrecht (1909), S. 11. 49 Siehe etwa: Rechtsstudium, DJZ 5 (1900), S. 282; Eisenbahn II, AöR 16 (1901), S. 38 (49); Justiz (1902), S. 19. Vgl. insoweit auch: Hueber, Methode, S. 48 ff., 64 ff. 50 Vgl. etwa: Rez. Bernatzik, AöR 1 (1886), S. 720 (725): „Der Verfasser kommt öfters auf den zu schreibenden allgemeinen Theil des Verwaltungsrechts zu sprechen; seine Arbeit ist dazu angethan, dass wir uns freuen könnten, wenn eine so tüchtige Kraft, wie er, denselben liefern wollte. Aber dann wird er wohl den lebendigen Staat mit seinem eignen Wollen und Handeln mehr in den Mittelpunkt rücken müssen. Einem Verwaltungsrecht ohne Staat fehlt sein erstes und vornehmstes Rechtssubjekt.“ In: Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (45), heißt es: „Die gleiche staatsrechtliche Grundlage erzeugte selbständig hier wie dort [scil.: bei den Römern und Franzosen] die gleichen Erscheinungen. Kaum ist bei uns die Staatsidee kräftig geworden, so wiederholt sich bei uns das Bild.“ Vgl. auch: Stand des öffentlichen Eigentums, AöR 21 (1907), S. 499 (504 f.): „Als nach den dunklen Jahrhunderten endlich der m o d e r n e S t a a t bei uns sich ausbildete, hatten die Juristen das römische Zivilrecht rezipiert, für das römische Verwaltungsrecht fehlte jegliches Verständnis; hatte man ja doch den Schlüssel nicht, der allein es erschliessen konnte, den rechten Staatssinn.“ Hervorhebung im Original. Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 142: „Der Fiskus ist nicht mehr, was er in der polizeistaatlichen vorverfassungsrechtlichen Zeit war [. . .]. Es ist falsch, dies so auszudrücken, als wäre jetzt eine bessere wissenschaftliche Erkenntnis seiner Natur zum Durchbruch gekommen. In Wahrheit ist eine andere Auffassung unseres Staatswesens zum Durchbruch gekommen, der Staat ist anders geworden und der Begriff des Fiskus mit ihm.“ Siehe zudem: Justiz (1902), S. 19: „Denn nach der echten kräftigen Staatsidee [. . .] ist eben der Staat von Natur etwas ganz anderes wie ein gewöhnlicher Privatmann.“ 51 Vgl. dazu sowie allgemein zur Entwicklung des Begriffs „Rechtsstaat“: Böckenförde, in: FS Arndt, S. 53 ff. (bes. 54 ff.); Stolleis, in: Erler/Kaufmann 47
B. Die Gründe der Forderung nach einem eigentümlichen Verwaltungsrecht 41
begreift er den Rechtsstaat als ein „Schlagwort“, welches bedeute, daß „weitere Forderungen [. . .] erfüllt werden mußten, sollte nicht der alte Polizeistaat trotz der Verfassung fortbestehen. [. . .] Der Rechtsstaat soll, wie der Polizeistaat, die besondere Art kennzeichnen, wie der Staat tätig ist, und zwar besteht sein Gegensatz zu jenem darin, daß er seine Wirksamkeit überall ,in der Weise des Rechts bestimmt‘. [. . .] Der Rechtsstaat ist der Staat des wohlgeordneten V e r w a l t u n g s r e c h t s .“53 Daß der Begriff vom Rechtsstaat den Begriff vom Staate unbeeinflußt läßt, beide Begriffe vielmehr nebeneinander stehen, wird sichtbarer noch, wenn man sich die Definition des Rechtsstaates bei Friedrich Julius Stahl (1802–1861) vor Augen hält,54 an die Otto Mayer sich nachweislich anlehnt:55 „Der Staat soll Rechtsstaat seyn, das ist die Losung und ist auch in Wahrheit der Entwickelungstrieb der neueren Zeit. Er soll die Bahnen und Gränzen seiner Wirksamkeit wie die freie Sphäre seiner Bürger in der Weise des Rechts genau bestimmen und unverbrüchlich sichern [. . .]. Dieß ist der Begriff des Rechtsstaates, nicht etwa daß der Staat bloß die Rechtsordnung handhabe ohne administrative Zwecke, oder vollends bloß die Rechte der Einzelnen schütze, er bedeutet überhaupt nicht Ziel und Inhalt des Staates, sondern nur Art und Charakter, dieselben zu verwirklichen.“ Die Idee, der Begriff des Rechtsstaates bedeutet damit für Otto Mayer lediglich die Forderung an den Staat, im Bereich der Verwaltung unter der Herrschaft der Gesetze zu handeln und den Einzelfall durch Verwaltungsakt gegenüber dem Bürger rechtlich bindend zu regeln. Nicht jedoch postuliert die Rechtsstaatsidee, daß „wesentlicher Kern“56 aller Rechtsinstitute des Verwaltungsrechts eine Grundlage sein muß, die sie von den auf dem Boden der Gleichheit der Rechtssubjekte gebauten Rechtsinstituten des Zivilrechts scharf scheidet,57 indem sie auf einem Staatswillen aufbaut, der das (Hrsg.), HRG IV, Sp. 367 ff. (bes. 369); Scheuner, in: ders., Staatstheorie und Staatsrecht, S. 185 ff. 52 Der Begriff „Rechtsstaat“ ist eine dem deutschen Sprachraum eigentümliche Wortschöpfung, Scheuner, in: ders., Staatstheorie und Staatsrecht, S. 185 (185); Böckenförde, in: FS Arndt, S. 53 (54). 53 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 59 f.; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 58. Hervorhebung im Original. 54 Die Philosophie des Rechts II 25 (1870), S. 137 f. Hervorhebung nicht im Original. 55 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 62 mit Fn. 14; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 59 mit Fn. 7; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 58 mit Fn. 7. 56 Vgl. Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 160. 57 Siehe: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 136 f.; Stand des öffentlichen Eigentums, AöR 21 (1907), S. 499 (500 f.); Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 73; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 40.
42
2. Kapitel: Die Grundlagen der Vertragsdogmatik Otto Mayers
andere Subjekt einseitig bestimmt und bindet.58 Somit ist es nicht die Idee des Rechtsstaates, die Otto Mayer zu der Annahme bestimmt, das sich öffentliches und privates Recht aus diametralen Prinzipien ableiten, und das Verwaltungsrecht demnach ein System von eigentümlichen Rechtsinstituten der staatlichen Verwaltung sein muß, sondern ein von der Idee des Rechtsstaates unbeeinflußter Begriff vom Staate. Diesen Begriff näher zu erläutern, zählt demnach zu den Aufgaben dieser Arbeit. Bevor sich jedoch dieser Aufgabe zugewandt werden kann, gilt es, darauf aufmerksam zu machen, daß es nicht allein ein bestimmter Begriff vom Staate ist, der als Ursache dafür genannt werden muß, daß Otto Mayer das öffentliche und mit ihm auch das Verwaltungsrecht als eine gegenüber dem Zivilrecht spezifische Art von Recht betrachtet.
III. Das Vorbild anderer rechtswissenschaftlicher Disziplinen Wenn nämlich Otto Mayer in den zu Beginn dieses Kapitels zitierten Aussagen verlangt, daß die Verwaltungsrechtswissenschaft ein „System von eigenthümlichen Rechtsinstituten der staatlichen Verwaltung sein“ müsse, damit sie „als gleichberechtigte juristische Disciplin neben die älteren Schwestern treten“ könne,59 ist es auch das Vorbild der anderen Rechtsdisziplinen, das Otto Mayer dazu bewegt, das Verwaltungsrecht als eine eigene „Rechtsart“60 zu entwickeln. Aus weiteren Äußerungen ergibt sich zudem, daß es hierbei vor allem die Zivilrechtswissenschaft ist, der die Verwaltungsrechtswissenschaft sich anzugleichen hat. So fordert er, daß „das Vorbild der Privatrechtswissenschaft zu befolgen sei“,61 oder daß „die Lehre des Verwaltungsrechts [. . .] gerade so auf sich selbst stehen [müsse] wie die des Civilrechts“;62 schließlich sei doch „zivilrechtliche Lehre und Gedankenzucht [. . .] der Stolz alles echten Juristentums“.63 58 Vgl. Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (86): „Ich bin auch der Meinung, dass uns für die Beherrschung und Durchdringung dieses Stoffes die einheitliche Grundlage nicht fehlt, deren ein selbständiger Zweig der Rechtswissenschaft bedarf. Sie ist bereits gefunden in jener besonderen Kraft des Staatswillens [. . .]. Wie der öffentlichrechtliche Vertrag des Staatsdienstverhältnisses, so müssen sich alle unsere einzelnen Rechtsinstitute als Offenbarung dieser Kraft nachweisen lassen.“ 59 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (3). Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 21; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 20: „[. . .] mußte die Verwaltungsrechtswissenschaft darnach trachten, sich ebenbürtig den älteren Schwesterdisziplinen an die Seite zu stellen.“ 60 Vgl. Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 15; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 14. 61 Rez. Lassar, AöR 40 (1921), S. 382 (382). 62 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 20.
B. Die Gründe der Forderung nach einem eigentümlichen Verwaltungsrecht 43
Als vorbildlich betrachtet Otto Mayer die Zivilrechtswissenschaft insbesondere ob der Behandlung des Stoffes nach einer bestimmten Methode. Dies zeigen Bemerkungen Otto Mayers, in denen er davon spricht, daß „das öffentliche Recht [. . .] juristisch geradeso streng und methodisch behandelt werden [müsse] wie das Civilrecht“64, daß er selbst „die der Civilrechtswissenschaft entlehnte Methode einseitig betont habe“, weil sie ihm in der Verwaltungsrechtswissenschaft „allzu sehr zurückgesetzt schien“.65 Zum Ausdruck gelangt dies auch, wenn Otto Mayer schreibt, die Verwaltungsrechtswissenschaft habe „[. . .] durch systematische Entwicklung und Zusammenordnung ihres ganzen Gehaltes an eigenartigen Rechtsideen [. . .] darnach trachten [müssen], sich ebenbürtig den älteren Schwesterdisziplinen an die Seite zu stellen.“66 Anderen Ausführungen läßt sich entnehmen, daß Otto Mayer die Behandlung des Verwaltungsrechts nach dem Vorbild der „,zivilistischen‘ Methode“67 begehrt, um das Verwaltungsrecht an Stoff zu bereichern und so als ein eigenständiges Rechtsgebiet entwickeln zu können. „Die Civilrechtswissenschaft“, schreibt er etwa, „ist dadurch so reich und anziehend geworden, dass sie sich nicht scheute, die grossen Rechtsideen in die kleinsten Einzelheiten des praktischen Lebens zu verfolgen. Die Wissenschaft des öffentlichen Rechts wird sich in derselben Weise ausbilden.“68 Und an anderer Stelle sagt er: „Das macht ja den Wert der Selbständigkeit der Disciplinen aus, dass jede auf diese Weise geführt ist von einem bestimmten einheitlichen Geiste, in welchem sie ihre Rechtserscheinungen betrachtet.“69
63
Rez. Zitelmann, AöR 39 (1920), S. 103 (104). Vgl. auch: Völkerrecht und Völkermoral, AöR 38 (1918), S. 1 (15): „[. . .] sondern der einer ganz bestimmten R e c h t s a r t , der vornehmsten und wichtigsten freilich, an der alles juristische Denken sich gebildet hat [. . .]: des b ü r g e r l i c h e n R e c h t s nämlich.“ Hervorhebung im Original. Ähnlich: Rez. Eckert, JW 48 (1919), S. 486 (486). 64 Justiz (1902), S. 25. 65 Rez. Seydel, AöR 12 (1897), S. 493 (496). 66 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 21; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 20. Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 18 ff. mit Fn. 8; Rez. Sartorius, AöR 18 (1903), S. 278 (279). Rez. v. Strauss und Torney, AöR 21 (1907), S. 445 (446): „Und tatsächlich steht es doch eben so, dass der rechtswissenschaftliche Gehalt desto deutlicher und einleuchtender erkennbar zu machen ist, je näher seine Ordnungen jeweils dem Zivilrecht verwandt sind, das die angestammte Heimat aller Rechtswissenschaften ist und bleibt.“; Rez. Rosin, ZgesHandR 43 (1895), S. 448 (451): „Die Wissenschaft des Verwaltungsrechts [. . .] will ihre allgemeinen Rechtsformen und Rechtsinstitute ausbilden, geradeso wie die älteren Schwestern aus der rechtswissenschaftlichen Familie sie haben.“ 67 Rez. Spiegel, AöR 25 (1909), S. 489 (489). 68 Eisenbahn I, AöR 15 (1900), S. 511 (511). 69 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 18.
44
2. Kapitel: Die Grundlagen der Vertragsdogmatik Otto Mayers
IV. Das Vorbild der Verwaltungsrechtswissenschaft in Frankreich Neben einer bestimmten Vorstellung vom Begriff des Staates und von Methode im Recht gereicht Otto Mayer aber auch das französische Verwaltungsrecht als Anlaß, das deutsche Recht der Verwaltung als ein eigentümliches, selbständiges Rechtsgebiet entstehen zu lassen. Denn im französischen Verwaltungsrecht sieht Otto Mayer seine Vorstellung von einer autarken Rechtsdisziplin verwirklicht,70 wenn er berichtet, es sei ihm bei der Bearbeitung des deutschen Verwaltungsrechts „von Nutzen“ gewesen, „durch die Schule der französischen Rechtswissenschaft gegangen“ zu sein.71 Otto Mayer gleicht daher das deutsche Verwaltungsrecht in einigen wesentlichen Punkten dem französischen an. Diese Angleichung rechtfertigt er mit dem Argument, daß „die allgemeinen Ideen des öffentlichen Rechts [. . .] unseren Kulturstaaten gemeinsam“ seien:72 „Der geistige Zusammen70 Vgl. Rez. Block, VerwArch 14 (1906), S. 28 (29): „In Frankreich ist alles viel einheitlicher und ausgeglichener; das Verwaltungsrecht ist älter, und die Menschen haben weniger Individualitätsbedürfnis. Kommt dann noch der richtige ,directeur‘ [. . .], so entsteht ein festes einheitliches Ganzes, ein wohl gezeichnetes, abgerundetes Bild des geltenden französischen Verwaltungsrechts.“ Vgl. auch: Civilproceß, ZfranzCivilR 9 (1878), S. 331 ff., 478 ff. (481). 71 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), Vorwort S. VIII f. Von einer französischstämmigen Großmutter mütterlicherseits, einer geborenen Dupré, erlernt Otto Mayer die französische Sprache [Selbstdarstellung, S. 1, 15.]. Noch vor dem 2. Staatsexamen im Jahre 1871 hat er den code civil durchgearbeitet. Als er im Juni 1871 in die Kölner Praxis seines Patenonkels Eduard Mayer, eines Vetters seines Vaters, eintritt, wird er von diesem in die Praxis des französischen Rechts eingeführt [Selbstdarstellung (1924), S. 5.]. Im November 1871 geht Otto Mayer nach Straßburg, um dort als Advokat zu arbeiten. Später übersiedelt er nach Mühlhausen im Elsaß [Selbstdarstellung (1924), S. 6.], wo er der ständige Berater aller Landesund Reichsbehörden wird, und so Einblick bekommt in das französische Verwaltungsrecht, welches sich hier noch in Geltung befindet [Curriculum, DJZ 14 (1909), Sp. 1042 (Sp. 1043).] Von einer Reise nach Paris im Jahre 1873 bringt sich Otto Mayer ein Exemplar von Dufour, Droit administratif, mit, das ihm im Quartier latin begegnet war, um es zu studieren, [Curriculum, DJZ 14 (1909), Sp. 1042 (Sp. 1043); Selbstdarstellung (1924), S. 9 f.]. Zwischen 1878 und 1881 wendet sich Mayer der Behandlung von Problemen des französischen Zivilrechts zu: „Der neue Civilprozeß und die Untheilbarkeit des Geständnisses“ (1878), „Die dingliche Wirkung der Obligation“ (1879), „Die concurence dèloyale“ (1881), [Selbstdarstellung (1924), S. 9.]. 1880 siedelt Mayer wieder nach Straßburg über und habilitiert sich. Seine Venia geht auf Französisches Zivilrecht und Internationales Privatrecht, [Selbstdarstellung (1924), S. 9.]. 1886 veröffentlicht Mayer seine „Theorie des Französischen Verwaltungsrechts“. Vgl. zu dem Einfluß des französischen Rechts auf das Denken Otto Mayers auch: Hueber, Methode, S. 30 ff.; Heyen, Der Staat 19 (1980), S. 444 ff. 72 Eisenbahn I, AöR 15 (1900), S. 511 (515). Ähnlich auch: Finanzwirtschaft, in: Gerloff/Meisel (Hrsg.), HdBFinanzWiss 1 (1926), S. 86 (87). Schon in: Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (33), heißt es: „Es gibt keinen deutschnationalen Begriff von öffentlichem Recht, der sich durch einen mehr civilrechtlichen Charakter kennzeich-
B. Die Gründe der Forderung nach einem eigentümlichen Verwaltungsrecht 45
hang der europäischen Völkerfamilie zeigt sich vielleicht nirgends deutlicher als in der gemeinsamen Geschichte der Ideen des öffentlichen Rechts.“73 Besonders eng sei der Zusammenhang zwischen den beiden Kulturnationen Deutschland und Frankreich. Frankreich sei die „edle Nachbarnation“, mit der „wir Deutsche [. . .] durch die wichtigsten Bande gemeinsamer Kultur so eng verbunden“ sind,74 es sei die „Schwesternation“, „mit welcher das Schicksal uns nun einmal trotz alledem geistig zusammengebunden“ habe.75 Wenn Frankreich in der Entwicklung der Ideen des öffentlichen Rechts eine Vorreiterrolle einnehme, könnten daher die „Deutschen [. . .] unverkennbar mehr die Stelle des Nachahmers, des Empfangenden“ spielen,76 zumal es einstmals umgekehrt gewesen sei: „Wenn man lediglich auf den Austausch von Rechtsideen und Rechtsformen sehen will, so ist Frankreich gegenüber unserer Handelsbilanz sehr entschieden passiv. Am Anfang freilich steht in unserem Haben ein großer Posten von dem Eroberungszug des fränkischen Rechtes her. Aber von da sind wir die Empfangenden.“77 Die Angleichung des deutschen an das französische Verwaltungsrecht durch Otto Mayer darf freilich nicht zu der Annahme verleiten, als habe dieser in „blindem Nachahmungstrieb“78 gehandelt. Gerade davor warnt Otto Mayer mit der Begründung, daß auch das französische Recht in bestimmten Punkten einen „argen Formalismus“, eine „gewisse Starrheit“ bewahrt habe,79 und weil auch „die fremden Rechtsideen“, die, „getragen vom frischen Luftzug der Kulturgemeinschaft, reichlich und reichlicher auf unser Feld“ fielen, „teils neue Frucht“ brächten, teils aber auch „als fremdes Unkraut erstickend zwischen unserem eigenen Gewächs“ wucherten.80 Als Otto Mayer sich in seiner Orientierung an dem französischen Verwaltungsrecht einer mitunter harschen Kritik ausgesetzt sieht,81 wie etwa dem Vorwurf der „schnöden Ausländerei“,82 erwidert er, es sei „sehr irrig“ zu nete.“ Vgl. auch: Rez. Brie, AöR 5 (1890), S. 418 (420 f.); Rez. Werner, AöR 37 (1918), S. 126 (126); Rez. Ryffel, AöR 19 (1905), S. 420 (420). 73 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 55. 74 Portalis (1902), S. 20. 75 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 65. 76 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 55. 77 Rez. v. Meier, HistVjS 1 (1908), S. 258 (258). 78 Justiz (1902), S. 23. 79 Justiz (1902), S. 13, 14. 80 Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 (371 f.). 81 G. Jellinek, VerwArch 5 (1897), S. 304 (306); Schultzenstein, JW 44 (1915), S. 734 (735); Niemeyer, Niemeyers Zeitschrift 34 (1925), S. 493 (493). Die schärfste Kritik setzt indes erst nach dem Tode Otto Mayers ein. So behauptet Kaufmann [Otto Mayer, VerwArch 30 (1925), S. 377 (386).], man empfinde „bei der Lektüre von Otto Mayers Verwaltungsrecht auf jeder Seite, daß das deutsche Verwaltungs-
46
2. Kapitel: Die Grundlagen der Vertragsdogmatik Otto Mayers
glauben, er habe „die Gedankenbilder der einzelnen Rechtsinstitute so ganz einfach der französischen Rechtswissenschaft entnommen“. „Gerade was daran am meisten Widerspruch erfahren“ habe, sei „eignes Gewächs.“83
C. Zusammenfassung Otto Mayer ist von der Idee geleitet, das Verwaltungsrecht als ein „System von eigenthümlichen Rechtsinstituten der staatlichen Verwaltung“ zu entwickeln. Mit dieser Idee korreliert die Vorstellung, daß das öffentliche gegenüber dem privaten Recht eine eigene „Rechtsart“ ist, weil privates und öffentliches Recht von diametralen Prinzipien beherrscht werden. Die einheitliche Grundlage des öffentlichen Rechts ist die einseitig bindende Kraft des Staatswillens. Das öffentliche Recht ist demzufolge beherrscht durch eine grundsätzliche Ungleichheit der Rechtssubjekte. Das Privatrecht dagegen leitet sich einheitlich ab aus dem Begriff des subjektiven Rechts des einzelnen. Gezeichnet ist es daher durch die Gleichheit der Rechtssubjekte. Da der Vertrag ein Rechtsinstitut jedenfalls des Zivilrechts ist – nach Auffassung Otto Mayers existieren keine dem öffentlichen Recht und Privatrecht gemeinsamen Rechtsinstitute –, setzt der Vertrag für Otto Mayer begrifflich die Gleichheit der sich einigenden Rechtssubjekte voraus. Auf dem Gebiet des durch die Ungleichheit der Rechtssubjekte charakterisierten öffentlichen Rechts ist er undenkbar. Obzwar aus der Sicht Otto Mayers der „Rechtsstaat“ durch die Existenz eines Verwaltungsrechts gekennzeichnet ist, ist es nicht die Idee des Rechtsstaates, die zu der Annahme eines eigenständigen Verwaltungsrechts zwingt. Die Grundlagen der Vorstellung von einem System eigentümlicher Rechtsinstitute der staatlichen Verwaltung liegen vielmehr zum Teil in der Vorbildlichkeit des französischen Verwaltungsrechts, vor allem aber in der Anschauung Otto Mayers vom Begriff des Staates, sowie in einer, an der Dogmatik des Zivilrechts orientierten Ansicht von Methode in der Rechtswissenschaft. Inwiefern jedoch bedingen das Verständnis von Staat und Methode im Recht die Prämisse Otto Mayers, daß öffentliches und privates Recht durch einander entgegengesetzte Prinzipien beherrscht werden und demnach das Verwaltungsrecht ein „System eigenthümlicher Rechtsinstitute der staatlirecht in ihm fremden Rationalisierungen vergewaltigt wird“. In Schutz genommen wird Otto Mayer dagegen von Bühler [VerwArch 27 (1919), S. 283 (287).]. 82 Rez. Hatschek, ZgesStaatsWiss 63 (1907), S. 541 (546). Siehe auch: Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), Vorwort S. IX; Eisenbahn II, AöR 16 (1901), S. 38 (49 Fn. 13). 83 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), Vorwort S. IX.
C. Zusammenfassung
47
chen Verwaltung“ zu sein hat? Diese Frage läßt sich erst beantworten, wenn feststeht, wodurch sich für Otto Mayer die Begriffe von Staat und Methode im Recht im einzelnen kennzeichnen. Die beiden sich anschließenden Kapitel widmen sich darum ausführlicher der „modernen Staatsidee“ und dem Methodenbegriff bei Otto Mayer. Das vorletzte Kapitel geht dann der Frage nach, ob aus dem Staats- und Methodenverständnis jeweils für sich betrachtet oder nur zusammengenommen die oben genannte Prämisse resultiert.
3. Kapitel
Die „moderne Staatsidee“ Otto Mayers A. Die Grundlagen des Staates Eine Schilderung der Auffassung Otto Mayers vom Wesen des Staates1 muß ansetzen bei dessen Verständnis von Recht.2 Das Recht, so Otto Mayer, sei „die Ordnung von Machtverhältnissen“.3 Es solle zwischen zwei Rechtssubjekten die Linie ihrer beiderseitigen Machtgrenzen ziehen.4 Es sei dazu da, „die Bedingungen aufzustellen und aufrechtzuerhalten, unter welchen eine menschliche Gesellschaft mit einem gewissen Maße von freier Bewegung des einzelnen und im gesicherten Besitz erst möglich wird“.5 In Abgrenzung zur Moral ist für Otto Mayer Recht erzwingbar.6 „Denn das Recht ist nicht bloss der Ausspruch über das, was sein soll, sondern auch die Macht, es zu verwirklichen.“7 Das Recht setzt für Otto Mayer demgemäß eine faktische „höhere Macht“ voraus, die es setzt und seine Geltung garantiert.8 Verkörpert wird für ihn diese faktische Macht durch den Staat, stehe doch hinter der Rechtsordnung nichts anderes „als eben die Staatsgewalt“.9 „Staatsgewalt“ bedeute „eben auch Macht über das Recht.“10 Recht sei also „jede Regel für äusseres Verhalten, für deren Aufrechterhaltung die öffentliche Gewalt eintritt“, 11 oder, anders gesagt, der „Staat sich einsetzt 1
Eine Darstellung des Staatsverständnisses von Otto Mayer findet sich auch bei: Hueber, Methode, S. 48 ff.; Heyen, Otto Mayer, S. 61 ff.; Schmidt-De Caluwe, Der Verwaltungsakt, S. 56 ff. 2 Hierzu äußert sich auch: Heyen, Otto Mayer, S. 95 ff. 3 Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 572; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 322. In: Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 366, spricht Otto Mayer nur von einer „Ordnung von Verhältnissen“. 4 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 13; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 13; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 13. 5 Finanzwirtschaft, in: Gerloff/Meisel (Hrsg.), HdbFinanzWiss 1 (1926), S. 86 (86). 6 Vgl. Völkerrecht und Völkermoral, AöR 38 (1918), S. 1 (16); Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 492 f.; Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 208; Eisenbahn III, AöR 16 (1901), S. 203 (231 Fn. 33); Staatsrecht (1909), S. 141. 7 Rez. Zorn, AöR 3 (1888), S. 475 (479). 8 Vgl. Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (67). 9 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (56). 10 Rez. Friters, AöR 39 (1920), S. 105 (106).
A. Die Grundlagen des Staates
49
mit seinem Zwang“.12 Ein von Gott vorgegebenes Naturrecht gibt es für Otto Mayer nicht. „Wir glauben heutzutage nicht mehr an ein Naturrecht. Rechtssätze sind Menschenwerk. Der Gott, an den wir glauben, erläßt keine.“13 Der Staat ist damit für Otto Mayer erst Voraussetzung allen Rechts. Für den Staat heiße es nicht: „im Anfang war das Recht“. „Sein Anfang und sein bleibender Grund“ sei vielmehr „die M a c h t .“14 Die Entstehung des Staates ist für Otto Mayer demnach kein Rechtsakt. Der Staat ist für ihn vielmehr zunächst etwas Faktisches, eine „grosse Tatsache“, reine „Macht“,15 eine Einrichtung,16 beziehungsweise – ganz im Sinne der lateinischen Bedeutung des Wortes17 – ein „Zustand, status, dass eine oberste Gewalt eingerichtet ist für ein gewisses Gebiet und für die zugehörigen Menschen“.18 Entscheidend ist also für die Konstituierung eines Staates nach der Auffassung Otto Mayers allein das tatsächliche Vorhandensein einer effektiven Staatsgewalt für ein gewisses Gebiet und die dazu gehörigen Menschen. Dies bringen auch sehr deutlich die folgenden, aus der Zeit kurz nach der Revolution der Jahre 1918/19 stammenden Aussagen Otto Mayers zum Ausdruck: „Die eingetretene Umwälzung bedeutet keine Zerstörung des Staates, damit er erst wieder neu aufgebaut werde [. . .]. Sobald wieder auch nur ein vorläufiger Besitz der Staatsgewalt sich tatsächlich ergeben hat, darf die Trägerschaft sich wieder ausgestattet halten mit der ,Heiligkeit und Unverletzlichkeit‘, welche die bisherige Ordnung dieser verleiht.“19 „Staat und Staatsgewalt sind lebendige Wirklichkeiten, die sich ordentlicherweise in den dafür gegeben Rechtsformen bewegen und fortentwickeln. Unter 11
Rez. Seidler, AöR 14 (1899), S. 132 (133). Völkerrecht und Völkermoral, AöR 38 (1918), S. 1 (16). Ähnlich: Wert des Völkerrechts (1915), in: Otto Mayer-Kl. Schriften II, S. 16 (20). 13 Wert des Völkerrechts (1915), in: Otto Mayer-Kl. Schriften II, S. 16 (19). Ähnlich: Völkerrecht und Völkermoral, AöR 38 (1918), S. 1 (5); Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 75. Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 26, wo vom Naturrecht als einer „merkwürdige[n] Strömung“ die Rede ist, welche „Jahrhunderte hindurch die gelehrte Welt beherrscht“ habe. 14 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (47). Hervorhebung im Original. „Macht“ ist dabei nicht gleichbedeutend mit „Gewalt“. Ein Staat entsteht für Otto Mayer nicht nur durch Gewalt, Eroberung, Unterjochung, vgl. Rez. Gumplowicz, JLitBl. 9 (1897), S. 185 (185 f.). 15 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (47). Vgl. daneben: Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 329: Staat als „einheitliche Machtgröße“. 16 Staatsrecht (1909), S. 14; Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (47, 53). 17 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (53): „Hat doch der Staat seinen Namen von dem ,Zustand‘, von der Einrichtung des Gemeinwesens.“ 18 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (47). 19 Anmerkung zu RGSt v. 4. 4. 1919, JW 48 (1919), S. 733. Hervorhebung nicht im Original. 12
50
3. Kapitel: Die „moderne Staatsidee‘‘ Otto Mayers
Umständen aber lösen sie sich von diesen Formen, um neue Bahnen einzuschlagen und das dafür geltende Recht frei zu gestalten. Für die Frage, ob das gilt, ist allein entscheidend der tatsächliche Bestand, den diese neue Ordnung gewonnen hat, die tatsächlich in ihrem Namen geübte Herrschaft. Mit dem eigentümlichen Satz: Recht muß doch Recht bleiben, kommt man dem Staate gegenüber nicht durch; wenn er es wirklich ist, der uns da entgegentritt, können auch wir Juristen uns nur vor ihm verneigen.“20 Die in nahezu allen deutschen Ländern erlassenen Verfassungen stellen aus der Sicht Otto Mayers konsequenter Weise nicht die Begründung, sondern nur eine Ordnung der bereits bestehenden tatsächlichen Verhältnisse dar. Dies bemüht sich Otto Mayer auch aus den Verfassungen selbst herauszulesen. So sagt er zu § 4 S. 1 der Verfassung Sachsens vom 4. September 1831, in der es heißt, der König sei das „souveräne Oberhaupt des Staates“, vereinige „in sich alle Rechte der Staatsgewalt und“ übe „sie unter den von Ihm gegebenen in der gegenwärtigen Verfassung festgesetzten Bestimmungen aus“:21 „Nach der Sprechweise der Verfassungsurkunde ist der Staat zunächst als ein Zustand gedacht, als die durch die Verfassung hergestellte Ordnung der Dinge. In dieser Ordnung gehört dem König die volle Gewalt, um sie, soweit nicht die Verfassung selbst nähere Bestimmungen dafür setzt, frei nach seinem Ermessen und fürstlichen Pflichtgefühl auszuüben; er ist das Oberhaupt der Ordnung.“22 Statt vom Staat als einem tatsächlichen „Zustand“ spricht Otto Mayer daher auch vom Staat als einer „äußerlichen Ordnung, welche für einen abgegrenzten Teil der Erdoberfläche und die zugehörige Menschengemeinschaft eingerichtet und mit oberster Gewalt ausgestattet ist“.23 „Diese Gewalt“ sei „die S t a a t s g e w a l t , die zugehörige Menschengemeinschaft das Vo l k , der zugehörige Teil der Erdoberfläche das S t a a t s g e b i e t .“24 Die Staatsgewalt sei das wichtigste unter diesen drei die Grund20
Anmerkung zu PrOVG v. 10. 11. 1921, JW 51 (1922), S. 610 (610). Hervorhebung nicht im Original. Ähnlich schon: Rez. Friters, AöR 39 (1920), S. 105 (105 f.): „Kann eine aus der Revolution hervorgegangene Regierung Rechtssätze schaffen, ,Verordnungen mit Gesetzeskraft‘? Sofern sie tatsächlich in den Besitz der Staatsgewalt getreten ist, zweifellos, würden wir sagen; denn die Staatsgewalt bedeutet eben auch Macht über das Recht.“ Hervorhebung nicht im Original. 21 Ähnliche oder gleichlautende Bestimmungen enthielten: Titel II § 1 Verf. Bayern v. 26. Mai 1818; § 5 Verf. Baden v. 22. Aug. 1818; § 4 Verf. Württemberg v. 25. Sept. 1819; § 10 Verf. Kurhessen v. 5. Jan. 1831. Die Verfassungen sind abgedruckt bei: Huber, Dokumente, S. 141 ff. 22 Staatsrecht (1909), S. 13. 23 Staatsrecht (1909), S. 11, 13, 15 Fn. 4. Ähnlich: Staat und Kirche, in: Hauck (Hrsg.), Realencyklopädie 183 (1906), S. 707 (714). Vgl. auch: Rez. Meißner, JW 51 (1922), S. 74. 24 Staatsrecht (1909), S. 11. Hervorhebung im Original.
B. Die „Undenkbarkeit‘‘ eines Bundesstaates
51
lagen des Staatswesens bildenden Merkmalen, da erst durch den Zusammenhang mit ihr die beiden anderen Elemente ihre begriffliche Bestimmtheit bekämen.25 Die Staatsgewalt im Sinne der neuzeitlichen Staatsidee müsse „notwendig o b e r s t e Gewalt sein, als solche unabhängig nach außen, rechtlich unwiderstehlich innerhalb ihres Gebiets und unbegrenzt in den Aufgaben, welche für eine solche Menschengemeinschaft mit Mitteln äußerer Ordnung zu verfolgen sind.“ Fehle etwas an der Staatsgewalt, so sei das Gemeinwesen als Staat noch nicht fertig oder es habe die dazu notwendigen Eigenschaften verloren.26 Das „klassische Staatsmerkmal“ ist damit für Otto Mayer „die Souveränität“,27 da er diese mit „oberster Staatsgewalt“ gleichsetzt: „Wo die öffentliche Gewalt in höchster Spitze erscheint, überlegen auch allen anderen Erscheinungen dieser Art innerhalb ihres Machtbereiches, nennen wir sie Staatsgewalt, Souveränität [. . .].“28 „Daß diese [. . .] Gewalt“ des Staates „die oberste sei“, das mache „seine Souveränität, die er als eine wesentliche Eigenschaft in Anspruch“ nehme.29
B. Die „Undenkbarkeit“ eines Bundesstaates Die Bedeutung des Merkmals der Souveränität für den Staatsbegriff illustriert besonders eindringlich die Auffassung Otto Mayers von der fehlenden Möglichkeit, den Staat juristisch als Bundesstaat zu denken.30 25
Staatsrecht (1909), S. 11. Staatsrecht (1909), S. 11. Hervorhebung im Original. 27 Staatsrecht (1909), S. 12 Fn. 1. 28 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 15; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 15. Vgl. auch: Völkerrecht und Völkermoral, AöR 38 (1918), S. 1 (23): „[. . .] unbindbare Souveränität des Staates [. . .].“ 29 Staat und Kirche, in: Hauck (Hrsg.), Realencyklopädie 183 (1906), S. 707 (714). Ebd., S. 708: „[. . .] der Souveränität des Staates, so wie er sie seiner Natur nach beanspruchen will.“ Vgl. auch: Trennung (1919), S. 4, wo es heißt, der Staat könne der Kirche nicht untertan sein. „Das widerspräche jetzt seiner Souveränität und damit seinem begrifflichen Wesen.“ Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 (349 Fn. 14): Staaten seien „von Natur berufen zu herrschen, souverän zu sein“. 30 Ausführlich begründet Otto Mayer seine Ablehnung des Begriffes vom Bundesstaat in: Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 ff. Dort auch gibt Otto Mayer zahlreiche Nachweise zu den Autoren, an die er mit seiner Auffassung anknüpft, und zu den Autoren, deren Ansichten er mit seiner Auffassung widerspricht. Zumindest kurz angesprochen findet sich die den Begriff des Bundesstaates ablehnende Lehre Otto Mayers auch in: Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (63 ff.); Rez. Bruck, JLitBl. 20 (1908), S. 111; Rez. Richter, AöR 25 (1909), S. 484; Staatsrecht (1909), S. 12 f.; Rez. Bornhak, JW 45 (1916), S. 1161 (1162); Rez. Giese, AöR 40 (1921), S. 125 (127 f.); Rez. Haff, AöR 40 (1921), S. 113 (118); Selbstdarstellung (1924), S. 17. Vgl. auch schon: Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 462 ff. Siehe 26
52
3. Kapitel: Die „moderne Staatsidee‘‘ Otto Mayers
Für die „juristische Betrachtungsweise“, schreibt Otto Mayer, enthalte das Wort Bundesstaat „einen Widerspruch, insofern Staat und Bund sich ausschließen“. „Unser strengerer Staatsbegriff duldet nicht zweierlei oder gar dreierlei Staat für das nämliche Gebiet.“31 Grund dafür ist der Umstand, daß für Otto Mayer ein Staat „Souveränität [. . .] als eine wesentliche Eigenschaft in Anspruch“ nimmt.32 Da Souveränität für ihn bedeutet, daß der Wille des Staates „innerhalb seines Gebietes keinem rechtlich gleichwertigen begegne, keinen höheren über sich habe“,33 und da schon begrifflich auf einem Gebiet nur eine Gewalt die oberste zu sein vermag, kann, „wie in der konstitutionellen Monarchie [. . .] nur der Fürst [. . .], so im Bundesstaat entweder der Bund oder die Staaten“ der Souverän sein.34 Ein Bundesstaat, in dem sowohl dem Bund, als auch den Ländern Staatsqualität zukommt, sei daher nur denkbar bei „Annahme der nicht so ganz zweifelsfreien Lehre von der Entbehrlichkeit der Souveränität für den Staatsbegriff“.35 Die Tatsache, daß in der Zeit des Deutschen Reiches von 1871 Staatsgewalt sowohl des Reiches, als auch der Länder, also „zweierlei Staatsgewalt [. . .]tätig“ war,36 erklärt Otto Mayer mit der „bedeutsamsten und fruchtbarsten“ Idee, von der das ganze „Verfassungswesen“ lebe, nämlich der von der Trennung der Gewalten.37 Diese Idee beherrsche nicht nur „die Verfassungen der Einzelstaaten“, sie komme vielmehr „auch in der Verfassung des Staates, der sie alle zusammenfaßt, nochmals zur Geltung“.38 Allerhierzu auch: Reichsverfassung, JW 48 (1919), S. 209 (209). Ein ausführlicher und mit zahlreichen Literaturnachweisen versehener Überblick über die gegen Ende des 19. Jahrhunderts kontrovers geführte Diskussion, ob ein Bundesstaat denkbar ist, insbesondere das deutsche Reich von 1871 als ein Bundesstaat begriffen werden muß, findet sich bei: Laband, Staatsrecht I2 (1888), S. 52 ff. 31 Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 (339 f.). Ebd., S. 341 Fn. 7: „Juristisch ist es auch nicht möglich, dass wenn der Bund Staat ist, auch die Glieder noch als Staaten anzusehen wären.“ 32 Staat und Kirche, in: Hauck (Hrsg.), Realencyklopädie 183 (1906), S. 707 (714). 33 Staat und Kirche, in: Hauck (Hrsg.), Realencyklopädie 183 (1906), S. 707 (714). Hervorhebung nicht im Original. 34 Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 (340 Fn. 6). 35 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (65). Siehe auch: Reichsverfassung, JW 48 (1919), S. 209 (209). Die von Otto Mayer hier angesprochene Lehre vertrat namentlich Laband [Staatsrecht I2 (1888), S. 60 ff., bes. S. 67.]. 36 Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 462. 37 Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 464; Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 (340 Fn. 6): „Wenn es sich darum handelt, in welcher Ordnung Bund und Einzelstaat den Untertanen gegenüber zusammenwirken, also um das bundesstaatliche Verwaltungsrecht, dann giebt allerdings nur die Formel der Trennung der Gewalten die richtige Anschaung: Deutsches Verwaltungsrecht Bd. II S. 462 ff.“ 38 Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 464.
B. Die „Undenkbarkeit‘‘ eines Bundesstaates
53
dings dürfe man die Idee nicht – wie in der deutschen Wissenschaft üblich39 – in dem Sinne verstehen, daß sich selbständige Rechtssubjekte mit einem jeweils eigenständigen Teil der Staatsgewalt gegenüberstehen. Denn dann gäbe es keine oberste Gewalt, wäre ein Staat nicht souverän. Folglich müßte „um der Einheit des Staates willen“40 die Theorie der Gewaltentrennung mit der deutschen Wissenschaft verworfen werden. Was jedoch diese „so einmütig“ verwerfe, sei „gar nicht die wirkliche Trennung der Gewalten, sondern der Popanz, den man daraus gemacht“ habe.41 Da nämlich die „öffentliche Gewalt“ kein handlungsfähiges Subjekt sei, sondern durch Menschen, die mit der Gewalt bekleidet seien, ausgeübt werden müsse, könne von einer „Trennung“ der Gewalten bereits dann gesprochen werden, wenn in einem Falle über das „Ob“ und „Wie“ der Ausübung der Gewalt durch den Willen von nur einer Person entscheiden werde, in einem anderen Falle durch den Willen dieser einen und einer anderen Person. Otto Mayer umschreibt dies mit den Worten: „Damit eine Trennung der Staatsgewalt bestehe, ist erforderlich, dass der menschliche Wille, welcher die eine davon trägt, nicht zugleich auch der Träger der anderen sei. [. . .] Es genügt, dass neben seinem [scil.: des Königs] Willen noch ein anderer Wille, der der Volksvertretung, dabei wirksam werde, dann ist die Trennung der Gewalten da; gesetzgebende und vollziehende Gewalt sollen nur nicht lediglich auf dem gleichen Willen ruhen.“42 Eine Trennung der Gewalten meint mithin für Otto Mayer, daß der Staatswille „verschiedenartig entsteht“43 und ausgeübt wird. Von daher verwundert es nicht, wenn Otto Mayer im Zusammenhang mit der Gewaltentrennung von einer „Zuständigkeitsverteilung“ spricht.44 Otto Mayer [Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 68 Fn. 2.] verweist insoweit unter anderem – zu Recht – auf Paul Laband [Staatsrecht I2 (1888), S. 517 mit Fn. 2.]. 40 Vgl. Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 2. 41 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 68 Fn. 2. Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 464 Fn. 18. 42 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 69. 43 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 71. Vgl. auch: Rez. Stier-Somlo, AöR 43 (1922), S. 364 (365). Siehe zudem schon: Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 2: „Abgesehen davon, dass schon um der Einheit des Staates willen Volksvertretung und Staatsoberhaupt nicht derart unabhängig und gleichwerthig auseinandergehn können, sind auch die Gewalten, welche die Verfassung ausscheidet, niemals so zwischen ihnen vertheilt, dass jedem je eine ausschliesslich zustünde. Die Vertheilung geschieht vielmehr zunächst zwischen zwei Arten staatlicher Willensäußerung, Gesetz und Vollziehung, unterschieden nach ihrer Entstehungsart [. . .].“ „Trotz der Trennung der Gewalten“ gebe es daher jeweils nur einen Souverän, Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 (340 Fn. 6). 44 Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 4; Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (32, 34, 38); Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 108; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 105. 39
54
3. Kapitel: Die „moderne Staatsidee‘‘ Otto Mayers
Denkbar ist für Otto Mayer ein Bundesstaat lediglich für die „politische Anschauung“.45 Denn für sie reiche es aus, daß „alle staatlichen Geschäfte in zwei grosse Massen verteilt“ sind, „deren eine im Namen der Gesamtheit, deren andere im Namen der Glieder in geordnetem Zusammenwirken und gesicherter Selbständigkeit besorgt wird.“46 Juristisch allerdings lasse sich das, was der Bundesstaat politisch sein soll, nur verwirklichen durch einen Staatenvertrag oder durch einen Oberstaat.47 Ein Oberstaat sei das Reich von 1871 nicht, da es an dem erforderlichen neuen Subjekt der Reichsgewalt fehle. Ein Oberstaat könne im konstitutionellen Deutschland auch nicht entstehen. Denn die Addition mehrerer monarchischer Souveräne gebe keinen neuen Souverän, sondern einen Monarchenbund.48 Allein die Addition mehrerer republikanischer Souveräne ergebe von selbst einen neuen Souverän, der die alten verschlinge „oder nur soviel von ihnen übrig lasse, als es ihm“ beliebe.49 Man könne den neuen Reichssouverän auch nicht in einer juristischen Person, gebildet durch die Einzelstaaten, suchen.50 Denn es sei „nicht denkbar“, ein „unvollziehbarer Gedanke“, daß der Staat eine juristische Person sei.51 Daher sei das Deutsche Reich von 1871 ein Staatenbund: „Germania trägt nun aber einmal keine phrygische Mütze, sondern sie trägt einen Kranz von Kronen im Haar.“52 45
Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 (341 Fn. 7). Hervorhebung nicht im Original. Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 (362). 47 Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 (346). Vgl. auch: Reichsverfassung, JW 48 (1919), S. 209 (209). 48 Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 (364). Ähnlich: Staatsrecht (1909), S. 13. 49 Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 (351). Auch in: Staatsrecht (1909), S. 13, konstatiert Otto Mayer: „Umgekehrt ist das Reich kein Staat [. . .].“ Erst für die Weimarer Republik stellt Otto Mayer fest: „Das Reich ist ein Staat geworden und die bisherigen Bundesstaaten stehen unter ihm;“, Rez. Stier-Somlo, AöR 43 (1922), S. 364 (364). Ähnlich: Rez. Giese, AöR 40 (1921), S. 125 (128); Reichsverfassung, JW 48 (1919), S. 209 (209). 50 Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 (347 ff.). 51 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (56, 58, 66). 52 Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 (369). Eine Folge der Auffassung Otto Mayers, wonach das Reich von 1871 kein Staat sein soll, ist, daß es ein „,deutsches Verwaltungsrecht‘ [. . .] – von den Oasen des Reichsverwaltungsrechts abgesehen – nur in der Theorie [gibt]“. Mit dem „deutschen Staatsrecht“ stehe es ja nicht anders, Rez. Fleischmann, AöR 28 (1912), S. 346 (347). Denn wenn Otto Mayer in der Staatsgewalt die faktische Macht sieht, die das Recht voraussetzt [vgl. den ersten Absatz von Abschnitt A. dieses Kapitels], das Deutsche Reich aber kein Staat ist, kann es auch kein gesamtdeutsches Verwaltungs- und Staatsrecht geben. Vgl. Gerber, Grundzüge des deutschen Staatsrechts3 (1880), S. 9: „Das Staatsrecht kann seiner Natur nach nur das Recht eines bestimmten Staates sein, da es eine konkrete, geschichtlich realisierte staatliche Willensmacht voraussetzt. Sonach könnte für Deutschland nur von einem Staatsrecht jedes einzelnen der selbständigen Staaten die Rede sein, welche innerhalb der deutschen Volksverbindungen nebeneinander bestehen.“ 46
C. Der „juristische‘‘ Begriff vom Staate
55
C. Der „juristische“ Begriff vom Staate I. Der Staat als juristische Person Die Ansicht, daß der Gedanke von der juristischen Persönlichkeit des Staates „unvollziehbar“ sei,53 führt an den Ausgangspunkt der Überlegungen Otto Mayers zum Wesen des Staates zurück. Denn sie beruht auf der eingangs erwähnten Auffassung Otto Mayers, daß der Staat als eine Tatsache Voraussetzung allen Rechts sei, daß mithin der „Staat auf sich selbst [stehe] als eine gewaltige Tatsache“ und zu ihm „Recht und Rechtsordnung“ dazu kommen könnten und sollten, indes „ n i e i n s e i n i n n e r s t e s W e s e n e i n [drängen]“.54 Das entscheidende Merkmal einer juristischen Person sei die rechtliche55 „Trennung des Unternehmens von dem ursprünglichen Unternehmen“,56 beziehungsweise von den natürlichen Personen;57 es sei „die Loslösung des Unternehmens und der dazu dienenden Machtmittel von dem ursprünglich Berechtigten, um ihr [scil.: der juristischen Person] das zu überweisen an seiner Statt“.58 Für den Staat bedeute dies, „dass das grosse Unternehmen Staat mit allem, was dazugehört, von der menschlichen Trägerschaft der Staatsgewalt, dem Souverän, rechtlich gelöst werde, dergestalt, dass dieser Souverän fortan, was er hier wirkt, n i c h t m e h r e i g e n e n N a m e n s w i r k t , sondern i n V e r t r e t u n g einer für dieses Unternehmen geschaffenen besonderen Rechtspersönlichkeit“.59 Dieser Gedanke aber sei nicht „juristisch vollziehbar“. Denn die Staatsgewalt „zu Gunsten der Rechtsfigur einer juristischen Person“ zu übertragen, die „aus eigener Macht n i c h t s “ sei, habe „in dieser Sphäre keinen Sinn: wer hielte hier die Scheidewand?“60 Man dürfe doch nicht vergessen, „dass das Verfas53 Eingehend und mit umfangreichen Nachweisen zu übereinstimmenden wie widerstreitenden Lehren anderer Autoren entwickelt Otto Mayer seine ablehnende Ansicht zur juristischen Persönlichkeit des Staates in: Person, in: FG Laband (1908), S. 1 ff. Vgl. daneben: Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 (347 f. mit Fn. 13); Staatsrecht (1909), S. 14 f.; Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 588 f.; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 329 f.; Rez. Haff, AöR 40 (1921), S. 113 (114 ff.). Eine ausführliche dogmengeschichtliche Untersuchung zur Lehre vom Staat als juristischer Person gibt Uhlenbrock [Der Staat als juristische Person.]. 54 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (48). Hervorhebung im Original. 55 Vgl. Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 575. 56 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (23). Vgl. auch: Rez. Haff, AöR 40 (1921), S. 113 (114). 57 Staatsrecht (1909), S. 14. 58 Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 588. Siehe auch ebd., S. 575. 59 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (56). Hervorhebung im Original. Vgl. auch: Rez. Haff, AöR 40 (1921), S. 113 (115).
56
3. Kapitel: Die „moderne Staatsidee‘‘ Otto Mayers
sungsrecht ganz andere Bedingungen“ habe „für das, was möglich ist, als das Privatrecht“, wo das Gesetz die Trennung bewirken könne.61 Denn wenn der Staat Voraussetzung allen Rechts ist, da das Recht nur existiert kraft der faktischen Macht der Staatsgewalt, die es garantiert,62 und wenn der Träger der Staatsgewalt diese übertrüge an eine gedachte Person, könnte diese Übertragung nicht in den Formen des Rechts vonstatten gehen, da die faktische Macht, die das Recht erfordert, dem Übertragenden infolge der Übertragung ja fehlte. Daher erinnert dieser Gedanke Otto Mayer an „Münchhausen, der sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zieht. Denn die juristische Person, dieses Geschöpf der Rechtsordnung, ist bloss dadurch etwas, dass eine vorhandene höhere Macht dazwischen tritt und sich für sie einsetzt und ihre Daseinsmöglichkeit gewährleistet. Und das fehlt ja gerade,“63 da „ueber den Staaten“ keine „Autorität“ stehe.64 Wäre der Staat eine juristische Person, müßte überdies für ihn durch Menschen in Vertretung gehandelt werden,65 da eine juristische Person keinen eigenen Willen besitze66 und demzufolge den für sie wirkenden wehrhaften Willen nur durch Vertretung erlangen könne.67 Diese Konsequenz werde aber in der Literatur nicht gezogen. Man verwahre sich im Gegenteil dagegen und stelle dem die „Lehre vom Organ“ gegenüber, weil der Begriff des Organs den Vorzug besitze, auf den es gerade bei der Erklärung des Staates ankomme, „dass er keine Geschiedenheit des Vertreters und des Vertretenen“ bedeute. Die Organlehre68 verneine damit aber die rechtliche Trennung des Unternehmens vom ursprünglichen Unternehmen, also das die juristische Person erst konstituierende Merkmal. Daher sei die Organlehre die entschiedenste Verneinung einer wirklichen und echten juristischen Persönlichkeit des Staates.69 Im übrigen besitze der Begriff „Organ“ 60
Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (56). Hervorhebung im Original. Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (56). 62 Vgl. den ersten Absatz von Abschnitt A. dieses Kapitels. 63 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (67). 64 Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 (348). 65 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (57). 66 Denn der Wille der Individuen lasse sich nicht teilen und wieder zusammensetzen zu einem Gesamtwillen. Aus den Einzelmenschen lasse sich nicht ein Gesamtwille „herausdestillieren“. An die „Theorie der realen Gesamt- oder Verbandspersönlichkeit“ oder auch kurz „Willenstheorie“ Otto von Gierkes (1841–1921) [Otto Mayer zitiert vorzugsweise aus: Gierke, Genossenschaftsrecht II (1873), S. 24 ff., 475 ff.], die von dieser Prämisse ausgehe, vermöge er, Otto Mayer, daher nicht zu glauben, Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 576 Fn. 7, 89 Fn. 20; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 326 Fn. 7, 329 Fn. 14. 67 Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 576; Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 326; Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (32). 68 Vgl. G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre2 (1905), S. 526 ff. 69 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (57 f.). Hervorhebung im Original. 61
C. Der „juristische‘‘ Begriff vom Staate
57
nicht die notwendige juristische Schärfe. Dieses Wort bedeute „ja alles und gar nichts“70 und tue seinen Dienst nur, „solange man es im Halbdunkel poetischen Vergleichs“ lasse.71 Deshalb solle man es „für juristische Ausführungen endlich einmal verbieten“. „Es ertödtet alles wissenschaftliche Verantwortungsgefühl.“72 Gegenüber dem in der Literatur73 aufgestellten Satz, schon im Begriff der Rechtsfähigkeit liege es, daß die Quelle derselben, die staatliche Rechtsordnung und damit der Staat, sich selbst als juristische Person setzen müsse, bemerkt Otto Mayer spöttisch: „Majestät trägt natürlich die Grosskreuze sämtlich zu verleihender Orden auch selbst.“74 Die Persönlichkeit des Staates sei daher „nichts als Bild, Gleichnis, Abstraktion“, um die „verwickelte Rechtseinrichtung, in welcher von sehr verschiedenen Mitwirkenden in planmässigem Zusammenarbeiten ein einheitlicher Zweck verfolgt“ werde, anschaulich zusammenfassen zu können.75 II. Das Volk als der Staat Obwohl der Staat für Otto Mayer nicht durch das Recht geschaffen und geprägt wird, ist es seiner Auffassung nach dennoch möglich, das Wesen des Staates „in juristischen Formen zu begreifen und sich zurechtzulegen und dadurch den Anschluss von all den weiteren rechtlichen Gestaltungen zu erleichtern“.76 Allerdings lasse sich, so Otto Mayer, der Staat nicht begrifflich erfassen, indem man ihn mit dem Volk gleichsetze, und zwar mit dem Volk als Gesellschaft, als Verband, welcher „immer die R e c h t s b e z i e h u n g d e r V e r b u n d e n e n “ bedeute.77 Denn das Wort Volk bedeute ja bekanntlich sehr verschiedene Dinge, von denen keines für eine Gleichstellung mit dem Staate tauge. Verstehe man unter dem Volk die ge70 Staatsrecht (1909), S. 14. Siehe auch: ebd., S. 152 Fn. 1, 216 Fn. 5. Vgl. zudem: Rez. Jèze, AöR 19 (1905), S. 597 (598); Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 65 Fn. 1; Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 254 Fn. 18, 320 Fn. 11, 394 Fn. 19, 445 Fn. 24, 503 Fn. 12, 661 Fn. 2, 662 Fn. 4; Rez. Peretiatkowicz, AöR 36 (1917), S. 369 (370); Rez. Hatschek, JW 51 (1922), S. 1570 (1570). 71 Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 254. 72 Eisenbahn II, AöR 16 (1901), S. 38 (50 Fn. 14). 73 Bernatzik, Kritische Studien, AöR 5 (1890), S. 169 (244). 74 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (59). 75 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (60 f.). Ähnlich: Staatsrecht (1909), S. 14; Rez. Haff, AöR 40 (1921), S. 113 (118); Bundesstaat, AöR 18 (1903), S. 337 (348 mit Fn. 13). Beiläufig bemerkt war der Begriff der juristischen Person für Otto Mayer „unter unseren gelehrten Fremdwörtern ein besonders häßliches“, Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 571 Fn. 1. 76 Vgl. Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (48). 77 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (51 f.). Hervorhebung im Original.
58
3. Kapitel: Die „moderne Staatsidee‘‘ Otto Mayers
ordnete Bürgerschaft, komme als Staatsform nur die Republik in Betracht.78 Fasse man das Volk als eine geschichtliche Größe, als das in geschichtlicher Gemeinschaft verbundene Ganze auf, könne das Volk und damit der Staat kein Verband sein, da dieser ja Rechtsbeziehungen der Verbundenen voraussetze, solche aber nur zwischen Lebenden bestehen könnten.79 Setze man Volk mit Bevölkerung gleich, also mit der jeweiligen Menge von Staatsangehörigen, käme die Mehrzahl der in diesem Wort Begriffenen als Träger selbständiger Rechtsbeziehungen gesellschaftlicher Art gar nicht in Betracht; gemeinsam sei dann nur der rechtliche Zustand, von der Staatsgewalt zusammengefaßt, beherrscht zu sein. Der „Verband“ verdiente hier den Namen eines „passiven“ in ausgesprochener Weise; der Staat wäre mithin Objekt der Herrschermacht.80 Der Staat sei jedoch ein tatsächlicher „Zustand, äußerliche Ordnung und als solche weder Subjekt noch Objekt“,81 weder Herrscher noch Beherrschter und daher in seiner Gesamtheit kein Rechtssubjekt.82 Wenn nämlich der Staat ein tatsächlicher Zustand ist, „dass eine oberste Gewalt eingerichtet ist für ein gewisses Gebiet und für die zugehörigen Menschen“,83 so muß der Träger dieser Staatsgewalt, das Oberhaupt des Staates, für Otto Mayer notwendig Faktor dieses Zustandes sein, innerhalb dieser Ordnung stehen. Deshalb schreibt er: „Der König als Oberhaupt des Staates steht selbst in dieser Ordnung darinnen als ihre Spitze und ihr vornehmstes Glied; er herrscht im Staate, aber er beherrscht nicht den Staat.“84 III. Der Staat als Anstalt Als angemessene rechtliche Kategorie für den Staat scheint Otto Mayer der Begriff der Anstalt. Zwar erhalte man, gehe man von der „staatlichen Anstalt aus als einem Einzelunternehmen des bereits vorausgesetzten und persönlich aufgefassten Staates“, bei der Anwendung diese Begriffes auf den Staat „zunächst das Gefühl: Der Staat ist für diesen Namen zu gross“. Aber daran dürfe „man sich nicht stossen“. Handele „es sich doch nur darum, das ursprünglich überjuristische Wesen des Staates in juristischen Formen zu begreifen“. Dafür müssten „die nächstliegenden genügen“.85 78
Vgl. Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (52 f.). Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (51 f.). 80 Vgl. Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (52). 81 Staatsrecht (1909), S. 14 Fn. 4. Hervorhebung nicht im Original. Vgl. auch: Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (52). 82 Staatsrecht (1909), S. 13. 83 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (47). 84 Staatsrecht (1909), S. 14 Fn. 4. Vgl. auch: Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (52). 79
D. Der Zweck des Staates
59
Der Anstaltsbegriff dünkt Otto Mayer für den Staat am geeignetsten, weil sich mit diesem eine weitere, bislang unausgesprochene Wesenseigenschaft des Staates zum Ausdruck bringen lasse, nämlich der Zweck des Staates. Als „ein guter sicherer Anstaltsbegriff“86 wähnt ihm darum folgende Begriffsbestimmung Wilhelm Eduard Albrechts (1800–1876): „Wir denken uns heutzutage [. . .] den Staat nicht als eine Verbindung von Menschen, die lediglich und unmittelbar für individuelle Zwecke und Interessen derselben, sey es Aller oder Vieler, oder auch eines Einzelnen, namentlich etwa des Herrschers, berechnet ist, sondern als ein Gemeinwesen, als eine Anstalt, die über den Einzelnen stehend, zunächst Zwecken gewidmet ist, die keineswegs bloß die Summe individueller Interessen des Herrschers und der Unterthanen, sondern ein höheres, allgemeines Gesamtinteresse bilden [. . .].“87 Otto Mayer läßt damit, anders als die damals überwiegende Meinung,88 einen bestimmten Staatszweck Eingang finden in seinen juristischen Begriff des Staates.
D. Der Zweck des Staates Daß der Staat einen Zweck verfolgt und worin dieser besteht, diese Gedanken gewinnt Mayer wohl durch die Lektüre der Werke Johann Gottlieb Fichtes (1762–1814) und Georg Wilhelm Friedrich Hegels (1770–1831).89 Zumindest von Hegels Philosophie des Rechts90 ist aufgrund eigener Äußerungen Mayers bekannt, daß er bereits als Student in Berlin versucht hat, sich in sie einzuarbeiten. Er habe damals, so schreibt er, auf eine ordentliche Anleitung verzichtet, da er alles „ganz autodidaktisch [. . .] durch ein hartnäckiges Ringen mit den schwerfälligen Texten erreichen“ wollte. Ganz ohne Erfolg geblieben sei es nicht. Insbesondere habe er „eine ganz andere 85
Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (55 Fn. 1). Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (54). 87 Rez. Maurenbrecher, Göttingische gelehrte Anzeigen 1837, S. 1489 (1491 f.), Nachdruck S. 3 f. 88 Vgl. insbesondere: Laband, Staatsrecht I2 (1888), S. 63. 89 Hegel wird von Otto Mayer als einer „unsere[r] größten Rechtsphilosophen“ bezeichnet, Fichte, in: Rektoratswechsel an der Universität Leipzig (1913), S. 17 (25). Zudem sei der Jurist „in aller ihm geziehmenden Bescheidenheit“ immer geneigt, Hegel „für einen recht großen Philosophen zu halten [. . .]“, Wert des Völkerrechts (1915), in: Otto Mayer-Kl. Schriften II, S. 16 (16). 90 „Grundlinien der Philosophie des Rechts – Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse“, Berlin 1821. Bei dem Buch, mit dem Otto Mayer sich in Hegels „Grundlinien der Philosophie des Rechts“ einarbeitet, handelt es sich um ein Exemplar der „Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse“, hrsg. von Eduard Gans im Rahmen der Werkausgabe des „Vereins von Freunden des Verewigten“ Bd. 8, 3. Aufl., Berlin 1854 (Privatbesitz). So die Angabe von: Heyen, Quaderni Fiorentini 8 (1979), S. 275 (282 Fn. 20). 86
60
3. Kapitel: Die „moderne Staatsidee‘‘ Otto Mayers
Hochachtung vor dem Staate“ gewonnen. Die habe ihn empfindlich gemacht gegenüber unzutreffenden Begriffsbestimmungen des Staates. Neben diejenige, nach welcher der Staat das „als sich dauernd darstellende räumliche Zusammenwohnen der Menschen miteinander“ sei, habe er daher „Botokudenstaat“91 geschrieben.92 Die „Hochachtung vor dem Staate“, die ihm die Lektüre Hegels vermittelt, rührt von der Tatsache her, daß dem Zweck des Staates, den Otto Mayer aus den Schriften Hegels herausliest, etwas Großartiges, ja Metaphysisches anhaftet. So schreibt Mayer, „Hegel“ habe „es so kräftig gesagt“, „dass der Endzweck des Staates nicht die ,Sicherung des Lebens und Eigentums der Individuen‘ sei“; diese seien Hegel zufolge vielmehr „,als ein verschwindendes Moment gesetzt‘ gegenüber der Wirklichkeit der sittlichen Idee“.93 Der Zweck des Staates, den „die Weltgeschichte bezeuge“94, sei, wie schon Fichte bekundet habe – dessen Gedanken insoweit in Hegel ihren „vollendetsten Ausdruck“ gefunden hätten95– und wie auch von Gerber zu Recht herausgehoben und aufgewiesen habe, auf das Volk als einer „geschichtlichen Größe“ gerichtet, also nicht auf die „Summe der einzelnen jetzt lebenden Menschen“, „sondern [auf] das in geschichtlicher Gemeinschaft geistig verbundene Ganze, welches in der jetzt lebenden Generation nur seine gegenwärtige Erscheinung“ finde.96 Der Staat sei eine „Einrichtung“, welche die Aufgabe und die Wirkung habe, „Volkseinheiten zu schaffen und zu erhalten, Menschengemeinschaften, die in solcher Gestalt zusammengebunden ihre Eigenart entfalten und zur Geltung bringen sollen 91 Um aufzuzeigen, welches Bild zur Zeit Otto Mayers über die „Botokuden“ vorherrschte, sei aus der auf das Jahr 1929 datierenden 15. Auflage des dritten Bandes vom Großen Brockhaus zitiert, in der es über die „Botokuden“ heißt: „Südamerikanischer Indianerstamm [. . .] in Espirito Santo [. . .]. [. . .] Sie leben in sehr primitiven Verhältnissen; die Männer liegen der Jagd ob, während die Frauen tier. und pflanzl. Nahrungsmittel sammeln. Das Haus besteht aus einem einfachen Dach, unter dem die B[otokuden], auf der Erde liegend, schlafen. Töpferei, Hängematten, Kanus fehlen. Ihre Waffen sind Pfeil und Bogen von außergewöhnlicher Größe.“ 92 Selbstdarstellung (1924), S. 3. 93 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (51). 94 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (47). 95 Fichte, in: Rektoratswechsel an der Universität Leipzig (1913), S. 17 (23, 25). 96 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (51). Vgl. auch: Staatsrecht (1909), S. 26; ebd., S. 17: „Aber hier ist nicht die geschichtliche Größe in Frage, für die der Staat da ist [. . .].“; ebd., S. 18: „Der Staat kann seinem Zweck, die Leiblichkeit der geschichtlichen Erscheinung eines Volkes zu sein, [. . .].“; ebd., S. 90: „Aber wie beim Volke die jeweils vorhandene Menschenmenge einen engeren Begriff Volk bildet als gegenwärtige Trägerschaft der geschichtlichen Aufgabe und Mittel zu ihrer Erfüllung, und wie zu diesem Zweck die Menschenmenge in einer festen Ordnung verbunden erscheint, Staat genannt, [. . .].“ Vgl. auch: Schiffahrtsabgaben II (1910), S. 38: „Das Ding [scil.: der Staat] [. . .] bedeutet eine geschichtlich gewordene Unterabteilung des Deutschen Volkes [. . .].“
D. Der Zweck des Staates
61
gegenüber den andern und handelnd und duldend mitarbeiten an dem Gange der Geschichte der Menschheit.“ Diese Einrichtung sei es, „die, um mit Hegels Hohem Lied auf den Staat zu reden, die konkreten Ideen, die Völkergeister, für den Weltgeist formt, ,um dessen Thron sie als die Vollbringer seiner Verwirklichung und als Zeugen und Zieraten seiner Herrlichkeit stehen‘“.97 Der Staat soll also mit anderen Worten die auf seinem Gebiet lebenden Menschen zu etwas „Unvergänglichem“, zu einer „Nation“ vereinen.98 Dazu sei der Staat ein „rauhes Wesen, das sehr ungemütlich werden“ könne, den Menschen von Jugend auf einschränke, und in Anspruch nehme auf mancherlei Weise.99 So dürfe der Staat, indem er dazu bestimmt sei, der „Zukunft der geschichtlichen Größe Volk [. . .] seine Gestalt zu geben“, seine „Menschen massenweise hinopfern“.100 Gar am „kraftvollsten“ verfolgt aus der Sicht Otto Mayers der Staat seinen Zweck, der geschichtlichen Größe Volk zu dienen, wenn er „seine Heere dem Feinde entgegen wirft zur Verteidigung des Vaterlandes, Menschenleben vernichtet und Städte zerstört und den friedlichen Bevölkerungen Kriegsleistungen auferlegt“.101 „Aber wunderbar! Die er so packt, die lieben ihn dafür, sie nennen 97
Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (47). Hervorhebung im Original. Vgl. Fichte, in: Rektoratswechsel an der Universität Leipzig (1913), S. 17 (22 ff.). Bezeichnend ist auch, daß Otto Mayer § 157 der Rechtsphilosophie Hegels, wo dieser dem Begriff der Sittlichkeit die Begriffe von Familie, bürgerlicher Gesellschaft und Staatsverfassung zuordnet, mit den Worten „fehlt die Nation“ kommentiert, Heyen, Quaderni Fiorentini 8 (1979), S. 275 (285); ders., Otto Mayer, S. 68. Vgl. auch: Bullinger, Öffentliches Recht und Privatrecht, S. 59 f.: „Die Erhebung des Nationalstaates zu einsamer Höhe hatte Hegels wirkungsmächtige Philosophie vollzogen.“ Daß Otto Mayer in der Vereinigung des Volkes zu einer Nation den Zweck des Staates sieht, erklärt sich auch daraus, daß sich in Deutschland seit den Befreiungskriegen zu Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Entstehung eines Nationalbewußtseins ein ideelles Streben nach Nationalstaatlichkeit entwickelt hatte, das erst mit Erlaß der Reichsverfassung vom 16. April 1871 befriedigt wurde. Da diese Verfassung maßgeblich auf das politische Wirken Otto von Bismarcks zurück ging, wurde die durch sie herbeigeführte Lösung der nationalen Frage als eine Lösung „von oben“ empfunden. Infolgedessen richtete sich das Nationalbewußtsein auf den Staat aus. Von ihm verlangte man die Einigung des deutschen Volkes, vgl. T. Nipperdey, in: Böckenförde (Hrsg.), Verfassungsgeschichte, S. 274 (287); dazu auch Huber, in: Böckenförde (Hrsg.), Verfassungsgeschichte, S. 171 (175). Ausführlich zur Entwicklung der nationalen Bewegung äußert sich Böckenförde [in: ders. (Hrsg.), Verfassungsgeschichte, S. 27 ff.]. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, daß Otto Mayer als Student Mitglied einer Burschenschaft war [Selbstdarstellung (1924), S. 3.]. Die Burschenschaften nämlich waren einer der wichtigsten Träger der nationalen und liberalen Bewegung, vgl. Kimminich, Verfassungsgeschichte2, S. 325 f. 99 Festrede (1911), S. 4. 100 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 15; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 15. Ähnlich auch: Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (51). 98
62
3. Kapitel: Die „moderne Staatsidee‘‘ Otto Mayers
sein Gebiet ihr Vaterland und wachsen unter sich zusammen zu einem Volk, das sich in der Zugehörigkeit an diesem Staat seiner Einheit bewußt ist, eins trotz aller Verschiedenheit des Stammes, Standes, der religiösen Überzeugungen.“102 Daß der Staat einem höheren Zweck zu dienen bestimmt ist, findet bei Otto Mayer nicht allein im Begriff der Anstalt seinen Niederschlag. Enthalten ist dieser Aspekt des Staates vielmehr bereits im Wort „Gemeinwesen“, mit dem Otto Mayer den Staat zu kennzeichnen sucht, wenn er den Staat als „das handlungsfähige Gemeinwesen, zu welchem ein Volk unter einer obersten Gewalt, der Staatsgewalt zusammengefaßt ist“, definiert.103 Unter einem „Gemeinwesen“ nämlich versteht Otto Mayer „Menschengemeinschaften für Zwecke, die über die Zwecke von Einzelmenschen hinausgehen. Das Hauptbeispiel“ sei „gerade der Staat [. . .].“104 „,Wesen‘ mit irgend einem Zusatz“ bedeute „die Einrichtung und Tätigkeit nach der bestimmten Seite hin“.105 Konsequenz dessen, daß der Staat einen Zweck verfolgt, der über die Zwecke einzelner hinausgeht, aber auch Konsequenz dessen, daß der Staat de facto entsteht, ist, daß Otto Mayer die „Idee des s t a a t s g r ü n d e n d e n V e r t r a g e s “, wonach „das Volk als Masse der einzelnen [. . .] den Staat durch einen Vertrag“ schafft „unter sich und mit dem künftigen Herrscher“, als „Schwächlichkeiten“ abtut.106 Eine weitere Folge dessen, daß Otto Mayer unter Berufung auf Fichte und Hegel dem Staat einen geradezu metaphysischen Zweck zuerkennt, ist, daß der Wille des Staates für ihn einen höheren Wert, eine einseitig bindende Kraft besitzt, mithin, daß der Staat mit oberster Gewalt ausgestattet und somit souverän ist.107 Zum Ausdruck kommt dies bereits in der Ansicht Otto Mayers, es sei „vor Allem das Werk der Hegelischen Schule“ Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 11. Festrede (1911), S. 4. 103 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 3. 104 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 15; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 15. 105 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (68). Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 1; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 1: „Der S t a a t ist das geordnete Gemeinwesen, zu welchem ein Volk zusammengefaßt ist, um seine Eigenart in der Geschichte zu entwickeln und zur Geltung zu bringen. Für dieses Gemeinwesen und zur Erfüllung seiner Zwecke wird mancherlei Tätigkeit geübt [. . .].“ Hervorhebung im Original. 106 Fichte, in: Rektoratswechsel an der Universität Leipzig (1913), S. 17 (20 f.). Hervorhebung im Original. 107 „Und zum Ausdrucke seiner hoheitlichen Macht und Herrlichkeit hatte sich nunmehr der folgenreiche Begriff der Souveränität durchgesetzt.“, Völkerrecht und Völkermoral, AöR 38 (1918), S. 1 (3). 101 102
D. Der Zweck des Staates
63
gewesen, die „Anerkennung der allgemeinen höheren Natur des Staatswillens zu verbreiten“.108 Deutlicher noch läßt sich diese Tatsache aus Sätzen Otto Mayers herauslesen, in denen es heißt, daß „an dem Staate eine besondere rechtliche Wirkungskraft zum Vorschein kommen [müsse], die in seiner Natur als Gemeinwesen begründet“ sei, „die öffentliche Gewalt“,109 und daß „der Staat [. . .] seinem Zweck, die Leiblichkeit der geschichtlichen Erscheinung eines Volkes zu sein, nur nachkommen [könne] dadurch, daß er für diese einen bestimmten Raum der Erde in Anspruch“ nehme „und mit seiner Herrschaft“ erfülle. „Alles Leben, das auf seinem Raum erscheint“, unterliege „seiner Ordnung und keiner anderen. So nur“ sei „er für die dazu gehörigen Menschen das, was er sein soll[e]: Ordnung einer obersten Gewalt.“110 Der dem Staat unter Berufung auf Fichte und Hegel zugesprochene „großartige“ Zweck erklärt damit, daß für Otto Mayer der „Staat in all seiner Herrlichkeit“111 mit „Ehrfurcht“ betrachtet werden muß,112 und daß dessen Dasein „einen so unendlichen Wert“ hat, daß der Staat „eben kein gewöhnlicher Privatmann“ ist,113 daß er „zu gewaltig [ist], um sich in den Rahmen zu fügen, der für Unternehmungen des bürgerlichen Rechts geformt ist“.114 Dieser Zweck offenbart sonach, weshalb Otto Mayer von dem Staat als „Simson“ spricht, „den man vergeblich zu binden“ suche „mit den neuen Stricken der juristischen Persönlichkeit“,115 daß die Annahme, der Staat lasse sich mit Hilfe des für das Privatrecht entwickelten Begriffes der juristischen Person rechtlich begreifen, eine „theoretische Degradierung“116 desselben bedeute, eine „kleinliche Künstelei, unwürdig der majestas, vor der wir stehen“,117 ja, daß angesichts des geradezu metaphysischen Staats108 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (30 Fn. 39). In Hegels Rechtsphilosophie unterstreicht Otto Mayer überdies den folgenden Satz in § 331: „Das Volk als Staat ist der Geist in seiner substantiellen Vernünftigkeit und unmittelbaren Wirklichkeit, daher die absolute Macht auf Erden.“, Heyen, Quaderni Fiorentini 8 (1979), S. 275 (285). 109 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 15 f.; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 15. Hervorhebung nicht im Original. 110 Staatsrecht (1909), S. 18. Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 588: „Hier nun handelt es sich um die Verfolgung des Staatszwecks und die dazu dienende Staatsgewalt.“ Hervorhebung nicht im Original. 111 Völkerrecht und Völkermoral, AöR 38 (1918), S. 1 (25). 112 Vgl. Französisches Verwaltungsrecht (1886), Vorwort S. XI; Entschädigungspflicht (1904), S. 26. 113 Wert des Völkerrechts (1915), in: Otto Mayer-Kl. Schriften II, S. 16 (21 f.). 114 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (63). 115 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (67). 116 Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 589. 117 Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 329. Von einer „Verkörperung der Majestät des Staates“ spricht Otto Mayer in: Rez. Ryffel, AöR 19 (1905), S. 420 (424).
64
3. Kapitel: Die „moderne Staatsidee‘‘ Otto Mayers
zwecks der Jurist „mit seinen Formeln den Staat nicht völlig [. . .] fassen“ könne, da „hier Dinge am Werke“ seien, „die sich seiner eigenartigen Rechenkunst“ entzögen, weshalb „unsere Studien notgedrungen auf dieses J e n s e i t i g e am Staate, das Metajuristische, wie man es schon genannt hat, sich ausdehnen“ müßten.118
E. Zusammenfassung Aus der Sicht Otto Mayers ist der Staat Voraussetzung allen Rechts und darum nicht als eine juristische Person, sondern als ein Zustand oder eine äußerliche Ordnung zu denken. Diese ist errichtet für einen abgegrenzten Teil der Erdoberfläche und die zugehörige Menschengemeinschaft. Sie ist notwendig mit oberster, also souveräner Gewalt ausgestattet. Das Merkmal der Souveränität ist daher für den Begriff des Staates bei Otto Mayer unentbehrlich. Deshalb auch kann ein Staat nicht als Bundesstaat gedacht werden. Grund und Legitimation dessen, daß der Staat mit oberster Gewalt ausgestattet ist und sein Wille eine einseitig bindende Kraft besitzt, rühren für Otto Mayer von dem Umstand her, daß der Staat Inbegriff der sich mit dem Ablauf der Geschichte wandelnden Idee vom Staate ist, somit auch Verkörperung der „modernen“ Staatsidee, die davon ausgeht, daß der Staat ein Gemeinwesen bildet und damit einen über das Ziel einzelner hinausgehenden Zweck verfolgt, nämlich den, die auf dem Staatsgebiet lebende Menschengemeinschaft zu einer Nation zu vereinen. Da diesem Zweck in den Augen Otto Mayers etwas Großartiges anhaftet, kommen dem Staat „Majestät“ und „Herrlichkeit“ zu und erheischt das Antlitz des Staates „Ehrfurcht“. Unangemessen erscheint es daher Otto Mayer, den Staat einem gewöhnlichen Privatmanne gleichzustellen.
118
Schiffahrtsabgaben II (1910), S. 63. Hervorhebung im Original.
4. Kapitel
Das Methodenverständnis Otto Mayers Im zweiten Kapitel wurde dargelegt, daß Otto Mayer sich in seiner wissenschaftlichen Vorgehensweise an einer in der Zivilrechtswissenschaft zur Anwendung gelangten Methode orientiert. Gemeint ist die von Rudolf von Jhering (1818–1892) mit dem Adjektiv „juristisch“1 umschriebene Methode.2 Es liegt daher der Gedanke nahe, die Methode Otto Mayers mit der „juristischen“ Methode gleichzusetzen. Dabei bliebe jedoch unberücksichtigt, daß es für Otto Mayer nicht die eine „juristische“ Methode gibt. Namentlich seine eigene sieht er durch eine Besonderheit gekennzeichnet: „Wenn man mich als Vertreter der ,juristischen Methode‘ bezeichnet, so darf das nicht bedeuten, daß keine andere hier diesen Namen verdiente. Die meine hat ihre Eigenart, die ich nicht verleugnen darf. Sie beruht auf dem Glauben an die Macht allgemeinerer Rechtsideen, die in den Mannigfaltigkeiten des wirklichen Rechts zur Erscheinung und Entfaltung kommen, zugleich aber auch ihrerseits in der Geschichte sich wandeln und fortschreiten.“3 Ausführlicher geht Otto Mayer auf sein Methodenverständnis nicht ein. Obgleich er die Behauptung aufstellt, „System und Methode zu haben“, müsse „ja ein jeder sich angelegen sein lassen, der es unternimmt, einen rechtswissenschaftlichen Gegenstand zu behandeln“,4 nimmt er an verschiedenen Stellen nur in kurzen Sätzen5 zu seinem eigenen Methodenverständnis Stellung. Als Grund dafür gibt er an, daß er „Auseinandersetzungen über Methodenfragen“ nicht liebe und „es namentlich nie [habe] verstehen können, wie einer zum Zeichen, daß er gesonnen ist, sich ernsthaft mit ei1 Unsere Aufgabe, Jahrbücher 1 (1857), S. 1 (21): „Während die naturhistorische, oder nennen wir sie von jetzt an die juristische Methode [. . .].“ 2 Vgl. Rez. Spiegel, AöR 25 (1909), S. 489 (489): „Auch die Verwerflichkeit der ,juristischen‘, besser gesagt ,zivilistischen‘ Methode hat schon Stoerk in seiner ,viel zu wenig gewürdigten Schrift‘ gegen Laband dargetan. Der letztere wird jetzt mit mir in Parallele gestellt: was ich für das deutsche Verwaltungsrecht verbrach, liess er sich vorher bezüglich des deutschen Staatsrechts zu Schulden kommen.“ 3 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), Vorwort S. VIII. 4 Rez. Spiegel, AöR 25 (1909), S. 489 (489). 5 In der im vorangegangenen Absatz gegen Ende angeführten knappen Textpassage [Nachweis in Fn. 3.] äußert sich Otto Mayer am ausführlichsten zu seinem Methodenverständnis!
66
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
nem Zweige der Wissenschaft zu beschäftigen, zunächst einmal mit einem Buch oder einer größeren Abhandlung über Begriff und Methode dieses Zweiges die Öffentlichkeit in Anspruch nehmen mag.“6 Anders als Otto Mayers Begriff vom Staat erschließt sich daher der Zugang zu Otto Mayers Verständnis einer wissenschaftlichen Arbeitsweise nicht bereits aus dessen eigenen Werken. Erforderlich ist zunächst eine Analyse der Grundlinien, wie sie übereinstimmend von den wichtigsten Vertretern der „juristischen“ Methode der Wissenschaft vom Recht zugrunde gelegt wurden. Sodann wird offenbar, worin Otto Mayer die „Eigenart“ seiner „juristischen“ Methode sieht.
A. Die „juristische“ Methode Auch wenn ihr Name dies vermuten läßt, war die „juristische“ Methode doch keineswegs die in der Jurisprudenz des 19. Jahrhunderts gemeinhin angewandte Methode. Das Adjektiv „juristisch“ wurde daher auch nicht im Sinne von „rechtswissenschaftlich“ verstanden. Es sollte vielmehr die Dogmatik umschreiben7 und damit eine eigene Art der wissenschaftlichen Arbeit innerhalb der Jurisprudenz kennzeichnen.8 I. Die Erkenntnis aus dem System Charakterisiert war diese Arbeit im wesentlichen durch die Idee, daß wissenschaftliche Erkenntnis allein im System9 gewonnen werden könne.10 6 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), Vorwort S. VIII. Ähnlich: Rez. Spiegel, AöR 25 (1909), S. 489 (489): „System und Methode selbst zum Gegenstande wissenschaftlicher Darstellung zu wählen, ist Sache besonderer Neigung, und etwas Lesbares daraus zu machen, eine besondere Gabe. Wenn beides so gänzlich fehlt, wie dem Referenten [. . .].“ 7 Jhering, Unsere Aufgabe, Jahrbücher 1 (1857), S. 1 (7): „Ich wende mich jetzt dem eigentlichen Gegenstande der vorliegenden Betrachtung zu, der Dogmatik. Auf sie paßt der Name der receptiven und productiven Jurisprudenz in ungleich höherem Maße, denn nur auf ihrem Gebiet kann von wirklichen juristischen Productionen die Rede sein.“ 8 Wilhelm, Methodenlehre, S. 7. 9 Die Begriffe „Dogmatik“ und „Systematik“ werden zu Unrecht oft in eins gesetzt, vgl. Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee und System, S. 11 Fn. 8. 10 Vgl. O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 19: „Das der deutschen Rechtswissenschaft eigentümliche Bedürfnis nach strenger Systematik [. . .].“ Noch im Jahre 1940 formulierte Sauer [Methodenlehre, S. 171.] unter Bezugnahme auf Rudolf von Jhering: „Das System ist das letzte große Ziel aller, nicht lediglich historischer Wissenschaften. Nur das System verbürgt Erkenntnis, verbürgt Kultur. Nur im System ist möglich wahres Wissen, wahres Wirken. Alle Erkenntnis ist systematische Erkenntnis.“ Vgl. auch: Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee und System,
A. Die „juristische‘‘ Methode
67
Schon Georg Friedrich Puchta (1798–1846),11 der mit seinen Werken wie kaum ein anderer den Vertretern der „juristischen“ Methode den Weg weisen sollte,12 hatte die Bedeutung des Systems13 herausgestrichen. Als ein Anhänger der von Friedrich Carl von Savigny (1779–1861) begründeten historischen Rechtsschule, die, so Puchta, „auf den Begriff des Nationellen zurück[gegangen]“ war und „in diesem den natürlichen Grund des Rechts und des Staates“ erkannt hatte, erblickte auch Puchta „die rechtserzeugende Kraft“ im „Geist des Volkes“.14 Anders als die reine historische Rechtsschule begriff Puchta indes als „Rechtsquellen“ – verstanden als „die Organe, welche dem Recht [. . .] seine sichtbare Gestalt geben“ – nicht nur die unmittelbare Volksüberzeugung [scil.: das aus der Gewohnheit erkennbar werdende Recht15] und die Gesetzgebung, sondern auch die Wissenschaft.16 Da die von dieser aufgedeckten Rechtssätze „nicht auf einer äußeren Autorität“ beruhten, konnten sie nur gelten, „insofern sie aus den Principien des S. 7 f.; dens., in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen, S. 1 (1): „Hat sich nicht alles Systemdenken letztlich als Relikt eines Wissenschaftsverständnisses erwiesen, das für das 18. und 19. Jahrhundert seine Berechtigung haben mochte?“ Siehe zudem: C. Schmitt, ZgesStaatsWiss 100 (1940), S. 5 (6 f.); Meyer-Hesemann, Methodenwandel, S. 41; Böckenförde, Gesetz2, S. 212 f.; Wieacker, Privatrechtsgeschichte2, S. 431 ff.; Schröder, Wissenschaft, S. 245 f.; Canaris, System2, S. 21; Jerusalem, Rechtswissenschaft, S. 134, 142 ff.; Remmert Übermaßverbot, S. 109 f.; Coing, Universitas 7 (1952), S. 241 (241 f., 243). 11 Ausführlich zu den Werken und der Methode Puchtas: Landsberg, Geschichte III 2, S. 438 ff.; Wilhelm, Methodenlehre, S. 70 ff.; Larenz, Methodenlehre6, S. 19 ff.; Bohnert, Rechtslehre; Wieacker, Privatrechtsgeschichte2, S. 399 ff. m. w. N. in Fn. 73. 12 So schreibt Jhering [Unsere Aufgabe, Jahrbücher 1 (1857), S. 1 (26).]: „[. . .] bedeutendsten Werk der Gegenwart, dem Cursus der Institutionen von Puchta [. . .]. Der letztgenannte Schriftsteller, dessen frühen Tod ich zu den härtesten Schlägen zähle, die die Jurisprudenz in unserem Jahrhundert erlitten, war, wenn irgend einer, berufen, die fernere Bewegung in unserer Wissenschaft zu leiten. [. . .] für die eigentliche V e r b r e i t u n g der juristischen Methode unter die große Masse hat sich keiner ein solches Verdienst erworben, als er [. . .].“ Hervorhebung im Original. Und bei Gerber [Akademische Rede (1851), in: Gesammelte Abhandlungen (1878), S. 1 (13).] heißt es: „[. . .] und wie namentlich Puchta diesen grossen Sieg des deutschen Geistes durch das eigenthümliche System befestigte, mit dem er das römische Recht durchdrungen hat.“ Hervorhebung im Original. Windscheid [Die Aufgaben der Rechtswissenschaft (1884), in: Gesammelte Reden und Abhandlungen (1904), S. 100 (105).] wiederum schreibt: „[. . .] die Richtung, die übrigens in ihrem Ursprung auf Puchta zurückgeht, [. . .].“ Vgl. auch: Larenz, Methodenlehre6, S. 20; Wilhelm, Methodenlehre, S. 70; Wieacker, Privatrechtsgeschichte 2, S. 400. 13 Die Geschichte des Systemgedankens und -begriffes beleuchtet: Stein, in: Diemer (Hrsg.), System und Klassifikation, S. 1 ff. 14 Kritik (1844), S. 5. 15 Kritik (1844), S. 10. 16 Cursus der Institutionen I3 (1850), S. 30. Vgl. auch: Kritik (1844), S. 17; Gewohnheitsrecht I (1828), 165 f.
68
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
bestehenden Rechts mit innerer Nothwendigkeit folg[t]en“.17 Eine „wissenschaftliche Ansicht“ könne „nur dann Recht“ sein, „wenn sie wissenschaftlich begründet, also wenn sie wahr“ sei. „Um dieses zu seyn“, müsse „sie in das System eingefügt, d. h. eben innerlich begründet [. . .] seyn“.18 Überdies sei „nur die systematische Kenntnis des Rechts [. . .] eine vollständige“, [. . .] „weil das Recht selbst ein System“ sei, „so daß nur wer es als solches“ erkenne, „seine Natur vollkommen“ erfasse.19 Carl Friedrich von Gerber (1823–1891)20, der zusammen mit Paul Laband (1838–1918)21 die „juristische“ Methode später auch in der Staatsrechtswissenschaft umsetzte,22 sprach von der „systematischen Aufgabe der Wissenschaft“,23 der „so ausserordentlich bedeutenden Wirksamkeit“, „welche für jede dogamtische Aufgabe aus der Begründung eines wissenschaftlichen Systems“ hervorgehe.24 In der „systematischen Anordnung des Stoffes“ mußte man für ihn „die Erfüllung einer durch sich selbst gerechtfertigten Forderung der Wissenschaft erkennen“.25 Rudolph von Jhering (1818–1892)26 schließlich glaubte, die „Aufgabe der Wissenschaft“ sei es, die innere „Gliederung des Rechts zu erforschen, für das Kleinste wie das Größte die richtige Stelle aufzusuchen. Diese systematische Seite der Jurisprudenz“ sei „für die Erkenntnis des Rechts von ungleich höherer Bedeutung, als es auf den ersten Blick“ scheine.27 Cursus der Institutionen I3 (1850), S. 45. Gewohnheitsrecht I (1828), S. 166. 19 Cursus der Institutionen I3 (1850), S. 100. 20 Eingehender erörtern die Methode Gerbers: Pauly, Methodenwandel, S. 92 ff.; Wilhelm, Methodenlehre, S. 91 ff.; Landsberg, Geschichte III 2, S. 778 ff.; Stolleis, Geschichte II, S. 331 ff.; Losano, in: Gedächtnisschrift Tammelo, S. 647 ff.; Friedrich, AöR 111 (1986), S. 197 (204 ff.); ders., Geschichte, S. 222 ff. m. w. N. in Fn. 2. 21 Zu Leben, Werk und Methode Paul Labands ausführlicher: Pauly, Methodenwandel, S. 177 ff.; Stolleis, Geschichte II, S. 341 ff.; Friedrich, Geschichte, S. 256 ff. m. w. N. in Fn. 1. 22 Remmert, Übermaßverbot, S. 110; Meyer-Hesemann, Methodenwandel, S. 38 f.; Badura, Verwaltungsrecht, S. 51 f. 23 Akademische Rede (1865), in: Gesammelte Abhandlungen (1878), S. 23 (30). 24 Akademische Rede (1865), in: Gesammelte Abhandlungen (1878), S. 23 (29). 25 System des Deutschen Privatrechts15 (1886), Vorrede (1848) S. III. Vgl. ebd., Vorrede (1848) S. IV: „In der That hat sich die Geringschätzung des Systems bei den bisherigen Schriftstellern [. . .] vielfach gerächt“. Vgl. zudem: ebd., Vorrede (1850), S. XIV: „Auch dem Systeme glaubt der Verfasser einen wesentlichen Antheil an der Lösung jener Aufgabe zuschreiben zu müssen.“ 26 Ausführlich zu der Methodenlehre Jherings: Wilhelm, Methodenlehre, S. 112 ff.; Larenz, Methodenlehre6, S. 24 ff., 43 ff.; Wolf, Große Rechtsdenker2, S. 556 ff.; Landsberg, Geschichte III 2, S. 788 ff.; Wieacker, Privatrechtsgeschichte2, S. 450 ff., jeweils m. w. N. 17 18
A. Die „juristische‘‘ Methode
69
II. Der Begriff des Systems Der Begriff des Systems bedeutete für die Vertreter der „juristischen“ Methode nicht eine bloße Zusammenfassung verschiedener, einem einheitlichen, äußerlichen Ordnungsgesichtspunkt genügender Elemente, mithin nicht ein bloßes Ordnungsschema. Vielmehr sollte das System mehrere Elemente nach einem Prinzip auswählen und miteinander verknüpfen, das nicht nur eine Aussage darüber ermöglicht, welche Art von Elementen zum System gehört, sondern auch darüber, wie die zum System gehörenden Elemente sich untereinander verhalten und miteinander zusammenhängen.28
Geist des römischen Rechts I4 (1878), S. 36. Die Explikation dieser verschiedenen Systembegriffe stammt von Peine [System, S. 32 ff., 39 ff., bes. S. 54, 58.]. Auch Coing [Geschichte des Systemgedankens, in: Frankfurter Universitätsreden 17, S. 26 (26).] schreibt, man müsse zwischen einem engeren Systembegriff, welcher das deduktive System bezeichne, und einem weiteren, der nur die Stoffordnung nach übergreifenden Gesichtspunkten meine, unterscheiden. Fikentscher [Methoden des Rechts IV, S. 97 ff.] differenziert gleichfalls zwischen solcher Art verschiedenen Systembegriffen. Jerusalem [Rechtswissenschaft, S. 123 ff.] sondert von dem „echten“ System, welches durch Geschlossenheit, Einheit gekennzeichnet sei, das „unechte“ ab. Canaris [Systembegriff2, S. 12.] vertritt demgegenüber die Auffassung, allen bislang entwickelten Systembegriffen [die er auszugsweise auf S. 11 f. zitiert; zu ihnen siehe auch: Stettner, Kompetenzlehre, S. 238 f. m. w. N.] seien die Merkmale Ordnung und Einheit gemeinsam. Dem folgt Larenz [Methodenlehre6, S. 168 f. Vgl. auch: Luhmann, Zweckbegriff und Systemrationalität, S. 36. Ders., Funktionen und Folgen formaler Organisation4, S. 23: „In der ontologischen Denktradition wird System durch die Begriffe Ganzes, Teil und Beziehung definiert. Ein System besteht darin, daß Einheiten (Substanzen) durch Beziehungen als Teile zu einem Ganzen verbunden werden. Das System ist die Interdependenz der Teile im Rahmen eines Ganzen. Die Art, wie die Teile zu einem Ganzen zusammengeordnet sind, macht die Struktur des Systems aus.“]. Die Annahme, allen Systembegriffen seien die Merkmale der Ordnung und Einheit gemeinsam, läßt sich jedoch nur aufrecht erhalten, wenn man wie Larenz [Methodenlehre6, S. 171.] davon ausgeht, daß man bei einer bloßen Ordnung nicht schon von einem System, sondern nur von einer „Reihe“ sprechen könne. Denn Peine [System, S. 20 ff.] weist zu Recht darauf hin, daß die Begriffe „Ordnung“ und „Einheit“ abhängig sind von dem Prinzip, welches entweder „Ordnung“ oder „Einheit“ stiften soll. Kritisch zu Canaris äußert sich darum auch Fikentscher [Methoden des Rechts III, S. 646 ff.; Methoden des Rechts IV, S. 96.]. Die Explikation von Peine auf das 19. Jahrhundert zu übertragen, ist angesichts dessen, daß sich Peine [System, S. 54 ff.] auf den bereits im 18. Jahrhundert von Johann Heinrich Lambert (1728–1777) entwickelten Systembegriff stützt, sowie in Anbetracht dessen, daß laut Coing [in: Blühdorn/Ritter (Hrsg.), Philosophie und Rechtswissenschaft, S. 149 (149)] auch für das 19. Jahrhundert einerseits zwischen dem System als der Ordnung des Stoffes – sei es eine subjektive planmäßige Ordnung oder die Spiegelung einer objektiven Ordnung – und andererseits dem System als einem deduktiven Begründungszusammenhang von Sätzen unterscheiden müsse, gerechtfertigt. 27 28
70
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
Das System sollte mithin in einer Mannigfaltigkeit eine Einheit29 entfalten.30 So sah Friedrich Carl von Savigny in einem juristischen System den „inneren Zusammenhang, welcher alle Rechtsinstitute und Rechtsregeln zu einer großen Einheit verknüpft“.31 Darauf aufbauend formulierte Puchta, „die systematische Erkenntnis“ sei „die Erkenntnis des inneren Zusammenhangs, welcher die Theile des Rechts verbinde[]; sie“ fasse „das Einzelne als Glied des Ganzen auf“.32 Und Carl Friedrich von Gerber sagte: „Wenn man auch immer erkannt hat, daß der Begriff des Systems den Gedanken einer nothwendigen Fügung des Einzelnen unter die einheitliche Herrschaft der Gesamtidee einschließe, so hat man doch selten die Nothwendigkeit einer consequenten Durchführung desselben festgehalten [. . .].“33 Die einzelnen Rechtsinstitute mußten daher für ihn „zu einer systematischen Einheit verbunden werden“, die auf „eigenen spezifisch juristischen Prinzipien“ beruhen sollte.34 Ein System hatte für ihn die „Aufgabe, auch der Mannigfaltigkeit ihr Recht zu geben, aber sie zugleich der Einheit des Ganzen zu verbinden.“35 Die systematische Einheit36 des Rechts erblickte man in der Ableitbarkeit eines niedriger plazierten aus einem höher plazierten Rechtsbegriff.37 Die Vertreter der „juristischen“ Methode meinten nämlich, daß das gesamte Recht eines Rechtsgebietes auf immer allgemeiner werdende Begriffe und damit letztlich auf einen einzigen Grundbegriff38 logisch zurückgeführt und Larenz [Methodenlehre6, S. 19.] formuliert dies für alle Systeme. Peine [System, S. 55.], weist jedoch daraufhin, daß das im Zusammenhang mit dem Begriff System verwendete Wort der „Einheit“ stets das Verhältnis der einzelnen Teile zueinander und ihr Verhältnis zum Gliederungs- oder Ordnungsgesichtspunkt betrifft. 30 Vgl. Larenz, Methodenlehre6, S. 20 ff.; Canaris, Systemdenken2, S. 20 f.; Coing, Universitas 7 (1952), S. 241 (241 f., 243); Schröder, Wissenschaft, S. 245 f. 31 System des heutigen römischen Rechts I (1840), S. 214. 32 Cursus der Institutionen I3 (1850), S. 100. 33 System des Deutschen Privatrechts15 (1886), Vorrede (1848) S. III. 34 System des Deutschen Privatrechts15 (1886), S. 14. 35 System des Deutschen Privatrechts15 (1886), Vorrede (1848) S. VI. 36 Siehe insoweit die Ausführungen von Peine [System, S. 108.] zu axiomatischen Systemen. 37 Vgl. Larenz, Methodenlehre6, S. 20 ff., 24 ff., 28 ff.; Canaris, Systemdenken2, S. 20 f.; Böckenförde, Gesetz2, S. 212 f.; Wieacker, Privatrechtsgeschichte2, S. 431 ff; Remmert, Übermaßverbot, S. 109 f.; Coing, Universitas 7 (1952), S. 241 (241 f., 243). 38 Daher auch der für diese Methode vielfach synonym verwendete Name der „Begriffsjurisprudenz“. Vgl. Laband, Rez. Bartolomei, AöR 19 (1905), S. 615 (617): „[. . .] und die Abneigung der Soziologen gegen die Begriffsjurisprudenz ist die Erklärung des Kriegs gegen die Begriffe selbst. Man kann der juristischen Methode nicht vorwerfen, dass sie sich in einer reinen Begriffsentwicklung erschöpfe.“ 29
A. Die „juristische‘‘ Methode
71
so „konstruiert“ werden müsse.39 Man bildete daher aus den Tatbeständen, die Gegenstand einer Regelung waren, durch Aussonderung und Verallgemeinerung bestimmter Elemente mehrere Gattungsbegriffe. Aus ihnen gewann man dann durch fortlaufendes Aussparen artbestimmender Merkmale immer allgemeinere Begriffe, bis schließlich aus diesem Abstraktionsprozeß ein letzter, allgemeinster Begriff hervorging, der die Spitze der so erzeugten Begriffspyramide bildete, während die konkreten Begriffe ihre Basis bildeten.40 Georg Friedrich Puchta beispielsweise vertrat die Ansicht, daß nur derjenige die „systematische Kenntnis“ des Rechts besitze, „welcher des Zusammenhangs der Rechtssätze sich“ bemächtige und „ihre Verwandtschaft unter einander erforscht“ habe, „so daß [er] die Abstammung eines jeden Begriffs durch alle Mittelglieder, die an seiner Bildung Antheil haben, auf und abwärts [. . .] verfolgen“ könne. Wenn man zum Beispiel das „einzelne Recht, über ein Grundstück zu gehen, welches der Eigenthümer dieses Grundstücks dem Eigenthümer eines benachbarten bestellt hat“, betrachte, so müsse „dem Juristen theils seine Stellung im System der Rechtsverhältnisse, theils der Rechte, also seine Herkunft bis zu dem Begriff des Rechts hinauf zum Bewußtsein kommen“, und er müsse „ebenso von diesem herab zu jenem einzelnen Recht gelangen können, dessen Natur erst dadurch vollkommen bestimmt“ werde. Man „nenne dieß eine Genealogie der Begriffe“.41 Rudolf von Jhering entwickelte hieraus den Unterschied zwischen „höherer und niederer Jurisprudenz“. Unter der „niederen Jurisprudenz“ verstand er diejenige Lehre, welche „dem Rechtsstoff [. . .] seine ursprüngliche und unmittelbar praktische Form“ ließ. Den „Gegensatz der höheren zur niederen Jurisprudenz“ bestimmte er „durch den Gegensatz des Rechts b e g r i f f e s zu der Rechts r e g e l “ , wobei er unter der Rechtsregel, sofern sie allgemein war, das Rechtsprinzip, und, sofern sie konkret war, den Rechtssatz verstand. Der „Übergang des Rechts aus dem niedern in den höhern Aggregatzustand“ werde nun durch „die juristische Construction“ vermittelt, „indem sie den gegeben Rohstoff zu Begriffen verflüchtig[e]“, 42 und „die Thatsachen auf Begriffe“ zurückführe.43 Die „juristische“ Methode 39
Vgl. Park, Rechtsfindung, S. 60. Vgl. Larenz, Methodenlehre6, S. 20, 23, 437 f., 439; Jerusalem, Rechtswissenschaft, S. 130 f., 132, 142, 148, 150 f.; Wieacker, Privatrechtsgeschichte 2, S. 400 f. Siehe zudem: Loening, Konstruktive Methode, Schmollers Jahrbuch 11 (1887), S. 117 (117 f.): „Die eine Auffassung betrachtet es als die wichtigste, nicht selten als die alleinige Aufgabe der Wissenschaft, die Erscheinungen des realen Lebens in Begriffen zusammenzufassen, von den engeren Begriffen zu immer weiteren und höheren fortzuschreiten, um auf diesem Wege schließlich zu einigen wenigen allgemeinen Begriffen zu gelangen.“ 41 Cursus der Institutionen I3 (1850), S. 100 f. 40
72
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
erfordere daher „eine Feststellung des Gattungs- und Artbegriffes, eine genaue Sonderung dessen, was der ganzen Gattung gemein und der einzelnen Art eigenthümlich ist“.44 „Diese Präcipitierung der Rechtssätze zu Rechtsbegriffen“ scheide sodann „die wissenschaftliche Auffassung und Behandlung eines Rechts von der Darstellung desselben in einem Gesetzbuch. Der Gesetzgeber“ könne „sich darauf beschränken, seine Anforderungen in ihrer ursprünglichen, unmittelbar praktischen Form aufzustellen, die Wissenschaft aber“ habe „nicht bloß die Aufgabe, dieselben zu erläutern und ordnen, sondern sie auf logische Momente des Systems zu reducieren“,45 zumal „dem geübten Auge [. . .] das Recht als ein logischer Organismus von Rechtsinstituten und Rechtsbegriffen“ erscheine.46 Im Lehrbuch der Pandekten von Bernhard Windscheid (1817–1892)47 ist zu lesen: „Wenn die Auslegung ihr Geschäft erledigt hat, handelt es sich um die Entwicklung der Begriffe[. . .]. Auch der eigentliche Gedanke des Rechtsgeschäfts stellt sich noch dar in Begriffen, d. h. in Zusammenfassung von Denkelementen; es kommt darauf an, die Begriffe in ihre Bestandteile aufzulösen, die in ihnen enthaltenen Denkelemente aufzuweisen. [. . .] Es liegt zugleich auf der Hand, daß erst aus der vollen Erfassung der Rechtsbegriffe sich das wahre System der Rechte, die innere Zusammengehörigkeit seiner Sätze, ergeben kann.“48 „Die Zurückführung eines Rechtsverhältnisses auf die ihm zugrunde liegenden Begriffe nennt man K o n s t r u k t i o n desselben.“49 Paul Laband formulierte: „Die wissenschaftliche Aufgabe der D o g m a t i k eines bestimmten positiven Rechts liegt aber in der Konstruktion der Rechtsinstitute, in der Zurückführung der einzelnen Rechtssätze auf allge42 Unsere Aufgabe, Jahrbücher 1 (1857), S. 1 (8 f.). Hervorhebung im Original. Ähnlich: Geist des römischen Rechts I4 (1878), S. 37. 43 Unsere Aufgabe, Jahrbücher 1 (1857), S. 1 (28 f. Fn. 9). 44 Unsere Aufgabe, Jahrbücher 1 (1857), S. 1 (16). 45 Geist des römischen Rechts I4 (1878), S. 39. 46 Geist des römischen Rechts I4 (1878), S. 42. 47 Näher zu Windscheid und seiner Methode: Larenz, Methodenlehre6, S. 28 ff.; Wolf, Große Rechtsdenker2, S. 589 ff.; Tripp, Positivismus, S. 212 ff.; Wieacker, Privatrechtsgeschichte 2, S. 446 m. w. N. in Fn. 47. 48 Pandekten I9 (1906), S. 111 f. Larenz [Methodenlehre6, S. 30.] merkt zu dieser Textstelle zu Recht an, daß Windscheid sich damit zum Gedanken des „logischen“ Systems bekenne, da nicht der Zweck einer Regelung, der ethische oder sozialpolitische Sinn eines Rechtsinstituts oder eines ganzen Rechtsgebietes die „innere Zusammengehörigkeit“ der Rechtssätze begründe, sondern die Gemeinsamkeit der in ihnen wiederkehrenden Begriffselemente. Vgl. demgegenüber: Tripp, Positivismus, S. 212 f. 49 Pandekten I9 (1906), S. 112. Hervorhebung im Original. Vgl. auch: Die Aufgaben der Rechtswissenschaft (1884), in: Gesammelte Reden und Abhandlungen (1904), S. 100 (104).
A. Die „juristische‘‘ Methode
73
meinere Begriffe und andererseits in der Herleitung der aus diesen Begriffen sich ergebenden Folgerungen.“50 Man könne „es nicht als richtig anerkennen, wenn jemand der Dogmatik andere Aufgaben stellt[e] als die gewissenhafte und vollständige Feststellung des Rechtsstoffes und die logische Beherrschung desselben durch Begriffe.“51 An einer von ihm rezensierten Arbeit lobt Laband daher, daß diese sich nicht in einer „blosse[n] Zusammenstellung des Materials“ erschöpfe, sondern „eine von einem einheitlichen Gesichtspunkt aus unternommene, streng folgerichtige Konstruktion“ gebe, daß die Arbeit „nach allen Richtungen hin die Konsequenzen des Grundprinzips“ ziehe und auf diese Weise „in überaus lichtvoller Weise den inneren Zusammenhang der einzelnen Rechtssätze und Rechtsbildungen“ darstelle und den Stoff in einer „klare[n] übersichtliche[n] Systematik“ gliedere.52 Für Carl Friedrich von Gerber schließlich mußte die Behandlung des Stoffes „von einem einheitlichen Principe ausgehen“, „aus e i n e m sanktionierenden Momente abgeleitet“ sein.53 Es dünkte ihm „ein dringendes Bedürfnis die Aufstellung eines wissenschaftlichen S y s t e m s zu sein, in welchem sich die einzelnen Gestaltungen als die Entwicklung eines einheitlichen Grundgedankens darstellen“.54 „Als ein wahrhaft juristisches System“ erschien ihm im Privatrecht „allein das S y s t e m d e r R e c h t e , welches den gesammten Rechtsstoff nur als den möglichen Ausdruck des Personenwillens betrachtet. Indem hierdurch das deutsche Recht wieder an die unmittelbar wirksame und lebendige Kraft des menschlichen Willens“ anknüpfe, „d. h. juristisch construiert“ werde, trete „es in die Reihe der die Gegenwart beherrschenden Erscheinungen.“55 Auch Rudolph Sohm (1841–1917)56 propagierte die hier beschriebene Systematik: „Wir denken und reden in juristischen Begriffen. [. . .] Wir gebrauchen die juristischen Begriffe [. . .] als F o r m d e r D a r s t e l l u n g [. . .] und damit zugleich als das M i t t e l , welches uns die Handhabung unseres Rechts [. . .] e r l e i c h t e r t . Durch die juristischen Begriffe bewältigen wir den ungeheuren Stoff. Wir zählen die Rechtssätze nicht nacheinander auf. Wie wäre das möglich! Wir pressen sie in die Rechtsbegriffe hinStaatsrecht I5 (1911), Vorwort (1887) S. IX. Hervorhebung im Original. Staatsrecht I5 (1911), Vorwort (1887) S. IX. 52 Rez. Preuss, AöR 18 (1903), S. 73 (73). 53 Das wissenschaftliche Princip (1846), S. 242. Hervorhebung im Original. 54 Grundzüge des deutschen Staatsrechts3 (1880), Vorrede (1865) S. VI. Hervorhebung im Original. 55 System des Deutschen Privatrechts15 (1886), Vorrede (1850) S. XIV. Hervorhebung im Original. 56 Zu weiterführender Literatur über Rudolph Sohm: Wieacker, Privatrechtsgeschichte2, S. 471 Fn. 8. 50 51
74
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
ein. Jeder Rechtsbegriff belehrt uns über unzählig viele Rechtssätze. Die Masse der Rechtssätze wird auf verhältnismäßig kurze Formeln gebracht, und diese Formeln treten zu einem von einem Grundgedanken beherrschten System zusammen.“57 III. Die Produktivität der Rechtswissenschaft Ihrem systematischen Vorgehen schrieben die Vertreter der „juristischen“ Methode eine produktive Kraft zu. Aus den allgemeineren Begriffen vermeinten sie auch „neue“ Rechtssätze gewinnen zu können, indem sie den Inhalt der konkreteren Begriffe aus den allgemeineren ableiteten, also im Wege einer „wissenschaftlichen Deduktion“ vorgingen.58 Sie selbst allerdings sprachen – wohl auch, weil sie erkannt hatten, daß aus einem Begriff nur das abgeleitet werden kann, was in diesem bereits enthalten ist59 – häufig lediglich davon, bereits vorhandenes, wenngleich bislang verborgenes Recht „aufzudecken“.60 Das Recht eines Rechtsgebietes zu „konstruieren“ bedeutete damit nicht nur, die bereits vorhandenen Rechtssätze auf einen einheitlichen Grundbegriff zurückzuführen. Es bedeutete auch, aus den allgemeinen Begriffen bislang nur latent existentes Recht deduktiv abzuleiten. Die „Konstruktion“ des Rechts war mithin der Versuch, das Recht als lückenlose Emanation einer zentralen Idee aufzufassen.61 Wiederum war es Georg Friedrich Puchta, der diese Gedanken zuerst in aller Deutlichkeit aussprach: „Es ist die Aufgabe der Wissenschaft, das gegebene Recht auf seine Principien zurückzuführen, und aus diesen jene 57
Über Begriffsjurisprudenz, DJZ 14 (1909), Sp. 1019 (1021). Hervorhebung im Original. Vgl. auch: Institutionen15 (1917), S. 37, 39. 58 Vgl. Larenz, Methodenlehre6, S. 21 f.; Jerusalem, Rechtswissenschaft, S. 132, 150, 157. Schröder [Wissenschaft, S. 249 f.] hingegen meint, im Vordergrund der Findung neuer Rechtssätze habe gestanden die Induktion, also die Prinzipienbildung. 59 Spätestens durch Otto von Gierke (1841–1921) wurden sie darauf hingewiesen, vgl. Gierke, Rez. Laband, Schmollers Jahrbuch 7 (1883), S. 1097 (1110). 60 Siehe nur: Puchta, Kritik (1844), S. 19, 20 f.: „Diese Rechtsätze [. . .] sind allerdings in ihm schon als Keime angelegt [. . .].“ Vgl. auch: Stampe, Rechtsfindung, DJZ 10 (1905), Sp. 417 (417 f.): „[. . .] erzielt die Rechtsfindung durch Konstruktion – welche ihre Tätigkeit konsequent nicht als Rechtsf i n d u n g , sondern als Aufdeckung von latent bereits v o r h a n d e n e m Rechte auffaßt –, die neuen Rechtssätze, welche sie braucht, durch rein l o g i s c h e Operation.“ Hervorhebung im Original. Dazu auch: Jerusalem, Rechtswissenschaft, S. 146. 61 Vgl. Stampe, Rechtsfindung, DJZ 10 (1905), Sp. 417 (417); Oertzen, Positivismus, S. 10; Wieacker, Privatrechtsgeschichte 2, S. 430 ff.; Larenz, Methodenlehre6, S. 441 f.; Jerusalem, Rechtswissenschaft, S. 165; Schröder, Wissenschaft, S. 267 f. A. A. wohl: Schröder, Wissenschaft, S. 270 f.
A. Die „juristische‘‘ Methode
75
nothwendigen Ergänzungen abzuleiten. So hat die Jurisprudenz nicht bloß eine receptive, sondern wie jede wahre Wissenschaft eine productive Aufgabe, sie tritt selbst in die Reihe der Rechtsquellen. Ich habe das durch sie erzeugte Recht, welches nicht wie jene anderen auf einer äußeren, sondern lediglich auf innerer Autorität beruht, und allein um der Wahrheit seiner Deduktion willen gilt, das Recht der Wissenschaft genannt.“62 „Ich habe [zudem] angedeutet, es sei ein Hinausgehen über den Standpunct der reinen historischen Schule nothwendig gewesen, um zu dieser dritten Rechtsquelle zu gelangen. Dies wird einleuchten, wenn man erwägt, daß diese Schule vorzugsweise der freien Seite des Rechts, denn dies eben ist die geschichtliche, sich zukehrt, seine logische und vernünftige dagegen zwar nicht negirt, aber doch in den Hintergrund gestellt, und ihr weniger Einfluß, als ihr gebührt, zuerkannt hat.“63 Carl Friedrich von Gerber schloß sich den Ausführungen Puchtas an: „Und was endlich diejenigen Rechtsnormen betrifft, welche durch die Thätigkeit der J u r i s t e n , die W i s s e n s c h a f t , erzeugt werden, so sind sie ihrer Natur nach nur a c c e s s o r i s c h e , d. h. durch das Vorhandensein eines gesetzlichen oder positiven Rechtsstoffes bedingte, indem die Wissenschaft nur in sofern rechtsproductiv ist, als sie das vorhandene Material des positiven Rechts auf seine Principien zurückführt, zu einem Ganzen von sich gegenseitig voraussetzenden und bedingenden Sätzen formirt [Puchta], und mit ernstem Streben nach Wahrheit die in dieser neuen Erscheinungsform sich ergebenden Lücken aus den Grundsätzen des bestehen62 Kritik (1844), S. 17 f. Vgl. auch: Cursus der Institutionen I3 (1850), S. 37: „Es ist nun die Aufgabe der Wissenschaft, die Rechtssätze in ihrem systematischen Zusammenhang, als einander bedingende und voneinander abstammende, zu erkennen, um die Genealogie der einzelnen bis zu ihrem Princip hinauf verfolgen, und ebenso von den Principien bis zu ihren äußersten Sprossen herabsteigen zu können. Bey diesem Geschäft werden Rechtssätze zum Bewußtsein gebracht und zu Tage gefördert werden, die in dem Geist des nationellen Rechts verborgen, weder in der unmittelbaren Überzeugung der Volksglieder und ihren Handlungen, noch in den Aussprüchen des Gesetzgebers zur Erscheinung gekommen sind, die also erst als das Produkt einer wissenschaftlichen Deduction sichtbar entstehen. So tritt auch die Wissenschaft als dritte Rechtsquelle zu den ersten beiden; das Recht, welches durch sie entsteht, ist Recht der Wissenschaft, oder, da es durch die Thätigkeit der Juristen ans Licht gebracht wird, Juristenrecht.“ 63 Kritik (1844), S. 18 f. Angesichts dieser und auch der oben wiedergegeben Aussagen haben die von Coing [in: Blühdorn/Ritter (Hrsg.), Philosophie und Rechtswissenschaft, S. 149 (151).] und Tripp [Positivismus, S. 206.] gehegten Zweifel an der Bedeutung der Logik in Puchtas System nur dann Berechtigung, sofern sie sich auf die tatsächliche Durchführung der Methode beziehen. Die Dominanz der Logik in Puchtas System wird bejaht von: Larenz, Methodenlehre6, S. 20; Stephanitz, Wissenschaft, S. 106; Wieacker, Privatrechtsgeschichte 2, S. 400 f.; Wilhelm, Methodenlehre, S. 86; Fikentscher, Methodenlehre III, S. 91 f.; Jerusalem, Rechtswissenschaft, S. 150 f.
76
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
den Rechts auszufüllen sucht.“64 Auch für ihn war daher das „System [. . .] die Grundlage sicherer juristischer Deduktion“.65 Denn „aus der Darstellung selbst“ ergab sich seines Erachtens, „daß die Analyse jener Rechte eine Subsumtion unter diejenigen Kategorien als möglich erscheinen läßt, nach welchen sie sich vermöge ihres hauptsächlichen Gehaltes neigen“.66 Rudolf von Jhering forderte dazu auf, „die latenten Rechtssätze ans Tageslicht zu bringen“.67 Er stand auf dem Standpunkt, „die höhere Jurisprudenz“ sei „nicht bloß Bildnerin des Stoffs, sondern auch Schöpferin“.68 Denn „die Begriffe“ seien „nicht bloße Auflösungen der gegebenen Rechtssätze, aus denen immer nur letztere sich wieder herstellen ließen“, sondern sie gäben auch die „Möglichkeit einer Vermehrung des Rechts aus sich selbst. Durch Combination der verschiedenen Elemente“ könne „die Wissenschaft neue Begriffe und Rechtssätze bilden; die Begriffe“ seien „productiv, sie paaren sich und zeugen neue“.69 Rudolph Sohm wiederum schrieb: „Das nennen wir juristisches Denken: die Welt der Rechtssätze sich untertan machen durch Ergreifen der in ihnen lebendigen Begriffe und aus diesen Begriffen Recht schöpfen für jeden, auch den unmittelbar im Gesetz nicht geregelten Fall.“ Die „Begriffsjurisprudenz“ gebe „uns Fingerzeige, wie wir die Lücken des positiven Rechts füllen“.70 Paul Laband schließlich meinte, man müsse aus „den gefundenen Prinzipien [die] sich ergebenden Folgerungen entwickel[n]“.71 „Denn bei der wissenschaftlichen Erörterung eines jeden Rechtssatzes, ergibt sich das unabweisbare Bedürfnis, die Zusammenhänge mit den Rechtsbegriffen, die Beziehungen zu den parallel laufenden Rechtsbildungen aufzusuchen und die daraus sich ergebenden Ergänzungen, Einschränkungen, Modifikationen, Wechselwirkungen zu ermitteln.“ 72 64
Das wissenschaftliche Princip (1846), S. 277 f. Hervorhebungen im Original. „Das Recht“, schreibt von Gerber [Akademische Rede (1851), in: Gesammelte Abhandlungen (1878), S. 1 (11).] außerdem, „ist nicht blos eine Thatsache, die gewusst, es ist zugleich eine lebendige Macht, von der die Gegenwart beherrscht sein soll. Daher ist es notwendig, dass die aus der Geschichte gewonnenen Rechtsideen nun wiederum aus ihrer historischen Verbindung gelöst, und nicht blos als folgenreiche Thatsachen äusserlich erzählt und geschildert werden, sondern als lebendige Glieder eines in unserem eigenen Wollen und Empfinden begründeten Organismus erkannt werden. Diese Thätigkeit ist eine wesentlich productive, sie ist ein vollständiges Erzeugen des Geschichtlichen für die Gegenwart.“ 65 Grundzüge des deutschen Staatsrechts3 (1880), Vorrede (1865) S. VI. 66 System des Deutschen Privatrechts15 (1886), Vorrede (1848) S. VII. 67 Geist des römischen Rechts I4 (1878), S. 35. 68 Unsere Aufgabe, Jahrbücher 1 (1857), S. 1 (14). 69 Geist des römischen Rechts I4 (1878), S. 39 f. 70 Über Begriffsjurisprudenz, DJZ 14 (1909), Sp. 1019 (1021 f.). 71 Staatsrecht I5 (1911), Vorwort (1876) S. VI.
A. Die „juristische‘‘ Methode
77
IV. Das Recht als System apriorischer Begriffe Um zu begründen, warum das gesamte Recht unter die Herrschaft allgemeiner Begriffe gebracht werden könne und müsse, stellte man das System der Begriffe als ein in sich abgeschlossenes und damit Neuerungen unzugängliches dar.73 Rudolf von Jhering etwa äußerte: „Denn in wie ungewöhnlichen, abweichenden Bildungen sich auch der fortschreitende Verkehr ergehen möge, die Besorgnis, daß er uns etwas absolut Neues bringen könnte, d. h. etwas, was nicht unter irgend einen unserer bisherigen Begriffe fiele, und wäre derselbe auch noch so allgemein, – diese Besorgnis ist ebenso unbegründet, als wenn man glauben wollte, es könnten heutzutage noch Thiere entdeckt werden, die im zoologischen System der heutigen Wissenschaft absolut kein Unterkommen fänden.“74 Und Paul Laband schrieb: „Gesetze können lückenhaft sein, die Rechtsordnung selbst aber kann ebenso wenig eine Lücke haben wie die Ordnung der Natur.“75 Daher „ist die Schaffung eines neuen Rechtsinstitutes, welches einem höheren und allgemeineren Rechtsbegriff überhaupt nicht untergeordnet werden kann, gerade so unmöglich wie die Erfindung einer neuen logischen Kategorie oder die Entstehung einer neuen Naturkraft.“76 In den Begriffen hatten sich damit zeitlos gültige Aussagen über Recht derart verselbständigt, daß eine aus ihnen gezogene Schlußfolgerung wiederum „richtiges“ Recht war. Die Begriffe besaßen eine unmittelbare und unwandelbare Realität.77 Puchta zum Beispiel war der Meinung, „jeder dieser Begriffe“ sei „ein lebendiges Wesen, nicht ein todtes Werkzeug“.78 Jhering wiederum betrachtete die Begriffe als „juristische Existenzen, [. . .] lebende[] Wesen, dienende[] Geister“.79 Gerber erachtete es als „nothwendig, dass die geschichtlichen Stoffe des deutschen Rechts geistig durchdrungen und zu selbständigen begrifflichen Existenzen gefördert werden. Vor allem“ sei „es erforderlich, aus diesen Stoffen [. . .] selbständige Rechtsinstitute zu 72
Rez. Mayer, AöR 2 (1887), S. 149 (156). Hervorhebung nicht im Original. Vgl. Wieacker, Privatrechtsgeschichte 2, S. 433, 436; Jerusalem, Rechtswissenschaft, S. 152 f., 157; Schröder, Wissenschaft, S. 247 f. 74 Unsere Aufgabe, Jahrbücher 1 (1857), S. 1 (16). 75 Budgetrecht (1871), S. 75. 76 Staatsrecht I5 (1911), Vorwort (1876) S. VI. 77 Vgl. Loening, Konstruktive Methode, Schmollers Jahrbuch 11 (1887), S. 117 (121): „Die andere Gefahr, der die konstruktive Methode leicht verfällt, liegt in der eigenthümlichen und, wie es scheint, unausrottbaren Neigung des menschlichen Geistes, die von ihm gebildeten Begriffe als selbständige Wesen zu betrachten, denen auch außerhalb des menschlichen Geistes eine reale Existenz zukommt.“ Siehe auch: Wieacker, Privatrechtsgeschichte 2, S. 433 f.; Böckenförde, Gesetz2, S. 213. 78 Cursus der Institutionen I3 (1850), S. 101. 79 Unsere Aufgabe, Jahrbücher 1 (1857), S. 1 (10). 73
78
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
bilden, die, wie Jhering trefflich“ sage, „nicht blosse Conglomerate von einzelnen Rechtssätzen“ seien, „sondern Existenzen, logische Individualitäten, juristische Wesen, an denen sich die bildnerische Kraft der Wissenschaft“ versuche, „indem sie ihr eigenthümliches Leben“ erkenne „und zur Entfaltung“ bringe.80 Und Sohm sagte noch nach Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches, daß sich die Grundbegriffe des Rechts zwar auf dem Boden des geltenden Rechts erweisen lassen müßten, jedoch dem „unbewußten Gesetzesinhalt“ angehörten, und zudem „in den Tiefen des Rechts, die von Wind und Wellen der Gegenwart nicht bewegt werden“, wohnten. Sie seien von „eherner, den Jahrhunderten trotzender Dauerkraft“. Daher auch habe das Bürgerliche Gesetzbuch keine neuen Grundbegriffe gebracht. „Wie wäre das möglich gewesen?“81 V. Der Sinn und Zweck eines Systems apriorischer Begriffe In der Vorstellung, daß sich das bereits vorhandene, wie auch das vom Gesetzgeber neu erlassene82 Recht um seiner Gültigkeit Willen auf Begriffe reduzieren lassen mußte, die ungeachtet ihrer Gewinnung durch fortlaufende Abstraktion einen unabänderlichen Charakter besaßen, mithin als vorgegeben, allein aus der Vernunft geboren, also als apriorisch angesehen wurden,83 offenbarte sich der Wunsch, das Recht vergeistigen und damit von den sich wandelnden politischen, soziologischen, ökonomischen, historischen, aber auch philosophischen Grundlagen lösen zu können.84 Dieser Wunsch nach einer Ablösung des Rechts von seinen gesellschaftlichen Fundamenten war wiederum motiviert durch zweierlei Bestrebungen. Einmal sah man in der Formalisierung des Rechts die alleinige Gewähr für eine Behauptung der Gerechtigkeit sowohl gegenüber der reaktionären Restauration, als auch gegenüber einer kommenden Revolution.85 So verteidigte Georg Friedrich Puchta in einem an Ernst Ludwig von Gerlach (1795–1877) gerichteten, auf den 16. Februar 1844 datierenden Brief86 80
Autonomie (1859), in: Gesammelte Abhandlungen (1878), S. 64 (68). Vermögensrecht, ABR 28 (1906), S. 173 (175 f., 177). Vgl. auch: Über Begriffsjurisprudenz, DJZ 14 (1909), Sp. 1019 (1022). 82 Vgl. Jerusalem, Rechtswissenschaft, S. 149; Larenz, Methodenlehre6, S. 22 f. Fn. 8. 83 Vgl. Böckenförde, Gesetz2, S. 213, 214, 217. 84 Vgl. Larenz, Methodenlehre6, S. 32; Wilhelm, Methodenlehre, S. 96 f., 101, 104, 107, 121 ff. 85 Vgl. Stolleis, Geschichte II, S. 331, 347; Wilhelm, Methodenlehre, S. 142 ff.; Böckenförde, Gesetz2, S. 214. 86 Der Brief ist abgedruckt bei: Liermann/Schoeps, Materialien, in: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 1961, S. 489 (500–502). Die Hervorhebungen im nachfolgenden Zitat finden sich auch im Original. 81
A. Die „juristische‘‘ Methode
79
seine Idee von einem Rechtssystem und seine damit verbundene Auffassung, daß das göttliche dem menschlichen Rechte weichen müsse unter anderem mit den Worten: „Der Jurist dagegen hat das Interesse, nun von vornherein den Begriff des Rechts streng und rein zu fassen, und seine Übergänge in andere Gebiete als Modifikationen jenes Begriffs zu behandeln, und damit zugleich in ihre erforderlichen Schranken einzuschließen. Dieses Interesse ist ein theoretisches – von Ihrem Standpunkt, ist ein Rechtssystem unmöglich, es ist aber auch ein praktisches, das Recht sicherzustellen, gegen Staatskünstler, mögen sie in der Jakobinermütze oder in der Tiara auftreten. [. . .] Teuerster Freund! Wenn Sie im Dunkel der Nacht aufsitzen, und an Ihrem Staat und Ihrem [scil.: göttlichen] Recht formen, vernehmen Sie nicht nebenan die Communisten87 zimmern und graben, nur durch eine dünne Wand von Ihnen geschieden?“ Und Carl Friedrich von Gerber schrieb im Revolutionsjahr 1848: „Denn es ist ein Irrthum, wenn man so manche durch Jahrhunderte gepflegte Rechtsinstitute durch einen einzigen Griff entwurzeln zu können vermeint; das zu Grunde liegende R e c h t s p r i n z i p , dem oft Unkenntnis und blinder Eifer die Schuld seiner zufälligen Anwendung in einer den politischen Anforderungen der Zeit widerstrebenden Weise beimißt, wird sich in anderer Verbindung immer von neuem kundgeben [. . .].“88 Nur wenige Jahre später äußerte er: „Die Möglichkeit der r e c h t l i c h e n Construktion eines Verfassungszustandes gewährt eine wichtige Garantie seines Bestehens; [. . .]. Eine solche Möglichkeit kann aber nur sehr unvollständig erwartet werden in einer Zeit, in welcher die öffentlichen Befugnisse als Stoffe behandelt werden, denen Jeder seine eigene subjektive Anschauung glaubt beilegen zu dürfen, in welcher die Elemente des Staatslebens im unklaren Wogen und trüben Flusse begriffen sind, und das Concrete, Reale, welches das Recht fordert, dem bloß Abstrakten, Idealen weichen muß.“89 Gerber postulierte daher: „Soll dieß [scil.: das Recht] zu seiner vollen inneren Selbständigkeit und zu einer ausgebildeten Technik gebracht werden, so daß es nicht mehr nur auf der sinnlichen Anschauung thatsächlicher Verhältnisse, sondern auf der sicheren 87 Das von Karl Marx und Friedrich Engels verfaßte „Manifest der Kommunistischen Partei“ erschien zwar erst im Februar 1848 in deutscher Sprache. Seinen Anfang nahm der Kommunismus jedoch bereits in der französischen Revolution von 1789 [vgl. dazu: Kollmer, Kommunismus, S. 11 ff.]. Das Bild, das in Deutschland vor dem Jahre 1848 über den Kommunismus vorherrschte, gibt ein aus dem Jahre 1846 stammendes Gedicht von Hoffmann von Fallersleben treffend wieder [Abgedruckt bei: Kollmer, Kommunismus, S. 17.]: „Der Communist kennt Arm nicht noch Reich,/der Communist macht Alles gleich./Dem ruhigen Bürger, dem nimmt er sein Gut,/daß er’s nach Belieben vertheilt und verthut./Er führet ein schreckliches Regiment,/er raubet und mordet, er senget und brennt [. . .].“ 88 System des deutschen Privatrechts15 (1886), Vorrede (1848) S. IX. Hervorhebung im Original. 89 Ueber öffentliche Rechte (1852), S. 22 f. Hervorhebung im Original.
80
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
Basis der exakten juristischen Kunst beruht, so ist eine Lösung desselben von jenen Verbindungen ein unabweisbares Bedürfnis.“90 Nur so erhielten namentlich „die öffentlichen Rechte [. . .] hierdurch die Festigkeit und Sicherheit der Privatrechte, und“ verlören „auf diese Weise jenen unklaren und unsicheren Bestand, bei dem sie lediglich als der launenhaften Willkühr der Tagesmeinung preisgegebene Elemente“ erschienen.91 Der oben genannten Forderung nach einer Ablösung des Rechts von seinen gesellschaftlichen Grundlagen und damit einer Reduktion des Rechts auf apriorische Begriffe lag zum anderen das Ziel zugrunde, die Jurisprudenz zu einer selbständigen und den „exakten“ Naturwissenschaften92 ebenbürtigen Wissenschaft zu erheben.93 Das Recht sollte nicht mehr nur rezipiert und mitsamt seinen historischen Entstehungsgründen „erzählend“ dargestellt werden.94 Vielmehr galt es, das Recht aus sich selbst heraus durch das beschriebene System abstrakter und zugleich präziser Begriffe zu begreifen und zu „erklären“.95 In Anlehnung an die Terminologie der CheSystem des deutschen Privatrechts15 (1886), Vorrede (1855) S. XV. Ueber öffentliche Rechte (1852), S. 57. 92 Ausführlich über den Einfluß der Naturwissenschaften auf die Jurisprudenz berichtet Stephanitz [Wissenschaft.]. 93 So auch: Stolleis, Geschichte II, S. 331. Für Carl Friedrich von Gerber etwa [Das wissenschaftliche Princip (1846), S. 241 f.] mußte die Behandlung des Rechts eine „wahrhaft wissenschaftliche sein“; sie mußte „den Anspruch auf eine wirkliche Wissenschaft befriedigen können“, indem sie den Rechtsstoff „zu einem abgerundeten Ganzen“ vereinigte, in dem ein „einheitliche[s] Principe [. . .] alle einzelnen Theile beherrscht“. Vgl. auch: Loening, Konstruktive Methode, Schmollers Jahrbuch 11 (1887), S. 117 (119): „Es ist deshalb für jede Wissenschaft unrichtig, die sog. konstruktive Methode als die allein richtige, als die allein wissenschaftliche zu bezeichnen, und so auch für die Rechtswissenschaft.“ 94 Vgl. Gerber, System des deutschen Privatrechts15 (1886), Vorrede (1848) S. III f.: „Die Consequenz eines nach dem Inhalte der Rechte zu schaffenden Systems erfordert [. . .] Ausscheidung alles Fremdartigen und eine Darstellung, welche nicht die Natur gewöhnlichen Erzählens“ haben darf. 95 Forsthoff, Verwaltungsrecht I10, S. 49. Paul Laband [Staatsrecht I5 (1911), Vorwort (1876) S. V, VI.] vertrat die Meinung, daß das Verständnis der „Verfassung selbst, die Erkenntnis ihrer Grundprinzipien und der aus letzteren herzuleitenden Folgesätze und die wissenschaftliche Beherrschung der neu geschaffenen Rechtsbildungen ein immer steigendes Interesse“ gewinne und Bedürfnis sei. „Die Befriedigung dieses Bedürfnisses“ aber könne „mit einer bloßen Zusammenstellung der Artikel der Reichsverfassung und der Reichgesetze unter gewissen Überschriften [. . .] nicht gelöst werden; ebensowenig durch die Hinzufügung von Stellen aus den Motiven der Gesetzesvorlagen und aus den Verhandlungen des Reichstages, welche meistens doch nur Erwägungen de lege ferenda“ enthielten. Es handele „sich vielmehr um die Analyse der neu entstandenen öffentlich rechtlichen Verhältnisse, um die Feststellung der juristischen Natur derselben und um die Auffindung der allgemeinen Rechtsbegriffe, denen sie untergeordnet sind.“ Denn „die wissenschaftliche Behandlung des Rechts“ bestehe „eben darin, daß sie die Erscheinungen des Rechtslebens nicht nur beschreibt, sondern erklärt und auf allgemeine Begriffe zurückführt.“ 90 91
A. Die „juristische‘‘ Methode
81
mie, Physik, Mathematik und Technik96 „analysierte“ man aus dem Recht das reine juristische „Element“,97 forschte mithin „konstruktiv“ gleich den Naturwissenschaften nach einer hinter den erscheinenden „Körpern“98 stehenden „Gesetzlichkeit“.99 Eine berühmt gewordene Rede von Julius Herrmann von Kirchmann (1802–1884) erläutert, daß die Vertreter der „juristischen“ Methode die aus der Abstraktion gewonnenen Begriffe als vorgegeben und unwandelbar ansahen, um in ihnen die hinter dem Recht stehende „Gesetzlichkeit“ erblikken zu können. Kirchmann äußerte in dieser Rede 1847, daß die Jurisprudenz, wenn sie den Anspruch einer echten Wissenschaft erheben wolle, dieselbe Aufgabe „wie die aller anderen Wissenschaften“ erfüllen müsse; sie habe „ihren Gegenstand zu verstehen, seine Gesetze zu finden, zu dem Ende die Begriffe zu schaffen, die Verwandtschaft und den Zusammenhang der einzelnen Bildungen zu erkennen und endlich ihr Wissen in ein einfaches System zu fassen“.100 Diese Aufgabe jedoch könne die Jurisprudenz nicht erfüllen, sofern man den Gegenstand der Jurisprudenz im positiven Recht erblicke.101 Denn der Gegenstand einer „wahren“ Wissenschaft sei wie bei den Naturwissenschaften nur „das natürliche, das ewige, das notwendige“, das „die Willkür [. . .] der Wissenschaft nicht zu verfälschen“ vermöge.102 Das positive Recht aber sei veränderlich103 und damit nicht Ausdruck ewiger Wahrheiten: „Wenn also die Gesetze der Natur und Kräfte Vgl. auch: Laband, Rez. Preuss, AöR 18 (1903), S. 73 (73): „[. . .] sowie andererseits im Gegensatz zu denjenigen Werken, welche sich auf eine Registrierung der positiven Gesetzes- und Verwaltungsvorschriften und Urteile beschränken, ist die vorliegende Monographie von echt wissenschaftlichem Geiste durchweht und vom ehrlichen Streben nach der Erkenntnis der Wahrheit erfüllt.“ 96 Vgl. Stolleis, Geschichte II, S. 332 Fn. 79. 97 Vgl. Gerber, System des deutschen Privatrechts15 (1886), Vorrede (1848) S. VIII f.: „Dieß sind die Ideen, welche mich bei der Begründung eines Systems des deutschen Privatrechts geleitet haben. Es kam mir hauptsächlich auf die Analyse und Construction des rein juristischen Elements der Rechtsinstitute an [. . .].“ Vgl. auch: Laband, Staatsrecht I5 (1911), Vorwort (1876) S. VI. 98 Vgl. Jhering, Unsere Aufgabe, Jahrbücher 1 (1857), S. 1 (9 f.): „[. . .] den Übergang des Rechts aus dem niedern in den höhern Aggregatzustand vermittelt die juristische Construction, indem sie den gegebenen Rohstoff zu Begriffen verflüchtigt. Die Umwandlung, die hiermit erfolgt, besteht negativ darin, daß der Stoff [. . .] die Gestalt eines juristischen Körpers annimmt.“ 99 Vgl. Böckenförde, Gesetz2, S. 212 f. Pauly [Methodenwandel, bes. S. 98 ff.] spricht davon, daß Gerber und Laband das Recht auf der Grundlage eines „Codes“ zu erklären und zu konstruieren gedacht hätten. 100 Jurisprudenz (1848), Nachdruck, S. 12. Ähnlich auch: ebd., S. 27. 101 Jurisprudenz (1848), Nachdruck, S. 7 f., 24 ff. 102 Jurisprudenz (1848), Nachdruck, S. 36. 103 Jurisprudenz (1848), Nachdruck, S. 29: „[. . .]; drei berichtigende Worte des Gesetzgebers und ganze Bibliotheken werden zu Makulatur.“
82
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
auch erst nach langen Bemühungen entdeckt wurden, so sind sie doch für die Gegenwart so wahr wie für die Vorzeit und bleiben wahr für alle Zukunft. Anders in der Rechtswissenschaft. Hat diese endlich nach langjährigen Bemühungen den wahren Begriff, das Gesetz einer ihrer Bildungen gefunden, so ist inzwischen der Gegenstand schon ein anderer geworden; die Wissenschaft kommt bei fortschreitender Entwicklung immer zu spät, niemals kann sie die Gegenwart erreichen.“104 Daher könne sich die Jurisprudenz nur dann zu einer wahren Wissenschaft erheben, wenn sie sich wieder auf das Naturrecht besinne.105 Spätestens jedoch mit der auf das Scheitern der Revolution von 1848 einsetzenden reaktionären Politik, die zu offenbaren schien, daß sich die Ideen des Naturrechts nicht realisieren ließen, war das Interesse an naturrechtlichspekulativen Werken erloschen,106 war, mit den Worten Bernhard Windscheids aus dem Jahre 1854, endgültig der „Traum des Naturrechts ausgeträumt“.107 Daher mußte, wenn man an die Jurisprudenz den Anspruch stellen wollte, eine autonome Fachwissenschaft zu sein,108 die gleich den Naturwissenschaften aus dem ihr eigentümlichen Anschauungsmaterial eine hinter den Erscheinungen stehende, unabänderliche „Gesetzlichkeit“ erforschte, einerseits den wechselhaften gesellschaftlichen Faktoren jeder Einfluß auf eine Rechtsbegründung abgesprochen werden, so daß die „ethischen, politischen oder volkswirtschaftlichen Erwägungen“ nicht mehr „Sache des Juristen als solchen“ waren,109 und man sich auf eine logische110 und formale111 Betrachtung des Rechts beschränken konnte. Ande104
Jurisprudenz (1848), Nachdruck, S. 16 f. Jurisprudenz (1848), Nachdruck, S. 24 ff., 45, 46 f. 106 Dazu: Stolleis, Geschichte II, S. 275 f.; ders., in: Jeserich/Pohl/Unruh (Hrsg.), Deutsche Verwaltungsgeschichte III, S. 85 (87); C. Schmitt, ZgesStaatsWiss 100 (1940), S. 5 (16 f.). Vgl. auch: Remmert, Übermaßverbot, S. 100; Stephanitz, Wissenschaft, S. 149. 107 Recht und Rechtswissenschaft (1854), in: Gesammelte Reden und Abhandlungen (1904), S. 3 (9). Vgl. auch: Die Aufgaben der Rechtswissenschaft (1884), in: Gesammelte Reden und Abhandlungen (1904), S. 100 (105). 108 Vgl. Wieacker, Privatrechtsgeschichte 2, S. 432. 109 Windscheid, Die Aufgaben der Rechtswissenschaft (1884), in: Gesammelte Reden und Abhandlungen (1904), S. 100 (112). Pauly [Methodenwandel, S. 143.] weist für Carl Friedrich von Gerber daraufhin, daß dieser allein für die formale grundbegriffliche Seite des Rechts die Geschichte und andere Faktoren aus der Rechtswissenschaft verbannt habe, nicht jedoch für die Hermeneutik. Dies dürfte indes für nahezu alle Vertreter der „juristischen“ Methode gegolten haben. 110 Vgl. Laband, Staatsrecht I5 (1911), Vorwort S. IX: „Die wissenschaftliche Aufgabe der D o g m a t i k eines bestimmten positiven Rechts liegt aber in der Konstruktion der Rechtsinstitute, in der Zurückführung der einzelnen Rechtssätze auf allgemeinere Begriffe und andererseits in der Herleitung der aus diesen Begriffen sich ergebenden Folgerungen. Dies ist [. . .] eine rein logische Denktätigkeit. Zur 105
A. Die „juristische‘‘ Methode
83
rerseits war es erforderlich, die allgemeineren Begriffe, in denen sich die „Gesetzlichkeiten“ verkörperten, als „selbständige Existenzen“ zu betrachten, auf die der Gesetzgeber keinen Zugriff nehmen konnte.112 Es war im Besonderen Rudolf von Jhering, der die Annahme, daß die Jurisprudenz das positive Recht als Ausfluß apriorischer Begriffe begreifen müsse, wenn sie eine Wissenschaft wie etwa die Physik sein wolle, repräsentativ113 zum Ausdruck brachte. Jhering war davon überzeugt, die Frage, worin die „innere[] Nothwendigkeit“, „die Natur der Sache“ liege, habe „die Jurisprudenz [. . .] kaum anders angefaßt und gelöst, als die Naturwissenschaft“.114 Wenn sich jemand über diese Vorgehensweise wundere, sei dies „um nichts besser, als wenn jemand sich wundern wollte, was doch die Naturforscher sich abmühten, das Brennen eines Lichts zu erklären; es sei eine Thatsache, was man mehr wolle? Entweder begnügen wir uns mit den Thatsachen überall, d. h. wir verzichten auf jede Jurisprudenz, oder aber wir suchen die Thatsachen auf Begriffe zurückzuführen“.115 Die „juristische“ Methode belegte er darum auch mit dem Adjektiv „naturhistorisch“,116 einem heute nicht mehr gebräuchlichen Wort für „physikalisch“.117 Jahre späLösung dieser Aufgabe gibt es kein anderes Mittel als die Logik; [. . .].“ Hervorhebung im Original. 111 Vgl. Laband, Rez. Bartolomei, AöR 19 (1905), S. 615 (616): „Das Recht ist lediglich die Form, die äussere Hülle der verwickelten und vielgestaltigen gesellschaftlichen Verhältnisse und es ist gerade eine Eigenschaft der Form, dass sie unabhängig von jedem Inhalt behandelt werden kann. So die Mathematik im Verhältnis zur Physik, welche auf mathematische Formeln zurückgeht.“ Vgl. auch: Laband, Rez. Mayer, AöR 2 (1887), S. 149 (151). 112 Für Carl Friedrich von Gerber [System des deutschen Privatrechts15 (1886), S. 14.] mußte zwar das Rechtssystem auf „eigenen specifisch juristischen Principien“ beruhen, so daß, so Gerber [Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechts3 (1880), S. 238 (Beilage III).] die Rechtswissenschaft die maßgeblichen Prinzipien „nach ihren Gesichtspunkten und den Regeln i h r e r Kunst“ zu entwickeln hatte. [Hervorhebung im Original.] Nicht jedoch war es erforderlich, daß das Prinzip im Rechtsstoff ausgesprochen oder nur angelegt war, vgl. Gerber, Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechts3 (1880), S. 238 (Beilage III); Akademische Rede (1865), in: Gesammelte Abhandlungen (1878), S. 23 (31). Dazu ausführlicher: Pauly, Methodenwandel, S. 101. Im Staatsrecht operierte Gerber daher mit Grundbegriffen, die den positiven Rechtsordnungen der deutschen Staaten voraus lagen, vgl. Pauly, Methodenwandel, S. 13, 101, 146 f., 163; Friedrich, AöR 111 (1986), S. 197 (205); Stolleis, Geschichte II, S. 343; Remmert, Übermaßverbot, S. 111. 113 Jhering sprach hier insbesondere für Gerber mit. Jhering und Gerber nämlich versicherten sich in Briefen gegenseitig der Übereinstimmung ihrer beider Methoden, vgl. dazu mit Nachweisen: Wilhelm, Methodenlehre, S. 89 ff. 114 Unsere Aufgabe, Jahrbücher 1 (1857), S. 1 (17). 115 Unsere Aufgabe, Jahrbücher 1 (1857), S. 1 (28 f. Fn. 9). 116 Unsere Aufgabe, Jahrbücher 1 (1857), S. 1 (21). 117 Wieacker, Privatrechtsgeschichte 2, S. 434 Fn. 12.
84
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
ter, nachdem er sich von der Begriffsjurisprudenz abgewendet hatte, bekannte Jhering zudem, er sei damals der – mittlerweile als irrig erkannten – Vorstellung verfallen, daß die Rechtswissenschaft „eine Mathematik des Rechts“ sei, „die kein höheres Ziel kenne, als ein korrektes Rechnen mit Begriffen“. „Ich suchte darin einst ausschließlich den wissenschaftlichen Charakter der Jurisprudenz, die Befreiung von dem geistigen Druck, mit dem das rein Positive auf mir lastete. Aus der niederen Welt des Positiven, die, heute so, morgen so, meinem wissenschaftlichen Bedürfnis, das etwas Dauerndes, Festes, an sich Wahres begehrte, keine Befriedigung gewährte, rettete ich mich in die höhere Welt der in sich ruhenden Begriffe, an welche die Macht des Gesetzgebers nicht heranreichte.“118 VI. Die Grundlagen eines Systems apriorischer Begriffe Sowohl der Wunsch, der Rechtspflege eine dem politischen Interessenstreit enthobene Neutralität zu sichern, als auch die Idee, die Jurisprudenz zu einer Wissenschaft zu erheben, die nach den hinter den Erscheinungen stehenden, ewigwährenden „Gesetzlichkeiten“ forscht, erklären jedoch allein, zu welchen Zwecken die Vertreter der „juristischen“ Methode bei der Rechtsbegründung von den gesellschaftlichen Gegebenheiten absahen und die Begriffe vom begrenzten Anschauungsmaterial des alltäglichen Rechtsverkehrs abstrahierten, um sie sodann zu „juristischen Wesenheiten quasikategorialer Existenz [zu] verabsolutier[en]“. 119 Daß überhaupt die Annahme von der Unabänderlichkeit der Begriffe und einer Möglichkeit der Ableitung „richtigen“ Rechts aus ihnen Platz greifen konnte, rührte demgegenüber von der deutschen idealistischen Philosophie her,120 die in der Natur nur ein Produkt der menschlichen Vernunft gesehen hatte,121 ja gar versucht hatte, die Welt aus einem einzigen Punkte gedanklich zu begreifen,122 und schließlich als wissenschaftlich eine Erkenntnisse nur dann ansah, wenn sie aus einer obersten Idee deduktiv abgeleitet123 war.124 So schrieb Scherz und Ernst in der Jurisprudenz9 (1904), S. 342. Böckenförde, Gesetz2, S. 217. 120 So Wieacker, Privatrechtsgeschichte 2, S. 434. Vgl. auch: Larenz, Methodenlehre6, S. 19; Jerusalem, Rechtswissenschaft, S. 127 f.; Coing, Universitas 7 (1952), S. 241 (242); ders., Geschichte des Systemgedankens, in: Frankfurter Universitätsreden 17, S. 26 (38). 121 Jerusalem, Rechtswissenschaft, S. 128. 122 Dies gilt namentlich für Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), Friedrich Wilhelm Schelling (1775–1854) und Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), vgl. Larenz, Methodenlehre6, S. 19; Jerusalem, Rechtswissenschaft, S. 128; Stein, in: Diemer (Hrsg.), System und Klassifikation, S. 1 (12). 123 Vgl. Stein, in: Diemer (Hrsg.), System und Klassifikation, S. 1 (12); Larenz, Methodenlehre6, S. 19. 118 119
A. Die „juristische‘‘ Methode
85
Rudolph Sohm: „Der Form nach verschwindet durch die Vorherrschaft des Begriffes die Positivität des Rechts. Die Wissenschaft verfährt, als ob sie die Rechtssätze aus gewissen allgemeinen Prinzipien frei hervorbrächte. Nur dadurch b e g r e i f e n wir das Recht. Nur dadurch wird das künstlerische Bedürfnis des menschlichen Geistes befriedigt, jenes Verlangen, welches die Herrschaft des Stoffes verabscheut. Von den gewonnenen Begriffen begehren wir zu immer höheren Begriffen aufzusteigen. Daher ergibt sich aus dem idealen Instinkte der Rechtswissenschaft das Suchen nach dem R e c h t s s y s t e m , d. h. nach einer Form der Darstellung, welche die ganze Masse des Rechts als die freie Entfaltung eines einzigen Begriffes, des B e g r i f f e s d e s R e c h t s , zur Anschauung bringt. Dann wird der Stoff verschwunden sein, und der Gedanke hat als Sieger das Feld behauptet.“125 Rudolf von Jhering wiederum konnte es „nicht genug hervorheben“, daß die „juristische Methode“ der Wissenschaft es ermögliche, „mit ihren Antworten den Fragen der Praxis voranzueilen, ihr also das demüthige Loos“ erspare, sich lediglich durch die Praxis zu neuen Entdeckungen anregen zu lassen“. Dabei sei es die „treibende Kraft des Gedankens“, die auf „neue Fragen und Rechtssätze“ führe. Denn „wenn irgendwo in einer praktischen Wissenschaft dem menschlichen Geiste der hohe Genuß bereitet ist, rein auf sich selbst angewiesen in der Welt des Gedankens umherzuschweifen und mit reichen Schätzen beladen heimzukehren, so“ sei „es in der Jurisprudenz“.126 Jhering vertrat darum auch die Ansicht: „[. . .] den Grund, warum mit dem Aufschwung der Jurisprudenz in unserem Jahrhundert zugleich ein entschiedener Widerwille gegen das Naturrecht eintrat, und warum auch die heutige Rechtsphilosophie sich eines so geringen Anklangs erfreut, diesen Grund kann ich nicht darin finden, daß sie z u v i e l , sondern daß sie z u w e n i g philosophisches Element enthalten, daß sie es z u w e n i g verstanden haben, uns in den geistigen Organismus der realen Rechtswelt einzuführen und uns die Vorgänge, die sich hier begeben, die Gesetze, die hier regieren, klar zu machen. Eben weil unser philosophisches Bedürfnis in der Dogmatik des römischen Rechts, wie sie heutzutage behandelt wird, eine so vollkommene Befriedigung findet, hat die Rechtsphilosophie einen so üblen Stand.“127 124 Reinhold, Über die Fundamente des philosophische Wissens, Jena 1791, S. 110 [Zitiert nach Stein, in: Diemer (Hrsg.), System und Klassifikation, S. 1 (12 Fn. 47).]: „Die Form der Wissenschaft ist in der Philosophie etwas längst bekanntes. Man wußte längst, daß sie im systematischen bestehe und folglich durch Grundsätze, die alle einem ersten untergeordnet sein müssen, bestimmt werden müsse.“ Vgl. auch: Jerusalem, Rechtswissenschaft, S. 128; Larenz, Methodenlehre6, S. 19. 125 Institutionen15 (1917), S. 40. Allein die Hervorhebung durch Kursivschrift findet sich nicht im Original. 126 Jahrbücher 1 (1857), S. 1 (18 f.). 127 Jahrbücher 1 (1857), S. 1 (19 f.). Hervorhebung im Original.
86
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
Die Annahme von der Unabänderlichkeit der Begriffe und einer Möglichkeit der Ableitung „richtigen“ Rechts aus ihnen war allerdings zugleich eine Hinterlassenschaft des Rationalismus. Dies zeigt sich daran, daß die Rechtswissenschaft zwar alles Recht als ein Ergebnis der historischen Entwicklung und daher als „positiv“ ansah, das „positive“ Recht128 selbst aber als eine vernünftige Ordnung betrachtete, die eben darum der begrifflichen Erfassung und Systematisierung zugänglich war.129 Für Georg Friedrich Puchta etwa läßt sich nachweisen, daß er sich zu der von ihm bekundeten Reduktion des Rechts auf allgemeine Begriffe allein kraft einer dem Recht innewohnenden Vernunft berechtigt glaubte: „Vermöge der vernünftigen Natur des Rechts muß auch das als Recht gelten, was mit innerer Nothwendig128 Nur am Rande sei vermerkt, daß die Ansichten darüber, inwieweit der „Begriffsjurisprudenz“ oder „juristischen“ Methode die Geistesbewegung des „Positivismus“ zugrunde lag, stark differieren. Coing [in: Blühdorn/Ritter (Hrsg.), Philosophie und Rechtswissenschaft, S. 149 (166 f.).] etwa meint, insbesondere Jhering habe dem philosophischen Positivismus Comtes sehr nahe gestanden. Landsberg [Geschichte III 2, S. 802 f.] hingegen sieht weder Jehring noch Gerber als durch den allgemein wissenschaftlichen Positivismus beeinflußt. Böckenförde [Gesetz2, S. 210 ff.], Wolf [Rechtsdenker2, S. 556 ff., 589 ff.], Remmert [Übermaßverbot, S. 109 ff.], Meyer-Hesemann [Methodenwandel, S. 38, 39.], Tripp [Positivismus, S. 214 f.] gehen von zumindest einem Einfluß des auf Comte zurückgehenden, allgemein wissenschaftlichen Positivismus auf die „juristische“ Methode oder „Begriffsjurisprudenz“ aus. Wieacker [Privatrechtsgeschichte 2, S. 430 ff.] hingegen vertritt die Ansicht, der Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts habe ein „rechtswissenschaftlicher Positivismus“ zugrunde gelegen, den man sowohl vom Gesetzespositivismus, nach dem alles Recht vom staatlichen Gesetzgeber erzeugt werde, wie auch vom allgemein wissenschaftlichen Positivismus Comtes, der die Möglichkeiten der Welterklärung auf die wissenschaftliche Beobachtung und Ordnung physikalischer, sozialer und psychologischer Tatsachen beschränkt habe, unterscheiden müsse, da mit diesen beiden Positivismen der rechtswissenschaftliche nur den Verzicht auf eine metaphysische Rechtsbegründung und die Anerkennung der unbedingten Autonomie der Fachwissenschaft gemein gehabt habe. Ähnlich wie Wieacker sprechen auch Friedrich [Geschichte, S. 224, 276 f., 277.] und Pauly [Methodenwandel, S. 96, 105, 146 ff.] insbesondere bei der Erörterung der Methode Gerbers nur von einem „rechtswissenschaftlichen Positivismus“. Noch weiter als Wieacker geht Jerusalem [Rechtswissenschaft, S. 157, 163.], für den die spätere Ablehnung der Begriffsjurisprudenz ein Ausfluß des juristischen Positivismus ist. Auch Larenz [Methodenlehre6, S. 22 Fn. 8, 32.] ist der Auffassung, es sei unrichtig, die Begriffsjurisprudenz mit dem Positivismus gleichzusetzen. Sowohl Jerusalem, als auch Larenz stützen sich auf den Umstand, daß die Begriffsjurisprudenz das Recht zu vergeistigen suchte, und daß sich nach ihr auch die durch das positive, also „gesetzte“ Recht [vgl. zu diesem Begriff: Wieacker, Privatrechtsgeschichte 2, S. 431 Fn. 5.] aufgestellten Begriffe ihre Legitimation aus den Begriffen des Systems herleiten mußten. 129 Larenz, Methodenlehre6, S. 32, 23. Vgl. auch: Coing, Universitas 7 (1952), S. 241 (241 f.); ders., Geschichte des Systemgedankens, in: Frankfurter Universitätsreden 17, S. 26 (38); Wieacker, Privatrechtsgeschichte2, S. 320; Stephanitz, Wissenschaft, S. 107; Böckenförde, Gesetz2, S. 213 Fn. 7.
A. Die „juristische‘‘ Methode
87
keit aus dem gegebenen Rechte folgt.“130 „So wird das Recht, obwohl aus der Freiheit stammend, durch die natürliche Nothwendigkeit seiner Gegenstände bedingt, es ist etwas vernünftiges. Dadurch erhalten seine Sätze den systematischen Zusammenhang, daß sie sich gegenseitig bedingen und voraussetzen, daß von der Existenz des einen auf die des andern ein Schluß möglich ist.“131 Nicht immer jedoch war es die Philosophie, die als der Hintergrund für den Glauben an die „lebendige Realität“ der Begriffe genannt werden kann. Paul Laband beispielsweise gab als Grund dafür, warum er nur nach den „dauernden, generellen und charakteristischen Eigenschaften des Rechts“ suche,132 nicht mehr den „alte Wahn“ an, „dass es eine Wahrheit“ gebe, „welche in der Reproduktion der Wirklichkeit“ bestehe „und dass der Geist der Spiegel der Welt“ sei, „in welchem die Wirklichkeit sich abspiegelt“.133 Schließlich hatte Otto von Gierke (1841–1921)134 angemerkt, daß die Jurisprudenz einen Erkenntnisgewinn nicht verzeichnen könne, wenn sie das Recht allein formal–logisch zu verstehen suche, da „auf rein logischem Wege in Ewigkeit nur immer wieder logische Kategorien gefunden werden“ könnten.135 Und Edgar Loening (1843–1919) hatte gegen die „juristische Methode“ den Vorwurf erhoben, daß sie „nicht mehr nach der Erkenntnis der realen Erscheinungen“ strebe, „sondern [. . .] ein künstliches Gebäude aufzurichten sich“ bemühe, indem sie die „Vorstellung von den Begriffen als selbständigen Wesen [. . .] zur Herrschaft“ gelangen lasse.136 Angesichts dieser „zahlreichen und scharfen Angriffe, welche gegen dieselbe [scil.: „juristische“ Methode] gerichtet“ wurden, erwiderte Laband daher: Er wisse „sehr wohl, daß die ausschließliche Herrschaft der logischen Behandlungsart des Rechts eine höchst nachteilige Einseitigkeit wäre und in gewisser Beziehung die Verkümmerung unserer Wissenschaft herbeiführen würde“. Er „verkenne [daher] weder die Bedeutung rechtshistorischer Forschung, [. . .] noch den Wert, welchen Geschichte, Volkswirtschaftslehre, Politik und Philosophie für die Erkenntnis des Rechts haben“, und sei sich bewußt, daß „die Dogmatik [. . .] nicht die einzige Seite der Rechtswissenschaft“ sei. Aber sie sei „doch eine derselben“,137 und das genüge. Denn 130
Kritik (1844), S. 17. Cursus der Institutionen I3 (1850), S. 36. 132 Rez. Bartolomei, AöR 19 (1905), S. 615 (617). 133 Rez. Bartolomei, AöR 19 (1905), S. 615 (616). 134 Gierke wird vielfach als der wohl bedeutendste Kritiker Labands eingeschätzt, vgl. Stolleis, Geschichte II, S. 359; Pauly, Methodenwandel, S. 228 m. w. N. in Fn. 1. 135 Rez. Laband, Schmollers Jahrbuch 7 (1883), S. 1097 (1110). 136 Konstruktive Methode, Schmollers Jahrbuch 11 (1887), S. 541 (546). 137 Staatsrecht I5 (1911), Vorwort (1887) S. IX. 131
88
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
schließlich sei „die wissenschaftliche Erkenntnis einer Sache [. . .] immer nur möglich hinsichtlich einzelner Eigenschaften oder Beziehungen der Sache durch Unterscheidungen und Abstraktionen, durch welche sich die wissenschaftlichen Begriffe“ bildeten; „jeder wissenschaftliche Fortschritt“ beruhe „auf der Teilung der Arbeit, auf dem Vorgang der Isolierung und Abstraktion. In Wirklichkeit“ gebe „es keine Unterscheidung unter den Sachen und Erscheinungen; aber keine Wissenschaft“ könne „eine Photographie oder Kopie der Wirklichkeit geben, sondern sie“ sei „eine Herrin, eine Kunst, in dem Sinne, dass sie die Wirklichkeit für ihre Zwecke und in ihren Formeln gestalte[]“.138 Daher könne sich die „wissenschaftliche Aufgabe der D o g m a t i k eines bestimmten positiven Rechts“ auf die „Konstruktion der Rechtsinstitute“ beschränken,139 für die es, abgesehen von der Erforschung der geltenden positiven Rechtssätze, kein anderes Mittel gebe als die Logik,140 „welche keine Ontologie“ sei „oder sein“ wolle.141
B. Die „juristische“ Methode Otto Mayers Ausgangspunkt des im folgenden zu schildernden Methodenverständnisses von Otto Mayer142 ist die bereits zu Anfang dieses Kapitels erwähnte Tatsache, daß Otto Mayer sich über den Begriff seiner Methode nur konzis und vereinzelt äußert, jedoch zu erkennen gibt, sich an der vor allem im Zivilrecht zur Anwendung gelangten, „juristischen“ Methode ein Vorbild genommen zu haben. Mit den im vorangegangenen Abschnitt gewonnenen Erkenntnissen über diese Methode lassen sich die verstreuten Äußerungen Otto Mayers, die auf sein wissenschaftliches Vorgehen Bezug nehmen, zu einem nahezu kompletten Bild zusammenfügen, und läßt sich auch ermitteln, worin die ebenfalls zu Anfang dieses Kapitels genannte Eigenart der „juristischen“ Methode Otto Mayers besteht. 138
Rez. Bartolomei, AöR 19 (1905), S. 615 (616). Staatsrecht I5 (1911), Vorwort (1887) S. IX. Hervorhebung im Original. 140 Staatsrecht I5 (1911), Vorwort (1887) S. IX. Ähnlich: Rez. Bartolomei, AöR 19 (1905), S. 615 (617). 141 Rez. Bartolomei, AöR 19 (1905), S. 615 (617). 142 Eine ausführlichere Darlegung der Methode Otto Mayers enthalten auch die Werke von Hueber [Methode.], Meyer-Hesemann [Methodenwandel, S. 20 ff.], und von Heyen [Otto Mayer, S. 155 ff., 194 ff.]. An der Darstellung Meyer-Hesemanns kritisiert allerdings Heyen [in: ders. (Hrsg.), Verwaltungsrechtswissenschaft, S. 29 (35).] eine zu geringe Berücksichtigung der Quellenliteratur. Im Zusammenhang mit der Darstellung Heyens wiederum äußert Stolleis [Geschichte II, S. 405 mit Fn. 129.], der Zugang zu Otto Mayers methodischem Vorgehen sei aufgrund verwischter Spuren kompliziert. Kürzere Stellungnahmen zu der Methode Otto Mayers geben etwa Glitza [DÖV 80 (1965), S. 329 ff.], Bachof [VVDStRL 30 (1972), 193 (215 ff.).], Friedrich [Geschichte, S. 313 ff.], Park [Rechtsfindung, S. 60 ff.], Günther [DÖD 2000, S. 169 (175 ff.)]. 139
B. Die „juristische‘‘ Methode Otto Mayers
89
I. Die Gemeinsamkeiten mit der „juristischen“ Methode Mit der „juristischen“ Methode „im allgemeinen“ hat diejenige Otto Mayers zunächst die Grundannahme gemein, daß die Jurisprudenz eine Wissenschaft nur sein könne, wenn sie versuche, die gegebenen Tatsachen auf der Grundlage eines Systems zu verdeutlichen und zu erklären.143 „Was nützt uns alle Wissenschaft, wenn sie nicht dazu diente, die Wirklichkeit des Rechts besser verständlich zu machen.“,144 schreibt Otto Mayer, und: „Es scheint mir nur, die Entwicklung eines Systems ist wesentlich Sache der Wissenschaft“,145 da „die systematische Darstellung weit geeigneter ist, ein gründliches Verständnis des Stoffes zu vermitteln.“146 Das Bestreben, das Recht systematisch zu erklären, läßt sich auch aus dem Titel des Lehrbuches zum französischen Verwaltungsrechts herauslesen, der lautet: „Theorie des Französischen Verwaltungsrechts“. Denn mit dem Wort „Theorie“ verbindet Otto Mayer die Bedeutung eines Erklärungsversuches. Deutlich wird dies anhand der folgenden Aussage, die Otto Mayer über seine Lehre vom öffentlichen Eigentum trifft: „Es handelt sich ja dabei ganz und gar um Theorie, um den Versuch der Verdeutlichung und besseren Verständlichmachung des bestehenden Rechts durch den Nachweis der es beherrschenden Ideen.“147 Wenn Otto Mayer das Recht aus seinen „beherrschenden Ideen“, mithin aus sich selbst heraus, aufgrund einer „rein juristische[n] Betrachtungsweise“,148 die alle „Mystik“149 und alles „unjuristische Beiwerk und Gerede“ ausgeschieden wissen will,150 zu erklären trachtet, und wenn Otto 143
Ähnlich: Meyer-Hesemann, Methodenwandel, S. 41. Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 140. 145 Rez. Hatschek, ZgesStaatsWiss 63 (1907), S. 541 (546). Vgl. zudem: Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 21: „Aber auch durch systematische Entwicklung und Zusammenordnung ihres ganzen Gehaltes an eigenartigen Rechtsideen mußte die Verwaltungsrechtswissenschaft darnach trachten, sich ebenbürtig den älteren Schwesterdisziplinen an die Seite zu stellen.“ 146 Rez. Rosin, ZgesHandelsR 56 (1905), S. 611 (611). Vgl. auch: Stand des öffentliches Eigentums, AöR 21 (1907), S. 499 (499). Dort ist zu lesen, daß man durch die Begriffe „das Vorgefundene zu erfassen und zu Verständnis und sicherer Beherrschung zu bringen“ habe. Ähnlich: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), Vorwort S. IX. Vgl. zudem: Rez. Jèze, AöR 32 (1914), S. 275 (275). Dort heißt es, man müsse versuchen, einen „allgemeinen Ausdruck“ zu finden, der die beobachteten Rechtstatsachen „erklärt, ohne ihnen Gewalt anzutun“. 147 Rez. Hawelka, AöR 27 (1911), S. 344 (345). 148 Staatsrecht (1909), S. 69. Für die „Theorie des französischen Verwaltungsrechts“ wird denn Otto Mayer auch durch Laband [AöR 2 (1887), S. 149 (150).] Lob dafür gespendet, daß er unter Abspaltung der Verwaltungslehre ausschließlich das Recht der Verwaltung schildere. 149 Vgl. Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (25). 144
90
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
Mayer zudem schreibt, „schlimmer noch“ sei es für ihn, „wenn [. . .] die allgemeinen Grundlagen und Grundbegriffe und das einheitliche System in bloßen äußerlichen Zusammenstellungen gesucht“ würden,151 so läßt sich annehmen, daß der Gedanke des Systems auch für ihn nicht nur eine an äußerlichen Gesichtspunkten orientierte Stoffordnung meint. Gestützt wird diese Annahme durch Äußerungen, in denen Otto Mayer sich gegen ein System wendet, welches das Ergebnis einer Methode ist, die noch bei Erscheinen der ersten Auflage von Otto Mayers Deutschem Verwaltungsrecht im Jahre 1895/96 ganz überwiegend in der Wissenschaft des Verwaltungsrechts zur Anwendung gelangte,152 nämlich der von einem „besondere[n] Zweig der Staatswissenschaft“, der Verwaltungslehre,153 angewandten Methode. Über das durch sie gegebene Ordnungsmodell sagt er, daß es zwar den Stoff „übersichtlicher“ gestalte,154 dem Bedürfnis der Verwaltungsbeamten entgegenkomme155 und auch der Rechtswissenschaft insofern nützlich sei, als es vortreffliche Nachschlagewerke schaffe.156 Dessenungeachtet konstatiert er jedoch: „Verwaltungsrechtswissenschaft ist das nicht.“157 Denn die Verwaltungslehre gliedere den Stoff „in einem geschlossenen System nach den verschiedenen Zwecken, die da verfolgt werden, als Schulwesen, Gewerbewesen, Gesundheitswesen, Armenwesen, Eisenbahnwesen“. Das Verwaltungsrecht werde „von diesen ,Wesen‘ einfach ins Schlepptau genommen“. Daher finde seine Einheit und Zusammengehörigkeit alles nur
150 Rez. v. Strauss und Torney, AöR 21 (1907), S. 445 (446). Vgl. auch: Rez. Jellinek, AöR 25 (1909), S. 497 (498). Dort verlangt Otto Mayer, daß man nicht der Versuchung erliegen dürfe, „unsere vermeintlich allzu trockene Juristerei durch Hereinnahme anderer Elemente schmackhafter“ zu machen. Das bedeutet freilich nicht, daß nicht auch Otto Mayer Rechtssätze historisch auslegte, vgl. nur: Entschädigungspflicht (1904), S. 4; Schiffahrtsabgaben I (1907), S. 45 ff.; Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (38); Verkauf, Das Recht 14 (1910), Sp. 758 (761 f.); Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 162 Fn. 14, 165 Fn. 22, 186 Fn. 17; Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 263 f. Fn. 13, 480 f. Fn. 17, 592 Fn. 24. 151 Rez. Rosin, ZgesHandelsR 43 (1895), S. 448 (452). 152 Vgl. Stolleis, Geschichte II, S. 320, 385 ff.; Friedrich, Geschichte, S. 307 f. 153 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 16. Vgl. auch: Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 20. Die hier zur Anwendung gebrachte Methode wurde deshalb auch „staatswissenschaftliche“ Methode genannt. Entgegen der Meinung von Friedrich [Geschichte, S. 307.] billigt auch Otto Mayer dem Vorgehen der Staatswissenschaft den Begriff „Methode“ zu, vgl. Rez. Meyer, AöR 11 (1896), S. 157 (158, 160); Rez. Seydel, AöR 12 (1897), S. 493 (496). 154 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 17 Fn. 5. 155 Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 19. 156 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 19 Fn. 8. Vgl. auch: Rez. Meyer, AöR 11 (1896), S. 157 (157); Rez. Neumeyer, AöR 28 (1912), S. 350 (352 f.). 157 Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 21. Ebenso: Selbstdarstellung (1924), S. 11.
B. Die „juristische‘‘ Methode Otto Mayers
91
in jenem äußerlichen Zweck, um den sich „Konglomerate verschiedenartigster Rechtssätze“ bildeten.158 Infolgedessen bemängelt159 Otto Mayer an der Systematik der Verwaltungslehre vor allem, daß sie juristisch Zusammengehöriges auseinanderreiße und für manches rechtlich Bedeutsame keinen Platz biete.160 Denn sie bemühe sich nicht darum, aus dem Verwaltungsrecht die „reinen“, immer allgemeineren Begriffe zu abstrahieren und „auszuklammern“, um diese einer Darstellung des Verwaltungsrechts im Rahmen eines „allgemeinen Teiles“ voran zu schicken.161 Schließlich arbeite „die Wissenschaft des Verwaltungsrechts gegenwärtig daran, sich loszumachen von dem bloßen Darbieten des Gesetzesstoffes, wie es so lange üblich war. Sie“ wolle „ihre allgemeinen Rechtsformen und Rechtsinstitute ausbilden, geradeso wie die älteren Schwestern aus der rechtswissenschaftlichen Familie sie“ hätten. „In diesem Sinne“ erhebe „man den Ruf nach einem allgemeinen Theile des Verwaltungsrechts“.162 Mit dem Ziel, die ein Rechtsgebiet beherrschenden Formen und Begriffe aufzudecken, wird offenbar, daß auch Otto Mayer einen bestimmten inneren Zusammenhang des Rechts,163 eine bestimmte die Vielfalt übergreifende Einheit nachzuweisen sucht.164 Mit dem Gedanken des Systems 158 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 18 f.; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 18 f. 159 Als die einseitige Betonung der „juristischen“ Methode in den Schriften Otto Mayers unter anderem durch Loening [Konstruktive Methode, Schmollers Jahrbuch 11 (1887), S. 117 (bes. S. 122 ff.).] heftig kritisiert wird, ringt sich Otto Mayer [Rez. Meyer, AöR 11 (1896), S. 157 (160).] zu der Feststellung durch, „beide Arten der Behandlung des Stoffes“ würden „wohl selbständig nebeneinander stehenbleiben müssen als gleichberechtigte Methoden“, und behauptet schließlich [Rezension Seydel, AöR 12 (1897), S. 493 (496).], daß der „Fortschritt der Zukunft in der Vereinigung beider Methoden“ bestehe. Sein „Deutsches Verwaltungsrecht“ habe er ursprünglich nach dieser neuen vereinigten Methode schreiben wollen. Warum dies nicht gegangen sei, sei eine Geschichte für sich. Vgl. auch: Rez. Lassar, AöR 40 (1921), S. 382 (382). Später freilich hält er an dieser Auffassung nicht mehr fest, vgl. Selbstdarstellung (1924), S. 11. 160 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 19 mit Fn. 8. 161 Vgl. Rez. Meyer, AöR 11 (1896), S. 157 (158): „Vollkommen ist nichts; so hat auch diese Methode ihre Nachtheile, die gerade in ihrer systematischen Gebundenheit begründet sind. Wenn es sich darum handelt, einen reinen Rechtsbegriff, ein allgemeines Rechtsinstitut zur Darstellung zu bringen, das nicht nur etwa in dem einen oder anderen Verwaltungszweige aufgeht, da findet natürlich das Wörterbuch immer eine Stelle dafür, wie das Alphabet sie ergibt. Für unsere Darstellungsweise wird es oft schwierig sein, dergleichen in das einmal gegebene System richtig einzufügen.“ 162 Rez. Rosin, ZgesHandelsR 43 (1895), S. 448 (451). Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 19 f. mit Fn. 8; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 21 mit Fn. 14; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 20 mit Fn. 14.
92
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
ist daher auch für ihn ein Prinzip angesprochen, das nicht nur eine Aussage darüber trifft, welche Elemente dem System angehören, sondern auch eine Aussage darüber, wie sich das Verhältnis der Systemelemente untereinander gestaltet.165 Bereits aus der Tatsache, daß Otto Mayer nach den allgemeingültigen Formen und Begriffen forscht, läßt sich ersehen, daß er gleich den anderen Vertretern der juristischen Methode das im vorangegangen Absatz angesprochene Prinzip in der Möglichkeit sieht, die Elemente des Systems letztlich auf einen einzelnen Grundbegriff, eine zentrale Idee zurückzuführen, mithin zu „konstruieren“. So heißt es bei ihm, jede Wissenschaft erfordere „das einheitliche Objekt“, die Verwaltungsrechtswissenschaft dementsprechend „den einen Punkt, aus welchem heraus das ganze Rechtssystem der Verwaltung heraus zu konstruieren“ sei.166 „In jeder Rechtsordnung“ stecke „ein System, ein wohlgefügter Bau ineinandergreifender Rechtsideen“,167 „nach welchen [. . .] der ganze innere Aufbau, die Entfaltung der einzelnen Teile sich eigentümlich“ gestalte.168 Die Rechtswissenschaft könne nicht darauf verzichten, „immer wieder zu versuchen, die Mannigfaltigkeit der Einzelerscheinungen unter die Herrschaft allgemeiner Ideen zu zwingen, also zu konstruieren.“169 Der Theoretiker des Verwaltungsrechts müsse nach einer Sammlung des Rechtsstoffes sich in der „konstruktiven Zusammenfassung“ versuchen und ergründen, ob die „zahllosen Detaillösungen nicht von allgemeinen Ideen beherrscht sind“,170 so daß „unsere Rechtsinstitute nichts anderes als verschiedene Erscheinungsformen“ einer „Idee“ seien.171 Die soeben erwähnten „Rechtsinstitute“ sind die Elemente des Systems von Otto Mayer: „Unser Hauptteil wird die Aufgabe haben, das System der 163 Er selbst spricht von „innere[r] wissenschaftliche[r] Gliederung unseres Verwaltungsrechts“, Neues vom öffentlichen Eigentum, AöR 39 (1920), S. 77 (90). 164 Vgl. E. Kaufmann, Otto Mayer, VerwArch 30 (1925), S. 377 (378 f.): „Wenn diese Fähigkeit, die leitenden Grundsätze aus dem Stoffe des Rechts herauszufühlen, von ihnen aus den inneren Zusammenhang des Rechtssystems zu erkennen [. . .], den großen Juristen ausmacht, dann gehört Otto Mayer zu den größten.“ 165 Vgl. 4. Kapitel, A. II. 166 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (86 Fn. 122). 167 Rez. Hatschek, ZgesStaatsWiss 63 (1907), S. 541 (546). 168 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 18. Daß das System durch die Rechtsideen gebildet wird, ist angesprochen auch in: Rez. Layer, AöR 17 (1902), S. 450 (450); Rez. v. Arnstedt, AöR 21 (1907), S. 453 (454). 169 Eisenbahn II, AöR 16 (1901), S. 38 (50 Fn. 14). Ähnlich: Rechtskraft, AöR 21 (1907), S. 1 (19). 170 Rez. Jèze, AöR 32 (1914), S. 275 (275). Vgl. auch: Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 501; Rez. Tezner, AöR 17 (1902), S. 141 (144); Rez. Goez, AöR 19 (1905), S. 590 (595); Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), Vorwort S. VIII; Rez. Triepel, JW 47 (1918), S. 158 (159); Rez. Hubrich, AöR 39 (1920), S. 96 (96).
B. Die „juristische‘‘ Methode Otto Mayers
93
einzelnen Rechtsinstitute dieses Verwaltungsrechts vorzutragen.“172 Diese Rechtsinstitute sind für ihn „ein Hilfsmittel der Rechtswissenschaft zur Beherrschung der Fülle von Stoff, welche die Rechtssubjekte darbieten“, da sie das Ganze zurückführten „auf gleichbleibende Einheiten, in deren ständiger Wiederholung“ es bestehe.173 Als Rechtsinstitute begreift Otto Mayer „die rechtlich bedingten Erscheinungen der öffentlichen Gewalt“ beziehungsweise die „feststehende[n] gleichbleibende[n] Formen für die Erscheinung der öffentlichen Gewalt“.174 Zur einen Gruppe der Rechtsinstitute gehören etwa die Polizeigewalt und die Finanzgewalt.175 Zur zweiten Gruppe zählen „die aus dem Zivilrecht geretteten“ Rechtsinstitute. „Sie führen zum Teil die alten Namen: Eigentum, Grunddienstbarkeit, Eigentumsbeschränkung, Dienstvertrag, Entschädigungs- und Erstattungsanspruch“. Der Zusatz „öffentlich“ oder „öffentlichrechtlich“ weise jedoch jeweils daraufhin, daß die Übereinstimmung mit dem zivilrechtlichen Urbild nur eine äußerliche sei.176 Neben den Rechtsinstituten räumt Otto Mayer auch den Rechtsbegriffen eine bedeutende Stellung innerhalb seines Systems ein. Über eine einheitliche Terminologie hinaus177 nämlich fordert Otto Mayer, daß immer wieder begonnen werden müsse mit einer „Revision der Grundbegriffe“.178 Die ganze Arbeit der deutschen Verwaltungsrechtswissenschaft sei auf eine feste Abgrenzung ihrer Begriffe gerichtet und müsse es sein, weil es sich um Rechtswissenschaft handele. Wer nichts zu bieten habe als Begriffe, „die dazwischen auch nicht zu passen brauchen, und gar noch solche Halbtöne, in denen alles zerfließt, [. . .] der, um es gelind auszudrücken“, nehme 171 Concurrence, ZgesHandelsR 26 (1881), S. 363 (363). Ähnlich: Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 74: „Wenn er [scil.: der Begriff] eine Folgerung darstellt aus den Grundideen [. . .].“ 172 Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 21. Vgl. auch schon: Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 21: „Die Rechtswissenschaft hat es nur mit den Formen zu thun, in welchen zwischen den von ihr beobachteten Rechtssubjekten Willensherrschaft gemäß dem objektiven Rechte erscheint. Die daraus sich ergebenden festen Arten von Formen in ihrer Verschiedenheit und ihrem Zusammenhang bilden ihr System.“ Vgl. auch: ebd., S. 160 f. 173 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 134; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 116; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 113. 174 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 116 f.; Deutsches Verwaltungsrecht 3 I (1924), S. 113 f. Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 135; Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 23, 158 f. 175 Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 22. 176 Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 114. Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 117. 177 Rez. Thoma, AöR 21 (1907), S. 450 (450). Ähnlich: Rez. Arndt, AöR 18 (1903), S. 96 (96); Rez. Goez, AöR 19 (1905), S. 590 (591); Rez. Layer, AöR 17 (1902), S. 450 (450). 178 Rez. Rosin, AöR 1 (1886), S. 715 (717).
94
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
an jener Arbeit nicht teil.179 Denn die Rechtswissenschaft habe „es mit den vom Menschengeist bewusst oder unbewusst geschaffenen Ordnungen gesellschaftlichen Lebens zu tun“. Diese Ordnungen seien Recht nur, weil sie feste Regeln seien. Die Rechtsregeln wiederum bedienten „sich als vornehmsten Hilfsmittels der Rechtsbegriffe, die Rechtsbegriffe nur sind, weil sie fest abgegrenzte Begriffe sind.“180 Nur der festen Begriffe bedürfe „das j u r i s t i s c h e H a n d w e r k “, nur sie meisterten „die Wirklichkeit des Lebens“ und zwängen „sie in ihre Formeln“, schnitten scharf ab, was nicht darin enthalten sein solle, möge „es ,innerlich‘ noch so sehr dazugehören“, und gäben „auf solche Weise der Handhabung des Rechts jenes eherne Gleichmass, auf dem für das Gemeinwesen der Segen des Rechts“ beruhe.181 Es stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis das Rechtsinstitut zum Rechtsbegriff steht. Zur Beantwortung dieser Frage kann auf den Umstand abgestellt werden, daß Otto Mayer von Rechtsinstituten spricht, die er aus dem Zivilrecht in das öffentliche Recht „gerettet“ habe.182 Denn das ermöglicht es, auf das damals im Zivilrecht vorherrschende Verständnis von einem Rechtsinstitut183 zu rekurrieren. Dieses gibt Georg Friedrich Puchta wieder: „Diese Rechtssätze, die das Recht eines Volkes bilden, sammeln sich in gewissen Massen, nach den Verhältnissen, die sie bestimmen; solche Massen von Rechtssätzen heißen Rechtsinstitute. So nennt man z. B. das Eigenthum ein Rechtsinstitut, insofern wir haben die Masse von Rechtssätzen zu denken, die es betreffen. Das Recht besteht aus Rechtsinstituten, diese wieder aus einzelnen Rechtssätzen.“184 Das Rechtsinstitut wird im Zivilrecht mithin als ein systematischer Grundbegriff, wenn auch nicht als ein Rechtsbegriff verstanden.185 Zieht man in Betracht, daß Otto Mayer ebenfalls unter anderem das Eigentum, wenn auch das öffentlich-rechtliche, als ein Rechtsinstitut an179
Rez. Tezner, AöR 17 (1902), S. 141 (144). Rez. Spiegel, AöR 25 (1909), S. 485 (490). 181 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (10). Hervorhebung im Original. Ähnlich: Schiffahrtsabgaben I (1907), S. 38: „Die juristischen Begriffe [. . .] haben eine eigentümliche Härte und Sprödigkeit. Sie schmiegen sich nicht den wogenden schwankenden Wirklichkeiten an, sondern schneiden herrisch mitten durch. Da gibts kein Schillern, keine Uebergänge; [. . .] das muß so sein. Wer Verständnis hat für den Segen und die Notwendigkeit des Rechts, fügt sich darein und rechnet damit.“ 182 Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 114. Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 136 Fn. 2. 183 Entwickelt wurde das Rechtsinstitut namentlich von Friedrich Carl von Savigny (1779–1861) und Friedrich Julius Stahl (1802–1862), vgl. Wilhelm, Methodenlehre, S. 46 ff.; Paust, Methode, S. 8 ff. 184 Cursus der Institutionen I3 (1850), S. 12. 185 Wilhelm, Methodenlehre, S. 47; Paust, Methode, S. 9, 10. 180
B. Die „juristische‘‘ Methode Otto Mayers
95
sieht,186 wird man konstatieren können, daß auch für ihn das Rechtsinstitut einen systematischen Ordnungsbegriff bildet, ein Sinnganzes, zu dem sich die Vorschriften des positiven Rechts und die sie tragenden allgemeineren Rechtsideen zusammenfügen.187 Der Verwaltungsakt beispielsweise ist ein Rechtsbegriff, kein Rechtsinstitut, muß jedoch für Otto Mayer „beim Aufbau der einzelnen Rechtsinstitute eine grosse Rolle spielen“.188 Als ein erstes Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, daß die Methode Otto Mayers ein systematisches Vorgehen beschreibt, das den gegebenen Rechtsstoff nicht bloß beschreibt und ordnet entsprechend rein äußerlichen, tatsächlichen Gesichtspunkten,189 sondern untergliedert nach allgemeineren Grundbegriffen, sogenannten Rechtsinstituten, deren Zusammenhang oder übergreifende Einheit durch ein Prinzip vermittelt wird, welches das Recht als Ableitung190 aus einer obersten, spezifisch juristischen Idee begreift und erklärt. In den wesentlichen Punkten stimmt daher Otto Mayer mit den im vorangegangenen Abschnitt erwähnten Vertretern der „juristischen“ Methode überein. II. Die Eigenart der Methode Otto Mayers Es fragt sich somit, worin Otto Mayer die einer Hervorhebung würdige Eigenart seiner Methode sieht, die er selbst wie folgt umschreibt: „Wenn man mich als Vertreter der ,juristischen Methode‘ bezeichnet, so darf das nicht bedeuten, daß keine andere hier diesen Namen verdiente. Die meine hat ihre Eigenart, die ich nicht verleugnen darf. Sie beruht auf dem Glauben an die Macht allgemeinerer Rechtsideen, die in den Mannigfaltigkeiten des wirklichen Rechts zur Erscheinung und Entfaltung kommen, zugleich aber auch ihrerseits in der Geschichte sich wandeln und fortschreiten. Es Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 117; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 114. 187 Vgl. Forsthoff, Verwaltungsrecht I10, S. 165 f. 188 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 65. 189 Vgl. Rez. Rosin, ZgesHandelsR 43 (1895), S. 448 (451 f.): „Die Wissenschaft des Verwaltungsrechts arbeitet gegenwärtig daran, sich loszumachen von dem bloßen Darbieten des Gesetzesstoffes, wie es so lange üblich war. Sie will ihre allgemeinen Rechtsformen und Rechtsinstitute ausbilden, geradeso wie ihre älteren Schwestern aus der rechtswissenschaftlichen Familie sie haben. [. . .] Ein allgemeiner Theil des gesammten Verwaltungsrechts oder eines größeren Theil desselben wird die gemeinsamen Rechtsformen [. . .] nach ihrer juristischen Zusammengehörigkeit ordnen; in diesem Zusammenhang wird ihre Natur erst recht klar; die einzelnen Erscheinungen erläutern sich gegenseitig.“ 190 Hueber [Methode, S. 45.] spricht von einer Deduktion aus den Ideen; MeyerHesemann [Methodenwandel, S. 25.] und Park [Rechtsfindung, S. 61.] gehen von einer „quasi-axiomatischen normativen Modellvorstellung“ in Otto Mayers System aus. 186
96
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
hängt bei mir wohl mit Hegelischer Rechtsphilosophie zusammen, vielleicht auch noch mit ganz Unjuristischem, mußte aber schon recht stark sein, daß ich es wagen konnte, solchen Ideen auch in dem zerfahrenen und unfertigen deutschen Verwaltungsrecht nachzugehen, um sie herauszuheben und aufzuweisen.“191 Der vierte Satz dieses Zitates verleitet zu der Annahme, daß „eine tüchtige Portion Hegelianismus in dem, was man Otto Mayers ,juristische Methode‘ nennt“, steckt,192 und daß demnach die Besonderheit der Methode Otto Mayers gerade in jenem „Hegelianismus“ liegt. Für diese Annahme streitet auch, daß Otto Mayer im Zusammenhang mit einer Konstruktion des Rechts überwiegend nicht von Prinzipien oder Gesichtspunkten, sondern von „Ideen“ spricht,193 denen er den Charakter positiven Rechts abspricht,194 und daß er von der „Wahrheit“ redet, die „immer Ausdruck einer Idee“ sei, „die sich hier entfalte[], sei es in den festen Bestimmungen des Rechtssatzes, sei es in den Mannigfaltigkeiten des Einzelfalles“.195 Allein, der Einfluß der idealistischen Philosophie Hegels auf das Denken Otto Mayer würde überschätzt, erstreckte man ihn auch auf die Methode Otto Mayers.196 Wenn Otto Mayer davon spricht, sein Glaube an die Macht Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), Vorwort S. VIII. Friedrich, Geschichte, S. 315. Ähnlich: E. Kaufmann, Otto Mayer, VerwArch 30 (1925), S. 377 (381 f.); Bachof, VVDStRL 30 (1972), S. 193 (219 f. mit Fn. 109); Hueber, Methode, S. 40 f., 159 f.; Stolleis, Geschichte II, S. 405; Niemeyer, Niemeyers Zeitschrift 34 (1925), S. 493 (493). Vgl. auch: Wittmayer, AöR 37 (1918), S. 472 (473); Markull, PreußVBl. 36 (1914/15), S. 723 (723). 193 Das Wort „Idee“ wird verwandt z. B. in: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 18, 38, 64, 247; Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 4, 74 f.; Civilproceß, ZFranzCivilR 9 (1878), S. 481 (485); Eisenbahn I, AöR 15 (1900), S. 511 (511); Portalis (1902), S. 7; Rez. Layer, AöR 17 (1902), S. 450 (450); Rez. Ryffel, AöR 19 (1905), S. 420 (420); Rez. Goez, AöR 19 (1905), S. 590 (592); Rez. Cathrein, DZKirchenR 20 (1911), S. 389 (389); Rez. Neumeyer, AöR 28 (1912), S. 350 (350); Rez. Werner, AöR 37 (1918), S. 126 (126); Rez. Lassar, AöR 40 (1921), S. 382 (383); Universität (1922), S. 30. Von „Prinzip“ ist die Rede in: Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1896), S. 345; Entschädigungspflicht (1904), S. 5. Von einem „Gedanken“ oder „Grundgedanken“ ist die Rede in: Grundsätze, Verhandlungen des 16. DJT 1 (1882), S. 217 (239); Rez. v. Arnstedt, AöR 21 (1907), S. 453 (454); Neues vom öffentlichen Eigentum, AöR 39 (1920), S. 77 (90). Das Wort „Grundsatz“ wird verwendet in: Civilproceß, ZFranzCivilR 9 (1878), S. 331 (332); Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 92, 320. Vom „Grosse[n] Gesichtspunkte“ wird gesprochen in: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), Vorwort S. VII. 194 Rez. Cathrein, DZKirchenR 20 (1911), S. 389 (389): „Denn wiewohl wir nicht verkennen, daß hinter den Rechtsordnungen, mit welchen wir unser Gemeinwesen einrichten, noch andere Ideen stehen, die sehr maßgebend auf sie einwirken und unter Umständen sie machtvoll durchbrechen, so haben wir doch den Glauben daran verloren, daß auch diesen die Form des Rechts eigen sei und daß sie den Namen Recht verdienen.“ 195 Selbstdarstellung (1924), S. 6. 191 192
B. Die „juristische‘‘ Methode Otto Mayers
97
allgemeinerer Rechtsideen hänge bei ihm „wohl mit Hegelischer Rechtsphilosophie zusammen“, sei zumindest aber so stark gewesen, daß er es habe wagen können, „solchen Ideen auch in dem zerfahrenen und unfertigen deutschen Verwaltungsrecht nachzugehen, um sie herauszuheben und aufzuweisen“,197 so ist damit allein die Hoffnung ausgesprochen, daß aufgrund der Rechtsphilosophie Hegels – die nach Otto Mayers eigenem Bekunden in weiter Verbreitung und Anerkennung stand198 – der Inhalt199 der maßgebenden Idee, namentlich derjenigen des Staates, als allgemeingültig, mithin gesamtdeutsch, angesehen werden kann.200 Nicht hingegen ist damit ausgesprochen, daß Otto Mayer unter dem Einfluß der Dialektik Hegels die Überzeugung gewinnt, daß eine Idee nur dann „wirklich“ ist, wenn sie sich in der Geschichte bewährt hat und darum „vernünftig“ ist, und nur dann „vernünftig“ ist, wenn sie „wirklich“ ist.201 Hiergegen läßt sich schon die große Distanz einwenden, die Otto Mayer in der Rechtswissenschaft gegenüber der Dialektik Hegels wahrt. So schreibt er: „Wie kommt der formale Begriff dazu [. . .], alle diese Verwüstungen anrichten zu dürfen. Aber wir kennen ihn ja wohl. Das ist nichts anderes als die alte Hegel’sche Dialektik, welche Dank dem mächtigen Einflusse L. v. Stein’s in der jüngeren Staatsrechts- und Staatswissenschaft Oesterreichs eine Nachblüthe feiert. Ein gewisser allgemeiner Eindruck von dem wirklichen Rechte fasst sich in ein Wort zusammen, das dann im Denken seine Begriffselemente entfaltet und von der Wirklichkeit verlangt, dass sie diesen entspreche. Dass dabei die heimischen Einrichtungen unbewusst zum allgemein Massgebenden gemacht werden, ist nur zu naheliegend. Nahm ja auch schon bei Hegel die Wirklichkeit der sittlichen Idee in ihren begriffsnothwendigen Entfaltungen 196 So auch: Meyer-Hesemann, Methodenwandel, S. 21 Fn. 5. Ähnlich: Heyen, Otto Mayer, S. 162 ff.; ders., Quaderni Fiorentini 8 (1979), S. 275 (281). 197 Vgl. 4. Kapitel, B. II. 198 Selbstdarstellung (1924), S. 3. 199 Heyen [Quaderni Fiorentini 8 (1979), S. 275 (281).] vertritt die Auffassung, Otto Mayer sei allein in gewissen inhaltlichen Vorstellungen von der politischen Philosophie Hegels beeinflußt worden. 200 Vgl. Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 21; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 21: „Unser Verwaltungsrecht ist naturgemäß zur Ausbildung gekommen bei den Einzelstaaten [. . .]. Aber immerhin: es gibt ein Gemeinsames, das überwiegt. Unser Verwaltungsrecht ist ein Erzeugnis unserer gemeinsamen Kultur, wenigstens in seiner für die wissenschaftliche Behandlung, die hier stattfinden soll, maßgebenden Grundidee.“ Ähnlich: Rez. Lassar, AöR 40 (1921), S. 382 (383). Siehe auch: Rez. Goez, AöR 19 (1905), S. 590 (592): „Wenn man aber vergegenwärtigt, wie das alles herausgewachsen ist aus gemeinsamen geschichtlichen Grundlagen, gemeinsamen Bedürfnissen und gemeinsam erlittenen Einflüssen gewisser Vorbilder, so wird man von vornherein zu der Vermutung berechtigt sein, dass in den massgebenden Begriffen eine gewisse Uebereinstimmung herrschen werde.“ 201 So aber: Hueber, Methode, S. 41; E. Kaufmann, Otto Mayer, VerwArch 30 (1925), S. 377 (382).
98
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
einfach die Gestalt des kgl. preussischen Staatswesens an.“202 „Realistisch, d. h. die Wirklichkeit im Auge haben, das will wohl jeder Jurist sein oder sollte es wollen.“ Es sei daher besser, „gegenüber der alten Hegelei [. . .] eine gesunde Reaktion der Nüchternheit“ zu vertreten,203 und „jene souveräne und hochgemuthe Rechtsphilosophie, wie Hegel sie sich erlauben durfte“, zu meiden.204 Um zu verstehen, worin Otto Mayer in Wahrheit die Eigenart seiner Methode sieht, gilt es sich zunächst die vielen Äußerungen vor Augen zu halten, in denen Otto Mayer die Bedeutung der „Rechtswirklichkeit“ hervorhebt.205 So warnt er vor „jedem Rechnen mit selbständig gewordenen abstrakten Begriffen, das ja nur zu leicht ein wissenschaftliches Spiel“ werde „zur Verhüllung der Wirklichkeit“.206 Oberste Aufgabe der Rechtswissenschaft sei es, realistisch zu sein.207 Man dürfe daher im Wege der Konstruktion kein „Luftgebäude“ aufführen,208 man müsse zwischen guter und 202 Rez. Gluht, AöR 3 (1888), S. 482 (485). Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 19 mit Fn. 10; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 18 mit Fn. 10. Dort führt Mayer im Hinblick auf die Methode Lorenz von Steins ein Zitat Edgar Loenings an: „Nicht ganz frei von willkürlichen Konstruktionen, die zum Teil durch eine ungenügende Kenntnis des positiven Rechts veranlaßt sind“. Mayer fügt hinzu: „ganz richtig.“ 203 Rez. Seydel, AöR 12 (1897), S. 493 (494). 204 Rez. Goldschmidt, VerwArchiv 11 (1903), S. 348 (349). Vgl. zudem: Concurrence, ZgesHandelsR 26 (1881), S. 363 (435): „Nebelgestalten rechtsphilosophischer Spekulation“. Vgl. auch: Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1896), S. 85 Fn. 7. Dort ist die Rede von „wunderlicher Metaphysik“. Ähnlich: Rez. Spiegel, AöR 25 (1909), S. 489 (493). 205 Vgl. Eisenbahn II, AöR 16 (1901), S. 38 (50 Fn. 14); Rez. Bernatzik, AöR 1 (1886), S. 720 (722); Rez. Triepel, AöR 18 (1903), S. 282 (282 f.); Rez. Goez, AöR 19 (1905), S. 590 (592); Rez. Hölder, AöR 20 (1906), S. 590 (590); Rez Block, VerwArch 14 (1906), S. 268 (269); Rez. Spiegel, AöR 25 (1909), S. 485 (490); Rez. Herzog, AöR 27 (1911), S. 346 (348); Rez. Bieberstein, AöR 28 (1912), S. 353 (355); Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), Vorwort S. VIII, IX; Universität (1922), S. 30; Selbstdarstellung (1924), S. 5, 8, 10, 13. 206 Rez. Seydel, AöR 12 (1897), S. 493 (494). Ähnlich schon: Rez. Bernatzik, AöR 1 (1886), S. 720 (722). Dort fragt Otto Mayer: „Was soll uns aber unter diesen Umständen bestimmen, dass wir das geistreiche Spiel abstrakter Begriffe, das der Verfasser uns vorführt, als Wirklichkeit hinnehmen?“ Vgl. zudem: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 5 Fn. 4: „Was die Logik an die Stelle setzen will, bildet nie etwas Greifbares und stimmt nicht mit der Wirklichkeit der gemeinen Auffassung.“ 207 Eisenbahn II, AöR 16 (1901), S. 38 (50 Fn. 14). 208 Rechtskraft, AöR 21 (1907), S. 1 (19). Ähnlich: Eisenbahn II, AöR 16 (1901), S. 38 (50 Fn. 14): Das Wort Konstruktion werde geradezu als Vorwurf gebraucht mit dem Beigeschmack der leeren, willkürlichen Konstruktion. „Eine Rechtswissenschaft, die als ihre oberste Aufgabe erkennt, realistisch zu sein, ist empfindlich dagegen.“
B. Die „juristische‘‘ Methode Otto Mayers
99
schlechter Konstruktion unterscheiden,209 dürfe eben nicht künstlich,210 nicht a priori konstruieren.211 Der Rechtswissenschaftler habe nur zu beobachten und getreulich wiederzugeben, was ist,212 nicht aber etwas Neues zu schaffen.213 Man dürfe nicht etwas „erfinden“, denn in der Rechtswissenschaft gebe es keine Erfinder oder solle es sie wenigstens nicht geben. Nur das, was das Leben wirksam und schaffend an Rechtsstoff schon enthalte, weise sie auf und beschreibe sie.214 Für das Verständnis von der Eigenart der Methode Otto Mayers muß zudem die im vorangegangenen Abschnitt215 aufgezeigte Tatsache Berücksichtigung finden, daß sich die meisten Vertreter der „juristischen“ Methode von den tatsächlichen Verhältnissen weitgehend gelöst hatten, indem sie als „Recht“ nur das ansahen, was sich auf die allein von der Wissenschaft entwickelten, hypostasierten Begriffe zurückführen und ableiten ließ. Denn aus ihr wird offenbar, daß Otto Mayer die Eigenart seiner „juristischen“ Methode in dem angegebenen Zitat216 mit den Worten umschreibt, daß für ihn die Ideen „in den Mannigfaltigkeiten des wirklichen Rechts zur Erscheinung und Entfaltung kommen“ müssen, soll aus ihnen heraus die Konstruktion eines deutschen Verwaltungsrechts möglich sein. An Paul Laband gerichtet etwa sagt er, daß die Staatsrechtswissenschaft dank ihm als ihrem vornehmsten Vertreter zwar vom „Geist entschlossener Einseitigkeit“ beseelt sei. Aber selbstverständlich bleibe „daneben die gleichwertige Forderung bestehen, dass unsere juristischen Begriffe doch nichts anderes sein sollen als nur eine Wiedergabe jener sozialen Tatsachen in ihrer besonderen Sprache“.217 Anders als die meisten Vertreter der „juristischen“ Methode sieht Otto Mayer mithin in den Begriffen respektive Ideen keine „Wesenheiten“, die allein der Gedankenwelt des Wissenschaftlers entspringen und darum „erfunden“ sind.218 Vielmehr müssen sich für ihn die Ideen als der empiri209
Rez. Triepel, JW 47 (1918), S. 158 (159). Rez. Fried, JW 48 (1919), S. 20 (21). 211 Rez. Goez, AöR 19 (1905), S. 590 (592). 212 Vgl. Grundsätze, Verhandlungen des 16. DJT 1 (1882), S. 217 (239); Eisenbahn II, AöR 16 (1902), S. 38 (65 f.); Universität (1922), S. 30. 213 Rez. Hatschek, ZgesStaatsWiss 63 (1907), S. 541 (542). Ähnlich: Justiz (1902), S. 25; Portalis (1902), S. 7. 214 Stand des öffentlichen Eigentums, AöR 21 (1907), S. 499 (499). 215 Vgl. 4. Kapitel, A. V. 216 Vgl. 4. Kapitel, B. II. 217 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (3). 218 Vgl. Grundsätze, Verhandlungen des 16. DJT 1 (1882), S. 217 (227): „Wir haben jetzt mehr Achtung vor den Thatsachen. Nicht das subjektive Meinen und Fürguthalten darf entscheiden, sondern es handelt sich darum, um sich zu schauen und zu beobachten, wohin das Ganze geht. Unsere Gesetzgebung, Rechtspflege und 210
100
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
schen Wirklichkeit inhärent erweisen,219 soll der Wissenschaftler sie allein durch Beobachtung nachweisen können. Sie müssen den Gesetzen, diesem „Hauptstock des Verwaltungsrechts“,220 zugrunde liegen. Daher habe man „zuerst hinab[zu]steigen in das Detail des positiven Rechts, um dessen leitende Ideen [. . .] zu finden“,221 und habe die „lebendige Gliederung, in welcher die verschiedenen Rechtsinstitute vom Gesetzgeber, bewußt oder unbewußt, gedacht waren, [. . .] zu erkennen und aufzuweisen“.222 Bei der Suche nach den das Recht beherrschenden Ideen orientiert sich Otto Mayer eng an der Rechtshandhabung durch die Verwaltungsgerichte und Verwaltungsbehörden. Sie ist für ihn gar die eigentliche „Rechtswirklichkeit“.223 Entscheidend ist es seiner Meinung nach daher auch, gemäß welchen Ideen die Gerichte und Behörden sich bei der Auslegung und Anwendung des Rechts haben leiten lassen.224 Diese Ideen sind es sodann, Rechtslehre bieten uns ja eine Fülle von Erscheinungen, an welchen vielleicht eine bestimmte Richtung zu erkennen ist, und ist das der Fall, so muß in dieser Richtung weitergegangen werden, es gibt dann keine Wahl.“ 219 Ähnlich: Hueber, Methode, S. 18 ff.; Heyen, Otto Mayer, S. 188 f.; Kleinheyer/Schröder, Deutsche Juristen3, S. 178 (179). Zum Teil a. A.: Meyer-Hesemann, Methodenwandel, S. 43. 220 Rez. Hatschek, ZgesStaatsWiss 63 (1907), S. 541 (546). 221 Rez. Goez, AöR 19 (1905), S. 590 (592). Ähnlich: Rez. Neumeyer, AöR 28 (1912), S. 350 (350). 222 Selbstdarstellung (1924), S. 8. Vgl. insoweit auch: Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 19 f., 21, 23. 223 Vgl. Rez. Zolger, AöR 14 (1899), S. 135 (136): „Den Stoff liefern nicht blosse Lehrmeinungen und Schulbegriffe, sondern das lebendige Recht soll es sein in enger Anlehnung an die Wirklichkeit der Rechtshandhabung. Die Aussprüche des Verwaltungsgerichtshofes und anderer Behörden spielen die Hauptrolle.“ Siehe zudem: Rez. Anschütz, AöR 17 (1902), S. 464 (465): „Das ist gerade der schwache Punkt der bekämpften Lehre, dass sie keinen Boden in der Wirklichkeit der Rechtshandhabung hat und das, was sie dafür ansieht, eitel Missverständnis ist.“ In: Selbstdarstellung (1924), S. 10, heißt es: „Um mir wieder die volle Anschauung von der Wirklichkeit dieses Rechts zu verschaffen, wie ich sie für die zuletzt vorausgegangenen zivilrechtlichen Arbeiten der jahrelangen Advokatur verdankt hatte, waren zuerst einmal die zahlreichen Bände der Entscheidungen des Conseil d’Etat, des französischen Verwaltungsgerichtshofes, durchzuarbeiten.“ 224 Vgl. Rez. Lobe, ZgesHandelsR 61 (1908), S. 274 (275): „Nur habe ich in der Anwendung, welche die französische Rechtsverwirklichung hier von dem Art. 1382 macht, bestimmte leitende Gedanken nachweisen zu können geglaubt, während der Verfasser einen etwas anderen Weg geht.“ Siehe auch: Universität (1922), S. 30: „[. . .] die wohl beobachtende Wirklichkeit des Rechts, nur eben mit der Aufgabe, die darin wirksamen allgemeinen Ideen zu erkennen und aufzuweisen.“ Vgl. auch: Fleiner, SchweizJZ 21 (1924/25), S. 77 (77): „Otto Mayer [. . .] erkannte, daß in der Unzahl von Einzelvorschriften der Verwaltungsgesetze allgemeine Rechtsbegriffe enthalten sind, die immer wiederkehren und die zusammen in ihrer geistigen Verbindung ein juristisches System ausmachen. Auf mehr als einem Gebiete hatte bereits die Rechtsprechung der deutschen Verwaltungsgerichte solche allgemeinen
B. Die „juristische‘‘ Methode Otto Mayers
101
die, weil sie in der Rechtswirklichkeit zur Erscheinung und Entfaltung gelangt sind, Otto Mayers Ansicht nach der Rechtsordnung zugrunde liegen. So schreibt er, daß „die Rechtsideen [. . .] erst in ihrer Wahrheit“ erschienen, „wenn die Mannichfaltigkeit des Lebens an die vom Gericht gehandhabte Rechtsregel“ schlage.225 Dieses Verständnis von der „Rechtswirklichkeit“ erlaubt es Otto Mayer, an die Spitze seines Systems die „ineinandergreifenden“ Ideen vom „modernen Staat“ und vom Rechtsstaat zu stellen, und damit zwei Ideen, von denen sich zwar die Gerichte und Behörden bei der Rechtshandhabung wohl haben leiten lassen,226 von denen jedoch keine im positiven Recht einen Ausdruck gefunden hatte, so daß ihr Geltungsgrund zumindest fragwürdig war.227 Kann eine Idee als der Rechtswirklichkeit immanent erwiesen werden, besitzt sie nach Ansicht Otto Mayers die Kraft, das positive Recht „machtvoll zu durchbrechen“.228 Der Wissenschaftler müsse infolgedessen „ein gewisses Maß von Freiheit beanspruchen: um auszuscheiden, was innerlich abgestorben oder wertlose Besonderheit ist, und dem, was lebendig und zukunftsreich ist, dann zum rechten Wort zu verhelfen“.229 Die Idee müsse „voll ausgedacht“ werden,230 durchdacht werden „in alle ihre FolgerunGrundsätze, zum Teil ohne klare Erfassung ihres Wesens, zur Anwendung gebracht und eine wichtige Pionierarbeit geleistet. Diese allgemeinen Begriffe galt es wissenschaftlich herauszuschälen aus dem fast unübersehbaren Material, das Gesetzgebung und Rechtsprechung darboten, und sie der Praxis an die Hand zu geben.“ 225 Oberverwaltungsgericht, PreußVBl. 22 (1900/01), S. 96. Vgl. zudem: Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 74: Wenn der Begriff des öffentlich-rechtlichen Eigentums „eine Folgerung darstellt aus den Grundideen, die unser neues Verwaltungsrecht beherrschen, so muß ihn das geltende Recht selbst, bewußt oder unbewußt, in solcher Weise durchdacht haben. Unsere Aufgabe wird es sein, darzutun, daß dessen Wirklichkeiten in der Tat ihm entsprechen, recht zu verstehen sind nur aus im heraus. Das ist dann auch der Beweis aus dem positiven Recht, den wir zu liefern haben, der einzige, aber auch der durchschlagende.“ 226 Dennewitz [Systeme des Verwaltungsrechts, S. 118.] konstatiert für die seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts errichteten Verwaltungsgerichte, sie hätten verstärkt den Willen zur Rechtsstaatlichkeit betätigt. 227 Ein „Positivist“ – dieser Begriff wird hier vermieden – war Otto Mayer daher in den Augen etwa von Bachof [VVDStRL 30 (1972), S. 193 (216 mit Fn. 96).] und Schmidt-De Caluwe [Der Verwaltungsakt, S. 55 f.] nicht. Anderes vertritt in der Tendenz Meyer-Hesemann [Methodenwandel, S. 45.]. 228 Vgl. Rez. Cathrein, DZKirchenR 20 (1911), S. 389 (389): „Denn wiewohl wir nicht verkennen, daß hinter den Rechtsordnungen [. . .] noch andere Ideen stehen, die sehr maßgebend auf sie einwirken und unter Umständen sie machtvoll durchbrechen [. . .].“ 229 Vgl. Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), Vorwort S. IX. Ähnlich: Selbstdarstellung (1924), S. 12. 230 Grundsätze, Verhandlungen des 16. DJT 1 (1882), S. 217 (236).
102
4. Kapitel: Das Methodenverständnis Otto Mayers
gen“;231 der Gedanke bedürfe einer „entschlossenen Durchführung“.232 Die Idee wird mithin in ihrer Geltung verallgemeinert.233 Der aus der Idee vom modernen Staat entstammende Grundgedanke von der „besonderen Kraft des Staatswillens“ gehört für Otto Mayer zu eben jenen Prinzipien, die, weil sie der Rechtswirklichkeit immanent sind, allgemeine Geltung zu beanspruchen haben. Daher erhebt er diesen Grundgedanken zu der „einheitlichen Grundlage“, „deren ein selbständiger Zweig der Rechtswissenschaft“ bedürfe. „In jeder Art von Einwirkung auf den Einzelnen“, und nicht allein im Befehl sieht er ihn infolgedessen in Erscheinung treten.234 „Alle unsere einzelnen Rechtsinstitute“ müssen sich demnach „nachweisen lassen“ als „Offenbarung dieser Kraft“.235 231
Entschädigungspflicht (1904), S. 6. Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (86). 233 Neues vom öffentlichen Eigentum, AöR 39 (1920), S. 77 (90): „Man kann“, so Otto Mayer, „nicht den Staatsdienstvertrag, die öffentliche Grunddienstbarkeit, die Verleihung öffentlicher Unternehmungen und die Verleihung besonderer Nutzungen an öffentlichen Sachen aus dem Banne des Privatrechts lösen und selbständig nach Gedanken, die dem öffentlichen Rechte eigen sind, durchbilden, ohne das Gleiche auch mit dem Rechtsinstitut des Eigentums vorzunehmen [. . .].“ 234 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (32). Vgl. auch: Eisenbahn II, AöR 16 (1901), S. 38 (46): „Ungemein viel reicher ist die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, in welchen wir ihre [scil.: der Staatsgewalt] Wirksamkeit erkennen [. . .].“ Siehe auch: Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 73: „Die Erscheinung der öffentlichen Gewalt kann, wie wir wissen, sehr mannigfaltige Gestaltungen annehmen. Wer immer nur einen Befehl als solche anerkennen will, verzichtet von vornherein auf das Verständnis unseres neuzeitlichen Verwaltungsrechts.“ Neues vom öffentlichen Eigentum, AöR 39 (1920), S. 77 (94): „[. . .] Aeußerung öffentlicher Gewalt (die selbstverständlich nicht gleichbedeutend ist mit dem plumpen Befehl;) [. . .].“ Vgl. daneben: Selbstdarstellung (1924), S. 13: „[. . .] obrigkeitliche Akte, durch die er im Einzelfall bestimmt, was Rechtens sein soll (nicht bloß befiehlt), [. . .].“ 235 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (86). Ebd.: „Der Wissenschaft des deutschen Verwaltungsrechts steht sicherlich für die nächste Zukunft ein gewaltiger Aufschwung bevor. Das neue Civilgesetzbuch wird zu einer festeren Abgrenzung der Gebiete führen. Das sich auflösende deutsche Privatrecht wird uns eine ganze Reihe von Rechtsinstituten herausgeben, die es jetzt noch in Anspruch nimmt. [. . .] Das deutsche Verwaltungsrecht erhält eine Fülle von Stoff [. . .].“ Davon, daß „das deutsche Privatrecht [. . .] eine ganze Reihe von Rechtsinstituten herauszugeben“ habe, spricht auch: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 136 Fn. 2. Vgl. insoweit auch: Selbstdarstellung (1924), S. 13: „Es gilt vor allem dem Mangel an Verständnis abzuhelfen für den Reichtum des neuen öffentlichen Rechts, der da enthalten ist in den Gestaltungsmöglichkeiten der unseren Rechtsstaat kennzeichnenden Einrichtungen.“ Schon in: Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 156, heißt es: „Aus der beschränkten Anwendbarkeit des Civilrechts ergibt sich für das Verwaltungsrecht, welchem alles Uebrige zu ordnen überlassen ist, ein grosser R e i c h t h u m a n F o r m e n , grösser als man ihn sich gemeiniglich vorstellt. Es handelt sich nicht um die Ausübung einzelner bestimmter Hoheitsrechte: alle Arten von Einwirkungen des Staates auf die Einzelnen sind in verwaltungsrechtlicher Gestalt denkbar.“ Hervorhebung im Original. 232
C. Zusammenfassung
103
C. Zusammenfassung Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß das Vorgehen Otto Mayers mit der „juristischen“ Methode die Annahme teilt, daß die Jurisprudenz eine Wissenschaft nur sein kann, wenn sie versucht, das Recht auf der Grundlage eines Systems zu erklären. Dabei meint auch für ihn das System nicht nur die an rein tatsächlichen Gesichtspunkten orientierte Ordnung des gegebenen Rechtsstoffes, sondern die Schaffung einer Einheit in der Vielfalt. Das Recht nämlich wird zurückgeführt, „konstruiert“, auf immer allgemeinere Begriffe beziehungsweise Ideen, bis es sich schließlich als Ableitung aus einer obersten Idee, dem „eine[n] Punkt“ in der Sprache Otto Mayers, begreifen läßt. Von der Mehrzahl der Vertreter der „juristischen“ Methode unterscheidet sich Otto Mayer durch die Forderung, daß die Ideen in der „Rechtswirklichkeit“ erst „zur Erscheinung und Entfaltung“ gekommen sein müssen, soll aus ihnen heraus das Recht eines Gebietes „konstruiert“ werden können. Unter der Rechtswirklichkeit versteht Otto Mayer weniger das positive Recht, als vielmehr die Handhabung des Rechts durch die Gerichte und Behörden. Haben sie sich von einer Idee bei ihren Entscheidungen „leiten“ lassen, liegt die Idee für Otto Mayer der Rechtsordnung zugrunde.
5. Kapitel
Das Verhältnis des Staats- zum Methodenverständnis Auf die Frage, warum Otto Mayer den Begriffen „Vertrag“ und „öffentliches Recht“ Inhalte beilegt, derentwegen der zusammengesetzte Begriff des „öffentlich-rechtlichen Vertrages“ im Staat-Bürger-Verhältnis einen Widerspruch in sich bildet, konnte im zweiten Kapitel geantwortet werden, daß für Otto Mayer öffentliches und privates Recht je eigene „Rechtsarten“ sind, so daß das Verwaltungsrecht ein System eigentümlicher Rechtsinstitute der staatlichen Verwaltung zu sein hat. Darüber hinaus konnte dargelegt werden, daß Otto Mayer vor allem durch sein Verständnis von der Natur des Staates und von Methode im Recht zu eben jener Vorstellung einer strikten Dichotomie von privatem und öffentlichem Recht geleitet wird. Offen gelassen werden mußte allerdings die Frage, inwiefern und inwieweit jeweils die Begriffe von Staat und Methode im Recht als Urheber dieser Vorstellung anzusehen sind. Mit den Erkenntnissen aus dem dritten und vierten Kapitel läßt sie sich beantworten.
A. Der Einfluß des Methodenverständnisses auf die Begriffe von Staat und Vertrag Für Otto Mayer setzt das Recht einander gegenüberstehende Rechtssubjekte voraus. Im Bereich des Verwaltungsrechts ist dies – zumindest im Sinne der „gewöhnlichen Redeweise“1 – auf der einen Seite der Staat, und auf der anderen Seite der ihm „untertane“ Mensch. „Verwaltungsrecht bedeutet also die rechtliche Ordnung der Verhältnisse zwischen dem verwaltenden Staat und den ihm dabei begegnenden Untertanen.“2
1 Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 13 Fn. 2. Ebd., heißt es dann, der Jurist müsse sich dies genauer „zurechtlegen“. Vgl. auch Abschnitt B. im 6. Kapitel. 2 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 13 f.; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 13. Sehr ähnlich: Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 13 f.
A. Das Methodenverständnis und die Begriffe von Staat und Vertrag
105
Das Verhältnis zwischen dem Staat und dem einzelnen Bürger ist keines der Gleichordnung. Denn gemäß der „echten kräftigen Staatsidee“ ist für Otto Mayer „der Staat von Natur etwas ganz anderes wie ein gewöhnlicher Privatmann“.3 Diesem Umstand muß das Verwaltungsrecht Rechnung tragen. Mit dem auf die Gleichordnung der Rechtssubjekte berechneten Privatrecht kann es daher ein gemeinsames Rechtsinstitut wie etwa den Vertrag nicht aufweisen.4 Daß der Staat seiner Natur nach etwas ganz anderes als ein gewöhnlicher Privatmann ist, leitet sich zu einem Teil aus dem hohen Stellenwert her, den Otto Mayer der dem Staat zufallenden Aufgabe, die auf seinem Gebiet lebenden Menschen zu einer Nation zu vereinen, beimißt. Denn aufgrund dieser Aufgabe besitzt für Otto Mayer der Staat „Majestät“ und „Herrlichkeit“, ja ist der Staat von seinen Bewohnern mit Ehrfurcht zu betrachten.5 Staat und Bürger als ungleich zu betrachten, folgt jedoch weit mehr noch aus der Tatsache, daß dem Willen des Staates zwingend eine stets einseitig bindende Kraft zukommt. Diese Tatsache wiederum ist nicht allein eine Konsequenz aus der dem Staate zufallenden Aufgabe. Der Umstand nämlich, daß der Staat einem über die Zwecke einzelner hinausgehenden Zweck zu dienen bestimmt ist und somit ein „Gemeinwesen“ bildet, mag es zwar als zweckdienlich oder angemessen erscheinen lassen, daß der Wille des Staates über eine höhere Natur verfügt. Angesichts der nicht auszuschließenden Möglichkeit jedoch, daß der Staat den ihm zukommenden Zweck auch auf andere Weise zu verwirklichen vermag, läßt sich aus dem Zweck des Staates nicht zwingend logisch herleiten, daß dem Handeln des Staates eine stets einseitig bindende Kraft zukommen muß. Dies jedoch ist notwendig, da andernfalls der Begriff des öffentlich-rechtlichen Vertrages im Staat-Bürger-Verhältnis nicht mehr gegen die Denkgesetz verstieße, mithin nicht mehr „undenkbar“ wäre. Daß der Staat notwendig stets mit einseitig bindender Kraft handelt, ist Otto Mayers Verständnis von Methode im Recht geschuldet.6 Es ist das Ergebnis des von Otto Mayer vertretenen Standpunktes, daß die Wissenschaft 3
Justiz (1902), S. 19. Vgl. im 2. Kapitel unter A. 5 Vgl. im 3. Kapitel unter D. 6 Es sei an dieser Stelle daran erinnert, daß Otto Mayer seine Abhandlung „Zur Lehre vom öffentlichrechtlichen Vertrage“ [AöR 3 (1888), S. 3 ff.] mit dem Satz einleitet, daß die Verwaltungsrechtswissenschaft „ein System eigenthümlicher Rechtsinstitute der staatlichen Verwaltung“ sein müsse, wolle sie „als gleichberechtigte juristische Disciplin neben die älteren Schwestern treten“. Wäre Otto Mayer auch ohne den Einfluß seines Methodenverständnisses der Ansicht gewesen, daß der Staat aufgrund der Denkgesetze stets einseitig bindend handelt, hätte es eines Hinweises auf das Vorbild der älteren Rechtsdisziplinen, die dank der „juristischen“ 4
106
5. Kapitel: Das Verhältnis des Staats- zum Methodenverständnis
das Recht allein im System darbieten und begreifen könne.7 Denn der Begriff des Systems meint für Otto Mayer die Entfaltung einer Einheit in der Vielfalt. Vermittelt wird für ihn diese Einheit durch ein an den Regeln der formalen Logik orientiertes Prinzip, mithin ein Prinzip, das nicht nur eine Aussage darüber zuläßt, welche Elemente zu dem System gehören, sondern auch darüber, in welchem Zusammenhang die Elemente untereinander stehen. Das erklärte Ziel Otto Mayers ist es, das Recht als eine Deduktion aus einigen wenigen ineinandergreifenden Ideen zu erklären. Zu diesen Ideen zählt Otto Mayer die Idee der einseitig bindenden Kraft des Staatswillens. Sie ist daher neben den aus dem Prinzip des Rechtsstaates sich ergebenden Gedanken der „eine Punkt, aus welchem das ganze Rechtssystem der Verwaltung heraus zu konstruieren“ ist.8 Dem Einfluß des Methodenbegriffes auf den Begriff des Staates ist es daher zuzuschreiben, daß es zwingend in der Natur des Staates liegt, mit einseitig bindender Kraft zu handeln. Das Methodenverständnis Otto Mayers offenbart zudem, weshalb Otto Mayer dem Begriff des Vertrages einen Inhalt beilegt, der dem des öffentlichen Rechts widerstreitet. Denn auch das Zivilrecht muß sich insgesamt als Offenbarung eines einzelnen Grundbegriffes erweisen. Da die Zivilrechtswissenschaft am Zivilrecht die Grenzen der rechtlichen Willensmacht der Einzelnen gegeneinander untersucht, findet sie ihren Grundbegriff im subjektiven Recht. Infolgedessen sind alle ihre Rechtsinstitute Arten subjektiver Rechte und damit gebaut auf dem Boden der Gleichheit der Rechtssubjekte. Der Vertrag ist ein Rechtsinstitut des Zivilrechts. Deshalb setzt er die Übereinstimmung zweier gleichberechtigter Willenserklärungen voraus. Im öffentlichen Recht, das durch die Ungleichheit der Rechtssubjekte charakterisiert ist, ist er „undenkbar“.9
B. Staats- und Methodenbegriff als einander bedingende Begriffe Die Vorstellung Otto Mayers von Methode im Recht und ihr enger Zusammenhang mit dem Begriff des Staates erklären darüber hinaus, daß Otto Mayer bei der Frage, ob ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im StaatBürger-Verhältnis denkbar ist, einen anderen Standpunkt einnimmt als Paul Laband.10 Methode je für sich bereits betrachtet als ein in sich geschlossenes System dargestellt wurden, nicht bedurft. 7 „Rechtswissenschaft zumindest ist systematisch, oder sie ist nicht.“ Dieser Satz stammt zwar von Hans Julius Wolff [Studium Generale 5 (1952), S. 195 (205).], bringt jedoch auch das methodische Denken Otto Mayers prägnant zum Ausdruck. 8 Vgl. Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (86 mit Fn. 122). 9 Vgl. im 2. Kapitel unter A.
B. Staats- und Methodenbegriff als einander bedingende Begriffe
107
Paul Laband ist der Auffassung, die von Otto Mayer „entwickelte Lehre vom ,öffentlich-rechtlichen Vertrage‘“ sei „am bedenklichsten“.11 Für Paul Laband bedeutet es „eine Ueberspannung, in a l l e n staatlichen Akten immer nur Aeßerungen der Staatsgewalt, der Herrschaft, zu erblicken“.12 Werde „jeder staatliche Akt ohne Ausnahme und ohne Rücksicht auf seinen Inhalt und seine Rechtswirkung als hoheitlich bezeichnet“, so habe „dieser Ausdruck gar keinen spezifischen Sinn; er“ sei „synonym mit staatlich“ und könne „daher nicht zur Charakteristik staatlicher Akte dienen“.13 Solle daher „die Bezeichnung ,Machtäußerung, Herrschaftsakt‘ eine besondere juristische Qualifikation sein“, müsse „sie in einem engeren, prägnanten Sinne genommen werden“. „Aeußerungen der Macht, des imperium“ seien die „einzelnen staatlichen Handlungen“ nur, wenn sie „einen Befehl, einen Zwang“ enthielten. Die Anschauungen Otto Mayers, „dass die gesammte staatliche Verwaltungstätigkeit Ausübung der hoheitlichen Macht über die Einzelnen sei“, sind deshalb seines „Erachtens unhaltbare“. Der Staat könne vielmehr bei der „Begründung von Verhältnissen, welche er durch einseitigen Herrschaftsakt hervorzurufen imstande wäre“, es vorziehen, „dem Einzelnen, der davon betroffen wird, einen Anteil, ein Mitwirkungsrecht einzuräumen“. „Wenn der Staat dabei besser fortkommt, warum soll er sich unnöthiger Weise als Herrscher aufspielen.“14 Anders als Otto Mayer kann Paul Laband daher die Schlußfolgerung ziehen, daß sich der Staat „als solcher“ nicht nur im Bereich des Privatrechts, sondern auch im Bereich des öffentlichen Rechts mit dem Bürger auf eine Stufe zu stellen vermag: „Der Untertan [. . .] kann sich freilich niemals auf das Niveau des Staates [. . .] e r h e b e n , wohl aber kann die höhere Macht auf die Stufe der ihr untergeordneten herabsteigen und sich der für letztere geltenden Rechtsordnung für bestimmte Verhältnisse unterwerfen. Die zahllosen täglich zwischen den 10
Daß dem Standpunkte Otto Mayers allein derjenige Paul Labands gegenübergestellt wird, findet seine Rechtfertigung in der Tatsache, daß Paul Laband schon zu Lebzeiten als der bedeutendste Staatsrechtslehrer des ausgehenden 19. Jahrhunderts angesehen wurde [vgl. Pauly, Methodenwandel, S. 207 ff.; Stolleis, Geschichte II, S. 341 mit Fn. 145.], und daß wohl erst die von Laband [Rez. Mayer, AöR 2 (1887), S. 149 ff.] geübte Kritik an der von Otto Mayer in dessen „Theorie des französischen Verwaltungsrechts“ erstmals vertretenen „Lehre vom öffentlich-rechtlichen Vertrag“ [ebd., S. 290 ff.] die kontroverse Auseinandersetzung über die begriffliche Möglichkeit eines Verwaltungsvertrages auslöste [Pakeerut, Vertrag, S. 27 ff.]. 11 Rez. Mayer, AöR 2 (1887), S. 149 (157). 12 Staatsrecht I5 (1911), S. 166 Fn. 5. Hervorhebung im Original. Gleichlautend: Rez. Wenzel, AöR 26 (1910), S. 365 (366). 13 Rez. Mayer, AöR 2 (1887), S. 149 (158). Ähnlich: Staatsrecht I5 (1911), S. 69 f. 14 Rez. Mayer, AöR 2 (1887), S. 149 (159). Vgl. auch: Staatsrecht I5 (1911), S. 69.
108
5. Kapitel: Das Verhältnis des Staats- zum Methodenverständnis
Staaten und ihren Untertanen abgeschlossenen Geschäfte vermögensrechtlichen Charakters genügen, um dies unwiderleglich zu erweisen; denn der Fiskus ist doch nichts anderes als der Staat selbst, kein vom Staat verschiedenes Rechtssubjekt, sondern eben der Staat soweit er sich in der Sphäre des Privatrechts bewegt und die Privatrechtsordnung als für sich verbindlich anerkennt. Kann sich der Staat der Privatrechtsordnung unterwerfen und sich auf die gleiche Stufe mit Privatpersonen stellen, so kann es doch nicht für ,begrifflich unmöglich‘ erklärt werden, daß der Staat auch auf dem Gebiet des öffentl. Rechts das Gleiche tut und eine gemeinsame Rechtssphäre anerkennt, innerhalb derer er mit Selbstverwaltungskörpern oder Einzelpersonen auf dem Fuße der Gleichberechtigung gewisse Verhältnisse ordnet.“15 Daß Paul Laband und Otto Mayer die Frage, inwieweit der Staat einseitig bindend handelt, verschiedentlich beantworten, gründet sich darauf, daß Otto Mayer dem Begriff vom Staat einen der Philosophie entnommenen, nach seinem Dafürhalten „großartigen“ Staatszweck zugrunde legt, Paul Laband hingegen mögliche Aufgaben und Ziele des Staates bei einer Bildung vom Begriff desselben außer acht läßt. Der Unterschied in der Bildung vom Begriff des Staates wiederum findet seinen Grund in der Tatsache, daß das Methodenverständnis Paul Labands in einem wesentlichen Punkt von demjenigen Otto Mayers abweicht. So sind zwar sowohl Paul Laband, als auch Otto Mayer Vertreter der sogenannten „juristischen“ Methode. Beide gehen mithin davon aus, daß das Recht durch eine Reduktion auf einige wenige, allgemeine Begriffe streng systematisch dargestellt und erklärt werden müsse. Während Paul Laband jedoch der Auffassung ist, die Dogmatik erschöpfe sich in einer rein logischen Denktätigkeit,16 die es verbiete, bei der Begriffsbildung den Zweck, dem der durch den Begriff zu beschreibenden Gegenstand diene, zu berücksichtigen,17 konstruiert Otto Mayer das Recht nach der Maßgabe von Ideen, die im „wirklichen Recht“, 15 Rez. Wenzel, AöR 26 (1910), S. 365 (366). Hervorhebung im Original. Nahezu gleichlautend die Ausführungen in: Staatsrecht I5 (1911), S. 166 Fn. 5. Vgl. auch: Staatsrecht I5 (1911), S. 448 f.; Staatsrecht II5 (1911), S. 188 ff.; Rez. Mayer, AöR 2 (1887), S. 149 (159). Rez. Preuss, AöR 18 (1903), S. 73 (78): „Dass der Staat und die Gemeinden [. . .] mit Einzelpersonen Verträge schliessen, [. . .] steht mit dem Begriff und Wesen des Staates nicht im Widerspruch. Daraus folgt keineswegs, dass diese Verträge unter den Regeln des C i v i l r e c h t s stehen müssen; sie können durchaus von besonderen, dem ö f f e n t l i c h e n Recht angehörenden Grundsätzen beherrscht werden und dennoch z w e i s e i t i g e Rechtsgeschäfte sein. Denn die Rechtsform des Vertrages ist von so allgemeiner und umfassender Art, dass sie ebenso dem Privatrecht wie dem öffentlichen Recht angehört, und es ist eine ganz unbegründete Behauptung, dass die Annahme des Staatsdienstvertrages ein Rückfall in die privatrechtliche Auffassung [. . .] sei.“ Hervorhebung im Original. 16 Vgl. Staatsrecht I5 (1911), Vorwort S. IX.
B. Staats- und Methodenbegriff als einander bedingende Begriffe
109
also in der Handhabung des Rechts durch die Verwaltungsgerichte und -behörden, „zur Erscheinung und Entfaltung“ gelangt sind, und deren Inhalte er der Rechtsphilosophie Fichtes und Hegels entnommen glaubt.18 Konsequent ist es daher, wenn Otto Mayer fordert, die Rechtswissenschaft müsse auch die – unter anderem durch Fichte und Hegel umschriebenen – „sozialen“ Tatsachen bei der Begriffsbildung berücksichtigen: „Jellinek hat in seiner Allg. Staatslehre die Forderung aufgestellt, dass die historisch politische Betrachtungsweise des Staates, die ihn als soziale Erscheinung ins Auge fasst, streng gesondert bleibe von der juristischen. Es ist die Ursache der verhängnisvollsten Irrtümer, dass man ,die juristische Natur des Staates fortwährend mit seiner sozialen Realität vermischt‘. Damit bringt er vortrefflich zum Ausdruck den Geist entschlossener Einseitigkeit, der die Stärke der Staatsrechtswissenschaft ausmacht und dessen vornehmster Vertreter Laband ist. Aber selbstverständlich bleibt daneben die gleichwertige Forderung bestehen, dass unsere juristischen Begriffe doch nichts anderes sein sollen als nur eine Wiedergabe jener sozialen Tatsachen in ihrer besonderen Sprache.“19 Den Schriften Fichtes und Hegels entnimmt Otto Mayer, daß dem Staat in seiner „sozialen Realität“ die Aufgabe zufällt, die auf seinem Gebiet lebenden Menschen zu einer Nation zu vereinen. Aufgrund dieser – aus der Sicht Otto Mayers hehren – Aufgabe kann und sollte es in Natur des Staates liegen, mit einseitig bindender Kraft zu handeln. Aus seinem Verständnis von Methode im Recht leitet Otto Mayer her, daß es sogar in der Natur des Staates liegen muß, einseitig bindend zu handeln. Staat und Bürger sind für Otto Mayer daher zwei voneinander grundverschiedene Rechtssubjekte. Infolgedessen kann der Staat „als solcher“ in den Bahnen eines auf die Gleichordnung der Rechtssubjekte zugeschnittenen Rechts nicht handeln. „Als solcher“ handelt er darum im Bereich des öffentlichen Rechts, das dem Umstand der „Mehrwertigkeit“ des Staates Rechnung trägt.20 Das auf der Gleichordnung der Rechtssubjekte aufgeVgl. Staatsrecht I5 (1911), S. 67: „Da kein Rechtsinstitut auf die Dauer sich erhalten kann, welches nicht einem als berechtigt anerkannten (vernünftigen) Lebenszweck dient, so liegt die Versuchung nahe, den Zweck in den Rechtsbegriff selbst zu verlegen und die schwierige und strenge Untersuchung der logischen Elemente, aus denen sich der Begriff eines Rechtsinstitutes komponiert, mit einer Spekulation über seinen Nutzen oder seine Notwendigkeit zu vertauschen. Diese Methode ist m. E. ein Abweg.“ 18 Vgl. 4. Kapitel, B. II. 19 Person, in: FG Laband (1908), S. 1 (3). 20 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 16; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 15: „Das öffentliche Recht ist aber nichts anderes als die O r d n u n g v o n Ve r h ä l t n i s s e n , a n w e l c h e n e i n T r ä g e r ö f f e n t l i c h e r Gewalt als solcher und damit die öffentliche Gewalt 17
110
5. Kapitel: Das Verhältnis des Staats- zum Methodenverständnis
baute Zivilrecht auf den Staat anzuwenden, muß aus der Sicht Otto Mayers die eng begrenzte Ausnahme bleiben.21 Sie sei „nichts Selbstverständliches, sondern eine geschichtliche Errungenschaft“.22 Sie bedürfe einer besonderen Begründung23 und gelte nur dort, wo der Staat „seine Natur verleugnet“.24 Sie setze voraus, daß „die Verwaltung in Lebensverhältnisse“ eintrete, „wie sie auch bei dem Einzelnen vorkommen, um alsdann bei diesem durch die Bestimmung des Zivilrechts geregelt zu werden“.25 Genauer erklärt wird durch Otto Mayer die Anwendung des Zivilrechts auf den Staat nicht.26 Immerhin ist es seines Erachtens auch nicht der vom Staat abgetrennte, weil als selbständige juristische Person und Privatmann begriffene, Fiskus, welcher die Anwendung eines auf die Gleichordnung der Rechtssubjekte zugeschnittenen Rechts auf den Staat ermöglicht.27 Der Fiskus nämlich ist für Otto Mayer „einfach der Staat selbst, von einer bestimmten Seite betrachtet“. Er ist der Staat als „Subjekt des Staatsvermögens, der auf Vermögensbesitz und Vermögenserwerb gerichtete Staat“.28 s e l b s t b e t e i l i g t i s t .“ Hervorhebung im Original. Vgl. auch: Staatsrecht (1909), S. 266: „Verhältnisse des öffentlichen Rechts werden wir überall anzunehmen haben, wo an einem solchen die öffentliche Gewalt selbst beteiligt ist.“ 21 Französisches Verwaltungsrecht (1886), S. 153; Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 141 f.; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 118; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 115. Vgl. auch im 1. Kapitel unter B. 22 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 54 Fn. 2. 23 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 54, 141 f. 24 Vgl. Haftung, SächsArchR 8 (1913), S. 1 (5): „[. . .]; die Anwendung des bürgerlichen Rechts ist hier die eng begrenzte Ausnahme, nur geltend, soweit der besondere Grund dafür reicht, der Umstand nämlich, daß der Staat, seine Natur verleugnend, sich herunterbegeben hat zum gewöhnlichen Privatmann, um wie ein solcher und in privatwirtschaftlicher Weise seine Geschäfte zu besorgen.“ 25 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 118; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 115. 26 Diese Feststellung trifft in dieser Form ebenso – soweit ersichtlich – nur: Schlette, Vertragspartner, S. 36 Fn. 152. Vgl. jedoch zudem: Kempen, Formenwahlfreiheit, S. 24; Krebs, in: Schmidt-Aßmann/Krebs, Städtebauliche Verträge, S. 120 (126 mit Fn. 297). 27 Nach Ansicht von Buddeberg [AöR 47 (1925), S. 85 (131 f.).] könnten all diejenigen, die, wie Otto Mayer, zwar einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Staat und dem Bürger für undenkbar erachteten, die Möglichkeit des Abschlusses eines zivilrechtlichen Vertrages jedoch bejahten, diese Möglichkeit nur unter Rückgriff auf die Fiskustheorie erklären. Er meint daher, daß die vor allem durch Otto Mayer aufgegebene Fiskustheorie auch von diesem in Wahrheit unter anderer Terminologie fortgeführt werde. Gurlit [Verwaltungsvertrag, S. 73.] schreibt gar, „vertragliche Koordination“ sei „nach Mayers Auffassung dem vom Staat abgetrennten [!] Fiskus möglich“. Das ist so zumindest mißverständlich, da Otto Mayer die Fiskustheorie eindeutig verwirft [vgl. 2. Kapitel, B. I.]. 28 Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 142; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 121; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 119.
B. Staats- und Methodenbegriff als einander bedingende Begriffe
111
Im Hinblick darauf, unter welchen Voraussetzungen das Zivilrecht auf den Staat zur Anwendung gelangt, schreibt daher Otto Mayer: „Es handelt sich stets nur um [eine] mehr oder weniger gelungene Ausdrucksweise.“29 Paul Laband hingegen sucht den Staat und dessen Rechtsverhältnisse anhand von Begriffen zu erfassen, die sich aus allein logischen Elementen komponieren. Den Zweck, dem der Staat zu dienen bestimmt ist, zieht er darum bei der Bildung des rechtswissenschaftlichen Begriffes vom Staat nicht mit ein. Aus einer dem Staate zufallenden Aufgabe herzuleiten, daß dieser stets einseitig handeln kann und soll, liegt ihm infolgedessen fern. Das erklärt, weshalb es für ihn keinen Grund gibt, warum sich der Staat nicht jederzeit einer auf die Gleichberechtigung der Rechtssubjekte zugeschnittenen Rechtsordnung soll unterwerfen können, er vielmehr der Ansicht ist, der Staat solle von seiner Herrschaft nur nach Bedarf Gebrauch machen.30 Die unterschiedlichen Standpunkte, die Otto Mayer und Paul Laband zu der Frage einnehmen, inwieweit der Staat Verträge auf dem Gebiet des öffentlichen wie privaten Rechts zu schließen vermag, resultieren daher aus Differenzen beim Verständnis vom Staat. Diese Differenzen wiederum sind das Ergebnis einer verschieden gearteten Methodenvorstellung. Da Otto Mayer seinen Begriff von Methode im Recht wohl auch mit dem Ziel entwickelt und umsetzt, den von ihm bereits zu Studienzeiten31 entwikkelten, Ehrfurcht erheischenden Begriff vom Staate auch im Rechte Geltung zu verschaffen, ist bei Otto Mayer der eine Begriff nicht nur Voraussetzung des anderen, die Begriffe bedingen sich vielmehr gegenseitig.
29 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 118 Fn. 3; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 115 Fn. 3. 30 Rez. Mayer, AöR 2 (1887), S. 149 (159): „Wenn man behauptet, der Staat könne desshalb mit Privaten keine Verträge schliessen, weil er ihnen nicht gleich stehe, sondern über sie herrsche, so ist dieser Grund nicht stichhaltig. Gerade im Gegentheil! Weil der Staat Herrscher ist, kann er sich nach eigenem Belieben a l l e r Rechtsformen bedienen, die ihm nützlich scheinen, und wenn er sich auf das Niveau des Privatrechts stellt und mit dem Einzelnen nach den Regeln desselben – wenngleich eines für gewisse Verwaltungszwecke modifizirten – Rechtsverhältnisse begründet, so ist dies eben eine Bethätigung seiner Freiheit, seiner ,hoheitlichen Macht‘, diejenige Rechtsform zu wählen, die ihm beliebt.“ Hervorhebung im Original. 31 Vgl. Selbstdarstellung (1924), S. 3.
112
5. Kapitel: Das Verhältnis des Staats- zum Methodenverständnis
C. Ergebnis Zu der Vorstellung, daß das öffentliche Recht eine gegenüber dem Zivilrecht eigene „Rechtsart“ ist, gelangt Otto Mayer vor allem durch seine Vorstellung von der Natur des Staates. Diese korreliert mit Otto Mayers Begriff von Methode im Recht.32
32 Bullinger [Öffentliches Recht und Privatrecht, S. 54 ff., bes. S. 59 f., 61 ff.; vgl. auch: dens., in: FS Rittner, S. 69 (71 ff., bes. 76).] sieht den Grund dafür, daß im 19. Jahrhundert die Unterscheidung von öffentlichem Recht und Privatrecht zu einem inneren Gegensatz gesteigert wurde, sowohl in einer „Vorstellung vom Staat als einem wesensmäßigen aliud gegenüber anderen menschlichen Verbindungen“, als auch in einer „Neigung zu begrifflicher Systemklarkeit“. Ähnlich äußert sich auch Stolleis [Geschichte II, S. 52; sowie in: Hofmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht, S. 41 (55 ff., bes. 57).]. De Wall [Privatrechtliche Vorschriften, S. 9 f.], Ehlers [Privatrechtsform, S. 34.] und Schröder [in: FS Gernhuber, S. 961 (967 ff.).] erwähnen demgegenüber als Ursache für die strikte Trennung von öffentlichem und privatem Recht seit Beginn des 19. Jahrhunderts nur den sich herausbildenden Antagonismus von Staat und Gesellschaft.
6. Kapitel
Die Bedeutung der Vertragsdogmatik Otto Mayers für die Gegenwart Ungeachtet der Tatsache, daß noch vor Ende des zwanzigsten Jahrhunderts zahlreiche Fragen einer Dogmatik des Rechtes vom Verwaltungsvertrag1 beantwortet waren, fehlte gleichwohl eine Idee, welche die gefundenen Antworten zu einem rechtsdogmatischen System vereinte.2 Einen Vorschlag, welchen Inhalt eine solche Systemidee haben könnte, hat die Wissenschaft erstmals jüngst unterbreitet. Diesem Vorschlag zufolge ist die Grundidee des Verwaltungsvertrages die rationale staatliche Entscheidung, die durch Konsens mit dem Vertragspartner Rechtsetzung im Einzelfall bewirkt.3 Hergeleitet wird diese Idee aus der Überlegung, daß aller staatlichen Aufgabenerledigung unter den Bedingungen des Rechtsstaates der Gedanke einer durch rechtliche Determination erzeugten Rationalität zugrunde liege, Geltungsgrund des Verwaltungsvertrages die staatliche Aufgabenerledigung sei und damit auch der Verwaltungsvertrag auf dem aller staatlichen Aufgabenerledigung zugrundeliegende Gedanken basiere.4 Daß Geltungsgrund des Verwaltungsvertrages einzig die staatliche Aufgabenerledigung sei, wird gefolgert aus der Annahme, daß Otto Mayer mit seinem Verdikt über den öffentlich-rechtlichen Vertrag auch heute noch „irgendwie“ Recht habe: Wie ein zwischen Privaten geschlossener Vertrag könne der Verwaltungsvertrag zwar nicht gedacht werden, als ein eigenständiges Institut zur Erledigung der dem Staate durch die Verfassung zugewiesenen Aufgaben sei er jedoch unverzichtbar.5 Inwieweit die soeben geschilderte Idee ihrer Funktion als Bezugspunkt eines Systems des Verwaltungsvertragsrechts dienlich ist, wird sich erst erweisen, wenn das System vollständig errichtet ist.6 Da die Errichtung dieses 1 Dem Begriff des Verwaltungsvertrages sollen hier alle Verträge unterfallen, die ein Verwaltungsträger mit einem anderen Verwaltungsträger oder einem Privaten schließt. Zur Terminologie vgl. Spannowsky, Verträge und Absprachen, S. 47 f.; Schlette, Vertragspartner, S. 18 ff. 2 Krebs, in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen, S. 41 (42 f). 3 Krebs, in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen, S. 41 (54). 4 Krebs, in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen, S. 41 (54). 5 Krebs, in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen, S. 41 (47 ff.). 6 Krebs, in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen, S. 41 (54).
114
6. Kapitel: Die Bedeutung der Vertragsdogmatik Otto Mayers
Systems nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist, sei im folgenden lediglich nach einer Antwort auf die Frage gesucht, ob der Ausgangspunkt, aus dem heraus die Idee entwickelt wurde, zutrifft, ob also Otto Mayer tatsächlich auch heute noch „irgendwie“ Recht hat7 oder ob nicht die Vertragsdogmatik Otto Mayers durch die „moderne Verwaltungsrechtswissenschaft [. . .] widerlegt“8 ist.
A. Einwände gegen den Vertragsbegriff Otto Mayers Da Otto Mayer einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen Staat und Bürger für undenkbar erachtet, weil ihm die Begriffe „Vertrag“ und „öffentlich-rechtlich“ im Verhältnis zwischen Staat und Bürger als unvereinbar scheinen, führt die moderne Verwaltungsrechtswissenschaft Einwände zunächst gegen Otto Mayers Begriff vom Vertrag. So wird die Behauptung aufgestellt, der von Otto Mayer gegen den öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen Staat und Bürger vorgetragene Einwand, es fehle an der erforderlichen Gleichheit der Vertragspartner, sei widerlegt mit dem Hinweis darauf, daß es allein auf die Gleichwertigkeit der Willenserklärungen ankomme und an ihr nicht zu zweifeln sei, weil „der Kontrakt definitionsgemäß das durch Willensübereinstimmung begründete Rechtsverhältnis“ sei und „diese Umschreibung“ es nicht zulasse, „einer der beiden Willenserklärungen einen höheren Wert beizumessen als der anderen“.9 Otto Mayer äußert jedoch an keiner Stelle seiner Werke die Auffassung, die Vertragspartner müßten sich auch außerhalb des Vertragsschlusses als Gleichberechtigte gegenüberstehen.10 Zudem ist es für den Abschluß eines Vertrages zunächst nicht entscheidend, ob zwei oder mehr Personen inhaltlich gleiches zu bewirken trachten, als vielmehr, ob sie Rechtsfolgen beiderseits herbeiführen wollen.11 Denn Abreden, die ausschließlich auf einem außerrechtlichen Geltungsgrund wie Freundschaft, Kollegialität oder Nachbarschaft beruhen, sind nach allgemeiner Auffassung keine Schuldverhältnisse im Rechtssinn,12 obgleich auch hier die Parteien inhaltlich gleiche Vorstellungen he7
So Krebs, in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen, S. 41 (44, 47). So das BVerwG [BVerwGE 23, S. 213 (215 f.).]. Vgl. aber auch: Schimpf, Vertrag, S. 17. 9 So die Begründung von Imboden [Vertrag, S. 42.], der sich Schimpf [Vertrag, S. 17.], Stern [AöR 84 (1959), S. 273 (277).], Kawalla [Verwaltungsvertrag, S. 2.] und Rüfner [Verwaltung, S. 316 f.] anschließen. 10 Das nehmen irrigerweise all die in Fn. 9 Genannten, aber auch Schlette [Vertragspartner, S. 36, 38, 39 mit Fn. 166.] an. 11 BGHZ 21, S. 102 (106 f.); BGH, NJW 21 (1968), S. 1874 (1874); BGH, NJW 24 (1971), S. 1404 (1405); Laranz/Wolf, Allg. Teil des Bürgerlichen Rechts8, § 22 Rn. 36; Palandt-Heinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch62, Einf. v. § 145 Rn. 2, Einl. v. § 241 Rn. 5. 8
B. Einwände gegen Otto Mayers Definition des öffentlichen Rechts
115
gen. Vor Augen zu halten gilt es sich zudem, daß nach Auffassung Otto Mayers die Einwilligung des Bürgers keine Voraussetzung dafür ist, daß die Verwaltung einseitig Recht setzen kann, sondern dafür, daß sie einseitig Recht setzen darf. Die Erklärung des Bürgers ist keine einen Rechtserfolg zu einem Teil tragende Willens-, sondern bloße Unterwerfungserklärung. Deutlich hervor geht dies aus den folgenden Worten Otto Mayers: „Der Vertrag aber bedeutet, daß der Rechtserfolg des Vorgangs getragen wird durch gleichwertig zusammenwirkende Willenserklärungen beider Teile. Ihm entspricht auf öffentlichrechtlichem Gebiet der Verwaltungsakt auf Unterwerfung: der Ausspruch der Behörde über den Untertan ist für sich allein das Wirkende; die Zustimmung des Betroffenen ist nur eine Voraussetzung dafür, daß dieser Ausspruch rechtmäßig und zuständigerweise ergehe; sie ist notwendig, um diese Belastung der Freiheit des Einzelnen gegenüber den verfassungsmäßigen Vorbehalten des Gesetzes zu decken: sie vertritt die gesetzliche Ermächtigung, weiter nichts.“13
B. Einwände gegen Otto Mayers Definition des öffentlichen Rechts Einwände führt die moderne Verwaltungsrechtswissenschaft überdies gegen Otto Mayers Definition des öffentliche Rechts als einer Ordnung der Verhältnisse, in denen die öffentliche Gewalt als solche, mithin einseitig hoheitlich, handelt.14 So wird die Auffassung vertreten, daß die Definition Otto Mayers aufgrund eines Wandels der Staatsbegriffe nicht mehr zeitgemäß sei. Der „Obrigkeitsstaat“ sei dem „kooperativen Staat“ gewichen, so daß Befehl und Zwang nicht mehr die alleinigen Handlungsformen des Staates seien.15 12 Palandt-Heinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch62, Einf. v. § 145 Rn. 2, Einl. v. § 241 Rn. 5. 13 Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 148 f. Nahezu ebenso: Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 262. Vgl. auch: Staatsrecht (1909), S. 40: „[. . .] denn der Vertrag setzt die rechtliche Gleichheit der Vertragsschließenden voraus, deren übereinstimmender Wille gemeinsam den Rechtserfolg zu tragen hat.“ 14 So schon Laband [vgl. 5. Kapitel, B.] und Apelt [Vertrag (1920), S. 54 ff., 126 ff.]. 15 So oder ähnlich: Pakeerut, Vertrag, S. 34 f., 126; Konrad, Vertrag, S. 7; Salzwedel, Vertrag, S. 12; BVerwGE 23, S. 213 (216); Stern, VerwArch 49 (1958), S. 106 (155 f., 157); Schmidt-De Caluwe, Verwaltungsakt, S. 138 ff.; Bauer, Die Verwaltung 25 (1992), S. 301 (304 f.); Höfling/Krings, JuS 40 (2000), S. 625 (625); Schmitz, NVwZ 19 (2000), S. 1238 (1240). Ebenso zumindest im Ansatz: Schlette, Vertragspartner, S. 40. Vgl. dazu auch: Bullinger, Vertrag, S. 32, 243 f., 246 f.; Burmeister, VVDStRL 52 (1993), S. 190 (222 ff.). Kritisch dazu überdies: Schmidt-Salzer, VerwArch 62 (1971), S. 135 (144 f.).
116
6. Kapitel: Die Bedeutung der Vertragsdogmatik Otto Mayers
Ein aus dem Recht abgeleiteter Grund,16 warum der Staat nicht mehr nur einseitig hoheitlich handeln solle, obwohl er dies könne, wird indes nicht genannt. Schon deshalb wird Otto Mayer von den Vertretern dieser Auffassung nicht „widerlegt“. Hinzu kommt, daß die Staatsvorstellung Otto Mayers durch den Begriff „Obrigkeitsstaat“ nicht zu kennzeichnen ist.17 Schlicht falsch ist die Kennzeichnung, sofern sie bedeuten soll, daß Otto Mayer den Vorstellungen des Polizeistaates verhaftet geblieben sei. Denn diese hat Otto Mayer stets bekämpft.18 Aber selbst dann, wenn der Begriff „Obrigkeitsstaat“ nicht ein Verhaftetsein in den Vorstellungen des absolutistischen Polizeistaates beschreiben soll, sondern ein Rechts- und Machtverhältnis, in dem der Bürger der Staatsgewalt a priori als „Untertan“ unterworfen ist, und in dem der Staat der der Gesellschaft aus eigener Machtvollkommenheit gegenübertretende Souverän ist,19 überzeugt es nicht, der Staatsvorstellung Otto Mayers den Begriff „Obrigkeitsstaat“ beizulegen, erst recht nicht, um hierdurch zugleich zum Ausdruck zu bringen, Otto Mayer habe eine strikt etatistische Sichtweise besessen.20 Denn es trifft nicht zu, daß die Staatsidee Otto Mayers der Konstruktion eines verbindlichen Rechts der Verwaltung entgegensteht, Otto Mayer dies erkennt, und gleichwohl an seiner Staatsidee festhält.21 Richtig ist zwar, daß Otto Mayer einerseits meint, das Recht setzte als die Ordnung von Machtverhältnissen rechtsfähige Personen voraus,22 und andererseits der Auffassung ist, der „Staat“ sei keine [juristische] Person,23 sondern ein tatsächlicher Zustand.24 Jedoch ist für Otto Mayer die juristische Persönlichkeit und damit die Rechtssubjektqualität „des“ Staates keine „rechtslogische Voraussetzung eines Verwaltungsrechts überhaupt“.25 Das 16 Nach Stern [VerwArch 49 (1958), S. 106 (156).] beruht der Wandel der Staatsbegriffe auf einem Wandel der soziologischen Verhältnisse. 17 Ebenso etwa: Kempen, Formenwahlfreiheit, S. 21. 18 So mit Recht: Bachof, VVDStRL 30 (1972), S. 193 (213 f.). Siehe zudem 4. Kapitel, B. II. 19 So Schmidt-De Caluwe, Verwaltungsakt, S. 22 f. 20 So aber: Schmidt-De Caluwe, Verwaltungsakt, S. 53, 58, 141, 216, 240, 249, 307 f. 21 So aber: Schmidt-De Caluwe, Verwaltungsakt, S. 47 f., 75 f. i.V. m. S. 249 ff. 22 Vgl. Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 13, mit Deutsches Verwaltungsrecht II1 (1895), S. 366; Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 13, mit Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 572; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 13, mit Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 322. 23 Vgl. 3. Kapitel, C. I. 24 Vgl. 3. Kapitel, A. 25 So aber: Schmidt-De Caluwe, Verwaltungsakt, S. 250 f. Ob diese These Schmidt-De Caluwes zutrifft, erscheint fragwürdig. Uhlenbrock [Der Staat als juristische Person, S. 169 f.] vertritt überzeugend anderes. Nachweise vermag SchmidtDe Caluwe für seine These zudem keine zu benennen. Auf Rupp [Grundfragen,
B. Einwände gegen Otto Mayers Definition des öffentlichen Rechts
117
wird bereits daran deutlich, daß Otto Mayer der Aussage, daß „von den Rechtssubjekten, zwischen welchen das Verwaltungsrecht gelten soll, das eine gleichmäßig bestimmt [ist] als der S t a a t “,26 in einer Fußnote die Sätze anschließt: „Die gewöhnliche Redeweise behandelt den Staat hier ohne weiteres als das in erster Linie beteiligte Rechtssubjekt. Der Jurist muß sich das genauer zurechtlegen, und zwar geschieht das in Deutschland vorwiegend in der Weise, daß man ihm die Eigenschaft einer j u r i s t i s c h e n P e r s o n zuerkennt. Man kann auch andere Wege gehen.“27 An welche Wege Otto Mayer denkt, sagt er leider nicht. Möglicherweise ähnelt sein Standpunkt dem von Hans Heinrich Rupp, der der Meinung ist, der Begriff der „Rechtssubjektivität“ sei ein Relationsbegriff und „die Rechtssubjektivität dessen, was man ,Staat‘ nennt“, sei „keine einheitliche“, sondern umfasse „eine ganze Spanne inhaltlich nicht identischer Beziehungsobjekte“.28 Denn auch Otto Mayer spricht davon, daß ein Rechtssubjekt seiner „inneren Natur“ nach nicht notwendig einheitlich sein müsse.29 Die Einheitlichkeit der Rechtssubjekte sei lediglich um der Verständlichkeit des Rechts Willen erforderlich.30 So formuliert Otto Mayer: „Die einheitliche Persönlichkeit des Staates kommt erst in Frage, wenn nun aus dieser [scil.: durch die Verfassung hergestellten] Ordnung heraus Tätigkeit entwickelt wird, um ihre Zwecke zu verfolgen. Von den verschiedensten Stellen aus wird hier S. 81 ff.] beruft sich Schmidt-De Caluwe [Verwaltungsakt, S. 251 Fn. 219.] zu Unrecht, da jener sich am angegebenen Ort nicht mit der Rechtssubjektivität „des“ Staates, sondern der seiner Organe im „Innenbereich“ auseinandersetzt. 26 Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 13; Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 13. Hervorhebung im Original. 27 Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 13 Fn. 1. Allein die Hervorhebung durch Kursivschrift findet sich nicht im Original. 28 Rupp, Grundfragen, S. 22 f. 29 Vgl. Deutsches Verwaltungsrecht I2 (1914), S. 13 Fn. 1: „Es kann bezweifelt werden, ob der Staat eine juristische Person im richtigen Sinne dieses Begriffes ist. [. . .] Wir haben es aber hier nur mit den Verhältnissen des in der Verfassung fertig gewordenen Staates nach außen zu tun, und in dieser Hinsicht ist die ganze Rechtsordnung darauf zugeschnitten, ihn als ein einheitliches Rechtssubjekt erscheinen zu lassen und zu behandeln. Ob auch seine innere Natur dem entspricht oder wir nur eine Scheinperson vor uns haben, kommt dafür nicht weiter in Betracht.“ Hervorhebung nicht im Original. 30 Vgl. Staatsrecht (1909), S. 17: „Der soeben angedeutete Vergleich mag nützlich sein, um die hier zugrunde liegende Rechtsvorstellung zu erleichtern, wonach eine solche wechselnde Menge im Sinne der Verfassung [scil.: das Volk] als Trägerin von Rechten anzusehen ist. Eine juristische Person liegt ja nicht vor. Für die privatrechtliche Anschauung enthält das große Schwierigkeiten. Aber auch der populus romanus hatte Rechte, ohne juristische Person zu sein, und in der heutigen Republik ist eben diese Volksmasse der Souverän und selbstberechtigter Träger der ganzen Staatsgewalt. [. . .] Um unser Verfassungsrecht zu verstehen, müssen wir mit dem Volke als mit einem Rechtssubjekte rechnen, ob das zu den gewohnten zivilrechtlichen Formeln paßt oder nicht.“ Hervorhebung nicht im Original.
118
6. Kapitel: Die Bedeutung der Vertragsdogmatik Otto Mayers
gehandelt, ursprünglichen und abgeleiteten Rechts, allein und zusammenwirkend, mannigfach bedingt und verumstandet. Alles beansprucht aber zusammengehörig zu sein und auf einheitliche Ziele gerichtet, wie das der einheitlichen Ordnung entspricht. Und das kommt zum Ausdruck dadurch, daß es bezeichnet wird als das Handeln n a m e n s e i n e s e i n z i g e n großen Subjekts, das dahinter steht, des persönlich g e d a c h t e n S t a a t e s , oder noch kräftiger dadurch, daß man solches Handeln geradezu bezeichnet als ein Ä u ß e r n d e s S t a a t s w i l l e n s . Das ist zunächst nichts anderes als ein Bild und Gleichnis. Je reicher und mannigfaltiger die Lebenstätigkeit des neuzeitlichen Rechts- und Verfassungsstaates sich entfaltet, desto weniger wird man ohne solche zusammenfassende und anschaulich machende Ausdrucksweisen durchkommen können. Auch die Rechtsordnung muß sich ihrer bedienen, will sie nicht vor lauter Korrektheit zuletzt unverständlich werden.“31 Daß Otto Mayer den „Staat“ nicht als juristische, sondern nur als eine „Scheinperson“32 begreift,33 hat mithin nicht zur Folge, daß es Otto Mayer nur unter Inkaufnahme eines sich in den Details fortsetzenden „Grundwiderspruches“ gelingt, ein „Recht“ der Verwaltung zu entwerfen.34 Zutreffend weist Rupp darauf hin, daß vielmehr die Lehre Georg Jellineks mit einem – auch von Otto Mayer erkannten35 – Widerspruch behaftet war, weil sie den Staat einerseits als omnipotent, andererseits als juristische Person und damit einheitlich begriff. In dieser Lehre nämlich erschöpfte sich „die Rechtsstaatsidee darin, dem Staat durch angebliche Selbstbindung ,objektive‘ Schranken zu inkorporieren“.36 Und „die Errichtung dieser ,objektiven‘ Schranken war eigentlich ein Widerspruch in sich selbst, wenn man die Gesamtheit aller Staatsgewalt als staatsidentische personale Einheit auffaßte und zugleich – wie Georg Jellinek – behauptete, alles Recht setzte 31
Staatsrecht (1909), S. 14. Hervorhebung im Original. Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 329. 33 Da in den konstitutionellen Monarchien der deutschen Länder des 19. Jahrhunderts zumeist zwar der König der alleinige Inhaber der Staatsgewalt war und der „Staat den allgemeinen Geschäftsnamen“ gab „für den König“ [vgl. O. Mayer, Staatsrecht (1909), S. 13, 16 Fn. 6.], an der Ausübung der Staatsgewalt jedoch durch die Verfassung dem Volk ein Anteil gegeben war [vgl. O. Mayer, Staatsrecht (1909), S. 17.], mußte es nach Ansicht Otto Mayers nicht allein in der Republik, wo „die wechselnde Menge“ Volk Träger der Staatsgewalt ist [O. Mayer, Staatsrecht (1909), S. 17.], an einem seiner inneren Natur nach einheitlichen Rechtssubjekt fehlen. 34 So aber: Schmidt-De Caluwe, Verwaltungsakt, S. 250 f. i.V. m. S. 60, sowie S. 149, 175 f., 177 ff., 231, 237, 251, 264. A. A.: Kempen, Formenwahlfreiheit, S. 22 f. 35 Deutsches Verwaltungsrecht I3 (1924), S. 78 mit Fn. 6. 36 Rupp, Grundfragen, S. 8. Vgl. auch dens., a. a. O., S. 110. Die Nachweise zu Georg Jellinek und Otto Mayer finden sich auf S. 150 Fn. 134. 32
B. Einwände gegen Otto Mayers Definition des öffentlichen Rechts
119
mindestens zwei Personen voraus und erschöpfe sich in der ,Abgrenzung der Willensphären‘ dieser Personen. Das hätte dazu führen müssen, daß das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, weil offenbar ein personeninternes Prinzip der Staatsperson – Beschränkung einer Staatsfunktion durch eine andere –, nicht einmal ein objektives Rechtsprinzip hätte sein können. So enthält denn auch die Selbstverpflichtungslehre Jellineks [. . .] alles andere als eine stichhaltige Begründung für den Rechtscharakter des objektiven Gesetzmäßigkeitsprinzips oder gar der subjektiven öffentlichen Rechte.“37 Der Annahme, Otto Mayer verfolge einen „obrigkeitsstaatlichen“ Ansatz,38 widerstreitet zudem, daß Otto Mayer ein System des Verwaltungsrechts, das nicht auf das Zivilrecht rekurriert und damit „eigentümlich“ und in sich geschlossen ist, ohne die Annahme eines Staatswillens, der ein Rechtsverhältnis aus sich selbst heraus einseitig bindend zu erzeugen vermag, nicht hätte konstruieren können. Denn Otto Mayer geht davon aus, daß eine durch gleichwertige Willenserklärungen herbeigeführte Einigung ein bindendes Rechtsverhältnis erst dann erzeuge, wenn „auch die Anerkennung der Rechtsordnung hinzukommt, welche durch einen Rechtssatz diesen Ausspruch für gültig erklärt“.39 Indes gestatteten nur wenige Gesetze der Verwaltung ein Handeln in Form des Vertrages. Zudem war oftmals streitig, ob dieser Vertrag sodann zivil- oder öffentlich-rechtlich aufzufassen sei.40 Aus einem Gesetz für das Verwaltungsrecht insgesamt die Möglichkeit einer sowohl den Bürger, als auch die Verwaltung bindenden Einzelfallregelung herzuleiten, war aber auch deshalb nicht möglich, weil nur vereinzelt Vorschriften existierten,41 welche besagten, unter welchen Voraussetzungen die Verwaltung das von ihr in einem Verwaltungsakt Ausgesprochene zurücknehmen oder widerrufen konnte.42 Daß Otto Mayer das Verwaltungsrecht einheitlich auf der aus sich selbst heraus einseitig bindenden, also ein Rechtsverhältnis erzeugenden Kraft des 37
Rupp, Grundfragen, S. 8 Fn. 24. So Schmidt-De Caluwe, Verwaltungsakt, S. 22 ff., 47 f., 53, 58, 216, 240, 249, 307 f. 39 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (49). 40 Vgl. Fleiner, Institutionen8 (1928), S. 211, 212 f. mit Fn. 93 ff. 41 Etwa die §§ 40, 53 der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich vom 26. Juli 1900, RGBl. 1900, S. 871 (886, 892). 42 Namentlich Schmidt-De Caluwe [Verwaltungsakt, S. 254.] vertritt die Ansicht, daß die Rechtsqualität des Verwaltungsaktes schon damals nur aus einem Gesetz habe folgen können, das die Bedingungen, unter denen ein einmal erlassener Verwaltungsakt aufgehoben werden dürfe, festlege. Da Otto Mayer diese Ableitung nicht verfolge, dem Verwaltungsakt infolgedessen die Rechtsqualität fehle, so sei er in der Lehre Otto Mayers kein rechtsstaatliches, sondern ein obrigkeitsstaatliches Institut [a. a. O., S. 246.]. 38
120
6. Kapitel: Die Bedeutung der Vertragsdogmatik Otto Mayers
Staatswillens aufbaut, ist demnach gleichermaßen motiviert durch seine Begriffe vom Rechtsstaat und von Methode im Recht. Nicht von Ungefähr äußert Otto Mayer schließlich: „Das Verwaltungsrecht hat zum Zweck die Sicherung der Freiheit der Staatsuntertanen und die Verwaltungsrechtswissenschaft erfüllt ihre Aufgabe, wenn sie diesen Zweck immer im Auge behält und dazu beitragen will, daß er möglichst vollkommen erreicht werde. Das ist wenigstens meine Auffassung von der Sache.“43 Die von Otto Mayer wider die begriffliche Möglichkeit öffentlich-rechtlicher Verträge gerichtete Lehre ist somit kein Resultat „obrigkeitsstaatlichen“ Denkens.44
C. Die Anerkennung des öffentlich-rechtlichen Vertrages durch den Gesetzgeber Nicht selten sucht die Verwaltungsrechtswissenschaft Otto Mayer auch durch einen Verweis auf die Anerkennung des öffentlich-rechtlichen Vertrages durch das Gesetz zu widerlegen.45 Otto Mayer indes ist der Auffassung, daß auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts die einseitig bindende Kraft des staatlichen Willens das Rechtsverhältnis begründet. Ein „einfaches“ Gesetz kann der Verwaltung zwar Bindungen auferlegen, indes keineswegs dem Willen „des“ Staates einen anderen Charakter verleihen. Ein Gesetz könnte somit die Einwilligung des einzelnen allenfalls „zu einer förmlichen Mitwirkung an der Erzeugung des Rechtsverhältnisses im Sinne des Vertrages“ steigern, wäre damit indes eine „leere juristische Liebhaberei“.46
D. Einwände gegen die von Otto Mayer postulierte Omnipotenz des Staates Von der Verwaltungsrechtswissenschaft wird gegen die Vertragsdogmatik Otto Mayers darüber hinaus eingewandt, daß der Staat rechtlich nicht alles aus sich heraus könne, da er verfassungsrechtlich konstituiert und damit auch in seinen Befugnissen von vornherein limitiert sei. Deshalb gebe es 43
Rez. Laun, AöR 25 (1909), S. 485 (485). Ebenso: Kempen, Formenwahlfreiheit, S. 21. Ähnlich: Bullinger, Vertrag, S. 244. 45 Z. B.: Apelt, Vertrag (1920), S. 135 ff.; Butterwegge, Verwaltungsvertrag, S. 56; Schimpf, Vertrag, S. 17; Kawalla, Verwaltungsvertrag, S. 2; Bonk, in: Stelkens/ Bonk/Sachs (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz6, § 54 Rn. 3; Spannowsky, Verträge und Absprachen, S. 21, 26 f.; Schlette, Vertragspartner, S. 34; Brohm, JZ 55 (2000), S. 321 (321). Dagegen: Henke, JZ 39 (1984), S. 441 (442); Bullinger, Vertrag, S. 243 f. 46 Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (41 f.). Hervorhebung nicht im Original. Vgl. auch 1. Kapitel, A. I. 44
D. Einwände gegen die von Mayer postulierte Omnipotenz des Staates
121
auch kein allgemeines Gewaltverhältnis zwischen Staat und Bürger mehr. Die Frage der Inanspruchnahme der Bürger sei infolgedessen auch nicht nur eine solche der Zuständigkeitsverteilung zwischen Gesetzgeber und Verwaltung, sondern auch eine solche des prinzipiellen Dürfens. Daher müsse sich die Einwilligung des Bürgers in seine Inanspruchnahme nicht denknotwendig in der Zustimmung zu einseitigem Bewirken der Verwaltung erschöpfen, sondern könne rechtlich gleichwertige Teilhabe am gemeinsam erzeugten Rechtserfolg sein.47 Dieser Einwand ist stichhaltig. Denn wenngleich bislang keine Einigkeit darüber herrscht, inwieweit der „Staat“ in seiner Gesamtheit durch die Verfassung konstituiert wird,48 besteht doch Übereinstimmung darin, daß die Verfassung aus heutiger Sicht eine „verbindliche, nicht nur ausschnittweise, sondern umfassende und daher abschließende Regelung der Handlungsbefugnisse staatlicher Organe“ darstellt.49 Jedenfalls aber legen Art. 1 Abs. 3 und Art. 20 Abs. 3 GG fest, daß der Gesetzgeber an die Grundrechte/die verfassungsmäßige Ordnung gebunden ist. Es läßt sich daher für die Gegenwart nicht mehr vertreten, daß „der Staatswille [. . .], der in Form des Gesetzes“ erscheine, „gegenüber seinen Untertanen keine rechtlichen Schranken“ habe, sondern „schlechthin bestimmen“ könne, „was er“ wolle,50 und die Funktion der Grundrechte „lediglich in der verhältnismäßigen Erschwerung des staatlichen Eingriffs“ liege,51 in der „Unterstellung bestimmter Seiten der Freiheit des Einzelnen unter die Herrschaft des Gesetzes“.52 Infolgedessen kann auch nicht mehr davon ausgegangen werden, daß jede von der Verwaltung im Einverständnis mit dem Bürger getroffene Rechtsfolge ein47 Krebs, in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen, S. 41 (46 f.); ders., in: SchmidtAßmann/Krebs, Verträge, S. 123 f. Ähnlich etwa: Henke, JZ 39 (1984), S. 441 (442); Schmidt-Salzer, VerwArch 62 (1971), S. 135 (144 f.); Stern, VerwArch 49 (1958), S. 106 (157); ders., AöR 84 (1959), S. 273 (278). 48 Während ein Teil der Lehre meint, die staatliche Macht werde durch die Verfassung in jeder Hinsicht errichtet [Erichsen, Staaatsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit3, S. 114 i.V.m. S. 99; Stern, StR I2, S. 95; BVerfGE 42, S. 312 (331 f.).], ist ein anderer Teil der Lehre der Auffassung, durch die Verfassung werde die staatliche Macht lediglich begrenzt, weil ein Recht ohne staatliche Macht gar nicht denkbar sei [Böckenförde, NJW 31 (1978), S. 1881 (1883); Isensee, in: HbStR I, § 13 Rn. 137 i.V.m. Rn. 5 f., 8 f., 13, 72 f.]. 49 Böckenförde, NJW 31 (1978), S. 1881 (1883), m. w. N. 50 O. Mayer, Schiffahrtsabgaben II (1910), S. 53. Vgl. auch: ders., Vertrag, AöR 3 (1888), S. 3 (30); ders., Staatsrecht (1909), S. 40, 170 Fn. 14; ders., Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 79, 87; ders., Deutsches Verwaltungsrecht II2 (1917), S. 5; ders., Deutsches Verwaltungsrecht II3 (1924), S. 3; ders., Rez. Arndt, AöR 18 (1903), S. 96 (97). 51 O. Mayer, Staatsrecht (1909), S. 163 Fn. 18. 52 O. Mayer, Staatsrecht (1909), S. 31. Vgl. auch: ders., Deutsches Verwaltungsrecht I1 (1895), S. 75 Fn. 11; ders., Rez. Brie, AöR 5 (1890), S. 418 (419 f.).
122
6. Kapitel: Die Bedeutung der Vertragsdogmatik Otto Mayers
zig in der Form des Erlasses eines Verwaltungsaktes auf Unterwerfung möglich ist, weil in der Einwilligung des Bürgers allein der Verzicht auf den in den Freiheitsrechten normierten Gesetzesvorbehalt zu erblicken ist.53 Da sich die Funktion der Grundrechte nicht darin erschöpft, Beeinträchtigungen der Freiheit dem Gesetz vorzubehalten, liegt in der Übernahme von Pflichten gegenüber der Verwaltung weniger ein Grundrechtsverzicht,54 als vielmehr in der Regel ein Grundrechtsgebrauch.55 Von daher ist es nicht mehr undenkbar, daß die Einwilligung des Bürgers in seine Inanspruchnahme eine rechtlich gleichwertige Teilhabe am erzeugten Rechtserfolg ist. Führt somit die Tatsache, daß der Staat unserer Zeit in seinen Befugnissen von vornherein limitiert ist, zu der Erkenntnis, daß die Vertragsdogmatik Otto Mayers nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, wirft sie – die soeben genannte Tatsache – andererseits die Frage auf, ob nicht auch heute noch der von Otto Mayer verfochtene Gedanke seine Berechtigung hat, nämlich der Gedanke, daß die Inanspruchnahme des Bürgers, die mit dessen Einvernehmen erfolgt, kein Vertrag sei, da es an einem Zusammenwirken zweier Willenserklärungen fehle. Denn wenngleich es mittlerweile außer Frage steht, daß die Einwilligung des Bürgers in seine Inanspruchnahme sich nicht mehr in der Zustimmung zu einseitigem Bewirken der Verwaltung erschöpft, sondern „echte“ Willenserklärung ist, erscheint es zweifelhaft, ob der Staat über die Möglichkeit verfügt, eine Willenserklärung abzugeben. Schließlich ist die Willenserklärung notwendiger Bestandteil und damit Mittel des Rechtsgeschäfts.56 Sowohl der privatrechtliche,57 als auch der öffentlich-rechtliche Vertrag58 werden den Rechtsgeschäften zugeordnet. Das Rechtsgeschäft wiederum wird als das Mittel der Privatautonomie gesehen, die das Prinzip der Selbstgestaltung der Rechtsverhältnisse durch den einzelnen nach seinem Willen bedeutet.59 Privatautonomie ist damit die 53
So aber O. Mayer, vgl. 1. Kapitel, A. I. So aber noch heute: Pietzcker, Der Staat 17 (1978), S. 527 (527 mit Fn. 3, 534 mit Fn. 33); Stern, StR III/2, S. 915; Pieroth/Schlink, Grundrechte18, Rn. 138. Vgl. auch: Maurer, Verwaltungsrecht14, § 14 Rn. 34. 55 So Göldner, JZ 31 (1976), S. 352 (355); Krebs, in: Schmidt-Aßmann/Krebs, Verträge, S. 186 f.; Kirchhof, Verwalten, S. 208; Rengeling, Kooperationsprinzip, S. 88; Rüfner, Verwaltung, S. 391 f.; Gurlit, Jura 23 (2001), S. 659 (659). 56 Larenz/Wolf, Allg. Teil des Bürgerlichen Rechts8, § 22 Rn. 5; Palandt-Heinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch62, Überbl. v. § 104 Rn. 2; Medicus, Allg. Teil des BGB8, Rn. 174 f. 57 Palandt-Heinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch62, Überbl. v. § 104 Rn. 12; Brox, Allg. Teil des BGB26, Rn. 96. 58 Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz6, § 54 Rn. 28; Weiß, Verwaltungsvertrag, S. 54. 59 Medicus, Allg. Teil des BGB8, Rn. 174 f.; Larenz/Wolf, Allg. Teil des Bürgerlichen Rechts8, § 22 Rn. 1; Palandt-Heinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch62, Überbl. v. § 104 Rn. 1 f. 54
D. Einwände gegen die von Mayer postulierte Omnipotenz des Staates
123
Freiheit, im Rahmen des zwingenden Rechts willkürlich, nach Belieben zu handeln.60 Der Staat indes kann nicht nach Belieben handeln. Denn wie soeben festgestellt, ist der Staat zumindest in seinen Handlungsbefugnissen in jeder Hinsicht durch das Recht determiniert. Der Staat verfügt damit nicht über Privatautonomie.61 Sieht man das Rechtsgeschäft gemeinhin als das Mittel der Privatautonomie an, kann der Staat demzufolge eine Willenserklärung nicht abgeben. Dies hätte zur Folge, daß der Staat nicht die Möglichkeit besäße, einen „wahren“ Vertrag zu schließen. §§ 54 ff. VwVfG62 schüfen damit ein Rechtsinstitut, das den Namen „Vertrag“ schwerlich verdiente. Angesichts der Tatsache jedoch, daß die Befugnis des Staates zum Abschluß eines privatrechtlichen Vertrages mit gutem Grund63 kaum jemals bestritten wurde,64 läßt sich zweifeln, ob die Privatautonomie als ein identitätsbildendes Merkmal aller Rechtsgeschäfte angesehen werden kann.65 Wer dies jedoch – etwa unter Hinweis darauf, daß die Privatautonomie keine unumgängliche Anwendungsvoraussetzung von Vorschriften wie §§ 433, 611 oder 631 BGB sei, so daß die Verwaltung durchaus in den Formen des Privatrechts handeln könnte66 – vertritt, muß anerkennen, daß Otto Mayer auch heute noch „irgendwie“ Recht hat, der Verwaltungsvertrag mithin in seinen Grundlagen nicht so konstruiert werden kann, wie der Vertrag unter Privaten, und dies bei der Errichtung eines Systems vom Verwaltungsvertrag in Rechnung zu stellen ist.67
60 Gramm, Privatisierung, S. 221; Emmerich, Wirtschaftsrecht, S. 129; Schachtschneider, Staatsunternehmen, S. 65. 61 Ehlers, Privatrechtsform, S. 86 f.; Pietzker, AöR 107 (1982), S. 61 (74); Mallmann, VVDStRL 19 (1961), S. 165 (196 ff.); Brohm, JZ 55 (2000), S. 321 (326); Zuleeg, VerwArch 73 (1982), S. 384 (396); Badura, Wirtschaftsverfassung, S. 135; Krebs, in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen, S. 41 (47); Schachtschneider, Staatsunternehmen, S. 10 ff., 263 f. Einer anderen Auffassung ist Röhl [VerwArch 86 (1995), S. 531 (537).], da er unter Privatautonomie die den Privatrechtssubjekten eingeräumte Befugnis zur Rechtsgestaltung versteht. 62 Und auch die entsprechenden Vorschriften in den Verwaltungsverfahrensgesetzen der Länder. 63 Vgl. Krebs, in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen, S. 41 (52 f.). 64 Soweit ersichtlich einzig von: Schachtschneider, Staatsunternehmen, S. 10 ff., 267 f. 65 Vgl. Krebs, in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen, S. 41 (48). 66 Vgl. Krebs, in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen, S. 41 (55). A. A.: Schachtschneider, Staatsunternehmen, S. 10 ff., 267 f. 67 Vgl. Krebs, in: Ehlers/Krebs (Hrsg.), Grundfragen, S. 41 (46 ff.).
Zusammenfassung Wahre Verträge des Staates mit dem einzelnen auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts erachtet Otto Mayer für „undenkbar“. Denn im Verhältnis des einzelnen zum Staat bedeutet für ihn der zusammengesetzte Begriff des „öffentlich-rechtlichen Vertrages“ einen Widerspruch in sich. Der Begriff des Vertrages setzt das gleichwertige Zusammenwirken zweier Willenserklärungen voraus. Auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts stehen sich jedoch Staat und Bürger nicht als gleichwertige Rechtssubjekte gegenüber, da der Staat hier stets „als solcher“, daß heißt durch die einseitig bindende Kraft seines Willens handelt. Die Mitwirkung des Bürgers ist eine bloße Einwilligung. Eine Willenserklärung, die an der Erzeugung eines Rechtserfolges mitwirkt, gibt der Bürger nicht ab. Auf die Frage, warum Otto Mayer den Begriffen „Vertrag“ und „öffentliches Recht“ Inhalte beilegt, derentwegen der zusammengesetzte Begriff des „öffentlich-rechtlichen Vertrages“ undenkbar ist, gibt Otto Mayer mit der Forderung, daß die Verwaltungsrechtswissenschaft ein System von eigentümlichen Rechtsinstituten der staatlichen Verwaltung sein müsse, selbst die Antwort. Öffentliches und privates Recht sind je eigene „Rechtsarten“, da sie von diametralen Prinzipien beherrscht werden. Gemeinsame Rechtsinstitute gibt es zwischen den beiden Rechtsgebieten infolgedessen nicht. Zu der Vorstellung, daß öffentliches und privates Recht Deduktionen aus entgegengesetzten Prinzipien sind, und das Verwaltungsrecht demzufolge ein System eigentümlicher Rechtsinstitute der staatlichen Verwaltung zu sein hat, führen Otto Mayer nicht die Ideen vom Verfassungs- und Rechtsstaat: Indem die Verfassungen eine Beteiligung des Volkes an der Gesetzgebung vorsehen, gewährleisten sie zwar, daß gesetzgebende und vollziehende Gewalt nicht nur auf einem Willen, nämlich dem des Monarchen beruhen. Sie begründen damit den Grundsatz der Gewaltenteilung, der die Möglichkeit gibt, die Verwaltung an das Gesetz zu binden. Die Idee des Rechtsstaates enthält sodann die Forderung, von dieser Möglichkeit weitreichend Gebrauch zu machen. Eine Aussage darüber, wie das Recht beschaffen sein muß, auf der Grundlage dessen die Verwaltung fortan verbindlich zu handeln hat, treffen die Ideen vom Verfassungs- und Rechtsstaat jedoch nicht. Lediglich die Notwendigkeit, an einer Lehre festzuhalten, die alle vermögensrechtlichen Angelegenheiten des Staates dem Fiskus als einer selbständig neben dem Staat existenten juristischen Person des Zivilrechts zuordnet, lassen sie entfallen.
Zusammenfassung
125
Das öffentliche und das private Recht als je eigene „Rechtsarten“ zu betrachten, resultiert aus den sich einander bedingenden Begriffen vom Staat und von Methode im Recht: Das Verwaltungsrecht ist die rechtliche Ordnung der Verhältnisse zwischen dem Staat und dem Bürger. Der Staat unterscheidet sich seiner Natur nach grundlegend vom gewöhnlichen Privatmann. Dieser Tatsache muß das Verwaltungsrecht Rechnung tragen. Seine Rechtsinstitute bauen demzufolge auf der Ungleichheit der Rechtssubjekte Staat und Bürger auf. Die Vorstellung von der Natur des Staates wird zum einen bestimmt durch die aus den Werken Georg Wilhelm Friedrich Hegels und Johann Gottlieb Fichtes entnommene Vorstellung, daß dem Staat in seiner sozialen Realität die Aufgabe zufällt, die auf seinem Gebiet lebenden Menschen zu einer Nation zu vereinen. Diese Aufgabe hat in den Augen Otto Mayers einen so großen Stellenwert, daß der Staat von seinen Bürgern mit Ehrfurcht zu betrachten ist. Deshalb kann und soll dem Willen des Staates eine einseitig bindende Kraft zukommen. Da Otto Mayer in Übereinstimmung mit der sogenannten „juristischen“ Methode davon ausgeht, daß die Jurisprudenz das Recht streng systematisch begreifen müsse, nämlich als eine Deduktion aus einigen wenigen, abstrakten Grundbegriffen, und da Otto Mayer die Idee der einseitig bindenden Kraft des Staatswillens zu jenen Grundbegriffen zählt, kann und soll der Staat nicht nur stets einseitig bindend handeln, er muß es sogar. Aus seinem Methodenverständnis leitet Otto Mayer zudem ab, daß das Zivilrecht einheitlich auf der Gleichheit der Rechtssubjekte aufbaut. Die Zivilrechtswissenschaft untersucht am Zivilrecht die Grenzen der rechtlichen Willensmacht der Einzelnen gegeneinander. Ihr Grundbegriff ist das subjektive Recht. Alle ihre Rechtsinstitute sind demnach Arten subjektiver Rechte und damit gebaut auf dem Boden der Gleichheit der Rechtssubjekte. Der Vertrag gehört seinem Herkommen nach dem Privatrecht an. Deshalb setzt er die Übereinstimmung zweier gleichberechtigter Willenserklärungen voraus. Im öffentlichen Recht, das durch die Ungleichheit der Rechtssubjekte charakterisiert wird, ist er „undenkbar“. Aus der Annahme, daß Otto Mayer mit diesem Urteil über den öffentlich-rechtlichen Vertrag auch heute noch „irgendwie“ Recht habe, leitet die Rechtswissenschaft seit kurzem eine Idee her, anhand derer sich die bislang zur Dogmatik des Verwaltungsvertrages angesammelten Erkenntnisse zu einem System formen lassen könnten. Eine genauere Untersuchung zeigt, daß dieser Auffassung in der Annahme, daß Otto Mayer auch heute noch „irgendwie“ Recht habe, zuzustimmen ist. Der einzig stichhaltige Einwand, der gegen die Vertragsdogmatik Otto Mayers ins Feld geführt werden kann, nämlich der Umstand, daß der Staat unter der Geltung des Grundgesetzes
126
Zusammenfassung
rechtlich nicht alles aus sich selbst heraus kann, da er verfassungsrechtlich konstituiert und damit in seinen Befugnissen von vornherein limitiert ist, führt zugleich zu der Erkenntnis, daß der Staat nicht über Privatautonomie verfügt. Sieht man die Privatautonomie als ein identitätsbildendes Merkmal des Vertrages an, kann der Verwaltungsvertrag nicht wie ein unter Privaten geschlossener Vertrag gedacht und damit in seinen Grundlagen nicht wie ein solcher konstruiert werden. Dies wiederum ist bei der Errichtung eines Systems des Verwaltungsvertrags in Rechnung zu stellen.
Literaturverzeichnis A. Verzeichnis der Quellenliteratur Abraham, Paul: Otto Mayer zum Gedächtnis, in: Das Recht 28 (1924), S. 329. Albrecht, Wilhelm Eduard: Rezension über Maurenbrechers Grundsätze des heutigen deutschen Staatsrechts, unveränderter Nachdruck der Veröffentlichung in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1837, S. 1489 ff., 1508 ff., Darmstadt 1962. Bernatzik, Edmund: Kritische Studien über den Begriff der juristischen Person und über die juristische Persönlichkeit der Behörden insbesondere, in: AöR 5 (1890), S. 169 ff. Bornhak, Conrad: Preußisches Staatsrecht, Bd. 2, 2. Aufl., Breslau 1912. – Grundriß des Verwaltungsrechts in Preußen und dem Deutschen Reiche, 5. Aufl., Leipzig 1916. Bühler, Ottmar: Otto Mayers Deutsches Verwaltungsrecht (Zweite Auflage). Seine Bedeutung für die Praxis und die kommende Zeit der Verwaltungsreform, in: VerwArch 27 (1919), S. 283 ff. Fleiner, Fritz: Nachruf auf: Otto Mayer, in: SchweizJZ 21 (1924/25), S. 77 f. – Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts, 8. Aufl. 1928, 2. Neudruck, Aalen 1963. Gerber, Carl Friedrich von: Das wissenschaftliche Princip des gemeinen deutschen Privatrechts, Jena 1846. – Akademische Rede, gehalten am 6. November 1851 beim Eintritt in das Kanzler-Amt der Universität Tübingen, in: Gesammelte juristische Abhandlungen, 2. Ausgabe, Jena 1878, S. 1 ff. – Ueber öffentliche Rechte, Unveränderter Abdruck der 1852 erschienenen 1. Auflage, Tübingen 1913. – Autonomie, zuerst erschienen in: Gerber, Carl Friedrich von/Jhering, Rudolph von (Hrsg.), Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts 3 (1859), hier zitiert nach: Gesammelte juristische Abhandlungen, 2. Ausgabe, Jena 1878, S. 64 ff. – Akademische Rede, gehalten am 31. Oktober 1865 bei Übernahme des Rektorats der Universität Leipzig, in: Gesammelte juristische Abhandlungen, 2. Ausgabe, Jena 1878, S. 23 ff. – Grundzüge des deutschen Staatsrechts, 3. Aufl. 1880, Neudruck, Aalen 1969. – System des Deutschen Privatrechts, 15. Aufl., Jena 1886.
128
Literaturverzeichnis
Gierke, Otto von: Das deutsche Genossenschaftsrechts, Bd. 2, Berlin 1873. – Labands Staatsrecht und die deutsche Rechtswissenschaft, in: Schmollers Jahrbuch 7 (1883), S. 1 ff. [= S. 1097 ff.]. Goldschmidt, James: Rezension zu: Otto Mayer, Justiz und Verwaltung. Rede zum Antritt des Rektorats der Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg, in: VerwArch 11 (1903), S. 340 ff. Haenel, Albert: Studien zum Deutschen Staatsrechte. Erste Studie. Die vertragsmässigen Elemente der Deutschen Reichsverfassung, Leipzig 1873. Jellinek, Georg: Allgemeine Staatslehre, 2. Aufl., Berlin 1905. – Rezension zu: Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1 und 2, 1. Aufl. 1895/96, in: VerwArch 5 (1897), S. 304 ff. Jellinek, Walter: Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 1931, unveränderter Neudruck, Offenburg 1948. Jhering, Rudolph von: Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, Bd. 1, 4. Aufl., Leipzig 1878. – Unsere Aufgabe, in: Gerber, Carl Friedrich von/Jhering, Rudolph von (Hrsg.), Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts 1 (1857), S. 1 ff. – Scherz und Ernst in der Jurisprudenz. Eine Weihnachtsgabe für das juristische Publikum, 9. Aufl., Leipzig 1904. Kaufmann, Erich: Nachruf auf: Otto Mayer, in: VerwArch 30 (1925), S. 377 ff. Kirchmann, Julius Hermann von: Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft. Erstmals veröffentlicht Berlin 1848. Hier zitiert nach der von Heinrich H. Meyer-Tscheppe hrsgg. Ausgabe, Heidelberg 1988. Kormann, Karl: System der rechtsgeschäftlichen Staatsakte, Berlin 1910. Krazeisen, Karl von: Rezension zu: Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 2, 2. Aufl. 1917, in: BlAdmPraxis 68 (1918), S. 62 f. Laband, Paul: Das Budgetrecht nach den Bestimmungen der Preussischen Verfassungs-Urkunde unter Berücksichtigung der Verfassung des Norddeutschen Bundes, Berlin 1871. – Rezension zu: Otto Mayer, Theorie des Französischen Verwaltungsrechts, 1886, in: AöR 2 (1887), S. 149 ff. – Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. 1, 2. Aufl., Freiburg i. B. 1888. – Rezension zu: Hugo Preuss, Das städtische Amtsrecht in Preussen, 1902, in: AöR 18 (1903), S. 73 ff. – Rezension zu: Alfredo Bartolomei, Diritto pubblico e teoria della conoscenza, 1903, in: AöR 19 (1905), S. 615 ff. – Rezension zu: Max Wenzel, Zur Lehre der vertragsmäßigen Elemente der Reichsverfassung, 1909, in: AöR 26 (1910), S. 365 ff. – Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. 1, 5. Aufl., Tübingen 1911.
A. Verzeichnis der Quellenliteratur
129
– Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. 2, 5. Aufl., Tübingen 1911. – Geburtstage bedeutender Rechtslehrer. Geh. Hofrat, Prof. Dr. Otto Mayer, Leipzig, vollendet am 29. März das 70. Lebensjahr, in: DJZ 21 (1916), S. 315. Laun, Rudolf von: Rezension zu: Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1, 2. Aufl. 1914, in: ÖstZÖffentR 3 (1918), S. 588 ff. Loening, Edgar: Die konstruktive Methode auf dem Gebiete des Verwaltungsrechts, in: Schmollers Jahrbuch 11 (1887), S. 117 ff. [= S. 541 ff.]. Markull, [Vorname ungenannt]: Deutsches Verwaltungsrecht. Zur zweiten Auflage von Otto Mayers Lehrbuch, in: PreußVBl. 36 (1914/15), S. 723 ff. Mayer, Otto: Der neue Civilproceß und die Untheilbarkeit des Geständnisses, in: ZFranzCivilR 9 (1878), S. 331 ff., 478 ff. – Die concurrence déloyale. Ein Beitrag aus dem französischen Rechte zur Lehre vom geistigen Eigenthum, in: ZgesHandelsR 26 (1881), S. 363 ff. – Sind die deutschrechtlichen oder die römischrechtlichen Grundsätze hinsichtlich des Fruchterwerbes im deutschen bürgerlichen Gesetzbuche aufzunehmen?, in: Verhandlungen des 16. deutschen Juristentages, Bd. 1, Berlin 1882, S. 217 ff. – Theorie des Französischen Verwaltungsrechts, Strassburg 1886. – Rezension zu: Heinrich Rosin, Das Recht der öffentlichen Genossenschaft, 1886, in: AöR 1 (1886), S. 715 ff. – Rezension zu: Edmund Bernatzik, Rechtsprechung und materielle Rechtskraft. Verwaltungsrechtliche Studien, 1886, in: AöR 1 (1886), S. 720 ff. – Zur Lehre vom öffentlich-rechtlichen Vertrage, in: AöR 3 (1888), S. 3 ff. – Rezension zu: Philipp Zorn, Lehrbuch des Kirchenrechts, 1888, in: AöR 3 (1888), S. 475 ff. – Rezension zu: Oscar Gluth: Die Lehre von der Selbstverwaltung im Lichte formaler Begriffsbestimmung, o. Jg., in: AöR 3 (1888), S. 482 ff. – Rezension zu: Siegfried Brie, Die gegenwärtige Verfassung, 1888, in: AöR 5 (1890), S. 418 ff. – Rezension zu: Georg Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1892, in: AöR 9 (1894), S. 280 ff. – Rezension zu: Heinrich Rosin, Das Recht der Arbeiterversicherung, Bd. 1, 1890, in: ZgesHandelsR 43 (1895), S. 448 ff. – Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1, 1. Aufl., Leipzig 1895. – Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 2, 1. Aufl., Leipzig 1896. – Rezension zu: Georg Meyer, Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts, 2. Aufl. 1893/94, in: AöR 11 (1896), S. 157 ff. – Rezension zu: Max von Seydel, Bairisches Staatsrecht, 4 Bd., 2. Aufl. 1896, in: AöR 12 (1897), S. 493 ff. – Rezension zu: Ludwig Gumplowicz, Allgemeines Staatsrecht, 2. Aufl. 1897, in: JLitBl. 9 (1897), S. 185 ff.
130
Literaturverzeichnis
– Rezension zu: Gustav Seidler, Zur Lehre vom Gewohnheitsrecht auf dem Gebiete des österreichischen Staats- und Verwaltungsrechts, 1898, in: AöR 14 (1899), S. 132 ff. – Rezension zu: Johann Zolger, Oesterreichisches Verordnungsrecht, 1898, in: AöR 14 (1899), S. 135 ff. – Eisenbahn und Wegerecht an einem Rechtsfalle erläutert, in: AöR 15 (1900), S. 511 ff. – Beitrag zu: Soll das Rechtsstudium den Realgymnasiasten zugänglich gemacht werden?, in: DJZ 5 (1900), S. 282. – Beitrag zu: Deutsche Rechtslehrer über das Preußische Oberverwaltungsgericht, in: PreußVBl. 22 (1900/01), S. 96. – Eisenbahn und Wegerecht, in: AöR 16 (1901), S. 38 ff. – Eisenbahn und Wegerecht, in: AöR 16 (1901), S. 203 ff. – Justiz und Verwaltung. Rede zum Antritt des Rektorats der Kaiser-WilhelmsUniversität Strassburg, Strassburg 1902. – Portalis und die organischen Artikel. Rede zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers am 27. Januar 1902 in der Aula der Kaiser-Wilhelms-Universität Strassburg, Strassburg 1902. – Rezension zu: Friedrich Tezner, Die deutschen Theorien der Verwaltungsrechtspflege, 1901, in: AöR 17 (1902), S. 141 ff. – Rezension zu: Max Layer, Prinzipien des Enteignungsrechts, 1902, in: AöR 17 (1902), S. 450 ff. – Rezension zu: Gerhard Anschütz, Die gegenwärtigen Theorien über den Begriff der gesetzgebenden Gewalt und den Umfang des königlichen Verordnungsrecht nach preussischem Staatsrecht, 2. Aufl. 1901, in: AöR 17 (1902), S. 464 ff. – Rezension zu: Adolf Arndt, Das selbständige Verordnungsrecht, 1902, in: AöR 18 (1903), S. 96 ff. – Rezension zu: Carl Sartorius, Kommentar zum Personenstandsgesetz in der vom 1. Januar 1900 geltenden Fassung, 1902, in: AöR 18 (1903), S. 278 ff. – Rezension zu: Heinrich Triepel, Quellensammlung zum deutschen Reichsstaatsrecht, 1901, in: AöR 18 (1903), S. 282 f. – Republikanischer und monarchischer Bundesstaat, in: AöR 18 (1903), S. 337 ff. – Rezension zu: James Goldschmidt, Das Verwaltungsstrafrecht, 1902, in: VerwArch 11 (1903), S. 348 ff. – Die Entschädigungspflicht des Staates nach Billigkeitsrecht. Vortrag gehalten in der Gehe-Stiftung zu Dresden am 19. März 1904, Dresden 1904. – Rezension zu: Heinrich Ryffel, Die schweizerische Landsgemeinde, 1904, in: AöR 19 (1905), S. 420 ff. – Rezension zu: Karl Goez, Die Verwaltungsrechtspflege in Württemberg, 1902, in: AöR 19 (1905), S. 590 ff.
A. Verzeichnis der Quellenliteratur
131
– Rezension zu: Gaston Jèze, Les principes généraux du droit adminstratif, 1904, in: AöR 19 (1905), S. 597 ff. – Rezension zu: Heinrich Rosin, Das Recht der Arbeiterversicherung, Bd. 2, 1905, in: ZgesHandelsR 56 (1905), S. 611 ff. – Staat und Kirche, in: Hauck, Albert (Hrsg.), Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, Bd. 18, 3. Aufl., Leipzig 1906, S. 707 ff. – Das Recht am Urteil, in: Die juristische Fakultät der Universität Leipzig verkündigt die Feier des Andenkens an Dr. Bernh. Friedr. Lauhn, welche am 12. Mai 1906 Vormittags 12 Uhr in der Aula des Collegium Iuridicum statthaben wird, Leipzig 1906. – Rezension zu: Eduard Hölder, Natürliche und juristische Personen, 1905, in: AöR 20 (1906), S. 590 ff. – Rezension zu: Maurice Block, Dictionnaire de l’administration française, refondue et consideérablement augmentée par Eduard Maguéro, 2 Bd., 1905, in: VerwArch 14 (1906), S. 268 ff. – Zur Lehre von der materiellen Rechtskraft in Verwaltungssachen, in: AöR 21 (1907), S. 1 ff. – Rezension zu: Hugo v. Strauss und Torney, Das Gesetz betreffend die Anlegung und Veränderung von Strassen und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften vom 2. Juli 1875, Kommentar, 5. Aufl. 1905, in: AöR 21 (1907), S. 445 ff. – Rezension zu: Richard Thoma, Der Polizeibefehl im badischen Recht, Teil 1, 1906, in: AöR 21 (1907), S. 450 ff. – Rezension zu: Oskar von Arnstedt, Das Preussische Polizeirecht, Bd. 1, 1905, in: AöR 21 (1907), S. 453 ff. – Schiffahrtsabgaben. Kritische Bemerkungen zu der gleichnamigen Schrift des Wirklichen Geheimen Oberregierungsrats M. Peters, vortragender Rat im preussischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten, Tübingen 1907. – Der gegenwärtige Stand der Frage des öffentlichen Eigentums (Vortrag gehalten in der Wiener Juristischen Gesellschaft am 6. März 1907), in: AöR 21 (1907), S. 499 ff. – Rezension zu: Julius Hatschek, Englisches Staatsrecht mit Berücksichtigung der für Schottland und Irland geltenden Sonderheiten, Bd. 2, in: ZgesStaatsWiss 63 (1907), S. 541 ff. – Die juristische Person und ihre Verwertbarkeit im öffentlichen Recht, in: Staatsrechtliche Abhandlungen. Festgabe für Paul Laband zum fünfzigsten Jahrestage der Doktor-Promotion, Bd. 1, Tübingen 1908, S. 1 ff. – Rezension zu: Ernst von Meier, Französische Einflüsse auf die Staats- und Rechtsentwicklung Preußens im XIX. Jahrhundert, Bd. 1, 1907, in: HistVjS 11 (1908), S. 258 f. – Rezension zu: Ernst Bruck, Das Verfassungs- und Verwaltungsrecht von ElsaßLothringen, Bd. 1, 1908, in: JLitBl. 20 (1908), S. 111.
132
Literaturverzeichnis
– Rezension zu: Adolf Lobe, Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes, Bd. 1, 1907, in: ZgesHandelsR 61 (1908), S. 274 ff. – Das Staatsrecht des Königreichs Sachsen, Tübingen 1909. – Rezension zu: Otto Richter, Der Reichsfiskus, 1908, in: AöR 25 (1909), S. 484. – Rezension zu: Rudolf v. Laun, Das Recht zum Gewerbebetrieb, 1908, in: AöR 25 (1909), S. 485 ff. – Rezension zu: Ludwig Spiegel, Die Verwaltungsrechtswissenschaft, 1909, in: AöR 25 (1909), S. 489 ff. – Rezension zu: Walter Jellinek, Der fehlerhafte Staatsakt und seine Wirkungen, 1908, in: AöR 25 (1909), S. 497 ff. – Ein Stück curriculum vitae, in: DJZ 14 (1909), Sp. 1041 ff. – Schiffahrtsabgaben II. Kritische Bemerkungen zum Entwurf eines Reichsgesetzes, die Erhebung von Schiffahrtsabgaben betreffend, Tübingen 1910. – Zum Verkauf des Tempelhofer Feldes, in: Das Recht 14 (1910), Sp. 758 ff. – Festrede, in: Feier des 90. Geburtstags Sr. Königl. Hoheit des Prinzregenten Luitpolt von Bayern zu Leipzig am 11. März 1911, Leipzig 1911. – Rezension zu: Fritz Hawelka, Die Rechte an öffentlichen Wegen in Oesterreich, 1910, in: AöR 27 (1911), S. 344 ff. – Rezension zu: Emil Herzog, Das Rechtsmittelverfahren und die Rechtskraft der Entscheidung in Steuer- und Gebührensachen, 1909, in: AöR 27 (1911), S. 346 ff. – Rezension zu: Viktor Cathrein, Recht, Naturrecht u. positives Recht. Eine kritische Untersuchung der Grundbegriffe der Rechtsordnung, 2. Aufl. 1909, in: DZKirchenR 20 (1911), S. 389 ff. – Rezension zu: Max Fleischmann (Hrsg.), Wörterbuch des deutschen Staats- und Verwaltungsrechts, begründet von Karl Freiherr v. Stengel, 2. Aufl. 1911, in: AöR 28 (1912), S. 346 ff. – Rezension zu: Karl Neumeyer, Internationales Verwaltungsrecht. Innere Verwaltung I, o. J., in: AöR 28 (1912), S. 350 ff. – Rezension zu: F. Freiherr Marschall von Bieberstein, Verantwortlichkeit und Gegenzeichnung bei Anordnung des Obersten Kriegsherrn, 1911, in: AöR 28 (1912), S. 353 ff. – Die Haftung des Staates für rechtswidrige Amtshandlungen, in: SächsArchR 8 (1913), S. 1 ff. – Fichte über das Volk. Rede des antretenden Rektors, in: Rektorwechsel an der Universität Leipzig am 20. November 1913, Leipzig 1913, S. 17 ff. – Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1, 2. Aufl., München und Leipzig 1914. – Rezension zu: Gaston Jèze, Das Verwaltungsrecht der französischen Republik, 1913, in: AöR 32 (1914), S. 275 ff.
A. Verzeichnis der Quellenliteratur
133
– Der Wert des Völkerrechts. Rede, gehalten zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Königs Friedrich August III. von Sachsen am 20. Mai 1915 in der Universität Leipzig, in: Otto Mayer. Kleine Schriften zum öffentlichen Recht, Bd. 2, hrsgg. von Erk Volkmar Heyen, Berlin 1981, S. 16 ff. – Rezension zu: Conrad Bornhak, Grundriß des deutschen Staatsrechts, 4. Aufl. 1916; ders., Grundriß des Verwaltungsrechts in Preußen und dem Deutschen Reich, 5. Aufl. 1916, in: JW 45 (1916), S. 1161 f. – Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 2, 2. Aufl., München und Leipzig 1917. – Rezension zu: A. v. Peretiatkowicz, Die Rechtsphilosophie des J. J. Rousseau, 1916, in: AöR 36 (1917), S. 369 f. – Rezension zu: Georges Werner, Le controle judicaire á Genève, 1917, in: AöR 37 (1918), S. 126 ff. – Völkerrecht und Völkermoral, in: AöR 38 (1918), S. 1 ff. – Rezension zu: Heinrich Triepel, Die Reichsaufsicht, 1917, in: JW 47 (1918), S. 158 f. – Rezension zu: Chr. Eckert (Hrsg.), Der Eintritt der erfahrungswissenschaftlichen Intelligenz in die Verwaltung, 1919, in: JW 48 (1919), S. 486 f. – Anmerkung zu: Reichsgericht, II. Strafsenat, Urteil vom 4. April 1919, in: JW 48 (1919), S. 733. – Die Trennung von Kirche und Staat, was sie bedeutet und was sie zur Folge hat, Leipzig/Berlin 1919. – Rezension zu: Alfred Fried, Entwicklung, Umfang und Bedeutung der zwischenstaatlichen Organisation in Amerika, 2. Aufl. 1918, in: JW 48 (1919), S. 20 f. – Zur vorläufigen Reichsverfassung, in: JW 48 (1919), S. 209 f. – Neues vom öffentlichen Eigentum, in: AöR 39 (1920), S. 77 ff. – Rezension zu: Eduard Hubrich, Der Legalcharakter der preußischen Universitätsstatuten und die Notwendigkeit eines neuen Universitätsgesetzes, 1918, in: AöR 39 (1920), S. 96 ff. – Rezension zu: Ernst Zitelmann, Die Unvollkommenheit des Völkerrechts, Rede, gehalten am hundertjährigen Gründungstag der Rheinischen Friedrich-WilhelmsUniversität zu Bonn, 18. Oktober 1918, 1919, in: AöR 39 (1920), S. 103 f. – Rezension zu: Alfred Friters, Revolutionsgewalt und Notstandsrecht, 1919, in: AöR 39 (1920), S. 105 ff. – Rezension zu: Karl Haff, Institutionen der Persönlichkeitslehre und des Körperschaftsrechts, 1918, in: AöR 40 (1921), S. 113 ff. – Rezension zu: F. Giese, Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919, 1919, in: AöR 40 (1921), S. 125 ff. – Rezension zu: Willibalt Apelt, Ein Beitrag zur Lehre von der rechtswirksamen Handlung im öffentlichen Recht, 1920, in: AöR 40 (1921), S. 244 ff. – Rezension zu: Gerhard Lassar, Grundbegriffe des preußischen Wegerechts, 1919, in: AöR 40 (1921), S. 382 ff.
134
Literaturverzeichnis
– Die Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg. Ihre Entstehung und Entwicklung, Berlin und Leipzig 1922. – Rezension zu: Otto Meißner, Das neue Staatsrecht des Reichs und seiner Länder, 1921, in: JW 51 (1922), S. 74. – Rezension zu: Gerhard Lassar, Der Erstattungsanspruch im Verwaltungs- und Finanzrecht, 1921, in: JW 51 (1922), S. 76 f. – Anmerkung zu: Preußisches Oberverwaltungsgericht, I. Senat, Entscheidung vom 10. November 1921, in: JW 51 (1922), S. 610 f. – Anmerkung zu: Reichsgericht, III. Zivilsenat, Entscheidung vom 14. März 1922, in: JW 51 (1922), S. 1385 ff. – Rezension zu: Julius Hatschek, Deutsches und Preußisches Staatsrecht, Bd. 1, 1922, in: JW 51 (1922), S. 1570 f. – Rezension zu: Fritz Stier-Somlo, Das Preußische Verfassungsrecht, 1922, in: AöR 43 (1922), S. 364 f. – Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1, unveränderter Nachdruck der 3. Aufl. 1924, Berlin 1969. – Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 2, unveränderter Nachdruck der 3. Aufl. 1924, Berlin 1969. – Selbstdarstellung [Otto Mayer], in: Planitz, Hans (Hrsg.), Die Rechtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Leipzig 1924, S. 153 ff. [= S. 1 ff.]. – Finanzwirtschaft und Finanzrecht, in: Gerloff, Wilhelm/Meisel, Franz (Hrsg.), Handbuch der Finanzwissenschaft, Bd. 1, Tübingen 1926, S. 86 ff. Meier, [Vorname ungenannt]: Rezension zu: Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1 und 2, 2. Aufl. 1914/17, in: SächsArchR 13 (1918), S. 54 f. Meyer, Georg: Lehrbuch des Deutschen Verwaltungsrechts, Bd. 1, 2. Aufl., Leipzig 1893. – Rezension zu: Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1 und 2, 1. Aufl. 1895/96, in: DLitZ 29 (1896), S. 918 ff. Meyer, Georg/Anschütz, Gerhard: Lehrbuch des Deutschen Staatsrechts, 7. Aufl., München und Leipzig 1919. Niemeyer, Theodor: Rezension zu: Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1 und 2, 3. Aufl. 1924, in: Niemeyers Zeitschrift 34 (1925), S. 493 f. Piloty, Robert: Rezension zu: Otto Mayer, Schiffahrtsabgaben II, 1910, in: JLitBl. 22 (1910), S. 46 ff. Puchta, Friedrich: Das Gewohnheitsrecht, Bd. 1, Erlangen 1828. – Kritik von Georg Beseler’s Volksrecht und Juristenrecht, 1843. Aus den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik besonders abgedruckt, Berlin 1844. – Cursus der Institutionen, Bd. 1, 3. Aufl., nach dem Tode des Verfassers besorgt von U. Rudorff, Leipzig 1850.
B. Verzeichnis der Sekundärliteratur
135
Rehm, Hermann: Rezension zu: Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1 und 2, 1895/1896, in: AöR 12 (1897), S. 590 ff. Savigny, Friedrich Carl von: System des heutigen Römischen Rechts, Bd. 1, Berlin 1840. Schelcher, Herbert: Rezension zu: Otto Mayer, le Droit administratif allemand, 1903, in: FZPraxisGesVerw 29 (1905), S. 346 f. – Rezension zu: Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1, 2. Aufl. 1914, in: FZPraxisGesVerw 44 (1915), S. 247 f. Schultzenstein, [Vorname ungenannt]: Rezension zu: Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1, 2. Aufl. 1914, in: JW 44 (1915), S. 734 ff. Seydel, Max von: Rezension zu: Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1 und 2, 1. Aufl. 1895/96, in: BlAdmPraxis 48 (1898), S. 143 ff. Sohm, Rudolph: Vermögensrecht. Gegenstand. Verfügung, in: AbR 28 (1906), S. 173 ff. – Institutionen. Geschichte und System des römischen Privatrechts, 15. Aufl., München und Leipzig 1917. – Über Begriffsjurisprudenz, in: DJZ 14 (1909), Sp. 1019 ff. Stahl, Friedrich Julius: Die Philosophie des Rechts. 1830–1837. Eine Auswahl nach der 5. Aufl. 1870, Tübingen 1926. Stampe, [Vorname ungenannt]: Rechtsfindung durch Konstruktion, in: DJZ 10 (1905), Sp. 417 ff. Triepel, Heinrich: Rezension zu: Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1 und 2, 3. Aufl. 1924, in: DJZ 30 (1925), S. 126. Windscheid, Bernhard: Recht und Rechtswissenschaft. Greifswalder UniversitätsFestrede von 1854, in: Gesammelte Reden und Abhandlungen, Leipzig 1904, S. 3 ff. – Die Aufgaben der Rechtswissenschaft. Leipziger Rektoratsrede vom 31. Oktober 1884, in: Gesammelte Reden und Abhandlungen, Leipzig 1904, S. 100 ff. – Lehrbuch des Pandektenrechts, Bd. 1, 9. Aufl., bearbeitet von Theodor Kipp, Neudruck der Ausgabe Frankfurt am Main 1906, Aalen 1963. Wittmayer, Leo: Rezension zu: Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1 und 2, 2. Aufl. 1914/17, in: AöR 37 (1918), S. 472 ff. Zorn, Philipp: Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. 1, 2. Aufl., Berlin 1895.
B. Verzeichnis der Sekundärliteratur Achterberg, Norbert: Der öffentlich-rechtliche Vertrag, in: JA 11 (1979), S. 356 ff. Adamovich, Ludwig: Handbuch des österreichischen Verwaltungsrechts, Bd. 1, 5. Aufl., Wien 1954. Antoniolli, Walter: Allgemeines Verwaltungsrecht, Wien 1954.
136
Literaturverzeichnis
Apelt, Willibalt: Der verwaltungsrechtliche Vertrag, Leipzig 1920. – Der verwaltungsrechtliche Vertrag, in: AöR 84 (1959), S. 249 ff. Bachof, Otto: Die Dogmatik des Verwaltungsrechts vor den Gegenwartsaufgaben der Verwaltung, in: VVDStRL 30 (1972), S. 193 ff. Badura, Peter: Das Verwaltungsrecht des liberalen Rechtsstaates. Methodische Überlegungen zur Entstehung des wissenschaftlichen Verwaltungsrechts, Göttingen 1967. – Wirtschaftsverfassung und Wirtschaftsverwaltung. Ein exemplarischer Leitfaden, Frankfurt am Main 1971. Bauer, Hartmut: Verwaltungsrechtslehre im Umbruch? Rechtsformen und Rechtsverhältnisse als Elemente einer zeitgemäßen Verwaltungsrechtsdogmatik, in: Die Verwaltung 25 (1992), S. 301 ff. Bernet, Wolfgang/Förster, Stefan: Otto Mayer – ein konservativer Verwaltungsrechtstheoretiker des deutschen Kaiserreiches, in: Staat und Recht 31 (1988), S. 1017 ff. Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Entstehung und Wandel des Rechtsstaatsbegriffs, in: FS für Adolf Arndt, Frankfurt am Main 1969, S. 53 ff. – Der verdrängte Ausnahmezustand. Zum Handeln der Staatsgewalt in außergewöhnlichen Lagen, in: NJW 31 (1978), S. 1881 ff. – Gesetz und gesetzgebende Gewalt. Von den Anfängen der deutschen Staatsrechtslehre bis zur Höhe des staatsrechtlichen Positivismus, 2. Aufl., Berlin 1981. – Die national-konstitutionelle Bewegung des Jahres 1848, in: ders. (Hrsg.), Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815–1914), Königstein/Ts. 1981, S. 27 ff. Bohnert, Joachim: Über die Rechtslehre Georg Friedrich Puchtas (1798–1846), Karlsruhe 1975. Bonk, Heinz Joachim: in: Stelkens, Paul/Bonk, Heinz Joachim/Sachs, Michael (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl., München 2001. – 25 Jahre Verwaltungsverfahrensgesetz, in: NVwZ 20 (2001), S. 636 ff. Brohm, Winfried: Grundsatzfragen städtebaulicher Verträge, in: Bauer, Hartmut/ Breuer, Rüdiger/Degenhart, Christoph/Oldiges, Martin (Hrsg.), 100 Jahre Allgemeines Baugesetz Sachsen, Stuttgart/München/Hannover/Berlin/Weimar/Dresden 2000, S. 457 ff. – Städtebauliche Verträge zwischen Privat- und Öffentlichem Recht, in: JZ 55 (2000), S. 321 ff. Brox, Hans: Allgemeiner Teil des BGB, 26. Aufl., Köln/Berlin/Bonn/München 2002. Büchner, Volker: Die Bestandskraft verwaltungsrechtlicher Verträge, Düsseldorf 1979.
B. Verzeichnis der Sekundärliteratur
137
Buddeberg, Theodor: Rechtssoziologie des öffentlich-rechtlichen Vertrages, in: AöR 47 (1925), S. 85 ff. Bullinger, Martin: Vertrag und Verwaltungsakt. Zu den Handlungsformen und Handlungsprinzipien der öffentlichen Verwaltung nach deutschem und englischem Recht, Stuttgart 1962. – Öffentliches Recht und Privatrecht. Studien über Sinn und Funktionen der Unterscheidung, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1968. – Öffentliches Recht und Privatrecht in Geschichte und Gegenwart, in: Beiträge zum Handels- und Wirtschaftsrecht. FS für Fritz Rittner, München 1991, S. 69 ff. Burmeister, Joachim: Verträge und Absprachen zwischen der Verwaltung und Privaten, in: VVDStRL 52 (1993), S. 190 ff. Butterwegge, Georg: Verwaltungsvertrag und Verwaltungsakt, Berlin 2001. Canaris, Claus-Wilhelm: Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz entwickelt am Beispiel des deutschen Privatrechts, 2. Aufl., Berlin 1983. Coing, Helmut: Geschichte und Bedeutung des Systemgedankens in der Rechtswissenschaft. Rede, gehalten beim Antritt des Rektorats, in: Frankfurter Universitätsreden, Heft 17, Frankfurt am Main 1956, S. 26 ff. – Die Lage der soziologischen Jurisprudenz. Zur Frage der juristischen Methode im Privatrecht, in: Universitas 7 (1952), S. 241 ff. Dennewitz, Bodo: Die Systeme des Verwaltungsrechts. Ein Beitrag zur Geschichte der modernen Verwaltungswissenschaft, Hamburg 1948. Efstratiou, Pavlos-Michael: Die Bestandskraft des öffentlichrechtlichen Vertrages, Berlin 1988. Ehlers, Dirk: Verwaltung in Privatrechtsform, Berlin 1984. Emmerich, Volker: Das Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, Bad Homburg v. d. H. 1969. Erichsen, Hans-Uwe: Das Verwaltungshandeln, in: ders./Ehlers, Dirk (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 12. Aufl., Berlin/New York 2002, §§ 11 ff. – Staatsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit, 3. Aufl., München 1982. Eyrich, Heinz: Mayer, in: Staatslexikon der Görres-Gesellschaft, 6. Aufl., Freiburg 1969, Bd. 5, Sp. 629 f. Fikentscher, Wolfgang: Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung, Bd. 3, Tübingen 1976. – Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung, Bd. 4, Tübingen 1977. Fioravanti, Maurizio: Die Theorie des „Rechtsstaats“ als „Verwaltungsstaat“ in Deutschland und Italien – Otto Mayer und Santi Romano –, in: RHistJ 4 (1985), S. 89 ff. Forsthoff, Ernst: Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Bd. 1, 10. Aufl., München 1973. Friedrich, Manfred: Paul Laband und die Staatsrechtswissenschaft seiner Zeit, in: AöR 111 (1986), S. 197 ff.
138
Literaturverzeichnis
– Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft, Berlin 1997. Giacometti, Zaccaria: Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, Bd. 1, Zürich 1960. Glitza, Eva: Die deutsche Verwaltung und die rein rechtswissenschaftliche Schule Otto Mayers, in: DÖV 80 (1965), S. 329 ff. Göldner, Detlef: Gesetzmäßigkeit und Vertragsfreiheit im Verwaltungsrecht, in: JZ 31 (1976), S. 352 ff. Gramm, Christof: Privatisierung und notwendige Staatsaufgaben, Berlin 2001. Grimm, Dieter: Diskussionsbeitrag zum Beratungsgegenstand „Verträge und Absprachen zwischen der Verwaltung und Privaten“, in: VVDStRL 52 (1993), S. 324 ff. Günther, Hellmuth: Otto Mayer und der „Dienstbefehl“ – Skizze zur fachlichen Weisung mit Exkursen –, in: DÖD 2000, S. 169 ff., 227 ff., 248 ff., 278 ff. Gurlit, Elke: Verwaltungsvertrag und Gesetz. Eine vergleichende Untersuchung zum Verhältnis von vertraglicher Bindung und staatlicher Normsetzungsautorität, Tübingen 2000. – Grundlagen des Verwaltungsvertrages, in: Jura 23 (2001), S. 659 ff., 731 ff. Henke, Wilhelm: Allgemeine Fragen des öffentlichen Vertragsrechts, in: JZ 39 (1984), S. 441 ff. Henneke, Hans-Günter: in: Knack, Hans Joachim, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 7. Aufl., Köln/Berlin/Bonn/München 2000, Vor § 54. – 30 Jahre LVwG, 20 Jahre VwVfG – Stabilität und Flexibilität des Verwaltungshandelns, in: DÖV 50 (1997), S. 768 ff. Heyen, Erk Volkmar: Positivistische Staatsrechtslehre und politische Philosophie. Zur philosophischen Bildung Otto Mayers, in: Quaderni Fiorentini 8 (1979), S. 275 ff. – Otto Mayers Kirchenrecht und die Verfassungsreform der evangelisch-lutherischen Kirche in Elsaß-Lothringen und Polen, in: ZSavignyStR 96 (1979), S. 239 ff. – Otto Mayer: Frankreich und das Deutsche Reich, in: Der Staat 19 (1980), S. 444 ff. – Die Verwaltungspraxis Otto Mayers in Straßburg und Leipzig, in: VerwArch 71 (1980), S. 44 ff. – Otto Mayer. Studien zu den geistigen Grundlagen seiner Verwaltungsrechtswissenschaft, Berlin 1981. – Deutschland, in: ders. (Hrsg.), Geschichte der Verwaltungsrechtswissenschaft in Europa, Frankfurt a. M. 1982, S. 29 ff. – Otto Mayer, in: Neue Deutsche Biographie, hrsg. von der Historischen Kommission bei der bayrischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1990, Bd. 16, S. 550 ff. Höfling, Wolfram/Krings, Günter: Der verwaltungsrechtliche Vertrag: Begriff, Typologie, Fehlerlehre, in: JuS 40 (2000), S. 625 ff.
B. Verzeichnis der Sekundärliteratur
139
Huber, Ernst Rudolf: Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 1, Stuttgart 1961. – Die Bismarcksche Reichsverfassung im Zusammenhang der deutschen Verfassungsgeschichte, in: Böckenförde, Ernst Wolfgang (Hrsg.), Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815–1914), Königstein/Ts. 1981, S. 171 ff. Hueber, Alfons: Otto Mayer. Die „juristische Methode“ im Verwaltungsrecht, Berlin 1982. Imboden, Max: Der verwaltungsrechtliche Vertrag, Basel 1958. Isensee, Josef: Die Staatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland, in: ders./Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, Heidelberg 1987, § 13. Jerusalem, Franz W.: Kritik der Rechtswissenschaft, Frankfurt a. M. 1948. Jesch, Dietrich: Gesetz und Verwaltung. Eine Problemstudie zum Wandel des Gesetzmäßigkeitsprinzips, 2. Aufl., Tübingen 1968. Jönsson, Katja/Wolfes, Matthias: Otto Mayer, in: Bautz, Friedrich Wilhelm (Begr. und Hrsg.), Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Herzberg 1999, Bd. 15, Sp. 991 ff. Kawalla, Klaus-Dieter: Der subordinationsrechtliche Verwaltungsvertrag und seine Abwicklung, Konstanz 1984. Kempen, Bernhard: Die Formenwahlfreiheit der Verwaltung, München 1989. Kimminich, Otto: Deutsche Verfassungsgeschichte, 2. Aufl., Baden-Baden 1987. Kirchhof, Paul: Verwalten durch „mittelbares“ Einwirken, Köln/Berlin/Bonn/München 1977. Kleinheyer, Gerd/Schröder, Jan: Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten. Eine biographische Einführung in die Geschichte der Rechtswissenschaft, 3. Aufl., Heidelberg 1989. Kollmer, Michael: Idee und Wirklichkeit des Kommunismus. Ein Abriß seiner Geschichte von Babeuf bis Stalin, Wien 1994. Konrad, Horst: Der öffentlich-rechtliche Vertrag – Institution oder Trugbild, Würzburg 1975. Krebs, Walter: Vorbehalt des Gesetzes und Grundrechte. Vergleich des traditionellen Eingriffsvorbehaltes mit den Grundrechtsbestimmungen des Grundgesetzes, Berlin 1975. – Der städtebauliche Vertrag im Gefüge der allgemeinen Vertragslehren des Verwaltungsrechts, in: Schmidt-Aßmann, Eberhard/Krebs, Walter, Rechtsfragen städtebaulicher Verträge. Vertragstypen und Vertragsrechtslehren, 2. Aufl., Köln 1992, S. 120 ff. – Grundfragen des öffentlich-rechtlichen Vertrages, in: Ehlers, Dirk/Krebs, Walter (Hrsg.), Grundfragen des Verwaltungsrechts und des Kommunalrechts, Berlin/ New York 2000, S. 41 ff.
140
Literaturverzeichnis
Landsberg, Ernst: Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, Abteilung 3, Halbband 2, Text, München und Heidelberg 1910. Larenz, Karl: Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl., Berlin/Heidelberg/ New York 1991. Larenz, Karl/Wolf, Manfred: Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 8. Aufl., München 1997. Liermann, Hans/Schoeps, Hans-Joachim: Materialien zur preußischen Eherechtsreform im Vormärz, in: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen aus dem Jahre 1961, S. 489 ff. Losano, Mario G.: Der Begriff „System“ bei Gerber, in: Objektivierung des Rechtsdenkens. Gedächtnisschrift für Ilmar Tammelo, Berlin 1984, S. 647 ff. Luhmann, Niklas: Zweckbegriff und Systemrationalität. Über die Funktion von Zwecken in sozialen Systemen, Tübingen 1968. – Funktionen und Folgen formaler Organisation, 4. Aufl., Berlin 1995. Mallmann, Walter: Schranken nichthoheitlicher Verwaltung, in: VVDStRL 19 (1961), S. 165 ff. Maurer, Hartmut: Der Verwaltungsvertrag – Probleme und Möglichkeiten, in: DVBl. 104 (1989), S. 798 ff. – Allgemeines Verwaltungsrecht, 14. Aufl., München 2002. Medicus, Dieter: Allgemeiner Teil des BGB, 8. Aufl., Heidelberg 2002. Meyer-Hesemann, Wolfgang: Methodenwandel in der Rechtswissenschaft, Heidelberg/Karlsruhe 1981. – Die paradigmatische Bedeutung Otto Mayers für die Entwicklung der deutschen Verwaltungsrechtswissenschaft, Rechtstheorie 13 (1982), S. 496 ff. Nipperdey, Thomas: Über einige Grundzüge der deutschen Parteiengeschichte, in: Böckenförde, Ernst-Wolfgang (Hrsg.), Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815–1914), Königstein/Ts. 1981, S. 274 ff. Oertzen, Peter von: Die soziale Funktion des staatsrechtlichen Positivismus. Eine wissenschaftliche Studie über die Entstehung des formalistischen Positivismus in der deutschen Staatsrechtswissenschaft, Frankfurt am Main 1974. Pakeerut, Worachet: Die Entwicklung der Dogmatik des verwaltungsrechtlichen Vertrages, Berlin 2000. Palandt, Otto: Bürgerliches Gesetzbuch, 62. Aufl., München 2003. Park, Jeong Hoon: Rechtsfindung im Verwaltungsrecht. Grundlegung einer Prinzipientheorie des Verwaltungsrechts als Methode der Verwaltungsrechtsdogmatik, Berlin 1999. Pauly, Walter: Der Methodenwandel im deutschen Spätkonstitutionalismus, Tübingen 1993. – Otto Mayer, in: Stolleis, Michael (Hrsg.), Juristen: ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, München 1995, S. 418 f.
B. Verzeichnis der Sekundärliteratur
141
Paust, Dirk: Die institutionelle Methode im Verwaltungsrecht, Göttingen 1997. Peine, Franz-Joseph: Das Recht als System, Berlin 1983. Pieper, Goswin: Zulässigkeit und Funktion des öffentlich-rechtlichen Vertrages im Verhältnis Staat und Bürger, insbesondere im Vergleich zur Funktion des Verwaltungsakts, in: DVBl. 82 (1967), S. 11 ff. Pieroth, Bodo/Schlink, Bernhard: Grundrechte. Staatsrecht II, 18. Aufl., Heidelberg 2002. Pietzcker, Jost: Die Rechtsfigur des Grundrechtsverzichts, in: Der Staat 17 (1978), S. 527 ff. – Rechtsbindungen der Vergabe öffentlicher Aufträge, in: AöR 107 (1982), S. 61 ff. Püttner, Günter: Wider den öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen Staat und Bürger, in: DVBl. 97 (1982), S. 122 ff. Remmert, Barbara: Verfassungs- und verwaltungsrechtsgeschichtliche Grundlagen des Übermaßverbotes, Heidelberg 1995. Rengeling, Hans-Werner: Das Kooperationsprinzip im Umweltrecht, Köln/Berlin/ Bonn/München 1988. Röhl, Hans Christian: Verwaltung und Privatrecht – Verwaltungsprivatrecht?, in: VerwArch 86 (1995), S. 531 ff. Rottmann, Frank: Der städtebauliche Vertrag – Instrument zur Umverteilung?, in: Bauer, Hartmut/Breuer, Rüdiger/Degenhart, Christoph/Oldiges, Martin (Hrsg.), 100 Jahre Allgemeines Baugesetz Sachsen, Stuttgart/München/Hannover/Berlin/ Weimar/Dresden 2000, S. 487 ff. Rüfner, Wolfgang: Formen öffentlicher Verwaltung im Bereich der Wirtschaft, Berlin 1967. – Die Nutzung öffentlicher Anstalten. Zur Anstaltslehre Otto Mayers, in: Die Verwaltung 17 (1984), S. 19 ff. Rupp, Hans Heinrich: Grundfragen der heutigen Verwaltungsrechtslehre, 2. Aufl., Tübingen 1991. Salzwedel, Jürgen: Die Grenzen der Zulässigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages, Berlin 1958. Sauer, Wilhelm: Juristische Methodenlehre. Zugleich eine Einleitung in die Methodik der Geisteswissenschaften, Stuttgart 1940. Schachtschneider, Karl Albrecht: Staatsunternehmen und Privatrecht, Berlin/New York 1986. Scheuner, Ulrich: Die neuere Entwicklung des Rechtsstaats in Deutschland, in: ders., Staatstheorie und Staatsrecht. Gesammelte Schriften, Berlin 1978, S. 185 ff. Schimpf, Christian: Der verwaltungsrechtliche Vertrag unter besonderer Berücksichtigung seiner Rechtswidrigkeit, Berlin 1982.
142
Literaturverzeichnis
Schlette, Volker: Die Verwaltung als Vertragspartner. Empirie und Dogmatik verwaltungsrechtlicher Vereinbarungen zwischen Behörde und Bürger, Tübingen 2000. Schmidt-Aßmann, Eberhard: Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee und System, Heidelberg 1982. – Grundlagen und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen Systembildung, in: Ehlers, Dirk/Krebs, Walter (Hrsg.), Grundfragen des Verwaltungsrechts und des Kommunalrechts, Berlin/New York 2000, S. 1 ff. Schmidt-De Caluwe, Reimund: Der Verwaltungsakt in der Lehre Otto Mayers. Staatstheoretische Grundlagen, dogmatische Ausgestaltung und deren verfassungsbedingte Vergänglichkeit, Tübingen 1999. Schmidt-Salzer, Joachim: Tatsächlich ausgehandelter Verwaltungsakt, zweiseitiger Verwaltungsakt und verwaltungsrechtlicher Vertrag, in: VerwArch 62 (1971), S. 135 ff. Schmitt, Carl: Das „allgemeine deutsche Staatsrecht“ als Beispiel rechtswissenschaftlicher Systembildung, in: ZgesStaatsWiss 100 (1940), S. 5 ff. Schmitz, Heribert: Moderner Staat – Modernes Verwaltungsverfahrensrecht, in: NVwZ 19 (2000), S. 1238 ff. Schröder, Jan: Privatrecht und öffentliches Recht. Zur Entwicklung der modernen Rechtssystematik in der Naturrechtslehre des 18. Jahrhunderts, in: FS für Joachim Gernhuber, Tübingen 1993, S. 961 ff. – Recht als Wissenschaft, Geschichte der juristischen Methode vom Humanismus bis zur historischen Schule (1500–1850), München 2001. Spannowsky, Willy: Grenzen des Verwaltungshandelns durch Verträge und Absprachen, Berlin 1994. Stein, Alois von der: Der Systembegriff in seiner geschichtlichen Entwicklung, in: Diemer, Alwin (Hrsg.), System und Klassifikation in Wissenschaft und Dokumentation, Meisenheim am Glan 1968, S. 1 ff. Stephanitz, Dieter von: Exakte Wissenschaft und Recht. Der Einfluß von Naturwissenschaft und Mathematik auf Rechtsdenken und Rechtswissenschaft in zweieinhalb Jahrtausenden. Ein historischer Grundriß, Berlin 1970. Stern, Klaus: Zur Grundlegung einer Lehre des öffentlich-rechtlichen Vertrages, in: VerwArch 49 (1958), S. 106 ff. – Zur Problematik des energiewirtschaftlichen Konzessionsvertrags, in: AöR 84 (1959), S. 273 ff. – Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, 2. Aufl., München 1984. – Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III/2, München 1994. Stettner, Rupert: Grundfragen einer Kompetenzlehre, Berlin 1983. Stolleis, Michael: Verwaltungsrechtswissenschaft und Verwaltungslehre. 1866–1914, in: Jeserich, Kurt G. A./Pohl, Hans/Unruh, Georg-Christoph von (Hrsg.), Deutsche Verwaltungsgeschichte, Stuttgart 1984, Bd. 3, S. 85 ff.
B. Verzeichnis der Sekundärliteratur
143
– Rechtsstaat, in: Erler, Adalbert/Kaufmann, Ekkehard (Hrsg.), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Berlin 1990, Bd. 4, Sp. 367 ff. – Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. 2, 1800–1914, München 1992. – Öffentliches Recht und Privatrecht im Prozeß der Entstehung des modernen Staates, in: Hoffmann-Riem, Wolfgang/Schmidt-Aßmann, Eberhard (Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, BadenBaden 1996, S. 41 ff. Tripp, Dietrich: Der Einfluß des naturwissenschaftlichen, philosophischen und historischen Positivismus auf die deutsche Rechtslehre im 19. Jahrhundert, Berlin 1983. Uhlenbrock, Henning: Der Staat als juristische Person. Dogmengeschichtliche Untersuchung zu einem Grundbegriff der deutschen Staatsrechtslehre, Berlin 2000. Wall, Heinrich de: Die Anwendbarkeit privatrechtlicher Vorschriften im Verwaltungsrecht, Tübingen 1999. Weiß, Paula Macedo: Pacta sunt servanda im Verwaltungsvertrag, Frankfurt am Main 1999. Wieacker, Franz: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, 2. Aufl., Göttingen 1967. Wilhelm, Walter: Zur juristischen Methodenlehre im 19. Jahrhundert. Die Herkunft der Methode Paul Labands aus der Privatrechtswissenschaft, Frankfurt a. M. 1958. Wolf, Erik: Große Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, 2. Aufl., Tübingen 1944. Wolff, Hans Julius: Typen im Recht und in der Rechtswissenschaft, in: Studium Generale 5 (1952), S. 195 ff. Zuleeg, Manfred: Die Anwendungsbereiche des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, in: VerwArch 73 (1982), S. 384 ff.
Sachwort- und Namenregister Beamtenanstellung 22 Befehl 31, 107 Begriffsjurisprudenz 70 Fn. 38, 76, 86 Fn. 128 Beleihung 22 f. Bundesstaat siehe Staat Deduktion 74, 76 Dogmatik 14, 66, 72, 85, 87 f., 113 Eingemeindung 23 Einwilligung 20, 122 Engels, Friedrich 79 Fn. 87 Etatismus 116 Fallersleben, Hoffmann von 79 Fn. 87 Fichte, Johann Gottlieb 59 f., 84 Fn. 122, 109 Fiskus 40 Fn. 50, 108, 110 Fiskustheorie 34 ff. Französisches Verwaltungsrecht 44 ff. Gemeinwesen 62 Genealogie der Begriffe 71, 75 Fn. 62 Gerber, Carl Friedrich von 60, 68, 70, 73, 75, 76 Fn. 64, 77, 79, 80 Fn. 93, 86 Fn. 128 Gerlach, Ernst Ludwig von 78 Gewaltenteilung 36, 52 f. Gewaltverhältnis 18 Gierke, Otto von 74 Fn. 59, 87 Grundrechte 18 f., 121 f. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 60 f., 62, 84 Fn. 122, 96 ff., 109 Hermeneutik 82 Fn. 10
Herrschaftsakt siehe Befehl Historische Rechtsschule 67 Idealistische Philosophie 84 Imperium siehe Befehl Jhering, Rudolf von 65, 68, 71, 76 f., 78, 83 f., 85 Juristische Methode 65 ff. Juristische Person siehe Staat Justiz 38 Kirchmann, Julius Hermann von 81 Kommunismus 79 Fn. 87 Konstruktion des Rechts 71 f., 74, 92, 98 Laband, Paul 30 f., 34, 68, 72, 76, 80 Fn. 95, 87 f., 99, 106 ff. Lambert, Johann Heinrich 69 Fn. 28 Loening, Edgar 87, 91 Fn. 159 Nation 61 Naturrecht 28, 49, 82, 85 Naturwissenschaften 80, 82 Oberstaat 54 Obrigkeitsstaat 115 ff. Organ 56 Polizeistaat 34 f., 37, 41, 166 Positivismus 86 Fn. 128, 101 Fn. 227 Privatautonomie 122 f. Produktivität der Rechtswissenschaft 74 ff. Puchta, Georg Friedrich 67, 70, 71, 74, 77, 78, 86, 94
Sachwort- und Namenregister Rationalismus 86 f. Recht – Abgrenzung des öffentlichen vom privaten 26 ff., 32 f., 38 – als System 66 ff. – Begriff des 48 f. – Konstruktion siehe dort – öffentliches 16 f., 27 – privates 32 f. – subjektives 32 f. Rechtsbegriffe 94 f. Rechtsgeschäft 122 Rechtsinstitut 92 f. Rechtsstaat 34, 37 ff. Rechtswirklichkeit 99 ff. Rupp, Hans Heinrich 117 Savigny, Friedrich Carl von 67, 70 Schelling, Friedrich Wilhelm 84 Fn. 122 Selbstverwaltung 24 f. Sohm, Rudolph 73, 76, 78, 85 Souveränität 17, 51 Staat – als Anstalt 58 f. – als Bundesstaat 51 ff. – als juristische Person 55 ff., 116 ff. – als Rechtssubjekt siehe Staat als juristische Person – als Volk 57 f. – Konstituierung durch das Recht 120 f. – Selbstbindung des 36, 118 f. – Zweck des 59 ff. Staatswissenschaftliche Methode 90 mit Fn. 153
145
Stahl, Friedrich Julius 41 Steuerpflicht 23 Subjektion siehe Gewaltverhältnis System – Begriff des 69 ff. – Erkenntnis aus dem 66 ff. Theoriebegriff Otto Mayers 98 Untertan 18 Urteil und Verwaltungsakt 38 Verfassung 18, 50 Verfassungsstaat 19, 34, 36 f. Vertrag – Begriff des 16, 20, 114 f., 122 f. – als Rechtsgeschäft 122 – als zivilrechtliches Rechtsinstitut 33 Verwaltungsakt – Begriff des 21, 38 – auf Unterwerfung 21 Verwaltungslehre 90 Völkerrecht 24 Vorbehalt des Gesetzes 11, 18, 20, 122 Vorrang des Gesetzes 11 Weimarer Republik 54 Fn. 49 Willenserklärung 20, 114 f., 122 f. Windscheid, Bernhard 72, 82 Zivilistische Methode siehe juristische Methode Zuständigkeitsverteilung und Gewaltentrennung 53



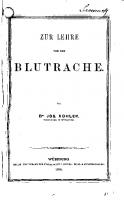

![Der gemischte Vertrag im Recht der Außenbeziehungen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft [1 ed.]
9783428461370, 9783428061372](https://dokumen.pub/img/200x200/der-gemischte-vertrag-im-recht-der-auenbeziehungen-der-europischen-wirtschaftsgemeinschaft-1nbsped-9783428461370-9783428061372.jpg)



![Otto der Schütz in der Literatur [Reprint 2019 ed.]
9783111492728, 9783111126364](https://dokumen.pub/img/200x200/otto-der-schtz-in-der-literatur-reprint-2019nbsped-9783111492728-9783111126364.jpg)
![Der Vertrag in der Lehre Otto Mayers [1 ed.]
9783428512348, 9783428112340](https://dokumen.pub/img/200x200/der-vertrag-in-der-lehre-otto-mayers-1nbsped-9783428512348-9783428112340.jpg)