Der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung: Eine verfassungs- und sozialrechtliche Untersuchung [1 ed.] 9783428524068, 9783428124060
Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ist selber Patient: Auf dem Operationstisch des Gesetzgebers wurden seit 1977
151 44 744KB
German Pages 192 Year 2007
Polecaj historie
Citation preview
Schriften zum Gesundheitsrecht Band 7
Der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Eine verfassungs- und sozialrechtliche Untersuchung
Von Nils Schaks
asdfghjk Duncker & Humblot · Berlin
NILS SCHAKS
Der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung
Schriften zum Gesundheitsrecht Band 7 Herausgegeben von Professor Dr. Helge Sodan, Freie Universität Berlin, Präsident des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin, Direktor des Deutschen Instituts für Gesundheitsrecht (DIGR)
Der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Eine verfassungs- und sozialrechtliche Untersuchung
Von Nils Schaks
asdfghjk Duncker & Humblot · Berlin
Der Fachbereich Rechtswisssenschaft der Freien Universität Berlin hat diese Arbeit im Jahre 2006 als Dissertation angenommen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, für sämtliche Beiträge vorbehalten # 2007 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme und Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Germany ISSN 1614-1385 ISBN 978-3-428-12406-0 Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier ∞ entsprechend ISO 9706 *
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Vorwort Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2006 / 2007 von dem Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur wurden bis Ende Oktober 2006 eingearbeitet. Die im Rahmen der „Föderalismusreform“ ergangenen Änderungen des Grundgesetzes vom 28. 08. 2006 hatten auf die vorliegende Arbeit keine Auswirkungen, so dass die zitierten Artikel sowohl die der alten als auch der neuen Fassung sind. Das Gesetz zur Änderung des Vertragsarztrechts und anderer Gesetze (Vertragsarztrechtsänderungsgesetz – VÄndG) konnte noch berücksichtigt werden. Für die Entstehung dieser Arbeit bin ich verschiedenen Personen zu Dank verpflichtet. In erster Linie meinem Doktorvater, Herrn Universitätsprofessor Dr. Helge Sodan, dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin und Direktor des Deutschen Instituts für Gesundheitsrecht (DIGR). Er hat mich bereits während meines Studiums gefördert; anlässlich der von ihm ausgerichteten Berliner Gespräche zum Gesundheitsrecht habe ich „mein Thema“ gefunden. Die Betreuung der Arbeit war stets hervorragend. Ich danke herzlich für die Unterstützung mit Rat und Tat, dass die Arbeit so schnell entstehen und in der Reihe „Schriften zum Gesundheitsrecht“ erscheinen konnte. Herrn Professor Dr. Herbert Bültmann, Präsident des Finanzgerichts a.D., danke ich für die Mühen der Zweitbegutachtung und die rasche Erstellung des Gutachtens. Des Weiteren danke ich sehr der Pfizer Deutschland GmbH, insbesondere Herrn Michael Klein, LL.M., Vice President External Affairs & Recht, für das großzügige Promotionsstipendium sowie die finanzielle Unterstützung bei der Drucklegung. Schließlich danke ich meiner Familie und meinen Freunden, insbesondere meinen Eltern und meiner Schwester, sowie den Herren Sebastian Peyer, Marcel Scharner und Sebastian Weber. Berlin, im November 2006
Nils Schaks
Inhaltsverzeichnis Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Erstes Kapitel Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung
21
A. Inhaltsbestimmung des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
I. Der Wortlaut der Formulierung „Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
1. Nachzeichnung des Wortlautwandels der Formulierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
2. Inhaltsgleichheit der Formulierung trotz Wortlautwandels . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
3. Wortlautauslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
a) Die einzelnen Wortlautelemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
b) Einbeziehung anderer Formulierungen des Bundesverfassungsgerichts
27
4. Ergebnis zu I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
II. Inhaltliche Konkretisierungen der Formulierung durch das Bundesverfassungsgericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
1. Überblick über die zu analysierenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
3. Finanzielle Stabilität und Gesundheitsschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
a) Wortlaut: Die finanzielle Stabilität als aliud zum Gesundheitsschutz . . .
35
b) Telos: Unterschiedliche Schutzzwecke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
4. Finanzielles Verständnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
a) Prima facie: Ein finanzieller Belang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
b) Argumente gegen ein finanzielles Verständnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
c) Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
5. Ergebnis zu II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
8
Inhaltsverzeichnis III. Die Heranziehung von Gesetzesbegründungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
1. BT-Drucks. 9 / 811 (Anl. 2, S. 12 f.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
2. BT-Drucks. 9 / 845 (S. 1, 11, 15 f., 17, 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
3. BT-Drucks. 9 / 1300 (S. 2 f., 3 ff., 9, 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
4. BT-Drucks. 11 / 2237 (S. 151, 195) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
5. BT-Drucks. 11 / 3480 (S. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
6. BT-Drucks. 11 / 6380 (S. 246, 264) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
7. BT-Drucks. 11 / 7760 (S. 372) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
8. BT-Drucks. 12 / 3209 (S. 60, 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
9. BT-Drucks. 12 / 3608 (S. 66 ff., 73, 74 f., 81, 83, 88, 93, 97, 98, 156) . . . . .
46
10. BT-Drucks. 13 / 4615 (S. 6, 8, 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
11. BT-Drucks. 15 / 28 (S. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
12. BT-Drucks. 15 / 75 (S. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
13. Ergebnis zu III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
IV. Die Heranziehung gesetzlicher Bestimmungen mit Bezug zur finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
V. Literaturstimmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
1. Die Ansicht von Renate Jaeger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
a) Darstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
b) Kritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
2. Die Ansicht von Stephan Rixen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
a) Darstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
b) Kritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
3. Die Ansicht von Walter Leisner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
a) Darstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
b) Kritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
4. Die Ansicht von Ulrich Freudenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
a) Darstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
b) Kritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
5. Die Ansicht von Martin Stockhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
a) Darstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
b) Kritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
6. Zusammenfassung zu V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Inhaltsverzeichnis
9
VI. Die Urteile des Bundessozialgerichts vom 08. und 09. 12. 2004 . . . . . . . . . . . . . .
59
VII. Teleologische Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
VIII. Ergebnis zu A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
B. Ergebnis zum Ersten Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Zweites Kapitel Die These vom Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung
62
A. Die Ansicht des Bundesverfassungsgerichts im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
I. Verfassungsrang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
II. Verfassungsrang als institutionelle Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
B. Gemeinwohlbelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
I. Was ist ein Gemeinwohlbelang? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
II. Arten von Gemeinwohlbelangen und ihre Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
1. Absolute und relative Gemeinwohlbelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
2. Gestufte Gemeinwohlbelange aufgrund der Drei-Stufen-Theorie . . . . . . . . . .
67
a) Die Drei-Stufen-Theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
b) Der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung im Lichte der Drei-Stufen-Theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
3. Fiskalische und finanzielle Belange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
III. Ergebnis zu B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
I. Das Sozial(staats)prinzip, Art. 20 Abs. 1, Art. 23 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG . .
73
1. Das Sozial(staats)prinzip allgemein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
2. Der Inhalt des Sozial(staats)prinzips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
3. Fallgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
a) 1. Fallgruppe: „Sicherheit gegen die Wechselfälle des Lebens“ . . . . . . . . . aa) Keine Garantie des Systems, sondern Erforderlichkeit eines Schutzsystems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb) Gewährleistung eines Minimalschutzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 76 79
10
Inhaltsverzeichnis b) 2. Fallgruppe: „Herstellung einer gerechten Sozialordnung“ . . . . . . . . . . . .
80
aa) Schutzbedürftigkeit als Kriterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
bb) Leistungsfähigkeit als Kriterium? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
cc) Keine Gleichrangigkeit von Schutzbedürftigkeit und Leistungsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
c) Ergebnis zu 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
4. Grenzen und Begrenzungen des Sozial(staats)prinzips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
5. Ergebnis zu I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
II. Das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
1. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG unter dem Aspekt des Abwehrrechts . . . . . . . . . . . . . .
87
2. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG unter dem Aspekt der Schutzpflicht . . . . . . . . . . . . . .
88
a) Dogmatische Herleitung: Umfang und Reichweite der Schutzpflicht . . .
89
b) Bestehen einer Schutzpflicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
c) Wann liegt allgemein eine Schutzpflichtverletzung vor? . . . . . . . . . . . . . . . .
93
aa) Voraussetzungen der Schutzpflichtverletzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
bb) Überprüfbarkeit der Schutzpflicht durch das Bundesverfassungsgericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
d) Keine Verletzung der Schutzpflicht im Falle der Nichteinführung der gesetzlichen Krankenversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
3. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG unter dem Aspekt des Leistungsrechts . . . . . . . . . . . .
99
4. Fehlender Gesundheitsbezug des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 5. Ergebnis zu II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 III. Die Menschenwürde, Art. 1 Abs. 1 GG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 IV. Kompetenzbestimmungen des Grundgesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1. Der materiell-rechtliche Gehalt von Kompetenzbestimmungen . . . . . . . . . . . . 103 2. Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 3. Art. 87 Abs. 2 GG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 4. Art. 120 Abs. 1 Satz 4 GG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 5. Ergebnis zu IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 V. Art. 109 Abs. 2 GG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 VI. Art. 33 Abs. 2, 5 GG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 VII. Art. 33 Abs. 2 EV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Inhaltsverzeichnis
11
VIII. Ungeschriebenes Verfassungsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 IX. Verfassungsrang durch Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts? . . . . . . . . 116 X. Kontrollüberlegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 1. Die sonstige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur gesetzlichen Krankenversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 2. Keine Einrichtungsgarantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 XI. Der Vorwurf des Sonderrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 D. Ergebnis zum Zweiten Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Drittes Kapitel Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
122
A. Die traditionelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Kontrolldichte 122 B. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Kontrolldichte bei sozialpolitischer Gesetzgebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 C. Kritik und eigener Vorschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 I. Kritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 1. Mangelnde Konsequenz in der Anwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 2. Unklarheit über die angewandten Kriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 3. Unvereinbarkeit mit der These vom Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 4. Unvereinbarkeit mit der Drei-Stufen-Theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5. Sonderproblem: Einstweilige Anordnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 6. Fixierung auf das Verhältnis Bundesverfassungsgericht – Gesetzgeber . . . 131 7. Keine Berücksichtigung kumulierender Grundrechtseingriffe . . . . . . . . . . . . 132 8. Keine Berücksichtigung gewonnener Erkenntnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 9. Der Begriff „Offensichtliche Fehlsamkeit“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 10. Ergebnis zu I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 II. Eigener Vorschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 1. Begriffsbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 2. Die unterschiedlichen Kontrolldichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 3. Die Kriterien für die unterschiedlichen Kontrolldichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
12
Inhaltsverzeichnis 4. Auswirkungen der Kontrolldichte auf die Verhältnismäßigkeitsprüfung . . . . 144 a) Die einzelnen Elemente der Verhältnismäßigkeitsprüfung . . . . . . . . . . . . . . aa) Legitimer Zweck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb) Legitimes Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cc) Geeignetheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dd) Erforderlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ee) Angemessenheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144 145 146 146 147 147
b) Die Auswirkung des Kontrollmaßstabs auf die Verhältnismäßigkeitsprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aa) Berufsausübungsregelungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb) Subjektive Berufswahlregelungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cc) Objektive Berufswahlregelungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148 148 149 150
5. Anwendung dieser Grundsätze auf die Entscheidungen zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung . . . . . . . . . . . . . . 151 a) Der Beschluss zur Altersgrenze von 68 Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aa) Die gesetzliche Regelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb) Die Ansicht des Bundesverfassungsgerichts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cc) Eigene Ansicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151 151 151 152
b) Der Beschluss zur Altersgrenze von 55 Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aa) Die gesetzliche Regelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb) Die Ansicht des Bundesverfassungsgerichts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cc) Eigene Ansicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153 153 153 154
c) Die Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aa) Die gesetzliche Ausgangslage und die Veränderungen durch das BSSichG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb) Die Ansicht des Bundesverfassungsgerichts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cc) Eigene Ansicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155 155 155 156
d) Entscheidungen, in denen Kostenregelungen gerechtfertigt wurden . . . . 160 aa) Gemeinsamkeiten der Entscheidungen: unmittelbare Kostenregelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 bb) Widersprüchlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 D. Ergebnis zum Dritten Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Viertes Kapitel Schlussbetrachtung
162
Zusammenfassung in Leitsätzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Sachregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Einleitung Ridgeon: „You must take my word for it that it is so. My laboratory, my staff, and myself are working at full pressure. We are doing our utmost. The treatment is a new one. It takes time, means, and skill; and there is not enough for another case. Our ten cases are already chosen cases. Do you understand what I mean by chosen cases?“ George Bernard Shaw1
Vor Verteilungs- und Kapazitätsproblemen stehen Politik und Medizin – ebenso wie der Arzt Ridgeon in Shaws Drama – auch heute. Wem soll geholfen werden? Wem kann geholfen werden? Welche Methoden und Therapieformen können angewendet werden? Worauf soll der Patient einen Anspruch haben? Wie soll dieser Anspruch eingelöst werden? Während der Arzt in Shaws Drama sich zwischen der Hilfe für ihm konkret bekannte Menschen entscheiden musste, hat das Problem der heutigen Gesetzgebung weitaus größere Ausmaße angenommen: Bei einem Versicherungsgrad von rund 90 %2 ist fast die Gesamtheit der Bevölkerung in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen. Die Ausgestaltung der gesetzlichen Krankenversicherung ist somit ein Thema von erheblicher politischer Brisanz. Dies zeigen nicht zuletzt der Streit über die „Bürger(zwangs)versicherung“3 und die „Gesundheitsprämie“ sowie die Proteste gegen den Gesundheitsfonds. Seit Beginn der gesetzlichen Krankenversicherung im Deutschen Kaiserreich 18834 hat sich der Kreis der versicherten Personen ständig erweitert: Bei Einfüh1 George Bernard Shaw, The Doctor’s Dilemma, Act I, in: The Doctor’s Dilemma, Getting Married, & The Shewing-Up of Blanco Posnet, London, Standard Edition 1932, S. 109. 2 Siehe zu diesen Angaben die vom Bundesministerium für Gesundheit veröffentlichten Monatsstatistiken der gesetzlichen Krankenversicherung über Mitglieder, mitversicherte Angehörige, Beitragssätze und Krankenstand. Abrufbar im Internet URL: http: // pdf.bmgs.comspace.de / bmgs / temp / 2ctemplateId3draw2cproperty3dpublicationFile2epdf2fkm12djuli2d september2d062epdf / index / start.htm (Datum des Dokuments: 10. Oktober 2006, abgerufen am 15. 10. 2006). Legt man eine Gesamtbevölkerung von 82.438.000 Menschen zu Grunde (vgl. die Angaben des Statistischen Bundesamts, abrufbar im Internet unter URL: http: // www.destatis.de / basis / d / bevoe / bevoetab4.php [abgerufen am: 15. 10. 2006]) ergibt sich ein Einbeziehungsgrad von gut 85 %. 3 Siehe hierzu Josef Isensee, NZS 2004, S. 393 ff.; Ferdinand Kirchhof, NZS 2004, S. 1 ff; Walter Leisner, Marktwirtschaft S. 35 (47 ff.); Stefan Muckel, SGb 2004, S. 583 ff., S. 670 ff.; Helge Sodan, ZRP 2004, S. 217 ff; ders., Modelle künftiger Gestaltung, S. 9 (10 ff.). 4 Gesetz betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. 06. 1883 – RGBl., S. 73, sowie Erste Kaiserliche Botschaft zur sozialen Frage, abgedruckt bei Michael Stolleis,
14
Einleitung
rung der gesetzlichen Krankenversicherung 1883 waren nur 14,4 % der Bevölkerung gesetzlich krankenversichert, im Jahre 1958 hingegen bereits etwa 53,1 %5. Derzeit sind rund 90 % der Bevölkerung gesetzlich krankenversichert6. Von der ursprünglichen Grundidee der sich selbst versichernden Arbeiterschaft hat man sich im Laufe der Zeit immer weiter entfernt7. Denn schon längst ist nicht mehr ein nur kleiner Teil von sozial Schutzbedürftigen in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen. Die Anhebung der Versicherungspflichtgrenze auf 45.900 bzw. 41.400 A für das Jahr 2003 und 45.594,05 bzw. 41.034,64 A für das Jahr 2004 (vgl. Art. 1 Nr. 1 lit. a) und c) Beitragssatzsicherungsgesetz – BSSichG) belegt dies8. Spätestens zu Beginn der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden die ersten Verwerfungen im System9 der gesetzlichen Krankenversicherung sichtbar10. Um das bestehende System funktionsfähig zu erhalten, wurden in immer kürzeren Abständen neue Reformgesetze erlassen. Allein seit 1977 hat die Gesetzgebung die gesetzliche Krankenversicherung durch über 50 größere Gesetze mit mehr als 7.000 Einzelbestimmungen zu reformieren versucht11. Doch keine der Reformen konnte die Probleme dauerhaft lösen. Stets wurde nach einer Gesetzesänderung der Ruf nach neuen Reformen laut12. „Nach der Reform ist vor der Reform!“13 konnte als Motto ausgemacht werden, denn der gesetzgeberische Aktionismus zeitigte nicht die erhoffte dauerhafte Wirkung14. Gefangen zwischen steigenden Kosten und sinkenden Einnahmen15, wurde es immer schwieriger, mit den zur Verfügung stehenQuellen, S. 105 f. Vgl. zur Geschichte der gesetzlichen Krankenversicherung Eberhard Eichenhofer, Sozialrecht, Rn. 32 ff.; Rolf-Ulrich Schlenker, HdBSozVersR I, § 1 Rn. 10 ff. 5 BVerfGE 11, 30 (43). 6 Siehe Einleitung, Fn. 2. 7 Siehe hierzu und zur Entwicklung des pflichtversicherten Personenkreises Helge Sodan, VVDStRL 64 (2005), S. 144 (147 ff.). 8 Siehe hierzu auch BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 479 ff. Für das Jahr 2007 soll die Grenze bei 47.700 A liegen. 9 Darauf, dass von einem geschlossenen, in sich stimmigen Regelungssystem immer weniger die Rede sein kann, weist Helge Sodan, GesR 2004, S. 305 (306) hin, der von „Chaotisierung“ spricht. So auch Raimund Wimmer, NJW 1995, S. 1577 (1578). 10 Siehe nur Josef Isensee, FS-Broermann, S. 365 f.; Franz Ruland, DRV 1985, S. 13; Otfried Seewald, Verfassungsrecht auf Gesundheit, S. 2 ff. 11 Vgl. dazu auf dem Stand von 1996 die Begründung der Fraktionen der CDU / CSU und FDP zu ihrem Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Strukturreform in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 30. 01. 1996, BT-Drucks. 13 / 3608, S. 13. Zehn Jahre später ist die Gesetzesflut noch größer. Die neuesten Gesetzesvorhaben sind das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) vom 22. 12. 2006 – BGBl. I, S. 3439 ff. sowie das GKVWettbewerbstärkungsgesetz – GKV-WSG. 12 Till-Christian Hiddemann / Stefan Muckel, NJW 2004, S. 7 (13); Helge Sodan, GesR 2004, S. 305. 13 Rainald Maaß, NJW 2005, S. 9. 14 Helge Sodan, VVDStRL 64 (2005), S. 144 (164 f.). 15 Im Einzelnen ist umstritten, welche Ursachen der Ausgabenanstieg hat. Genannt werden u. a. ältere Patientenschaft, technologischer Fortschritt, Anspruchsmentalität. Vgl. hierzu
Einleitung
15
den Mitteln die Ansprüche der am System der gesetzlichen Krankenversicherung beteiligten Personen zu erfüllen. Der Gesetzgeber konnte sich bisher nicht zu einem grundlegenden Systemwechsel im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung durchringen. Statt dessen reagierte er mit Zulassungsbeschränkungen bei Leistungserbringern16, Höchstpreisen für Arzneimittel, Leistungskürzungen, Selbstbeteiligungen, Budgetierungen, Altersgrenzen etc.17, um die gesetzliche Krankenversicherung in ihrer überkommenen Form zu erhalten. Betroffen waren alle am System Beteiligten wie Versicherte18, Ärzte19, Zahnärzte20 und Apotheker21, zahntechnische Labore22, pharmazeutische Unternehmen23 und Pharmagroßhändler24, aber auch die außerhalb des Systems stehenden privaten Krankenversicherungen25. Oftmals sahen die dergestalt Betroffenen in den sie berührenden Maßnahmen Grundrechtsverletzungen und traten den Gang nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht an. Seit 1984 hatte das Bundesverfassungsgericht deshalb häufig über die Verfassungsmäßigkeit von Regelungen der gesetzlichen Krankenversicherung zu entscheiden. Dabei bildete sich ein zentrales Argumentationsmuster heraus: Die finanzielle Stabilität und damit die Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung26 seien Gemeinwohlinteressen von so hohem Gewicht, dass sie auch erhebliche Grundrechtseingriffe rechtfertigen könnten27. In fast 30 EntscheiUlrich Freudenberg, Beitragssatzstabilität, S. 20 ff.; Timo Hebeler, Jura 2005, S. 17 (19 f.); Renate Jaeger, System, S. 15 (17 f.). Welche Gründe nun wirklich ausschlaggebend für das Defizit sind, kann im Rahmen der vorliegenden Untersuchung dahinstehen, denn dass ein Defizit besteht, ist unbestritten. Thema dieser Arbeit ist die Haltung des Bundesverfassungsgerichts u. a. gegenüber gesetzgeberischen Maßnahmen, die das Defizit beheben sollen. 16 Zu den Leistungserbringern gehören v. a. die Vertrags(zahn)ärzte (§§ 95 ff. SGB V), Krankenhausbetreiber (§§ 107 ff. SGB V), Gesundheitshandwerker (§§ 124 ff. SGB V), Apotheker und Pharmaindustrie (§§ 129 ff. SGB V). Das Sozialversicherungsrecht verwendet diesen Begriff durchgehend, soweit es nicht auf einzelne Gruppen von Leistungserbringern, wie z. B. nur auf die Vertragsärzte abstellt, vgl. Winfried Kluth, MedR 2005, S. 65 (66 mit Fn. 22). Ausführlich Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 279 ff. 17 Eine Auflistung der Maßnahmen findet sich in BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2005, S. 273 (274, 275). Vgl. auch Winfried Kluth, MedR 2005, S. 65 (68 f.). 18 Vgl. BVerfGE 103, 392 ff. 19 Vgl. nur BVerfGE 103, 172 ff. 20 Siehe BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 3413. 21 Z. B. BVerfGE 106, 359 ff. 22 Dazu BVerfGE 106, 351 ff. 23 Siehe BVerfGE 108, 45 ff. 24 Vgl. BVerfGE 106, 369 ff. 25 Dazu BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 479 ff. 26 In anderen Zweigen der Sozialversicherung lassen sich Parallelen finden, so z. B. aus jüngster Zeit bezüglich der landwirtschaftlichen Alterskassen – BVerfGE 109, 96 (111 f.), zur Arbeitslosenversicherung – BVerfGE 77, 84 (107).
16
Einleitung
dungen wurde diese Argumentation zum Dreh- und Angelpunkt in der verfassungsrechtlichen Beurteilung von Maßnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung28. So passierten unter anderem die Regelungen zum Zulassungsende ab dem 68. Lebensjahr in der vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung29, zum Verbot der erstmaligen Zulassung als Vertrags(zahn)arzt nach Vollendung des 55. Lebensjahres30, zu Zulassungsbeschränkungen bei Überversorgung31 oder zur Anhebung der Versicherungspflichtgrenze32 unbeanstandet das Bundesverfassungsgericht. Teile in der Literatur folgen dem Bundesverfassungsgericht und befürworten die Rechtsprechung zu diesem Grundsatz33. Andere Stimmen34 vermissen eine nähere Auseinandersetzung des Bundesverfassungsgerichts mit dem (von diesem selbst) aufgestellten Grundsatz der finanziellen Stabilität und der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber nicht nur das Bundesverfassungsgericht begründet seine Rechtsprechung nicht weiter, auch die Literatur behandelte dieses Thema bislang eher stiefmütterlich 35, obwohl vor allem in jüngster Zeit vermehrt auf die Bedeutung des Grundsatzes der finanziellen Stabilität und der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung für die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hingewiesen wird36. Das geringe Interesse des Schrifttums steht in einem bemerkenswerten Gegensatz zur erheblichen Bedeutung des Grundsatzes der finanziellen Stabilität für die gesamte gesetzliche Krankenversicherung: Während der Grundsatz der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung zunächst nur zur Rechtfertigung von Berufsausübungsregelungen im Sinne der Drei-Stufen-Theorie37 herangezogen 27 Vgl. nur BVerfGE 68, 193 (218); 70, 1 (25); BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1998, 1776 (1777). 28 Helge Sodan, GesR 2004, S. 305 (306). 29 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1998, S. 1776 ff. Dazu Helge Sodan, NJW 2003, S. 257 (258). Siehe auch die Änderung durch Art. 1 Nr. 5 e) bb) VÄndG vom 22. 12. 2006 – BGBl. I, S. 3439 (3441), welcher die Altersgrenze in unterversorgten Gebieten aufhebt. 30 BVerfGE 103, 172 ff. Dazu Thomas Muschallik, MedR 1997, S. 109 ff. Siehe auch die Änderung durch Art. 1 Nr. 6 d) VÄndG vom 22. 12. 2006, der diese Grenze aufhebt. 31 BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 2002, S. 400 ff. 32 BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 479 ff. 33 So zum Beispiel Guy Beaucamp, JA 2003, S. 51 (52, 53); Timo Hebeler, Jura 2005, S. 17 (22); Renate Jaeger, NZS 2003, S. 225 (232); Friedrich E. Schnapp / Markus Kaltenborn, Friedensgrenze, S. 51; Rolf Stober, MedR 1990, S. 10 (10, 13); Georg Wannagat, MedR 1986, S. 1 (2). Vgl. auch BayVerfGH, BayVBl. 1990, 749 (750); BayVBl. 2002, S. 79; BayVBl. 2004, S. 367 (368). 34 Z. B. Dagmar Felix, NZS 2004, S. 587; Josef Isensee, NZS 2004, S. 393 (394, 395); Helge Sodan, Finanzielle Stabilität, S. 9 (11); ders., GesR 2004, S. 305 (306). 35 Ausnahmen insoweit Walter Leisner, Finanzielle Stabilität, S. 15 (18 ff.); Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 223 ff., 295 ff.; Helge Sodan, GesR 2004, S. 305 (306). 36 Dagmar Felix, NZS 2004, S. 587; Jürgen W. Hidien, DVBl. 2002, S. 402 (403); Helge Sodan, GesR 2004, S. 305 (306); ders., Finanzielle Stabilität, S. 9 (11). 37 Siehe Zweites Kapitel B. II. 2. a).
Einleitung
17
wurde38, wird ihm inzwischen hinreichende rechtfertigende Kraft auch im Hinblick auf objektive Berufszulassungsregelungen, also den schärfsten Eingriffen in die Berufsfreiheit, zugesprochen39. Mittlerweile wurde der Grundsatz sogar zur Begründung der Erforderlichkeit einer bundeseinheitlichen Regelung im Sinne des Art. 72 Abs. 2 GG herangezogen40. Zu Beginn der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zu dem Grundsatz der finanziellen Stabilität wurde er als Gemeinwohlbelang bezeichnet, jedoch bereits mit dem Hinweis, dass der Gesetzgeber sich diesem Belang nicht entziehen dürfte41. Später stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass dieser Gemeinwohlbelang hohe42 oder große43 Bedeutung habe. Sprachlich anders gefasst war die Formulierung des Bundesverfassungsgerichts in dem Beschluss zu §§ 1 f. Zuzahlungs-VO44. Dort hieß es, dass es sich bei der finanziellen Stabilität „um ein von hoher Bedeutung für die Allgemeinheit getragenes Regelungsziel“ handele. Dann wurde die finanzielle Stabilität als ein besonders wichtiges Gemeinschaftsgut bezeichnet45. Es folgte die Einstufung des Grundsatzes der finanziellen Stabilität als Gemeinwohlgrund von überragender Bedeutung und hinreichendem Gewicht46 oder als überragend wichtiger Gemeinwohlbelang47 beziehungsweise überragend wichtiges Gemeinschaftsgut48. Schließlich hieß es, es handele sich um einen „wichtigen Gemeinwohlbelang“49. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erschöpft sich aber nicht darin, die hohe Bedeutung des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung hervorzuheben. Das Gericht führt außerdem in ständiger Rechtsprechung aus, dass sich der einfache Gesetzgeber einerseits diesem Grundsatz nicht entziehen dürfe50 und dass jenem andererseits ein weiter Spielraum beim Erlass von Reformgesetzen zustehe51. Die bundesverfassungsgericht-
BVerfGE 68, 193 (218, 219). BVerfGE 103, 172 (184); BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 2002, S. 400 (401). 40 BVerfGE 113, 167 (198 f.). 41 BVerfGE 68, 193 (218). 42 BVerfGE 70, 1 (29); BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1999, S. 2730 (2731); NJW 2000, S. 1781; NJW 2001, S. 883 (884); BVerfGE 103, 172 (184). 43 BVerfGE 82, 209 (230). 44 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1994, S. 3007 45 BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 2002, S. 400 (401). 46 BVerfGE 103, 172 (184); BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 2002, S. 400 (401). 47 BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 479 (481). 48 BVerfG, NVwZ 2006, S. 191 (199). 49 BVerfGE 113, 167 (233). 50 BVerfGE 68, 193 (218); BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 1991, S. 205; NJW 1992, S. 735 (736); Meso B 10 / 493, S. 296 (298); NJW 2000, S. 1781; NJW 2000, S. 3413. Dem folgend BayVerfGH, BayVBl. 1990, 749 (750); BayVBl. 2002, S. 79; BayVBl. 2004, S. 367 (368). 38 39
2 Schaks
18
Einleitung
liche Kontrolle bleibt deshalb gering52. Dies bestätigt ein Blick auf den Ausgang der Verfahren, in denen der Grundsatz der finanziellen Stabilität und der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung herangezogen wurde. Hier ergibt sich ein einheitliches Bild: Immer wenn dieser Grundsatz herangezogen wurde, blieben die angestrengten Verfahren erfolglos. Es bestehen nur drei scheinbare Ausnahmefälle53. In der ersten dieser drei Entscheidungen war die Verfassungsbeschwerde erfolgreich. Dies lag jedoch nicht an der Verfassungswidrigkeit des in Rede stehenden Gesetzes, sondern an dessen zu strenger Auslegung durch das Bundesverwaltungsgericht. Die gesetzlichen Bestimmungen selbst wurden ausdrücklich als verfassungsgemäß und durch den Grundsatz der finanziellen Stabilität gerechtfertigt angesehen54. Nicht der Rechtsetzungsakt, sondern der Rechtsprechungsakt war verfassungswidrig. In einem Kammerbeschluss vom 01. 09. 199955 sah das Bundesverfassungsgericht zwar eine Verletzung von Art. 12 Abs. 1 GG als gegeben an. Dennoch wurde die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Die Kammer argumentierte, dass die angegriffenen Vorschriften bereits außer Kraft getreten seien und dass die Rückabwicklung von Rechtsverhältnissen, die fünf bis sechs Jahre in der Vergangenheit lägen, nicht oder nur schwer möglich sei. Deshalb sei die Annahme der Verfassungsbeschwerde nicht zur Durchsetzung der in § 90 Abs. 1 BVerfGG genannten Rechte angezeigt56. Im letzten der drei Beschlüsse verwarf das Bundesverfassungsgericht die Auslegung von § 116 SGB V und § 31 Ärzte-ZV durch das Bundessozialgericht. Diese Bestimmungen ermöglichen, dass Krankenhausärzte mit abgeschlossener Weiterbildung vom Zulassungsausschuss zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung ermächtigt werden. Die Ermächtigung ist eine gegenüber der Zulassung nachrangige Form der Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung57. § 116 Satz 2 SGB V bestimmt, dass die Ermächtigung nur zu erteilen ist, soweit und solange eine ausreichende ärztliche Versorgung der Versicherten ohne die besonderen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse der Krankenhausärzte nicht sichergestellt ist. Das Bundessozialgericht hatte entschieden, dass niedergelassene Vertragsärzte nicht klagebefugt seien und deshalb die einem Dritten erteilte Ermächtigung nicht anfechten könnten. Diese Auslegung von § 116 SGB V und § 31 Ärzte-ZV hat das Bundesverfassungsgericht verworfen. Die 51 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1992, S. 735 (736); NJW 1994, S. 3006; NJW 2000, S. 1781. 52 Jürgen W. Hidien, DVBl. 2002, S. 402 (403) spricht schärfer von „Entmaterialisierung“ des Grundrechts der Berufsfreiheit; Eberhard Schmidt-Aßmann, Grundrechtspositionen, S. 35, 41, 45 f. 53 BVerfGE 82, 209 ff.; BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 1781 f. und NJW 2005, S. 273 ff. 54 BVerfGE 82, 209 (228 ff.). 55 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 1781 f. 56 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 1781 (1782). 57 Matthias Schnath, HdBVertragsarztR, § 5 B Rn. 24 ff.
Einleitung
19
genannten Vorschriften müssten so ausgelegt werden, dass Vertragsärzte als Drittbetroffene gegen die durch die Zulassungsausschüsse erteilten Ermächtigungen Rechtsschutz in Anspruch nehmen könnten. Dies wird mit den zahlreichen bereits bestehenden gesetzlichen Beschränkungen der Berufsfreiheit von Vertragsärzten begründet: Da die Vertragsärzte restriktiven Vergütungs-, Zulassungs- und Niederlassungsregelungen unterworfen seien, müsse überprüft werden können, ob die den zugelassenen Ärzten entstehenden Konkurrenten zu Recht ermächtigt würden. Versetzt man sich in die Lage der Ärzte, die eine Ermächtigung anstreben, wird deutlich, dass auch in diesem Beschluss der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung zur Rechtfertigung von Belastungen herangezogen wurde: Zum einen wurden alle bisherigen Eingriffe vorsorglich noch einmal gerechtfertigt. Zum anderen wird die Rechtsposition der Ärzte, die eine Ermächtigung anstreben, geschwächt. Denn selbst wenn ihnen eine Ermächtigung erteilt wird, besteht nun die Möglichkeit, dass bereits zugelassene Vertragsärzte diese Ermächtigung gerichtlich anfechten. Hierdurch wird eine zusätzliche Hürde auf dem Weg zur Ermächtigung aufgestellt. Bedenkt man, dass im ersten und im dritten der drei Ausnahmebeschlüsse die gesetzlichen Bestimmungen gerechtfertigt wurden und die Grundrechtsverletzung im zweiten Beschluss sanktionslos blieb, wurde vom Ergebnis her letztlich jede gesetzgeberische Maßnahme für zulässig erachtet, sofern der Grundsatz der finanziellen Stabilität tatsächlich als einschlägig angesehen wurde58. Aus diesen Gründen wurde zunehmend der Vorwurf laut, dass das Bundesverfassungsgericht im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung ein „Sonderrecht“ herausbilde, welches mit sonstigen Aussagen des Bundesverfassungsgerichts nur schwer oder überhaupt nicht in Einklang zu bringen sei59. Weiterhin wird von Teilen der Literatur beklagt, dass die ärztliche Freiheit im Allgemeinen zunehmend geringer werde60 und dass die Judikatur des Bundesverfassungsgerichts zur Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG weniger freiheitsliebend oder zumindest weniger freiheitsfreundlich sei als im Hinblick auf andere Grundrechte61. 58 Ein Sonderfall insofern: BVerfGE 106, 181 (193 f.), da der Grundsatz der finanziellen Stabilität und damit der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung zwar angesprochen, aber nicht als einschlägig angesehen wurde. Vgl. auch Eberhard Schmidt-Aßmann, Grundrechtspositionen S. 46. 59 Beispielsweise Friedhelm Hufen, Leistungserbringer, S. 27 (37 f.); ders., NJW 2004, S. 14 [„inkonsistente Spruchpraxis“]; Walter Leisner, Belastungsgrenze S. 78 [„Spezial-Verfassungsrecht“ der Sozialversicherung]; Eberhard Schmidt-Aßmann, NJW 2004, S. 1689 (1690) [„um sich selbst kreisendes Sonderrecht“]; Helge Sodan, GesR 2004, S. 305 (306). 60 Jürgen W. Hidien, DVBl. 2002, S. 402 (403) spricht von einer „verfassungsgerichtlich hingenommenen gesetzlichen Entwertung der ärztlichen Berufsfreiheit“; Adolf Laufs, NJW 1999, S. 2717 ff.; ders., FS-Deutsch, S. 625 (628 ff.); Rainer Pitschas, VVDStRL 64 (2005), S. 109 (135 mit Fn. 105); Michael Quaas, MedR 2001, S. 34 (34, 36 f.); Wolfgang Weiß, NZS 2005, S. 67 (68); Raimund Wimmer, NJW 1995, S. 1577 (1580). 61 Peter M. Huber, FS-Kriele, S. 389; Friedhelm Hufen, NJW 1994, S. 2913 ff.; Helmut Lecheler, VVDStRL 43 (1985), S. 48 (50, 51 f.); Peter J. Tettinger, DVBl. 1999, S. 679 (684).
2*
20
Einleitung
So gibt es kritische Stimmen: „Für den Eingriff in die Berufsfreiheit und in das Eigentum wird man der Rechtsprechung kaum den Vorwurf überspannter Grundrechtssensibilität machen können.“62 „Die vielfältig beobachtete hohe ,Grundrechtssensibilität‘ des BVerfG sucht man hier vergebens.“63 Dies alles ist Grund genug, sich dem Grundsatz der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung zu widmen. Anliegen dieser Schrift ist es, 1. den Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung zu ermitteln (Erstes Kapitel), 2. zu untersuchen, ob eine Bindung des Gesetzgebers an den Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung besteht und wo sie herrührt (Zweites Kapitel), sowie 3. zu analysieren, welchen Spielraum der Gesetzgeber bei Regelungen der gesetzlichen Krankenversicherung besitzt, die in Grundrechte eingreifen (Drittes Kapitel).
Matthias Herdegen, JZ 2004, S. 873 (875). Eberhard Schmidt-Aßmann, NJW 2004, S. 1689 (1690). Vgl. auch dens., Grundrechtspositionen, S. 35, 43, 45 f. 62 63
Erstes Kapitel
Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung A. Inhaltsbestimmung des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung kann auch nach den zahlreichen hierzu ergangenen Entscheidungen nicht als geklärt gelten. Dabei ist er von zentraler Bedeutung, denn er war der Argumentationskern zahlreicher bundesverfassungsgerichtlicher Entscheidungen. Und – ohne vorgreifen zu wollen – je nach dem, welcher Inhalt dem Grundsatz zukommt, wird dies Auswirkungen auf seine Verortung in der Rechtsordnung und seine rechtfertigende Kraft haben. Mangels einer Definition oder vertiefter Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts, was es hierunter versteht, muss der Inhalt im Wege der Auslegung ermittelt werden. Während bei der Auslegung von Gesetzen eine gewisse Einigkeit besteht, welche Methoden herangezogen werden können1, besteht keine vergleichbare Auslegungsmethode in Bezug auf bundesverfassungsgerichtliche Entscheidungen. Ein allgemeingültiges Interpretationsmodell zum Verständnis der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu entwickeln, wäre Gegenstand einer eigenständigen Arbeit und würde hier den Rahmen sprengen. Aufgrund der Unterschiede zwischen Gesetzestexten und Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts können die klassischen, auf Friedrich Carl von Savigny zurückgehenden Auslegungsmethoden2 nicht unmodifiziert übernommen werden. Zunächst wird – noch in Übereinstimmung mit den klassischen Canones – anhand des Wortlauts der Formulierung des Gemeinwohlbelangs der Rahmen aufgezeigt, innerhalb dessen sich eine Definition bewegen muss3 (dazu I.). Der so 1 Siehe hierzu BVerfGE 11, 126 (130); BGHZ 46, 74 (76); Ernst Forsthoff, Verfassungsauslegung, S. 39 f.; Friedrich Müller / Ralph Christensen, Methodik I, Rn. 375. 2 Friedrich Carl von Savigny, Römisches Rechts I, §§ 32 ff., insbes. § 33. 3 Der Wortlaut ist Grenze der Auslegung BVerfGE 71, 81 (105); 73, 206 (235); 85, 69 (73); 95, 64 (93); 98, 17 (45); BGHZ 46, 74 (76); Wolfgang Fikentscher, Methoden IV,
22
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
ermittelte Inhalt wird weiter konkretisiert, indem auf die vereinzelten Erläuterungen des Bundesverfassungsgerichts zurückgegriffen wird (II.). Darüber hinaus werden die Gesetzesbegründungen zu den Gesetzen herangezogen, deren Verfassungsmäßigkeit überprüft wurde (III.). Auch auf gesetzliche Bestimmungen, die sich mit der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung im weiteren Sinne beschäftigen, wird eingegangen (IV.). Anschließend werden zum Verständnis des Inhalts des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Stimmen aus der Literatur (V.) sowie Ausführungen des Bundessozialgerichts (VI.) herangezogen. Schließlich sollen Sinn und Zweck des Grundsatzes zur Inhaltsbestimmung herangezogen werden (VII.).
I. Der Wortlaut der Formulierung „Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung“ Die Auslegung nach dem Wortlaut führt zu einer Interpretation anhand „der Bedeutung eines Ausdrucks oder einer Wortverbindung im allgemeinen Sprachgebrauch oder, falls ein solcher vorhanden ist, im besonderen Sprachgebrauch des jeweils Redenden [ . . . ]“.4 Allerdings stößt man vorliegend bei der grammatischen Auslegung auf Probleme. Denn der Wortlaut des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung wurde in der hierzu ergangenen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mehrfach verändert. An welchen Wortlaut ist also anzuknüpfen? Diese Frage muss zuerst beantwortet werden. Deshalb wird zunächst die Wortlautveränderung nachgezeichnet (1.), bevor die Frage beantwortet wird, ob, und wenn ja, welche inhaltlichen Änderungen mit dem Formulierungswandel verbunden sind (2.) und welchen Inhalt die Formulierung aufweist (3.). 1. Nachzeichnung des Wortlautwandels der Formulierung Besonders häufig war in den Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts von der „Sicherung der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung“ die Rede5. Leicht variiert in der Formulierung ist die Wortwahl in der EntscheiS. 294 f.; Karl Larenz, Methodenlehre, S. 322; Friedrich Müller / Ralph Christensen, Methodik I, Rn. 310; Helge Sodan / Jan Ziekow, Öffentliches Recht, § 2 Rn. 6; Klaus Stern, Staatsrecht I, S. 136. 4 Karl Larenz, Methodenlehre, S. 320. Vgl. auch Christian Saueressig, Jura 2005, S. 525 (526). 5 Z. B. BVerfGE 68, 193 (218); 70, 1 (25 f., 29); BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 1991, S. 205; NJW 1992, S. 735 (736); Kammerbeschluss vom 20. September 1991, Az: 1 BvR 259 / 91 unter 2. b) der Gründe; Kammerbeschluss vom 20. September 1991 Az: 1 BvR 1455 / 90 unter 2. a) der Gründe (beide zitiert nach: juris); BVerfG (Kammerbeschluss),
A. Inhaltsbestimmung
23
dung im 82. Band der amtlichen Sammlung: „Aber auch der soziale Aspekt der Kostenbelastung im Gesundheitswesen hat erhebliches Gewicht. Er wirkt sich in erster Linie auf die gesetzliche Krankenversicherung aus, deren Stabilität nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts große Bedeutung für das Gemeinwohl hat“6. Teilweise wird auch von der „Finanzierbarkeit der gesetzlichen Krankenversicherung“ gesprochen7. Etwas verändert, aber ähnlich: „Soll die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung mit Hilfe eines Sozialversicherungssystems erreicht werden, stellt auch dessen Finanzierbarkeit einen überragend wichtigen Gemeinwohlbelang dar“.8 An anderer Stelle sind die „Sicherung der finanziellen Grundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung“ und der „Erhalt der Beitragsstabilität“ von Bedeutung9. Ebenfalls in Zusammenhang mit Neuregelungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung spricht das Bundesverfassungsgericht von der „Stabilisierung der äußerst angespannten Finanzlage der Krankenkassen“10. Es finden sich auch Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts, in denen das Attribut „finanziell“ nicht verwendet wird: „Die Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung ist für das Gemeinwohl anerkanntermaßen von hoher Bedeutung“11. „Auch trägt die Regelung als Teil eines im Gesundheitsstrukturgesetz enthaltenen Bündels von Maßnahmen zur Erhöhung der Beitragseinnahmen und damit zur Erhaltung der Stabilität des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung bei.“12 Die „Beitragssatzstabilität und damit die Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung zu erhalten“13 spielen auch eine Rolle. „Tragfähig können insoweit auch die Belange der gesetzlichen Krankenversicherung werden, wenn sonst der gleichmäßige und kostengünstige Zugang der Versicherten zu vertragsärztlichen Leistungen gefährdet wäre.“14 Weitere Formulierungen sind etwa „Funktionsfähigkeit (des Systems) der gesetzlichen Krankenversicherung“15, „Sicherstellung der Versorgung der gesetzlich VersicherNJW 1999, S. 2730 (2731); NJW 2000, S. 1781; NJW 2000, S. 3413; NJW 2001, S. 883 (884); BVerfGE 103, 172 (184); BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 2002, S. 400 (401); NZS 2005, S. 479 (481); BVerfG, Kammerbeschluss vom 18. 02. 2004, Az: 1 BvR 2152 / 03, Rn. 1 (zitiert nach: www.bverfg.de); BVerfGE 113, 167 (233). Hervorhebungen, auch im Folgenden, jeweils nicht im Original. 6 BVerfGE 82, 209 (230). 7 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1993, S. 1520; NJW 1994, S. 785; NJW 1998, S. 1776 (1777); BVerfG, NVwZ 2006, S. 191 (199). 8 BVerfGE 103, 172 (184 f.). Wortgleich BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 2002, S. 400 (401). 9 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1994, S. 3007. 10 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1997, S. 2444 (2445). 11 BVerfGE 103, 172 (184 f.); BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 2002, S. 400 (401). 12 BVerfGE 103, 392 (404). 13 BVerfG (Kammerbeschluss), NVwZ-RR 2002, S. 802. 14 BVerfGE 106, 181 (193) – der Grundsatz wurde in diesem Fall aber nicht als einschlägig betrachtet. 15 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2005, S. 273 (275); NZS 2005, S. 91 (92).
24
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
ten“16 oder „der Gemeinwohlbelang der Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der gesetzlichen Krankenversicherung“17. Schließlich findet sich die Aussage: „Dies dient dazu, das Leistungssystem der Krankenversicherung funktionsfähig zu halten“.18 Eine kursorische Betrachtung ergibt, dass kein einheitlicher Begriff besteht. Vielmehr lassen sich je nach Lage des Falls unterschiedliche Schwerpunktsetzungen erkennen. So tauchen die folgenden Formulierungen auf: 1. Sicherung der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung, 2. Sicherung der finanziellen Stabilität und damit der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung, 3. Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung, 4. Finanzierbarkeit der gesetzlichen Krankenversicherung 5. Finanzierbarkeit des Sozialversicherungssystems, 6. Sicherung der finanziellen Grundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung, 7. Erhalt der Beitragsstabilität, 8. Erhöhung der Beitragseinnahmen und damit Erhaltung der Stabilität des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung, 9. Stabilisierung der äußerst angespannten Finanzlage der Krankenkassen, 10. Beitragssatzstabilität und damit die Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung, 11. Belange der gesetzlichen Krankenversicherung wie der gleichmäßige und kostengünstige Zugang der Versicherten zu vertragsärztlichen Leistungen, 12. Funktionsfähigkeit (des Systems) der gesetzlichen Krankenversicherung, 13 Sicherstellung der Versorgung der gesetzlich Versicherten und 14. Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der gesetzlichen Krankenversicherung.
2. Inhaltsgleichheit der Formulierung trotz Wortlautwandels Bevor mit der Ermittlung des Inhalts begonnen werden kann, muss die Frage beantwortet werden, ob den unterschiedlichen Formulierungen unterschiedliche Inhalte zu Grunde liegen. Insofern tut sich ein Dilemma auf: Ohne das Ganze zu kennen, lassen sich keine Aussagen über dessen Teile treffen, aber ohne Kenntnis 16 17 18
BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2005, S. 273 (275). BVerfG (Kammerbeschluss), MedR 2005, S. 285 (286). BVerfGE 106, 275 (300).
A. Inhaltsbestimmung
25
der Teile wird das Ganze nicht verständlich19. Es gibt jedoch mehrere Gründe, die Frage, ob die unterschiedlichen Formulierungen denselben Inhalt aufweisen, bejahend zu beantworten. Denn erstens ergingen alle Beschlüsse zum selben Themenkomplex, nämlich zur Einschränkbarkeit von Grundrechten zu Gunsten der gesetzlichen Krankenversicherung. Fast ausschließlich war das Grundrecht der Berufsfreiheit von Leistungserbringern betroffen20. Die finanzielle Stabilität (oder verwandte Wendungen) war stets der Gemeinwohlbelang im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung von gesetzgeberischen Eingriffen21. Aufgrund des abgegrenzten Themenbereiches und der inhaltlichen Nähe der Entscheidungen zueinander kann man darauf schließen, dass das Argumentationsmuster dasselbe ist. Zweitens sind die Unterschiede in der Formulierung nur geringfügig. So macht es beispielsweise keinen Unterschied, ob von der „Finanzierbarkeit der gesetzlichen Krankenversicherung“ gesprochen wird oder von der „Finanzierbarkeit des Sozialversicherungssystems“, wenn im konkreten Fall mit dem allgemeineren Begriff Sozialversicherungssystem gerade die gesetzliche Krankenversicherung gemeint ist. Wenn von der „Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung“ die Rede ist, dann muss hierin auch die „finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung“ enthalten sein. Denn das Attribut „finanziell“ ist nur eine nähere Eingrenzung, Ausgangspunkt bleibt aber die Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung. Gleiches gilt für den Ausdruck „Sicherung der finanziellen Stabilität und damit der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung“. Auch dieser enthält in sich die „finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung“. Ein inhaltlicher Unterschied zwischen der „Sicherung der Finanzierbarkeit der gesetzlichen Krankenversicherung“ und der „Sicherung der finanziellen Grundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung“ ist ebenfalls nicht auszumachen. Drittens weist eine hohe Anzahl der dargestellten Entscheidungen die Formulierung „Sicherung der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung“ auf. Zumindest bei den Beschlüssen mit identischer Formulierung kann man davon ausgehen, dass diese Formulierung jeweils einen identischen Inhalt hat. Wenn dann noch innerhalb einer Entscheidung die Formulierung variiert, wie es oft der Fall ist, dann spricht dies dafür, dass das Bundesverfassungsgericht die Formulierung nur aus stilistischen Gründen ändert, ohne dem Grundsatz einen anderen Inhalt beimessen zu wollen. Schließlich verweisen die Beschlüsse oft auf vorherige Entscheidungen, besonders oft auf die Ausgangsentscheidung im 68. Band der amtlichen Sammlung22. Wenn das Bundesverfassungsgericht Abweichungen gesehen hätte, würde es nicht 19 20 21 22
Vgl. hierzu Ulrich Schroth, Rechtsphilosophie, S. 275 f. Siehe unten Zweites Kapitel B. II. 2. b). Siehe hierzu ausführlich unten Zweites Kapitel B. II. BVerfGE 68, 193 ff.
26
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
auf seine eigenen Entscheidungen verweisen. So verweist das Bundesverfassungsgericht in NVwZ-RR 2002, S. 802 sowohl auf BVerfGE 68, 193 (218), als auch auf BVerfGE 70, 1 (29) als auch auf BVerfGE 103, 172, obwohl es selber nicht von der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern von der „Beitragssatzstabilität und damit [der] Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung“ spricht. In der Summe (thematische Identität, sprachliche Variationen innerhalb derselben Entscheidung, Verweise der Entscheidungen untereinander) bestehen genügend Gründe, die für eine einheitliche Verwendung der Formulierungen sprechen.
3. Wortlautauslegung Ausgangspunkt für die Ermittlung des Inhalts soll die Formulierung sein, die am häufigsten verwendet wird, nämlich „Sicherung der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung“. Zugleich ist es die Formulierung, die als erste verwendet wurde. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass es die größte Sicherheit bietet, den wirklichen Inhalt zu Tage zu fördern. Bei einer anderen Formulierung bestünde die Gefahr, dass diese ausnahmsweise einen besonderen Sinngehalt aufweist, der von den übrigen Formulierungen abweicht. Zum anderen bezog sich das Bundesverfassungsgereicht häufig auf die Entscheidung aus dem 68. Band der amtlichen Sammlung. Es kann davon ausgegangen werden, dass es an den dort begründeten Inhalt anknüpfen will. Auch in der Literatur wird auf die finanzielle Stabilität abgestellt23. Im Folgenden wird deshalb stets von der finanziellen Stabilität die Rede sein, da der Inhalt – auch wenn dieser erst noch ermittelt werden muss – derselbe ist. a) Die einzelnen Wortlautelemente Der Wortlaut der Formulierung setzt sich zusammen aus den Elementen „Sicherung“, „finanzielle Stabilität“ und „gesetzliche Krankenversicherung“. Der Begriff „Sicherung“ kann einerseits mit „Schutz“ oder „Sicherstellen“ gleichgestellt werden24. Dies bedeutet soviel wie Verteidigung eines Zustandes vor Gefahren oder allgemein vor nachteiligen Veränderungen. Ein als positiv angesehener Zustand soll bewahrt werden. Es werden Vorkehrungen getroffen, um einer drohenden Verschlechterung zu begegnen. Etwas ist stabil, wenn es a) haltbar, fest, b) widerstandsfähig, kräftig c) beständig, dauerhaft ist25. Die gesetzliche Krankenversicherung wäre demnach stabil, 23 Friedhelm Hufen, Leistungserbringer, S. 27 (37 f.); Renate Jaeger, System, S. 15 (37); Walter Leisner, Finanzielle Stabilität, S. 15 ff.; Helge Sodan, GesR 2004, S. 305 (306). 24 Der Duden, Bd. 2, Das Stilwörterbuch, 7. Aufl. 1988, S. 635 („Sicherung“). 25 Der Duden, Bd. 2, Das Stilwörterbuch, 7. Aufl. 1988, S. 655 („stabil“).
A. Inhaltsbestimmung
27
wenn sie die an sie gestellten Anforderungen dauerhaft erfüllt und auch in Krisenzeiten Widerständen trotzen kann. Man könnte dann von einer finanziellen Beständigkeit oder Dauerhaftigkeit an Stelle von finanzieller Stabilität sprechen. Die Finanzsituation wird geprägt durch die Höhe der Einnahmen einerseits und die Höhe der Ausgaben andererseits. Die Finanzen sind nur dann beständig, wenn langfristig ein Gleichgewicht des Zu- und Abflusses der Geldmittel gegeben ist. Finanzielle Stabilität bedeutet deshalb, dass sich Ausgaben und Einnahmen im Gleichklang entwickeln und dass die Ausgaben nicht größer als die Einnahmen werden26. Mit der Fügung „der gesetzlichen Krankenversicherung“ wird zum Ausdruck gebracht, in welchem Bereich die zuvor erläuterten Aussagen gelten sollen, nämlich im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, wie sie derzeit als System der sozialen Sicherung besteht. Da ein anderes System nicht vorhanden ist, kann nur das existierende System gemeint sein so, wie es zur Zeit ausgestaltet ist27. Bezieht man sich also auf den reinen Wortlaut der Formulierung „Sicherung der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung“, wie sie seit der Entscheidung im 68. Band der amtlichen Sammlung regelmäßig verwendet wird, so ergibt sich folgendes Zwischenergebnis: Der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung bedeutet, dass Vorkehrungen getroffen werden sollen gegen ein Auseinanderdriften von Einnahmen und Ausgaben, das sich negativ auf das bestehende System der gesetzlichen Krankenversicherung als sozialem Sicherungssystem auswirken könnte.
b) Einbeziehung anderer Formulierungen des Bundesverfassungsgerichts In engem Zusammenhang mit dem Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung steht die Wendung von der „Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung“, die das Bundesverfassungsgericht bereits im 70. Band der amtlichen Sammlung verwendet hat. Dort heißt es: „Das durch die Bestimmung eingeführte Höchstpreissystem ist Teil der Maßnahmen, die der Gesetzgeber mit dem Ziel der Kostendämpfung im Gesundheitswesen ergriffen hat, nachdem weit über dem Grundlohnanstieg liegende Preiserhöhungen namentlich in den Bereichen der zahntechnischen Leistungen sowie der Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung und damit deren Funktionsfähigkeit in Frage gestellt hatten. Das Mittel der Höchstpreise soll nach seiner Vorstellung Preiswettbewerb ermöglichen, um hierdurch die Ausgabenentwicklung zu 26 Ob dies auch in die umgekehrte Richtung gilt, dass die Einnahmen nicht höher sein dürfen als die Ausgaben, so dass Beitragssatzkürzungen zwingend erforderlich würden, ist zumindest derzeitig ein hypothetisches „Problem“. 27 Ausdrücklich auf das derzeit bestehende System hebt ab BVerfG, NVwZ 2006, S. 191 (198).
28
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität bremsen und zur Sicherung der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung zu sorgen.“28
Die Wendung „und damit deren Funktionsfähigkeit“ deutet auf einen zwangsläufigen Zusammenhang in dem Sinne hin, dass alles, was der finanziellen Stabilität dient, automatisch der Funktionsfähigkeit zu Gute kommt. Nach der Verwendung im 70. Band tauchte diese Wendung erst wieder in einem Beschluss vom 20. 03. 200129 auf. Abermals aufgegriffen wurde die Formel sodann in rascher Folge in Beschlüssen vom 27. 04. 2001, 21. 06. 2001, 04. 02. 2004 und 18. 02. 200430. Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit hierdurch der zuvor ermittelte Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität modifiziert wird. In allen erwähnten Entscheidungen werden der Grundsatz der finanziellen Stabilität und der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung mit der Wendung „und damit“ verknüpft. Der Wortlaut spricht also dafür, dass die finanzielle Stabilität ein Ausschnitt, eine Teilmenge ist, die notwendigerweise in dem übergeordneten Begriff der Funktionsfähigkeit enthalten ist. Es ließe sich ein Vergleich mit dem Rechtsstaatsprinzip ziehen, das durch zahlreiche Unterprinzipien konkretisiert wird31. Wenn die finanzielle Stabilität einen Ausschnitt aus der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung bildet, dann ist die Funktionsfähigkeit der Oberbegriff. Anhand der verschiedenen vom Bundesverfassungsgericht verwendeten Formulierungen ließe sich folgendes Konzept entwerfen: Mit der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung identisch ist die Stabilität des Systems, es handelt sich um Synonyme. Denn ein instabiles System kann auf Dauer nicht funktionsfähig sein. Die Stabilität setzt sich zum einen aus der finanziellen Stabilität, mit dem aus dem Wortlaut ermittelten Inhalt, und der nicht-finanziellen Stabilität zusammen. Hierunter kann man unter anderem den Zugang der Versicherten zur Versorgung fassen, die Qualität der Versorgung sowie ein ausreichendes Leistungserbringer-Angebot. Dieses Konzept ließe sich mit dem Wortlaut der Entscheidungen vereinbaren. Die Systematisierung bringt auch Ordnung in die Vielzahl der verwendeten Formulierungen. BVerfGE 70, 1 (25 f.) – Hervorhebung nicht im Original. BVerfGE 103, 172 (184). 30 BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 2002, S. 400 (401); NVwZ-RR 2002, S. 802; NZS 2005, S. 479 (481); BVerfG, Kammerbeschluss vom 18. 02. 2004, Az.: 1 BvR 2152 / 03, Rn. 1 (zitiert nach: www.bverfg.de). Der Beschluss vom 18. 02. 2004 weist keine eigene Begründung auf, es wird auf die Begründung von BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 479 ff. verwiesen. Hieraus kann jedoch geschlossen werden, dass das Bundesverfassungsgericht inhaltlich an den Aussagen des vorangegangenen Beschlusses festhält und somit seine Rechtsprechung bestätigt. Vgl. auch BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 91 (92), NJW 2005, S. 273 (275). 31 Roman Herzog, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 20 VII Rn. 3, 21 ff. (Stand der Bearbeitung: 1980); Hartmut Maurer, Staatsrecht I, § 8 Rn. 9 ff.; Helge Sodan / Jan Ziekow, Öffentliches Recht, § 7 Rn. 1. 28 29
A. Inhaltsbestimmung
29
Andererseits führt ein solches Verständnis zu Ungereimtheiten. Denn bei geringen Einnahmen bedarf es für das finanzielle Gleichgewicht niedriger Ausgaben (finanzielle Stabilität); dies steht jedoch im Widerspruch zur möglichst hochwertigen Versorgung32, die kostenintensiv ist (nicht-finanzielle Stabilität). Entstehen zum Zwecke einer bestmöglichen medizinischen Versorgung höhere Kosten, müssen diese über die Beitragszahlungen ausgeglichen werden. Hierdurch würden aber die Versicherten und die Arbeitgeber, die Beiträge zur Sozialversicherung leisten (vgl. §§ 249 ff. SGB V), belastet. Das ließe sich mit niedrigen Beitragssätzen nicht vereinbaren. Letzten Endes könnte bei einem solchen Verständnis immer ein Unterprinzip gegen ein anderes ausgespielt werden, ein wirklicher Gleichklang wäre nicht zu erreichen. Das Problem, dass Unterprinzipien miteinander in Kollision treten können, existiert zwar auch beim Rechtsstaatsprinzip, ohne dass deshalb die Ausarbeitung von Unterprinzipien verworfen würde. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass beim Grundsatz der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung die Unterprinzipien stets in Konflikt treten, während dies beim Rechtsstaatsprinzip nur ausnahmsweise der Fall ist. Anders als das Rechtsstaatsprinzip lässt der Grundsatz der finanziellen Stabilität auch ein anderes Ergebnis, eines, das Spannungen vermeidet, zu. Dieses systematische Argument spricht gegen die zuvor angedachte Hierarchisierung der Gemeinwohlbelange. Der Wortlaut lässt zwar ein „hierarchisches“ Verständnis zu, er erzwingt es aber nicht. Dass es sich bei der Formulierung „Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung“ nicht um einen anderen, höherrangigen Belang handelt, wird auch deutlich durch die häufige unmittelbare Inbezugnahme der Entscheidung aus dem 70. Band der amtlichen Sammlung durch andere Entscheidungen, die den Zusatz „und damit der Funktionsfähigkeit“ nicht enthalten33. Auch innerhalb einer Entscheidung werden die Begrifflichkeiten nicht durchgehend verwendet. So sprechen mehrere Entscheidungen von der Stabilität des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung34, wobei das Attribut „finanziell“ gerade nicht verwendet wird. In BVerfGE 103, 172 (189) ist zunächst von der „finanziellen Stabilität“ die Rede, anschließend vom „Erhalt der Funktionsfähigkeit der kassenärztlichen35 Versorgung“. Auch die Literatur geht nicht von unterschiedlichen Belangen aus. Aufgrund der Systematik sprechen die besseren Gründe dafür, die Formulierung des Bundesverfassungsgerichts nicht in dem oben beschriebenen „hierarchischen“ 32 BSG, Urteil vom 09. 12. 2004, Az. B 6 KA 44 / 03 R, Rn. 147 (zitiert nach: www.bundessozialgericht.de); Michael Quaas / Rüdiger Zuck, Medizinrecht, § 24 Rn. 4. 33 BVerfGE 82, 209 (230); 103, 172 (185); BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1994, S. 3007; NJW 1998, S. 1776 (1777); NJW 1999, S. 2730 (2731); DVBl. 2002, S. 400 (401); NZS 2005, S. 479 (481). 34 BVerfGE 82, 209 (230); BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 1991, 205 (206); BVerfGE 103, 392 (404). 35 Der Begriff des „Kassenarztes“ wurde durch das Gesundheitsstrukturgesetz vom 21. 12. 1992 (BGBl. I, S. 2266 ff.) durch den Begriff „Vertragsarzt“ ersetzt. Siehe hierzu Michael Quaas / Rüdiger Zuck, Medizinrecht, § 4 Rn. 41 f.
30
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
Sinne zu verstehen. Die in einigen Entscheidungen enthaltene Fügung „und damit der Funktionsfähigkeit“ ist deshalb aber nicht bedeutungslos. Ihr kann entnommen werden, dass das Ziel der finanziellen Stabilität kein Selbstzweck sein, sondern letztlich der Aufrechterhaltung des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung dienen soll. Dessen Existenz und Funktionsfähigkeit stecken hinter der finanziellen Stabilität; ihnen sollen die stabilen Finanzen dienen. Die übrigen Formulierungen, die das Bundesverfassungsgericht teilweise zur Präzisierung oder an Stelle des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung verwendet, lassen ebenfalls nicht auf einen anderen Inhalt schließen. Die sonstigen abweichenden Formulierungen sind vereinzelt geblieben und nicht durchgehend verwendet worden, wie es bei der Formulierung „und damit der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung“ der Fall ist. 4. Ergebnis zu I. Dem Wortlaut lässt sich somit entnehmen, dass mittels des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Vorkehrungen getroffen werden sollen gegen ein Auseinanderdriften von Einnahmen und Ausgaben, das sich negativ auf das bestehende System der gesetzlichen Krankenversicherung als sozialem Sicherungssystem auswirken könnte.
II. Inhaltliche Konkretisierungen der Formulierung durch das Bundesverfassungsgericht Aus den Zusammenhängen, in denen die Formel von der finanziellen Stabilität verwendet wurde, lassen sich möglicherweise Rückschlüsse auf den Inhalt des Grundsatzes ziehen. Deshalb werden die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Grundsatz der finanziellen Stabilität daraufhin untersucht, ob sie für das Verständnis des Inhalts förderliche Aussagen enthalten.
1. Überblick über die zu analysierenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts So führt das Gericht aus, dass die Kostendämpfung im Gesundheitswesen der finanziellen Stabilität diene. Indem die Ausgabenentwicklung gebremst werde, solle sowohl ein medizinisch hohes Niveau als auch die Stabilität der Beitragssätze sichergestellt werden. Dies könne durch eine Senkung und Festschreibung der Vergütung erfolgen36. 36
BVerfGE 68, 193 (218).
A. Inhaltsbestimmung
31
Auch sei ein Höchstpreissystem mit dem Ziel der Kostendämpfung im Gesundheitswesen dem Grundsatz der finanziellen Stabilität zuträglich37. Preiserhöhungen würden die finanzielle Stabilität und damit die Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung in Frage stellen. Die Ausgabenentwicklung zu bremsen, trage zur Sicherung der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung bei38. In dem Beschluss zum Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) führte das Bundesverfassungsgericht aus: „Der Gesetzgeber betrachtet ein wirtschaftlich gesundes Krankenhauswesen als Voraussetzung für die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung und für sozial tragbare Krankenhauskosten. Die Bedeutung dieser Gemeinwohlbelange ist außerordentlich hoch einzuschätzen. Die bedarfsgerechte und leistungsfähige Krankenhauspflege ist ein unverzichtbarer Teil der Gesundheitsversorgung, die das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung als besonders wichtiges Gemeinschaftsgut ansieht. [ . . . ] Aber auch der soziale Aspekt der Kostenbelastung im Gesundheitswesen hat erhebliches Gewicht. Er wirkt sich in erster Linie auf die gesetzliche Krankenversicherung aus, deren Stabilität nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts große Bedeutung für das Gemeinwohl hat [ . . . ].“39
Später hieß es, dass der Regelungsauftrag in Art. 33 Abs. 2 Einigungsvertrag (EV) ausdrücklich zur Vermeidung von Defiziten bei den Arzneimittelausgaben der Krankenversicherungen erteilt wurde. Das Bundesverfassungsgericht schließt sich der Gesetzesbegründung40 an, die davon ausging, dass eine solche Regelung notwendig sei, um eine finanzielle Überforderung der Krankenkassen im Beitrittsgebiet zu vermeiden41. In den Beschlüssen vom 20. 09. 199142 führte das Bundesverfassungsgericht zum einen aus, dass der damalige § 34 Abs. 3 SGB V der Sicherung der Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung dienen solle. „Zur Erreichung dieses Ziels der Kosteneindämmung kann die angegriffene Regelung durchaus einen Beitrag leisten.“43 Zum anderen erläutert das Bundesverfassungsgericht den Schutzzweck des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung: „Dieser Schutzzweck unterscheidet sich von dem des Arzneimittelgesetzes, das unabhängig von Kostengesichtspunkten eine gesundheitspolitische Zielsetzung verfolgt.“44 BVerfGE 70, 1 (25). BVerfGE 70, 1 (25 f.). 39 BVerfGE 82, 209 (230). 40 BT-Drucks. 11 / 7760, S. 372. 41 BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 1991, S. 205. 42 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1992, S. 735 ff.; BVerfG, Kammerbeschluss vom 20. 09. 1991, Az.: 1 BvR 259 / 91 (zitiert nach: juris); BVerfG (Kammerbeschluss), Meso B 10 / 493, S. 296 ff. 43 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1992, S. 735 (736). So auch BVerfG, Kammerbeschluss vom 20. 09. 1991, Az.: 1 BvR 259 / 91, unter 2. b) der Gründe (zitiert nach: juris); BVerfG (Kammerbeschluss), Meso B 10 / 493, S. 296 (298). 37 38
32
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
Bezüglich der Regelung, dass sich die Zuzahlungshöhe nach der Packungsgröße richtet, führte das Bundesverfassungsgericht aus, dass dies der Sicherung der finanziellen Stabilität und dem Erhalt der Beitragssatzstabilität diene45. In der Entscheidung zur Trennung zwischen haus- und fachärztlicher Versorgung hieß es, dass durch die Neuordnung neben gesundheitspolitischen Zielen der Qualitätsverbesserung für die Versicherten auch finanzpolitische Ziele der Kostendämpfung angestrebt würden46. „Art. 30 Abs. 1 GSG diente dem Zweck, eine sofortige finanzielle Entlastung der gesetzlichen Krankenversicherung zu erreichen [ . . . ].“47 Zweck der Regelung, die durch den Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung gerechtfertigt werden sollte, sei eine Entlastung der gesetzlichen Krankenversicherung bei den Arzneimittelausgaben gewesen.48 Weiterhin findet sich die Erklärung, dass das Ziel eine wirtschaftlich tragbare Krankenversicherung sei49. Als Gemeinwohlbelang trete neben die Volksgesundheit das funktionierende vertragsärztliche System der gesetzlichen Krankenversicherung50. In einem Senatsbeschluss wird der Grundsatz der finanziellen Stabilität als „ein sehr allgemein gehaltenes Ziel“ bezeichnet51. Weiterhin wird wiederholt, dass neben der Gesundheitsversorgung gerade im Gesundheitswesen der Kostenaspekt für gesetzgeberische Entscheidungen erhebliches Gewicht habe52. Außerdem: „Die Kostenbegrenzung ist damit nur eines der Ziele, die der Gesetzgeber verfolgt, um das System insgesamt funktionsfähig zu erhalten. Zugleich strebt er an, dass die volkswirtschaftlich für vertretbar gehaltene Beitragsbelastung, die der Krankenversicherung ihr Finanzierungsvolumen vorgibt, nicht überschritten und die Verteilung der Finanzmittel den Zielen der Versorgung der Versicherten mit einem ausreichenden und zweckmäßigen Schutz im Krankheitsfall gerecht wird. Mehrausgaben in einem Sektor bedingen dabei notwendigerweise Kürzungen an anderer Stelle, wenn Beitragserhöhungen vermieden werden sollen.“53 „Neben der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung [ . . . ] hat gerade im Gesundheitswesen der Kostenaspekt für gesetzgeberische Entscheidungen erhebliches Gewicht. [ . . . ] Soll die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung mit Hilfe eines Sozialversicherungs44 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1992, S. 735 (736). So auch BVerfG, Kammerbeschluss vom 20. 09. 1991, Az.: 1 BvR 259 / 91, unter 2. c) der Gründe (zitiert nach: juris). 45 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1994, S. 3007. 46 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1999, S. 2730 (2731). 47 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 1781. 48 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 1781. 49 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2001, S. 883 (884). 50 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2001, S. 883 (884). 51 BVerfGE 103, 172 (183). 52 BVerfGE 103, 172 (184). 53 BVerfGE 103, 172 (186).
A. Inhaltsbestimmung
33
systems erreicht werden, stellt auch dessen Finanzierbarkeit einen überragend wichtigen Gemeinwohlbelang dar, von dem sich der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des Systems und bei der damit verbundenen Steuerung des Verhaltens der Leistungserbringer leiten lassen darf [ . . . ].“54
In einer späteren Senatsentscheidung wurde festgestellt, dass die angegriffene Regelung Teil von Maßnahmen zur Erhöhung der Beitragseinnahmen sei, weshalb sie der Erhaltung der Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung diene55. In einem Nichtannahmebeschluss aus dem Jahre 2001 erklärt das Bundesverfassungsgericht, dass die vertragszahnärztliche Honorarkürzung durch Abstaffelungen bei zunehmender Leistungsmenge (Punktwertdegression) Art. 12 Abs. 1 GG nicht verletze56. § 85 Abs. 4 lit. b SGB V in der Fassung des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG) vom 21. 12. 1992 diene dazu, die Qualität vertrags(zahn)ärztlicher Leistungen zu verbessern und die Beitragssatzstabilität und damit die Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung zu erhalten, was ein ausreichend gewichtiger Grund des Gemeinwohls sei57. In den Beschlüssen58, in denen eine einstweilige Anordnung gegen das In-KraftTreten bestimmter Vorschriften des Beitragssatzsicherungsgesetzes (BSSichG) vom 23. 12. 200259 abgelehnt wurde, finden sich Äußerungen, dass die finanzielle Stabilität in dem Ausmaß gefährdet würde, in dem die vorgesehenen Preissenkungen nicht realisiert würden60. In den beiden Beschlüssen zur Anhebung der Versicherungspflichtgrenze werden bekannte Ausführungen wiederholt. So zum Beispiel die These, dass, wenn die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung mit Hilfe eines Sozialversicherungssystem erreicht werden solle, auch dessen Finanzierbarkeit einen überragend wichtigen Gemeinwohlbelang darstelle61. Es finden sich aber auch neue Ausführungen wie zum Beispiel: „Die Stabilität des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung ist kein Selbstzweck. Die gesetzliche Krankenversicherung dient der Absicherung der als sozial schutzbedürftig angesehenen Versicherten vor den finanziellen Risiken einer Erkrankung.“62
In der Kernspintomographie-Entscheidung63 wird ausgeführt, dass die Konzentration kernspintomographischer Leistungen bei speziell qualifizierten Ärzten 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 2002, S. 400 (401). BVerfGE 103, 392 (404). BVerfG (Kammerbeschluss), NVwZ-RR 2002, S. 802. BVerfG (Kammerbeschluss), NVwZ-RR 2002, S. 802. BVerfGE 106, 351 ff.; 106, 359 ff.; 106, 369 ff.; 108, 45 ff. BGBl. I, S. 4637. BVerfGE 106, 351 (356); 106, 359 (363); 106, 369 (374); 108, 45 (50). BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 479 (481). BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 479 (481). Siehe hierzu Peter Wigge, NZS 2005, S. 176 ff.
3 Schaks
34
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
(Radiologen und Nuklearmediziner) zur Sicherstellung der Qualität der Versorgung sowie der Wirtschaftlichkeit im Interesse der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung vorgenommen würde64. Schließlich erklärt das Bundesverfassungsgericht, dass die Begrenzung der Arztzahlen nach dem Willen des Gesetzgebers der Kostenreduzierung und damit einer Stabilisierung des Systems insgesamt diene65. In der Entscheidung zum Risikostrukturausgleich hieß es, dass die Einführung des freien Kassenwahlrechts zu einem Wettbewerb zwischen den Kassen führen sollte. Dieser Wettbewerb wiederum diene dazu, Qualität, Wirtschaftlichkeit und Effizienz der medizinischen Versorgung zu verbessern und damit die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung zu wahren66. Obwohl hier die Qualität der medizinischen Versorgung an erster Stelle genannt wird, belegen die nachfolgenden Ausführungen, dass es inhaltlich in keiner Weise um die Qualität der Versorgung geht. Denn es heißt im Anschluss: „Die Krankenkassen sollen, um sich Vorteile im Wettbewerb zu verschaffen, Wirtschaftlichkeitspotentiale erschließen und allgemein ihre Effizienz verbessern. Gelingt es einer Kasse besser als anderen, bestimmte finanzielle Faktoren zu beeinflussen und so ihre Kosten zu senken, dann soll sie diesen durch eigenes Verhalten erzielten finanziellen Vorteil nicht mit weniger erfolgreich arbeitenden Kassen teilen müssen. Die aus unterschiedlich erfolgreichen Wirtschaftlichkeitsbemühungen resultierenden Kostenvorteile sollen sich vielmehr in unterschiedlich hohen Beitragssätzen niederschlagen dürfen.“67
In der Entscheidung zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des BSSichG hieß es, dass die angegriffenen Vorschriften die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung verfolgten, unter anderem durch Preissenkungen zur Kostenbegrenzung, Ausgabenbegrenzung der Krankenkassen, sowie Maßnahmen zur Einnahmeverbesserung68. Darüber hinaus sei die Finanzierbarkeit der gesetzlichen Krankenversicherung in einem Sozialstaat ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut. Zur Finanzierbarkeit gehöre auch – als unabdingbare Voraussetzung für ein Fortbestehen des gegenwärtigen Systems – die Beitragsstabilität 69.
2. Zwischenergebnis Die Formulierung von der finanziellen Stabilität wurde also im Zusammenhang genannt mit folgenden anderen Formulierungen: 64 65 66 67 68 69
BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 91 (92). BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2005, S. 273 (274). BVerfGE 113, 167 (230). BVerfGE 113, 167 (230 f.). BVerfG, NVwZ 2006, S. 191 (198). BVerfG, NVwZ 2006, S. 191 (199).
A. Inhaltsbestimmung
35
1. sowohl medizinisch hohes Niveau als auch Stabilität der Beitragssätze, 2. Kostendämpfung oder Kosteneindämmung, 3. sozialer Aspekt der Kostenbelastung, 4. Vermeidung von Defiziten, 5. Beitrags(satz)stabilität, 6. neben gesundheitspolitischen Zielen der Qualitätsverbesserung auch finanzpolitische Ziele der Kostendämpfung, 7. finanzielle Entlastung, 8. neben die Volksgesundheit tritt das funktionierende vertragsärztliche System der gesetzlichen Krankenversicherung, 9. Erhöhung der Beitragseinnahmen und 10. Schutz der als sozial schutzbedürftig angesehenen Versicherten vor finanziellen Risiken bei Erkrankungen.
3. Finanzielle Stabilität und Gesundheitsschutz Blickt man auf den Kontext der Entscheidungen, in denen der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Verwendung fand, so ist für das Verständnis besonders aufschlussreich zum einen der Wortlaut der bundesverfassungsgerichtlichen Begründungen und zum anderen der mit dem Grundsatz verfolgte Zweck. a) Wortlaut: Die finanzielle Stabilität als aliud zum Gesundheitsschutz Der Grundsatz der finanziellen Stabilität steht – so die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts – neben der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung70. Wenn eine Sache neben einer anderen steht, dann können beide nicht identisch sein. Bei der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung muss es sich folglich um ein aliud zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung oder der Volksgesundheit handeln. Er ist kein spezifisch die Gesundheit schützender Gemeinwohlbelang. Auch andere Formulierungen stützen dieses Ergebnis. So wird im 82. Band der amtlichen Sammlung zunächst von der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gesprochen. Dann heißt es: „Aber auch der soziale Aspekt der Kostenbelastung im Gesundheitswesen hat erhebliches Gewicht. Er wirkt sich in erster Linie auf die gesetzliche Krankenversicherung aus, deren 70 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1999, S. 2730 (2731); NJW 2001, S. 883 (884); DVBl. 2002, S. 400 (401); BVerfGE 103, 172 (184).
3*
36
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität Stabilität nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts große Bedeutung für das Gemeinwohl hat [ . . . ].“71
Auch aus dieser Formulierung wird deutlich, dass es sich um zwei, also um unterschiedliche Gemeinwohlbelange handeln muss. Denn das Wort „auch“ signalisiert, dass zu dem erstgenannten Aspekt ein weiterer dazukommt, dass etwas hinzugefügt wird. Dies wird durch die Entscheidung zum Zulassungsende nach Vollendung des 68. Lebensjahres bestätigt. Der Gesetzgeber hatte seine Regelung damit begründet, dass überhöhte Ausgabenzuwächse in der gesetzlichen Krankenversicherung vermieden werden sollen; von Gesundheitsschutz war in der Gesetzesbegründung keine Rede72. Das Bundesverfassungsgericht erwähnt zwar diese Tatsache, es lässt aber offen, ob diese Begründung den gesetzgeberischen Eingriff zu rechtfertigen vermag und stellt anstelle73 der finanziellen Stabilität auf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung und Gefahren durch „altersschwache“ Vertragsärzte ab, also auf einen gesundheitsschützenden Belang. Wenn das Bundesverfassungsgericht von der Finanzierbarkeit der gesetzlichen Krankenversicherung74 bzw. der Sozialversicherung75 oder der Sicherung ihrer finanziellen Grundlagen76 oder der Stabilisierung der äußerst angespannten Finanzlage der Krankenkassen77 spricht, so ist einsichtig, dass finanzielle Aspekte von Belang sind. Gleiches gilt auch, wenn es um den Erhalt der Beitragsstabilität 78 oder die Erhöhung der Beitragseinnahmen 79 oder den Belang der gesetzlichen Krankenversicherung wie den gleichmäßigen und kostengünstigen Zugang der Versicherten zu vertragsärztlichen Leistungen80 geht. b) Telos: Unterschiedliche Schutzzwecke Nicht nur die Wortwahl lässt erkennen, dass der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung nicht mit dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung gleichzusetzen ist. Auch ein Blick auf die Schutzzwecke der beiden Belange verdeutlicht dies. In drei Beschlüssen81 aus dem Jahre 1991 wird ausBVerfGE 82, 209 (230) – Hervorhebung nicht im Original. Vgl. BT-Drucks. 12 / 3608, S. 93. 73 Kritik an diesem Vorgang und der Entscheidung insgesamt bei Ulrich Becker, NZS 1999, S. 521 (525); Winfried Boecken, FS-Brohm, S. 231 ff.; Helge Sodan, NJW 2003, S. 257 (258). 74 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1993, S. 1520; NJW 1994, S. 785; NJW 1998, S. 1776 (1777). 75 BVerfGE 103, 172 (184 f.); BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 2002, S. 400 (401). 76 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1994, S. 3007. 77 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1997, S. 2444 (2445). 78 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1994, S. 3007. 79 BVerfGE 103, 392 (404). 80 BVerfGE 106, 181 (193) – der Grundsatz wurde aber nicht als einschlägig angesehen. 71 72
A. Inhaltsbestimmung
37
drücklich ausgeführt, dass der Grundsatz der finanziellen Stabilität andere als gesundheitsschützende Zwecke verfolgt. Wörtlich heißt es dort im Hinblick auf die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung: „Dieser Schutzzweck unterscheidet sich von dem des Arzneimittelgesetzes, das unabhängig von Kostengesichtspunkten eine gesundheitspolitische Zielsetzung verfolgt.“82
Das Arzneimittelgesetz (AMG) dient dem Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren, die von Medikamenten ausgehen können (vgl. § 1 AMG). Es hat eindeutig eine gesundheitsschützende Zielrichtung. Das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass das AMG dem Schutz der Volksgesundheit dient83. Eine ausschließlich gesundheitsschützende Zielrichtung kann der Grundsatz der finanziellen Stabilität deshalb nicht haben. Der Gliedsatz „das unabhängig von Kostengesichtspunkten eine gesundheitspolitische Zielsetzung verfolgt“ kann unterschiedlich interpretiert werden, je nachdem, ob man die Betonung auf das Wort „unabhängig“ oder „gesundheitspolitisch“ legt. Man kann diesen Satzteil so lesen, dass das AMG allein eine gesundheitspolitische Zielsetzung verfolgt, während der Grundsatz der finanziellen Stabilität dies in keiner Weise tut. Oder man versteht den Satz so, dass zwar auch der Grundsatz der finanziellen Stabilität eine gesundheitspolitische Zielsetzung verfolgt, aber nur abhängig von Kostengesichtspunkten. Der Unterschied in beiden Fällen läge nun darin, dass einmal gar keine gesundheitspolitische Zielsetzung verfolgt wird oder aber eine von Kosten abhängige gesundheitspolitische Zielsetzung. Da das Bundesverfassungsgericht stets ausführt, dass es sich bei den Regelungen der gesetzlichen Krankenversicherung um sozialstaatlich motivierte Vorschriften handelt84 und eben nicht um gesundheitspolitisch motivierte85, kann nur die erstgenannte Interpretation richtig sein. In diesem Sinne ist auch ein weiteres Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu verstehen, das sowohl das damalige KHG86 als auch § 30 GewO betraf87. Dort erläuterte das Gericht, dass § 30 GewO dem Gesundheitsschutz diene, während das 81 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1992, S. 735 ff.; BVerfG, Kammerbeschluss vom 20. 09. 1991, Az.: 1 BvR 259 / 91 (zitiert nach: juris); BVerfG (Kammerbeschluss), Meso B 10 / 493, S. 296 ff. 82 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1992, S. 735 (736). So auch BVerfG, Kammerbeschluss vom 20. 09. 1991, Az.: 1 BvR 259 / 91, unter 2. c) der Gründe; BVerfG, Kammerbeschluss vom 20. 09. 1991, Az.: 1 BvR 1455 / 90, unter 2. c) der Gründe (beide zitiert nach: juris) – diese Passage ist nicht abgedruckt in Meso B 10 / 493, S. 296 ff. 83 BVerwG, NJW 1985, S. 1410. 84 BVerfGE 68, 193 (209); 82, 209 (230); BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1997, S. 2444 (2445); BVerfGE 103, 172 (185); BVerfG (Kammerbeschluss) DVBl. 2002, S. 400 (401); NVwZ 2005, S. 572 (573); BVerfGE 113, 167 (233); BVerfG, NJW 2006, S. 891 (892). Davon geht auch BT-Drucks. 12 / 3608, S. 68 f. aus. 85 So auch Michael Quaas / Rüdiger Zuck, Medizinrecht, § 24 Rn. 5. 86 Auch zu Änderungen des KHG zitierte das BVerfG den Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung, BVerfGE 82, 209 ff. 87 BVerwGE 70, 201 (203).
38
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
KHG vornehmlich ein Finanzierungsgesetz sei88. Diese Differenzierung zwischen Finanzierungs- und Gesundheitsschutzzwecken wird auch in der Literatur gesehen: Der Gesetzeszweck des KHG (vgl. § 1 Abs. 1) bestätigt, dass tragbare, das heißt niedrige, Pflegesätze gewollt sind, während die Versorgung nur angemessen zu sein hat, nicht aber bestmöglich oder besonders hochwertig89. Eine letzte Klarstellung, dass die finanzielle Stabilität und damit die Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung nicht unmittelbar der Qualitätsverbesserung dient, lässt sich ausdrücklich auch dem Beschluss über die Abrechenbarkeit kernspintomographischer Leistungen entnehmen: „Ihre verfassungsrechtliche Rechtfertigung finden die Anforderungen der Kernspintomographie-Vereinbarung weniger unter dem Gesichtspunkt der Qualitätssicherung als unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit der Versorgung.“90
Diese Argumentation erstaunt umso mehr, als nur wenige Sätze vorher gerade mit der Sicherung der Qualität der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung argumentiert wird91, auf die es an dieser Stelle doch nicht ankommen soll. 4. Finanzielles Verständnis Aus den Zusammenhängen, in denen das Bundesverfassungsgericht den Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung verwendet, konnte bereits ermittelt werden, dass der Grundsatz keinen speziell dem Gesundheitsschutz dienenden Belang darstellt, also was der Grundsatz nicht beinhaltet. Nun soll eine positive Inhaltsbestimmung erfolgen.
a) Prima facie: Ein finanzieller Belang Bereits die Bezeichnung des Grundsatzes deutet darauf hin, dass er finanziell zu verstehen ist. Dies verdeutlichen auch die einzelnen Ziele, zu deren Rechtfertigung der Grundsatz herangezogen wurde: Die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung soll erreicht werden durch Kostendämpfung bzw. -reduzierung92, durch Vermeidung von Defiziten bei den Arzneimittelausgaben 93, durch BVerwGE 70, 201 (203) – Hervorhebung nicht im Original. Heinz-Joachim Pabst, FS-Rüfner, S. 607 (609). 90 BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 91 (92). 91 BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 91 (92). 92 BVerfGE 68, 193 (218); BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1992, S. 735 (736); BVerfG, Kammerbeschluss vom 20. 09. 1991, Az.: 1 BvR 259 / 91, unter 2. c) der Gründe (zitiert nach: juris); BVerfG (Kammerbeschluss), Meso B 10 / 493, S. 296 (298); NJW 1999, S. 2730 (2731); NJW 2005, S. 273 (274). 93 BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 1991, S. 205. 88 89
A. Inhaltsbestimmung
39
eine sofortige finanzielle Entlastung der gesetzlichen Krankenversicherung94, durch Erhöhung der Beitragseinnahmen95; gefährdet ist die Stabilität durch Preiserhöhungen und eine steigende Ausgabenentwicklung96. Ein erstes Zwischenergebnis könnte demnach lauten: Da der gesetzlichen Krankenversicherung bestimmte Aufgaben zugewiesen sind, benötigt sie zu deren Erfüllung Finanzmittel. Der Grundsatz der finanziellen Stabilität rechtfertigt nun Eingriffe in die Freiheit aller am System Beteiligten (und darüber hinaus97), um dem System die nötigen Mittel zu verschaffen oder zu verhindern, dass es durch weitere Mehrausgaben belastet wird. b) Argumente gegen ein finanzielles Verständnis Andererseits gibt es auch vereinzelt Ausführungen, die sich mit diesem Zwischenergebnis nicht ganz vereinbaren lassen. Sie sind jedoch weit weniger zahlreich. So fanden auch das Niveau der vertragsärztlichen Versorgung98, die Qualität der Versorgung99 sowie das volkswirtschaftliche Gleichgewicht100 Erwähnung. Wenn das Bundesverfassungsgericht das Niveau und die Qualität der ärztlichen Versorgung als Bestandteil des Grundsatzes der finanziellen Stabilität ansieht, dann verwundert es, dass mit demselben Grundsatz Leistungskürzungen gerechtfertigt wurden. In der Entscheidung zur Rechtsprechung des Bundessozialgerichts bezüglich des Rechtsschutzes gegen erteilte Ermächtigungen101 hat die 2. Kammer des Ersten Senats die Beeinträchtigungen vertragsärztlicher Freiheit aufgezählt und klargestellt, dass auch Beschränkungen des Behandlungsspektrums, das der einzelne Vertragsarzt zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung erbringen kann, durch den Grundsatz der finanziellen Stabilität gerechtfertigt sind. Was für den Arzt eine Verengung des Leistungsspektrums ist, stellt sich für den Versicherten als Leistungskürzung dar. Denn diese Sach- und Dienstleistungen muss er nun selber tragen, sie werden nicht mehr von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. Leistungskürzungen führen aber nicht zu einer Erhöhung des Niveaus oder einer Verbesserung der Qualität, sondern im Gegenteil zu einer Verschlechterung des vertragsärztlichen Versorgungsstandards. Somit werden auch BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 1781. BVerfGE 103, 392 (404). 96 BVerfGE 70, 1 (25 f.). 97 Auch den privaten Krankenversicherern, die gerade nicht in das System der gesetzlichen Krankenversicherung eingebunden sind, werden Eingriffe in ihre grundrechtlich geschützte Freiheit auferlegt, was ebenfalls mit dem Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung gerechtfertigt wird. So BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 479 (481). 98 BVerfGE 68, 193 (218). 99 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1999, S. 2730. 100 BVerfGE 103, 172 (186). 101 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2005, S. 273 (274, 275). 94 95
40
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
Verschlechterungen der ärztlichen Versorgung durch den Grundsatz der finanziellen Stabilität gerechtfertigt102. Was das volkswirtschaftliche Gleichgewicht betrifft, so stehen dahinter makroökonomische Erwägungen, die sich finanziellen Belangen zuordnen lassen. Eindeutig ist jedenfalls, dass unter der Formulierung „volkswirtschaftliches Gleichgewicht“ nicht dasselbe wie unter Volksgesundheit oder bestmöglicher Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung zu verstehen ist. Dass die Qualität der Versorgung zwar als Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung ausgegeben wird, letzten Endes jedoch nur behauptet wird, zeigt sich auch in der Entscheidung zum Risikostrukturausgleich. Während zunächst angegeben wird, dass die Qualität der medizinischen Versorgung verbessert werden solle103, wird dieser Aspekt bei der nachfolgenden ausführlicheren Begründung gar nicht mehr aufgegriffen. Statt dessen ist von Wirtschaftlichkeitspotentialen, Effizienz, finanziellen Faktoren und Kostenvorteilen die Rede, mit keinem Wort jedoch von einer qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung für die Bevölkerung104. Somit muss davon ausgegangen werden, dass die Qualitätsverbesserung oder die Qualität der medizinischen Versorgung zwar gelegentlich behauptet wird, sie ist jedoch nicht Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität. Es bestehen noch weitere Widersprüchlichkeiten: Sowohl die Stabilität der Beitragssätze105 als auch eine Erhöhung der Beitragssätze106 wurde durch den Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung als geboten angesehen. Hierbei handelt es sich jedoch um zwei gegensätzliche Maßnahmen, die durch denselben Grundsatz gerechtfertigt wurden. Hier stellt sich die Frage, ob dem Grundsatz ein bestimmter, einheitlicher Inhalt entnommen werden kann. Die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts lassen hieran Zweifel aufkommen.
c) Zwischenergebnis Was bleibt also übrig vom Inhalt des Grundsatzes? Letzten Endes ging es stets um die Systemerhaltung, entweder durch Einsparungen (z. B. Leistungskürzungen) oder durch Einnahmenerhöhungen. Qualitative Aspekte haben aber kaum eine Rolle gespielt. In einem Beschluss wird sogar ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Qualität der Versorgung die angegriffene Regelung nicht rechtfertige, obwohl zuvor das Gericht selber mit qualitativen Argumenten operierte107. Auch die 102 103 104 105 106 107
So z. B. in BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1997, S. 2444 ff. BVerfGE 113, 167 (230). BVerfGE 113, 167 (231). BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1994, S. 3007. BVerfGE 103, 392 (404). BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 91 (92).
A. Inhaltsbestimmung
41
vorgebrachten Erwägungen im Hinblick auf die Volkswirtschaft haben keine Überzeugungskraft. Vielmehr sprechen die Erläuterungen des Bundesverfassungsgerichts dafür, dass allein finanzielle Aspekte ausschlaggebend waren. Der zitierte Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung enthält so viele, teils widersprüchliche Elemente, dass sein Inhalt sehr abstrakt formuliert sein muss, um alle Maßnahmen, die bisher durch ihn gerechtfertigt wurden, gleichermaßen zu erfassen. Es handelt sich um eine der vielkritisierten „globalen Großformeln“108. Alleinige Konstante der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu diesem Grundsatz ist die Mittelbeschaffung bzw. die Vermeidung weiterer Ausgaben zum Zwecke des Systemerhaltung. Im Einzelfall ist es gleichgültig, welche Maßnahme ergriffen wurde, solange sie der gesetzlichen Krankenversicherung zu Gute kommt, denn auch gegenteilige Maßnahmen wurden durch denselben Grundsatz gerechtfertigt. Diese Beliebigkeit spricht dagegen, dem Grundsatz der finanziellen Stabilität einen über die Finanzbeschaffung hinausgehenden Inhalt zu entnehmen. 5. Ergebnis zu II. Die bisherigen Schritte der Konkretisierung haben ergeben, dass der Grundsatz der finanziellen Stabilität einen finanziellen Inhalt aufweist. Er steht für die Beschaffung finanzieller Mittel (oder der Vermeidung von Ausgaben), die dem System der gesetzlichen Krankenversicherung zu Gute kommen soll.
III. Die Heranziehung von Gesetzesbegründungen Eine weitere Auslegungsmethode ist die historische Auslegung. Bei der Auslegung von Rechtsnormen fragt sie danach, „welche Deutung denn der Regelungsabsicht des Gesetzgebers oder seiner eigenen Normvorstellung am meisten entspricht“109. Auskunft über die Normvorstellungen des Gesetzgebers gibt häufig die Entstehungsgeschichte des Gesetzes110, so dass als Erkenntnisquelle auch die dem Entwurf beigegebene Begründung dienen kann111. Bislang wurden alle gesetzgeberischen Eingriffe in die Berufsfreiheit mit Hilfe des Grundsatzes der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung gerechtfertigt. Wenn die Gesetze der verfassungsgerichtlichen Kontrolle standhielten, kann davon ausgegangen werden, dass das zu Grunde liegende gesetzgeberische Konzept gebilligt wurde. Oder es finden sich Ausführungen des Gerichts, inwieVgl. hierzu Helmut Lecheler, VVDStRL 43 (1985), S. 48 (58). Karl Larenz, Methodenlehre, S. 328. 110 Karl Larenz, Methodenlehre, S. 330. Siehe auch Friedrich Müller / Ralph Christensen, Methodik I, Rn. 360, 362. 111 Karl Larenz, Methodenlehre, S. 330; Christian Saueressig, Jura 2005, S. 525 (529). 108 109
42
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
weit bestimmte Argumente nicht tragfähig sind. Somit ist es möglich, dass die Gesetzgebungsmaterialien – vermittelt durch eine bejahende Gerichtsentscheidung – zur Auslegung herangezogen werden können oder gerade nicht (im Falle einer verwerfenden Entscheidung). Das soll im Folgenden untersucht werden. In vielen Entscheidungen, die zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichern Krankenversicherung ergingen, hat das Bundesverfassungsgericht Bezug genommen auf die Gesetzesbegründungen zu den jeweils in Rede stehenden Vorschriften. Verwiesen wurde auf BT-Drucks. 9 / 811, Anl. 2, S. 12 f.112; 9 / 845, S. 1, 11, 15 f.113, 17114 und 18115, BT-Drucks. 9 / 1300, S. 2 f.116, 3 ff.117, 9118, 10119; BT-Drucks. 11 / 2237, S. 151, 195120, BT-Drucks. 11 / 3480, S. 24121, BTDrucks. 11 / 6380, S. 246, 264122, BT-Drucks. 11 / 7760, S. 372123, BT-Drucks. 12 / 3209, S. 60, 61124, BT-Drucks. 12 / 3608, S. 66 ff.125, 73126, 74 f.127, 81128, 83129, 88130, 93131, 97132, 98133, 156134, BT-Drucks. 13 / 4615, S. 6135, 8, 11136, BT-Drucks. 15 / 28, S. 14137, BT-Drucks. 15 / 75, S. 1138. Der Übersichtlichkeit halber und um Wiederholungen zu vermeiden, werden die Gesetzesbegründungen 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
BVerfGE 68, 193 (220). BVerfGE 70, 1 (26). BVerfGE, 68, 193 (218). BVerfGE 68, 193 (220). BVerfGE 68, 193 (218). BVerfGE 68, 193 (219). BVerfGE 68, 193 (218). BVerfGE 70, 1 (32). BVerfGE 103, 172 (190). BVerfGE 103, 172 (188). BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 1781 (1782). BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 1991, S. 205. BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2001, S. 883. BVerfGE 113, 167 (230). BVerfGE 103, 172 (188). BVerfGE 113, 167 (230). BVerfGE 103, 172 (188). BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1999, S. 2730 (2731). BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 3413; NVwZ-RR 2002, S. 802. BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1998, S. 1776 (1777). BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2005, S. 273 (274). BVerfGE 103, 172 (188). BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 1781. BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1997, S. 2444 (2446). BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1997, S. 2444 (2445). BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 479 (481). BVerfGE 106, 369 (364).
A. Inhaltsbestimmung
43
in chronologischer Reihenfolge untersucht und nicht in der Reihenfolge, in der sie vom Bundesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen zitiert worden sind.
1. BT-Drucks. 9 / 811 (Anl. 2, S. 12 f.) Dieser Teil der Gesetzesbegründung wurde lediglich herangezogen, um zu belegen, dass die Einsparung von 140 Mio. DM für zahntechnische Leistungen keine Existenzgefährdung der Zahntechnikerbetriebe herbeiführe. Denn der Gesamtumsatz für zahntechnische Leistungen habe im Jahr 1979 4,5 Milliarden DM betragen. 2. BT-Drucks. 9 / 845 (S. 1, 11, 15 f., 17, 18) Diese Begründung benennt als Ziel des Entwurfs des Gesetzes zur Ergänzung und Verbesserung der Wirksamkeit kostendämpfender Maßnahmen in der Krankenversicherung (Kostendämpfungs-Ergänzungsgesetz – KVEG)139 die „Stabilisierung der Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung“. Angestrebt werde eine Stabilisierung der Beitragssatzentwicklung, damit die Kostenbelastung privater und öffentlicher Haushalte reduziert werde. Hierdurch werde auch die konjunkturelle Entwicklung insgesamt stabilisiert. Auf S. 11 lassen sich folgende Schlagwörter finden: „Befürchtung, dass die Beitragssätze steigen“, „Dämpfung des Ausgabenanstiegs“, „Begrenzung des Ausgabenanstiegs“, „dauerhafte Stabilisierung der Finanzlage“, „Gefährdung der Beitragssatzstabilität“, „Anstieg der Beitragssätze vermeiden“, „das Defizit durch kurzfristig wirksame Ausgabenkürzungen abzudecken“, „längerfristig die Ausgaben im Rahmen der Einkommensentwicklung der Versicherten halten“, „die gesundheitliche Versorgung wirtschaftlicher und bedarfsgerechter gestalten“ sowie „das Kostenbewußtsein bei allen Beteiligten erhöhen“. Die Begründung zu § 376 d RVO auf Seite 15 f. spricht von einem Preiswettbewerb, der zu einer preisgünstigeren Versorgung führen solle. Zu Art. 5 Nr. 6 KVEG wird auf Seite 17 ausgeführt, dass eine Minderung des Preisniveaus für die Stabilisierung der Beitragssätze erforderlich sei. Der abschließende Punkt „Finanzielle Auswirkungen“ (S. 18) bestätigt, dass lediglich Einsparungen bezweckt sind. Diesen Sätzen ist zu entnehmen, dass der Gesundheitsschutz kein Ziel des KVEG war, sondern allein die weitere Senkung von Kosten im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung.
139
Gesetz vom 22. 12. 1981 – BGBl. I, S. 1578 ff.
44
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
3. BT-Drucks. 9 / 1300 (S. 2 f., 3 ff., 9, 10) Auch diese Gesetzesbegründung spricht davon, dass die Ausgabenentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung an die Leistungsfähigkeit der Gesamtwirtschaft und die Lohn- und Gehaltsentwicklung der Versicherten anzupassen sei. Mehrfach ist von einem Kostendämpfungskonzept die Rede. Sein Ziel sei die langfristige Sicherung eines medizinisch hohen Niveaus bedarfsgerechter Gesundheitsversorgung einerseits und die Stabilität der Beitragssätze andererseits. Der Grundgedanke dieses Konzepts sei jedoch die einnahmeorientierte Ausgabepolitik. Hieraus wird abermals deutlich, dass die Kostendämpfung Vorrang hat und dass die Gesundheitsversorgung nur in dem Maße betrieben wird, wie es die finanziellen Möglichkeiten zulassen. Im Folgenden ist noch die Rede von der „Gefährdung der Beitragssatzstabilität“, der „Anpassung der Ausgabenentwicklung an die Grundlohnentwicklung“, von einer „kostengünstigeren Versorgung der Versicherten“ sowie von der „Verwirklichung wirksamer Kostendämpfung“. 4. BT-Drucks. 11 / 2237 (S. 151, 195) Vorgeschlagen wird der Ausbau von Wirtschaftlichkeitsprüfungen; die Qualität und Finanzierbarkeit der gesundheitlichen Versorgung sollen durch Ausschluss einer Neuzulassung oder Neuermächtigung von Ärzten, die das 55. Lebensjahr vollendet haben140, und die Ableistung einer einjährigen Vorbereitungszeit vor der Zulassung sichergestellt werden. Es wird auf eine kostengünstigere Arzneimittelversorgung hingewirkt und auf kostenbewusstes und wirtschaftliches Verhalten. Ärzte, die älter als 55 Jahre sind und erstmals zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen würden, gefährdeten die Wirtschaftlichkeit in der gesetzlichen Krankenversicherung. Auch diesen Worten kann nicht belastbar entnommen werden, dass der Gesetzgeber ein dem Gesundheitsschutz dienendes Konzept vor Augen hatte. Denn es wird nicht geltend gemacht, dass Ärzte, die das 55. Lebensjahr erreicht haben, eine Gefahr für die Patienten darstellen oder eine qualitativ minderwertige Versorgung böten. Einsparungen hatten Vorrang vor einer Verbesserung der Versorgung. 5. BT-Drucks. 11 / 3480 (S. 24) Es ist die Rede von der Sicherung einer funktionsfähigen Solidargemeinschaft, wozu die Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung verbessert werden müsste. Überversorgungen sollen abgebaut und die Wirtschaftlichkeit in den Versorgungsstrukturen verbessert werden. Frei werdende Ressourcen sollten für Beitragssatzsenkungen und den Ausgleich von Versorgungsdefiziten eingesetzt werden. Hier 140 Beachte auch die Abschaffung durch Art. 1 Nr. 6 d) Vertragsarztrechtsänderungsgesetz – VÄndG vom 22. 12. 2006 – BGBl. I, S. 3439 (3441), die zum 01. 01. 2007 in Kraft getreten ist.
A. Inhaltsbestimmung
45
könnte man auf den ersten Blick eine Maßnahme zur Qualitätsverbesserung vermuten, wenn der Überfluss in einigen Versorgungsbereichen verringert wird und es dadurch zu Leistungsverbesserungen in defizitären Bereichen kommt. Doch es fragt sich, wer definiert, was unter „Überversorgung“ zu verstehen ist und ob eine solche wirklich vorliegt? Auch ohne diese Fragen zu beantworten, ist eindeutig, dass die „Beseitigung der Versorgungsdefizite“ erst in Angriff genommen werden soll, nachdem Einsparungen stattgefunden haben. Eine Verbesserung der Versorgung unabhängig von der vermeintlichen Überversorgung soll nicht vorgenommen werden. Auch hieran lässt sich wieder das Primat des Finanziellen vor der Qualitätsverbesserung erkennen. Eine Verbesserung der Versorgung soll allenfalls nach Maßgabe der Finanzlage erfolgen.
6. BT-Drucks. 11 / 6380 (S. 246, 264) Auf diesen beiden Seiten wird dargestellt, dass in der Bundesrepublik Deutschland ein hohes Preisniveau für Arzneimittel besteht, wie ein Vergleich mit europäischen Staaten zeige. Hieraus kann allenfalls der Appell entnommen werden, die Preise für Arzneimittel zu senken. Ein niedrigerer Preis für das gleiche Präparat verbessert jedoch nicht die Qualität der Versorgung, sondern ausschließlich die Finanzlage der Kassen. 7. BT-Drucks. 11 / 7760 (S. 372) Diese Gesetzesbegründung betrifft Art. 33 Abs. 2 des Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands – Einigungsvertrag (EV) – vom 31. 08. 1990141 und enthält folgende Ausführung. „Die Vorschrift normiert einen konkreten Auftrag an den gesamtdeutschen Gesetzgeber zur Schaffung einer gesetzlichen Regelung über einen Abschlag auf den Herstellerabgabepreis von Arzneimitteln. Eine solche Regelung ist notwendig, um eine finanzielle Überforderung der Krankenkassen im beigetretenen Gebiet zu vermeiden. Solange die der Beitragsbemessung zugrunde liegenden Löhne der Versicherten im beigetretenen Gebiet noch wesentlich unter den vergleichbaren Löhnen im sonstigen Bundesgebiet liegen, können die Krankenkassen die sonst üblichen Arzneimittelpreise nicht bezahlen; wollte man ihnen diese Preise zumuten, würde dies zwangsläufig zu einem Defizit führen.“
Auch hier spielten gesundheitsschützende Aspekte ersichtlich keine Rolle. Vermieden werde sollte ein Defizit der Krankenkassen im Beitrittsgebiet, also eine finanzielle Notlage. 141 BGBl. II, S. 889 und Gesetz zu dem Vertrag vom 31. 08. 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands – Einigungsvertragsgesetz – und der Vereinbarung vom 18. 09. 1990 vom 23. 09. 1990, BGBl. II, S. 885.
46
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
8. BT-Drucks. 12 / 3209 (S. 60, 61) Diese Gesetzesbegründung wurde im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Zulässigkeit der Einführung eines Therapieschlüssels zitiert. Die ärztlichen Diagnosen sollen nach einem Schlüssel der Internationalen Klassifikation der Krankheiten standardisiert und übermittelt werden. Die Maßnahme soll die Datenübermittlung vom Arzt zur Krankenkasse vereinfachen. Die Vereinfachung des Verwaltungsaufwands innerhalb der Krankenkassen führt jedoch nicht unmittelbar zu einem verbesserten Gesundheitsschutz. Primär soll die Verwaltungstätigkeit, nicht die ärztliche Versorgung durch die Standardisierung effizienter werden.
9. BT-Drucks. 12 / 3608 (S. 66 ff., 73, 74 f., 81, 83, 88, 93, 97, 98, 156) Auf den S. 66 ff. ist die Rede von „Unwirtschaftlichkeiten“, „mangelnder Effizienz“, einer „dramatischen finanziellen Entwicklung“, einer „mittel- und längerfristigen Stabilisierung der Ausgabenentwicklung“, der „expansiven Ausgabenentwicklung“, „Ausgabendämpfung“ sowie der „Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Versorgung“ und ähnlichem. Schließlich findet sich folgendes Zitat: „Die medizinische Leistungsfähigkeit und die Versorgungsqualität der Krankenkassen wird nicht beeinträchtigt, die Wirtschaftlichkeit wird erhöht.“142
Hierdurch wird deutlich, dass es keineswegs um Qualitätsverbesserung geht. Die Einsparungen sollen erreicht werden, ohne dass der status quo der Versorgung geändert wird. Die Qualität der Versorgung und die Kostenersparnis, die der Grundsatz der finanziellen Stabilität bringen soll, sind zwei voneinander getrennte Aspekte. Diese Sicht wird auch nicht durch folgendes Zitat entkräftet: „. . . lässt sich eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung, die dem medizinischen und medizintechnischen Fortschritt angemessen berücksichtigt, auch ohne Beitragssatzerhöhung sicherstellen.“143
Auch wenn dieser Satz auf den ersten Blick so klingt, als ob gesundheitsschützende Aspekte betroffen seien, trifft dies nicht zu. Denn die zitierte Passage erschöpft sich lediglich in der Behauptung – vielleicht auch dem Wunsch – , dass die Qualität der Versorgung sich auch bei Einsparungen nicht verschlechtert. Ob diese Behauptung stimmt, kann dahinstehen. Denn selbst wenn dem so wäre, ergäbe sich hieraus nicht der Gesundheitsschutz als Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung. Die normale Entwicklung des medizinischen Fortschritts wird nicht behindert, jedoch wird eine möglichst optimale Versorgung der Bevölkerung nicht angestrebt oder gefördert. Stattdessen wird die Hoffnung ausgedrückt, dass sich der Markt schon zu helfen wisse. 142 143
BT-Drucks. 12 / 3608, S. 67. BT-Drucks. 12 / 3608, S. 69.
A. Inhaltsbestimmung
47
Die vom Bundesverfassungsgericht in Bezug genommenen Passagen auf S. 73 und 81 beschäftigen sich mit den Preisen für Arzneimittel in der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesetzesbegründung geht davon aus, dass die Arzneimittelpreise im internationalen Vergleich hoch seien. Festbeträge sollen das Preisniveau in diesem Marktsegment senken. Auf S. 74 f. wird ausgeführt, dass die Neuordnung der Finanzstrukturen der gesetzlichen Krankenversicherung erforderlich und beabsichtigt sei. Durch diese Neuordnung solle ein Wettbewerb zwischen den Kassen ermöglicht werden. Das Bundesverfassungsgericht entnimmt S. 83 der Gesetzesbegründung, dass durch die Aufgliederung des hausärztlichen und des fachärztlichen Versorgungsbereichs „gesundheitspolitische Ziele der Qualitätsverbesserung für die Versicherten neben finanzpolitischen Zielen der Kostendämpfung angestrebt“ würden. Tatsächlich findet sich in der zitierten Passage nur die Aussage, dass die Gliederung in die hausärztliche und die fachärztliche Versorgung konkretisiert werde, „um die notwendigen Grundlagen für die Aufwertung der hausärztlichen Tätigkeit sowie für die kassenärztliche Bedarfsplanung zu schaffen.“ Es fragt sich, ob „die Aufwertung der hausärztlichen Tätigkeit“ mit dem „gesundheitspolitischen Ziel der Qualitätsverbesserung für die Versicherten“ gleichgesetzt werden kann. Demgegenüber war die Bedarfsplanung stets als Instrument zur Kostensenkung gedacht144, so dass diesem Teil der Gesetzesbegründung durchaus das Ziel der Kostendämpfung entnommen werden kann, wie es das Bundesverfassungsgericht tut. Aber selbst wenn man der Auffassung ist, dass sich der Gesetzesbegründung tatsächlich beide Ziele entnehmen lassen, so ist doch klar, dass die gesundheitspolitischen Ziele der Qualitätsverbesserung nicht isoliert verfolgt werden, sondern nur zusammen mit finanzpolitischen Zielen. Die Finanzlage spielt stets eine Rolle und beeinflusst andere Aspekte, wie zum Beispiel die Qualitätsverbesserung, sofern diese überhaupt betroffen ist. Im Nichtannahmebeschluss vom 12. 07. 2000 wird auf S. 88 der Bundestagsdrucksache 12 / 3608 verwiesen. Dort wird die Einführung des degressiven Punktwerts begründet. Laut der Gesetzesbegründung zu § 85 Abs. 4 b SGB V „werden die Krankenkassen an Kostenvorteilen und Rationalisierungsmöglichkeiten in umsatzstarken Praxen beteiligt“. Im weiteren wird nur die Funktionsweise des degressiven Punktwerts erläutert. Wenn die Krankenkassen an die Ärzte weniger zahlen müssen, so handelt es sich um Einsparungen der Krankenkassen. Es ist also einzig die finanzielle Situation der Krankenkassen betroffen. Andere Aspekte, wie zum Beispiel die Qualität der Versorgung, werden nicht angesprochen und offensichtlich auch nicht verfolgt. Denn wenn ein (Zahn-)Arzt weniger oder gar kein Geld für dieselbe Behandlung erhält, wird man nicht erwarten können, dass die Versicherten in Zukunft besser als bislang versorgt würden. 144 Ausgehend von der These der angebotsinduzierten Nachfrage, sollte durch die Vermeidung steigender Arztzahlen einem Kostenanstieg begegnet werden. Vgl. hierzu Thorsten Kingreen, Sozialstaatsprinzip, S. 530.
48
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
S. 93 der Bundestagsdrucksache 12 / 3608 betrifft § 95 Abs. 7 Satz 3 SGB V, der die Altersgrenze von 68 Jahren für Vertrags(zahn)ärzte einführt145. Durch die dergestalt eingeführte Beschränkung der Arztzahlen soll die Finanzierbarkeit der gesetzlichen Krankenversicherung nicht nur zu Lasten jüngerer Ärzte sichergestellt werden. Dies ist abermals ein finanzieller Aspekt und keiner, welcher der Qualität der vertragsärztlichen Versorgung dienen soll. Die Formulierung, dass dies nicht ausschließlich zu Lasten der jüngeren Ärzte gehen soll, führt zu keinem anderen Ergebnis. Denn hierdurch wird nur präzisiert, wer das finanzielle Opfer innerhalb der Ärzteschaft zu tragen hat, es kann jedoch nicht geleugnet werden, dass den Ärzten ein finanzielles Opfer abverlangt wird. Durch diese Erläuterungen wird ebenfalls deutlich, dass dem Grundsatz der finanziellen Stabilität kein gesundheitsschützender Aspekt innewohnt. Denn es kann nicht erklärt werden, weshalb die Qualität der ärztlichen Versorgung steigen und die Gesundheitsvorsorge verbessert werden soll, wenn es weniger Ärzte gibt. Dies wird auch durch einen Kammerbeschluss des Bundesverfassungsgerichts bestätigt, indem ausgeführt wird, dass die Begrenzung der Arztzahlen der Kostenreduzierung, nicht aber der Qualitätsverbesserung dient146. Auch auf S. 97 f. wird die Begrenzung der Arztzahlen angesprochen. Es wird in der Gesetzesbegründung die Annahme vertreten, dass steigende Arztzahlen zu steigenden Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung führten. Dies brächte eine Gefahr für die Finanzierbarkeit des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung mit sich. Andere, als die genannten Kostengründe, werden in diesem Zusammenhang nicht genannt. In Bezug auf das Preismoratorium für Arzneimittel führt die Gesetzesbegründung auf S. 156 aus: „Durch die Regelung wird eine finanzielle Entlastung der gesetzlichen Krankenversicherung bei den Arzneimittelausgaben für die Jahre 1993 und 1994 erreicht. Die Preisabsenkung wird auf solche apothekenpflichtigen Arzneimittel beschränkt, für die noch kein Festbetrag nach § 35 SGB V festgesetzt ist. Damit werden auch die Hersteller dieser Arzneimittel zur Entlastung der gesetzlichen Krankenversicherung herangezogen.“
Andere Belange, wie etwa der Gesundheitsschutz der Versicherten, werden nicht angesprochen, sondern ausschließlich die erwähnte finanzielle Entlastung der gesetzlichen Krankenversicherung.
10. BT-Drucks. 13 / 4615 (S. 6, 8, 11) Auf S. 6 wird dargelegt, dass die wirtschaftlichen Fundamente des Sozialstaates gefährdet seien, unter anderem durch ein hohes Niveau von Sozialabgaben. Ange145 Siehe auch die Änderungen durch das VÄndG vom 22. 12. 2006 – BGBl. I, S. 3439 (3441). 146 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2005, S. 273 (274).
A. Inhaltsbestimmung
49
strebt werde eine Konsolidierung der Sozialversicherungshaushalte, die Stabilisierung des Beitragssatzniveaus sowie die Begrenzung der Ausgabenentwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das Beitragsentlastungsgesetz solle der Selbstverwaltung von Krankenkassen und Leistungserbringern mehr Gestaltungsspielraum im Vertrags- und Leistungsbereich zur Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven geben. Gleichzeitig solle die Finanzverantwortung der Krankenkassen gestärkt werden. Auf S. 8 wird die Absenkung des Krankengeldes um 10 % mit einer Angleichung an das Niveau der Lohnersatzleistungen anderer Versicherungszweige begründet. Auf S. 11 schließlich ist vom Einsparpotential im Hinblick auf den Abbau von Fehlbelegungen in Krankenhäusern die Rede. Ziel der Neuregelung sei eine Einsparung von 800 Mio. DM. Insgesamt sollen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung reduziert werden, was zu weiteren Einsparungen in beträchtlicher Höhe führen solle. Kein einziges Mal ist von Qualitätsverbesserung die Rede. Alleiniges Ziel ist die Kostenreduzierung.
11. BT-Drucks. 15 / 28 (S. 14) Die Gesetzesbegründung führt aus, dass durch Anhebung der Versicherungspflichtgrenze gut verdienende Arbeitnehmer mit „guten Risiken“ weniger leicht in die Privatversicherung wechseln können. Dadurch würden die Wettbewerbsbedingungen der gesetzlichen Krankenversicherung verbessert, die Einnahmen könnten erhöht und die gesetzliche Krankenversicherung insgesamt entlastet werden. Dies trage „dazu bei, die dauerhafte Leistungsfähigkeit dieser Solidargemeinschaft zu erhalten.“ Von dem Gesundheitsschutz oder der Qualitätsverbesserung der vertragsärztlichen Leistungen ist an keiner Stelle die Rede. Es geht allein um die Verbesserung der Einnahmesituation der gesetzlichen Krankenversicherung.
12. BT-Drucks. 15 / 75 (S. 1) Diese Drucksache enthält den Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der gesetzlichen Rentenversicherung (Beitragssatzsicherungsgesetz – BSSichG). Das Gesetz solle helfen, „die Finanzgrundlagen der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung zu stärken, das Beitragsniveau zu stabilisieren und im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) finanziellen Spielraum für notwendige strukturelle Reformmaßnahmen zu schaffen.“ Daraufhin werden nur finanzielle Auswirkungen aufgeführt. Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass unter dem Grundsatz der finanziellen Stabilität allein finanzielle Erwägungen zu verstehen sind, die dem Systemerhalt der gesetzlichen Krankenversicherung dienen sollen.
4 Schaks
50
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
13. Ergebnis zu III. Insgesamt lässt sich also feststellen, dass (fast) ausschließlich finanzielle Erwägungen eine Rolle spielten. Sofern andere Belange überhaupt belastbar der Gesetzesbegründung entnommen werden können, spielen sie nur eine untergeordnete Rolle und werden nie allein, sondern stets mit oder neben finanziellen Erwägungen genannt.
IV. Die Heranziehung gesetzlicher Bestimmungen mit Bezug zur finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Es gibt im Gesundheitsrecht einige gesetzliche Bestimmungen, die den Begriff der Beitragssatzstabilität verwenden, so zum Beispiel § 71 Abs. 1 Satz 1, § 85 Abs. 3 Satz 1, § 85 a Abs. 4 Satz 1, § 86 Abs. 2 Satz 2 SGB V, § 6 Abs. 1 Satz 3 BPflV. Möglicherweise kann dieser Begriff bei der Inhaltsermittlung des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung weiterhelfen. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass die Heranziehung der gesetzlichen Bestimmungen nur sehr behutsam erfolgen kann. Denn der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität kann nicht mit dem der Beitragssatzstabilität identisch sein, schließlich wurden durch den Grundsatz der finanziellen Stabilität nicht nur Maßnahmen zur Stabilisierung der Beitragssätze gerechtfertigt, sondern auch solche, die die Beitragssätze erhöhen. § 71 Abs. 1 Satz 1 SGB V enthält die gesetzliche Statuierung des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität 147. Die Legaldefinition lautet: „Die Vertragspartner auf Seiten der Krankenkassen und der Leistungserbringer haben die Vereinbarungen über die Vergütungen nach diesem Buch so zu gestalten, dass Beitragssatzerhöhungen ausgeschlossen werden, es sei denn, die notwendige medizinische Versorgung ist auch nach Ausschöpfen von Wirtschaftlichkeitsreserven ohne Beitragssatzerhöhungen nicht zu gewährleisten (Grundsatz der Beitragssatzstabilität).“
Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität besagt, dass Beitragssatzerhöhungen erst dann erfolgen dürfen, wenn die notwendige medizinische Versorgung auch durch Ausschöpfen von Wirtschaftlichkeitsreserven nicht mehr gewährleistet werden kann148. Es geht also nicht um eine Verbesserung der Versorgung, sondern um die Beibehaltung eines status quo. Dieselbe medizinische Versorgung soll nur zu geringeren Kosten garantiert werden. Die notwendige medizinische Versorgung ist nur eine Untergrenze, die nicht unterschritten werden darf. Kommt es doch zu Bei147 Siehe hierzu Ulrich Freudenberg, Beitragssatzstabilität; Helge Sodan / Olaf Gast, NZS 1998, S. 497 ff. 148 Rainer Hess, in: Kasseler Kommentar, Bd. 1, § 71 SGB V Rn. 3 (Stand der Bearbeitung: Mai 2003).
A. Inhaltsbestimmung
51
tragssatzerhöhungen, dann dienen diese nicht der Qualitätsverbesserung, sondern nur dem Ausgleich der Mehrausgaben. Dieses finanzielle Verständnis wird auch durch den Normzweck bestätigt. Denn durch die Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 1 SGB V sollen die Leistungsfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit der gesetzlichen Krankenversicherung sowie deren Finanzierung zu vertretbaren Beitragssätzen auf Dauer gesichert werden149. Die Qualität der Versorgung oder ihre Verbesserung werden nicht als Ziele genannt, sondern Finanzierung, Wirtschaftlichkeit und vertretbare, also niedrige Beitragssätze. Wenn überhaupt, kann man im Begriff der Leistungsfähigkeit ein qualitatives Element entdecken, wenn man davon ausgeht, dass nur ein System, das die Bevölkerung tatsächlich ausreichend versorgt, leistungsfähig ist. Jedoch ist die Leistungsfähigkeit hierbei nur eines von mehreren Zielen. Die Qualität der Versorgung wäre im Begriff der Leistungsfähigkeit so versteckt enthalten, dass man nur davon ausgehen kann, dass die Angemessenheit der Versorgung nur eine Untergrenze darstellt, die nicht unterschritten werden darf, um überhaupt noch von Krankenversorgung sprechen zu können. Insgesamt kann aber auch den gesetzlichen Bestimmungen nicht entnommen werden, dass der Grundsatz der finanziellen Stabilität ein die Gesundheit unmittelbar schützender Belang ist.
V. Literaturstimmen Die Äußerungen im Schrifttum zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung sind trotz ihrer geringen Anzahl recht heterogen. Die Stellungnahmen stammen aus einem Zeitraum von 1989 bis 2005. Es ist zu berücksichtigen, dass die älteren literarischen Stellungnahmen nur auf wenige Entscheidungen zu diesem Grundsatz Bezug nehmen konnten.
1. Die Ansicht von Renate Jaeger Renate Jaeger hatte als Mitglied der 2. Kammer des Ersten Senats maßgeblichen Einfluss auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich des Sozialrechts. Ihre Ausführungen sind aufgrund ihrer Mitwirkung an zahlreichen Entscheidungen von besonderem Interesse, zumal ihre Darstellung aus dem Jahre 2003 stammt und damit vergleichsweise aktuell ist.
149
4*
BT-Drucks. 11 / 2237, S. 191 zu § 79.
52
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
a) Darstellung Sie versteht die Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung als „Gesamtbegriff für das Ziel, auch wirtschaftlich Schwachen den vollen Zugang zu ärztlicher Versorgung, Krankenhausversorgung, Arznei- und Heilmitteln und sonstigen therapeutischen Einrichtungen zu finanziell tragbaren Bedingungen tatsächlich zu gewährleisten.“150
Oder knapper: „Krankenversicherungsschutz zu bezahlbaren Konditionen“151.
Diese Definition lässt sich in vier Elemente aufspalten: Erstens handelt es sich bei dem genannten Grundsatz um ein Ziel oder einen Zweck, der von der Gesetzgebung verfolgt werden soll. Zweitens geht es um die medizinische Versorgung und drittens um tragbare Kosten. Viertens wird der Personenkreis angesprochen, für den die gesetzliche Krankenversicherung stabil sein soll. Wenn auch die wirtschaftlich Schwachen vollen Zugang haben sollen, soll sich jedermann eine adäquate ärztliche Versorgung leisten können. Sie bezeichnet den Grundsatz der Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung als „multifunktionales Argument, das sowohl gegenüber den Versicherten als auch gegenüber den Leistungserbringern oder etwaigen Konkurrenten in der Privatversicherung tragfähig sein kann“152. Dieser Grundsatz sei ein „schillernder Gemeinwohlbelang“; er stehe als „argumentatives Einfallstor“ vielen Aspekten offen153. b) Kritik In sprachlicher Hinsicht fordern die Ausführungen von Jaeger im Hinblick auf den Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung zu Kritik heraus. Der Begriff „schillernder Gemeinwohlbelang“ aus der Feder einer Richterin am Bundesverfassungsgerichts für eine Argumentationsfigur, mit deren Hilfe auch detailliert begründete Verfassungsbeschwerden mit wenigen Sätzen zurückgewiesen werden, ist zumindest ungewöhnlich. Auch die Worte „multifunktional“ und „argumentatives Einfallstor“ erwecken eher den Eindruck einer gewissen Beliebigkeit und nicht den begrifflicher Präzision. Die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung als argumentative Allzweckwaffe, die jedem und allem entgegengehalten werden kann? Auch wenn die Formulierungen in der Wortwahl befremden mögen, so decken sie sich doch inhaltlich mit den bisherigen Ergebnissen. Es wurde bereits festgestellt, dass auch widersprüchliche bis ent150 151 152 153
Renate Jaeger, System, S. 15 (37). Renate Jaeger, System, S. 15 (36). Renate Jaeger, System, S. 15 (37); dies., NZS 2003, S. 225 (233). Renate Jaeger, System, S. 15 (37); dies., NZS 2003, S. 225 (233).
A. Inhaltsbestimmung
53
gegengesetzte Maßnahmen des Gesetzgebers durch diesen Grundsatz gerechtfertigt wurden. Die Bezeichnung als „multifunktional“ kann als freundliche Umschreibung dieses Befundes gewertet werden. Das Vertragsarztrecht ist eine komplexe Materie, bei der zahlreiche Personengruppen und Institutionen (Versicherte, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Kassenärztliche Vereinigungen, Krankenkassen usw.) mit ihren unterschiedlichen Interessen aufeinander treffen. Solche mehrpoligen Rechtsbeziehungen zu regeln, ist schwieriger als die zweipolige Rechtsbeziehung Staat – Bürger. Diese Schwierigkeiten dürfen aber nicht zu einer Beliebigkeit in der Argumentation führen. Aus tatsächlichen Schwierigkeiten beginnen Gemeinwohlbelange nicht zu „schillern“; es sei denn, man wünscht die Beliebigkeit zur Stärke des Grundsatzes zu machen. Das kann aber niemand wollen. In inhaltlicher Hinsicht sind vor allem zwei Dinge problematisch. Erstens: Stabil bedeutet beständig, sich im Gleichgewicht haltend. Dieses Wort sagt aber nichts über die Kosten für den Einzelnen aus. Stabil kann die Kassenlage auch dann sein, wenn bei hohen Ausgaben regelmäßig hohe Einnahmen fließen; dass die Höhe der Beiträge für einen einzelnen Versicherten oder die Gemeinschaft der Versicherten dann möglicherweise unerträglich hoch sind, ist sicherlich nicht wünschenswert. Nur: Stabil ist die Kassenlage dann trotzdem. Dann kann es sogar heißen, den Versicherten besonders hohe Kosten abzuverlangen, damit die Finanzlage stabil bleibt. Wenn Jaeger dennoch auf die finanziell tragbaren Bedingungen abstellt, dann wird deutlich, dass es um möglichst niedrige Kosten geht. Hierbei wird jedoch außer acht gelassen, dass auch Beitragserhöhungen durch den Grundsatz gerechtfertigt wurden154. Zweitens ist fraglich, was unter „vollem Zugang“ zur ärztlichen Versorgung zu verstehen ist. Heißt das, die bestmögliche Versorgung soll gewährleistet werden? Dann läge ein Konflikt vor. Denn qualitativ hochwertige und umfassende Versorgung ist teuer, was sich gerade nicht mit der Kostensenkung vereinbaren lässt. Hier wird einmal mehr deutlich, dass gegensätzliche Maßnahmen durch den Grundsatz der finanziellen Stabilität gerechtfertigt wurden. Auch wurde bei der Analyse der Rechtsprechung klar, dass gesundheitsschützende Belange, wie zum Beispiel die Qualität der Versorgung, gerade keine Rolle spielten. Dies bestätigt das Ergebnis der bisherigen Auslegungen, dass die einzige Konstante am Grundsatz des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung die Kostenreduzierung ist und anderen Aspekten keine Bedeutung zugemessen wird. Zutreffender ist deshalb die zuvor zitierte Kurzdefinition: Krankenversicherungsschutz zu bezahlbaren Preisen155.
154 155
BVerfGE 103, 392 (404). Siehe Erstes Kapitel, Fn. 151.
54
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
2. Die Ansicht von Stephan Rixen a) Darstellung Stephan Rixen sieht den Begriff der finanziellen Stabilität als Pleonasmus an, da sozialstaatliches Engagement stets auf finanzielle Mittel angewiesen sei. Deshalb seien Sozialversicherungssysteme nur dann stabil, wenn sie finanziell ausreichend ausgestattet seien. Seiner Meinung nach stelle der Begriff der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung ein Gemeinwohlziel dar, das sich als Funktionieren des staatlichen Sozialversicherungssystems umschreiben lasse. Der Gesetzgeber dürfe für das Funktionieren des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung sorgen und er müsse auch die dafür erforderlichen Mittel bereit stellen dürfen156. b) Kritik Rixens Definition des Inhalts des Begriffs „Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung“ erscheint sehr weit, jedoch korrespondiert diese Weite mit den vielfältigen Situationen, in denen das Bundesverfassungsgericht die Formel herangezogen hat. Im Unterschied zu Jaeger diskutiert Rixen das Problem der Finanzierbarkeit staatliche Sozialversicherungssysteme erheblich kritischer157. Im wesentlichen stimmt seine Auffassung mit dem bislang ermittelten Ergebnis dieser Untersuchung überein.
3. Die Ansicht von Walter Leisner a) Darstellung Walter Leisner untersucht, ob die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung ein grundgesetzliches Gebot darstellt, ob es einen verfassungsrechtlichen Beitragssatzerhöhungsstopp in der gesetzlichen Krankenversicherung gibt158. Anders als die meisten der vorgenannten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nähert er sich der Problematik der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung aus Sicht der Beitragszahler. Sein Ausgangspunkt ist nicht die Belastung der Leistungserbringer, sondern der Versicherten. Er versteht die Begriffe „Funktionsfähigkeit“ und Leistungsfähigkeit“ im Hinblick auf die gesetzliche Krankenversicherung als Synonyme. Gemeint sei, dass die gesetzlichen Krankenkassen „insgesamt“, „eben in ihrer System-Einheit“ die ihnen zugewiesenen Aufgaben erfüllen können159. 156 157 158 159
Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 310. Vgl. Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 317 ff. Walter Leisner, Finanzielle Stabilität, S. 15 ff. Walter Leisner, Finanzielle Stabilität, S. 19.
A. Inhaltsbestimmung
55
Zweck der finanziellen Stabilität sei die Erhaltung eines funktionsfähigen Systems der gesetzlichen Krankenversicherung, das System müsse die an es gestellten Anforderungen erfüllen können. Hinter dem Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung verberge sich mehr als die banale Erkenntnis, dass das, was der Gesetzgeber einer Kasse an Aufgaben stelle, von dieser auch erfüllt werden können müsse. Vielmehr komme es entscheidend auf den Hintergrund der gesetzlichen Krankenversicherung an: Die soziale Schutzbedürftigkeit sei Rechtfertigung und zugleich Grenze des Versicherungszwangs und solidarischer Umverteilung160. Seiner Ansicht nach ist die Formel aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts deshalb folgendermaßen zu verstehen: „Der Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass diese Kassen, im Namen ihrer gesetzlichen Aufgabenerfüllung der Versorgung Schutzbedürftiger, nicht mehr zu erstatten haben, als sie an Beiträgen einnehmen; sie dürfen also, das ist die betriebswirtschaftlich selbstverständliche Folge, durch ihre gesetzliche Aufgabenstellung nicht in die Insolvenz getrieben werden. Und der Gesetzgeber muss eine solche nicht etwa durch Staatszuschüsse abwenden, die es herkömmlich in diesem Bereich nie oder nur marginal gegeben hat. Für einen Beitragserhöhungsstopp bedeutet dies aber nun gerade keinerlei Rechtfertigung, im Gegenteil: Alle Mittel, die zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der Sicherung der ,sozial Schutzbedürftigen‘ erforderlich sind, dürfen auch, müssen sogar, von den Mitgliedern der Versichertengemeinschaft gefordert werden. Nicht mehr und nicht weniger ergibt sich aus dem Begriff der ,finanziellen Stabilität‘ der Gesetzlichen Krankenkassen.“161
Leisner versteht den Grundsatz als die Ausgeglichenheit von Einnahmen und Ausgaben. Die gesetzliche Krankenversicherung ist dann stabil und damit funktionsfähig, wenn sie die gesetzlichen Aufgaben mit den eigenen Mitteln erfüllen kann. Der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung sei somit nicht mit dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität gleichzusetzen.
b) Kritik Leisner bezieht sich in seiner Untersuchung vor allem auf die Beitragssatzstabilität und untersucht diese aus der Sicht der Versicherten und der Arbeitgeber. Dies kann jedoch nur ein Teil des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung sein, da die meisten Entscheidungen zu Einschränkungen von Rechten der Leistungserbringern, nicht aber der Versicherten ergingen. Jedoch besteht insoweit Übereinstimmung, als der Grundsatz der finanziellen Stabilität auch aus der Sicht Leisners das Gleichgewicht von Einnahmen und Ausgaben zum Zwecke der Sicherung der sozial Schutzbedürftigen betrifft.
160 161
Walter Leisner, Finanzielle Stabilität, S. 20. Walter Leisner, Finanzielle Stabilität, S. 20 f.
56
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
4. Die Ansicht von Ulrich Freudenberg a) Darstellung Ulrich Freudenberg untersucht den Grundsatz der Beitragssatzstabilität, wie er im SGB V verwendet und dort – zum Zeitpunkt seiner Arbeit – in § 141 Abs. 2 Satz 3162 legaldefiniert wurde. Ausgehend von der Legaldefinition entnimmt er dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität drei Handlungsanweisungen, nämlich die Vermeidung von Beitragssatzerhöhungen, die Gewährleistung der notwendigen medizinischen Versorgung sowie die Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven163. Bei der Frage des Verhältnisses des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität bei der Vereinbarung der Gesamtverträge (§ 71 Abs. 2 SGB V) zum Gebot der angemessenen Vergütung ärztlicher Leistungen (§ 71 Abs. 1 SGB V)164 führt Freudenberg aus, dass die Stabilisierung der Beitragssätze Teil des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung sei165.
b) Kritik Seine Überlegungen betreffen vor allem das einfache Recht oder gehen von diesem aus, weshalb seine Ergebnisse nur begrenzt auf die – hier untersuchte – Ebene des Verfassungsrechts übertragen werden können. Da sich auch Freudenberg – entsprechend der Thematik seiner Arbeit – nur mit der Beitragssatzstabilität auseinandersetzt, bezieht er sich nur auf einen Teilbereich des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung.
5. Die Ansicht von Martin Stockhausen a) Darstellung Stockhausen leitet in unterschiedlichem Maße Belange, die Eingriffe in Art. 12 Abs. 1 GG zu rechtfertigen vermögen, aus dem Gemeinwohlbelang „Volksgesundheit“ ab. Mehrere Gemeinwohlbelange nennt er im Zusammenspiel von ärztlicher Berufsfreiheit und Kostendämpfung166, von denen jedoch nur die Punkte „System 162 § 141 SGB V wurde mit Wirkung vom 01. 01. 2004 aufgehoben durch das GKV-Modernisierungs-Gesetz vom 14. 11. 2003, BGBl. I, S. 2190 (2227, 2257). 163 Ulrich Freudenberg, Beitragssatzstabilität, S. 35 ff., 40 ff., 48 ff. 164 Vgl. hierzu auch Josef Isensee, VSSR 1995, S. 321 (340 ff.); Helge Sodan / Olaf Gast, NZS 1998, S. 497 ff.; Raimund Wimmer, MedR 1998, S. 533 (534 ff.). 165 Ulrich Freudenberg, Beitragssatzstabilität, S. 107 mit Fn. 509, wo er ausdrücklich auf die Entscheidungen BVerfGE 68, 193 (218) und BVerfGE 70, 1 (30) verweist. 166 Martin Stockhausen, Berufsfreiheit, S. 73 ff.
A. Inhaltsbestimmung
57
und Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung“ und „Beitragsstabilität und Kostendämpfung“ zur Begriffsbestimmung des Inhaltes des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung herangezogen werden können. Das System der kassenärztlichen Versorgung und dessen Leistungsfähigkeit seien eng miteinander verbunden. Bei beiden Aspekten handele es sich um überragend wichtige, absolute Gemeinschaftsgüter167. Bezüglich der Beitragsstabilität und der Kostendämpfung, die er als untrennbar miteinander verbunden sieht, bejaht Stockhausen die Eigenschaft als eigenständige, die Berufsfreiheit begrenzende Schrankenwerte168. Zum Aspekt der Kostendämpfung zitiert er eine Passage des Bundesverfassungsgerichts, nach der die Begrenzung der Ausgabenentwicklung zur Stabilisierung der Beitragssätze bei gleichzeitiger Beibehaltung eines hohen Niveaus einer bedarfsgerechten medizinischen Versorgung eine dem Gemeinwohl dienende Zielsetzung sei169. Das Ziel der Kostendämpfung sei der Erhalt des Systems der kassenärztlichen Versorgung. Wenn die Ausgabenentwicklung das System der gesetzlichen Krankenversicherung gefährde, würde das Ziel der Kostendämpfung zu einem wichtigen Gemeinschaftsgut. Grundsätzlich hätten Beitragsstabilität und Kostendämpfung aber nicht den Rang überragend wichtiger, absoluter Gemeinschaftsgüter170.
b) Kritik Bei der Würdigung der Ergebnisse von Stockhausen gilt es zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt des Abschlusses seiner Arbeit erst zwei Entscheidungen171 zum Grundsatz der finanziellen Stabilität vorlagen. Dies erklärt, weshalb er auf die Volksgesundheit rekurriert, obwohl das Bundesverfassungsgericht die Volksgesundheit als etwas anderes, als einen anderen Gemeinwohlbelang ansieht. Er wird dementsprechend auch nicht vom Bundesverfassungsgericht in den Entscheidungen zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung angewandt172. Die Ausführungen zur Qualität der Versorgung können angesichts des Ergebnisses der Rechtsprechungsanalyse nicht überzeugen. Aber auch Stockhausen sieht die Kostendämpfung zum Zwecke der Systemerhaltung als einen zentralen Punkt in der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts an.
Martin Stockhausen, Berufsfreiheit, S. 76. Martin Stockhausen, Berufsfreiheit, S. 77 f. 169 Martin Stockhausen, Berufsfreiheit, S. 78 mit Verweis auf BVerfGE 68, 193 (218). 170 Martin Stockhausen, Berufsfreiheit, S. 78. 171 BVerfGE 68, 193 ff.; 70, 1 ff. 172 Einzige Ausnahme ist insoweit BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2001, S. 883 (884), wo der Gemeinwohlbelang der Volksgesundheit zwar erwähnt, aber nicht herangezogen wird. 167 168
58
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
6. Zusammenfassung zu V. In der Literatur zum Grundsatz der finanziellen Stabilität wird der Schwerpunkt auf die Auswirkungen dieses Grundsatzes, seine rechtfertigende Kraft gelegt, der Inhalt dieses Grundsatzes wird kaum ausgeleuchtet. Aber auch aus den wenigen Aussagen lässt sich die Erkenntnis gewinnen, dass der wesentliche Gehalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung die Kostensenkung im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung ist. Dieses System soll funktionsfähig und damit überhaupt erhalten werden. Das bestätigen auch die Ausführungen von Autoren, die – ohne sich vertieft mit dem Grundsatz beschäftigt zu haben – den Grundsatz ganz selbstverständlich ausschließlich mit der Kostenreduzierung gleichstellen, ohne dass der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung gesundheitsschützende Aspekte zugebilligt würden: „Die Handlungsbeschränkungen des Arztes finden damit ihre Rechtfertigung in der Legitimation der wirtschaftlich motivierten und zur Sicherung des Systemfortbestandes erforderlichen Leistungsbeschränkungen der gesetzlichen Krankenversicherung.“173 „Als eine dem Gemeinwohl dienende gesetzliche Zielsetzung des Maßgabevorbehalts nebst seiner Konkretisierungen kommt vorliegend allein in Betracht die Sicherung der finanziellen Stabilität und Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung oder, was in der Sache auf das Gleiche hinausläuft, das Ziel der Kostendämpfung im Gesundheitswesen bzw. der Bezahlbarkeit der Krankenhausleistungen.“174
Klückmann, der den Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung mit dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität nach § 71 SGB V gleichsetzt, führt aus: „Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität i. S. der Ausgabenbegrenzung als hauptsächlichster Stützpfeiler dieser Finanzierung und die Begrenzung von Beitragssatzerhöhungen als primäres Element des Grundsatzes kann deshalb verfassungsrechtlich nicht zweifelhaft sein [ . . . ].“175
Insofern besteht Übereinstimmung mit den Ergebnissen der vorangegangenen Konkretisierungsmethoden.
Winfried Kluth, MedR 2005, S. 65 (70) – Hervorhebung nicht im Original. Otto Depenheuer, Krankenhauswesen, S. 218 – Hervorhebung nicht im Original. 175 Harald Klückmann, in: Hauck / Noftz, SGB V, Bd. 3, K § 71 Rn. 18 (Stand der Bearbeitung: III / 05). 173 174
A. Inhaltsbestimmung
59
VI. Die Urteile des Bundessozialgerichts vom 08. und 09. 12. 2004 Am 08. und 09. 12. 2004 hat der 6. Senat des Bundessozialgerichts einige grundsätzliche Urteile zur vertragsärztlichen Versorgung gefällt176. In diesen Entscheidungen befasst sich das Gericht ausführlich auch mit verfassungsrechtlichen Fragen. Exemplarisch soll ein Urteil herausgegriffen und die darin enthaltenen Ausführungen zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung untersucht werden. Das Bundessozialgericht billigt der gesetzlichen Krankenversicherung Verfassungsrang zu177. Von dieser Prämisse ausgehend, führt das Bundessozialgericht aus, dass der Gesetzgeber nicht frei sei, ob dieser ein System erhalten oder schaffen wolle, „das allen oder zumindest der großen Mehrzahl der Bürger eine angemessene Versorgung im Krankheitsfall gewährleistet. Die Sicherung einer solchen angemessenen Versorgung zu bezahlbaren Konditionen“ sei „ein Gemeinwohlbelang von überragender Wichtigkeit“178. Eine weitergehende Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität erfolgt zwar nicht, der Senat verweist jedoch ausdrücklich auf die Ausführungen von Jaeger („Krankenversicherungsschutz zu bezahlbaren Konditionen“179). Somit kann davon ausgegangen werden, dass das Bundessozialgericht ebenfalls von dem zuvor ermittelten Inhalt des Grundsatzes ausgeht. Denn es verweist nicht nur auf die Ausführungen von Jaeger, sondern das Gericht greift auch die von ihr genannten Elemente des Grundsatzes auf: Personenkreis, Kosten, Gemeinwohlbelang, Gesundheitswesen.
VII. Teleologische Auslegung Unter teleologischer Auslegung versteht man eine Interpretation „gemäß den erkennbaren Zwecken und dem Grundgedanken einer Regelung. Die einzelne Bestimmung ist im Rahmen ihres möglichen Wortsinns und in Übereinstimmung mit dem Bedeutungszusammenhang des Gesetzes in dem Sinne auszulegen, der den Zwecken der gesetzlichen Regelung und dem Rangverhältnis dieser Zwecke optimal entspricht. Dabei hat der Auslegende stets die Gesamtheit der Zwecke im Auge zu behalten, die einer Regelung zugrunde liegen.“180 176 Vgl. den Presse-Vorbericht Nr. 68 / 04 des Bundessozialgerichts vom 29. 11. 2004 sowie die Presse-Mitteilung des Bundessozialgerichts Nr. 68 / 04 vom 10. 12. 2004 (zitiert nach: www.bundessozialgericht.de). 177 BSG, Urteil vom 09. 12. 2004, Az.: B 6 KA 44 / 03 R, Rn. 145 ff. (zitiert nach: www. bundessozialgericht.de). 178 BSG, Urteil vom 09. 12. 2004, Az.: B 6 KA 44 / 03 R, Rn. 147 (zitiert nach: www.bundessozialgericht.de). 179 Renate Jaeger, NZS 2003, S. 225 (232). 180 Karl Larenz, Methodenlehre, S. 332.
60
1. Kap.: Der Inhalt des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
Methodisch einwandfrei – d. h. ohne normgelöste subjektive „Wertung“ – lassen sich „Sinn und Zweck“ einer zu deutenden Vorschrift jedoch nur aus einer grammatischen, historisch-genetischen und / oder systematischen Interpretation erschließen; neben diesen allgemein anerkannten Auslegungsregeln ist die teleologische Interpretation kein selbständiges Element der Konkretisierung181. Die ratio legis ist vielmehr erst das Ergebnis vorausgegangener Auslegung. Dennoch sind Sinn und Zweck einer Norm von erheblicher Bedeutung. Verfassungsinterpretation ist „notwendig Anwendung der teleologischen Methode als Zusammenfassung von sprachlicher, historischer und systematischer Auslegung, nicht aber als vierte Auslegungsart neben diesen drei“182. Deshalb kann durch die teleologische Auslegung nicht mehr gewonnen werden: Anhand anderer Auslegungsmethoden wurden Sinn und Zweck des Grundsatzes ermittelt. Er dient – mit dem ermittelten Inhalt – als rechtfertigender Belang bei Eingriffen in die Berufsfreiheit. Der Grundsatz ist der Zweck im Rahmen der verfassungsrechtlichen Prüfung der Verhältnismäßigkeit von Grundrechtseingriffen. Der Grundsatz dient der Kostenersparnis oder Einnahmesteigerungen.
VIII. Ergebnis zu A. Im Einzelfall wurden also sehr unterschiedliche, ja gegenläufige Maßnahmen durch den Grundsatz gerechtfertigt. Einzige Konstante ist, dass die Sicherung von Einnahmen oder die Vermeidung von Ausgaben bezweckt wird. Einen gesundheitsschützenden Aspekt weist der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung nicht auf.
B. Ergebnis zum Ersten Kapitel Der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung ist ein vom Gesetzgeber verfolgter Zweck im Rahmen der Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen. Sein Inhalt lässt sich wie folgt verstehen: Gemeint sind Einnahmesteigerungen oder Vermeidung von Kosten, also ausschließlich finanzielle Aspekte. Die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung und die Qualität der vertragsärztlichen Versorgung werden vom Bundesverfassungsgericht zwar gelegentlich angeführt, diese Belange trugen die Entscheidungen jedoch nicht. Denn durch den Grundsatz der finanziellen Stabilität wurden auch Leistungskürzungen, 181 Rolf D. Herzberg, JuS 2005, S. 1 (6 ff.); Konrad Hesse, Grundzüge, Rn. 68; Friedrich Müller / Ralf Christensen, Methodik I, Rn. 364; Horst Schlehofer, JuS 1992, S. 572 (576); Helge Sodan, Kollegiale Funktionsträger, S. 514 f. 182 Ekkehart Stein, in: Denninger / Hoffmann-Riem / Schneider / Stein, GG, Bd. 1, Einleitung II Rn. 93 (Stand der Kommentierung: 2001).
B. Ergebnis zum Ersten Kapitel
61
also Qualitätsverschlechterungen gerechtfertigt. Der Grundsatz verfolgt zumindest unmittelbar keine gesundheitsschützende Zielrichtung. Primäres Ziel ist die Verbesserung der Einnahmesituation. Dadurch soll das System der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten werden. Es geht also um Systemschutz durch die Sicherung seiner Finanzierung. Dies wird auch Auswirkungen auf die im folgenden Kapitel zu untersuchende Frage haben, ob der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Verfassungsrang hat und wo dieser zu verorten sein könnte.
Zweites Kapitel
Die These vom Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts erschöpfen sich nicht in der Formulierung des Grundsatzes der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung. Das Bundesverfassungsgericht hebt seit seiner ersten Entscheidung zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung in ständiger Rechtsprechung1 hervor, dass der Gesetzgeber sich diesem Grundsatz nicht entziehen dürfe. Die Auseinandersetzung mit dieser These ist Gegenstand dieses Kapitels.
A. Die Ansicht des Bundesverfassungsgerichts im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung I. Verfassungsrang Wenn das Bundesverfassungsgericht ausführt, dass der Gesetzgeber sich der Sicherung der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung nicht entziehen dürfe, heißt das, dass der Gesetzgeber an diesen Grundsatz gebunden sein soll. Jener ist also nicht frei darin, ob er den Grundsatz verfolgen kann oder will, die Verfolgung dieses Zwecks ist ihm vorgegeben. Gebunden ist der Gesetzgeber aber nur an höherrangiges Recht. Hier kommt nur die Verfassung, also das Grundgesetz, in Betracht. Europa- und völkerrechtliche Aspekte, die die gesetzliche Krankenversicherung dem deutschen Gesetzgeber abverlangen könnten, sind nicht ersichtlich. Das Bundesverfassungsgericht hat sich bei seinen Entscheidungen zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung nie mit völker- oder europarechtlichen Fragen auseinandergesetzt. Nimmt man das Bundesverfassungsgericht beim Wort, handelt es sich bei dem Grundsatz der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung um einen Gemein1 BVerfGE 68, 193 (218); vgl. ferner BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 1991, S. 205; NJW 1992, S. 735 (736). Auf BVerfGE 68, 193 (218) verweisen außerdem BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1998, S. 1776 (1777); NJW 1999, S. 2730 (2731); NJW 2000, S. 1781 (1782); NJW 2000, S. 3413; NJW 2001, S. 883 (884); BVerfGE 103, 172 (185).
A. Die Ansicht des Bundesverfassungsgerichts
63
wohlbelang, der von der Verfassung vorgegeben wird2, also Verfassungsrang hat. Wenn im Folgenden von „Verfassungsrang“ die Rede ist, so ist hiermit gemeint, dass das Grundgesetz den Grundsatz nicht nur billigt und als zulässig anerkennt, sondern vielmehr, dass die Verfassung diesen Grundsatz erfordert, dass eine verfassungsrechtliche Pflicht besteht, ihn zu verfolgen. Wo rührt dieser Verfassungsrang her? Die zitierten Entscheidungen schweigen zu dieser Frage.
II. Verfassungsrang als institutionelle Garantie Das Bundesverfassungsgericht geht also davon aus, dass der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Verfassungsrang hat. Doch die Bedeutung des Satzes, dass der Gesetzgeber sich dem Grundsatz der finanziellen Stabilität nicht entziehen dürfe, geht darüber hinaus. Wer die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung fordert, verlangt im selben Atemzug ihre Existenz. Denn wenn kein System der gesetzlichen Krankenversicherung existiert, kann auch dessen finanzielle Stabilität nicht gefordert werden. Damit der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung wirksam sein kann, bedarf es des Bestehens einer gesetzlichen Krankenversicherung. Die Frage, ob die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Verfassungsrang hat, ist also der Frage, ob die gesetzliche Krankenversicherung an sich Verfassungsrang hat, nachgelagert3. Gäbe es keine gesetzliche Krankenversicherung oder könnte der einfache Gesetzgeber sie beliebig ändern, würde eine Verfassungspflicht zur Erhaltung ihrer finanziellen Stabilität hinfällig. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Einrichtung. Verfolgt man also den Gedanken des Bundesverfassungsgerichts weiter, so kommt man zu dem Ergebnis, dass eine Einrichtungsgarantie 4, eine institutionelle Garantie vorliegt. Unter einer solchen versteht man den verfassungsrechtlichen Schutz eines einfachgesetzlich konstituierten Schutzgutes5. Institutionelle Garantien garantieren über die rechtliche Form bzw. Organisation hinaus auch das tatsächliche Bestehen und Funktionieren dieser rechtlichen Form bzw. Organisa2 So auch BSG, Urteil vom 09. 12. 2004, Az. B 6 KA 44 / 03 R, Rn. 147 ff. (zitiert nach: www.bundessozialgericht.de). Auch in der Literatur wird teilweise vom Verfassungsrang zumindest der gesetzlichen Krankenversicherung ausgegangen Joachim Burmeister, Grundrechtsverständnis, S. 21 ff., 97 ff.; Ernst Rudolf Huber, Rechtsstaat, S. 589 (610 f.); Jörg Müller-Vollbehr, ZRP 1984, S. 262 (266); Werner Weber, Der Staat 4 (1965), S. 409 (416); Michael Quaas / Rüdiger Zuck, Medizinrecht, § 81 Rn. 17. 3 So auch Hans-Jürgen Papier, Sozialrechtshandbuch, § 3 Rn. 77, der als rechtfertigenden Belang „die Existenz und die Leistungsfähigkeit des Systems der kassenärztlichen Versorgung“ annimmt. Ebenso Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 309. 4 Siehe hierzu grundlegend Carl Schmitt, Verfassungslehre, S. 170 ff. Aus jüngster Zeit Ute Mager, Einrichtungsgarantien. Diese Kategorie hält für bedeutungslos Matthias Cornils, Grundrechte, S. 534 f. 5 Ute Mager, Einrichtungsgarantien, S. 406.
64
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
tion6. Hierauf deutet auch die vom Bundesverfassungsgericht häufig verwendete Formulierung von der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung hin7. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Schlussfolgerung bislang jedoch nicht ausgesprochen. Im Folgenden werden neben dem Begriff „Verfassungsrang“ auch die Begriffe „Einrichtungsgarantie“, „verfassungsrechtliche Garantie“ oder „institutionelle Garantie“ verwandt, ohne dass für den vorliegenden Zusammenhang ein Unterschied bestünde.
B. Gemeinwohlbelange Wenn das Bundesverfassungsgericht ausführt, dass die Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung ein Gemeinwohlbelang sei, dem sich der Gesetzgeber nicht entziehen dürfe, so stellt sich allgemein die Frage, was im vorliegenden Zusammenhang unter einem Gemeinwohlbelang zu verstehen ist (I.). Weiterhin wird der Frage nachgegangen, welche Arten von Gemeinwohlbelangen es gibt und welche Bedeutung sie im Rahmen der Prüfung eines Freiheitsgrundrechts besitzen (II.).
I. Was ist ein Gemeinwohlbelang? Unter Gemeinwohl oder Allgemeinwohl versteht man das „Allgemeine Beste“, „das Interesse des Ganzen der menschlichen Gesellschaft“8. Das Gemeinwohl verkörpert die Idee vom guten Zustand des Gemeinwesens9. Es lassen sich zahlreiche Synonyme finden wie zum Beispiel „öffentliches Interesse“, „öffentlicher Belang“, „Gründe des gemeinen Wohls“, etc.10. Eine klare Inhaltsbestimmung gestaltet sich auf Grund des hohen Abstraktionsgrades und der dahinterliegenden philosophischen Konzeption als schwierig11. Einigkeit besteht, dass es „das Gemeinwohl“ nur in der Einzahl gibt, während die Belange, die das Gemeinwohl ausmachen, vielfältig sind12. Nicht nur Juristen haben sich bis in die jüngste Vergangenheit des Themas angenommen13: Ute Mager, Einrichtungsgarantien, S. 411. BVerfGE 70, 1 (25 f.); 103, 172 (184); BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 2002, S. 400 (401); NVwZ-RR 2002, S. 802; NZS 2005, S. 479 (480); NZS 2005, S. 91 (92); NJW 2005, S. 273 (275). 8 Josef Isensee, HdBStR III, § 57 Rn. 2; Gerhard Köbler, Wörterbuch, S. 14 („Allgemeinwohl“). 9 Josef Isensee, HdBStR III, § 57 Rn. 2. 10 Peter Häberle, AöR 95 (1970), S. 86 (89 f. mit Fn. 12); Josef Isensee, HdBStR III, § 57 Rn. 4; Robert Uerpmann, Öffentliches Interesse, S. 23. 11 Josef Isensee, HdBStR III, § 57 Rn. 3, 17. 12 Josef Isensee, HdBStR III, § 57 Rn. 18; Robert Uerpmann, Öffentliches Interesse, S. 23. 6 7
B. Gemeinwohlbelange
65
„Die Auseinandersetzung über die Bedeutung des politisch-sozialen Leitbegriffs ,Gemeinwohl‘ blickt in unserem Kulturkreis auf eine inzwischen zweieinhalbtausendjährige Vergangenheit zurück. Schon beim ersten Blick in ein Verzeichnis älterer Autoren zu dem Begriff stößt man auf Platon, Aristoteles, Cicero, Augustinus, Thomas von Aquin, Hobbes, Montesquieu, Montaigne, Pufendorf, Kant, Hegel, Thomas Paines, Smith oder vom Stein, gewissermaßen also eine Art Who is Who der europäischen Geistesgeschichte, das bis in die Gegenwart fortgeschrieben wird.“14
Dieses Zitat verdeutlicht, dass sich keine allgemein konsentierte Ansicht zum Begriff des Gemeinwohls finden lassen wird. An dieser Stelle soll deshalb nicht der Versuch unternommen werden, einen eigenen Gemeinwohlbegriff zu entwickeln. Statt dessen orientiert sich die Darstellung an den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts, das die unterschiedlichen Gemeinwohlbelange als Rechtfertigungsgründe für Grundrechtseingriffe heranzieht15. Im Folgenden soll unter Gemeinwohlbelang deshalb ein legitimer Zweck16 verstanden werden, wie er im Rahmen der verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprüfung herangezogen werden darf, um die Beeinträchtigung eines Freiheitsgrundrechtes zu rechtfertigen. Nach allgemeiner Auffassung verfolgt der Gesetzgeber einen legitimen Zweck, wenn ihm ein bestimmter Zweck nicht von Verfassungs wegen verboten ist17. Von einem verfassungsrechtlichen Verbot, finanzielle Ziele zu Gunsten der gesetzlichen Krankenversicherung zu verfolgen, kann nicht ausgegangen werden, weshalb grundsätzlich gegen die Einordnung des Grundsatzes der finanziellen Stabilität als Gemeinwohlbelang nichts zu erinnern ist.
II. Arten von Gemeinwohlbelangen und ihre Bedeutung Das Grundgesetz differenziert nicht zwischen unterschiedlichen Rängen der Gemeinwohlbelange. In den qualifizierten Gesetzesvorbehalten bei einzelnen Grundrechten treten zwar besondere Güter auf, die als Gemeinwohlbelange Grundrechtseingriffe rechtfertigen können. Dahinter verbirgt sich aber kein in sich geschlossenes abgestuftes Gemeinwohlgüter-Konzept. Derlei Systematisierungsbemühungen haben jedoch schon früh nach Inkrafttreten des Grundgesetzes begonnen. Diese Systematisierungen beanspruchen teilweise Geltung für alle Grundrechte (1. und 3.), teilweise gelten solche Kategorisierungen nur für bestimmte Freiheitsrechte, wie zum Beispiel für Art. 12 Abs. 1 GG (2.). 13 Peter Häberle, Öffentliches Interesse; Josef Isensee, HdBStR III, § 57 Rn. 1 ff.; Wolfgang Martens, Öffentlich als Rechtsbegriff; Robert Uerpmann, Öffentliches Interesse; Hans J. Wolff / Otto Bachof / Rolf Stober, Verwaltungsrecht I, § 29 Rn. 1 ff. 14 Rudolf Fisch / Klauspeter Strohm, FS-Armin, S. 73. 15 So z. B. in BVerfGE 34, 238 (245 f.); 49, 382 (400); 53, 135 (145); 95, 173 (183). Aus der Literatur Josef Isensee, HdBStR III, § 57 Rn. 110; Gerhard Köbler, Wörterbuch, S. 14 („Allgemeinwohl“). 16 Siehe zum legitimen Zweck ausführlich unten Drittes Kapitel C. II. 4. a) aa). 17 Bernhard Schlink, Abwägung, S. 192.
5 Schaks
66
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
1. Absolute und relative Gemeinwohlbelange Allgemein ist anerkannt, dass die verschiedenen Gemeinwohlbelange unterschiedliche Wertigkeiten aufweisen können. Eine Unterscheidung der Gemeinwohlbelange anhand ihrer Wertigkeit wird bei der Kategorisierung zwischen absoluten und relativen Gemeinwohlbelangen vorgenommen18. Diese Kategorien verwendet auch das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung: So kann man unter absoluten öffentlichen Interessen „die allgemein anerkannte[n] und von der jeweiligen Politik des Gemeinwesens unabhängigen Gemeinschaftswerte (wie zum Beispiel die Volksgesundheit)“ verstehen19. Demgegenüber werden relative öffentliche Interessen nicht als dem Gesetzgeber vorgegeben angesehen, vielmehr handelt es sich um solche, „die sich erst aus seinen besonderen wirtschafts-, sozial- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen und Zielen ergeben, die er also erst selbst in den Rang wichtiger Gemeinschaftsinteressen erhebt“20. Absolute Belange sind demnach solche, die aus der Verfassung abzuleiten sind, also Verfassungsrang haben, während relative Gemeinwohlbelange diesen Rang gerade nicht teilen21. Aus dieser Differenzierung folgt, dass lediglich erstere bei der Herstellung praktischer Konkordanz22 mit anderen Verfassungsgütern, insbesondere den Grundrechten, herangezogen werden dürfen23. Das Bundesverfassungsgericht hätte an Stelle der Formulierung, dass sich der Gesetzgeber dem Grundsatz der finanziellen Stabilität nicht entziehen dürfte, auch formulieren können, dass es sich bei diesem Grundsatz um einen absoluten Gemeinwohlbelang handelt. In beiden Fällen wäre der Verfassungsrang, der dem Grundsatz zukommen solle, gleichermaßen zum Ausdruck gebracht worden. Murswiek differenziert weiter zwischen originären und derivativen verfassungsrechtlichen Gemeinschaftsgütern24. Erstere sind nur solche, die das Grundgesetz als Bestandteile des Gemeinwesens ausdrücklich ausweist, nicht dagegen solche, zu deren Einrichtung oder Schutz das Grundgesetz dem Gesetzgeber lediglich eine Kompetenz erteilt. Derivative verfassungsrechtlich Gemeinschaftsgüter werden in der Verfassung nicht ausdrücklich aufgeführt. Sie erhalten ihren Rang dadurch, dass sie zur Bewahrung der originären verfassungsrechtlichen Güter notwendig sind. Folgt man dieser Differenzierung, so muss der Grundsatz der finanziellen 18 So aus dem Schrifttum Rüdiger Breuer, HdBStR VI, § 148 Rn. 11; Eberhard Grabitz, Freiheit, S. 66; Walter Leisner, Sozialversicherung, S. 67; Detlef Merten, Kostendämpfungsgesetz, S. 91 (110); Uwe Seetzen, NJW 1975, S. 429 (430); Helge Sodan / Jan Ziekow, Öffentliches Recht, § 24 Rn. 35. 19 BVerfGE 13, 97 (107). 20 BVerfGE 13, 97 (107). 21 Eberhard Grabitz, Freiheit, S. 66 f. 22 Siehe hierzu Konrad Hesse, Grundzüge, Rn. 72, 317 ff., 325, 332; Matthias Herdegen, JZ 2004, S. 873 (877). 23 Eberhard Grabitz, Freiheit, S. 67. 24 Dietrich Murswiek, Risiken der Technik, S. 225.
B. Gemeinwohlbelange
67
Stabilität ein derivativer verfassungsrechtlicher Gemeinschaftswert sein, da der Grundsatz nicht ausdrücklich im Grundgesetz benannt wird. 2. Gestufte Gemeinwohlbelange aufgrund der Drei-Stufen-Theorie a) Die Drei-Stufen-Theorie Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts enthält Art. 12 Abs. 1 GG ein einheitliches Grundrecht, das dem einheitlichen Regelungsvorbehalt des Art. 12 Abs. 1 Satz 2 unterfällt25. Auch wenn der Wortlaut des Art. 12 Abs. 1 GG es nahegelegt hätte, zwischen Berufsausübungsfreiheit und Berufswahlfreiheit zu unterscheiden26 und den Regelungsvorbehalt nur auf die Berufsausübungsfreiheit zu beziehen, hat das Bundesverfassungsgericht dies früh anders gesehen27. Diesem Verständnis folgt der überwiegende Teil der Literatur28. Ausgangspunkt der Drei-Stufen-Theorie ist, dass Regelungen die Berufsfreiheit unterschiedlich intensiv berühren können, je nach dem, ob es sich um Regelungen der Berufsausübung oder Regelungen der Berufswahl handelt. Berufswahlregelungen können noch weiter differenziert werden, in Abhängigkeit davon, ob sie „die Erfüllung objektiver, dem Einfluss des Berufswilligen entzogener und von seiner Qualifikation unabhängiger Kriterien“29 verlangen (dann objektive Berufswahlregelungen) oder ob sie „die Wahl eines Berufs an persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen, erworbene Abschlüsse und erbrachte Leistungen“30 anknüpfen (dann subjektive Berufswahlregelungen). Während Berufsausübungsregelungen bereits durch „vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls“31 oder „hinreichende Gründe des Gemeinwohls“32 gerechtfertigt werden können, gelten für Berufswahlregelungen im Hinblick auf das verfolgte öffentliche Interesse strengere Anforderungen. Subjektive Berufswahlrege-lungen sind zum Schutze wichtiger Gemeinschaftsgüter zulässig33. Demgegenüber BVerfGE 33, 303 (336); 54, 237 (245 f.); 84, 133 (148). Jörg Lücke, Berufsfreiheit, S. 3 ff., passim; Bodo Pieroth / Bernhard Schlink, Grundrechte, Rn. 806, 808. 27 So bereits BVerfGE 7, 377 (402). 28 Klaus Stern / Johannes Dietlein, Staatsrecht IV / 1, S. 1883 f.; Manfred Gubelt, in: Münch / Kunig, GG, Bd. 1, Art. 12 Rn. 40 ff.; Gerrit Manssen, in: von Mangoldt / Klein / Starck, GG, Bd. 1, Art. 12 Rn. 103; Rupert Scholz, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 12 Rn. 25 (Stand der Bearbeitung: Juni 2006); Rolf Stober, MedR 1990, S. 10 (12); Peter J. Tettinger, in: Sachs, GG, Art. 12 Rn. 81. A. A. Christian Pestalozza, NJW 2006, S. 1711 (1712). 29 Bodo Pieroth / Bernhard Schlink, Grundrechte, Rn. 826. 30 Bodo Pieroth / Bernhard Schlink, Grundrechte, Rn. 832. 31 BVerfGE 7, 377 (405); 78, 155 (162). 32 BVerfGE 68, 272 (282). 33 BVerfGE 13, 97 (107). 25 26
5*
68
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
müssen objektive Berufswahlregelungen der „Abwehr nachweisbarer oder höchstwahrscheinlicher schwerer Gefahren für ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut“ dienen34. An dieser im Apotheken-Urteil vom 11. 06. 195835 begründeten Drei-StufenTheorie hält das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung fest36, auch wenn es im Einzelnen Modifikationen vorgenommen hat und nicht mehr nur auf die formale Zuordnung eines Eingriffs zu einer Stufe abstellt, sondern insgesamt auf die Intensität eines Eingriffs37. Die an der Drei-Stufen-Theorie geäußerte grundsätzliche Kritik38 vermochte sich bislang ebenso wenig durchzusetzen wie die Umbenennung in „Fünf-Stufen-Theorie“39. Bedauerlicherweise fehlen Kriterien, die erklären, was beispielsweise einen wichtigen Gemeinschaftswert zu einem solchen werden lässt und was ihn von einer vernünftigen Erwägung des Gemeinwohls unterscheidet40. Deshalb wird an der Drei-Stufen-Theorie eine gewisse Beliebigkeit kritisiert41. Jedoch können immerhin die Belange, die objektive Berufswahlregelungen zu rechtfertigen vermögen, von „wichtigen Gemeinschaftswerten“ abgegrenzt werden. Während wichtige Gemeinschaftswerte auch relative Gemeinwohlbelange sein können42, sind überragend wichtige Gemeinschaftsgüter nur Gemeinwohlbelange von Verfassungsrang43. Gegen die Annahme, dass überragend wichtige Gemeinschaftsgüter nur Gemeinwohlbelange von Verfassungsrang sein können, ließe sich einwenden, dass es der Erstreckung des Regelungsvorbehalts in Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG auf die Berufswahlfreiheit dann nicht bedurft hätte. Ohne die Erstreckung des Regelungsvorbehalts wäre die Berufswahlfreiheit ein vorbehaltlos gewährtes Grundrecht. Aber auch diese können – durch kollidierendes Verfassungsrecht – eingeschränkt werBVerfGE 7, 377 (408). Vgl. auch BVerfGE 21, 245 (251); 25, 1 (16). BVerfGE 7, 377 ff. Vgl. auch Rüdiger Breuer, HdBStR VI, § 147 Rn. 158 f. 36 BVerfGE 33, 303 (337 f.); 86, 28 (38 ff.); 97, 12 (32). A. A. Bernhard Schlink, Abwägung, S. 68 ff. Er sieht die Drei-Stufen-Theorie in der Sache für aufgegeben an. Demgegenüber hält Klaus Stern / Johannes Dietlein, Staatsrecht IV / I, S. 1890 die Drei-StufenTheorie für eine „nach wie vor aktuelle Idee“. 37 Siehe unter anderem BVerfGE 11, 30 (42 ff.); 12, 144 (147 f.). Aus dem Schrifttum Klaus Stern / Johannes Dietlein, Staatsrecht IV / 1, S. 1890; Helge Sodan, Privat(zahn)ärztliche Behandlungspflicht, S. 51 f. 38 Jörn Ipsen, JuS 1990, S. 634 (635 ff.); Jörg Lücke, Berufsfreiheit, S. 4 f., 15, 52 f., passim; Hans Heinrich Rupp, AöR 92 (1967), S. 212 (232 ff.); Peter J. Tettinger, AöR 108 (1983), S. 92 (122 f.). 39 Thomas Clemens, in: Umbach / Clemens, GG, Bd. 1, Anhang zu Art. 12 Rn. 75 ff. 40 Helmut Lecheler, VVDStRL 43 (1985), S. 48 (57). 41 Eberhard Grabitz, Freiheit, S. 66 mit Fn. 68; Peter Häberle, AöR 95 (1970), S. 86 (101); Bodo Pieroth / Bernhard Schlink, Grundrechte, Rn. 856 f. 42 Rüdiger Breuer, HdBStR VI, § 148 Rn. 11; Hans D. Jarass, in: Jarass / Pieroth, GG, Art. 12 Rn. 37; Gerrit Manssen, in: von Mangoldt / Klein / Starck, GG, Bd. 1, Art. 12 Rn. 140. 43 Winfried Kluth, ZHR 162 (1998), S. 657 (671, 676); Jörg Lücke, Berufsfreiheit, S. 52 f.; Gerrit Manssen, in: von Mangoldt / Klein / Starck, GG, Bd. 1, Art. 12 Rn. 140. 34 35
B. Gemeinwohlbelange
69
den44. Die Erstreckung des Regelungsvorbehalts des Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG hätte also keinerlei Auswirkung, wenn auch nach der Ausdehnung des Regelungsvorbehaltes in die Berufswahlfreiheit nur zu Gunsten von Gütern mit Verfassungsrang eingegriffen werden könnte. Jedoch ist dieser Einwand nur zutreffend, wenn im Zeitpunkt des Apotheken-Urteils (1958) im Hinblick auf kollidierendes Verfassungsrecht bereits dieselben grundrechtsdogmatischen Erkenntnisse galten, wie sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorliegen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Eine dem heutigen Standard entsprechende Dogmatik im Hinblick auf die Rechtfertigung von Eingriffen in vorbehaltlos gewährte Grundrechte durch kollidierendes Verfassungsrecht entwickelte sich erst ab 197045. Somit können nur absolute Gemeinwohlbelange, also Güter von Verfassungsrang, objektive Berufswahlregelungen rechtfertigen.
b) Der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung im Lichte der Drei-Stufen-Theorie Diese Drei-Stufen-Theorie hat auch Bedeutung für den Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung. Art. 12 Abs. 1 GG ist das Grundrecht, das meist bei den Entscheidungen zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung betroffen war46. Nur zwei Entscheidungen stellen in dieser Hinsicht Ausnahmen dar. In diesen beiden Beschlüssen ging das Bundesverfassungsgericht von der Einschlägigkeit unter anderem des Art. 2 Abs. 1 GG aus. In dem ersten Beschluss differenzierte das Bundesverfassungsgericht: Die Leistungserbringer konnten sich auf Art. 12 Abs. 1 GG berufen, nur die beschwerdeführenden Berufsorganisationen – soweit sie beschwerdefähig waren – waren auf Art. 2 Abs. 1 GG verwiesen47. Dies lässt sich damit begründen, dass die Berufsorganisationen selbst keinen Beruf ausüben, sondern die Interessen ihrer Mitglieder vertreten. Ihre Tätigkeit dient nicht der Schaffung und Erhaltung einer Lebensgrundlage, sondern der Förderung der wirtschaftlichen Tätigkeit der Mitglieder. Im zweiten der beiden Beschlüsse ging es um die Mindestbemessungsgrenze für Beiträge hauptberuflich selbständig Erwerbstätiger, die freiwillig Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung sind. Hier wurde nicht Art. 12 Abs. 1 GG, sondern Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem rechtsstaatlichen Grundsatz des Vertrauensschutzes als Prüfungsmaßstab herangezo44 Peter Badura, Staatsrecht, C Rn. 25; Helge Sodan / Jan Ziekow, Öffentliches Recht, § 24 Rn. 19; Klaus Stern / Michael Sachs, Staatsrecht III / 2, S. 571 ff. 45 Jörg Lücke, Berufsfreiheit, S. 4 mit Verweis auf BVerfGE 28, 243 (260 f.); 30, 173 (193); 32, 98 (107 f.); 52, 223 (246 f.). So auch Otto Depenheuer, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 241 (250); Sebastian Lenz / Philipp Leydecker, DÖV 2005, S. 841; Bodo Pieroth, AöR 114 (1989), S. 422 (425), die ebenfalls auf die Entscheidung im 28. Band der amtlichen Entscheidungssammlung verweisen. 46 Vgl. nur BVerfGE 68, 193 (216); 82, 209 (223); 103, 172 (182 f.); 106, 369 (373). 47 BVerfGE 70, 1 (25, 27).
70
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
gen48. Dass Art. 2 Abs. 1 GG insgesamt nur sehr selten als Prüfungsmaßstab herangezogen wird, entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und der ganz herrschenden Auffassung in der Literatur, die in Art. 2 Abs. 1 GG ein subsidiäres Auffanggrundrecht erblicken49. Die Eigentumsfreiheit aus Art. 14 Abs. 1 GG sieht das Bundesverfassungsgericht nicht als verletzt an, in der Regel lehnt es bereits die Eröffnung des Schutzbereichs ab50. Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb51 wird selten angesprochen52; ob es überhaupt von Art. 14 Abs. 1 GG geschützt wird, bleibt – wie auch in der sonstigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts53 – offen54. Aus diesen Gründen konzentriert sich die Darstellung auf die Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG. Bezüglich des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, dass dieser auch objektive Berufswahlregelungen rechtfertigen kann, dass es sich also um einen überragend wichtigen Gemeinwohlbelang im Sinne der Drei-Stufen-Theorie handelt55. Dies bestätigt das oben ermittelte Auslegungsergebnis, dass das Bundesverfassungsgericht mit der Formulierung, dass der Gesetzgeber sich dem Grundsatz der finanziellen Stabilität nicht entziehen dürfe, den Verfassungsrang des Grundsatzes postuliert. 3. Fiskalische und finanzielle Belange Unter einem fiskalischen Belang versteht man das Interesse des Staates an der Erzielung von Steuereinnahmen. Diese Belange werden zuweilen begrifflich von finanziellen Belangen unterschieden56. Während die finanziellen Interessen allgemeine oder besondere öffentliche Interessen darstellen und geringere Gegeninteressen überwiegen können, soll dies für fiskalische Belange nicht gelten57. BVerfGE 103, 392 (403). BVerfGE 6, 32 (37); 9, 63 (73); 50, 290 (362); 89, 1 (13); Peter Badura, Staatsrecht, C Rn. 108; Walter Schmidt, AöR 91 (1966), S. 42 (84 f.); Helge Sodan, Zwangsvereinigungen, S. 37. 50 BVerfGE 68, 193 (222 f.); 70, 1 (31); 82, 209 (234 f.); BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1992, S. 735 (736); NJW 1998, S. 1776 (1777 f.). 51 Siehe BGHZ 23, 157 (163); 81, 21 (33); 132, 181 (186); Winfried Boecken, FS-Brohm, S. 231 (233 ff.). 52 Eine Ausnahme insoweit BVerfGE 68, 193 (222 f.). 53 BVerfGE 105, 252 (278). 54 BVerfGE 68, 193 (222 f.). 55 BVerfGE 103, 172 (184); BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 2002, S. 400 (401); so auch BSG, Urteil vom 09. 12. 2004, Az. B 6 KA 44 / 03 R, Rn. 147 ff. (zitiert nach: www. bundessozialgericht.de); Timo Hebeler, Jura 2005, S. 17 (22); Renate Jaeger, NZS 2003, S. 225 (232); Hans D. Jarass, NZS 1997, S. 545 (547). 56 Hans J. Wolff / Otto Bachof / Rolf Stober, Verwaltungsrecht I, § 29 Rn. 16. 57 Hans J. Wolff / Otto Bachof / Rolf Stober, Verwaltungsrecht I, § 29 Rn. 16. 48 49
B. Gemeinwohlbelange
71
Was die rechtfertigende Kraft von fiskalischen und finanziellen Erwägungen betrifft, so besteht weder in der Literatur noch in der Rechtsprechung eine einheitliche Linie. In einer frühen Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht ausgeführt, „daß auch finanzielle Erwägungen sachgerecht sein können und damit den Vorwurf der Willkür entkräften“58. Später wurde dann differenzierter formuliert: „Fiskalische Erwägungen, die darauf abzielen, dem Staat Aufgaben zu ersparen, sind also hier nicht als sachliche Gründe für eine differenzierende Behandlung anzusehen.“59
Auch in anderen Entscheidungen wurden finanzpolitische Gründe oder die finanziellen Belastungen der Haushalte60 nicht als hinreichend gewichtige Allgemeinwohlinteressen angesehen. In zwei Senatsentscheidungen aus jüngerer Zeit hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich festgehalten, „dass das Ziel, aus fiskalischen Gründen die Einnahmen des Staates zu erhöhen, allein eine Beschränkung der Berufswahl nicht rechtfertigen kann“61. Das Schrifttum sieht die rechtfertigende Kraft finanzieller und fiskalischer Erwägungen als gering an62. Das wird deutlich, wenn Autoren Maßnahmen kritisieren, „die auf eine schlichte Mittelbeschaffung gerichtet“ sind63. Demgegenüber vertritt Clemens die Ansicht, dass es nicht beanstandet werden kann, „wenn der Bundesgesetzgeber unter dem ,Deckmantel‘ des Zieles bundeseinheitlicher Qualitätssicherung [ . . . ] andere Ziele (mit-)verfolgt. So kann er außer Vorschriften, die zweifellos die Qualität der Leistungserbringung erhöhen, auch Regelungen treffen, die zugleich zu Kosteneinsparungen führen sollen [ . . . ]. Solche finanziellen Motivationen sind nicht etwa unzulässig, sondern von der weiten Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers gedeckt.“64 Auch wenn Clemens von der Zulässigkeit finanzieller Erwägungen ausgeht, so macht doch die Verwendung der Worte „Deckmantel“, „(mit-)verfolgt“, „zugleich“ klar, dass die rechtfertigende Kraft dieser Belange nicht allzu hoch einzuschätzen ist. Dies sieht auch Jaeger so, wenn sie ausführt: „Rein finanzielle Interessen, die häufig das Handeln des Gesetzgebers bestimmen und von diesem als zwingend und überaus gewichtig angesehen werden, überzeugen insofern unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten in Karlsruhe nicht immer.“65 BVerfGE 3, 4 (11). BVerfGE 27, 391 (396). 60 So z. B. in BVerfGE 27, 220 (228). Siehe auch BVerfGE 30, 367 (391); 38, 175 (180); 67, 100 (140). 61 BVerfGE 102, 197 (216); BVerfG, NJW 2006, S. 1261 (1264); vgl. zur letzten Entscheidung Christian Pestalozza, NJW 2006, S. 1711 ff. 62 Ernst Benda, Gesetze, S. 26; Josef Isensee, ZVersWiss 2004, S. 651 (654); Detlef Merten, Kostendämpfung, S. 91 (126 f.). Differenzierend Robert Uerpmann, Öffentliches Interesse, S. 128 ff. 63 Herbert Posser / Rolf-Georg Müller, NZS 2004, S. 178 (179). 64 Thomas Clemens, in: Umbach / Clemens, GG, Bd. 1, Anhang zu Art. 12 Rn. 54. 65 Renate Jaeger, System, S. 15 (31). 58 59
72
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
Wenn fiskalische / finanzielle Belange nur eine geringe rechtfertigende Kraft aufweisen, dann können sie weder absolute Gemeinwohlbelange noch überragend wichtige Gemeinschaftsgüter im Sinne der Drei-Stufen-Theorie darstellen. Das Bundesverfassungsgericht hat – aus seiner Sicht – folgerichtig im Zusammenhang mit dem Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung auch nie von einem bloß fiskalischen Belang gesprochen.
III. Ergebnis zu B. Das Bundesverfassungsgericht sieht den Grundsatz der finanziellen Stabilität als absoluten Gemeinwohlbelang, also Gemeinwohlbelang von Verfassungsrang an und auch als überragend wichtigen Gemeinschaftswert, der im Rahmen der DreiStufen-Theorie zu Art. 12 Abs. 1 GG auch objektive Berufswahlregelungen rechtfertigen kann.
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Wenn der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Verfassungsrang haben soll, muss er einer Norm entnommen werden können, die selber Verfassungsrang hat. Dabei kann es sich sowohl um eine geschriebene als auch um eine ungeschriebene Verfassungsnorm handeln. Deshalb sollen die einzelnen Vorschriften untersucht werden, aus denen der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung resultieren könnte, die Möglichkeiten des ungeschriebenen Verfassungsrechts sowie die Frage des Verfassungsrangs durch Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (I. – IX.). Da der Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung den Verfassungsrang des bestehenden Systems der gesetzlichen Krankenversicherung voraussetzt66, kann bei der Untersuchung, wo der Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung herrührt, zunächst geprüft werden, ob die gesetzliche Krankenversicherung selbst Verfassungsrang hat. Wenn sich aus einer Bestimmung des Grundgesetzes der Verfassungsrang ableiten lässt, wird im Anschluss die Frage beantwortet, ob aus dieser Bestimmung auch der Verfassungsrang der finanziellen Stabilität folgt. Kann der Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung nicht begründet werden, dann kommt auch ihrer finanziellen Stabilität kein Verfassungsrang zu, denn die finanzielle Stabilität ist abhängig vom Bestehen einer gesetzlichen Krankenversicherung und von ihrem Rang in der Normenhierarchie. 66
Siehe oben Zweites Kapitel A. II.
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
73
Abgeschlossen wird der Gedankengang durch Kontrollüberlegungen, anhand derer das gefundene Ergebnis mit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die nicht zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung ergangen sind, und dogmatischen Grundsätzen verglichen wird (X.) und zum Vorwurf des Sonderrechts Stellung bezogen wird (XI.).
I. Das Sozial(staats)prinzip, Art. 20 Abs. 1, Art. 23 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG Als verfassungsrechtliche Wurzel der gesetzlichen Krankenversicherung kommt das Sozial(staats)prinzip in Betracht.
1. Das Sozial(staats)prinzip allgemein Anders als die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. 08. 191967 und zahlreiche Landesverfassungen68 hat das Grundgesetz keine sozialen Grundrechte proklamiert69. Statt dessen konstituiert das Grundgesetz in Art. 20 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 1 Satz 1 die Bundesrepublik Deutschland als „sozialen Bundesstaat“ bzw. „sozialen Rechtsstaat“ und gestattet die deutsche Mitwirkung bei der Entwicklung der Europäischen Union nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG nur, wenn diese auch „sozialen [ . . . ] Grundsätzen [ . . . ] verpflichtet ist“70. Aus diesen Formulierungen wird allgemein eine Staatszielbestimmung abgelesen71. Hierunter versteht man eine Verfassungsnorm mit rechtlicher Wirkung, die der Staatstätigkeit die fortdauernde Beachtung oder Erfüllung bestimmter Aufgaben vorschreibt, aber die Art und Weise der Erfüllung offen lässt72. Das Sozial(staats)prinzip gewährt grundsätzlich kein subjektives öffentliches Recht, sondern es beinhaltet ein objektives Prinzip73. Konkrete Ansprüche des Einzelnen können aus Art. 20 Abs. 1 GG daher regelmäßig nicht hergeleitet werden74. RGBl., S. 1383 ff., z. B. Art. 151 ff. Vgl. z. B. Art. Art. 166 BayVerf; Art. 18 BerlVerf; Art. 48 BrandVerf; Art. 8 BremVerf; Art. 24 VerfNRW; Art. 36 ThürVerf. 69 Konrad Hesse, Grundzüge, Rn. 208, 289; Karl Albrecht Schachtschneider, Sozialprinzip, S. 17. 70 Hervorhebungen nicht im Original. 71 Vgl. nur Hans-Jürgen Papier, Sozialrechtshandbuch, § 3 Rn. 1; Uwe Volkmann, Solidarität, S. 378; Hans F. Zacher, HdBStR II, § 28 Rn. 1. 72 Hans H. Klein, DVBl. 1991, S. 729 (733); Uwe Volkmann, Solidarität, S. 377. 73 Walter Leisner, Sozialversicherung, S. 118; Klaus Stern, Staatsrecht I, S. 880. 74 BVerfGE 27, 253 (283); 82, 60 (80); Wolfgang Abendroth, Rechtsstaat, S. 114 (117); Roman Herzog, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 20 VIII Rn. 28 (Stand der Bearbeitung: 1980); Josef Isensee, ZVersWiss 2004, S. 651 (668). 67 68
74
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
Gemäß Art. 79 Abs. 3 GG dürfen unter anderem die in Art. 20 GG niedergelegten Grundsätze nicht berührt werden. Hieraus ergibt sich, dass der Kern des Sozial(staats)prinzips selbst durch eine Verfassungsänderung nicht geändert werden kann75. Die früher teilweise vertretene Auffassung, es handele sich bei dem Sozial(staats)prinzip um einen unverbindlichen Programmsatz76, konnte sich nicht durchsetzen und muss als überholt betrachtet werden77. Das Sozialstaatsprinzip ist zwar normativ verbindlich, aber da es ein der konkreten Ausgestaltung in hohem Maße fähiges und bedürftiges Prinzip ist, muss es in der Regel durch Gesetze verwirklicht werden78. Unterschiede zeigen sich in der Bezeichnung dieser Staatszielbestimmung. Teilweise wird es auch als Sozialprinzip79 bezeichnet. Überwiegend ist jedoch vom Sozialstaatsprinzip oder sozialstaatlichen Prinzip die Rede80. Hieran wird gelegentlich kritisiert, dass das Grundgesetz an keiner Stelle vom Sozialstaat spricht, sondern stets von einem sozialen Bundes- bzw. Rechtsstaat81. Ein sozialer Rechtsstaat bzw. ein sozialer Bundesstaat sei jedoch qualitativ etwas anderes als ein Sozialstaat. Im Folgenden werden beide Begriff synonym und parallel verwandt.
2. Der Inhalt des Sozial(staats)prinzips Der Begriff des Sozialen entzieht sich jeder einfachen Definition82. Es steht in enger Beziehung zum Begriff der Gerechtigkeit83. Dies macht die Begriffsbestimmung nicht einfacher, lasten doch auf dem Begriff der Gerechtigkeit – wie auf dem des Gemeinwohls – mehr als 2000 Jahre philosophischen Bemühens84. Der Inhalt des Sozialprinzips ist auch deshalb schwer zu bestimmen, weil der Parlamenta75 So die h. M. BVerfGE 84, 90 (121); Bodo Pieroth, in: Jarass / Pieroth, GG, Art. 79 Rn. 10 f.; Hans-Jürgen Papier, FS-50 Jahre BSG, S. 23 (24); Rainer Pitschas, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 827 (832). A.A. Matthias Jestaedt, HdBStR II, § 29 Rn. 49 ff., 54 mit Fn. 294; Ewald Wiederin, VVDStRL 64 (2005), S. 53 (74 f.). 76 Ernst Forsthoff, VVDStRL 12 (1954), S. 8 (27 ff.); ders., Sozialstaat, S. 145. 77 Vgl. Ingwer Ebsen / Franz Knieps, Sozialrechtshandbuch, § 14 Rn. 57; Hans-Jürgen Papier, Sozialrechtshandbuch, § 3 Rn. 1; Karl Albrecht Schachtschneider, Sozialprinzip, S. 35 f. 78 BVerfGE 1, 97 (105); 65, 182 (193); 82, 60 (80); 100, 271 (284); Hans Peter Ipsen, Grundgesetz, S. 16 (23); Walter Leisner, Sozialversicherung, S. 119; Karl Albrecht Schachtschneider, Sozialprinzip, S. 38 f. 79 Karl Albrecht Schachtschneider, Sozialprinzip, S. 31 f., passim. 80 Helge Sodan / Jan Ziekow, Öffentliches Recht, § 10 Rn. 1 ff.; Klaus Stern, Staatsrecht I, S. 877 ff.; Hans F. Zacher, HdBStR II, § 28 Rn. 1. 81 Josef Isensee, FS-Broermann, S. 365 (371); Detlef Merten, VSSR 1995, S. 155 (157 f.); Karl Albrecht Schachtschneider, Sozialprinzip, S. 31 f. 82 Timo Hebeler, Jura 2005, S. 17 (18); Klaus Stern, Staatsrecht I, S. 891 f. 83 Karl Albrecht Schachtschneider, Sozialprinzip, S. 32 ff. 84 Vgl. Eberhard Eichenhofer, JZ 2005, S. 209 (210); Karl Albrecht Schachtschneider, Sozialprinzip, S. 32 ff.
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
75
rische Rat bei den Beratungen über das Grundgesetz 1948 / 49 sich nicht damit befasst hat, was das Adjektiv „sozial“ in Art. 20 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG bedeuten soll85. Anders als bei den Prinzipien des Rechts- und Bundesstaates kann das Sozialprinzip auch nicht auf eine verfassungsrechtliche Tradition zurückblicken, aus der sich eine inhaltliche Präzisierung ableiten ließe86. Um das Sozialprinzip handhabbar zu machen, sind von Rechtsprechung und Literatur Fallgruppen87 herausgearbeitet worden. Anhand dieser soll der Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung und so des Grundsatzes der finanziellen Stabilität untersucht werden. 3. Fallgruppen Das Sozialprinzip soll Hilfe gegen Not und Armut bieten88, ein menschenwürdiges Existenzminimum sichern89, den Ausgleich sozialer Gegensätze herbeiführen90, für eine gerechte Sozialordnung sorgen91 und Sicherheit gegen die Wechselfälle des Lebens bieten92. Von diesen Fallgruppen betreffen nur die letzten beiden möglicherweise den Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung. Da der Punkt „Sicherheit vor den Wechselfällen des Lebens“ als der speziellere Aspekt erscheint, soll mit diesem begonnen werden. a) 1. Fallgruppe: „Sicherheit gegen die Wechselfälle des Lebens“ Die gesetzliche Krankenversicherung wird gemeinhin dem Punkt „Sicherheit vor den Wechselfällen des Lebens“ zugeordnet93. Anders als die private Krankenversicherung basiert die gesetzliche Krankenversicherung nicht auf der Versicherung eines individuellen Risikos, sondern auf der Umverteilung unter den Beitragszahlern und soll den Versicherten vor den Gefahren, die von Krankheiten für sein Sozialleben ausgehen, schützen94. Mit den „Wechselfällen des Lebens“ sind Ereignisse gemeint, „die einen Menschen ereilen und dessen soziale Lebensführung 85 Karl Albrecht Schachtschneider, Sozialprinzip, S. 20; Klaus Stern, Staatsrecht I, S. 878; Hans F. Zacher, HdBStR II, § 28 Rn. 14 ff. 86 Karl Albrecht Schachtschneider, Sozialprinzip, S. 36; Klaus Stern, Staatsrecht I, S. 881. 87 Siehe die Systematisierungen bei Hartmut Maurer, Staatsrecht I, § 8 Rn. 72 ff.; Maximilian Wallerath, JZ 2004, S. 949 (953); Helmut Simon, FS-Redeker, S. 159 (161); ausführlich Hans F. Zacher, HdBStR II, § 28 Rn. 32 ff. 88 BVerfGE 1, 97 (105). 89 BVerfGE 40, 121 (133); 44, 353 (375); 45, 187 (228). 90 BVerfGE 22, 180 (204); 81, 242 (255); 100, 271 (284). 91 BVerfGE 5, 85 (198); 36 (abw. Meinung), 237 (250); 59, 231 (263); 93, 121 (163). 92 BVerfGE 21, 362 (373); 28, 324 (348). 93 Eberhard Schmidt-Aßmann, NJW 2004, S. 1689 (1690); Klaus Stern, Staatsrecht I, S. 893; Hans F. Zacher, HdBStR II, § 28 Rn. 43 ff. 94 Eberhard Eichenhofer, Sozialrecht, Rn. 356.
76
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
nachhaltig berühren, so dass die Sozialversicherung als ein Kollektivsystem helfend beisteht und die negativen Folgen des Ereignisses abfedert oder gar gänzlich ausgleicht“95. Erkrankungen und Behandlungsbedürftigkeit sind solche Schicksalsfälle des Lebens, weshalb das Sozialprinzip auch dem Schutz des Einzelnen in Fällen von Krankheit dienen soll96. Es könnte zwar problematisch sein, inwieweit selbstverschuldete Krankheiten, etwa durch Drogenmissbrauch, ungesunde Ernährungs- und Lebensgewohnheiten etc.97 erfasst sein müssten (vgl. § 1 Satz 2 SGB V), hierauf soll es für die vorliegende Untersuchung jedoch nicht ankommen. Statt dessen wird davon ausgegangen, dass jede Form der Krankheit oder der medizinischen Behandlungsbedürftigkeit einen „Wechselfall des Lebens“ darstellt. aa) Keine Garantie des Systems, sondern Erforderlichkeit eines Schutzsystems Entnimmt man dem Sozialprinzip einen Auftrag zur Schaffung sozialer Sicherungssysteme gegen die Wechselfälle des Lebens98, so kann – auch wenn dies nicht ausgesprochen wird – davon ausgegangen werden, dass nicht nur die Existenz dieses Sicherungssystems gefordert wird, sondern auch seine Effektivität99. Es leuchtet ein, dass zur Schaffung und Erhaltung eines solchen Systems finanzielle Mittel unerlässlich sind. Man könnte deshalb annehmen, dass der Gesetzgeber verpflichtet sei, die soziale Krankenversicherung einzuführen und finanziell stabil zu halten. Genau wie bei Art. 19 Abs. 4 GG, der nicht nur die Schaffung eines Rechtsschutzsystems fordert, sondern eines effektiven Systems100, kann auch bei Art. 20 Abs. 1 GG erwartet werden, dass die gesetzliche Krankenversicherung effektiv ist, eben finanziell stabil und funktionsfähig. Diese Argumentation ist jedoch nur auf den ersten Blick überzeugend. Denn der Gesetzgeber ist nicht verpflichtet, die gesetzliche Krankenversicherung im Sinne des geltenden Systems einzuführen, sondern ein Sicherungssystem gegen die Wechselfälle des Lebens101. Auch der Einwand, dass letzten Endes jede Form der Krankenversicherung funktionsfähig sein müsste und somit immer vom Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung und ihrer Funktionsfähigkeit ausgegangen werden könnte, verfängt nicht. Aus der möglicherweise bestehenden allgemeinen Verpflichtung, einen Timo Hebeler, Jura 2005, S. 17 (18 f.). BVerfG, NJW 2006, S. 891 (892). 97 Vgl. hierzu Eberhard Eichenhofer, VSSR 2004, S. 93 (100 ff.); Friedrich E. Schnapp, DVBl. 2004, S. 1053 (1058); Udo Steiner, MedR 2003, S. 1 (3). 98 BVerfGE 21, 362 (373); 28, 324 (348). Vgl. auch BVerfGE 68, 193 (209). 99 Siehe zum Verhältnis von Existenz und Effektivität oben Zweites Kapitel A. II. 100 BVerfGE 84, 34 (49); 104, 220 (231 f.); Helge Sodan / Jan Ziekow, Öffentliches Recht, § 45 Rn. 1, 6. 101 Daniela Beer / Dominik Klahn, SGb 2004, S. 13 (17); Eberhard Schmidt-Aßmann, NJW 2004, S. 1689 (1690); Helge Sodan, ZRP 2004, S. 217 (220); Martin Stockhausen, Berufsfreiheit, S. 76; Wolfgang Weiß, NZS 2005, S. 67 (73). 95 96
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
77
Krankheitsschutz zu organisieren, folgt nicht der Verfassungsrang des konkret bestehenden Systems. „Es ist sicher richtig, daß weder das unterverfassungsmäßige Anspruchssystem noch die organisatorische Ausgestaltung des zur Zeit existierenden Normenbestandes verfassungsrechtlich gewährleistet ist.“102
Dazu sind die verfassungsrechtlichen Vorgaben zu karg103. Wie das einzuführende System konkret auszusehen hat, wird von dem Sozialprinzip nicht vorgegeben und kann diesem auch nicht durch Interpretation entnommen werden104. Das Sozialprinzip ist eine Staatszielbestimmung, es soll eine bestimmte Gesellschaftsordnung erreichen. Damit ist aber nur das Ziel, nicht der Weg vorgegeben105. Es bestehen unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Ziel, den Krankheitsschutz zu organisieren, wie auch die Diskussionen um die verschiedenen Modelle von Gesundheitsprämien und Bürger(zwangs)versicherungen belegen. Auch die Pflicht zur privaten Vorsorge, verbunden mit staatlichen Hilfen für Sozialschwache, wäre ein Modell106, wie Krankheitsrisiken abgesichert werden könnten. Schmidt-Aßmann bringt diese Erkenntnis folgendermaßen auf den Punkt: „Der im Sozialstaatsprinzip angelegte Auftrag an die staatlichen Instanzen, soziale Sicherungssysteme gegen die Wechselfälle des Lebens zu schaffen, bedeutet nicht, dass solche Systeme in ihrem überkommenen Zuschnitt erhalten bleiben müssen. Sozialstaatlich entscheidend ist allein der Erfolg der staatlichen Sicherung.“107
Es besteht ein Unterschied, ob eine bestimmte Rechtslage vom Sozialprinzip (zwingend) gefordert wird oder ob sie mit dem Sozialprinzip vereinbar ist. Im zuletzt genannten Fall steht nur fest, dass das Sozialprinzip eine bestimmte Rechtslage nicht verbietet; wie andere Grundgesetzbestimmungen sich zu dieser Rechtslage verhalten, wird dadurch in keiner Weise vorweggenommen108. Das Sozialprinzip verlangt zwar auf Grund seiner Abstraktheit Konkretisierungen durch den Gesetzgeber, aber die vorgenommenen einfachgesetzlichen Konkretisierungen erhalten deshalb nicht Anteil am Verfassungsrang109. Auch die Äußerungen Lerches110, der als Vertreter des Verfassungsrangs der gesetzlichen KrankenverKlaus Stern, Staatsrecht I, S. 894. Paul Kirchhof, HdBStR IV, § 93 Rn. 1, 6. 104 Hans Peter Bull, Staatsaufgaben, S. 237. 105 BVerfGE 52, 283 (298); 59, 231 (262 f.); Peter Badura, DÖV 1989, S. 491 (494); Thorsten Kingreen, Sozialstaatsprinzip, S. 143 f.; Josef Isensee, FS-Broermann, S. 365 (371); Hans-Jürgen Papier, Sozialrechtshandbuch, § 3 Rn. 6; Eberhard Schmidt-Aßmann, NJW 2004, S. 1689 (1690). 106 So Walter Leisner, Marktwirtschaft, S. 35 (45 ff.). 107 Eberhard Schmidt-Aßmann, NJW 2004, S. 1689 (1690). 108 Vgl. Walter Leisner, Sozialversicherung, S. 124 f. 109 Josef Isensee, FS-Broermann, S. 365 (371); Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 309; Werner Weber, Der Staat 4 (1965), S. 409 (416). 110 Peter Lerche, Übermaß 1999, S. 231. 102 103
78
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
sicherung angesehen wird, gehen nicht so weit, als dass die gesetzliche Krankenversicherung in ihrer überkommenen Gestalt erhalten werden müsste. Lerche ist der Auffassung, dass „ein Mindestmaß gewisser vorhandener sozialer Institutionen bestehen bleiben“ müsse. Selbst wenn mit den Worten „vorhandener sozialer Institutionen“ auf den status quo abgestellt würde, hieße das nicht, dass die gesetzliche Krankenversicherung Verfassungsrang hätte. Denn Lerche spricht von einem Mindestmaß sozialer Institutionen, ob hierzu die gesetzliche Krankenversicherung gehört, lässt sich dieser Passage nicht entnehmen. Im Übrigen geht auch er davon aus, dass das Sozialstaatsziel dem Gesetzgeber die Aufrichtung einer neuen sozialen Ordnung nicht verwehrt111. Diese kann der Gesetzgeber aber nur dann aufrichten, wenn er die überkommenen Strukturen der gesetzlichen Krankenversicherung verändern darf. Die beiden Aussagen sind deshalb nur dann miteinander zu vereinbaren, wenn sie in dem Sinne verstanden werden, dass der Gesetzgeber zwingend an das Ziel der sozialen Sicherung gebunden ist, nicht aber an einen bestimmten einzuschlagenden Weg. Teilweise lässt sich erkennen, dass die Ermittlung der Verfassungsgarantie der gesetzlichen Krankenversicherung nur auf einem in diese Richtung gehenden Vorverständnis beruht. Wenn Burmeister vertritt, „wegen der Enthaltung des Grundgesetzes bei der Statuierung sozialer Grundrechte“ „einen institutionellen Bestandsschutz bestimmter Leistungen des staatlichen Leistungsapparats“ verankern zu müssen112, so ist diese Argumentation keineswegs zwingend. Aus dem Fehlen sozialer Grundrechte kann ebenso gut (oder besser?) das Gegenteil geschlossen werden: Wenn das Grundgesetz betont vorsichtig bei der Zuerkennung sozialer Positionen ist und die Realisierung sozialer Forderungen dem Gesetzgeber überantwortet, dann kann eher davon ausgegangen werden, dass diesem im Rahmen des Demokratie- und Sozialstaatsprinzips die Ausgestaltung der Sozialordnung überantwortet ist. Dann aber hat die Sozialordnung den Rang eines einfachen Gesetzes und keineswegs Verfassungsrang. Teilweise finden sich auch Widersprüche in der Position Burmeisters. Denn während er zunächst ausdrücklich vertritt, dass das Grundgesetz keine sozialen Grundrechte enthält, heißt es später: „Auch wenn es heute noch verfrüht sein dürfte, im großen Stil von sozialen Grundrechten zu sprechen, so ist doch der Weg dazu über eine begrenzt grundrechtsinstitutionelle Festlegung von Sozialwerten gegeben.“113
Wenn das Grundgesetz keine sozialen Grundrechte enthält, dann auch nicht „im kleinen Stil“ und erst recht nicht zukünftig „in großem Stil“. Entgegen der Erkenntnis, dass es keine sozialen Grundrechte gibt, solche dennoch in das Grundgesetz hineinlesen zu wollen, vermag argumentativ nicht zu überzeugen.
111 112 113
Peter Lerche, Übermaß 1999, S. 232. Joachim Burmeister, Grundrechtsverständnis, S. 22 f. Joachim Burmeister, Grundrechtsverständnis, S. 98.
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
79
bb) Gewährleistung eines Minimalschutzes Das Sozialstaatsprinzip erfordert in Bezug auf die sozialen Sicherungssysteme aber nur ein Minimum an Schutz114. „Der Abbau auch des unerlässlichen Grundbestandes sozialer Sicherung wäre verfassungswidrig.“115 Alles das, was nicht den unerlässlichen Grundbestand berührt, wird also vom Sozialstaatsprinzip auch nicht erzwungen. Jedoch ist bislang ungeklärt, wie dieser Grundbestand auszusehen hat. Mit dem Grundbestand sind nicht die tragenden Organisationsprinzipien des gegenwärtigen Sozialversicherungssystems gemeint (z. B. Sachleistungsprinzip), sondern der Kern eines Sozialversicherungssystems. Es ließe sich auch eine Sozialgestaltung vorstellen, die auf eine gesetzliche Pflichtversicherung verzichtet und statt dessen auf eine Pflicht zur privaten Absicherung setzt und sozial Schutzbedürftige hierbei durch finanzielle Zuwendungen aus Steuermitteln unterstützt. Nur ein Mindestmaß an Schutz ist verfassungsrechtlich vorgegeben116 und kann als Inhalt von Art. 20 Abs. 1, Art. 23 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG angesehen und den Grundrechten als Gemeinschaftswert von Verfassungsrang entgegengehalten werden. Am Verfassungsrang des Sozialstaatsprinzips kann nur die Regelung teilhaben, die von Art. 20 Abs. 1 GG erzwungen wird. Nicht alles, was als politisch erwünscht oder landläufig als „sozial“ verstanden wird, hat wegen Art. 20 Abs. 1 GG Verfassungsrang. Kann dem Bürger nur ein Minimum an Schutz gewährt werden, so kann ihm auch nur ein Minimum an verfassungsrechtlichem Gehalt als verfassungsrechtlicher Gemeinschaftswert entgegengehalten werden. Selbstverständlich ist der Gesetzgeber nicht durch das Sozialstaatsprinzip gehindert, einen weitergehenden Schutz, als ihn das Sozialstaatsprinzip fordert, zu verwirklichen. Dabei handelt es sich dann aber um sozialpolitische Entscheidungen, solche Maßnahmen werden nicht von Art. 20 Abs. 1, Art. 23 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG gefordert. Nur dass es ein Schutzsystem gibt, nicht aber wie dieser Schutz aussieht, wird vorgegeben117. Wenn bereits lediglich die Existenz eines Minimums an Schutz gefordert ist, können auch nur die Funktionsfähigkeit dieses Minimums und die finanziellen Mittel, die zu dessen Aufrechterhaltung nötig sind, gefordert werden. So formuliert denn auch Konrad Hesse: „Die Formel vom sozialen Rechtsstaat enthält daher zwar für den konkretisierenden Gesetzgeber einen verbindlichen Auftrag, aber keine verbindlichen Richtlinien für die Erfüllung dieses Auftrags. Die Neigung, alles Wünschenswerte in sie hineinzulegen und es auf diese Weise als Verfassungsgebot auszugeben, verkennt die Bedeutung der Formel, gerade auch im Kontext der demokratischen Ordnung des Grundgesetzes.“118 114 BVerfGE 68, 193 (209); 82, 60 (80); Ulrich Becker, NZS 2003, S. 561 (565 mit Fn. 70); Jürgen Schwabe, NJW 1969, S. 2274 (2275). 115 Klaus Stern, Staatsrecht I, S. 895; Rica Werner, Leistungsfähigkeit, S. 116 116 Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 308. 117 Walter Leisner, Sozialversicherung, S. 124 f.; Friedrich E. Schnapp, HdBVertragsarztR, § 4 Rn. 19. 118 Konrad Hesse, Grundzüge, Rn. 215. So auch Hans Peter Bull, FS-Badura, S. 57 (72).
80
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
Das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, dass das Sozialstaatsprinzip nicht in dem Sinne verstanden werden könne, dass es bei der Existenzsicherung des Bürgers gegen die Wechselfälle des Lebens ein „so und nicht anders aufgebautes Sozialversicherungssystem“119 gewährleistet. Auch die Argumentation Schwabes, der ebenfalls von einem Mindestmaß an Schutz ausgeht, kann zu keinem anderen Ergebnis führen. Er ist der Ansicht, dass das Vorenthalten von finanziellen, sachlichen und personellen Mitteln, die zum Gesundheitsschutz benötigt werden, gegen das Sozialprinzip in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verstoße. Denn hierdurch entstünden Leid, Schmerzen und Tod, was der Staat auf Grund seiner Schutzpflicht verhindern müsse120. Aber das Existenzminimum wird bereits geschützt, und der Schutz des Existenzminimums erzwingt nicht die Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung. Abermals spielt hier der Charakter des Sozialstaatsprinzips als Staatszielbestimmung eine Rolle. Auch bei der Pflicht, ein Minimum an Daseinsvorsorge zu gewährleisten, hat der Staat einen weiten Spielraum, wie er diese Pflicht erfüllt. Bestimmte Wege oder Mittel, wie zum Beispiel die Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung, werden von Art. 20 Abs. 1 GG nicht vorgegeben. Zwar dient die gesetzliche Krankenversicherung dem „Schutz vor den Wechselfällen des Lebens“, aber das bestehende System der gesetzlichen Krankenversicherung wird nicht von diesem Aspekt des Sozialprinzips gefordert. Deshalb kann auch der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung nicht von diesem Aspekt des Sozialstaatsprinzips verlangt werden. Möglicherweise lässt sich dieser Grundsatz aber unter den Punkt „Herstellung einer gerechten Sozialordnung“ fassen.
b) 2. Fallgruppe: „Herstellung einer gerechten Sozialordnung“ Das Bundesverfassungsgericht hat zum Sozialstaatsprinzip ausgeführt, dass es eine „gerechte Sozialordnung“ ermöglichen solle121, womit sich abermals die Frage stellt, was gerecht ist. Nach der Rechtsprechung und Literatur umfasst diese Fallgruppe des Sozialstaatsprinzips die Fürsorge für Hilfsbedürftige, d. h. für „Personen, die aufgrund ihrer persönlichen Lebensumstände oder gesellschaftlichen Benachteiligung an ihrer persönlichen oder sozialen Entfaltung gehindert sind“122. Dies war auch der historische Ausgangspunkt der gesetzlichen Krankenversicherung, bevor der Versichertenkreis immer weiter ausgedehnt wurde. Zieht man die 5,8 % der freiwillig Versicherten ab, bleibt immer noch ein Einbeziehungsgrad von 119 BVerfGE 39, 302 (315). Vgl. auch BVerfGE 51, 115 (125) – im Hinblick auf Arbeitslosengeld. 120 Jürgen Schwabe, NJW 1969, S. 2274 f. 121 BVerfGE 5, 85 (198); 36 (abw. Meinung), 237 (250); 59, 231 (263); 93, 121 (163). 122 BVerfGE 100, 271 (284). So bereits 45, 376 (387); vgl. auch BVerfGE 43, 13 (19).
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
81
rund 80 % der Bevölkerung123. Wollte man annehmen, dass die Einbeziehung der derzeitig gesetzlich Versicherten in das System der gesetzlichen Krankenversicherung und dessen Ausgestaltung vom Sozialprinzip unter dem Aspekt der Herstellung einer gerechten Sozialordnung gefordert würde, müsste dargelegt werden, dass 80 % der Versicherten hilfsbedürftig seien. Bull verwendet dementsprechend den Begriff der „Bedürftigen“ im Zusammenhang mit der Sozialversicherung auch nur in Anführungszeichen124. aa) Schutzbedürftigkeit als Kriterium In einer westeuropäischen Industrienation mit einem – trotz aller gegenwärtigen Probleme – der höchsten Lebensstandards in der Welt vermögen nicht 80 % der Bürger „den Wechselfällen des Lebens nicht Herr zu werden“125. Dennoch werden Zweifel geäußert, ob genügend Personen in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen sind126. Dieser Ansicht liegt folgendes Argumentationsmuster zu Grunde: Es wird am Kriterium der Schutzbedürftigkeit festgehalten, aber die Schutzbedürftigkeit wird nicht individuell verstanden. Nicht nur, wer selber schutzbedürftig ist, wird in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen, sondern auch nicht schutzbedürftige Personen, die auf Grund ihrer höheren Beiträge den sozial Schutzbedürftigen niedrigere Beiträge ermöglichen. Sozial Schutzbedürftigen soll ein Krankenversicherungsschutz zu für sie sozial und wirtschaftlich vertretbaren Beitragssätzen geboten werden127. Es wird also der Solidargedanke der gesetzlichen Krankenversicherung, wie er in § 1 Satz 1 und § 3 SGB V zum Ausdruck kommt, auf die Verfassungsebene übertragen. Dies entspricht der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das neben der Schutzbedürftigkeit auf ein zweites Kriterium abstellt, nämlich die Leistungsfähigkeit der Beitragszahler128. Bei dieser Argumentation handelt es sich jedoch um einen Zirkelschluss129: Der einfachgesetzlich eingeführten Krankenversicherung wird Verfassungsrang eingeräumt, der dann im Namen der Solidarität eine weitere Ausdehnung der Pflichtversicherung rechtfertigen soll. Einbezogen werden Personen, Vgl. Einleitung, Fn. 2. Hans Peter Bull, Staatsaufgaben, S. 236. 125 So Jan Boetius, Einflussfaktoren, S. 31 f. Eine Begrenzung des Versichertenkreises auf die wirklich Schutzbedürftigen fordern Walter Leisner, Sozialversicherung, S. 55 ff.; ders., Belastungsgrenze, S. 79; ders., Finanzielle Stabilität, S. 15 (20 ff.); Helge Sodan, Freie Berufe, S. 332 f.; ders., VVDStRL 64 (2005), S. 144 (155 ff.) 126 BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 479 (481). Anders jedoch eine spätere Entscheidung, diesmal des Ersten Senats, in der es heißt, dass nach der gesetzlichen Typisierung die hilfsbedürftigen Personengruppen erfasst seien, BVerfG, NJW 2006, S. 891 (892). 127 Franz-Josef Oldiges, ZSR 1990, S. 354 (357); Franz Ruland, DRV 1985, S. 13 (29); Bertram Schulin, HdBSozVersR I, § 6 Rn. 184, 199. 128 BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 479 (481); BVerfGE 113, 167 (230). Vgl. auch Walter Leisner, Sozialversicherung, S. 58 f. 129 Friedrich E. Schnapp / Markus Kaltenborn, Friedensgrenze, S. 50. 123 124
6 Schaks
82
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
die individuell eindeutig nicht schutzbedürftig sind, aber deren Einkommen für die Finanzierung von Interesse ist. Lässt man sich auf diese Argumentation ein, zeigen sich weitere Widersprüche. Teilweise wird das Bild eines Ruderboots bemüht, das zu seinem Vorwärtskommen auf starke Ruderer angewiesen sei130. Dann fragt sich, weshalb nicht die stärksten Ruderer herangezogen werden. Die 10 % der Bevölkerung mit den höchsten Einkommen werden gerade nicht herangezogen. Ihnen bleibt die Wahl, ob sie sich privat oder freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichern wollen. Statt dessen werden bei einer Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze diejenigen herangezogen, die bislang nur knapp über der bisherigen Versicherungsgrenze lagen. Diese Menschen als die im Vergleich zu den übrigen Versicherten besonders starke „Ruderer“ zu bezeichnen, scheint kaum plausibel. Wenn das Bundesverfassungsgericht das Kriterium der Schutzbedürftigkeit aufstellt, ist davon auszugehen, dass dieses Kriterium einen sinnvollen Anwendungsbereich haben soll. Zumindest kann ausgemacht werden, „daß es gewisse Kategorien von anderen abgrenzt, die eben nicht schutzbedürftig sind, weil anderweitig abgesichert (Beamte) oder weil sie sich durch private Versicherung zu helfen vermögen“131. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob der Einzelne die Kosten einer Behandlung – die im Einzelfall immens sein können – zu tragen vermag, sondern dass er die für die Versicherung erforderlichen Mittel aufbringen kann132. Er muss durch Vorsorge den Wechselfällen des Lebens Herr werden können. Das vermögen mit Sicherheit nicht nur die wenigen Nicht-Pflichtversicherten, sondern wesentlich weitere Bevölkerungskreise133. Die naheliegende Frage, ob diese Ausdehnung zu Recht geschah, wird zu selten aufgeworfen. Dabei wäre zu hinterfragen, wieso gerade in den Wohlstandsjahren der 1960er und 1970er die Schutzbedürftigkeit weiter Bevölkerungskreise plötzlich eingetreten ist. Die Annahme, dass bewusst nichtschutzbedürftige Personen einbezogen wurden, ist nicht fernliegend. Geht man davon aus, dass Leben und körperliche Unversehrtheit zu den kostbarsten Gütern gehören, die der Mensch genießen kann, so gilt diese Feststellung nicht nur gegenüber dem Staat. Nicht nur von diesem kann Beachtung dieses Wertes verlangt werden. Auch der Einzelne muss sich diese Erkenntnis entgegenhalten lassen. Wer, um seine Versicherung zu finanzieren, bei seinen Urlaubsreisen Einschränkungen vornehmen muss, wird deshalb noch nicht sozial schutzbedürftig. Bei der sozialen Schutzbedürftigkeit im Sinne des Sozialprinzips kommt es somit nicht auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Anderen, sondern ausschließlich Ingwer Ebsen, VVDStRL 64 (2005), S. 180 f. (Diskussionsbeitrag). Walter Leisner, Sozialversicherung, S. 60. 132 Eberhard Schmidt-Aßmann, Grundrechtspositionen, S. 21. 133 Deshalb warnte bereits im Jahre 1961 Walter Bogs, Freiheit, S. 509 (513 f.) vor einer übertriebenen Ausweitung der Pflichtversicherung und dem damit einhergehenden Freiheitsverlust. Vgl. auch Helge Sodan, VVDStRL 64 (2005), S. 144 (155 f.). Kritisch zur ständigen Ausweitung der Pflichtversicherung auch Detlef Merten, NZS 1998, S. 545 (548 ff.). 130 131
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
83
auf die eigene Leistungsfähigkeit an134. Ob jemand sozial schutzbedürftig ist, richtet sich nicht nach dem Einkommen seines Nachbarn, sondern nach seinen eigenen Einkünften. Im Übrigen: Wer sozial schutzbedürftig ist, ist nicht leistungsfähig, und wer leistungsfähig ist, ist nicht sozial schutzbedürftig. Es liegt ein Gegensatzpaar vor. Da die Kriterien auf einander widersprechende Eigenschaften abstellen, ist ohnehin fraglich, ob diese Kriterien (zumindest ihre Kombination) richtig gewählt sind. bb) Leistungsfähigkeit als Kriterium? Aber selbst wenn man die Richtigkeit dieser beiden Kriterien (Schutzbedürftigkeit und Leistungsfähigkeit) unterstellt, ergäben sich Probleme: Das Kriterium der Schutzbedürftigkeit wird zugunsten der Leistungsfähigkeit geopfert, wenn letzten Endes fast doch die gesamte Bevölkerung in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen ist135. Die Rechtsprechung wird widersprüchlich, wenn zwei Kriterien aufgestellt werden und eines davon in seiner Wirksamkeit nahezu vollständig von dem anderen Kriterium verdrängt würde. In Wirklichkeit würde dem Aspekt der Schutzbedürftigkeit keine Bedeutung zugemessen136, obwohl man doch davon ausgehen könnte, dass dieser Aspekt unter dem Blickwinkel des Sozialstaatsprinzips der ausschlaggebende sein sollte137. Denn das Sozialstaatsprinzip fordert den Schutz der Schwächeren. Gewährleistet werden soll eine Mindest- und Grundsicherung138. Die Belastung der Leistungsfähigen ist die rechtfertigungsbedürftige Folge, nicht Selbstzweck. Die Leistungsfähigkeit sollte allenfalls ein Hilfskriterium sein. Es kann helfen, Härten bei der im Einzelfall schwierigen Abgrenzung zwischen beiden Gruppen zu begründen. Beide Kriterien können jedoch nicht gleichgewichtig sein, denn sie verlangen das Vorliegen einander widersprechender Eigenschaften. Würde man annehmen, dass beide Kriterien gleichrangig seien, entstünde ein Patt. Wollte man zu Gunsten des einen oder des anderen Kriteriums entscheiden, gäbe es keine rationale Grundlage. Jede Entscheidung wäre willkürlich. Deshalb muss ein Kriterium vorrangig sein. Das ist das Kriterium der Schutzbedürftigkeit139. Das Kriterium der Leistungsfähigkeit kann nicht dazu dienen, den Aspekt der Schutzbedürftigkeit vollständig zu überspielen. Zumal man bei einer Einbeziehung von 90 % der Bevölkerung in die gesetzliche Krankenversicherung bereits nahe an der Bürgerzwangsversicherung liegt. 134 So auch Ferdinand Kirchhof, NZS 2004, S. 1 (2); Rica Werner, Leistungsfähigkeit, S. 180 ff. 135 Kritisch auch Görg Haverkate, DVBl. 2004, S. 1061 (1062); Thorsten Kingreen, Sozialstaatsprinzip, S. 265 ff. 136 So auch Walter Leisner, Sozialversicherung, S. 55 f. 137 Kritik deshalb auch bei Thorsten Kingreen, Sozialstaatsprinzip, S. 263 ff. 138 Josef Isensee, ZVersWiss 2004, S. 651 (654); Detlef Merten, NZS 1998, S. 545 (550). 139 Der Sache nach auch Hans-Jürgen Papier, ZSR 1990, S. 344 (347).
6*
84
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
Teilweise wird sogar noch strenger gefordert, dass „nichtsteuerliche Abgaben zu ihrer Rechtfertigung eines besonderen, von der Leistungsfähigkeit abzuschichtenden Grundes ihrer Erhebung“ bedürfen140. Dieser besondere Grund wird im vorliegenden Zusammenhang vermisst. Denn es wird bei den Nichtschutzbedürftigen allein auf die Leistungsfähigkeit Bezug genommen, ohne dass ein anderer Grund ersichtlich oder auch nur behauptet wird. Danach wäre die Einbeziehung sozial nichtschutzbedürftiger Personen per se unzulässig. Haverkate kritisiert, dass das Bundesverfassungsgericht im Bereich der Sozialversicherung das Kriterium der Privatnützigkeit der Beiträge zu Gunsten der Umverteilung stark relativiert habe141. cc) Keine Gleichrangigkeit von Schutzbedürftigkeit und Leistungsfähigkeit Es wurde bereits festgestellt, dass die beiden Kriterien „Schutzbedürftigkeit“ und „Leistungsfähigkeit“ ein Gegensatzpaar darstellen. Denkt man die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts weiter, so werden die bisherigen Rechtfertigungsversuche hinfällig. Bislang konnten immer weitere Personenkreise allein wegen ihrer Leistungsfähigkeit in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen werden; der Prozentsatz der Pflichtversicherten beträgt rund 80 %, insgesamt sind 90 % der Bevölkerung in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen. Je weiter sich der Einbeziehungsgrad den 100 % nähert, desto offensichtlicher wird, dass beide Kriterien keine Rolle mehr spielen. Isensee führt hierzu aus: „Je höher sie [scil.: die Versicherungspflichtgrenze] steigt, umso zahlungskräftiger ist der Kreis der erzwungenen Neuzugänge, jedoch umso schwächer deren soziale Schutzbedürftigkeit und umso fadenscheiniger die juristische Legitimation der Versicherungspflicht, die sich just auf diesen Umstand stützen möchte.“142
Bei einer umfassenden Pflichtversicherung käme es gar nicht mehr auf Schutzbedürftigkeit oder die Leistungsfähigkeit an, sondern nur noch auf den Wohnsitz im Bundesgebiet. Dann müsste es also einen Einbeziehungsgrad geben, ab dem die Kriterien „Schutzbedürftigkeit“ und „Leistungsfähigkeit“ schlagartig irrelevant und von Verfassungs wegen durch das Kriterium „Wohnsitz im Bundesgebiet“ ersetzt würden. Ein solcher „Umschlagpunkt“ ist dem Art. 20 Abs. 1 GG mit juristischen Mitteln nicht zu entnehmen. Je höher die Versicherungspflichtgrenze wird und sie weiterhin mit den gleichrangigen Kriterien „Schutzbedürftigkeit“ und „Leistungsfähigkeit“ gerechtfertigt wird, desto weniger überzeugend kann eine solche Argumentation sein, bis ihre Unhaltbarkeit schließlich evident wird.
140 Rica Werner, Leistungsfähigkeit, S. 180. Vgl. auch Friedhelm Hase, Versicherungsprinzip, S. 61 ff. 141 Görg Haverkate, DVBl. 2004, S. 1061 (1062). 142 Josef Isensee, ZVersWiss 2004, S. 651 (654).
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
85
c) Ergebnis zu 3. Die gesetzliche Krankenversicherung in ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung kann daher nicht als Fürsorge nur für Hilfsbedürftige angesehen werden143. Der Gesetzgeber hat hierdurch das von Art. 20 Abs. 1, Art. 23 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG geforderte Minimum an sozialem Schutz überschritten, so dass die gesetzliche Krankenversicherung in ihrer derzeitigen Ausgestaltung nicht mehr als durch das Sozialstaatsprinzip gefordert angesehen werden kann. Es ist nicht zu bestreiten, dass es einen Prozentsatz von Personen gibt, die sozial schutzbedürftig und auf staatliche Hilfe bei der Gesundheitsversorgung angewiesen sind. Jedoch liegt dieser Prozentsatz erheblich unter den derzeitigen 90 %, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. Bestritten werden muss die Behauptung, dass jeder der in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert ist, auch automatisch sozial schutzbedürftig sein soll. Die Existenz des bestehenden Systems der gesetzlichen Krankenversicherung wird nicht vom Sozialstaatsprinzip verlangt144, weder unter dem Aspekt des Schutzes vor den Wechselfällen des Lebens noch unter dem Aspekt der Herstellung einer gerechten Sozialordnung. Deshalb kann auch der Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität nicht aus dieser Bestimmung abgeleitet werden.
4. Grenze und Begrenzungen des Sozial(staats)prinzips Ergänzend sei auf weitere Aspekte hingewiesen: Die Umsetzung des Sozialprinzips kann nur im Rahmen des rechtlich und tatsächlich, d. h. auch finanziell, Möglichen gefordert werden145. Zum Rahmen des Möglichen gehört nicht nur die finanzielle Leistungskraft des Staates, sondern auch der Bürger146. Auch die Leistungserbringer, wie zum Beispiel die Ärzte, sind Bürger, die beanspruchen können, mit ihren Grundrechtsinteressen ernst genommen zu werden147. Auch ihre finanzielle Leistungsfähigkeit muss berücksichtigt werden. Diese ist jedoch durch zahlreiche Gesetze in den letzten Jahrzehnten immer weiter geJan Boetius, Einflussfaktoren, S. 31 f. BVerfGE 39, 302 (314 f.); 77, 340 (344); Hans Peter Bull, Staatsaufgaben, S. 237; Martin Füllsack, Reformmodelle, S. 67; Josef Isensee, Umverteilung, S. 27 f.; Renate Jaeger, System, S. 15 (16); Hans Hofmann, in: Schmidt-Bleibtreu / Klein, GG, Art. 20 Rn. 31; Walter Leisner, Grundgesetz und Krankenversicherung, S. 43 (44 f.); Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 308; Ruth Schimmelpfeng-Schütte, GesR 2004, S. 1; Helge Sodan, ZRP 2004, S. 217 (220); Martin Stockhausen, Berufsfreiheit, S. 76. 145 BVerfGE 33, 303 (333 f.); Karl-Jürgen Bieback, Verfassungsrechtlicher Schutz, S. 28; Volker Neumann, DVBl. 1997, S. 92 (94); Eberhard Schmidt-Aßmann, NJW 2004, S. 1689 (1690); Klaus Stern, Staatsrecht I, S. 919. 146 Klaus Stern, Staatsrecht I, S. 919. 147 Eberhard Schmidt-Aßmann, Grundrechtspositionen, S. 11; ders., NJW 2004, S. 1689 (1691). 143 144
86
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
sunken148. Das Sozialstaatsprinzip kann nur Verteilungsmaßstäbe liefern, aber keine Verteilungsmasse149. Wäre es anders, bestünden die gegenwärtigen Probleme nicht. Der Gesetzgeber kann das Sozialprinzip nur im Rahmen der Grundrechte verwirklichen, nicht gegen sie150. Das Sozialprinzip stellt nur eine Bestimmung im Gefüge des Grundgesetzes dar, diese taugt nicht dazu, die Wirkung der Grundrechte zu überspielen. Die Grundrechte stehen auch nicht in einem Gegensatz zum Gemeinwohl, vielmehr sind auch sie Teil des Allgemeinwohls151. Der Gesetzgeber kann selbst durch eine weite Sozialgesetzgebung nicht die Bindung an die Grundrechte gemäß Art. 1 Abs. 3 GG umgehen152. „Die Handlungspflichten und Handlungsaufträge des sozialen Staatsziels sind indes nicht absolut und isoliert zu begreifen. Sie sind eingebettet in die weiteren Gehalte der Staatsfundamentalnorm des Art. 20 Abs. 1 GG, also in die bundesstaatliche, demokratische und rechtsstaatliche Verfassungsordnung. Der Staatszielbestimmung der Sozialstaatlichkeit kommt in diesem Geflecht kein Vorrang zu, so dass die staatliche Durchsetzung oder Förderung des sozialen Staatsziels stets die Verfahrens-, Kompetenz- und Grundrechtsbestimmungen der bundes-, demokratie- und rechtsstaatlichen Verfassungsordnung zu wahren hat.“153
Schließlich sei auf den Grundsatz des Vorrangs privater Lebensgestaltung verwiesen. Er besagt, dass staatliche Regelungen subsidiär gegenüber der Vorsorge des eigenverantwortlich handelnden Individuums sind154. „Das Grundgesetz geht eben vom ,Prinzip Verantwortung‘ aus“.155 Dass private Vorsorge des Einzelnen für weite Bevölkerungskreise möglich ist, zeigen auch andere Versicherungszweige. Das Prinzip der Eigenvorsorge ist auch einfachgesetzlich abgesichert, wie in § 1 Abs. 1, Satz 1, 2 SGB II156. Es gilt das Prinzip der Subsidiarität staatlicher 148 149
Helge Sodan, Freie Berufe, S. 9 ff., 159 f. Josef Isensee, FS-Broermann, S. 365 (368). So auch Peter Badura, DÖV 1989, S. 491
(496). 150
Josef Isensee, FS-Broermann, S. 365 (376); Helge Sodan / Olaf Gast, NZS 1998, S. 497
(505). Peter Häberle, AöR 95 (1970), S. 86 (112). Helge Sodan, NZS 2001, S. 169 (175). 153 Hans-Jürgen Papier, Sozialrechtshandbuch, § 3 Rn. 2. So auch Rainer Pitschas, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 827 (833). 154 Peter Badura, DÖV 1989, S. 491 (493); Josef Isensee, Subsidiaritätsprinzip, S. 313 ff; ders., FS-Broermann, S. 365 (390); Thorsten Kingreen, Sozialstaatsprinzip, S. 261 ff.; Eberhard Schmidt-Aßmann, Grundrechtspositionen, S. 13; Helge Sodan, DÖV 2000, S. 361 (368 f.). Kritik am „paternalistischen“ Staat auch bei Görg Haverkate, DVBl. 2004, S. 1061 (1062); Friedrich E. Schnapp, DVBl. 2004, S. 1053 (1054); Rica Werner, Leistungsfähigkeit, S. 124 f. 155 Jan Ziekow, FS-Armin, S. 189 (198). Vgl. auch Friedhelm Hufen, VVDStRL 47 (1989), S. 142 (156). 156 I. d. F. des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24. 12. 2003 – BGBl. I, S. 2954 (2956). 151 152
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
87
Fürsorge, denn staatliche Fürsorge kann nicht und soll nicht die Eigeninitiative und -verantwortung des Einzelnen ersetzen157.
5. Ergebnis zu I. Aus Art. 20 Abs. 1, Art. 23 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG folgt nicht der Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung und damit auch nicht der Grundsatz ihrer finanziellen Stabilität.
II. Das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG In der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts158 findet sich die Aussage, dass die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung der versicherten Bevölkerung letztlich der Gesundheit und dem Leben von Menschen und damit dem Gemeinwohl diene. Auch das Bundesverfassungsgericht zitiert in seinen Entscheidungen zum Grundsatz der finanziellen Stabilität zuweilen die hohe Bedeutung des Gesundheitsschutzes159. In der Literatur stellen einige Stimmen die Versorgung der gesetzlich Versicherten mit dem Schutz der Volksgesundheit gleich160. Somit könnte man den Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung vermittelt über den Gemeinwohlbelang „Volksgesundheit“ als Teil des Grundrechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) ansehen161.
1. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG unter dem Aspekt des Abwehrrechts Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit kann nicht unter dem Aspekt des Abwehrrechts aktiviert werden, denn wer eine gesetzliche Krankenversicherung einführen und beibehalten will, der verlangt das Tätigwerden des Gesetzgebers. Abwehrrechte sind jedoch darauf gerichtet, dass der Gesetzgeber gerade nicht tätig wird162. 157 Christoph Enders, VVDStRL 64 (2005), S. 7 (34) m. w. N.; Hans J. Wolff / Otto Bachof / Rolf Stober, Verwaltungsrecht I, § 18 Rn. 28; Hans F. Zacher, HdBStR II, § 28 Rn. 27, 33. Vgl. auch BVerwGE 11, 252 (254 f.); 23, 149 (152 f.); 27, 58 (63). 158 BSGE 82, 55 (61). 159 BVerfGE 82, 209 (230); 103, 172 (184); BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1998, S. 1776 (1777). 160 Walter Leisner, Finanzielle Stabilität, S. 15 (17 f.); Udo Steiner, MedR 2003, S. 1 (6). 161 Siehe hierzu Martin Stockhausen, Berufsfreiheit, S. 73 f. 162 Konrad Hesse, Grundzüge, Rn. 350; Helge Sodan / Jan Ziekow, Öffentliches Recht, § 22 Rn. 21.
88
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
2. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG unter dem Aspekt der Schutzpflicht Auch wenn die Abwehrfunktion der Grundrechte klassischerweise ihr Hauptanwendungsbereich163 ist, so ist doch anerkannt, dass die Grundrechte darüber hinausgehende Funktionen haben. So werden Teilhabe-, Leistungs- und Schutzrechte diskutiert164. Man spricht von einem originären Leistungsrecht, wenn es unabhängig von bestehenden Leistungssystemen auf die Schaffung neuer Leistungen gerichtet ist165. Demgegenüber sind Teilhaberechte darauf gerichtet, Zugang zu einem bereits bestehenden Leistungssystem zu verschaffen166. Bei der Schaffung der gesetzlichen Krankenversicherung geht es nicht um den Zugang zu einem bestehenden System, da das fragliche System erst geschaffen werden soll. Somit kann nur der Aspekt des Leistungsrechts, nicht aber des Teilhaberechts berührt sein. Aber auch der Aspekt der Schutzpflicht kann betroffen sein. Hierunter versteht man die Pflicht des Staates, rechtliche Regelungen so auszugestalten, dass die Gefahr von Grundrechtsverletzungen eingedämmt bleibt167. Problematisch ist das Verhältnis dieser beiden Grundrechtsfunktionen zueinander. Denn im vorliegenden Fall ist nicht ganz klar, worin sich diese beiden Funktionen unterscheiden. In beiden Fällen geht es um die Schaffung und Aufrechterhaltung der gesetzlichen Krankenversicherung. In der Literatur, die sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ein Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung hergeleitet werden kann, werden beide Aspekte nebeneinander behandelt168. Im Folgenden wird ebenso verfahren, wobei mit der Schutzpflicht begonnen wird. Die Herleitung könnte wie folgt aussehen: Die gesetzliche Krankenversicherung hätte dann Verfassungsrang, wenn aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG die Pflicht folgte, sie einzuführen. Unter dem Aspekt der Schutzpflicht wäre dies der Fall, wenn die Nichteinführung der gesetzlichen Krankenversicherung eine Schutzpflichtverletzung darstellte. Oder anders: Wenn die Schutzpflicht den Gesetzgeber zwänge, die gesetzliche Krankenversicherung, wie sie derzeit besteht, einzuführen. Die verfassungsrechtliche Prüfung einer Schutzpflicht erfolgt anders als die Verletzung eines Abwehrrechts. Das Bestehen einer Schutzpflicht [b)] muss von ihrer Überprüfbarkeit [c)] und ihrer Verletzung [d)] unterschieden werden. Zuvor muss 163 Josef Isensee, HdBStR V, § 111 Rn. 21. Das BVerfG spricht auch von der Sinnmitte der Grundrechte, so in BVerfGE 61, 82 (101). 164 Siehe zu diesen Dimensionen der Grundrechte Josef Isensee, HdBStR V, § 111 Rn. 77 ff.; Dietrich Murswiek, HdBStR V, § 112; Hans H. Klein, HdBGR I, § 6 Rn. 62 ff. 165 Helge Sodan / Jan Ziekow, Öffentliches Recht, § 22 Rn. 8. 166 Dietrich Murswiek, HdBStR V, § 112 Rn. 68 ff. Siehe auch BVerfGE 45, 376 (386 ff.). 167 BVerfGE 49, 89 (142). 168 Eberhard Schmidt-Aßmann, Grundrechtspositionen, S. 23 ff.; ders., NJW 2004, S. 1689 (1691); Helge Sodan, NZS 2003, S. 393 f.
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
89
jedoch die Schutzpflicht dogmatisch hergeleitet werden, um den Umfang und die Reichweite der staatlichen Schutzpflicht zu bestimmen [a)].
a) Dogmatische Herleitung: Umfang und Reichweite der Schutzpflicht Es ist allgemein anerkannt, dass staatliche Schutzpflichten zu Gunsten von Leben und körperlicher Unversehrtheit bestehen, auch ohne dass diese ausdrücklich im Grundgesetz statuiert sind169. So formulierte das Bundesverfassungsgericht: „Art. 2 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG verpflichtet den Staat, jedes menschliche Leben zu schützen. Diese Schutzpflicht ist umfassend. Sie gebietet dem Staat, sich schützend und fördernd vor dieses Leben zu stellen [ . . . ]“170.
Die dogmatische Herleitung dieser Schutzpflichten ist jedoch umstritten171. Der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wird vorgeworfen, in dieser Frage keine eindeutige und klare Position zu beziehen172. Der Streit über die richtige Begründung der grundrechtlichen Schutzpflichten soll hier nur in dem Maße geführt werden, in dem es für die Behandlung des Themas erforderlich ist. Lediglich insoweit, als sich aus den unterschiedlichen dogmatischen Herleitungen ein unterschiedlicher Schutzumfang ergibt, wird der Streit geführt. Das Bundesverfassungsgericht verfolgt einen doppelten Begründungsansatz: Zum einen soll die grundrechtliche Schutzpflicht aus dem objektiv-rechtlichen Gehalt der Grundrechte folgen173, zum anderen aus der Menschenwürde174. Das Verhältnis dieser beiden Ansätze zueinander ist nicht eindeutig. Während in den früheren Entscheidungen der Eindruck entstand, dass primär der objektiv-rechtliche Gehalt entscheidend sei und die Menschenwürde nur ergänzend herangezogen würde175, erscheint es inzwischen so, als sei die Menschenwürde unmittelbar Quelle der Schutzpflicht176. Bedenkt man, dass das Bundesverfassungsgericht in der zweiten Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch ausdrücklich festgestellt hat, dass sich Gegenstand und Maß der Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG und nicht aus der Menschenwürde ergeben, kann man davon ausgehen, dass Art. 1 Abs. 1 GG Bedeutung für das Bestehen der Schutzpflicht hat. Die inhaltliche BVerfGE 39, 1 (41); 46, 160 (164); 49, 89 (141 f.); 53, 30 (57); 56, 54 (73). BVerfGE 46, 160 (164). 171 Vgl. Johannes Dietlein, Schutzpflichten, S. 34 ff.; Wolfram Cremer, Freiheitsgrundrechte, S. 232 ff.; Peter Unruh, Schutzpflichten, S. 37 ff. 172 So z. B. Eckart Klein, NJW 1989, S. 1633 (1635 f.); Hans H. Klein, DVBl. 1994, S. 489 (492); Wolfram Cremer, Freiheitsgrundrechte, S. 230, 231. 173 BVerfGE 39, 1 (41 f.); 56, 54 (73); 77, 170 (214). 174 BVerfGE 88, 203 (251). 175 So in BVerfGE 39, 1 (41 f.). 176 So in BVerfGE 88, 203 (251). 169 170
90
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
Reichweite dieser Schutzpflicht bestimmt sich jedoch nach dem Freiheitsrecht des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG177, unabhängig davon, ob sie aus dem objektiv-rechtlichen Gehalt der Grundrechte oder aus der Menschenwürde hergeleitet wird. In dieselbe Richtung, dass sich also die Reichweite der Schutzpflicht aus dem jeweiligen Freiheitsrecht ergibt, gehen auch andere dogmatische Begründungen. Sowohl diejenigen, die das Bestehen der Schutzpflicht ideengeschichtlich begründen178, als auch diejenigen, die die Schutzpflicht bereits dem Wortlaut der Einzelgrundrechte entnehmen wollen179, sehen die Schutzpflicht in den Einzelgrundrechten verwurzelt. Zum selben Ergebnis kommen auch die Vertreter einer Auffassung, die die Schutzpflicht nicht als eigenständige dogmatische Figur anerkennen, sondern die Schutzpflicht vom abwehrrechtlichen Gehalt des Freiheitsrechts mitumfasst sieht180. Teilweise wird die staatliche Schutzpflicht auf den Menschenwürdekern reduziert181 oder aus den Grundrechtsschranken in Verbindung mit dem Sozialprinzip abgeleitet182. Da die letzten beiden Ansichten die Schutzpflicht nicht aus dem Freiheitsrecht ableiten, ist der Schutzumfang ein anderer als bei den zuvor dargestellten Auffassungen. Besonders augenscheinlich wird dies bei der Reduktion der Schutzpflicht auf den Menschenwürdekern. Gegen die beiden letztgenannten Ansichten werden jedoch gewichtige Bedenken vorgebracht. Die Menschenwürdekern-Theorie stößt zum einen auf praktische Schwierigkeiten. Bislang ist es nicht überzeugend gelungen, eine Inhaltsbestimmung der Menschenwürde zu liefern183. Wenn dies nicht gelingt, lässt sich auch der Kernbereich der Menschenwürde kaum bestimmen und von ihrem „Randbereich“ abgrenzen184. Vor allem aber würden die Einzelgrundrechte obsolet werden. Wenn letzten Endes der Schutz bereits aus der Menschenwürde herrührte, wäre die Statuierung einzelner Freiheitsrechte entbehrlich185. Und schließlich soll die Menschenwürdegarantie den Schutz der Einzelgrundrechte verstärken. Die Menschenwürdegarantie soll nicht zu einer Schwächung des Grundrechtsschutzes führen186. Letz177
So auch Eckart Klein, NJW 1989, S. 1633 (1637); Gerhard Robbers, Sicherheit, S. 131,
187. 178 Josef Isensee, Sicherheit, S. 3 ff., 21 ff.; Eckart Klein, NJW 1989, S. 1633 (1636); Gerhard Robbers, Sicherheit, S. 27 ff. 179 Albert Bleckmann, DVBl. 1988, S. 938 (941 f.). 180 Dietrich Murswiek, Risiken der Technik, S. 63 ff., 89 ff., 107, 276; Jürgen Schwabe, Grundrechtsdogmatik, S. 213 ff. 181 Christian Starck, Verfassungsauslegung, S. 70 ff. 182 Otfried Seewald, Verfassungsrecht auf Gesundheit, S. 79 ff. 183 Karl Doehring, Staatsrecht, S. 281; Matthias Herdegen, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 1 Abs. 1 Rn. 30 (Stand der Bearbeitung: Februar 2005); Josef Franz Lindner, Grundrechtsdogmatik, S. 183 ff.; Martin Nettesheim, AöR 130 (2005), S. 71 (78). 184 Peter Unruh, Schutzpflichten, S. 43. 185 Peter Unruh, Schutzpflichten, S. 44. 186 Dietrich Murswiek, Risiken der Technik, S. 125 f.
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
91
teres wäre aber der Fall, wenn nur der Menschenwürdekern durch die Schutzpflicht gesichert würde und nicht der gesamte Schutzbereich des Einzelgrundrechts. Gegen die von Seewald vertretene Ansicht, dass sich die Schutzpflicht aus dem Sozialstaatsprinzip sowie den Grundrechtsschranken ergibt, bestehen ebenfalls Bedenken. Denn die Grundrechtsschranken als Befugnisnormen würden zu Eingriffspflichten umgewandelt. Die Grundrechtsschranken sollen dem Gesetzgeber ein Tätigwerden ermöglichen, nicht eine Eingriffspflicht auferlegen187. Aber auch wenn die Grundrechtsschranken in Verbindung mit dem Sozialprinzip die Schutzpflicht begründeten, würde zumindest aus dem Sozialstaatsprinzip – wie zuvor gesehen – nicht der Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung folgen188. Somit ergibt sich der Umfang und die Reichweite der grundrechtlichen Schutzpflicht aus dem jeweiligen Freiheitsgrundrecht, hier aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG. Auf die Frage, ob und inwieweit mit der Schutzpflicht ein Anspruch des Einzelnen korrespondiert189, kommt es vorliegend nicht an, denn es geht nur um die Frage, ob die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, dass der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Verfassungsrang hat, zutrifft. Nicht erheblich ist vorliegend, ob – falls ein solcher Verfassungsrang aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgt – der Bürger aus dem Grundsatz einen irgendwie gearteten Anspruch ableiten kann und wie er diesen möglicherweise durchsetzen kann. b) Bestehen einer Schutzpflicht Der Schutzbereich der Schutzpflicht entspricht dem des Abwehrrechts190. Mittels der gesetzlichen Krankenversicherung soll den Gefahren, die dem Einzelnen im Falle von Krankheit entstehen, begegnet werden (vgl. § 1 Satz 1 SGB V). Die Schaffung und Beibehaltung der gesetzlichen Krankenversicherung dient dem Zweck, den Versicherten im Falle von Krankheit eine medizinische Versorgung zu gewähren. Hierdurch soll die menschliche Gesundheit im biologisch-physischen Sinne191 geschützt werden. Somit ist der Schutzbereich des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG unter dem Aspekt der Schutzpflicht betroffen. Es soll davon ausgegangen werden, dass die staatliche Schutzpflicht umfassend gilt192, also nicht nur vor Gefahren ausländischer Hoheitsgewalt oder privater DritPeter Unruh, Schutzpflichten, S. 49. Siehe oben Zweites Kapitel C. II. 189 Siehe hierzu Markus Möstl, DÖV 1998, S. 1029 ff.; Helge Sodan, NVwZ 2000, S. 601 (602 ff.). 190 Wolfram Cremer, Freiheitsgrundrechte, S. 266. 191 Siehe hierzu BVerfGE 56, 54 (73 ff.). Ausführlich Georg Hermes, Schutz, S. 222 ff. 192 So Johannes Dietlein, Schutzpflichten, S. 102 f., Hans H. Klein, DVBl. 1994, S. 489 (490); Gerhard Robbers, Sicherheit, S. 124, 127; Peter Szczekalla, Schutzpflichten, S. 98; Peter Unruh, Schutzpflichten, S. 22 f., 75 f. 187 188
92
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
ter schützt193, sondern auch vor Naturereignissen. Diese Frage wird in der Literatur streitig diskutiert, und sie ist im vorliegenden Zusammenhang von Relevanz. Schlösse man sich der These an, dass die Schutzpflicht nur vor Gefahren schützt, die von ausländischer Hoheitsgewalt oder privaten Dritten ausgingen, dann würde der Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung nicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgen können, denn Krankheit ist weder eine Gefahr durch private Dritte noch durch ausländische Hoheitsgewalt. Diese Frage muss jedoch nicht weiter vertieft werden, falls festgestellt wird, dass der Gesetzgeber seiner Schutzpflicht auch ohne Einführung / Beibehaltung der gesetzlichen Krankenversicherung in ihrer jetzigen Form nachkommt. Die verschiedenen Krankheiten und Verletzungen, welche die körperliche Unversehrtheit und das menschliche Leben zu jedem Zeitpunkt gefährden können, stellen nicht nur eine entfernte, eher theoretische Gefahr dar. Es ist allgemein vorhersehbar, dass Menschen im Laufe ihres Lebens erkranken und dass die Schutzgüter des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG beeinträchtigt werden. Im schlimmsten Fall sind Erkrankungen irreparabel und tödlich. Deshalb liegt eine wirkliche Gefährdung von hinreichender Intensität vor, so dass auch die Voraussetzung der Überschreitung einer gewissen Gefahrenschwelle vorliegt194. Wenn also sowohl die Schutzpflicht des Staates stets besteht, als auch die Gefahr der Beeinträchtigung des Schutzgutes (durch Krankheiten) zu jedem Zeitpunkt des menschlichen Lebens, dann kann das bloße Bestehen einer Gefahr für das geschützte Rechtsgut allein nicht als ausreichend angesehen werden, um hieraus den Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung oder ihrer finanziellen Stabilität zu folgern. Die Schutzpflicht besagt nur, dass der Staat die Rechtsgüter des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG schützen muss und wovor, nicht aber wie, wann und wieweit. Der Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung oder des Grundsatzes der finanziellen Stabilität bestünde nur dann, wenn der Gesetzgeber gezwungen wäre, gerade die bestehende Form der gesetzlichen Krankenversicherung einzuführen. Dies wäre der Fall, wenn alle anderen Verhaltensweisen verfassungswidrig wären. Fraglich ist, ob die Schutzpflicht verletzt ist, wenn der Gesetzgeber die gesetzliche Krankenversicherung in ihrer jetzigen Form nicht einführt bzw. nicht beibehält.
193 So aber Wolfram Cremer, Freiheitsgrundrechte, S. 268; Detlef Merten, GS-Burmeister, S. 227 (237). 194 Siehe zu diesem Erfordernis Christoph Brüning, JuS 2000, S. 955 (956); Josef Isensee, Sicherheit, S. 37 f.
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
93
c) Wann liegt allgemein eine Schutzpflichtverletzung vor? aa) Voraussetzungen der Schutzpflichtverletzung Das Bundesverfassungsgericht hat ausgeführt, dass nur ausnahmsweise eine Feststellung der Verletzung der Schutzpflicht in Frage komme, da der Gesetzgeber einen weiten Spielraum195 habe, ob und wie er seiner Verpflichtung nachkomme196. Der Spielraum des Gesetzgebers bezieht sich nicht nur auf die Frage, ob er tätig werden will, sondern auch, wenn eine Verpflichtung zum Handeln besteht, wie er dieser Pflicht nachkommt197. In den seltensten Fällen wird der Gesetzgeber deshalb gezwungen sein, eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen198. Das Erfordernis eines gesetzgeberischen Spielraums begründet das Bundesverfassungsgericht mit der gewaltenteilenden Funktionsordnung des Grundgesetzes. Staatliche „Entscheidungen [sollen] möglichst richtig, das heißt von den Organen getroffen werden, die dafür nach ihrer Organisation, Zusammensetzung, Funktion und Verfahrensweise über die besten Voraussetzungen verfügen [ . . . ]“199. Das schließt aus, dass die Judikative in weitem Maße rechtssetzende Funktionen wahrnehmen kann. Daher muss die Erfüllung der Schutzpflichten primär der Legislative überantwortet sein. Der zugebilligte „Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum“, der auch Raum lässt, etwa konkurrierende öffentliche und private Interessen zu berücksichtigen“200, kann variieren. „Diese weite Gestaltungsfreiheit kann von den Gerichten je nach Eigenart des in Rede stehenden Sachbereichs, den Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden und der Bedeutung der auf dem Spiele stehenden Rechtsgüter nur in begrenztem Umfang überprüft werden [ . . . ].“201 Weiterhin sind von Bedeutung Art, Nähe und Ausmaß der möglichen Gefahr202 und inwieweit bereits eingetretene Schäden reparabel sind oder 195 Zum Spielraum sollen an dieser Stelle noch keine vertieften Ausführungen gemacht werden. Dieses Thema ist Gegenstand des folgenden Kapitels, wo v. a. der Spielraum des Gesetzgebers bei Eingriffen in die abwehrrechtliche Dimension der Grundrechte behandelt wird. Hier soll zunächst von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich des Spielraums bei Schutzpflichten ausgegangen werden. 196 BVerfGE 77, 170 (215). Vgl. auch bereits BVerfGE 56, 54 (80 f.). Siehe auch Hans D. Jarass, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 35 (49); Fritz Ossenbühl, FG-25 BVerfG, Bd. I, S. 458 (505 f.). 197 Josef Isensee, Sicherheit, S. 37 ff. 198 BVerfGE 46, 160 (164 f.). 199 BVerfGE 68, 1 (86). Vgl. auch BVerfGE 95, 1 (15); Wolfram Cremer, Freiheitsgrundrechte, S. 298 ff. 200 BVerfGE 77, 170 (214 f.). BVerfGE 79, 174 (202); 85, 191 (212); BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1996, S. 651; NJW 1998, S. 2961 (2962). 201 BVerfGE 77, 170 (215). Vgl. auch bereits BVerfGE 56, 54 (80 f.). 202 BVerfGE 49, 89 (142); Josef Isensee, Sicherheit, S. 37; Detlef Merten, GS-Burmeister, S. 227 (242 f.).
94
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
nicht und inwieweit der Eintritt der Gefahr beherrschbar und vom Einzelnen steuerbar ist203. Zunächst nahm das Bundesverfassungsgericht eine Schutzpflichtverletzung dann an, wenn der Gesetzgeber bislang keine Maßnahmen ergriffen hatte oder die bestehenden Maßnahmen evident unzureichend waren204. Im Schrifttum wurde hieran kritisiert, dass eine Schutzpflicht nicht erst durch eine evident unzureichende Maßnahme, sondern durch jede unzureichende Maßnahme verletzt wird205. Nach Vorarbeiten im Schrifttum206 hat das Bundesverfassungsgericht die Figur des Untermaßverbots in seiner Rechtsprechung zu den grundrechtlichen Schutzpflichten aufgegriffen207. Das Untermaßverbot verwehrt es dem Gesetzgeber, ein gewisses Schutzniveau zu unterschreiten. Es fordert, dass die ergriffenen Maßnahmen den notwendigen Schutz bieten208. Der Schutz muss „schon ausreichend“ sein, hinlänglicher Schutz für das zu schützende Rechtsgut muss gewährleistet sein209. Eine Verletzung der Schutzpflicht liegt also in concreto immer dann vor, wenn gegen das Untermaßverbot verstoßen wird210. Anders als das Übermaßverbot, das übermäßig belastende staatliche Maßnahmen abwehrt, verhindert das Untermaßverbot, dass der Staat zu wenig zum Schutze grundrechtlicher Rechtsgüter unternimmt211. Ein Verstoß gegen das Untermaßverbot und damit gegen die grundrechtliche Schutzpflicht liegt dann vor, wenn bislang keine geeigneten (dem Schutz überhaupt dienlichen) Vorkehrungen getroffen wurden, wenn es ein geeignetes Mittel gibt, das besseren Schutz gewährt als die bereits gegebenen Mittel, ohne stärker als diese in Rechte Dritter einzugreifen oder öffentliche Interessen zu beeinträchtigen oder wenn die Hinnahme der nach geltendem Recht verbleibenden Gefährdungen des Grundrechtsgutes bei Abwägung mit entgegenstehenden privaten und öffentlichen Interessen nicht zumutbar ist212. Dieser Ansatz lässt sich mit der ursprünglichen – und teilweise noch aufrechterhaltenen – Formulierung des Bundesverfassungsgerichts, nach der eine Schutz203 BVerfGE 53, 30 (58); Josef Isensee, Sicherheit, S. 37; Bodo Pieroth / Bernhard Schlink, Grundrechte, Rn. 98. 204 BVerfGE 56, 54 (80 f.); 77, 170 (215); 79, 174 (202). 205 Detlef Merten, GS-Burmeister, S. 227 (241). 206 Claus-Wilhelm Canaris, AcP 184 (1984), S. 201 (228); Hans D. Jarass, AöR 110 (1985), S. 363 (395). 207 BVerfGE 88, 203 (254); BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1995, S. 2343; NJW 1996, S. 651. 208 Eckart Klein, NJW 1989, S. 1633 (1638) spricht auch von „effektivem Schutz“. 209 Detlef Merten, GS-Burmeister, S. 227 (240). 210 BVerfGE 88, 203 (254). 211 Josef Isensee, HdBStR V, § 111 Rn. 1 ff. 212 Detlef Merten, GS-Burmeister, S. 227 (238 ff.); Markus Möstl, DÖV 1998, S. 1029 (1038 f.).
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
95
pflichtverletzung dann vorliegt, wenn der Gesetzgeber untätig geblieben ist oder die ergriffenen Maßnahmen evident unzureichend sind213, kombinieren. So erfasst der Begriff „keine geeigneten Maßnahmen“ sowohl den Fall der völligen Inaktivität des Gesetzgebers als auch den Fall, dass der Gesetzgeber (offensichtlich) unzureichende Maßnahmen ergriffen hat. bb) Überprüfbarkeit der Schutzpflicht durch das Bundesverfassungsgericht Damit ist das Prüfschema vorgegeben, anhand dessen das Bundesverfassungsgericht eine Schutzpflichtverletzung überprüft. Ist auch eine der genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, so ist der Gesetzgeber seiner Schutzpflicht nicht nachgekommen. Es würde sich dann die Frage stellen, ob der gesetzgeberische Spielraum so weit eingeschränkt ist, dass nur eine bestimmte Maßnahme (die Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung) ergriffen werden kann, weil nur diese keine Verletzung der Schutzpflicht darstellen würde. Die Beantwortung der Frage, ob die Schutzpflicht verletzt ist, erfordert die Bestimmung des Kontrollmaßstabs. Denn in manchen Entscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht den Spielraum des Gesetzgebers eingeschränkt. In diesen Entscheidungen zum Atomrecht214 und zum Schwangerschaftsabbruch215 ging es um erhebliche, irreparable Gefährdungen für das Rechtsgut Leben, so dass die Verhinderung einer Verletzung als besonders dringlich erschien. Im Nasciturus-Urteil aus dem Jahre 1993 lehnte das Bundesverfassungsgericht deshalb ausdrücklich eine bloße Evidenzkontrolle ab216 und machte dem Gesetzgeber detaillierte Vorgaben. Diese Einschränkung des Spielraums lag begründet in den Besonderheiten der Gefahren der Kernenergie bzw. der Endgültigkeit der Abtreibung. Im Falle eines Schwangerschaftsabbruchs ist der Nasciturus auf den Schutz durch Dritte angewiesen. Eine Möglichkeit sich selbst zu helfen, hat er naturgemäß nicht. Im Falle des Krankheitsschutzes sieht dies anders aus, da es Privatversicherungen gibt, mit deren Hilfe man sich vor Risiken absichern kann. Und nicht jede Krankheit ist irreparabel oder gar tödlich, so wie es die Abtreibung für den Nasciturus ist. Auch die Entscheidungen zum Atomrecht lassen sich mit den allgemeinen Krankheitsrisiken nicht vergleichen. Der Einzelne kann sich nicht wirksam vor den Gefahren der Radioaktivität schützen. Die Schutz- und Vorsorgemöglichkeiten liegen außerhalb seiner Einflusssphäre. Krankheiten sind in der Regel auch nicht so schwerwiegend und schädlich wie die Schäden durch einen Atomunfall. Mit diesen beiden Extremfällen lässt sich das Krankheitsrisiko nicht gleichsetzen. Es ist also von einem 213 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1998, S. 2961 (2962); vgl. ferner BVerfGE 56, 54 (80 f.); 77, 170 (215); 79, 174 (202); 85, 191 (212); 89, 276 (286); 92, 26 (46). 214 BVerfGE 49, 89 (142 f.); 53, 30 (58). 215 BVerfGE 88, 203 ff. 216 BVerfGE 88, 203 (262 f.).
96
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
weniger engen Maßstab als in den Entscheidungen zum Schwangerschaftsabbruch und Atomrecht auszugehen. Denn auch wenn das Auftreten von Krankheiten in der Regel nicht steuerbar ist, so besteht doch die Möglichkeit der Vorsorge bzw. vorsorglichen Organisation von Behandlungsmöglichkeiten. Somit ist davon auszugehen, dass dem Gesetzgeber im Hinblick auf die gesetzliche Krankenversicherung keine detaillierten Vorgaben – anders als bei den Entscheidungen zum Schwangerschaftsabbruch und Atomrecht– gemacht werden können. Teilweise wird jedoch vertreten, dass im Falle der Überprüfung von Schutzpflichten die Reichweite der Schutzpflicht und ihr Kontrollmaßstab auseinanderfielen217. Damit ist nicht die Anerkennung eines gesetzgeberischen Spielraums gemeint, sondern darüber hinausgehend die Zubilligung eines nicht justiziablen Handlungsraums des Gesetzgebers. Der zu überprüfenden Norm wird eine Handlungs- und eine Kontrollnorm entnommen, wobei letztere a priori weniger weit reicht als erstere. Im Falle der Übereinstimmung von Handlungsnorm und Kontrollnorm spricht man auch von Konvergenz, anderenfalls, wenn die Kontrollnorm nicht ganz so weit reicht wie die (materielle) Handlungsnorm, von Divergenz218. Im Falle von Divergenz würde der Gesetzgeber zu mehr verpflichtet sein, als das Bundesverfassungsgericht überprüfen kann. Dies wiederum würde bedeuten, dass schon dann eine gesetzgeberische Handlungspflicht bestehen würde, bevor eine Verletzung der Schutzpflicht festgestellt werden könnte. Auf die gesetzliche Krankenversicherung bezogen, könnte – wenn die Prämisse richtig ist – ihr Verfassungsrang auch dann gegeben sein, wenn noch keine Schutzpflichtverletzung vorliegt. Der Streit kann dahinstehen. Selbst im Falle von Divergenz hieße das, dass auch das Bundesverfassungsgericht nur bis zu dieser Grenze prüfen könnte. Das Bundesverfassungsgericht könnte den Satz, dass der Gesetzgeber an den Grundsatz der finanziellen Stabilität gebunden ist, nur dann behaupten, wenn es entweder der Konvergenzlösung folgt oder wenn Handlungs- und Kontrollnorm (noch) übereinstimmen. d) Keine Verletzung der Schutzpflicht im Falle der Nichteinführung der gesetzlichen Krankenversicherung Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung ist ein legitimer Zweck, und im Grundgesetz wird die Sozialversicherung erwähnt (Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG), wozu die gesetzliche Krankenversicherung gehört. Man kann deshalb nicht annehmen, dass sie von Verfassungs wegen verboten sein soll. Die Legitimität des Zwecks und des Mittels sind zu bejahen. Bei der Eignung kommt es nicht darauf an, dass das gewählte Mittel das zur Zweckerreichung bestmögliche ist. Vielmehr genügt es, wenn das gewählte Mittel 217 Konrad Hesse, FS-Mahrenholz, S. 541 (557 ff.); Josef Isensee, HdBStR VII, § 162 Rn. 63; Walter Krebs, Kontrolle, S. 94. 218 Vgl. hierzu Marius Raabe, Grundrechte, S. 148 ff.
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
97
zur Zweckerreichung zumindest (mit-)beiträgt219. Da die Organisation des Gesundheitsschutzes in der Form einer gesetzlichen Krankenversicherung zumindest (mit anderen Maßnahmen) irgendwie zur Erreichung des Zieles „Gesundheitsschutz“ beitragen kann, ist die gesetzliche Krankenversicherung ein geeignetes Mittel. Wenn die Verletzung der Schutzpflicht voraussetzt, dass bislang keine geeigneten Maßnahmen ergriffen wurden, so verlangt diese Forderung eine Vergewisserung über die bisherigen gesetzgeberischen Maßnahmen im Hinblick auf den Gesundheitsschutz. Dem Gesundheitsschutz dienen – in unterschiedlichem Maße, teils nur mittelbar, teils unmittelbar – unter anderem folgende Gesetze bzw. gesetzliche Bestimmungen: das Arzneimittelgesetz (AMG), das Apothekengesetz (ApoG), das Betäubungsmittelgesetz (BtMG), die unterschiedlichen Heilkundegesetze der Länder, das Heilwesen-Werbegesetz (HeilwWerbG), Regelungen der Privatversicherung, das Transplantationsgesetz (TPG), das Bundesinfektionsschutzgesetz (IfSG), §§ 611 ff., 631 ff., 677 ff., 823 ff. BGB, §§ 211 ff., 218 ff., 223 ff. StGB, § 30 GewO, das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG), das Fleischhygienegesetz (FlHG), das Atomgesetz (AtomG) sowie das Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG). Darüber hinaus dienen auch die Maßnahmen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung dem Gesundheitsschutz, z. B. auf dem Gebiet der Drogen- und HIV-Prävention. Und auch andere Gesetze, wie zum Beispiel solche zur Reinhaltung des Wassers, des Bodens oder der Luft (BImSchG, TA Lärm, TA Luft, BBodSchG, etc.) oder des Arbeitsschutzes (ASiG), das Sprengstoffgesetz (SprengG) haben eine zumindest zum Teil gesundheitsschützende Komponente. Darüber hinaus besteht eine Vielzahl von Verordnungen, die die Schutzanforderungen zum Teil präzisieren und konkretisieren. Eine gesetzgeberische Untätigkeit oder eine evidente Mangelhaftigkeit der gesetzgeberischen Maßnahmen läge deshalb auch dann nicht vor, wenn es keine gesetzliche Krankenversicherung gäbe. Ist die Einführung (Beibehaltung) der gesetzlichen Krankenversicherung erforderlich, um ein ausreichendes Schutzniveau, einen effektiven Gesundheitsschutz zu erreichen? Die gesetzliche Krankenversicherung müsste dann ein geeignetes Mittel zum Gesundheitsschutz sein, das einen besseren Schutz als die bisherigen Mittel gewährleistet, ohne stärker als diese in Rechte Dritter einzugreifen oder öffentliche Interessen zu beeinträchtigen. Angesichts der finanziellen Schieflage der gesetzlichen Krankenversicherung und der ständigen Leistungskürzungen der letzten Jahrzehnte ist sehr fraglich, ob die gesetzliche Krankenversicherung in ihrer jetzigen Form allzu leistungsfähig ist: Ärzte streiken, Vertragsarztsitze bleiben (sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland) vakant, junge Mediziner wandern ins Ausland ab, die Zahlen der Studienanfänger im Fach Humanmedizin sinken, Privatpatienten müssen durch die von ihnen beglichenen Rechnungen die vertragsärztliche Versorgung subventionieren, unter den Krankenkassen findet ein milliardenschwerer 219
Detlef Merten, GS-Burmeister, S. 227 (240).
7 Schaks
98
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
Umverteilungsprozess durch den Risikostrukturausgleich statt220, teilweise sind Krankenkassen hochverschuldet. Deshalb ist bereits zweifelhaft, ob die derzeitige gesetzliche Krankenversicherung genauso geeignet ist wie andere Modelle des Gesundheitsschutzes (Kopfpauschale, Pflicht zur Privatversicherung, Reduzierung des Versichertenkreises), wie auch die Einigkeit über Parteigrenzen hinweg zeigt, dass die gesetzliche Krankenversicherung reformiert werden muss. Darüber hinaus greift eine Pflichtversicherung stark in die Grundrechte von Versicherten, am System beteiligten Leistungserbringern sowie außerhalb des System stehenden Personen (Unternehmen der Privatversicherung) ein: Bestünde zum Beispiel nur eine Pflicht zur Versicherung an Stelle der gesetzlichen Pflichtversicherung, hätten die Versicherten mehr Freiheit zur Gestaltung ihrer Gesundheitsvorsorge, andererseits hätten die privaten Versicherungsunternehmen einen größeren potentiellen Kundenstamm. Die Leistungserbringer könnten wiederum – durch mehr Marktlichkeit – auf eine angemessene Honorierung ihrer Leistungen hoffen. Auch die öffentliche Hand, die zu milliardenschweren finanziellen Zuwendungen genötigt ist, könnte sich bei ihren Zuschüssen auf die finanziell wirklich Schutz- und Hilfsbedürftigen konzentrieren. Deshalb ist eine gesetzliche Krankenversicherung nicht von Verfassungs wegen geboten, um einen effektiven oder ausreichenden Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Denn sie ist weder geeigneter noch weniger belastend. Aus dem Vorstehenden ergibt sich bereits, dass der Verzicht auf eine gesetzliche Krankenversicherung nicht unzumutbar ist. Denn wenn eine gesetzliche Krankenversicherung weder effektiver ist noch weniger belastet, gibt es keine Aspekte, die im Rahmen der Zumutbarkeit für die gesetzliche Krankenversicherung sprechen könnten. Selbst wenn man aber eine Pflicht zum Tätigwerden annähme, so würde dennoch keine Pflicht zur Schaffung der gesetzlichen Krankenversicherung, wie sie derzeit besteht, vorliegen. Denn der Gesetzgeber hätte bei der Frage, wie er tätig wird, einen Gestaltungsspielraum, der nicht nur durch eine bestimmte Handlungsmöglichkeit ausgeschöpft werden könnte. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie sich ein Gesundheitsschutz für die Bevölkerung ausgestalten ließe. Er könnte ganz neue Wege gehen, wie zum Beispiel durch die Einführung eines Kopfpauschalenmodells bzw. einer Privatversicherungspflicht mit staatlichen Zuschüssen oder die bestehenden Regelungen ausbauen. Wenn schon eine einzelne gesetzgeberische Maßnahme in der Regel nicht gefordert werden kann221 und der Einzelne keinen Anspruch aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG auf Bereithaltung bestimmter Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung hat222, dann kann erst recht kein ganzes Bündel solcher Maßnahmen in Form eines umfassenden Gesetzes beansprucht 220 Siehe hierzu Ferdinand Kirchhof, Risikostrukturausgleich, S. 19 ff.; Helge Sodan / Olaf Gast, Risikostrukturausgleich; Wolfgang Spoerr / Julia Winkelmann, NZS 2004, S. 402 ff. 221 BVerfGE 77, 170 (215); 79, 174 (202). 222 BVerfG, NJW 2006, S. 891 (893) m. w. N.; Josef Isensee, ZVersWiss 2004, S. 651 (664).
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
99
werden. Selbst in den Extremfällen von lebensbedrohenden oder gar tödlichen Krankheiten hat das Bundesverfassungsgericht dem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nur entnommen, dass die Gerichte zu einer „grundrechtsorientierten Auslegung der maßgeblichen Vorschriften des Krankenversicherungsrechts“ verpflichtet seien223, obwohl gerade in diesen schweren Krankheitsfällen die Bereitstellung bestimmter Leistungen am ehesten zu befürworten wäre. Im Ergebnis folgt aus der Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG nicht die Pflicht des Staates, eine gesetzliche Krankenversicherung einzuführen224. Wie auch das Sozialstaatsprinzip, so fordert auch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG unter dem Aspekt der Schutzpflicht, dass der Gesetzgeber den Gefahren durch Krankheit begegnet. Er ist jedoch frei, wie er dieses Ziel verfolgt. Eine Verletzung der Schutzpflicht liegt nicht vor, da der Gesetzgeber nicht untätig geblieben ist hinsichtlich des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung. Diese Maßnahmen genügen den Anforderungen des Untermaßverbotes. 3. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG unter dem Aspekt des Leistungsrechts Anders als bei der Schutzpflicht besteht beim Leistungsrecht225 Einigkeit, dass es der subjektiv-rechtlichen Seite der Grundrechte entspringt. Sein Inhalt wird also unstreitig der Grundrechtsverbürgung selbst entnommen. Gegen eine Verfassungsgarantie der gesetzlichen Krankenversicherung ließe sich zunächst argumentieren, dass aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG kein Anspruch auf Gesundheit folgt226. Jedoch muss die Forderung nach dem Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung nicht im Sinne eines Anspruchs auf Gesundheit verstanden werden. Vielmehr kann diese Haltung als Forderung eines Schutzes vor den Gefahren durch Krankheit interpretiert werden. Beansprucht würde dann ein System, das vor den Risiken von Krankheiten schützt. Diese Forderung stimmt dann inhaltlich mit der an das Sozialstaatsprinzip und an Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG (Aspekt der Schutzpflicht) gestellten Forderung überein. Aber auch aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG unter dem Aspekt des Leistungsrechts kann nicht der Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung erwachsen. Das Bundesverfassungsgericht227 und die Literatur228 sind betont zurückhaltend bei der Zuerken223 BVerfG, NJW 2006, S. 891 (893, 894) – Hervorhebung nicht im Original. Siehe hierzu Klaus Goecke, NZS 2006, S. 291 (293 ff.); Robert Francke / Dieter Hart, MedR 2006, S. 131 ff. 224 BVerfGE 1, 97 (104 f.); Udo Di Fabio, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 2 Abs. 2 Rn. 46 (Stand der Bearbeitung: Februar 2004); Josef Isensee, ZVersWiss 2004, S. 651 (664). 225 Siehe zu Leistungs- und Teilhaberechten Wolfram Cremer, Freiheitsgrundrechte, S. 363 ff. 226 BVerfGE 1, 97 (104 f.); Udo Di Fabio, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 2 Abs. 2 Rn. 45 f., 94 (Stand der Bearbeitung: Februar 2004). 227 BVerfGE 33, 303 (332 ff.); 36, 321 (332 f.);
7*
100
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
nung originärer Leistungsrechte. Dieselben Gründe, die für einen weiten Spielraum bei der Erfüllung von Schutzpflichten sprechen, spielen auch hier eine Rolle. Es geht um die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers in sachlicher und finanzieller Hinsicht sowie um die Einhaltung der Funktionenordnung. Schließlich ist für den Gesundheitsschutz in erster Linie der einzelne Mensch zuständig, auch hier muss der Vorrang der Eigenverantwortung berücksichtigt werden229. Es sind keine Gründe ersichtlich, die nicht schon bei Art. 20 Abs. 1 GG oder bei Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG unter dem Aspekt der Schutzpflicht angesprochen wären, die bei Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG unter dem Aspekt des Leistungsrechts zu einer abweichenden Beurteilung führen könnten. Es lässt sich also festhalten, dass der Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung und damit auch der des Grundsatzes der finanziellen Stabilität nicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG unter dem Aspekt des Leistungsrechts gefolgert werden kann. 4. Fehlender Gesundheitsbezug des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Aus einem weiteren Grund kann der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung nicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG hergeleitet werden: Der Grundsatz der finanziellen Stabilität selbst hat keine gesundheitsschützende, sondern eine finanzielle Bedeutung. Dass dadurch mittelbar die Volksgesundheit und damit Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG geschützt wird, kann deshalb nicht angenommen werden. Denn dieser Grundsatz wurde auch zu Leistungskürzungen, also zur Verschlechterung der Versorgung herangezogen230. 5. Ergebnis zu II. Die Auffassung, dass Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG Sitz des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung sei, trifft nicht zu. Erstens gebietet weder die staatliche Schutzpflicht noch ein originäres Leistungsrecht die Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung. Somit kann auch der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung nicht aus dieser Grundrechtsbestimmung hergeleitet werden, unabhängig davon, ob man auf die objektive Schutzpflicht oder das subjektive Leistungsrecht rekurriert. Zweitens hat dieser Grundsatz keinen gesundheitsschützenden Inhalt. 228 Martin Füllsack, Reformmodelle, S. 62 f.; Hans D. Jarass, in: Jarass / Pieroth, GG, Art. 2 Rn. 94; Philip Kunig, in: von Münch / Kunig, GG, Bd. 1, Art. 2 Rn. 60; Christian Starck, in: von Mangoldt / Klein / Starck, GG, Bd. 1, Art. 2 Rn. 211; Fritz Ossenbühl, NJW 1976, S. 2100 (2104 f.). 229 Udo Di Fabio, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 2 Abs. 2 Rn. 46, 52 (Stand der Bearbeitung: Februar 2004); Eberhard Schmidt-Aßmann, Grundrechtspositionen, S. 13. 230 Siehe oben Erstes Kapitel A.
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
101
III. Die Menschenwürde, Art. 1 Abs. 1 GG An der Spitze der Verfassung steht die Menschenwürdegarantie, die auch als Höchstwert bezeichnet wird231. Art. 1 Abs. 1 GG prägt die gesamte Ordnung des Grundgesetzes und gibt Impulse auch für nachfolgende Grundrechte232. Zwar ist das Aufstellen von Rangverhältnissen auf Verfassungsebene problematisch, doch kann der besondere Rang des Art. 1 Abs. 1 GG durch Art. 79 Abs. 3 GG gerechtfertigt werden. Der Streit, ob die Menschenwürdegarantie selber ein Grundrecht darstellt oder nicht233, kann dahinstehen. Es steht hier nur der Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung in Rede. Der Inhalt der Menschenwürde ist schwer zu fassen234. Deshalb sind Versuche, die Menschenwürde positiv zu beschreiben, bislang nicht über eine Aufzählung einzelner Dimensionen hinausgegangen. Bei diesen besteht nur bezüglich der Selbstbestimmung, der körperlichen und seelischen Integrität, des sozialen Geltungsanspruchs und des Schutzes vor Willkür Einigkeit235. Teilweise wird gefordert, dass auch der Schutz der körperlichen Integrität durch Art. 1 Abs. 1 GG erfolge236. Somit bestünde ein Zusammenhang zur menschlichen Gesundheit und damit der gesetzlichen Krankenversicherung. Jedoch nehmen andere Stimmen einen solchen Schutz nur dann an, wenn finale Eingriffe in die körperliche Integrität in Rede stehen237. Daran würde es im Falle von Krankheiten fehlen, da sie niemandem als finale Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit zugerechnet werden können. Da die gesetzliche Krankenversicherung in ihrer jetzigen Ausprägung nicht nur vor Verletzungen der körperlichen Integrität schützt, könnte Art. 1 Abs. 1 GG nur einem Teil des Grundsatzes der finanziellen Stabilität Verfassungsrang geben. Schließlich wird auch darauf aufmerksam gemacht, dass Krankheiten ein allgemeines Lebensrisiko darstellen. Wenn es sich verwirklicht, liegt keine Würdeverletzung vor238. Anderenfalls würde die Menschenwürde zu kleiner Münze verkommen. Zu dem gleichen Ergebnis kommt man, wenn man die 231 BVerfGE 45, 187 (227); 96, 375 (399); Matthias Herdegen, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 1 Abs. 1 Rn. 4 f. (Stand der Bearbeitung: Februar 2005); Philip Kunig, in: von Münch / Kunig, GG, Bd. 1, Art. 1 Rn. 1, 4; Martin Nettesheim, AöR 130 (2005), S. 71 (78). 232 Peter Häberle, HdBStR II, § 22 Rn. 11. 233 Zum Streitstand Wolfram Cremer, Freiheitsgrundrechte, S. 243 ff.; Matthias Herdegen, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 1 Abs. 1 Rn. 26 (Stand der Bearbeitung: Februar 2005). 234 Vgl. die Nachweise in Zweites Kapitel, Fn. 183. 235 Matthias Herdegen, in: Maunz / Dürig, GG, Art 1 Abs. 1 Rn. 31 (Stand der Bearbeitung: Februar 2005); Adalbert Podlech, in: Denninger / Hoffmann-Riem / Schneider / Stein, GG, Bd. 1, Art. 1 Abs. 1 Rn. 23, 29, 34, 40 (Stand der Bearbeitung: 2001). Ablehnend Georg Hermes, Schutz, S. 140 f., 222. 236 Christian Starck, in: von Mangoldt / Klein / Starck, GG, Bd. 1, Art. 1 Rn. 92. 237 Matthias Herdegen, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 1 Abs. 1 Rn. 90 (Stand der Bearbeitung: März 2006). 238 Christoph Enders, VVDStRL 64 (2005), S. 1 (39).
102
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
Menschenwürde von der Verletzung her bestimmt und im Anschluss an Dürig fragt, ob „der konkrete Mensch zum Objekt, zu einem bloßen Mittel, zur vertretbaren Größe herabgewürdigt wird“239. Wenn die menschliche Gesundheit anders als durch die Einführung einer gesetzlichen Krankenversicherung in ihrer derzeitigen Form geschützt würde, zum Beispiel durch ein System der Kopfpauschalen oder eine Privatversicherungspflicht, läge hierin keine Menschenwürdeverletzung. Niemand würde zum bloßen Objekt herabgewürdigt, wenn er nicht pflichtversichert wäre, sondern zum Beispiel Art und Umfang seines Krankenversicherungsschutzes selber bestimmen könnte. Teilweise wird aus Art. 1 Abs. 1 GG – unter dem Aspekt der Gewährleistung des Existenzminimums240 – hergeleitet, dass dem Einzelnen das medizinische Existenzminimum gewährt werden müsse, worauf der Einzelne auch einen Anspruch habe241. Aber ungeachtet dessen, wie das medizinische Existenzminimum im Einzelfall zu bestimmen ist242, wird aus dieser Verpflichtung nicht folgen können, dass der Einzelne die Einführung / Beibehaltung der gesetzlichen Krankenversicherung erzwingen könne. Diese Ausführungen zur Erfüllung der gesetzgeberischen Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 GG243 gelten ihrem Sinn nach auch hier. Die gesetzliche Krankenversicherung wird also nicht von der Menschenwürdegarantie erzwungen. Deshalb verleiht Art. 1 Abs. 1 GG erst recht dem Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung keinen Verfassungsrang. Denn dieser Belang weist nicht einmal einen gesundheitsschützenden Inhalt auf.
IV. Kompetenzbestimmungen des Grundgesetzes Auch aus den Kompetenzbestimmungen des Grundgesetzes werden in unterschiedlichem Maße materielle Gehalte entnommen. Teilweise werden auf diese Weise verfassungsrechtliche Garantien bestimmter Einrichtungen hergeleitet und begründet. Im Folgenden soll untersucht werden, ob dieser Gedankengang zur Begründung des Verfassungsrangs des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung fruchtbar gemacht werden kann. Hierzu bedarf es zunächst der Beantwortung der Frage, inwieweit Kompetenzvorschriften ein materiell-rechtlicher Gehalt zukommt (1.). Danach werden die im Zusammenhang mit dem Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung genannten Bestimmungen des Grundgesetzes im Einzelnen untersucht (2. – 4.).
239 Günter Dürig, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 1 Abs. 1 Rn. 28 (Stand der Bearbeitung: 1959). 240 Siehe hierzu BVerfGE 45, 187 (227 ff.); 82, 60 (85); 99, 246 (259). 241 Volker Neumann, NZS 2006, S. 393 ff. 242 Hierzu Klaus Stern, Staatsrecht IV / 1, S. 51 ff. 243 Zum Verhältnis von Art. 1 Abs. 1 zu Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG Klaus Stern, Staatsrecht IV / 1, S. 77 ff.
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
103
1. Der materiell-rechtliche Gehalt von Kompetenzbestimmungen Unter dem materiell-rechtlichen Gehalt von Kompetenzbestimmungen versteht man Rechtsfolgen, die über die Zuweisung einer Kompetenz oder Zuständigkeit an einen Träger öffentlicher Gewalt hinausgehen244. Inwieweit Kompetenznormen auch ein materiell-rechtlicher Gehalt zukommt, ist eine intensiv diskutierte Streitfrage. Die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts hierzu ist – scheinbar – schwankend245. Eine erste Strömung im Meinungsspektrum besteht aus Vertretern einer „reinen Kompetenzlehre“. Ihre Anhänger lehnen es ab, den Kompetenzbestimmungen über die Zuweisung von Zuständigkeiten hinaus weitere materiale Rechtsfolgen zuzubilligen246. Da die Vertreter dieser Ansicht den Kompetenzbestimmungen keinen materiellen Gehalt zusprechen, werden ihnen in der Regel keine Güter von Verfassungsrang entnommen, die im Kollisionsfall zu Einschränkungen von Grundrechten herangezogen werden können. Die Gegenposition247 gesteht den Kompetenznormen in weitem Umfang materiale Rechtsfolgen zu. Diese Auffassung entnimmt dementsprechend auch zahlreiche Güter von Verfassungsrang den Kompetenzbestimmungen, die grundrechtsbeschränkend wirken können. Als Hauptargument wird die Einheit der Verfassung bemüht, nach der Grundrechtsverbürgungen und Zuständigkeitszuweisungen nicht in einem strikten Gegensatz gesehen werden dürfen. Zwischen diesen beiden Polen steht eine gemäßigte Auffassung, die den Kompetenzbestimmungen nur dann materiale Rechtsfolgen entnommen wissen will, wenn von der Kompetenzzuweisung nur durch Grundrechtseinschränkungen in sinnvoller Weise Gebrauch gemacht werden kann; wenn anderenfalls die Kompetenz nicht ausgeübt werden könnte248. Keine der beiden Extrempositionen vermag zu überzeugen. Würde man aus jeder Kompetenzbestimmung einen Gemeinwohlbelang von Verfassungsrang ableiten, so wären auch die Hochseefischerei (Art. 74 Abs. 1 Nr. 17 GG), der Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge (Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG), die Seezeichen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 21 GG) und die Abfallwirtschaft (Art. 74 Abs. 1 Bodo Pieroth, AöR 114 (1989), S. 422 (423). Vgl. die Darstellungen bei Hermann Butzer, Fremdlasten, S. 126 ff.; Bodo Pieroth, AöR 114 (1989), S. 422 (424 ff.). 246 So BVerfGE 69 (abw. Meinung), 57 (59); Ernst-Wolfgang Böckenförde, Grundrechtsdogmatik, S. 20; Horst Dreier, DVBl. 1980, S. 471 (473); Martin Kriele, JA 1984, S. 629 (631 f.); Sebastian Lenz / Philipp Leydecker, DÖV 2005, S. 841 (846); Bodo Pieroth / Bernhard Schlink, Grundrechte, Rn. 334; Klaus Stern / Michael Sachs, Staatsrecht III / 2, S. 582 ff.; Bernhard Schlink, EuGRZ 1984, S. 457 (464 f.). Zur Vorsicht mahnen auch Matthias Herdegen, JZ 2004, S. 873 (876); Helge Sodan / Jan Ziekow, Öffentliches Recht, § 24 Rn. 21. 247 BVerfGE 28, 243 (261); 32, 40 (46); 69, 1 (21 f.); Albert Bleckmann, DÖV 1983, S. 129 (130 f.); Rupert Stettner, Kompetenzlehre, S. 6 ff., 10 ff., 18 ff., 24 ff., passim. 248 So z. B. Jörg Lücke, Berufsfreiheit, S. 52 f.; Hans D. Jarass, in: Jarass / Pieroth, GG, Vorb. vor Art. 1 Rn. 46; Bodo Pieroth, AöR 114 (1989), S. 422 (440 ff.); Stefan Muckel, Religiöse Freiheit, S. 265 f. 244 245
104
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
Nr. 24 GG) Güter von Verfassungsrang. Hätte der Tierschutz bereits auf Grund von Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG Verfassungsrang besessen, so wäre auch der Streit um die Einführung des Tierschutzes in Art. 20a GG überflüssig gewesen249. Durch diese inflationäre Vermehrung von Gemeinwohlbelangen250 würden die „wirklichen“ Verfassungsgüter in nicht unerheblicher Weise relativiert. Da sich der Bund wegen des Regel-Ausnahme-Verhältnisses in der Kompetenzzuweisung zwischen Bund und Ländern (Art. 70 GG) stets auf einen Gesetzgebungstitel stützen muss, liefe die Annahme des Verfassungsrangs von Kompetenzbestimmungen – zumindest auf Bundesebene – zu einem allgemeinen Gesetzesvorbehalt der Grundrechte hinaus, der gerade nicht besteht251. Andererseits kann es jedoch auch nicht als bedeutungslos angesehen werden, wenn der Verfassungsgeber eine Aufgabenzuweisung ausdrücklich regelt. Dann scheinen die in der Kompetenzbestimmung genannten Rechtsgebiete oder Sachmaterien eine gewisse Anerkennung erfahren zu haben. Oder wie die Richter Mahrenholz und Böckenförde in ihrem Sondervotum zur Entscheidung über das Kriegsdienstverweigerungs-Neuordnungsgesetz ausführten: „Sie [scil. die Kompetenzvorschriften] besagen damit auch, daß das Handeln in diesen Bereichen von der innerbundlichen Verfassungsordnung her nicht überhaupt ausgeschlossen ist.“252 Viel spricht also dafür, die Lösung nicht abstrakt und generell für alle Kompetenzbestimmungen gleichermaßen zu suchen. Nicht ein abstrakter Streit über das Wesen der Kompetenzbestimmung kann bestimmen, ob im Einzelfall ein Gut Verfassungsrang hat. Vielmehr kann nur durch Auslegung der jeweiligen Kompetenzbestimmung selbst ermittelt werden, inwieweit der in Rede stehenden Grundgesetzbestimmung ein über die formellen Rechtsfolgen hinausgehender Gehalt entnommen werden kann. Deshalb werden im Folgenden die Grundgesetzbestimmungen, die die gesetzliche Krankenversicherung zum Gegenstand haben, daraufhin untersucht, ob und wenn ja, inwieweit ihnen materiale Rechtsfolgen zukommen, die auf den Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung und gegebenenfalls des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung hinweisen. 2. Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG Teilweise wird vertreten, dass eine gesetzliche Krankenversicherung mit Versicherungszwang und der Pflicht zur Leistung von Sozialabgaben stets in Grundrechte eingreife, weshalb Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG materiale Rechtsfolgen habe. 249 Siehe hierzu Rupert Scholz, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 20a Rn. 59 ff., insbes. Rn. 60 (Stand der Bearbeitung: Juni 2002). 250 Vgl. Horst Dreier, in: Dreier, GG, Bd. 1, Vorb. Rn. 140; Martin Kriele, JA 1984, S. 629 (631 f.). 251 Horst Dreier, DVBl. 1980, S. 471 (473); Kay Waechter, Der Staat 30 (1991), S. 19 (25 ff., 30). 252 BVerfGE 69 (abw. Meinung), 57 (60) – Hervorhebung im Original. So auch Josef Isensee, ZVersWiss 2004, S. 651 (667).
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
105
Schließlich habe auch das Bundesverfassungsgericht in Entscheidungen zu anderen staatlichen Monopolen darauf abgestellt, dass die Monopolkompetenzen nur durch Grundrechtseingriffe ausgeübt werden könnten253. Außerdem hätte der Grundgesetzgeber eine bestimmte Ausformung der Sozialversicherung vorgefunden. An diese Tradition hätte er anknüpfen und die Zulässigkeit der Sozialversicherung in ihrer überkommenen Form sichern wollen254. Aus diesen Gründen wird einem Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung das Wort geredet255. Auch das Bundessozialgericht sieht den Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung wohl „in der Kontinuität einer mehr als hundertjährigen Entwicklung und gestärkt durch Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenztitel des GG (Art. 74 Abs 1 Nr 12, Art 87 Abs 2 GG)“ begründet256. Im Hinblick auf den Wortlaut gestehen auch Befürworter einer Verfassungsgarantie der gesetzlichen Krankenversicherung zu, dass das Grundgesetz (also auch Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG) keine ausdrückliche Garantie enthält257. Der Wortlaut des Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG spricht nur von Sozialversicherung. Er enthält nicht das Wort „Garantie“ oder einen ähnlichen Begriff. Zwar fällt die gesetzliche Krankenversicherung unter den Begriff „Sozialversicherung“. Aber wollte man die Garantie eines bestimmten Instituts herauslesen, so wäre das um so eher möglich, je präziser dieses Institut in der Kompetenznorm beschrieben wird. Der Begriff Sozialversicherung ist denkbar weit258 und umfasst sowohl die Künstlersozialabgabe259 als auch die Pflegeversicherung260, die den Vätern und Müttern des Grundgesetzes noch unbekannt waren. Die Tatsache, dass die Norm so weit, offen, flexibel ist und dem Gesetzgeber einen großen Spielraum einräumt, spricht dagegen, ihr in Bezug auf die gesetzliche Krankenversicherung eine feste Garantie des bestehenden Systems zu entnehmen261. Wenn schließlich der Wortlaut des Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG den Begriff „Sozialversicherung“ enthält, so entspricht dies einer praktischen Notwendigkeit. Wer eine Zuständigkeit zuweisen will, muss den Gegenstand, auf den sie sich erstrecken soll, benennen262. Allein aus der (verfassungs-)textlichen Erwähnung kann nicht pauschal die Anerkennung einer historisch gewachsenen Einrichtung im Sinne einer Hermann Butzer, Fremdlasten, S. 126 mit Verweis auf BVerfGE 14, 105 (111). Hermann Butzer, Fremdlasten, S. 135. 255 Hermann Butzer, Fremdlasten, S. 145 spricht von „paraverfassungsrechtlichem Rang“; Rolf-Ulrich Schlenker, Rückschrittsverbot, S. 52 ff. 256 BSG, Urteil vom 09. 12. 2004, Az.: B 6 KA 44 / 03 R, Rn. 148 (zitiert nach: www.bundessozialgericht.de). 257 Rolf-Ulrich Schlenker, Rückschrittsverbot, S. 51. 258 BVerfGE 75, 108 (146); 87, 1 (34); 88, 203 (313). 259 BVerfGE 75, 108 (146). 260 BVerfGE 103, 197 (215 f.). 261 Theodor Maunz, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 74 Rn. 176 (Stand der Bearbeitung: 1984). 262 Rica Werner, Leistungsfähigkeit, S. 113. 253 254
106
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
institutionellen Garantie gefolgert werden263. Auch ein Vergleich mit anderen institutionellen Garantien macht deutlich, dass diese explizit angesprochen werden, so zum Beispiel die Garantie des Berufsbeamtentums264 (Art. 33 Abs. 5 GG), der kommunalen Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG) oder der kirchlichen Eigenständigkeit (Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Abs. 3 WRV)265. Man sollte deshalb nicht vorschnell die dort explizit garantierten Einrichtungen durch eine inflationäre Schöpfung weiterer Verfassungseinrichtungen relativieren. In systematischer Hinsicht gilt es zu bedenken, dass Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG im Abschnitt über die Gesetzgebungskompetenzen steht266. Auch dieser Befund spricht eher gegen als für die Annahme von materialen Rechtsfolgen. Jedoch gilt diese Beobachtung für alle Kompetenzbestimmungen und kann deshalb nicht entscheidend sein. Aber gerade deshalb müssen doch klare Anzeichen vorliegen, weshalb den Kompetenzbestimmungen mehr als die Zuweisung einer Zuständigkeit an den Bund entnommen werden soll. Solche Anzeichen liegen bei Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG nicht vor, im Gegenteil. Dem Grundgesetz liegt bei der Zuweisung der Kompetenzen der Gedanke zu Grunde, dass dem Bund nur die Kompetenzen zustehen, die ihm ausdrücklich zugewiesen sind (vgl. Art. 30 und Art. 70 Abs. 1 GG). Gesetzestechnisch hätte auch genau anders verfahren werden können, indem die Länderkompetenzen abschließend aufgezählt werden. Dann wäre der Begriff „Sozialversicherung“ nicht in Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG aufgetaucht. Statt dessen müsste der Begriff „Polizeirecht“ 267 auftauchen. Man kann also aus der Gesetzgebungstechnik nicht folgern, dass die Sozialversicherung durch eine institutionelle Garantie abgesichert ist, das Bestehen eines funktionsfähigen Polizei- und Ordnungswesens aber nicht268. Schließlich handelt es sich bei Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG um einen Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung. Von dieser Kompetenz muss der Gesetzgeber aber per definitionem keinen Gebrauch machen; er hat zwar grundsätzlich die Rechtsmacht, nicht aber die Pflicht, die Sozialversicherung zu regeln. Konkurrierende Gesetzgebung heißt gerade, dass die Länder so lange zuständig sind (vgl. Art. 72 Abs. 1 GG), wie der Bund nicht handelt, und dass der Bund nicht handeln muss, wenn er keine Notwendigkeit sieht. Darüber hinaus verdeutlicht Art. 72 Abs. 2 GG, dass der Bund nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen von der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz Gebrauch machen darf. Die Annahme einer institutionellen Garantie der Sozialversicherung 263 Hans-Uwe Erichsen, FS-Wolff, S. 219 (239 f.); Kay Waechter, Der Staat 30 (1991), S. 19 (25 ff., 30). 264 Siehe Helmut Lecheler, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 359 (363). 265 Harald Bogs, Sozialversicherung, S. 155 f., 620 ff.; Rica Werner, Leistungsfähigkeit, S. 113. Siehe auch Wolfgang Spoerr / Julia Winkelmann, NZS 2004, S. 402 (403). 266 Siehe zur systematischen Auslegung anhand der Stellung der Norm Christian Saueressig, Jura 2005, S. 525 (527). 267 Polizeirecht ist klassischerweise Landesrecht, vgl. BVerfGE 8, 143 (150); 40, 261 (266); Philipp Kunig, in: von Münch / Kunig, GG, Bd. 3, Art. 70 Rn. 8. 268 Philipp Kunig, in: von Münch / Kunig, GG, Bd. 3, Art. 70 Rn. 4.
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
107
würde entgegen dem Geist der Kompetenzaufteilung zu einer Gesetzgebungspflicht führen269. Wenn sich die Befürworter einer institutionellen Garantie auf geschichtliche Erwägungen stützen, schwächen zwei wesentliche Punkte ihre Argumentation. Zum einen war gerade zu Beginn der Geltung des Grundgesetzes überwiegende Auffassung, dass den Kompetenzbestimmungen keine materialen Rechtsfolgen zukommen270. Erst Mitte der 1960er Jahre setzte sich die entgegengesetzte Ansicht durch271. Es ist deshalb sehr unwahrscheinlich, dass man die institutionelle Garantie der Sozialversicherung auf eine so unorthodoxe Weise verankern wollte. Der zweite Einwand bezieht sich auf Art. 123 Abs. 1 GG. Nach dieser Vorschrift gilt Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages fort, soweit es dem Grundgesetz nicht widerspricht. Erfasst werden alle Normen, die vor dem Zusammentritt des Bundestages galten272. Wenn diese Rechtsnormen materiell mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind, werden sie automatisch außer Kraft gesetzt273. Deshalb ist die Aussage, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes die bestehende Sozialversicherung absichern wollten, nur teilweise richtig. Nur soweit, wie Regelungen der Sozialversicherung materiell mit dem Grundgesetz vereinbar waren, konnte an diese angeknüpft werden. Der primäre Zweck der Kompetenzverteilung liegt in der Verteilung staatlicher Macht zwischen Bund und Ländern. Für einen darüber hinausgehenden Zweck liegen keine Anhaltspunkte vor. Wenn schließlich angenommen wird, Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG sei die kompetenzrechtliche Entsprechung des Sozialstaatsprinzips in Art. 20 Abs. 1 GG und deshalb müsse man Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG die Garantie der gesetzlichen Krankenversicherung entnehmen274, so überzeugt dies nicht. Warum soll die materielle Garantie aus der Kompetenznorm folgen, wenn doch bereits eine Norm mit materiellem Gehalt besteht? Dann spricht viel dafür, dass der materielle Gehalt in der „materiellen“ und nicht in der Kompetenzbestimmung steckt. Zum anderen wäre die Verankerung in der „formellen“ Norm schlicht überflüssig, wenn die Garantie der gesetzlichen Krankenversicherung schon in der „materiellen“ Norm enthalten wäre. So hat es denn auch nicht nur das Bundesverfassungsgericht275 ausdrücklich abgelehnt, Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG eine Garantie der gesetzlichen KrankenversicheSiehe auch Josef Isensee, ZVersWiss 2004, S. 651 (667). Andreas Hamann, Rechtsstaat, S. 25; Herbert Krüger, NJW 1955, S. 201 (203 mit Fn. 32); Harold Rasch, WuW 1955, S. 667 (677 f.). 271 Z. B. Horst Ehmke, VVDStRL 20 (1963), S. 53 (89 ff.); Peter Lerche, AöR 90 (1965), S. 341 (347, 351); Fritz Ossenbühl, DÖV 1965, S. 649 (657). 272 Theodor Maunz, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 123 Rn. 3 (Stand der Bearbeitung: 1964). 273 Theodor Maunz, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 123 Rn. 9 (Stand der Bearbeitung: 1964). 274 Hermann Butzer, Fremdlasten, S. 134. 275 BVerfGE 39, 302 (314 f.); 89, 365 (377). 269 270
108
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
rung zu entnehmen. Auch im Schrifttum weigern sich zahlreiche Stimmen276, dem Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG so weitgehende materiale Rechtsfolgen zu entnehmen, wie es die Befürworter der institutionellen Garantie der Sozialversicherung tun. Somit kann der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung ebenfalls nicht dieser Verfassungsbestimmung entnommen werden.
3. Art. 87 Abs. 2 GG Das Bundessozialgericht entnimmt den Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung aus der Zusammenschau von Art. 74 Abs. 1 Nr. 12, Art. 87 Abs. 2 GG sowie einhundert Jahren Geschichte277. Dass Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG die Garantie der gesetzlichen Krankenversicherung nicht entnommen werden kann, wurde soeben dargelegt. Fraglich ist, inwieweit Art. 87 Abs. 2 GG zu einem anderen Ergebnis führen kann. Der Wortlaut des Art. 87 Abs. 2 GG ist anders gefasst als der des Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG und spricht von „sozialen Versicherungsträgern“. Damit sind Träger öffentlicher Verwaltung gemeint, die Aufgaben der Sozialversicherung im Sinne des Art. 74 I Nr. 12 GG wahrnehmen278. Auch bei Art. 87 Abs. 2 GG taucht nur der weite Begriff „soziale Versicherungsträger“ auf, nicht aber der speziellere Begriff der gesetzlichen Krankenversicherung. Und genau wie bei Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG ist nicht von einer Garantie oder einer ähnlichen verfassungsfesten Institution die Rede. In systematischer Hinsicht gilt es ebenfalls zu bedenken, dass Art. 87 Abs. 2 GG in dem Abschnitt über die Verwaltungskompetenzen angesiedelt ist, was gegen einen materialen Gehalt im Sinne einer Verfassungsgarantie der gesetzlichen Krankenversicherung spricht. Weiterhin muss beachtet werden, dass die Verwaltungskompetenzen des Bundes nicht weiter reichen können als seine Gesetzgebungskompetenzen279. Wenn also schon aus der Gesetzgebungskompetenz des Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG nicht der Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung hergeleitet werden kann, dann erst recht nicht aus der entsprechenden Verwaltungskompetenz. Auch das entstehungsgeschichtliche Argument, dass zum Zeitpunkt der Entstehung des Grundgesetzes es nur eine Minderheit als möglich ansah, Kompetenzbestimmungen materiale Rechtsfolgen zu entnehmen, wirkt sich hier aus. Und schließlich 276 Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (213); Rüdiger Breuer, VVDStRL 44 (1986), S. 211 (236); Reinhard Hendler, Selbstverwaltung, S. 227; Eberhard Schmidt-Aßmann, GS-Martens, S. 249 (253); Friedrich E. Schnapp, HdBSozVersR I, § 49 Rn. 38; Rica Werner, Leistungsfähigkeit, S. 112 f. 277 BSG, Urteil vom 09. 12. 2004, Az.: B 6 KA 44 / 03 R, Rn. 148 (zitiert nach: www.bundessozialgericht.de). 278 BVerfGE 63, 1 (34 f.); Peter Axer, Normsetzung, S. 276 f.; Michael Sachs, in: Sachs, GG, Art. 87 Rn. 49; Walter Krebs, Rentenversicherung, S. 10 f. 279 BVerfGE 12, 205 (229); 15, 1 (16); 78, 374 (386); Georg Hermes, in: Dreier, GG, Bd. 3, Art. 83 Rn. 16.
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
109
liegt der primäre Zweck in der Aufteilung der Verwaltungskompetenzen zwischen dem Bund und den Ländern. Lerche kritisiert die „rauhe Rigidität der Verneinung“ mancher Stimmen in der Literatur und der Rechtsprechung und entnimmt der Vorschrift des Art. 87 Abs. 2 GG eine staatsaufgabenrechtliche Komponente280. Aber auch die Befürwortung der staatsaufgabenrechtlichen Komponente geht nicht so weit, dass Lerche eine Bestandsgarantie für die Existenz oder Zuständigkeitsbereiche der Sozialversicherungsträger annimmt. Vielmehr verweist er auf die Weite des Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG, auf den 87 Abs. 2 GG Bezug nimmt. Und diese Weite verbiete die Annahme einer Garantie der gesetzlichen Krankenversicherung281. Andere Gesichtspunkte, die eine andere Entscheidung rechtfertigen könnten, liegen nicht vor. Somit folgt auch aus Art. 87 Abs. 2 GG keine Garantie der gesetzlichen Krankenversicherung282 und damit auch nicht eine Garantie des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung. 4. Art. 120 Abs. 1 Satz 4 GG Art. 120 Abs. 1 Satz 4 GG beschäftigt sich mit den Lasten der Sozialversicherung. Teilweise wird dieser Vorschrift eine Verantwortung des Staates für die finanzielle Ausstattung der gesetzlichen Krankenversicherung entnommen. Demgemäß sei mit Art. 120 Abs. 1 Satz 4 GG eine allgemeine Sicherungs- und Garantiefunktion des Staates für die Sozialversicherung verfassungsrechtlich verankert283. Auch Art. 120 Abs. 1 Satz 4 GG verwendet einen weiten Oberbegriff, wenn es von sozialen Versicherungsträgern und nicht den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung spricht. Und abermals ist mit keinem Wort von einer Bestandsgarantie die Rede. Art. 120 Abs. 1 GG regelt nach herrschendem Verständnis allein das Verhältnis des Bundes zu den Ländern im engeren Sinne284. Es handelt sich bei Art. 120 280 Peter Lerche, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 120 Rn. 152 (Stand der Bearbeitung: Dezember 1992). 281 Peter Lerche, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 120 Rn. 153 f. (Stand der Bearbeitung: Dezember 1992). 282 BVerfGE 21, 362 (371); 39, 302 (314 f.); 89, 365 (377); Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (213); Harald Bogs, Sozialversicherung, S. 620 ff.; Siegfried Broß, in: von Münch / Kunig, GG, Bd. 3, Art. 87 Rn. 6; Martin Burgi, in: von Mangoldt / Klein / Starck, GG, Bd. 3, Art. 87 Rn. 74; Georg Hermes, in: Dreier, GG, Bd. 3, Art. 87 Rn. 60; HansJürgen Papier, Sozialrechtshandbuch, § 3 Rn. 24; Michael Sachs, in: Sachs, GG, Art. 87 Rn. 98; Eberhard Schmidt-Aßmann, NJW 2004, S. 1689 (1695); Michael Selk, JuS 1990, S. 895; Rolf Stober, JA 1986, S. 534 (535); Rica Werner, Leistungsfähigkeit, S. 112 f. 283 So BSGE 47, 148 (153 f.); Herbert Posser / Rolf-Georg Müller, NZS 2004, S. 178 (180) m. w. N. 284 BVerfGE 113, 167 (207, 208, 210, 211); Gertrude Lübbe-Wolff, in: Dreier, GG, Bd. 3, Art. 120 Rn. 15 f.; Helmut Siekmann, in: Sachs, GG, Art. 120 Rn. 7.
110
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
Abs. 1 Satz 4 GG um eine reine Zuständigkeitsregelung285. In diesem Sinne sind auch Urteile des Bundessozialgerichts zu verstehen286. Wenn es sich um eine reine Kompetenznorm handelt, dann ist ausgeschlossen, dass Art. 120 Abs. 1 Satz 4 GG materiale Rechtsfolgen, etwa im Sinne einer verfassungsrechtlichen Garantie der gesetzlichen Krankenversicherung, zukommen. Dies widerlegt die zuvor geschilderte Ansicht, die aus Art. 120 Abs. 1 Satz 4 GG eine verfassungsrechtliche Verankerung der gesetzlichen Krankenversicherung herauslesen will. Somit kann auch Art. 120 Abs. 1 Satz 4 GG nicht als Sitz einer verfassungsrechtlichen Garantie der gesetzlichen Krankenversicherung angesehen werden287.
5. Ergebnis zu IV. Aus den untersuchten Kompetenznormen kann der Verfassungsrang des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung nicht abgeleitet werden.
V. Art. 109 Abs. 2 GG Freudenberg vertritt die Ansicht, dass der gesetzlichen Krankenversicherung ein Verfassungsrang aufgrund der Bestimmung des Art. 109 Abs. 2 GG zukomme. Diese Vorschrift spreche von den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, wozu nach § 1 Abs. 2 StabG unter anderem ein stabiles Preisniveau gehöre. Zwar seien die Gesamtvertragsparteien, die gemäß § 71 Abs. 2 SGB V die Gesamtverträge schließen, nicht ausdrücklich Adressaten der Bestimmung des Art. 109 Abs. 2 GG. Doch diese Vorschrift verbiete „allgemein eine Politik, die die Preisentwicklung außer acht läßt“288. Hieraus sei zu folgern, dass Art. 109 Abs. 2 GG auch in den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung ausstrahle, was durch § 52 Abs. 4 HGrG bestätigt werde289. Ergänzend wird auf das Sozialprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG verwiesen, dem das Gebot eines funktionsfähigen Systems sozialer Absicherung zu entnehmen sei290. Schließlich lasse sich auch Art. 74 Abs. 1 Nr. 16 GG heranziehen, der Vorkehrungen gegen eine Anbieterdominanz auf dem Markt vorsehe. Aus dieser Gesamtschau folge der Verfassungsrang des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität, der zuvor mit dem Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung gleichgesetzt wurde. BVerfGE 113, 167 (207, 213). BSGE 34, 177 (178 f.); 81, 276 (285 f.). 287 BVerfGE 39, 302 (314 f.); Harald Bogs, Sozialversicherung, S. 620 ff.; Rica Werner, Leistungsfähigkeit, S. 112 f. 288 Ulrich Freudenberg, Beitragssatzstabilität, S. 107. 289 Ulrich Freudenberg, Beitragssatzstabilität, S. 107 f. 290 Ulrich Freudenberg, Beitragssatzstabilität, S. 35 ff. 285 286
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
111
Derlei „Gesamtschauen“ sind mit Vorsicht zu handhaben. Wenn es genügend Bestimmungen für eine Gesamtschau gibt, dann sollte sich aus einer dieser Vorschriften die gewünschte Rechtsfolge ergeben. Wenn sich aber aus keiner einzelnen Bestimmung die erhoffte Rechtsfolge ergibt, dann fragt sich, weshalb sie sich aus der Summe der unergiebigen Normen ergeben sollte. Wenn der (Grund-)Gesetzgeber zu einem Themenkomplex mehrere Normen formuliert hat, dann kann man davon ausgehen, dass er sich mit der Thematik beschäftigt hat. In einem solchen Fall das Schweigen des Normgebers zu ignorieren und durch eine Gesamtschau zu überspielen, muss auf Vorbehalte stoßen291. Der Gesamtschau Freudenbergs ist bereits deshalb nicht zu folgen, da der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung nicht mit dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität gleichzusetzen ist292. Aber auch im Falle der Identität der beiden Grundsätze vermag die Argumentation von Freudenberg nicht zu überzeugen. Angesichts der finanziellen Krise, in der die gesetzliche Krankenversicherung steckt, scheint es zweifelhaft, ob die gesetzliche Krankenversicherung in ihrer jetzigen Form besser geeignet ist, die einzelnen Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu erreichen als andere Formen eines organisierten Krankenschutzes. Darüber hinaus handelt es sich – wie bei dem Sozialprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG – um eine Staatszielbestimmung293. Aus diesem Grunde kann Art. 109 Abs. 2 GG nur das Ziel – gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht – aufzeigen, nicht aber das Mittel, das zur Zielerreichung führen soll. Deshalb gehen die Kommentierungen zu Art. 109 Abs. 2 GG auch nicht auf eine in dieser Vorschrift verankerte Einrichtungsgarantie der gesetzlichen Krankenversicherung ein294. Die hilfsweisen Ausführungen zu Art. 20 Abs. 1 und Art. 74 Abs. 1 Nr. 16 GG lassen sich ebenfalls widerlegen: Art. 20 Abs. 1 GG verlangt irgendein System sozialer Sicherung im Falle von Krankheit, nicht aber das bestehende. Das erforderliche System muss zwar funktionstüchtig sein. Da es aber weder eine Ermittlung der Vergütung der Ärzte durch Gesamtverträge noch das Sachleistungsprinzip vorsehen muss, kann nicht aus dem Umstand, dass die bisherigen Mechanismen die öffentlichen Haushalte gefährden können, der Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung oder des Grundsatzes ihrer finanziellen Stabilität geschlossen werden. Im Gegenteil, ein System von weniger reglementierter Preisbildung und höherer Marktlichkeit würde wohl eher für angemessene Preise sorgen. Die Pflicht, die Kosten zunächst selbst zu tragen und sich dann erstatten zu lassen, Siehe auch Walter Krebs, Jura 1996, S. 181 (183). Siehe oben Erstes Kapitel A., insbes. III. 293 Peter Badura, Wirtschaftsverfassung, Rn. 17, 111, 113; Christoph Gusy, Gesetzgeber, S. 153; Markus Heintzen, in: von Münch / Kunig, GG, Bd. 3, Art. 109 Rn. 14; Werner Heun, in: Dreier, GG, Bd. 3, Art. 109 Rn. 20; Josef Isensee, HdBStR III, § 57 Rn. 122. 294 Z. B. Hans-Bernhard Brockmeyer, in: Schmidt-Bleibtreu / Klein, GG, Art. 109 Rn. 9 ff.; Werner Heun, in: Dreier, GG, Bd. 3, Art. 109 Rn. 20 ff. 291 292
112
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
würde die kostenintensive Mitnahmementalität eher mindern, so dass keine Mehrbelastungen der öffentlichen Haushalte zu befürchten wären. Art. 74 Abs. 1 Nr. 16 GG als Gesetzgebungskompetenz ist thematisch von der gesetzlichen Krankenversicherung weiter entfernt als Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG, der wie gesehen das Rechtsinstitut „gesetzliche Krankenversicherung“ nicht verfassungsrechtlich verankert. Die genannten Erwägungen, die sich auf Wortlaut, Systematik, Entstehungsgeschichte und Gesetzeszweck stützen, beanspruchen auch im Hinblick auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 16 GG (erst recht) Geltung.
VI. Art. 33 Abs. 2, 5 GG Art. 33 Abs. 2, 5 GG könnte möglicherweise der Sitz des Verfassungsrangs der gesetzlichen Krankenversicherung und damit gegebenenfalls des Grundsatzes ihrer finanziellen Stabilität sein, wenn die Leistungserbringer unter den Anwendungsbereich dieser Bestimmungen fallen. Nach ganz herrschender Auffassung in Rechtsprechung und Schrifttum handelt es sich bei der Ausübung der vertrags(zahn)ärztlichen Tätigkeit nicht um einen eigenständigen Beruf im Verhältnis zur privat(zahn)ärztlichen Tätigkeit, sondern um eine Modalität des allgemeinen Berufs des frei praktizierenden (Zahn-)Arztes295. In einem Kammerbeschluss werden Zweifel an der überkommenen Rechtsprechung geäußert296, diese wird jedoch nicht aufgegeben. Vielmehr zeigen nachfolgende Entscheidungen297, in denen die zuvor geäußerten Zweifel gerade nicht aufgegriffen werden, dass an der ursprünglichen Auffassung festgehalten wird298. In den zeitlich späteren Beschlüssen ging das Bundesverfassungsgericht stillschweigend davon aus, dass die vertragsärztliche Tätigkeit kein eigenständiger Beruf im Sinne von Art. 12 Abs. 1 GG sei. Die Grundrechtsprüfung wird in derselben Weise vorgenommen wie vor dem Beschluss vom 31. 03. 1998. Das Bundesverfassungsgericht hat in den Entscheidungen zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung jedoch nie auf Art. 33 GG zurückgegriffen. Seit dem Kassenarzturteil299 entspricht es ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, bei der vertragsärztlichen Tätig295 Vgl. nur BVerfGE 11, 30 (41); 12, 144 (147); 69, 233 (244); BSGE 81, 143 (144 f.); Thomas Clemens, in: Umbach / Clemens, GG, Bd. 1, Anhang zu Art. 12 Rn. 6 ff.; Friedhelm Hufen, MedR 1996, S. 394 (396); Winfried Kluth, MedR 2005, S. 65 (69); Helge Sodan, Freie Berufe, S. 156 f., 164 f., 193 f., 228; Peter Wigge, HdBVertragsarztR, § 2 Rn. 8. A. A. Harald Bogs, FS-Wannagat, S. 51 (69 f.); Erika Herweck-Behnsen, NZS 1995, S. 211 f.; Albert Krölls, GewArch 1993, S. 217 (221). 296 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1998, S. 1776 f. 297 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1999, S. 2730 (2731); BVerfGE 103, 172 (184); BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 2002, S. 400 (401). 298 Thomas Clemens, in: Umbach / Clemens, GG, Bd. 1, Anhang zu Art. 12 Rn. 4. 299 BVerfGE 11, 30 (39 f.).
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
113
keit im Grunde von einer freiberuflichen Tätigkeit300 auszugehen301. Bereits das spricht dagegen, Art. 33 Abs. 2, 5 GG den Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung zu entnehmen. Der Vertragsarzt übt weder ein öffentliches Amt302 noch einen staatlich gebundenen Beruf aus303; er ist auch kein Beliehener304. Weiterhin lässt sich schwerlich begründen, weshalb aus der Einordnung des Vertrags(zahn)arzt-Berufs als staatlich gebundenem Beruf oder öffentlichem Dienst der Verfassungsrang des gesamten Systems der gesetzlichen Krankenversicherung oder des Grundsatzes ihrer finanziellen Stabilität folgen sollte. Die Anerkennung der Prüfingenieure für Baustatik sowie der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure als staatlich gebundene Berufe305 führt auch nicht dazu, dass es einen Grundsatz der Funktionsfähigkeit des „Prüf- oder Vermessungsingenieurswesen“ geben sollte, der Verfassungsrang hätte.
VII. Art. 33 Abs. 2 EV Die Ansicht, der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung folge aus Art. 33 Abs. 2 EV, ließe sich wie folgt begründen. Die Vorschrift verpflichtet „den gesamtdeutschen Gesetzgeber zur Schaffung einer gesetzlichen Regelung über einen Abschlag auf den Herstellerabgabepreis von Arzneimitteln“ im Beitrittsgebiet. Das gesamte Zustimmungsgesetz zum EV wurde mit Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat gemäß Art. 79 Abs. 1, 2 GG verabschiedet306, so dass von einer verfassungsrechtlichen Gesetzgebungspflichtausgegangen werden könnte. Jedoch bestimmt Art. 45 Abs. 2 EV, dass die Bestimmungen des EV nach dem Beitritt des Beitrittsgebiets im Range eines Bundesgesetzes gelten. Damit hätte der Grundsatz keinen Verfassungsrang. „Beitragsbedingte“ Verfassungsänderungen wurden unmittelbar durch Art. 4 EV vorgenommen307. Nur die dort genannten Siehe zum Begriff des Freien Berufes Helge Sodan, Freie Berufe. So zum Beispiel in BVerfGE 11, 30 (39); 12, 144 (147); BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1998, S. 1776 (1777). 302 Vgl. Karl Heinrich Friauf, Morbiditätsrisiko, S. 29 ff.; Helmut Lecheler / Lothar Determann, Sozialversicherungsträger, S. 10 f., 34; Chr. Rosset / J. Gerth, SGb 1994, S. 508 (510); Rolf Stober, MedR 1990, S. 10 (11). Ausführlich zu Art. 33 GG Helmut Lecheler, in: Friauf / Höfling, GG, Bd. 2, Art. 33 Rn. 1 ff. (Stand der Bearbeitung: Oktober 2000). 303 Winfried Boecken, NZS 1999, S. 417 (418 f.); Friedhelm Hufen, MedR 1996, S. 394 (396 f.); Winfried Kluth, MedR 2005, S. 65 (69); Eberhard Schmidt-Aßmann, Grundrechtspositionen, S. 36; Helge Sodan, Freie Berufe, S. 144 f. A.A. Harald Bürck, MedR 1989, S. 63 f.; Gerrit Manssen, ZfSH / SGB 1994, S. 1 (8 f.). 304 Helge Sodan, Freie Berufe, S. 102 ff.; Wolfgang Weiß, NZS 2005, S. 67 (69 f.). 305 Vgl. BVerfGE 73, 301 (316). 306 Siehe Heiko Wagner, Einigungsvertrag, S. 149. 307 Peter Badura, Staatsrecht, A Rn. 44. 300 301
8 Schaks
114
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
Änderungen haben Verfassungsrang, andere Bestimmungen sind Normen des Bundesrechts im Range eines Bundesgesetzes (sofern es sich nicht bloß um eine Rechtsverordnung in Anlage I des EV handelt)308. Art. 33 Abs. 2 EV gehört nicht zu den in Art. 4 EV genannten Änderungen. Deshalb hat der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung keinen Verfassungsrang auf Grund des EV. Dies entspricht der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. In seinen Entscheidungen zum Einigungsvertrag hat es dessen Bestimmungen, die nicht in Art. 4 EV enthalten waren, an den Grundrechten gemessen309. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Grundrechte im Rang über den fraglichen Bestimmungen stehen. Hätten sie Verfassungsrang, könnten sie nur an Art. 79 GG, nicht aber den Grundrechten gemessen werden310. Selbst wenn man diesem Teil des Einigungsvertrages Verfassungsrang zubilligen würde, so ergäbe sich hieraus nicht der Verfassungsrang des gesamten Systems der gesetzlichen Krankenversicherung oder des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung. Denn der Begründung zu Art. 33 Abs. 2 EV311 kann entnommen werden, dass nur die Vermeidung der finanziellen Überforderung der Krankenkassen im Beitrittsgebiet durch Abschläge auf den Herstellerabgabepreis von Arzneimitteln gewollt war. Hierbei handelt es sich jedoch nur um einen Teil des Grundsatzes der finanziellen Stabilität. Denn der Grundsatz wäre in örtlicher Hinsicht beschränkt auf das Beitrittsgebiet, in sachlicher Hinsicht auf die Arzneimittel und in persönlicher Hinsicht auf die Krankenkassen. Und schließlich könnte Art. 33 Abs. 2 EV, der erst im Jahre 1990 in Kraft trat, nicht erklären, weshalb das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahre 1984 den Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität postulierte.
VIII. Ungeschriebenes Verfassungsrecht Es ist anerkannt, dass es Rechtsnormen von Verfassungsrang geben kann, die nicht schriftlich in der Verfassungsurkunde niedergelegt sind312. Solche Sätze von 308 Peter Badura, Staatsrecht, A Rn. 44; ders., HdBStR VIII, § 189 Rn. 22. Vgl. auch Volker Busse, DÖV 1991, S. 345 (349 ff.); Karl Doehring, Einigungsvertrag, S. 27 ff.; Matthias Herdegen, Einigungsvertrag; Eckart Klein, DÖV 1991, S. 569 (570, 571); Klaus-Dieter Schnappauf, DVBl. 1990, S. 1249 (1252); Heiko Wagner, Einigungsvertrag, S. 149 ff.; Hubert Weis, AöR 116 (1991), S. 1 (24 ff.). 309 So zum Beispiel in BVerfGE 84, 90 (128); 84, 133 (146 ff.); 85, 360 (372). 310 So wie es bei den Bestimmungen des Art. 4 EV geschehen ist, z. B. BVerfGE 84, 90 (117 ff., 131); 84, 133 (145). Auch in BVerfGE 82, 316 (320) ging das Gericht davon aus, dass nur in Art. 4 EV Änderungen des Grundgesetzes vorgenommen würden. 311 BT-Drucks. 11 / 7760, S. 372. 312 Christoph Gusy, Gesetzgeber, S. 140 f.; Konrad Hesse, Grundzüge, Rn. 34; Heinrich Amadeus Wolff, Ungeschriebenes Verfassungsrecht, passim.
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
115
Verfassungsrang sind zum Beispiel der Grundsatz des bundesfreundlichen Verhaltens313 oder die ungeschriebenen Gesetzgebungskompetenzen des Bundes314. Deshalb kann aus der Tatsache, dass weder die gesetzliche Krankenversicherung noch der Grundsatz ihrer finanziellen Stabilität aus dem geschriebenen Verfassungsrecht abzuleiten sind, noch nicht geschlossen werden, dass der Grundsatz der finanziellen Stabilität nicht doch Verfassungsrang haben könnte. Ausführungen, dass die gesetzliche Krankenversicherung oder der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung einen ungeschriebenen Verfassungsgrundsatz darstellt, existieren nicht. Wenn der Verfassungsrang postuliert wurde, dann in der Regel in Zusammenhang mit Bestimmungen wie Art. 20 Abs. 1 GG, nie wurde er als ungeschriebener Verfassungsgrundsatz beschrieben. Dennoch soll auch diese Möglichkeit untersucht werden. Eine Form, in der ungeschriebenes Verfassungsrecht auftritt, ist Verfassungsgewohnheitsrecht. Die Existenz von Verfassungsgewohnheitsrecht ist nicht unumstritten315. Doch auch wenn man von der Prämisse ausgeht, dass es grundsätzlich Verfassungsgewohnheitsrecht geben kann, so müssen zwei Voraussetzungen gleichzeitig vorliegen, damit der gesetzlichen Krankenversicherung und gegebenenfalls dem Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung ein solcher Rang zuerkannt werden kann. Erstens muss eine längere tatsächliche Übung vorliegen, die auf den Verfassungsrang schließen lässt, und zweitens muss diese Übung von einer entsprechenden Rechtsüberzeugung der Beteiligten getragen sein316. Davon kann nicht ausgegangen werden. Zum ersten Mal wurde der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung im Jahre 1984 verwendet. Bis zu diesem Zeitpunkt müssten sich die längere tatsächliche Übung und die Rechtsüberzeugung nachweisen lassen. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Soweit ersichtlich, wurde der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung vor dem Jahre 1984 nicht aufgestellt. Tomuschat nennt in seiner Bestandsaufnahme des Verfassungsgewohnheitsrechts den Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung nicht317. Auch wenn man auf die Gegenwart abstellt und fragt, ob der Grundsatz seit seiner Formulierung im Jahre 1984 Verfassungsrang erworben hat, kommt man zu keinem anderen Ergebnis. Denn erstens ist dieses Vorgehen schon im Ansatz fragwürdig, da das Bundesverfassungsgericht ersichtlich schon 1984 vom Verfassungsrang ausging. Zum anderen sind die 20 Jahre, die seit der Entscheidung 313 Siehe dazu BVerfGE 6, 309 (361 f.); 8, 122 (140); 12, 205 (255); 92, 203 (230 f.); 106, 225 (243). 314 Vgl. zu diesen BVerfGE 3, 407 (421); 22, 180 (213); 26, 281 (300); 77, 288 (299). 315 Kritisch z. B. Walter Krebs, Vorbehalt des Gesetzes, S. 13; Christian Tomuschat, Verfassungsgewohnheitsrecht, S. 83 ff. 316 BVerfGE 22, 114 (121); Walter Krebs, Vorbehalt des Gesetzes, S. 13; Christian Tomuschat, Verfassungsgewohnheitsrecht, S. 14, 25 f., 44, 48; Heinrich Amadeus Wolff, Ungeschriebenes Verfassungsrecht, S. 428, 438 ff., 446 ff. 317 Christian Tomuschat, Verfassungsgewohnheitsrecht, S. 29 ff.
8*
116
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
im 68. Band der amtlichen Sammlung vergangen sind, eine vergleichsweise kurze Zeitspanne. Andere ungeschriebene Verfassungsgrundsätze reichen zurück bis in die Weimarer Republik oder sogar die konstitutionelle Monarchie des Kaiserreiches. Es besteht also keine längere Übung. Zum anderen liegt keine Rechtsüberzeugung der Beteiligten vor. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Grundsatz nie erläutert, hergeleitet oder vertieft behandelt. Bezüglich des Grundsatzes des bundestreuen Verhaltens318 und der ungeschriebenen Gesetzgebungskompetenzen319 ließen sich zumindest in den frühen Entscheidungen ausführlichere Begründungen und Verweise finden. Auch an der Einheitlichkeit der Rechtsüberzeugung würde es mangeln. Denn das Bundesverfassungsgericht geht in anderen Entscheidungen davon aus, dass weder die Existenz der gesetzlichen Krankenversicherung noch ihre wesentlichen Strukturmerkmale von Verfassungs wegen vorgegeben sind320. Die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zum Verfassungsrang sind deshalb widersprüchlich. In manchen Entscheidungen ist das Bundesverfassungsgericht vom Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung ausgegangen, in einigen hat es diesen Verfassungsrang aber auch ausdrücklich abgelehnt. Auch in der Literatur lehnen zahlreiche namhafte Stimmen einen Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung ab321. Somit liegen die Voraussetzungen für das Vorliegen von Verfassungsgewohnheitsrecht nicht vor.
IX. Verfassungsrang durch Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts? Lässt sich aus keiner Bestimmung mit Verfassungsrang die gesetzliche Krankenversicherung noch der Grundsatz ihrer finanziellen Stabilität herleiten, so bleibt eine letzte Möglichkeit, dennoch den Verfassungsrang anzuerkennen. Dies wäre der Fall, wenn die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts selbst Verfassungsrang hätte. Diese These findet auch heute, unter Geltung des Grundgesetzes, Anhänger322. Anknüpfungspunkt sind Art. 94 Abs. 2 Satz 1 GG, § 31 Abs. 2 BVerfGG. In diesen Bestimmungen ist von der Gesetzeskraft bestimmter Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts die Rede. Argumentiert wird wie folgt: Die Verfassung sei kein Gesetz wie jedes andere, unter das sich subsumieren ließe. Verfassungsrechtsprechung sei Verfassungsinterpretation, durch die die Verfassung Siehe Zweites Kapitel, Fn. 313. Siehe Zweites Kapitel, Fn. 314 320 Siehe dazu ausführlich unten Zweites Kapitel C. XI., insbes. Fn. 326, 327. 321 Peter Badura, DÖV 1989, S. 491 (496); Hans Hofmann, in: Schmidt-Bleibtreu / Klein, GG, Art. 20 Rn. 31; Renate Jaeger, System, S. 15; Thorsten Kingreen, Sozialstaatsprinzip, S. 183; Helge Sodan, VVDStRL 64 (2005), S. 144 (166); ders., GesR 2004, S. 305 (306); 322 Z. B. Ernst-Wolfgang Böckenförde, NJW 1976, S. 2089 (2099); ders., VVDStRL 39 (1981), S. 174 f. (Diskussionsbeitrag); ders., NJW 1999, S. 9 (12 f.); Eberhard Grabitz, VVDStRL 39 (1981), S. 197 f. (Diskussionsbeitrag). 318 319
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
117
konkretisiert würde. Letztlich würde erst das Bundesverfassungsgericht entscheiden, was Inhalt der Verfassung sei323. Überwiegend stößt diese Auffassung jedoch auf Widerspruch und Ablehnung324. Diese Kritik ist berechtigt, denn träfe diese Ansicht zu, würde – um nur einen Grund zu nennen – das Bundesverfassungsgericht Verfassungsrecht setzen. Dies ist weder seine Funktion im Verfassungsgefüge, noch ist es dazu die geeignete Stelle. Vor allem ist das Bundesverfassungsgericht nicht in Art. 79 GG genannt, obwohl dort das Verfahren und die Zuständigkeit zur Änderung von Verfassungsrecht geregelt sind. Die Möglichkeit des Verfassungsrechts qua Richterspruch ist damit abzulehnen. Das Bundesverfassungsgericht kann nicht einem einfach-gesetzlich eingeführten System Verfassungsrang zubilligen, indem es – ohne jede Begründung – in einem Beschluss feststellt, dass der Gesetzgeber sich dem vom Bundesverfassungsgericht selbst formulierten Grundsatz nicht entziehen dürfe. So sieht es auch Mahrenholz, wenn er ausführt: „Aber jedenfalls kann das Verfassungsrecht nicht autoritativ durch Begriffe, die das Bundesverfassungsgericht kreiert, umgebildet werden.“325
X. Kontrollüberlegungen 1. Die sonstige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur gesetzlichen Krankenversicherung Aus keiner der in Betracht kommenden Bestimmungen des Grundgesetzes kann also der Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung und damit auch nicht der des Grundsatzes der finanziellen Stabilität abgeleitet werden. Interessanterweise hat auch das Bundesverfassungsgericht erst kürzlich betont, dass das bestehende System der gesetzlichen Krankenversicherung nicht verfassungsrechtlich geschützt sei: „Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist dem Grundgesetz eine Verfassungsgarantie des bestehenden Systems der Sozialversicherung oder doch seiner tragenden Organisationsprinzipien nicht zu entnehmen.“326 323 Ernst-Wolfgang Böckenförde, NJW 1976, S. 2089 (2099); ders., NJW 1999, S. 9 (12 f.). 324 Ernst Benda / Eckart Klein, Verfassungsprozeßrecht, Rn. 1313 mit Fn. 61; Christoph Gusy, Gesetzgeber, S. 249 f.; Herbert Bethge, in: Maunz / Schmidt-Bleibtreu / Klein / Bethge, BVerfGG, § 31 Rn. 157 ff. (Stand der Bearbeitung: Juni 2001); Hans H. Klein, SymposiumLerche, S. 49 (57); Ulrich Scheuner, DÖV 1980, S. 473 (477); Klaus Schlaich, VVDStRL 39 (1981), S. 99 (130 ff. m. w. N.); Klaus Schlaich / Stefan Korioth, BVerfG, Rn. 484, 500; Ewald Wiederin, FS-Badura, S. 605 (628). 325 Ernst Gottfried Mahrenholz, Symposium-Lerche, S. 23 (38). 326 BVerfG (Kammerbeschluss), NVwZ 2005, S. 572 (574). So auch BVerfGE 39, 302 (314 f.); 77, 340 (344); 89, 365 (376 ff.); 113, 167 (201, 203).
118
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
Dies entspricht der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch im Hinblick auf andere Zweige der Sozialversicherung327 und der herrschenden Ansicht des Schrifttums328. Diese Ausführungen sind zugleich eine Absage an diejenigen, die zumindest einen Kernbestand der Sozialversicherung als verfassungsrechtlich garantiert ansehen329. Denn nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts sind nicht einmal die tragenden, also die grundlegenden Organisationsprinzipien, auf dem das derzeit bestehende Krankenversicherungssystem beruht, verfassungsrechtlich abgesichert. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss zum Risikostrukturausgleich seine Position wie folgt dargelegt: „Für die Existenz eines derartigen Bestandsschutzes geben Wortlaut und Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes jedoch keinen Anhaltspunkt. Der bereits vom vorkonstitutionellen Gesetzgeber aus Gründen der Zweckmäßigkeit getroffenen Entscheidung für ein gegliedertes Krankenversicherungssystem mit seinen Vor- und Nachteilen [ . . . ] wohnt kein tiefergehender Gerechtigkeitsgehalt inne, der es nahe legen könnte, der Verfassungsgeber habe der einfach-rechtlichen Systementscheidung besonderen Schutz zukommen lassen wollen.“330
Bei den Entscheidungen zur einstweiligen Anordnung gegen das Beitragssatzsicherungsgesetz hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach festgestellt, dass jeder der dort genannten Beträge wichtig sei, um die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung zu erhalten – „zumindest vorläufig bis zu einer Strukturreform“331. Eine grundlegende Strukturreform wird also ausdrücklich für zulässig gehalten332. Von der Notwendigkeit und der Zulässigkeit einer umfassenden Neuorganisation der gesetzlichen Krankenversicherung geht auch der Gesetzgeber selber aus333. Es liegt also ein Widerspruch zwischen den verschiedenen Entscheidungen vor. Auf der einen Seite wird dem Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung klar eine Absage erteilt und eine Reform, welche die Struktur der gesetzlichen Krankenversicherung grundlegend umgestaltet, als zulässig erachtet. Auf der anderen Seite wird erklärt, dass der Gesetzgeber an den Grundsatz der finanziellen Stabilität des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung gebunden sei und sich diesem nicht entziehen dürfe. Wie gesehen, setzt die finanzielle Stabilität 327 Im Hinblick auf die Rentenversicherung BVerfGE 53, 257 (293 f.); 100, 1 (39). Aus der Literatur hierzu Helge Sodan, NZS 2005, S. 561 (562 ff.). 328 Peter Badura, DÖV 1989, S. 491 (496); Hans Hofmann, in: Schmidt-Bleibtreu / Klein, GG, Art. 20 Rn. 31; Renate Jaeger, System, S. 15; Thorsten Kingreen, Sozialstaatsprinzip, S. 183; Hans-Jürgen Papier, ZSR 1990, S. 344 (353); ders., Sozialrechtshandbuch, § 3 Rn. 24 ff.; Rainer Pitschas, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 827 (849); Helge Sodan, VVDStRL 64 (2005), S. 144 (166); ders., GesR 2004, S. 305 (306). 329 So z. B. Konrad Hesse, Grundzüge, Rn. 212. 330 BVerfGE 113, 167 (203). 331 BVerfGE 106, 351 (356); 106, 359 (365); 106, 369 (374); 108, 45 (50). 332 So auch Renate Jaeger, NZS 2003, S. 225 (230). 333 So z. B. in BT-Drucks. 12 / 3608, S. 66, 68, 69.
C. Die verfassungsrechtliche Ableitung des Gemeinwohlbelangs
119
zwingend die Existenz der gesetzlichen Krankenversicherung voraus. Das einzige System der gesetzlichen Krankenversicherung, das existiert, ist aber logischerweise das bestehende. Und auf dieses hebt das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich ab334. Hieraus ergibt sich, dass einer der beiden Sätzen nicht aufrecht erhalten werden kann, so dass der Vorwurf des Sonderrechts erhoben werden kann335. Die These, dass der Gesetzgeber auf Grund des Art. 20 Abs. 1 GG an den Grundsatz der finanziellen Stabilität gebunden sein soll, erscheint aus einem weiteren Grund problematisch. In ständiger Rechtsprechung336 (auch in den Beschlüssen zum Grundsatz der finanziellen Stabilität337) vertritt das Bundesverfassungsgericht die Auffassung, dass Art. 20 Abs. 1 GG dem Gesetzgeber einen weiten Spielraum bei der Regelung sozialpolitischer Fragen überlässt. Es fragt sich, wie die große gesetzgeberische Freiheit mit dessen gleichzeitiger Bindung an den Grundsatz der finanziellen Stabilität vereinbart werden kann. Ist Bindung nicht das Gegenteil von Freiheit? Wie soll der Gesetzgeber gleichzeitig frei und unfrei sein?
2. Keine Einrichtungsgarantie Selbst bei Wahl eines anderen Ansatzpunktes zur Ermittlung des Verfassungsranges des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung erhält man kein anderes Ergebnis. Anstatt von der in Frage kommenden Verfassungsnorm aus zu argumentieren, ließe sich auch ein Ansatz wählen, der danach fragt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit von einer Einrichtungsgarantie gesprochen werden kann. Denn das Bundesverfassungsgericht geht der Sache nach von einer Einrichtungsgarantie der gesetzlichen Krankenversicherung aus338. Erste Voraussetzung ist das Vorliegen einer einfachgesetzlich konstituierten Einrichtung. Zweitens haben Einrichtungsgarantien als weitere Gemeinsamkeit, dass sie die Gewährleistung von Autonomie als Schutzzweck aufweisen339. Zwar ist die erste Voraussetzung, das Vorliegen einer einfachgesetzlich konstituierten Einrichtung, erfüllt. Die gesetzliche Krankenversicherung gewährt aber keine Autonomie im oben geforderten Sinne: Grundidee der gesetzlichen Krankenversicherung ist das Element der Zwangsversicherung der Bevölkerung. Dieser bleibt gerade kein Raum zur privatautonomen Absicherung des Krankheitsrisikos. Die Möglichkeit der freien Wahl der Krankenkasse ändert hieran nichts, denn die gesetzlichen Krankenkassen gewähren im Wesentlichen dieselben Leistungen. Bei den institutionellen Garantien erstreckt sich die Garantiefunktion des 334 335 336 337 338 339
BVerfG, NVwZ 2006, S. 191 (198). Siehe zu diesem Vorwurf die Nachweise in Einleitung, Fn. 59. BVerfGE 30, 250 (263); 37, 1 (20); 39, 210 (225 f.); 40, 196 (222 f.); 77, 308 (332). BVerfG, NVwZ 2006, S. 191 (199). Siehe oben Zweites Kapitel A. II. Ute Mager, Einrichtungsgarantien, S. 406 ff.
120
2. Kap.: Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität
Staates auch auf das tatsächliche Funktionieren, da es um die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe geht, für die nach der Verfassung „grundsätzlich der Staat letztverantwortlich“ ist340. Aber auch dieses Kriterium ist bei der gesetzlichen Krankenversicherung nicht erfüllt: Für die Gesundheitsvorsorge ist grundsätzlich der Einzelne selbst verantwortlich341. Sozialversicherung ist keine originäre Staatsfunktion, für die „grundsätzlich der Staat letztverantwortlich“ ist342.
XI. Der Vorwurf des Sonderrechts Dem Grundgesetz lässt sich weder der Verfassungsrang des gegenwärtigen Systems der gesetzlichen Krankenversicherung noch der des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung entnehmen. Der Grundsatz der finanziellen Stabilität ist lediglich ein „relativer“ Gemeinwohlbelang. Er ist nicht geeignet, objektive Berufswahlregelungen zu rechtfertigen, er stellt keinen überragend wichtigen Gemeinwohlbelang dar343. Seine rechtfertigende Kraft im Rahmen der verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprüfung ist wesentlich schwächer als von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundessozialgerichts angenommen. Greift man die zuvor beschriebene Kategorie der finanziellen / fiskalischen Belange auf344, so stellt man fest, dass der Grundsatz der finanziellen Stabilität hier hineinfällt. Er dient lediglich der Mittelbeschaffung bzw. der Vermeidung weiterer Ausgaben. Es handelt sich also bei dem Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung nur um einen schlichten fiskalischen / finanziellen Belang345, also die Art von Gemeinwohlbelangen mit geringer rechtfertigender Kraft. An dieser Stelle lässt sich berechtigterweise der Vorwurf des Sonderrechts erheben. Von der ständigen Rechtsprechung im Hinblick auf das Sozialprinzip, welche auf die Zustimmung des überwiegenden Teils des Schrifttums stößt, wird abgewichen. Auf diese Weise wird der Rang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung überhöht.
Ute Mager, Einrichtungsgarantien, S. 411. Udo Di Fabio, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 2 Abs. 2 Rn. 46, 52 (Stand der Bearbeitung: Februar 2004); Eberhard Schmidt-Aßmann, Grundrechtspositionen, S. 13. 342 Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (210); Hans-Jürgen Papier, ZSR 1990, S. 344 (348); Michael Wollenschläger / Jutta Krogull, NZS 2005, S. 237 (239 mit Fn. 4). 343 Otto Depenheuer, Krankenhauswesen, S. 218 f., 296. 344 Siehe oben Zweites Kapitel B. II. 3. 345 So auch Ferdinand Kirchhof, NZS 2004, S. 1 (3); Stefan Muckel, SGb 2004, S. 583 (590); Helge Sodan, S. 217 (220). Zweifel an der rechtfertigenden Kraft des Belangs auch bei Winfried Boecken, FS-50 Jahre BSG, S. 363 (367). 340 341
D. Ergebnis zum Zweiten Kapitel
121
D. Ergebnis zum Zweiten Kapitel Die These des Bundesverfassungsgerichts in den Entscheidungen zum Grundsatz der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung, dass dieser Grundsatz Verfassungsrang habe, lässt sich nicht plausibel begründen. Vielmehr trifft die in anderen Entscheidungen des Gerichts vertretene Auffassung zu, dass die gesetzliche Krankenversicherung und damit auch der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung keinen Verfassungsrang haben. Die gesetzliche Krankenversicherung ist eine Einrichtung des einfachen Gesetzes. Würde man ihr einen Verfassungsrang zuerkennen, hieße dies, die Normenhierarchie auf den Kopf stellen. Denn dann stünde das einfache Gesetz über den Grundrechten des Grundgesetzes.
Drittes Kapitel
Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers Die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zum Grundsatz der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung erschöpfen sich nicht darin, diesem Grundsatz Verfassungsrang zuzubilligen. In den Entscheidungen, die zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung ergingen, wurden zugleich wichtige Aussagen hinsichtlich des Verhältnisses des Gesetzgebers zum Bundesverfassungsgericht getroffen. Das Bundesverfassungsgericht ist der Ansicht, dass ein besonders lockerer Kontrollmaßstab im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung gelte. Dies bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Erfolgsaussichten des jeweils angestrengten verfassungsgerichtlichen Verfahrens. Die Enge oder Weite des Kontrollmaßstabs kann für Erfolg oder Misserfolg einer Verfassungsbeschwerde oder Normenkontrolle von ausschlaggebender Bedeutung sein. Trotz – oder gerade wegen – dieser Bedeutung1 ist man hinsichtlich der Kontrollproblematik zu einer allgemein anerkannten und praktizierten Lösung noch nicht vorgedrungen. Zunächst wird die allgemeine Dogmatik des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich der Überprüfbarkeit von Gesetzen skizziert (A.), anschließend wird die diesbezügliche Auffassung im Bereich der Sozialversicherung dargestellt (B.). Das Kapitel schließt mit Kritik an der Ansicht des Bundesverfassungsgerichts bezüglich des Kontrollmaßstabs im Bereich des Krankenversicherungsrechts und einem eigenen Vorschlag zur Lösung des Problems (C.).
A. Die traditionelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Kontrolldichte Bei der Frage der Kontrolldichte2 geht es darum zu bestimmen, wieweit das Bundesverfassungsgericht die tatsächlichen Grundlagen gesetzgeberischer Entscheidungen überprüfen darf. Grundsätzlich richtet sich die Kontrolldichte nach BVerfGE 39 (abw. Meinung), 1 (72). Der Begriff findet sich – soweit ersichtlich – das erste Mal bei Peter Lerche, Übermaß, 1961, S. 337. 1 2
A. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Kontrolldichte
123
dem materiellen Recht3. So ist die Kontrolldichte bei Art. 68 Abs. 1 GG eine andere als bei Art. 72 Abs. 2 GG. Vorliegend geht es ausschließlich um die Kontrolldichte bei Art. 12 Abs. 1 GG. Bei den dem Gesetz zu Grunde liegenden Tatsachen, nicht bei der Beurteilung der rechtlichen Fragen, liegt oftmals das Hauptproblem verfassungsgerichtlicher Auseinandersetzungen. Die Annahme oder Ablehnung der gesetzgeberischen Tatsachengrundlagen ist nicht selten eine Vorentscheidung im Hinblick auf die spätere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts4. Oftmals sind die Tatsachengrundlagen und die Auswirkungen des Gesetzes in der Zukunft ungewiss. Das Bundesverfassungsgericht hat zu dieser Lage ausgeführt: „Ungewißheit über die Auswirkungen eines Gesetzes in einer ungewissen Zukunft kann nicht die Befugnis des Gesetzgebers ausschließen, ein Gesetz zu erlassen, auch wenn dieses von großer Tragweite ist. Umgekehrt kann Ungewißheit nicht schon als solche ausreichen, einen verfassungsgerichtlicher Kontrolle nicht zugänglichen Prognosespielraum des Gesetzgebers zu begründen. Prognosen enthalten stets ein Wahrscheinlichkeitsurteil, dessen Grundlagen ausgewiesen werden können und müssen; diese sind einer Beurteilung nicht entzogen.“5
Auch wenn ungewisse Entwicklungen oder Tatsachen einer bundesverfassungsgerichtlichen Kontrolle nicht entgegen stehen, so haben diese tatsächlichen Unsicherheiten doch Auswirkungen auf den Kontrollumfang. Die bislang ausführlichste Darlegung seines Verständnisses von der Kontrolldichte6 hat das Bundesverfassungsgericht im Mitbestimmungsurteil vom 01. 03. 19797 geliefert. Das Gericht macht bei der Frage, inwieweit das Bundesverfassungsgericht Tatsachenund Prognoseentscheidungen des Gesetzgebers überprüfen darf, drei unterschiedliche Maßstäbe aus: „Im einzelnen hängt die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers von Faktoren verschiedener Art ab, im besonderen von der Eigenart des in Rede stehenden Sachbereichs, den Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden, und der Bedeutung der auf dem Spiele stehenden Rechtsgüter. Demgemäß hat die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wenn auch im Zusammenhang anderer Fragestellungen, bei der Beurteilung von Prognosen des Gesetzgebers differenzierte Maßstäbe zu Grunde gelegt, die von einer Evidenzkontrolle [ . . . ] über eine Vertretbarkeitskontrolle [ . . . ] bis hin zu einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle reichen [ . . . ].“8
Hier wird deutlich, dass die Kontrolldichte sich nicht nur nach dem materiellen Recht, also der betroffenen Grundrechtsbestimmung richtet. Selbst in Bezug auf BVerfGE 88, 87 (96); 91, 346 (363); 91, 389 (401); Christoph Gusy, Gesetzgeber, S. 143. Klaus Schlaich / Stefan Korioth, BVerfG, Rn. 534. 5 BVerfGE 50, 290 (332). 6 Peter M. Huber, FS-Kriele, S. 389 (399). Vgl. auch Otto Depenheuer, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 241 (262). 7 BVerfGE 50, 290 ff. 8 BVerfGE 50, 290 (323 f.) – Hervorhebungen nicht im Original. 3 4
124
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
ein und dieselbe Vorschrift können unterschiedliche Maßstäbe bestehen. Bei diesen Kontrollmaßstäben handelt es sich zwar um keine exakt abgegrenzten Kategorien, sondern mehr um eine Beschreibung, eine Art gleitender Skala9. Vor allem die Kategorien Evidenz und Vertretbarkeit scheinen schwer unterscheidbar10. Aber dennoch muss der Versuch unternommen werden, die einzelnen Maßstäbe so genau wie möglich zu fassen. Nur dann kann dieses Konzept eine Hilfe bei der Fallbeurteilung sein. Zur Vertretbarkeitskontrolle hat das Bundesverfassungsgericht im so genannten Mitbestimmungsurteil aus dem Jahre 1979 ausgeführt: „Das Mitbestimmungsgesetz bewirkt wesentliche Veränderungen auf dem Gebiet der Wirtschaftsordnung. Es unterscheidet sich von wirtschaftslenkenden Gesetzen anderer Art durch seinen weitreichenden Inhalt, teilt mit diesen aber die Bezogenheit auf Tatbestände, die rascheren Wandlungen unterliegen als andere, denen eine größere Konstanz eignet. Das Gesetz regelt einen Ausschnitt komplexer, schwer übersehbarer Zusammenhänge; diese hängen ihrerseits von Faktoren einer nicht auf die Bundesrepublik beschränkten Entwicklung ab, die sich zuverlässiger Einschätzung entziehen. Bei dieser Sachlage kann jedenfalls nicht gefordert werden, daß die Auswirkungen des Gesetzes mit hinreichender Wahrscheinlichkeit oder gar Sicherheit übersehbar sein müßten, zumal Rechtsgüter wie das des Lebens oder der Freiheit der Person nicht auf dem Spiele stehen. Ob das Bundesverfassungsgericht sich auf eine bloße Evidenzkontrolle zu beschränken hätte, bedarf keiner Entscheidung. Denn die Prognose des Gesetzgebers ist vertretbar. Dieser Maßstab verlangt, daß der Gesetzgeber sich an einer sachgerechten und vertretbaren Beurteilung des erreichbaren Materials orientiert hat. Er muß die ihm zugänglichen Erkenntnisquellen ausgeschöpft haben, um die voraussichtlichen Auswirkungen seiner Regelung so zuverlässig wie möglich abschätzen zu können und einen Verstoß gegen Verfassungsrecht zu vermeiden. Es handelt sich also eher um Anforderungen des Verfahrens. Wird diesen Genüge getan, so erfüllen sie jedoch die Voraussetzungen inhaltlicher Vertretbarkeit; sie konstituieren insoweit die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers, die das Bundesverfassungsgericht bei seiner Prüfung zu beachten hat.“11
Nähere Ausführungen zu den beiden anderen Maßstäben machte das Bundesverfassungsgericht in diesem Urteil nicht. Zieht man aber Entscheidungen heran, in denen das Gericht eine Evidenz- bzw. eine intensivierte inhaltliche Prüfung vorgenommen hat, sowie die Bedeutung der Begriffe „Evidenz“ und „intensivierte inhaltliche Kontrolle“, so gewinnt man folgendes Ergebnis: Evidenz bedeutet Offensichtlichkeit, Eindeutigkeit. Wird eine Evidenzkontrolle vorgenommen, kann also nur geprüft werden, ob das zu Grunde liegende Tatsachenmaterial offensichtlich unzutreffend oder unvollständig ist. Es muss greifbar zu Tage treten, dass Fakten falsch oder gar nicht ermittelt wurden, die für die Beurteilung der in Rede stehenden Bestimmung von Bedeutung sind12. So hat das Klaus Schlaich / Stefan Korioth, BVerfG, Rn. 536. Christoph Gusy, Gesetzgeber, S. 144; Klaus Schlaich / Stefan Korioth, BVerfG, Rn. 536. 11 BVerfGE 50, 290 (333 f.). 12 Hans-Peter Schneider, NJW 1980, S. 2103 (2105). 9
10
B. Die Rechtsprechung zur Kontrolldichte bei sozialpolitischer Gesetzgebung
125
Bundesverfassungsgericht bei der Erforderlichkeitsprüfung in der Entscheidung zum Güterkraftverkehrsgesetz betont, dass das Gericht ein Mittel nur dann für nicht erforderlich halten darf, wenn das Alternativmittel den erstrebten Zweck in einfacherer, gleich wirksamer, aber die Grundrechte weniger fühlbar einschränkender Weise „so eindeutig erfüllt, daß ein Gericht in der Lage wäre auszusprechen, der Gesetzgeber habe dieses Mittel anstatt des von ihm gewählten einzusetzen“ 13. Die Argumentation erscheint zwar zirkelschlussartig, aber es wird deutlich, dass das Bundesverfassungsgericht im Fall einer Evidenzkontrolle auf Eindeutigkeit der Verfassungswidrigkeit abstellt. Demgegenüber hat das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel im Apotheken- und Kassenarzturteil14 eigene Sachverhaltsaufklärung betrieben und gesetzgeberische Annahmen durch eigene Erhebungen ersetzt. Dies stimmt mit dem Ausdruck intensive Kontrolle überein: Es wird gründlich geprüft und nachgeforscht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der Evidenzkontrolle lediglich darauf geachtet wird, dass das unterbreitete Tatsachenmaterial nicht offensichtlich unvollständig oder eindeutig fehlerhaft ist. Bei der Vertretbarkeitskontrolle wird immerhin auch verlangt, dass der Gesetzgeber korrekt bei der Zusammenstellung des Tatsachenmaterials vorgegangen ist. Bei der intensivierten inhaltlichen Kontrolle schließlich kann das Bundesverfassungsgericht nicht nur die Richtigkeit und Vollständigkeit des Verfahrens, sondern auch des Materials überprüfen. Fehlerhafte oder unvollständige Erhebungen kann das Bundesverfassungsgericht durch eigene ersetzen.
B. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Kontrolldichte bei sozialpolitischer Gesetzgebung Es entspricht ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dem Gesetzgeber auf den Gebieten des Arbeits-, Wirtschafts- und Sozialrechts einen besonders weiten Gestaltungsspielraum zuzubilligen15. So hat das Bundesverfassungsgericht wiederholt ausgeführt, dass das Bundesverfassungsgericht sozialpolitische Entscheidungen des Gesetzgebers anzuerkennen habe, solange dessen „Erwägungen weder offensichtlich fehlsam noch mit der Wertordnung des Grundgesetzes unvereinbar sind“16. Im Hinblick auf sozialpolitische Maßnahmen lässt sich dies problemlos mit dem weiten Spielraum vereinbaren, der Art. 20 Abs. 1 GG als Staatszielbestimmung dem Gesetzgeber einräumt. 13 BVerfGE 40, 196 (223) – Hervorhebung nicht im Original. Vgl. auch BVerfGE 36, 1 (17); 37, 1 (20); 53, 135 (145 f.). 14 BVerfGE 7, 377 ff.; 11, 30 ff. 15 Siehe oben Zweites Kapitel, Fn. 336, 337. 16 BVerfGE 89, 365 (376) m. w. N. So auch BVerfGE 113, 167 (215).
126
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
Unter den Entscheidungen zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es nur wenige, die sich ausdrücklich damit beschäftigen, welcher Kontrollmaßstab anzuwenden ist. Das Bundesverfassungsgericht ist zunächst davon ausgegangen, dass es eine Vertretbarkeitskontrolle vornehmen könne (2. Stufe)17. Denn es formulierte, dass die Maßnahme des Gesetzgebers „auf einer eingehenden und fundierten Analyse“ beruhe, „die jedenfalls vertretbar“ erscheine18. Hierbei zitierte das Bundesverfassungsgericht das Mitbestimmungsurteil, so dass davon ausgegangen werden kann, dass es die dort erwähnte Vertretbarkeitskontrolle im Blick hatte. Erst der Beschluss vom 07. 03. 1994 (also zehn Jahre nach der erstmaligen Verwendung des Grundsatzes der finanziellen Stabilität) brachte eine Änderung in der Form, dass das Bundesverfassungsgericht nur noch eine Evidenzkontrolle vornahm. Die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat in diesem Beschluss die Auffassung vertreten, dem Gesetzgeber stehe „bei der Beurteilung von Eignung und Erforderlichkeit der gewählten Mittel zur Erreichung“ des Ziels der Sicherung der finanziellen Grundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung „ein weiter Beurteilungsspielraum“ zu, der nur dann überschritten werde, „wenn seine Erwägungen so offensichtlich fehlsam“ seien, „daß sie vernünftigerweise keine Grundlage für gesetzgeberische Maßnahmen abgeben“ könnten19. Mit Blick auf den Beschluss zum Risikostrukturausgleich konnte der Eindruck entstehen, das Bundesverfassungsgericht würde zu einer strengeren Prüfung übergehen. Denn es sprach davon, dass die zu überprüfenden Vorschriften auch einer strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung standhielten20. Jedoch bezog sich diese Aussage nur auf die Prüfung im Hinblick auf einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG. Im Hinblick auf die Freiheitsrechte ist das Bundesverfassungsgericht gerade nicht von einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle ausgegangen. Zunächst entstand der Anschein, dass eine Vertretbarkeitskontrolle durchgeführt würde21. Damit hätte eine Rückkehr zur ursprünglichen Ansicht und eine Abkehr von der Evidenzkontrolle vorgelegen. Dieser Eindruck trügt jedoch. Wie die anschließende Überprüfung der Geeignetheit und Erforderlichkeit der angegriffenen Regelungen zeigt, geht das Bundesverfassungsgericht weiterhin von einem besonders weiten Spielraum des Gesetzgebers aus und nimmt eine Verfassungswidrigkeit der Vorschriften nur bei offensichtlicher Fehlsamkeit an22. Eine Rückkehr zur Vertretbarkeitskontrolle lässt sich also nicht feststellen.
17 18 19 20 21 22
BVerfGE 68, 193 (220); BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 1991, S. 205 (206). BVerfGE 68, 193 (220). BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1994, S. 3007. BVerfGE 113, 167 (232). BVerfGE 113, 167 (234). BVerfGE 113, 167 (252 f., 264).
C. Kritik und eigener Vorschlag
127
C. Kritik und eigener Vorschlag Im Folgenden soll untersucht werden, inwieweit die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zutreffen (I.) und welche gegebenenfalls abweichende Lösung vorzuziehen ist (II.).
I. Kritik Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, teilweise allgemein zur Kontrolldichte, teilweise speziell zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung, sieht sich erheblichen Einwänden ausgesetzt.
1. Mangelnde Konsequenz in der Anwendung Der erste Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass der Spielraum allzu oft nur behauptet, nicht aber begründet wird. Das bloße Behaupten eines gesetzgeberischen Spielraums bringt keinen Ertrag. In diesem Zusammenhang wird der Spielraum auch „deus ex machina zahlreicher verfassungsgerichtlicher Entscheidungen“ genannt23. So lässt sich beobachten, dass in Entscheidungen, in denen keine Grundrechtsverletzung festgestellt wird, zuvor der Spielraum des Gesetzgebers und die damit korrespondierende eingeschränkte Nachprüfbarkeit durch das Bundesverfassungsgericht besonders betont werden. Ein besonders weiter Spielraum des Gesetzgebers wurde vom Bundesverfassungsgericht bei so verschiedenen Rechtsmaterien wie dem Rentenrecht24, dem öffentlichen Berufs-25 und Gewerberecht26 und sogar dem Strafrecht27 anerkannt. Besonders weit soll der Spielraum auch auf den Gebieten der Außenpolitik28 sowie der Bildungspolitik29 sein. Hinzu kommen die bereits erwähnten Spielräume auf den Gebieten des Arbeits-, Wirtschafts- und Sozialrechts30. Auch im Schrifttum wird darauf hingewiesen, dass es kaum eine Materie gibt, für die ein entsprechender Hinweis nicht erfolgte31. Hierbei ist keineswegs klar, welches Kriterium entscheidet, ob der Spielraum des Gesetzgebers enger oder weiter sein soll. Der Spielraum kann jedoch keineswegs allein von dem 23 Konrad Hesse, FS-Mahrenholz, S. 541 (542). So auch Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (204); Andreas Voßkuhle, in: von Mangoldt / Klein / Starck, GG, Bd. 3, Art. 93 Rn. 43 mit Fn. 185. 24 BVerfGE 71, 66 (77, 79). 25 BVerfGE 73, 301 (315 ff.). 26 BVerfGE 37, 1 (20). 27 BVerfGE 71, 206 (215 f.). Vgl. auch BVerfGE 61, 291 (313 f.). 28 BVerfGE 4, 157 (168 ff.); 40, 141 (178); 55, 349 (365). 29 BVerfGE 34, 165 (185). 30 Siehe oben Zweites Kapitel, Fn. 336, 337. 31 Ralf Poscher, Grundrechte, S. 271 f.
128
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
Rechtsgebiet abhängig sein. Zum einen lässt sich eine Vorschrift nicht immer zweifelsfrei einem Rechtsgebiet zuordnen. Handelt es sich zum Beispiel bei §§ 51 f. LMBG um Vorschriften des Straf- oder des Lebensmittelrechts? Wenn für ein bestimmtes Fehlverhalten im Vertragsarztrecht eine Sanktion statuiert wird und eine identische Rechtsfolge im Steuer- oder Strafrecht vorgesehen ist, sollen dann für dieselbe Vorschrift unterschiedliche Maßstäbe gelten, obwohl die Regelung dieselbe ist? Spiegelbildlich dazu wird die Bedeutung des betroffenen Grundrechts betont, wenn eine Grundrechtsverletzung bejaht wird. Erstaunlicherweise wurde nun bei fast jedem Grundrecht diese besondere Bedeutung festgestellt32. So wurde sowohl dem menschlichen Leben33 als auch der Gewissensfreiheit34 zugebilligt, einen Höchstrang darzustellen. Ein hoher Rang wurde der Meinungs-, Informations-, Presse- und Rundfunkfreiheit35, dem Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis36, der Versammlungsfreiheit 37, der Berufsfreiheit38, dem Grundrecht auf rechtliches Gehör39, dem Grundrecht auf Ehe40 und dem Grundrecht der Freiheit der Person41 attestiert. Andererseits betont das Bundesverfassungsgericht, dass es auf der Verfassungsebene keine Rangunterschiede gibt42. Hieraus ergibt sich, dass die Bezeichnung als besonders wichtiges oder hohes Grundrecht leer läuft, da sie auf fast jedes Grundrecht bezogen wurde. Abgesehen von Art. 1 Abs. 1 GG, der wegen der besonderen Absicherung in Art. 79 Abs. 3 GG als Höchstwert angesehen werden kann, ist es auch problematisch, innerhalb der übrigen Freiheitsgrundrechte eine Rangordnung aufzustellen43. Da nahezu alle Grundrechte als besonders bedeutsam bezeichnet wurden, ist mit dieser Betonung sowenig gewonnen wie mit der Betonung des Spielraums.
Kritisch hierzu Detlef Merten, GS-Burmeister, S. 227 (234 f.). BVerfGE 39, 1 (42); 49, 24 (53). 34 BVerfGE 23, 127 (134). 35 BVerfGE 59, 231 (265); 77, 65 (74). 36 BVerfGE 67, 157 (171). 37 BVerfGE 69, 305 (348). 38 BVerfG (Kammerbeschluss), EuGRZ 2006, S. 197 (198). 39 BVerfGE 61, 14 (17). 40 BVerfGE 76, 1 (51). 41 BVerfGE 22, 180 (219). 42 So BVerfGE 3, 225 (231 f.); 30, 173 (193); 33, 23 (27). 43 Kritisch auch Georg Hermes, Schutz, S. 252 f.; Ute Mager, Einrichtungsgarantien, S. 399; Detlef Merten, GS-Burmeister, S. 227 (235); Friedrich Müller, Einheit der Verfassung, S. 204 ff.; Ulrich Scheuner, DÖV 1971, S. 505 (509); Klaus Stern, Verfassungstreue, S. 34 f. 32 33
C. Kritik und eigener Vorschlag
129
2. Unklarheit über die angewandten Kriterien Zweitens ist nicht immer klar, warum ein bestimmter Kontrollmaßstab gewählt wurde: Das heißt, die Kriterien für einen bestimmten Maßstab bleiben im Dunkeln44. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht im Mitbestimmungsurteil entsprechende Kriterien benannt. Jedoch wird im Einzelfall nicht immer klar, weshalb in diesem Fall eine Vertretbarkeitskontrolle, in einem anderen Fall eine Evidenzkontrolle vorgenommen wird. Beispielhaft hierfür ist, dass das Bundesverfassungsgericht zunächst im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung von einer Vertretbarkeitskontrolle ausging, bevor es ohne jede Begründung nur noch eine Evidenzkontrolle vornahm.
3. Unvereinbarkeit mit der These vom Verfassungsrang der gesetzlichen Krankenversicherung Speziell bei den Entscheidungen zum Grundsatz der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es einen weiteren Kritikpunkt: Auf der einen Seite wird stets betont, dass der Gesetzgeber an den Grundsatz der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung gebunden sei, dass der Gesetzgeber sich diesem nicht entziehen dürfte. Der Verfassungsrang des Grundsatzes wird betont, wenn es um den rechtfertigenden Grund für Eingriffe in die Berufsfreiheit geht. Auf der anderen Seite wird auf den Ebenen der Geeignetheit und Erforderlichkeit der weite Spielraum des Gesetzgebers betont. An dieser Stelle ist nicht mehr zu lesen, dass der Gesetzgeber gebunden sein soll, obwohl diese Feststellung auch hier gelten müsste. Müsste der Spielraum nicht eingeschränkt sein, wenn sich der Gesetzgeber diesem Grundsatz nicht entziehen dürfte?
4. Unvereinbarkeit mit der Drei-Stufen-Theorie Des weiteren entsteht ein Bruch innerhalb der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Die bei Art. 12 Abs. 1 GG angewandte Drei-Stufen-Theorie differenziert nach subjektiven und objektiven Berufszulassungsregelungen sowie nach Berufsausübungsregelungen. Je nach dem, welche Art von Regelung vorliegt, sind unterschiedlich hohe Anforderungen an die Wertigkeit des rechtfertigenden Belangs zu stellen. Im Falle von objektiven Berufswahlregelungen kommt beispielsweise eine Rechtfertigung nur durch Güter von Verfassungsrang in Betracht. Hierin erschöpft sich die Drei-Stufen-Theorie jedoch nicht. Es geht ihr auch und vor allem um Abstufungen in der Stringenz und Justiziabilität der einzelnen Elemente des Übermaßverbots45. Allgemein gesprochen, soll die Kontrolldichte zu44 Ernst Gottfried Mahrenholz, Symposium-Lerche, S. 23 (32); Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 320; Hans-Peter Schneider, NJW 1980, S. 2103 (2105).
9 Schaks
130
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
nehmen, je wichtiger die zu schützenden Interessen sind und je intensiver sie berührt werden46. Das Bundesverfassungsgericht selbst hat festgestellt, dass der gesetzgeberische Gestaltungsspielraum um so geringer wird, je mehr eine Regelung in ihren Auswirkungen einer Berufswahlregelung nahe kommt47. Somit gilt, dass die Drei-Stufen-Theorie bei besonders gewichtigen Eingriffen nicht nur besonders bedeutsame Gemeinwohlbelange erfordert, sondern auch eine besonders intensive Kontrolle. Im Falle von objektiven Berufswahlregelungen zum Beispiel besteht keinerlei Beurteilungs- oder Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers, weder im Hinblick auf das Gewicht des zu schützenden Gemeinschaftsguts noch hinsichtlich der tatsächlichen Gefährdung noch im Hinblick auf die Eignung oder Erforderlichkeit der eingesetzten Mittel48. In diesen Fällen ergibt sich die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes wegen Verstoßes gegen Art. 12 Abs. 1 GG bereits dann, wenn der Gesetzgeber die Gefahrenprognose, die Eignung oder Erforderlichkeit der Regelung nicht nachweisen kann49. Beschränkte man die Prüfung der Erforderlichkeit stets auf eine Evidenzkontrolle, so würde dieser Aspekt der Drei-Stufen-Theorie ausgeblendet. Das Bundesverfassungsgericht hätte sich nicht damit begnügen dürfen, Gesetze erst dann als verfassungswidrig anzusehen, wenn sie offensichtlich fehlsam sind50, sondern es hätte die Anforderungen der Drei-Stufen-Theorie miteinbeziehen müssen. Dies hätte zu einer Erhöhung, nicht zu einer Absenkung des Kontrollniveaus geführt. 5. Sonderproblem: Einstweilige Anordnungen Ein weiteres Problem zeigt sich bei dem Erlass einstweiliger Anordnungen. Mehrere der dargestellten Entscheidungen ergingen in Verfahren, in denen der Erlass einstweiliger Anordnungen begehrt wurde51. Das Bundesverfassungsgericht hat hier – wie auch andernorts – betont, dass beim Erlass einer einstweiligen Anordnung ein strenger Maßstab gelte. Dieser Maßstab sei noch strenger, wenn das In-Kraft-Treten eines Gesetzes verhindert werden solle52. Die Chancen eines Beschwerdeführers, eine einstweilige Anordnung erlassen zu sehen, sind deshalb sehr gering. Dieser strenge Maßstab wird nicht zu Unrecht angelegt, denn es gilt den Respekt vor dem Gesetzgeber zu wahren. 45 Hans-Jürgen Papier, FS-Stern, S. 543 (554). So auch Otto Depenheuer, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 241 (262 f.). 46 Ingwer Ebsen, VSSR 1996, S. 351 (361). 47 BVerfGE 11, 10 (42); 12, 144 (148). So auch Bodo Pieroth / Bernhard Schlink, Grundrechte, Rn. 846. 48 Hans-Jürgen Papier, FS-Stern, S. 543 (554). So auch Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (224). 49 Hans-Jürgen Papier, FS-Stern, S. 543 (554 f.). 50 So auch Hans-Jürgen Papier, FS-Stern, S. 543 (555). 51 BVerfGE 106, 351 ff.; 106, 359 ff.; 106, 369 ff.; 108, 45 ff. 52 BVerfGE 106, 351 (355); 106, 359 (363); 106, 369 (372 f.); 108, 45 (48).
C. Kritik und eigener Vorschlag
131
Dieses Vorgehen wird jedoch dann problematisch, wenn es mit einer anderen Vorgehensweise kombiniert wird: In der bisher einzigen Entscheidung, in der das Bundesverfassungsgericht trotz Heranziehung des Grundsatzes der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung ein Gesetz für mit dem Grundgesetz unvereinbar hielt, hat es sich geweigert, den Verfassungsverstoß zu sanktionieren: Es hat die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, da die Rückabwicklung von Rechtsverhältnissen, die vier bis fünf Jahre in der Vergangenheit liegen, problematisch sei53. Für den Beschwerdeführer hat dies folgende Dramaturgie zur Folge. In einem ersten Schritt wird wegen des strengen Maßstabs bei § 32 BVerfGG keine einstweilige Anordnung erlassen. Bis das Bundesverfassungsgericht in der Hauptsache entscheiden kann, vergeht oftmals eine lange Zeit. Erschwert wird eine schnelle Entscheidung durch die strengen Anforderungen an die Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde und an den Vorlagebeschluss im Verfahren nach Art. 100 Abs. 1 GG. Bis das Bundesverfassungsgericht entscheidet, hat der Grundrechtsträger womöglich finanzielle Einbußen auf Grund des verfassungswidrigen Gesetzes erlitten. Da das Bundesverfassungsgericht eine Rückabwicklung scheut, ist die einzige Sanktion des Gesetzgebers die Kassation des Gesetzes (im Falle von zeitlich befristeten Gesetzen nicht einmal das). Da das Verhalten ansonsten unsanktioniert bleibt, ist – gerade in Zeiten leerer Kassen – der Anreiz, die Grundrechte der Leistungserbringer ernst zu nehmen, gering. Diese Befürchtung wurde auch von den Beschwerdeführern in späteren Verfahren geäußert54.
6. Fixierung auf das Verhältnis Bundesverfassungsgericht – Gesetzgeber Bei der Diskussion der Kontrolldichte wird stets auf das Verhältnis des Bundesverfassungsgerichts zum Gesetzgeber geachtet. Allzu leicht kann hierbei der Grundrechtsträger aus dem Blick verloren werden. Das Bundesverfassungsgericht wurde nicht eingerichtet, um den Gesetzgeber nicht zu kontrollieren, sondern u. a. um einen effektiven Grundrechtsschutz zu gewährleisten55. So richtig und wichtig es ist, den Gesetzgeber nicht durch eine zu enge Kontrolle zu bevormunden, so wichtig ist es auch, bei der Bestimmung des Verhältnisses von Gesetzgeber zu Bundesverfassungsgericht die Grundrechte der Bürger im Blick zu behalten. Das Bundesverfassungsgericht kann seiner Aufgabe als Hüter der Verfassung56 nur dann gerecht werden, wenn es sich nicht von anderen Instanzen, und sei es der Gesetzgeber, den Sachverhalt eines Streitfalls als undiskutierbar vorschreiben lässt57. BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 1781 f. BVerfGE 106, 359 (362 f.). 55 Christoph Degenhart, Staatsrecht I, Rn. 744; Helge Sodan / Jan Ziekow, Öffentliches Recht, § 16 Rn. 5 f. 56 BVerfGE 1, 184 (195). 53 54
9*
132
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
7. Keine Berücksichtigung kumulierender Grundrechtseingriffe In einer der letzten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die zum Grundsatz der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung ergangen ist, findet sich folgende Passage: „Die Zulassungsbeschränkungen und die Deckelung der Gesamtvergütung haben das System des Vertragsarztrechts spätestens seit dem In-Kraft-Treten des Gesundheitsstrukturgesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2266) am 1. Januar 1993 verändert. Für die Leistungserbringer hat sich das Spektrum an Dienst- und Sachleistungen verengt, das mit den Krankenkassen abgerechnet werden kann. Die Vergütungen der Vertragsärzte sind gekürzt und die Zuwächse bei den Vergütungen an die beitragspflichtigen Einnahmen gekoppelt worden (§ 85 SGB V). Die Vertragsärzte werden Wirtschaftlichkeits- und Plausibilitätskontrollen unterzogen (§§ 106, 106 a SGB V). Vor allem aber wird der Zustrom der Leistungserbringer durch Mechanismen der Bedarfsplanung gelenkt. Nachdem lange Zeit ein ungehinderter Zugang zur vertragsärztlichen Versorgung bestanden hatte, wurden seit 1986 sukzessive regional wirksame Zulassungssperren eingeführt [ . . . ]. Die praktischen Auswirkungen sind für alle Arztgruppen erheblich. So waren Anfang 2003 etwa für Chirurgen nur noch 3 vom Hundert und für fachärztliche Internisten nur noch 2 vom Hundert der Planungsbereiche offen [ . . . ]. Flankiert werden diese Maßnahmen der Verminderung der Zahl der Leistungserbringer im System durch die Einführung von Altersgrenzen für Vertragsärzte (§ 98 Abs. 2 Nr. 12 SGB V i.V. m. § 25 Ärzte-ZV; § 95 Abs. 7 Satz 3 SGB V). [ . . . ] Das Grundrecht des Vertragsarztes aus Art. 12 Abs. 1 GG wird im Interesse der Funktionsfähigkeit des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung in vielfältiger Weise eingeschränkt. Zur Sicherung von Qualität und Wirtschaftlichkeit muss er Einschränkungen seines Behandlungsspektrums ebenso hinnehmen wie Regelungen, die seine Niederlassungsfreiheit, seine Fallzahlen und seine Vergütung begrenzen.“58
Hiermit spricht das Bundesverfassungsgericht – freilich ohne es so zu nennen – das Problem kumulierender oder additiver Grundrechtseingriffe59 an. Es wird deutlich, dass sich die einzelnen Belastungen, die das Bundesverfassungsgericht jeweils für sich geprüft hat, zu massiven Freiheitsverkürzungen summieren. Dass das Verbot übermäßiger Belastung dabei noch respektiert wird, wird zunehmend bezweifelt60. Diese Befürchtung wurde auch von der Baden-Württembergischen und der Saarländischen Landesregierung in dem Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des BSSichG geäußert61. Die Dogmatik ist bei diesem Thema über eine Problembeschreibung und erste Lösungsansätze noch nicht hinausgelangt62. Fritz Ossenbühl, FG-25 Jahre BVerfG, Bd. I, S. 458 (495). BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2005, S. 273 (274, 275). 59 Vgl. hierzu Friedhelm Hufen, NJW 1994, S. 2913 (2916); Winfried Kluth, ZHR 162 (1998), S. 673 f.; Michael Klöpfer, VerwArch 74 (1983), S. 201 ff. spricht auch von „Belastungskumulation“; Jörg Lücke, DVBl. 2001, S. 1469 ff. 60 So u. a. von Karl Heinrich Friauf, Morbiditätsrisiko, S. 43 f.; Winfried Kluth, MedR 2005, S. 65 (70); Helge Sodan, NJW 2003, S. 1761 (1763 f.); ders., GesR 2004, S. 305 (307). 61 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 13. 09. 2005, Az.: 2 BvF 2 / 03, Rn. 11 (zitiert nach: www.bverfg.de) – insoweit nicht abgedruckt unter BVerfG, NVwZ 2006, S. 191 ff. 62 Otto Depenheuer, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 241 (264). 57 58
C. Kritik und eigener Vorschlag
133
In der Literatur werden drei Voraussetzungen genannt, bei deren Vorliegen von kumulierenden bzw. additiven Grundrechtseingriffen ausgegangen wird: Gleichzeitige Geltung der belastenden Normen gegenüber dem Belasteten, Beeinträchtigung desselben Grundrechtsgutes, identischer Zweck, der mit den Eingriffen verfolgt wird63. Diese Voraussetzungen sind – wenn auch bezüglich der einzelnen Gruppen von Leistungserbringern in unterschiedlichem Maße – erfüllt. Betroffen sind die Leistungserbringer (Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Pharmaunternehmer) in ihrem Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1 GG. Die zahlreichen Vorschriften des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung (wie zum Beispiel Budgetierungen der Gesamtvergütungen, Punktwertverfall, Einschränkung der Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung in örtlicher und zeitlicher Sicht) sind zum selben Zeitpunkt in Kraft und wirken somit gleichzeitig. Und schließlich dienen diese Maßnahmen alle demselben Zweck: der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung, also der Kosteneinsparung. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Grunde nach das Verbot übermäßiger Gesamtbelastung anerkannt64. So hat es bereits früh entschieden, dass bei der Bemessung einer Kriminalstrafe eine bereits verbüßte Freiheitsstrafe nach der Wehrdisziplinarordnung nicht unberücksichtigt bleiben dürfe65. Dem ist der Gesetzgeber mit Schaffung des § 51 Abs. 1 Satz 1 StGB (vgl. auch § 16 WDO, § 14 BDG) nachgekommen. Auch im Steuerrecht wird auf die Belastung durch die Gesamtbesteuerung abgestellt66, was auf die Anerkennung der verfassungsrechtlichen Bedeutsamkeit additiver / kumulierender Grundrechtseingriffe schließen lässt. Wird das Vorliegen additiver Grundrechtseingriffe bejaht, so hat dies eine strengere Prüfung der Grundrechtseingriffe zur Folge: Nicht nur jede einzelne gesetzgeberische Maßnahme muss für sich verfassungsmäßig sein, ein zweiter Prüfungsschritt verlangt zu prüfen, ob auch beide Maßnahmen kumulativ vorliegen dürfen67. Da die Bündelung der Eingriffe zu einer erhöhten Eingriffsintensität und damit zu einer stärkeren Belastung des betroffenen Grundrechtsträgers führt, müssen höhere Anforderungen an die Prüfung der Verhältnismäßigkeit gestellt werden68. Beim Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung verfährt die Rechtsprechung jedoch entgegengesetzt: Anstatt strenger zu prüfen, wird das bereits bestehende Ausmaß gesetzlicher Eingriffe als Ausgestaltung eines öffentlich-rechtlichen Systems dargestellt, das weitere Eingriffe recht63 Gregor Kirchhof, NJW 2006, S. 732 (734); Winfried Kluth, ZHR 162 (1998), S. 673 f; Jörg Lücke, DVBl. 2001, S. 1469 (1470 f.). 64 Vgl. BVerfG, NJW 2005, S. 1338 (1340 f.). 65 BVerfGE 21, 378 ff. Der Sache nach ebenso BVerfGE 105, 135 (165). 66 BVerfGE 93, 121 (135); Otto Depenheuer, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 241 (264); Walter Leisner, Belastungsgrenze, S. 67 f., 72 f.; Paul Kirchhof, VVDStRL 39 (1981), S. 213 (238 ff.); ders., HdBStR IV, § 88 Rn. 103. 67 Paul Kirchhof, VVDStRL 39 (1981), S. 213 (240); Jörg Lücke, DVBl. 2001, S. 1469 (1476). 68 Jörg Lücke, DVBl. 2001, S. 1469 (1476); Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 333 f.
134
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
fertige. Da die Leistungserbringer an diesem System teilhaben wollten und da sie dessen Nutzen zögen, müssten sie auch weitere Eingriffe in Kauf nehmen69.
8. Keine Berücksichtigung gewonnener Erkenntnisse Bereits in der ersten Entscheidung zum Grundsatz der finanziellen Stabilität hieß es: „Um die Ausgabenentwicklung zu bremsen und sie der Entwicklung der Versicherteneinkommen anzupassen, erging im Jahre 1977 das Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz, mit dem den Selbstverwaltungsorganen wirksame Instrumente zur bedarfsgerechten und kostengünstigen Versorgung der Versicherten in die Hand gegeben werden sollten [ . . . ]. Da indessen die Defizite der gesetzlichen Krankenversicherung auch weiterhin nicht beseitigt werden konnten, hat der Gesetzgeber zusätzliche Maßnahmen beschlossen: Das am 1. Januar 1982 in Kraft getretene Gesetz zur Ergänzung und Verbesserung der Wirksamkeit kostendämpfender Maßnahmen in der Krankenversicherung (KostendämpfungsErgänzungsgesetz – KVEG) vom 22. Dezember 1981 [ . . . ].“70
Im Beschluss zur Verfassungsmäßigkeit der Zugangssperre zur vertragsärztlichen Versorgung nach Vollendung des 55. Lebensjahres zählt das Bundesverfassungsgericht einige gesetzgeberische Maßnahmen auf, die zur finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung hätten beitragen sollen, und führt dann aus: „Die genannten Mittel waren und sind allesamt grundsätzlich geeignet, zur finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung beizutragen, wenngleich keine Maßnahme nachhaltig gewirkt hat.“71
Bereits in der ersten Entscheidung zum Grundsatz der finanziellen Stabilität wurde also zugestanden, dass die vorangegangenen Maßnahmen ineffizient waren. Auch die nachfolgenden Entscheidungen lassen nicht erkennen, dass die finanziellen Probleme der gesetzlichen Krankenversicherung ansatzweise gelöst würden. Im Gegenteil. Das Eingeständnis, dass keine (!) der ergriffenen Maßnahmen nachhaltig gewirkt habe, wurde nur noch deutlicher. Nach 17 Jahren Rechtsprechung zu diesem Grundsatz kommt die Aussage, dass die bislang ergriffenen Maßnahmen im Grunde nicht wirkungsvoll waren, einem Eingeständnis gleich. Wenn sich gezeigt hat, dass bestimmte Maßnahmen ineffektiv sind, dann sind die Möglichkeiten „sich ein hinreichend sicheres Bild“ zu machen, wie es das Bundesverfassungsgericht im Mitbestimmungsurteil verlangt hat72, verbessert worden. Deshalb wird 69 Besonders augenscheinlich wird dies in BSG, Urteil vom 09. 12. 2004, Az.: B 6 KA 44 / 03 R, Rn. 148 (zitiert nach: www.bundessozialgericht.de). Kritik hieran auch bei Karl Heinrich Friauf, Morbiditätsrisiko, S. 59. 70 BVerfGE 68, 193 (195) – Hervorhebung nicht im Original. 71 BVerfGE 103, 172 (189) – Hervorhebung nicht im Original. Vgl. auch BVerfGE 113, 167 (176) und bereits BVerfGE 68, 193 (195) als ersten Beschluss zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung. 72 BVerfGE 50, 290 (332 f.).
C. Kritik und eigener Vorschlag
135
eine strengere Überprüfung des Gesetzgebers möglich, aber auch erforderlich. Nahezu 20 Jahre später dem Gesetzgeber denselben Spielraum zuzubilligen wie bei der ersten Maßnahme zur Erhaltung der finanziellen Stabilität, lässt sich mit der sonstigen Rechtsprechung nicht vereinbaren. Denn das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, dass der Gesetzgeber zur Nachbesserung verpflichtet ist, wenn die seinerzeitigen Prognosen sich als unzutreffend erwiesen haben73. Aus diesem Grund wurde zum Beispiel der generelle Ausschluss schreib- und sprechunfähiger Personen von der Testiermöglichkeit (damals §§ 2232, 2233 BGB, § 31 BeurkundungsG) für unverhältnismäßig erklärt74. Wenn also festgestellt wird, dass keine Maßnahme dauerhaft gewirkt hat, dann haben sich die seinerzeitigen gesetzgeberischen Überlegungen als unzutreffend erwiesen, weshalb den Gesetzgeber eine Nachbesserungspflicht trifft. Das hat auch im Bereich der Sozialversicherung zu gelten. Der Gesetzgeber muss sich außerdem an seinen eigenen Aussagen festhalten lassen. Der Spielraum des Gesetzgebers verengt sich, sobald er sich bereits im selben Zusammenhang geäußert hat. Setzt sich der Gesetzgeber zu seinen eigenen Aussagen in Widerspruch, verstärkt sich die Kontrolldichte75. Deshalb wird in der Regel von einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle auszugehen sein, wenn der Gesetzgeber seine Einschätzung bereits kundgetan hat76. Eine solche Einschätzung liegt im Zusammenhang mit dem Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung vor: „Gesetzliche Eingriffe zur unmittelbaren Begrenzung der Ausgaben in den einzelnen Leistungsbereichen sind als dauerhaftes Instrument untauglich; sie können und dürfen auch nicht wiederholt eingesetzt werden.“77
Diese Auffassung wird auch von der Literatur geteilt78. Dennoch hat der Gesetzgeber selbst wiederholt zur unmittelbaren Ausgabenbegrenzung in Grundrechte eingegriffen79, also genau das getan, wogegen er sich zuvor noch ausdrücklich gewandt hat. Gerade in solchen Fällen des Selbstwiderspruchs liegt es nahe, intensiver zu prüfen, da nicht beide Ansichten gleichermaßen zutreffen können.
73 BVerfGE 30, 250 (263); 57, 139 (162 f.); 113, 167 (234); Rüdiger Breuer, HdBStR VI, § 148 Rn. 19; Joachim Wieland, in: Dreier, GG, Bd. 1, Art. 12 Rn. 138. 74 BVerfGE 99, 341 (354 f.). 75 Steffen Augsberg, ZRP 2005, S. 105 (107). 76 Steffen Augsberg, ZRP 2005, S. 105 (107). 77 BT-Drucks. 12 / 3608, S. 69. 78 Karl Heinrich Friauf, Morbiditätsrisiko, S. 55 ff. 79 So die Regelungen, die folgenden Entscheidungen zu Grunde lagen BVerfGE 68, 193 ff.; 70, 1 ff.; BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 1991, S. 205 ff.; NJW 2000, S. 1781 f.; NJW 2000, S. 3413; NVwZ-RR 2002, S. 802; BVerfGE 106, 275 ff.; 106, 351 ff.; 106, 359 ff.; 106, 369 ff.; 108, 45 ff. Siehe dazu unten Drittes Kapitel C. II. 5. d) sowie die Schilderung in BVerfG, Beschluss vom 13. 09. 2005, Az.: 2 BvF 2 / 03, Rn. 11 ff. (zitiert nach: www.bverfg.de) – insoweit nicht abgedruckt unter BVerfG, NVwZ 2006, S. 191 ff.
136
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
9. Der Begriff „Offensichtliche Fehlsamkeit“ Die Aussage, dass das Bundesverfassungsgericht Erwägungen des Gesetzgebers hinzunehmen habe, solange diese nicht fehlsam oder mit der Wertordnung des Grundgesetzes unvereinbar sind, erscheint problematisch. Wenn Erwägungen des Gesetzgebers nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind, dann sind sie verfassungswidrig. Dass verfassungswidrige Erwägungen des Gesetzgebers vom Bundesverfassungsgericht nicht hingenommen werden dürfen, ist eine Selbstverständlichkeit. Die Frage ist jedoch, wann gesetzgeberische Erwägungen mit dem Grundgesetz unvereinbar sind. Hierauf gibt die Aussage aber keine Antwort. Die Formulierung „weder offensichtlich fehlsam noch mit der Wertordnung des Grundgesetzes unvereinbar“ scheint es nahe zulegen, dass es zwei mögliche Gründe für die Verfassungswidrigkeit gesetzgeberischer Erwägungen gibt: Erstens die offensichtliche Fehlsamkeit. Selbst wenn eine Regelung nicht offensichtlich fehlsam ist, kann sich die Verfassungswidrigkeit zweitens noch aus der Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz ergeben. Es würde somit eine doppelte Überprüfbarkeit vorliegen. Da das Bundesverfassungsgericht zuvor aber den weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers betont, scheint etwas anderes gemeint zu sein. Intendiert war wohl die Aussage, dass eine Verfassungswidrigkeit erst bei offensichtlicher Fehlsamkeit angenommen werden könne. Diese Sicht lässt sich möglicherweise mit Art. 20 Abs. 1 GG vereinbaren, jedoch nur so lange, wie keine Grundrechtseingriffe in Rede stehen. So lange, wie keine Grundrechtseingriffe vorliegen, ist bei sozialpolitischen Maßnahmen alleine Art. 20 Abs. 1 GG Maßstab. Sobald aber durch die sozialpolitischen Maßnahmen in Grundrechte eingegriffen wird, müssen ihre Maßstäbe beachtet werden. Sie gewähren keinen so weiten Spielraum wie das Sozialstaatsprinzip. Auch im Schrifttum wurde darauf hingewiesen, dass die Formulierung von der offensichtlichen Fehlsamkeit sich allenfalls auf Berufsausübungsregelungen beziehen könne80 und dass nicht generell ein besonders weiter Maßstab Anwendung finden könne81. Seetzen nennt diesen weiten Spielraum einen „Freibrief für Experimente“82, Ossenbühl vermisst eine Berücksichtigung von Grundrechtspositionen83 und Leisner warnt vor einem „Klima der Gesetzesentbindung, bis hin zur virtuellen Schrankenlosigkeit“84. Badura will dem Gesetzgeber nur bezüglich der Beurteilung des Gemeinwohlbelangs einen weiten Spielraum einräumen, der erst bei offensichtlicher Fehlsamkeit überschritten ist. Die Beantwortung der Frage, ob der Gesetzgeber den konkretisierten Gemeinwohlbelang auch so verfolgen durfte, sei hingegen „engeren verfassungsrechtlichen Anforderungen unterworfen“85. 80 81 82 83 84
Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (206). Helge Sodan / Olaf Gast, NZS 1998, S. 497 (501, 505). Uwe Seetzen, NJW 1975, S. 429 (431). Fritz Ossenbühl, FG-25 Jahre BVerfG, Bd. I, S. 458 (505 f.). Walter Leisner, Belastungsgrenze, S. 82.
C. Kritik und eigener Vorschlag
137
Zu beachten ist auch, dass der lockere Maßstab ursprünglich nur gewählt wurde, wenn die Sachlage in Gegenwart und Zukunft tatsächlich unsicher war. Demgegenüber wird die weite Einschätzungsprärogative dem Gesetzgeber im Bereich des Sozialrechts selbst bei konkreten Eingriffen zugestanden, obwohl keine besondere Ungewissheit über die Maßnahmen besteht86.
10. Ergebnis zu I. Insgesamt ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht zur Kontrolldichte bei Maßnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung zahlreichen Kritikpunkten ausgesetzt. Sie ist teilweise in sich widersprüchlich, teilweise mit anderen Rechtsprechungsansätzen oder dogmatischen Grundsätzen unvereinbar. Diese Kritik bezieht sich insbesondere auf die Prüfung des Übermaßverbots. Es wird sogar offen die Frage gestellt, ob das Bundesverfassungsgericht überhaupt eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vornimmt, die diesen Namen verdient87. Dabei wird gerade die Verhältnismäßigkeitsprüfung als Herzstück bei der Prüfung der materiellen Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes angesehen88. Rixen spricht deshalb von einer „Beseitigung der Berufsfreiheit auf der Rechtfertigungsebene“89. Und Isensee kritisiert: „Mit dem Argument der ,Sicherung der finanziellen Stabilität und damit der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung‘ setzt das grundrechtliche Denken praktisch aus.“90 Auch aus einem anderen Grund kann von einer nur eingeschränkten Verhältnismäßigkeitsprüfung die Rede sein, insbesondere dann, wenn das Bundesverfassungsgericht auf den Gemeinwohlbelang „Finanzierbarkeit der gesetzlichen Krankenversicherung“ anstatt auf das Synonym „finanzielle Stabilität“ zurückgreift91. Denn der Ausdruck Finanzierbarkeit impliziert, dass eine Finanzierung der in Rede stehenden Leistungen möglich ist92. Ob die Aufbürdung finanzieller Lasten aber tatsächlich von den Betroffenen zu schultern ist, ob jene ihnen zumutbar ist, steht erst am Ende der Verhältnismäßigkeitsprüfung fest93. Die Behauptung der möglichen Finanzierbarkeit durch den Gemeinwohlbelang kann Peter Badura, AöR 92 (1967), S. 382 (386). Friedhelm Hufen, NJW 2004, S. 14 (16 f.). 87 Wolfgang Weiß, NZS 2005, S. 67 (72). Ähnlich Winfried Boecken, FS-Brohm, S. 231 (240 f.); Friedhelm Hufen, NJW 2004, S. 14 (16); Josef Isensee, NZS 2004, S. 393 (394, 395); Winfried Kluth, ZHR 162 (1998), S. 657 (680). 88 Siehe nur Helge Sodan / Jan Ziekow, Öffentliches Recht, § 24 Rn. 32. 89 Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 318. 90 Josef Isensee, ZVersWiss 2004, S. 651 (654). 91 So in BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1993, S. 1520; NJW 1994, S. 785; NJW 1998, S. 1776 (1777); BVerfG, NVwZ 2006, S. 191. Siehe hierzu auch Erstes Kapitel A. I. 1. und 2. 92 Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 317 f. 93 Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 317 f. 85 86
138
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
nicht ausreichen und entbindet nicht von einer vollständigen Prüfung des Übermaßverbots. Dem Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Verfassungsrang einzuräumen, ist mit der Normenhierarchie unvereinbar, weil die Annahme des Verfassungsrangs die Grundrechte dem einfachen Recht unterordnet. Wenn zusätzlich die Kontrolldichte stark zurückgenommen wird, dann ist die Gefahr einer Erosion der Grundrechte umso größer. Der Gesetzgeber würde nur noch dann sanktioniert werden, wenn die Verfassungswidrigkeit seiner Maßnahme so offensichtlich ist, dass sie sich jedem geradezu aufdrängt. Solche extremen Gesetze kommen zwar vor, dürften aber dennoch recht selten sein. Sie dürften sogar so selten sein, dass im Ergebnis gar keine Kontrolle mehr besteht, was auch in der Literatur auf Kritik stößt94. Ein solch weiter – nahezu unbegrenzter – Spielraum kann dem Gesetzgeber nicht zugestanden werden, weil die Einbindung insbesondere der Leistungserbringer in das Recht der gesetzlichen Krankenversicherung vielfältige, intensive Grundrechtsbelastungen verursacht.95 Diese könnten in immer geringer werdendem Maße an verfassungsrechtlichen Maßstäben überprüft werden. Konsequent angewandt, führte die Reduktion der Kontrolldichte bei gleichzeitiger Überhöhung des Rangs des Grundsatzes der finanziellen Stabilität zu einer Loslösung des Gesetzgebers von der in Art. 1 Abs. 3 GG statuierten strikten Bindung an die Grundrechte96. Die bisherigen Betrachtungen haben nur ergeben, dass und warum die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers – wie das Bundesverfassungsgericht sie zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung vertritt – nicht weiterführend ist. Im Folgenden sollen abweichende Lösungsansätze vorgeschlagen werden.
II. Eigener Vorschlag Möglicherweise handelt es sich bei der Abgrenzung der Kompetenzen von Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht um ein „ewiges Problem“97. Zumindest ist es ein Fragenkreis, der kein einfaches Subsumieren oder schematisches Vorgehen erlaubt; gefragt sind differenzierende Lösungen98. Aber es können immerhin Kriterien aufgezeigt werden, die die Handhabung dieser schwierigen Frage erleichtern. 94 Zusätzlich zu den bereits genannten Görg Haverkate, DVBl. 2004, S. 1061 (1063); Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 226. 95 Vgl. Helge Sodan, Freie Berufe, S. 315. 96 Diese Befürchtung äußert auch Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 226. 97 Fritz Ossenbühl, FS-Redeker, S. 55 (56). Siehe auch Karl Doehring, FS-Stern, S. 1059; Walter Krebs, Kontrolle, S. 80 mit Fn. 187; Hans-Peter Schneider, NJW 1980, S. 2103 (2104) spricht von „einer Quadratur des Kreises“. 98 Robert Alexy, Grundrechte, S. 495.
C. Kritik und eigener Vorschlag
139
Der Verweis auf den Spielraum hilft nur weiter, wenn gleichzeitig die Kriterien erkennbar sind, wann ein enger und wann ein weiter Spielraum vorliegt und wie dieser Spielraum jeweils aussieht. Die Grenzen des Spielraums müssen im voraus bestimmbar sein, damit verfassungsrichterliches Handeln vorhersehbar und berechenbar bleibt. Damit die erhofften Wirkungen eintreten, müssen – nach einer Klärung der Begrifflichkeiten – drei Fragen beantwortet sein. Erstens: Welche Maßstäbe gibt es? Zweitens: Welche Kriterien entscheiden, welcher Maßstab angewandt wird? Drittens: Wie wirkt sich der jeweils angewandte Maßstab auf die Verhältnismäßigkeitsprüfung aus? 1. Begriffsbestimmungen An dieser Stelle sollen einige Begriffe, die im Folgenden von Bedeutung sind, kurz erläutert werden. So versteht man unter einer Tatsache einen realen Sachverhalt99, eine Aussage über die Wirklichkeit100. Tatsachen sind dem Wahrheitsbeweis zugänglich. Dies unterscheidet die Tatsache von der Wertung, die eine subjektive Entscheidung darstellt101 und gerade nicht dem Wahrheitsbeweis zugänglich ist102. Eine Prognose wiederum bezieht sich nicht auf die Gegenwart, sondern auf die Zukunft. Eine Prognose ist also eine Einschätzung zukünftiger Sachverhalte103. Aber auch Prognosen sind dem Wahrheitsbeweis zugänglich und können sich in der Zukunft als richtig oder falsch herausstellen104. Der Begriff der Beweislast wird hier nicht streng im zivilprozessualen Sinn verstanden. Vielmehr geht es um die Frage, wer die Tatsachen, Prognosen oder Wertungen nachzuweisen hat, die belegen können, ob ein Gesetz verhältnismäßig ist105. Sofern das Bundesverfassungsgericht nicht selbst Tatsachen erhebt (wie im Falle einer inhaltlich intensivierten Kontrolle), kommen nur der Gesetzgeber einerseits und derjenige, der sich gegen das Gesetz wendet (im Falle einer Verfassungsbeschwerde also der Grundrechtsträger) andererseits in Betracht. Die Antwort erscheint zunächst eindeutig: Wenn der Gesetzgeber in Grundrechte eingreift, so ist sein Handeln nur verfassungsgemäß, wenn es verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Denn das System der Freiheitsrechte beruht darauf, dass „die Freiheit des Einzelnen prinzipiell unbegrenzt, während die Befugnis des Staates zu Eingriffen in diese Sphäre prinzipiell begrenzt ist“106. „Hier also die ursprunghafte, nicht rechtKlaus Jürgen Philippi, Tatsachenfeststellungen, S. 4. Fritz Ossenbühl, FG-25 Jahre BVerfG, Bd. I, S. 458 (466). 101 Fritz Ossenbühl, FG-25 Jahre BVerfG, Bd. I, S. 458 (466). 102 Bernhard Schlink, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 445 (455). 103 Christoph Gusy, Gesetzgeber, S. 173; Fritz Ossenbühl, FG-25 Jahre BVerfG, Bd. I, S. 458 (467). 104 Bernhard Schlink, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 445 (455). 105 Siehe hierzu auch Rüdiger Breuer, Der Staat 16 (1977), S. 21 (37). 106 Carl Schmitt, Verfassungslehre, S. 126 – Hervorhebung im Original. 99
100
140
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
fertigungsbedürftige, grundsätzlich umfassende Freiheit des Individuums – dort die notwendig rechtlich gebundene und beschränkte, auf Rechtfertigung verwiesene Staatsgewalt.“107 Demnach muss der Staat nachweisen, dass der Eingriff gerechtfertigt108, also insbesondere auch verhältnismäßig ist; zumindest gehen Zweifel hierbei zu seinen Lasten109. Auch das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, dass Unklarheiten in der Bewertung von Tatsachen zumindest bei schwerwiegenden Eingriffen zu Lasten des Staates gehen müssten110. Diese scheinbar einfache Antwort wird jedoch durch die Einräumung der unterschiedlichen Spielräume relativiert. So führt Schlink aus, dass bei der Legitimität des Zweckes eine Vermutung für die Rechtmäßigkeit des gewählten Zweckes spreche111. Unter Kontrolldichte wird verstanden, wie intensiv das Bundesverfassungsgericht gesetzgeberische Entscheidungen nachprüfen und inwieweit gegebenenfalls eigene Sachverhalts- und Tatsachenaufklärung betreiben und seine Erkenntnisse an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers stellen darf. Dem entspricht spiegelbildlich der Spielraum des Gesetzgebers (Einschätzungsprärogative). Ist er weit, kann das Bundesverfassungsgericht nur eingeschränkt überprüfen, ist er hingegen eng, kann das Bundesverfassungsgericht umfassender nachprüfen. Es handelt sich also um dasselbe Phänomen, das aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wird. Mit anderen Worten, der Spielraum des Gesetzgebers entspricht der abgestuften Kontrollmöglichkeit des Gerichts112. Im Folgenden wird von zwei Prämissen ausgegangen: Erstens, dass die Tatsachenfeststellung und –überprüfbarkeit durch das Bundesverfassungsgericht von der Institutionsgarantie der Verfassungsgerichtsbarkeit eingeschlossen ist113 und zweitens, dass das Bundesverfassungsgericht diesen Aufgaben (mindestens) in demselben Maße gewachsen ist wie der Gesetzgeber114.
2. Die unterschiedlichen Kontrolldichten Dass dem Gesetzgeber bei unterschiedlichen Grundgesetzbestimmungen unterschiedliche Spielräume zustehen können, ist leicht einsichtig. Es fragt sich jedoch, weshalb bei ein und derselben Norm unterschiedliche Kontrolldichten bestehen 107 Josef Isensee, HdBStR V, § 111 Rn. 7. So auch Matthias Cornils, Grundrechte, S. 36 f. Diese Sichtweise ablehnend Peter Häberle, Wesensgehaltgarantie, S. 222 ff., insbes. Fn. 536. 108 Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 331. 109 So auch Bernhard Schlink, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 445 (454). 110 BVerfGE 45, 187 (238). 111 Bernhard Schlink, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 445 (450). 112 BVerfGE 88, 87 (96); 91, 346 (363); 91, 389 (401). 113 Horst Ehmke, VVDStRL 20 (1963), S. 53 (95 f.); Fritz Ossenbühl, FG-25 Jahre BVerfG, Bd. I, S. 458 (467) m. w. N. 114 Davon gehen auch aus Christoph Gusy, Gesetzgeber, S. 165; Fritz Ossenbühl, FG-25 Jahre BVerfG, Bd. I, S. 458 (467); Klaus Jürgen Philippi, Tatsachenfeststellungen, S. 167 f.
C. Kritik und eigener Vorschlag
141
sollen115. Warum sollte nur eine Evidenzkontrolle vorgenommen werden und die Verfassungswidrigkeit einer Maßnahme folgenlos bleiben, obwohl eine intensivere Kontrolle, welche die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes belegen könnte, möglich wäre116? Einziger Grund dürfte demnach die tatsächliche Schwierigkeit einer intensivierten Nachprüfung sein117. Wenn dem Bundesverfassungsgericht keine besseren Erkenntnismöglichkeiten zur Verfügung stehen, dann darf und kann es nicht allzu intensiv prüfen. Aber, um seiner Aufgabe als Hüter der Grundrechte gerecht zu werden, müsste das Bundesverfassungsgericht jedes Mal so intensiv wie möglich prüfen118. Es soll jedoch nicht verkannt werden, dass das Bundesverfassungsgericht bei der Vielzahl der Verfahren nicht in jedem Einzelfall in eine vollständige Tatsachenprüfung eintreten kann. Es soll deshalb von den drei im Mitbestimmungsurteil genannten Kontrollmaßstäben ausgegangen werden: Evidenz-, Vertretbarkeits- und intensivierte inhaltliche Kontrolle119.
3. Die Kriterien für die unterschiedlichen Kontrolldichten Stehen die Maßstäbe fest, so bedarf es nun der Kriterien, die entscheiden, wann welcher der Maßstäbe Anwendung findet. In der Entscheidung müssen, will man Transparenz und Rationalität des Entscheidungsprozesses erhöhen, der jeweils angewandte Maßstab und die Erfüllung der ihm zugrundeliegenden Kriterien offen gelegt werden. Eine solche Offenlegung wäre nicht neu. Auf diese Art verfährt das Bundesverfassungsgericht bereits bei der Prüfung des allgemeinen Gleichheitssatzes. Seit der so genannten „Neuen Formel“120 legt das Bundesverfassungsgericht offen, ob es eine Willkürprüfung oder eine strengere inhaltliche Prüfung vornimmt. Bei der Neuen Formel ist das Kriterium, nach dem sich richtet, ob ein strenger oder weiter Maßstab angelegt wird, die Intensität der Ungleichbehandlung für den Betroffenen121. Zur Ermittlung der Intensität der Ungleichbehand-lung werden mehrere Aspekte herangezogen. So wird unterschieden, ob es sich um eine Ungleichbehandlung von Personen oder Sachverhalten handelt122, ob der Betroffene die Ungleichbehandlung durch eigenes Verhalten beeinflussen Zweifel bei Klaus Schlaich, VVDStRL 39 (1981), S. 99 (111 f.). Bedenken auch bei Hans-Peter Schneider, NJW 1980, S. 2103 (2105). 117 Klaus Schlaich / Stefan Korioth, BVerfG, Rn. 527, 537 sehen als einziges Kriterium die Regelungsdichte des Kontrollmaßstabs an. 118 So auch Peter Badura, FS-Fröhler, S. 321 (340). 119 Hans-Peter Schneider, NJW 1980, S. 2103 (2106 ff.) spricht auch Verhaltens-, Verfahrens- und Ergebniskontrolle. 120 BVErfGE 55, 72 (88). Siehe hierzu Josef Franz Lindner, Grundrechtsdogmatik, S. 412 ff.; vgl. auch BVerfGE 107, 133 (141) m. w. N. 121 BVerfGE 88, 87 (96 f.); 89, 15 (22 f.); 95, 267 (316 f.). Aus dem Schrifttum statt vieler Werner Heun, in: Dreier, GG, Bd. 1, Art. 3 Rn. 21 m. w. N. 122 BVerfGE 75, 348 (357); 78, 232 (247); 88, 87 (96). 115 116
142
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
kann123 und ob und inwieweit auch Freiheitsrechte betroffen sind124. Und auch im Mitbestimmungsurteil wurden Maßstäbe für die Prüfung von Freiheitsrechten – zumindest im Ansatz – offen gelegt. Dort wurden als Kriterien genannt der in Rede stehende Sachbereich, die Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden, sowie die Bedeutung der auf dem Spiele stehenden Rechtsgüter125. Das deckt sich mit den Aussagen, die das Bundesverfassungsgericht in Entscheidungen zur Kontrolldichte bei gesetzgeberischen Schutzpflichten getätigt hat126. Was den in Rede stehenden Sachbereich betrifft, so gilt bereits eine früher getroffene Feststellung, dass nämlich eine Regelung mehreren Sachbereichen zugeordnet werden kann. Zum anderen hat das Bundesverfassungsgericht eine Vielzahl von Sachbereichen als besonders wichtig bezeichnet 127. Der betroffene Sachbereich selbst sagt noch nicht allzu viel über das Erfordernis einer strengen oder weiten Prüfung aus. Es gibt gesetzliche Bestimmungen, die dem Strafrecht zuzuordnen sind und dennoch den Bürger nur marginal berühren (z. B. Details aus der Verfahrensordnung), während Berufsausübungsregelungen ihn durchaus existentiell treffen können. Das pauschale Abstellen auf einen Sachbereich kann im Einzelfall durchaus zu falschen Einschätzungen führen, weshalb der Aspekt des „in Rede stehenden Sachbereichs“ nicht überbetont werden sollte. So stellt auch Badura fest: „Das Maß der Justiziabilität und damit der verfassungsgerichtlichen Nachprüfung ist nicht davon abhängig, ob es sich um ein wirtschaftspolitisches Gesetz handelt, sondern wird zuerst dadurch bestimmt, welche Rechte, Freiheiten und Garantien der Verfassung durch das Gesetz berührt werden.“128
Die Möglichkeit, sich ein Urteil zu bilden, ist in starkem Maße vom Einzelfall und dessen Tatsachenmaterial abhängig. Hierbei sollte nicht vorschnell auf eine Unmöglichkeit verfassungsgerichtlicher Kontrolle geschlossen werden. Denn zum einen ist das Bundesverfassungsgericht im Grunde zur Tatsachenfeststellung ebenso geeignet wie der Gesetzgeber129. Zum anderen weisen die Grundrechte in ihrer abwehrrechtlichen Dimension – die bei Eingriffen der vorliegenden Art betroffen ist – eine hohe Regelungsdichte auf, sowohl was den Tatbestand als auch die Rechtsfolgen betrifft130. Somit ist selbst eine strikte Kontrolle grundsätzlich möglich131. Weiterhin müssen zwei Sonderfälle berücksichtigt werden, bei deren Vorliegen sich BVerfGE 88, 87 (96); 97, 169 (181); 99, 367 (388). BVerfGE 74, 9 (24); 88, 87 (96); 91, 346 (363); 99, 367 (388); 107, 133 (141). 125 BVerfGE 50, 290 (332 f.). 126 Z. B. BVerfGE 56, 54 (80 f.); 77, 170 (215). 127 Vgl. oben Drittes Kapitel C. I. 1. 128 Peter Badura, FS-Fröhler, S. 321 (343). So auch Klaus Schlaich / Stefan Korioth, BVerfG, Rn. 537. 129 Siehe den Nachweis in Drittes Kapitel, Fn. 114. 130 Christoph Gusy, Gesetzgeber, S. 146. 131 Christoph Gusy, Gesetzgeber, S. 147. 123 124
C. Kritik und eigener Vorschlag
143
die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers weiter verengt. Die Möglichkeit des Bundesverfassungsgerichts, sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden, ist erhöht, wenn der Gesetzgeber bereits früher eine anderslautende Einschätzung getroffen hat. Dann kann das Bundesverfassungsgericht anhand der früheren und der jetzigen Einschätzung mehrere Informationsquellen nutzen, um sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden. Der zweite Sonderfall liegt dann vor, wenn sich über einen gewissen Zeitraum gesetzgeberische Prognosen nicht bewahrheitet haben. Auch dann ist der gesetzgeberische Spielraum eingeschränkt, denn wenn eine bestimmte Prognose nie eingetreten ist, dann ist es unwahrscheinlicher geworden, dass sich dieselbe Annahme beim nächsten Gesetz als zutreffend herausstellen wird. Dann hat das Gericht die Möglichkeit, sich das hinreichend sichere Urteil zu bilden, dass die Prognose auch diesmal nicht tragfähig sein wird. Anstatt das neue Gesetz als verfassungsgemäß zu akzeptieren, kann es angezeigt sein, den Gesetzgeber an seine Nachbesserungspflicht zu erinnern. Das letzte Kriterium, welches das Bundesverfassungsgericht benannt hat, war die Bedeutung der auf dem Spiele stehenden Rechtsgüter. Als Beispiele für Rechtsgüter, bei denen eine höhere Kontrolldichte nötig sei, wurden das Grundrecht auf Leben sowie die Freiheit der Person genannt132. Diese Argumentation klingt danach, als wolle das Bundesverfassungsgericht auf den Rang des Rechtsguts abstellen. Da es aber keine unterschiedlichen Wertigkeiten der einzelnen Freiheitsrechte gibt133, wäre ein solches Verständnis nicht weiterführend. Anstatt auf den Rang des Rechtsgutes zu rekurrieren, bietet es sich an, darauf abzustellen, wie elementar der Einzelne in seiner Freiheit betroffen ist. Damit ist die Eingriffsintensität gemeint. So ist eindeutig, dass ein Eingriff in das Rechtsgut Leben den Bürger elementar betrifft. Das liegt aber nicht darin begründet, dass Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG einen höheren Wert als Art. 12 Abs. 1 GG aufweist. Vielmehr hat ein Eingriff in das Rechtsgut Leben wegen seiner Endgültigkeit eine andere Qualität. Bei einem minimalen Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit, der so niedrig ist, dass er kaum die Bagatellgrenze überschreitet, um überhaupt von einem Eingriff zu sprechen, ist ebenfalls Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG betroffen. Dieser Eingriff betrifft jedoch den Bürger nicht so intensiv wie eine objektive Berufsausübungsregelung, obwohl in diesem Fall Art. 12 Abs. 1 GG und nicht Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG betroffen ist. Es liegt nahe, auch bei Freiheitsrechten134 bei der Bestimmung des Kontrollmaßstabs hauptsächlich auf die Intensität des Eingriffs abzustellen135. Die Intensität des Eingriffs ist auch an anderer Stelle ein entscheidendes Kriterium: Je nach Intensität des Eingriffs gelten unterschiedliche Rechtfertigungsanforderungen bei der Angemessenheit. Das Bundesverfassungsgericht verlangt, dass der Eingriff „in BVerfGE 50, 290 (333). Siehe oben Drittes Kapitel C. I. 1. mit Nachweisen in Fn. 42, 43. 134 Wie gesehen, wird bei Gleichheitsrechten bereits so verfahren, siehe die Nachweise in Drittes Kapitel, Fn. 121. 135 So auch Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (218); Winfried Kluth, ZHR 162 (1998), S. 657 (664, 680). 132 133
144
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
angemessenem Verhältnis zu dem Gewicht und der Bedeutung des Grundrechts“ steht136, dass „bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht und der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt bleibt“137. Besonders klar tritt dieses Vorgehen bei Art. 12 Abs. 1 GG und der Drei-Stufen-Theorie des Bundesverfassungsgerichts hervor138. Auch das Bundesverfassungsgericht hat ausgeführt, dass Zweifel in der Bewertung von Tatsachen, zumindest bei schweren Grundrechtseingriffen, nicht zu Lasten des Grundrechtsträger gehen dürften139. Hier wird deutlich, dass auch das Bundesverfassungsgericht auf die Intensität des Eingriffs abstellt. Unter dem Begriff der „Intensität“ können mehrere Arten der Betroffenheit zusammengefasst werden. Erstens ist die Betroffenheit umso größer, je mehr Personen betroffen sind (personelle Intensität). Zweitens lässt sich sagen, dass im Allgemeinen die Eingriffsintensität um so höher ist, je mehr Grundrechte betroffen sind (quantitative Intensität). Auch in zeitlicher Hinsicht können Abstufungen bestehen; so ist zum Beispiel ein Gesetz, das für einen begrenzten, kurzen Zeitraum eine Zahlungsverpflichtung statuiert, weniger belastend als ein Gesetz, das dieselbe Zahlungsverpflichtung ohne zeitliche Begrenzung auferlegt (temporale Intensität). Und schließlich kann in dasselbe Grundrecht durch unterschiedliche Maßnahmen unterschiedlich tief eingegriffen werden (qualitative Intensität), wovon auch Art. 19 Abs. 2 GG sowie die Drei-Stufen-Theorie zeugen. Eine unbestrittene Zuordnung wird vielleicht nicht stets möglich sein, jedoch liegen sowohl positive als auch negative Kriterien vor, die die Entscheidung, welcher Maßstab anzuwenden ist, vorstrukturieren und so zu einer möglichst rationalen Entscheidung führen können.
4. Auswirkungen der Kontrolldichte auf die Verhältnismäßigkeitsprüfung a) Die einzelnen Elemente der Verhältnismäßigkeitsprüfung Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, auch Übermaßverbot genannt, hat zentrale Bedeutung bei der Prüfung von Grundrechtsverletzungen140. Unumstritten ist, dass dieser Grundsatz Verfassungsrang hat141, nur die Begründungen142 hierfür BVerfGE 67, 157 (173). BVerfGE 83, 1 (19). Vgl. auch BVerfGE 65, 1 (54); 90, 145 (173); 102, 197 (220). 138 Siehe oben Zweites Kapitel B. II. 2. a). 139 BVerfGE 45, 187 (238). 140 Vgl. aus der umfangreichen Literatur nur Roman Herzog, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 20 VII Rn. 71 ff. (Stand der Bearbeitung: 1980); Bernhard Schlink, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 445 ff.; Klaus Stern, FS-Lerche, S. 165. Kritisch Fritz Ossenbühl, VVDStRL 39 (1981), S. 189 (Diskussionsbeitrag) – „der große Gleich- und Weichmacher“. 141 BVerfGE 23, 127 (133); 103, 332 (366 f.); Fritz Ossenbühl, FS-Lerche, S. 151 (153). 142 Siehe hierzu Andreas von Arnauld, JZ 2000, S. 276 ff. 136 137
C. Kritik und eigener Vorschlag
145
differieren: Als verfassungsrechtlicher Sitz werden sowohl die Grundrechte143, als auch das Rechtsstaatsprinzip144 angesehen, als auch die Grundrechte in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip145 als auch Art. 19 Abs. 2 GG146. Da die unterschiedlichen Auffassungen nur relevant werden, wenn es um die Frage geht, ob der Grundsatz auch im Staat-Staat-Verhältnis gilt147 und diese Frage durch den Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung nicht aufgeworfen wird, kann für den vorliegenden Zweck offen bleiben, welche Verfassungsbestimmung Sitz des Übermaßverbots ist. Seiner Struktur nach besteht der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz aus fünf Prüfungspunkten. Eine Regelung ist nur dann verhältnismäßig, wenn sie erstens einen legitimen Zweck verfolgt, zweitens wenn ein legitimes Mittel verwendet wird, drittens wenn die Regelung zur Zweckerreichung geeignet, viertens erforderlich und fünftens angemessen (auch zumutbar oder verhältnismäßig im engeren Sinne) ist148. Allen Entscheidungen, die zum Grundsatz der finanziellen Stabilität ergingen, ist der legitime Zweck gemeinsam. Der Grundsatz der finanziellen Stabilität war der vom Gesetzgeber verfolgte Zweck bei den Eingriffen in die Grundrechte unter anderem von (Zahn-)Ärzten, Versicherten, Apothekern, Versicherungsunternehmern sowie Pharmaunternehmern. aa) Legitimer Zweck Ob der mit dem Eingriff verfolgte Zweck legitim ist, hängt entscheidend davon ab, wer ihn verfolgt149: die Verwaltung ist aufgrund von Art. 20 Abs. 3 GG an die Gesetze gebunden. Ihre Freiheit, bestimmte Zwecke zu verfolgen, wird also nicht nur durch das Grundgesetz, sondern auch durch die sogenannten einfachen Gesetze eingeschränkt. Der Gesetzgeber hingegen ist im Hinblick auf das innerstaatliche Recht nur an das Grundgesetz gebunden und somit freier in seiner Zwecksetzung. Da der Grundsatz der finanziellen Stabilität bei der Frage relevant wurde, ob ein Gesetz verfassungsgemäß ist, wird im folgenden ausschließlich die Verhältnismäßigkeit von Gesetzen thematisiert. Der Gesetzgeber verfolgt einen legitimen Zweck, wenn ihm ein bestimmter Zweck nicht von Verfassungs wegen verboten ist150. Ein solcher von Verfassungs 143 BVerfGE 65, 1 (44); Philip Kunig, Rechtsstaatsprinzip, S. 354; Bernhard Schlink, EuGRZ 1984, S. 457 (459 f.); Friedrich E. Schnapp, JuS 1983, S. 850 (852 f.). 144 BVerfGE 69, 1 (35); 76, 256 (359); 80, 109 (119 f.); BSGE 59, 276 (278); Roman Herzog, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 20 VII Rn. 71 ff. (Stand der Bearbeitung: 1980). 145 BVerfGE 19, 342 (348 f.); 61, 126 (134); Hans D. Jarass, in: Jarass / Pieroth, GG, Art. 20 Rn. 80. 146 BGHSt 4, 375 (376 f.); Günter Dürig, AöR 81 (1956), S. 117 (146 f.); Hans-Uwe Erichsen, Jura 1988, S. 387 (388); Rupprecht von Krauss, Verhältnismäßigkeit, S. 50 f. 147 Vgl. Bernhard Schlink, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 445 (447 ff.). 148 Bodo Pieroth / Bernhard Schlink, Grundrechte, Rn. 279 und 289 ff. 149 Bodo Pieroth / Bernhard Schlink, Grundrechte, Rn. 280. 150 Helge Sodan / Jan Ziekow Öffentliches Recht, § 24 Rn. 33.
10 Schaks
146
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
wegen verbotener Zweck wäre zum Beispiel die Schlechterstellung der in Art. 3 Abs. 3 GG genannten Personen. Denn aus Art. 3 Abs. 3 GG ergibt sich gerade, dass diese Personengruppen nicht anders behandelt werden dürfen als andere Personengruppen. Insgesamt enthält das Grundgesetz jedoch wenige Verbote, so dass dem Gesetzgeber eine weite Freiheit der Zweckwahl zusteht. Er ist nicht darauf angewiesen, nur die bereits vom Grundgesetz vorgegebenen Zwecke zu verfolgen, sondern kann eigene schaffen, so lange ein Zweck nicht verfassungsrechtlich verboten ist. Diese Frage ist eine reine Rechtsfrage, so dass es auf Tatsachenerhebungen und Prognosen nicht ankommt151. bb) Legitimes Mittel Wie bei der Zweckwahl hat der Gesetzgeber auch bei der Wahl seiner Mittel eine große Freiheit. Verwehrt ist ihm, verfassungsrechtlich verbotene Mittel einzusetzen152. Ein solches wäre unter anderem – nach dem ausdrücklichen Verbot in Art. 102 GG – die Todesstrafe. Während der legitime Zweck der Grundsatz der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung ist, welcher die gemeinsame Verbindung des vorliegenden Entscheidungsmaterials darstellt, sind die Mittel zur Zweckerreichung in den einzelnen Entscheidungen jeweils unterschiedlich. Unter dem Mittel werden im vorliegenden Zusammenhang die einzelnen Steuerungsmechanismen verstanden, mit Hilfe derer der legitime Zweck erreicht werden soll. Als Beispiel sei an dieser Stelle die Altersgrenze von 68 Jahren erwähnt153. Ausdrücklich problematisiert hat das Bundesverfassungsgericht die Legitimität des Mittels nicht. Da aber bislang alle Gesetze für verfassungsgemäß gehalten wurden154, wurde damit auch stets die Legitimität des gewählten Mittels bejaht. Im Schrifttum wurden hingegen Zweifel an der Legitimität mancher Mittel geäußert155. cc) Geeignetheit Unter dem Begriff der Eignung oder Geeignetheit versteht man die Tauglichkeit des gewählten Mittels, den gewählten Zweck zu fördern156. Nach ständiger RechtChristoph Gusy, Gesetzgeber, S. 167. Bodo Pieroth / Bernhard Schlink, Grundrechte, Rn. 280. 153 Siehe hierzu BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1998, S. 1776 ff. 154 Eine Ausnahme insoweit BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 1781 f. Hier war die angegriffene Regelung nicht angemessen, was dennoch nicht zur Annahme der Verfassungsbeschwerde führte. 155 Winfried Boecken, FS-Brohm, S. 231 (241 f.) wirft die Frage auf, inwieweit es sich bei der Altersgrenzen von 68 Jahren um Altersdiskriminierung handelt. Ders., NZS 2005, S. 393 ff. 156 BVerfGE 30, 292 (316); 33, 171 (187); 90, 145 (172). 151 152
C. Kritik und eigener Vorschlag
147
sprechung des Bundesverfassungsgerichts muss die gewählte Regelung nicht die geeignetste oder tauglichste sein; es genügt, dass das gewählte Mittel zumindest teilweise zur Zweckerreichung beiträgt oder beitragen kann157. Dies führt zu einer Relativierung des Merkmals. Denn in der Regel lassen sich mehrere Mittel zur Zielerreichung vorstellen. Nur völlig ungeeignete Mittel werden deshalb bereits auf dieser Prüfungsstufe ausgeschlossen. In den Entscheidungen, in denen der Grundsatz der Funktionsfähigkeit herangezogen wurde, hatte das Bundesverfassungsgericht keinen Zweifel an der Eignung der jeweils in Rede stehenden Regelung. An dieser Stelle – wie auch bei den folgenden Punkten der Erforderlichkeit und Angemessenheit – stellen sich die Probleme des Einschätzungsspielraums des Gesetzgebers, der Kontrolldichte des Bundesverfassungsgerichts und der Beweislast, denn hier geht es nicht mehr nur um die Beantwortung reiner Rechtsfragen. Vielmehr werden hier die Probleme der richtigen Ermittlung und Beurteilung des Tatsachenmaterials virulent. dd) Erforderlichkeit Das Gebot der Erforderlichkeit verlangt, dass der Gesetzgeber unter mehreren gleich geeigneten Mitteln, dasjenige wählt, das den Bürger am wenigsten belastet158. Eine Pflicht, weniger belastende Maßnahmen zu ergreifen, besteht also dann nicht, wenn die milderen Mittel weniger effektiv sind, sie das verfolgte Ziel nur in schwächerem Maße fördern können. Außerdem ist Voraussetzung, dass das mildere Mittel nicht Dritte oder die Allgemeinheit stärker belastet159. ee) Angemessenheit Statt von Angemessenheit ist auch von Zumutbarkeit oder Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne die Rede. Das Bundesverfassungsgericht verlangt, dass der Eingriff „in angemessenem Verhältnis zu dem Gewicht und der Bedeutung des Grundrechts“ steht160 oder „dass bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht und der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt bleibt“161. Abgesehen von einem einzigen Beschluss162 hat das Bundesverfassungsgericht stets die Grenze der Zumutbarkeit als gewahrt angesehen. 157 BVerfGE 67, 157 (175); 96, 10 (23); Michael Sachs, in: Sachs, GG, Art. 20 Rn. 150; Helmuth Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, Bd. 2, Art. 20 (Rechtsstaat) Rn. 182; Klaus Stern, Staatsrecht III / 2, S. 776 f. 158 BVerfGE 67, 157 (176); 90, 145 (172); 105, 17 (36). 159 Hans D. Jarass, in: Jarass / Pieroth, GG, Art. 20 Rn. 85; Gerrit Manssen, Grundrechte, Rn. 188. 160 BVerfGE 67, 157 (173). 161 BVerfGE 83, 1 (19). Ähnlich BVerfGE 90, 145 (173); 102, 197 (220). 162 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 1781 f.
10*
148
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
b) Die Auswirkung des Kontrollmaßstabs auf die Verhältnismäßigkeitsprüfung An dieser Stelle müssen nun nicht nur die Konsequenzen aus den Ausführungen zur Kontrolldichte gezogen werden, sondern mehrere Rechtsprechungsansätze des Bundesverfassungsgerichts miteinander in Einklang gebracht werden, namentlich die Drei-Stufen-Theorie zu Art. 12 Abs. 1 GG sowie allgemeine Verhältnismäßigkeitserwägungen. Zuvor wurde ermittelt, dass die Eingriffsintensität als wichtigstes Kriterium für die Kontrolldichte von besonderer Bedeutung ist. Da sich auch die Drei-StufenTheorie an der Eingriffsintensität orientiert und sie eine spezielle Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes darstellt163, bietet es sich an, die Drei-StufenTheorie als Grundlage der folgenden Überlegungen zu nehmen. Die Ausführungen zum legitimen Zweck, zur Eignung, Erforderlichkeit, Angemessenheit sowie zur Kontrolldichte werden für die drei Stufen von möglichen Eingriffen in die Berufsfreiheit getrennt dargestellt. aa) Berufsausübungsregelungen Aufgrund der Drei-Stufen-Theorie ist der legitime Zweck, der Eingriffe in Art. 12 Abs. 1 GG legitimiert, bereits vorgegeben. Vernünftige Erwägungen des Allgemeinwohls müssen die Regelung zweckmäßig erscheinen lassen164. Die legitimen Zwecke sind also sehr weit gefasst, es scheiden nur verfassungswidrige Zwecke aus. Gleiches gilt für die Mittel zur Zweckverfolgung. Bezüglich der übrigen Prüfungspunkte des Übermaßverbotes (Eignung, Erforderlichkeit, Angemessenheit) gilt folgendes: Da Berufsausübungsregelungen diejenigen Beeinträchtigungen sind, die Art. 12 Abs. 1 GG am wenigsten intensiv berühren, dürfte in der Regel nur eine Evidenz- oder Vertretbarkeitskontrolle in Betracht kommen. Dies entspricht auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach sozialpolitische Maßnahmen nicht intensiv überprüft werden165, was sich jedoch nur auf Berufsausübungsregelungen bezog166. Zwar bestehen auch Berufsausübungsregelungen, die in ihren belastenden Wirkungen Berufswahlregelungen nahe kommen, aber diese werden nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wie Berufswahlregelungen behandelt167. Sie müssen also die strengeren Anforderungen erfüllen, weshalb sie nicht der Kontrolldichte von schlichten Berufsausübungsregelungen unterfallen. 163 Hans-Wolfgang Arndt, Wirtschaftsverwaltungsrecht, S. 875 (891); Peter Häberle, Wesensgehaltgarantie, S. 67 f.; Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 314. 164 Siehe oben Zweites Kapitel B. II. 2. a). 165 BVerfGE 30, 250 (263); 37, 1 (20); 39, 210 (225); 77, 308 (332). 166 Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (206). 167 BVerfGE 11, 30 (42 ff.); 12, 144 (148).
C. Kritik und eigener Vorschlag
149
Auch wenn die Zuordnung einer Regelung zu einer Stufe der Drei-Stufen-Theorie und die Kontrolldichte in der Regel übereinstimmen (mit Ausnahme der soeben genannten besonders intensiven Berufsausübungsregelungen)168, kann es zu einer weiteren Ausnahme kommen. Denn auch wenn eine Berufsausübungsregelung alleine nicht besonders belastend ist, so kann sie doch in Verbindung mit anderen, bereits bestehenden Regelungen Art. 12 Abs. 1 GG intensiv beeinträchtigen (kumulierender / additiver Grundrechtseingriff). Wegen der höheren Eingriffsintensität der kumulierenden Beeinträchtigungen 169 muss auch intensiver kontrolliert werden. Zwar reichen nach wie vor vernünftige Erwägungen des Allgemeinwohls aus, um eine derartige Maßnahme zu legitimieren, doch dafür steigt die Kontrolldichte. Somit kann unter Umständen nicht nur eine Evidenz-, sondern sogar eine intensivierte inhaltliche Kontrolle geboten sein. Auf diese Weise ließe sich eine verbesserte Kontrolle additiver / kumulierender Eingriffe erreichen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die bislang ergriffenen Maßnahmen sich nicht als besonders wirkungsvoll erwiesen haben170. bb) Subjektive Berufswahlregelungen Subjektive Berufswahlregelungen sind nur zum Schutze überragender Gemeinschaftsgüter, die der Freiheit des Einzelnen vorgehen, zulässig171. Hierdurch wird der Kreis legitimer Zwecke, die einen Eingriff in Art. 12 Abs. 1 GG rechtfertigen, begrenzt. Es genügt nicht mehr, auf die Vernünftigkeit einer Erwägung zu verweisen, vielmehr muss der Zweck eine gesteigerte Wertigkeit aufweisen, auch wenn nicht der Verfassungsrang des Zwecks gefordert werden kann172. Erkennt man an, dass der Grundsatz der finanziellen Stabilität keinen Verfassungsrang hat, dass es sich nur um eine finanzielle Erwägung handelt, so muss seine rechtfertigende Kraft als gering angesehen werden. Zwar können auch solche Zwecke, die der Gesetzgeber sich selber vorgibt, subjektive Berufswahlregelungen rechtfertigen, es muss sich nicht um absolute Gemeinwohlbelange handeln. Aber rein finanzielle Erwägungen haben die niedrigste rechtfertigende Kraft, so dass sie nicht die Wichtigkeit erreichen, um von einem überragenden Gemeinschaftsgut sprechen zu können. Somit dürften subjektive Berufswahlregelungen in aller Regel nicht durch den Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung gerechtfertigt werden. Auf den Ebenen der Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit wird in der Regel eine Vertretbarkeitskontrolle angezeigt sein. Ausnahmen könnten dann So auch Peter M. Huber, FS-Kriele, S. 389 (399). Jörg Lücke, DVBl. 2001, S. 1469 (1476). 170 Wie es das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung zur Altersgrenze von 55 Jahren konzediert, BVerfGE 103, 172 (189). 171 BVerfGE 7, 377 (406). 172 Siehe oben Zweites Kapitel B. II. 1. – 3. 168 169
150
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
gemacht werden, wenn die Anforderungen an die Berufswahl so niedrig sind, dass sie von der weiten Mehrheit der betroffenen Grundrechtsträger unproblematisch erfüllt werden. In einem solchen Falle könnte auch eine Evidenzkontrolle ausreichend sein. Jedoch werden solche subjektiven Berufswahlregelungen selten sein, da von diesen kaum eine Wirkung ausgehen dürfte, wenn sie unproblematisch erfüllt werden können. Sie dürften dann jedoch vermutlich ungeeignet sein. Andererseits kann im Falle kumulierender / additiver Grundrechtseingriffe auch eine intensivierte inhaltliche Kontrolle geboten sein. cc) Objektive Berufswahlregelungen Nur Gemeinschaftsgüter von Verfassungsrang sind überragend wichtige Gemeinschaftsgüter, die auch objektive Berufswahlregelungen rechtfertigen können173. Der Grundsatz der finanziellen Stabilität hat keinen Verfassungsrang und kann somit objektive Berufswahlregelungen nicht rechtfertigen. Auf Grund der hohen Intensität, mit der in das Grundrecht der Berufsfreiheit eingegriffen wird, muss bei der Überprüfung von Berufswahlregelungen ein strenger Kontrollmaßstab angelegt werden174, weshalb in aller Regel nur die intensivierte inhaltliche Kontrolle als Kontrollmaßstab in Betracht kommt, vor allem wenn zusätzlich noch kumulierende / additive Grundrechtseingriffe in Rede stehen oder wenn widersprüchliche oder nicht eingetretene Einschätzungen des Gesetzgebers in der Vergangenheit vorliegen. Aus der Drei-Stufen-Theorie ergibt sich insbesondere für die Punkte Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit eine weitere Besonderheit. Das Bundesverfassungsgericht vertritt die Auffassung, dass objektive Berufswahlregelungen nur zulässig seien zur „Abwehr nachweisbarer oder höchstwahrscheinlicher schwerer Gefahren für ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut“175. Die Gefahr, der durch die ergriffene Maßnahme begegnet werden soll, muss also nachweisbar oder zumindest höchstwahrscheinlich sein. Damit ist die Problematik der „Beweislast“ angesprochen. Es fragt sich, wer diese Gefahr nachweisen muss. Da durch objektive Berufswahlregelungen in schwerwiegender Weise in Art. 12 Abs. 1 GG eingegriffen wird, ist die Antwort schnell gefunden: Die hohen Anforderungen der 3. Stufe sollen dem Schutz des Bürgers dienen. Die Erreichung dieses Ziels ist nur dann gewährleistet, wenn der Gesetzgeber die drohende Gefahr nicht nur behaupten, sondern nachweisen muss. Somit trägt der Gesetzgeber die „Beweislast“176. Siehe oben Zweites Kapitel B. II. 2. So auch in den Entscheidungen BVerfGE 7, 377 ff.; 11, 30 ff.; 12, 144 ff. 175 BVerfGE 7, 377 (408). Vgl. auch BVerfGE 21, 245 (251); 25, 1 (16). 176 Vgl. Winfried Boecken, FS-Brohm, S. 231 (240 f.); Görg Haverkate, DVBl. 2004, S. 1061 (1063 f.); Hans-Jürgen Papier, FS-Stern, S. 543 (554); Bernhard Schlink, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 445 (454); Rupert Scholz, in: Maunz / Dürig, GG, Art. 12 Rn. 337 (Stand der Bearbeitung: Juni 2006). Siehe auch BVerfGE 45, 187 (238). 173 174
C. Kritik und eigener Vorschlag
151
Er muss darlegen können, dass er ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut schützen will, dass dieses Gemeinschaftsgut nachweisbar / höchstwahrscheinlich gefährdet ist, dass die intendierte Maßnahme geeignet ist, der Gefahr zu begegnen, dass keine milderen, aber gleich effektiven Mittel zur Gefahrenabwehr zur Verfügung stehen und schließlich, dass die Schwere des Eingriffs in einem angemessenen Verhältnis zum Gewicht und zur Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe steht. 5. Anwendung dieser Grundsätze auf die Entscheidungen zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung Im Folgenden sollen anhand der ermittelten Ergebnisse einige ausgewählte Entscheidungen überprüft werden.
a) Der Beschluss zur Altersgrenze von 68 Jahren aa) Die gesetzliche Regelung Durch § 95 Abs. 7 Satz 3 SGB V177 wurde erstmals gesetzlich geregelt, dass ein Vertrags(zahn)arzt am Ende des Kalendervierteljahres, in dem er sein 68. Lebensjahr vollendet, aus der vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung ausscheidet. Der Gesetzgeber begründete diese Maßnahme damit, dass die (vermeintliche) (zahn)ärztliche Überversorgung nicht alleine zu Lasten der jüngeren (Zahn-)Ärzte gehen dürfe178. bb) Die Ansicht des Bundesverfassungsgerichts In dem hierzu ergangenen Beschluss vom 31. 03. 1998 hat die 1. Kammer des Zweiten Senats entschieden, dass die Altersgrenze von 68 Jahren für die Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung (§ 95 Abs. 7 Satz 3 SGB V) mit dem Grundgesetz vereinbar sei179. Dabei geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, dass die Altersgrenze eine subjektive Zulassungsbeschränkung darstelle180. Als besonders wichtiges Gemeinschaftsgut, das die Regelung rechtfertigt, wird die Finanzierbarkeit der gesetzlichen Krankenkasse angesprochen. Jedoch hatte das Bundesverfassungsgericht 177 Eingeführt durch das GSG vom 21. 12. 1992, BGBl. I, S. 2266 (2280 f.). Siehe auch die Änderung durch Art. 1 Nr. 5 e) bb) VÄndG vom 22. 12. 2006 – BGBl. I, S. 3439 (3441), welche die Altersgrenze in unterversorgten Gebieten aufhebt. 178 BT-Drucks. 12 / 3608, S. 93. 179 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1998, S. 1776 ff. 180 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1998, S. 1776 (1777).
152
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
Zweifel, ob dieser fiskalische Belang die Regelung rechtfertigen könne. Es hat deshalb nicht auf diesen Belang abgestellt. Statt dessen rechtfertigt das Bundesverfassungsgericht das Gesetz mit der Begründung, dass die Lebenserfahrung zeige, dass die Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Alter abnehme181. Von nicht mehr voll leistungsfähigen (Zahn-)Ärzten gingen Gefahren für die Gesundheit der Versicherten aus. Im übrigen sei die Regelung verhältnismäßig. Eine Eignungsprüfung wäre bürokratischer und weniger wirksam. Außerdem sei die Altersgrenze sehr hoch angesetzt, höher zum Beispiel als in anderen Berufen. cc) Eigene Ansicht Wie gesehen, stellt die finanzielle Stabilität bzw. Finanzierbarkeit der gesetzlichen Krankenversicherung kein besonders wichtiges Gemeinschaftsgut dar, welches Berufszulassungsregelungen, weder objektive noch subjektive, rechtfertigen kann. Das Gericht hätte diesen Punkt deshalb nicht offen lassen müssen, sondern hatte Gelegenheit klarzustellen, dass die rechtfertigende Kraft des Grundsatzes der finanziellen Stabilität nur schwach ist. Anstatt auf die finanzielle Stabilität abzustellen, wie es der Gesetzgeber getan hat, greift das Bundesverfassungsgericht auf Aspekte des Gesundheitsschutzes zurück. Bereits an diesem Austauschen der Begründung wurde Kritik geäußert, da der Gesetzgeber zu keinem Zeitpunkt des Gesetzgebungsverfahrens auf diesen Aspekt hingewiesen hat182. Diese scheinbare „Rettung“ des Gesetzes erkauft sich das Bundesverfassungsgericht mit einem Folgeproblem. Gehen von über 68-jährigen Ärzten Gefahren für die Bevölkerung aus, so fragt sich, weshalb Ärzte, die älter als 68 Jahre sind, noch Privatpatienten oder Kassenpatienten, die die Kosten der Behandlung selber tragen, behandeln dürfen. Dabei konnte das Gericht nicht behaupten, zwischen Ärzten, die ausschließlich Privatpatienten behandeln und solchen, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, bestehe insofern ein Unterschied, als Vertragsärzte mit ihrer ganzen Arbeitskraft den Versicherten zur Verfügung stehen müssten. Denn dies ist nicht der Fall, da auch Vertrags(zahn)ärzte Nebentätigkeiten ausüben dürfen und das Bundessozialgericht ausdrücklich festgehalten hat, dass ein Vertragsarzt nicht mit der gesamten Arbeitskraft den Versicherten zur Verfügung stehen müsse183. Der Schopf, an dem sich die Erste Kammer aus dem selbst bereiteten Sumpf ziehen will, lautet nun: Ärzte, die jünger als 68 Jahre seien, würden „eine rasche und sichere Heilung der Versicherten“ bewerkstelligen können. Dem liegt wohl die Vorstellung zu Grunde, dass ein Arzt mit Vollendung des 68. Lebensjahres Patienten nicht mehr rasch und sicher heilen könne. Dann stellt sich aber erneut die Frage, weshalb Privatpatienten von älteren Ärzten behandelt und damit langsamer und weniger sicher geheilt werden dürfen. 181 182 183
BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1998, S. 1776 (1777). Rainald Maaß, NJW 1998, S. 3390 (3392); Helge Sodan, NJW 2003, S. 257 (258). BSG, NJW 1998, S. 3442 (3444).
C. Kritik und eigener Vorschlag
153
Schließlich heißt es, die „rasche und sichere Heilung der Versicherten“ würde zu einer effektiven Verwendung der Krankenversicherungsbeiträge führen184. Damit wäre man aber wieder bei finanziellen Erwägungen angelangt, die nur eine geringe rechtfertigende Kraft aufweisen. Im übrigen können sich die Versicherten auf Grund der Möglichkeit der Arztwahl (vgl. § 76 Abs. 1 Satz 1 SGB V) von dem Arzt behandeln lassen, den sie für leistungsfähig halten, so dass ein Schutz der Versicherten vor sich selbst nicht nötig ist185. Weder im Ergebnis, noch in der Begründung kann dieser Beschluss deshalb überzeugen186. Diese stark kritisierte Entscheidung wird im Schrifttum auch als „satirereif“ und „Demenzbeschluss“ bezeichnet187. b) Der Beschluss zur Altersgrenze von 55 Jahren aa) Die gesetzliche Regelung § 98 Abs. 2 Nr. 12 SGB V188 und § 25 Ärzte-ZV189 bzw. § 25 Zahnärzte-ZV190 regeln, dass (Zahn-)Ärzte, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, nicht mehr neu zur vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung zugelassen werden dürfen. Eine Ausnahme kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht. Hintergrund der Regelung ist, dass Vertrags(zahn)ärzte, die erst nach Vollendung des 55. Lebensjahres erstmals zur vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung zugelassen werden, nur noch wenige Jahre im Berufsleben stehen. In dieser Zeit müssten sie die Investitionskosten für die Praxis erwirtschaften. Bei diesen Ärzten sei deshalb der Kostendruck und damit die Gefahr unwirtschaftlichen Verhaltens besonders hoch, was ihren Ausschluss aus der vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung rechtfertige191. bb) Die Ansicht des Bundesverfassungsgerichts In dem Beschluss über die Zulässigkeit des Ausschlusses von Ärzten nach Vollendung des 55. Lebensjahres von der vertragsärztlichen Versorgung192 hielt das BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 1998, S. 1776 (1778). Ulrich Becker, NZS 1999, S. 521 (525). 186 Statt vieler Friedhelm Hufen, NJW 2004, S. 14 (17 mit Fn. 62). 187 Rainald Maaß, NJW 1998, S. 3390 (3392); ders., NJW 1999, S. 3377 (3381). 188 Eingeführt durch das GRG vom 20. 12. 1988, BGBl. I, S. 2477 (2507). Siehe auch die Aufhebung durch Art. 1 Nr. 6 b) VÄndG vom 22. 12. 2006 – BGBl. I, S. 3439 (3441). 189 Zulassungsverordnung für Vertragsärzte eingeführt durch das GRG vom 20. 12. 1988, BGBl. I, S. 2477 (2573) – damals noch unter dem Namen Zulassungsordnung für Kassenärzte. 190 Zulassungsverordnung für Vertragzahnsärzte eingeführt durch das GRG vom 20. 12. 1988, BGBl. I, S. 2477 (2575) – damals noch unter dem Namen Zulassungsordnung für Kassenzahnärzte. 191 Siehe BT-Drucks. 11 / 2237, S. 195. 192 BVerfGE 103, 172 ff. 184 185
154
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
Bundesverfassungsgericht die angegriffene Regelung für verfassungsgemäß. Es ging davon aus, dass der Eingriff in die Berufsfreiheit keiner der drei Stufen der Drei-Stufen-Theorie zugeordnet werden müsse. Denn selbst wenn die Anforderungen an objektive Berufszulassungsregelungen erfüllt sein müssten, lägen diese Voraussetzungen vor193, da der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung überragend wichtig sei. Das Bundesverfassungsgericht billigt die gesetzgeberische Konzeption, dass die betroffenen Ärzte unter dem Druck stünden, in kurzer Zeit die Praxiskosten zu erwirtschaften194. Im übrigen sei die Regelung auch verhältnismäßig. Denn die Altersgrenze greife erst, wenn bereits ein bedeutender Teil des Berufslebens absolviert sei195. Hierauf könnten sich die (Zahn-)Ärzte einstellen, indem sie sich zu einem früheren Zeitpunkt um einen Vertrags(zahn)arztsitz bewürben. cc) Eigene Ansicht Erkennt man an, dass der Grundsatz der finanziellen Stabilität keinen Verfassungsrang hat, kann diese Auffassung nicht überzeugen. Denn nur absolute Gemeinwohlbelange (Güter von Verfassungsrang) sind überragend wichtige Gemeinschaftsgüter, die objektive Berufswahlregelungen rechtfertigen können. Dies ist bei dem Grundsatz der finanziellen Stabilität nicht der Fall: es handelt sich lediglich um einen rein finanziellen Belang mit geringer rechtfertigender Kraft. Das Bundesverfassungsgericht hätte die angegriffene Regelung somit einer der drei Stufen zuordnen müssen. Und nur, wenn es sich um eine reine Berufsausübungsregelung, die in ihren Auswirkungen einer Berufswahlregelung nicht nahe kommt, hätte sie durch den Grundsatz der finanziellen Stabilität gerechtfertigt werden können. Dies ist aber nicht der Fall. Davon, dass es sich um eine schlichte Berufsausübungsregelung handelt, ist aber das Bundesverfassungsgericht selber nicht überzeugt, denn sonst hätte es die Frage nicht offen lassen müssen. Somit hätte die verfassungsrechtliche Prüfung an dieser Stelle beendet sein müssen, da die Voraussetzungen der Drei-Stufen-Theorie nicht erfüllt sind, die Regelung also nicht als verfassungsgemäß hätte angesehen werden dürfen. Auch in dieser Entscheidung zeigt sich ein eklatanter Widerspruch. In dem vermeintlichen Bestreben, die 55-Jahre-Grenze verfassungsgemäß zu gestalten, hat der Gesetzgeber zugleich eine Härtefallregelung getroffen (§ 98 Abs. 2 Nr. 12 a. E. SGB V a. F.). Da der Zweck der 55-Jahre-Grenze jedoch ist, unwirtschaftliches Verhalten von Vertrags(zahn)ärzten, die unter hohem finanziellen Druck stehen, zu verhindern, gestattet die Härtefallregelung, dass gerade diejenigen zur Versorgung zugelassen werden, bei denen die Wahrscheinlichkeit unwirtschaftlichen Verhaltens 193 194 195
BVerfGE 103, 172 (184). BVerfGE 103, 172 (190 f.). BVerfGE 103, 172 (192 f.).
C. Kritik und eigener Vorschlag
155
– nach Auffassung des Gesetzgebers – am größten ist196. Das macht die Regelung in hohem Maße widersprüchlich, was – wenn auch nicht zur Perplexität der Regelung – so doch zu einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle hätte führen müssen. Schließlich betrifft dies Regelung Vertragsärzte und Vertragszahnärzte gleichermaßen (vgl. § 72 Abs. 1 Satz 2 SGB V). Während das Phänomen, dass Versicherte von Vertragsärzten Gefälligkeitsleistungen verlangen, einigermaßen bekannt ist, gilt selbiges für Vertragszahnärzte nicht. Die meisten Menschen vermeiden einen Besuch beim Zahnarzt, weshalb Bonusregelungen für einen regelmäßigen Zahnarztbesuch erlassen werden mussten197. Kaum ein Versicherter lässt zahnmedizinisch nicht indizierte Leistungen an sich vornehmen, um beispielsweise nicht zur Arbeit erscheinen zu müssen. Insofern unterscheiden sich die Lage bei Ärzten und Zahnärzten deutlich. Eine Gleichbehandlung scheint hier nicht gerechtfertigt198. Aber weder der Gesetzgeber noch das Bundesverfassungsgericht haben sich mit dieser Problematik auseinandergesetzt. Deshalb wurde auch diese Entscheidung insgesamt kritisch von der Literatur aufgenommen199. Bezeichnend ist, dass diese Regelung durch das VÄndG aufgehoben wurde. c) Die Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze aa) Die gesetzliche Ausgangslage und die Veränderungen durch das BSSichG § 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V statuiert die Versicherungspflicht für Arbeiter und Angestellte, § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V bestimmt, dass sie versicherungsfrei sind, wenn das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt die Versicherungspflichtgrenze übersteigt. Wer die Versicherungspflichtgrenze überschreitet, hat die Wahl, ob er sich überhaupt versichern lässt, eine Privatversicherung abschließt oder sich freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert (§ 9 Abs. 1 SGB V). Art. 1 Nr. 1 BSSichG200 hob die Versicherungspflichtgrenze von 40.5000 A im Jahre 2002 auf 45.900 A ab dem 01. 01. 2003 an (vgl. § 6 Abs. 6 Satz 1 SGB V). Aus Vertrauensschutzgründen wurde für Arbeiter und Angestellte, die am 31. 12. 2002 oberhalb der bis dahin geltenden Versicherungspflichtgrenze lagen, ein Wert von 41.400 A festgesetzt (vgl. § 6 Abs. 7 SGB V). bb) Die Ansicht des Bundesverfassungsgerichts Das Bundesverfassungsgericht nahm die beiden Verfassungsbeschwerden privater Krankenversicherungsunternehmen gegen die Erhöhung der Versicherungs196 197 198 199 200
Thomas Muschallik, MedR 1997, S. 109 (114); Helge Sodan, Freie Berufe, S. 241. Thomas Muschallik, MedR 1997, S. 109 (111). Helge Sodan, Freie Berufe, S. 241 ff. Statt vieler Friedhelm Hufen, NJW 2004, S. 14 (17 mit Fn. 62). Vom 23. 12. 2002, BGBl. I, S. 4637.
156
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
pflichtgrenze nicht zur Entscheidung an201. In den beiden Beschlüssen zur Anhebung der Versicherungspflichtgrenze ging die Kammer davon aus, dass kein Eingriff in grundrechtlich geschützte Freiheit vorliege. Die privaten Krankenversicherungsunternehmen seien nicht Adressaten der Versicherungsgrenze; sie seien allenfalls faktisch mittelbar betroffen202. Selbst im Falle einer unterstellten Grundrechtsbeeinträchtigung käme eine Annahme der Verfassungsbeschwerde nicht in Betracht. Denn Art. 12 Abs. 1 GG schütze nicht vor Veränderungen des Marktes und gewähre keinen Anspruch auf Sicherung zukünftiger Erwerbschancen203. Außerdem hätten die privaten Krankenversicherungsunternehmen die Geschäftssparte der ergänzenden Krankenversicherung; diese werde nicht berührt. Im Gegenteil, dieser Bereich werde weiter wachsen. Nähme man einen Eingriff in Art. 12 Abs. 1 GG an, so wäre dieser jedenfalls gerechtfertigt204. Der Grundsatz der finanziellen Stabilität und damit der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung sei ein überragend wichtiger Gemeinwohlbelang. Bei der Abgrenzung des Versichertenkreises stehe dem Gesetzgeber eine weite Einschätzungsprärogative zu. Die Anhebung der Versicherungspflichtgrenze sei geeignet, Mehreinnahmen zu generieren. Gleich effektive, aber weniger belastende Maßnahmen stünden nicht zur Verfügung. Dass auch andernorts Einsparungspotential bestehe, lasse die Erforderlichkeit nicht entfallen. Im übrigen sei die Anhebung der Versicherungspflichtgrenze auch angemessen, da nur eine geringfügige Beeinträchtigung vorliege, die die privaten Krankenversicherungsunternehmen nicht erheblich träfe. cc) Eigene Ansicht An dieser Stelle soll nur die Vereinbarkeit des BSSichG mit Art. 12 Abs. 1 GG untersucht werden und nicht die formelle Verfassungsmäßigkeit205, da diese nicht den Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung berührt. Art. 12 Abs. 1, Art. 19 Abs. 3 GG schützen die Tätigkeit eines privaten Krankenversicherungsunternehmens. Durch die Anhebung der Versicherungspflichtgrenze wird den Privatversicherungsunternehmen zwar nicht verboten, Vollversicherungsverträge mit Personen abzuschließen, die unterhalb der Versicherungspflichtgrenze liegen. Aber es liegt auf der Hand, dass niemand zwei Vollversicherungen abschließt. Deshalb sind die Versicherungsunternehmen sofort von der Regelung be201 BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 479 ff.; BVerfG, Kammerbeschluss vom 18. 02. 2004, Az.: 1 BvR 2152 / 03 (zitiert nach: www.bverfg.de). Der zweite Beschluss verweist lediglich auf die Begründung des ersten Beschlusses. 202 BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 479 (480). 203 BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 479 (480). 204 BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 479 (480 ff.). 205 Siehe zur formellen Verfassungsmäßigkeit des BSSichG BVerfG, NVwZ 2006, S. 191 (192 ff.). A.A. Helge Sodan, NJW 2003, S. 1761 (1762 f.).
C. Kritik und eigener Vorschlag
157
troffen, auch wenn sie nicht die Adressaten der Regelung sind206. Das wusste auch der Gesetzgeber. Auch faktische Beeinträchtigungen können Eingriffe in ein Grundrecht darstellen207, so dass ein Eingriff vorliegt208. Deshalb geht auch die Ausführung fehl, Art. 12 Abs. 1 GG schütze nicht vor Veränderungen des Marktes. Diese Ansicht ist zu undifferenziert. Diese Aussage kann sich nur auf die Konkurrenz durch private Wettbewerber in einem wettbewerblich organisierten Umfeld beziehen209. Dies ist bei staatlichen Monopolen – wie die gesetzliche Krankenversicherung eines ist210 – nicht der Fall. Es liegt zum einen keine Konkurrenz Privater vor, zum anderen ist das künstlich geschaffene Monopol nicht Zeichen eines wettbewerblich organisierten, freien Marktes211. Auch geht es nicht um einen Anspruch auf Gewinnchancen. Vielmehr setzten sich die Antragsteller dagegen zur Wehr, dass sie bei der Gewinnung neuer Kunden behindert werden. Es geht also um die Abwehr eines Eingriffs212 und das ist klassischerweise die Funktion von Freiheitsrechten 213. Anscheinend soll es argumentativ gegen die Antragsteller verwandt werden, dass sie Gewinn anstreben. Dabei gehört es gerade zu den Tatbestandsmerkmalen des Berufsbegriffs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 GG, dass der Grundrechtsträger seine Lebensgrundlage sichern und erhalten will214, was in der Regel stets mit dem Streben nach Gewinn einhergeht. Das ist in einem freiheitlichen Gesellschaftssystem weder anstößig noch rechtfertigungsbedürftig, sondern Voraussetzung für materielle Unabhängigkeit und Wohlstand. Der bestehende Eingriff ist also nur dann mit Art. 12 Abs. 1 GG vereinbar, wenn er verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Auch staatliche Monopole (wie die gesetzliche Krankenversicherung) müssen mit Art. 12 Abs. 1 GG vereinbar sein215. Maßgebend ist hierbei die Drei-Stufen-Theorie. Private Versicherungsunternehmen bleiben zwar bestehen, so dass keine Berufswahlregelung vorliegt (dies wäre bei der vollständigen Verdrängung vom Markt der Fall). Jedoch wird gesetzlich festgeschrieben, dass etwa 90 % der Bevölkerung den Unternehmen der privaten Kran206 Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (200); Helge Sodan, NJW 2003, S. 2581 (2582). 207 Vgl. Herbert Bethge, VVDStRL 57 (1998), S. 7 ff., insbes. S. 40; Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 260 f. 208 Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (200); Michael Wollenschläger / Jutta Krogull, NZS 2005, S. 237 (239). 209 Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (215 f.). 210 Hans-Jürgen Papier, ZSR 1990, S. 344 (347); Detlef Merten, NZS 1998, S. 545 (551); Friedrich E. Schnapp / Markus Kaltenborn, Friedensgrenze, S. 71 m. w. N. 211 Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (216). 212 Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 272. 213 BVerfGE 50, 290 (337). 214 Siehe nur BVerfGE 97, 228 (252 f.): 102, 197 (212); BVerfG, NJW 2004, S. 2363. So bereits BVerwGE 1, 54; 1, 92 (93); 22, 286 (287). 215 Friedhelm Hufen, NJW 2004, S. 14 (16); Hans-Jürgen Papier, ZSR 1990, S. 344 (348 f.); Friedrich E. Schnapp / Markus Kaltenborn, Friedensgrenze, S. 71 ff. Siehe zum Arbeitsvermittlungsmonopol BVerfGE 21, 245 (248).
158
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
kenversicherung als potentielle Kunden entzogen werden. Dies spricht gegen die Annahme einer bloßen Berufsausübungsregelung. Denn beim Marktzugang geht es nicht um eine nebensächliche Frage, sondern grundlegend um das Recht auf den faktischen Zugang zum Kunden216, der Grundlage der Teilhabe am Wettbewerb ist. Der Zugang zum Kunden wird aber nahezu unmöglich, wenn 90 % der Bevölkerung als potentielle Kunden ausscheiden. Diese Kontingentierung zu Lasten der privaten Krankenversicherungsunternehmen und zu Gunsten des gesetzlichen Verwaltungsmonopols ist von den Grundrechtsträgern auch durch eigenes Verhalten nicht beeinflussbar217. Dieser Eingriff kommt in seinen Auswirkungen somit einer objektiven Berufswahlregelung nahe218. Berufsausübungsregelungen, die einer Berufswahlregelung nahe kommen, sind nur gerechtfertigt, wenn sie „durch besonders wichtige Interessen der Allgemeinheit, die anders nicht geschützt werden können“, erfordert werden219. Der Grundsatz der finanziellen Stabilität ist kein solch wichtiger Belang. Bereits an dieser Stelle hätte die Entscheidung anders ausfallen müssen. Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht sich dieser Ansicht nicht anschließt, hätte es die Regelung intensiver kontrollieren müssen. Es hätte sich nicht mit dem Hinweis auf die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers begnügen dürfen. Bei derart schwerwiegenden Eingriffen wie der Anhebung der Versicherungspflichtgrenze auf die derzeitige Höhe, kann dem Gesetzgeber kein Blankoscheck ausgestellt werden. Bei einem Einbeziehungsgrad von 90 % der Bevölkerung ist die Grenze der Einschätzungsprärogative überschritten, es besteht keinerlei Spielraum mehr. Es liegt in der Natur der Versicherungsgrenze, dass diejenigen, die darüber liegen, höhere Jahresentgelte erzielen, als diejenigen, die darunter liegen. Bloß auf die Leistungsfähigkeit derjenigen zu verweisen, die über der Grenze liegen, kann nicht ausreichen. Denn machte man ernst damit, dass die Leistungsfähigkeit alles rechtfertigt, wäre man bald bei der zweifelhaften Bürgerzwangsversicherung. Dann wäre aber das Kriterium der sozialen Schutzbedürftigkeit aufgegeben220. Entscheidend wäre dann nur noch die Eigenschaft, Bewohner des Bundesgebietes zu sein. Somit führt dass Bundesverfassungsgericht seine eigene Argumentation ad absurdum. Darüber hinaus findet sich im Gesetzesentwurf zum BSSichG kein Hinweis auf das Kriterium der Leistungsfähigkeit221; ähnlich wie auch bei dem Beschluss zur Altersgrenze von 68 Jahren stellt das Bundesverfassungsgericht eigene Erwägungen an, obwohl es doch dem Gesetzgeber einen weiten Spielraum Vgl. BVerfGE 105, 252 (265). Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (222); Hans-Jürgen Papier, FS-Stern, S. 543 (554). Siehe auch Helge Sodan, NJW 2003, S. 1761 (1766); ders., NJW 2003, S. 2581 (2582). 218 Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (222); Friedrich E. Schnapp / Markus Kaltenborn, Friedensgrenze, S. 77 ff. 219 BVerfGE 11, 30 (43 f.). 220 Siehe hierzu oben, Zweites Kapitel C. I. 3. b) bb) – cc). 221 Michael Wollenschläger / Jutta Krogull, NZS 2005, S. 237 (241). 216 217
C. Kritik und eigener Vorschlag
159
zubilligen will. In der Gesetzesbegründung findet sich nur der Hinweis, dass durch das BSSichG die Finanzgrundlagen gestärkt, das Beitragssatzniveau stabilisiert und ein finanzieller Spielraum für Reformen geschaffen werden solle222. Bei einer intensivierten inhaltlichen Prüfung hätte auch genauer nachgefragt werden müssen, ob tatsächlich mit den erwarteten Mehreinnahmen zu rechnen wäre. Denn durch die Anhebung der Versicherungspflichtgrenze werden zwar neue Beitragszahler gewonnen, diese neuen Beitragszahler sind jedoch zugleich neue Anspruchsberechtigte. Außerdem können diese – da sie der privaten Krankenversicherung entzogen sind – die gesetzliche Krankenversicherung nicht mehr quersubventionieren223. Auch hätte die Tatsache, dass bislang weder die Einsparungsmaßnahmen noch die Erhöhungen der Versicherungspflichtgrenze dauerhaft gewirkt haben, Anlass zu Zweifeln geben müssen, ob die abermalige Anhebung der Versicherungspflichtgrenze zur Sanierung der gesetzlichen Krankenversicherung geeignet ist224. Bei der Frage, ob Art. 1 Nr. 1 BSSichG erforderlich ist, hätte der Gesetzgeber nachweisen müssen, dass es keine gleich geeigneten, aber die Grundrechtsträger weniger belastenden Maßnahmen gibt. Bei derart intensiven Grundrechtseingriffen gehen Zweifel an der Erforderlichkeit zu Lasten des Gesetzgebers225. Dieser vermochte jedoch nicht zu belegen, dass die Alternativmittel ungeeignet oder belastender sind. Abschließend sei auf einen bemerkenswerten Satz aus dem Nichtannahmebeschluss vom 04. 02. 2004 verwiesen. Dort führt das Bundesverfassungsgericht aus: „Da es an der Möglichkeit der beitragsfreien Mitversicherung von Familienangehörigen in der privaten Krankenversicherung fehlt und dort zusätzlich eine Risikoselektion stattfindet, ist die private Krankenversicherung für besserverdienende ältere Arbeitnehmer mit familiären Unterhaltsverpflichtungen ohnedies zu teuer.“226
Der Bürger – und nicht das Bundesverfassungsgericht oder gar einzelne Kammern desselben – entscheidet, wie viel ihm die Absicherung des Krankheitsrisikos wert ist. Nicht das Bundesverfassungsgericht sollte werten, welcher Bürger sich welche Krankenversicherung leisten kann oder soll. Auf paternalistische Bevormundung, ganz gleich ob aus Berlin oder Karlsruhe, kann der Grundrechtsträger verzichten. Im Ergebnis hätte die Anhebung der Versicherungspflichtgrenze für verfassungswidrig wegen Verstoßes gegen Art. 12 Abs. 1 GG erklärt werden müssen227. BT-Drucks. 15 / 28, S. 1. Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (224 f.); Helge Sodan, Privat(zahn)ärztliche Behandlungspflicht, S. 59 m. w. N. 224 So auch Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (225 mit Fn. 156). 225 Hans-Jürgen Papier, FS-Stern, S. 543 (554).; Bernhard Schlink, FS-50 Jahre BVerfG, Bd. II, S. 445 (454). Siehe auch BVerfGE 45, 187 (238). 226 BVerfG (Kammerbeschluss), NZS 2005, S. 479 (481). 227 So auch Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (224 ff.); Helge Sodan, NJW 2003, S. 1761 (1766); Michael Wollenschläger / Jutta Krogull, NZS 2005, S. 237 (243). 222 223
160
3. Kap.: Die These vom weiten Spielraum des Gesetzgebers
d) Entscheidungen, in denen Kostenregelungen gerechtfertigt wurden aa) Gemeinsamkeiten der Entscheidungen: unmittelbare Kostenregelung In etlichen Regelungen hat der Gesetzgeber durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes unmittelbar in die Preisfindung eingegriffen, so zum Beispiel bei der verbindlichen Festsetzung für die Vergütungsvereinbarungen (damaliger § 368g Abs. 5a Satz 3 RVO)228, Vereinbarung von Preisen als Höchstpreise (damaliger § 376d Abs. 2 Satz 3 RVO)229, der Preisabschlagsregelung von 55 % auf Arzneimittel im Beitrittsgebiet (damaliger § 311 SGB V)230, dem Preisabschlag und Preismoratorium für Arzneimittel (Art. 30 Abs. 1 GSG)231, den vertrags(zahn-) ärztlichen Honorarkürzungen aufgrund der Punktwertdegression (§ 85 Abs. 4b SGB V)232, der Festsetzung von Festbeträgen (§ 35 f. SGB V)233, bei der Preisabsenkung für zahntechnische Leistungen (Art. 6 BSSichG)234 sowie den Rabattregeln für Apotheker (Art. 1 Nr. 7 BSSichG)235, pharmazeutische Unternehmen (Art. 11 BSSichG)236 und pharmazeutische Großhändler (Art. 1 Nr. 8 BSSichG)237. Gemeinsam ist allen diesen Maßnahmen, dass Einsparungen in den verschiedenen Leistungsbereichen vorgenommen werden sollten und deshalb das Preisniveau geregelt wurde. bb) Widersprüchlichkeit Dass so oft unmittelbar in die Preisfindung eingegriffen wurde, muss überraschen angesichts der Aussage des Gesetzgebers, dass „gesetzliche Eingriffe zur unmittelbaren Begrenzung der Ausgaben in den einzelnen Leistungsbereichen“ „als dauerhaftes Instrument untauglich“ seien; dass sie „auch nicht wiederholt eingesetzt werden“ dürfen und können238. Legt man die in der Bundestagsdrucksache geäußerte Ansicht als zutreffend zu Grunde, vermag die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts nicht zu überzeugen: Es betont den Spielraum des Gesetzgebers, der weitgehend frei sei und kaum Bindungen unterläge, dann heißt es wie228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
BVerfGE 68, 193 ff. BVerfGE 70, 1 ff. BVerfG (Kammerbeschluss), DVBl. 1991, S. 205 ff. BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 1781 f. BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 3413; NVwZ-RR 2002, S. 802. BVerfGE 106, 275 ff. BVerfGE 106, 351 ff. BVerfGE 106, 359 ff. BVerfGE 106, 369 ff. BVerfGE 108, 45 ff. BT-Drucks. 12 / 3608, S. 69.
D. Ergebnis zum Dritten Kapitel
161
der überraschend, dass die Regelungen verfassungsgemäß sind, obwohl der Gesetzgeber selber ausdrücklich feststellt, dass solche Regelungen unzulässig seien. Nur einmal hat das Bundesverfassungsgericht eine solche unmittelbare Preisregelung für unverhältnismäßig gehalten, ohne freilich die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung anzunehmen239. Dabei hätte es sich angeboten, den Gesetzgeber beim Wort zu nehmen und auf Grund seiner widersprüchlichen Aussagen strenger zu kontrollieren. Selbst wenn man dem Gesetzgeber grundsätzlich einen weiten Einschätzungsspielraum zubilligt, kann dies dann nicht gelten, wenn jener sich selbst widerspricht. Dann kann das Bundesverfassungsgericht sehr wohl nachprüfen, welches der beiden möglichen gesetzgeberischen Konzepte vorzuziehen ist. Geht es um den Systemerhalt, scheut sich das Bundesverfassungsgericht auch nicht, eigene Begründungen zu liefern, wenn der Gesetzgeber seine Maßnahmen allzu deutlich unhaltbar formuliert und begründet hat240.
D. Ergebnis zum Dritten Kapitel Der gesetzgeberische Spielraum ist nie grenzenlos241; er darf es zumindest von Verfassungs wegen nicht sein. Aber selbst ein besonders weiter Spielraum, der pauschal im gesamten Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung gilt, existiert nicht242. Es gelten die allgemeinen Grundsätze, wie sie das Bundesverfassungsgericht unter anderem im Apotheken- und Mitbestimmungsurteil aufgestellt hat. Je nach dem wie intensiv die Beeinträchtigung des Schutzbereichs des Art. 12 Abs. 1 GG ist, wie groß die drohende Gefahr für andere Güter ist und wie weit tatsächlich die Möglichkeit der Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht besteht, kann der gesetzgeberische Spielraum sehr eng (intensivierte inhaltliche Kontrolle) oder relativ weit (Evidenzkontrolle) sein. Eine grundsätzliche Aufgabe der Kontrolle oder die Annahme eines besonders weiten Spielraums, weil Regelungen der gesetzlichen Krankenversicherung betroffen sind, wäre weder mit Art. 1 Abs. 3 GG noch der Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts im Gefüge der Staatsorgane vereinbar. Legt man diese Grundsätze zu Grunde, hätte so manche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung anders ausfallen müssen.
BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 1781 f. Siehe die Kritik an der 68-Jahre-Entscheidung und der Entscheidung zur Anhebung der Versicherungspflichtgrenze Drittes Kapitel C. II. 5. a) cc) bzw. Drittes Kapitel C. II. 5. c) cc). 241 Michael Kloepfer, NJW 1971, S. 1585 (1586). 242 Herbert Bethge / Christian von Coelln, VSSR 2004, S. 199 (203); Fritz Ossenbühl, FG-25 BVerfG, Bd. I, S. 458 (502). 239 240
11 Schaks
Viertes Kapitel
Schlussbetrachtung Es konnte in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt werden, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung nicht überzeugend ist. Die Widersprüchlichkeit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Sozialrecht geht konform mit der Widersprüchlichkeit und den chaotischen Zuständen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung selber1. Dogmatische Grundsätze und jahrzehntealte Rechtsprechungsansätze werden auf dem Altar des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung geopfert, um die gesetzgeberische Regelungsflut rechtfertigen zu können. Dies rächt sich, denn es entstehen Folgeprobleme, die nur durch immer weitere Ausnahmen und dogmatische Brüche „gelöst“ werden können. Wendete das Bundesverfassungsgericht dieselben Maßstäbe wie in seiner sonstigen Rechtsprechung an, sähe es sich nicht zu diesen Verrenkungen genötigt. Dann müsste auch nicht mehr der Vorwurf des verfassungsgerichtlichen Sonderrechts im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung erhoben werden. Der Grundsatz der finanziellen Stabilität ist ein Allzweck- oder PassepartoutArgument2. Diese Bezeichnung stellt keine böswillige Herabsetzung seitens der Kritiker dar, vielmehr wird diese Einordnung durch die Äußerungen zuständiger Richter am Bundesverfassungsgericht selbst nahe gelegt3. Gefährlicher als die Inhaltsleere dieser Formel ist ihre „präjudizierende Funktion“4, die dadurch veranschaulicht wird, dass noch nie ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich war, wenn der Grundsatz zitiert wurde. Dabei gibt es Verfahren, die erfolgreich waren und in denen der Grundsatz der finanziellen Stabilität als Belang hätte angeführt werden können. Eine solche Entscheidung stellt der Senatsbeschluss vom 06. 12. 20055 dar. Die Bundesregierung hatte in diesem Verfahren den Ausschluss bestimmter Therapieformen bei lebensbedrohenden bzw. tödlichen Krankheiten von der Leistungspflicht der Krankenkassen mit dem Grundsatz der 1 Siehe hierzu Bertram Schulin, JZ 1992, S. 419; Helge Sodan, GesR 2004, S. 305 (306); Raimund Wimmer, NJW 1995, S. 1577 (1578). 2 Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 318. 3 Renate Jaeger, System, S. 15 (37); dies., NZS 2003, S. 225 (233). 4 Vgl. Stephan Rixen, Sozialrecht, S. 318. 5 BVerfG, NJW 2006, S. 891 ff.
4. Kap.: Schlussbetrachtung
163
finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung gerechtfertigt6. Obwohl es um die den Krankenkassen dadurch entstehenden Kosten ging, hat das Bundesverfassungsgericht diesen Aspekt in den Gründen nicht mehr erwähnt. Das Bundesverfassungsgericht, das sich sonst nicht scheut, dem Gesetzgeber detaillierte Vorschriften zu machen, sollte seine Rolle als Hüter der Verfassung und damit der Grundrechte aktiver wahrnehmen. Ein erster Schritt wäre es, die institutionelle Argumentation beim Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung aufzugeben7. Denn das Grundgesetz geht von einem individuellen Ansatz aus8. Der Staat ist für die Bürger da; staatliches Handeln, das in Freiheitsrechte eingreift, bedarf der Rechtfertigung, nicht aber das Gebrauchen von grundrechtlich geschützter Freiheit. Anstatt einem einfachgesetzlich eingeführten Sozialversicherungssystem, dem „kein tiefergehender Gerechtigkeitsgehalt“ innewohnt9, Verfassungsrang einzuräumen, sollten die Grundrechte der wirtschaftlichen Betätigung gestärkt werden. Anstatt auf Kontrolle des Gesetzgebers zu verzichten, sollte das Bundesverfassungsgericht die Grenzen gesetzgeberischer Spielräume zum Schutz der Bürgerrechte strenger kontrollieren. Dazu bedürfte es keiner völligen Neuausrichtung der Rechtsprechung. Das Bundesverfassungsgericht müsste nicht einmal zurück gehen bis zum Apothekenurteil, dem Kassenarzturteil oder dem Kassenzahnarztbeschluss10. Auch in der jüngeren Rechtsprechung finden sich Ansätze, an die das Gericht anknüpfen könnte: Im Hinblick auf vorläufige Berufsverbote nach § 132a StPO hat das Bundesverfassungsgericht wegen der hohen Bedeutung der Berufsfreiheit strenge Maßstäbe aufgestellt11. Noch grundlegender war in den vergangenen Jahren die vom Bundesverfassungsgericht erzwungene Liberalisierung der freien Berufe12, besonders augenscheinlich ist diese Entwicklung bei Werbeverboten. Die strengen Werbeverbote wurden zunächst für Apotheker13, dann für steuer- und rechtsberatende Berufe14, Tierärzte15 und sogar für Allgemeinmediziner 16 gelockert. Diese Liberalisierung 6 BVerfG, Beschluss vom 06. 12. 2005, Az.: 1 BvR 347 / 98, Rn. 37 (zitiert nach: www. bverfg.de) – insofern nicht abgedruckt unter BVerfG, NJW 2006, S. 891 ff. 7 Kritisch auch Eberhard Schmidt-Aßmann, NJW 2004, S. 1689 (1690). 8 Siehe nur Eberhard Schmidt-Aßmann, Grundrechtspositionen, S. 9. 9 BVerfGE 113, 167 (203). 10 BVerfGE 7, 377 ff.; 11, 30 ff.; 12, 144 ff. 11 BVerfG (Kammerbeschluss), EuGRZ 2006, S. 197 (198). 12 Siehe hierzu Michael Kleine-Cosack, NJW 2003, S. 868 ff. 13 BVerfGE 94, 372 ff. 14 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2000, S. 3195 f. 15 BVerfG (Kammerbeschluss), NJW 2002, S. 3091 ff. 16 BVerfGE 106, 181 ff. – der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung wurde für nicht anwendbar gehalten. Vgl. auch BVerfG, MedR 2006, S. 107 f.
11*
164
4. Kap.: Schlussbetrachtung
bei Apothekern und Ärzten zeigt, dass auch im Gesundheitswesen mehr Freiheit möglich ist. Geht man noch etwas weiter in die Vergangenheit, so lassen sich ebenfalls interessante Ausführungen zur Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG finden: „Die Berufsfreiheit verwirklicht sich [ . . . ] vorwiegend im Bereich der privaten Berufsund Arbeitsordnung und ist hier vornehmlich darauf gerichtet, die eigenpersönliche, selbstbestimmte Lebensgestaltung abzuschirmen, also Freiheit von Zwängen oder Verboten im Zusammenhang mit Wahl und Ausübung des Berufes zu gewährleisten.“17 „Art. 12 Abs. 1 GG konkretisiert das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit im Bereich der individuellen Leistung und Existenzerhaltung (BVerfGE 30, 292 [334]) und zielt auf eine möglichst unreglementierte berufliche Tätigkeit ab (BVerfGE 34, 252 [256]).“18
Die Stichworte „eigenpersönlich“, „selbstbestimmt“, „Freiheit von Zwängen und Verboten“, „freie Entfaltung der Persönlichkeit“, „individuelle Leistung“ oder „möglichst unreglementierte berufliche Tätigkeit“ bieten ein reichhaltiges Anknüpfungspotential. An diesen Aspekten sollte sich der Grundrechtsschutz des Art. 12 Abs. 1 GG verstärkt ausrichten.
BVerfGE 33, 303 (331) – Hervorhebung im Original. BVerfGE 54, 301 (313). Siehe auch BVerfGE 50, 16 (29); 81, 70 (85); 101, 331 (347); BVerfG, NJW 2004, S. 1305 (1307). 17 18
Zusammenfassung in Leitsätzen 1. Seit 1984 hat das Bundesverfassungsgericht in fast 30 Entscheidungen gesetzgeberische Maßnahmen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung durch den Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung als gerechtfertigt angesehen. Noch nie, wenn dieser Grundsatz Anwendung fand, hat das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz für nichtig oder für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt. 2. Weiterhin darf sich der Gesetzgeber – nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts – diesem Grundsatz nicht entziehen. Es handele sich um einen Gemeinwohlbelang von hinreichendem Gewicht und überragender Bedeutung. Auch objektive Berufswahlregelungen im Sinne der Drei-Stufen-Theorie des Art. 12 Abs. 1 GG können durch diesen Belang gerechtfertigt werden. 3. In den Entscheidungen zum Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung wurde dem Gesetzgeber ein weiter Gestaltungs- und Einschätzungsspielraum zugebilligt, der nur eingeschränkt vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden könne. 4. Zur Ermittlung des Inhalts des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung wurden der Wortlaut dieser Formulierung, inhaltliche Konkretisierungen des Bundesverfassungsgerichts, die einschlägigen Gesetzesbegründungen, ähnlich lautende gesetzliche Bestimmungen, Stimmen aus der Literatur, die Ansicht des Bundessozialgerichts sowie Sinn und Zweck des Grundsatzes analysiert. 5. Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass der untersuchte Grundsatz der verfolgte Zweck im Rahmen der Prüfung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ist. Sein Inhalt lässt sich wie folgt verstehen: Verfolgt werden Einnahmesteigerungen oder die Vermeidung von Kosten, also ausschließlich finanzielle Aspekte. Die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung und die Qualität der vertragsärztlichen Versorgung werden vom Bundesverfassungsgericht zwar gelegentlich angeführt, diese Belange trugen die Entscheidungen jedoch nicht. Es geht um den Schutz des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung durch die Sicherung seiner Finanzierung. Dies gilt ungeachtet dessen, dass das Bundesverfassungsgericht gelegentlich den Wortlaut seiner Formulierung geringfügig verändert hat. Der zu verzeichnende Wortlautwandel ist ohne Auswirkung auf den Inhalt des Grundsatzes. 6. Entgegen der vom Bundesverfassungsgericht in den Entscheidungen zum Grundsatz der finanziellen Stabilität geäußerten Ansicht kommt diesem Grundsatz kein Verfassungsrang zu. Ein solcher Rang lässt sich weder geschriebenem noch
166
Zusammenfassung in Leitsätzen
ungeschriebenem Verfassungsrecht entnehmen. Es handelt sich um einen fiskalischen / finanziellen Belang. 7. Das Sozialprinzip gibt nur einen zu erreichenden Soll-Zustand vor, jedoch keine Mittel, wie dieser zu erreichen ist. Art. 20 Abs. 1 GG garantiert weder das bestehende System der gesetzlichen Krankenversicherung noch seine tragenden Gedanken. Da bereits das existierende System nicht geschützt wird, kann auch dessen finanzielle Stabilität nicht verfassungsrechtlich garantiert sein. Weder die Fallgruppe „Schutz vor den Wechselfällen des Lebens“ noch die Fallgruppe „Herstellung einer gerechten Sozialordnung“ erzwingen ein anderes Ergebnis. Bei einer Einbeziehung von rund 90 % der Bevölkerung in die gesetzliche Krankenversicherung kann nicht behauptet werden, diese komme nur solchen Menschen zu Gute, die sozial schutzbedürftig seien, das heißt besonders ungünstige Lebensumstände hätten und in ihrer gesellschaftlichen Entwicklung gefährdet seien. 8. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG beinhaltet ebenfalls nicht den Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung, denn der Grundsatz weist bereits keinen gesundheitsschützenden Inhalt auf. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verlangt auch nicht die Einführung oder Beibehaltung der gesetzlichen Krankenversicherung. Zwar dienen sowohl die gesetzliche Krankenversicherung als auch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG dem Gesundheitsschutz. Die gesetzliche Krankenversicherung könnte aber nur dann Verfassungsrang haben, wenn der Gesetzgeber im Falle des Nichtergreifens dieses Mittels seine Schutzpflicht verletzt. Anderenfalls ist der Gesetzgeber frei, welches Mittel er einsetzt. Und da andere ebenso wirksame Mittel gewählt werden könnten, erzwingt die Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG nicht die Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung, wie sie derzeit als soziales Sicherungssystem besteht. Auch der Aspekt des originären Leistungsrechts führt zu keiner anderen Betrachtungsweise. 9. Die Kompetenzbestimmung des Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG spricht zwar von der Sozialversicherung, und die gesetzliche Krankenversicherung ist Teil hiervon. Aber nicht jede in einer Kompetenzbestimmung aufgeführte Materie kann Verfassungsrang haben. Bei der Frage, ob Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG eine institutionelle Absicherung des überkommenen Systems der gesetzlichen Krankenversicherung enthält, führt keine der klassischen Auslegungsmethoden zu dem Ergebnis, dass die gesetzliche Krankenversicherung Verfassungsrang hätte. Dies entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. 10. Art. 84 Abs. 2 GG enthält ebenfalls eine Kompetenzbestimmung. Dieselben Erwägungen, die dazu führten, dass aus der Gesetzgebungskompetenz des Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG kein Verfassungsrang des Grundsatzes der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung erwächst, gelten auch bei Art. 84 Abs. 2 GG. Dieses Ergebnis wird ebenfalls von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gestützt. 11. Auch bei Art. 120 Abs. 1 Satz 4 GG handelt es sich um eine reine Kompetenzbestimmung, der keine materialen Rechtsfolgen entnommen werden kön-
Zusammenfassung in Leitsätzen
167
nen. Diese Bestimmung soll ausschließlich das Verhältnis des Bundes zu den Ländern regeln. Der Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität kann dieser Vorschrift also nicht entnommen werden. 12. Art. 109 Abs. 2 GG ist ebenso wie das Sozialstaatsprinzip eine Staatszielbestimmung. Die Weite jener Vorschrift verbietet die Annahme, in ihr sei der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung verfassungsrechtlich abgesichert. 13. Art. 33 Abs. 2, 5 GG führt ebenfalls zu keinem anderen Ergebnis. Da die vertrags(zahn)ärztliche Tätigkeit weder die Ausübung öffentlichen Dienstes noch ein staatlich gebundener Beruf ist, noch eine Beleihung darstellt, spielt Art. 33 Abs. 2, 5 GG keine Rolle im vorliegenden Zusammenhang und kann dem Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung keinen Verfassungsrang verleihen. 14. Art. 33 Abs. 2 EV hat bereits keinen Verfassungsrang und kann ihn somit auch nicht dem Grundsatz der finanziellen Stabilität verleihen. Darüber hinaus trat der Einigungsvertrag erst Jahre, nachdem das Bundesverfassungsgericht den Verfassungsrang des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung bereits postuliert hatte, in Kraft. 15. Auch Verfassungsgewohnheitsrecht als ungeschriebenes Verfassungsrecht enthält nicht den verfassungsrechtlichen Sitz des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung. Keine der beiden Voraussetzungen, damit von Verfassungsgewohnheitsrecht gesprochen werden kann, liegt vor: Weder besteht eine längere tatsächliche Übung, dass dem Grundsatz Verfassungsrang zukommt, noch liegt eine entsprechende einheitliche Rechtsüberzeugung vor. 16. Der Verfassungsrang wird dem Grundsatz auch nicht qua Richterspruch des Bundesverfassungsgerichts zuteil. Denn die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts haben selber keinen Verfassungsrang. 17. Durch die Einräumung eines Verfassungsranges des Grundsatzes der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung würde die Normenhierarchie auf den Kopf gestellt. Im Ergebnis stünde das durch einfaches Gesetz eingeführte System der gesetzlichen Krankenversicherung über den Grundrechten. Dieses Ergebnis wäre mit Art. 1 Abs. 3, Art. 20 Abs. 3 GG unvereinbar. 18. Die These des Bundesverfassungsgerichts, dass der Gesetzgeber im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung einen besonders weiten Spielraum genösse, der einer bundesverfassungsgerichtlichen Kontrolle nur eingeschränkt zugänglich sei, ist zu allgemein. Auch im Bereich des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung gelten die allgemeinen dogmatischen Grundsätze und Rechtsprechungsansätze. 19. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den gesetzgeberischen Spielräumen lässt nicht immer vollständig erkennen, weshalb ein bestimmter Kontrollmaßstab gewählt wurde. Weitere Kritikpunkte sind unter anderem die feh-
168
Zusammenfassung in Leitsätzen
lende Berücksichtigung der Problematik kumulierender Grundrechtseingriffe, die fehlende Durchsetzung gesetzgeberischer Nachbesserungspflichten oder die Unvereinbarkeit mit der Drei-Stufen-Theorie. 20. Wendet man die sonst geltenden Grundsätze und Rechtsprechungsansätze des Bundesverfassungsgerichts an, dann kann nicht stets eine bloß flüchtige Evidenzkontrolle vorgenommen werden. Die Kontrolldichte variiert, wie sonst auch, von einer Evidenz- bis hin zu einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle. Insbesondere in Fällen massiver Grundrechtsbeeinträchtigungen muss die Kontrolle strenger ausfallen. Deshalb hätten zum Beispiel die Entscheidungen zu den Altersgrenzen von 55 und 68 Jahren zur Anhebung der Versicherungspflichtgrenze sowie die Entscheidungen, in denen unmittelbare Preisregelungen in Rede standen, anders ausfallen müssen. In allen Fällen hätte intensiver kontrolliert werden müssen. In den drei Beschlüssen zur Versicherungspflichtgrenze sowie zu den Altersgrenzen hätte zusätzlich klargestellt werden müssen, dass die in Rede stehenden Eingriffe so intensiv sind, dass sie objektiven Berufswahlregelungen zumindest nahe kommen und nicht durch den Grundsatz der finanziellen Stabilität gerechtfertigt werden können, da dieser nur eine schwache legitimierende Kraft aufweist.
Literaturverzeichnis Abendroth, Wolfgang: Zum Begriff des demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (1954), in: Ernst Forsthoff (Hrsg.), Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, S. 114 ff., 1968, München (zit. als: Wolfgang Abendroth, Rechtsstaat). Alexy, Robert: Theorie der Grundrechte, Neudruck der Erstauflage, 1994, Baden-Baden (zit. als: Robert Alexy, Grundrechte). Arnauld, Andreas von: Die normtheoretische Begründung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, JZ 2000, S. 276 ff. Arndt, Hans-Wolfgang: Wirtschaftsverwaltungsrecht, in: Udo Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2003, S. 875 ff., Heidelberg (zit. als: Hans-Wolfgang Arndt, Wirtschaftsverwaltungsrecht). Augsberg, Steffen: Verfassungsrechtliche Aspekte einer gesetzlichen Offenlegungspflicht für Vorstandsbezüge, ZRP 2005, S. 105 ff. Axer, Peter: Normsetzung und Exekutive in der Sozialversicherung, 2000, Tübingen. (zit. als: Peter Axer, Normsetzung) Badura, Peter: Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den verfassungsrechtlichen Grenzen wirtschaftspolitischer Gesetzgebung im sozialen Rechtsstaat, AöR 92 (1967), S. 382 ff. – Richterliches Prüfungsrecht und Wirtschaftspolitik, in: Peter Oberndorfer / Herbert Schambeck (Hrsg.), Verwaltung im Dienste von Wirtschaft und Gesellschaft. Festschrift für Ludwig Fröhler zum 60. Geburtstag, S. 321 ff., 1980, Berlin (zit. als: Peter Badura, FSFröhler). – Der Sozialstaat, DÖV 1989, S. 491 ff. – Die innerdeutschen Verträge, insbesondere der Einigungsvertrag, in: Josef Isensee / Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. VIII, § 189, 1995, Heidelberg (zit. als: Peter Badura, HdBStR VIII). – Staatsrecht, 3. Aufl. 2003, München (zit. als: Peter Badura, Staatsrecht). – Wirtschaftsverfassung und Wirtschaftsverwaltung, 2. Aufl. 2005, Tübingen (zit. als: Peter Badura, Wirtschaftsverfassung). Beaucamp, Guy: Vertragsärztliche Zulassung und Berufsfreiheit, JA 2003, S. 51 ff. Becker, Ulrich: Zur verfassungsrechtlichen Stellung der Vertragsärzte am Beispiel der zulassungsbezogenen Altersgrenzen, NZS 1999, S. 521 ff. – Arzneimittelrabatte und Verfassungsrecht – zur Zulässigkeit der Preisabschläge nach dem Beitragssatzsicherungsgesetz, NZS 2003, S. 561 ff.
170
Literaturverzeichnis
Beer, Daniela / Klahn, Dominik: Rechtliche und ökonomische Eckpunkte einer Bürgerversicherung, SGb 2004, S. 13 ff. Benda, Ernst: Grundrechtswidrige Gesetze. Ein Beitrag zu den Ursachen verfassungsgerichtlicher Beanstandung, 1979, Baden-Baden (zit. als: Ernst Benda, Gesetze). Benda, Ernst / Klein, Eckart: Verfassungsprozeßrecht, 2. Aufl. 2001, Heidelberg (zit. als: Ernst Benda / Eckart Klein, Verfassungsprozeßrecht). Bethge, Herbert: Der Grundrechtseingriff, in: VVDStRL 57 (1998), S. 7 ff. – Kommentierung zu § 31, in: Theodor Maunz / Bruno Schmidt-Bleibtreu / Franz Klein / Herbert Bethge (Hrsg.), Bundesverfassungsgerichtsgesetz-Kommentar, Loseblattsammlung, Bd. 1, (Stand der Bearbeitung: Juni 2001), München (zit. als: Herbert Bethge, in: Maunz / Schmidt-Bleibtreu / Klein / Bethge, BVerfGG). Bethge, Herbert / Coelln, Christian von: Die gesetzliche Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze in der Gesetzlichen Krankenversicherung als möglicher Verstoß gegen die Grundrechte privater Krankenversicherungsunternehmen, VSSR 2004, S. 199 ff. Bieback, Karl-Jürgen: Verfassungsrechtlicher Schutz gegen Abbau und Umstrukturierung von Sozialleistungen, 1997, Berlin (zit. als: Karl-Jürgen Bieback, Verfassungsrechtlicher Schutz). Bleckmann, Albert: Zum materiellrechtlichen Gehalt der Kompetenzbestimmungen des Grundgesetzes, DÖV 1983, S. 129 ff. – Neue Aspekte der Drittwirkung der Grundrechte, DVBl. 1988, S. 938 ff. Boecken, Winfried: Vertragsärztliche Bedarfsplanung aus rechtlicher Sicht, NZS 1999, S. 417 ff. – Art. 14 GG und die Entziehung der vertragsärztlichen Zulassung wegen Erreichens der Altersgrenze, in: Carl-Eugen Eberle / Martin Ibler / Dieter Lorenz (Hrsg.), Der Wandel des Staates vor den Herausforderungen der Gegenwart. Festschrift für Winfried Brohm zum 70. Geburtstag, S. 231 ff., 2002, München (zit. als: Winfried Boecken, FS-Brohm). – Do ut des – Gedanken zur vertragsärztlichen Vergütung, in: Matthias von Wulffen / Otto Ernst Krasney (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundessozialgericht, S. 363 ff., 2004, Köln u. a. (zit. als: Winfried Boecken, FS-50 Jahre BSG). – Die Altersgrenze von 68 Jahren für Vertragsärzte aus EG-rechtlicher Sicht, NZS 2005, S. 393 ff. Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Die Methoden der Verfassungsinterpretation – Bestandsaufnahme und Kritik, NJW 1976, S. 2089 ff. – Diskussionsbeitrag, in: VVDStRL 39 (1981), S. 174 f. – Zur Lage der Grundrechtsdogmatik nach 40 Jahren Grundgesetz, 1989, München-Nymphenburg (zit. als: Ernst-Wolfgang Böckenförde, Grundrechtsdogmatik). – Verfassungsgerichtsbarkeit: Strukturfragen, Organisation, Legitimation, NJW 1999, S. 9 ff. Boetius, Jan: Einflußfaktoren für die Finanzierung von GKV und PKV, in: ders. / Hans-Olaf Wiesemann, Die Finanzierungsgrundlagen in der Krankenversicherung – Zur Grenzziehung zwischen GKV und PKV, 1998, Köln (zit. als: Jan Boetius, Einflußfaktoren). Bogs, Harald: Die Sozialversicherung im Staat der Gegenwart, 1973, Berlin (zit. als: Harald Bogs, Sozialversicherung).
Literaturverzeichnis
171
– Freie Zulassung zum freiberuflichen Kassenarztamt unter dem Bonner Grundgesetz, in: Wolfgang Gitter / Werner Thieme / Hans F. Zacher (Hrsg.), Festschrift für Georg Wannagat zum 65. Geburtstag, S. 51 ff., 1981, Köln u. a. (zit. als: Harald Bogs, FS-Wannagat). Bogs, Walter: Das Problem der Freiheit im sozialen Rechtsstaat (1961), in: Ernst Forsthoff (Hrsg.), Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, S. 509 ff., 1968, München (zit. als: Walter Bogs, Freiheit). Breuer, Rüdiger: Legislative und administrative Prognoseentscheidungen, Der Staat 16 (1977), S. 21 ff. – Die öffentlichrechtliche Anstalt, in: VVDStRL 44 (1986), S. 211 ff. – Freiheit des Berufs, in: Josef Isensee / Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts des Bundesrepublik Deutschland, Bd. VI, § 147, 2. Aufl. 2001, Heidelberg (zit. als: Rüdiger Breuer, HdBStR VI, § 147). – Die staatliche Berufsregelung und Wirtschaftslenkung, in: Josef Isensee / Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. VI, § 148, 2. Aufl. 2001, Heidelberg (zit. als: Rüdiger Breuer, HdBStR VI, § 148). Brockmeyer, Hans-Bernhard: Kommentierung zu Art. 109, in: Bruno Schmidt-Bleibtreu / Franz Klein (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, 10. Aufl. 2004, Neuwied. (zit. als: Hans-Bernhard Brockmeyer, in: Schmidt-Bleibtreu / Klein, GG). Broß, Siegfried: Kommentierung zu Art. 87, in: Ingo von Münch / Philip Kunig (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 3, 5. Aufl. 2003, München (zit. als: Siegfried Broß, in: von Münch / Kunig, GG). Brüning, Christoph: Voraussetzungen und Inhalt eines grundrechtlichen Schutzanspruchs – BVerwG, NVwZ 1999, 1234, JuS 2000, S. 955 ff. Bürck, Harald: Verfassungsrechtliche Probleme der Zulassung als Kassenarzt, MedR 1989, S. 63 ff. Bull, Hans Peter: Die Staatsaufgaben nach dem Grundgesetz, 1973, Frankfurt am Main (zit. als: Hans Peter Bull, Staatsaufgaben). – Sozialstaat – Krise oder Dissenz?, in: Michael Brenner / Peter M. Huber / Markus Möstl (Hrsg.), Der Staat des Grundgesetzes – Kontinuität und Wandel. Festschrift für Peter Badura zum siebzigsten Geburtstag, S. 57 ff., 2004, Tübingen (zit. als: Hans Peter Bull, FS-Badura). Burgi, Martin: Kommentierung zu Art. 87, in: Hermann von Mangoldt / Friedrich Klein / Christian Starck (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Bd. 3, 5. Aufl. 2005, München (zit. als: Martin Burgi, in: von Mangoldt / Klein / Starck, GG). Burmeister, Joachim: Vom staatsbegrenzenden Grundrechtsverständnis zum Grundrechtsschutz für Staatsfunktionen, 1971, Frankfurt am Main (zit. als: Joachim Burmeister, Grundrechtsverständnis). Busse, Volker: Das vertragliche Werk der deutschen Einheit, DÖV 1991, S. 345 ff. Butzer, Hermann: Fremdlasten in der Sozialversicherung, 2001, Tübingen (zit. als: Hermann Butzer, Fremdlasten). Canaris, Claus-Wilhelm: Grundrechte und Privatrecht, AcP 184 (1984), S. 201 ff.
172
Literaturverzeichnis
Clemens, Thomas: Kommentierung Anhang zu Art. 12, in: Dieter C. Umbach / Thomas Clemens (Hrsg.), Grundgesetz, Mitarbeiterkommentar und Handbuch, Bd. 1, 2002, Heidelberg (zit. als: Thomas Clemens, in: Umbach / Clemens, GG). Cornils, Matthias: Die Ausgestaltung der Grundrechte, 2005, Tübingen (zit. als: Matthias Cornils, Grundrechte). Cremer, Wolfram: Freiheitsgrundrechte, 2003, Tübingen (zit. als: Wolfram Cremer, Freiheitsgrundrechte). Degenhart, Christoph: Staatsrecht I – Staatszielbestimmungen, Staatsorgane, Staatsfunktionen, 22. Aufl. 2006, Heidelberg (zit. als: Christoph Degenhart, Staatsrecht I). Depenheuer, Otto: Staatliche Finanzierung und Planung im Krankenhauswesen, Diss. jur. Bonn, 1986, Berlin (zit. als: Otto Depenheuer, Krankenhauswesen). – Freiheit des Berufs und Grundfreiheiten der Arbeit, in: Peter Badura / Horst Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. II, S. 241 ff., 2001, Tübingen (zit. als: Otto Depenheuer, FS-50 Jahre BVerfG). Dietlein, Johannes: Die Lehre von den grundrechtlichen Schutzpflichten, 2. Aufl. 2005, Berlin (zit. als: Johannes Dietlein, Schutzpflichten). Di Fabio, Udo: Kommentierung zu Art. 2 Abs. 2, in: Theodor Maunz / Günter Dürig u. a. (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Loseblattsammlung, (Stand der Bearbeitung: Februar 2004), München (zit. als: Udo Di Fabio, in: Maunz / Dürig, GG). Doehring, Karl: Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 3. Aufl. 1984, Frankfurt am Main (zit. als: Karl Doehring, Staatsrecht). – Zur Regelung der Eigentumsfrage im Einigungsvertrag zwischen Bundesrepublik Deutschland und DDR, in: Rudolf Wildenmann (Hrsg.), Nation und Demokratie, S. 27 ff., 1991, Baden-Baden (zit. als: Karl Doehring, Einigungsvertrag). – Zur Erstreckung gerichtlicher Kontrolle des Gesetzgebers und der Regierung, in: Joachim Burmeister u. a. (Hrsg.), Verfassungsstaatlichkeit. Festschrift für Klaus Stern zum 65. Geburtstag, S. 1059 ff., 1997, München (zit. als: Karl Doehring, FS-Stern). Dreier, Horst: Forschungsbegrenzung als verfassungsrechtliches Problem, DVBl. 1980, S. 471 ff. – Kommentierung Vorbemerkung vor Art. 1, in: ders. (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Bd. 1, 2. Aufl. 2004, Tübingen (zit. als: Horst Dreier, in: Dreier, GG). Dürig, Günter: Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde, AöR 81 (1956), S. 117 ff. – Kommentierung zu Art. 1 Abs. 1, in: Theodor Maunz / Günter Dürig u. a. (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Loseblattsammlung (Stand der Bearbeitung: 1959), München (zit. als: Günter Dürig, in: Maunz / Dürig, GG). Ebsen, Ingwer: Das System der Gliederung in haus- und fachärztliche Versorgung als verfassungsrechtliches Problem, VSSR 1996, S. 351 ff. – Diskussionsbeitrag, in: VVDStRL 64 (2005), S. 180 f. Ebsen, Ingwer / Knieps, Franz: Krankenversicherungsrecht, in: Bernd Baron von Maydell / Franz Ruland (Hrsg.), Sozialrechtshandbuch, § 14, 3. Aufl. 2003, Baden-Baden (zit. als: Ingwer Ebsen / Franz Knieps, Sozialrechtshandbuch). Ehmke, Horst: Prinzipien der Verfassungsinterpretation, in: VVDStRL 20 (1963), S. 53 ff.
Literaturverzeichnis
173
Eichenhofer, Eberhard: Eigentum – Verschulden – Vertrag: Privatrechtsbegriffe als Sozialrechtskonstrukte?, VSSR 2004, S. 93 ff. – Sozialrecht, 5. Aufl. 2004, Tübingen (zit. als: Eberhard Eichenhofer, Sozialrecht). – Sozialrecht und soziale Gerechtigkeit, JZ 2005, S. 209 ff. Enders, Christoph: Sozialstaatlichkeit im Spannungsfeld von Eigenverantwortung und Fürsorge, in: VVDStRL 64 (2005), S. 7 ff. Erichsen, Hans-Uwe: Das Übermaßverbot, Jura 1988, S. 387 ff. – Besonderes Gewaltverhältnis und Sonderverordnung, in: Christian-Friedrich Menger (Hrsg.), Fortschritte des Verwaltungsrechts. Festschrift für Hans J. Wolff zum 75. Geburtstag, S. 219 ff., 1973, München (zit. als: Hans-Uwe Erichsen, FS-Wolff). Felix, Dagmar: Rezension zu: Finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung und Grundrechte der Leistungserbringer, NZS 2004, S. 587. Fikentscher, Wolfgang: Methoden des Rechts, Bd. IV, 1977, Tübingen (zit. als: Wolfgang Fikentscher, Methoden IV). Fisch, Rudolf / Strohm, Klauspeter: Wandel in der Kontinuität? Überlegungen zum Begriff Gemeinwohl, in: Stefan Brink / Heinrich Amadeus Wolff (Hrsg.), Gemeinwohl und Verantwortung. Festschrift für Hans Herbert von Armin zum 65. Geburtstag, S. 73 ff., 2004, Berlin (zit. als: Rudolf Fisch / Klauspeter Strohm, FS-Armin). Forsthoff, Ernst: Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaates, in: VVDStRL 12 (1954), S. 8 ff. – Verfassungsprobleme des Sozialstaats (1954), in: ders. (Hrsg.), Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, S. 145 ff., 1968, München (zit. als: Ernst Forsthoff, Sozialstaat). – Zur Problematik der Verfassungsauslegung, 1961, Stuttgart (zit. als: Ernst Forsthoff, Verfassungsauslegung). Francke, Robert / Hart, Dieter: Die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung für Heilversuche, MedR 2006, S. 131 ff. Freudenberg, Ulrich: Beitragssatzstabilität in der gesetzlichen Krankenversicherung – Zur rechtlichen Relevanz einer politischen Zielvorgabe, Diss. jur. Bonn, 1995, Baden-Baden (zit. als: Ulrich Freudenberg, Beitragssatzstabilität). Friauf, Karl Heinrich: Zur Frage, ob eine Überbürdung des Morbiditätsrisikos im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung auf die Vertragsärzte mit dem Grundgesetz vereinbar ist, Rechtsgutachten, 1997, Sankt-Augustin (zit. als: Karl Heinrich Friauf, Morbiditätsrisiko). Füllsack, Martin: Reformmodelle in der gesetzlichen Krankenversicherung und ihre Vereinbarkeit mit der Verfassung, Diss. jur. Konstanz, 1996, Konstanz (zit. als: Martin Füllsack, Reformmodelle). Goecke, Klaus: Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Leistungspflicht der Krankenkassen beim Off-Label-Use von Arzneimitteln, NZS 2006, S. 291 ff. Grabitz, Eberhard: Freiheit und Verfassungsrecht, 1976, Tübingen (zit. als: Eberhard Grabitz, Freiheit). – Diskussionsbeitrag, in: VVDStRL 39 (1981), S. 197 f.
174
Literaturverzeichnis
Gubelt, Manfred: Kommentierung zu Art. 12, in: Ingo von Münch / Philip Kunig (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 1, 5. Aufl. 2000, München (zit. als: Manfred Gubelt, in: von Münch / Kunig, GG). Gusy, Christoph: Parlamentarischer Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht, 1985, Berlin (zit. als: Christoph Gusy, Gesetzgeber). Häberle, Peter: „Gemeinwohljudikatur“ und Bundesverfassungsgericht (Teil I), AöR 95 (1970), S. 86 ff. – Öffentliches Interesse als juristisches Problem, 1970, Bad Homburg (zit. als: Peter Häberle, Öffentliches Interesse). – Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz, 3. Aufl. 1983, Heidelberg (zit. als: Peter Häberle, Wesensgehaltgarantie). – Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft, in: Josef Isensee / Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, § 22, 3. Aufl. 2004, Heidelberg (zit. als: Peter Häberle, HdBStR II). Hamann, Andreas: Rechtsstaat und Wirtschaftslenkung, 1953, Heidelberg (zit. als: Andreas Hamann, Rechtsstaat). Hase, Friedhelm: Versicherungsprinzip und sozialer Ausgleich, 2000, Tübingen (zit. als: Friedhelm Hase, Versicherungsprinzip). Haverkate, Görg: Die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme, DVBl. 2004, S. 1061 ff. Hebeler, Timo: Grundlegende Rechtsfragen der Finanzierungskrise des deutschen Sozialstaates, Jura 2005, S. 17 ff. Heintzen, Markus: Kommentierung zu Art. 109, in: Ingo von Münch / Philip Kunig (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 3, 5. Aufl. 2003, München (zit. als: Markus Heintzen, in: von Münch / Kunig, GG). Hendler, Reinhard: Selbstverwaltung als Ordnungsprinzip, 1984, Köln u. a. (zit. als: Reinhard Hendler, Selbstverwaltung). Herdegen, Matthias: Die Verfassungsänderungen im Einigungsvertrag, 1991, Heidelberg (zit. als: Matthias Herdegen, Einigungsvertrag). – Verfassungsinterpretation als methodische Disziplin, JZ 2004, S. 873 ff. – Kommentierung zu Art. 1 Abs. 1, in: Theodor Maunz / Günter Dürig u. a. (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Loseblattsammlung, (Stand der Bearbeitung: Februar 2005 und März 2006), München (zit. als: Matthias Herdegen, in: Maunz / Dürig, GG). Hermes, Georg: Das Grundrecht auf Schutz von Leben und Gesundheit, Diss. jur. Freiburg, 1987, Heidelberg. (zit. als: Georg Hermes, Schutz). – Kommentierung zu Art. 83 und Art. 87, in: Horst Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 3, 2000, Tübingen (zit. als: Georg Hermes, in: Dreier, GG). Herweck-Behnsen, Erika: Die Legitimation der Zulassungsbeschränkung des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG) für Vertragsärzte und Vertragszahnärzte durch das Grundgesetz, NZS 1995, S. 211 ff. Herzberg, Rolf D.: Die ratio legis als Schlüssel zum Gesetzesverständnis? – Eine Skizze und Kritik der überkommenen Auslegungsmethodik, JuS 2005, S. 1 ff.
Literaturverzeichnis
175
Herzog, Roman: Kommentierung zu Art. 20 VII und VIII, in: Theodor Maunz / Günter Dürig u. a. (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Loseblattsammlung (Stand der Bearbeitung: 1980), München (zit. als: Roman Herzog, in: Maunz / Dürig, GG). Hess, Rainer: Kommentierung zu § 71 SGB V, in: Kasseler Kommentar zum Sozialversicherungsrecht, Loseblattsammlung, Bd. 1 (Stand der Bearbeitung: Mai 2003), München (zit. als: Rainer Hess, in: Kasseler Kommentar). Hesse, Konrad: Die verfassungsgerichtliche Kontrolle der Wahrnehmung grundrechtlicher Schutzpflichten des Gesetzgebers, in: Herta Däubler-Gmelin / Klaus Kinkel / Hans Meyer / Helmut Simon (Hrsg.), Gegenrede. Aufklärung – Kritik – Öffentlichkeit. Festschrift für Ernst Gottfried Mahrenholz, S. 541 ff., 1994, Baden-Baden (zit. als: Konrad Hesse, FSMahrenholz). – Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Neudruck der 20. Aufl. von 1995, 1999, Heidelberg (zit. als: Konrad Hesse, Grundzüge). Heun, Werner: Kommentierung zu Art. 3, in: Horst Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 1, 2. Aufl. 2004, Tübingen (zit. als: Werner Heun, in: Dreier, GG). – Kommentierung zu Art. 109, in: Horst Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 3, 2000, Tübingen (zit. als: Werner Heun, in: Dreier, GG). Hiddemann, Till-Christian / Muckel, Stefan: Das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung, NJW 2004, S. 7 ff. Hidien, Jürgen W.: Anmerkung zu BVerfG, Kammerbeschluss vom 27. 04. 2002 – 1 BvR 1282 / 99, DVBl. 2002, S. 400 ff., DVBl. 2002, S. 402 ff. Hofmann, Hans: Kommentierung zu Art. 20, in: Bruno Schmidt-Bleibtreu / Franz Klein (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, 10. Aufl. 2004, Neuwied (zit. als: Hans Hofmann, in: Schmidt-Bleibtreu / Klein, GG). Huber, Ernst Rudolf: Rechtsstaat und Sozialstaat in der modernen Industriegesellschaft (1965), in: Ernst Forsthoff (Hrsg.), Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, S. 589 ff., 1968, München (zit. als: Ernst Rudolf Huber, Rechtsstaat). Huber, Peter M.: Zur verfassungsgerichtlichen Kontrolle von Berufsausübungsregelungen am Beispiel des notariellen Gebührenrechts, in: Burkhardt Ziemske / Theo Langheid / Heinrich Wilms / Görg Haverkate (Hrsg.), Staatsphilosophie und Rechtspolitik. Festschrift für Martin Kriele zum 65. Geburtstag, S. 389 ff., 1997, München (zit. als: Peter M. Huber, FSKriele). Hufen, Friedhelm: Gesetzesgestaltung und Gesetzesanwendung im Leistungsrecht, in: VVDStRL 47 (1989), S. 142 ff. – Berufsfreiheit – Erinnerung an ein Grundrecht, NJW 1994, S. 2913 ff. – Inhalt und Einschränkbarkeit vertragsärztlicher Grundrechte, MedR 1996, S. 394 ff. – Grundrechtsschutz der Leistungserbringer und privaten Versicherer in Zeiten der Gesundheitsreform, NJW 2004, S. 14 ff. – Grundrechte der Leistungserbringer in der gesetzlichen Krankenversicherung und Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, in: Helge Sodan (Hrsg.), Finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung und Grundrechte der Leistungserbringer, S. 27 ff., 2004, Berlin (zit. als: Friedhelm Hufen, Leistungserbringer).
176
Literaturverzeichnis
Ipsen, Hans Peter: Über das Grundgesetz (1950), in: Ernst Forsthoff (Hrsg.), Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, S. 16 ff., 1968, München (zit. als: Hans Peter Ipsen, Grundgesetz). Ipsen, Jörn: „Stufentheorie“ und Übermaßverbot – Zur Dogmatik des Art. 12 GG, JuS 1990, S. 634 ff. Isensee, Josef: Umverteilung durch Sozialversicherungsbeiträge, 1973, Berlin (zit. als: Josef Isensee, Umverteilung). – Der Sozialstaat in der Wirtschaftskrise, in: Joseph Listl / Herbert Schambeck (Hrsg.), Demokratie in Anfechtung und Bewährung. Festschrift für Johannes Broermann, S. 365 ff., 1982, Berlin (zit. als: Josef Isensee, FS-Broermann). – Das Grundrecht auf Sicherheit. Zu den Schutzpflichten des freiheitlichen Verfassungsstaates, 1983, Berlin (zit. als: Josef Isensee, Sicherheit). – Verfassungsrecht als „politisches Recht“, in: ders. / Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. VII, § 162, 1992, Heidelberg (zit. als: Josef Isensee, HdBStR VII). – Das Recht des Kassenarztes auf angemessene Vergütung, VSSR 1995, S. 321 ff. – Gemeinwohl und Staatsaufgaben im Verfassungsstaat, in: ders. / Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III, § 57, 2. Aufl. 1996, Heidelberg (zit. als: Josef Isensee, HdBStR III). – Das Grundrecht als Abwehrecht und als staatliche Schutzpflicht, in: ders. / Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. V, § 111, 2. Aufl. 2000, Heidelberg (zit. als: Josef Isensee, HdBStR V). – Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht: eine Studie über das Regulativ des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft, 2. Aufl. 2001, Berlin (zit. als: Josef Isensee, Subsidiaritätsprinzip). – „Bürgerversicherung“ im Koordinatensystem der Verfassung, NZS 2004, S. 393 ff. – Rationierung von Gesundheitsleistungen – Verfassungsrechtliche Maßstäbe der Kontingentierung, ZVersWiss 2004, S. 651 ff. Jaeger, Renate: Die Reformen in der gesetzlichen Sozialversicherung im Spiegel der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, NZS 2003, S. 225 ff. – Welches System der gesetzlichen Krankenversicherung wird durch das Grundgesetz geschützt?, in: Stefan Empter / Helge Sodan (Hrsg.), Markt und Regulierung – Rechtliche Perspektiven für eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, S. 15 ff., 2003, Gütersloh (zit. als: Renate Jaeger, System). Jarass, Hans D.: Grundrechte als Wertentscheidungen bzw. objektivrechtliche Prinzipien in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 110 (1985), S. 363 ff. – Sicherung der Rentenfinanzierung und Verfassungsrecht, NZS 1997, S. 545 ff. – Die Grundrechte: Abwehrrechte und objektive Grundsatznormen, in: Peter Badura / Horst Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. II, S. 35 ff., 2001, Tübingen (zit. als: Hans D. Jarass, FS-50 Jahre BVerfG).
Literaturverzeichnis
177
– Kommentierung zu Vorbemerkung vor Art. 1, Art. 2, Art. 12 und Art. 20, in: ders. / Bodo Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Kommentar, 8. Aufl. 2006, München (zit. als: Hans D. Jarass, in: Jarass / Pieroth, GG). Jestaedt, Matthias: Bundesstaat als Verfassungsprinzip, in: Josef Isensee / Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, § 29, 3. Aufl. 2004, Heidelberg (zit. als: Matthias Jestaedt, HdBStR II). Kingreen, Thorsten: Das Sozialstaatsprinzip im europäischen Verfassungsverbund, 2003, Tübingen (zit. als: Thorsten Kingreen, Sozialstaatsprinzip). Kirchhof, Ferdinand: Verfassungsrechtliche Probleme einer umfassenden Kranken- und Renten-„Bürgerversicherung“, NZS 2004, S. 1 ff. – Der Risikostrukturausgleich in der gesetzlichen Krankenversicherung als Ausstieg aus dem Wettbewerb?, in: Helge Sodan (Hrsg.), Krankenkassenreform und Wettbewerb, S. 19 ff., 2005, Berlin (zit. als: Ferdinand Kirchhof, Risikostrukturausgleich). Kirchhof, Gregor: Kumulative Belastung durch unterschiedliche staatliche Maßnahmen, NJW 2006, S. 732 ff. Kirchhof, Paul: Besteuerung und Eigentum, in: VVDStRL 39 (1981), S. 213 ff. – Staatliche Einnahmen, in: Josef Isensee / Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. IV, § 88, 2. Aufl. 1999, Heidelberg (zit. als: Paul Kirchhof, HdBStR IV, § 88). – Finanzierung der Sozialversicherung, in: Josef Isensee / Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatrechts der Bundesrepublik Deutschland, § 93, Bd. IV, 2. Aufl. 1999, Heidelberg (zit. als: Paul Kirchhof, HdBStR IV, § 93). Klein, Eckart: Grundrechtliche Schutzpflichten des Staates, NJW 1989, S. 1633 ff. – Der Einigungsvertrag, Verfassungsprobleme und -aufträge, DÖV 1991, S. 569 ff. Klein, Hans H.: Staatsziele im Verfassungsgesetz – Empfiehlt es sich, ein Staatsziel Umweltschutz in das Grundgesetz aufzunehmen?, DVBl. 1991, S. 729 ff. – Die grundrechtliche Schutzpflicht, DVBl. 1994, S. 489 ff. – Verfassungsgerichtsbarkeit und Gesetzgebung, in: Peter Badura / Rupert Scholz (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit und Gesetzgebung. Symposium aus Anlaß des 70. Geburtstages von Peter Lerche, S. 49 ff., 1998, München (zit. als: Hans H. Klein, Symposium-Lerche). – Grundrechte am Beginn des 21. Jahrhunderts, in: Detlef Merten / Hans-Jürgen Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte, Bd. I, § 6, 2004, München (zit. als: Hans H. Klein, HdBGR I). Kleine-Cosack, Michael: Vom Werbeverbot zum Werberecht des Arztes, NJW 2003, S. 868 ff. Kloepfer, Michael: Das Geeignetheitsgebot bei wirtschaftslenkenden Steuergesetzen, NJW 1971, S. 1585 ff. – Belastungskumulation durch Normenüberlagerung im Abwasserrecht, VerwArch 74 (1983), S. 201 ff. Klückmann, Harald: Kommentierung zu § 71 SGB V, in: Karl Hauck / Wolfgang Noftz (Hrsg.), Sozialgesetzbuch – SGB V, Kommentar, Loseblattsammlung, Bd. 3, K § 71 (Stand der Bearbeitung: III / 05), Berlin (zit. als: Harald Klückmann, in: Hauck / Noftz, SGB V). 12 Schaks
178
Literaturverzeichnis
Kluth, Winfried: Bundesverfassungsgericht und wirtschaftslenkende Gesetzgebung, ZHR 162 (1998), S. 657 ff. – Ärztliche Berufsfreiheit unter Wirtschaftlichkeitsvorbehalt?, MedR 2005, S. 65 ff. Köbler, Gerhard: Juristisches Wörterbuch, 13. Aufl. 2005, München (zit. als Gerhard Köbler, Juristisches Wörterbuch). Krauss, Rupprecht von: Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in seiner Bedeutung für die Notwendigkeit des Mittels im Verwaltungsrecht, Diss. jur. Hamburg, 1955, Hamburg (zit. als: Rupprecht von Krauss, Verhältnismäßigkeit). Krebs, Walter: Vorbehalt des Gesetzes und Grundrechte, Diss. jur. Bochum, 1975, Berlin (zit. als: Walter Krebs, Vorbehalt des Gesetzes). – Kontrolle von staatlichen Entscheidungsprozessen. Ein Beitrag zur rechtlichen Analyse von gerichtlichen, parlamentarischen und Rechnungshofkontrollen, 1984, Heidelberg (zit. als: Walter Krebs, Kontrolle). – Rechtsdisziplin durch höchstrichterliche Rechtsprechung, Jura 1996, S. 181 ff. – Verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Organisationsreform der Deutschen Rentenversicherung, 1999, Bad Homburg (zit. als: Walter Krebs, Rentenversicherung). Kriele, Martin: Vorbehaltlose Grundrechte und die Rechte anderer, JA 1984, S. 629 ff. Krölls, Albert: Grundgesetz und ärztliche Niederlassungsfreiheit, GewArch 1993, S. 217 ff. Krüger, Herbert: Neues zur Freiheit der Persönlichkeitsentfaltung und deren Schranken, NJW 1955, S. 201 ff. Kunig, Philip: Das Rechtsstaatsprinzip, 1986, Tübingen (zit. als: Philip Kunig, Rechtsstaatsprinzip). – Kommentierung zu Art. 1 und Art. 2, in: Ingo von Münch / Philip Kunig (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 1, 5. Aufl. 2000, München (zit. als: Philip Kunig, in: von Münch / Kunig, GG). – Kommentierung zu Art. 70, in: Ingo von Münch / Philip Kunig (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 3, 5. Aufl. 2003, München (zit. als: Philip Kunig, in: von Münch / Kunig, GG). Larenz, Karl: Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl. 1991, Berlin u. a. (zit. als: Karl Larenz, Methodenlehre). Laufs, Adolf: Immer weniger Freiheit ärztlichen Handelns, NJW 1999, S. 2717 ff. – Zur Freiheit des Arztberufs, in: Hans-Jürgen Ahrens u. a. (Hrsg.), Festschrift für Erwin Deutsch zum 70. Geburtstag, S. 625 ff., 1999, Köln u. a. (zit. als: Adolf Laufs, FSDeutsch). Lecheler, Helmut: Artikel 12 GG – Freiheit des Berufs und Grundrecht der Arbeit, in: VVDStRL 43 (1985), S. 48 ff. – Staatsbürgerliche Rechte und Pflichten, in: Karl Heinrich Friauf / Wolfram Höfling (Hrsg.), Berliner Kommentar zum Grundgesetz, Loseblattsammlung, Bd. 2, Art. 33 (Stand der Bearbeitung: Oktober 2000), Berlin (zit. als: Helmut Lecheler, in: Friauf / Höfling, GG). – Das Berufsbeamtentum – Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit, in: Peter Badura / Horst Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. II, S. 359 ff., 2001, Tübingen (zit. als: Helmut Lecheler, FS-50 Jahre BVerfG).
Literaturverzeichnis
179
Lecheler, Helmut / Determann, Lothar: Die rechtlichen Vorgaben für die Sozialversicherungsträger bei der Bestimmung des Rechtsstatus ihrer Bediensteten, 1999, Berlin (zit. als: Helmut Lecheler / Lothar Determann, Sozialversicherungsträger). Leisner, Walter: Sozialversicherung und Privatversicherung: dargestellt am Beispiel der Krankenversicherung, 1974, Berlin (zit. als: Walter Leisner, Sozialversicherung). – Die verfassungsrechtliche Belastungsgrenze der Unternehmen: dargestellt am Beispiel der Personalzusatzkosten, 1996, Berlin (zit. als: Walter Leisner, Belastungsgrenze). – Grundgesetz und gesetzliche Krankenversicherung, in: Stefan Empter / Helge Sodan (Hrsg.), Markt und Regulierung – Rechtliche Perspektiven für eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, S. 43 ff., 2003, Gütersloh (zit. als: Walter Leisner, Grundgesetz und Krankenversicherung). – Finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung – ein grundgesetzliches Gebot?, in: Helge Sodan (Hrsg.), Finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung und Grundrechte der Leistungserbringer, S. 15 ff., 2004, Berlin (zit. als: Walter Leisner, Finanzielle Stabilität). – Die soziale Marktwirtschaft als Grundlage der Wirtschafts- und Sozialverfassung, in: Helge Sodan (Hrsg.), Die sozial-marktwirtschaftliche Zukunft der Krankenversicherung, S. 35 ff., 2005, Berlin (zit. als: Walter Leisner, Marktwirtschaft). Lenz, Sebastian / Leydecker, Philipp: Kollidierendes Verfassungsrecht – Verfassungsrechtliche Maßstäbe der Einschränkbarkeit vorbehaltloser Freiheitsrechte, DÖV 2005, S. 841 ff. Lerche, Peter: Übermaß und Verfassungsrecht, 1. Aufl. 1961, 2. Aufl. 1999, Köln u. a. (zit. als: Peter Lerche, Übermaß, 1961 bzw. 1999). – Das Bundesverfassungsgericht und die Verfassungsdirektiven, AöR 90 (1965), S. 341 ff. – Kommentierung zu Art. 120, in: Theodor Maunz / Günter Dürig u. a. (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Loseblattsammlung, (Stand der Bearbeitung: Dezember 1992), München (zit. als: Peter Lerche, in: Maunz / Dürig, GG). Lindner, Josef Franz: Theorie der Grundrechtsdogmatik, 2005, Tübingen (zit. als: Josef Franz Lindner, Grundrechtsdogmatik). Lübbe-Wolff, Gertrude: Kommentierung zu Art. 120, in: Horst Dreier (Hrsg.), GrundgesetzKommentar, Bd. 3, 1999, Tübingen (zit. als: Gertrude Lübbe-Wolff, in: Dreier, GG). Lücke, Jörg: Die Berufsfreiheit: Eine Rückbesinnung auf den Text des Art. 12 Abs. 1 GG, 1994, Heidelberg (zit. als: Jörg Lücke, Berufsfreiheit). – Der additive Grundrechtseingriff sowie das Verbot übermäßiger Gesamtbelastung des Bürgers, DVBl. 2001, S. 1469 ff. Maaß, Rainald: Die Entwicklung des Vertragsarztrechts in den Jahren 1997 und 1998, NJW 1998, S. 3390 ff. – Die Entwicklung des Vertragsarztrechts in den Jahren 1998 und 1999, NJW 1999, S. 3377 ff. – Die Entwicklung des Vertragsarztrechts in den Jahren 2003 und 2004 (Teil 1), NJW 2005, S. 9 ff. Mager, Ute: Einrichtungsgarantien, 2003, Tübingen (zit. als: Ute Mager, Einrichtungsgarantien). 12*
180
Literaturverzeichnis
Mahrenholz, Ernst Gottfried: Verfassungsgerichtsbarkeit und Gesetzgebung, in: Peter Badura / Rupert Scholz (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit und Gesetzgebung. Symposium aus Anlaß des 70. Geburtstages von Peter Lerche, S. 23 ff., 1998, München (zit. als: Ernst Gottfried Mahrenholz, Symposium-Lerche). Manssen, Gerrit: Das Kassenarztzulassungsrecht des SGB V, ZfSH / SGB 1994, S. 1 ff. – Staatsrecht II – Grundrechte, 4. Aufl. 2005, München (zit. als: Gerrit Manssen, Grundrechte). – Kommentierung zu Art. 12, in: Hermann von Mangoldt / Friedrich Klein / Christian Starck (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Bd. 1, 5. Aufl. 2005, München (zit. als: Gerrit Manssen, in: von Mangoldt / Klein / Starck, GG). Martens, Wolfgang: Öffentlich als Rechtsbegriff, 1969, Bad Homburg u. a. (zit. als: Wolfgang Martens, Öffentlich als Rechtsbegriff). Maunz, Theodor: Kommentierung zu Art. 123, in: ders. / Günter Dürig u. a. (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Loseblattsammlung (Stand der Bearbeitung: 1964), München (zit. als: Theodor Maunz, in: Maunz / Dürig, GG). – Kommentierung zu Art. 74, in: ders. / Günter Dürig u. a. (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Loseblattsammlung (Stand der Bearbeitung: 1984), München (zit. als: Theodor Maunz, in: Maunz / Dürig, GG). Maurer, Hartmut: Staatsrecht I, 4. Aufl. 2005, München (zit. als: Hartmut Maurer, Staatsrecht I). Merten, Detlef: Sind Art. 1 § 1 Nr. 37 lit. a) und Art. 2 § 10 Absatz 1 des Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetzes vom 27. 6. 1977 (BGBl. I S. 1069) im Hinblick auf die durch die Normen betroffenen Kassenärztlichen (Bundes-)Vereinigungen und die (Kassen-)Ärzte mit den Grundrechtsbestimmungen des Grundgesetzes vereinbar?, in: Karl August Bettermann / Detlef Merten, Zwei Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit des Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetzes 1977 – Kassenarztrechtsteil, S. 91 ff., 1980, Köln (zit. als: Detlef Merten, Kostendämpfungsgesetz). – Grenzen des Sozialstaates, VSSR 1995, S. 155 ff. – Die Ausweitung der Sozialversicherungspflicht und die Grenzen der Verfassung, NZS 1998, S. 545 ff. – Grundrechtliche Schutzpflichten und Untermaßverbot, in: Klaus Stern / Klaus Grupp u. a. (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Joachim Burmeister, S. 227 ff., 2005, Heidelberg (zit. als: Detlef Merten, GS-Burmeister). Möstl, Markus: Probleme der verfassungsprozeduralen Geltendmachung gesetzgeberischer Schutzpflichten, DÖV 1998, S. 1029 ff. Muckel, Stefan: Religiöse Freiheit und staatliche Letztentscheidung, 1997, Berlin (zit. als: Stefan Muckel, Religiöse Freiheit). – Verfassungsrechtliche Grenzen der Reformvorschläge zur Krankenversicherung, SGb 2004, S. 583 ff. (Teil I), S. 670 ff. (Teil II und Schluss). Müller, Friedrich: Die Einheit der Verfassung. Elemente einer Verfassungstheorie III, Schriften zur Rechtstheorie Bd. 76, 1979, Berlin (zit. als: Friedrich Müller, Einheit der Verfassung).
Literaturverzeichnis
181
Müller, Friedrich / Christensen, Ralph: Juristische Methodik, Bd. I, 8. Aufl. 2002, Berlin (zit. als: Friedrich Müller / Ralph Christensen, Methodik I). Müller-Vollbehr, Jörg: Sozialverfassung, Sozialpolitik und Sozialreform, ZRP 1984, S. 262 ff. Murswiek, Dietrich: Die staatliche Verantwortung für die Risiken der Technik: verfassungsrechtliche Grundlagen und immissionsschutzrechtliche Ausformung, 1985, Berlin. (zit. als: Dietrich Murswiek, Risiken der Technik). – Grundrechte als Teilhaberechte, soziale Grundrechte, in: Josef Isensee / Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. V, § 112, 2. Aufl. 2000, Heidelberg (zit. als: Dietrich Murswiek, HdBStR V). Muschallik, Thomas: Zur Verfassungsmäßigkeit der Altersgrenze von 55 Jahren für die vertragszahnärztliche Zulassung, MedR 1997, S. 109 ff. Nettesheim, Martin: Die Garantie der Menschenwürde zwischen metaphysischer Erhöhung und bloßem Abwägungstopos, AöR 130 (2005), S. 71 ff. Neumann, Volker: Sozialstaatsprinzip und Grundrechtsdogmatik, DVBl. 1997, S. 92 ff. – Das medizinische Existenzminimum, NZS 2006, S. 393 ff. Oldiges, Franz-Josef: Sozialversicherung und Privatversicherung nach dem GesundheitsReformgesetz aus der Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung, ZSR 1990, S. 354 ff. Ossenbühl, Fritz: Probleme und Wege der Verfassungsauslegung, DÖV 1965, S. 649 ff. – Die Interpretation der Grundrechte in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, NJW 1976, S. 2100 ff. – Die Kontrolle von Tatsachenfeststellungen und Prognoseentscheidungen durch das Bundesverfassungsgericht, in: Christian Starck (Hrsg.), Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz. Festgabe aus Anlaß des 25jährigen Bestehens des Bundesverfassungsgerichts, Bd. I, S. 458 ff., 1976, Tübingen (zit. als: Fritz Ossenbühl, FG-25 Jahre BVerfG). – Diskussionsbeitrag, in: VVDStRL 39 (1981), S. 189. – Maßhalten mit dem Übermaßverbot, in: Peter Badura / Rupert Scholz (Hrsg.), Wege und Verfahren des Verfassungslebens, Festschrift für Peter Lerche zum 65. Geburtstag, S. 151 ff., 1993, München (zit. als: Fritz Ossenbühl, FS-Lerche). Pabst, Heinz-Joachim: Fallpauschalengesetz und Spielräume kirchlicher Krankenhäuser, in: Stefan Muckel (Hrsg.), Kirche und Religion im sozialen Rechtsstaat. Festschrift für Wolfgang Rüfner zum 70. Geburtstag, S. 607 ff., 2003, Berlin (zit. als: Heinz-Joachim Pabst, FS-Rüfner). Papier, Hans-Jürgen: Sozialversicherung und Privatversicherung – verfassungsrechtliche Vorgaben, ZSR 1990, S. 344 ff. – Staatliche Monopole und Berufsfreiheit – dargestellt am Beispiel der Spielbanken, in: Joachim Burmeister u. a. (Hrsg.), Verfassungsstaatlichkeit. Festschrift für Klaus Stern zum 65. Geburtstag, S. 543 ff., 1997, München (zit. als: Hans-Jürgen Papier, FS-Stern). – Der Einfluss des Verfassungsrechts auf das Sozialrecht, in: Bernd Baron von Maydell / Franz Ruland (Hrsg.), Sozialrechtshandbuch, § 3, 3. Aufl. 2003, Baden-Baden (zit. als: Hans-Jürgen Papier, Sozialrechtshandbuch).
182
Literaturverzeichnis
– Staatsrechtliche Vorgaben für das Sozialrecht, in: Matthias von Wulffen / Otto Ernst Krasney (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundessozialgericht, S. 23 ff., 2004, Köln u. a. (zit. als: Hans-Jürgen Papier, FS-50 Jahre BSG). Pestalozza, Christian: Das Sportwette-Urteil des BVerfG – Drei Lehren über den Fall hinaus (BVerfG, NJW 2006, 1261), NJW 2006, S. 1711 ff. Philippi, Klaus Jürgen: Tatsachenfeststellungen des Bundesverfassungsgerichts, Diss. jur. Saarbrücken, 1971, Köln u. a. (zit. als: Klaus Jürgen Philippi, Tatsachenfeststellungen). Pieroth, Bodo: Materiale Rechtsfolgen grundgesetzlicher Kompetenz- und Organisationsnormen, AöR 114 (1989), S. 422 ff. – Kommentierung zu Art. 79, in: Hans D. Jarass / Bodo Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 8. Aufl. 2006, München (zit. als: Bodo Pieroth, in: Jarass / Pieroth, GG). Pieroth, Bodo / Schlink, Bernhard: Grundrechte – Staatsrecht II, 22. Aufl. 2006, Heidelberg (zit. als: Bodo Pieroth / Bernhard Schlink, Grundrechte). Pitschas, Rainer: Soziale Sicherungssysteme im „europäisierten“ Sozialstaat, in: Peter Badura / Horst Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. II, S. 827 ff., 2001, Tübingen (zit. als: Rainer Pitschas, FS-50 Jahre BVerfG). – Die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme, in: VVDStRL 64 (2005), S. 109 ff. Podlech, Adalbert: Kommentierung zu Art. 1 Abs. 1, in: Erhard Denninger / Wolfgang Hoffmann-Riem / Hans-Peter Schneider / Ekkehart Stein (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Reihe Alternativkommentare, Loseblattsammlung, Bd. 1, 3. Aufl. (Stand der Bearbeitung: 2001), Neuwied u. a. (zit. als: Adalbert Podlech, in: Denninger / Hoffmann-Riem / Schneider / Stein, GG). Poscher, Ralf: Grundrechte als Abwehrrechte, 2003, Tübingen (zit. als: Ralf Poscher, Grundrechte). Posser, Herbert / Müller, Rolf-Georg: Arzneimittelmarkt 2004 – Herstellerzwangsrabatt und Festbeträge für Patentarzneimittel, NZS 2004, S. 178 ff. Quaas, Michael: Zur Berufsfreiheit des Freiberuflers, insbesondere der Ärzte, MedR 2001, S. 34 ff. Quaas, Michael / Zuck, Rüdiger: Medizinrecht, 2005, München (zit. als: Michael Quaas / Rüdiger Zuck, Medizinrecht). Raabe, Marius: Grundrechte und Erkenntnis, Diss. jur. Kiel, 1998, Baden-Baden (zit. als: Marius Raabe, Grundrechte). Rasch, Harold: Kartellverbot und Grundgesetz, WuW 1955, S. 667 ff. Rixen, Stephan: Sozialrecht als öffentliches Wirtschaftsrecht, 2005, Tübingen (zit. als: Stephan Rixen, Sozialrecht). Robbers, Gerhard: Sicherheit als Menschenrecht. Aspekte der Geschichte, Begründung und Wirkung einer Grundrechtsfunktion, 1987, Baden-Baden (zit. als: Gerhard Robbers, Sicherheit). Rosset, Chr. / Gerth, J.: Zulassungsbeschränkungen im Kassenarztbereich nach dem Gesundheitsstrukturgesetz unter verfassungsrechtlicher Sicht, SGb 1994, S. 508 ff.
Literaturverzeichnis
183
Ruland, Franz: Notwendigkeit und Grenzen einer Reform der Finanzierung der Sozialversicherung, DRV 1985, S. 13 ff. Rupp, Hans Heinrich: Das Grundrecht der Berufsfreiheit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 92 (1967), S. 212 ff. Sachs, Michael: Kommentierung zu Art. 20 und Art. 87, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 3. Aufl. 2003, München (zit. als: Michael Sachs, in: Sachs, GG). Saueressig, Christian: Die Auslegung von Gesetzen: Eine Einführung, Jura 2005, S. 525 ff. Savigny, Friedrich Carl von: System des heutigen Römischen Rechts, Bd. I, 1840, Leipzig (zit. als: Friedrich Carl von Savigny, Römisches Recht I). Schachtschneider, Karl Albrecht: Das Sozialprinzip, 1974, Bielefeld (zit. als: Karl Albrecht Schachtschneider, Sozialprinzip). Scheuner, Ulrich: Die Funktion der Grundrechte im Sozialstaat – Grundrechte als Richtlinie und Rahmen der Staatstätigkeit, DÖV 1971, S. 505 ff. – Verfassungsgerichtsbarkeit und Gesetzgebung, DÖV 1980, S. 473 ff. Schimmelpfeng-Schütte, Ruth: Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) und Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, GesR 2004, S. 1 ff. Schlaich, Klaus: Verfassungsgerichtsbarkeit im Gefüge der Staatsfunktionen, in: VVDStRL 39 (1981), S. 99 ff. Schlaich, Klaus / Korioth, Stefan: Das Bundesverfassungsgericht, 6. Aufl. 2004, München (zit. als: Klaus Schlaich / Stefan Korioth, BVerfG). Schlehofer, Horst: Juristische Methodologie und Methodik der Fallbearbeitung, JuS 1992, S. 572 ff. Schlenker, Rolf-Ulrich: Soziales Rückschrittsverbot und Grundgesetz, 1986, Berlin (zit. als: Rolf-Ulrich Schlenker, Rückschrittsverbot). – Geschichte und Reformperspektiven der gesetzlichen Krankenkassen, in: Bertram Schulin (Hrsg.), Handbuch des Sozialversicherungsrechts, Bd. 1, § 1, 1994, München (zit. als: Rolf-Ulrich Schlenker, HdBSozVersR I). Schlink, Bernhard: Abwägung im Verfassungsrecht, Diss. jur. Heidelberg, 1976, Berlin (zit. als: Bernhard Schlink, Abwägung). – Freiheit durch Eingriffsabwehr – Rekonstruktion der klassischen Grundrechtsfunktion, EuGRZ 1984, S. 457 ff. – Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, in: Peter Badura / Horst Dreier (Hrsg.), 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. II, S. 445 ff., 2001, Tübingen (zit. als: Bernhard Schlink, FS-50 Jahre BVerfG). Schmidt, Walter: Die Freiheit vor dem Gesetz, AöR 91 (1966), S. 42 ff. Schmidt-Aßmann, Eberhard: Zum staatsrechtlichen Prinzip der Selbstverwaltung, in: Peter Selmer / Ingo von Münch (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Wolfgang Martens, S. 249 ff., 1987, Berlin u. a. (zit. als: Eberhard Schmidt-Aßmann, GS-Martens). – Grundrechtspositionen und Legitimationsfragen im öffentlichen Gesundheitswesen, 2001, Berlin u. a. (zit. als: Eberhard Schmidt-Aßmann, Grundrechtspositionen). – Verfassungsfragen der Gesundheitsreform, NJW 2004, S. 1689 ff.
184
Literaturverzeichnis
Schmitt, Carl: Verfassungslehre, 1928, München und Leipzig (zit. als: Carl Schmitt, Verfassungslehre). Schnapp, Friedrich E.: Die Verhältnismäßigkeit des Grundrechtseingriffs, JuS 1983, S. 850 ff. – Organisation der gesetzlichen Krankenversicherung, in: Bertram Schulin, Handbuch des Sozialversicherungsrechts, Bd. 1, § 49, 1994, München (zit. als: Friedrich E. Schnapp, HdBSozVersR I). – Sozialstaatlichkeit im Spannungsfeld von Eigenverantwortung und Fürsorge, DVBl. 2004, S. 1053 ff. – Verfassungsrechtliche Determinanten vertragsärztlicher Tätigkeit, in: ders. / Peter Wigge (Hrsg.), Handbuch des Vertragsarztrechts. Das gesamte Kassenarztrecht, § 4, 2. Aufl. 2006, München (zit. als: Friedrich E. Schnapp, HdBVertragsarztR). Schnapp, Friedrich E. / Kaltenborn, Markus: Verfassungsrechtliche Fragen der „Friedensgrenze“ zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung, 2000, Berlin (zit. als: Friedrich E. Schnapp / Markus Kaltenborn, Friedensgrenze). Schnappauf, Klaus-Dieter: Der Einigungsvertrag – Überleitungsgesetzgebung in Vertragsform, DVBl. 1990, S. 1249 ff. Schnath, Matthias: Die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung, in: Friedrich E. Schnapp / Peter Wigge (Hrsg.), Handbuch des Vertragsarztrechts. Das gesamte Kassenarztrecht, § 5, 2. Aufl. 2006, München (zit. als: Matthias Schnath, HdBVertragsarztR). Scholz, Rupert: Kommentierung zu Art. 20a, in: Theodor Maunz / Günter Dürig u. a. (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Loseblattsammlung (Stand der Bearbeitung: Juni 2002), München (zit. als: Rupert Scholz, in: Maunz / Dürig, GG). – Kommentierung zu Art. 12, in: Theodor Maunz / Günter Dürig u. a. (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Loseblattsammlung (Stand der Bearbeitung: Juni 2006), München (zit. als: Rupert Scholz, in: Maunz / Dürig, GG). Schroth, Ulrich: Hermeneutik, Norminterpretation und richterliche Normanwendung, in: Arthur Kaufmann / Winfried Hassemer / Ulfried Neumann (Hrsg.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 7. Aufl. 2004, Heidelberg (zit. als: Ulrich Schroth, Rechtsphilosophie). Schulin, Bertram: Rechtliche Grundprinzipien der gesetzlichen Krankenversicherung und ihre Probleme, in: ders. (Hrsg.), Handbuch des Sozialversicherungsrechts, Bd. I, § 6, 1994, München (zit. als: Bertram Schulin, HdBSozVersR I). – Anmerkung zu BSG, Urteil vom 01. 10. 1990 – 6 Rka 30 / 89, JZ 1992, S. 419 ff. Schulze-Fielitz, Helmuth: Kommentierung zu Art. 20 (Rechtsstaat), in: Horst Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 2, 2. Aufl. 2006, Tübingen (zit. als: Helmuth Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG). Schwabe, Jürgen: Krankenversorgung und Verfassungsrecht, NJW 1969, S. 2274 ff. – Probleme der Grundrechtsdogmatik, 2. Aufl. 1997, Hamburg. (zit. als: Jürgen Schwabe, Grundrechtsdogmatik). Seetzen, Uwe: Der Prognosespielraum des Gesetzgebers, NJW 1975, S. 429 ff. Seewald, Otfried: Zum Verfassungsrecht auf Gesundheit, 1981, Köln u. a. (zit. als: Otfried Seewald, Verfassungsrecht auf Gesundheit).
Literaturverzeichnis
185
Selk, Michael: Einschränkung von Grundrechten durch Kompetenzbestimmungen, JuS 1990, S. 895 ff. Siekmann, Helmut: Kommentierung zu Art. 120, in: Michael Sachs (Hrsg.), GrundgesetzKommentar, 3. Aufl. 2003, München (zit. als: Helmut Siekmann, in: Sachs, GG). Simon, Helmut: Die Stärke des Volkes mißt sich am Wohl der Schwachen, in: Bernd Bender / Rüdiger Breuer / Fritz Ossenbühl / Horst Sendler (Hrsg.), Rechtsstaat zwischen Sozialgestaltung und Rechtsschutz. Festschrift für Konrad Redeker zum 70. Geburtstag, S. 159 ff., 1993, München (zit. als: Helmut Simon, FS-Redeker). Sodan, Helge: Kollegiale Funktionsträger als Verfassungsproblem. Dargestellt unter besonderer Berücksichtigung der Kunststoffkommission des Bundesgesundheitsamtes und der Transparenzkommission, Diss. jur. FU Berlin, 1987, Frankfurt am Main (zit. als: Helge Sodan, Kollegiale Funktionsträger). – Berufsständische Zwangsvereinigungen auf dem Prüfstand des Grundgesetzes, 1991, Baden-Baden (zit. als: Helge Sodan, Zwangsvereinigungen). – Freie Berufe als Leistungserbringer im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung. Ein verfassungs- und verwaltungsrechtlicher Beitrag zum Umbau des Sozialstaates, 1997, Tübingen (zit. als: Helge Sodan, Freie Berufe). – Vorrang der Privatheit als Prinzip der Wirtschaftsverfassung, DÖV 2000, S. 361 ff. – Der Anspruch auf Rechtsetzung und seine prozessuale Durchsetzung, NVwZ 2000, S. 601 ff. – Verfassungsrechtliche Anforderungen an Regelungen gemeinschaftlicher Berufsausübung von Vertragsärzten, NZS 2001, S. 169 ff. – Verfassungsrechtsprechung im Wandel – am Beispiel der Berufsfreiheit, NJW 2003, S. 257 ff. – Zur Verfassungsmäßigkeit der Ausgliederung von Leistungsbereichen aus der gesetzlichen Krankenversicherung, NZS 2003, S. 393 ff. – Das Beitragssatzsicherungsgesetz auf dem Prüfstand des Grundgesetzes, NJW 2003, S. 1761 ff. – „Gesundheitsreform“ ohne Systemwechsel – wie lange noch?, NJW 2003, S. 2581 ff. – Die „Bürgerversicherung“ als Bürgerzwangsversicherung, ZRP 2004, S. 217 ff. – Die gesetzliche Krankenversicherung nach dem GKV-Modernisierungsgesetz – Zehn Thesen zur Gesundheitsreform, GesR 2004, S. 305 ff. – Finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung und Grundrechte der Leistungserbringer – eine Einführung, in: ders. (Hrsg.), Finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung und Grundrechte der Leistungserbringer, S. 9 ff., 2004, Berlin (zit. als: Helge Sodan, Finanzielle Stabilität). – Verfassungsrechtliche Determinanten der gesetzlichen Rentenversicherung, NZS 2005, S. 561 ff. – Die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme, in: VVDStRL 64 (2005), S. 144 ff. – Modelle künftiger Gestaltung der Krankenversicherung auf dem Prüfstand des Grundgesetzes, in: ders. (Hrsg.), Die sozial-marktwirtschaftliche Zukunft der Krankenversicherung, S. 9 ff., 2005, Berlin (zit. als: Helge Sodan, Modelle künftiger Gestaltung).
186
Literaturverzeichnis
– Privat(zahn)ärztliche Behandlungspflicht zu abgesenkten staatlichen Gebührensätzen als Verfassungsproblem, 2006, Berlin (zit. als: Helge Sodan, Privat(zahn)ärztliche Behandlungspflicht). Sodan, Helge / Gast, Olaf: Die Relativität des Grundsatzes der Beitragssatzstabilität, NZS 1998, S. 497 ff. – Umverteilung durch „Risikostrukturausgleich“: verfassungs- und europarechtliche Grenzen des Finanztransfers in der gesetzlichen Krankenversicherung, 2002, Berlin (zit. als: Helge Sodan / Olaf Gast, Risikostrukturausgleich). Sodan, Helge / Ziekow, Jan: Grundkurs Öffentliches Recht, 2005, München (zit. als: Helge Sodan / Jan Ziekow, Öffentliches Recht). Spoerr, Wolfgang / Winkelmann, Julia: Rechtliche Koordinaten des Finanzausgleichs unter Krankenkassen – Die BSG-Urteile zum Risikostrukturausgleich (RSA) vom 24. Januar 2003, NZS 2004, S. 402 ff. Starck, Christian: Praxis der Verfassungsauslegung, 1994, Baden-Baden (zit. als: Christian Starck, Verfassungsauslegung). – Kommentierung zu Art. 1, in: Hermann von Mangoldt / Friedrich Klein / Christian Starck (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. 1, 5. Aufl. 2005, München (zit. als: Christian Starck, in: von Mangoldt / Klein / Starck, GG). Stein, Ekkehart: Kommentierung zu Einleitung vor Art. 1, in: Erhard Denninger / Wolfgang Hoffmann-Riem / Hans-Peter Schneider / Ekkehart Stein (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Reihe Alternativkommentare, Loseblattsammlung, Bd. 1, 3. Aufl. (Stand der Kommentierung: 2001), Neuwied u. a. (zit. als: Ekkehart Stein, in: Denninger / Hoffmann-Riem / Schneider / Stein, GG). Steiner, Udo: Das Bundesverfassungsgericht und die Volksgesundheit, MedR 2003, S. 1 ff. Stern, Klaus: Zur Verfassungstreue der Beamten, 1974, München (zit. als: Klaus Stern, Verfassungstreue) – Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, 2. Aufl. 1984, München (zit. als: Klaus Stern, Staatsrecht I). – Zur Entstehung und Ableitung des Übermaßverbotes, in: Peter Badura / Rupert Scholz (Hrsg.), Wege und Verfahren des Verfassungslebens, Festschrift für Peter Lerche zum 65. Geburtstag, S. 165 ff., 1993, München (zit. als: Klaus Stern, FS-Lerche). – Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III / 2, 1994, München (zit. als: Klaus Stern / ggf. Bearbeiter, Staatsrecht III / 2). – Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. IV / 1, 2006, München (zit. als: Klaus Stern / ggf. Bearbeiter, Staatsrecht IV / 1). Stettner, Rupert: Grundfragen einer Kompetenzlehre, 1983, Berlin (zit. als: Rupert Stettner, Kompetenzlehre). Stober, Rolf: Die körperschaftlich organisierten Sozialversicherungsträger, JA 1986, S. 534 ff. – Kassenärztliche Bedarfsplanung und Freiheit der Berufsausübung, MedR 1990, S. 10 ff.
Literaturverzeichnis
187
Stockhausen, Martin: Ärztliche Berufsfreiheit und Kostendämpfung: Möglichkeiten und Grenzen der Beschränkung der (kassen-)ärztlichen Berufsfreiheit zum Zwecke der Kostendämpfung im Gesundheitswesen, Diss. jur. Hamburg, 1989, Hamburg (zit. als: Martin Stockhausen, Berufsfreiheit). Stolleis, Michael (Hrsg.): Quellen zur Geschichte des Sozialrechts, 1976, Göttingen u. a. (zit. als: Michael Stolleis, Quellen). Szczekalla, Peter: Die sogenannten grundrechtlichen Schutzpflichten im deutschen und europäischen Recht: Inhalt und Reichweite einer „gemeineuropäischen Grundrechtsfunktion“, Diss. jur. Osnabrück, 2002, Berlin (zit. als: Peter Szczekalla, Schutzpflichten). Tettinger, Peter J.: Das Grundrecht der Berufsfreiheit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 108 (1983), S. 92 ff. – Verfassungsrecht und Wirtschaftsordnung, DVBl. 1999, S. 679 ff. – Kommentierung zu Art. 12, in: Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 3. Aufl. 2003, München (zit. als: Peter J. Tettinger, in: Sachs, GG). Tomuschat, Christian: Verfassungsgewohnheitsrecht? Eine Untersuchung zum Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 1972, Heidelberg (zit. als: Christian Tomuschat, Verfassungsgewohnheitsrecht). Uerpmann, Robert: Das öffentliche Interesse, 1999, Tübingen (zit. als: Robert Uerpmann, Öffentliches Interesse). Unruh, Peter: Zur Dogmatik der grundrechtlichen Schutzpflichten, 1996, Berlin (zit. als: Peter Unruh, Schutzpflichten). Volkmann, Uwe: Solidarität – Programm und Prinzip der Verfassung, 1998, Tübingen (zit. als: Uwe Volkmann, Solidarität). Voßkuhle, Andreas: Kommentierung zu Art. 93, in: Hermann von Mangoldt / Friedrich Klein / Christian Starck (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Bd. 3, 5 Aufl. 2005, München (zit. als: Andreas Voßkuhle, in: von Mangoldt / Klein / Starck, GG). Waechter, Kay: Forschungsfreiheit und Fortschrittsvertrauen, Der Staat 30 (1991), S. 19 ff. Wagner, Heiko: Der Einigungsvertrag nach dem Beitritt: Fortbestehen, Bestandssicherheit und Rechtswahrung vor dem Bundesverfassungsgericht, Diss. jur. München, 1994, Berlin (zit. als: Heiko Wagner, Einigungsvertrag). Wallerath, Maximilian: Der Sozialstaat in der Krise, JZ 2004, S. 949 ff. Wannagat, Georg: Zulassungsbeschränkungen im Kassenarztbereich aus rechtlicher Sicht, MedR 1986, S. 1 ff. Weber, Werner: Die verfassungsrechtlichen Grenzen sozialstaatlicher Forderungen, Der Staat 4 (1965), S. 409 ff. Weis, Hubert: Verfassungsrechtliche Fragen in Zusammenhang mit der Herstellung der staatlichen Einheit Deutschlands, AöR 116 (1991), S. 1 ff. Weiß, Wolfgang: Der Vertragsarzt zwischen Freiheit und Bindung, NZS 2005, S. 67 ff. Werner, Rica: Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im Beitragsrecht der gesetzlichen Krankenversicherung, Diss. jur. Greifswald, 2004, Berlin (zit. als: Rica Werner, Leistungsfähigkeit).
188
Literaturverzeichnis
Wiederin, Ewald: Die Gesetzeskraft der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, in: Michael Brenner / Peter M. Huber / Markus Möstl (Hrsg.), Der Staat des Grundgesetzes – Kontinuität und Wandel. Festschrift für Peter Badura zum siebzigsten Geburtstag, S. 605 ff., 2004, Tübingen (zit. als: Ewald Wiederin, FS-Badura). – Sozialstaatlichkeit im Spannungsfeld von Eigenverantwortung und Fürsorge, in: VVDStRL 64 (2005), S. 53 ff. Wieland, Joachim: Kommentierung zu Art. 12, in: Horst Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 1, 2. Aufl. 2004, Tübingen (zit. als: Joachim Wieland, in: Dreier, GG). Wigge, Peter: Die Rechtsstellung des Vertragsarztes, in: Friedrich E. Schnapp / Peter Wigge (Hrsg.), Handbuch des Vertragsarztrechts. Das gesamte Kassenarztrecht, § 2, 2. Aufl. 2006, München (zit. als: Peter Wigge, HdBVertragsarztR). – Zur Verfassungsmäßigkeit der Beschränkung der Abrechnungsgenehmigung in der Kernspintomographie-Vereinbarung auf die Fachgebiete Radiologie und Nuklearmedizin, NZS 2005, S. 176 ff. Wimmer, Raimund: Rechtsstaatliche Defizite im vertragsärztlichen Berufsrecht, NJW 1995, S. 1577 ff. – Der Rechtsanspruch von Vertragsärzten auf angemessene Vergütung, MedR 1998, S. 533 ff. Wolff, Hans J. / Bachof, Otto / Stober, Rolf: Verwaltungsrecht I, 11. Aufl. 1999, München (zit. als: Hans J. Wolff / Otto Bachof / Rolf Stober, Verwaltungsrecht, Bd. 1). Wolff, Heinrich Amadeus: Ungeschriebenes Verfassungsrecht unter dem Grundgesetz, 2000, Tübingen (zit. als: Heinrich Amadeus Wolff, Ungeschriebenes Verfassungsrecht). Wollenschläger, Michael / Krogull, Jutta: Zur Verfassungsmäßigkeit der Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung durch das Beitragssatzsicherungsgesetz, NZS 2005, S. 237 ff. Zacher, Hans F.: Das soziale Staatsziel, in: Josef Isensee / Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, § 28, 3. Aufl. 2004 (zit. als: Hans F. Zacher, HdBStR II). Ziekow, Jan: Eigenverantwortung als Verfassungsprinzip, in: Stefan Brink / Heinrich Amadeus Wolff (Hrsg.), Gemeinwohl und Verantwortung. Festschrift für Hans Herbert von Armin zum 65. Geburtstag, S. 189 ff., 2004, Berlin (zit. als: Jan Ziekow, FS-Armin).
Sachregister Abwägung 65, 68, 94 Abwehrfunktion der Grundrechte 88 Abwehrrechte 87 Altersgrenzen 15, 132, 133, 146, 168 Angemessenheit 51, 143, 147, 148, 149, 150 Apotheken-Urteil 68 Arbeitgeber 29, 55 Arzneimittelausgaben 31, 32, 38, 48 Arztzahlen 34, 47, 48 Auffanggrundrecht 70 Ausgabenentwicklung 27, 30, 31, 39, 44, 46, 49, 57, 134 Auslegung 18, 21, 22, 41, 42, 59, 60, 99, 104, 106 Auslegungsmethoden 21, 60, 166 Beeinträchtigung 65, 92, 133, 156, 161 Beitragsstabilität 23, 24, 34, 36, 57 Beitragszahler 54, 81, 159 Beitrittsgebiet 31, 45, 113, 114, 160 Beliehener 113 Beruf 69, 112, 113, 167 Berufsausübungsfreiheit 67 Berufsfreiheit 17, 18, 19, 25, 41, 56, 57, 67, 68, 69, 70, 76, 85, 87, 103, 128, 129, 137, 148, 150, 154, 163, 164 Berufswahlfreiheit 67, 68, 69 Bestandsgarantie 109 Beweislast 139, 147, 150 Bürger(zwangs)versicherung 13 Bundesstaat 73, 74 Divergenz 96 Drei-Stufen-Theorie 16, 67, 68, 69, 70, 72, 129, 130, 144, 148, 149, 150, 154, 157, 165, 168 Effektivität 76 Eigentumsfreiheit 70 Eingriffsintensität 133, 143, 144, 148, 149
Einrichtungsgarantie 63, 64, 111, 119 Einschätzungsprärogative 123, 124, 137, 140, 143, 156, 158 Entstehungsgeschichte 41, 112, 118 Erforderlichkeit 17, 76, 126, 129, 130, 147, 148, 149, 150, 156, 159 Ermächtigung 18, 19 Erwerbschancen 156 Evidenz 124, 141, 148, 149, 168 Existenzgefährdung 43 Existenzminimum 75, 80, 102 Fehlsamkeit 126, 136 Festbeträge 47 Funktionsfähigkeit 15, 16, 18, 20, 23, 31, 33, 34, 38, 41, 54, 62, 64, 72, 76, 79, 113, 121, 122, 129, 131, 132, 137, 146, 147, 156, 166 Funktionsordnung 93 Geeignetheit 126, 129, 146, 149 Gefälligkeitsleistungen 155 Gemeinschaftsgüter 57, 66, 67, 68, 72, 149, 150, 154 Gemeinwohl 23, 31, 36, 57, 58, 64, 65, 86, 87 Gemeinwohlbelang 17, 23, 24, 25, 32, 33, 35, 52, 56, 57, 59, 63, 64, 65, 66, 70, 72, 87, 103, 120, 136, 137, 156, 165 Gerechtigkeit 74 Gesamtschau 110, 111 Gesetzeskraft 116 Gesetzeszweck 38, 112 Gesetzgebungskompetenzen 106, 108, 115, 116 Gestaltungsfreiheit 71, 93, 100 Gesundheit 13, 14, 35, 51, 87, 90, 91, 99, 101, 102, 152 Gesundheitsprämie 13 Gesundheitsrecht 50
190
Sachregister
Gesundheitsschutz 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 48, 49, 80, 96, 97, 98, 100, 166 Gewerbebetrieb 70 Grundrechte 19, 20, 63, 65, 67, 68, 69, 73, 78, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 114, 125, 128, 130, 131, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 163 Grundrechtseingriffe 15, 65, 105, 132, 133, 136, 150, 168 Grundrechtsschranken 90, 91 Hierarchisierung 29 Hüter der Verfassung 131, 163 Judikative 93 Justiziabilität 129, 142 Kassenarzturteil 112, 125, 163 körperliche Unversehrtheit 82, 87, 92, 99, 101, 143 Kompetenzbestimmungen 102, 103, 104, 106, 107, 108 Konkordanz 66 Kontrolldichte 122, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 168 Kontrolle 17, 41, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 135, 138, 139, 141, 142, 149, 150, 155, 161, 163, 167, 168 Kontrollmaßstab 96, 122, 126, 129, 150, 167 Konvergenz 96 Kostendämpfung 27, 30, 31, 32, 35, 38, 44, 47, 56, 57, 58 Krankenkassen 23, 24, 31, 34, 36, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 97, 114, 119, 132, 162, 163 Leben 77, 82, 87, 89, 92, 95, 99, 128, 143 Legislative 93 Leistungserbringer 19, 26, 28, 33, 50, 54, 69, 85, 98, 112, 131, 132, 133, 134, 138 Leistungsfähigkeit 44, 46, 49, 51, 54, 57, 58, 63, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 105, 106, 108, 109, 110, 152, 158 Leistungskürzungen 15, 39, 40, 60, 97, 100 Leistungsrecht 88, 99, 100
Menschenwürde 89, 90, 101 Menschenwürdekern 90 Mitbestimmungsurteil 123, 124, 126, 129, 134, 141, 142, 161 Mittelbeschaffung 41, 71, 120 Monopol 157 Nachbesserungspflicht 135, 143 Nasciturus-Urteil 95 Neuzulassung 44 Objekt 102 öffentliches Amt 113 Pflegesätze 38 Preismoratorium 48, 160 Privatversicherung 49, 52, 97, 98, 155 Privatversicherungspflicht 98 Prognose 124, 139, 143 Prognosespielraum 123 Programmsatz 74 Prüfungsmaßstab 70 Punktwertdegression 33, 160 Qualitätsverbesserung 32, 35, 38, 40, 45, 46, 47, 49, 51 Rechtsstaat 63, 73, 74, 79, 107, 147 Rechtsstaatsprinzip 28, 29, 145 Rechtsüberzeugung 115, 116, 167 Risikostrukturausgleich 34, 40, 98, 118, 126 Rückabwicklung 18, 131 Sachleistungsprinzip 79, 111 Schutzbedürftigkeit 55, 81, 82, 83, 84, 158 Schutzbereich 91 Schutzpflicht 80, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 166 Schutzzweck 31, 37, 119 Selbstbestimmung 101 Selbstverwaltung 49, 106, 108 Sinn und Zweck 60, 165 Sonderrecht 19 Sozialordnung 75, 78, 80, 81, 85, 166 Sozialstaat 34, 74 Sozialstaatsprinzip 47, 73, 74, 77, 79, 80, 83, 85, 86, 91, 99, 116, 118, 136, 167
Sachregister Sozialversicherung 19, 29, 36, 66, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 96, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 120, 122, 135, 166 Spielraum 17, 20, 49, 80, 93, 95, 100, 105, 119, 122, 125, 126, 127, 129, 135, 136, 138, 139, 140, 143, 158, 159, 160, 161, 167 staatlich gebundener Beruf 113 Staatszielbestimmung 73, 74, 77, 80, 86, 111, 125, 167 Subsidiarität 87, 131 Systemerhaltung 40, 41, 57 Tatsache 36, 105, 115, 139, 159 Tatsachenmaterial 124, 125, 142 tatsächliche Übung 115, 167 Teilhaberechte 88 Übermaßverbot 94, 144 Überprüfbarkeit 89, 95, 122, 136 Ungleichbehandlung 141 Untermaßverbot 94 Unterprinzip 29 Verfassungsänderung 74 Verfassungseinrichtungen 106 Verfassungsgarantie 78, 99, 105, 108, 117 Verfassungsgewohnheitsrecht 115, 116, 167 Verfassungsrang 59, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 85, 87, 88, 91, 92, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
191
105, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 129, 138, 144, 149, 150, 154, 163, 165, 166, 167 Verfassungsurkunde 114 Vergütung 30, 56, 111, 132 Verhältnismäßigkeit 60, 133, 144, 145, 147, 165 Versicherungsgrad 13 Versicherungspflichtgrenze 14, 16, 33, 49, 82, 84, 155, 156, 158, 159, 161, 168 Versorgung 18, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 43, 44, 454, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 87, 91, 97, 100, 132, 133, 134, 151, 152, 153, 154, 165 Vertretbarkeit 124 Verwaltungskompetenz 108 Volksgesundheit 32, 35, 37, 40, 56, 57, 66, 87, 100 Wahrscheinlichkeit 124, 154 Wechselfälle des Lebens 75, 76, 77, 80 Weimarer Republik 116 Wertung 60, 139 Wettbewerb 34, 47, 158 Willkür 71, 101 Wirtschaftlichkeitsprüfungen 44 Wortlautveränderung 22 Zulassung 16, 18, 44, 133, 151 Zulassungsbeschränkungen 15, 16, 132 Zumutbarkeit 98, 144, 147
![Umverteilung durch »Risikostrukturausgleich«: Verfassungs- und europarechtliche Grenzen des Finanztransfers in der Gesetzlichen Krankenversicherung [1 ed.]
9783428507092, 9783428107094](https://dokumen.pub/img/200x200/umverteilung-durch-risikostrukturausgleich-verfassungs-und-europarechtliche-grenzen-des-finanztransfers-in-der-gesetzlichen-krankenversicherung-1nbsped-9783428507092-9783428107094.jpg)
![Arzneimittellisten und Grundrechte: Eine verfassungsrechtliche Untersuchung der Ausschlüsse von Arzneimitteln von der Verordnungsfähigkeit zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung aus der Sicht der Hersteller und der Verbraucher [1 ed.]
9783428483662, 9783428083664](https://dokumen.pub/img/200x200/arzneimittellisten-und-grundrechte-eine-verfassungsrechtliche-untersuchung-der-ausschlsse-von-arzneimitteln-von-der-verordnungsfhigkeit-zu-lasten-der-gesetzlichen-krankenversicherung-aus-der-sicht-der-hersteller-und-der-verbraucher-1nbsped-9783428483662-9783428083664.jpg)
![Der Präventionsauftrag der gesetzlichen Unfallversicherung: Verfassungs- und europarechtliche Vorgaben für Präventionsmaßnahmen [1 ed.]
9783428533527, 9783428133529](https://dokumen.pub/img/200x200/der-prventionsauftrag-der-gesetzlichen-unfallversicherung-verfassungs-und-europarechtliche-vorgaben-fr-prventionsmanahmen-1nbsped-9783428533527-9783428133529.jpg)
![Die Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung: Eine empirische Analyse am Beispiel der Allgemeinen Ortskrankenkassen [1 ed.]
9783428470556, 9783428070558](https://dokumen.pub/img/200x200/die-ausgaben-in-der-gesetzlichen-krankenversicherung-eine-empirische-analyse-am-beispiel-der-allgemeinen-ortskrankenkassen-1nbsped-9783428470556-9783428070558.jpg)

![Die Eigenverantwortung gesetzlich Krankenversicherter unter besonderer Berücksichtigung der Risiken wunscherfüllender Medizin: Eine verfassungs- und sozialrechtliche Untersuchung [1 ed.]
9783428542741, 9783428142743](https://dokumen.pub/img/200x200/die-eigenverantwortung-gesetzlich-krankenversicherter-unter-besonderer-bercksichtigung-der-risiken-wunscherfllender-medizin-eine-verfassungs-und-sozialrechtliche-untersuchung-1nbsped-9783428542741-9783428142743.jpg)
![Dezentrale Wohlfahrtsstaatlichkeit im föderalen Binnenmarkt?: Eine verfassungs- und sozialrechtliche Untersuchung am Beispiel der Vereinigten Staaten von Amerika [1 ed.]
9783428503254, 9783428103256](https://dokumen.pub/img/200x200/dezentrale-wohlfahrtsstaatlichkeit-im-fderalen-binnenmarkt-eine-verfassungs-und-sozialrechtliche-untersuchung-am-beispiel-der-vereinigten-staaten-von-amerika-1nbsped-9783428503254-9783428103256.jpg)
![Das Steuerstrafrecht im Spannungsfeld des Verfassungs- und Europarechts: Eine kritische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Wertungsdivergenzen zwischen Steuer- und Steuerstrafrecht als Verfassungsproblem, der Hinterziehung verfassungswidriger Steuern sowie der verfassungs- und europarechtlichen Grenzen der Steu [1 ed.]
9783428505265, 9783428105267](https://dokumen.pub/img/200x200/das-steuerstrafrecht-im-spannungsfeld-des-verfassungs-und-europarechts-eine-kritische-untersuchung-unter-besonderer-bercksichtigung-der-wertungsdivergenzen-zwischen-steuer-und-steuerstrafrecht-als-verfassungsproblem-der-hinterziehung-verfassungswidriger-steuern-sowie-der-verfassungs-und-europarechtlichen-grenzen-der-steu-1nbsped-9783428505265-9783428105267.jpg)
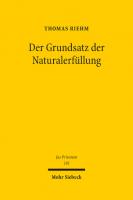
![Zur Problematik unterschiedlicher Risikostruktur und ihres Ausgleichs in der Sozialversicherung: insbesondere in der gesetzlichen Krankenversicherung [1 ed.]
9783428461929, 9783428061921](https://dokumen.pub/img/200x200/zur-problematik-unterschiedlicher-risikostruktur-und-ihres-ausgleichs-in-der-sozialversicherung-insbesondere-in-der-gesetzlichen-krankenversicherung-1nbsped-9783428461929-9783428061921.jpg)
![Der Grundsatz der finanziellen Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung: Eine verfassungs- und sozialrechtliche Untersuchung [1 ed.]
9783428524068, 9783428124060](https://dokumen.pub/img/200x200/der-grundsatz-der-finanziellen-stabilitt-der-gesetzlichen-krankenversicherung-eine-verfassungs-und-sozialrechtliche-untersuchung-1nbsped-9783428524068-9783428124060.jpg)