Das Paar im Fokus: Eheberatung in Westdeutschland 1945–1965 9783111097534, 9783111088983
Marriage counseling did not just serve those looking for advice but also performed a task that affected society as a who
200 46 4MB
German Pages 440 Year 2023
Polecaj historie
Table of contents :
Danksagung
Inhalt
Einleitung
1 Die Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik und ihre Entwicklung im „Dritten Reich“
2 Ehe von der frühen Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1960er-Jahre
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
4 Katholische Eheberatung
Fazit
Abkürzungen
Quellen und Literatur
Register
Citation preview
Vera-Maria Giehler Das Paar im Fokus
Family Values and Social Change
Edited by Isabel Heinemann
Volume 7
Vera-Maria Giehler
Das Paar im Fokus Eheberatung in Westdeutschland 1945–1965
Zugl.: Diss. Ludwig-Maximilians-Universität München, Dr. phil. 2022
ISBN 978-3-11-108898-3 e-ISBN (PDF) 978-3-11-109753-4 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-109907-1 ISSN 2366-9462 Library of Congress Control Number: 2023933911 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. © 2023 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Einbandabbildung: Plakat der katholischen Beratungsstelle für Ehe- und Familienfragen, Historisches Archiv des Erzbistums Köln/AEK, DBK, KZI 28 Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com
Für Florian und Emmy
Danksagung Die vorliegende Arbeit wurde im Oktober 2021 als Dissertation an der LudwigMaximilians-Universität München an der Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften eingereicht. Ohne zahlreiche Unterstützung hätte sie in dieser Form nicht realisiert werden können. Mein Dank gilt zunächst meiner Erstgutachterin Prof. Dr. Margit Szöllösi-Janze für die Betreuung und insbesondere für das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht hat. Sie hat mir damit die Chance gegeben, meine Dissertation zu verwirklichen. Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit, Elternzeit und erschwerter Arbeitsbedingungen während der Coronapandemie zog sich die Ausarbeitung über längere Zeit hin – in der Prof. Szöllösi-Janze mich auch weiter begleitete. Ebenfalls danken möchte ich Prof. Dr. Michael Hochgeschwender, der meine Arbeit als Zweitgutachter betreute und mir Hinweise zur kirchengeschichtlichen Forschung gab. Dass meine Dissertation in der Reihe „Family Values and Social Change“ erscheinen kann, freut mich besonders. Der Herausgeberin der Reihe Prof. Dr. Isabel Heinemann gebührt dafür mein Dank. Bei der Recherche für diese Arbeit haben mich zahlreiche Archive, Institutionen und Einzelpersonen unterstützt. Für die Freigabe des noch unter Schutzfrist stehenden Materials danke ich dem Landesarchiv Berlin und dem Historischen Archiv des Erzbistums Köln. In Letzterem beantwortete Lena Wormans mir zahlreiche Fragen. Auch Institutionen wie Eheberatungsstellen und ihre Akteure, die in ihrem Alltag nicht mit historischer Forschung in Berührung kommen, stellten mir Dokumente zur Verfügung oder führten mit mir Gespräche. Für diese Bereitschaft und die daraus entstandenen Einblicke danke ich ihnen. Ebenso bedanke ich mich bei allen Wissenschaftlern, die mir mit ihrer Expertise weiterhalfen und Denkanstöße gaben, durch die meine Arbeit fachliche Fundierung erfuhr. Für die Unterstützung bei der Drucklegung gilt mein Dank Dr. Daniela Gasteiger, die mich umsichtig und engagiert begleitet hat. Bei Maria Nyström bedanke ich mich für unseren wöchentlichen Austausch, der mir über die letzten Jahre eine wichtige Begleitung war. Erwähnen möchte ich die Publikation „Sex before the Sexual Revolution: Intimate Life in England, 1918 – 1963“ von Simon Szreter und Kate Fisher, die mich inspiriert hat, das Thema Eheberatung zu untersuchen. Mein abschließender und größter Dank gilt meinem Mann und meiner Tochter. Ihnen ist dieses Buch gewidmet. Ingolstadt, im Mai 2023
Vera-Maria Giehler
Inhalt Einleitung 1 Forschungsgegenstand und Fragestellung Forschungsüberblick 6 Quellen und Archive 11 13 Aufbau
1
Die Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik und ihre Entwicklung im „Dritten Reich“ 15 16 . Amtliche Beratungsstellen . Kirchliche Beratungsstellen 27 . Zwischenfazit 39
Ehe von der frühen Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1960er-Jahre 42 . Ehe und Familie bei Kriegsende 43 46 . Heimkehrerehen . Liebe und Sexualität 50 . Wirtschaftliche Verhältnisse und Frauenerwerbstätigkeit 53 55 . „Krise der Ehe“ und Familie im Wandel . Ehe- und Familienrecht 56 . Politische Einbindung der Eheberatung in das Bundesministerium für Familienfragen 64 67 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung . Eheberatung in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik 67 . Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung 89 . Selbstverständnis und Professionalisierung nichtkonfessioneller und evangelisch geprägter Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen 120 . Zusammenarbeit und Konkurrenz der DAJEB mit konfessioneller Eheberatung 158 . Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort 165 . Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle BerlinReinickendorf 199 . Zwischenfazit 244 Katholische Eheberatung 248 . Katholische Kirche und Theologie im Wandel
249
X
. . . . . Fazit
Inhalt
Das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen 272 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer 297 Eheberatung Zusammenarbeit der katholischen Eheberatung mit DAJEB und EZI Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts und der 341 Beratungsstellen vor Ort Zwischenfazit 392 396
Abkürzungen
407
Quellen und Literatur 408 408 Archive Online-Ressourcen 409 Gedruckte Quellen und Darstellungen Register
426
410
336
Einleitung Die vorliegende Arbeit untersucht die institutionalisierten nichtkonfessionellen sowie katholisch gebundenen Eheberatungsstellen in Westdeutschland im Zeitraum von 1945 bis 1965. Sie verfolgt die Forschungsfrage, in welchem Verhältnis Selbstverständnis und Praxis der Akteure standen. Dabei lautet die zentrale These, dass in beiden Beratungsrichtungen deutliche Ambivalenzen vorlagen. Diese reichten besonders in der nichtkonfessionellen Beratung, die häufig evangelisch beeinflusst war, bis hin zu Widersprüchlichkeiten.
Forschungsgegenstand und Fragestellung Eheberatung diente einerseits konkret den Ratsuchenden, erfüllte andererseits in den Augen ihrer Akteure jedoch auch eine zentrale soziale und letztlich staatstragende Aufgabe. Sie erlaubte einen Zugriff auf die „Keimzelle der Gesellschaft“, als welche die Ehe galt, und damit verknüpfte Ordnungsvorstellungen. Dies rief in der Nachkriegszeit zahlreiche Verbände und Persönlichkeiten, die Kirchen, aber auch bestimmte Berufsgruppen wie Mediziner und Psychologen auf den Plan, die ihre Deutungen von Ehe teilweise in Konkurrenz zueinander durchzusetzen suchten. Bei der katholischen Beratung kam die Funktion als Sakrament hinzu. Damit wurde die Arbeit zu einem Dienst an Gott und der Kirche. Nichtkonfessionelle und katholische Eheberatung erweisen sich damit als Forschungsgegenstand, der im Schnittpunkt verschiedenster Entwicklungen steht. Nach den Anfängen in der Weimarer Republik erfuhr die Beratung in der Nachkriegszeit und frühen Bundesrepublik einen deutlichen Ausbau. Wesentliche Einflüsse waren zeitgenössische Befürchtungen einer „Krise der Ehe“, die Rechristianisierungsbemühungen der katholischen Kirche und eugenisches Denken, das sich in der nichtkonfessionellen und evangelisch geprägten Beratung hielt. Die in der Nachkriegszeit zu beobachtenden Kontinuitäten und Veränderungen spiegelten sich sowohl in der praktischen Arbeit als auch in den Akteuren. Dabei zeichneten sich bereits die erheblichen gesellschaftlichen Umbrüche in den Ehe- und Familienverhältnissen ab, die im Lauf der 1960er-Jahre zum Durchbruch kommen sollten. In diesem Zusammenhang betont beispielsweise Anette Timm die Bedeutung der Praxisebene: „[I]nsisting on continuities (or ruptures) in welfare state provision after 1945 without looking at local practice can be extremely misleading.“¹ Diese Aussage erweist sich auch für die vor-
Timm, Annette F.: The Politics of Fertility in Twentieth-Century Berlin. New York 2010, S. 253. https://doi.org/10.1515/9783111097534-001
2
Einleitung
liegende Untersuchung als grundlegend. Nur die Sicht auf die konkrete Umsetzung der Beratungsarbeit ermöglicht einen differenzierten Blick auf den Gegenstand. Eheberatung bezüglich Selbstverständnis und Praxis der involvierten Akteure und Institutionen hin zu beleuchten, eröffnet ein weites Blickfeld: auf Vorstellungen von Ehe und Familie sowie gesellschaftlich erwünschtem (Reproduktions‐)Verhalten; auf das Selbstbild, das berufliche Verständnis und Handeln sowie die Intentionen der Beratenden², deren institutionelle Einbindung und Professionalisierung; die Ratsuchenden sowie für die katholische Beratung zusätzlich auf das Verhältnis zu Glauben, Kirche und Lehramt. Da die nichtkonfessionelle und die katholische Eheberatung die beherrschenden Richtungen darstellten, erschließt deren Betrachtung das Gros der Beratungslandschaft sowie maßgebliche Deutungskonkurrenzen. Die vorliegende Studie nimmt sowohl das zeitgenössisch offen thematisierte als auch das nicht explizit formulierte Selbstverständnis der verschiedenen Akteure in den Blick. Dabei ist zwischen den Haltungen zu differenzieren, welche die Leitungsebene der jeweiligen Beratungseinrichtung erkennen ließ, und den Einstellungen der Berater selbst. Die Arbeit nähert sich diesem Selbstverständnis erstens über praxisorientierte Zugänge, zweitens über die Institutionalisierung der Organisationsstruktur sowie drittens über die in diesem Rahmen vorangetriebene Professionalisierung. In den Fokus der Analyse rücken deshalb vor allem die bundesweit agierende Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (DAJEB) und das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen (KZI). Für die Praxis konzentriert sich die Darstellung auf diejenigen Eheprobleme, die angesprochen wurden, sowie die Frage, wie die Akteure konkrete Beratungssituationen gestalteten und darüber berichteten. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, das Selbstverständnis der Beratenden mit der konkreten Umsetzung zu vergleichen. Auch die Ratsuchenden und ihr Verhalten werden mit einbezogen, um ein umfassendes Bild zu gewinnen. Konkreter Forschungsgegenstand sind daher diejenigen Eheberatungsstellen, welche Hilfe im Krisenfall anboten und sich an beide Partner wandten. Berücksichtigung finden hier sowohl nichtkonfessionelle als auch katholische Einrichtungen. Nicht näher betrachtet werden somit beispielsweise Institutionen, die sich lediglich an Frauen wandten, auf Geburtenregelung spezialisiert waren oder vorbeugende Eheschulungen anboten. Das gilt auch für Pro Familia, die zu diesem Zeitpunkt zudem nur eine untergeordnete Rolle spielte. Die spezifischen gesell Im Folgenden steht die männliche Form Berater bzw. Eheberater in Hinblick auf die nichtkonfessionelle Eheberatung, da dort vor allem Männer als Akteure sichtbar werden; ebenso in der evangelischen Beratung. Hingegen wird bei der katholischen Eheberatung von Beraterinnen bzw. Eheberaterinnen gesprochen, da hier in erster Linie Frauen berieten.
Forschungsgegenstand und Fragestellung
3
schaftlichen, politischen und juristischen Rahmenbedingungen in der DDR lassen einen Zuschnitt auf Westdeutschland mit Westberlin sinnvoll erscheinen. Der evangelischen Eheberatung kam bis zu ihrem organisatorischen Zusammenschluss 1959 nur eine marginale Bedeutung zu, da sie lediglich über wenige Stellen verfügte. Aus diesem Grunde bildet sie in der folgenden Darstellung keinen eigenen Schwerpunkt, erhält aber dennoch Aufmerksamkeit, da sie wichtige Berührungspunkte mit den beiden untersuchten Beratungsrichtungen aufwies. Zum einen prägten evangelische Akteure über die DAJEB das nichtkonfessionelle Angebot, zum anderen herrschte zur katholischen Richtung eine gewisse Konkurrenz. Für die Kontextualisierung des Untersuchungsgegenstands wurden weitere Themengebiete berücksichtigt. Beispielsweise spielte die zeitgenössische Sexualmoral in der Eheberatung eine wichtige Rolle und fand deshalb Eingang in die Überlegungen. Aspekte, die in der Beratungsarbeit nur ansatzweise dokumentiert sind, etwa Vergewaltigungen, fallen hingegen weitestgehend aus der Studie heraus. Der Untersuchungszeitraum umfasst die Jahre 1945 bis 1965. Auch wenn der 8. Mai 1945 für die Eheberatung keine feste Epochengrenze darstellt, empfiehlt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs als Beginn, da sich neue gesellschaftliche, politische und juristische Voraussetzungen herausbildeten. Besondere Berücksichtigung finden die zeitlichen Kontinuitätslinien zurück in den Nationalsozialismus und die Weimarer Republik. Der für die Arbeit gewählte Schlusspunkt 1965 liegt in dem in dieser Zeit erheblichen Umbruch der Ehe- und Familienverhältnisse begründet. Zudem stieß das Zweite Vatikanische Konzil Veränderungen im katholischen Milieu an. Auch die Eheberatung trat Mitte der 1960er-Jahre in eine neue Phase. Mit der DAJEB, dem KZI und dem Evangelischen Zentralinstitut für Familienberatung (EZI) hatten sich die Akteure positioniert und mit übergeordneten Anerkennungs- und Ausbildungsrichtlinien eine Professionalisierung ihrer Tätigkeit erreicht. Da sich diese Entwicklung ebenso wie der gesellschaftliche Wandel bereits früher abgezeichnet hatten und erst später mit aller Kraft zur Durchsetzung kommen sollten, bedeutet das Jahr 1965 jedoch keine strenge Zäsur. Die vorliegende Untersuchung ist an der Schnittstelle zwischen der Sozialgeschichte der Familie und Ehe, der Geschichte der Sozialen Arbeit und der Kirchengeschichte positioniert.³ Letzterer Berührungspunkt gilt in erster Linie für den
Zur Sozialgeschichte vgl. etwa Rölli-Alkemper, Lukas: Familie im Wiederaufbau. Katholizismus und bürgerliches Familienideal in der Bundesrepublik Deutschland 1945 – 1965. Paderborn 2000; Herzog, Dagmar: Die Politisierung der Lust. Sexualität in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. München 2005; Soden, Kristine von: Die Sexualberatungsstellen in der Weimarer Republik 1919 – 1933. Berlin 1988; zu Kirchengeschichte vgl. z. B. Fischer, Martin: Dienst an der Liebe. Die katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung in der DDR. Würzburg 2014; Illemann, Regina:
4
Einleitung
Teil zur katholischen Beratung. Die Studie knüpft insbesondere an den Ansatz zur „Verwissenschaftlichung des Sozialen“⁴ an, den Lutz Raphael in einem gleichnamigen Aufsatz entwickelte. Die „‚Verwissenschaftlichung‘ des Sozialen bezeichnet […] konkret die dauerhafte Präsenz humanwissenschaftlicher Experten, ihrer Argumente und Forschungsergebnisse in Verwaltungen und Betrieben, in Parteien und Parlamenten bis hin zu den alltäglichen Sinnwelten sozialer Gruppen, Klassen oder Milieus“ seit dem 19. Jahrhundert. Raphael benennt „einen langanhaltenden Prozeß der ‚Verwissenschaftlichung‘ zwischenmenschlicher Beziehungen und individueller Befindlichkeiten“.⁵ Seine Überlegungen zielen einerseits auf Akteure und andererseits auf Prozesse ab. Diese Positionierung von Experten des Sozialen und die damit verbundene Anwendung ihres Wissens lassen sich auch für die Eheberatung und deren Selbstverständnis beobachten. So definiert Margit Szöllösi-Janze Experten als diejenigen, die bereits vorhandenes Wissen reproduzieren, indem sie es einer gewissen Klientel, z. B. in Politik oder Verbänden, verfügbar machen.⁶ Im Gegensatz zu ihnen generieren Wissenschaftler neues Wissen. Demzufolge sind Eheberater eher dem Kreis der Experten zuzuordnen. Sie speisten ihre Kenntnisse in Institutionen wie die DAJEB und das KZI ein und nahmen für sich in Anspruch, über konkrete Hilfestellungen in Gesprächen Lösungen herbeiführen zu können. Dazu reflektierten sie in der zeitgenössischen Fachliteratur sowie in Zeitschriften ihre spezifischen Wissensbestände zu Ehe und das Vorgehen in der Beratung – teilweise aus den jeweiligen konfessionellen Traditionen heraus, aber auch in Anknüpfung an eugenisches Denken. In der Nachkriegszeit erlebte die Eheberatung neben einem Institutionalisierungs- auch einen Professionalisierungsschub, der eng mit dem Selbstverständnis der Beratenden und der Etablierung ihrer Expertenrolle verbunden war. Da sich für sie eine klare Nähe zur Sozialen Arbeit beobachten lässt, werden besonders damit
Katholische Frauenbewegung in Deutschland 1945 – 1962. Politik, Geschlecht und Religiosität im Katholischen Deutschen Frauenbund. Paderborn 2016. Zur Geschichte der Sozialen Arbeit vgl. z. B. Neuffer, Manfred: Die Kunst des Helfens. Geschichte der Sozialen Einzelhilfe in Deutschland. Weinheim 1990 sowie Wolf Rainer Wendt, Geschichte der Sozialen Arbeit 2. Die Profession im Wandel ihrer Verhältnisse. Stuttgart 2008. Raphael, Lutz: „Die Verwissenschaftlichung des Sozialen als methodische und konzeptuelle Herausforderung für eine Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts“. In: Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft 22 (1996), H. 2, S. 165 – 193. Ebd., S. 166. Vgl. Szöllösi-Janze, Margit: „Wissensgesellschaft in Deutschland: Überlegungen zur Neubestimmung der deutschen Zeitgeschichte über Verwissenschaftlichungsprozesse“. In: Geschichte und Gesellschaft 30 (2004), H. 2, S. 277– 313, hier S. 282.
Forschungsgegenstand und Fragestellung
5
verbundene Aspekte aufgegriffen.⁷ Professionalisierung beschreibt Raphael als Transformationen, die sich aus der „Verwissenschaftlichung der Ausbildungsinhalte, der Akademisierung der Berufsabschlüsse und der Veränderung von Berufsverständnis und Berufspraxis“ ergeben.⁸ An anderer Stelle verweist er darauf, dass der Blick auf Professionen oft auf die sozialen und politischen Aspekte der Berufsfelder beschränkt bleibe. Er sieht die Notwendigkeit, die Berufspraxis und ihre Wechselbeziehungen mit der Wissenschaft einem genaueren Blick zu unterziehen.⁹ Dem kommt die vorliegende Studie nach. Weitere Definitionen von Professionalisierung weisen in die gleiche Richtung. So erläutert Wolf Rainer Wendt in seiner Monografie zur Berufs- und Diskursgeschichte der Sozialen Arbeit, zum Anspruch einer Profession gehöre die „Einheitlichkeit des Verfahrens, die Kontrolle des Prozesses, in dem beruflich gehandelt wird, und seine wissenschaftliche Begründung“.¹⁰ Ähnlich äußert sich Wilfried Rudloff, der unter Professionalisierung „Spezialisierung, Verwissenschaftlichung und Zugangsumgrenzung bei der Berufsausausübung im Dienstleistungssektor“¹¹ versteht. Daher bietet es sich mit Blick auf die Eheberatung zum einen an, die Ausbildungsrichtlinien und deren Formalisierung genauer zu analysieren, und zum anderen, die Diskussionen der Akteure über mögliche Methoden und Vorgehensweisen nachzuvollziehen. In diesem Sinne stellt sich die Frage, ob Eheberatung im Zuge dieses Prozesses zu einer Profession wurde oder eher als Berufsbild zu betrachten ist. Die beiden Komplexe „Verwissenschaftlichung“ und „Professionalisierung“ beschreibt Raphael als „Basisprozesse“ der Moderne.¹² Dass in diesem Zusammenhang kein normativer Fortschrittsoptimismus im Sinne der Modernisierungstheorie gemeint ist, wie er in den Planungsutopien der 1960er-Jahre hervortrat,
Vgl. z. B. Müller, Burkhard: „Professionalisierung“. In: Thole, Werner (Hrsg.): Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. Opladen 2002, S. 725 – 744 sowie Hammerschmidt, Peter / Sagebiel, Juliane (Hrsg.): Professionalisierung im Widerstreit – Zur Professionalisierungsdiskussion in der sozialen Arbeit – Versuch einer Bilanz. Neu-Ulm 2010. Zeitgenössisch vgl. z. B. Bang, Ruth: Psychologische und methodische Grundlagen der Einzelfallhilfe (Casework). Wiesbaden 1958 sowie Kamphuis, Marie: Die persönliche Hilfe in der Sozialarbeit unserer Zeit. Eine Einführung in die Methode der Einzelfallhilfe für Praxis und Ausbildung. Stuttgart 1968. Raphael, Lutz: Experten im Sozialstaat. In: Hockerts, Hans Günter (Hrsg.): Drei Wege deutscher Sozialstaatlichtkeit. NS-Diktatur, Bundesrepublik und DDR im Vergleich, S. 231– 258, hier S. 233. Vgl. Raphael, Verwissenschaftlichung, 1996, S. 180. Wendt, Geschichte, 2008, S. 107. Rudloff, Wilfried: Die Wohlfahrtsstadt. Kommunale Ernährungs-, Fürsorge- und Wohnungspolitik am Beispiel Münchens 1910 – 1933. 2. Teilband, Göttingen 1998, S. 751 f. Raphael, Verwissenschaftlichung, 1996.
6
Einleitung
arbeitete die historische Forschung bereits heraus.¹³ Entsprechend formuliert Szöllösi-Janze das Konzept einer historisierten Wissensgesellschaft, das „Modernisierung […] völlig neutral definiert, nämlich als Extension von individuellen und gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten auf der Basis von wissenschaftlichem Wissen. Es impliziert also keine teleologische Fortschrittsutopie und keine positive Bewertung.“¹⁴ Auch Peter Weingart betont, dass Verwissenschaftlichung nicht etwa eine Entwicklung zu „höherer“ Rationalität sei, sondern lediglich die „Disziplinierung von Handlungsmöglichkeiten und die Systematisierung des Handelns“.¹⁵ Meist bleibe unentdeckt, dass in neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen Wertsetzungen enthalten seien. Dieser Hinweis ist besonders in Hinblick auf die Eugenik wichtig, in deren Kontext amtliche Eheberatung in der Weimarer Republik zunächst entstand. Denn für einen Teil der Akteure blieb eugenisches Denken bis in die Bundesrepublik hinein bedeutend. Auch Eugenik war ein Phänomen der Moderne, da sie die Verwissenschaftlichung eines menschlichen Handlungsbereichs, der Fortpflanzung, darstellte.¹⁶
Forschungsüberblick Bisher liegen nur wenige Arbeiten zu institutionellen Eheberatungen in Westdeutschland nach 1945 vor.¹⁷ Für die nichtkonfessionelle Richtung leistet Annette F. Timms 2010 erschienene Monografie The Politics of Fertility ¹⁸ einen wesentlichen Beitrag. Die Autorin geht der Frage nach, welchen Einfluss der Staat auf die Reproduktion von Paaren nahm, indem er die zeitgenössisch viel diskutierten „notions of sexual duties“¹⁹ aufgriff und zu Geschlechtskrankheiten beriet. Für den Zeitraum der 1920er- bis 1970er-Jahre beleuchtet sie, welche Auswirkungen die Bevölke-
Dipper, Christof: Art. „Moderne“. In: Docupedia-Zeitgeschichte, 17.1. 2018.Verfügbar unter: https:// docupedia.de/zg/Dipper_moderne_v2_de_2018, besucht am 29.7. 2022. Szöllösi-Janze, Wissensgesellschaft, 2004, S. 311 f. Weingart, Peter/ Kroll, Jürgen / Bayertz, Kurt: Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland. Frankfurt am Main 1988, S. 17. Vgl. ebd., S. 16. Eberhard Hauschildt spricht davon, dass die Forschungsliteratur in Bezug auf kirchliche Familienberatung bisher „freundlich formuliert – sehr übersichtlich“ sei. Hauschildt, Eberhard: „Kirchliche Familienberatung in den 1960er Jahren. Der Wandel im Selbstverständnis: von der paternalen Fürsorge in Abwehr der Modernisierung zur fachlichen sozialen Arbeit im therapeutischen Dialog“. In: Lepp, Claudia / Oelke, Harry/ Pollack, Detlef (Hrsg.): Religion und Lebensführung im Umbruch der langen 1960er Jahre. Göttingen 2016, S. 259 – 279, hier S. 261. Timm, Politics, 2010. S. ebd., S. 25.
Forschungsüberblick
7
rungspolitik auf die Ratsuchenden in Berlin hatte. Dabei zeigt sie personelle und ideelle Kontinuitäten auf. Im Kapitel zur Beratung von Paaren im Berlin der Nachkriegszeit geht sie auch auf die DAJEB²⁰ sowie die Praxis der amtlichen Stellen ein. Für diese untersucht sie den Zeitraum von 1948 bis 1955 und zieht dafür die Monats- und Jahresberichte der bezirklichen Gesundheitsämter sowie des Landesgesundheitsamtes und des Hauptsozialamtes heran.²¹ Diese Quellen sind auch in die vorliegende Untersuchung eingeflossen. Timm fasst zusammen: „[M]arriage counsellors were forced to react to the specific […] needs of Berliners […]. This […] coexisted with lingering adherence to eugenic thinking, which found particularly strong support in the upper administration […]. In the meantime […], a third current was gaining ground. With some ties back to Weimar […], psychological counseling was finding increasing acceptance.“²² Der Beobachtung ist sich anzuschließen. Gleichzeitig erweitert die vorliegende Arbeit den Blick auf die Beratungsverhältnisse, indem sie die bezirkliche Eheberatung in Berlin-Reinickendorf integriert. Christiane Kullers 2004 erschienene Monografie zur Familienpolitik im föderativen Sozialstaat ²³ deckt die Zeit nach 1949 ab und ist für die frühe Einordnung der Eheberatung „im Grenzbereich zwischen Familien- und Gesundheitspolitik“ wichtig.²⁴ Dies verweist bereits auf die eugenischen Wurzeln der amtlichen Beratung. Zudem widmet Kuller der Familienberatung in den 1950er- und frühen 1960erJahren ein Kapitel, vor allem der DAJEB.²⁵ Dabei geht sie auch auf die Professionalisierung der Akteure ein. Mit dem Inhalt der Beratung befasst sie sich hingegen nur am Rande.²⁶ Franka Schneiders Aufsatz „‚Einigkeit im Unglück‘?“²⁷ ist vor allem für die zeitgenössische Debatte zur „Krise der Ehe“ sowie die Umsetzung der Eheberatung in Berlin aufschlussreich. Schneider geht dabei auch auf die Berichte des Landesgesundheitsamtes sowie bezirklicher Gesundheitsämter ein, welche die vorliegende Studie ebenfalls auswertet. Sie verweist zudem auf die Kontinuität der eugenischen Beratungsmotivation: „Eheberatung bot ein […] Instrumentarium des Zugriffs auf
Vgl. ebd., S. 250 f. Vgl. ebd., S. 238 – 243 und S. 253 – 256. Ebd., S. 255. Kuller, Christiane: Familienpolitik im föderativen Sozialstaat. Die Formierung eines Politikfeldes in der Bundesrepublik 1949 – 1975. München 2004. Ebd., S. 335. Vgl. ebd., S. 228 – 234, S. 240 – 243 und S. 251– 252. Vgl. ebd., S. 230 f. Schneider, Franka: „‚Einigkeit im Unglück‘? Berliner Eheberatungsstellen zwischen Ehekrise und Wiederaufbau“. In: Naumann, Klaus (Hrsg.): Nachkrieg in Deutschland. Hamburg 2001, S. 206 – 226.
8
Einleitung
Individuen, deren Reproduktionsverhalten und geschlechtsspezifische Vorstellungen.“²⁸ Ein weiterer Aufsatz von Schneider, „Ehen in Beratung“,²⁹ fokussiert auf die Zeitschrift Constanze. Themen sind wiederum die „Krise der Ehe“, die vorbeugende Gesundheitsberatung Heiratswilliger und die Beratung zur Geburtenregelung. Als lohnenswert erachtet Schneider eine „Untersuchung der tatsächlich geleisteten Arbeit einzelner Eheberatungsstellen“³⁰, eine Anregung, die es im Folgenden aufzugreifen gilt. Lisa Dittrich (†) verfolgte an der Ludwig-Maximilians-Universität München ein Habilitationsprojekt mit dem Titel „Beziehungsgeschichten: Zwischen Fürsorge, Partnerschaft und Liebe. Ehen und Paarbeziehungen in beiden deutschen Staaten (1945 – 1990)“.³¹ Dittrich analysierte den Wandel von Ehen, wobei die Krise der Paare und deren Beratung den Ausgangspunkt ihrer Forschungen zum Wertewandel bildeten. Als Quellen nutzte sie Briefwechsel mit Eheberatern, Ratgeberkolumnen und -sendungen sowie Egodokumente wie Autobiografien und Tagebücher. Die Studie konnte aufgrund des Todes der Autorin nicht vollendet werden. Innerhalb der DAJEB-Führung spielten Rassen- und Sozialhygieniker eine wichtige Rolle. Ihre Biografien verweisen auf große personelle und inhaltliche Kontinuitäten zwischen Nationalsozialismus und früher Bundesrepublik. Uwe Kaminsky beleuchtet in seinem 2005 erschienenen Aufsatz „Zwischen Rassenhygiene und Biotechnologie. Die Fortsetzung der eugenischen Debatte in Diakonie und Kirche 1945 bis 1969“³² den historischen Umgang mit der Eugenik in der evangelischen Kirche. Er kommt zu dem Fazit, dass diese versuchte, in der Bundesrepublik „an eine als positiv beschriebene eigene Tradition der Auseinandersetzung mit ‚Erbwertigkeiten‘ unkritisch anzuknüpfen“.³³ Als treibende Kraft stellt Kaminsky Joachim Fischer vor, den Gründer der DAJEB. Fischers Verbindungen zur evangelischen Kirche und seine Rolle im Eugenischen Arbeitskreis des Diakonischen Werks sind wesentlich für das Verständnis eines der wichtigsten Akteure der DAJEB. In einem weiteren, 2008 publizierten Aufsatz „Vom eugenischen Dunkel am Fusse des anti-euthanatischen Leuchtturms: Zur Nachgeschichte von Eugenik und ‚Eu Ebd., S. 224. Vgl. Schneider, Franka: „Ehen in Beratung“. In: Kaminsky, Annette (Hrsg.): Heimkehr 1948. München 1998, S. 192– 216. S. ebd., S. 216. Dittrich, Lisa: Zwischen Liebessehnsucht und Arbeit an der Beziehung: Aushandlungen des Eheideals in der DDR. Präsentation im Rahmen des Oberseminars Neuere Forschungen zur Zeitgeschichte, 16. Juni 2020, S. 2. Kaminsky, Uwe: „Zwischen Rassenhygiene und Biotechnologie. Die Fortsetzung der eugenischen Debatte in Diakonie und Kirche, 1945 bis 1969“. In: Zeitschrift für Kirchengeschichte 116 (2005), H. 2, S. 204– 241. Ebd., S. 239.
Forschungsüberblick
9
thanasie‘ am Beispiel der Evangelischen Kirche nach 1945“³⁴ befasst sich Kaminsky erneut mit diesen Verbindungen. Von Horst Schütz erschien 2004 die Monografie Gesundheitsfürsorge zwischen humanitärem Anspruch und eugenischer Verpflichtung. Entwicklung und Kontinuität sozialhygienischer Anschauungen zwischen 1920 und 1960 am Beispiel von Prof. Dr. Carl Coerper ³⁵. Coerper war in die Gründung der DAJEB involviert und fungierte in den 1950er-Jahren als deren Vorsitzender. Seine Vorstellungen von Eheberatung sind wesentlich, um die angesprochenen Kontinuitäten nachzuvollziehen. Schütz’ Einschätzung zufolge nutzte Coerper seinen Einfluss auf die Gesundheitspolitik, um „wesentlich zur Restauration der Sozialhygiene im öffentlichen Gesundheitsdienst nach 1945 beizutragen“.³⁶ Mit den Kontinuitäten der eugenischen Bewegung über 1945 hinaus befasst sich auch ein Aufsatz von Isabel Heinemann. In „Die ‚erbgesunde Familie‘ als transatlantisches Projekt: Paul B. Popenoe, Otmar Freiherr von Verschuer und die Kontinuitäten der Eugenik, 1920 – 1970“³⁷ wertet Heinemann u. a. Patienten- und Beratungsakten von Otmar Freiherr von Verschuer aus. Sie kommt zu dem Schluss: „Am Beispiel von Familienplanung und Familienberatung zeigt sich, dass sich die Wirkung der Eugenik-Bewegung auf Konzepte von Reproduktion und Familie keineswegs mit dem Untergang des Nationalsozialismus erschöpfte. Im Gegenteil, der Rückgriff auf eugenisches Wissen wurde […] genutzt, um die Familie als die Grundlage des Staates und der Nation vor den Zumutungen der Moderne zu schützen.“³⁸ Anette Lippolds 2014 veröffentlichte Dissertation The Church and Modern Marriage ³⁹ erwies sich als ausgesprochen anschlussfähig. Für den Zeitraum von 1920 bis 1970 untersucht Lippold die institutionelle Entwicklung der evangeli-
Kaminsky, Uwe: „Vom eugenischen Dunkel am Fusse des anti-euthanatischen Leuchtturms: Zur Nachgeschichte von Eugenik und ‚Euthanasie‘ am Beispiel der Evangelischen Kirche nach 1945“. In: Daubach, Helia-Verena (Hrsg.): Justiz und Erbgesundheit. Düsseldorf 2008, S. 195 – 210. Schütz, Horst: „Gesundheitsfürsorge zwischen humanitärem Anspruch und eugenischer Verpflichtung. Entwicklung und Kontinuität sozialhygienischer Anschauungen zwischen 1920 und 1960 am Beispiel von Prof. Carl Coerper“. Husum 2004. Ebd., S. 26. Heinemann, Isabel: „Die ‚erbgesunde Familie‘ als transatlantisches Projekt: Paul B. Popenoe, Otmar Freiherr von Verschuer und die Kontinuitäten der Eugenik, 1920 – 1970“. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 71 (2023), H. 3, S. 237– 271. Ich danke Isabel Heinemann für die Zusendung des Manuskripts vor dessen Veröffentlichung. Ebd., S. 1. Lippold, Anette: The Church and Modern Marriage: Denominational Marriage Counseling and the Transformation of Mainline Christian Religion in Germany and the United States, 1920 – 1970s. New York 2014.
10
Einleitung
schen und katholischen Eheberatung in einem Vergleich zwischen den USA und Deutschland anhand des religious market model. Für die deutsche Nachkriegszeit betrachtet sie vor allem die konfessionellen Institutionen sowie die Caritas.⁴⁰ In der Konkurrenz mit weltlichen Stellen und der Auseinandersetzung innerhalb der Konfessionen habe sich die kirchliche Beratung durch Laien zu einem professionellen psychologischen Angebot entwickelt. Lippold kommt zu dem Schluss: „The presence of competition […] was instrumental in shaping a final product.“⁴¹ Die Beratungspraxis behandelt Lippold dagegen so gut wie nicht,⁴² da diese aufgrund der „privileged nature of the interactions between counselors and clients […] difficult to assess“⁴³ sei. An diesem Forschungsdesiderat setzt die vorliegende Arbeit an. Als erster Historiker befasste sich Lukas Rölli-Alkemper in seiner 2000 erschienenen Dissertation Familie im Wiederaufbau ⁴⁴ mit der institutionalisierten katholischen Eheberatung. Er widmet deren Wandel zwischen 1945 bis 1965 ein eigenes Unterkapitel mit Schwerpunkt auf dem KZI.⁴⁵ Dabei kommt er zu dem Schluss, dass die Amtskirche in dieser Zeit zwar an ihrer abstrakten Ehelehre festhielt, die Beraterinnen jedoch die Ratsuchenden mit ihren konkreten Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellten. Damit etablierte sich ein grundlegend neuer Ansatz: „Nicht mehr die Seelenführung in der Beichte und die Gnadenwirkung der kirchlichen Sakramente, sondern das beratende Gespräch mit erfahrenen Laien wurden als wirksamstes Mittel gegen die Gefährdungen der modernen Ehe angesehen.“⁴⁶ Regina Illemanns 2016 erschienene theologische Dissertation Katholische Frauenbewegung in Deutschland 1945 – 1962 ⁴⁷ fragt nach dem Verständnis von Eheberatung im Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB). Im Rahmen der gesellschaftspolitischen Profilierungen des KDFB befasst die Autorin sich im Kapitel „Engagement in der katholischen Eheberatung“ vor allem mit der Rolle des Frauenbundes im KZI, aber auch mit den Grundsätzen der bekannten Eheberaterin Josepha Fischer-Erling.⁴⁸ Illemann verweist bereits auf deren „liberalere Stand-
Für die Entwicklung der Eheberatung von 1945 bis Mitte der 1960er Jahre vgl. ebd., S. 300 – 304 und S. 311– 353. Ebd., S. 361. Für die Beratungspraxis vgl. ebd., S. 324 f. Ebd., S. 324. Rölli-Alkemper, Familie, 2000. Vgl. ebd., S. 360 – 367. Ebd., S. 366 f. Illemann, Frauenbewegung, 2016. Vgl. ebd., S. 135 – 145.
Quellen und Archive
11
punkte“, die im Folgenden ebenfalls umrissen werden.⁴⁹ Zur Praxis äußert sie sich wie folgt: „Jenseits der hier dargelegten Grundsätze sind […] zu den 1950er Jahren keine Details über die Beratungsarbeit dokumentiert. Welche Anliegen und Fragen also mit Ratsuchenden konkret besprochen wurden oder wie die Beratungsstellen etwa mit den Themen […] umgingen, ist nicht ersichtlich.“⁵⁰ Die Entwicklung der katholischen Beratung in der DDR verfolgt Martin Fischer in seiner 2014 erschienenen Dissertation Dienst an der Liebe ⁵¹, die er gleichzeitig als kirchengeschichtliche und theologische Untersuchung anlegt. Zwar konzentriert er sich auf die DDR, geht aber ebenfalls auf die Bundesrepublik ein.⁵² Er betrachtet zudem das Verhältnis von Theologie und Psychologie.⁵³ Im Laufe des 20. Jahrhunderts seien „erste zaghafte Berührungspunkte zwischen Kirche und Psychoanalyse […] spürbar“ geworden,⁵⁴ eine Feststellung, die sich auch für diese Studie in Hinblick auf das Selbstverständnis katholischer Eheberaterinnen als fruchtbar erwies. Keine Erwähnung finden dagegen „konkrete Schicksale, inhaltliche Präferenzen oder Fallbeispiele“⁵⁵ aufgrund fehlender Verschriftlichung oder Veröffentlichung. Auch Beratungsmotiven und Statistiken geht der Autor explizit nicht nach.
Quellen und Archive Da Akten individueller Beratungen in der Regel aus Datenschutzgründen vernichtet beziehungsweise aufgrund der zunächst fehlenden Professionalisierung oft nur sehr lückenhaft angelegt wurden,⁵⁶ ist es eine Herausforderung, Einzelfälle nachvollziehen zu können. Der auf Sozial- und Diakoniegeschichte spezialisierte Historiker Uwe Kaminsky äußert die Vermutung, dass die mangelnde Dokumentation auch eine zeitgenössische Kontrolle der Arbeit verhindern sollte.⁵⁷ Eine weitere Problematik besteht darin, dass Jahresberichte einzelner Beratungsstellen in der Regel nur unsystematisch entstanden. Ab etwa Mitte der 1960er-Jahre liegt deutlich
Ebd. S. 44. Ebd., S. 138. Fischer, Dienst, 2014. Vgl. ebd., S. 148 – 159. Vgl. ebd., S. 237– 251. Ebd., S. 239. S. ebd., S. 10. Vgl. Gespräch mit Dr. Florian Moeser-Jantke, Geschäftsführer DAJEB, persönliche Kommunikation, September 2014. Vgl. Kaminsky, Uwe: AW: Materialsuche für Dissertation Eheberatung 1945 – 1965. Mail an VeraMaria Giehler, 2. Juni 2017.
12
Einleitung
mehr Material vor,⁵⁸ was einerseits auf die zunehmende Professionalisierung und andererseits auf weitere Faktoren wie neu entstehende Stellen im Zuge der Frauenbewegung zurückzuführen ist. Ein praktisches Hindernis auf der Suche nach Quellen liegt in der weitgehenden Eigenständigkeit der Eheberatungsstellen, die zudem über die ganze Bundesrepublik verstreut waren. So kamen die verschiedensten Archive oder Institutionen in Frage. Mit über 80 von ihnen wurde Kontakt aufgenommen. Schließlich fanden sich Dokumentationen von Einzelberatungen in Form von Briefwechseln, Aktennotizen, Einladungen an den Ehepartner der Ratsuchenden und Protokollen. Zwar steht das Material weitestgehend noch unter Schutzfrist, doch deren frühzeitige Aufhebung war mit der Auflage möglich, anonymisiert zu zitieren. Deshalb sind Vorund Nachnamen, die dem betreffenden Material entstammen, abgekürzt wiedergegeben. Die für das Thema zentralen Quellen lagern im Archiv des Deutschen Caritasverbandes, dem Archiv des Erzbistums Köln, dem Bundesarchiv Koblenz sowie dem Landesarchiv Berlin. In Letzterem befinden sich die Akten der Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf, die sich mit etwa 470 Fällen als das einzige Konvolut zur nichtkonfessionellen Eheberatung herausstellten. Gleichzeitig bilden sie den größten während der Recherchen eruierten Bestand zur Eheberatungspraxis insgesamt. Dieser Fund ermöglicht eine Fallstudie sowohl in Hinblick auf Selbstverständnis als auch Praxis der Akteure. Dabei ist die Variationsbreite der Akten unterschiedlich: Sie erstreckt sich von Einladungen an die Ehepartner der Ratsuchenden mit einer zum Teil standardisierten halben Seite bis hin zu vollständig nachvollziehbaren Fällen inklusive Schriftwechsel mit Betroffenen, Behörden, Anwälten und entsprechenden Protokollen mit bis zu über 200 Schriftstücken. Darüber hinaus fanden sich im Landesarchiv Berlin vor allem Berichte von Gesundheitsämtern sowie Jahres- oder Monatsberichte. Dabei handelt es sich um Quellen verschiedener Beratungsstellen, die nur selten chronologisch lückenlos vorhanden sind und deren Umfang zwischen einer Zeile und bis zu über 20 Seiten liegt. Im Erzbistum Köln lagern in erster Linie Akten über das in Köln angesiedelte KZI. Zudem ist dort der Briefwechsel des Leiters mit Ratsuchenden zugänglich. Insgesamt konnten 41 Korrespondenzen zur katholischen Eheberatung ermittelt und im Rahmen einer zweiten Fallstudie erstmals ausgewertet werden. Auch im Archiv des Deutschen Caritasverbandes lagern Konvolute zum KZI, außerdem Material der Caritas selbst. Die Kommunikation der DAJEB mit Politik und Ministerien war zum Teil im Bundesarchiv greifbar. Des Weiteren publizierte die DAJEB regelmäßig In-
So z. B. ab 1967 aus evangelischen Beratungsstellen, einsehbar im Archiv des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung (ADE).
Aufbau
13
formationsschreiben und äußerte sich ebenso wie das KZI in weiteren Publikationen zur eigenen Arbeit. Befragungen von Zeitzeugen sind aufgrund des Untersuchungszeitraums kaum mehr möglich. Es gelang jedoch, ein Interview mit Alice Haidinger, der ersten Vorsitzenden der Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe, zu führen.
Aufbau Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Teile. Der erste ist den Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik und der Zeit des Nationalsozialismus gewidmet. Im zweiten Teil stehen die nichtkonfessionelle und die evangelische Beratung im Mittelpunkt, der dritte untersucht die katholische Richtung. Bezüge entstehen durch das von Beratenden untereinander gepflegte enge professionelle Verhältnis. Im ersten Teil identifiziert die Studie mit der Gründung der ersten Eheberatungsstellen entscheidende Grundlagen sowie Akteure und eruiert die Kontinuitäten und Diskontinuitäten in die Zeit des Nationalsozialismus. Insbesondere die enge Verbindung zur Eugenik, aber auch personelle Kontinuitäten und die Ausrichtung der Beratungen spielten noch in der Bundesrepublik eine wichtige Rolle. Der zweite Teil erläutert zu Beginn den gesellschaftlichen, politischen und juristischen Rahmen der nichtkonfessionellen Eheberatung, um die Ausgangslage in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik zu umreißen. Zur Sprache kommen Vorstellungen von Ehe und tatsächlich gelebte Paarbeziehungen. Es folgt die Untersuchung der DAJEB als offiziell paritätische Arbeitsgemeinschaft mit dem Anspruch, die gesamte Eheberatung zu vertreten. Dabei erweisen sich Rassen- und Sozialhygieniker als wesentliche Akteure, welche die Ausrichtung der DAJEB entscheidend prägten. Ihr Denken sowie ihr Bemühen um Professionalisierung bestimmten das Selbstverständnis der Arbeitsgemeinschaft. Auch das Verhältnis der DAJEB zur konfessionellen Beratung wird eruiert. Im nächsten Schritt rücken Selbstverständnis und Praxis einzelner Einrichtungen in den Mittelpunkt, wobei Publikationen wie Fachzeitschriften und die Berichterstattung der mit der DAJEB kooperierenden Stellen die Basis der Analyse bilden. Als Fallbeispiel dient die Eheberatungsstelle des Gesundheitsamtes Berlin-Reinickendorf, für die Material zu individuellen Beratungen vorliegt. Der dritte Teil zu katholischer Eheberatung ist in Struktur und Inhalt ähnlich aufgebaut. Zuerst werden die Grundlagen anhand verschiedener Entwicklungen in katholischer Kirche und Theologie sowie mit Blick auf Eheideal und Eherecht erläutert. Das Verständnis von katholischer Beratung, das die Eheberaterinnen zeigten, sowie deren Selbstverständnis sind ebenfalls Gegenstand der Betrachtung.
14
Einleitung
Anschließend rückt die Praxis nach dem Ende des Nationalsozialismus in den Fokus und damit das KZI als katholische Antwort auf die DAJEB. Sein Selbstverständnis ist in Publikationen und über Schlaglichter auf die Beratungspraxis skizziert. Die einzelnen Teile sind jeweils mit einem Zwischenfazit versehen.
1 Die Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik und ihre Entwicklung im „Dritten Reich“ Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sanken die Geburtenzahlen, die Scheidungsraten stiegen und auch der Bevölkerungsverlust durch den Ersten Weltkrieg machte sich bemerkbar. Politik, Medizin und Wissenschaft begannen, diese Phänomene intensiv zu diskutieren.¹ Für die abnehmenden Geburten und zahlreicher werdenden Trennungen machten viele Akteure die „Rationalisierung“ der Sexualität, d. h. die individuelle Kontrolle der Fortpflanzung, verantwortlich. Vertreter aus Eugenik und Rassenhygiene, welche die Lehre von der „genetischen Verbesserung“ der Bevölkerung propagierten,² beeinflussten diese Debatten wesentlich.³ Eugenik galt als angewandte Wissenschaft, um Perspektiven zur Selbststeuerung der menschlichen Evolution auszuloten und mit Hilfe des Staates umzusetzen.⁴ Mit ihren biopolitischen Utopien ist sie als Phänomen einer Moderne zu werten, die mit Wissenschaft Handlungsräume eröffnete und erweiterte.⁵ Weingart ordnet die Eugenik einem Rationalisierungs- und Verwissenschaftlichungsprozess zu, der Handlungsbereiche überhaupt erst zu Wissensfeldern mache, die wiederum selbst das Handeln orientieren.⁶
Zur Sexual- und Eheberatung in der Weimarer Republik und im „Dritten Reich“ vgl. im Folgenden Soden, Sexualberatungsstellen, 1988; Timm, Politics, 2010, S. 81 ff. Vgl. dazu auch Klautke, Egbert: Rassenhygiene, Sozialpolitik und Sexualität. Ehe und Sexualberatung in Deutschland 1918 – 1945. In: Bruns, Claudia (Hrsg.): Von Lust und Schmerz. Köln 2004, S. 293 – 312. Reyer, Jürgen: Alte Eugenik und Wohlfahrtspflege. Entwertung und Funktionalisierung der Fürsorge vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Freiburg im Breisgau 1991, S. 9. Siehe ebd. für den engen Zusammenhang der beiden Begriffe Rassenhygiene und Eugenik. Hinzu kam nach dem Ersten Weltkrieg das Bild der „neuen Frau“, das einen starken Einfluss auf die Vorstellungen von Ehe und Sexualität ausübte. Dieser Typus war die berufstätige, ökonomisch unabhängige und politisch gleichberechtigte Frau, die im Laufe des Krieges an Selbstständigkeit gewonnen hatte. Kriegsheimkehrer sahen sich damit unvorbereitet konfrontiert: „Vorherrschend waren emotionale und körperliche Entfremdungen, Zerrüttungen auf seelischem und sexuellem Gebiet. In vielen Ehen fand während der Nachkriegszeit eine ‚Generalinventur‘ statt.“ Soden, Sexualberatungsstellen, 1988, S. 45. Vgl. Schmuhl, Hans-Walter: „Hermann Muckermann. Ein Akteur im Spannungsfeld von Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik“. In: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 109 (2014), H. 3 – 4, S. 241– 255, hier S. 241. S. Szöllösi-Janze, Wissensgesellschaft, 2004, S. 311 f. S. Weingart u. a., Rasse, 1988, S. 16. https://doi.org/10.1515/9783111097534-002
16
1 Die Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik
Letztlich strebten Eugeniker an, die menschliche Fortpflanzung zu kontrollie⁷ ren. Medizinisch auf die Nachwuchsplanung und Zeugung Einfluss zu nehmen, schien einen praktikablen Zugriff vor allem auf das Reproduktionsverhalten der Arbeiterschichten zu bieten. Dabei zielte die „positive Eugenik“ darauf, über eine entsprechende Steuer- und Familienpolitik die „Erbtüchtigen“ zur Reproduktion zu animieren und den Anteil der als wünschenswert beurteilten Erbanlagen zu vergrößern.⁸ „Züchterische Maßnahmen“ versprachen höhere Intelligenz, bessere körperliche Konstitution, Schönheit oder „rassische Reinheit“.⁹ Bei der „negativen Eugenik“ hingegen stand im Fokus, unerwünschte Anlagen zu verringern und als „minderwertig“ Betrachtete aktiv an der Fortpflanzung zu hindern. Dies reichte bis hin zur Sterilisierung.¹⁰ Diese Ideen konsequent umzusetzen, bedeutete letztlich, das Sexualverhalten der Bevölkerung zu kontrollieren. Einen Zugang dazu bot die Ehe, vor allem aber die Beratung und Untersuchung junger, heiratswilliger Paare, um deren „Erbgut“ mit Gesundheitszeugnissen einzuschätzen. Dies sollte zumindest die Möglichkeit offenhalten, von der Ehe abzuraten oder sie auch in letzter Konsequenz zu verbieten. Hier findet sich der Beginn der institutionellen Eheberatung, die sich bereits nach wenigen Jahren in eine amtliche eugenische, eine katholische und eine evangelische Richtung ausdifferenzierte. Dies geschah in Abgrenzung zur Sexualberatung, die verschiedene private und staatliche Träger mit Zielsetzungen wie sexuelle Aufklärung und Verhütung gegründet hatten. Dazu gehörte beispielsweise der Bund für Mutterschutz. Die Nationalsozialisten schlossen bald nach ihrem Machtantritt die Sexualberatung und vereinnahmten die Eheberatung für ihre Ziele.
1.1 Amtliche Beratungsstellen Als erster Akteur hatte sich der Deutsche Monistenbund aus eugenischen Motiven dafür eingesetzt, potenzielle Ehepartner dazu zu verpflichten, Gesundheitszeugnisse auszutauschen. Bereits im Jahr 1911 eröffnete der Bund in Dresden eine erste eugenische Beratungsstelle, die allerdings vier Jahre später wieder schloss.¹¹ Die
Vgl. Reyer, Eugenik, 1991, S. 16. Ebd., S. 96. Weingart u. a., Rasse, 1988, S. 16. Reyer, Alte Eugenik, 1991, S. 96. Die Stelle wurde von der Dresdner Gruppe des Deutschen Monistenbundes errichtet. Gegründet 1906 vom Naturwissenschaftler Ernst Haeckel, setzte sich der Monistenbund als freigeistige Bewegung für die Verbreitung einer auf naturwissenschaftlicher Grundlage basierenden philosophi-
1.1 Amtliche Beratungsstellen
17
eigentliche Gründungszeit der Eheberatung lag in den 1920er-Jahren, als eugenisches Gedankengut in die Politik Einzug hielt. In den „Leitsätzen des Reichsgesundheitsrats vom 26. Februar 1920“ war zu lesen, dass die „Fernhaltung der körperlich oder geistig für die Ehe und die Zeugung gesunder Kinder Untauglichen“ von der Eheschließung ein „wesentliches Mittel zur Verhütung einer Rassenverschlechterung“ sei.¹² Im Jahr 1921 forderte ein Erlass des Reichsinnenministeriums die Standesbeamten auf, jedem heiratswilligen Paar noch vor dem Aufgebot ein „Merkblatt für Eheschließende“ auszuhändigen. Dieses warb dafür, sich vor der Ehe freiwillig von einem Arzt untersuchen zu lassen, um ein Gesundheitszeugnis zu erhalten. Der Schwerpunkt der Eheberatung lag damit auf der gesundheitlichen beziehungsweise erbgesundheitlichen Prüfung vor der Heirat. Verhütungsberatung wurde abgelehnt, da Paare mit gewünschten Erbanlagen möglichst viele Kinder bekommen sollten. Verlobte erhielten nach einer medizinischen Untersuchung und erbbiologischen Befragung ein sogenanntes Heirats- oder Gesundheitszeugnis, auf das sie ihre Entscheidung zur Eheschließung stützen konnten. Der erhoffte Erfolg blieb jedoch aus. Teilweise kamen pro Jahr weniger als 200 Besucher in die Beratungsstellen. Viele nahmen das Zeugnis als Eingriff in die Privatsphäre wahr. Da die amtliche Eheberatung ihren Ursprung in der Eugenik hatte, entstand sie als ein Bereich der Gesundheitsfürsorge. Diese reichte von der Krankenpflege über Hygiene, Seuchenbekämpfung, Ernährungsberatung, Aufklärung und Vorbeugung der Säuglingssterblichkeit bis hin zur Psychiatrie. Entsprechend stand das neue Beratungsfeld unter medizinischer Oberaufsicht.¹³ Eheberatung beschränkte sich dabei nicht auf Eugenik, sondern sollte zunächst auch dazu beitragen, Geschlechtskrankheiten einzudämmen,¹⁴ was es ihr erschwerte, ein eigenes Profil zu entwickeln. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann die institutionelle Zuordnung der amtlichen Eheberatung zur Gesundheitsfürsorge langsam aufzuweichen.¹⁵ Der eugenisch ausgerichteten amtlichen Eheberatung standen die Sexualberatungsstellen gegenüber, in denen pro Jahr durchschnittlich 1.000 Beratungen stattfanden. Befürworter waren Sozialdemokraten, Frauenrechtlerinnen und Sexualreformer. Ihre Ausrichtung deckte sich teilweise mit den Ansichten der Eugenik, da es ihnen um eine materielle Verbesserung der Lebensbedingungen ging, um
schen Weltanschauung ein. Der Bund wurde 1933 von den Nationalsozialisten aufgelöst. Vgl. Fischer, Dienst, 2014, S. 97 ff. Zit. n. Reyer, Alte Eugenik, 1991, S. 97. Hering, Sabine / Münchmeier, Richard: Geschichte der Sozialen Arbeit: eine Einführung. Weinheim 2014, S. 66 – 69. Ebd., S. 148. Vgl. Kapitel 3.1 Eheberatung in der Nachkriegszeit. Kapitelverweise werden mit Kurztiteln angegeben.
18
1 Die Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik
Erbanlagen entsprechend zu fördern oder zu hemmen. Dies verdeutlicht, dass die Eugenik nicht auf politisch rechts stehende Gruppierungen beschränkt, sondern bei einer großen Bandbreite von politischen und gesellschaftlichen Akteuren als Steuerungsinstrument akzeptiert war.¹⁶ Darüber hinaus zielten Sexualberatungsstellen darauf, das Bildungsprivileg der bürgerlichen Schichten zu Verhütung zu durchbrechen. Aus diesem Grund setzten die Einrichtungen sich dafür ein, empfängnisverhütende Mittel zu verbreiten und Schwangerschaftsabbrüche zu legalisieren.¹⁷ Damit standen sich Sexualberatung und amtliche Eheberatung kontrovers gegenüber. Abtreibungen lehnten Eugeniker bis auf wenige Ausnahmen ab, ebenso Verhütung bei „erbgesunden“ Ehepaaren.¹⁸ Sowohl die Diskussion als auch die Entwicklung der Beratung in der Weimarer Republik wurde wesentlich durch die Kontroverse zwischen Sexual- und Eheberatung bestimmt. Die erste Sexualberatungsstelle befand sich im 1919 von dem Mediziner Magnus Hirschfeld¹⁹ gegründeten Institut für Sexualwissenschaft in Berlin.²⁰ Hirschfeld vertrat als Mitglied der Gesellschaft für Rassenhygiene eugenische Ideen, die Stelle führte auch Gespräche zur Frage der Ehetauglichkeit. Ab 1924 folgten weitere Angebote, die zunächst vom Mutterschutzbund um die prominente bürgerliche Frauenrechtlerin Helene Stöcker²¹ ausgingen. Die in diesem Kontext entstehende Kombination aus Ehe- und Sexualberatung erwies sich als sehr erfolgreich. Ende der 1920er-Jahre erreichten die Gründungen ihren Höhepunkt. In der gesamten Weimarer Republik führte allein die Arbeitsgemeinschaft Freier Sexual-ReformVereine mehr als 80 Einrichtungen, die Liga für Mutterschutz und soziale Familienhygiene über 500. Die Ratsuchenden fragten vor allem Verhütungsmethoden nach. Soziale und wirtschaftliche Erwägungen spielten hierbei eine wichtige Rolle. Eugeniker kritisierten diese Form der Geburtenregelung mittels individueller Entscheidungen als willkürlich. Ihnen ging es nicht um die Lage des Einzelnen,
Vgl. Klautke, Rassenhygiene, 2004, S. 301 sowie Lulay, Birgit: Eugenik und Sozialismus. Biowissenschaftliche Diskurse in den sozialistischen Bewegungen Deutschlands und Großbritanniens um 1900. Stuttgart 2021. Schätzungen gehen für die 1920er-Jahre davon aus, dass jährlich bis zu 20.000 Frauen an den Folgen einer illegalen Abtreibung starben. Vgl. Fischer, Dienst, 2014, S. 115. Vgl. Klautke, Rassenhygiene, 2004, S. 301 f. Zur Biografie Hirschfelds vgl. Kotowski, Elke-Vera / Schoeps, Julius H. (Hrsg.): Magnus Hirschfeld. Ein Leben im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Berlin 2004. Zum Institut für Sexualwissenschaft neu erschienen: Herrn, Rainer: Der Liebe und dem Leid. Das Institut für Sexualwissenschaft 1919 – 1933. Frankfurt am Main 2022. Zur Biografie Stöckers vgl. Lütgemeier-Davin, Reinhold / Wolff, Kerstin (Hrsg.): Helene Stöcker. Lebenserinnerungen. Die unvollendete Autobiographie einer frauenbewegten Pazifistin. Köln 2015.
1.1 Amtliche Beratungsstellen
19
sondern den „Volkskörper“ als Ganzes.²² Der Ausschuß für Rassenhygiene und Bevölkerungswesen des Preußischen Landesgesundheitsrats drängte darauf, die flächendeckende Einrichtung von amtlichen Eheberatungsstellen zu empfehlen, um den freien Sexualberatungsstellen entgegenzuwirken. Die amtlichen Angebote sollten sich ausschließlich darauf konzentrieren, die Eheeignung medizinisch zu prüfen und darüber gewonnene Gesundheitszeugnisse zentral zu sammeln. Am 19. Februar 1926 gab der preußische Minister für Volkswohlfahrt Heinrich Hirtsiefer²³ (Zentrum) einen entsprechenden Runderlass über die „Einrichtung ärztlich geleiteter Eheberatungsstellen in Gemeinden und Kreisen“ heraus.²⁴ Der„HirtsieferErlaß“, der einen Kompromiss zwischen SPD und Zentrum darstellte,²⁵ sah eine freiwillige Beratung vor. Ursprünglich war geplant gewesen, die Untersuchung als Vorschrift im Personenstandsgesetz zu verankern. Dies hatte sich aber als nicht durchsetzbar erwiesen. Der Erlass zog eine breite Aufmerksamkeit und eine hohe Zahl an neuen Beratungsstellen nach sich. Noch im selben Jahr entstanden in Preußen 77 Einrichtungen, 52 weitere befanden sich in Vorbereitung.²⁶ Sachsen und Braunschweig verzeichneten eine ähnliche Entwicklung. Um den Besuchern möglichst Anonymität zu garantieren, waren die Angebote oft einer großen Behörde oder Krankenkasse zugeordnet. Öffnungszeiten am Abend zielten auf Arbeiter ab, Sprechstunden am Vormittag auf Hausfrauen. Die erste amtliche Beratungsstelle der Weimarer Republik eröffnete am 1. Juni 1926 im Berliner Bezirksamt Prenzlauer Berg:²⁷ Es wird Rat erteilt in allen sexuellen Fragen, insbesondere in denen der Fortpflanzung, und über die gesundheitliche und erbgesundheitliche Eignung als Ehepartner und Eltern/ Ehewerbern werden auf Wunsch Heiratszeugnisse ausgestellt. Beratung, Untersuchung und Ausstellung der Heiratszeugnisse erfolgen kostenlos[.] Dem gesamten Fürsorgepersonal der Ehe-
Vgl. Klautke, Rassenhygiene, 2004, S. 302. Zur Biografie Hirtsiefers vgl. Hermans, Baldur: „Heinrich Hirtsiefer (1876 – 1941) – ein Christlichsozialer Zeitgefährte – gehasst und verfolgt“. In: Ders. (Hrsg.): Re-visionen zu Nikolaus Gross und Heinrich Hirtsiefer. Essen 2015, S. 53 – 67. Der sog. „Hirtsiefer-Erlaß“ ist abgedruckt in Soden, Sexualberatungsstellen, 1988, S. 164 f. Zur Auseinandersetzung zwischen SPD und Zentrum vgl. Richter, Ingrid: Katholizismus und Eugenik in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. Zwischen Sittlichkeitsreform und Rassenhygiene. Paderborn 2001, S. 102 ff. Vgl. Fischer, Dienst, 2014, S. 105. Zur Eheberatungsstelle Prenzlauer Berg und ihrem Leiter vgl. Kolata, Jens: „Zwischen sozialistischer und nationalsozialistischer Eugenik. Friedrich Karl Scheumann und die Eheberatungsstelle Berlin Prenzlauer-Berg“. In: Hermanns, Ludger/ Hirschmüller, Albrecht (Hrsg.): Vom Sammeln, Bedenken und Deuten in Geschichte, Kunst und Psychoanalyse. Stuttgart 2013, S. 61– 82.
20
1 Die Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik
beratungsstelle ist in allen Fällen Schweigepflicht auferlegt / Es liegt im dringenden Interesse jedes einzelnen, sich in der Eheberatungsstelle rechtzeitig sexualhygienischen Rat zu holen.²⁸
Die Beratungsstelle galt als Modellprojekt. Sie erlangte über Deutschland hinaus große Aufmerksamkeit. Dies lag auch an ihrem Leiter Friedrich Karl Scheumann.²⁹ Er galt als führender sozialdemokratischer Eheberater und stand „wie kaum ein anderer Arzt für die Verknüpfung von Eugenik und Fürsorgegedanken in den kommunalen ärztlichen Eheberatungsstellen“³⁰. Scheumann sprach sich für ein erweitertes Angebot aus, um sowohl Jugendliche und junge Erwachsene für sexuelle Aufklärung zu gewinnen, als auch Verheiratete bei Problemen zu unterstützen. Diese Ehestandsberatung betrachtete er als Aufgabe seiner Einrichtung, da selbst nach eugenischen Beratungen und bei unterstützenswerten Eheschließungen unvorhersehbare Schwierigkeiten auftreten könnten: „Es ist wohl möglich, daß eine gesund begründete Ehe in ihrem Verlauf, besonders bei den heutigen Schwierigkeiten der Lebenshaltung, geschädigt werden kann; weit mehr eine solche Ehe, deren Fundament von vornherein schwach war.“³¹ Die Chancen, in diesen Fällen zu helfen, betrachtete er als gut.³² Im ersten Jahr führte Scheumann laut eigener Aussage 800 Beratungen durch, dann etwa 300 pro Jahr. Für jeden Besucher rechnete er mit einer Gesprächsdauer von 15 bis 30 Minuten. Die meisten Ratsuchenden waren Arbeiter. Zunächst stand der Wunsch nach Ehestandsberatung an zweiter Stelle, ab 1929 an erster. Eugenische Fälle gab es nur vereinzelt, obwohl Scheumann diesen Aspekt seiner Arbeit als besonders relevant hervorhob. Damit wollte er vermutlich nicht nur eugenische Beratung bewerben, sondern sich auch von der kritisierten Sexualberatung abheben. Als Mittelkürzungen der Kommunen die Eheberatung bedrohten, pries er eugenische Maßnahmen, um langfristig Kosten zu sparen. Gesundheitszeugnissen stand er jedoch kritisch gegenüber und begründete dies mit schwer zu eruierenden
Werbeplakat abgedruckt in Soden, Sexualberatungsstellen, 1988, S. 72. Friedrich Karl Scheumann (geb. 1.6.1896) war nach seiner Promotion als niedergelassener Arzt tätig, bevor er 1926 Leiter der Eheberatungsstelle Prenzlauer Berg wurde. Sein Eintritt in die SPD zwei Jahre später scheint in erster Linie aufgrund der „sozialistischen Eugenik“ erfolgt zu sein. Als Mitglied des Vorstands des Deutschen Bundes für Volksaufartung und Erbkunde publizierte Scheumann in der Verbandszeitschrift regelmäßig zu Eheberatung. Allein zwischen 1926 und 1932 warb er in über 40 Fachartikeln und zwei Monografien für Eugenik und Eheberatung, ebenso in ihm politisch entgegenstehenden Medien. Am 1. Mai 1933 trat Scheumann der NSDAP bei und verbesserte vorübergehend seine Rolle in der Medizinalbürokratie. Nachdem ihm dort jedoch keine weitere Karriere gelang, ließ er sich wieder als praktischer Arzt nieder. Vgl. Kolata, Eugenik, 2013, S. 61– 82. Ebd., S. 78. Nevermann, Hans: Über Eheberatung. Leipzig 1931, S. 39. Ebd.
1.1 Amtliche Beratungsstellen
21
Krankheiten, über die noch zu wenig bekannt sei. Auch sprach er sich gegen eine zwangsweise Ehetauglichkeitsfeststellung und Eheverbote aus. Verhütungsmittel lehnte er ab, freiwillige Sterilisierungen bewertete er hingegen positiv. Welche konkreten Auswirkungen die Beratungspraxis haben konnte, zeigt sich am Beispiel einer siebenköpfigen Arbeiterfamilie, die Scheumann beriet. Abgesehen von kurzen Unterbrechungen erhielt diese Familie seit Jahren Zuwendungen vom Wohlfahrtsamt, da der Mann fast andauernd arbeitslos war. Die Frau hatte fünf Kinder geboren und sechs Fehlgeburten erlitten. Scheumann beurteilte die Kinder nun unter eugenischen Gesichtspunkten. Das älteste, voreheliche Kind betrachtete er als deutlich besser veranlagt als die vier ehelichen, denen er Asthenie und Neurasthenie diagnostizierte. Vor der Beratung hatte die Frau einen Selbstmordversuch unternommen. Scheumann beschrieb sie als äußerst reizbar, sie lebe mit dem Mann in dauerndem Streit. Auch deutete der Mediziner an, der Ehemann sei chronisch untreu. Scheumann riet, weitere Geburten „sowohl aus eugenischen wie sozialhygienischen und individualhygienischen Gesichtspunkten zu vermeiden“.³³ Er empfahl eine Sterilisierung auf Kosten des Wohlfahrtsamtes. Als Verbesserungsmaßnahme ermahnte er den Ehemann in der Folge gelegentlich, die voreheliche Tochter wurde bei den Großeltern untergebracht. Nach einem Jahr kam Scheumann zum Schluss, dass sich das Familienleben weitgehend gebessert habe. Die Frau habe erkannt, dass der Mann, „wenn er eine geregelte Beschäftigung hat (Notstandsarbeit), überhaupt zu keinen Klagen Anlaß gibt“.³⁴ Dennoch suchte Scheumann nach weiteren Unterstützungsmöglichkeiten. Einen wesentlichen Zerrüttungsfaktor sah er in den Wohnverhältnissen, die Familie lebte gemeinsam in einer Stube und einer Küche. Mit Hilfe des Wohnungs- und Wohlfahrtsamtes wollte er die Wohnsituation ändern. Scheumann war in seinem Fachgebiet sehr aktiv. Er publizierte nicht nur extensiv, sondern war zudem im Ausschuß für Bevölkerungswesen und Rassenhygiene des Preußischen Landesgesundheitsrats für das Referat Entwicklung und Betrieb der Eheberatungsstellen zuständig. Auch engagierte er sich für deren überregionale Vernetzung. Ähnlich konkrete Unterstützung wie in der amtlichen Einrichtung am Prenzlauer Berg erhielten Besucher in der Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Berlin. Die Erwartungshaltung dort war, dass besonders viele junge Menschen eine voreheliche Beratung wünschten. Stattdessen gingen kaum Anfragen dafür ein. Schnell erwies sich, dass die Betreuung bestehender Ehen einen deutlich größeren
Scheumann, F. K.: Eheberatung. Einrichtung, Betrieb und Bedeutung für die biologische Erwachsenenberatung. Berlin 1928, S. 46. Zitiert nach Soden, Sexualberatungsstellen, 1988, S. 110. Ebd.
22
1 Die Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik
Prozentsatz der Tätigkeit ausmachte. Die zuständige Ärztin und Eheberaterin berichtete im Rückblick vor allem von Fragen zu Verhütung, Schwangerschaftsabbruch und unerfülltem Kinderwunsch. Frauen erhielten häufig den Rat, eine Ausbildung abzuschließen und berufstätig zu bleiben, bis sie schwanger wurden. An juristischen Themen standen vor allem Unterhaltsfragen und Auskünfte über Scheidung im Vordergrund.³⁵ Neben Scheumann prägte auch der Mediziner Rainer Fetscher³⁶, Leiter der Eheund Sexualberatungsstelle Dresden, maßgeblich die Diskussion um die staatliche Eheberatung. Sein Interesse galt vor allem der Frage, ob kriminelle Anlagen vererbbar seien. Dazu baute er mit Unterstützung des Sächsischen Ministeriums für Justiz 1925 eine „Erbbiologische Kartei“ auf. Diese enthielt Informationen zu allen sächsischen Gefängnisinsassen, deren Haftzeit drei Monate überstieg. Um die Daten zu ergänzen, fragte Fetscher bei Behörden nach und nahm Familienangehörige in die Kartei auf. Sein Ziel war es, den Werdegang der Familien verfolgen und später erbbiologisch auswerten zu können.³⁷ Fetscher war ein vehementer Verfechter von Sterilisierungen, die er trotz ihres gesetzlichen Verbots durchführte. Zudem forderte er obligatorische Ehefähigkeitszeugnisse. Die meisten amtlichen Beratungsstellen zogen einen vom ihm entwickelten Diagnosekatalog heran, um „Ehetauglichkeit“ zu diagnostizieren. Er nutzte seine Einrichtung, um negative Eugenik zu
Durand-Wever, Anne-Marie: „Eheberatung vor 1933 und nach 1945“. In: Fischer, J[oachim] (Hrsg.): Archiv für Jugend- und Eheberatung. Bd. 1, 1950, unveröffentlichtes Manuskript. DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Rainer Fetscher (16. Oktober 1895 – 8. Mai 1945) begann seine Karriere als Mediziner am HygieneInstitut der TH Dresden, wo er sich 1923 habilitierte. Nach seiner Ernennung zum Leiter der Eheund Sexualberatungsstelle wurde er in den Vorstand der Kriminalbiologischen Gesellschaft gewählt, 1928 erhielt er eine Professur für Hygiene. Fetscher war politisch ursprünglich eher links orientiert, allerdings ist bei ihm im Laufe der Zeit eine Annäherung an nationalsozialistische Positionen zu beobachten. Dennoch wurde Fetscher Anfang 1934 in den Ruhestand versetzt.Vgl. Scholz, Albrecht: Art. „Rainer Fetscher (1895 – 1945)“. In: Sigusch, Volkmar/ Grau, Günter (Hrsg.): Personenlexikon der Sexualforschung. Frankfurt am Main 2009, S. 160 – 165. Rainer Fetschers politische Einstellung und sein Wirken nach seiner Versetzung in den Ruhestand sind in der Forschung umstritten. Nach seinem Tod wurden ihm diverse Ehrungen zuteil, deren politische Instrumentalisierung in der DDR und Auswirkungen Reiner Pommerin analysiert. Vgl. Pommerin, Reiner: „Zwischen Anpassung und Widerstand. Zum 100. Geburtstag von Prof. Dr. Rainer Fetscher“. In: Technische Universität Dresden (Hrsg.): Rainer Fetscher. Gedenkschrift aus Anlaß des 100. Geburtstages. Dresden 1996, S. 15 – 30. Die Kartei enthielt 1933 Daten über insgesamt 145.000 Personen. Ihre Informationen wurden für gelegentliche Gutachten genutzt. In der Weltwirtschaftskrise wurden die Mittel für die Kartei drastisch gekürzt. Ungeklärt ist, ob die Kartei nach 1932 weitergeführt und ob sie danach noch genutzt wurde. Vgl. Lienert, Marina / Heidel, Caris-Petra: „Rainer Fetscher (1895– 1945)“. In: Ärzteblatt Sachsen 21 (Januar 2010), S. 27– 29, hier S. 28.
1.1 Amtliche Beratungsstellen
23
praktizieren und Sterilisierungen politisch zu propagieren. Wie andere Verfechter eugenischer Eheberatung hatte er die Hoffnung, dass eines Tages eugenisch indizierte Sterilisierungen eingeführt würden. Fetschers Sprechstunde fand einmal wöchentlich unter Trägerschaft der AOK statt. 1927 kamen knapp 600 Personen. Aber auch bei ihm meldeten sich wie bei Scheumann nur wenige Interessierte zur eugenischen Beratung, auch wenn er der Ansicht war, die Zahl steige „Gott sei Dank“.³⁸ Als Beispiel für seine Beratungsarbeit besprach Fetscher in der Zeitschrift Volkskunde, Volksaufartung, Eheberatung die Versöhnung eines Ehepaares. Der Mann hatte ihn um Hilfe gebeten. Fetscher bezeichnete den Fall als „etwas undankbaren Versuch einer Versöhnung“.³⁹ Die Frau hatte die Scheidung eingereicht, nachdem ihr Mann sich selbst und sie mit Gonorrhoe infiziert hatte. Wegen Alkoholkonsums sei er in einem Zustand gewesen, in dem er nicht mehr gewusst habe, was er tat. Als der Mediziner mit der Ehefrau sprach, sagte sie ihm, dass sie sich nur sehr schwer habe entschließen können, ihren Mann zu verlassen. Sie liebe ihn, befürchtete aber, dass sich sein Verhalten wiederholen würde. Fetscher formulierte daraufhin dem Mann gegenüber: „Das ganze Unglück kommt daher, daß Sie Alkohol getrunken haben, obwohl Sie nicht einen Tropfen vertragen können. Verpflichten Sie sich für alle Zukunft zur Abstinenz, schließen Sie sich einem entsprechenden Verbande an, dann wird ihre Frau in diesem Verhalten die nötige Sicherung der Fortsetzung der Ehe erblicken.“⁴⁰ Der Ratsuchende ging laut Fetscher auf den Vorschlag „geradezu mit Begeisterung“ ein und war zu allem bereit, um seine Frau zurückzugewinnen. Die Ehefrau wiederum betrachtete dies als Solidaritätsbekundung, zu einer Scheidung kam es nicht. In seinen Aufzeichnungen schloss der Eheberater: „Nun, man kann nicht behaupten, daß es immer gut ist, eine Ehe, die in die Brüche gehen will, zu schlichten. Es gibt auch Fälle, in denen man herzlichst wünscht, daß sie auseinander ginge, ohne daß es jedoch die äußeren Verhältnisse gestatten würden […].“⁴¹ Das Beispiel zeigt einerseits, wie bedeutend die Rolle des Beraters war. Fetscher sprach in seinem Fazit zudem Möglichkeiten und Grenzen der Beratung an. Außerdem traten die Ratsuchenden als Akteure in Erscheinung, die ihre Situation reflektierten und entsprechend ihren Bedürfnissen aktiv handelten.⁴²
Fetscher, R[ainer]: „Aus der Praxis der Eheberatung“. In: Volksaufartung, Erbkunde, Eheberatung 3 (1928), Nr. 8, S. 187– 188, hier S. 188. Ders.: „Aus der Praxis der Eheberatung“. In: Volksaufartung, Erbkunde, Eheberatung 3 (1928), Nr. 7, S. 161– 164, hier S. 162 f. Ebd. Ebd. Vgl. dazu auch Kapitel 3.6.2 Blick der Ratsuchenden.
24
1 Die Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik
Insgesamt boten die amtlichen Einrichtungen in der Praxis eine breitere Beratung an als von der Gesetzgebung vorgesehen. Dies verweist auf den Prozess der „Verwissenschaftlichung des Sozialen“, der vor allem in öffentlichen Verwaltungen zu beobachten ist – so auch in der Eheberatung. Raphael stellt für die Weimarer Republik eine „Verberuflichung der sozialen Dienstleistungen, Kooperation mit wissenschaftlichen Spezialisten und Formierung neuer Sachverständigenrollen“ fest.⁴³ Arbeitsplätze für Experten entstanden. Die Sicht der neuen Experten, in diesem Fall der Eheberater, gestaltete die Dienstleistung.⁴⁴ Häufig wurden Ehe- und Sexualberatung verknüpft, da dies größeren Erfolg versprach als ein reines Angebot zu eugenischer Beratung. Letztere war in der Praxis weitestgehend gescheitert, da kaum jemand sie nachfragte. Somit passte sich das Angebot an die Bedürfnisse der Ratsuchenden an, aber auch an das Selbstverständnis der Eheberater. Die sozialdemokratische Synthese aus Ehe- und Sexualberatung etablierte sich mehr und mehr. Zum einen war der Basisdruck hin zur Sexualberatung stark, zum anderen machten sozialdemokratische Ärzte ihren Einfluss in der kommunalen Eheberatung geltend.⁴⁵ Die Forderung der SPD, amtliche Angebote zu Sexualberatungsstellen auszubauen, stieß bei der zentrumsnahen Bürokratie des Volkswohlfahrtsministeriums zunehmend auf Akzeptanz. Manche Entscheidungsträger planten von vorneherein, Ehe- und Sexualberatung zu verknüpfen, wie beispielsweise der Berliner Stadtrat. Andere wiederum hofften auf die Einführung eines obligatorischen Gesundheitszeugnisses, um so den geringen Anteil der eugenischen Beratung zu steigern. Bekanntester Vertreter dieser Gesundheitsberatung war der Sozialdemokrat Alfred Grotjahn⁴⁶, der sich auch für eine negative Eugenik in Form von Zwangssterilisierungen aussprach. Um die Eheberatung weiter zu fördern, gründeten führende Ärzte im Juni 1927 die Vereinigung öffentlicher Eheberatungsstellen. Auch Fetscher und Scheumann waren beteiligt. Geplant war, Eheberatung wissenschaftlich zu fundieren, gemeinsame Arbeitsmethoden zu entwickeln, einheitliches Material zu entwerfen, Fortbildungen anzubieten sowie ein Archiv aufzubauen. Gemeinsame Veröffentlichungen und Netzwerkarbeit standen auf der Agenda. Obwohl die Akteure unterschiedliche Schwerpunkte setzten, sahen sie alle die Lösung von Eheproblemen im medizinischen Bereich – sowohl in der Eugenik als auch in der Behandlung von Krankheiten, die aus Sicht der Berater grundsätzlich alle zu Eheproblemen
Raphael, Experten, S. 236. Vgl. ders., Verwissenschaftlichung, 1996, S. 180. Vgl. Fischer, Dienst, 2014, S. 108. Zu Grotjahn vgl. Hansen, Eckhard et al. (Hrsg.): Biographisches Lexikon zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1871 bis 1945. Bd. 2: Sozialpolitiker in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus 1919 bis 1945. Kassel 2018, S. 63 – 65.
1.1 Amtliche Beratungsstellen
25
führen konnten.⁴⁷ Im Jahr darauf gründete sich der Reichsverband für Geburtenregelung und Sozialhygiene, zu dem verschiedene Sexualreformverbände gehörten. Er gab die Zeitschrift Sexual-Hygiene heraus.⁴⁸ Die amtliche Eheberatung der Weimarer Republik stellte die relevanteste Umsetzung eugenischer Politik dar. Dennoch spielte sie sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der Praxis eine deutlich geringere Rolle als die Sexualberatung. Seit 1929 war „in Fachkreisen [sogar] von einer ‚Krise der Eheberatung‘“⁴⁹ die Rede. Erst als die Nationalsozialisten die Sexualberatungsstellen auflösten, endete auch deren Erfolgsgeschichte. Die Beratungsrichtung stand mit ihren Ansichten zu Sexualität und Fortpflanzung im Widerspruch zu nationalsozialistischen Auffassungen und galt als ein bedrohlicher Teil der Arbeiterbewegung.⁵⁰ Daher erging am 17. Mai 1933 an die Landespolizeibehörden die Aufforderung, diese „kulturbolschewistischen Bestrebungen dienenden Organisationen für Geburtenregelung und Sozialhygiene“⁵¹ sofort aufzulösen und ihr Vermögen zu beschlagnahmen. Es kam zu Entlassungen, Verhaftungen und der Verfolgung von Mitarbeitern, von denen zahlreiche emigrierten. Viele Eheberatungsstellen, zum Teil auch Ehe- und Sexualberatungsstellen, bestanden zunächst dennoch fort, auch ihre personelle Besetzung blieb gleich. Andere nannten sich nun „Beratungsstellen für Erb- und Rassenpflege“. Eine Eheschließung ohne „Ehetauglichkeitszeugnis“ war nicht mehr möglich, die vormals freiwillige Beratung nunmehr obligatorisch. Sippschaftstafeln erfassten die Verwandtschaft der Untersuchten bis hin zu den Großeltern und deren Nachfahren. Informationen von Ärzten und Behörden sicherten die Aussagen der Betroffenen ab. Eine Vielzahl rassenpolitischer Maßnahmen trat in Kraft: Zu nennen ist das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, das Sterilisationen bei zu vermutenden Erbschäden auch gegen den Willen der Betroffenen vorsah,⁵² des Weiteren das „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ im September 1935, das Eheschließung beziehungsweise Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Nichtjuden verbot. Im Oktober 1935 folgte das „Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes“ Vgl. dazu auch Kapitel 3.5.3 Modell-Beratungsstelle Hannover. Zusammenschlüsse auf Verbandsebene als Gegenmaßnahme zu anderen Beratungsrichtungen stellten auch später in der Bundesrepublik wichtige Abgrenzungs- und Entwicklungsschritte dar.Vgl. dazu auch Kapitel 4.2.1 Vorgeschichte und Gründung. Soden, Sexualberatungsstellen, 1988, S. 80. Vgl. im Folgenden Czarnowski, Gabriele: Das kontrollierte Paar. Ehe- und Sexualpolitik im Nationalsozialismus. Weinheim 1991. Preußischer Minister des Innern, Schreiben vom 17. Mai 1933, zitiert nach Soden, Sexualberatungsstellen, 1988, S. 148. Das Gesetz beruhte auf einem Entwurf des Preußischen Landesgesundheitsrates. Vgl. dazu Kapitel 1.2 Kirchliche Beratungsstellen.
26
1 Die Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik
(„Erbgesundheitsgesetz“), das Eheverbote bei Erbkrankheiten vorsah. Im Mai 1935 gaben die „Grundsätze für die Errichtung und Tätigkeit der Beratungsstellen für Erb- und Rassenpflege“ im Bereich jedes Gesundheitsamtes mindestens eine Beratungsstelle vor, unabhängige medizinische Angebote wurden verboten. Die Einrichtungen waren mindestens mit einem leitenden Arzt und einer Gesundheitspflegerin besetzt. Damit sollte die Erbgesundheit der Familie gefördert werden. Da das Handeln des Arztes und Beraters auf die Gesamtheit des „Volkes“ zielen sollte, stellte die Ehe keinen privatrechtlichen Vertrag mehr dar. Dies führte tendenziell zu ihrer Auflösung als Institution, sie wurde für den Zweck der „Verbesserung der Rasse“ funktionalisiert. Gabriele Czarnowski resümiert: „Weil die Sexualität für den Rassenbegriff konstitutiv war, kann die nationalsozialistische Ehe- und Sexualpolitik per se als ‚Rassenpolitik‘ verstanden werden.“⁵³ An eugenische Programme anknüpfend, nutzten die Nationalsozialisten die Eheberatung in ihrem Sinne als Erfassungsinstrument. Ratsuchende spielten als Individuen gegenüber der „Volksgemeinschaft“ keine Rolle mehr. Die verbliebenen Eheberater versuchten teilweise, in der neuen politischen Ordnung einen Platz zu finden. Obwohl viele von Scheumanns Kollegen im Bezirksamt entlassen wurden, überstand der Mediziner, der als Sachverständiger im Ausschuß für Bevölkerungswesen und Rassenhygiene des Preußischen Landesgesundheitsrats tätig gewesen war, die nationalsozialistische Machtübernahme zunächst unbeschadet. Auch seine SPD-Mitgliedschaft hatte vorerst keine Konsequenzen. Scheumann hoffte, dass die neuen Machthaber eugenische Maßnahmen stärker unterstützen würden. Er plädierte für eine größere Kontrolle, hob seinen Einsatz für Sterilisierungen hervor und begrüßte deren Zwangsdurchführung. Am 1. Mai 1933 trat Scheumann der NSDAP bei. Er amtierte vorübergehend als Stellvertreter des Gesundheitsamtes und der Eheberatung. Als er die Leiterin einer Sexualberatungsstelle anzeigte, weil sie ein Abtreibungsmittel verschrieben hatte, wurden alle städtischen Berliner Ehe- und Sexualberatungsstellen geschlossen. Zwar bestand Scheumanns Einrichtung weiterhin, er fungierte jedoch nicht mehr als deren Leiter. Vielmehr zielte er auf eine weitere Karriere als leitender Amtsarzt. Nachdem er jedoch trotz mehrfacher Bewerbung keinen Posten am Erbgesundheitsgericht erhalten hatte, schied er 1939 auf eigenen Antrag aus der kommunalen Verwaltung aus. Seine ehemalige Tätigkeit als Leiter einer Beratungsstelle, die als sozialpolitisch motiviert galt und auch Verhütungsberatung einschloss, hatte ihn als politisch unzuverlässig desavouiert. Czarnowski, Gabriele: „‚Der Wert der Ehe für die Volksgemeinschaft‘. Frauen und Männer in der nationalsozialistischen Ehepolitik“. In: Heinsohn, Kirsten et al. (Hrsg.): Zwischen Karriere und Verfolgung. Handlungsräume von Frauen im nationalsozialistischen Deutschland. Frankfurt am Main 1997, S. 78 – 95, hier S. 78.
1.2 Kirchliche Beratungsstellen
27
Fetscher, der ursprünglich ebenfalls eher sozialdemokratisch orientiert war, hatte sich bereits in der Weimarer Republik immer mehr nationalsozialistischen Positionen angenähert und begeisterte sich für das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ von 1933. Ebenfalls 1933 unterzeichnete er das „Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem deutschen Staat“. Dennoch wurde Fetscher Anfang 1934 in den Ruhestand versetzt. Er musste seinen Professorentitel abgeben, seine „Erbbiologische Kartei“ geriet in Vergessenheit.
1.2 Kirchliche Beratungsstellen Die Kirchen unterstützten die amtliche Eheberatung, da sie den Sexualberatungsstellen entgegenwirken wollten.⁵⁴ Beide Konfessionen gerieten unter Druck, weil sie eine zunehmend medizinische Interpretation der Ehe verhindern wollten und auch befürchteten, Einfluss und ihre moralische Führungsrolle zu verlieren.⁵⁵ Der Konkurrenzdruck zwang sie, sich mit Eheberatung auseinanderzusetzen und eine umfassendere Begleitung von Ehe und Familie zu konzipieren.⁵⁶ Erstmals äußerte sich die katholische Kirche auf der Paderborner Diözesansynode 1922 zum Thema, als die freiwillige Abgabe von Gesundheitszeugnissen vor der Ehe zur Diskussion stand.⁵⁷ Da die amtliche Eheberatung, wie sie vom Zentrum geplant und im Hirtsiefer-Erlaß vorgesehen war, den Vorstellungen der Amtskirche durchaus entsprach, betrachtete sie ein eigenes konfessionelles Angebot ursprünglich als unnötig. Dennoch bestanden bereits erste katholische Beratungsstellen wie diejenige in Berlin, die der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB)⁵⁸ und die Caritas 1928 gegründet hatten, sowie eine Einrichtung in Frankfurt. Zu vermuten ist, dass beide mit dem Ziel der vorehelichen Beratung eingerichtet wurden.⁵⁹ Das untersuchte Material lässt jedoch keine fundierte Aussage zu.
Zur Sexual- und Eheberatung in der Weimarer Republik und im „Dritten Reich“ vgl. im Folgenden Soden, Sexualberatungsstellen, 1988; Timm, Politics, 2010, S. 81 ff. Vgl. dazu auch Klautke, Rassenhygiene, 2004, S. 293 – 312. Vgl. Lippold, Church, 2014, S. 68 ff. Zur Konzeption katholischer Eheberatung vgl. Richter, Katholizismus, 2001, S. 111 ff. sowie Niedermeyer, Albert: Handbuch der speziellen Pastoralmedizin. Bd. 2: Ehe- und Sexualleben: Fakultative Sterilität, Sterilität, Künstliche Befruchtung, Impotenz, Eheberatung. Wien 1952, S. 376 ff. Zur katholischen Eheberatung in der Weimarer Republik vgl. Fischer, Dienst, 2014, S. 115 ff. Seit 1983 ist die Abkürzung KDFB für den Katholischen Deutschen Frauenbund gebräuchlich. Daher wird sie in der vorliegenden Arbeit verwendet, auch wenn der Frauenbund im Untersuchungszeitraum noch mit „KDF“ abgekürzt wurde. Vgl. Kapitel 4.5.5.1 Eheberatung in der Großstadt.
28
1 Die Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik
Nachdem die Ehestandsberatung einen Ausbau erfahren hatte, betrachtete die katholische Kirche die amtliche Eheberatung in Preußen jedoch als gescheitert. Die Fuldaer Bischofskonferenz⁶⁰ stellte daraufhin 1927 die Eheberatung zur Diskussion und gab 1930 entsprechende Leitsätze heraus.⁶¹ Sie enthielten neben scharfem Protest gegen die Ausweitung der amtlichen Beratung auch vehemente Forderungen nach einer autonomen katholischen Eheberatung. Erklärtes Ziel war es, ein religiössittlich orientiertes Angebot aufzubauen, um den Glauben der Ratsuchenden zu erneuern und die amtliche Eheberatung im Sinne der Kirche zu beeinflussen. Man wies darauf hin, „daß der katholische Seelsorger durch die Erteilung der Brautunterrichte bereits immer im Dienste der Eheberatung gestanden“ habe.⁶² Die Fuldaer Leitsätze bezogen Eheberatung nicht nur auf den Zeitraum vor der Heirat, sondern auch auf die Ehe selbst, denn innerhalb der Kirchenstrukturen bestand die Befürchtung, dass sich Gläubige an nichtkonfessionelle Stellen wenden könnten.⁶³ Der Caritasverband und der KDFB sollten mit finanzieller Unterstützung der Bischöfe die katholische Eheberatung aufbauen. Als Beraterinnen waren liebevolle und kluge Frauen vorgesehen, die „eindringlich und wohlwollend eine gütliche Verständigung unter den Ehegatten“⁶⁴ zu erreichen hatten. Im August 1930 gab die Caritas eine entsprechende Denkschrift heraus. Zwar existierten bereits vereinzelt katholische Beratungsstellen, doch vor allem der KDFB betrieb nun maßgeblich Neugründungen. Dem schloss sich der Verband der Frauen- und Müttervereine an, er spielte jedoch lediglich eine untergeordnete Rolle. Dass einige katholische Kreise der Eheberatung kritisch gegenüberstanden, trat in den 1930 erschienenen Richtlinien zum Thema deutlich zutage. Dort stand, gläubige Katholiken bräuchten keine Sonderzuwendung, da die katholische Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe genüge, wenn Krisen im Ehe- und Familienleben entstünden. Sich in sexuellen und Ehefragen Rat zu holen, galt vielmehr als Schwäche. Dem widersprachen die Eheberaterinnen. Gerade die Praxis bestätige, dass die gesellschaftlichen Veränderungen christliche Beratungsstellen notwendig machten. Die Frauen betonten, dass sexuelle Not, Ehe- und Familienkrisen auch in katholischen Kreisen existierten, und sahen gerade diejenigen Eheleute in besonderer Bedrängnis, die sich um sittliche Gewissenhaftigkeit bemühten. Ihrer Ansicht nach genügte es nicht, auf die katholische Ehelehre hinzuweisen. Dem Ratsuchen-
Ab 1966 Deutsche Bischofskonferenz. Die Weisungen der Bischofskonferenz sind abgedruckt in Niedermeyer, Handbuch, 1952, S. 378. Vgl. außerdem Fischer, Dienst, 2014, S. 377 ff. und Richter, Katholizismus, 2001, S. 121 f. Nevermann, Eheberatung, 1931, S. 51. Zur Eheberatung von Caritas und KDFB vgl. im Folgenden Lippold, Church, 2014, S. 178 ff. Niedermeyer, Handbuch, 1952, S. 378.
1.2 Kirchliche Beratungsstellen
29
den sei „nicht geholfen, wenn ihm nur kalte, nüchterne Grundsätze entgegengehalten werden“.⁶⁵ Die Beraterinnen wollten vielmehr individuell auf die Besucher eingehen. Sie betrachteten daher „mütterlich und warmherzig empfindende Frauen“ als besonders geeignet, um die Einrichtungen zu leiten.⁶⁶ Damit knüpften sie an eine in der Sozialen Arbeit tief verankerte Tradition an, weibliche Berufstätigkeit als unverzichtbaren Dienst an der Gesellschaft zu legitimieren. Als Begründung schrieben sie allen Frauen eine „geistige Mütterlichkeit“ zu, die als Gegenpol und Ausgleich zur vermeintlich kalten Rationalität einer von männlicher Berufstätigkeit dominierten Gesellschaft fungierte. Der Verweis auf die zugewandten Eigenschaften der Frau begründete weibliche Erwerbsarbeit aber nicht nur, sondern verteidigte sie auch gegen Konkurrenz.⁶⁷ Bereits 1931 veranstaltete der KDFB einen Kurs für katholische Eheberatungsstellen, 1932 folgte ein weiterer.⁶⁸ Auf Einladung der Caritas sowie des KDFB gründete sich im selben Jahr der Reichsausschuß für katholische Eheberatung, dem die wichtigsten Verbände des Sozialkatholizismus sowie weitere Experten wie Hermann Muckermann⁶⁹ und Albert Niedermeyer⁷⁰ angehörten.⁷¹ Den Vorsitz führten
„Richtlinien zur Eheberatung“. In: Vorstandsblätter der Frauen- und Müttervereine, 1930. Zitiert nach Rocholl-Gärtner, Ingeborg: Anwalt der Frauen, Hermann Klens. Düsseldorf 1978, S. 123 f. Ebd. Zum Konzept der „geistigen Mütterlichkeit“ vgl. Sachße, Christoph: Mütterlichkeit als Beruf. Sozialarbeit, Sozialreform und Frauenbewegung 1871– 1929. Frankfurt am Main 1986, S. 102– 107. Vgl. Richter, Ingrid: „Von der Sittlichkeitsreform zur Eugenik. Katholischer Deutscher Frauenbund und eugenische Eheberatung“. In: Muschiol, Gisela (Hrsg.): Katholikinnen und Moderne. Katholische Frauenbewegung zwischen Tradition und Emanzipation. Münster 2003, S. 255 – 280, hier S. 266 und S. 268 f. Hermann Muckermann (30. 8.1877– 27.10.1962) studierte nach seinem Eintritt in den Jesuitenorden Theologie, Biologie, Zoologie und Philologie und wurde zum Dr. phil. promoviert; 1909 wurde er zum Priester geweiht. Um seinem Interesse an der Eugenik besser nachgehen zu können, trat Muckermann 1926 aus dem Jesuitenorden aus. Im Jahr darauf wurde er Abteilungsleiter am KaiserWilhelm-Institut für Anthropologie, dessen Finanzierung er unterstützt hatte. Zwar war er Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene und Mitbegründer von Das kommende Geschlecht. Zeitschrift für Eugenik, dennoch war er als katholischer Priester für die Nationalsozialisten politisch untragbar und wurde 1933 entlassen. Später erfolgte zudem ein Rede- und Publikationsverbot. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte er unter anderem den Lehrstuhl für Angewandte Anthropologie und Sozialethik an der TH Berlin inne. Im Jahr 1952 erhielt Muckermann das Bundesverdienstkreuz. Vgl. Schmuhl, Muckermann, 2014. Albert Niedermeyer (24.9.1888 – 22. 3.1957) wurde in Medizin und Jura promoviert sowie zum Dr. phil. Der in Deutschland als Gynäkologe tätige Sozialhygieniker befürwortete eine gemäßigte Eugenik. Er betonte den sittlichen Aspekt und lehnte Ehezeugnisse sowie negative eugenische Maßnahmen ab. 1933 verfasste er für die Fuldaer Bischofskonferenz eine Denkschrift zum Gesetzesentwurf über die Unfruchtbarmachung Minderwertiger, in der er diesen scharf kritisierte. Niedermeyer befürchtete, dass mit dem Gesetz die Vernichtung sogenannten „lebensunwerten Le-
30
1 Die Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik
im jährlichen Wechsel Caritas und KDFB, wobei beide Verbände die Führungsrolle anstrebten.⁷² Unstimmigkeiten bestanden vor allem darüber, wie stark eugenische Ziele die Beratungspraxis beeinflussen sollten, weniger über Eugenik an sich. Die Caritas wollte ausgebildete Mediziner als Zuständige in der Beratung einsetzen, um der Eugenik einen größeren Stellenwert zu geben. Diese Fokussierung auf das Medizinische suchte der Frauenbund zu verhindern, da er die Beratung als Dienst von Frauen für Frauen betrachtete. Die Beraterinnen qualifizierten sich als Mütter und Ehefrauen für ihre Tätigkeit und sollten auf dieser Basis den vor allem weiblichen Besuchern warmherzigen, lebensnahen Rat geben. Darüber hinaus wollte der KDFB mit der Eheberatung einen neuen weiblichen Berufszweig etablieren. Auch wegen dieser Unstimmigkeiten stand mit Anna Beckmann⁷³ eine Frau dem Reichsausschuß für katholische Eheberatung als Geschäftsführerin vor, die bens“ einhergehen könnte. Aufgrund seiner Position fachlich völlig isoliert, kehrte er in sein Geburtsland Österreich zurück, wo er ab 1934 die Eheberatung und Schwangerenfürsorge Wiens leitete. 1938 wurde Niedermeyer im KZ Sachsenhausen inhaftiert, später mit dem Verbot wissenschaftlicher Betätigung jedoch entlassen. Nach Kriegsende habilitierte er sich und erhielt eine außerordentliche Professor für Pastoralmedizin in Wien. Zu seinen Hauptwerken zählt das Handbuch der speziellen Pastoralmedizin, eine der letzten größeren Veröffentlichungen auf diesem Gebiet. Die Pastoralmedizin war interdisziplinär ausgerichtet und verband bis etwa in die 1950erJahre Theologie mit Medizin, Psychiatrie und Ethik, um den Gläubigen Themen, die über pastorale Fragen hinausgingen, beantworten zu können. Vgl. Niedermeyer, Albert: Wahn, Wissenschaft und Wahrheit. Lebenserinnerungen eines Arztes. Innsbruck 1956. Richter, Katholizismus, 2001, S. 320 und S. 368 ff. o. V.: „Albert Niedermeyer“. In: Wien Geschichte Wiki. Verfügbar unter: https://www.ge schichtewiki.wien.gv.at/Albert_Niedermeyer, aufgerufen am 11. Oktober 2021. Zu weiteren Mitgliedern des Reichsausschusses vgl. o. A.: Reichsausschuss für katholische Eheberatung, Abschrift, Archiv des Deutschen Caritasverbandes (ADCV), 349.4, Fasz. 02. Wie auch später in der Bundesrepublik war von den Kirchen die katholische die erste, die eine spezialisierte, übergeordnete Führung der Eheberatungsstellen anstrebte. Vgl. Kapitel 3.4.2 Katholisches Zentralinstitut sowie Kapitel 4.2.1 Vorgeschichte und Gründung. Anna Beckmann (geb. Heselhaus, 1882– 7. 5.1952) arbeitete ursprünglich in der Familienfürsorge. Sie gründete 1927 eine der ersten katholischen Eheberatungsstellen. Die Geschäftsführerin des Reichsausschusses für katholische Eheberatung war gleichzeitig Vorsitzende der Konferenz der katholischen Eheberatungsstellen. Zu diesem Zeitpunkt war die Mutter von drei Kindern verwitwet und widmete der katholischen Eheberatung „ihre volle Kraft und ganze Liebe“. Die Aufgaben der Eheberatung sah sie vor allem in geistig-seelischer Perspektive, ergänzt um eugenische Aspekte. Nach dem Zweiten Weltkrieg betrieb Beckmann weiterhin die Eheberatungsstelle in Bonn, zum Teil finanziert aus eigenen Mitteln. Unter ihrer Mitwirkung entstand das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen. Kurz vor ihrem Tod erhielt sie das päpstliche Verdienstkreuz „Pro ecclesia et pontifice“. Krabbel, Gerta: „Anna Beckmann“. In: Die christliche Frau 41 (1952), H. 3, S. 94– 95, hier S. 94. Vgl. Arning, Holger: „Frauen auf den Katholikentagen“. In: Raasch, Markus / Linsenmann, Andreas (Hrsg.): Die Frauen und der politische Katholizismus. Akteurinnen, Themen, Strategien. Paderborn 2018, S. 111– 150, hier S. 144. Vgl. Fischer, Dienst, 2014, S. 148, Fn. 347. Vgl. Richter, Sittlichkeitsreform, 2003, S. 270.
1.2 Kirchliche Beratungsstellen
31
keinem der beiden Verbände angehörte. Der Reichsausschuß sollte unter anderem die Gründung katholischer Beratungsstellen fördern, die Eheberatungsbewegung beobachten und zu dabei entstehenden Fragen beraten, Richtlinien für die Praxis entwickeln, für die Ziele katholischer Eheberatung werben sowie geeignete Kräfte mit ausbilden. Zu diesem Zeitpunkt bestanden 45 katholische Stellen. Noch im selben Jahr hielt der Reichsausschuß mit dem Deutschen Caritasverband in Freiburg eine Tagung ab, auf der Muckermann die Diskussion beherrschte. Sein Engagement verschob den Akzent hin zu einer eugenischen Beratung.⁷⁴ Auf der Tagesordnung standen Themen wie „Die Eugenik und der Aufgang des Abendlandes“, „Die Geschichte der Eheberatung und die Notwendigkeit konfessioneller Gestaltung“ sowie „Das Problem der konkreten Gestaltung der Eheberatung“.⁷⁵ Die eugenische Zielsetzung war immer wieder Diskussionspunkt zwischen Caritas und KDFB und gewann im Laufe der Zeit zunehmend an Bedeutung. Zu Beginn hatten katholische Kreise sie mit Skepsis betrachtet, später aber immer mehr aufgegriffen, wobei Sterilisierung sowie zwangseugenische Maßnahmen jedoch weiterhin auf Ablehnung stießen. Katholische Eheberatung sollte mit dem kirchlichen Eheideal vor allem der Glaubenserneuerung und sittlichen Werten dienen.⁷⁶ Trotz der Bemühungen blieb die Wirkung katholischer Eheberatung gering. Es habe zu wenige Beratungsstellen gegeben, nicht genug Ratsuchende und auch Jugendliche zeigten kein Interesse.⁷⁷ Die evangelischen Kirchen ließen ein größeres eugenisches Engagement erkennen als die katholische. Sie strebten an, Eugenik mit ihrer Ehe- und Sexualpädagogik⁷⁸ sowie ihren Vorstellungen von Volkssittlichkeit, Nächstenliebe und Vaterlandsliebe zu verbinden.⁷⁹ Während des Nationalsozialismus waren sie bereit, in eugenischen Fragen mit der Regierung zu kooperieren. Bereits 1931 entstand in der
Zur Tagung vgl. Dies., Katholizismus, 2001, S. 126 ff. Dies., Sittlichkeitsreform, 2003, S. 266 f. Das Programm der Tagung ist abgedruckt in Soden, Sexualberatungsstellen, 1988, S. 79. Das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen konstatierte im Rückblick: „Beachtliche Tagungen fanden in jenen Jahren statt zur Fundierung der praktischen Arbeit“; o. A.: Niederschrift aus der Besprechung in der erweiterten Trägerschaft des Kath. Zentralinstituts für Ehe- und Familienfragen am 16. Mai 1960 in Köln, S. 2, Historisches Archiv des Erzbistums Köln (AEK), Archiv der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen (KZI), 295. Zur Eugenikdebatte im KDFB vgl. Richter, Sittlichkeitsreform, 2003. Die Zahl der beratenen Fälle lag pro Jahr zwischen 50 bis 350. Vgl. Lippold, Church, 2014, S. 198. Vgl. im Folgenden Sach, Louisa: Gedenke, daß du eine deutsche Frau bist! Die Ärztin und Bevölkerungspolitikerin Ilse Szagunn (1887– 1971) in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Berlin 2006, S. 151 ff. Auch verfügbar unter: https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/ 7386, besucht am 4. September 2021. Vgl. im Folgenden Kaminsky, Rassenhygiene, 2005, H. 2, S. 206 ff.
32
1 Die Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik
Inneren Mission eine „Fachkonferenz für Eugenik“,⁸⁰ um die Modernisierung des Verbandes zu fördern. Die Konferenz sprach sich für Sterilisationen „erbbiologisch schwer Belasteter“ aus. Während des Nationalsozialismus beriet sie die evangelischen Anstalten dabei, das Zwangssterilisationsgesetz umzusetzen. Auch Lothar Loeffler,⁸¹ einer der bekanntesten Rassenhygieniker des „Dritten Reiches“, nahm an den Sitzungen teil.⁸² In der preußischen Regierung bestanden zu Anfang Bedenken, dass die evangelische der amtlichen Eheberatung entgegenwirken würde, was sich jedoch als unbegründet erwies. Anscheinend nahm die Öffentlichkeit die evangelische Beratung kaum wahr.⁸³ Die Ursache dafür war auch, dass die evangelischen Kirchen sich nicht auf eine offizielle Position zu Verhütung und Eheberatung einigen konnten und keinen Konsens fanden, wie sie die Gründung von Beratungsstellen unterstützen sollten.⁸⁴ Diese Konflikte innerhalb der Kirchen behinderten während der gesamten Weimarer Republik den Aufbau der Beratungsarbeit. Die Innere Mission⁸⁵ als zentrale Wohlfahrtsorganisation der evangelischen Kirche nahm dabei den Standpunkt ein, Eheberatung sei von Medizinern auf eugenischer Basis und mit religiöser Motivation zu leisten. Im Kontrast dazu wollte der Deutsche Evangelische Frauenbund das Feld der Laienarbeit – spezifisch Frauen – überlassen. Die Konfliktlinien entsprachen somit denjenigen innerhalb der katholischen Kirche. Die Beraterinnen konnten sich aus ihrer eigenen Lebens- und Eheerfahrung heraus qualifizieren. Sie sollten Scheidungen verhindern und Ratsuchende für ein aktives kirchliches Leben gewinnen. Obwohl der Bund zum Handeln aufrief, gründeten nur wenige lokale Frauenorganisationen Beratungsstellen, sodass insgesamt bis 1931 lediglich 13 entstanden.⁸⁶ Die erste und bekannteste war die 1927 in
Seit 1934 „Ständiger Ausschuss für Rassenhygiene und Rassenpflege“. Zur Biografie Loefflers vgl. Kapitel 3.2.4.3 Lothar Loeffler. Vgl. Kaminsky, Rassenhygiene, 2005, S. 224. Vgl. Sach, Frau, 2006, S. 151 ff. Evangelische Eheberatung wird selbst in der Publikation Hans Nevermanns von 1931, die einen Überblick über die Eheberatung der Weimarer Republik bietet, nicht erwähnt. Im Gegensatz dazu ist der Eheberatung der katholischen Kirche ein eigenes Kapitel gewidmet. Vgl. Nevermann, Eheberatung, 1931. Vgl. im Folgenden: Lippold, Church, 2014, S. 118 ff. 1957 schloss sich die Innere Mission mit dem Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland unter dem Namen „Innere Mission und Hilfswerk der EKD“ zusammen. Im Jahr 1975 wurde daraus das „Diakonische Werk der EKD e. V.“. In der vorliegenden Arbeit wird der Verband ab dem Zusammenschluss 1957 als Diakonisches Werk bezeichnet. Dies folgt dem Beispiel von Lippold. Vgl. Lippold, Church, 2014. Lippold führt die geringe Forschung zu protestantischer Eheberatung in Weimarer Republik und Nationalsozialismus auch auf die kleine Anzahl der Beratungsstellen und ihren mangelnden Einfluss zurück. Vgl. ebd., S. 122.
1.2 Kirchliche Beratungsstellen
33
Berlin-Friedenau gegründete Einrichtung,⁸⁷ deren Leitung Maria Blech⁸⁸ innehatte. Wie in Friedenau besetzten fast immer Frauen die Führungspositionen. Ziel war es, Ratsuchenden ein Gesprächsangebot zu machen, sodass sie Eheprobleme einer außenstehenden, zugewandten Person mitteilen konnten. Obwohl die medizinische Beratung den Schwerpunkt bilden sollte und die Innere Mission eugenischen Maßnahmen auch unter Zwang positiv gegenüberstand, spielte dies in der Praxis aber scheinbar eine untergeordnete Rolle. Die meisten Beratungsstellen blieben kleine Unternehmungen, die oftmals nicht einmal in eine Institution eingebunden waren. Dennoch gelang es, die Arbeit auf geringer Basis auszubauen. Auch katholische Theologen versuchten, ihre Morallehre mit einer biologistischen Weltordnung zu verschmelzen.⁸⁹ Der wichtigste Vertreter auf diesem Gebiet, Muckermann, trug wesentlich dazu bei, diesen Gedanken in der katholischen Öffentlichkeit zu verbreiten. Beispielsweise plädierte er für Maßnahmen negativer Eugenik wie Sterilisation.⁹⁰ Muckermann, der 1926 aus dem Jesuitenorden austrat, war eine durchaus umstrittene Persönlichkeit. Besonders seine mangelnde Unterordnung unter die Autorität der Amtskirche stieß dort auf Kritik. Als im Dezember 1930 die päpstliche Enzyklika „Casti connubii“⁹¹ zu Familie und Gesellschaft erschien, war er gezwungen, offiziell von seiner Position abzurücken und sich der Vgl. dazu auch Jäger, Sarah: Bundesdeutscher Protestantismus und Geschlechterdiskurse 1949 – 1971. Eine Revolution auf leisen Sohlen. Tübingen 2019, S. 320. Maria Blech (geb. Jacobi, 16.9.1886) wurde meist als „Frau Pfarrer Blech“ bezeichnet. Sie war jedoch nicht selbst ordiniert, sondern vielmehr Witwe eines Pfarrers und hatte einen Hintergrund in Sozialarbeit und Pädagogik. Zur Leiterin der 1927 gegründeten Evangelischen Eheberatungsstelle wurde Blech nicht von den Frauenorganisationen, sondern von der Kirchenleitung Berlin Kirchenkreis Kölln-Land ernannt, was eine Ausnahme zum üblichen Vorgehen darstellte. Wie viele in der evangelischen Beratungsarbeit äußerte sich Blech zu Beginn des „Dritten Reichs“ positiv: Man spüre „stark und dankbar den gewaltigen Umschwung in der Einstellung zu Ehe und Familie im nationalsozialistischen Staat“ (zitiert nach Lippold, Church, 2014, S. 154, Fn. 84). Ihre Beratungsstelle blieb bis mindestens Herbst 1944 bestehen. Zum August 1945 wurde Blech dann als Leiterin der Evangelischen Ehehilfe der Inneren Mission angestellt. Bereits in der Weimarer Republik besaß Blech einen großen Einfluss, den sie nach dem Zweiten Weltkrieg weiter ausbaute. Vgl. Vorstand der Kreissynode Kölln-Land I [sic], Bescheinigung, 17. August 1945, Evangelisches Landeskirchliches Archiv Berlin (ELAB), 29/550 sowie Vorstand der Kreissynode Kölln-Land I [sic], Bescheinigung, 19. Oktober 1945, ELAB, 29/550 sowie Lippold, Church, 2014, S. 141 f., S. 165, S. 174 und S. 311 sowie Sach, Frau, 2006, S. 154. Vgl. im Folgenden für die Diskussion der päpstlichen Enzyklika und ihrer Rezeption Richter, Katholizismus, 2001, S. 257– 287, S. 313 ff.; Löscher, Monika: „… der gesunden Vernunft nicht zuwider …?“ Katholische Eugenik in Österreich vor 1938. Innsbruck / Wien / Bozen 2009, S. 70 – 102; vgl. auch Fischer, Dienst, 2014, S. 119 ff. sowie Schmuhl, Muckermann, 2014, S. 246 f. Vgl. Löscher, Vernunft, 2009, S. 79; zur Bedeutung Muckermanns für die Popularisierung der Eugenik vgl. auch ebd., S. 94– 96. Enzyklika „Casti connubii“ von Papst Pius XI. über die christliche Ehe, 31. Dezember 1930.
34
1 Die Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik
kirchlichen Lehrmeinung zu Eugenik anzuschließen. Zwar befürwortete der päpstliche Erlass eugenische Maßnahmen über die Sozial- und Familienpolitik; negative Eugenik, beispielsweise Sterilisierungen, lehnte er jedoch „kompromisslos“⁹² ab.⁹³ Dies bestimmte auch in Zukunft die Haltung der Amtskirche. Explizit galt die Enzyklika darüber hinaus als Disziplinierung von Muckermann.⁹⁴ Monika Löscher beobachtet insgesamt, dass die eugenischen Forderungen sich in der katholischen Kirche abschwächten. Sie liefen letztlich auf eine moralische Selbstkontrolle hinaus und sollten mit der katholischen Sexualordnung zu vereinbaren sein.⁹⁵ Als Muckermann auf der Sitzung des Ausschusses für Bevölkerungswesen und Eugenik des Preußischen Landesgesundheitsrats vom Juli 1932 das Eröffnungsreferat hielt, sprach er sich dennoch dafür aus, eugenisch indizierte Sterilisierungen von der Strafverfolgung auszuschließen. An der Sitzung beteiligt war auch Scheumann. Muckermanns Ausführungen erwiesen sich als konsensbildend. Zusammen mit der katholischen Zentrumspartei trug er so entscheidend zu einem entsprechenden Gesetzesentwurf bei. Der Verabschiedung kam allerdings die Machtübernahme Adolf Hitlers zuvor. Der Entwurf bildete jedoch einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom Juli 1933.⁹⁶ Die konfessionellen Eheberatungsstellen blieben vorerst weitgehend bestehen.⁹⁷ Die Caritas hegte die Hoffnung, die katholische Eheberatung erhalten zu können, vermutlich auch, weil sie wie die NSDAP Geburtenprävention ablehnte. Sie begrüßte zu Beginn die Auflösung der Sexualberatungsstellen. Darüber hinaus zeigte das Reichsinnenministerium Bereitschaft, Zugeständnisse zu machen, um die Beratungseinrichtungen im eigenen Sinne zu nutzen. Da sich der Staat zunehmend einmischte, schien dem KDFB bald allerdings ein Rückzug in Kirchenhierarchien
Richter, Katholizismus, 2001, S. 287. Niedermeyer beklagte, dass die eugenikfreundliche Tendenz der Eheenzyklika nicht erkannt werde. Später setzte sich in der Forschung die Erkenntnis durch, dass „Casti connubii“ einer positiven Eugenik uneingeschränkt zustimme und auch manche Formen der negativen Eugenik nicht eindeutig ablehne. Vgl. ebd., S. 264 ff. Vgl. Löscher, Vernunft, 2009, S. 77. Vgl. dies.: „Katholische Eugenik in Deutschland und in Österreich im Kontext der pästlichen Eheenzyklika Casti Connubii“. In: Römische Quartalschrift 109 (2014), S. 24– 55. Auch wenn Zusammenhänge bestehen, wird die Eugenik der Weimarer Republik von einigen Historikern als eigenständige Bewegung verstanden, die mehr war als ein bloßer Vorgänger nationalsozialistischer Politik. Vgl. Sach, Frau, 2006, S. 133. Zu katholischer Eheberatung im Nationalsozialismus vgl. Richter, Katholizismus, 2001, S. 131 ff. sowie Fischer, Dienst, 2014, S. 127 ff.
1.2 Kirchliche Beratungsstellen
35
und damit unter den Schutz des Konkordats sinnvoll.⁹⁸ Zwar wuchs die Zahl katholischer Beratungsstellen bis 1935 weiter auf 65 an. Beispielsweise stellte der Caritasverband Frankfurt, der seit 1929 eine Einrichtung führte, 1934 eine hauptamtliche Eheberaterin ein und gründete zusätzlich eine Eheanbahnungsstelle. Später stieß die Arbeit jedoch zunehmend auf Hindernisse. Der ausgebildeten Seelsorgehelferin sei es nur „mit großem Geschick“ gelungen, „während der nationalsozialistischen Bedrückung trotz aller Belästigungen und Anfeindungen ihre Arbeit fortzusetzen und im Stillen zu wirken“.⁹⁹ Ähnlich erging es weiteren Beratungsstellen. Ab 1936 stellten viele ihre Arbeit ein. Schätzungsweise ein Drittel war noch aktiv, doch selbst Beckmann als Vorsitzende des Reichsausschusses für katholische Eheberatung hatte kaum mehr Kontakt zu ihnen. Als die Angebote schließlich nicht mehr öffentlich für ihre Dienste werben durften, wurde deutlich, dass eine breite katholische Eheberatung gescheitert war. Einzelne Einrichtungen firmierten bald als „Seelsorgehilfe in Ehe- und Familienfragen“, um den religiösen Fokus der Arbeit zu betonen und Konflikte zu vermeiden. Andere nannten sich „Kirchliche Beratungsstelle in Ehe- und Familienfragen“.¹⁰⁰ Eine katholische Eheberatungsarbeit war jedoch kaum mehr vorhanden. Nachweislich elf Stellen blieben über das „Dritte Reich“ hinaus bestehen.¹⁰¹ Wie die NSDAP mit den katholischen Eheberatungseinrichtungen umging, ist in der Forschung insgesamt umstritten und gleichzeitig eine Untersuchungslücke. Nach Lippold stieg die Zahl der Beratungsstellen nach 1933, im Laufe der Zeit war jedoch nur noch eine Minderheit in Betrieb.¹⁰² Rölli-Alkemper konstatiert einen Anstieg der Beratungsstellen bis 1934, bevor die Nationalsozialisten sie schlossen.¹⁰³ Laut von Soden blieben alle konfessionellen Einrichtungen erhalten.¹⁰⁴ Richter konstatiert hingegen, die katholischen seien „sukzessive aufgehoben“ worden, da das neue Regime „in den katholischen Eheberatungsstellen eine Zentrale für Sterilisationsgegner“ vermutete und ein „konkurrierendes Weltanschauungsangebot“ befürchtete.¹⁰⁵ Die bereits im „Dritten Reich“ als Eheberaterin tätige Josepha
Zu einem Treffen von KDFB und den Frauen- und Müttervereinen mit der Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink zum Thema Schulungsarbeit im Sinne des Nationalsozialismus vgl. RochollGärtner, Anwalt, 1978, S. 123 f. So.: „Ein Leben im Dienst der Ehe“, [o. A.], 09. Februar 1964, Archiv Caritas Frankfurt, Nr. 7100 – 03. Vgl. o. A.: [Rückmeldung] Zum Bericht über die Besprechung vom 22.1.1952, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Vgl. Kapitel 4.1.4 Katholische Eheberatung. Vgl. Lippold, Church, 2014, S. 226 f. Vgl. Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 361. Vgl. Soden, Sexualberatungsstellen, 1988, S. 161. Richter, Katholizismus, 2001, S. 132 f.
36
1 Die Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik
Fischer-Erling schreibt im Rückblick 1956: „Mit dem Dritten Reich verschwanden 1933 bis auf wenige konfessionelle alle Beratungsstellen.“¹⁰⁶ Das nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen schilderte die Situation widersprüchlich, obwohl die betreffenden Darstellungen weitestgehend vom selben Autor stammten. Hermann Klens¹⁰⁷ war selbst in die Eheberatung involviert und stand zudem in engem Kontakt mit einigen Größen aus der Praxis. Er schrieb zum einen, dass die Arbeitsgemeinschaft für Eheberatung verboten worden sei.¹⁰⁸ Bei anderer Gelegenheit bemerkte er, dass die Gestapo den Reichsausschuß 1939 aufgelöst und die entsprechende Akte beschlagnahmt habe.¹⁰⁹ Im selben Jahr findet sich in einer Besprechung jedoch der explizite Hinweis, dass sich die neue politische Lage zwar auf die Tätigkeit des Ausschusses auswirke, er aber nie aufgelöst worden sei. Dort ist unter Angabe von Beispielen auch zu lesen, dass die Einrichtungen ihre Arbeit unter der Bezeichnung „Kirchliche Beratungsstelle in Ehe- und Familienfragen“ teilweise aufrechterhielten.¹¹⁰ Aus einem einige Jahre älteren Besprechungsprotokoll geht
Fischer-Erling, Josepha: „Eheberatung“. In: Scherer, Alice et al. (Hrsg.): Ehe und Familie. Grundsätze, Bestand und fördernde Maßnahmen. Freiburg im Breisgau 1956, Sp. 149 – 158, hier Sp. 153. Hermann Klens (21.9.1880 – 25. 8.1972) studierte Philosophie und Theologie und wurde 1905 zum Priester geweiht. Seine anschließende Zeit als Kaplan in Dortmund prägte seine Sicht einer sozial und politisch engagierten Seelsorge. Klens wurde 1915 zum Generalsekretär des Zentralverbands der Katholischen Jungfrauenvereine ernannt, 1922 zum Generalpräses. Ab 1928 war er zudem als Generalpräses des Zentralverbands der Frauen- und Müttervereine tätig. In Bezug auf katholische Eheberatung forderte der Theologe, die eugenische Beratung in den Mittelpunkt zu stellen. 1937 erhielt Klens ein Publikationsverbot, 1939 wurden die Zentralverbände von der Gestapo aufgelöst, ihr Vermögen beschlagnahmt. Es bestand der Verdacht, die Verbände seien über die Vereinszeitschriften politisch aktiv. Nach Kriegsende gründete Klens im Auftrag der Deutschen Bischöfe die Kirchliche Hauptarbeitsstelle für Frauenseelsorge, 1951 wurde der Zentralverband der katholischen Frauen- und Müttergemeinschaften wiedererrichtet. Klens galt als einer der führenden Priester der praktischen Seelsorge und erhielt sowohl das Große Bundesverdienstkreuz als auch diverse Ehrungen seitens der Kirche. Vgl. Rocholl-Gärtner, Anwalt, 1978. Vgl. Richter, Sittlichkeitsreform, 2003, S. 271. Vgl. Klens, Hermann: Bericht über die Besprechung betr. Neuaufbau der Eheberatung und Errichtung eines Institutes für Eheberatung am 22.1.1952. An die Teilnehmer an der Besprechung zur Nachprüfung und evtl. Ergänzung, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Weiter präzisiert findet sich diese Darstellung auch später, ergänzt um ein ausdrückliches Verbot jeder weiteren Arbeit in der Eheberatung, die jedoch im Stillen in geringem Maße weitergeführt worden sei. S. [Klens, Hermann]: Bericht über das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen, 14. April 1961, AEK, DBK, KZI 295, S. 3. Vgl. ders.: Bericht über eine Besprechung betr. Bildung einer„Arbeitsgemeinschaft für Ehe- und Familienfragen“ am 4. Februar 1957. AEK, Gen. II 13.2a, 1. Vgl. o. A.: [Rückmeldung] Zum Bericht über die Besprechung vom 22.1.1952, AEK, Gen. II 13.2a, 1.
1.2 Kirchliche Beratungsstellen
37
zudem hervor, dass die Konferenz der Eheberatungsstellen unter Beckmanns Leitung bestehen geblieben sei.¹¹¹ Die vorliegende Studie geht aufgrund der Materiallage zu verschiedenen Beratungsstellen davon aus, dass einige von ihnen schlossen, andere jedoch erhalten blieben, auch wenn sie immer schwereren Bedingungen unterlagen und die Arbeit abnahm. Dies erscheint plausibel, da die Einrichtungen weitgehend selbstständig waren und sich unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten anpassten. Die Studie nimmt ferner an, dass der Reichsausschuß zwar nicht verboten wurde, seine Arbeit faktisch jedoch zum Erliegen kam.¹¹² Evangelische Eheberater sahen in der Machtübernahme zu Beginn ein Versprechen der NSDAP, Familie und traditionelle Rollenbilder zu unterstützen.¹¹³ Im Sinne der Nationalsozialisten ging beispielsweise die Evangelische Ehe- und Familienberatungsstelle in Berlin-Friedenau vor. „An die Stelle der Auflösung der Ehe, der Furcht vor dem Kinde, des schrankenlosen Sichauslebens setzt unser heutiger Staat wieder die Bindung und Verpflichtung der Ehe an die Volksgemeinschaft. Freudig arbeiten wir mit an diesem Dienst am Volk und Vaterland.“¹¹⁴ Da sie mit dem neuen Regime konform war, blieb die Beratungsstelle bestehen, auch sahen sich die Mitarbeiter keinen Repressionen ausgesetzt.¹¹⁵ Letzteres war die Regel, außer in Hamburg schlossen die Nationalsozialisten keine evangelische Einrichtung. Vielmehr blieben erst im Laufe der Zeit wegen der engeren Beratungsbedingungen und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs die Ratsuchenden weg. Fast alle Stellen gaben ihre Tätigkeit auf.¹¹⁶ Zuvor hatten evangelische Eheberater das Angebot jedoch sogar ausbauen können. Sie betrachteten sich weitestgehend als staatliche Akteure.¹¹⁷ Ilse
Vgl. Klens, Hermann: Bericht über die Besprechung betr. Neuaufbau der Eheberatung und Errichtung eines Institutes für Eheberatung am 22.1.1952, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Vgl. Kapitel 4.1.4 Katholische Eheberatung. Vgl. im Folgenden Lippold, Church, 2014, S. 153 ff. Timm, Politics, 2010, S. 149 ff. Evangel. Ehe- und Familienberatungsstelle. Jahresbericht 1934. Zitiert nach Soden, Sexualberatungsstellen 1988, S. 162. Laut Richter wurden auch evangelischen Einrichtungen von Seiten des Reichsinnenministeriums interne Zugeständnisse gemacht. Vgl. Richter, Katholizismus, 2001, S. 132, Fn. 160. Jäger hält es hingegen für erwiesen, dass die evangelische Eheberatung im Nationalsozialismus sehr schnell unterbunden wurde. Vgl. Jäger, Protestantismus, 2019, S. 321; dazu siehe auch Fußnote 119. Doch liegen dazu keine Hinweise vor. Zudem führte mindestens die Evangelische Ehehilfe Berlin ihren Dienst ungestört fort. Vgl. Hermine Bäcker an Innere Mission Bremerhaven, Brief, 19. Dezember 1950, ADE, CAW 1117. Vgl. dazu auch das Beispiel aus Halberstadt, Helmut: Psychologische Beratungsarbeit in der evangelischen Kirche. Geschichte und Perspektiven. Stuttgart 1986, S. 22.
38
1 Die Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik
Szagunn,¹¹⁸ die Ärztin der Beratungsstelle in Berlin-Friedenau, hielt 1936 Referate zu evangelischer Eheberatung. Diese sollte, so lautete der Beschluss, in Fragen der Eugenik und Rassenhygiene eine führende Rolle übernehmen. In Weimar öffnete 1933 eine neue Stelle, deren Leiterin eine Weiterbildung als ehrenamtliche Beraterin des lokalen Rasseamtes absolvierte. Eine solch enge Zusammenarbeit bildete allerdings die Ausnahme. Welche Bedeutung die Eugenik in der Beratungspraxis hatte, ist unklar. Jedenfalls erschienen eugenische Aspekte den Beratern in der Regel mit ihrer Arbeit kompatibel. Die Verantwortung, die Ehen für „erbgesunden“ Nachwuchs trügen, wurde beispielsweise religiös interpretiert, als Zeichen der christlichen Liebe und Sorge für künftige Generationen. Spätestens 1936 waren Berater mit der Entwicklung der staatlichen Eheberatung jedoch unzufrieden, besonders mit deren biologistischem Fokus. Sie konzentrierten sich auf eine rein seelsorgerische Beratung. Dabei trat die Schwierigkeit hervor, die engen Rahmenbedingungen des Staates nicht zu überschreiten. Das Verbot, den Namen „Eheberatung“ zu führen, verstärkte dieses Bewusstsein. Viele evangelische Stellen nannten sich „Ehehilfe“. Befürchtungen, dass die Nationalsozialisten die Einrichtungen schließen würden, wuchsen. Im Jahr 1938 bestanden nur noch sechs evangelische Angebote, die um ihre Existenz kämpften. Die einzige Ausnahme bildete Berlin-Friedenau, wo die Eheberatung in die lokale Kirchenadministration integriert war und von dieser finanzielle Zuwendungen erhielt. Nach dem Zweiten Weltkrieg verwiesen Innere Mission und die Leiterin der Beratungsstelle auf eine seit Jahrzehnten ununterbrochene Tätigkeit.¹¹⁹
Ilse Szagunn (geborene Tesch, 16.9.1887– 10. 3.1971) wurde 1913 in Berlin promoviert und war 1918 die erste Berufsschulärztin Deutschlands. Von 1914 bis 1927 war sie Leiterin der Säuglings- und Mütterberatungsstelle in Charlottenburg und eröffnete 1930 eine Jugendsprechstunde. Von 1925 bis 1928 engagierte sie sich als Bezirksverordnete der DVP und war von 1928 an Mitglied des Preußischen Landesgesundheitsrates. Sie arbeitete in der evangelischen Eheberatungsstelle Berlin-Friedenau bis etwa 1943. „Ihre ideologischen Überzeugungen speisten sich aus einer nicht immer kongruenten Mischung aus protestantisch gefärbtem Nationalkonservativismus, Frauenbewegung, bürgerlichem Antisemitismus und Eugenik“ (Sach, Frau, 2006, Zitat aus dem Abstract der OnlineVersion unter: https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/7386, besucht am 4. September 2021). Szagunn befürwortete bereits in der Weimarer Republik Zwangssterilisationen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie als praktische Ärztin und Eheberaterin tätig. Die Medizinerin publizierte über 130 Artikel, insbesondere zu Jugendfürsorge sowie Familien- und Sozialpolitik. 1953 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz. Vgl. Sach, Frau, 2006 sowie Grossmann, Atina: Reforming Sex: The German Movement for Birth Control and Abortion Reform, 1920 – 1950. New York 1995, S. 280, Fn. 65. In der späteren Wahrnehmung wurden die evangelischen Eheberatungsstellen hingegen durch das NS-Regime „plötzlich“ (Große-Schönepauck, H[elene]: Die Eheberatung in Deutschland und in anderen Ländern, [1969], S. 8, Bundesarchiv Koblenz (BArch), B 189/2807, Bl. 265 ff.) oder „abrupt“ unterbrochen (Groeger, G[uido]: „Verfahren und Probleme der Jugend- und Eheberatung“. In: Mitteilungshefte der Landesarbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und für
1.3 Zwischenfazit
39
1.3 Zwischenfazit Sowohl die theoretischen als auch die praktischen Wurzeln der Eheberatung liegen in der Weimarer Republik. Die Akteure der staatlichen Eheberatung waren sich trotz verschiedener Ansichten über Intention und Praxis einig, dass das eigentliche Ziel ihrer Tätigkeit in der demografischen und eugenischen Stärkung der Bevölkerung lag. Dabei bot die Eugenik die Diskussionsbasis, auf der die Beratungsstellen aufbauten. Eheberatung entstand somit als Bereich der Gesundheitsfürsorge unter der Ägide von Medizinern und sollte dazu beitragen, die Verbreitung von Krankheiten und unerwünschtem „Erbgut“ zu verhindern. Konfessionelle Eheberatung stellte hierzu keine Gegenbewegung dar, sondern diente vielmehr der Ausweitung dieser Arbeit. Sie entsprach einer christlich geprägten, sozialen Mütterlichkeit.¹²⁰ Darüber, wie weit der eugenische Einfluss auf die Beratungen gehen sollte, bestanden Konflikte. Letztlich konnten in der evangelischen Kirche eugenische Akteure mehr Einfluss gewinnen als in der katholischen. Unklar bleibt jedoch, welche Bedeutung die Eugenik in der Beratungspraxis hatte. Sowohl in der Weimarer Republik als auch in den Anfangsjahren des Nationalsozialismus bis 1935, als die eugenischen Beratungen noch nicht verpflichtend waren, entsprach die Zahl der Ratsuchenden nicht den Erwartungen. Die Beratungsanlässe waren häufig andere als von den Einrichtungen intendiert. Besonders eugenische Sprechstunden waren schlecht besucht. Vielmehr befassten sich sowohl amtliche wie kirchliche Stellen mit Ehestandsberatung, das heißt, sie betreuten Verheiratete bei Ehekonflikten. Das Vorhaben vorehelicher, präventiver Beratungen scheiterte somit an mangelnder Nachfrage. Hier wird eine Kluft zwischen Selbstverständnis und Praxis in der Eheberatung deutlich, wobei sich Beratende auf die von den Ratsuchenden ausgehende Nachfrage einließen.
Geschlechtserziehung, Nordrhein-Westfalen 5 (1955), H. 19, S. 2– 12, hier S. 3, Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)) beziehungsweise mussten aus nicht näher genannten Gründen ihre Arbeit einstellen, offensichtlich aufgrund nationalsozialistischer Vorgaben. Vgl. Kowalewsky, Wolfram: „Eheberatung und Geschlechtserziehung im Einzelgespräch und in der Öffentlichkeit“. In: Die Mitarbeit: Zeitschrift zur Gesellschafts- und Kulturpolitik 1960, S. 323 – 329, hier S. 323, DZI. Fischer, Ernst: „Hilfe zum Leben – für die Familie. Über die Arbeit der Ehe- und Erziehungsberatung“. In: Die Innere Mission. Zeitschrift des Diakonischen Werkes Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland 53 (1963), S. 188 – 190, hier S. 190, DZI. Doch 1950 sprach die Innere Mission davon, dass die Evangelische Ehehilfe Berlin seit Jahrzehnten ihren Dienst ungestört verrichte. Vgl. Hermine Bäcker an Innere Mission Bremerhaven, Brief, 19. Dezember 1950, ADE, CAW 1117. Ebenso die Leiterin der Beratungsstelle, vgl. Blech, Maria: Zwanzig Jahre Eheberatung. [1951], ADE, CAW 413. Vgl. Sachße, Mütterlichkeit, 1986, S. 283.
40
1 Die Wurzeln der Eheberatung in der Weimarer Republik
Berater aller Couleur beriefen sich nach dem Ende des „Dritten Reiches“ auf die Anfänge der Eheberatung.¹²¹ Jedoch hatte die Arbeit 1933 nicht abrupt geendet. Vielmehr weisen Weimarer Republik und Nationalsozialismus Kontinuitäten im medizinischen Diskurs und in der Beratung auf. Die Etablierung der Beratungsarbeit war im Sinne einer „Verwissenschaftlichung des Sozialen“ ein fortlaufender Prozess, der durch Nationalsozialismus oder Weltkrieg keine Zäsur aufwies.¹²² Bereits in der Weimarer Republik beeinflusste die staatlicherseits geförderte Eugenik wesentlich die Errichtung amtlicher Beratungsstellen. Dort herrschte die Intention, in erster Linie mit eugenischer Absicht vorehelich-präventiv zu beraten, was das Selbstverständnis der Beratenden wesentlich prägte. Der Nationalsozialismus radikalisierte den eugenischen Diskurs und verband die vormals freiwillige Beratung mit gesetzlichem Zwang.¹²³ Auch kirchliche Akteure beteiligen sich an der juristischen Ausarbeitung der entsprechenden Gesetze. Für die Genese der Eheberatung spielte ihre Ausdifferenzierung in verschiedene Richtungen eine wichtige Rolle. Die von SPD, Frauenrechtlerinnen und Sexualreformern geförderten Sexualberatungsstellen bildeten den Ausgangspunkt. Eheberatung entstand größtenteils in Konkurrenz beziehungsweise Abgrenzung zu diesem erfolgreichen Angebot. Die Nationalsozialisten schlossen die Sexualberatung, wandelten städtische Eheberatungen um und bauten eine eigene Struktur auf. Nach der Machtübernahme blieben katholische Beratungseinrichtungen vorerst weitgehend bestehen. Als die staatliche Einmischung ihre Arbeit ab Mitte der 1930er-Jahre jedoch zunehmend erschwerte, beendeten viele ihre Tätigkeit. Eine katholische Eheberatungsarbeit fand kaum mehr statt. Evangelische Beratungsangebote definierten sich auch über ihre Nähe zum Staat und blieben aufgrund ihrer weitgehend konformen Ausrichtung bestehen. Erst später setzte aufgrund der nationalsozialistischen Politik und besonders mit Beginn des Zweiten Weltkriegs ein Schwund an Ratsuchenden ein, der zur Schließung fast aller Beratungen führte. Für die weniger erfolgreichen konfessionellen Einrichtungen war das Jahr 1933 damit kein radikaler Einschnitt, auch wenn ihre Arbeit im Laufe der Jahre zunehmend zum Erliegen kam. Die Gründungsphase der institutionellen Eheberatung in der Weimarer Republik prägte die grundsätzliche ideologische und institutionelle Aufstellung ihrer verschiedenen Richtungen und beeinflusste nachhaltig Selbstverständnis und Praxis in der Nachkriegszeit. Sowohl innerhalb der amtlichen als auch der kon Vgl. z. B. Kapitel 3.2.4 Rassen- und Sozialhygieniker und Kapitel 4.1.3 Umgang mit katholischer Eugenik. Vgl. Raphael, Verwissenschaftlichung, 1996, S. 186. Vgl. Lippold, Church, 2014, S. 69 f. Timm, Politics, 2010, S. 118 ff. sowie Grossmann, Sex, 1995, S. 211 f.
1.3 Zwischenfazit
41
fessionellen Einrichtungen zeigte sich der Konflikt zwischen ihrer vorehelichen Beratungsintention und dem davon abweichenden Wunsch der Ratsuchenden, in erster Linie bei Ehekonflikten beraten zu werden.
2 Ehe von der frühen Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1960er-Jahre Eheberatung sollte dazu dienen, Ehen entsprechend bestimmter sozialer Ordnungsvorstellungen zu beeinflussen. Um dieser Verknüpfung auf den Grund zu gehen, werden im Folgenden einzelne Schlaglichter auf das Eheverständnis von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis in die 1960er-Jahre geworfen. Darüber hinaus klärt das Kapitel mit dem Ehe- und Familienrecht die gesetzlichen Rahmenbedingungen und beleuchtet die politische Einbindung der Beratungsarbeit. In den gesellschaftspolitischen Diskussionen der unmittelbaren Nachkriegszeit rückten die Themen Sexualität und „Sittlichkeit“ in den Mittelpunkt.¹ Sie galten nicht als Privatangelegenheit, sondern als Kristallisationspunkte sozialer und nationaler Ordnungsvorstellungen. Dabei ging es um moralische Normen und Geschlechterordnungen sowie um kulturelle Werte. Eine kleine, aber wirkmächtige Gruppe in Politik und Kirchen, die sich für „Sittlichkeit“ einsetzte, beherrschte die Debatte. Sie trat bereits seit der Jahrhundertwende mit ihrer Kritik hervor, die als Abwehrreaktion auf Teile der kulturellen Moderne zu verstehen ist. Als Verstoß gegen die „Sittlichkeit“ galt jegliches sexuelle Verhalten, das nicht der Kinderzeugung innerhalb der Ehe diente. Dennoch blieb vage, was genau „Sittlichkeit“ nun bedeutete, auch für deren Befürworter und die Zeitgenossen. Ergebnis war, dass ein großer Deutungsspielraum entstand, der je nach Interessenlage verschiedene Interpretationen zuließ. Die Ideologisierung von Sexualität bestimmte den zeitgenössischen Blick wie auch die Aussagen über den Zustand der Gesellschaft. Dabei verdeutlicht die Debatte auch Ambivalenzen, was Krisenwahrnehmungen und Hinwendungen zur Moderne anging. In der allgemeinen Wahrnehmung dominierte zunächst eine erotische Freizügigkeit, begleitet von chaotischen gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen und der raschen Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten.² Dies führte zu der Diagnose, es herrsche allgemeine Bindungsunfähigkeit. Verstärkt durch erhöhte Scheidungszahlen und die „Fraternisierung“ deutscher Frauen mit alliierten Soldaten³ entstand der Eindruck, die Gesellschaft
Vgl. im Folgenden Steinbacher, Sybille: Wie der Sex nach Deutschland kam. Der Kampf um Sittlichkeit und Anstand in der frühen Bundesrepublik. München 2011, S. 7 ff., S. 133 und S. 348 f. Zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten vgl. Timm, Politics, 2010, S. 187 ff. Schätzungen gehen davon aus, dass 50 bis 90 Prozent der US-Soldaten mit deutschen Frauen „fraternisierten“. Nach damals vorherrschender Lesart galt dies als ein Symbol des moralischen Zerfalls. Die Frauen würden sich prostituieren und die Gefallenen beleidigen. Vgl. dazu Heinemann, Elizabeth: „Die Stunde der Frauen. Erinnerungen an Deutschlands ‚Krisenjahre‘ und westdeutsche https://doi.org/10.1515/9783111097534-003
2.1 Ehe und Familie bei Kriegsende
43
verfalle moralisch und leide unter einer sich auflösenden Sexualordnung.⁴ Die Schlagworte von der „Krise der Ehe“ sowie der „sexuellen Krise“ verwiesen auf die Vermutung, dass die Institution der Ehe gefährdet sei, worin sich der Zusammenbruch und die Neuorientierung der Gesellschaft besonders deutlich spiegelten. Bereits in den 1950er-Jahren setzte sich aber die Erkenntnis durch, dass die Zustände der Nachkriegsjahre eine Ausnahme dargestellt hatten.⁵ Die Scheidungsraten pendelten sich ein. Stabilität und Auflösungstendenzen schienen teilweise parallel zu existieren, was in den Krisensemantiken zu einem Nebeneinander an Deutungen führte⁶ sowie dazu, dass reine Zerfallsbilder an Erklärungswert verloren.⁷ Dabei sahen einige Stimmen die Krise auf die Gruppe der Heimkehrer begrenzt, andere betonten ihren gesamtgesellschaftlichen Charakter. Die Folge war, dass Staat und Kirchen nach mehr Einfluss auf Ehe und Familie suchten, den sie auch in der institutionellen Eheberatung fanden.⁸ Diese erhielt die Aufgabe, die alte Eheordnung wiederherzustellen, und wurde damit für familienpolitische Bestrebungen instrumentalisiert.⁹ Für den daran anschließenden Diskurs erwiesen sich Soziologie und Sexualforschung als relevant. Hier herrschte jedoch keine wissenschaftliche Neutralität, sondern die Grundannahme, dass sexuelle Beziehungen zu institutionalisieren und zu normieren seien.¹⁰
2.1 Ehe und Familie bei Kriegsende Millionen gefallener und vermisster Soldaten, Flüchtlingsströme und Wohnungsnot führten nach Kriegsende zu enormen demografischen Verschiebungen. Die Familienverbände bestanden nun in der Regel aus Frauen, alten Männern und Kindern.
nationale Identität“. In: Naumann, Klaus (Hrsg.): Nachkrieg in Deutschland. Hamburg 2001, S. 149 – 177, hier S. 164 ff. Vgl. Herzog, Dagmar: Die Politisierung der Lust. Sexualität in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. München 2005, S. 83 ff. Vgl. Große-Schönepauck, Helene: „Die Scheidungshäufigkeit in Deutschland“. In: Scherer, Alice et al. (Hrsg.): Ehe und Familie. Grundsätze, Bestand und fördernde Maßnahmen. Freiburg im Breisgau 1956, Sp. 131– 140. Vgl. Schneider, Einigkeit, 2001, S. 212 sowie Schneider, Ehen, 1998, S. 194 und S. 215. Vgl. Silies, Eva-Maria: Liebe, Lust und Last. Die Pille als weibliche Generationserfahrung in der Bundesrepublik 1960 – 1980. Göttingen 2010, S. 43. Vgl. Schneider, Einigkeit, 2001, S. 212 sowie Schneider, Ehen, S. 194 und S. 215. Vgl. ebd., S. 205. Vgl. Jäger, Protestantismus, 2019, S. 108 ff.
44
2 Ehe von der frühen Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1960er-Jahre
Dies änderte sich, als die ehemaligen Soldaten zurückkehrten,¹¹ was nicht nur für die Ehefrauen ein Einschnitt war. Vielmehr gab es nun auch wieder eine Aufteilung der Frauen in Verheiratete und Alleinstehende, während im Krieg ihre Situation ähnlich gewesen war.¹² Sibylle Meyer und Eva Schulze konstatieren in ihrer Untersuchung des Familienalltags in der Nachkriegszeit: „Ein Mann als Haushaltsvorstand galt wieder als soziale Norm […]. Dies wurde für die ‚Alleinstehenden‘ zur spürbaren Diskriminierung, während die Ehefrauen von der sozialen Wertschätzung in ihrem Aufgehen in der Familie und der Arbeit für die Familie eher unterstützt wurden.“¹³ Verwitwete oder unverheiratete Frauen stießen zunehmend auf Misstrauen. Als Problem galt zudem der sogenannte „Frauenüberschuss“ von geschätzt zwei Millionen, die aufgrund der im Krieg gefallenen Männer unverheiratet blieben. Gleichzeitig gab es das Phänomen sogenannter „Onkelehen“: eheähnliche Beziehungen verwitweter Frauen, die bewusst unverheiratet blieben, um die Renten- oder Pensionsansprüche aus ihren früheren Ehen nicht zu verlieren. Angesichts des Geburtenausfalls, der aus dem Frauenüberschuss errechnet wurde, der Familien ohne Väter und der Onkelehen wuchsen die Befürchtungen, dass die traditionelle Familie als gesellschaftstragende Institution ihr Ende erreicht habe.¹⁴ Viele hegten allerdings die Hoffnung, dass die Verhältnisse sich wieder normalisieren würden.¹⁵ Die klassische Kleinfamilie blieb als verheißungsvolles Bild bestehen, da der Wunsch nach Stabilität und Geborgenheit weit verbreitet war, auch wenn unkonventionelle Familienformen einige Jahre auf Toleranz trafen.¹⁶ Zeitgenössische soziologische Studien stimmten darin überein, dass die Bevölkerung ihre emotionalen Bedürfnisse in Ehe und Familie befriedigen wolle. Die Ehe galt dabei als „ein Verhältnis zwischen Mann und Frau, das nicht nur auf personale Gemeinschaft, sondern auf Familie zielt“.¹⁷ Dieses Leitbild blieb paternalistisch geprägt. An zweiter Stelle folgte jedoch bald die Vorstellung der part-
Vgl. Meyer, Sibylle / Schulze, Eva: Von Liebe sprach damals keiner. Familienalltag in der Nachkriegszeit. München 1985, S. 11 und S. 87 ff. Vgl. Heinemann, Elizabeth: What Difference Does a Husband Make? Women and Marital Status in Nazi and Postwar Germany. Berkeley 2003. Meyer/Schulze, Liebe, 1985, S. 217. Vgl. Niehuss, Merith: Familie, Frau und Gesellschaft. Studien zur Strukturgeschichte der Familien in Westdeutschland 1945 – 1960. Göttingen 2001, S. 380. Vgl. Schneider, Einigkeit, 2001, S. 209 f. Vgl. Vgl. Sachße, Christoph / Tennstedt, Florian: Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland. Bd. 4: Fürsorge und Wohlfahrtspflege in der Nachkriegszeit 1945 – 1953. Stuttgart 2012, S. 25. Zur Sicht in späteren Jahren auf „Onkelehen“ u. Ä. vgl. Oheim, Gertrud et al.: Die gute Ehe. Ein Ratgeber für Mann und Frau. Gütersloh 1959/1965, S. 121 ff. König, René: Materialien zur Soziologie der Familie. Bern 1946, S. 109.
2.1 Ehe und Familie bei Kriegsende
45
nerschaftlichen Ehe.¹⁸ Die Tendenz zu diesem Modell nahm im Laufe der 1950erJahre zu. Emotionale Faktoren gewannen mehr und mehr an Bedeutung.¹⁹ Dieses neue Eheideal, das Eheratgeber propagierten und Soziologen beschrieben, hieß auch „Gefühlspartnerschaft“, „Partnerschaftsehe“ oder „Gefährtenfamilie“.²⁰ Kernpunkte waren eine gleichrangige Partnerschaft, eine enge gefühlsmäßige Bindung, ein gemeinsames Streben nach Erfüllung sowie sexuelle Gleichberechtigung. Auch dieses Ehebild sah allerdings nicht vor, dass die Frau berufstätig war, sondern wies ihr vielmehr die Rolle der gut ausgebildeten Hausfrau zu. Über ihre Tätigkeit in Heim und Familie sollte sie Wertschätzung erhalten und an Selbstbewusstsein gewinnen, sodass ihre Erwerbstätigkeit überflüssig wurde. Entsprechend lag ein besonderes Gewicht auf der Berufstätigkeit des Mannes und seiner geistigen Führung. An die kommunikativen Fähigkeiten der Paare waren hohe Erwartungen geknüpft. Als Voraussetzung für die Partnerschaft galten Vertrauen, Liebe, Treue und Achtung. Die Eheschließung selbst war eng mit dem romantischen Liebesideal verbunden. In der soziologischen Diskussion um diese Ehen tritt deutlich hervor, dass sie zwar begrüßt wurden, aber gleichzeitig als instabiler galten als stärker patriarchalisch orientierte Ehen. Hauptbefürchtung war, dass die Eheleute bereits in der Partnerwahl Fehler machten,²¹ Krisen schlechter durchhielten und sich bei seelischer Entfremdung schneller scheiden ließen.²² Diese Diagnose hing mit der großen Aufmerksamkeit zusammen, die Scheidungen in den 1950er-Jahren erhielten. Die hohen Scheidungszahlen der unmittelbaren Nachkriegszeit galten vor allem als Krisenzeichen.²³ Dabei waren sie auch auf einen Nachholbedarf der Verwaltung zurückzuführen, da die Gerichte ab 1943 zunehmend eingeschränkt tätig gewesen waren. Das hatte einen Überhang anstehender Scheidungen zur Folge. In den unmittelbaren Nachkriegsjahren erfolgten Scheidungen meist deshalb, weil die Ehepartner lange Trennungen erlebt hatten, häufig neue Beziehungen eingegangen waren oder das Selbstbewusstsein der Frau gestiegen war. Männer stellten die Hälfte der Scheidungsanträge. Dieses Phänomen wird auch mit ihren verbesserten Vgl. Brombach, Sabine: Literatur als Erkenntnisquelle gesellschaftlicher Wirklichkeit. Interpretationen ausgewählter Eheromane und Analysen ehe- und familiensoziologischer Forschungsarbeiten aus der westdeutschen Nachkriegszeit bis 1961. Frankfurt am Main 1995, S. 179 ff. und S. 240 ff. Vgl. Silies, Liebe, 2010, S. 44 f. Vgl. z. B. Oheim, Ehe, 1959, S. 34 ff. Vgl. im Folgenden Brombach, Literatur, 1995, S. 74 ff., S. 114 ff., S. 129, S. 150 ff. und S. 171 ff. Dies bezog sich insbesondere auf die Schicht- und Konfessionszugehörigkeit sowie das Alter. Mit beidem wurden verschiedene Norm- und Wertvorstellungen verbunden. S. ebd., S. 233 ff. Vgl. im Folgenden Niehuss, Familie, 2001, S. 99 ff.
46
2 Ehe von der frühen Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1960er-Jahre
Heiratschancen erklärt. Auffällig ist, dass nur wenige von ihnen in diesem Zeitraum schuldig gesprochen wurden. Diese Verhältnisse änderten sich im Laufe der 1950er-Jahre. Ab 1955 stellten Frauen zwei Drittel der Scheidungsanträge, wobei die Hälfte der Männer ein Schuldurteil erhielt. Scheidungsursache war in diesen Fällen meist eine Eheverfehlung, zu der Beschimpfungen, Drohungen oder Vernachlässigungen zählten. Auch die Juristen der Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf wiesen vor allem Männer darauf hin, diese Verhaltensweisen sowie Gewalt zu unterlassen, da sie einen Scheidungsgrund darstellten.²⁴ Dennoch blieb eine Scheidung für Frauen schwierig, weil sie sich dadurch wirtschaftlich massiv verschlechterten und sich gesellschaftlicher Ächtung aussetzten. Der soziale Wert einer Ehe war für sie höher einzuschätzen als für den Mann. In den Scheidungsverfahren waren die während des Krieges geschlossenen Ehen proportional am stärksten vertreten, was an überhasteten Aufgeboten und kriegsbedingt unterschiedlichen Erfahrungen der Partner lag. Letzteres stellte auch für bereits länger bestehende Ehen eine erhebliche Belastungsprobe dar.
2.2 Heimkehrerehen Je länger die Kriegsgefangenschaften von Ehemännern und Familienvätern dauerten, desto stärker entfremdeten sich Paare aufgrund verschiedener Lebensrealitäten.²⁵ Männer waren häufig an der Vergangenheit orientiert. Sie wussten oft nicht, wie es zuhause und im Alltag ihrer Familie konkret aussah. Bei ihrer Rückkehr waren sie schockiert, wie sehr Mangel und Zerstörung das Leben bestimmten. Den meisten war nicht bewusst gewesen, wie schwer ihre Frauen es hatten, das Überleben der Kinder und Angehörigen zu sichern. Insbesondere Mütter mit kleinen Kindern waren vielfach gefordert gewesen. Sie hatten den Nachwuchs aufgezogen und die Ernährung organisiert, wozu zahlreiche selbstständige Entscheidungen nötig gewesen waren. Diese Situation hatte sie physisch und psychisch dauerhaft belastet. Männer hingegen waren über Jahre hinweg nicht selbstbestimmt gewesen, zuerst wegen ihres Militärdienstes, später aufgrund der Gefangenschaft. Beide Si-
Vgl. Kapitel 3.6.3 Beratungsthemen. Vgl. im Folgenden Niehuss, Familie, 2001, S. 106 ff. sowie Kilian, H.: „Der Wiedereinstieg des Heimkehrers in Familie, Ehe und Beruf“. In: Bürger-Prinz, Hans / Giese, Hans (Hrsg.): Die Sexualität des Heimkehrers. Vorträge gehalten auf dem 4. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung in Erlangen 1956. Stuttgart 1957, S. 27– 37. Zur „Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung“ und den dort vertretenen Einstellungen vgl. Steinbacher, Sex, 2011, S. 220 ff.
2.2 Heimkehrerehen
47
tuationen waren dennoch von starken Männlichkeitsidealen geprägt, die jedoch mit der Rückkehr zu Frau und Familie an Bedeutung verloren. Eine zeitgenössische Feststellung lautete, „Heimkehr“ sei „oft schwerer als Gefangenschaft!“.²⁶ Heimkehrer erschienen im neuen Alltag oftmals hilflos, ihre Ehefrauen hingegen stark und selbstbewusst. Das führte vielfach zu der Deutung, Frauen seien nicht bereit, sich ihrem Ehemann unterzuordnen. Spätere Forschungen verdeutlichen jedoch, dass Frauen nicht mehr Mitsprache aufgrund eines prinzipiellen Emanzipationswunsches forderten, sondern da der Alltag dies verlangte. Typisch für die zeitgenössische Debatte war die Einschätzung der Situation durch die bekannte Frauenzeitschrift Constanze als Krise des Mannes.²⁷ Sowohl die deutschen Behörden als auch die alliierten Besatzungsmächte unterstützten die Wiedereingliederung der Heimkehrer. Da sich der soziale Status der Männer über ihre berufliche Tätigkeit definierte, mussten sie in den Arbeitsmarkt reintegriert werden. Sobald es ihnen möglich war, konzentrierten die Heimkehrer ihre Energie auf ihr Berufsleben. Ihr Interesse, die vorherigen Erfahrungen ihrer Familien verstehen zu wollen, sank.²⁸ Die Nachkriegsgesellschaft war geprägt von einer großen Mobilität durch Flüchtlingsströme und Kriegsheimkehrer, sich wandelnde familiale Beziehungen und einen allgemein empfundenen Werteverlust. Dies alles führte zu Unsicherheit. In der Folge erschien Angst als das bestimmende Lebensgefühl der 1950er-Jahre.²⁹ Interviews mit Zeitzeugen verdeutlichen, dass Eheleute jahrelang unter den Kriegsfolgen litten.³⁰ Fast überall verlief die Wiedereingliederung sehr schwierig, da Männer und Frauen sich voneinander entfernt hatten. Über elf Millionen Männer waren in Gefangenschaft gewesen. Häufig kehrten sie mit Folgeschäden körperlich stark geschwächt zurück und brauchten über einen langen Zeitraum Pflege. Frauen und Männer erkannten sich kaum wieder, da die Erlebnisse der vergangenen Jahre auch ihr Aussehen verändert hatten. Viele Männer konnten ihren Frauen nicht die über viele Jahre erhoffte praktische und emotionale Unterstützung sein.³¹ Sie waren teilweise apathisch oder depressiv und litten darunter, ihrer Familie nicht adäquat helfen zu können. In ihre frühere Rolle als Ernährer und Haushaltsvorstand fanden
Kilian, Wiedereinstieg, 1957, S. 27. Vgl. Schneider, Ehen, 1998, S. 193 ff. sowie Schneider, Einigkeit, 2001, S. 210 f. Vgl. Niehuss, Familie, 2001, S. 106 ff. Vgl. Brombach, Literatur, 1995. Vgl. im Folgenden s. Meyer/Schulze, Liebe, 1985. Alice Förster und Birgit Beck untersuchen die Nachkriegszeit mit Hilfe des psychiatrischen Konzepts der Post-traumatic Stress Disorder, unter der viele gelitten haben dürften. Vgl. dazu Beck, Barbara / Förster, Alice: „Post-Traumatic Stress Disorder and World War II. Can a Psychiatric Concept Help us Understand Postwar Society?“. In: Bessel, Richard et al. (Hrsg.): Life after Death: Approaches to a Cultural and Social History of Europe During the 1940s and 1950s. Cambridge 2003, S. 15 – 35.
48
2 Ehe von der frühen Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1960er-Jahre
sie damit vorerst nicht zurück. Frauen und Kinder litten offenbar jedoch besonders darunter, dass Ehemänner und Väter ihrer Betroffenheit keinen Ausdruck verliehen, sondern in Sprachlosigkeit verfielen. Die Verantwortung für die Familie blieb damit bei den Frauen. Dies führte einerseits zu einem Wandel innerfamilialer Machtstrukturen, hatte aber andererseits auch zur Folge, dass sich die Arbeitslast der Frauen erhöhte, bis sie kaum mehr zu tragen war. Materielle Not, Hunger, Kälte, beengte Wohnverhältnisse und Arbeitslosigkeit verursachten Spannungen.³² Weitere Probleme entstanden häufig, da auch Väter und Kinder sich fremd waren. Meist waren die Mütter gezwungen, hier zusätzlich zu vermitteln.³³ Auch eine soziologische Untersuchung von 1948 zeigte, dass die Frauen die Hauptverantwortung für den familiären Zusammenhalt schulterten.³⁴ Einige Männer äußerten, sie seien stolz auf die Leistungen ihrer Frau. Die meisten kamen mit der gewandelten Situation jedoch nicht zurecht. Die Autorin der Studie, Hilde Thurnwald, beachtete zwar die Leistungen der Frauen in den vergangenen Jahren, wies ihnen aber gleichzeitig die Aufgabe zu, die negativen Folgen nicht nur zu tragen, sondern darüber hinaus auch noch ihre Ehemänner zu stärken.³⁵ Bei den Frauen hat sich öfter unter der jahrelangen Last der Verantwortung und Ausschöpfung aller Kräfte eine Gefühlsverhärtung und betont rationalistische Haltung ausgebildet, die ihnen die schwache Position des Mannes schonungslos preisgibt […]. Gelingt es der Frau in allen diesen Lagen nicht, aus einer mütterlichen Haltung heraus lösend zu wirken […], so häufen sich bei beiden Ehepartnern […] Spannungen an, die den Zusammenhalt der Familie zu sprengen drohen. Das Unvermögen mancher Frauen, die besondere und schwierige Seelenlage des heimgekehrten Mannes zu verstehen und ihm zu helfen, wird gekennzeichnet durch die Flucht solcher Männer zu ihren Eltern. Bei Vater und Mutter sucht der Mann als Kind den Trost, den ihm die Frau als Gefährtin nicht zu geben vermag.³⁶
Vgl. dazu auch Thurnwald, Hilde: Gegenwartsprobleme Berliner Familien. Eine soziologische Untersuchung an 498 Familien. Berlin 1948. Knappe Wohnverhältnisse wurden bis Ende der 1950erJahre als eines der Hauptprobleme benannt.Vgl. Krapp, Peter: Sozialhygienische Untersuchung über schwierige Ehen. Dargestellt an 1554 auf Veranlassung des Landgerichtes während der Jahre 1948 bis 1955 durch die Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute in Hamburg bewirkten Versöhnungsversuchen bei Scheidungsbegehren. Hamburg 1958, S. 12 ff. Zum Umgang der Heimkehrer mit ihren Kindern vgl. auch Kilian, Wiedereinstieg, 1957, S. 29 ff. sowie Mayer, A.: „Zur Heimkehrerfrage. Diskussionsbeitrag zum Vortrag Kilian“. In: Bürger-Prinz, Hans / Giese, Hans (Hrsg.): Die Sexualität des Heimkehrers.Vorträge gehalten auf dem 4. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung in Erlangen 1956. Stuttgart 1957, S. 38 – 41. Vgl. im Folgenden Thurnwald, Gegenwartsprobleme, S. 190 ff.Vgl. dazu auch Brombach, Literatur, 1995, S. 158 ff. Vgl. dazu auch Hirt, Stefanie: Marriage Guidance in Berlin. Reprinted from the „International Journal of Sexology“, May 1949, Landesarchiv Berlin (LAB), B Rep 012, Nr. 176. Thurnwald, Gegenwartsprobleme, 1948, S. 198 f.
2.2 Heimkehrerehen
49
Die Frau erschien hier weniger als Ehefrau, sondern vielmehr in einer Art Mutterrolle. Der Mann wurde infantilisierend dargestellt. Dabei sollte es Thurnwald zufolge für die Frauen nicht nur darum gehen, die Bedürfnisse der Männer zu beachten, deren Demütigungen durch den Krieg im Text sehr präsent sind. Die Autorin forderte vielmehr, dass Frauen ihre Bedürfnisse ignorieren sollten. An der Erschöpfung, die daraus resultierte, gab sie den Frauen selbst die Schuld, da diese falsch mit der Situation umgegangen seien. Frauen ebenso wie Männer zu unterstützen und zu heilen, war kein Thema. Frauen müssten vielmehr„häufig genug ihre eigene Reizbarkeit zu bekämpfen suchen, was bei dem Übermaß an Arbeit und Verantwortung nicht immer gelang“.³⁷ Eheprobleme wurden somit ihnen zur Last gelegt, obwohl die Frauen durchaus ansprachen, dass ihren Belastungen Gleichgültigkeit entgegengebracht wurde. Auch forderten sie aufgrund ihrer größeren Selbstständigkeit, dass die Männer sich veränderten.³⁸ Gleichzeitig sahen sich viele „bewußt als Trägerinnen der Familieneinheit“ und bemühten sich um eine friedliche Atmosphäre.³⁹ Mindestens bis 1954 waren Beratungsstellen aufgerufen, sich der Ehen von Heimkehrern besonders anzunehmen.⁴⁰ Bis wenigstens 1958 waren Heimkehrerehen in der Eheberatung sichtbar.⁴¹ Diese sich über Jahre ausdehnende Rückkehr der Männer machte die Frauen mit deren Verfassung vertraut und bereitete sie in gewisser Weise darauf vor. Zudem berichteten die Zeitungen ausführlich über Heimkehrer und ihre Probleme und erteilten Ratschläge, wie Frauen sich ihrer Ehemänner annehmen sollten.⁴² Auch die psychologischen und körperlichen Folgen, welche die Niederlage für Männer hatte, erhielten Raum. Ärzte wiesen insbesondere auf Potenzstörungen hin und empfahlen Potenzmittel.⁴³ Des Weiteren kam männliche Untreue zur Sprache. Als Ursache galt die bittere Enttäuschung des Mannes über die elenden Verhältnisse seiner Familie und den Zustand seiner verblühten, sorgenvollen, selbstständigen Frau. Untreue war demzufolge mit den körperlichen und psychischen Folgen zu erklären, die aus den weiblichen Opfern und Pflichten entstanden waren. Dass manche Eheleute dies ebenso sahen, verdeutlichen Beispiele aus der Rechtsberatung Berlin-Reinickendorf.⁴⁴
Ebd., S. 190. Vgl. ebd., S. 201. Ebd., S. 190. Vgl. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 9, März 1954, LAB, B Rep. 012, Nr. 176. Vgl. Krapp, Untersuchung, 1958, S. 18. Vgl. Meyer/Schulze, Liebe, 1985, S. 127 ff. Vgl. Herzog, Politisierung, 2005, S. 107 ff. Vgl. Kapitel 3.6.3 Beratungsthemen.
50
2 Ehe von der frühen Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1960er-Jahre
Obwohl viele Bedürfnisse nicht erfüllbar waren und manche Familien vorwiegend aus Not zusammenblieben, galten Ehe und Familie als letzter Halt im Zusammenbruch der staatlichen Ordnung.⁴⁵ Versachlichte Solidarität stabilisierte nach Helmut Schelsky die Beziehungen. Eheleute stellten ihre emotionalen Wünsche bewusst zugunsten einer gemeinsamen materiellen Sicherung zurück, um ihren Alltag zu bewältigen.⁴⁶ Auch mit Blick auf Erotik und Sexualität häuften sich die Klagen über Versachlichung, Entinnerlichung und Entkultivierung.⁴⁷ Gleichzeitig beobachteten Soziologen, dass die Ehe sich von einer Institution hin zu einer personalen Intimgruppe wandelte.⁴⁸ Zeitgenossen verwiesen damit auf später auch in der Forschung benannte Individualisierungstendenzen.
2.3 Liebe und Sexualität Erlösung aus all den Problemkomplexen der Nachkriegszeit sollte die Liebe bieten. Dieses Ideal zu erfüllen, gestaltete sich schwierig, auch aufgrund der zeitgenössisch konstatierten Enttäuschung der Frauen.⁴⁹ Vor allem die stark konsultierten Ratgeberspalten thematisierten dies,⁵⁰ beispielsweise eine Kolumne in der Constanze. Im Mittelpunkt stand dort die Frage, wer an Deutschlands Kriegs- und Nachkriegszustand schuld sei. Ohne die Art der Schuld näher zu benennen, kategorisierte der Artikel Männer als Verursacher und Frauen als Mitschuldige – sie hätten männliche Macht und Uniformen bewundert. Die Schulddiskussion verschob sich damit auf die Ebene von Sexualität und Paarbeziehungen, da in Politik und Gesellschaft der Wunsch vorherrschte, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem „Dritten Reich“ zu vermeiden und eine verloren geglaubte Normalität wiederherzustellen. Mit Blick auf die Ehe gab es verschiedene Ansichten: Manche stellten die Institution und die monogame Paarbeziehung in den Vordergrund, andere befürworteten das Recht auf erotische Freizügigkeit und vertraten über die Ehe hinausgehende Vorstellungen von Beziehung. Diese Meinungen konnten auch nebeneinander bestehen, bei-
Vgl. Schelsky, Helmut: Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart: Darstellung und Deutung einer empirisch-soziologischen Tatbestandsaufnahme. Stuttgart 1955, S. 63. Schelsky geht sogar davon aus, dass Kriegs- und Nachkriegsjahre in Ehe und Familie in den meisten Fällen als bewusste Stärkung des Zusammenhalts empfunden worden seien. Vgl. ebd., S. 261. Vgl. Schelsky, Wandlungen, 1955, S. 279 ff. sowie Brombach, Literatur, 1995, S. 59 ff. Vgl. Schelsky, Wandlungen, 1955, S. 26 ff. sowie Müller-Freienfels, Wolfram: Ehe und Recht. Tübingen 1962, S. 39 ff. Vgl. Thurnwald, Gegenwartsprobleme, S. 194 ff. sowie Brombach, Literatur, 1995, S. 56 ff. Vgl. im Folgenden Herzog, Politisierung, 2005, S. 91 und 120 f.
2.3 Liebe und Sexualität
51
spielsweise plädierte die Constanze sowohl für die romantische Liebe in der Ehe als auch gegen diese, da sie eine überholte Institution sei, und für die Erfüllung von Sexualität und Kinderwunsch ohne festen Partner.⁵¹ In den ersten Jahren war damit noch unklar, welche Vorstellungen sich durchsetzen würden. So widersprüchlich die Ansichten auch waren, betonten sie doch die gesellschaftspolitische Dimension von Paarbeziehungen. Vor- und außereheliche Sexualität galten dabei als fortschreitende Liberalisierung der Sitten und erst im Rückblick als Folge wirtschaftlicher Not und Besatzung. Das Nachholbedürfnis nach Vergnügen war groß.⁵² Laut einer Umfrage aus dem Jahr 1949 hießen 71 Prozent der Befragten vorehelichen Geschlechtsverkehr gut. Die Kirchen konstatierten eine erotische Überreizung. Indem sie eine Debatte anstießen, in der sie Sexualität als Bedrohung von Religion verurteilten und sexuelle Reinheit propagierten, um die gesamtgesellschaftliche Krise zu lösen, trugen sie wesentlich zu einem kurz darauf sichtbar werdenden Einstellungswandel bei.⁵³ Die 1950er-Jahre waren eine Phase der Rekonstruktion traditioneller Familienstrukturen. Frauen erreichte zunehmend die Aufforderung, sich der männlichen Autorität zu unterwerfen.⁵⁴ Das politische Bemühen, frühere Geschlechterbeziehungen wiederherzustellen, sollte die Rückkehr zu einer imaginierten Ära von Sicherheit und Stabilität ermöglichen. In Millionenauflagen erschienen Sexualratgeber, die betonten, Keuschheit vor der Heirat sei die Voraussetzung für eine glückliche Ehe. Die Werke forderten dazu auf, voreheliche Erfahrungen zu meiden und Reinheit in der Beziehung anzustreben, um ein erfüllteres Liebesleben in der Ehe zu erreichen. Dies galt vor allem für Frauen, die insgesamt als weniger sexuell interessiert galten.⁵⁵ Selbstbeherrschung war dabei eine Frage von Moral und Gesundheit, Sexualität vermehrt mit Scham besetzt. Heterosexueller Geschlechtsverkehr innerhalb der Ehe galt als einzig natürliche Praktik, darüber Hinausgehendes war tabu. Beziehung und Sexualität wandelten sich zu Schauplätzen der Tugendhaftigkeit. Auch die Soziologie appellierte an die Gesellschaft, sexuelle Normen einzuhalten, um die gesellschaftlichen Strukturen zu sichern.⁵⁶ Anderslautende
Zu Artikeln in der Constanze vgl. auch Nuys-Henkelmann, Christian: „‚Wenn die rote Sonne abends im Meer versinkt …‘ Die Sexualmoral der fünfziger Jahre“. In: Bagel-Bohlan, Anja / Salewski, Michael (Hrsg.): Sexualmoral und Zeitgeist im 19. und 20. Jahrhundert. Opladen 1990, S. 107– 146, hier S. 110 f. und S. 119 f. Vgl. Niehuss, Familie, 2001, S. 310 f. Vgl. Herzog, Politisierung, 2005, S. 91. Vgl. im Folgenden ebd., S. 110 und S. 120 ff. Z. B. Oheim, Ehe, 1959, S. 118 ff. und S. 308 ff. Vgl. Schelsky, Helmut: Soziologie der Sexualität. Über die Beziehungen zwischen Geschlecht, Moral und Gesellschaft. Hamburg 1955, S. 48 ff.
52
2 Ehe von der frühen Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1960er-Jahre
Ergebnisse zu vor- und außerehelicher Sexualität erschienen vor dieser Folie als Diskrepanz zwischen Anspruch und Praxis.⁵⁷ Die Soziologie thematisierte Geschlechtsverkehr vor allem als innereheliche Aktivität.⁵⁸ Die 1949 durchgeführte „Umfrage in die Intimsphäre“ ergab, dass die Interviewten Ehe als Institution der Ordnung und Sicherheit sowie als Beitrag zu Sitte und Moral sahen, die den Ehepartnern Halt vermittelte. Dies gaben 89 Prozent an. Über 80 Prozent der Verheirateten waren mit ihrer Ehe zufrieden. Gleichzeitig gab es jedoch auch die Erkenntnis, dass die Ehe nicht unbedingt als notwendige Voraussetzung für sexuelle Beziehungen galt. Vielmehr gaben 89 Prozent der Männer und 69 Prozent der Frauen an, Sexualität außerhalb einer Ehe zu leben. Die Teilnehmer bejahten zudem sexuelle Bedürfnisse von Frauen. Für ihre Zufriedenheit in der Ehe machte es zudem keinen Unterschied, ob voreheliche Erfahrungen bestanden. Empfängnisverhütung befürworteten fast 70 Prozent, wobei sie wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche Gründe angaben. Über 60 Prozent hielten sexuelle Beziehungen als für das Lebensglück wesentlich. Diese Ergebnisse standen in einem deutlichen Gegensatz zum öffentlich propagierten Ideal, dass die Partner „rein“ in die Ehe gehen müssten, sowie zur Haltung von Politik und Kirche zur Empfängnisverhütung. Zeitgenössisch ließ sich dies als Modernisierung des Eheideals verstehen. Untreue lehnten die Befragten hingegen klar ab. Gleichzeitig gaben 10 Prozent der Frauen und 23 Prozent der Männer an, untreu zu sein. Die Studie sah die Ursache dafür im Frauenüberschuss, der die Normen lockere. Bis zu Beginn der 1960er-Jahre nahm die Akzeptanz vorehelichen Verkehrs wieder ab, stärker noch als in der früheren Nachkriegszeit. Als im Jahr 1963 nochmals eine Umfrage zu Sexualität erfolgte, gaben nur noch 61 Prozent an, vorehelichen Geschlechtsverkehr zu billigen.⁵⁹ Gleichzeitig gab es jedoch Schätzungen, dass bis zu 90 Prozent voreheliche sexuelle Erfahrungen machten. Anders als in früheren Studien verschwiegen Befragte diese Erlebnisse offensichtlich eher. Kommuniziertes und tatsächliches Verhalten klafften immer mehr auseinander. Gleichzeitig wird jedoch davon ausgegangen, dass die oft vertretene zeitgenössische Vorstellung von der Ehe als einzig legitimem Ort von Sexualität Auswirkungen auf deren Erleben hatte. Eine Folge der Tabuisierung war die mangelhafte Aufklärung, die mit einer hohen Rate ungewollter Schwangerschaften einherging. Selbst Fachzeitschriften
Vgl. Jäger, Protestantismus, 2019, S. 108 ff. Dabei wurden bestimmte Fragen von vorneherein nicht gestellt und damit tabuisiert. Dazu gehörte beispielsweise Homosexualität.Vgl. im Folgenden Friedeburg, Ludwig von: Die Umfrage in der Intimsphäre. Beiträge zur Sexualforschung. Stuttgart 1953 sowie Steinbacher, Sex, S. 158 ff. Vgl. im Folgenden Herzog, Politisierung, 2005, S. 122 und 152 f. sowie Brombach, Literatur, 1995, S. 66 ff. sowie Steinbacher, Sex, 2011, S. 299 f.
2.4 Wirtschaftliche Verhältnisse und Frauenerwerbstätigkeit
53
klärten nur über die Kalendermethode nach Knaus-Ogino auf, die auf der Errechnung der fruchtbaren Tage beruhte. Viele Mediziner kritisierten diese Vorgehensweise, da sie ungesund für die Partnerschaft sei. Insgesamt gab es nur wenige Beratungsangebote zur Geburtenregelung selbst für Ehepaare, die sich jedoch selbst einen pragmatischen Umgang mit dem Thema wünschten.⁶⁰ Ende der 1950er-Jahre war fast jede dritte Braut schwanger, besonders häufig waren „Mussehen“ aufgrund einer Schwangerschaft unter Minderjährigen.⁶¹ Schätzungen gehen davon aus, dass zu Beginn der 1960er-Jahre mehr als die Hälfte aller Eheschließungen und 90 Prozent der sogenannten Frühehen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren nur aus diesem Grund geschlossen wurden.⁶² Dass diese Verbindungen besonders scheidungsanfällig waren, verwundert nicht. Frühehen waren in der Eheberatung daher sowohl in der Weiterbildung als auch in der Praxis ein wichtiger Diskussionsgegenstand.⁶³
2.4 Wirtschaftliche Verhältnisse und Frauenerwerbstätigkeit Die 1950er- und frühen 1960er-Jahre erschienen als eine Phase der Stabilisierung traditioneller Familienformen. In der Wahrnehmung der Zeitgenossen normalisierte sich das Leben. Ein trotz der „Krise der Familie“ vorhandener „Stabilitätsrest“ schien diese Theorie zu stützen.⁶⁴ Der berufliche Wiedereinstieg der Männer trug dazu bei, dass sich die gewünschten Familienstrukturen durchsetzten. Heimkehrer erhielten bevorzugt Beschäftigung. Andere staatliche Maßnahmen zielten darauf, Frauen in ihre häusliche Rolle zurückzudrängen. Die Folge war, dass sie erneut vom Verdienst des Ehemannes abhängig waren.⁶⁵ Das Wirtschaftswunder begann, wenn auch noch nicht für alle Bevölkerungsschichten. Einige waren noch länger mit materiellen Problemen und daraus resultierenden Konflikten konfrontiert.⁶⁶ Ende des Jahrzehnts bewohnten 85 Prozent der Ehepaare aber eine eigene Wohnung mit Küche oder Kochnische.⁶⁷ Die großen kriegsbedingten sozialen Probleme waren bis zur zweiten Legislaturperiode weitgehend bewältigt.⁶⁸ Mit dem wirtschaftlichen
Vgl. Schelsky, Wandlungen, 1955, S. 279 sowie Brombach, Literatur, 1995, S. 59 ff. Vgl. dazu auch Nuys-Henkelmann, Sonne, 1990, S. 116 ff. Zur zeitgenössischen Sicht auf Frühehen vgl. Oheim, Ehe, 1959, S. 125 ff. Vgl. Kapitel 3.5.3 Modell-Beratungsstelle sowie 3.5.4 Vertrauensstelle. Schelsky, Wandlungen, 1955, S. 13. Vgl. Brombach, Literatur, 1995, S. 356. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 327. Zum Wirtschaftswunder und dessen Auswirkungen vgl. Sachße/Tennstedt, Geschichte, 2012, S. 37 ff. Vgl. Niehuss, Familie, 2001, S. 278 ff. Vgl. Sachße/Tennstedt, Geschichte, 2012, S. 183.
54
2 Ehe von der frühen Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1960er-Jahre
Aufschwung und zunehmend eingespieltem Ehe- und Familienleben verschoben sich auch die Konflikte innerhalb der Ehen. Nun standen Untreue,⁶⁹ das Desinteresse von Männern an ihren Familien und die Geringschätzung der Hausfrauenarbeit im Vordergrund.⁷⁰ Bereits 1950 lag die Frauenerwerbstätigkeit bei über 44 Prozent und stieg bis Ende der 1960er-Jahre nur um weitere 2 Prozent.⁷¹ Gleichzeitig lehnten Sozialwissenschaften, Politik, Kirchen und Verbände weibliche Erwerbstätigkeit weiter ab.⁷² Dass Ehefrauen und Mütter de facto aber mehr arbeiteten, durchbrach die ihnen zugeschriebene innerhäusliche Rolle zunehmend.⁷³ Die Ernährerposition des Mannes war in Frage gestellt, mit weitreichenden Konsequenzen. Eine neue Norm bildete sich heraus, welche die Berufstätigkeit junger Ehefrauen ohne Kinder überwiegend positiv beurteilte. Auch Eheratgeber zeichneten ein zunehmend wohlwollendes Bild der Geld verdienenden Ehefrau.⁷⁴ Für Frauen mit kleinen Kindern bedeutete ihre Berufstätigkeit, dass sich ihr tägliches Arbeitspensum deutlich erhöhte. Hier setzte auch die Kritik an. Die Doppelbelastung widerspreche dem weiblichen Geschlecht und schädige die Kinder, da die Familie sich entinnerliche.⁷⁵ Auch die Frauen bewerteten weibliche Erwerbstätigkeit unterschiedlich, je nach Schichtzugehörigkeit. Arbeiterinnen zogen den Status als Hausfrau vor, da er Kontrollfreiheit mit sich brachte. Im Mittelstand hatten 40 Prozent der Frauen den Wunsch, ihre Berufstätigkeit mit einer Heirat aufzugeben, während nur 10 Prozent mit freien Berufen dazu bereit waren. Diejenigen mit qualifizierten Berufen strebten in ihren Beziehungen eher eine Partnerschaft an.⁷⁶ Schichtbestimmend blieb jedoch die berufliche Tätigkeit des Ehemannes. Akzeptierte er die Berufstätigkeit seiner Frau nicht, gab diese ihren Beruf entweder früh auf oder es kam zu Eheproblemen.⁷⁷ Insbesondere die Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe war sich dieser Thematik bewusst.⁷⁸ Andere verheiratete Frauen ver-
Treue galt bis 1963 als am Ehepartner am meisten geschätztes Ideal. Ab 1965 wurden hingegen die Vorzüge der Untreue breit diskutiert. Vgl. Herzog, Politisierung, 2005, S. 182 ff. Vgl. Niehuss, Familie, 2001, S. 278 ff. Vgl. Pierenkemper, Toni: „Arbeit, Einkommen und Lebensstandard“. In: Rahlf, Thomas (Hrsg.): Deutschland in Daten. Zeitreihen zur Historischen Statistik, Bonn 2015, S. 142– 153, hier S. 145. Vgl. Niehuss, Familie, 2001, S. 304 f. Vgl. im Folgenden Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 328 sowie Niehuss, Familie, 2001, S. 381 ff. Vgl. Oheim, Ehe, 1959, S. 201 ff. S. Kuller, Christiane: „Einführung. Krisendebatten um Ehe und Familie in den 1960er Jahren“. In: Lepp, Claudia / Oelke, Harry/ Pollack, Detlef (Hrsg.): Religion und Lebensführung im Umbruch der langen 1960er Jahre. Göttingen 2016, S. 205 – 213, hier S. 209. Vgl. Brombach, Literatur, 1995, S. 152 ff., S. 173 und S. 180 f. Vgl. Niehuss, Familie, 2001, S. 381. Vgl. Kapitel 3.5.4 Vertrauensstelle.
2.5 „Krise der Ehe“ und Familie im Wandel
55
blieben im innerfamiliären Aufgabenbereich und zeigten sich stolz auf die Erfüllung ihrer häuslichen Pflichten.⁷⁹
2.5 „Krise der Ehe“ und Familie im Wandel Bis zu Beginn der 1960er-Jahre war die Zahl der Eheschließungen mit neun Hochzeiten auf 1.000 Einwohner pro Jahr hoch, obwohl die „Krise der Ehe“ weiter thematisiert wurde. Westdeutschland befand sich im „Goldenen Zeitalter für Heirat und Familie“.⁸⁰ Die Geburtenzahlen waren mit 2,51 Kindern pro Frau ungewöhnlich hoch und lagen knapp über dem Niveau von 1940.⁸¹ Ab 1963 stiegen jedoch auch die Scheidungszahlen wieder schnell an,⁸² wenige Jahre später ging die Geburtenrate stark zurück, was dem zugrunde liegenden langfristigen statistischen Trend entsprach.⁸³ Doch nicht nur die demografischen Zahlen offenbarten zu diesem Zeitpunkt die „Krise der Familie“, sondern auch die inneren Familienverhältnisse sowie ihre vermeintlichen Auswirkungen. Das damit verbundene Niedergangsnarrativ, das eine am Bevölkerungswachstum orientierte Politik anstimmte, sah die Krisenursache in der modernen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Dass diese auf eine emotionale Beziehungsstruktur reduziert sei, stelle die gesellschaftliche Funktion von Ehe und Familie in Frage. Einige Soziologen legten steigende emotionale Ansprüche an eine Ehe als Qualitätsgewinn aus, da diese keine zwingende Notwendigkeit mehr darstellte. Doch konnte sich diese positive Interpretation nicht breitenwirksam durchsetzen, stattdessen blieben die beobachteten Krisenphänomene im Fokus. Tonangebend war das Leitbild der Hausfrauenehe und der bürgerlichen Kernfamilie, die eine „natürliche“, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung vorsah. Die wichtigste Aufgabe der Frauen bildete die Kindererziehung.
Vgl. Brombach, Literatur, 1995, S. 164. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung: Fakten. Eheschließungen und rohe Eheschließungsziffer in Deutschland (1841– 2018). Verfügbar unter: https://www.bib.bund.de/Permalink.html? id=10218438, besucht am 18. Oktober 2020. Vgl. auch Rothenbacher, Franz / Fertig, Georg: „Bevölkerung, Haushalte und Familien“. In: Rahlf, Thomas (Hrsg.): Research Report. Deutschland in Zahlen. Zeitenreihen zur Historischen Statistik. Bonn 2015, S. 30 – 45, hier S. 38. Vgl. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung: Fertilität. Zusammengefasste Geburtenziffer in Deutschland, 1871– 2016. Verfügbar unter: https://www.bib.bund.de/Permalink.html?id=10241752, besucht am 18. Oktober 2020. Vgl. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung: Fakten. Ehescheidungen und rohe Ehescheidungsziffer in Deutschland (1888 – 2018). Verfügbar unter: https://www.bib.bund.de/Permalink.html? id=10237618, besucht am 18. Oktober 2020. Vgl. im Folgenden Kuller, Einführung, 2016, S. 207 ff.
56
2 Ehe von der frühen Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1960er-Jahre
Der zeitgenössische Blick auf Ehe und Familie verwies weniger auf die realen Verhältnisse als auf herrschende Idealvorstellungen, die der Gesellschaft in einer Zeit der Ungewissheit Halt geben sollten. Da der Bedarf, eine imaginierte Normalität herzustellen, sank, verlor die Moralisierung von Sexualität und Sittlichkeit allmählich an Bedeutung. Anfang der 1960er-Jahre zeigten sich zunehmend liberalere Tendenzen.⁸⁴ Diese kamen mit den sozialen Bewegungen ab Mitte der 1960er-Jahre, in denen längerfristige Wandlungsprozesse kulminierten, stärker zum Durchbruch. Das wirkte sich auch auf die Machtverhältnisse innerhalb der Familien aus und veränderte den Umgang zwischen den Ehepartnern sowie zwischen Eltern und Kindern.⁸⁵
2.6 Ehe- und Familienrecht Insgesamt spiegelte die Rechtslage weniger die tatsächlichen gesellschaftlichen Veränderungen wider, wie beispielsweise die zunehmende Frauenerwerbstätigkeit, als vielmehr das Ehebild der Ära Adenauer. Zeitgenössisch wurde dies als „‚Ethisierung‘ des Rechts“ analysiert,⁸⁶ wobei das Gesetz dazu beitragen sollte, die Ehe in den „Stand der Hingebung und Opferbereitschaft“ zu erheben.⁸⁷ So flossen naturrechtliche und christliche Überzeugungen zu Geschlechterrollen, Ehe, Familie und Sexualität in Gesetzgebung und Rechtsprechung mit ein.⁸⁸ Auch die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (DAJEB) forderte, eine Eherechtsreform müsse sich an der ewigen göttlichen Ordnung orientieren.⁸⁹ In der Nachkriegszeit erließ der Alliierte Kontrollrat ein Ehegesetz, um nationalsozialistisches Gedankengut zu beseitigen.⁹⁰ Allerdings blieb unklar, ob das „Ehegesundheitsgesetz“ von 1935 dennoch weiterbestand.⁹¹ Da sich die Alliierten in der Handhabung uneins waren, gab es innerhalb der Besatzungszonen verschiedene Auslegungen. Zudem befürworteten sie teilweise den Austausch von Gesundheitszeugnissen. Sie befürchteten ebenfalls fallende Geburtenraten und un-
Vgl. dies., Familienpolitik, 2004, S. 225 f. Vgl. ebd., S. 224. Müller-Freienfels, Ehe, 1962, S. 29. Ebd., S. 30. Vgl. ebd., S. 95 sowie Herzog, Politisierung, 2005, S. 146. S. DAJEB: Bericht, 1953, S. 3 f., Archiv des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung (ADE), JF 31. Vgl. auch DAJEB: Jahresbericht 1953. Detmold [1954], S. 4, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Kontrollratsgesetz Nr. 16, Ehegesetz vom 20. Februar 1946. Vgl. im Folgenden Timm, Politics, 2010, S. 229 ff. und 300 ff.
2.6 Ehe- und Familienrecht
57
terstützten Restriktionen des Sexualverhaltens. Dies trug dazu bei, dass Politik und Eheberatung keine Notwendigkeit sahen, Arbeit oder Methoden der Beratungsstellen zu überdenken. Vor allem die öffentliche Gesundheitspflege hegte den Wunsch, Gesundheitsuntersuchungen vor der Ehe erneut verpflichtend festzuschreiben. Ab 1949 fanden hierzu Beratungen statt. In der Folge erließen einige Bundesländer Gesetze, die den Austausch von Gesundheitszeugnissen vor der Eheschließung vorschrieben, zum Beispiel Baden-Württemberg.⁹² Zu einer bundesweit einheitlichen Regelung kam es aber nicht. Ende 1951 erklärte das Bundesinnenministerium die Beratungen für beendet. Auch das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ galt nicht als typisch nationalsozialistisches Gesetz, da andere Länder ähnliche Regelungen hatten. Nach dem Ende des Nationalsozialismus wurde es nicht aufgehoben, allerdings auch nicht mehr angewendet. Politik, Medizin und Justiz forderten in den 1950erJahren eine neue Regelung, die Befürworter konnten sie aber nicht durchsetzen.⁹³ Die Tendenz, Maßnahmen der negativen Eugenik in gewisser Weise zu bejahen, blieb noch länger bestehen. Der Rechtswissenschaftler Wolfram Müller-Freienfels forderte 1962, dass eine intensive ärztliche Aufklärungspflicht über Erbkrankheiten und die Pflicht zum Austausch von Gesundheitszeugnissen unter Verlobten gesetzlich begründet werden sollten.⁹⁴ Generell war er der Ansicht: Ganz unvereinbar mit unseren modernen Auffassungen von der Freiheit und Würde des einzelnen sind schließlich alle gesetzlichen Bemühungen um eine ‚Menschenzüchtung‘ mit dem Ziel, die Wahl des Ehepartners in positivem Sinne naturwissenschaftlich unmittelbar zu beeinflussen oder gar zu lenken. Keine soziale, medizinische oder eugenische Lehre berechtigt zu solchem Dirigismus. In Frage kommen allein negative Vorkehrungen […]. Das Gesetz darf keinesfalls weiter gehen, als die gesicherte, exakte medizinische Erkenntnis reicht – kann und soll aber innerhalb dieser Grenzen mit Vorsicht die Postulate unterstützen.⁹⁵
Ein Jahr später hob Baden-Württemberg das Gesetz zum Austausch von Gesundheitszeugnissen auf, da Paare ärztlichen Empfehlungen, nicht zu heiraten, kaum Folge leisteten.⁹⁶
Gesetz Nr. 347 über die Vorlegung eines Gesundheitszeugnisses vor der Eheschließung vom 14. März 1949. Vgl. auch Gesundheitsamt Stadt Stuttgart, Gesundheitszeugnis zur Vorlage vor der Eheschließung, [1950], LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5 – 30 – 02. Vgl. Timm, Politics, 2010, S. 233 ff. und 303 ff. Vgl. auch Kapitel 3.2.4.4 Eugenischer Arbeitskreis. Vgl. Müller-Freienfels, Ehe, 1962, S. 281 f. Ebd., S. 113. Von 2.865 Beanstandungen unter 236.360 Eheschließungen folgten 260 Paare dem ärztlichen Rat, nicht zu heiraten. Vgl. ebd., S. 283, Fn 2.
58
2 Ehe von der frühen Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1960er-Jahre
Ehe und Familie standen mit dem Grundgesetz (GG), in dem auch die Gleichberechtigung der Geschlechter festgeschrieben war⁹⁷, unter dem besonderen Schutz des Staates.⁹⁸ Damit besserte sich aber der Status von Frauen noch nicht auf allen Rechtsebenen, denn eine Anpassung des Privatrechts fand vorerst nicht statt. Die in Artikel 117 GG vorgesehene Regelungsfrist verstrich 1953 ungenutzt. Langjährige Rechtsunsicherheit und eine widersprüchliche Rechtsprechung waren die Folge.⁹⁹ Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) von 1896 mit seinem patriarchalischen Ehe- und Familienverständnis blieb somit vorerst unangetastet. Ab 1955 befasste sich im Bundestag der Unterausschuss „Familienrechtsgesetz“ mit den notwendigen gesetzlichen Änderungen. Dort standen sich zwei Sichtweisen gegenüber. Die eine betrachtete die Gleichberechtigung als Individualrecht, die andere betonte die Ehe als schützenswerte Gemeinschaft. In letzterer galt eine rechtlich festgeschriebene Gleichberechtigung häufig als ehegefährdend. Hinzu kam die Überzeugung, die Geschlechter seien grundsätzlich verschieden. Gleichberechtigung galt häufig als Aufwertung der Frauen, weniger als Angleichung der Geschlechterrollen.¹⁰⁰ Nach einer Einigung des Unterausschusses sollte das Grundgesetz durch das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz von 1957 schließlich umgesetzt werden.¹⁰¹ Eine der zentralen Grundlagen des BGB bildete das Letztentscheidungsrecht des Mannes in Eheangelegenheiten: „Dem Manne steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu; er be-
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ (§ 3 Abs. 2 GG). Vgl. im Folgenden Berghahn, Sabine: „Der Ritt auf der Schnecke. Rechtliche Gleichstellung in der Bundesrepublik Deutschland“. In: Koreuber, M. / Mager, U. (Hrsg.): Recht und Geschlecht. Zwischen Gleichberechtigung, Gleichstellung und Differenz. Baden-Baden 2004, S. 59 – 80; Dressler, Sabine: „Bedrohung oder Fundament der Ehe? Gleichberechtigung im politisch-rechtlichen Diskurs und in Eheratgebern der 1950er Jahre“. In: Scholz, Sylka et al. (Hrsg.): In Liebe verbunden. Zweierbeziehungen und Elternschaft in populären Ratgebern von den 1950ern bis heute. Bielefeld 2013, S. 99 – 126, hier S. 99 ff.; Niehuss, Familie, 2001, S. 288 ff. „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft“ (§ 6 GG). Zur Praxis der Scheidungsverfahren vgl. auch Etzold, Raphaela: Gleichberechtigung in erster Instanz. Deutsche Scheidungsurteile der 1950er Jahre im Ost-/West-Vergleich. Tübingen 2019, S. 129 ff. Zur Sicht von Seiten der Eheberatung vgl. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 24, Januar 1958, BArch, B 142/2043, Bl. 92 ff. Vgl. Jäger, Protestantismus, 2019, S. 97 f. Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts v. 18.06.1957, Bundesgesetzblatt I 1957, 21. Juni 1957. Zu verschiedenen Formulierungsvorschlägen vgl. o. A.: „Eherecht. Bettelei ums Haushaltsgeld“. In: Der Spiegel 6 (1952), Nr. 6, S. 28 – 30, hier S. 29.
2.6 Ehe- und Familienrecht
59
stimmt insbesondere Wohnort und Wohnung.“¹⁰² Dieses Entscheidungsrecht stellte in den Debatten um das Gleichberechtigungsgesetz den größten Streitpunkt dar.¹⁰³ Trotz Protesten insbesondere der katholischen Kirche¹⁰⁴ einigte sich der Unterausschuss darauf, das Letztentscheidungsrecht zu streichen. Nach Diskussionen im Parlament wurde dieses Recht allerdings wieder aufgenommen. Zwei Jahre später erklärte das Bundesverfassungsgericht das Letztentscheidungsrecht schließlich für verfassungswidrig. Auch in der Kindererziehung hatte der Vater bis 1959 das letzte Wort.¹⁰⁵ Darüber hinaus bestimmte das BGB ihn als alleinigen Vertreter des minderjährigen Kindes.¹⁰⁶ Das Bundesverfassungsgericht erklärte dies ebenfalls für nichtig und legte eine „gemeinsame, unteilbare Verantwortung gegenüber dem Kinde“ fest.¹⁰⁷ Künftig konnten Eltern einen Vormundschaftsrichter anrufen, wenn sie sich in Erziehungsfragen nicht einigen konnten. Die Urteilsbegründung betonte jedoch, dass biologische und funktionale Unterschiede der Geschlechter auch verschiedene rechtliche Rollenbestimmungen im Familienrecht erlaubten. Das Urteil stellte eine familienpolitische Zäsur dar und löste sowohl Begeisterung als auch Entrüstung aus. Mit dem Gleichberechtigungsgesetz traten 1958 weitere Änderungen des BGB in Kraft.¹⁰⁸ Zu nennen ist hier vor allem die Zugewinngemeinschaft, welche die in der Ehe gemeinsam erwirtschafteten Vermögenswerte unter den Eheleuten hälftig aufteilte. Dem lag die Vorstellung zugrunde, dass Haus- und Erwerbsarbeit gleichwertig seien.¹⁰⁹ Im Falle einer Scheidung sollten Frauen nicht automatisch Armut ausgesetzt sein. Darüber hinaus konnten sie nach der Gesetzesänderung ihr in die
§ 1354 BGB. Vgl. dazu Berghahn, Ritt, 2004, S. 61; Dressler, Bedrohung, 2013, S. 99 ff.; Niehuss, Familie, 2001, S. 288 ff. Zur Kritik am Eherecht vgl. Müller-Freienfels, Ehe, 1962, S. 95 ff. Katholische Berater innerhalb der Familien- und Jugendarbeit distanzierten sich hingegen aufgrund ihrer Beratungspraxis immer offener vom katholischen Lehramt, welches das Letztentscheidungsrecht des Vaters theologisch begründete. Vgl. Rahden, Till van: „Demokratie und väterliche Autorität. Das Karlsruher ‚Stichentscheid‘-Urteil von 1959 in der politischen Kultur der frühen Bundesrepublik“. In: Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History 2/2005, S. 160 – 179. Vgl. im Folgenden ebd. § 1628 BGB und § 1629 BGB. Bundesverfassungsgericht, zitiert nach Rahden, Demokratie, 2005, S. 160. Vgl. im Folgenden Niehuss, Familie, 2001, S. 282. „Die Ehegatten sind verpflichtet, nach Kräften zum gemeinsamen Unterhalt beizutragen. Die Frau hat das Recht, ihren Beitrag durch Hausarbeit zu leisten. Die Führung des Hauswesens und die Sorge für die Kinder ist den anderen Arten, zum Unterhalt der Familie beizutragen, gleich zu bewerten“ (§ 1356 BGB).
60
2 Ehe von der frühen Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1960er-Jahre
Ehe eingebrachtes Vermögen selbst verwalten. Bis dahin durfte der Ehemann im Sinne einer Nutzverwaltung darüber verfügen. Der Ehemann hatte zudem nicht mehr das Recht, das Arbeitsverhältnis seiner Frau zu kündigen.¹¹⁰ Damit konnten Frauen auch gegen den Willen ihres Mannes einer Berufstätigkeit nachgehen. Allerdings galt dies nur eingeschränkt, denn das Leitbild der Hausfrauenehe blieb bestehen: „Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist.“¹¹¹ Zwar hatte es hier bereits 1949 Grenzen gegeben, doch bestanden weiter Kündigungsmöglichkeiten. „Der Mann hat der Frau nach Maßgabe seiner Lebensstellung, seines Vermögens und seiner Erwerbsfähigkeit Unterhalt zu gewähren.“¹¹² Umgekehrt galt dies auch für die Frau, sollte der Mann dazu nicht imstande sein. Da die Ehefrau für den Haushalt zuständig war, stand ihr zu dessen Leitung regelmäßig ein angemessener Teil des Familienunterhalts zu.¹¹³ Erst eine weitere Reform des Ehe- und Familienrechts tilgte 1977 das Leitbild der Hausfrauenehe, sodass Frauen ohne Einschränkungen einer Berufstätigkeit nachgehen konnten.¹¹⁴ Grundsätzlich galt die Ehe als auf Lebenszeit angelegt. Eine Scheidung war jedoch nach dem sogenannten Verschuldensprinzip möglich.¹¹⁵ Dies war mit erheblichen Nachteilen für den schuldig geschiedenen Partner verbunden. Diesem war es beispielsweise kaum mehr möglich, das Sorgerecht für gemeinsame Kinder zu erhalten. Zusätzlich zum Verschuldensprinzip gab es seit 1938 die Möglichkeit, sich über das Zerrüttungsprinzip scheiden zu lassen,¹¹⁶ das die Nationalsozialisten aus bevölkerungspolitischer Motivation eingeführt hatten. Es ermöglichte unter anderem die Scheidung einer kinderlosen Ehe. In der Nachkriegszeit drängte die Rechtsprechung das Zerrüttungsprinzip in den Hintergrund. Ab 1954 lag die Betonung immer mehr auf dem sittlichen Wert und der Unauflöslichkeit der Ehe. Diesen Ansatz griff die Bundesregierung auf. Gegen den Widerstand von SPD und FDP schränkte sie mit dem Familienrechtsänderungsgesetz von 1961 das Zerrüttungs-
Vgl. im Folgenden Niehuss, Familie, 2001, S. 292. § 1356 BGB. § 1360 BGB. Zudem bestimmte dieser Paragraf, dass die Ehefrau ihre Verpflichtung, zum Familienunterhalt beizutragen, in der Regel durch die Haushaltsführung erfüllte. Zur Diskussion darum vgl. o. A., Eherecht, 1952, S. 28 ff. Zu zeitgenössischen Vorstellungen des Umgangs mit Haushaltsgeld vgl. Oheim, Ehe, 1959, S. 152 ff. Vgl. auch Kapitel 3.6.3 Beratungsthemen. „Die Ehegatten regeln die Haushaltsführung im gegenseitigen Einvernehmen“ (§ 1356 BGB). Zu Scheidung und Scheidungsfolgen vgl. Müller-Freienfels, Ehe, 1962, S. 135 ff. und S. 284 ff. Vgl. im Folgenden o. A.: „Eherecht. Das zerrüttete Prinzip“. In: Der Spiegel 15 (1961), Nr. 27, S. 14– 17.
2.6 Ehe- und Familienrecht
61
prinzip weiter ein.¹¹⁷ Eine Scheidung war nicht mehr möglich, wenn der an der Zerrüttung Unschuldige Widerspruch einlegte. Diese Form der Scheidung blieb umstritten. Müller-Freienfels äußerte: „Eine objektive, zuverlässige Aufklärung und Beurteilung der ‚Ehezerrüttung‘, ohne daß Intimitäten des Ehelebens hervorgeholt werden, ist vielfach gar nicht möglich.“¹¹⁸ Doch auch ein Scheidungsverfahren nach dem Verschuldensprinzip rief bei Betroffenen zum Teil Bestürzung hervor. Müller-Freienfels empfahl die Hilfe von Eheberatern, „um die Schärfen und Härten des Eheprozesses im Einzelfall zu mildern“.¹¹⁹ Viele Gerichte nutzten diese Begleitung, auch wenn sie gesetzlich nicht ausdrücklich vorgesehen war. Manche Scheidungskammern setzten Verfahren zeitweise aus, um Betroffene zur Eheberatung zu schicken. Zudem fragten sie Eheberater an, um bei Scheidungen Gutachten auszustellen.¹²⁰ Lutz Raphael zufolge war die gutachterliche Urteilskompetenz die „handgreiflichste Form“ der Verwissenschaftlichung des Sozialen, über welche der Experte Entscheidungsbefugnis erhielt.¹²¹ Gutachten anzufertigen bildete in einigen Beratungseinrichtungen einen wichtigen Teil der Arbeit. Allerdings lehnten Berater es in der Regel ab, Gutachten über Fälle zu schreiben, die sie persönlich betreuten. Ein Zeugnisverweigerungsrecht stand ihnen jedoch nicht zu.¹²² Dies führte zu Problemen, wenn Eheberater aus Gewissensgründen ihre Aussage verweigerten.¹²³ Sowohl die Mitarbeit von Beratungsstellen beim Sühneversuch als auch ihr Recht auf Zeugnisverweigerung stand daher immer wieder in der Diskussion.¹²⁴
Gesetz zur Vereinheitlichung und Änderung familienrechtlicher Vorschriften, 11.08.1961. Müller-Freienfels, Ehe, 1962, S. 286. Ebd., S. 333. Ebenso konnten Gutachten zum Ehemündigkeitsverfahren angefragt werden. Vgl. dazu ebd., S. 323 ff. Zur Haltung der Beratungsstellen vgl. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 25, Februar 1958, S. 24 ff., BArch, B 142/2043, Bl. 104 ff. Zur Praxis vgl. auch Kapitel 3.5.4 Vertrauensstelle. Raphael, Verwissenschaftlichung, 1996, S. 167. § 53 StPO. Wolfram Müller-Freienfels empfahl, eine gesetzliche Anordnung zur Eheberatung als Voraussetzung für die Einreichung einer Scheidungsklage zu schaffen. Vgl. Müller-Freienfels, Ehe, 1962, S. 317 ff. Ebenso die DAJEB,Vgl. dazu DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 19, Juli 1956, BArch, B 142/418, Bl. 251 ff. Sowohl das Bundesjustizministerium als auch die Bundesländer befassten sich immer wieder mit dieser Fragestellung.Vgl. z. B. Bundesjustizministerium, Aktennotiz, 21. März 1951, BArch, B 141/49456, Bl. 79. Vgl. z. B. Groeger, Verfahren, 1955, S. 8, DZI. Für ein einvernehmliches Vorgehen vgl. z. B. Kaufmann, Hannes, Aktenvermerk, 6. März 1952, BArch, B 141/49456, Bl. 76 ff. Vgl. z. B. Bayerisches Staatsministerium der Justiz an Bundesminister der Justiz, Stellungnahme, 15. Februar 1956, BArch, B 141/49456, Bl. 70 ff. sowie Bundesministerium der Justiz, Vermerk, 26. September 1962, BArch, B 141/49456.
62
2 Ehe von der frühen Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1960er-Jahre
Bei einer Scheidung nach dem Verschuldensprinzip war die Höhe der Unterhaltszahlungen von der Schuld der Geschiedenen abhängig.¹²⁵ Schuldig gesprochene oder in beidseitigem Verschulden geschiedene Personen hatten keinen Anspruch auf Unterhaltszahlungen. Dies war vielen Betroffenen bei ihrer Scheidung noch nicht bewusst, da Unterhaltsansprüche erst danach zur Verhandlung kamen. Ansprüche bestanden in diesen Fällen nur, wenn den Betroffenen aus Alters- oder Krankheitsgründen beziehungsweise aufgrund von Kindererziehung eine Erwerbstätigkeit nicht zuzumuten war. Auch bei geltenden Unterhaltsansprüchen bestand keine Zahlungsgarantie. Frauen verloren bei einer Scheidung zudem ihre Rentenansprüche sowie Sachleistungen aus der Krankenversicherung. Was Sexualität anging, orientierte sich sowohl das Eherecht als auch das Sexualstrafrecht an einer klaren geschlechtlichen Rollenaufteilung. Die sexuelle Hingabe von Frauen in der Ehe galt als selbstverständlich.¹²⁶ Ehebrüche stellten einen absoluten Scheidungsgrund dar. Sie zogen zudem ein Eheverbot nach sich zwischen denjenigen Partnern, die den Ehebruch begangen hatten. Allerdings konnten die Betroffenen beim Vormundschaftsgericht eine Befreiung vom Eheverbot beantragen.¹²⁷ Ehebruch war zudem strafbar, grundsätzlich war sogar eine Haftstrafe von bis zu sechs Monaten denkbar.¹²⁸ Solche Verurteilungen waren jedoch selten.¹²⁹ 1969 wurde diese Strafrechtsvorschrift aufgehoben. Ebenfalls rechtlich reglementiert war voreheliche Sexualität.¹³⁰ Der sogenannte Kuppeleiparagraf verbot, unverheirateten Paaren Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, in denen diese „Unzucht“ treiben konnten.¹³¹ Darauf drohten bis zu fünf Jahre Gefängnis. Da Geschlechtsverkehr zwischen Verlobten nicht per se als unzüchtig galt, stand der Unzuchtsbegriff lange zur Diskussion.¹³² Die Rechtsprechung ging überwiegend auf den Einzelfall ein, was Ausnahmen zuließ. Dies änderte sich 1954, als der Bundesgerichtshof feststellte, dass Geschlechtsverkehr zwischen
Vgl. im Folgenden Niehuss, Familie, 2001, S. 103 ff. Vgl. Herzog, Politisierung, 2005, S. 358, Fn. 55. Vgl. Oheim, Ehe, 1959, S. 401. „Der Ehebruch wird, wenn wegen desselben die Ehe geschieden ist, an dem schuldigen Ehegatten, sowie dessen Mitschuldigen mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein“ (§ 175 StGB). Zwischen 1950 und 1956 wurden pro Jahr zwischen 140 bis 210 Personen verurteilt. Vgl. Brombach, Literatur, 1995, S. 45. 1959 wurden wegen Ehebruchs 126 Personen bestraft. Vgl. MüllerFreienfels, Ehe, 1962, S. 109. § 180 StGB und 181 StGB.Vgl. dazu im Folgenden Niehuss, Familie, 2001, S. 316 sowie Oheim, 1959, S. 397 ff. Vgl. dazu auch Müller-Freienfels, Ehe, 1962, S. 66 f. Vgl. dazu auch Oheim, Ehe, 1959, S. 92 f.
2.6 Ehe- und Familienrecht
63
Verlobten als unzüchtig zu gelten hatte, da die Bindung noch nicht endgültig war.¹³³ Lösten die Partner eine Verlobung, konnten sie Verlobungsgeschenke zurückverlangen.¹³⁴ Ausgaben, die Mann oder Frau getätigt hatten, weil sie eine Hochzeit erwarteten, waren angemessen zu ersetzen.¹³⁵ Entlobte Frauen konnten vom ehemaligen Verlobten ein „Kranzgeld“ verlangen, sofern sie wegen des Eheversprechens zum ersten Mal Geschlechtsverkehr gehabt hatten.¹³⁶ Die Begründung für den Schadenersatzanspruch lautete, dass der Verlust der Jungfräulichkeit künftige Heiratschancen mindere. Einige nationalsozialistische Gesetze fanden in der Nachkriegszeit fast unverändert Eingang in das Strafgesetzbuch.¹³⁷ Homosexuelle Handlungen, die auch bereits im Kaiserreich und in der Weimarer Republik unter Strafe gestanden hatten, blieben mit § 175 StGB weiterhin ein Verbrechen. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte 1957 den von den Nationalsozialisten verschärften Straftatbestand.¹³⁸ Sowohl die Werbung für als auch der Verkauf von empfängnisverhütenden Mitteln waren aufgrund des „Himmler-Erlasses“ von 1941 nur eingeschränkt zugelassen. 1962 trat das Bundessozialhilfegesetz in Kraft, das einen Rechtsanspruch auf Hilfe „in besonderen Lebenslagen“ einführte.¹³⁹ Das Gesetz trug wesentlich dazu bei, dass sich das neu formierende Feld der Sozialen Arbeit und damit auch die Eheberatung professionalisierten. Ein neues Selbstverständnis war auch an Begriffsänderungen abzulesen: Wohlfahrtspflege hieß nunmehr Soziale Arbeit, Fürsorge Sozialhilfe.¹⁴⁰
Vgl. auch DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 14, August 1955, S. 1 ff., ADE, JF 31. § 1301 BGB. § 1297 und § 1298 BGB. „Hat eine unbescholtene Verlobte ihrem Verlobten die Beiwohnung gestattet, so kann sie, wenn die Voraussetzungen des § 1298 oder des § 1299 vorliegen, auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld verlangen“ (§ 1300 BGB). Vgl. dazu auch DAJEB: Informationsschreiben Nr. 21, März 1957, S. 6 f., LAB, B Rep 012, Nr. 176. Vgl. im Folgenden Herzog, Politisierung, 2005, S. 158 ff. Dieser blieb bis 1969 bestehen. Bundessozialhilfegesetz (BSHG vom 30. Juni 1961), § 1 Abs. 1. Als Grundsätze waren im BSHG die Befähigung zur Selbsthilfe (§ 1 Abs. 2) und die individuelle Hilfe (§ 3) festgelegt. Vgl. Hering, Sabine / Münchmeier, Richard: „Restauration und Reform – Die Soziale Arbeit nach 1945“. In: Thole, Werner (Hrsg.): Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. Opladen 2002, S. 97– 118, hier S. 102 ff. sowie Wendt, Geschichte, 2008, S. 214.
64
2 Ehe von der frühen Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1960er-Jahre
2.7 Politische Einbindung der Eheberatung in das Bundesministerium für Familienfragen Die Eheberatung war ab 1959 politisch im Familienministerium eingebettet. In der frühen Bundesrepublik galt eine Familienpolitik als erforderlich, die auf die Ehe als zentrale Institution setzte und die unterschiedlichen Geschlechterrollen betonte, um der weithin empfundenen Unordnung der Geschlechterverhältnisse entgegenzuwirken.¹⁴¹ Eine entsprechende Politik sollte auch einen befürchteten Geburtenrückgang aufhalten.¹⁴² Aus diesen Überlegungen heraus entstand 1953 das Bundesministerium für Familienfragen.¹⁴³ Allerdings erhielt es kaum Kompetenzen. Seine Gründung stellte vor allem ein symbolisches Entgegenkommen an die katholische Kirche dar, um nicht auf die kirchliche Forderung nach Abschaffung der Zivilehe eingehen zu müssen. Die Kirche hatte im Wahlkampf die Unionsparteien wesentlich unterstützt. Der Katholik Franz-Josef Wuermeling ¹⁴⁴ erhielt den Ministerposten. Da Wuermeling nur über einen geringen Etat verfügte, beschränkte sich seine Arbeit im Wesentlichen auf eine enge Kooperation mit kirchlichen Verbänden und öffentliche Auftritte.¹⁴⁵ Er vertrat die Auffassung, die Familie sei die transzendentale Keimzelle des Staates. Seine Politik zielte darauf ab, die Gleich-
Vgl. Heinemann, Stunde, 2001, S. 170. Vgl. Timm, Politics, 2010, S. 305 ff. Dessen Einrichtung und erste Maßnahmen erschienen der Bremer Eheberatungsstelle „sehr zeitgemäß“. Gemeinhardt, Wolfgang: Eheberatung als Aufgabe des Öffentlichen Gesundheitsdienstes; dargestellt an den derzeitigen Verhältnissen in Bremen. Hamburg 1956, S. 95. Franz-Josef Wuermeling (8.11.1900 – 7. 3.1986) wurde in Volkswirtschaft promoviert und legte die juristischen Staatsexamina ab. Danach wurde er im preußischen Ministerium des Innern tätig. Dem Anpassungsdruck des „Dritten Reiches“ widerstand er und trat weder der NSDAP noch einer ihrer Organisationen bei. Stattdessen übernahm er demonstrativ den Vorsitz des Katholischen Akademikervereins. Im Jahr 1939 erfolgte Wuermelings Versetzung in den Ruhestand aus politischen Gründen. Der Jurist ging daraufhin in die Privatwirtschaft. Seine Ansichten waren von der Überzeugung geprägt, der Nationalsozialismus sei das Ergebnis einer Missachtung der Sittengesetze. Daher sah Wuermeling die Notwendigkeit zu einer Rechristianisierung und trat bereits 1945 der CDU bei. In schneller Folge wurde er in verschiedene politische Ämter gewählt. Seit 1949 gehörte er dem Deutschen Bundestag an. In den 1950er-Jahren engagierte er sich für den Volkswartbund. Von 1953 bis 1962 war er Familienminister. Der Politiker erhielt sowohl das Großkreuz des Bundesverdienstordens als auch den päpstlichen Gregorius-Orden. Vgl. Aretz, Jürgen: „Franz-Josef Wuermeling“. In: Ders. et al. (Hrsg.): Zeitgeschichte in Lebensbildern. Aus dem deutschen Katholizismus des 19. und 20. Jahrhunderts. Münster 2001, S. 245 – 259 sowie Steinbacher, Sex, 2011, S. 128. Vgl. als öffentlicher Auftritt z. B.Wuermeling, Franz-Josef: Gestalt und Gestaltung der Ehe in der modernen Gesellschaft, Rede anläßlich der Jahrestagung der DAJEB, Detmold 25. Mai 1961, BArch, B 189/2815, Bl. 227 ff.
2.7 Politische Einbindung der Eheberatung in das Bundesministerium für Familienfragen
65
berechtigung der Geschlechter abzuwehren,¹⁴⁶ die Familie zu stärken und die Geburtenraten zu erhöhen.¹⁴⁷ Der Familienminister setzte in der Nachkriegszeit auf die Selbstheilungskräfte der Familie:¹⁴⁸ „Die Zukunft auch unseres Volkes steht und fällt mit den Familien, die sich an die Ordnung der Zehn Gebote halten. Diese Ordnung bewahrt vor dem Aussterben, sie sichert die Volkskraft der Zukunft, sie verankert die ethischen Grundsätze für das Gemeinschaftsleben.“¹⁴⁹ Zudem forderte er die Frauen auf, sich zu opfern und ihre Männer für deren Demütigungen und Ängste im Krieg zu entschädigen. Werturteile spielten in der Familienpolitik eine wesentliche Rolle. Auch deshalb vertrat Wuermeling die Auffassung, dass wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema obsolet seien. Obwohl der familienpolitische Beirat 1959 erweitert wurde, gelang es nicht, Forschungsergebnisse in der Familienpolitik stärker zu etablieren. Im Beirat waren auch Soziologen und Rassenhygieniker des Nationalsozialismus vertreten beziehungsweise deren Schüler.¹⁵⁰ Da sich die Eheberatungsstellen in der Regel in kommunaler oder freier Trägerschaft befanden, konnte die Familienpolitik deren Arbeit inhaltlich nicht vorgeben. Jedoch hatte sie die Möglichkeit, über Geldzuwendungen Einfluss auszuüben. Auch wenn der Etat knapp war, erhofften sich die Akteure deshalb, über die Förderung von Familienbildung und -beratung unerwünschten gesellschaftlichen Entwicklungen entgegenzusteuern. Zu Beginn war dieser Bereich lediglich als Fürsorge und ergänzende Bildung gedacht, er spielte aber eine immer größere Rolle, um der wahrgenommenen Infragestellung des traditionellen Familienideals entgegenzuarbeiten.¹⁵¹ „Familienbildung“ sollte das Fundament der Familienpolitik sein, wobei der Begriff bis Ende der 1960er-Jahre unscharf blieb. An Eheberatung bestand vor allem im Sinne einer „Scheidungsbremse“ Interesse. Unter anderem gewährte das Bundesfamilienministerium der Familienberatung mit Zustimmung aller Parteien finanzielle Zuschüsse.¹⁵² Diese Zuschüsse trugen wesentlich zur Finanzierung von Ausbildungslehrgängen bei.¹⁵³
Vgl. Steinbacher, Sex, 2011, S. 128. Vgl. Niehuss, Familie, 2001, S. 172 ff. Vgl. Herzog, Politisierung, 2005, S. 146 ff. Wuermeling, Franz-Josef: „Familienbildung – Fundament der Familienpolitik“. In: Beckel, Albrecht et al. (Hrsg.): Erwachsenenbildung 5 (1959), H. 4, S. 109 – 113, hier S. 109, Archiv des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Vgl. Kuller, Einführung, 2016, S. 328 ff. Vgl. ebd., S. 227 und S. 336. Große-Schönepauck, H[elene]: Die Eheberatung in Deutschland und in anderen Ländern, [1969], S. 1, BArch, B 189/2807, Bl. 265 ff. Vgl. Kuller, Einführung, 2016, S. 227 und S. 336.
66
2 Ehe von der frühen Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1960er-Jahre
Für Wohlfahrtspflege und Fürsorge war das Bundesinnenministerium zuständig, das ebenfalls Ansprechpartner der Verbände war.¹⁵⁴ Bis 1959 galt Eheberatung als gesundheitliche Aufklärung und war somit dem Gesundheitssektor des Innenministeriums zugeordnet. Im Laufe der Zeit vertraten die Verbände ihre Interessen zunehmend selbstbewusst als Partner des Wohlfahrtsstaates.¹⁵⁵ Der 1961 eingeführte Rechtsanspruch auf Sozialberatung stärkte ihre Position weiter.¹⁵⁶ Ab 1967 führten die familienpädagogischen Gespräche im Bundesfamilienministerium dazu, dass die verschiedenen Bereiche, wie Gesundheitserziehung, Geschlechtserziehung, Familienberatung und Familienplanung, organisatorisch klar getrennt wurden. Das Familienministerium war für Familienberatung und Familienplanung zuständig.¹⁵⁷
Vgl. Hammerschmidt, Peter: Wohlfahrtsverbände in der Nachkriegszeit. Reorganisation und Finanzierung der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 1945 bis 1961. München 2005, S. 103. Vgl. Sachße/Tennstedt, Geschichte, 2012, S. 182. Vgl. Klens, H[ermann]: Bericht über die Sitzung der Trägerverbände des Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen am 11. August 1961, 16. August 1961, Archiv des Katholischen Deutschen Frauenbunds (AKDFB), Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Vgl. Kuller, Einführung, 2016, S. 243.
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung Der folgende Untersuchungsteil ist der Frage gewidmet, wie sich in nichtkonfessionellen, teilweise evangelisch beeinflussten und auch rein evangelischen Eheberatungsstellen Selbstverständnis und Praxis zueinander verhielten. Der Untersuchungszeitraum umfasst die Nachkriegszeit bis Mitte der 1960er-Jahre. Die These lautet, dass Selbstverständnis und Praxis der Beratungsarbeit Ambivalenzen aufwiesen, die bis hin zu offensichtlichen Widersprüchen reichten. In welcher Ausgangssituation sich die Eheberatung in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik befand, gilt es anhand der Beratungssituation verschiedener Städte zu eruieren. Im Anschluss rückt die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (DAJEB) als verbandlicher Zusammenschluss der Beratungsstellen in den Mittelpunkt, um ihre Akteure, ihr Selbstverständnis und ihren Einfluss auf die Arbeit zu untersuchen. Im zweiten Schritt erschließen die folgenden Ausführungen Selbstverständnis und Beratungspraxen ausgewählter Einrichtungen anhand ihrer Publikationen. Abschließend steht ein Fallbeispiel: Über die Rechtsberatungsstelle Reinickendorf/Wittenau überlieferte Egodokumente geben Einblick in die Beratungssituation selbst, die erstmals genauer analysiert wird. Zudem ist es möglich, Beratende und Ratsuchende als Akteure herauszuarbeiten.
3.1 Eheberatung in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik Die Fremdwahrnehmung von Ehen in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik war durchaus negativ. Dies stimmte allerdings nicht zwangsläufig damit überein, wie die Verheirateten selbst über ihre eigene Ehe dachten. So ergab die 1949 durchgeführte und 1935 veröffentlichte „Umfrage in die Intimsphäre“, dass 25 Prozent der Befragten die meisten Ehen für unglücklich hielten. 39 Prozent glaubten, die Partner stünden sich gleichgültig gegenüber. Hingegen gaben 85 Prozent an, mit ihrer eigenen Ehe zufrieden zu sein. Der Autor schloss daraus, dass ein falsches Bild über den Zustand der Ehe bestehe. Er selbst sah die größte Gefahr für Ehen dann gegeben, wenn alte und neue Leitbilder kollidierten.¹ Auch unter Eheberatern gab es Hinweise, dass die gängigen Redensarten von Verheirateten über die Ehe häufig viel abwertender waren als der Blick auf die eigene Ehe. Man wage es nicht, nach
Vgl. Friedeburg, Umfrage, 1953, S. 22. https://doi.org/10.1515/9783111097534-004
68
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
außen von der eigenen glücklichen Ehe zu sprechen, da man die Ehe allgemein als korrumpiert ansehe.² In der Sicht von Staat und Kirchen war die Ehe unangefochten die Institution, welche die Gesellschaft trug und stützte. Der Zustand der Ehen galt als Seismograf für den Zustand der Gesellschaft selbst und bot damit einen vielversprechenden Angriffspunkt, soziale Wertvorstellungen zu propagieren und durchzusetzen. Dieses gesellschaftliche Verständnis von Ehe, das damit verbundene Idealbild und der ihr beigemessene Wert wirkten sich wesentlich darauf aus, wie Beratungsstellen ihre Zielsetzung und Konzepte gestalteten. Da die Einrichtungen häufig ihre Eigenständigkeit betonten, auch wenn sie an bestimmte Träger gebunden waren, wichen sie auch in ihrem Anspruch deutlich voneinander ab. Gemeinsam war ihnen jedoch, vermeintlich harmonische Verhältnisse wiederherstellen zu wollen. Ehekrisen galten als Abweichung von der Norm und erforderten die Rückkehr zu einem vormaligen Zustand.³ Vor allem in amtlichen Stellen herrschte nach dem Krieg die Ansicht, dass die Eheprobleme abebben würden, wenn die wirtschaftliche Not behoben sei.⁴ Andere hingegen beurteilten Ehekonflikte nicht als vorübergehendes, sondern als modernisierungstypisches Phänomen. In dieser Interpretation stellten die Nachkriegszustände lediglich einen Beschleunigungsfaktor dar.⁵ Die Jugend zu erziehen und auf Ehe und Familie vorzubereiten, galt allen als übergreifende Lösung. Auch in der Fürsorge suchten die Akteure an die Weimarer Republik anzuknüpfen, sowohl in der Trägerstruktur als auch den fachlichen Anforderungen. Ebenso wie in der Eheberatung lag der Fokus dabei inhaltlich darauf, die Gesellschaft wieder zu „normalisieren“.⁶ Nach Kriegsende griffen alle noch bestehenden Eheberatungsstellen auf Bewährtes zurück. Vor allem amtliche, aber auch vereinzelte konfessionelle Einrichtungen hatten den Krieg überstanden. So führten sie entweder die eugenisch geprägte Beratung fort oder besannen sich auf ihre jeweils anderen Ansätze aus der Weimarer Republik. Der Gegensatz von Ehe- und Sexualberatung wiederholte sich allerdings nicht.⁷ Zwar grenzten sich beide Strömungen gegeneinander ab, Sexualberatungsstellen wurden zu Beginn jedoch nur vereinzelt wieder gegründet.
S. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 19, Juli 1956, S. 2, BArch, B 142/418, Bl. 251 ff. Vgl. Schneider, Ehen, 1998, S. 200 ff. und S. 216. Vgl. Kapitel 3.1.1 Eugenik oder psychologische Konfliktberatung? Vgl. Thurnwald, Gegenwartsprobleme, 1948, S. 211 ff. und S. 226 ff. Vgl. Eßer, Florian: „Die Geschichte der Sozialen Arbeit als Profession“. In: Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online. Fachgebiet Soziale Arbeit, 2011, S. 1– 36, hier S. 25 f. Verfügbar unter: https://www.beltz.de/fachmedien/erziehungswissenschaft/enzyklopaedie_erziehungswissenschaft_ online_eeo.html, besucht am 22. Juli 2022. Vgl. Silies, Liebe, S. 224 ff.
3.1 Eheberatung in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik
69
Zeitgenössisch war die Rede von drei Säulen der Eheberatung: der rein konfessionellen (katholischen), der medizinischen Beratung zur Geburtenregelung und der allgemeinen Eheberatung (inklusive dort vertretener evangelischer Beratungen).⁸ Letztere Verquickung weist darauf hin, dass es vor allem evangelische Akteure waren, die 1949 mit der Gründung der überkonfessionellen Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung versuchten, ihre Konzeption und damit ihr Gesellschaftsbild als maßgeblich für das gesamte Feld zu etablieren. Damit treten die bikonfessionellen Konkurrenzen als erste Konfliktlinie in der Eheberatung hervor, die sie deutlich prägen sollten, auch wenn die Gründung des Katholischen Zentralinstituts für Ehe- und Familienfragen (KZI) erst 1952 erfolgte.⁹ Wie bekannt Beratungsstellen in der Öffentlichkeit waren, lässt sich nicht eindeutig eruieren. Doch ist davon auszugehen, dass zumindest die Einrichtungen, die nicht einer Behörde angegliedert waren, kaum im Bewusstsein einer breiten Bevölkerung waren. Noch 1956 war das rheinland-pfälzische Justizministerium überzeugt, es gebe im eigenen Bundesland keine Eheberatungsstellen.¹⁰ Dabei gingen mindestens zwei katholische Beratungen in Koblenz und Trier sowie eine in Neustadt/Hardt seit der Nachkriegszeit ihrer Tätigkeit nach.¹¹ Vor allem im Bereich der Fürsorge und Medizin herrschte eine hohe personelle Kontinuität, da es an qualifizierten Mitarbeitern mangelte.¹² Eine schwierige Finanzlage und Kompetenzstreitigkeiten zwischen Gesundheits- und Sozialämtern, die sich auf die amtliche Eheberatung bezogen, erschwerten die Arbeit. Diese Auseinandersetzungen verweisen neben der konfessionellen auf eine zweite Konfliktlinie der frühen Eheberatung. Umstritten war, ob die amtliche Beratung unter medizinischer Ägide bleiben sollte, unter der sie in der Weimarer Republik als Bereich der Gesundheitsfürsorge gestanden hatte¹³ und im Nationalsozialismus fortgeführt worden war. Auch in der Bundesrepublik galt dies noch für viele Einrichtungen. In der Nachkriegszeit wünschten sich die Akteure vermehrt ein eigenes Profil für die Eheberatung.
Vgl. Hannes Kaufmann an Bundesjustizministerium, Brief, 23. Juni 1953, BArch, B 141/49456, Bl. 50 ff. Versucht wurde, weitere Differenzierungen innerhalb dieser Säulen vorzunehmen. Vgl. Central Ausschuß für die Innere Mission, Anlage zum Bericht über die Arbeitstagung, 1951, ADE, CAW 1117. Vgl. Kapitel 3.2.1 Vorgeschichte und Gründung sowie Kapitel 4.2.1 Vorgeschichte und Gründung. Vgl. Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz an Bundesminister der Justiz, Stellungnahme, 14. Mai 1956, BArch, B 141/49456, Bl. 77 f. Vgl. o. A.: Niederschrift der Gründung der vorbereitenden Sitzung / eines Kuratoriums für Eheberatung im Bistum Trier, Entwurf, 15. Oktober 1953. AEK, DBK, KZI 28 sowie DAJEB: Jahresbericht 1952. Detmold [1953], S. 9 ff., DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. Sachße/Tennstedt, Geschichte, 2012, S. 164 ff. Vgl. Hering/Münchmeier, Geschichte, 2014, S. 148.
70
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Eng mit der behördlichen Integration der Eheberatung verknüpft war die Frage, welche Art der Beratung die Besucher nachfragten. Es zeigte sich, dass die Ratsuchenden medizinisch-eugenische Tendenzen weitestgehend ablehnten, auch wenn verschiedene Akteure der Eheberatung selbst ihr Angebot mit dieser Ausrichtung aufrechterhalten wollten. Gleichzeitig arbeiteten in der frühen Bundesrepublik unter den Beratern zunehmend Psychologen, die bereitstanden, um Konflikte in bestehenden Ehen zu beraten. In der Eheberatung wurde mit der zunehmenden Präsenz psychologisch ausgebildeter Experten bereits deutlich, dass sich die Psychologie bis in die 1970er-Jahre immer stärker zu einer„therapeutischen Leitwissenschaft“¹⁴ entwickeln würde.
3.1.1 Eugenik oder psychologische Konfliktberatung? Die umstrittene behördliche Anbindung der amtlichen Eheberatung Die amtlichen Eheberatungsstellen suchten sich nach 1945 auf ihre Wurzeln in der Weimarer Republik zu besinnen, teilweise ist aber auch zu beobachten, dass sie an nationalsozialistische Strukturen anknüpften.¹⁵ Dabei nahm Berlin wie in der Vorauch in der Nachkriegszeit eine herausragende Stellung in der Beratungslandschaft ein, die hier eine große Variationsbreite bot. Aber auch in anderen Städten wie Frankfurt, Hamburg und Karlsruhe sind diese Entwicklungen nachzuverfolgen, ebenso wie daraus entstehende Konflikte. Die meisten amtlichen Berliner Eheberatungsstellen waren bei den Gesundheits- oder Sozialämtern der verschiedenen Bezirke untergebracht. Die Gesundheitsämter hatten nach 1945 die Anweisung erhalten, Familien in Schwierigkeiten beizustehen, auch bei „Ehenot“. In den Beratungsstellen für Nerven- und Gemütskranke fanden ebenfalls gesonderte Sprechstunden für Eheberatung statt, die ehrenamtlich tätige Psychologen und Juristen anboten.¹⁶ Im Jahr 1949 hatten zwölf Westberliner Bezirke amtliche Eheberatungsstellen: Charlottenburg, Kreuzberg, Tiergarten, Neukölln, Reinickendorf, Schöneberg, Spandau, Steglitz, Tempelhof, Wedding, Wilmersdorf und Zehlendorf.¹⁷ Sie waren an bereits bestehende Behörden angegliedert. Einzige separate Einrichtung war Charlottenburg, für weitere waren keine Finanzierungsmöglichkeiten vorhanden. Auffällig ist, dass weder die
So die Kapitelüberschrift bei Tändler, Maik: Das therapeutische Jahrzehnt. Der Psychoboom in den siebziger Jahren. Göttingen 2016, S. 34. Vgl. Raphael, Experten, 1998, S. 242 u. 257. Vgl. Senator für Gesundheitswesen Berlin an Medizinaldirektor Gesundheitsamt München, Brief, 9. Juli 1953, LAB, B Rep. 012, Nr. 176. Vgl. im Folgenden Schneider, Ehen, 1998, S. 206 f. sowie Timm, Politics, 2010, S. 235 ff.
3.1 Eheberatung in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik
71
Gesundheits- noch die Sozialämter eine grundsätzliche Neuausrichtung anstrebten. Der Zwang, wegen der Not der Bevölkerung unmittelbar zu handeln, verhinderte Reformen.¹⁸ Gleichzeitig fanden bereits ab 1946 erste Austauschprogramme für Sozialarbeiter mit den USA statt, die einen Methodentransfer zum Ziel hatten. Daran waren auch Eheberater beteiligt. Allerdings scheiterten diese Übertragungsversuche weitgehend.¹⁹ Zwischen Landesgesundheitsamt (LGA) und Hauptsozialamt kam es zu Kompetenzstreitigkeiten über die Eheberatung und deren Ausrichtung. Während das LGA betonte, dass vorbeugende Beratung beziehungsweise eugenische Maßnahmen notwendig seien,²⁰ war das Hauptsozialamt an der Betreuung bei Ehekonflikten interessiert. Auch da sich die höhere administrative Ebene diesbezüglich nicht einig war, unterschied sich die Praxis in den Berliner Einrichtungen in der Folge stark. Die Beratung vor Ort reflektierte jedoch nicht zwangsläufig die Haltung der Vorgesetzten, sondern war ebenso abhängig vom jeweiligen Eheberater. In Schöneberg war beispielsweise eine Beraterin tätig, die Pro Familia nahestand,²¹ während in Steglitz die für Eugenik eintretende Ilse Szagunn arbeitete.²² In Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik wollten einige Ärzte und Eheberater den eugenischen Zuschnitt der Arbeit beibehalten beziehungsweise wieder aufnehmen,²³ auch das LGA. Vertreter des Amtes konstatierten, dass die Nachkriegssituation sich nachteilig auf Ehekandidaten und Jugend auswirke, weshalb sie vorehelicher Beratung und der Ausstellung von Gesundheitszeugnissen Priorität einräumten. Aus diesem Grund bestand das LGA auch darauf, die Eheberatung in der Zuständigkeit des Gesundheitsamtes zu belassen. Zwar sollten Ehepaare in Krisensituationen durchaus Hilfe erhalten, doch gingen die Verantwortlichen davon aus, dass es sich bei Ehekonflikten um vorübergehende Erscheinungen der Kriegsund Nachkriegszeit handele. Die vorbeugende Gesundheitsberatung galt weiter als Grundpfeiler des Eheglücks, um Krisen wegen Krankheiten zu verhindern. In diesem Sinne war aus Sicht des LGA das wichtigste Ziel, nur gesunde Paare heiraten zu lassen.²⁴
Vgl. dazu auch Neuffer, Kunst, 1990, S. 61 ff. Zu den Programmen vgl. ebd., S. 84 ff. Vgl. auch Kapitel 3.5.3 Modell-Beratungsstelle. Zur Haltung des Landesgesundheitsamts vgl. Meyer, Curt: „Eheberatung“. In: Berliner Gesundheitsblatt. Zeitschrift für alle Heilberufe, H. 22, 1950, S. 549 – 551, DZI. Als Bericht ihrer Arbeit vgl. Hirt, Marriage, 1949, LAB, B Rep 012, Nr. 176. Vgl. Grossmann, Sex, 1995, S. 280, Fn. 65. Vgl. auch Kapitel 1.2. Kirchliche Beratungsstellen. Vgl. im Folgenden Schneider, Ehen, 1998, S. 209; Schneider, Einigkeit, 2001, S. 114 ff.; Timm, Politics, 2010, S. 227 f. und S. 236 f. Vgl. Meyer, Eheberatung, 1950, S. 549.
72
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Bald schon zeigte sich das Hauptproblem der eugenischen Beratung. Sie war bei vielen Ratsuchenden diskreditiert, was zu einer geringen Nachfrage nach Gesundheitszeugnissen und insgesamt wenigen Besuchern führte. Der erste Tätigkeitsbericht der Eheberatungsstelle beim Berliner Gesundheitsamt 1948 zog ein nüchternes Fazit, das eine realistische Einschätzung der Situation zeigt: „Der Besuch lässt recht zu wünschen übrig. Hierfür dürfte verantwortlich sein, dass die Bevölkerung aufgrund ihrer schlechten Erfahrung während der Nazizeit wenig Vertrauen zu derartigen öffentlichen Einrichtungen hat und daß die VAB in einer angeblich sehr gut besuchten Frauenberatung konzeptionsverhütende Mittel kostenlos abgibt und so diese Frauen anzieht.“²⁵ Obwohl das LGA beklagte, dass andere Einrichtungen einen hohen Zulauf hätten, zweifelte es die eigene Arbeitsausrichtung nicht an. Einige Bezirksämter folgten dieser Auffassung, allen voran das Gesundheitsamt Charlottenburg, das seine Eheberatungsstelle wenige Wochen nach Kriegsende wiedereröffnete. Dort betrachtete man die „Fortsetzung des nazistischen Aufgabengebietes des Gesundheitsamtes, Erb- und Rassenpflege“, als „jederzeit für die dauernde Betätigung der Verwaltung“ gültig.²⁶ Andere Stellen vermieden es, derart explizit an den Nationalsozialismus anzuknüpfen. Aus Spandau kamen Beschwerden, dass Ratsuchende die dortige Einrichtung nicht wegen eugenischer Fragen, sondern mit Ehestreitigkeiten aufsuchten. Im Jahresbericht 1950 hieß es, es kämen größtenteils Frauen mit der Bitte um Ratschläge, wie sie ihren Mann halten könnten, wenn die Ehe zu zerbrechen drohte. Empört klagten die Eheberater: „Das ist nicht der Sinn und die Aufgabe einer ärztlichen Eheberatung […]. Im Vordergrund haben gesundheitliche Belange zu stehen, nicht Störungen, die durch seelische Einflüsse und Auseinanderleben bedingt sind.“²⁷ Vielfach herrschte noch die Vorstellung, eugenische Bestrebungen seien überzeitliche Werte, losgelöst vom „Dritten Reich“.²⁸ Das Beispiel Charlottenburg verdeutlicht jedoch, dass es auch möglich war, nationalsozialistische Praktiken ausdrücklich fortzuführen. Letztlich untergrub die geringe Nachfrage für eugenische Beratung allerdings deren Ziele, da sie letztlich kaum zur Anwendung kam. Die eugenische Ausrichtung des Berliner Landesgesundheitsamtes stieß auch innerhalb der Verwaltung auf Widerstand, was jedoch nicht bedeutete, dass das grundsätzliche Recht des Staates, das Reproduktionsverhalten zu beeinflussen, in
Bezirksamt Reinickendorf, Situations- und Tätigkeitsbericht des Gesundheitsamtes Reinickendorf Jahr 1948, 31. März 1949, S. 15, LAB, B Rep 012, Nr. 104. Gesundheitsamt Charlottenburg, zitiert nach Schneider, Einigkeit, 2001, S. 214 f. Bezirksamt Spandau: Jahresbericht, 27. Januar 1950, LAB, B Rep 012, Nr. 260. Vgl. auch Bezirksamt Neukölln: Bericht für das II. Quartal 1955, 15. Juli 1955, LAB, B Rep 012, Nr. 130. Vgl. Kapitel 3.2.4 Rassen- und Sozialhygieniker.
3.1 Eheberatung in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik
73
Frage stand.²⁹ Zwischen 1949 und 1951 kam es zu einer Debatte, wie die Eheberatung institutionell verankert werden sollte. Auf oberer Verwaltungsebene wollte das Hauptsozialamt sie als Konfliktberatung bei sich angliedern und setzte dies beispielsweise im Bezirk Schöneberg entsprechend um. Selbst das Hauptjugendamt beteiligte sich und gründete Eheberatungsstellen. Da aber nur wenige Personen die eugenisch ausgerichtete Sprechstunde in Anspruch nahmen, verweigerte der Stadtkämmerer eine substanziellere Finanzierung auch für anders ausgerichtete Angebote. Auf unterer Ebene missfiel vor allem den Fürsorgerinnen der Führungsanspruch des LGA. Die von allen Seiten vorgebrachten Argumente gegen die eugenischen Beratungen des Gesundheitsamts bezogen sich vor allem darauf, dass die Bevölkerung aufgrund vormaliger Erfahrungen misstrauisch sei. Sofern Ratsuchende die eugenische Sprechstunde in Anspruch nahmen, kamen sie in der Regel aufgrund bestehender Krankheiten mit konkreten Fragen. Wie wenig ausgeprägt das Problembewusstsein hinsichtlich eugenischer Beratung bei deren Akteuren teilweise war, zeigt auch das Beispiel der Frankfurter Inneren Mission. Dort fanden ab 1949 Sprechstunden für Eheberatung statt. Die Stelle bewarb ihre Arbeit mit dem bei ihr tätigen und „Ihnen sicher als Erbbiologe gut bekannt[en]“ Otmar Freiherr von Verschuer³⁰, einem Rassenhygieniker. Zudem arbeiteten dort auch ein Mediziner, ein Psychotherapeut und ein Jurist.³¹ Zwei Monate später berichtete von Verschuer auf einer Tagung, dass die Stelle noch einen sehr schwachen Zuspruch habe. Er führte dies darauf zurück, dass Beratungen freiwillig seien. Seiner Ansicht nach wagten zu diesem Zeitpunkt eben nur wenige Menschen über ihren engsten privaten Rahmen hinaus, bei anderen Hilfe zu su Vgl. im Folgenden Schneider, Einigkeit, 2001, S. 208 und 218 ff. sowie Timm, Politics, 2010, S. 236 ff. Otmar Freiherr von Verschuer (16. Juli 1896 – 8. August 1969) engagierte sich bereits während seines Medizinstudiums in völkischen Aktivitäten und beteiligte sich an konterrevolutionären militanten Aktionen. Später arbeitete der Rassenhygieniker eng mit den Nationalsozialisten zusammen. Dennoch betrachteten diese ihn aufgrund seiner engen Verbindung zur evangelischen Kirche, wo er im Eugenischen Arbeitskreis aktiv war, mit Argwohn. Verschuers wissenschaftliches Hauptinteresse galt der Zwillingsforschung. Seine Karriere ließ ihn 1942 bis zum Leiter des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik (KWI) aufsteigen. Bereits früh wurde Verschuer Mitglied des Erbgesundheitsgerichts. 1943 begann er eine Forschungszusammenarbeit mit seinem ehemaligen Doktoranden Josef Mengele, dem SS-Lagerarzt des KZ Auschwitz. Dennoch gelang es Verschuer 1946, als Mitläufer eingestuft zu werden und in die Wissenschaft zurückzukehren. Ab 1951 war der Mediziner als Direktor des Instituts für Humangenetik in Münster tätig. Später engagierte er sich erneut im Eugenischen Arbeitskreis der evangelischen Kirche. Vgl. Weiss, Sheila F.: „Verschuer, Otmar Reinhold Ralph Ernst Freiherr von“. In: Neue Deutsche Biographie, Bd. 26. Berlin 2016, S. 768 – 770 sowie Kaminsky, Dunkel, 2008, S. 209. Vgl. auch Heinemann, Familie, 2023. Vgl. A. Schumacher an Stadtgesundheitsamt, Brief, Stadtarchiv Frankfurt, Stadtgesundheitsamt, 186.
74
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
chen.³² Sein Fazit lautete, die eugenische Beratung müsse letztlich verpflichtend gemacht werden. In Berlin führte dieses mangelnde Problembewusstsein dazu, dass selbst auf Ebene der Amtsärzte die Aufgaben in der Eheberatung teilweise anders definiert wurden als vom LGA vorgegeben. Das Gesundheitsamt Wedding richtete sich beispielsweise mit psychologischem Ansatz auf Ehekonflikte hin aus, obwohl das LGA dieses Vorgehen explizit ablehnte.³³ Das Legitimationsproblem der eugenischen Beratung verstärkte sich, weil deutlich mehr Ratsuchende mit juristischen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen kamen. Die Sozialämter verzeichneten bis 1950 immer stärkeren Zulauf. Allerdings gab es auch dort Klagen über zu geringe Besucherzahlen. Die vielerorts beobachtete Tendenz der Ratsuchenden, nicht mit einem vorehelichen Prüfanliegen, sondern bei konkreten Ehekonflikten Hilfe zu suchen, zeigt sich klar auch in der Praxis der amtlichen Eheberater Berlins. Dies wird an den Monatsberichten der bezirklichen Gesundheitsämter deutlich, die offiziell eugenisch ausgerichtet waren.³⁴ De facto berieten sie aber fast nur bestehende Ehen, in der Regel, indem die Berater zuhörten und allgemeine Ratschläge erteilten. Die Beratung legte beispielsweise einer Ehefrau, die sich über ihren Mann beschwerte, nahe, „sich an dem Positiven (gesunder Ehemann, der Arbeit hat, 2 gutgeratene Kinder) zu freuen, anstatt sich an dem Negativen aufzureiben“.³⁵ In Einzelfällen fanden jedoch auch psychologische Beratungen statt, was das Landesgesundheitsamt ursprünglich nicht zulassen wollte.³⁶ Die beherrschenden Themen bildeten dabei bis in die 1950er-Jahre Wohnungsnot und die Untreue des Mannes. Konnten Berater den Ratsuchenden helfen, hielten sie dies fest: „Zuweilen gelingt es die Ehepartner zur Versöhnung zu veranlassen. Oftmals kann den Ratsuchenden, auch in den für die Fortführung der Ehe aussichtslosen Fällen, durch individuelle Bera-
S. Bornikoel: Bericht über die Tagung „Ehe und Ehelosigkeit in der christlichen Verkündung und Seelsorge“, [8. März 1949], S. 3, ADE, CAW 419. Vgl. z. B. [Bezirksamt] Wedding: Tätigkeitsbericht, 29. Januar 1949, LAB, B Rep 012, Nr. 103 sowie [Bezirksamt] Wedding: Tätigkeitsbericht, 29. November 1949, LAB, B Rep 012, Nr. 38. Vgl. z. B. [Bezirksamt] Zehlendorf: Bericht über die Tätigkeit des Gesundheitsamtes Zehlendorf im Monat November 1948, 18. Dezember 1948, LAB, B Rep 012, Nr. 204 sowie Bezirksamt Zehlendorf: Bericht über die Tätigkeit des Gesundheitsamtes Zehlendorf über die Zeit vom 3. April bis 30. Juni 1949, 5. August 1949, LAB, B Rep 012, Nr. 102. [Bezirksamt] Zehlendorf: Bericht über die Tätigkeit der Abteilung Gesundheitswesen, 22. November 1949, S. 19 f., LAB, B Rep 012, Nr. 106. Vgl. [Bezirksamt] Steglitz: Leistungsbericht des Gesundheitsamtes Steglitz, 16. April 1951, LAB, B Rep 012, Nr. 110.
3.1 Eheberatung in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik
75
tung, die positive Einstellung zum Leben zurückgegeben werden.“³⁷ Die meisten Berater richteten ihre Praxis und Rollendefinition somit an den Bedürfnissen der Betroffenen aus und bestimmten die Zielsetzung amtlicher Eheberatung auf pragmatische Art, auch wenn sie dies dem LGA gegenüber nicht explizit kommunizierten. Ihr Selbstverständnis stimmte somit nicht zwangsläufig mit der Politik der höheren Gesundheitsadministration überein. Damit stand den Ratsuchenden auch in den Gesundheitsbehörden Hilfe im ehelichen Konfliktfall zur Verfügung, anders als es die Rhetorik des LGA vermuten ließ.³⁸ Nicht nur in Berlin, auch in vielen anderen Beratungsstellen waren schon Ende der 1940er- und Anfang der 1950er-Jahre Psychologen tätig, beispielsweise in Frankfurt und Karlsruhe. In der Nachkriegszeit avancierte die Soziale Arbeit zu einem der ersten fest umrissenen Arbeitsgebiete für praktische Psychologen, besonders die privaten und kommunalen Erziehungsberatungsstellen.³⁹ Für die Eheberatung lässt sich diese Tendenz ebenfalls ablesen. Dies zeugt von der Erkenntnis, dass es hier eines anders gelagerten Wissens bedurfte, als es die juristische oder medizinische Beratung leisten konnte. Auch in dieser Hinsicht war die Entwicklung der Berliner Eheberatungsstellen beispielhaft. Im Übrigen machte sich die Psychologie als angewandte Wissenschaft der „Menschenführung“ zunehmend auch in der Sozialen Arbeit bemerkbar.⁴⁰ Der Arzt des Hauptgesundheitsamtes Bremen hatte sich ebenfalls zum Ziel gesetzt, auf psychologischer Basis Eheprobleme zu lösen.⁴¹ Nach der Diskussion um die Legalisierung der heimlichen Abtreibungspraxis entstand 1948 eine Eheberatungsstelle, die sich ein breites Profil gab: Sie sollte vorehelich-präventiv, zu Geburtenregelung und bei Ehekonflikten beraten. Die meisten Besucher kamen wegen Schwangerschaftsunterbrechung und Verhütung. Nach abgelehnten Interruptionsanträgen konnten Frauen wirtschaftliche Hilfe zwischen 10 bis 200 DM erhalten. Den größten Konfliktstoff stellten wie andernorts die Untreue des Ehemannes und psychische Störungen sowie Alkohol dar. Zwischen 1948 und Ende 1954 wurden insgesamt 2.208 Fälle in der Kartei verzeichnet. Die Zahl der Sprechstundenberatungen war allerdings größer, findet sich jedoch nicht in der Dokumentation. Ratsuchende waren, in absteigender Reihenfolge, entweder angestellt, in freien Berufen tätig, Studenten oder Arbeiter. Je nach
[Bezirksamt] Zehlendorf: Bericht über die Tätigkeit der Abteilung Gesundheitswesen, 23. Dezember 1949, S. 17, B Rep 2, Nr. 106. Vgl. auch [Bezirksamt] Charlottenburg: Tätigkeitsbericht, 11. März 1949, LAB, B Rep 012, Nr. 103. Vgl. Timm, Politics, 2010, S. 229, S. 241 f. und S. 254 f. Vgl. Tändler, Jahrzehnt, 2016, S. 99 f. Ebd., S. 12. Vgl. im Folgenden Gemeinhardt, Eheberatung, 1956, S. 16 ff.
76
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Jahr lag die Arbeitslosenzahl zwischen 28 und 43 Prozent. Das Budget betrug 1949 über 11.000 DM. Wegen ihrer Ausrichtung stand die Einrichtung unangefochten unter medizinischer Hoheit: Zwei Familienfürsorgerinnen arbeiteten dort unter ärztlicher Leitung. Maßgebend waren nach eigenen Angaben die Vorstellungen des Rassen- und Sozialhygienikers Carl Coerper.⁴² Gleichzeitig beobachtete man auch hier, dass das Verständnis der Besucher für Eugenik abnahm. In einer sozialhygienischen Dissertation über die Eheberatungsstelle Bremen schloss der Autor wehmütig: „Jeder Eheberater hegt den stillen Wunsch, vorwiegend Beratungen vor der Ehe durchzuführen. Aber wie anderswo muss man auch in der Bremer EBSt [Eheberatungsstelle] enttäuscht hinnehmen, dass das Verhältnis umgekehrt ist.“⁴³ In Berlin konnte die anhaltende Debatte um die behördliche Anbindung der Beratung auf Leitungsebene nicht gelöst werden. Spätestens 1953 musste das LGA zugeben, dass es seine Interessen nicht hatte durchsetzen können, hoffte allerdings weiterhin, ein künftiges Ehegesetz werde die Beratung in die Zuständigkeit des Gesundheitsamtes einordnen. Zwar hielt sich noch länger eine Kontinuität eugenischen Denkens,⁴⁴ doch die vorbeugende Gesundheitsfürsorge verlor zunehmend an Bedeutung. Dazu trug auch bei, dass der Gesundheitszustand der Bevölkerung sich stabilisierte. Die Medizin entwickelte neue Heilungsmöglichkeiten, die sich auch verbreiteten. Schließlich verdrängte die zunehmende Privatisierung des Gesundheitssektors diese Art der präventiven Fürsorge endgültig.⁴⁵ In Frankfurt sind in der Nachkriegszeit ähnlich gelagerte Konflikte um die behördliche Einordnung der Eheberatung zu beobachten. Auch hier setzte das Gesundheitsamt alles daran, die Beratung weiter zu nutzen, um eugenische Eingriffe in die Partnerwahl vornehmen zu können. Schon während der Zeit des Nationalsozialismus hatte das Gesundheitsamt Eheleute beraten und wollte diese Arbeit fortsetzen. Nun erhob aber das Jugendamt ebenfalls Anspruch darauf, Eheberatung anzubieten. Das Gesundheitsamt plante, die Arbeit in Form der Abteilung „Erbpflege“ fortzuführen, die es bereits während der Zeit des Nationalsozialismus gegeben und deren Arbeitsgebiet sich nach dem Krieg nicht wesentlich geändert hatte. Dies verschwieg die Behörde jedoch. Dort hieß es, man führe „seit 1945 wie bereits vor 1933“ Eheberatung durch.⁴⁶ Hingegen strebte das Jugendamt eine sozi-
Zu Coerper vgl. 2.3.4.2 Carl Coerper. Die Beratungsstelle wurde 1949 Mitglied der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung, der Leiter war zudem Mitglied bei Pro Familia. Gemeinhardt, Eheberatung, 1956, S. 46. Bis 1956 erbaten nur zehn Personen aufgrund konkreter Fragen eine eugenische Beratung. Vgl. Oheim, S. 58 ff. und 378 ff. Vgl. Sachße/Tennstedt, Geschichte, 2012, S. 183. Schmith an Minister des Innern, Brief, 14. April 1950, Stadtarchiv Frankfurt, Stadtgesundheitsamt, 186. Auch Franka Schneider stellt fest, dass Nationalsozialismus und Krieg in der Wahrneh-
3.1 Eheberatung in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik
77
alpädagogische Ausrichtung an. Der Leiter des Jugendamtes hatte die Arbeit in einem „gewissen, wenn auch nicht ausgesprochenen Gegensatz zu seinem Vorgänger […] ausgebaut“.⁴⁷ Das Gesundheitsamt definierte Eheberatung nach wie vor als medizinische Hilfestellung vor der Heirat, erweiterte das Angebot allerdings um Sprechstunden mit einer Psychologin und sexuelle Beratung im Bedarfsfall. Die Besucherzahl lag bei etwa 200 Personen im Monat.⁴⁸ Die laufenden Kosten für die Abteilung betrugen 1948 9.000 DM.⁴⁹ Die auffallend hohe Zahl an Ratsuchenden ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Eheberatung auch materielle Hilfe gewährleisten konnte. Aus Sicht des Gesundheitsamtes war es folglich nicht notwendig, die „mit bestem Erfolg bei ständig steigender Frequenz“ stattfindenden Beratungen dem Jugendamt zu überlassen.⁵⁰ Die Eheberatung verblieb damit bei der Gesundheitsbehörde. Ähnlich wie in Frankfurt gab es auch in Hamburg Bemühungen, die Eheberatung an das Gesundheitsamt anzubinden. Im August 1946 öffnete die Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute wieder, die 1933 geschlossen worden war.⁵¹ Die Gesellschaft der Freunde des Rechtsauskunftswesens und des Güteverfahrens hatte sie ursprünglich 1925 eingerichtet. Mit ihrer als ganzheitlich zu beschreibenden Ausrichtung unterschied sie sich sowohl von der eugenischen als auch der Sexualberatung.⁵² Nicht Krisenberatung, sondern vorbeugende Eheberatung galt als
mung der Eheberatung häufig eine eigenartige Leerstelle bildeten. Vgl. Schneider, Einigkeit, 2001, S. 217. Schmith an Prestel, Brief, 3. Februar 1949, S. 2, Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main (Stadtarchiv Frankfurt), Stadtgesundheitsamt, 186. Vgl. Der Magistrat: Errichtung einer Ehe- und Sexualberatungsstelle, 3. April 1947, Stadtarchiv Frankfurt, Magistratsakten, 8877. Vgl. Der Magistrat: Errichtung einer Ehe- und Sexualberatungsstelle, Dezember 1948, Stadtarchiv Frankfurt, Magistratsakten, 8877. Im Jahr 1948 entsprach 1 DM einer Kaufkraft von ca. 2,56 Euro im Jahr 2019. Vgl. Deutsche Bundesbank: Kaufkraftäquivalente historische Beträge in deutschen Währungen. Januar 2020. Verfügbar unter: www.bundesbank.de/resource/blob/615162/3334800 ed9b5dcc976da0e65034c4666/mL/kaufkraftaequivalente-historischer-betraege-in-deutschen-waeh rungen-data.pdf, besucht am 22. Dezember 2020. Stadtrat an Hier, Brief, 19. Mai 1949, Stadtarchiv Frankfurt, Stadtgesundheitsamt, 186. Vgl. Lottig, E[milie]: Niederschrift über eine Arbeitssitzung der Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute, 25. September 1946, Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg (Staatsarchiv Hamburg), 352– 6 Gesundheitsbehörde, 1057. In den Akten des Staatsarchivs Hamburg ist das Gründungsjahr 1925 vermerkt, während Nevermann von 1926 ausgeht. Im Folgenden wird vom Gründungsdatum 1925 ausgegangen. Vgl. Sozialbehörde an Präsidenten der Gesundheitsbehörde, Brief, 14. Juli 1952, Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1057 sowie Nevermann, Eheberatung, 1931, S. 61.
78
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Hauptaufgabe.⁵³ Etwa zwei Jahre nach ihrer Gründung zog die Einrichtung räumlich in die Gesundheitsbehörde um, mit der sie eng zusammenarbeitete, ohne ihr jedoch unterstellt zu sein. Die ursprünglich rein juristische Ausrichtung erweiterte sich damit stark. Die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter umfassten neben Juristen auch Mediziner und Theologen. Die Hamburger Stelle galt vielen als Vorbild und inspirierte Neugründungen in Berlin, Köln, Kiel und Lübeck.⁵⁴ Die hauptamtliche Mitarbeiterin der Vertrauensstelle begrüßte ausdrücklich, dass die Stadt im Juli 1948 in der Gesundheitsverwaltung eine neue Beratungsstelle schuf. Trotz der medizinischen Ausrichtung verstehe man Eheberatung gemeinsam als „Seelsorge“.⁵⁵ Tatsächlich lagen die Interessen ähnlich. Ungewöhnlich für Verantwortliche im öffentlichen Gesundheitsdienst war, dass sie der Sexualberatung offen gegenüberstanden, auch hier in Übereinstimmung mit der Vertrauensstelle.⁵⁶ Mit ihrer Beratungsstelle für Gesundheits-, Ehe- und Lebensfragen griffen die Akteure damit auf eine vor 1933 bestehende Tradition zurück.⁵⁷ Ob das auch eugenische Aspekte betraf, lässt sich aus den vorliegenden Materialien nicht ersehen. Explizit thematisiert findet sich Eugenik nicht. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Einrichtungen verlief somit von Beginn an allem Anschein nach harmonisch. In Hamburg waren auch die personellen Kontinuitäten besonders ausgeprägt: Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete teilweise dasselbe Personal in der Beratungsstelle wie in der Weimarer Republik. Dazu zählte auch der Vorsitzende, der zudem die Leitung der öffentlichen Rechtsauskunfts- und Vergleichsstelle innehatte. Letztere knüpfte explizit an die „alte Tradition“ vor 1933 an.⁵⁸ Vertrauensstelle und Rechtsauskunft arbeiteten erneut eng zusammen, wobei die finanziellen Mittel von der Vertrauensstelle kamen. Beiden ging es darum, „die Würde des Menschen in diesen persönlichsten aller Beziehungen wahren zu helfen“.⁵⁹ Mit etwa zehn Mit-
Vgl. Oberinspektorin: Protokoll, 27. März 1953, Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1057. Vgl. Nevermann, Eheberatung, 1931, S. 61 ff; Kaufmann, [Hannes]: Aus der Praxis einer Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute, o. D., Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1057. Emilie Lottig an Gemsjäger, Brief, 23. Juli 1948, Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1057. Vgl. Obermedizinalrat, Aktenvermerk, 6. Mai 1952, Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1057. Vgl. DAJEB: Umfrage, 17. Oktober 1950, Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1061. Oberfürsorgerin: Besprechung mit dem Leiter Rechtsauskunfts- und Beratungsstelle der Sozialbehörde am 24. Juni 1948, 7. Juli 1948, Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1057. Lottig, E[milie]: Niederschrift über eine Arbeitssitzung der Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute, 25. September 1946, Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1057.
3.1 Eheberatung in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik
79
arbeitern war die Stelle dreimal die Woche zwei Stunden geöffnet.⁶⁰ Im Jahr 1952 wurde die bisher von einem Verein getragene Einrichtung vollständig an die Rechtsauskunft angegliedert.⁶¹ Der „Verein für Eheleute und Verlobte e. V.“ wiederum schloss sich Pro Familia an.⁶²
3.1.2 Beratungsanlässe, Ausbau der Arbeit und weitere Beratungsstellen Die Beratungsanlässe unterschieden sich teilweise zwischen den Stellen, was auch auf deren unterschiedliche Ausrichtung zurückzuführen war. Insgesamt treten jedoch zwei Tendenzen hervor: Die Probleme der Nachkriegsgesellschaft wirkten sich auf Ehen aus, und der Leidensdruck Ratsuchender war teils groß. Außerdem suchten immer mehr Menschen die Beratungsangebote auf, sodass die Arbeit einiger Stellen sich ausweitete und sie eine bessere Ausstattung erhielten. Hoch frequentiert waren diejenigen Beratungen, die materielle Hilfe anbieten konnten oder sich zunehmend auf psychologische Ansätze hin ausrichteten, wenig Besucher kamen in die amtliche eugenische Sprechstunde. Ganz oben auf der Liste der Beratungsanlässe standen Heimkehrerprobleme. Damit konfrontierte Ehen erwiesen sich als besonders krisenanfällig, kommentierte etwa die Beraterin, die in der Stelle der Arbeiterwohlfahrt in Berlin arbeitete. Sie führte die Schwierigkeiten darauf zurück, dass alle infolge des Krieges psychisch stark erschöpft seien: „Es scheint so, als hätten die Menschen nicht mehr die seelische Kraft, die notwendig ist, um Spannungen, wie sie wohl in jeder Ehe auftreten, zu überwinden oder auszutragen […]. Es ist erschütternd sehen zu müssen, wie lächerlich kleine Mißverständnisse der Anfang ernster Ehekrisen sind.“⁶³ Diese Einschätzung verdeutlicht nicht nur die psychische Situation Ratsuchender, sondern auch, wie betroffen die Eheberaterin davon war. Auch die Psychologin, die in der 1947 eingerichteten Beratungsstelle des Berliner Frauenbunds fest angestellt war, stellte fest, dass mehrere der beratenen Männer Heimkehrer seien, die mit
Vgl. ebd. Vgl. Gerhard Schulz an Präsidenten der Gesundheitsbehörde, Brief, 14. Juli 1952, Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1057. Vgl. Hannes Kaufmann an Bundesjustizministerium, Brief, 23. Juni 1953, BArch, B 141/49456, Bl. 50 ff. Thicken, Hanna: „Aufgaben der Eheberatung“. In: Neues Beginnen 3 (1952), Nr. 6, S. 3, DZI.
80
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
ihren Ehefrauen nicht mehr zurechtkämen.⁶⁴ Der Bund organisierte auch Vorträge und Diskussionen, unter anderem zu Erziehung und Ehe. Auch die ehrenamtliche Beraterin der in Detmold 1947 gegründeten Beratungsstelle für seelische Konflikte beobachtete in zahlreichen Fällen, wie schwer es Heimkehrern fiel, wieder in den Alltag zurückzufinden. Die Beraterin hatte ein Dienstzimmer in der Sozialverwaltung. Sie hatte in ihrer Zeit als Eheberaterin Erfahrungen beim Berliner Bezirksamt Prenzlauer Berg gesammelt, wo sie bis 1933 tätig gewesen war, und fasste ihre Arbeit als überparteilich und überkonfessionell auf. Sie war überzeugt, dass allein die Tatsache, sich aussprechen zu können, vielen Besuchern bereits Erleichterung bringe: „In den meisten Fällen konnte durch wiederholte Aussprachen, die oft an sich schon von den Ratsuchenden […] als Wohltat empfunden wurden, zur Lösung menschlicher Konflikte und zur Schlichtung von Spannungen beigetragen werden […]. Es handelt sich also […] um den gelungenen Versuch, durch rein menschliches Eingehen auf jeden einzelnen Fall, zu helfen.“⁶⁵ Ebenfalls in diesen Themenkreis gehörten Probleme, wie sie die in der Karlsruher Vertrauensstelle arbeitende Psychologin beobachtete. So beschrieb sie Ehekonflikte um Haushaltsgeld, das Ehemänner benützten, um sich wieder ihre alte Rolle zu sichern.⁶⁶ Hier wird sichtbar, wie die Umwälzungen der Kriegs- und Nachkriegszeit dazu geführt hatten, den Mann als Autoritätsperson zu hinterfragen. Jahrelang hatten die Frauen allein gewirtschaftet, entschieden und teilweise auch Geld verdient, während sie nun wieder nach den alten Verhältnissen leben sollten. Die Karlsruher Stelle war in ihrer Ausrichtung vom Club berufstätiger Frauen geprägt. Dieser gründete und erweiterte die Beratungseinrichtung. Die Mitbegründerin des Clubs war vormals als Juristin in Hamburg tätig gewesen, deshalb waren ihr die Sühneversuche der dortigen Vertrauensstelle bekannt.⁶⁷ Zuvor hatte bereits eine engagierte Juristin, die auch Erfahrung in Psychotherapie hatte, einmal
S. Berliner Frauenbund 1947: Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 1. April 1948 bis 31. März 1949, April 1949, S. 9, LAB, B Rep 235 – 07, Nr. 308. Zum Berliner Frauenbund vgl. auch Schneider, Ehen, 1998, S. 216 sowie Timm, Politics, 2010, S. 236. Sozialverwaltung Kreis Detmold an Stadtverwaltung Karlsruhe, Brief, 21. Mai 1949, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188. Vgl. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe]: [Tätigkeitsbericht], [1966], S. 2, Eheberatung Karlsruhe sowie Interview mit Dr. Alice Haidinger, ehemalige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Vertrauensstelle für Jugend- und Eheberatung, Karlsruhe, persönliche Kommunikation, 30. und 31. Mai 2017. Vgl. Klaas, Andrea: „50 Jahre Eheberatung in Karlsruhe – eine Erfolgsstory“. In: Ehe-, Familienund Partnerschaftsberatungsstelle (Hrsg.): 50 Jahre Eheberatung in Karlsruhe. Karlsruhe 2003, S. 7– 23, hier S. 8.
3.1 Eheberatung in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik
81
wöchentlich eine provisorische Beratung angeboten.⁶⁸ Nach Einschätzung der Stadtverwaltung arbeitete sie „recht gut“. Die Stadt selbst sah zuerst nicht die Notwendigkeit, eine institutionalisierte Stelle einzurichten. Sie betrachtete dies als Aufgabe der Wohlfahrtsorganisationen, auch, „da erfahrungsgemäss eine amtliche Einrichtung, die das Privatleben berührt[,] weniger gern in Anspruch genommen wird“.⁶⁹ Dennoch beteiligte sich die Stadt bald am Ausbau der Stelle mit dem Ziel, die Eheberatung zu professionalisieren und zu erweitern. Zwei Büroräume und die Halbtagsarbeit einer Akademikerin sollten dies unterstützen.⁷⁰ Die Stadt übernahm die Finanzierung der Beratung nach längeren Verhandlungen weitgehend mit 2.400 DM jährlich ab Mitte 1952.⁷¹ Bereits im darauffolgenden Jahr erhöhte sich der Zuschuss um 1.200 DM.⁷² Zuvor war das Budget kleiner als erhofft, sodass die Arbeit im November 1951 in geringerem Umfang begann als geplant. Anfangs betrug der monatliche Etat 255 DM. Er stammte vom Wohlfahrtsamt und aus Beiträgen ab 10 DM monatlich, die der Club berufstätiger Frauen und diverse weitere Vereinigungen zur Verfügung stellten.⁷³ Als die Stelle später vergrößert wurde, standen dort eine Juristin, eine Medizinerin, eine Volkswirtin und ein ehemaliger Bundesrichter den Ratsuchenden zur Verfügung.⁷⁴ Es waren meist Frauen, welche die angebotenen acht Beratungsstunden die Woche⁷⁵ nutzten und zum Teil stundenlange Fahrten auf sich nahmen.⁷⁶ Wie in der Vertrauensstelle in Hamburg fanden auch in Karlsruhe Vorträge statt.⁷⁷ Die Mitarbeiter bildeten sich vor allem über evangelische Angebote fort.⁷⁸ Bei der Gründung hatte eugenische Beratung keine Bedeutung. Auch die städtischen Behörden ließen keinerlei Interesse in diese Richtung erkennen. Vgl. Klaas, Jahre, 2003, hier S. 7– 9 und S. 16. Mayer an Stadtverwaltung, Brief, 13. Juni 1949, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188. Vgl. Anneliese Schroeder an Stadtverwaltung, Brief, 2. April 1951, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/HReg., Nr. 5188. Vgl. Gutenkunst an Direktor Wohlfahrtsamt, Brief, 3. Oktober 1951, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/ SJB, Nr. 31 sowie Städtische Sozialverwaltung, Haushaltsplan 1952, Beschluß, 26. Juli 1952, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/SJB, Nr. 31. Städtische Sozialverwaltung: Beschluß, 21. August 1953, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/SJB, Nr. 31. Vgl. [Alice] Haidinger an Stadtverwaltung Karlsruhe, Brief, 20. Oktober 1951, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188. Vgl. Klaas, Jahre, 2003, S. 8. Vgl. Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute: Plakat, [1951], Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/SJB, Nr. 31. Vgl. L. P.: „Wenn es in der Ehe ‚kriselt‘. In: B[adische Neueste Nachrichten], 13. Februar 1952, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188. Vgl. Club für berufstätige Frauen Karlsruhe: Einladung, 9. Juni 1951, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/ SJB, Nr. 31. Vgl. Klaas, Jahre, 2003, S. 9.
82
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
In der Göttinger Stelle unter Guido Groeger spielte männliche Untreue als konkreter Beratungsanlass eine wesentliche Rolle. Bei solchen akuten Krisen herrschte unter Beratern die Ansicht, dass sie erfolgreich bearbeitet werden konnten. Auch frühzeitige Beratung sei wichtig. Die meisten Besucher waren Frauen mittleren Alters und schon lange verheiratete Ratsuchende.⁷⁹ Groeger beobachtete häufig Ehekonflikte, die entstanden, weil die Partner sich nicht als geistige Gemeinschaft fühlten. Eine prozentuale Angabe machte er dazu aber nicht. Die evangelische Beratungsstelle Düsseldorf hielt fest, 10 Prozent der Besucher kämen mit Fragen zu Geburtenregelung und Sexualität. Der Leiter sah darin den Beweis, dass diese Fragen die Eheleute selten beschäftigten. Die geringe Zahl zeugte ihm zufolge von dem Gefühl, die Ursachen von Schwierigkeiten nicht allein in den technischen Dingen suchen zu können.⁸⁰ Dass die Ratsuchenden möglicherweise in der evangelischen Einrichtung nicht den richtigen Ort für Fragen zu den genannten Themen sahen, stand nicht sichtbar zur Debatte. Derselbe Berater bezeichnete außerdem die Zahl der in die Sprechstunden kommenden „Perversen, also […] Homosexuellen, Exhibitionisten und andere“ als erheblich.⁸¹ Sexualität, die nicht der Norm entsprach, floss nicht in die Statistik ein, sondern galt als Perversion. Weitere Stellen beschrieben ähnliche Eheprobleme wie in Göttingen, Detmold und Karlsruhe. Die Beratung der „Arbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege“ war im Sozialamt Schöneberg untergebracht und plante, eng mit den amtlichen Einrichtungen zusammenzuarbeiten. Die Schöneberger Stelle führte Konflikte vor allem auf die lange Trennung von Paaren, gesundheitliche und seelische Kriegsfolgen, die Wirtschaftslage sowie die Berufstätigkeit von Ehefrauen zurück.⁸² In der Hamburger Vertrauensstelle, wo die Beratung juristisch orientiert war, suchten die meisten Besucher entsprechend rechtlichen Rat zu Scheidungsfragen. Ehebruch, d. h. Untreue, war oftmals der Grund.⁸³ Nach eigener Einschätzung verhinderte die Vertrauensstelle etwa ein Drittel der Scheidungsfälle.⁸⁴ Dennoch
Vgl. o. A., „Eheberatungsstelle“, S. 343, DZI. Groeger, Verfahren, 1955, S. 6, DZI. Ebd., S. 11. Vgl. Schneider, Ehen, 1998, S. 206. Vgl. Lottig, E[milie]: Niederschrift über eine Arbeitssitzung der Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute, 25. September 1946, Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1057. Für den Zeitraum 1951– 1953 wird dabei von insgesamt 334 verhinderten Scheidungen ausgegangen. Für 1958 liegen genauere Zahlen vor.Von 1.190 bearbeiteten Fällen konnten 270 (22,7 Prozent) versöhnt werden. Zu Scheidung wurde in 199 Fällen geraten, davon abgeraten in 127. Die Zurücknahme des Scheidungswunsches wurde von der Vertrauensstelle allerdings nur als vorläufiges Ergebnis betrachtet, da sich die Ehesituation langfristig auch wieder verschlechtern konnte. Vgl. Krapp, Untersuchung, S. 23 f.
3.1 Eheberatung in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik
83
musste sie sich gegen die Annahme verteidigen, nicht unbedingt erfolgreich zu sein, denn der Geschäftsführer Hannes Kaufmann formulierte: „Gewiss gelingt es in vielen Fällen, zerrüttete Ehen wieder in Ordnung zu bringen oder wenigstens anständige Formen des Zusammenlebens zu finden. Die Arbeit hat mehr Aussicht auf Erfolg, als im allgemeinen angenommen wird.“ Den Beratern war wichtig, im Fall einer Scheidung dafür zu sorgen, dass diese „in anständigen Formen vor sich geht“. Ähnlich wie in Detmold propagierte die Stelle in Hamburg damit ein personales Beratungsverständnis. Doch das wichtigste Ziel war es, ein Ort zu sein, „wo verbitterte und verzweifelte Menschen, die sich und anderen keine Gerechtigkeit mehr widerfahren lassen, sich aussprechen können“. Die wichtigste Methode war auch hier folglich „Zuhören können!“. Wie bereits im Namen der Vertrauensstelle sichtbar, wollten die Berater Vertrauen erwecken, weniger mahnen oder Rat geben. Dabei verstanden sie sich als „Fürsorger der Seele“.⁸⁵ Ob sie diesen Anspruch an das eigene Selbstverständnis in der Praxis erfüllten, lässt sich wegen mangelnder Quellen nicht überprüfen. Doch reflektierte die Vertrauensstelle bereits früh, „[w]elche Anforderungen Ratsuchende in der Praxis stellen“.⁸⁶ Auf Behördenebene hinterließ die Einrichtung den Eindruck, ihre Aufgaben „sehr ernsthaft“ zu erledigen.⁸⁷ Im Herbst 1947 organisierte sie eine erste Tagung,⁸⁸ danach fanden regelmäßig weitere Fortbildungen statt.⁸⁹ In Hamburg stieg die Zahl der Beratungsfälle von 116 im Anfangsjahr auf 911 im Jahr 1951.⁹⁰ Von 1953 an nahm die Besucherfrequenz erneut stark zu und blieb anschließend bis 1958 konstant bei etwa 1.100 bis 1.200 Fällen und ca. 2.000 Beratungen. Nach eigener Einschätzung gelang es der Eheberatung 1951, in 20 Prozent der über Gerichte eingeleiteten Sühneverfahren eine Versöhnung zu erreichen.⁹¹ Kaufmann, [Hannes]: Aus der Praxis einer Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute, o. D., S. 2 f., Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1057. E[milie] Lottig: Einladung zur Jahresversammlung der Mitglieder des Vereins „Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute e. V.“, 23. Juli 1948, Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1057. Röder, Aktennotiz, 3. August 1948, Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1057. Vgl. Kaufmann, [Hannes]: Aus der Praxis einer Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute, o. D., Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1057. Vgl. z. B. Verband der Rechtsauskunftsstellen e. V.: Einladung, 02. Dezember 1948, Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1057 sowie Emilie Lottig, Plakat, 26. Mai 1950, Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1057. Vgl. Gerhard Schulz an Präsidenten der Gesundheitsbehörde, Brief, 14. Juli 1952, Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1057. Von der Wiedereröffnung bis 1953 nahm die Besucherfrequenz stark zu und blieb anschließend bis 1958 konstant bei etwa 1.100 bis 1.200 Fällen und ca. 2.000 Beratungen. Vgl. Krapp, Untersuchung, 1958, S. 22. Vgl. Hannes Kaufmann an Bundesjustizministerium, Brief, 9. August 1951, BArch, B 141/49456, Bl. 40 ff.
84
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Auch hier zeigte sich die ebenfalls in Karlsruhe zu beobachtende Tendenz, die Beratungsarbeit auszubauen.
3.1.3 Die Nachfolge der Sexualberatung Die in der Weimarer Republik erfolgreichen Sexualberatungsstellen lebten in ihrer ursprünglichen Form nicht erneut auf.⁹² Zwar bemühten sich einige Ärzte, diese Praxis fortzuführen. In Frankfurt beispielsweise beantragte die KPD, die bis zum „Dritten Reich“ bestehende Ehe- und Sexualberatungsstelle, die insbesondere unsachgemäße Abtreibungen verhindern sollte, wieder zu öffnen.⁹³ Damit griff auch sie auf vormalige Ansätze zurück, allerdings in der Tradition der Arbeiterbewegung der Weimarer Republik. Die Initiative der KPD blieb vermutlich erfolglos, zumindest findet sich in den gesichteten Quellen kein Hinweis auf die gewünschte Einrichtung. Geburtenregelung und Sexualberatung hatten weiterhin einen schlechten Ruf, auch wegen deren. Die Sexualberatungsstellen fanden allerdings eine Nachfolge in der 1952 gegründeten Familienplanungsorganisation Pro Familia.⁹⁴ Diese hatte ihren Ursprung in einer internationalen Konferenz der Sexualreformer in Zürich 1930 und war aus der US-amerikanischen Vereinigung Planned Parenthood hervorgegangen. Ihr wichtigstes Ziel war es, Zugang zu Geburtenkontrolle und Familienplanung zu ermöglichen. Da sie Verhütungsmittel ausgab, waren in der Organisation fast ausschließlich Mediziner tätig. In der Beratungslandschaft spielte Pro Familia lediglich eine untergeordnete Rolle und zählte nur wenige Einrichtungen.⁹⁵ Auch über Pro Familia hinaus gab es einige Angebote, die sich mit dem Thema Familienplanung befassten. Die Beratungsstelle der Arbeiterwohlfahrt in Bremen zählte vor allem Schwangere mit Abtreibungswunsch zu ihren Besuchern. Daneben
Vgl. im Folgenden Grossmann, Sex, 1995, S. 201 sowie Silies, Liebe, 2010, S. 234 ff. Vgl. KPD Kreisleitung Frankfurt an Auth, Eingabe, 20. Februar 1947, Stadtarchiv Frankfurt, Stadtgesundheitsamt, 186. Zu Pro Familia neu erschienen: Roesch, Claudia: Wunschkinder. Eine transnationale Geschichte der Familienplanung in der Bundesrepublik Deutschland. Göttingen 2021. Erst 1961 erfuhr Pro Familia einen enormen Aufschwung mit der Einführung der„Pille“. Da diese verschreibungspflichtig war, suchten interessierte Frauen zunehmend die Familienplanungsorganisation auf. Staatlich unterstützt wurde eine Einrichtung von Pro Familia erstmals 1965. Bis Ende der 1960er-Jahre distanzierten sich die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung und die konfessionellen Verbände von Pro Familia, da sie deren Beratungsmethoden als zu einseitig betrachteten. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 335 ff. Zur Sicht des Familienministeriums auf Pro Familia vgl. Große-Schönepauck, H[elene]: Die Eheberatung in Deutschland und in anderen Ländern, [1969], S. 811 f., BArch, B 189/2807, Bl. 265 ff.
3.1 Eheberatung in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik
85
berichtete die dortige Beraterin vor allem von Gesprächen zu Geburtenregelung und Ehekonflikten.⁹⁶ Amtliche Berliner Beratungsstellen verwiesen bei Fragen zu Verhütung in der Regel auf die Versicherungsanstalt Berlin (VAB).⁹⁷ Umgekehrt leitete die VAB fürsorgerische und psychiatrische Fälle an die Gesundheitsämter weiter. Die Versicherung hatte mindestens fünf Frauenberatungsstellen gegründet, die auf Sexualberatung fokussiert waren und bereits in der Weimarer Republik bestanden hatten. Ihr Ziel war es, Abtreibungen zu reduzieren und finanzielle Verluste aufgrund der gesundheitlichen Folgen zu verringern.⁹⁸ Schwangerschaftsabbruch war verboten, es sei denn, Leib und Leben der Mutter befanden sich in unabwendbarer Gefahr.⁹⁹ Bei illegaler Durchführung drohten denjenigen, welche den Eingriff vornahmen, bis zu zehn Jahre Gefängnis, den Frauen drei bis fünf Jahre. Unmittelbar nach Kriegsende war die Zahl illegaler Abtreibungen aufgrund der Massenvergewaltigungen jedoch hoch.¹⁰⁰ Das hatte zu Diskussionen um eine Lockerung des § 218 geführt. Im Mai 1945 waren Abbrüche per Sonderregelung für vergewaltigte Frauen legalisiert worden.¹⁰¹ Die Behörden genehmigten in den ersten Monaten der Besatzung Abtreibungen großzügiger oder duldeten sie zumindest inoffiziell.¹⁰² Langfristig blieb das Verbot allerdings weiter in Kraft, Ende 1946 wurde die Sonderregelung aufgehoben. Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche war dennoch hoch, da es kaum Zugang zu empfängnisverhütenden Mitteln gab und Sexualität nach wie vor tabuisiert war.¹⁰³ Schätzungsweise trieben in den 1950erJahren jährlich eine halbe bis eine Million Frauen ab.¹⁰⁴ An den häufig auftretenden Komplikationen starben, ebenfalls jährlich, etwa 10.000 Frauen.¹⁰⁵
Thicken, Hanna: „Aufgaben der Eheberatung“. In: Neues Beginnen 3 (1952), Nr. 6, S. 3, DZI. Vgl. Timm, Politics, 2010, S. 236 und S. 243. Zeitgenössisch vgl. Bezirksamt Spandau an Landesgesundheitsamt, Brief, 26. Juli 1949, LAB, B Rep. 012, Nr. 260. Vgl. Soden, Sexualberatungsstellen, 1988, S. 113 f. sowie Timm, Politics, 2010, S. 110 ff. sowie Grossmann, Sex, 1995, S. 41 ff. und S. 189 ff. sowie zeitgenössisch Parow-Souchon, Eva: „Eheberatung in Berlin“. In: Volksgesundheitsdienst 9/1951, S. 231– 232, DZI. § 218 StGB. Zur Diskussion um diesen Paragrafen vgl. auch Gante, Michael: § 218 in der Diskussion. Meinungs- und Willensbildung 1945 – 1976. Düsseldorf 1991. Zu Vergewaltigungen nach Kriegsende vgl. auch Mühlhauser, Regina: Vergewaltigungen in Deutschland 1945. Nationaler Opferdiskurs und individuelles Erinnern betroffener Frauen. In: Naumann, Klaus (Hrsg.): Nachkrieg in Deutschland. Hamburg 2001, S. 384– 404. Vgl. Grossmann, Sex, 1995, S. 195. Vgl. Timm, Politics, 2010, S. 192 f. 1948 wurden 1.896 Anträge auf Schwangerschaftsunterbrechung gestellt, 1.119 aus medizinischer Indikation genehmigt. Vgl. Landesgesundheitsamt: Jahresbericht 1948, LAB, B Rep 012, Nr. 99. Vgl. Grossmann, Sex, 1995, S. 195. Trotz ihrer Häufigkeit wurden nur wenige illegale Abtreibungen aufgedeckt. So sprachen die Gerichte z. B. 1959 in 5.400 Fällen Haftstrafen gegen Ärzte, Hebammen bzw. „Engelmacherinnen“ aus.
86
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
3.1.4 Evangelische Beratung In der evangelischen Eheberatung war, wie bereits in der Weimarer Republik, das Engagement von Frauen entscheidend.¹⁰⁶ Einzelne Personen setzten sich nach dem Krieg dafür ein, die Arbeit wieder aufzunehmen. Dabei waren starke Bezüge zur Vorkriegszeit zu erkennen.¹⁰⁷ Maßgebliche Kreise in der evangelischen Kirche wandten sich allerdings gegen eine zentrale evangelische Beratung, da sie sich von einer paritätischen Verbandsgründung größeren Einfluss versprachen. Ursache dafür war der große Druck, den die evangelische Kirche in der Ära Adenauer verspürte.¹⁰⁸ Die Initiative für rein konfessionelle Stellen lag deshalb zunächst bei den Landeskirchen, die auch hier wie in anderen Bereichen auf ihre Eigenständigkeit bedacht waren. Im Verlauf der 1950er-Jahre entstanden in allen Landeskirchen entsprechende Einrichtungen in urbanen Gegenden.¹⁰⁹ Aber auch die Evangelische Eheberatungsstelle in der Inneren Mission Berlin nahm frühzeitig ihre Arbeit wieder auf. Ab November 1945 bot sie „[e]ingehende persönliche Beratung, seelsorgerlich, auch juristisch und ärztlich. Die Beratung geschieht uneigennützig und verschwiegen, jedoch ohne Haftung“.¹¹⁰ Jede Woche standen vier Stunden als Sprechzeiten in zwei verschiedenen Bezirken zur Verfügung. Darüber hinaus war die Leiterin Maria Blech bereit, Ratsuchende nach vorheriger telefonischer Anmeldung in ihrer Privatwohnung zu empfangen.¹¹¹ Blech hatte die Beratungsstelle bereits in der Weimarer Republik geleitet und war nun bei der Inneren Mission angestellt.¹¹² Auch die dort tätige Rechtsanwältin war dieselbe wie vor dem Krieg. Zwei Ärzte kamen neu hinzu.¹¹³ Die Stelle der Inneren Mission war schon in der Weimarer Republik eine der wichtigsten evangelischen Eheberatungen gewesen, die ihrer Arbeit auch während der Zeit des Nationalsozialismus ungestört hatte nachgehen können.¹¹⁴ In der Nachkriegszeit nahm sie den Betrieb vor diesem Erfahrungshintergrund wieder auf. Nach eigener Aussage kamen „die Leute am laufenden Band, viel, viel mehr als von den Pfarrern geschickt“. Die Be-
Angesichts dieser Zahlen reagierten ärztlich geleitete Eheberatungsstellen zum Teil mit Beratungen zur Geburtenregelung. Vgl. Schneider, Ehen, 1998, S. 208 f. Vgl. Lippold, Church, 2014, S. 311. Vgl. Jäger, Protestantismus, 2019, S. 330. Vgl. Kapitel 3.2.1 Vorgeschichte und Gründung. Vgl. Hauschildt, Familienberatung, 2016, S. 265. Evangelische Eheberatungsstelle: Anzeige, 1945, ELAB, 29/550. Vgl. ebd. Vgl. Vorstand der Kreissynode Kölln-Land I [sic], Bescheinigung, 17. August 1945, ELAB, 29/550. Vgl. Maria Blech an Evangelische Kirchengemeinden in Groß-Berlin, Brief, Oktober 1945, ELAB, 29/550. Vgl. Kapitel 1.2 Kirchliche Beratungsstellen.
3.1 Eheberatung in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik
87
raterin hoffte, „dass die Kinder der Welt ein Stück Kirche bei uns finden“.¹¹⁵ Die Innere Mission äußerte, ohne dies zu begründen, den Verdacht, dass man die Erfolge dieser und auch anderer Beratungsstellen in diesen selbst rosiger sehe, als sie in Wirklichkeit waren.¹¹⁶ Die Arbeit der Stelle umfasste neben der praktischen Beratung auch Interessenvertretung. Beispielsweise befassten sich die Mitarbeiter mit dem Ehegesetz, um Eingaben machen zu können.¹¹⁷ Ein erster Eheberatungslehrgang sollte im August 1948 mit 40 Teilnehmern stattfinden.¹¹⁸ Blech organisierte zudem evangelische Beratungsarbeit außerhalb Berlins. Da sie sehr bekannt war, langjährige Erfahrung nachweisen konnte und gute Verbindungen zur evangelischen Kirche hatte, war sie die geeignete Person, um Frauenorganisationen bei der Errichtung weiterer Angebote zu unterstützen. Allein in der sowjetischen Besatzungszone eröffneten bis 1948 sechs Eheberatungsstellen mit ihrer Hilfe. Die regionalen Kirchenadministrationen unterstützten die Neugründungen.¹¹⁹ Bis 1952 vergrößerte sich die Einrichtung der Inneren Mission. Sprechstunden gab es nun auch in Dahlem, Friedenau, Neukölln und im Wedding.¹²⁰ Der erste Bericht über eine evangelische Tagung zum Thema Ehe liegt für den März 1949 unter dem Titel „Ehe und Ehelosigkeit in der christlichen Verkündigung und Seelsorge“ vor.¹²¹ Unter Leitung des bekannten Rassenhygienikers Otmar Freiherr von Verschuer wurde über evangelische Eheanbahnung gesprochen. Verschuer berichtete offenbar in Fortführung seiner Ansichten „über die Entwicklung der erbgesundheitlichen Eheberatung zwischen den 2 Weltkriegen“.¹²² Allgemein kreiste die Diskussion vor allem um Fragen der Ehewahl. Die Teilnehmer vertraten die Ansicht, Eltern seien ihren Kindern in der Lebensführung kein Vorbild mehr. Dem wollten sie mit Ehekursen entgegenwirken, wozu jedoch die Mittel fehlten. Als wichtige Maßnahme galt außerdem, Kindern ab 14 Jahren Zärtlichkeit zu entziehen, wodurch sie sich von den Eltern lösen und für die Ehe bereitmachen sollten. Auch in weiteren Fragen vertraten die Anwesenden klare Haltungen. Konflikte in der Ehe
Maria Blech an Generalsuperintendent, Brief, 10. Dezember 1945, ELAB, 29/550. Zur Arbeit der Beratungsstelle in der Nachkriegszeit vgl. auch Blech, Maria: „Über die Eheberatung der Inneren Mission“. In: Die Innere Mission. Zeitschrift des Diakonischen Werkes Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland 37 (1947), H. 9 – 10, S. 37– 43, DZI. S. M. Eichholz an Marx, Brief, 10. Oktober 1951, ADE, CAW 1117. Vgl. Maria Blech an Generalsuperintendent, Brief, 10. Dezember 1945, ELAB, 29/550. Vgl. Maria Blech an Generalsuperintendent, Brief, 20. Juli 1948, ELAB, 29/550. Vgl. Lippold, Church, 2014, S. 311 ff. Vgl. [Innere Mission]: Bericht über das Jahr 1952, [1953], ADE, CAW 1117. Vgl. im Folgenden Bornikoel: Bericht über die Tagung in Bremen-Lesum, [März 1949], ADE, CAW 415. Bornikoel: Bericht über die Tagung in Bremen-Lesum, [März 1949], S. 3, ADE, CAW 415.
88
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
entstünden, wenn Verwandte sich einmischten. Zu Scheidungen war die Meinung, hier sei eine allgemeine Laxheit eingetreten, die Trauung und Ehe entwerte und „zu einem schweren Problem für die evangel. Kirche“ werde.¹²³ Einigkeit herrschte dennoch darüber, dass Eheberatung nicht unbedingt in Einrichtungen der evangelischen Kirche selbst stattfinden müsse. Sich an bereits bestehenden Angeboten wie zum Beispiel den Vertrauensstellen für Verlobte und Eheleute in Hamburg und Lübeck zu beteiligen, „dürfte in vielen Fällen günstiger sein und die Möglichkeit zu organisatorischen Verknüpfungen geben, die bei eigenen Einrichtungen fehlen müssten“.¹²⁴ Diese Strategie, welche die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendund Eheberatung bewusst vorantrieb,¹²⁵ kennzeichnete in den kommenden Jahren die Praxis der evangelischen Beratungsarbeit. Die Untersuchung verschiedener Städte und Eheberatungsinstitutionen zeigt, wie sich die meisten Beratungsstellen an ihrer alten Ausrichtung in der Weimarer Republik orientierten. Die Zeit des Nationalsozialismus blendeten sie weitgehend aus. Besonders die Eheberatung in Berlin griff über alle Unterschiede der Ausrichtung hinweg auf bestehende Konzepte zurück.¹²⁶ Zudem nahm die Stadt erneut deutschlandweit die Führungsposition ein, was Vielfalt und Entwicklung von Beratungsstellen anging. Die Debatten der Nachkriegszeit speisten sich aus ihren Vorläufern in Weimarer Republik und „Drittem Reich“. Der gesellschaftliche Wandel hatte dabei zur Folge, dass sich die Bedeutungen von Sexualberatung, Eugenik und Eheberatung verschoben.¹²⁷ Dennoch zeigen sich Entwicklungen, die der Eheberatung zumindest in der Praxis ein verändertes Profil verliehen. So verdeutlicht das Beispiel Frankfurts, wie sich Berater mindestens im Einzelfall explizit, wenn auch vorsichtig, von der Arbeit ihrer Vorgänger während der Zeit des Nationalsozialismus abgrenzten. Zudem zeigte sich, dass es kein Bedürfnis nach eugenischer Beratung gab, die jedoch vor allem Akteure auf Leitungsebene der amtlichen Eheberatung und der Gesundheitsbehörden nach wie vor propagierten. Stattdessen entwickelten die Praktiker ein anderes Verständnis ihrer Tätigkeit. Sie beabsichtigten, bestehende Ehen zu „heilen“, auch mit psychologischen Methoden. Die zumindest formale medizinische Deutungshoheit über die amtliche Eheberatung blieb dennoch in der frühen Bun-
Ebd., S. 2. Ebd., S. 3, ADE, CAW 415, S. 4. Zu der Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Hamburg vgl. Kapitel 3.1.1 Eugenik oder psychologische Konfliktberatung?. Vgl. Kapitel 3.4.1 Die Begründung. Nach Sachße und Tennstedt war auch in der Fürsorge der Rückgriff auf Bekanntes und Bewährtes zu beobachten. Sie führen dies auf die Ressourcenknappheit der Nachkriegszeit zurück.Vgl. Sachße/Tennstedt, Geschichte, 2012, S. 183. Vgl. Grossmann, Sex, 1995, S. 211 f.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
89
desrepublik größtenteils bestehen, wie besonders das Beispiel Berlins zeigt. Noch bis 1959 galt Eheberatung als gesundheitliche Aufklärung und war somit dem Gesundheitssektor des Innenministeriums zugeordnet – auch wenn sich in der Praxis ein Wandel abzuzeichnen begann.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung Die Gründung der DAJEB veränderte die Beratungslandschaft nachhaltig.¹²⁸ Als erster übergeordneter Eheberatungsverband zwang sie sämtliche auf diesem Feld tätigen Personen und Gruppen dazu, sich zu positionieren. Die hauptsächlich evangelischen Akteure bemühten sich, ihre Konzeption der Eheberatung in einem betont überkonfessionellen Verband durchzusetzen und die allgemeine Praxis zu prägen. Dies ist vor dem Hintergrund der neuen politischen und konfessionellen Gegebenheiten in der Bundesrepublik zu sehen, denn Teile der evangelischen Kirche wähnten sich nach 1945 in der Defensive.
3.2.1 Vorgeschichte und Gründung In der Nachkriegszeit wollte Joachim Fischer¹²⁹, der beratende Sozialhygieniker des Diakonischen Werkes, die evangelische Kirche dazu anregen, die Eheberatung wieder aufzunehmen und zu vertiefen. Diese betrachtete er als Feld innenmissionarischer Arbeit, auf dem die evangelische Kirche in Zusammenarbeit mit Ärzten und Sozialhygienikern grundlegend wegweisend sein könnte. Die bisherige Praxis kritisierte er als unsystematisch und plädierte dafür, zentral gesteuert vorzugehen und offiziell zu Ehe und Geburtenregelung Stellung zu beziehen.¹³⁰ Die Not der Ehescheidungen ruft nach einer planvollen Eheberatung im evangelisch-christlichen Sinn. Die Weltanschauungen und anderen Konfessionen sind bereits auf dem Plan und emsig an der Arbeit. Die Evangelische Kirche in Deutschland ist es den Gliedern ihrer Ge-
Die hier vorgestellten Thesen wurden jüngst in einem Aufsatz veröffentlicht: Giehler, VeraMaria: Rassen- und Sozialhygieniker als Bindeglied der nichtkonfessionellen und evangelischen Eheberatung in der bundesdeutschen Nachkriegszeit. In: Mitteilungen zur Kirchlichen Zeitgeschichte 17 (2023), S. 117–143. Vgl. zu Fischers Biografie Kapitel 3.2.4.1 Joachim Fischer. Vgl. J[oachim] Fischer an Centralausschuss für Innere Mission, Brief, 17. Mai 1948, ADE, CAW 412. Auch Schneider verweist auf Fischer als maßgeblichen Initiator der DAJEB. Vgl. Schneider, Ehen, 1998, S. 207 f.
90
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
meinden schuldig, in diesen entscheidenden Lebensfragen allerorts übereinstimmend mit klaren Antworten und wohl fundiertem Rat zu Hilfe zu kommen! Bei der Wichtigkeit der Frage und den von Laien nicht ohne Weiteres zu übersehenden theologischen und biologischen Voraussetzungen, sowie bei der Wandlung der dogmatischen und wissenschaftlichen Einstellung diesen Fragegebieten gegenüber, geht es nicht länger an, die Eheberatung der Evangelischen Kirche und ihrer Hilfsorgane hier und da wachsen und arbeiten zu lassen, wie es die Umstände, wie es und zufälliger Wissensstand der Beratenden zulässt.¹³¹
Für die Umsetzung machte Fischer konkrete Vorschläge. Er trat dafür ein, die lokalen Bemühungen stärker zu konzentrieren und die praktische Arbeit unter eine zentrale Leitung zu stellen. Für jede Kirche war eine Arbeitsgruppe vorgesehen, die aus je einem in ihrer Gemeinde aktiven Mediziner, Pädagogen und Juristen bestehen sollte, darunter zwei Frauen. Geplant war eine mehrtägige Arbeitskonferenz, um Grundlinien für die Eheberatung zu erarbeiten. Anschließend sollten die Arbeitsgruppen in ihrer Landeskirche alle Mitarbeiter bündeln und die Beratungsarbeit entsprechend fördern.¹³² Offenbar hoffte Fischer auf einen Arbeitsauftrag der Inneren Mission, mit der er in Verbindung stand.¹³³ Unterstützung erfuhr er von Lothar Loeffler,¹³⁴ der als Rassenhygieniker in der Zeit des Nationalsozialismus aktiv gewesen war und ebenfalls bei der Inneren Mission für „einen christlichen Ehe- und Familiendienst“ warb.¹³⁵ Die Innere Mission beurteilte die Eheberatung als „innerste Herzensangelegenheit“ Fischers.¹³⁶ Einen Arbeitsauftrag oder eine Unterstützung erteilte sie Fischer aber nicht. Dass er seine Pläne verwirklichen würde, galt aufgrund fehlender Mittel als unwahrscheinlich.¹³⁷ Später waren es auch die Landeskirchen, die übergeordneten evangelischen Gründungen ihr Veto entgegenbrachten. Möglicherweise befürchteten sie, ihre Autonomie auf diesem Gebiet zu verlieren, da sie selbst lokale konfessionelle Beratungsstrukturen aufbauten.¹³⁸ Als Fischer die Unterstützung der Inneren Mission versagt blieb, suchte er anderweitig nach Mitstreitern.¹³⁹ Um seine Person entstand eine Arbeitsgemein-
[Joachim] Fischer an Centralausschuss Innere Mission, Brief, 4. September 1948, S. 1, ADE, CAW 412. Vgl. ebd. sowie J[oachim] Fischer an Centralausschuss für Innere Mission, Brief, 17. Mai 1948, ADE, CAW 412. Vgl. Hermine Bäcker an Innere Mission Hannover, 20. Oktober 1949, ADE, CAW 412. Vgl. zur Biografie Loefflers Kapitel 3.2.4.3 Lothar Loeffler. [Innere Mission], Aktennotiz, 14. März 1949, ADE, CAW 1117. Hermine Becker [sic] an Innere Mission Mannheim, 11. April 1950, ADE, CAW 412. Vgl. Innere Mission Bremen an Hermine Bäcker, Brief, 11. August 1949, ADE, CAW 1117 sowie Hermine Bäcker an Innere Mission Hannover, 20. Oktober 1949, ADE, CAW 412. Vgl. Kapitel 3.4 Zusammenarbeit und Konkurrenz. Vgl. Hermine Bäcker an Innere Mission Hannover, Brief, 20. Oktober 1949, ADE, CAW 412.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
91
schaft aus Ärzten, Erziehern, Juristen, Seelsorgern, Schwestern und Fürsorgerinnen.¹⁴⁰ Neben Loeffler war ihr prominentestes Mitglied der Sozial- und Rassenhygieniker Carl Coerper¹⁴¹. Fischer bemerkte später dazu: „Gerade dieser Respekt vor so verschieden begründeter Verantwortung schaffte eine segensreiche Atmosphäre des Vertrauens, das wiederum der fachlichen Arbeit zu allererst zugute kam.“¹⁴² Im Juni 1949 brachte die Arbeitsgemeinschaft eine Denkschrift über die Absichten, Arbeitsweisen und Grundlagen der ‚Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung‘ heraus.¹⁴³ Die Beteiligten legten darin ihre Ziele dar, die Zusammensetzung des Verbands sowie dessen Grundlagen. Noch bevor sie offiziell die DAJEB gründeten, entwarfen sie einen Lehrplan für geplante Kurse. Die Entstehung der DAJEB muss in die Versuche evangelischer Kreise eingeordnet werden, Deutungshoheit auch in einem veränderten Nachkriegsdeutschland zu bewahren. In der Bundesrepublik herrschte erstmals seit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1870/71 „konfessionelle Parität“¹⁴⁴ zwischen Katholiken und Protestanten. Thomas Sauer zufolge glaubten zahlreiche Protestanten, „der Protestantismus habe seine dominierende kulturelle und gesellschaftliche Stellung, die er nach 1871 errungen und auch nach dem Untergang der Monarchie bewahrt hatte, an den Katholizismus verloren“.¹⁴⁵ Die Eheberatung bot nun ein Feld, dass es evangelischen Akteuren ermöglichte, ihre Ansichten zu einer der wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen zu verbreiten. Dazu galt es, alle Kräfte der Eheberatung in einem Verband zu bündeln und unter dessen Oberaufsicht allgemein gültige Berufsbilder, Arbeitsrichtlinien und Ausbildungsordnungen zu entwickeln. Die DAJEB gründete sich als Verein mit 16 Mitgliedern am 1. Oktober 1949 in Detmold unter dem Namen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (AJEB).¹⁴⁶ Bereits kurz darauf erschien auf Publikationen der Zusatz „Deutsche“ vor
Vgl. Fischer, Jochen: „Zehn Jahre Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung“. In: Loeffler, Lothar (Hrsg.): Ehe und Familie als Gabe und Aufgabe. Göttingen 1959, S. 35 – 41, hier S. 35. Auch die bekannten evangelischen Eheberaterinnen Maria Blech und Ilse Szagunn waren bei der ersten Versammlung anwesend. Vgl. Lippold, Church, 2014, S. 313. Zur Biografie Coerpers vgl. Kapitel 3.2.4.2 Carl Coerper. Fischer, Jahre, 1959, S. 36. Vgl. DAJEB: Denkschrift über die Absichten, Arbeitsweisen und Grundlagen der „Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung“, Detmold Juli 1949, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Sauer, Thomas: Westorientierung im deutschen Protestantismus? Vorstellungen und Tätigkeit des Kronberger Kreises. Berlin / Boston 2009, S. 1 f. Ebd., S. 2. Die Liste der Gründungsmitglieder enthält nur zwei Frauen. Vgl. Kruse, Ulrich / Schall, Traugott Ulrich: „Kleine Geschichte der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung“. In: Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (Hrsg.): 50 Jahre DAJEB 1949 – 1999.
92
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
dem Namen.¹⁴⁷ Eine offizielle Namensänderung in Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung fand allerdings erst 1955 statt.¹⁴⁸ Die DAJEB stellte sowohl ihre Arbeit als auch ihre Beratungsstellen oft in eine Kontinuitätslinie zur Weimarer Republik. Daher verwundert, dass weder bei ihrer Gründung noch später die 1927 entstandene „Vereinigung öffentlicher Eheberatungsstellen“ Erwähnung fand. Diese hätte als eine Art Vorgängerinstitution als Bezugspunkt dienen können. Die Arbeitsgemeinschaft war der Überzeugung, dass Eheberatung von staatlichen Institutionen nicht adäquat erfüllbar war. In ihrer Satzung war 1949 folglich formuliert, daß die Pflege der Jugenderziehung im Hinblick auf die Ehe und die Beratung der Ehen und Ehelosen dringende menschliche und soziale Aufgaben sind. Diese Aufgaben können erschöpfend weder von einem einzigen Berufsstand noch von staatlichen Institutionen erfüllt werden. Aus diesem Grunde schließen sich Vertreter aller interessierten Berufsgruppen und Fachrichtungen zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen.¹⁴⁹
Die DAJEB verstand sich als überkonfessionell, nicht antikonfessionell.¹⁵⁰ Ihre Denkschrift über die Voraussetzungen sachgemäßer Jugend- und Eheberatung von 1953 verwies stolz darauf, dass sowohl katholische wie evangelische Mitarbeiter dem Vorstand angehörten. Dennoch gelinge es, selbst das schwierige Thema der Geburtenregelung derart zu diskutieren, dass man es gemeinsam vertreten könne.¹⁵¹ Da die DAJEB der erste Zusammenschluss von Beratungsstellen war, zwang sie dennoch die konfessionelle und vor allem die katholische Beratung, sich zu positionieren.¹⁵² Fischer wurde immer wieder als Gründer hervorgehoben.¹⁵³ Die Innere Mission betrachtete die DAJEB als Fischers „ganz persönliche Angelegenheit“. Aus der
[München] 1999, S. 5 – 49, hier S. 5. Ihren Sitz hatte die DAJEB in der Waldemarstr. 15 in Detmold. Vgl. DAJEB: Jahrestagung, 1965, LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5 – 30 – 02. Vgl. DAJEB: Jahresbericht 1951. Detmold [1952], S. 3, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. [DAJEB]: Satzung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung, Abschrift, 21. Mai 1955, S. 1, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Zum Zweck der Einheitlichkeit wird die DAJEB in der vorliegenden Arbeit von Beginn an unter ihrem späteren Namen geführt. [DAJEB]: Satzung der Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung, Abschrift, 1. Oktober 1949, [S. 1], DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. Jäger, Protestantismus, 2019, S. 324. Vgl. DAJEB: Denkschrift über die Voraussetzungen sachgemäßer Jugend- und Eheberatung. Detmold 1953, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. auch Kapitel 3.4.1.2 Zusammenarbeit. Vgl. Kapitel 4.2.1 Vorgeschichte und Gründung. Vgl. z. B. Bundesministerium der Justiz an Bundesminister der Finanzen, Brief, 22. April 1950, BArch, B 142/418, Bl. 67 f. sowie Hermine Bäcker an Innere Mission Hannover, Brief, 20. Oktober 1949, ADE, CAW 412.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
93
Inneren Mission hätten sich einzelne Persönlichkeiten „zur Mitarbeit bereit erklärt; aus der Überlegung heraus, daß es besser ist, diese Arbeitsgemeinschaft mit zu beeinflussen, als sie sich ganz selbst zu überlassen“.¹⁵⁴ In diesem Sinne erhielt auch die lokale Vereinigung in Hannover den Rat, Verbindung zur DAJEB aufzunehmen.¹⁵⁵ Die Formulierung zeigt eher den Wunsch, die Arbeitsgemeinschaft kontrollieren zu wollen, als die Bestrebung, sie zu unterstützen. Fischer suchte weiterhin die Verbindung zu evangelischen Kreisen, auch mit der Begründung, dass die DAJEB eine Arbeitsgemeinschaft evangelischer Christen sei. Wiederholt bat er zudem, die evangelische Ausrichtung anzuerkennen sowie mit ähnlichen Arbeitsfeldern der Inneren Mission zu kooperieren.¹⁵⁶ Dies widersprach dem offiziellen Anspruch der DAJEB, ein überkonfessioneller oder paritätischer Zusammenschluss zu sein, was jedoch keiner der Beteiligten anmerkte.
3.2.2 Organisation und Aufgabenstellung Die Vorstandsstruktur der DAJEB umfasste mehrere Gremien: ein Kuratorium, einen Vorstand, den erweiterten Vorstand sowie einen Arbeitsausschuss. Die Vorsitzenden hatten dabei die Funktion von Arbeitsvorständen. Erster Vorsitzender wurde der Sozialhygieniker Fischer, der die Gründung maßgeblich vorangetrieben hatte. Frauen waren im Vorstand nicht vertreten.¹⁵⁷ Dieser hatte zu Beginn die Aufgabe, Themen und Dozenten für die Kurse auszuwählen sowie Mitglieder zu benennen, die im Namen der DAJEB Vorträge zu vom Vorstand bestimmten Aspekten halten durften.¹⁵⁸ Zu den Referenten gehörten beispielsweise 1951 so gegensätzliche Personen wie der Direktor des Seminars für Wohlfahrtspfleger der Caritas Hans Wollasch,¹⁵⁹ der Rassenhygieniker von Verschuer und die Gründer von
Ebd. Vgl. ebd. S. [Maria Blech], Aktenvermerk, 19. Juli 1951, ADE, CAW 412. Vgl. Kruse/Schall, Geschichte, 1999, S. 6 und S. 20 f. sowie DAJEB, Jahresbericht 1951, [1952], S. 3, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. [DAJEB], Satzung, 1949, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Hans Wollasch (17.7.1903 – 26.4.1975) gehörte von der Nachkriegszeit bis in die 1960er-Jahre zu den namhaftesten Persönlichkeiten im sozialen Ausbildungsbereich. Nach seinem Abschluss in katholischer Theologie studierte er Pädagogik und Psychologie. Nachdem er eine Assistenz an der Universität Freiburg innegehabt hatte, arbeitete Wollasch während seines gesamten folgenden Berufslebens für den Deutschen Caritasverband. Dabei war der Theologe vor allem im Bereich der Pädagogik, Psychologie und Jugendwohlfahrtspflege an den sozialen Schulen des Caritasverbandes tätig. Im Jahr 1946 übernahm Wollasch die Leitung des Seminars für Wohlfahrtspfleger, die er bis 1969 innehatte. Hinzu kamen weitere Leitungsposten in der Aus- und Fortbildung der Sozialen
94
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Pro Familia, Hans Harmsen und Anne-Marie Durand-Wever.¹⁶⁰ Das breite Spektrum der Referenten zeigt, dass die DAJEB ihren Anspruch, Vielfalt zu fördern, ernst nahm, sowohl was ihre Mitglieder anging als auch die Eheberater, mit denen sie zusammenarbeitete. Beraterinnen traten als Referentinnen weniger in Erscheinung. Diese Diskrepanz zwischen der bundesweit insgesamt hohen Anzahl an Eheberaterinnen, die teilweise auch Stellen leiteten, und ihrer Repräsentanz innerhalb der DAJEB ist auffällig. Der erweiterte Vorstand gab zusammen mit einem Kuratorium Veröffentlichungen heraus.¹⁶¹ Er präzisierte im Laufe der Jahre Zusammensetzung, Wahlmodi und Aufgaben der beständig wachsenden Gremien. Im Jahr 1964 umfasste der Vorstand fünf Personen, der erweiterte Vorstand acht, ebenso wie das Kuratorium.¹⁶² Dieses sollte Ratschläge erteilen und Hilfe bei der Mittelbeschaffung leisten.¹⁶³ Zum Kuratorium gehörten unter anderem Ministerialräte des Bundesinnenministeriums sowie eine Oberregierungsrätin des Bundesfamilienministeriums.¹⁶⁴ Die Mitglieder traten erwartungsgemäß kaum in Erscheinung.¹⁶⁵ Des Weiteren existierte ein Arbeitsausschuss, der nicht auf eine bestimmte Zahl an Mitgliedern oder Aufgaben festgelegt war
Arbeit. Zudem war er ab 1949 im Zentralrat und Zentralvorstand der Caritas und ab 1966 auch im Geschäftsführenden Vorstand vertreten. Wollasch legte Wert auf Interdisziplinarität, Praxisbezug und wissenschaftliche Fundierung in Verbindung mit einer anthropologisch-theologischen Deutung. Dabei stand seine Tätigkeit im Dienst der Erneuerung des christlichen Ehe-, Familien- und Erziehungsverständnisses. Seitens des Staates, der Kirche und der Wissenschaft erhielt Wollasch diverse Ehrungen. Vgl. Nachbauer, Kurt: „Wollasch, Hans“. In: Maier, Hugo (Hrsg.): Who is who der Sozialen Arbeit. Freiburg 1998, S. 641– 642. Vgl. DAJEB, Jahresbericht 1951, [1952], S. 3, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle sowie DAJEB: Jahresbericht 1949/50. Detmold, Juli 1950, S. 3 f., DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. [DAJEB], Satzung, 1949, DAJEB Bundesgeschäftsstelle. Zur Besetzung des erweiterten Vorstands vgl. DAJEB, Jahresbericht 1951, [1952], S. 2, DAJEB Bundesgeschäftsstelle. Vgl. [DAJEB]: Satzung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung, Abschrift, 22. Mai 1964, DAJEB Bundesgeschäftsstelle. Vgl. [DAJEB]: Satzung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung 1958, 16. Mai 1958, DAJEB Bundesgeschäftsstelle. Vgl. DAJEB: Jahresbericht 1952. Detmold [1953], S. 3, DAJEB Bundesgeschäftsstelle; [Lothar] Loeffler an [Helene] Große-Schönepauck, Brief, 21. Juli 1960, BArch, B 189/2815, Bl. 196 ff. sowie Kapitel 3.2.3.2 Staatliche Förderung. Im Kuratorium waren Otto Buurmann, Ministerialdirektor der Gesundheitsabteilung im Niedersächsischen Sozialministerium und späterer Leiter der Gesundheitsabteilung im Bundesministerium des Innern, sowie Wilhelm Hagen, Ministerialrat im Innenministerium, vertreten. Sie verstanden die finanzielle Unterstützung der Eheberatung als Staatsaufgabe. Vgl. Schütz, Gesundheitsfürsorge, 2004, S. 195. Vgl. [DAJEB]: Begründung zum Satzungs-Neufassungs-Entwurf, 14. September 1957, S. 3, DAJEBBundesgeschäftsstelle.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
95
und nach Bedarf eingesetzt werden konnte.¹⁶⁶ Ihm gehörte zu Beginn der 1950er-Jahre beispielsweise die führende Eheberaterin der Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Hamburg an.¹⁶⁷ Die im Nachhinein von der DAJEB selbst als „barock“ bezeichnete Organisationsstruktur hatte den Vorteil, eine große Anzahl von Fachkräften an die Arbeitsgemeinschaft zu binden.¹⁶⁸ Dies entsprach auch der Vorstellung der Initiatoren, die verstreuten Erfahrungen und Kräfte auf dem Feld der Eheberatung zu sammeln.¹⁶⁹ Ein hohes Maß an ehrenamtlichem Engagement galt als selbstverständlich.¹⁷⁰ Die Mitgliederversammlung beteiligte sich ebenfalls an der Gremienarbeit. Mitglied konnte werden, wer sich ausdrücklich und durch seine Tätigkeit zu den Grundsätzen der DAJEB bekannte.¹⁷¹ Im Allgemeinen war dies von einer Kursteilnahme beim Verband abhängig. Kurz nach Gründung hatte die Arbeitsgemeinschaft 107 eingeschriebene Mitglieder.¹⁷² Im Jahr darauf waren es bereits 161 Mitglieder sowie 20 Mitgliedschaften von Eheberatungsstellen nicht behördlicher Einrichtungen.¹⁷³ 1957 zählte die DAJEB etwa 200 Einzelmitglieder.¹⁷⁴ Die meisten waren Mediziner. Zudem bestanden enge Kontakte zu den Gesundheitsämtern.¹⁷⁵ Seit Mitte der 1950er-Jahre versuchte der Verband zunehmend, korporative Mitglieder zu werben, um die Zahlen zu steigern. Besonders interessiert war die Arbeitsgemeinschaft daran, konfessionelle Zentralstellen dazu zu bewegen, sich zu beteiligen, wovon sie sich mehr Werbung bei Mitarbeitern und Arbeitsgemeinschaften erhoffte. Dieser Versuch scheiterte jedoch. Die Zahl der Mitglieder blieb nach Ansicht der DAJEB „schmal“.¹⁷⁶ Von Beginn an bemühte sie sich, ihre Basis zu ver-
Vgl. [DAJEB]: Satzung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung, Abschrift, 22. Mai 1964, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. DAJEB, Jahresbericht 1951, [1952], S. 2, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Im Jahr 1952 hatte der Arbeitsausschuss insgesamt 14 Mitglieder. S. Kruse/Schall, Geschichte, 1999, S. 20. Vgl. DAJEB, Denkschrift, 1949, [S. 3], DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. Kruse/Schall, Geschichte, 1999, S. 20. Vgl. [DAJEB], Satzung, 1949, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. DAJEB: Jahresbericht 1949/50. Detmold, Juli 1950, S. 5 ff., DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Diese Eheberatungsstellen waren in Bremen, Kiel, Hamburg, Lübeck, Cuxhaven, Dortmund, Minden, Bielefeld, Göttingen, Münster, Northeim, Hannover, Kirchheim, Wiesbaden, Neustadt, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Wilhelmshaven und Peine. Vgl. DAJEB, Jahresbericht 1951, [1952], S. 5 f., DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. Hermine Bäcker: Besprechung über die Umbildung der DAJEB, 29. Januar 1957, ADE, CAW 1118. Vgl. z. B. Senator für Gesundheitswesen Berlin an Medizinaldirektor Gesundheitsamt München, Brief, 9. Juli 1953, LAB, B Rep. 012, Nr. 176 sowie Landesgesundheitsrat Niedersachsen: Mitteilungen des Niedersächsischen Landesgesundheitsrates, H. 4, 1952, BArch, B 141/49456. [DAJEB]: Begründung zum Satzungs-Neufassungs-Entwurf, 14.9.1957, S. 1, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle.
96
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
größern. Bestenfalls sollten alle mit Jugend- und Eheberatung befassten Stellen und Organisationen fördernde Mitglieder sein. Immer wieder suchte die Arbeitsgemeinschaft nach Kontakten, bot Vorträge an oder streute breit Berichte.¹⁷⁷ Diese Anstrengungen dauerten über den Untersuchungszeitraum an, „um die Repräsentanz der DAJEB als ‚Deutsche‘ Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung zu rechtfertigen“.¹⁷⁸ So wurde beispielsweise empfohlen, in größeren Städten Arbeitsgemeinschaften zu bilden, die dann mit ihr in Verbindung treten und eine Landesarbeitsgemeinschaft formen sollten.¹⁷⁹ Als Zusammenschluss trat vor allem die 1952 gegründete Niedersächsische Landesarbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung in Erscheinung.¹⁸⁰ Darüber hinaus kamen weitere Landesarbeitsgemeinschaften nur in Nordrhein-Westfalen und Hamburg zustande.¹⁸¹ Auch im Vorstand scheiterte allerdings der Versuch, mit Regionalleitern lokale Strukturen aufzubauen.¹⁸² In der DAJEB galt die Ehe als Fundament der sittlichen Ordnung.¹⁸³ Ihr Hauptziel war, tradierte Ehenormen wiederherzustellen.¹⁸⁴ Zu diesem Zweck galt es, Eheberater wissenschaftlich und methodisch auf ihre Aufgaben vorzubereiten und weiterzubilden. Dazu sollte eine Jahrestagung dienen. Des Weiteren bestand der Plan, Jugend- und Eheberatungsstellen zu gründen und wissenschaftliche Grundlagenforschung zu betreiben. Darüber hinaus war vorgesehen, international mit ähnlichen Einrichtungen zusammenzuarbeiten.¹⁸⁵ Das Zentrum der Arbeit bildete die Sexualpädagogik. Gleichzeitig grenzte sich die DAJEB explizit von der Sexualberatung ab, die ihrer Ansicht nach zu einseitig arbeitete. Sie hielt sich zugute, dass sie eine umfassende und vorbeugende Jugend- und Eheberatung praktiziere und präge, die durch sie eine weite Verbreitung und Anerkennung in Deutschland finde.¹⁸⁶ In Ehekrisen zu helfen, stand
Vgl. [DAJEB]: Fragen der Zusammenarbeit, o. D., LAB, B Rep 012, Nr. 176. [DAJEB]: Begründung zum Satzungs-Neufassungs-Entwurf, 14.9.1957, S. 1 f., DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Zur geplanten Struktur dieser Arbeitsgemeinschaften vgl. [DAJEB]: Fragen der Zusammenarbeit, o. D., LAB, B Rep 012, Nr. 176. Vgl. DAJEB, Jahresbericht 1951, [1952], S. 9, DAJEB Bundesgeschäftsstelle sowie DAJEB, Jahresbericht 1953, [1945], S. 12, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle.Vgl. auch Kapitel 3.5.3 Modell-Beratungsstelle. Vgl. Große-Schönepauck, H[elene]: Die Eheberatung in Deutschland und in anderen Ländern, BArch, B 189/2807, Bl. 265 ff. Vgl. Kruse/Schall, Geschichte, 1999, S. 21 f. Vgl. Kapitel 3.3.1 Vorstellungen von Ehe. Vgl. Schneider, Ehen, 1998, S. 207 f. Vgl. [DAJEB], Satzung, 1949, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. DAJEB, Denkschrift, 1953, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. auch Kapitel 3.4.1.2 Zusammenarbeit.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
97
an letzter Stelle.¹⁸⁷ Damit ignorierte die DAJEB den in der Praxis sichtbaren tatsächlichen Bedarf. Die Arbeitsgrundlage bildete die Überzeugung: „Vorbeugen ist besser als heilen!“¹⁸⁸ Die Satzung von 1958 enthielt wesentliche Änderungen. Dazu gehörte eine explizit paritätische Ausrichtung: „Die weltanschauliche und konfessionelle Einstellung zum Wesen der Ehe wird durch die Mitgliedschaft bei der DAJEB nicht berührt. Abstimmungen über Fragen derartigen Inhalts finden nicht statt.“¹⁸⁹ Darüber hinaus wollte die DAJEB ihre Ziele nicht mehr selbst direkt umsetzen, sondern Hilfe dazu anbieten. Der Zweck war, in erster Linie die Jugend- und Eheberatung auf Bundesebene zu fördern. Dazu zählten verschiedene Aufgaben: Beratungsstellen und örtliche Arbeitskreise zu unterstützen und Gedankenaustausch zu fördern, die Gründung weiterer Einrichtungen anzuregen, wissenschaftliche und methodische Weiterbildung sowie Grundlagenforschung zu fördern und zu veröffentlichen.¹⁹⁰ Die Arbeitsgemeinschaft gab damit ihre dominierende Stellung im Fortbildungsbereich auf.¹⁹¹ Mit den konfessionellen Verbänden vereinbarte sie sowohl auf katholischer als auch evangelischer Seite, dass diese interessierten Eheberatern die Teilnahme an ihren Kursen ermöglichten.¹⁹² Grund war, dass bereits seit Langem eine separate katholische Fortbildungsarbeit existierte. Außerdem zeichnete sich bereits ab, dass sich die evangelische Eheberatung von der DAJEB ablösen würde und ein eigenes Zentralinstitut anstrebte, die 1959 gegründete „Konferenz für Evangelische Familienberatung“ (EKFuL).¹⁹³ Der Fortbildungsbereich, der das Herzstück der DAJEB bildete, konnte damit nicht länger gehalten werden. Die nunmehr eigenständige evangelische Eheberatung unterminierte zudem die Mitgliedsbasis der DAJEB, sodass diese an Bedeutung verlor. Im selben Jahr definierte
Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 230. Vgl. auch Kapitel 3.3.1 Vorstellungen von Ehe. Da Eheberatung in Krisensituationen den Kern der vorliegenden Studie bildet, wird die sexualpädagogische Arbeit der DAJEB nicht näher untersucht. DAJEB: Ergebnis der Arbeitsausschusssitzung, 30. Juni 1951, S. 3, BArch, B 142/418, Bl. 110 ff. [DAJEB]: Satzung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung 1958, 16. Mai 1958, S. 3, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. ebd., S. 1. Vgl. Kapitel 3.3.5 Kommunikation. Vgl. Halberstadt, Beratungsarbeit, 1986, S. 63 f. 1961 erfolgte die Umbenennung und Umwandlung der Konferenz in den eingetragenen Verein „Konferenz für Evangelische Familien- und Lebensberatung“ (EKFuL). Dessen Abkürzung wird in der vorliegenden Arbeit durchgehend verwendet, auch wenn die Konferenz bis zu diesem Zeitpunkt noch mit „KEFuL“ abgekürzt wurde. So sollen Verunsicherungen vermieden werden. Heute lautet der Name „Konferenz für Familien- und Lebensberatung e. V. Fachverband für psychologische Beratung und Supervision“. Vgl. Kapitel 3.4.1 Die Begründung.
98
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
ein Vorstandsbeschluss die Arbeitsgemeinschaft nunmehr als Fachvereinigung für Eheberatung auf christlicher Grundlage.¹⁹⁴ Da Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus an den internationalen Entwicklungen nicht hatte teilnehmen können, wollte die DAJEB nunmehr die Zusammenarbeit über die Bundesrepublik hinaus fördern. Aus diesem Grund ernannte sie eine Auslandsreferentin. Auf internationaler Ebene war die DAJEB ab 1956 Mitglied in der Union Internationale des Organismes Familiaux (UIOF).¹⁹⁵ Zudem bestanden enge Verbindungen zum „Institut zur Förderung öffentlicher Angelegenheiten“, dessen Geschäftsführer Carl Coerper auch als einer der DAJEB-Vorstände fungierte. Coerper sorgte in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender von 1952 bis 1956 ebenfalls dafür, dass die DAJEB mit der Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitswesen eng kooperierte. Als im Institut zur Förderung öffentlicher Angelegenheiten 1951 die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für psychische Hygiene entstand, war die DAJEB durch Fischer dort ebenfalls vertreten. Diese Arbeitsgemeinschaft sollte allen im Bereich der psychischen Hygiene Tätigen den Informationsaustausch ermöglichen und erhielt international Anerkennung.¹⁹⁶
3.2.3 Finanzstruktur In der DAJEB herrschte die Ansicht, dass Eheberatung weitestgehend auf private Initiativen angewiesen bleibe. Obwohl sie die staatliche Betätigung in dem Feld ablehnte, verlangte sie nach ministerieller Förderung. „Den personellen und materiellen Rahmen einer solchen Arbeit zu garantieren, sollte die lohnende Aufgabe einer weisen Staatsführung sein“, formulierte eine DAJEB-Denkschrift von 1953.¹⁹⁷ Von Beginn an war die Finanzsituation der DAJEB angespannt. Auch wenn sie in späteren Jahren in größerem Umfang Mittel verschiedener Bundesministerien erhielt, blieb die Lage über die Jahre schwierig. Die Arbeit auszubauen, war vor allem aufgrund finanzieller Probleme nicht möglich.¹⁹⁸ Der Arbeitsgemeinschaft fehlte eine Trägerinstitution, sie hatte zu wenig Eigenmittel. Diese schlechte finanzielle
Vgl. Halberstadt, Beratungsarbeit, 1986, S. 63 f. sowie DAJEB an Bundesminister des Innern, Brief, 7. August 1958, S. 3, BArch, B 142/2043, Bl. 52 f. Vgl. Fischer, Jahre, 1959, S. 39. Zum Bericht über die erste Konferenzteilnahme der DAJEB als Mitglied der UIOF vgl. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 20, September 1956, LAB, B Rep. 012, Nr. 176. Vgl. Schütz, Gesundheitsfürsorge, 2004, S. 191. Vgl. auch Kapitel 3.2.4.1 Joachim Fischer. DAJEB, Denkschrift, 1953, S. 7, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. Große-Schönepauck, H[elene]: Die Eheberatung in Deutschland und in anderen Ländern. [Bonn 1968]. BArch, B 189/2807, Bl. 265 ff.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
99
Ausstattung der DAJEB stand im deutlichen Gegensatz zu den guten Netzwerken, die sie mit den Ministerien verbanden, und auch zu ihrer erfolgreichen Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit.¹⁹⁹ 3.2.3.1 Eigenmittel Der erste Vorsitzende der DAJEB, der Sozialhygieniker Joachim Fischer, formulierte im Rückblick, man sei 1949 an die Arbeit gegangen, ohne sich durch finanzielle Sorgen entmutigen zu lassen.²⁰⁰ Die Arbeitsgemeinschaft sollte sich zu Beginn laut Satzung durch freiwillige Zuwendungen der Mitglieder finanzieren.²⁰¹ Hinzu kamen Spenden und Kursgebühren. Verpflichtende Mitgliedsbeiträge gab es nicht. Die Dozenten verzichteten weitgehend auf ein Honorar.²⁰² Die Frage, wie die weitere Arbeit zu finanzieren war, stellte die DAJEB von Anfang an vor große Probleme. Sie bat ihre Mitglieder, je wenigstens 1 DM beizusteuern²⁰³ und ihre Kontakte zu nutzen, um ihr aus behördlicher oder privater Quelle Zuwendung zu ermöglichen.²⁰⁴ Auch im Jahr darauf verwies der Jahresbericht auf die schwierige Finanzsituation. Erneut rief der Verband zu Spenden oder einer Fördermitgliedschaft auf: „Helfe jeder dazu, daß uns durch Zustimmung, Spenden und Beihilfen die Möglichkeit gegeben wird, eine deutsche Jugend-, Ehe- und Familienberatung von Niveau aufzubauen, die dazu beitragen kann, die Fundamente der persönlichen und sozialen Gemeinschaft wieder instand zu setzen und gesund zu erhalten.“²⁰⁵ Noch 1960 ging Beziehern der Informationsschreiben die Aufforderung zu, Beiträge der vergangenen Jahre zu überweisen, da die DAJEB darauf dringend angewiesen war.²⁰⁶ Immer wieder war die Finanzierung von Projekten in Gefahr.²⁰⁷ Die DAJEB musste Vorhaben zurückstellen²⁰⁸ oder gänzlich aufgeben.²⁰⁹ Eheberater arbeiteten
Vgl. Kapitel 3.3 Selbstverständnis und Professionalisierung. S. Fischer, Jahre, 1959, S. 39 f. Vgl. [DAJEB]: Satzung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung. 16. Mai 1958, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. Fischer, Jahre, 1959, S. 39 f. 1950 betrug das Durchschnittseinkommen eines Arbeiters 243 Mark im Monat. Vgl. Haustein, Sabine: Vom Mangel zum Massenkonsum: Deutschland, Frankreich und Grossbritannien im Vergleich 1945 – 1970. Frankfurt 2007, S. 41. Vgl. DAJEB: 6. Rundschreiben, 20. Mai 1950, S. 2, ADE, JF 31. DAJEB, Jahresbericht, [1952], S. 10, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. DAJEB, Zahlungsaufforderung, Juli 1960, BArch, B 191/163, Bl. 34. Vgl. z. B. Bundesministerium des Innern, Aktennotiz, 18. April 1950, B 142/418, Bl. 66 sowie [Fischer, Jochen] an Große-Schönepauck, Brief, 2. Februar 1960, BArch, B 189/2815, Bl. 183. Vgl. z. B. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 8, Januar 1954, BArch, 189/2815, Bl. 29 ff. Vgl. z. B. DAJEB, Jahresbericht, [1952], S. 9 f., DAJEB-Bundesgeschäftsstelle sowie [Lothar] Loeffler an [Helene] Große-Schönepauck, Brief, 21. Juli 1960, BArch, B 189/2815, 21. Juli 1960, Bl. 196 ff.
100
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
mit großem ehrenamtlichen Engagement, was zum Teil „materielle Opfer“ notwendig machte.²¹⁰ So steuerte zum Beispiel Lothar Loeffler vorübergehend 500 DM aus eigener Tasche bei, um den Ausbildungslehrgang 1956 zu ermöglichen.²¹¹ Im Jahr 1955 überarbeitete die DAJEB ihre Satzung. Sie hielt fest, dass der Zweck der Arbeitsgemeinschaft nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet sei. Allerdings erhielt die Mitgliederversammlung nunmehr die Möglichkeit, Mitgliedsbeiträge verpflichtend festzulegen.²¹² Sie beschloss einen jährlichen Beitrag von 3 DM. Verbunden war dies mit der Bitte um einen höheren Betrag, falls es die wirtschaftliche Lage erlaube.²¹³ Hinzu kamen Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Veröffentlichungen.²¹⁴ Der Vorstand wollte damit nach außen ein Zeichen setzen, dass die Mitglieder bereit waren, die DAJEB nicht nur formal, sondern auch finanziell zu fördern.²¹⁵ Doch erst mit der Satzungsänderung von 1964 griff ein verpflichtender Beitrag.²¹⁶ Im ersten Geschäftsjahr von November 1949 bis Juni 1950 betrugen die Einnahmen und Ausgaben der DAJEB insgesamt 3.316,10 DM. Das meiste waren Hörergebühren.²¹⁷ Die Teilnahme an einem Kurs kostete 5 DM, hinzu kam eine Einschreibegebühr von 50 DM. Das Verbandskonto verbuchte nach Abschluss des 5. Lehrgangs im Mai 1950 ein Plus von 16 DM.²¹⁸ Die Mitgliedsbeiträge brachten 1956 600 DM. Insgesamt betrugen die Eigenmittel im entsprechenden Geschäftsjahr 1.300 DM.²¹⁹ Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 6.060,75 DM. Davon gab die DAJEB im Abrechnungszeitraum von April bis Dezember 4.588,15 DM aus.²²⁰ Am höchsten waren die Kosten für Veröffentlichungen und Kurse. Publikationen schlugen mit 1.900 DM zu Buche, die Jahresarbeitstagung mit 3.000 DM.²²¹ Für das folgende Jahr rechnete man mit ähnlichen Kosten, die für Tagungen, Veröffentli-
Fischer, Jahre, 1959, S. 40. Vgl. Lothar Loeffler an [Otto] Buurman, Brief, 20. Dezember 1955, BArch, B 142/2043, Bl. 424 ff. Vgl. [DAJEB]: Satzung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung, Abschrift, 21. Mai 1955, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. S. DAJEB an Mitglieder, Brief, 30. Juni 1955, BArch, B 142/2043, Bl. 363. Vgl. [DAJEB]: Satzung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung, Abschrift, 21. Mai 1955, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. [Walter] Raupach an Bundesministerium des Innern, Brief, 30. Juni 1955, BArch, B 142/2043, Bl. 363 ff. Vgl. [DAJEB], Satzung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung, 22. Mai 1964, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. Kruse/Schall, Geschichte, 1999, S. 49. Vgl. DAJEB: 6. Rundschreiben, 20. Mai 1950, S. 2, ADE, JF 31. Vgl. [DAJEB]: Antrag, [1956], BArch, B 142/2043, Bl. 5. Vgl. DAJEB: Abschluß, 31. Dezember 1956, BArch, B 142/2043, Bl. 16. Vgl. [DAJEB]: Kosten-Plan, [1956], BArch, B 142/2043, Bl. 6.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
101
chungen, Reisen der Vorstandsmitglieder, Literaturbeschaffung und Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes eingeplant waren.²²² Für Personal fielen in den 1950er-Jahren nur wenige Ausgaben an. Beispielsweise kostete 1954 die Beschäftigung einer halben Schreibkraft monatlich 18 DM, der Geschäftsführer 100 DM.²²³ Die unabhängigen Rechnungsprüfungen fanden in der Regel ohne Beanstandungen statt.²²⁴ Unterstützung erhielt die DAJEB zumindest in den ersten Jahren von evangelischer Seite. Der Centralausschuss der Inneren Mission spendete 1949 und 1950 je 100 DM.²²⁵ Der DAJEB-Vorsitzende Fischer verstand die Spende auch als ideelle Unterstützung. Er bedankte sich beim Direktor des Centralausschusses Friedrich Münchmeyer²²⁶ für diese „unschätzbare Hilfe“. Als Gegenleistung sollte Münchmeyer in das Kuratorium der DAJEB gewählt werden.²²⁷ Im Centralausschuss befürwortete man die Kurse der Arbeitsgemeinschaft. Darüber hinaus bestand die Hoffnung, dass sich die Beratungsarbeit stärker konfessionell ausrichtete, wenn bewusst evangelische Teilnehmer die Kurse besuchten.²²⁸ Da der evangelische Verband noch keine eigenen Kurse abhielt, bot sich ihm hier die Möglichkeit, direkt auf die Fortbildung von Eheberatern Einfluss zu nehmen.
Vgl. DAJEB: Abschluß, 31. Dezember 1956, BArch, B 142/2043, Bl. 16. Vgl. Bundesminister des Innern, Vermerk, 4. Januar 1954, BArch, B 142/418, Bl. 172 f. Vgl. z. B. Abschrift Rechnungsprüfung, BArch, B 142/418, Bl. 45 sowie [o. U.], DAJEB Verwendungsnachweis, [1957], BArch, B 142/2043, Bl. 24 ff. Vgl. Kruse/Schall, Geschichte, 1999, S. 49. Friedrich Münchmeyer (14. 2.1901– 7.1.1988) wurde nach einem Studium der Theologie 1925 Militärpfarrer, 1930 Militärkreispfarrer in Dresden. Von 1940 an war er Generalfeldvikar des Evangelischen Feldbischofs und hatte damit eines der obersten geistlichen Ämter in der Wehrmacht inne. Im Jahr 1946 wurde Münchmeyer Geschäftsführender Direktor des Centralausschusses für Innere Mission. Diese Tätigkeit übte er bis 1957 aus, als er Präsident der Hauptgeschäftsstelle des neu fusionierten Werkes „Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland“ wurde. Für diese Fusion hatte er sich mit Nachdruck eingesetzt, sie gilt als sein besonderes Verdienst. In dieser Zeit erhielt der Theologe die Ehrendoktorwürde der Universität Münster. Ende der 1950er-Jahre initiierte Münchmeyer einen Eugenischen Arbeitskreis. Bei Beratungen des Bundesinnenministeriums sprach er sich gegen eine Entschädigung von Zwangssterilisierten aus. Vgl. Kaminsky, Rassenhygiene, 2005, S. 219 ff. sowie Braun, Hannelore / Grünzinger, Gertraud: Personenlexikon zum deutschen Protestantismus 1919 – 1949. Göttingen 2006, S. 182 sowie o. A.: Die Präsidenten und Direktoren der Diakonischen Werke. 1957– 1962: Dr. h. c. Friedrich Münchmeyer. Verfügbar unter: www.diakonie.de/praesidenten-und-direktoren-der-diakonischen-werke, besucht am 18. Oktober 2020. Zu Innerer Mission und Evangelischem Hilfswerk vgl. Sachße/Tennstedt, Geschichte, 2012, S. 101 ff. Vgl. [Jochen] Fischer an [Friedrich] Münchmeyer, Brief, 30. Dezember 1949, ADE, CAW 412 sowie DAJEB an [Friedrich] Münchmeyer, Brief, 21. Juli 1950, ADE, CAW 412. Vgl. o. A., Aktenvermerk, 9. Dezember 1949, ADE, CAW 412.
102
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
3.2.3.2 Staatliche Förderung Die finanzielle Basis der DAJEB bildete im Grunde die Förderung zuerst durch das Innen-, später durch das Familienministerium.²²⁹ Verschiedene Landesregierungen unterstützten den Verband ebenfalls. Von Beginn an beantragte die DAJEB dort Zuschüsse. Die Regierungen genehmigten die Mittel teilweise oder sandten Spenden. Dabei handelte es sich um Beträge zwischen 100 und 1.000 DM. Die niedersächsische Landesregierung, aber auch die Regierung in Düsseldorf erwiesen sich dabei als am zuverlässigsten.²³⁰ Mit ihren Anträgen war die DAJEB vor allem erfolgreich, wenn sie an Konferenzen oder Kursen in der entsprechenden Region beteiligt war.²³¹ Gleichzeitig hieß es schon 1950, dass die Arbeitsgemeinschaft auf Bundes- und nicht auf Landesebene arbeite und ihre Unterstützung vom Bund kommen müsse.²³² Das Bundesinnenministerium wiederum empfahl, bei den Gesundheitsministerien der Länder um Beihilfen anzufragen.²³³ Der Haushaltsplan des Innenministeriums sah keine Zuschüsse für Eheberatung vor. Dennoch erhielt die DAJEB von dort Unterstützung – aus Mitteln zur „Förderung der volksgesundheitlichen Bestrebungen und der Bekämpfung menschlicher Krankheiten“.²³⁴ Die Zuordnung gründete im Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten,²³⁵ das die Förderung der Sexualaufklärung vorsah. Dieses Programm stimmte mit dem sexualpädagogischen Ansatz der DAJEB überein.²³⁶ Bedingung für die Förderung war, dass die Kurse für Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet geöffnet waren und diese in ihrem Wohnort in der Lage sein mussten, in der Jugend- und Eheberatung beziehungsweise der seelischen Hygiene tätig zu sein.²³⁷ Im Bundesministerium des Innern „bestand Übereinstimmung darüber, daß die Arbeitsgemeinschaft auf jeden Fall gestützt werden soll“, auch als Gegengewicht zur Sexualberatung.²³⁸ Das Ministerium förderte die DAJEB erstmals 1950 mit einem
Vgl. Fischer, Jahre, 1959, S. 39. Zur finanziellen Unterstützung vgl. z. B. [DAJEB], Antrag, [1956], BArch, B 142/2043 sowie Groeger, Verfahren, 1955, S. 9, DZI. Zur Sicht des Landes Niedersachsen auf Eheberatung insgesamt vgl. Landesgesundheitsrat Niedersachsen: Mitteilungen des Niedersächsischen Landesgesundheitsrates, H. 4, Hannover 1952, BArch, B 141/49456. Vgl. [o. U.], DAJEB Verwendungsnachweis, [1957], BArch, B 142/2043, Bl. 24 ff. S. [Jochen] Fischer an [Wilhelm] Hagen, Brief, 19. Juni 1950, BArch, B 142/418, Bl. 69 f. Vgl. BMdI, Vermerk, Januar 1956, BArch, B 142/2043, Bl. 429 f. Vgl. Bundesministerium des Innern, Vermerk, 29. August 1951, BArch, B 142/418, Bl. 144 ff. Vgl. Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten (GeschlKrG) vom 23. Juli 1953, § 15 Abs. 3. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 240 ff. Vgl. Bundesministerium des Innern, Aktennotiz, 18. April 1950, BArch, B 142/418, Bl. 66. Bundesminister des Innern, Vermerk, 4. Januar 1954, BArch, B 142/418, Bl. 172 f.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
103
Betrag von 1.000 DM.²³⁹ In den darauffolgenden Jahren gewährte es jährlich Summen zwischen 2.000 und 6.000 DM.²⁴⁰ Wie viel der beantragten Mittel es im Jahr letztlich genehmigte, war im Voraus allerdings unklar. Die DAJEB sah ihre Erwartungen zu ihrer Bestürzung nicht immer erfüllt.²⁴¹ Die Verantwortlichen waren im Vorfeld des Öfteren von einer höheren Unterstützung und größeren Kostenplänen ausgegangen. 1957 errechnete die DAJEB ein notwendiges Jahresbudget von 20.000 DM, wobei sie 10.000 DM von der Bundesebene erhoffte. Die weiteren Mittel sollten über Landesregierungen, Dachverbände, Spitzenorganisationen und eine Beihilfe aus dem Jugendplan kommen.²⁴² Vonseiten des Bundes erhielt die DAJEB jedoch mit 6.000 DM schließlich deutlich weniger Geld als erhofft.²⁴³ Planungssicherheit war damit nicht gegeben. Ab Mitte 1959 war das Familienressort des Familienministeriums für Eheberatung zuständig, nicht mehr die Gesundheitsförderung des Innenministeriums.²⁴⁴ Die DAJEB hatte diesen Wechsel zusammen mit den einschlägigen konfessionellen Trägerverbänden beantragt, wobei ihr die Ministerien selbst dazu geraten hatten.²⁴⁵ Als „Zuschüsse für Ehe- und Elternberatung“ erhielt sie Haushaltsmittel von 50.000 DM. Damit begann eine systematische finanzielle Förderung der Aus- und Fortbildung in diesem Bereich. Der gesundheitspolitische Aspekt der Familienbildung beziehungsweise der Eheberatung rückte in den Hintergrund.²⁴⁶ Nur in wenigen Jahren war das Geld der DAJEB am Ende des Geschäftsjahres nicht vollständig aufgebraucht. Das Bundesinnenministerium forderte, mehr Eigenmittel einzusetzen.²⁴⁷ Oberregierungsrätin Helene Große-Schönepauck,²⁴⁸ die Leiterin des zuständigen Referats und DAJEB-Kuratoriumsmitglied, erkannte Vgl. Kruse/Schall, Geschichte, 1999, S. 49 sowie [Wilhelm] Hagen an DAJEB, Brief, 25. August 1950, BArch, B 142/418, Bl. 97 f. Vgl. DAJEB an Bundesminister des Innern, Antrag, 10. Mai 1959, BArch, B 142/2043, Bl. 474 ff. Vgl. DAJEB an Bundesminister des Innern, Brief, 7. August 1958, BArch, B 142/2043, Bl. 152 f. Vgl. [DAJEB], Antrag, [1956], BArch, B 142/2043, Bl. 4. Vgl. DAJEB: Kostenplan 1957/58, BArch, B 142/2043, Bl. 40 ff. sowie Bundesministerium des Innern an DAJEB, Brief, 18. Juli 1957, BArch, B 142/2043, Bl. 41 f. Vgl. DAJEB an Bundesminister für Familien- und Jugendfragen, Brief, 10. Mai 1959, BArch, B 142/ 2043, Bl. 474 f. Vgl. Klens/Fischer/Becker: Antrag an den Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages auf Einordnung der Jugend-, Ehe- und Familienberatung in die Aufgaben des Bundesministeriums für Familien- und Jugendfragen, Januar 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 240 ff. Vgl. z. B. DAJEB: Abschluß, 31. Dezember 1956, BArch, B 142/2043, Bl. 16 sowie Stralau an DAJEB, Brief, 24. Juli 1958, BArch, B 142/2043, Bl. 149 f. Helene Große-Schönepauck war promovierte Juristin und leitete seit der Gründung des Familienministeriums das Referat für Ehe-, Familien- und Erbrecht, Ehe- und Elternberatung, Mutterschutz, Frauenfragen und Familienerholung. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S 242, Fn. 71.
104
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
durchaus an, wie schwer es der Arbeitsgemeinschaft fiel, Mittel aufzubringen, die überhaupt erst öffentliche Zuschüsse ermöglichten. Sie betrachtete den weiteren Ausbau der Arbeit vor allem als finanzielles Problem. Da Mittel des Bundes nur für zentrale Maßnahmen und nicht für örtliche Beratungsstellen verfügbar waren und zudem die konfessionellen Träger einfacher an Geld kommen konnten, handelte das Familienministerium bei den Zuwendungen für die DAJEB besonders großzügig.²⁴⁹ Fischer war Große-Schönepauck für „das große Verständnis, das die DAJEB in Ihrem Hause findet, […] ganz besonders dankbar“.²⁵⁰ Dennoch befand die DAJEB, dass auch das Bundesfamilienministerium keine ausreichend klaren Aussagen machte, welche Mittel es zur Verfügung stellen konnte, und das Geld zu spät zuwies.²⁵¹ Wenn es darum ging, Finanzanträge durchzusetzen, baten die Vorstände der DAJEB die in den Bundesministerien tätigen Kuratoriumsmitglieder mehrfach erfolgreich um Hilfe.²⁵² Loeffler forderte diese Unterstützung nachdrücklich:²⁵³ „So geht es einfach nicht weiter. Noch halten wir Ruhe. Aber eines Tages werden wir reden, worauf sich die Herren des Ministeriums verlassen können!“²⁵⁴ Er sah sich dazu berechtigt, Forderungen zu stellen, und führte dazu ganz allgemein die Arbeit der DAJEB, aber auch ihre internationalen Kontakte²⁵⁵ sowie die finanzielle und ehrenamtliche Unterstützung ins Feld, die er und andere Beteiligte leisteten.²⁵⁶ Loefflers Bemühungen führten schließlich dazu, dass das Ministerium die Beihilfen aufstockte.²⁵⁷
Vgl. Große-Schönepauck, H[elene]: Die Eheberatung in Deutschland und in anderen Ländern. [Bonn 1968], S. 5 f. und S. 16, BArch, B 189/2807, Bl. 265 ff. [Jochen] Fischer an [Helene] Große-Schönepauck, Dezember 1959, BArch, B 189/2815, Bl. 176. Vgl. z. B. Walter Raupach an [Jochen] Fischer, Abschrift Brief, 19. Juli 1960, BArch, B 189/2815, Bl. 199 f. sowie [Lothar] Loeffler an [Helene] Große-Schönepauck, Brief, 21. Juli 1960, BArch, B 189/ 2815, Bl. 196 ff. Vgl. z. B. ebd. sowie [Jochen] Fischer an [Wilhelm] Hagen, Brief, 19. Juni 1950, BArch, B 142/418, Bl. 69 f. Vgl. z. B. Lothar Loeffler an [Otto] Buurman, Brief, 20. Dezember 1955, BArch, B 142/2043, Bl. 424 ff. sowie Lothar Loeffler an [Helene] Große-Schönepauck, Brief, 3. August 1960, BArch, B 189/ 2815, Bl. 203 ff. Ebd. Vgl. [Lothar] Loeffler an [Helene] Große-Schönepauck, Brief, 21. Juli 1960, BArch, B 189/2815, Bl. 196 ff. Vgl. Lothar Loeffler an [Otto] Buurman, Brief, 20. Dezember 1955, BArch, B 142/2043, Bl. 424 ff. sowie [Lothar] Loeffler an [Helene] Große-Schönepauck, Brief, 21. Juli 1960, BArch, B 189/2815, Bl. 196 ff. Vgl. z. B. BMdI, Vermerk, Januar 1956, BArch, B 142/2043, Bl. 429 f. sowie [Walter] Raupach an [Helene] Große-Schönepauck, Brief, 3. August 1960, BArch, B 189/2815, Bl. 210.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
105
3.2.4 Rassen- und Sozialhygieniker als Vorstandsmitglieder der DAJEB Die Vorsitzenden der DAJEB bekannten sich zu einer dezidiert sozialhygienischen Ausrichtung, womit sie das Selbstverständnis des Verbands maßgeblich prägten. Sie bauten damit auf ihrer eigenen Vergangenheit als Rassen- und Sozialhygieniker auf. Die Sozialhygiene nahm gruppen- und klassenspezifische Lebensweisen in den Blick und untersuchte die gesellschaftlichen und strukturellen Ursachen der Wohnund Arbeitsbedingungen, von Ernährungs- und Freizeitverhalten sowie Familienleben.²⁵⁸ Bei der Rassenhygiene hingegen, einem um die Jahrhundertwende von Alfred Ploetz geprägten Begriff, ging es um eine Verbesserung des „Erbguts“. Eugenik und Rassenhygiene wurden in den folgenden Jahrzehnten oft synonym verwendet.²⁵⁹ In der DAJEB lassen sich eugenische Tendenzen in diversen thematischen Zusammenhängen nachweisen. Gleichzeitig bot die Arbeitsgemeinschaft der Eheberatung die Chance für Praktiker, sich zu professionalisieren und weiterzubilden. Sie betonte außerdem ausdrücklich, dass sie Vielfalt in der Beratungsarbeit wünsche, und schloss somit auch nicht sozialhygienisch orientierte Berater ein. Wegen ihrer evangelisch-christlichen Ausrichtung waren außerdem entsprechend konfessionell gebundene Akteure willkommen. Innerhalb der DAJEB traten zwei Ansätze zutage, die nebeneinander existierten.²⁶⁰ Der eine zielte darauf, die Familie als Keimzelle des Staates zu schützen, während der andere Paare unterstützen wollte, ihr persönliches Glück in der Ehe zu finden. Raphael ist dabei zuzustimmen, dass im Zuge der„Individualisierung immer mehr Bereiche in den Handlungszugriff und Diskussionszusammenhang von Wissenschaften geraten“ seien. Damit rückte auch „unsere Glücksfähigkeit in diesem Jahrhundert unter die fürsorgliche Beobachtung und zuweilen strenge Selbst- bzw. Fremdkontrolle durch ein wissenschaftliches Expertenwissen“.²⁶¹ Mit Joachim Fischer begründete ein Sozialhygieniker die DAJEB und fungierte als ihr erster Vorsitzender.²⁶² Zudem waren mit Carl Coerper und Lothar Loeffler zwei Mediziner involviert, „die in den frühen dreißiger Jahren an der Durchsetzung der Zwangssterilisation in den evangelischen Fürsorgeeinrichtungen beteiligt ge-
Vgl. Hering/Münchmeier, Geschichte, 2014, S. 56. Vgl. Westermann, Stefanie / Ohnhäuser, Tim / Kühl, Richard: Medizin im Dienst der „Erbgesundheit“. Einleitende Bemerkungen. In: Westermann, Stefanie / Kühl, Richard / Groß, Dominik (Hrsg.): Medizin im Dienst der „Erbgesundheit“. Beiträge zur Geschichte der Eugenik und „Rassenhygiene“. Berlin 2009, S. 15 – 21. Vgl. Timm, Politics, 2010, S. 249 ff. Raphael, Verwissenschaftlichung, 1996, S. 193. Vgl. Kapitel 3.2.1 Vorgeschichte und Gründung.
106
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
wesen waren“.²⁶³ Coerper verfocht auch nach 1945 eine sozialbiologisch orientierte Sozialhygiene mit einer leistungsbezogenen Gesundheitspflicht.²⁶⁴ Diese Kontinuität sozialhygienischen Denkens war es, die bis in die 1960er-Jahre hinein die staatlich organisierte Gesundheitsfürsorge prägte, was sich auch an den Karrieren der Mediziner aufzeigen ließ.²⁶⁵ Nach der Gründung der DAJEB stieß das Familienministerium eine Diskussion über die Vergangenheit einzelner Mitglieder an.²⁶⁶ In der Kritik stand insbesondere Loefflers Vorstandsmitgliedschaft.²⁶⁷ Das Ministerium äußerte Befürchtungen, dass insbesondere in den Kursen der Arbeitsgemeinschaft NS-Gedankengut zu Eugenik erneut in Umlauf geraten könnte.²⁶⁸ Es gab zu verstehen, eine Förderung der DAJEB „nicht mehr vertreten zu können“, sollte Loeffler Vorstandsmitglied bleiben. Der Vorstand der DAJEB diskutierte diese Bedenken offenbar ausführlich, kam allerdings zu dem Schluss, dass er durch seine Zusammensetzung die Gewähr biete, „im Rahmen der Kurse keinen Raum für politische Interpretation der wissenschaftlichen, ethischen und methodischen Fragen“ zu lassen. Die DAJEB stufte Loefflers Tätigkeit und seine Ansichten als unbedenklich ein, da „eine gründliche Entnazifizierung [Loefflers] stattgefunden habe“. Nach Kriegsende hatten die Alliierten den Mediziner bis Oktober 1945 interniert.²⁶⁹ Vermutlich stützte sich die Einschätzung des Vorstands auch auf diese Zeit. Die genaueren Umstände von Loefflers Internierung stellen allerdings ein Forschungsdesiderat dar, sodass sein Entnazifizierungsprozess sich derzeit der Beurteilung entzieht. Selbstkritische Äußerungen des Rassenhygienikers zu seiner nationalsozialistischen Vergangenheit lassen sich nicht nachweisen. Er blieb dem eugenischen Denken verhaftet.²⁷⁰ Die Debatte um Loeffler führte laut Vorstand der DAJEB dazu, dass weitere Dozenten überprüft wurden. Überlegungen kamen auf, anderen Mitgliedern den Austritt zu empfehlen, sollten diese eine Entnazifizierung vermeiden wollen. Auf welche Maßnahme oder Mitglieder sich dies bezog, lässt sich aus dem vorliegenden
Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 229. Vgl. Schagen, Udo / Schleiermacher, Sabine: „Carl Arthur Johannes Coerper“. In: Dies. (Hrsg.): 100 Jahre Sozialhygiene, Sozialmedizin und Public Health. Berlin 2005, S. 2. Vgl. Schütz, Gesundheitsfürsorge, 2004, S. 11. Vgl. im Folgenden Frake, Elisabeth: „Wandel mit Weile – oder 50 Jahre DAJEB“. In: Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (Hrsg.): 50 Jahre DAJEB 1949 – 1999. [München] 1999, S. 50 – 85, hier S. 61. S. ebd., Fn. 129. Ebd., S. 61, ebenso die folgenden Zitate. Vgl. Klee, Ernst: „Loeffler, Lothar“. In: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Frankfurt am Main 2007, S. 376. Vgl. Kapitel 3.2.4.3 Lothar Loeffler.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
107
Material nicht nachvollziehen.²⁷¹ Der Vorstand, in dem mit Fischer, Coerper und Loeffler drei im Nationalsozialismus erfolgreiche Mediziner engagiert waren, schloss den Vorgang. Die Reaktion des Familienministeriums darauf ist nicht überliefert. Da die DAJEB jedoch weiterhin staatliche Mittel erhielt, ist davon auszugehen, dass eine weitere Überprüfung nach damaligen Kriterien nichts ergab oder die Thematik nicht weiterverfolgt wurde. Später entsandte das Ministerium eine Vertreterin ins Kuratorium der DAJEB.²⁷² Ob diese eine Kontrollinstanz darstellen sollte, war nicht zu ermitteln. Timm kommt zu dem Schluss: „The leadership was quite successful in distracting attention from the fact that […] key founding members had been active in various facets of Nazi racial hygiene.“²⁷³ So verwundert es nicht, dass Loeffler aus dem Familienministerium Glückwünsche zu seinem Geburtstag erhielt.²⁷⁴ Die DAJEB vermied es ganz allgemein, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. In der Weimarer Republik hatte sich die Deutsche Gesellschaft für soziale Hygiene dafür engagiert, erbbiologische Daten breit zu erfassen.²⁷⁵ Als Fragebögen der DAJEB 1953 an diese Datensammlung erinnerten, geriet der Verband
Dass innerhalb der DAJEB eine Diskussion über die vorbelasteten Vorstandsmitglieder stattfand, wird nur aufgrund eines Artikels in der Jubiläumspublikation zum 50-jährigen Bestehen der DAJEB deutlich. Vgl. Frake, Wandel, 1999, S. 61. Entsprechende Quellen konnten weder in den besuchten Archiven noch bei der DAJEB selbst gefunden werden, wodurch sich weder Inhalt noch Zeitpunkt der Diskussion genauer nachvollziehen lassen. Frake, zum Zeitpunkt der Publikation Beisitzerin im Vorstand der DAJEB (vgl. o. A.: „Wer ist wer“. In: Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (Hrsg.): 50 Jahre DAJEB 1949 – 1999. [München] 1999, S. 148 – 165, hier S. 151), lag entsprechendes Material der DAJEB vor.Vgl. Gespräch d. Autorin mit Elisabeth Frake-Roth, 19. Mai 2020. Was nach der Rückgabe dieses Konvoluts geschah, ist nicht nachvollziehbar. Die Nachfrage in der Beratungsstelle Hannover, in der Loeffler tätig gewesen war, erbrachte keine Rückmeldung zu vorhandenen Schriftstücken. Vgl. Kapitel 3.2.2 Organisation und Aufgabenstellung. Vgl. Timm, Politics, 2010, S. 250. Vgl. [Helene] Große-Schönepauck an Lothar Loeffler, Brief, 27. Januar 1966, BArch, B 189/2815, Bl. 366. Die deutsche Gesellschaft für soziale Hygiene wurde 1928 gegründet, erster Vorsitzender war Carl Coerper. Unter anderen gehörte Alfred Grotjahn dem Vorstand an. Zweck der Gesellschaft war die Förderung der wissenschaftlichen Sozialhygiene, wobei ihre Gründung unter Sozialhygienikern umstritten war. Auch erwies es sich als schwierig, eine gemeinsame Begriffsdefinition zu finden. Für Coerper war Sozialhygiene biologischen Methoden verpflichtet. Die Gründung der Gesellschaft für soziale Hygiene stellte für ihn daher einen wichtigen Schritt in Richtung eines sozialhygienischen Gesundheitssystems dar. Innerhalb des Gesundheitssystems wiederum bedeutete sie die weiter fortschreitende wissenschaftliche Anerkennung der Sozial- und Rassenhygiene. Im „Dritten Reich“ wurde sie mit anderen Organisationen zur Deutschen Gesellschaft für Hygiene zwangsvereinigt.Vgl. Schütz, Gesundheitsfürsorge, 2004, S. 89 f.
108
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
unter Druck und musste sich rechtfertigen.²⁷⁶ Joachim Fischer beteuerte, die Bögen sollten nur eine einigermaßen übereinstimmende Berichterstattung und einen Erfahrungsaustausch ermöglichen, aber nicht zu irgendeiner Form allgemeiner oder spezieller Statistik führen. Dies gestatte weder der vielseitige Gegenstand der Arbeit noch die individuelle Arbeitsweise der Beratungsstellen.²⁷⁷ Da führende Mitglieder an einem Sterilisationsgesetz mitwirkten,²⁷⁸ vermutet Kuller hinter den Fragebögen jedoch die Intention, „weite Kreise der Bevölkerung in der Eheberatung zu erfassen“, da diese eine tragende Säule des Gesetzeskonzepts darstellte.²⁷⁹ Dies lässt sich mit einer Aussage Fischers stützen, der kritisierte, dass die Konkurrenz und Zersplitterung der Beratungseinrichtungen zu einer ungenügenden Erfassung der Bevölkerung führten.²⁸⁰ Das Selbstverständnis der DAJEB scheint weder durch diese Episoden noch die Tätigkeit ihrer prominenten Vorstandsmitglieder beeinflusst worden zu sein. Der Verband entwickelte auch später kein Problembewusstsein.²⁸¹ Im Gegenteil bemerkte Fischer 1959, die DAJEB habe die „Jugend- und Eheberatung in fachlicher, methodischer, organisatorischer und menschlicher Hinsicht von den Belastungen einer vergangenen Zeit befreit“.²⁸² Auch in anderen pädagogischen Beratungsangeboten wie beispielsweise der Erziehungs- oder Mütterberatung ist diese Kontinuität zu beobachten. Bis auf wenige Ausnahmen ist bis mindestens in die 1960erJahre keine wirkliche Aufarbeitung nachzuweisen.²⁸³ Der Umgang der DAJEB mit Thematik und Akteuren fügte sich somit in durchaus typische zeitgenössische Muster. Die Vorstände waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich eugenisches Denken im Verband hielt.
Vgl. im Folgenden ebd., S. 229 f. S. [Joachim] Fischer: [Umfrage] Jahresbericht, Dezember 1953, BArch, B 189/2815, Bl. 15 ff. Vgl. auch [Fischer, Joachim]: „Erfahrungen der Eheberatung im Jahre 1952. Zusammengestellt aus Tätigkeitsberichten von Eheberatungsstellen im Auftrage der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung“. In: Der Öffentliche Gesundheitsdienst. Monatsschrift für Gesundheitsverwaltung und Sozialhygiene 15 (1953/54), H. 9, Sonderdruck, Dezember, S. 361– 365, hier S. 361, ADE, JF 31 sowie DAJEB: Jahresbericht 1953, S. 6, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. Kapitel 3.2.4.4 Eugenischer Arbeitskreis. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 230 f. S. Fischer, J[oachim]: Über den Stand der Eheberatung in einigen europäischen Ländern und den USA. [1952], S. 46, ADE, CAW 1117. Timm hingegen sieht die DAJEB über Konferenzen, Buchbesprechungen und Fachliteratur bewusst einen Weg weg von NS-eugenischen Methoden einschlagen, allerdings ohne die Definition von Ehe als Zentrum staatlicher Wohlfahrtspolitik aufzugeben. Vgl. Timm, Politics, 2010, S. 250. Fischer, Jahre, 1959, S. 40. Vgl. Gröning, Katharina: Entwicklungslinien pädagogischer Beratungsarbeit. Anfänge – Konflikte – Diskurse. Heidelberg 2010, S. 96.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
109
3.2.4.1 Joachim Fischer Joachim Fischer war nach seinem medizinischen Staatsexamen 1939 im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig.²⁸⁴ Nach einem beruflichen Aufenthalt in Rothenburg wurde er Amtsarzt in Lemgo und zweiter Medizinaldezernent der Regierung in Detmold.²⁸⁵ Seit 1946 war Fischer beratender Sozialhygieniker, seit 1957 Leiter der Abteilung Gesundheitsfürsorge des Diakonischen Werkes. Ab 1965 gab der Mediziner zudem die Sozialhygienische Rundschau heraus. Er trieb die Gründung der DAJEB wesentlich voran und amtierte zwei Jahre als ihr Vorsitzender. Nach einer Unterbrechung von mehreren Jahren wurde er von 1959 bis 1963 erneut auf diesen Posten gewählt.²⁸⁶ Fischer engagierte sich in der evangelischen Kirche und vertrat in der Eheberatung einen entsprechenden konfessionell begründeten Ansatz.²⁸⁷ In der Nachkriegszeit machte er außerdem keinen Hehl aus seiner eugenischen Überzeugung: „Als Amtsarzt bemühe ich mich seit Langem, der sozialhygienischen Verpflichtung zur Eheberatung nachzukommen. An sich gehört sie zu den Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes, wurde aber vor 1945 entstellt und danach verkannt und vernachlaessigt [sic].“²⁸⁸ Fischer setzte sich für eugenische Eheberatung und entsprechende Eheverbote ein. Angelehnt an Grotjahns Ansichten der 1920er-Jahre propagierte er eine negative und positive Fortpflanzungshygiene.²⁸⁹ Gleichzeitig sah er, dass der Eugenik aufgrund der sittlichen Begründung der Ehe Grenzen gesetzt waren.²⁹⁰ Generell vertrat Fischer den Standpunkt, dass die Eugenik wegen der NSEuthanasie in ein schlechtes Licht gerate.²⁹¹ Diese Haltung zog sich auch durch seine Beiträge, mit denen er sich in größere Diskussionen einschaltete, etwa die bundesrepublikanische Debatte um die Meldepflicht für behinderte Kinder ab 1965.²⁹² Als Leiter der Abteilung Gesundheitsfürsorge des Diakonischen Werkes erhielt Fischer den Auftrag, die Konferenz für Evangelische Familienberatung (EKFuL) zu gründen, die 1959 ihre Arbeit aufnahm. Ebenso engagierte er sich dafür, dass 1964
Vgl. im Folgenden Kaminsky, Dunkel, 2008, S. 207. Vgl. ebenso ders., Rassenhygiene, 2005, S. 232. Fischer bezeichnete sich als Medizinal- und Regierungsrat. Er war in Detmold auch neben seiner Arbeit im Diakonischen Werk weiterhin tätig. Vgl. z. B. DAJEB: Informationsschreiben Nr. 18, Januar 1956, S. 14, ADE, JF 31. Vgl. dazu Kruse/Schall, Geschichte, 1999, S. 6. Vgl. Kapitel 3.2.1 Vorgeschichte und Gründung sowie Kapitel 3.2.4.1 Joachim Fischer. J[oachim] Fischer an Centralausschuss für Innere Mission, Brief, 17. Mai 1948, ADE, CAW 412. Vgl. Kaminsky, Rassenhygiene, 2005, S. 222. Vgl. J[oachim] Fischer an Centralausschuss für Innere Mission, Brief, 17. Mai 1948, ADE, CAW 412. Vgl. z. B. Fischer, Joachim: „Entwicklung und Beurteilung eugenischer Gesetzgebung in Deutschland“. In: Ärztliche Mitteilungen: deutsches Ärzteblatt 36 (1951), H. 2, S. 19 – 20 sowie Fischer, J[oachim]: „Neue Formen der Eheberatung“. In: Ärztliche Mitteilungen: deutsches Ärzteblatt 38 (1953), H. 13, Sonderdruck, BArch, B 189/2815, Bl. 35 f. Vgl. Kaminsky, Rassenhygiene, 2005, S. 232 f.
110
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
das Evangelische Zentralinstitut für Familienberatung (EZI) entstehen konnte. Innerhalb der evangelischen Beratungsarbeit setzten sich zu diesem Zeitpunkt Professionalisierungstendenzen weiter durch, die Praxis richtete sich zunehmend deutlicher an der Psychotherapie aus. Fischer, der diese Entwicklung ablehnte, verlor in der Folge an Einfluss, was auf verschiedene Auseinandersetzungen um EKFuL und EZI zurückzuführen ist.²⁹³ Er verließ das Diakonische Werk und wurde 1968 leitender Eheberater der Evangelischen Landeskirche Baden. In der Praxis hatte er den Ruf, über große Einfühlungsgabe zu verfügen.²⁹⁴ Zu diesem Zeitpunkt war Fischer von der DAJEB, der Konferenz und dem EZI bereits entfremdet und hatte seinen vormals herausragenden Status dort verloren.²⁹⁵ Im Ringen darum, wie die evangelische Beratungsarbeit sich ausrichten und wer die Führungsrolle innehaben sollte, unterlag er schließlich dem Leiter der Hauptberatungsstelle für die Evangelische Kirche im Rheinland, Guido Groeger²⁹⁶. Ab 1951 hatte Groeger begonnen, die evangelische Beratungsarbeit im Rheinland aufzubauen, durch die er schnell an Einfluss gewann.Vier Jahre später zog er in den erweiterten Vorstand der DAJEB ein. Der Psychotherapeut wurde zu einem der einflussreichsten Akteure in der evangelischen Eheberatung und prägte diese entscheidend. 3.2.4.2 Carl Coerper Carl Coerper besaß Ausstrahlung, galt als guter Redner und großes organisatorisches Talent.²⁹⁷ Nach seiner Promotion in Medizin arbeitete er in der Kinderheilkunde, später als Kreiskommunalarzt. Gegen die Interessen von Zentrum und SPD setzte der scheidende Stadtmedizinalrat den parteipolitisch nicht festgelegten und in Köln unbekannten Coerper 1926 als Dezernent für das Gesundheitswesen Kölns durch. Seine umfangreichen gesundheitspolitischen Aktivitäten führten zu Konflikten zwischen leitenden Ärzten, Universität und Stadtverwaltung. Aus diesem Grunde erhielt Coerper entgegen seinem Wunsch keinen Lehrauftrag an der Universität Köln.
Vgl. Kapitel 3.4.1 Die Begründung. Vgl. unleserlich, Aktenvermerk, 23. Juni 1956, ADE, CAW 419. Vgl. Lippold, Church, 2014, S. 326 f. Guido Nikolai Groeger (1917– 2004) studierte Medizin und Psychotherapie. Er wurde über „Die Entwicklung der Heiratshäufigkeit im Deutschen Reich 1919 – 1939“ promoviert. Von 1964 an amtierte er als erster Vorsitzender der EKFuL, bis er 1968 Direktor des EZI wurde. Unter seiner Leitung entwickelte das EZI eine beherrschende Stellung, die evangelische Beratungsarbeit wurde professionalisiert. Die Position als Direktor des EZI hatte Groeger bis 1979 inne. Vgl. o. A.: Guido Groeger. Auf: https://wiki.de.dariah.eu/display/F1P/Groeger%2C+Guido, besucht am 8. März 2021, sowie DAJEB: Sitzungsprotokoll, 9. Juni 1955, BArch, B 142/2043, Bl. 372 ff. Vgl. Kapitel 3.4.1 Die Begründung. Vgl. im Folgenden Schütz, Gesundheitsfürsorge, 2004, S. 15 ff.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
111
Coerper widmete sich zu diesem Zeitpunkt bereits länger den Themen Konstitution und Vererbung sowie der Frage, wie diese zu beeinflussen seien.²⁹⁸ Bald nach seiner Ernennung zum Dezernenten für das Gesundheitswesen begann er, sich in seinen Veröffentlichungen vermehrt mit der „sozialhygienischen Diagnose“ zu befassen. Gegen Ende der 1920er-Jahre avancierte diese zu einem zentralen Thema und ersetzte für ihn die karitativ orientierte Sozialhygiene.²⁹⁹ Die Vertreter der „sozialhygienischen Diagnose“ sahen im Gegensatz zu früheren Konzeptionen der Sozialhygiene keine Notwendigkeit mehr, die Gesellschaft zu reformieren. Vielmehr verschrieben sie sich biologischen Methoden und lehnten interdisziplinäre sozialwissenschaftliche Ansätze völlig ab, so auch Coerper selbst als Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für soziale Hygiene.³⁰⁰ Coerper gründete seine Sicht auf Krankheiten auf eine „Mythologie von Grundeigenschaften des Lebens“.³⁰¹ Darin waren deterministische Regeln des sozialen Lebens ausschlaggebend.³⁰² Körperliche und geistige Anlagen sowie soziales Verhalten wurden so als angelegt und dadurch prognostizierbar festgeschrieben. Aus dieser Perspektive stellten Krankheiten keine individuelle Angelegenheit dar, vielmehr galt es zu untersuchen, welche Auswirkungen sie auf die Gemeinschaft hatten, deren kleinste Einheit die Familie darstellte. Hier kam der Frau, genauer der Hausfrau und Mutter, die zentrale Rolle zu, sodass die weibliche Erbmasse bei der Diagnose im Vordergrund stand. Männer erbrachten ihre soziale Leistung hingegen dem „Volk“ gegenüber, weshalb sie vor allem unter diesem Gesichtspunkt beurteilt wurden. Coerpers „sozialhygienische Diagnose“ entsprach somit einer mystifizierten Vererbungstheorie. Gab es Abweichungen, griff eine negative oder positive Prophylaxe, wobei unter letztere auch die Eheberatung fiel. Mit dem Beginn des „Dritten Reiches“ stellte Coerper die Sozialhygiene zunehmend in den Dienst rassenhygienischer Vorstellungen.³⁰³ Als 1933 die überwiegende Mehrzahl aller Kölner Beigeordneten durch Nationalsozialisten ersetzt wurden, blieb der als politisch zuverlässig geltende Coerper im Amt.³⁰⁴ Er begrüßte
In Hinblick auf die „sozialhygienische Diagnose“ vgl. ebd., S. 76 f. Vgl. z. B. Coerper, Carl: „Ärztliche Berufsberatung“. In: Zeitschrift für Schulgesundheitspflege und soziale Hygiene 40 (1927), H. 7, S. 212– 215. Vgl. Moser, Gabriele: „‚Die Zukunft gehört der prophylaktischen Medizin‘ – Sozialhygiene, medizinisches Präventionsverständnis und Gesundheitsbegriff Ende der 1920er Jahre“. In: Schagen, Udo / Schleiermacher, Sabine (Hrsg.): Sozialmedizin, Sozialhygiene, Public Health: Konzepte und Visionen zum Verhältnis von Medizin und Gesellschaft in historischer Perspektive. Berlin 2002, S. 15 – 20, hier S. 18 f. Schütz, Gesundheitsfürsorge, 2004, S. 76. Vgl. im Folgenden ebd., S. 74 ff. Vgl. ebd., S. 78. Vgl. ebd., S. 15 ff.
112
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
den Staatsumbau sowie die nationalsozialistische Sozialpolitik und trat am 1. Mai 1933 der NSDAP bei. Durch parteiliche Einflussnahme erhielt er den lang ersehnten Lehrauftrag für Volksgesundheitspflege an der Universität Köln. Der Mediziner hielt rassenhygienische Vorlesungen, sein Spezialgebiet stellte die Sozialbiologische Diagnostik dar. Darüber hinaus verfolgte Coerper auch aktiv rassenhygienische Ziele. Unter seiner Leitung kam das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ zur Anwendung. Reihenuntersuchungen sollten in Köln der Leistungsüberprüfung und Erfassung „Minderwertiger“ dienen. Sowohl Coerpers Organisationstätigkeit im Kölner Gesundheitswesen, die er nach rassenhygienischen Gesichtspunkten ausübte, als auch sein konkretes Engagement für Zwangssterilisationen bieten die Möglichkeit, seine Ansichten und Handlungen nachzuvollziehen.³⁰⁵ Über Krankenmorde war er zumindest informiert, organisatorisch war er an der vorangegangenen Räumung einer Heilanstalt beteiligt.³⁰⁶ Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges verlor Coerper seine Anstellung, seinen Lehrauftrag und seinen Sitz als Beigeordneter.³⁰⁷ Coerpers Schwester, Oberin im Diakonissenmutterhaus Detmold, vermittelte ihm in Bielefeld eine neue Stelle im Evangelischen Hilfswerk Westfalen. Die dortige Aufgabe, im Krieg zerstörte Krankenhäuser und deren Verwaltung wiederaufzubauen, entsprach der Berufserfahrung des Mediziners. Derartige Kompetenzen waren zu diesem Zeitpunkt dringend gesucht. Das Hilfswerk machte sich auch Coerpers zahlreiche Kontakte zunutze. Seine Vergangenheit schadete ihm nicht. Offenbar setzte sich weder der Rassenhygieniker selbst noch dessen Umfeld mit seiner früheren Tätigkeit oder nationalsozialistischem Gedankengut auseinander. Privat galt er als bekennender Christ sowie als Teil des christlichen Widerstandes. 1948 durchlief der Mediziner erfolgreich ein Entnazifizierungsverfahren.³⁰⁸ Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass er in die britische Zone umzog, vorhandenes Material zerstört war und er eine enge kirchliche Bindung aufwies sowie viele Leumundzeugen hatte. Im Jahr 1950 wurde Coerper an das Frankfurter Institut zur Förderung öffentlicher Angelegenheiten berufen.³⁰⁹ Dort übernahm er den Posten des Geschäftsführers der Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitswesen (AGG).³¹⁰ Ab 1951 wirkte er als Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Sozialhygiene, der
Vgl. Endres, Sonja: Zwangssterilisationen in Köln 1934– 1945. Köln 2010, S. 85 sowie Schütz, Gesundheitsfürsorge, 2004, S. 151, Fn. 346. Vgl. Endres, Zwangssterilisationen, 2010, S. 85 f. Vgl. im Folgenden Schütz, Gesundheitsfürsorge, 2004, S. 15 ff. und S. 162 f. Vgl im Folgenden ebd., S. 152 ff. sowie Endres, Zwangssterilisationen, 2010, S. 84 ff. Vgl. im Folgenden Schütz, Gesundheitsfürsorge, 2004, S. 26 und S. 173 ff. Ab 1955 Deutsche Zentrale für Volksgesundheitspflege. Coerper blieb Geschäftsführer bis 1956.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
113
Wiedergründung der Deutschen Gesellschaft für soziale Hygiene. Dieser Organisation stellte er auch die Zeitschrift der AGG als Publikationsmöglichkeit zur Verfügung. Ein Jahr später nahm er seine Dozententätigkeit für das Fach „Sozialhygiene“ an der Universität Köln wieder auf. Zudem war er Mitherausgeber der Zeitschrift Gesundheitsfürsorge. Zwar hatte er keine direkte Entscheidungsgewalt inne, doch nutzte er seinen Einfluss auf die Gesundheitspolitik. Dem Mediziner gelang es, den öffentlichen Gesundheitsdienst nach 1945 mitzuprägen und insbesondere über die AGG die Restauration der Sozialhygiene voranzutreiben. Sein eigentliches Ziel einer vorbeugenden Familienfürsorge konnte er jedoch nicht erreichen. Schließlich galten seine gesundheitspolitischen Vorstellungen in der Zwischenzeit wissenschaftlich als überholt und waren zu umstritten, um noch mehrheitsfähig zu sein.³¹¹ Coerper war von 1952 bis 1956 Vorsitzender der DAJEB. Dabei betrieb er eine enge Anbindung an die AGG. Häufig hielt er Vorträge vor evangelischen Einrichtungen.³¹² Anlässlich seines 70. Geburtstags dankte die DAJEB ihm 1956 für „seinen Rat und reiche Erfahrung“, die er der Arbeitsgemeinschaft zur Verfügung stelle. Seine Tätigkeit bewertete sie als „richtungweisend, anregend und […] klärend“ weit über die Medizin hinaus.³¹³ In seinem Nachruf beschrieb Fischer ihn als väterlichen Senior der Ehe- und Familienberatung, der „ein starkes, unmittelbares Beispiel lauterer Gesinnung, mutigen Eintretens für Sauberkeit und Sitte und so auch ein leuchtendes Beispiel hoher Ehe- und Familienauffassung gegeben“ habe.³¹⁴ Coerpers beruflicher Weg war eng verbunden mit der wissenschaftlichen Entwicklung der Sozialhygiene von der gemeindenahen Gesundheitsfürsorge zu einem Instrument der Rassenhygiene.³¹⁵ Seine Karriere nach 1945 ist ein Beispiel für die personelle Kontinuität in der Gesundheitsfürsorge. Die fehlende kritische Auseinandersetzung mit der NS-Zeit verweist auf die damit verbundene kollektive Verdrängung von Schuld. Die eugenischen Elemente einer weiterhin am „Volks-
Zu Coerpers Vorstellungen von Sozialhygiene in der Bundesrepublik vgl. Coerper, Carl: „Sozialhygiene, ein Abriß ihrer Struktur und ihrer Aufgaben“. In: Der öffentliche Gesundheitsdienst. Monatsschrift für Gesundheitsverwaltung und Sozialhygiene 21 (1959/60), S. 134– 139 sowie Trüb, Carl L. Paul: Die Terminologie und Definition Sozialmedizin und Sozialhygiene in den literarischen Sekundärquellen der Jahre 1900 bis 1960. Opladen 1978, S. 42 ff. Vgl. ebd., S. 133 und S. 195 f. Dort sprach er z. B. über Ehehygiene sowie Gattenwahl und Verlobtenberatung.Vgl. [Innere Mission]: Bericht über den Lehrgang für evangelische Eheberatung vom 26. bis 31.5.1952 in Herrenalb, [1952], ADE, CAW 1117. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 20, September 1956, S. 1, ADE, JF 31. Fischer, J[oachim]: „Carl Coerper verstorben“. In: Wege zum Menschen. Monatsschrift für Seelsorge, Psychotherapie und Erziehung und zur Förderung der Zusammenarbeit von Arzt und Seelsorger 12 (1960), S. 105 – 106, hier S. 105. Vgl. Schütz, Gesundheitsfürsorge, 2004, S. 11.
114
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
wohl“ orientierten Gesundheitsfürsorge kamen zunächst nicht auf den Prüfstand. Erst in den 1960er-Jahren durchbrach ein Generationswechsel diese Kontinuität. Hier liegt der Übergang zu einer neueren Sozialmedizin, dem längere Auseinandersetzungen vorausgingen.³¹⁶ 3.2.4.3 Lothar Loeffler Lothar Loeffler war einer der führenden Rassenbiologen des „Dritten Reiches“³¹⁷ mit „weitreichenden politischen Beziehungen […] im nationalsozialistischen Staat“.³¹⁸ Nach seiner Promotion in Medizin arbeitete er 1927 als einer der ersten Wissenschaftler am neu gegründeten Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik.³¹⁹ Diesem blieb er auch nach seinem Ausscheiden verbunden und bildete im Netzwerk ehemaliger Mitarbeiter eine zentrale Figur. Bereits 1932 trat er in die NSDAP und die SA ein.³²⁰ Zwei Jahre später wurde er ordentlicher Professor für Erb- und Rassenbiologie in Königsberg. Einen Ruf an das Frankfurter Institut für Erbbiologie und Rassenhygiene lehnte er ab.³²¹ Von 1935 bis 1942 führte er als Gauamtsleiter in Ostpreußen das Rassenpolitische Amt der NSDAP.³²² Der Mediziner lehnte 1933 Schwangerschaftsabbrüche aufgrund einer eugenischen Indikation ebenso wie „Euthanasie“ als nicht notwendig ab.³²³ Gleichzeitig gehörte er seit 1934 als ärztlicher Beisitzer verschiedenen Erbgesundheitsgerichten an, die über die Anordnung von Zwangssterilisationen entschieden. Kuller führt aus, dass der Reichsärzteführer Loeffler 1939 als einen „der ersten Ärzte in den Plan zur Ermordung geistig behinderter Kinder eingeweiht“ habe, Loeffler habe aber nach eigenen Angaben nicht mitwirken wollen.³²⁴ Dennoch verfolgte er 1942 ein Projekt über „erbbiologische Fragen nach sozialen Gesichtspunkten“ innerhalb der Begleitforschung zur „Kindereuthanasie“.³²⁵ Bis heute ist diese Zusammenarbeit nicht im Detail untersucht. In der Bundesrepublik veröffentlichte Loeffler später
Vgl. ebd., S. 216. Vgl. Klee, Loeffler, 2007, S. 376. Schmuhl, Hans-Walter: Grenzüberschreitungen. Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik 1927– 1945. Göttingen 2005, S. 516. Vgl. im Folgenden ebd., S. 68, S. 76 f. und S. 216. Vgl. Klee, Loeffler, 2007, S. 376. Vgl. Schmuhl, Grenzüberschreitungen, 2005, S. 207 f. Vgl. Klee, Loeffler, 2007, S. 376. Vgl. Kaminsky, Rassenhygiene, 2005, S. 225. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 229, Fn. 25. Vermutlich betrieb Loeffler anhand von Fotos Auswertungen zum Vorkommen von Papillarlinien auf der Hand. Vgl. Schmuhl, Grenzüberschreitungen, 2005, S. 235 ff.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
115
Artikel, die eine Rechtfertigung anklingen lassen und in denen er um Verständnis warb.³²⁶ Loeffler erreichte den Höhepunkt seiner Karriere während der Zeit des Nationalsozialismus, als er 1942 Inhaber des Lehrstuhls für Erb- und Rassenbiologie der Universität Wien wurde. Zwei Jahre später kam ein weiteres Amt im Wissenschaftlichen Beirat des Bevollmächtigten für das Gesundheitswesen hinzu.³²⁷ Kollegen bezeichneten das von Loeffler geleitete Institut als „Mammutinstitut“.³²⁸ Die Errichtung kostete eine Million Reichsmark. Eine Abteilung für experimentelle Genetik, die der Krebsforschung gewidmet war, machte das Institut auf dem Gebiet des ehemaligen, nun dem nationalsozialistischen Deutschland „angeschlossenen“ Österreich einzigartig. Die Forschung stand im Dienst der Erhaltung der „Rasse“. Unter anderem versuchten seine Mitarbeiter, einen Bluttest zu entwickeln, durch den Rassenzugehörigkeit bestimmt werden sollte.³²⁹ Damit gingen Immunisierungsexperimente an Schwarzen Kriegsgefangenen einher, die diese schweren Gesundheitsgefahren aussetzten.³³⁰ Der Bluttest sollte eine wissenschaftlich gesicherte Expertise bieten und damit über die üblichen anthropologischen Abstammungsgutachten hinausgehen, die vor allem auf einer Vermessung des Körpers basierten. Entsprechende Gutachten zu erstellen, gehörte zu Loefflers wichtigsten Aufgaben und war eine bedeutende Einnahmequelle. Nach dieser Methode entstanden auch Vaterschaftsgutachten.³³¹ Mit dem Einmarsch der Roten Armee floh Loeffler in den Westen, wo die Alliierten ihn internierten.³³² Nach seiner Entlassung im Oktober 1945 lässt sich bis 1949 keine berufliche Tätigkeit nachweisen.³³³ Dann wurde Loeffler Sachverständiger für Vaterschaftsgutachten in Hannover. Obwohl er selbst angab, kein überzeugter Christ zu sein,³³⁴ hatte er gute Verbindungen zur evangelischen Kirche und wurde 1950 Anstaltsarzt einer evangelischen Einrichtung für Körperbehinderte.³³⁵ Seit 1949 saß er im Vorstand der DAJEB, deren Vorsitzender er von 1963 bis 1971
Vgl. Kaminsky, Dunkel, 2008, S. 208 f. Vgl. Klee, Loeffler, 2007, S. 376. Vgl. Schmuhl, Grenzüberschreitungen, 2005, S. 520. Vgl. Mayer, Thomas / Müller, Tobias: „Die Ungleichmacher“. In: Der Standard v. 17./18. April 2010. Verfügbar unter: www.derstandard.at/story/1271374498107/die-ungleichmacher, besucht am 18. Oktober 2020. Vgl. Schmuhl, Grenzüberschreitungen, 2005, S. 515 ff. Vgl. Mayer/Müller, Ungleichmacher, 2020. Vgl. ebd. Vgl. Klee, Loeffler, 2007, S. 376. Konsistorialpräsident an Theodor Schober, Brief, 18. Oktober 1966, ADE, HGSt 2334. Vgl. Kaminsky, Rassenhygiene, 2005, S. 224 f.
116
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
war.³³⁶ Zudem amtierte er als Vorsitzender der Niedersächsischen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung und arbeitete in der Eheberatungsstelle Hannover auch in der Praxis.³³⁷ In der Außenwahrnehmung galt seine Tätigkeit für die DAJEB als maßgebend.³³⁸ Im Jahr 1952 wurde Loeffler Mitglied des niedersächsischen Landesgesundheitsrats. Mit einem Lehrauftrag für Sozialbiologie an der Technischen Hochschule Hannover kehrte er zwei Jahre später in die Wissenschaft zurück. Da er sich seit 1933 mit Strahlengenetik befasste, saß er von 1957 bis 1966 als Fachmann im Arbeitskreis Strahlenbiologie der Deutschen Atomkommission.³³⁹ Loeffler war im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie und erhielt von 1968 bis 1972 einen Lehrauftrag an der Medizinischen Hochschule Hannover.³⁴⁰ Er warnte vor den Gefahren radioaktiver Strahlung und trug dazu bei, das Fach der Humangenetik zu etablieren. 1961 erhielt er das Bundesverdienstkreuz.³⁴¹ In der Bundesrepublik blieb Loeffler sowohl in seinem Duktus³⁴² als auch seinem Einsatz für die Eugenik den 1920er-Jahren verhaftet. Er trat für Sterilisationen aus eugenischen Gründen ein.³⁴³ Des Weiteren engagierte er sich für „Erziehung zur Ehe aus eugenischer Sicht“.³⁴⁴ 1963 kam seine frühere Tätigkeit einem Beiratsmitglied des Familienministeriums zu Ohren. Dabei stand auch der Vorwurf im Raum, Loeffler habe jüdische Professoren ins KZ gebracht. Als Loeffler davon erfuhr, engagierte er eine Rechtsanwaltspraxis, die mit zivil- und strafrechtlichen Maßnahmen drohte.³⁴⁵ Der Betreffende ließ daraufhin verlauten, die Aussage sei so nicht getätigt worden, und entschuldigte sich für einen vielleicht missverständlichen Eindruck seiner Äußerungen.³⁴⁶ Danach wandte Loeffler sich an das Familienministerium und bat, „vom Gesichtspunkt der Ehrenwahrung“ die An-
Vgl. Kruse/Schall, Geschichte, 1999, S. 6. Darüber hinaus wurde Loeffler 1970 Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung Hannover. Klee, Loeffler, 2007, S. 376. Vgl. Tägert, Ilse: Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung für das Geschäftsjahr 1953/54. Sonderdruck aus Soziale Arbeit 3 (1954), H. 11, S. 2, BArch, B 142/418. Vgl. [Ranke] an [Friedrich] Münchmeyer, Brief, 29. Mai 1957, ADE, CAW 1118. Vgl. Kaminsky, Rassenhygiene, 2005, S. 224 f. Vgl. Klee, Loeffler, 2007, S. 376. Vgl. Mayer/Müller, Ungleichmacher, 2020. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 230. Vgl. Kaminsky, Dunkel, 2008, S. 202 ff. Vgl. Loeffler, Lothar: „Erziehung zur Ehe in eugenischer Sicht“. In: Ders. (Hrsg.): Ehe und Familie als Gabe und Aufgabe. Göttingen 1959, S. 15 – 21 sowie ders.: „Erziehung zur Ehe in eugenischer Sicht“. In: Wege zum Menschen. Monatsschrift für Seelsorge, Psychotherapie und Erziehung und zur Förderung der Zusammenarbeit von Arzt und Seelsorger 11 (1959), S. 77– 83. Vgl. L. Burhenne an [Hans W.] Jürgens, Brief, 13. Dezember 1963, BArch, B 189/2815, Bl. 323 f. S. Hans W. Jürgens an L. Burhenne, Brief, 19. Dezember 1963, BArch, B 189/2815, Bl. 322.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
117
gelegenheit auch dem Familienminister zu unterbreiten.³⁴⁷ Die katholische Eheberaterin Josepha Fischer-Erling,³⁴⁸ die Loeffler auf die Vorwürfe aufmerksam gemacht hatte, bezweifelte diese von Beginn an. Aus Loefflers gutem Ruf schloss sie, dass die Anklagen nicht zutreffen könnten. Ihre Einschätzung zeugt von einem erstaunlichen Vertrauen in die Meinung der Fachkreise. Dies verwundert umso mehr, als die Eheberaterin eine Gegnerin des Nationalsozialismus gewesen und ihr zudem Loefflers Mitgliedschaft in der NSDAP bekannt war. Sie war überzeugt, Loeffler habe „keinen entscheidenden Einfluß“ im „Dritten Reich“ gehabt.³⁴⁹ Ihre Reaktion verdeutlicht, wie gut es Loeffler gelang, sein Renommee in der Bundesrepublik wiederherzustellen. 3.2.4.4 Eugenischer Arbeitskreis Fischer, Loeffler und Coerper waren im Eugenischen Arbeitskreis des Diakonischen Werks tätig. Diesen Einfluss nutzten sie maßgeblich, um sich auch in der Bundesrepublik für eugenische Maßnahmen einzusetzen.³⁵⁰ Das Evangelische Hilfswerk und die Innere Mission fusionierten 1957 unter dem Namen „Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland“, 1975 folgte die Namensänderung in „Das Diakonische Werk“.³⁵¹ Gemeinsam mit weiteren bekannten Rassen- und Sozialhygienikern beteiligten sich Fischer, Loeffler und Coerper ab 1959 am Entwurf eines Sterilisationsgesetzes in der Nachfolge des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, das nach Lothar Loeffler an [Helene] Große-Schönepauck, Brief, 28. Dezember 1963, BArch, B 189/2815, Bl. 325. Josepha Fischer-Erling (geb. Erling, 2.12.1900 – 31.12.1994) schloss 1926 ihr Jurastudium mit einer Promotion zu krimineller Abtreibung ab, in der sie das Thema differenziert beleuchtete. Bis zu ihrer Entlassung durch die Nationalsozialisten war sie Leiterin des Archivs der Deutschen Jugendbewegung. Danach engagierte sie sich ehrenamtlich als Eheberaterin für den Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB), dessen Ideal Fischer-Erling als akademisch gebildete, verheiratete Frau mit fünf Kindern entsprach. Während des „Dritten Reiches“ verhalf sie Juden zur Flucht. Von der Nachkriegszeit bis 1972 leitete Fischer-Erling die katholische Eheberatung in Köln. Ihre Beratungsarbeit galt als vorbildlich. Seit 1948 engagierte sie sich im Zentralvorstand des KDFB, von 1952 bis 1955 im Präsidium. Als gefragte Expertin war Fischer-Erling ab 1954 im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesfamilienministeriums aktiv und trat in der Debatte um die Familienrechtsreform gegen ein Letztentscheidungsrecht des Ehemannes ein.Vgl. Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 44 ff. Vgl. Josepha Fischer-Erling an Lothar Loeffler, Abschrift, 12. Dezember 1963, BArch, B 189/2815, Bl. 326 f. Vgl. im Folgenden Kaminsky, Rassenhygiene, 2005. Vgl. ebenso Kaminsky, Dunkel, 2008, S. 202 ff. Im Folgenden wird der Name Diakonisches Werk verwendet, unter dem die Institution bis heute bekannt ist. Zum Namen vgl. Behrendt-Raith, Nina: Gemeinde Diakonie. Eine qualitative Studie zu Einflussfaktoren und Handlungsperspektiven der Gemeindediakonie am Beispiel des Ruhrgebiets. Berlin 2018, S. 31.
118
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
dem Ende des Nationalsozialismus mit der Auflösung der Erbgesundheitsgerichte faktisch aufgehoben worden war. Gleichzeitig gingen die einzelnen Besatzungszonen damit jedoch sehr unterschiedlich um. In den westlichen Zonen blieben die gesetzlichen Grundlagen weitestgehend unangetastet, während die Ausführung des Gesetzes ausgesetzt wurde. Formal blieb es jedoch bis 1974 bestehen,³⁵² was Bestrebungen zur Einführung eines neuen Sterilisationsgesetzes begünstigte.³⁵³ Ab 1947 sind immer wieder entsprechende Vorbereitungen zu beobachten. Treibender Akteur innerhalb des Eugenischen Arbeitskreises war Fischer als beratender Sozialhygieniker des Diakonischen Werks. Innerhalb der evangelischen Kirche war die Haltung bestimmend, Eugenik in einer Rückbesinnung auf die Weimarer Republik zu begründen und damit als nicht typisch nationalsozialistisch zu betrachten.³⁵⁴ Die evangelische Moraltheologie brachte keine ernsten Einwände vor, was wesentlich zur Rechtfertigung beitrug. In diesem Sinne gelang es, das Sterilisationsgesetz grundsätzlich als positiv, nach 1933 aber als politisch missbraucht zu bewerten. Damit galten Zwangssterilisationen zwar als historische Vorreiter der „Euthanasie“, jedoch nicht als generelles Unrecht. Die Vorgängerorganisation des Eugenischen Arbeitskreises war allerdings in die im Nationalsozialismus durchgeführten Zwangssterilisationen eng verstrickt gewesen, denn sie hatte evangelische Anstalten bei der Umsetzung des entsprechenden Gesetzes beraten.³⁵⁵ Der neue Arbeitskreis knüpfte an dieses Gremium an, ohne dessen Tätigkeit zu diskutieren. Ein Schuldbewusstsein wird nicht sichtbar, vielmehr stilisierte man die Rolle evangelischer Einrichtungen in der Nachkriegszeit als Widerstand. Dieses Abrücken von der NS-„Euthanasie“ hatte nach Kaminsky eine Funktion: Für die ehemals darin verstrickten Ärzte, die mit der evangelischen Kirche und dem Diakonischen Werk in Verbindung standen, sollte gerade die vermeintliche Distanz „Gestaltungsspielräume für eugenisches Handeln in der Nachkriegszeit eröffnen“.³⁵⁶ Da der wissenschaftliche Kern der Eugenik als nicht vom Nationalsozialismus diskreditiert galt, konnten dies die Mediziner selbst ebenfalls für sich in Anspruch nehmen. Damit ist auch außerhalb der evangelischen Kirche
Vgl. auch Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 230. Vgl. auch Hahn, Daphne: „Vom Zwang zur Freiwilligkeit. Eugenisch orientierte Regulierungen im Nachkriegsdeutschland“. In: Wecker, Regina et al. (Hrsg.): Wie nationalsozialistisch ist die Eugenik? Internationale Debatten zur Geschichte der Eugenik im 20. Jahrhundert. Wien 2009, S. 259 – 270. Vgl. im Folgenden Kaminsky, Dunkel, 2008, S. 198 ff. Vgl. ders., Rassenhygiene, 2005, S. 206 ff. Zur Haltung der evangelischen Kirche bezüglich Eugenik vgl. auch Kapitel 1.2 Kirchliche Beratungsstellen. Ders., Dunkel, 2008, S. 209.
3.2 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung
119
sowohl auf nationaler wie internationaler Ebene zu konstatieren, dass eugenisches Denken sich bis in die 1960er-Jahre hinein hielt.³⁵⁷ Da Zwangssterilisationen und Eheverbote nach 1945 nicht als nationalsozialistisches Unrecht anerkannt wurden, mussten auch Rassenhygieniker kaum Rechenschaft ablegen.³⁵⁸ Ab 1959 beschäftigte sich der Wiedergutmachungsausschuss des Bundestages mit Zwangssterilisationen,³⁵⁹ deren Opfer die Entschädigungsgesetzgebungen von 1953 und 1956 nicht einbezogen hatten. Als das Diakonische Werk eine Stellungnahme abgeben sollte, kam Fischer dieser Aufforderung gemeinsam mit Münchmeyer im Oktober 1960 im Bundesfinanzministerium nach. Beide vertraten den Standpunkt, das Erbgesundheitsgesetz sei kein Unrecht gewesen. Deshalb lehnten sie jegliche finanzielle Wiedergutmachung ab. Dies entsprach auch den Vorstellungen des Ministeriums, das 1961 ebenfalls Bemühungen verfolgte, ein neues Sterilisationsgesetz zu initiieren. Der Eugenische Arbeitskreis plädierte für freiwillige Sterilisierung aus eugenischer Indikation. Vorgesehen waren dabei die Konzeptbereiche Sterilisation, „Anstaltsasylierung“ sowie Ehe- und Familienberatung.³⁶⁰ Nach den Erfahrungen im Nationalsozialismus sollte es aber nicht möglich sein, die Einwilligung Betroffener durch die Zustimmung Dritter zu ersetzen. Ebenso wenig geben sollte es eine Liste von Krankheiten, die Sterilisationen zwangsweise nach sich zogen.³⁶¹ Individuelle Entscheidungen in Bezug auf die eigene Reproduktion galten als selbstsüchtig und ablehnungswürdig. Allerdings setzten sich persönliche Familienplanung und Vorstellungen von Sexualität, die nicht allein auf die Zeugung von Nachwuchs gerichtet waren, zunehmend durch. Hintergrund waren der Wertewandel, eine Privatisierung gesundheitspolitischer Fragen sowie neue Entwicklungen wie die „Pille“. Diese gesellschaftliche Dynamik überholte die Debatten des Arbeitskreises. Zum Sterilisationsgesetz kam es nicht mehr. Auch die Stellungnahmen des Diakonischen Werks änderten sich in den 1960er-Jahren. Im Jahr 1964 resümierte Fischer, eine persönliche Eugenik habe bereits 1959 dazu geführt, dass die qualitative Bevölkerungspolitik verworfen worden sei.³⁶² Der Arbeitskreis, dem in Fragen der Biologie und Ethik ursprünglich eine einflussreiche Rolle zukam, trat ab 1968 nicht mehr zusammen. Er war überaltert, hatte aber schließlich auch den
Vgl. Kaminsky, Rassenhygiene, 2005, S. 239. Zur Rezeption der NS-Medizin nach 1945 vgl. Jütte, Robert: „Rezeptions- und kontroverse Diskursgeschichte der NS-Medizin nach 1945“. In: Ders. (Hrsg.): Medizin und Nationalsozialismus. Bilanz und Perspektiven der Forschung. Göttingen 2011, S. 311– 323. Vgl. im Folgenden Kaminsky, Rassenhygiene, 2005, S. 218 ff. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 230. Vgl. im Folgenden Kaminsky, Rassenhygiene, 2005, S. 227 ff. S. ebd., S. 231.
120
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Weggang Fischers zu beklagen, der insbesondere im Bereich Eheberatung und Sozialhygiene fachliche Expertise besaß. Seine Auflösung fällt mit dem Generationenwechsel innerhalb der Gesundheitsfürsorge zusammen und war gleichbedeutend mit dem Eingeständnis, an Relevanz verloren zu haben.
3.3 Selbstverständnis und Professionalisierung nichtkonfessioneller und evangelisch geprägter Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen Die DAJEB trieb die Aus- und Weiterbildung der Eheberatung wesentlich voran. Dies trug maßgeblich zu deren Professionalisierung im weiteren Sinn bei. Eheberatung entwickelte sich zu einem Beruf mit Qualitätsanforderungen und standardisierten Ausbildungswegen. Diesem Prozess, der sich parallel zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit insgesamt vollzog, widmet sich das vorliegende Kapitel. Raphael fasst Professionalisierung als Veränderungen, die sich aus der „Verwissenschaftlichung der Ausbildungsinhalte, der Akademisierung der Berufsabschlüsse und der Veränderung von Berufsverständnis und Berufspraxis“ ergeben.³⁶³ Etwas offener formuliert es Wendt, der den Begriff der Akademisierung meidet. Einer Profession zugrunde liegen ihm zufolge die „Einheitlichkeit des Verfahrens, die Kontrolle des Prozesses, in dem beruflich gehandelt wird, und seine wissenschaftliche Begründung“.³⁶⁴ Diese Definition erscheint für die Gruppe der Eheberater als geeigneter. In diesem Sinne wird Professionalisierung im Folgenden anhand der Publikationen der DAJEB, ihrer Vorstände und von in der Praxis tätigen Eheberatern nachvollzogen und diskutiert. In ihren Publikationen traten die Versuche der Arbeitsgemeinschaft, über die Eheberatung ihre Gesellschaftsdeutungen durchzusetzen, klar zutage: Ehekrisen erschienen hier als Symptom einer weitreichenden sozialen Krise. Eheberatung hatte die Aufgabe, diese Krise zu beenden und letztlich dem Ideal einer konfliktlosen, harmonischen Partnerschaft näherzukommen. Dabei blieben viele Akteure den sozialhygienischen und eugenischen Diskursen der Vorkriegszeit verhaftet.
Raphael, Experten, S. 233. Wendt, Geschichte, 2008, S. 107.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
121
3.3.1 Vorstellungen von Ehe und Eheberatung in der DAJEB und ihrem Umfeld Mit ihren Denkschriften von 1949 und 1953 positionierte sich die DAJEB offiziell in der Jugend- und Eheberatung. Die Texte enthielten erstmals Anforderungen an Eheberatung und Berater, auf die sich ein breites Spektrum von Praxisakteuren geeinigt hatte. Die Denkschriften stellten damit erste Bemühungen dar, die Arbeit zu vereinheitlichen, und waren ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu ihrer Professionalisierung. Nach außen trugen die Veröffentlichungen wesentlich zur Bekanntheit der DAJEB und der Wahrnehmung ihrer Fachkompetenz bei. Damit entsprachen sie dem Selbstverständnis der Arbeitsgemeinschaft als vielfältige, die Eheberatung in Deutschland prägende Fachgesellschaft. Die DAJEB leitete ihre Aufgabe aus der Überzeugung her, „daß die Ordnung der Geschlechtsbeziehungen eine entscheidende Grundlage aller persönlichen und hieraus mittelbar auch aller sozialen Lebensordnung bildet“.³⁶⁵ Damit entsprach sie dem zeittypischen Argumentationsmuster einer „sittlichen“ Ordnungsvorstellung.³⁶⁶ Da nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft die Mehrheit der Menschen nicht mehr die notwendigen Voraussetzungen besaß, um diese sittliche Ordnung zu leben, wollte sie die Fähigkeit dazu stärken. Sie beschrieb jedoch nie näher, wie das auszusehen hatte. Die Denkschriften fassten die Ehe, aber auch die Geschlechterbeziehungen als betont irrational. In der Denkschrift von 1949 hieß es dazu: „Letzter Sinn und Geheimnis der Geschlechterbeziehungen sind mit dem Verstand nicht zu enträtseln. Sie sind vielmehr zu suchen in der Zusammengehörigkeit zweier Menschen, die als Geschöpf durch ihr Geschlecht in einzigartiger Mitmenschlichkeit aufeinander angewiesen sind.“³⁶⁷ Der Ehe kam gemäß der DAJEB eine gesellschaftliche Schlüsselrolle zu, denn sie sollte in ihrer intakten Form wiederum die Jugend zur Ehe erziehen. Sittliche Jugenderziehung und Eheberatung galten als untrennbare Aufgaben. Das machte es laut der Arbeitsgemeinschaft notwendig, verschiedene Fachrichtungen zusammenzubringen. Ihren eigenen Beitrag sah sie darin, die verstreuten Erfahrungen und Kräfte zu sammeln. Sie verstand sich nicht nur als Arbeitsgemeinschaft, sondern wurde darüber hinaus immer wieder als Fachgesellschaft bezeichnet. Trotz ihrer Mythisierung der Ehe vertrat sie den Anspruch, wissenschaftliche Grundlagenarbeit zu betreiben. Beide Aspekte formulierte sie auch noch zehn Jahre nach der Gründung.
DAJEB, Denkschrift, 1949, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. auch im Folgenden. Vgl. Tändler, Jahrzehnt, 2016, S. 100 f. DAJEB, Denkschrift, 1949, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle, S. 3.
122
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
„Sittlichkeit“ als Grundlage jedweder Ordnung war über die Jahre gleichbleibend auch das Hauptthema der Veröffentlichungen Joachim Fischers, des DAJEBVorsitzenden, und prägte seine Haltung zu Ehe sowie Eheberatung nachhaltig.³⁶⁸ In seinen Schriften hatte eine Erziehung zur Ehe, der sich die DAJEB widmen sollte, eine wichtige gesellschaftliche Funktion im Sittlichkeitsgefüge. Fischer ging davon aus, dass sich in allen Gesellschaftsschichten als Folge des Krieges eine Sittenverwahrlosung etabliert habe. Gerne verwies er in diesem Zusammenhang auf die „Schund- und Schmutz“-Literatur. Um der„Verwahrlosung“ entgegenzuwirken, solle die Gesellschaft, wie dies auch in den Denkschriften der DAJEB zum Ausdruck kam, zu einem geradezu mystisch beschriebenen Urbild des Menschen zurückkehren. Dies war nach Fischer in der Ehe exemplarisch erlebbar. Häufig findet sich in seinen Ausführungen ein mythisch-christlicher Anklang. Die Eheberatung werde immer „anthropologisch auf ein Ganzheitsbild ausgerichtet bleiben und hinter der Physis die Metaphysis kennen und ehrfürchtig zu erkennen suchen“.³⁶⁹ Ebenso wie Fischer begriff Carl Coerper, Vorstandsmitglied und späterer Vorsitzender der DAJEB, die Ehe als mythisches Phänomen. Ihre geheimnisvolle Kraft mache die Eheleute jeweils ganz zur Frau beziehungsweise zum Mann.³⁷⁰ Lothar Loeffler, ebenfalls Mitglied im Vorstand, begriff Ehekrisen ähnlich wie Fischer als Symptom einer weitreichenden sozialen Krise. Der Eheberatung wies er damit eine entscheidende Rolle bei der Heilung zu. Sie sei „vordringliche Aufgabe aller […], die um die Erhaltung des deutschen Staates und Volkes bemüht sind“.³⁷¹ Mit Fischer agitierte er gegen „Schmutz und Schund“. Dabei ging er so weit zu formulieren, dass die Initiatoren solcher Machenschaften Verbrecher gegen die Menschlichkeit seien.³⁷² Loeffler beschrieb die desintegrierenden Kräfte der Freizeit als Gefahr für Ehe und Familie, da in Bezug auf sie „noch keinerlei Verhaltensschemata für ein sinnvolles Leben“ bereitstehe.³⁷³ Darüber hinaus beklagte der
Vgl. z. B. Fischer, Joachim: „Die Ordnung der Geschlechterbeziehungen als Grundlage persönlicher und sozialer Ordnung“. In: Ders. (Hrsg.): Archiv für Jugend- und Eheberatung. Bd. 1, 1950, unveröffentlichtes Manuskript, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Ders.: Stand der Eheberatung in einigen europäischen Ländern und den USA. [1952], ADE, CAW 1117. Fischer, Ordnung, 1950, S. 5, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Zu Fischers Sicht auf Ehe und Ehevorbereitung vgl. auch Fischer, Jochen: Wir zwei wollen es besser machen. Ein Buch für Verlobte und junge Eheleute. Lahr 1964. Vgl. im Folgenden Schütz, Gesundheitsfürsorge, 2004, S. 195 f. Loeffler, Lothar: „Grundsätzliche Gedanken zur Frage der Jugend- und Ehekrise“. In: Caritas 53 (1952), H. 1– 2, S. 5 – 15, hier S. 15, DZI. S. ebd., S. 12. Loeffler, Lothar: „Arbeit, Freizeit, Familie in Hinblick auf die Ehe“. In: Ders. (Hrsg.): Arbeit, Freizeit und Familie im Hinblick auf die Ehe, das Alter und die Jugend. Hannover 1955, S. 6 – 20, hier S. 19.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
123
Mediziner in seiner Krisendiagnose die Reduzierung der Familie auf die Kleinfamilie und den Verlust der Betriebsgemeinschaft. Die Ehe selbst sah er als kleinste, aber wichtigste soziale Gemeinschaft. Die neuen Ehen betrachtete er nicht als wesentlich unglücklicher als früher, jedoch krisenanfälliger, weil ihre Basis Gefühle seien. Kernpunkte der Ehe waren für ihn „Sorge, Liebe, Treue, Eintreten für einander, echte Teilnahme aneinander, Gestaltung des Lebens der Familie“.³⁷⁴ Dabei ging er davon aus, dass Ehen Wandlungen durchmachten, woraus sich Schwierigkeiten ergäben. Den Umgang damit hielt er für entscheidend, damit die Ehe fortbestand. Loeffler publizierte deutlich weniger zum Thema Eheberatung als Fischer und Carl Coerper. Jedoch war er als Leiter der Eheberatungsstelle Hannover der einzige Vorstand, der aus der Praxis der Beratungsarbeit schrieb.³⁷⁵ Sowohl Fischer als auch Coerper³⁷⁶ lehnten eine relevante gesellschaftliche Entwicklung der Nachkriegszeit, die zunehmende Erwerbstätigkeit von Ehefrauen, ab. Fischer beschrieb diese gar als Bedrohung des Frauseins und damit auch als Bedrohung für Mann und Familie. In seinen Augen waren berufstätige Ehefrauen gar das zentrale Problem der Zeit.³⁷⁷ Weibliche Erwerbstätigkeit gefährdete die Geschlechterordnung, wie sie der DAJEB und ihren tonangebenden Persönlichkeiten vorschwebte. Wie die DAJEB insgesamt und auch Fischer und Coerper legte Loeffler großen Wert auf das Verhalten vor der Ehe und die Beziehung von Mann und Frau zueinander. Er sprach davon, dass die „Wesensverschiedenheit der Geschlechter […] beim Menschen vielleicht weniger primär naturaliter bedingt ist als sie scheinen mag, sondern möglicherweise viel stärker sekundär, sozialiter bedingt sein könnte“.³⁷⁸ Dass die Menschen ihre Rollen gemäß ihrer sozialen Funktion gestalten sollten, erkannte er damit an. Daraus folgte für ihn, die Geschlechterbeziehungen stärker über soziale Impulse zu steuern, um die „rechte Begegnung der Geschlechter in der Ehe und im weiteren sozialen Raum“ zu ermöglichen.³⁷⁹ Die in den DAJEB-Publikationen oft anklingende Mythisierung der Ehe spielte auch in der evangelischen Ehelehre eine wichtige Rolle, beispielsweise bei dem Ders.: „Die Krise der mitmenschlichen Beziehungen in der Ehe und das Scheidungsbegehren“. In: Soziale Arbeit: Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete 3 (1954), H. 2, S. 49 – 56, hier S. 49, DZI. Vgl. auch im Folgenden. Vgl. Kapitel 3.5.3 Modell-Beratungsstelle. Schütz, Gesundheitsfürsorge, 2004, S. 195 f. Vgl. Fischer, Jochen: „Erwerbstätigkeit der Ehefrau im Hinblick auf ihre Rolle als Gattin und Mutter“. In: Ehe und Familie 8 (1962), Nr. 1/2, S. 9 – 11, BArch, B 189/2815, Bl. 270 ff. Zu Fischers Haltung gegenüber der Erwerbstätigkeit von Ehefrauen vgl. auch Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 231. Loeffler, Lothar: „Gegenwärtige Probleme der Geschlechterbeziehung“. In: Soziale Arbeit: Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete 4 (1955), H. 4, S. 572– 582, hier S. 581, DZI. Ebd.
124
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Berater Theodor Bovet³⁸⁰. Innerhalb der evangelischen Eheberatungsarbeit war der Schweizer Mediziner richtungsweisend.³⁸¹ In der Ehe, wie er sie verstand, finde der Mensch seine Vollendung, Mann und Frau würden zur„Person der Ehe“ vereinigt.³⁸² Dabei ging er von einem romantischen Liebesideal aus, demzufolge die wahre Liebe nur in der Ehe gelebt werden könne. Dazu gehörte auch eine erfüllte Sexualität im Sinne eines ganzheitlichen Liebesverständnisses. Männlichkeit und Weiblichkeit galten Bovet mit ihren unterschiedlichen gesellschaftlichen Aufgabenbereichen als von Gott geschenkt. Der Mediziner sah sowohl die Institution Ehe als auch einzelne Ehen in der Krise. Das Ziel der Eheberatung war für ihn, die Zahl der guten Ehen zu vergrößern und der Ehe zu einem noch nie dagewesenen Ansehen zu verhelfen. Im Sinne Bovets galt in der Beratungspraxis „das Ehepaar als ein eigenes Individuum“.³⁸³ Dabei standen Mitte der 1950er-Jahre verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Ratsuchende konnten sich schriftliche Auskünfte einholen. Auch wenn die Berater dies selten erwähnten, wird deutlich, dass der Umfang der brieflichen Beratung nicht unerheblich war. Ausführliche Korrespondenz war im Sprechstundenplan nicht vorgesehen und sehr zeitraubend. Besucher konnten aber auch vor Ort an einer Individual- oder Gruppenberatung teilnehmen. Individualberatung umfasste dabei nicht nur einzelne Personen, sondern auch Ehepaare. Theodor Bovet (28. 5.1900 – 6. 3.1976) wurde 1928 an der Universität Zürich in Medizin promoviert und arbeitete anschließend als Nervenarzt. Ursprünglich konfessionslos, wandte Bovet sich in den 1930er-Jahren dem Christentum zu. 1949 gründete er die Evangelische Eheberatungsstelle in Zürich, die er auch selbst leitete. 1960 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät. Im selben Jahr gründete er auch das Christliche Institut für Ehe- und Familienkunde in Basel. Als dieses später aufgelöst wurde, richtete der Eheberater 1967 das Institut für Ehe- und Familienwissenschaft in Zürich ein. Der vielfach publizierte Autor war Herausgeber der Zeitschrift Ehe. Zentralblatt für Ehe- und Familienkunde sowie Mitherausgeber der deutschen evangelischen Zeitschrift für Seelsorge und Beratung Wege zum Menschen. Das Hauptthema seiner Veröffentlichungen bildete die Beziehung zwischen Mann und Frau. Er begründete eine eigene Ehelehre (Gamologie), in der Mann und Frau in der „Person der Ehe“ ihre Vollendung als Einheit finden. In den 1950er-Jahren klärte Bovet über Homophilie auf und unterstützte Homosexuelle, die in die Schweiz flüchteten.Vgl. G. S.: „Bovet, Theodor“. In: Kosch,Wilhelm et al. (Hrsg.): Deutsches Literatur-Lexikon, Bd. 2. München 2002, Sp. 497– 498 sowie Website www.schwulengeschichte.ch, besucht am 16. Oktober 2020.Vgl. auch Eckart, Individuation, S. 81 ff. sowie Jäger, Protestantismus, 2019, S. 111 ff., S. 131 ff. und S. 323. Vgl. im Folgenden Eckart, Angelika M.: Bezogene Individuation in der Ehe: eine pastoralpsychologische Studie über den Beitrag systemischer Therapiemodelle für die institutionelle katholische Eheberatung. Frankfurt am Main 1999, S. 81 ff. sowie Jäger, Protestantismus, 2019, S. 111 ff., S. 131 ff. und S. 323. Bovet, Theodor: Die Ehe. Das Geheimnis ist gross. Tübingen 1962, S. 15. Vgl. im Folgenden Groeger, Verfahren, 1955, S. 6, DZI. Vgl. auch Blech, Maria: „Evangelische Eheberatung in neuem Stadium?“. In: Die Innere Mission. Zeitschrift des Diakonischen Werkes Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland 41 (1951), H. 12, S. 371– 374, DZI.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
125
Da Bovets Schriften zeitgenössisch hochrelevant waren, verwundert, dass der Leiter der hannoverschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung 1960 das Problem einer fehlenden Ehekunde ansprach.³⁸⁴ Wolfram Kowalewsky beklagte, dass der Berater in der Gesprächssituation mannigfaltige Einzelerkenntnisse als eine Einheit im Sinne einer Ehekunde erfassen müsse. Diese Aufgabe sei für den Einzelnen überaus groß, da es eine übergreifende Ehekunde bisher nur in Ansätzen gebe.³⁸⁵ Dabei hatte er zuvor indirekt auf Bovet verwiesen. Kowalewsky sah die Aufgabe der Beratung darin, den Ratsuchenden anzuleiten, die Gesamtzusammenhänge seiner Ehe zu erkennen. Zum Partner und zur Ehe gebe es zwei Wege: einerseits über die Stärkung der eigenen Persönlichkeit und andererseits über die Überwindung der Einzelpersönlichkeit.³⁸⁶ Letzterer Gedanke findet sich auch in Bovets „Person der Ehe“. Beratung, wie sie die Praktiker in Fachartikeln beschrieben, umfasste sowohl äußere Faktoren wie die Vermittlung von Haushaltshilfen als auch Unterstützung bei der Lösung seelischer Konflikte. Dabei lässt sich ein Denken in Schuldkategorien beobachten. Als gemeinsame Wurzel zahlreicher Streitpunkte galt die „Ichbezogenheit der Eheleute, die Unfähigkeit, eine echte Partnerschaft zu verwirklichen. Der Ehegatte wird nicht in seiner Wirklichkeit, in seinem Sosein erkannt, nicht in seiner Wesensart verstanden […]. Er soll vielmehr dazu dienen, bewußte oder unbewußte Ansprüche zu erfüllen.“³⁸⁷ Sowohl bewusste als auch unbewusste Wunschbilder gefährdeten dabei die Ehe. Der Autor folgerte: „Entscheidend ist, daß beide Partner bereit sind, ihren Schuldanteil einzusehen, daß sie nach dem Sinn ihrer Not fragen lernen. Dann können Ehekrisen zu Heilungskrisen und Reifungsprozessen werden.“ Eheberater sahen in Krisen und Beratung die Chance, dass der Einzelne und das Paar gemeinsam wachsen könnten. Dabei spielte zumindest in den evangelischen Stellen durchaus die Frage eine Rolle, ob die Ratsuchenden aus vernünftigen Erwägungen ihre Ehe aufrechterhalten und vertiefen wollten oder auch „als Christ die Ehe und Familie als Schöpfungsordnung Gottes“ erfuhren und entsprechend lebten. Dass die in der DAJEB vertretene evangelische Eheberatung damit bewusst religiös ausgerichtet war und als seelsorgerischer Dienst hier eventuell im Gegensatz zu paritätischen oder amtlichen Stellen stand, kommunizierte ein Artikel von 1951 explizit. Ein Widerspruch zur DAJEB bestand darin in den Augen der Autorin nicht. Die verbandlichen Grundsätze galten ihr vielmehr auch
Vgl. im Folgenden Kowalewsky, Eheberatung. S. ebd., S. 325. S. ebd., S. 324. Schorsch, Helene: „‚Miteinander alles Gute und Böse tragen‘. Aus der Arbeit einer Vertrauensstelle für Ehe- und Familienfragen“. In: Das Diakonische Werk, Nr. 3, Stuttgart 1956, S. 3 – 4, hier S. 3, DZI. Im Folgenden ebd.
126
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
für die evangelische Beratungsarbeit als wertvoll, insbesondere in Hinblick auf die Strenge, mit der die DAJEB voreheliche Sexualität und Verhütung ablehnte.³⁸⁸ Wie war nun sicherzustellen, dass die Ehe wieder zum stabilisierenden Faktor einer sittlichen Gesellschaftsordnung wurde? Die Antwort der DAJEB auf diese Frage lautete voreheliche Beratung. Hier wollte sie das Interesse der Öffentlichkeit besonders fördern, dem Bereich gelte es, langfristig „die bevorzugte Aufmerksamkeit“ zuzuwenden.³⁸⁹ In diesem Sinne definierte eine Denkschrift der DAJEB 1953 ihre Tätigkeit näher als Beratung, in der „Menschen in den Nöten und Schwierigkeiten ihrer Ehe […] beraten werden können, in denen sie aber auch persönlichen Rat und Hilfe erhalten zur rechten Vorbereitung auf die Ehe, zur rechten Gattenwahl und zur Vermeidung von Schäden und Schwierigkeiten in der Ehe“.³⁹⁰ Zur vorbereitenden Eheberatung gehörten auch Aspekte der Ehetauglichkeit, Eugenik und Geburtenregelung. Die „Beratung und Betreuung von Eheleuten, deren Ehe in ernster Gefahr ist mit dem Ziel, möglichst die Ehe zu erhalten und eine dem Wesen der Ehe entsprechende Lebensgemeinschaft zu schaffen“,³⁹¹ war zumindest in den Anfangsjahren keine Priorität in der DAJEB, sondern stand erst an vierter Stelle. Die Definition der Beratung klang damit zwar personal, jedoch orientierte sich die Denkschrift in erster Linie an Vorstellungen von der Institution Ehe. Die Betonung lag auf der vorbereitenden eugenischen Eheberatung und nicht auf den individuellen Bedürfnissen der Ratsuchenden. Eugenik spielte in den Publikationen von Fischer und Coerper für die vorbeugende Eheberatung eine zentrale Rolle. Fischer grenzte die von ihm angestrebte professionelle Beratung sowohl von der „mißverstandene[n] Eugenik“ des Nationalsozialismus als auch vom liberalen „Mißverständnis über die Rolle des Sexuellen“ in Sexualberatung sowie Geburtenregelung ab.³⁹² Er war der Überzeugung, dass „die Eugenik ein wesentlicher Bestandteil der Eheberatung ist und bleibt“.³⁹³ Den Misserfolg der eugenischen Beratung führte er nicht auf die negativen Erlebnisse der Bevölkerung im „Dritten Reich“ zurück.Vielmehr gab er der zersplitterten, uneinheitlichen und widersprüchlichen Eheberatung in Deutschland die Schuld.³⁹⁴
Vgl. Blech, Eheberatung, 1951, S. 371 und S. 374, DZI. DAJEB, Denkschrift, 1953, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle, S. 5. Ebd., S. 3. Ebd. Vgl. Fischer, Formen, 1953. Vgl. auch ders., Stand der Eheberatung in einigen europäischen Ländern und den USA. [1952], ADE, CAW 1117, S. 43. Ders.: „Stand und Zukunft der Eheberatung“. In: Der öffentliche Gesundheitsdienst. Monatsschrift für Gesundheitsverwaltung und Sozialhygiene 14 (1952), H. 3, Sonderdruck, S. 90 – 96, hier S. 90, ADE, CAW 1117. Vgl. ebd., S. 93.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
127
Er betrachtete es als selbstverständlich, dass neue Beratungsstellen mit den Gesundheitsämtern in eugenischen Fragen eine sehr enge Zusammenarbeit pflegten.³⁹⁵ Direkt dort angesiedelt sein sollte Eheberatung jedoch nicht, wie frühere Erfahrungen zeigten, und sie sollte auch keinen amtlichen Charakter haben.³⁹⁶ Für Coerper ergab sich die Bedeutung der Eugenik in der Eheberatung auch daraus, dass die Partnerwahl vom biologischen Standpunkt aus für ihn die relevanteste Lebensentscheidung neben der Berufswahl darstellte. Ehe und Familie waren eins, im Zentrum stand die Frau. Sinn der Ehe war es, Kinder zu zeugen. Der Eheberatung kam damit bevölkerungspolitische Bedeutung zu.³⁹⁷ Beratung zu Verhütung und Geburtenkontrolle betrachtete Coerper zunächst als ausgeschlossen. Mitte der 1950er-Jahre formulierte er jedoch mögliche Ausnahmen.³⁹⁸ Auch vorehelichen Geschlechtsverkehr befand er für die spätere Ehe als schädlich. In der Eheberatung ging es ihm zunächst darum, Krankheiten auszuschließen. Loeffler äußerte sich in den vorliegenden Publikationen nicht zu Eugenik in der Beratungsarbeit. Lediglich aus einer Aktennotiz der Inneren Mission geht hervor, dass er Eheberatung als gemeinsame Aufgabe von Arzt und Seelsorger betrachtete, bei der eugenische Vorgehensweisen als ein Bereich erhalten bleiben sollten.³⁹⁹ Die aufgefundenen Materialien lassen nicht rückschließen, ob er der Eugenik in der Eheberatung tatsächlich eine geringe Rolle beimaß oder lediglich in der Öffentlichkeit vorsichtig damit umging. Verschiedene Fachzeitschriften berichteten über die Gründung der DAJEB. Häufig klang auch hier eine eugenische Haltung an oder die Autoren verwiesen explizit darauf, dass eugenische Maßnahmen notwendig seien, gerade im Bereich der Fürsorge. Ein Beitrag äußerte 1950 im Duktus früherer Jahre: „Die Folgewirkungen zweier Weltkriege haben den gesunden biologischen Aufbau unseres Volkes weitgehend zerstört und die Volkskraft geschwächt.“⁴⁰⁰ Daher sollten Gesundheitsförderung und Vorbeugung in den Vordergrund der Jugend- und Eheberatung treten. Die Gründung der DAJEB erschien in diesem Licht als positive Entwicklung. Ihre Ausrichtung wurde in Hinblick auf die Bekämpfung von Jugendverwahrlosung
Vgl. ebd., S. 96. Vgl. Fischer, J[oachim]: „Zur Einrichtung von Jugend- und Eheberatungsstellen“. In: Volksgesundheitsdienst (1950), H. 11, S. 279 – 282. Vgl. [Coerper, Carl]: „Beitrag zur Eheberatung“. In: Coerper, Karl [sic] (Hrsg.): Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitswesen 1 (1952), H. 10, S. 5 – 7, DZI. Vgl. Coerper, Carl: „Zur Methodik sachgemäßer Eheberatung“. In: Die Innere Mission. Zeitschrift des Diakonischen Werkes Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland 44 (1954), H. 7, S. 201– 208. Vgl. [Innere Mission], Aktennotiz, 14. März 1949, ADE, CAW 1117. ND, Arbeitsgemeinschaft, 1950, S. 137, DZI.
128
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
und Ehenot lobend als „umfassende erziehliche Beeinflussung“ beschrieben.⁴⁰¹ Teilweise druckten Fachzeitschriften einzelne Publikationen der DAJEB fast komplett ab und gaben sie kaum kommentiert wieder, beispielsweise die Zeitschrift für das Fürsorgewesen und die evangelische Publikation Wege zum Menschen, eine Monatsschrift für Seelsorge, Psychotherapie und Erziehung. ⁴⁰² Auch die Stimmen aus der Praxis befürworteten den präventiven Charakter der Eheberatung. Gegen eine Therapeutisierung bestehender Ehen grenzten sie sich eher ab. Mitte der 1950er-Jahre befand der Leiter der Hauptberatungsstelle für die Evangelische Kirche im Rheinland, Guido Groeger, das Zeitalter der Psychoanalyse erschwere die Erkenntnis über Dinge, die damit eben nicht greifbar seien. Der Psychotherapeut war der Überzeugung, man habe verlernt, die übergeordneten, ganzheitlichen Phänomene zu betrachten. Nun sei man dabei, sich diesen wieder zuzuwenden. Als Beispiel verwies Groeger auf den herauspräparierten Sexus, der wieder eingefangen werden müsse, nachdem er erschreckende Bedeutung erlangt habe. Dies gelinge nur in der ganzheitlichen Sicht auf Ehe und Familie. Die Beratungsarbeit bewege sich daher auf eine umfassende Familienberatung zu, innerhalb derer die Eheberatung das Kernstück bilde.⁴⁰³ Für die Protagonisten der DAJEB waren neben der Eugenik mit Sozial- und Psychohygiene auch zwei weitere Konzepte der Vorkriegszeit wichtig. Coerper zufolge sollte der Berater feststellen, ob eine Ehe die sozialhygienischen Voraussetzungen bezüglich Einkommen,Wohnung und Beruf erfüllen konnte. Diese Beratung betrachtete er als schwierig, mühsam und manchmal auch enttäuschend. Das machte in seinen Augen jedoch auch deutlich, wie groß die Aufgabe war. Eine Ehe wieder in Ordnung gebracht zu haben, war für ihn gleichbedeutend damit, einem Patienten das Leben zu retten.⁴⁰⁴ Explizit verortete auch Fischer sich als Sozialhygieniker mit psychohygienischem Auftrag.⁴⁰⁵ Fischer wollte die Sozialhygiene um das Geistig-Seelische erweitern und ihr einen neuen Impuls geben. Die Sozialhygiene bringe
Ebd., S. 138. Vgl. z. B. o. A.: „Umschau. Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung“. In: [Sozialamt der Landeshauptstadt Hannover (Hrsg.):] Zeitschrift für das Fürsorgewesen (1950), Nr. 16, S. 184– 185 sowie o. A.: „Jugend- und Eheberatung“. In: Wege zum Menschen. Monatsschrift für Seelsorge, Psychotherapie und Erziehung und zur Förderung der Zusammenarbeit von Arzt und Seelsorger 7 (1955), S. 315, DZI. S. Groeger, Verfahren, 1955, S. 2 f. Vgl. [Coerper, Carl]: „Eheberatung“. In: Coerper, Karl [sic] (Hrsg.): Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitswesen 1 (1952), H. 4, S. 2. Vgl. Fischer, Stand, 1952, S. 90 sowie Fischer, Joachim: „Jugend- und Eheberatung als psychohygienischer Auftrag an den Sozialhygieniker“. In: Gesundheitsfürsorge. Zeitschrift für die ge-
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
129
den Arzt […] mit dem ganzen Kreis jener Wissenschaften in Berührung, die sich um die Kenntnis der sozialen, kulturellen, aber auch seelischen und geistigen Umwelt des Menschen bemühen […]. Sie erkennt daher als ihre ureigenste Aufgabe, was heute weite Kreise der Gesamtmedizin als neuer Impuls erfüllt: Hüterin leib-seelischer Gesundheit im sozialen Raum zu sein!⁴⁰⁶
Dieses von ihm als leib-seelische Gesundheit oder Psychohygiene bezeichnete Vorgehen sah er als Garant,⁴⁰⁷ um das Verhältnis der Geschlechter zueinander vor und in der Ehe wieder adäquat herzustellen. Die Einhaltung der Geschlechterrollen beziehungsweise die „Differenzierung von Mann und Weib“ war in seinen Augen „die Wurzel jeder Mitmenschlichkeit“ und der sozialen Ordnung. Damit stellte sich „der Psychohygiene die eindeutige Aufgabe, sich zunächst der Familie, den Ehen, der Jugend […] zu widmen“.⁴⁰⁸ Auch Carl Coerper publizierte in großem Umfang zu diversen Themen.⁴⁰⁹ Seine Vorstellung von Eheberatung orientierte sich dabei weiter an seinem bereits in der Weimarer Republik entwickelten Konzept der „sozialhygienischen Diagnose“.⁴¹⁰ Für alle Veröffentlichungen der DAJEB galt, dass verschiedene Kernaspekte häufig vage blieben. Die Arbeitsgemeinschaft schrieb der Ehe selbst und dem Verhältnis der Geschlechter zueinander einen letztlich rätselhaften, dem Verstand nicht zugänglichen Charakter zu. Die Vorstellungen der Vorstände unterschieden sich in manchen Punkten kaum. Die „sittliche Ordnung“ spielte eine zentrale Rolle, insbesondere in den Publikationen Fischers. Hingegen verstanden er und Coerper sich anders als Loeffler mehr als Sozialhygieniker. Fischer wollte Sozialhygiene um Psychohygiene erweitern, während Coerper den von ihm geschaffenen LeibseeleAnsatz verfolgte. Die Aufgabe des Beraters erscheint bei Coerper als eine weisungsgebende, was eigentlich mit den Grundsätzen der DAJEB nicht übereinstimmte. Loeffler strebte hingegen mehr eine Begleitung der Ratsuchenden an. Fischer äußerte sich dazu nicht. Den Vorständen gelang es offenbar, mit teilweise voneinander abweichenden Vorstellungen zu operieren. Die Mitglieder der DAJEB
sundheitlichen Aufgaben im Rahmen der Familienfürsorge 1 (1951), Sonderdruck, LAB, B Rep 012, 176. Vgl. auch im Folgenden. Ebd., S. 10. Laut dem zeitgenössischen Psychologen Karl Mierke gab es drei Ebenen der Psychohygiene: Die präventive, die restitutive und die kurative.Vgl. Mierke, Karl: Psychohygiene im Alltag. Stuttgart 1967, S. 8. Fischer geht auf diese Einteilung nicht ein, seine Ausführungen scheinen sich jedoch vor allem an präventiver Psychohygiene zu orientieren. Fischer, Eheberatung, 1951, S. 10. Vgl. Schütz, Gesundheitsfürsorge, 2004, S. 182. Vgl. Kapitel 3.2.4.2 Carl Coerper.
130
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
setzten sich mit den Positionen der Vorstände nicht auseinander, vermutlich, da Vielseitigkeit ein wichtiges Arbeitsprinzip des Verbands bildete. Die eugenische Beratung stellte explizit einen Bestandteil der Arbeit dar. Schütz formuliert, in der DAJEB spiegele sich „ein Konglomerat struktureller Vorstellungen zur Beratungsarbeit, typischen der Gesundheitsfürsorgevorstellung Carl Coerpers entspringenden konstitutionsklinisch-sozialhygienischen Anteilen und einer evangelisch-christlichen Moralvorstellung“.⁴¹¹ Dem ist sich anzuschließen.
3.3.2 Die Beraterpersönlichkeit Eine Frage, welche die DAJEB in ihren Denkschriften, aber auch ihre Vorstände und die Eheberater selbst intensiv beschäftigte, war diejenige nach der geeigneten Beraterpersönlichkeit. Wie sollte ein Eheberater beschaffen sein, dem die gesellschaftlich als zentral wahrgenommene Funktion anvertraute wurde, Ehen wieder ins Lot zu bringen? Laut DAJEB waren Fachkenntnisse ebenso bedeutend wie persönliche Eignung und praktische Erfahrungen. Dennoch ging die Denkschrift von 1953 vor allem auf die Wesensart und notwendigen Eigenschaften der Berater ein.⁴¹² Persönlichkeitsbildung, verbunden mit dem christlichen Glauben, war auch im sich neu formierenden Feld der Sozialen Arbeit eines der wichtigsten Ausbildungsziele.⁴¹³ Damit reihte sich die DAJEB in eine Praxis mit längerer Tradition ein. Bereits in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, als Alice Salomon in den „Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit“ in Berlin begann, Form und Inhalte sozialer Ausbildung zu gestalten, ging es sowohl um Fachwissen als auch die Hinwendung der Persönlichkeit zur sozialen Gesinnung.⁴¹⁴ Der DAJEB war ihre Außenwirkung sehr wichtig. Sie wollte ungeeignete Berater aus den ihr angebundenen Stellen fernhalten. Ebenso legte die Arbeitsgemeinschaft Wert darauf, dass jeder Eheberater das Ansehen der gesamten Arbeit stützte. Professionalität wurde sowohl auf der Ebene der Praxis als auch in Bezug auf Ausbildungsnotwendigkeiten erstmals thematisiert. Die Teamarbeit blieb während des gesamten Untersuchungszeitraums ein wesentliches Merkmal der Eheberatung im Sinne der DAJEB.
Schütz, Gesundheitsfürsorge, 2004, S. 195. Vgl. auch Kapitel 3.2.4 Rassen- und Sozialhygieniker. Vgl. DAJEB, Denkschrift, 1953, S. 8 ff., DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. Neuffer, Kunst, 1990, S. 74 ff. Vgl. Sachße, Mütterlichkeit, S. 128.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
131
Als besonders gute Voraussetzung für einen Eheberater galt laut Denkschrift eine akademische Bildung und ein sozialer oder pädagogischer Beruf.⁴¹⁵ Eine der wichtigsten Eigenschaften war die Einsicht in die eigenen Grenzen. Aus ihr erwächst die nötige Zurückhaltung gegenüber dem Klienten. Der Berater muß stets den Klienten selbst entscheiden lassen; er kann ihm nur die Konsequenzen verschiedener Verhaltungsweisen klar machen. Der Berater darf keine Macht ausüben wollen […]. Der Berater muß sich in aller Bescheidenheit klar darüber sein, daß er keine Wunder wirken kann; das bewahrt ihn auch vor Mutlosigkeit.⁴¹⁶
Idealerweise sollten Eheberater zwischen 35 und 55 Jahre alt sein, um „in den gleichen Erlebnisbereichen mit der Generation der zu Beratenden [zu] wurzeln“. Darüber hinaus sollten sie selbst in einer guten Ehe leben. Kinder zu haben war wünschenswert, denn „die tägliche Erfahrung im eigenen Leben gibt jedem Jugendund Eheberater das beste Rüstzeug für seine Arbeit“.⁴¹⁷ Als ganz entscheidend für die Eignung galten Charakter und Temperament, Gesinnung und sittliche Bindung. Der Berater hatte eine breite Spanne an Fähigkeiten mitzubringen. Er sollte einen nüchternen Blick für Tatsachen haben sowie Sensibilität und Differenziertheit beweisen – jedoch nicht zu viel, da dies hemmend wirke. Darüber hinaus waren eine gewisse Resolutheit und Durchsetzungsvermögen, Verschwiegenheit, Humor und Einfallsreichtum Voraussetzung. Im Gespräch sollte er nicht übereilt urteilen, Besonnenheit zeigen und die Übersicht behalten. Auch musste er unparteiisch bleiben: „Jede Parteinahme für einen der beiden Ehepartner widerspricht dem Sinn einer sachgemäßen Eheberatung.“⁴¹⁸ Schließlich galt es, das Vertrauen beider sich möglicherweise streitender Parteien zu gewinnen. Dafür brauchte der Eheberater weitere bestimmte Eigenschaften. Dazu gehörte ein „primäres und unbeirrbares Wohlwollen für Menschen“. Nicht Distanziertheit und Belehrung, sondern „unmittelbare […] Freundlichkeit, Wärme und Kontaktfähigkeit“ sollte er an den Tag legen. Das war eine Gratwanderung, da die Beratung kein Gespräch auf Augenhöhe war. Letztlich herrschte die Überzeugung, der Berater müsse eine „selbstverständliche Überlegenheit“ haben, die sich aber weder „moralisch überhebt noch sich mit dem Klienten anbiedert. Der Klient will im Grunde eine Autorität hören und doch einen Menschen finden. Ein in ruhiger Freundlichkeit gewahrter Abstand ist auch die beste Art, unkontrollierte Übertragungssituationen zu vermeiden.“⁴¹⁹ In diesem Zitat zeigt sich auch das Bild, das die DAJEB von den Ratsuchenden hatte.
Vgl. im Folgenden DAJEB, Denkschrift, 1953, S. 8 ff., DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Ebd., S. 11. Ebd., S. 9. Ebd., S. 10. Ebd., S. 9 f.
132
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Diese suchten demzufolge eine freundliche Autorität, die sie in der selbstverständlichen Überlegenheit des Eheberaters finden würden. Gleichzeitig blieb das Bild des Beraters, ähnlich wie das der Geschlechterbeziehungen in der Ehe selbst, unkonturiert. Dies war beabsichtigt: „Das Beste, was ein Berater zu geben hat, ist nicht rational zu fassen.“⁴²⁰ Die Arbeit im Sinne der DAJEB war keine weibliche Domäne. Die Arbeitsgemeinschaft befürwortete aber explizit, auch Frauen in großem Umfang einzubeziehen, da sie als besonders einfühlsam galten.
3.3.3 Standardisierung der Ausbildung Die DAJEB hatte mit ihren Denkschriften frühzeitig Anforderungen an Eheberatung und -berater festgehalten. Damit war erstmals definiert, welche Voraussetzungen von ihr anerkannte Eheberater erfüllen sollten. Zudem wurde eine Vereinheitlichung angestoßen, wenn auch auf geringem fachlichem Niveau.⁴²¹ Ein erster Ausbildungslehrgang fand 1952 statt. Er umfasste in diesem Jahr 15 Abende à vier Stunden. Um von der Arbeitsgemeinschaft anerkannt zu werden, mussten Berater entsprechend der Denkschrift über die Voraussetzungen sachgemäßer Jugend- und Eheberatung ab 1953 einen solchen Lehrgang von 14 dreistündigen Abendterminen absolvieren. Teilnehmer erhielten die Anregung, zwei schriftliche Arbeiten zu verfassen. Darüber hinaus waren sie ein Jahr lang in einer von der DAJEB anerkannten Beratungsstelle tätig und besuchten regelmäßige Fortbildungen,⁴²² was die DAJEB als ihre Hauptaufgabe bezeichnete.⁴²³ Bereits in ihrem Gründungsjahr begann die DAJEB, in Detmold erste einwöchige Kurse abzuhalten, die bis 1951 bis zu dreimal jährlich stattfanden.⁴²⁴ 1952
Ebd., S. 11. Es scheint sich hier um eine positive zeitgenössische Charakterisierung zu handeln. Selbst im als besonders methodisch und technisch empfundenen Konzept der Casework wird auf „das irrationale Moment, das über das Können hinausgeht und dieses schließlich beherrscht“, verwiesen. Kamphuis, Hilfe, 1968, S. 32. Die Arbeit der Niederländerin Marie Kamphuis hatte einen großen Einfluss auf die Soziale Arbeit in Deutschland. Vgl. Neuffer, Kunst, 1990, S. 115 ff. Kamphuis stand mit Ilse Tägert, der Psychologin der Jugend- und Eheberatungsstelle Hannover, in Kontakt.Vgl. Kamphuis, Marie: „Vorwort zur zweiten Auflage“. In: Dies.: Die persönliche Hilfe in der Sozialarbeit unserer Zeit. Eine Einführung in die Methode der Einzelfallhilfe für Praxis und Ausbildung. Stuttgart 1968, o. S. Auch die DAJEB selbst schätzte die Ausbildungslehrgänge im Nachhinein ein als „weit von dem entfernt […], was heute Weiterbildung ausmacht“. Kruse/Schall, Geschichte, 1999, S. 6. Vgl. Kapitel 3.3.1 Vorstellungen von Ehe. Vgl. DAJEB: Jahresbericht 1951. Detmold [1952], S. 8 f., DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. Fischer, Jahre, 1959, S. 38 sowie Kruse/Schall, Geschichte, 1999, S. 8.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
133
folgte in Kooperation mit der lokalen Bielefelder Arbeitsgemeinschaft der erste Ausbildungslehrgang für Jugend- und Eheberatung.⁴²⁵ Er diente einerseits dazu, Eheberater weiterzubilden, andererseits als Erweiterung der örtlichen Beratungsmöglichkeiten. Die meisten der 38 Teilnehmer waren Fürsorgekräfte, Ärzte und Erzieher. Sie hatten über eine von der DAJEB autorisierte Vorbereitungsgruppe die Zulassung zum Lehrgang erhalten. Sechs Teilnehmer folgten der Empfehlung, eine schriftliche Arbeit zu einem selbst gewählten Gegenstand zu verfassen,⁴²⁶ einige andere entschieden sich für eine nicht näher definierte Halbjahresarbeit zu einem von der DAJEB angebotenen Thema.⁴²⁷ Nach Abschluss des Kurses stellte die Bielefelder Arbeitsgemeinschaft aus dem Teilnehmerkreis eine zusätzliche Beratergruppe für ihre Stelle zusammen. Weitere Berater planten, als Helferkreis zur Verfügung zu stehen und sich zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Behörden zu betätigen. Mit der Bildung der Gruppe betrachtete die DAJEB die Hauptaufgabe des Lehrgangs als erfüllt. Die Referenten des Arbeitslehrgangs waren mit Joachim Fischer, Carl Coerper und Otmar Freiherr von Verschuer stark sozialhygienisch geprägt, die Vortragenden der Inneren Mission auch evangelisch.⁴²⁸ Daneben sprachen verschiedene Leiter von Eheberatungsstellen. Themen waren unter anderem Vererbung und Erziehung, Ehe und Ehelosigkeit als Lebensordnung, Ökonomie des Haushaltes, Fehlformen der Sexualität, Jugend und Familie im Gesetz. Allerdings gab es auch Vorträge zu psychologischen Themen, wie beispielsweise Psychologie des Jugendalters sowie ärztliche und psychotherapeutische Fragen der Eheberatung – Letzteres stark eugenisch geprägt.⁴²⁹ Methodische Aspekte waren vermutlich über Vorträge zu Fehlformen des Helfens oder Organisation und Methode der Beratung abgedeckt. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass sich diese Referate inhaltlich auf sehr allgemeine Ratschläge beschränkten wie die, nie Ungeduld zu zeigen,
Vgl. im Folgenden DAJEB: Bericht über den ersten Ausbildungslehrgang für Jugend- und Eheberatung, [1952], BArch, B 142/2043, Bl. 400 ff. Zu folgenden Themen: Der Lebenskreis der Frau, Das Verhältnis von Mutter und Kind, Aufgaben der Sexualpädagogik, Die berufstätige Mutter und ihr Kind, Analyse von Halmes „Theresa“, Darstellung eines Beratungs-Übungsfalles. Zu folgenden Themen: Familie und Betrieb als konkurrierende Gemeinschaftsformen, Die unterschiedliche Erziehungsproblematik bei Pflege- und Adoptivkindern, Die zu erwartenden Auswirkungen der formaljuristischen Gleichberechtigung in der Ehe und Familie, Auswirkungen der disharmonischen Reifung und Möglichkeiten zu ihrem Ausgleich. Zur Beratungspraxis von Verschuer vgl. H., Familie, [2022]. Bereits 1951 bewertete die DAJEB Tiefenpsychologie als unentbehrlichen Bestandteil der Eheberatung, deren Nutzung aber Fachkräftemangel, Zeitaufwand und fehlende Finanzierung im Wege standen.Vgl. Fischer, J[oachim]: Zusammengefasster Bericht des VIII. Arbeitslehrganges, Januar 1951‚ S. 2, LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5 – 30 – 02.
134
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Klienten sich aussprechen zu lassen und eine Brücke des Verstehens zwischen den Beteiligten zu bauen. Ziel der Beratung war, Zeit zu gewinnen, um eine eventuelle Scheidung hinauszuzögern. Generell sollten Klienten die Situation des Ehepartners besser verstehen und auch lernen, ihre eigene Lage realistischer und ruhiger zu sehen. Nachdem der Berater Hoffnungsmomente betont und konkrete Ratschläge gegeben hatte, sollte das Gespräch enden. Die Erfahrungen des Lehrgangs führten unter anderem dazu, bei künftigen Kursen an jedem Abend einen Übungsfall zu besprechen. Schließlich trugen sie dazu bei, die Denkschrift über die Voraussetzungen sachgemäßer Jugend- und Eheberatung von 1953 zu formulieren. Weitere Ausbildungslehrgänge fanden regelmäßig statt.⁴³⁰ Die Themen umfassten später unter anderem Praxisberichte und -übungen, sittliche Ordnung, Vorgehen in der Beratung, juristische Fragen sowie Erziehung und Sexualpädagogik.⁴³¹ In Gegenden, in denen Eheberatung noch unbekannt war, wurden einwöchige Arbeitstagungen abgehalten, um Interessierten aus Behörden und Spitzenorganisationen einen Einstieg zu vermitteln.⁴³² Mitglieder der DAJEB sollten darauf achten, „dass wirklich nur berufene Personen aller Fachrichtungen an unserer Arbeit teilnehmen“.⁴³³ Dabei wird erneut das Nebeneinander neuer psychologischer und psychotherapeutischer Ansätze sowie älterer eugenischer Prägungen deutlich. Vor allem zu Beginn waren die Kurse stark eugenisch beeinflusst. 1950 gab es beispielsweise Referate unter anderem über die Themen Bevölkerungsdynamik als Europäische und Weltfrage, das Leib-Seele-Problem, Gesichtspunkte der Menschenbeurteilung, Eugenik sowie Grundfragen des Erbes.⁴³⁴ „Eugenische Gedanken über die Vorbereitung zur Ehe“ behandelte Loeffler noch 1959.⁴³⁵ Gleichzeitig registrierte Fischer bereits zu Beginn der 1950er-Jahre, dass das Interesse an psychotherapeutischen Fragen zum Teil groß war. Dazu gab es ebenfalls Vorträge. Fischer selbst referierte beispielsweise 1951 über die Bedeutung der Tiefenpsychologie für das Verständnis der Jugend- und Eheprobleme. Wie häufig zeigt sich in der näheren Betrachtung allerdings, dass Fischer beziehungsweise die DAJEB Psychologie auf Fragen der Geschlechtsidentität im Sinne
Vgl. z. B. DAJEB: Informationsschreiben Nr. 12, Dezember 1954, S. 2, LAB, B Rep. 012, Nr. 176 sowie DAJEB: Informationsschreiben Nr. 18, Januar 1956, S. 11, LAB, B Rep. 012, Nr. 176. Vgl. DAJEB, Denkschrift, 1953, S. 14, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Da außer zum ersten Ausbildungslehrgang keine weiteren Berichte vorliegen, können deren Inhalte nicht weiter untersucht werden. Aus den vorgegebenen Themen lässt sich allerdings schließen, dass diese inhaltlich den Jahrestagungen der 1950er-Jahre entsprachen. Vgl. Fischer, Jahre, 1959, S. 38. Zum ersten Kurs liegt ein Bericht vor. Vgl. DAJEB: Bericht über den ersten Lehrgang der DAJEB, 1949, BArch, B 142/418, Bl. 58 ff. DAJEB: 6. Rundschreiben, 20. Mai 1950, ADE, JF 31. Vgl. DAJEB: V. Lehrgang, Mai 1950, BArch, B 142/418. Vgl. DAJEB: Arbeitswoche, [1959], BArch, B 191/163, Bl. 34.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
135
der sittlichen Ordnung reduzierten.⁴³⁶ Auch der darauffolgende Kurs bot eine Mischung aus psychologischen und psychotherapeutischen Ansätzen, diesmal mit Bezug zur Kindererziehung, wobei der Referent allerdings stets die Bedeutung erblicher Anlagen und der sittlichen Ordnung betonte.⁴³⁷ In den 1960er-Jahren trieb die DAJEB die Professionalisierung aktiv weiter voran. Ein Zusammenschluss der für die Eheberatung wichtigen Institutionen führte dazu, dass die Ausbildung ausgebaut und verbandsübergreifend standardisiert wurde. Die DAJEB, das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen (KZI) sowie die Konferenz für Evangelische Familienberatung (EKFuL), später das Evangelische Zentralinstitut für Familienberatung (EZI), verbanden sich im Deutschen Arbeitskreis Jugend-, Ehe- und Familienberatung (DAK). Wie der Arbeitskreis zustande kam, lässt sich anhand des vorliegenden Materials ebenso wenig nachvollziehen wie die Vorarbeiten zu den dort gefassten Beschlüssen.⁴³⁸ Im Februar 1963 beschloss der DAK eine Grundsatzerklärung über Wesen und Methode der Eheberatung. Im Jahr darauf legte er die „Rahmenordnung für die Ausbildung der Eheberater“ fest. Später folgten Leitsätze zur Verantwortung für Ehe und Familie. Beide Beschlüsse gingen dem Bundesfamilienminister zu.⁴³⁹ Der DAK konnte nunmehr die finanzielle Förderung der Ausbildung beim Bund beantragen.⁴⁴⁰ Die Verbände betonten in ihren Leitsätzen, ihre Aufgabe darin zu sehen, die sinnvolle Gestaltung von Beziehungen zu unterstützen. Sie führten Eheprobleme auf Missverhältnisse „zwischen hoch gespannten Erwartungen auf menschliche Erfüllung und ungenügender Entwicklung zu umfassender Liebesgemeinschaft“ zurück. Verheiratete sollten sich „in ihrer Eigenart annehmen und ihre personale Entwicklung gegenseitig achten und fördern. In ihrem leiblichen und geistigen Einswerden erfahren Mann und Frau Beglückung durch Geben und Nehmen; die leibliche Freude hat in der Ehe ihr eigenständiges Recht.“⁴⁴¹ Die Grundsatzerklärung definierte Eheberatung als helfenden Dienst an den Ehen. Die Beratung befasste sich demnach sowohl mit der Vorbereitung auf die Ehe als auch mit Problemen der Partnerwahl und Eheführung sowie allgemein mit
Vgl. Fischer, J[oachim]: Zusammengefasster Bericht des VIII. Arbeitslehrganges der DAJEB, Januar 1951‚ S. 2, LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5 – 30 – 02. Vgl. DAJEB: IX. Arbeitstagung, Juli 1952, BArch, B 142/418, Bl. 124. Der einzige Hinweis findet sich im Jubiläumsrückblick der DAJEB in der Aussage, die Verhandlungen seien lange und mitunter schwierig gewesen. S. Kruse/Schall, Geschichte, 1999, S. 8. Vgl. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 74, März 1966, S. 13 ff., BArch, B 189/2817, Bl. 222 ff. Da Bundesmittel nur vergeben werden konnten, sofern sie bundesweit wirksam wurden, stellte die Finanzierung der Ausbildung eine relevante Fördermöglichkeit dar. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 233. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 74, März 1966, S. 18, BArch, B 189/2817, Bl. 222 ff.
136
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Ehekrisen.⁴⁴² Hinzu kamen die Themen Ehelosigkeit sowie Partnerschaft der Geschlechter in der Gesellschaft. Der DAK definierte Beratung dabei nach wie vor als eine Hilfestellung, die über die Begleitung von Verheirateten in Krisensituationen hinausging und einen gesamtgesellschaftlichen Anspruch hatte. „Eheberatung […] steht unter der Verantwortung für die Ehe als einer vorgegebenen Seinsordnung. Sie […] ist sowohl ein diakonisch-seelsorgerlicher [sic] wie auch ein sozialer Dienst am Einzelnen und an der politischen Gemeinschaft.“⁴⁴³ Dies galt auch drei Jahre später noch in der novellierten Grundsatzerklärung. Das Aufgabenfeld der Beratung waren Einzel-, Paar- und Gruppengespräche, deren Ziel darin bestand, Verständnis für Wesen und Aufgabe der Ehe zu vermitteln, aber auch Einsicht in die eigene wie die Situation des Partners. In der Arbeit mit den Ratsuchenden ging es darum, notwendige Entscheidungen auszuloten und Verhaltenskorrekturen freizulegen. Diese Gespräche erschienen implizit als Methoden der Eheberatung. Ganz im Sinne der DAJEB war die Festlegung, diese müsse von einer Arbeitsgruppe getragen werden, die sich laufend weiterzubilden hatte. Sie sollte mindestens drei Vertreter aus den Berufsfeldern der Ärzte, Theologen, Psychologen, Juristen und Sozialarbeiter umfassen. Die Mitglieder sollten eine noch nicht näher definierte „besondere Ausbildung“ absolviert haben,⁴⁴⁴ die den hohen Anforderungen an Haltung, Methode, Wissen und Verschwiegenheit der Berater genügen sollte. Eheberatung war als hauptamtliche Tätigkeit anzustreben. Die DAK-Richtlinien dienten der Standardisierung der Ausbildung und Kontrolle der Berufsausübung. Sie erhielten 1964 in einer Rahmenordnung für die Ausbildung Gültigkeit. Zwei Jahre später überarbeitete der Arbeitskreis seine Richtlinien und gliederte die Ausbildung in einen Theorie- und einen Praxisteil. Die Theorie sollte Grundwissen in Ehe- und Familienkunde sowie eine Einführung in die Methodik der Beratungsarbeit vermitteln. Diese Kenntnisse galt es dann in der Praxisausbildung in einer Arbeitsgruppe einzuüben, die ein erfahrener Berater anleitete. Beide Ausbildungsteile beinhalteten eine Abschlussarbeit und ein -kolloquium. Wie genau sie die Ausbildung durchführten, blieb den einzelnen Verbänden ebenso überlassen wie die Auswahl der Interessenten. Dabei zielte das gesamte Vorgehen darauf, die Haltung des Eheberaters zu klären.⁴⁴⁵ Ob es bei dieser Haltung, wie bereits in der Denkschrift von 1953, weiterhin um die persönliche Ebene ging oder doch die methodische, bleibt offen. In der Arbeitsgruppe bestand durchaus das Bewusstsein, dass 60 Vorlesungsstunden nicht genügend Kenntnisse vermitteln konnten. Man konzentrierte sich auf
Vgl. ebd., S. 14. Ebd., S. 13 f. Ebd., S. 14. Vgl. ebd.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
137
Grundhaltungen und das Wissen über Zusammenhänge. Das EZI befand, dass die Vorlesungen vor allem darstellen sollten, wo die Probleme lagen. Darüber hinaus hatten die Unterrichtseinheiten den Zweck, zur Zurückhaltung und Vorsicht zu mahnen und Selbsteinsicht anzuregen. Ferner war beabsichtigt, mit dem Ausbildungsprogramm zu verdeutlichen, welche zukünftige Richtung die Weiterbildung einnehmen sollte.⁴⁴⁶ Richtlinien und Ausbildungsordnung traten mit Beginn des Jahres 1966 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt benötigte jede anerkannte Beratungsstelle sowie jeder Eheberater eine schriftliche Eignungsbestätigung des zuständigen Verbandes. Über die der DAJEB angegliederten Beratungsstellen entschied ein Anerkennungsausschuss, dem der DAJEB-Vorsitzende, zwei Vorstandsmitglieder, die in der Aus- und Fortbildung tätig waren, sowie zwei aktive Eheberater angehörten. Dabei orientierte sich die Arbeitsgemeinschaft in der Umsetzung explizit an ihrer Denkschrift von 1953.⁴⁴⁷ Indem die DAJEB sich an der Schaffung einheitlicher Ausbildungsrichtlinien beteiligte, trug sie dazu bei, die Eheberatung zu professionalisieren.⁴⁴⁸ Dass der Verband dafür eintrat, die Aus- und Weiterbildung zu normieren, prägte sein Bild nach außen und trug wesentlich dazu bei, dass sich die Eheberatung konsolidierte. Allerdings wurden die Beschlüsse aus den 1960er-Jahren kaum aktiv umgesetzt. Da sich der Verband aus dem Fortbildungsbereich aufgrund der Konkurrenz mit den konfessionellen Angeboten weitestgehend zurückgezogen hatte, bot er ab 1959 kaum mehr Lehrgänge an.⁴⁴⁹ Bis Ende der 1960er-Jahre führte er insgesamt nur noch fünf örtlich gebundene Kurse durch.⁴⁵⁰ Stattdessen traf er Vereinbarungen mit dem Katholischen Zentralinstitut und der Evangelischen Konferenz, Kandidaten in deren Kurse aufzunehmen.⁴⁵¹
3.3.4 Methoden Die einschlägigen Definitionen⁴⁵² von Professionalisierung betrachten eine wissenschaftlich basierte Methodik als eines ihrer wichtigen Kennzeichen. Der Vor-
Vgl. EZI: Vorschlag für einen Rahmenplan der Ausbildungsgebiete der Eheberater, 1963, BArch, B 191/10. Vgl. Müller, Professionalisierung, 2002, S. 15 f. Vgl. auch Kapitel 3.3.1 Vorstellungen von Ehe. Zur Professionalisierung in der Sozialen Arbeit vgl. Hammerschmidt/Sagebiel, 2010, S. 9 – 24. Vgl. Kapitel 3.2.2 Organisation und Aufgabenstellung und Kapitel 3.3.5 Kommunikation. Der Beschluss, sich aus der Aus- und Weiterbildung zurückzuziehen, wurde in den 1970erJahren revidiert. Vgl. Kruse/Schall, Geschichte, 1999, S. 9 f. Vgl. Halberstadt, Beratungsarbeit, 1986, S. 63 f. Vgl. Einleitung.
138
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
standsvorsitzende der DAJEB, Joachim Fischer, brachte das Verhältnis seiner Institution dazu 1950 prägnant zum Ausdruck: So […] mag unsere Arbeit […] sich dazu der verschiedensten Methoden bedienen, der naturwissenschaftlichen wie der pädagogischen, der physiologischen wie der psychologischen, der rationalen wie der irrationalen: immer wird sie dabei doch anthropologisch auf ein Ganzheitsbild ausgerichtet bleiben und hinter der Physis die Metaphysis kennen und ehrfürchtig zu erkennen suchen.⁴⁵³
Diese Gegenüberstellung lässt erkennen, dass Fischer nicht durchweg mit einem „neuen humanwissenschaftlichen Wissen“ arbeitete, das „nach dem Vorbild der Medizin sein Zentrum in der rationalen Konstruktion therapeutischer Intervention besitzt“ und nach Lutz Raphael im Zuge der „Verwissenschaftlichung des Sozialen“ auch in der Fürsorge, Sozialarbeit und Psychotherapie angewandt wurde.⁴⁵⁴ Vielmehr versuchten die DAJEB und ihre Akteure, einen rationalen Wissenschaftsbegriff mit ihren transzendenten Vorstellungen vom Geheimnis der Ehe und der Geschlechterbeziehungen zu verbinden. Auch andere Vorstandsmitglieder formulierten in diesem Sinne eigene methodische Grundlagen für die Beratungsarbeit. Ihre Basis bildeten ebenfalls Konzepte der Vorkriegszeit und christlich-metaphysische Vorstellungen. Coerper schuf ein Einordnungssystem für das sogenannte „Leibseeleproblem“, das er selbst als Methodenbeitrag bezeichnete.⁴⁵⁵ Dieses Problem bezog er auf die Psychologie, die er in nächster Nähe zur Sozialhygiene sah.⁴⁵⁶ Er bewertete die Psychologie als chaotisches Feld, dessen System und Begrifflichkeiten für die Eheberatung wenig hilfreich seien. Mit seiner Ordnung des „Leibseeleproblems“ wollte er Abhilfe schaffen. Dabei blieb das Zusammenspiel des Leiblichen und Seelischen absichtlich vage: „Wo das Seelische auf das Leibliche wirkt, können wir nur ahnen, nach dem jetzigen Stand des Wissens ist es das vegetative Nervensystem.“⁴⁵⁷ Auch die Ehe bleibe „immer ein gewisses Geheimnis […], d. h. eine nur logisch nicht erklärbare und doch wirklich und tatsächlich vorhandene Einheit.“⁴⁵⁸
Fischer, Ordnung, 1950, S. 5, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Zu Fischers Sicht auf Ehe und Ehevorbereitung vgl. auch Fischer, Jochen: Wir zwei wollen es besser machen. Ein Buch für Verlobte und junge Eheleute. Lahr 1964. Raphael, Verwissenschaftlichung, 1996, S. 170. Vgl. Karl [sic] Coerper: „Das Leibseeleproblem“. In: Fischer, J[oachim] (Hrsg.): Archiv für Jugendund Eheberatung. Bd. 1, 1950, unveröffentlichtes Manuskript, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. Trüb, Terminologie, 1978, S. 45. Coerper, Leibseeleproblem, 1950, S. 2, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Ebd., S. 4.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
139
Innerhalb dieser Prämissen teilte Coerper die Faktoren, die zur Gestaltung der Ehe beitrugen, in verschiedene Bereiche beziehungsweise Ebenen ein. Der wirklichen Liebe entsprach der Geist, die Kameradschaft befand sich auf der Bewusstseinsebene, die Erotik im Triebbereich und die Sexualität im Vitalbereich. Wichtig war dabei vor allem, im Vitalbereich den nicht näher definierten Halt zu bewahren, den Krankheiten allerdings wesentlich verändern oder zeitweilig aufheben konnten. Explizit nannte Coerper Geschlechtskrankheiten und Tuberkulose. Geistesebene und Bewusstseinsebene hingen jedoch mit sittlichen Idealen und der Fähigkeit zur Selbstkritik zusammen. Daraus leitete sich die notwendige Grundhaltung der Eheberater ab: Die Auffassung von Leib und Seele, die in der Eheberatung notwendig ist, bei der die Seele als ein Teil des Lebens betrachtet wird, muß Ihnen in Fleisch und Blut übergegangen sein, wenn Sie Menschen wirklich helfen wollen. Wer nicht eine Gestaltlehre oder eine Funktionslehre des Leibseelischen besitzt, arbeitet ohne Ordnung, vielleicht mit einem guten, edlen Herzen, aber bietet selbst auch nicht den Halt seinen Klienten, den sie von ihm erwarten.⁴⁵⁹
Als sichersten und einflussreichsten Faktor bezeichnete Coerper dabei Weltanschauung und Religion. Auf dieser Basis waren die positiven Eigenschaften des Beratenden festzustellen, um „die den Halt gefährdenden Besonderheiten und Schwierigkeiten beeinflussen zu können“.⁴⁶⁰ Coerpers Ansichten blieben über die Jahre unverändert.⁴⁶¹ An die Einordnung des „Leibseeleproblems“ schloss sich bei Coerper eine spezielle Diagnostik der Eheberatung an, die er 1953 in den Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitswesen beschrieben. Ziel war die Eheprognose.⁴⁶² Diese Diagnostik beinhaltete klar definierte Fragen nach Ehe und Familienverhältnissen. Dazu gehörten Auskünfte zum Familienhintergrund, zur Auffassung von Ehe, Aufklärung und Ehevorbereitung eigener Kinder sowie zur Haltung zu Ehekrisen und Schwierigkeiten. Die Arbeitsgruppe der Beratungsstelle erhielt eine Zusammenfassung mit diesen Angaben und erstellte anschließend die „sozialbiologische Diagnose“, die bereits im Namen an die von Coerper während des Nationalsozialismus betriebene „sozialhygienische Diagnose“ erinnert. Ziel der „sozialbiologischen Diagnose“ war es, Schwierigkeiten zu formulieren sowie positive und negative Aspekte zu benennen. Daraus folgte die Prognose, ob die Ehe erhalten werden konnte und aus welchem Grund. Grundsätzlich war, sofern möglich, Ziel der Beratung, die Verbindung zu retten. Die Therapie beinhaltete, den Ratsuchen Ebd., S. 7. Ebd., S. 6. Vgl. Coerper, Methodik, 1954, DZI. Vgl. im Folgenden [Coerper, Carl]: „Methoden der Eheberatung“. In: Coerper, Karl [sic] (Hrsg.): Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitswesen 2 (1953), H. 12, S. 5 – 7, DZI.
140
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
den deutlich zu machen, „was in dieser Ehe fehlt […] und zwar für beide Partner getrennt, schließlich auch in Gegenwart beider Eheleute. Es folgt sodann die besondere Aufgabenstellung, die Angabe der Wege und Möglichkeiten des Zusammenlebens, und drittens die nachgehende Fürsorge.“⁴⁶³ Therapie in diesem Sinne bedeutete eine vom Berater den Ratsuchenden präsentierte Fehleranalyse. Dieses Vorgehen widersprach eklatant dem in der Denkschrift der DAJEB formulierten Grundsatz, die Ratsuchenden selbst entscheiden zu lassen. Allerdings stimmte es mit der Ansicht der DAJEB überein, dass der Berater eine natürliche Überlegenheit besitze⁴⁶⁴ und aus einer Autoritätsposition heraus die Ehe beurteilen und die Krise entsprechend seiner Prognose lösen könne. Aufgrund der Denkschriftinhalte ist zu vermuten, dass Coerpers Vorgehen nicht der DAJEB-Beratungsmethodik entsprochen hätte, vor allem, da er den Ratsuchenden offenbar keinerlei eigenständige Entscheidungen überlassen wollte, sondern engmaschige Vorgaben machte. Dies war mit der von der DAJEB geforderten Selbstbestimmung der Klienten und der Akzeptanz ihrer individuellen Entwicklungen nicht vereinbar. Coerper äußerte sich ein Jahr später erneut zur Methodik der Eheberatung. Auch hier scheint wieder eine ambivalente Haltung durch: Es gebe keine „Allerweltsmethode“, aber man müsse einen Ariadnefaden für das Labyrinth der Ehekrisen besitzen.⁴⁶⁵ Darunter verstand er, sich Zeit zu nehmen, verschwiegen zu sein sowie Eheberatung auf Freiwilligkeit aufzubauen. Als „speziellere Methoden“ riet der Sozialhygieniker, sich nicht vornehmlich auf Psychologie und Testverfahren zu stützen.⁴⁶⁶ Er empfahl die Methode der Biografie, in welcher sich der Berater vom Ratsuchenden dessen Lebensgang und die sozialen Tatsachen der Familie darlegen lasse. Sollte der Ratsuchende nicht spontan berichten, schlug Coerper vor, mit Fragen nach körperlichen Leiden zu beginnen und sich danach über deren sozialpsychologische Auswirkungen berichten zu lassen. Anschließend sei nach Schulden, Veruntreuungen, Steuerhinterziehungen und Ähnlichem zu fragen. Auch seien Auskünfte über die Wohnung der Familie, mögliche diesbezügliche Schwierigkeiten und Probleme im Berufsleben wissenswert. Coerper schloss, dass mit dieser Befragung über die Hälfte aller Ehekrisen aufgeklärt und häufig auch gelöst werden könnten.⁴⁶⁷ Als weitere Methode empfahl er, die Ordnung in der Ehe klar zu erkennen. Mann und Frau gehörten sich erst gegenseitig, dann den Kindern und dann der Familie. Coerpers Ausführungen zeigen einen eigenwilligen Methodenbegriff.
Ebd., S. 6 f. Vgl. Kapitel 3.3.1 Vorstellungen von Ehe. S. Coerper, Methodik, 1954, S. 205, DZI. Vgl. auch im Folgenden. S. ebd., S. 206. Ebd.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
141
Im engeren Sinne ist jedoch höchstens in der Aufnahme der Biografie eine Methode zu erkennen. Daran, wie Coerper das „Leibseeleproblem“ behandelte, zeigt sich, wie er neuere Ansätze in sein bestehendes Konzept integrierte.⁴⁶⁸ Dies richtete sich gegen die Begriffe und Diagnosen aus Psychologie und Psychiatrie, „ohne scheinbare Kenntnis der tatsächlichen wissenschaftlichen Grundlagen“.⁴⁶⁹ Dabei handelte es sich nicht um eine eigentliche Weiterentwicklung, vielmehr blieb Coerper dem Bild einer durch Krankheiten gefährdeten Gesellschaft verhaftet. Die „sozialbiologische Diagnose“ sollte anhand von Informationen über Einkommen, Familie und Berufstätigkeit die anschließende psychologische beziehungsweise psychosomatische Therapie ergeben und damit dazu beitragen, die soziale Ordnung wiederherzustellen. Der wichtigste Teil der Psychotherapie war für Coerper, Struktur und Zusammenhänge des Leibseelischen zu kennen. Hier wird die Kontinuität seines sozialhygienischen Denkens in der Eheberatung deutlich. Im Gegensatz zu früheren Ansichten waren seine Publikationen jedoch nicht mehr völkisch-rassistisch oder eugenisch geprägt. An die Stelle von Ausgrenzung trat die Forderung nach Kontrolle. Obwohl Coerpers Methode der Biografie Anklänge an die zeitgenössisch in den USA angewandte Casework hat, wird diese nicht erwähnt.⁴⁷⁰ Mary Richmond hatte Casework zu Beginn des 20. Jahrhunderts als „wissenschaftlich fundierte, rationale Problemlösungsstrategie“⁴⁷¹ entwickelt. Sie hatte damit eine detaillierte Methode geschaffen, die als spezifisches Unterrichtsfach für die Soziale Arbeit in den USA eine Klammer bildete, um Professionalisierung voranzutreiben und das Berufsbild des Sozialarbeiters zu vereinheitlichen.⁴⁷² Nach Richmond ging es bei der Sozialen Diagnose darum, genau diejenigen Faktoren zu erfassen, die auf einen Menschen wirken. Dabei betonte sie die Wechselwirkung zwischen Umwelt und Persönlichkeit. Casework sollte den betreffenden Menschen schließlich dabei unterstützen, seine Ressourcen zu mobilisieren. Diese Herangehensweise betonte die Selbstbestimmtheit der Person und wurde als „demokratischer Prozess“ zwischen Sozialarbeitenden und Klienten verstanden.⁴⁷³ Die in Deutschland zu diesem Zeitpunkt noch wenig beachtete Casework stellte die Handlung des Helfens unter einen methodischen Gesichtspunkt.⁴⁷⁴ Eine zeitgenössische Definition der Casework beschrieb deren Ziel als Hilfe zur Selbsthilfe:
Vgl. Schütz, Gesundheitsfürsorge, 2004, S. 177 ff. Ebd., S. 179. Vgl. Kapitel 3.3.4 Methoden. Sachße, Mütterlichkeit, 1994, S. 256. Ebd., S. 247. Vgl. im Folgenden auch Kamphuis, Hilfe, 1968 sowie Bang, Grundlagen, 1958. Sachße, Mütterlichkeit, 1994, S. 248 – 257. Vgl. im Folgenden Kamphuis, Hilfe, 1968 sowie Bang, Grundlagen, 1958.
142
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Casework ist eine Kunst, bei der die Erkenntnisse der Wissenschaften über die menschlichen Beziehungen und die Geschultheit im Handhaben von Beziehungen eingesetzt werden, um im Individuum Fähigkeiten zu mobilisieren […], die geeignet sind[,] eine bessere Anpassung des Klienten an das Ganze oder einen Teil seiner Umgebung herbeizuführen.⁴⁷⁵
Diese Anpassung sollte den Wunsch des Klienten nach Dazugehörigkeit und Geborgenheit erfüllen. Dabei ging Casework davon aus, dass die Befriedigung emotionaler Bedürfnisse eine absolute Notwendigkeit darstellte. Die Bezeichnung Klient zielte darauf ab, den beruflichen Aspekt der partnerschaftlichen Begegnung zu betonen und aus dem Bereich der Wohltätigkeit zu lösen.⁴⁷⁶ Der Begriff machte somit den Wandel der Beratung von der Bevormundung zu einer Partnerschaft auch semantisch greifbar.⁴⁷⁷ Vor allem musste der Caseworker den Klienten in seinem Recht auf individuelle Entwicklung und Selbstbestimmung akzeptieren, indem er bewusst auf Wertungen verzichtete. Casework arbeitete mit psychosozialen Diagnosen und fand vor allem im Gespräch statt. Vertrauen und die Anerkennung ambivalenter Gefühle spielten dabei eine wichtige Rolle. Caseworker sollten nie von der Überzeugung ausgehen, die Lösung für die Schwierigkeiten des Klienten zu wissen, und auch nicht voraussetzen, dass dieser lediglich zu der gleichen Ansicht gelangen müsse. Vielmehr galt die Sicht des Klienten als richtiger als jede Antwort aus der Sicht des Caseworkers.⁴⁷⁸ Ratschläge sollten daher sparsam zum Einsatz kommen, da der Klient eigene Einsichten und innere Selbstständigkeit erreichen musste, um reifen zu können. Die Gefahr der Übertragung war Caseworkern früh bewusst und stets ein zentrales Thema. Gleichzeitig konnten Caseworker selbst eine Autorität im besten Sinne sein und ihre eigene Reife und größeren Kenntnisse und Erfahrungen in entwicklungsfördernder Weise zur Verfügung stellen.⁴⁷⁹ Casework war bereits in der Weimarer Republik über die
Swithun Bowers, zitiert nach Kamphuis, Hilfe, 1968, S. 32. Definition: „Ein Mensch mit einem Problem, der zu einer sozialen Einrichtung kommt […] und dort Hilfe erhält“. Helen Harris Perlman zitiert nach Kamphuis, Hilfe, 1968, S. 72. Vgl. Kaminsky, Uwe: Kirche in der Öffentlichkeit – Die Transformation der Evangelischen Kirche im Rheinland (1948 – 1989). Bonn 2008, S. 276. S. Bang, Grundlagen, 1958, S. 153 f. Da Casework Elemente der Psychoanalyse enthält, wurde sie in der konfessionellen Arbeit vielfach abgelehnt. Nur zögernd nahmen Psychotherapeuten, Psychiater und Mediziner den Ansatz an, der ihrer Wahrnehmung nach in ihr Fachgebiet eindrang. In der Sozialen Arbeit wiederum sahen dort Tätige die Gefahr, dass Casework helfendes Handeln entpersönlichen und mechanisieren könnte. Zudem wurde allgemein die amerikanische Herkunft der Casework ablehnend diskutiert. Vgl. Neuffer, Kunst, 1990, S. 135 ff. sowie zeitgenössisch Kamphuis, Hilfe, 1968, S. 24 ff.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
143
Soziale Frauenschule in Berlin als „Soziale Therapie“ nach Deutschland vorgedrungen. Diese Entwicklung schnitt der Nationalsozialismus ab.⁴⁸⁰ Die Rezeption von Casework in der DAJEB umfasste ein breites Spektrum: Sie reichte von einer klaren Ablehnung über eine Annäherung bis hin zur Befürwortung. Darin zeigte sich exemplarisch, wie vielstimmig die Diskussion um die Einführung der Casework war, die noch zu keinem Konsens kam. In der gesamten Sozialen Arbeit rückten zu Beginn der 1950er-Jahre zunehmend psychosoziale Notlagen in den Diskussionsmittelpunkt. Dieser Perspektivwechsel hatte einen Wandel im Selbstverständnis zur Folge, der die Auseinandersetzung mit Methoden förderte, auch wenn die Berater diese damit noch nicht zwangsläufig in der Praxis umsetzten.⁴⁸¹ Zeitgenössisch war in der Eheberatung in der Regel von „Ratsuchenden“ die Rede. Im Gegensatz dazu sprach auch die DAJEB häufig von „Klienten“ und verwendete damit einen Begriff der Casework. Die Denkschrift der DAJEB verwies aber nicht explizit auf Casework und war weder mit deren Zielsetzung noch Methoden gleichzusetzen. Dennoch deuteten einige Aspekte der Denkschrift zur Voraussetzung für Eheberater in diese Richtung. So musste der Berater eine selbstverständliche Überlegenheit mitbringen, die der im Casework geforderten positiven Autorität ähnelte. Nur auf den ersten Blick bestand ein Widerspruch zwischen dieser Forderung und der Mahnung, sich gegenüber dem Klienten nicht moralisch überlegen zu wähnen. Auch der Hinweis der DAJEB, Klienten selbst entscheiden zu lassen, barg Parallelen zur im Casework geforderten Selbstbestimmung und Akzeptanz der individuellen Entwicklung. Ebenso wie der Caseworker sollte der Berater nicht übereilt beurteilen. Auch war man sich in der DAJEB der Gefahr von Übertragungssituationen bewusst. Aus der Beratungspraxis gab es Stimmen, die verschiedene Aspekte der Casework aufgriffen. Wolfram Kowalewsky, der Leiter der hannoverschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung, sah für die Arbeit zwei Aufgaben: das überpersönliche Ziel, Ehe und Familie zu fördern und zu stärken, sowie die persönliche Beratung.⁴⁸² In der Öffentlichkeit wird unter Eheberatung oftmals ein Vorgang verstanden, durch welchen das Verhältnis der beiden Ehegatten zueinander und die Bewältigung ihrer Ehe verbessert werden soll. Diese Auffassung […] ist jedoch nicht ausreichend. Zwar sind Ziel und Ergebnis
Vgl. dazu auch Neuffer, Kunst, 1990, S. 23 ff. und S. 135 ff. Vgl. ebd., S. 99 ff. Zur Beratungsstelle Hannover vgl. Kapitel 3.5.3 Modell-Beratungsstelle.
144
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
der Eheberatung die Hilfe für die Ehe, der Weg dahin aber geht in erster Linie über die Hilfe für die leidende Einzelpersönlichkeit.⁴⁸³
Dabei arbeite der Eheberater zusammen mit den Ratsuchenden. „Der Auftrag […] liegt dann zunächst darin, diesen Menschen aus ihrem Konflikt herauszuhelfen und mit ihnen zusammen nach einer Lösung zu suchen, die ihren Möglichkeiten angemessen ist.“⁴⁸⁴ Laut Kowalewsky spielte in der Arbeit seiner von der DAJEB hoch angesehenen Stelle auch eine große Rolle, dass Ratsuchende von anderen Menschen und der öffentlichen Meinung beeinflusst seien. Er ging so weit zu konstatieren, dass der Einzelne „häufig der zufällige Träger von viel allgemeineren geistigen und sozialgeschichtlichen Konflikten“ sei. Trotz dieser allgemeineren Gesetzlichkeit, die sich im Ratsuchenden entfalte, sollte dessen Leiden im Mittelpunkt stehen. Ein Ehekonflikt [ist] für den einzelnen Menschen ein erschreckendes, verzweiflungsvolles und zumeist in seinen tieferen Zusammenhängen unverständliches Geschehen […]. Dieser Gesichtspunkt […] muß weit vor allen allgemeingültigen und objektiven Einsichten stehen […]. Die Aufgabe der Beratung liegt nun freilich darin, den Ratsuchenden über dieses Empfinden seines persönlichen Leidens hinaus und zum Erkennen der Gesamtzusammenhänge seiner Ehe zu führen.⁴⁸⁵
Daher sei zuerst der Einzelne zu entlasten und zu stärken. Danach erst sei dieser in der Lage, sich, seinen Partner und die Ehe anders zu betrachten. Kowalewsky ging auf die Ähnlichkeit von Eheberatung und Casework ein, die sich vor allem im Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe zeigte. Dass er diese Ausrichtung befürwortete, geht auch aus der Art und Weise hervor, wie er die Beratung beschrieb. Den Ratsuchenden sollte keineswegs vorgegeben werden, „wie sie ihre Beziehungen zueinander und ihre Ehe verbessern könnten“. Das sei nicht die Aufgabe der Eheberatung. Vielmehr solle diese den einzelnen Eheleuten „Gelegenheit geben, ihre Handlungen, Einstellungen und Gefühle zu klären und deutlich zu erkennen […]. Allmählich – zugleich mit der Stärkung und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit – können sie dann ihre eigene Beteiligung an den Schwierigkeiten erkennen. Durch eine solche Entwicklung können sie zu einer inneren Begegnung kommen.“⁴⁸⁶ Ziel war somit, die individuelle Persönlichkeit zu stärken und Selbsthilfe zu ermöglichen. Zum Schluss verwies Kowalewsky darauf, dass die Eheberatung gegenüber der Casework eigene Gesetzlichkeiten finden müsse. Was darunter zu verstehen ist, erläuterte er
Kowalewsky, Eheberatung, 1960, S. 325, DZI. Ebd., S. 323. Ebd., S. 324 f. Ebd., S. 325.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
145
nicht. Offenbar gab es Vorbehalte, das Konzept, das auf dem Hintergrund der USamerikanischen Gegebenheiten basierte, auf die deutsche Situation anzuwenden. Im Jahr 1961 erschien in der Zeitschrift für analytische Kinderpsychologie, Psychotherapie und Psychagogik ein Fachartikel über Casework in der Eheberatung.⁴⁸⁷ Ruth Bang, die Autorin, war Expertin für Casework. Sie hatte ein paar Jahre zuvor das erste Lehrbuch dazu in deutscher Sprache verfasst und damit einen Standard gesetzt.⁴⁸⁸ Im Artikel fällt ins Auge, dass Bang im Gegensatz zu den meisten anderen Publikationen im Bereich der Eheberatung immer wieder auf weitere internationale Experten des Fachgebietes verwies und deren Erkenntnisse diskutierte. Als neu am Casework bezeichnete die Autorin „[d]ie Einbeziehung von seelischer Gesundheit beim Verstehen und Helfen hinsichtlich der Lebensschwierigkeiten eines Klienten“.⁴⁸⁹ Sie ging davon aus, dass Fachkreise dies noch nicht vollends verstünden: „Es fehlt auch in vielen Bereichen sozialer und pädagogischer Arbeit noch an dem Wissen um die Bedeutung eines bewußten diagnostischen Denkens auf Grund bestimmter psychologischer Kenntnisse.“⁴⁹⁰ Für Eheberater bedeutete dies, zuerst die psychosozialen Hintergründe der Eheschwierigkeiten zu ergründen. Statt bestimmter sittlicher Werte sollte dabei das Gefühlsleben im Mittelpunkt stehen. Um die Klienten gut zu beraten, mussten Berater ihre eigenen sittlichen Werte hinterfragen, sodass sie in einer akzeptierenden, vorurteilsfreien Haltung gegenüber anderen Lebensauffassungen arbeiten konnten. Menschen, die mit Fehlhaltungen, z. B. Ehebruch […] gegen sittliche Ordnungen verstoßen, verletzen damit Tabus, die wir selbst respektieren, nach denen wir leben, die uns heilig sind […]. Es ist schwer, objektiv darauf zu reagieren […]. Es sind also Gegebenheiten, die zum Teil im Klienten, zum Teil in uns selbst und zum Teil in kulturellen Lebensumständen liegen, die die akzeptierende, nicht verurteilende Haltung erschweren.⁴⁹¹
Eheberater sollten sich auch mit Tabus auseinandersetzen und notfalls bereit sein, diese zu verletzen. Gemeint waren zum Beispiel bedingungsloser Gehorsam sowie das ungeschriebene Gebot, nicht über Sexualität zu sprechen. „Der Helfer wird durch eine solche Arbeit an und mit sich selbst auch an Einfühlungsvermögen in
Vgl. im Folgenden Bang, R[uth]: „Verstehen und Helfen in der Einzelfallhilfe (Casework) unter besonderer Berücksichtigung der Voraussetzungen in der Arbeit der Eheberatung“. In: Zeitschrift für analytische Kinderpsychologie, Psychotherapie und Psychagogik in Praxis und Forschung 10 (1961), H. 6, S. 228 – 237. Vgl. Schlatter, Margit: „Vorwort“. In: Bang, Ruth: Psychologische und methodische Grundlagen der Einzelfallhilfe (Casework). Wiesbaden 1958, S. 7– 8, hier S. 7 sowie Neuffer, Kunst, 1990, S. 174 f. Bang, Verstehen und helfen, 1961, S. 228. Ebd., S. 228 f. Ebd., S. 233.
146
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
andere Anschauungen gewinnen, wird er doch hie und da bei solcher Arbeit die Erfahrung machen, daß es nicht allzuviel endgültige Antworten auf offene Fragen gibt, weil er ja u. U. die Wandelbarkeit seiner eigenen Anschauungen dabei erlebt.“⁴⁹² Insbesondere mit dem Tabu der Sexualität sollten sich Berater ernsthaft auseinandersetzen, da Geburtenplanung, uneheliche Schwangerschaft oder voreheliche Sexualität in der Eheberatung eine wichtige Rolle spielten. „Die Auswirkungen dieser Fragen auf Glück und Unglück des Ehelebens […] sind durch die Gefühle von Angst, Schuld, Unsicherheit, Aggression usw., die mit ihnen verbunden sind, oft geradezu erschütternd. Es darf aber auch hinzugefügt werden, daß oft bereits mit kleinsten helfenden Hinweisen Zentnerlasten vom Herzen der betreffenden Menschen genommen werden können.“⁴⁹³ Dass dies den Beratern auch selbst schwerfallen könnte, formulierte Bang mehrfach, sie sprach immer wieder von dazu notwendiger Tapferkeit. In Bangs Fachbeitrag ist deutlich sichtbar, wie sich die Beratung von ihrer alten, auf Sittlichkeitsvorstellungen beruhenden Basis entfernte und psychologische Methoden erschloss. Dabei warb die Autorin bei Beratern, die Casework gegenüber kritisch eingestellt waren, mit dem Hinweis, dass auch diese Methode gefühlsgeleitet sei. „Im Grunde genommen gibt es gar keine Methode der Gesprächsführung, sondern es ergibt sich die Gesprächsführung als Konsequenz aus der inneren Haltung und der Art des Verstehens, aus unserem Wissen und unserer Erfahrung und unserem individuellen Wesen ganz von selbst.“⁴⁹⁴ Die Idee der Hilfe zur Selbsthilfe fand sich auch in Loefflers Vorstellungen von Beratung, ohne dass er Casework direkt ansprach. Besucher sollten sich vertrauensvoll öffnen können, um mit Hilfe des Beraters Konfliktursachen in ihrer Ehe zu erkennen. Der daraufhin erteilte Rat sollte Wege des Neuanfangs aufzeigen, für den das Paar, wieder mit dem Beistand des Beratenden, seine eigenen Kräfte mobilisieren musste. Dies bezeichnete der Mediziner als im seelischen Bereich ansetzende soziale Hilfe.⁴⁹⁵ Loeffler forderte damit von den Ratsuchenden eine größere Eigenverantwortung als Coerper. Eheberatung beinhaltete bei ihm zwar auch, Rat zu geben, stellte jedoch mehr eine Begleitung als eine Weisung dar. Hingegen lehnte die Sozialarbeiterin Kara Lenz-von Borries Casework rundheraus ab. Sie schrieb 1952, sie wende diese Methode nicht an. Aus dem folgenden Zitat geht klar hervor, dass sie große Vorbehalte gegen festgelegte und vereinheitlichende Formen der Beratungsarbeit hatte:
Ebd., S. 236. Ebd., S. 237. Ebd., S. 235. Vgl. Loeffler, Krise, 1954, S. 54 ff., DZI.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
147
Im amerikanischen Casework scheint es einen ziemlich genau festgelegten methodischen Ablauf […] von Analyse, Diagnose, Aufstellung des Behandlungsplanes, Behandlung zu geben, die der Klient nacheinander durchläuft. Für die Analyse werden in Amerika Tests angewandt; solche spielen in unserer Eheberatung gar keine Rolle. In den echten Eheberatungsfällen […] gibt es nur eine „Methode“: das Gespräch.⁴⁹⁶
Zwar sprach Lenz-von Borries hier wie in der Casework von Klienten statt von Ratsuchenden. Doch scheint dieser Begriff bei ihr keine theoretisch-methodische Untermauerung zu besitzen, noch verweist er auf eine veränderte Haltung gegenüber den Besuchern. Das als Methode wiedergegebene „Gespräch“ ist knapp beschrieben. Auf diesem Weg erfährt der Berater vom zentralen Problem der zu beratenden Ehe. Ergebnis ist die Einsicht, wie es zu der vorliegenden Situation kommen konnte, und die nüchterne Erkenntnis des eigenen Verhaltens. „Das ist einer der entscheidenden Punkte des Gesprächs, – einer der Punkte, an denen die Grenze der ‚Methode‘ sehr klar erreicht ist und die Seelsorge beginnt.“⁴⁹⁷ An dieser Stelle wird die Ablehnung deutlich, die Teile der Sozialen Arbeit der Casework entgegenbrachten. Sie beschrieben die Methode als entpersönlicht und mechanisiert. Damit war auch eine Kritik am rationalen Wissenschaftsbegriff verbunden. Die favorisierte Methode der Eheberatung, die Lenz-von Borries auch als „Wirklichkeitsanalyse“ bezeichnete, beschränkte sich somit auf das Gespräch, aus dem sich die Beratung in Form von Seelsorge ableitete. Damit sollte die Beratung „eine besonnenere und sachlichere Einstellung“ erreichen. Die Ehe könne wieder gesunden, wenn die Partner zu der letztlich rational nicht zu durchdringenden Einsicht gekommen seien, dass sie sich gegenseitig nichts vorzuwerfen hätten. Komme es nicht zu dieser Einsicht, sei es nur noch möglich, dem einzelnen Klienten in Ansätzen zu helfen.⁴⁹⁸ Ebenso wie im Ehebild der DAJEB wurde hier auf die geheimnisvolle Kraft der Ehe verwiesen. Sie schien etwas Übergeordnetes und Eigenständiges, zu dem uneinsichtige Betroffene keinen Zugang hatten. Ebenfalls 1952 erschien ein Artikel von Elsa Pick, in dem sie sich zwar von Casework abgrenzte, jedoch zugab, dass sie zumindest ähnlich vorgehe. Berater
Lenz-von Borries, Kara: „Eheberatung als Casework“. In: Gesundheitsfürsorge. Zeitschrift für die gesundheitlichen Aufgaben im Rahmen der Familienfürsorge 1 (1952), H. 11, S. 201– 202, hier S. 201. Kara Lenz-von Borries (geb. von Borries, 1901) war Sozialarbeiterin und wurde 1929 an der Universität Bonn in Volkswirtschaft promoviert. Sie war mit dem Rassenhygieniker Fritz Lenz verheiratet. Vgl. Borries, Kara von: Das Puddelverfahren in Rheinland und Westfalen, volkswirtschaftlich betrachtet. Bonn 1929. Lilienthal, Georg: „Lenz, Fritz“. In: Neue Deutsche Biographie, Bd. 14. Berlin 1985, S. 223 – 225, hier S. 224 sowie Reinicke, Peter: Soziale Krankenhausfürsorge in Deutschland. Von den Anfängen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Opladen 1998, S. 112. Lenz-von Borries, Eheberatung, 1952, S. 202. Reinicke, Krankenhausfürsorge, 1998, S. 202.
148
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
sollten die Situation vom Standpunkt des Hilfesuchenden aus beurteilen und davon ausgehend eine Lösung anbahnen. Nicht die persönliche Einstellung sollte ausschlaggebend sein. Der Berater dürfe dem Ratsuchenden laut Autorin nicht die eigene Meinung aufoktroyieren. „Wer eine Beratungsstelle aufsucht, tut es schweren Herzens. Man muß Geduld mit ihm haben, denn es fällt dem Ratsuchenden nicht leicht, sich offen auszusprechen, umso mehr, da nicht die ‚Schuldigen‘ den Weg zum Berater finden – oder nur in den allerseltensten Fällen – sondern die Familienangehörigen, die unter den Zuständen leiden.“⁴⁹⁹ Gleichzeitig beschrieb Pick ihr Vorgehen nicht als Methode, wie dies auf Casework zutreffen würde, sondern als innere Berufung. „Geduld [ist] sehr wichtig für den Berater, Eingehen auf die Nöte des anderen und die Fähigkeit, Vertrauen zu erwerben. All dies sind Eigenschaften, die kaum durch Schulung erworben werden können, sondern sozusagen auf innerer Berufung basieren.“⁵⁰⁰ Über öffentliche und private Fürsorgestellen sollten sich Eheberater ein Bild des Ehelebens machen. Hier ist ein gewisser Widerspruch erkennbar, da die Ratsuchenden der Fürsorge eher negativ gegenüberstanden. Jedoch gab es zu diesem Zeitpunkt auch die Alternative nicht, Hausbesuche zu machen, wie in der Casework üblich, da die Erfahrungen der NS-Zeit noch zu frisch waren.⁵⁰¹ Ursprünglich plante die DAJEB eine weitere Denkschrift zur Methodik der Beratung und Art und Umfang der Zusammenarbeit aller Kräfte,⁵⁰² die allerdings bei den Recherchen für die vorliegende Arbeit nicht auffindbar war. Ob sie nicht erhalten ist oder nicht zustande kam, ist unklar. Die Denkschriften der DAJEB vertraten deutlich den Anspruch, eine professionelle Eheberatung zu begründen. Deshalb verwundert, dass die angekündigte dritte Denkschrift nicht vorliegt. Gleichzeitig blieben viele Punkte, wie beispielsweise die Fähigkeiten des Beraters oder die Sicht auf Beziehungen, trotz ausführlicher Beschreibung im Vagen. Dies mag sowohl an der fehlenden Wissenschaftlichkeit als auch an der Notwendigkeit gelegen haben, möglichst viele Vertreter von Beratungsstellen anzusprechen und an sich zu binden. In der Eheberatung kam es nicht zur Entwicklung einer einheitlichen, einem rationalen Wissenschaftsbegriff folgenden Methode. Indem sie Gesprächsführung diskutierten, entwickelten die Akteure jedoch im weitesten Sinne flexible Herangehensweisen. Ein klares Methodeninstrumentarium kritisierten sie als mechanisch und unangemessen. Gerade bei kirchennahen Beratern provozierte ein nor-
Pick, Elsa: „Ehe- und Erziehungsberatung“. In: Der Helfer. Nachrichtenblatt der Arbeiterwohlfahrt 6 (1952), Nr. 3, S. 1– 2. Ebd., S. 1. Vgl. Hering/Münchmeier, Restauration, 2002, S. 97– 118, S. 107 f. DAJEB, Denkschrift, 1953, S. 2, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. ebenso DAJEB, Jahresbericht 1953, S. 7, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
149
mativer Professionalisierungs- und Verwissenschaftlichungsbegriff, der nach Raphael mit einer „Entzauberung der Welt“⁵⁰³ einherging, Widerstände. Gleichzeitig zeigen die Methodendiskussionen im Untersuchungszeitraum den Versuch, Wissenschaft und christliches Denken zu verbinden und damit einen gangbaren Weg zu finden. Was unter Methodik zu verstehen war, benannten auch die DAK-Richtlinien von 1964/1966 zur Ausbildung von Eheberatern nicht näher.⁵⁰⁴ Im Vorschlag des EZI, der die Ausbildungsgebiete skizzierte, fand sich lediglich der Hinweis, Methoden seien Gesprächsführung sowie die Beziehung zwischen Berater und Ratsuchenden.⁵⁰⁵ Eine Konkretisierung erfolgte nicht. Der DAK verzichtete damit darauf, sich ein eigenes Methodenspektrum zu erarbeiten. Auch legte er sich nicht auf bereits bestehende Arbeitsweisen wie Casework fest. Zwar gab es einen Hinweis auf Methodik, diese bewegte sich allerdings nur auf einem nicht näher benannten, zudem fachlich offenbar niedrigen Niveau. Zu dieser Zeit war auch die Methodenlehre in der Sozialen Arbeit beispielsweise auf eine professionelle Gesprächsführung konzentriert.⁵⁰⁶ Dabei handelte es sich nicht um ein festgelegtes Vorgehen, sondern um Suchstrategien für Lösungen.⁵⁰⁷ Eheberater sollten Methoden in erster Linie über die praktische Arbeit lernen, zu der Gesprächsführung, Anamnese-Erhebung, Gruppengespräche und schriftliche Arbeiten wie Gesprächsprotokolle, Briefe, Gutachten, Fallbesprechungen, Gestaltung und Durchführung von Eheseminaren sowie die Zusammenarbeit mit Institutionen sozialer Hilfe gehörten.⁵⁰⁸ Gegen Ende der 1960er-Jahre wandte sich die Ausbildung dem psychologischen Training zu und arbeitete mit Praxisfragen, wodurch die lange verfolgten Konzepte in den Hintergrund traten. Während der gesamten 1960er-Jahre zeigte sich bereits ein zunehmendes Interesse an der „individuellen und sozialen Anwendung der Psychologie“, das eng mit den Steuerungs- und Planungsutopien der 1960er-Jahre verbunden war. Damit waren große Erwartungen an die Regelungsfähigkeit der Psychologie gerichtet.⁵⁰⁹ Vor diesem Hintergrund kritisierte Lothar Loeffler 1968 eine Kurskonzeption, die mit einer Vielfalt von
Raphael, Verwissenschaftlichung, 1996, S. 165. Vgl. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 74, März 1966, S. 14, BArch, B 189/2817, Bl. 222 ff. Vgl. EZI: Vorschlag für einen Rahmenplan der Ausbildungsgebiete der Eheberater, 1963, BArch, B 191/10. Zur Methodenlehre in der Sozialen Arbeit vgl. Galuske, Michael / Müller, Wolfgang C.: „Handlungsformen in der Sozialen Arbeit“. In: Thole, Werner (Hrsg.): Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. Opladen 2002, S. 485 – 508, hier S. 486. Vgl. Müller, Professionalisierung, 2002, S. 741. Vgl. EZI an Mitglieder und Beratungsstellen, Brief, 28. April 1964, BArch, B 191/10. Tändler, Jahrzehnt, 2016, S. 104 f.
150
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Präsentationen zu einem breiten Themenfeld von Ehefragen arbeite, als veraltet. Dies sei innerhalb der Beratungsarbeit nicht mehr akzeptiert, ebenso wenig wie fehlende neue Lehrmethoden.⁵¹⁰
3.3.5 Kommunikation in der Fachgesellschaft Die Detmolder Jahrestagungen der DAJEB waren das öffentlich wahrnehmbare Zentrum ihrer Arbeit. Sie trugen den Anspruch auf Professionalisierung der Eheberatung in Fachkreise und in die Öffentlichkeit. Gleichzeitig dienten sie als Mitgliederversammlungen.⁵¹¹ Im Sinne der Sexualpädagogik zielten die Tagungen in erster Linie auf die Erziehung der Jugend zur Ehe. Die Themen waren vielfältig. Ab Ende der 1950erJahre standen die Jahrestagungen vermehrt unter einen übergeordneten Aspekt, was sich schließlich ab 1961 als Schema durchsetzte.⁵¹² Im Allgemeinen standen am Vormittag Jugend- und Erziehungsberatung auf der Tagesordnung und nachmittags Eheberatung. Die Inhalte ähnelten sich von 1949 bis Ende der 1950er-Jahre. Dazu zählten die Ordnung der Geschlechterbeziehungen, Physiologie und Psychologie sowie Fehlformen der Sexualität.⁵¹³ Hierunter fielen Homosexualität, Onanie, Frigidität und Impotenz. Eugenische Schlussfolgerungen waren auch hier präsent: „Referent schließt mit einigen wichtigen Hinweisen auf die Typen der Sexualverbrecher in Beziehung zu menschlichem Körperbau und Charakterformen und folgert daraus praktische Massnahmen der Schul- und Elternerziehung.“ Außerdem behandelten die Tagungen Erbfragen, Eherecht sowie Soziologie.⁵¹⁴ Sie bildeten die für die DAJEB typischen Themen ab. Zeitgenössisch diskutierte gesellschaftliche Fragen wie beispielsweise die „Mischehe“, vor der auch nichtkonfessionelle Eheratgeber warnten, kamen hingegen selten vor.⁵¹⁵ Beispielsweise findet sich nur bei einer Tagung der Hinweis, dass die Teilnehmer den Kinsey-Report diskutierten.⁵¹⁶ Der Sexualforscher Alfred C. Kinsey ging unter anderem davon aus, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung bisexuell, Masturbation unter Männern weit verbreitet sei und die Ehe nicht leide, wenn die
Vgl. Lippold, Church, 2014, S. 326 f. In diesem Sinne verwundert es, dass hierzu relativ wenig Material vorliegt. Vgl. DAJEB: Einladung Jahrestagung, 1961, LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5 – 30 – 02 sowie Kruse/Schall, Geschichte, 1999, S. 15 f. Fischer, J[oachim]: Zusammengefasster Bericht des VIII. Arbeitslehrganges der DAJEB, Januar 1951‚ S. 6, LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5 – 30 – 02. Vgl. Fischer, Jahre, 1959, S. 38. Vgl. z. B. Oheim, Ehe, 1965, S. 80 f. Vgl. Kinsey, Alfred C.: Das sexuelle Verhalten der Frau. Berlin 1954.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
151
Frau sexuelle Erlebnisse vor der Heirat hatte. Seine in Deutschland 1954 veröffentlichte Untersuchung hatte in der Öffentlichkeit erhebliches Aufsehen erregt. Daher verwundert es, dass der Report auf den Tagungen nicht mehr Aufmerksamkeit erhielt. Lediglich die Berufstätigkeit von Müttern und Ehefrauen beschäftigte die DAJEB immer wieder.⁵¹⁷ Stärker rezipierte die katholische Seite Kinseys Forschungen. Die Teilnehmer der Jahrestagung von 1950 befassten sich mit der Jugend- und Eheberatung als Aufgabe sozialer Psychohygiene, mit Geburtenregelung und Eugenik im Rahmen der Eheberatung, Kontaktmangel-Katastrophen bei Jugendlichen und in der Ehe sowie Wissen, Ethos und Praxis der Beratung.⁵¹⁸ In den beiden darauffolgenden Jahren interpretierte Otto Buurmann, Ministerialdirektor der Gesundheitsabteilung im Niedersächsischen Sozialministerium, den Gesundheitsbegriff der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Grundlage der Beratungsarbeit,⁵¹⁹ wobei er ihn sozialhygienisch auflud. Er erklärte, die WHO habe mit ihrer Aussage, Gesundheit umfasse nicht nur Freiheit von Schwäche und Krankheit, sondern auch körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden, dieselbe als soziales Recht, aber auch Verpflichtung etabliert. Daher schloss er, Gesundheit sei ebenso wichtig wie Freiheit, und forderte den Ausbau sozialhygienischer Kenntnisse.⁵²⁰ Darüber hinaus kamen auf der Tagung Erziehungsberatung und die Berufstätigkeit von Ehefrauen zur Sprache.⁵²¹ Außerdem referierten prominente Vertreter aus der Praxis,⁵²² wie Theodor Bovet, der entscheidende Theoretiker evangelischer Beratungsarbeit.⁵²³ Bovet sprach 1954 auf der Jahrestagung über „Erfahrungen auf dem Gebiete der Eheberatung“. Im Jahr darauf trug er vor etwa 130 Teilnehmern über „Erziehung zur Ehe“ sowie seine Erfahrungen aus der Eheberatung vor. Die Zuhörer konnten mit ihm Fragen aus ihrer eigenen Praxis besprechen. Der Theologe äußerte die Vermutung,
Vgl. z. B. DAJEB: Bericht über die Jahrestagung, 1956, LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5 – 30 – 02 sowie DAJEB: Einladung, 1962, LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5 – 30 – 02. Vgl. DAJEB: Jahresbericht 1949/50, 1950, S. 8, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. World Health Organization: Constitution. New York 1946. S. LGA: Bericht über die Jahrestagung der DAJEB, 1951, S. 1, LAB, B Rep. 012, Nr. 176. Vgl. ebd. sowie LGA: Bericht über die Jahrestagung der DAJEB, 1952, LAB, B Rep. 012, Nr. 176. Vgl. z. B. DAJEB: Einladung Jahrestagung, 1959, LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5 – 30 – 02 sowie DAJEB: Gesamtüberblick, Mai 1957, BArch, B 189/2815, Bl. 92 ff. Jäger weist darauf hin, dass innerhalb der evangelischen Eheberatung nach 1945 eugenische Überlegungen nicht mehr thematisiert worden seien, s. ebd., S. 322. Allerdings geht Bovet als führender evangelischer Berater auch auf die erbbiologische Tauglichkeit potenzieller Ehepartner und ihrer Familien sowie negative Eugenik ein.Vgl. Bovet, Theodor: Die Ehe. Ihre Krise und Neuwerdung. Ein Handbuch für Eheleute und ihre Berater. Tübingen 1951, S. 208 ff. Eine weitere Untersuchung evangelischer Eheberatung in Hinblick auf eugenische Denkmuster erscheint notwendig.
152
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
die real gelebten Ehen seien nie besser gewesen. Er sah zeitgenössische Ehekonflikte darin begründet, dass von den Partnern eine geistig-seelische Gemeinschaft gefordert werde. Dies betrachtete er als Fortschritt. Eheprobleme deutete er gleichzeitig als Verlust der patriarchalen Stellung des Mannes und der Suche nach einem neuen Idealbild, was er nicht negativ bewertete.⁵²⁴ Auf der Tagung erhielt auch der Kinsey-Report Aufmerksamkeit. Bovet forderte, Ratsuchenden klare Weisungen zu Sexualität zu geben. Auch Coerper sah seine Ansichten zu Sexualität und Paarbeziehungen durch den Report nicht in Frage gestellt. Er kritisierte Kinseys Untersuchungsergebnisse zur weiblichen Sexualität: „Ihm liegt eben nur eine zoologische und keine humane Psychologie zugrunde. Es bleibt eine Erfahrungstatsache, daß das sexuelle Vorerlebnis für die Frau besonders ungünstig ist.“⁵²⁵ Die DAJEB suchte die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren im Bereich Gesundheit beziehungsweise Ehe und Familie. Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitswesen (AGG) beziehungsweise der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Familienorganisationen (AGF) hielt sie Tagungen ab.⁵²⁶ Die Veranstaltung der AGG galt als außerordentlich gut besucht. Die Referate befassten sich mit dem Jahresbericht der DAJEB, der Erziehung zur Ehe in der evangelischen Jugendberatung, der Eherechtsreform sowie der Methodik von Jugend- und Eheberatung.⁵²⁷ Die Gemeinschaftstagung mit der AGF stand unter dem Gesamtthema „Die außerhäusliche Erwerbstätigkeit der Ehefrau und Mutter“.⁵²⁸ Erstmals berichteten Eheberatungsstellen auf der Jahrestagung 1953 von ihren Erfahrungen,⁵²⁹ ein Format, das ab 1958 fester Bestandteil der Treffen war.⁵³⁰ Im Jahr 1962 widmete sich die gesamte Veranstaltung der praktischen Arbeit. Referate zu verschiedenen Beratungssituationen bereiteten die anschließenden Gruppenarbeiten der etwa 100 Teilnehmer vor, beispielsweise zu „Beratungsmöglichkeiten bei der unerfüllten und der innerlich leer gewordenen Ehe“ oder der Frage „Wie können wir mit dem Ehestörer Kontakt gewinnen?“.⁵³¹
Vgl. DAJEB: Niederschrift über die Konferenz 1955, 18. Februar 1956, S. 8 ff., BArch, B 189/2815, Bl. 56 ff. Ebd., S. 3. Gegründet 1954, waren in der Arbeitsgemeinschaft zunächst der Familienbund der Deutschen Katholiken, die Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen und der Deutsche Familienverband zusammengeschlossen. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 130. Vgl. o. A., Bericht – Anlage 3, November 1953, S. 3 f., ADE, JF 31. Vgl. DAJEB: Einladung, 1962, LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5 – 30 – 02. Vgl. DAJEB: Jahresbericht 1953, [1954], S. 3 ff., DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. DAJEB: Einladung Jahrestagung, 1958, LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5 – 30 – 02. Vgl. DAJEB: Gesamtüberblick, Mai 1957, BArch, B 189/2815, Bl. 92 ff.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
153
Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der DAJEB 1959 erschien eine Festschrift.⁵³² Zudem waren auf der Jahrestagung Abgeordnete verschiedener Ministerien anwesend, es gab Musik sowie eine Ansprache von Familienminister FranzJosef Wuermeling.⁵³³ 200 Personen besuchten einen öffentlichen Vortrag über „Ehe und Liebe in unserer Zeit“. Außer den Jahrestagungen fanden ab 1951 für die Leiter der Eheberatungsstellen einmal jährlich Konferenzen statt. Die Vortragsthemen ähnelten denen der jährlichen Treffen, daneben wurden vor allem der planmäßige Ausbau der Eheberatung sowie die Ausarbeitung von Ausbildungsnormen besprochen.⁵³⁴ „Die fachliche Wirksamkeit der DAJEB vollzieht sich im Wesentlichen auf Kursen und Tagungen, wobei vor allem von den […] Jahrestagungen in Detmold eine beachtliche Breitenwirkung ausgeht“, schrieb das Bundesfamilienministerium 1969 über die Arbeit des Verbandes.⁵³⁵ Dieser ging selbst ebenfalls davon aus, dass besonders die Jahrestagungen eine öffentliche Wirkung erzielten.⁵³⁶ Seine Vertreter stellten sich zudem anderen Institutionen für Vorträge zur Verfügung oder nahmen an Tagungen teil.⁵³⁷ Zu Beginn sollten die Veranstaltungen vor allem unter Beweis stellen, wie dringend notwendig die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft war.⁵³⁸ Die DAJEB nutzte die Treffen bewusst, um relevante Akteure einzubinden oder kennenzulernen sowie Netzwerkarbeit zu betreiben.⁵³⁹ Darüber hinaus warb sie auch über Plakate und Anzeigen für ihre Anliegen und hoffte, so die Mitarbeit von Medizinern, Juristen, Pädagogen, Seelsorgern und Fürsorgern zu erreichen.⁵⁴⁰ Für die Praxis hingegen galten die Ausbildungskurse als relevanter.⁵⁴¹
Vgl. Loeffler, Lothar (Hrsg.): Ehe und Familie als Gabe und Aufgabe. Göttingen 1959. Vgl. DAJEB: Einladung Jahrestagung, 1959, LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5 – 30 – 02 sowie Arbeitsgemeinschaft Deutscher Familienorganisationen an Mitglieder, Brief, 3. November 1959, BArch, B 191/ 163, Bl. 34 f. Vgl. z. B. DAJEB: Bericht über die Konferenz der Leiter der Eheberatungsstellen, Mai 1951, BArch, B 141/49456, Bl. 17 ff. sowie DAJEB: Konferenz der Leiter der Eheberatungsstellen, 1954, LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5 – 30 – 02. Große-Schönepauck, H[elene]: Die Eheberatung in Deutschland und in anderen Ländern, [1969], S. 5, BArch, B 189/2807, Bl. 265 ff. Vgl. Fischer, Jahre, 1959, S. 38. Vgl. z. B. DAJEB: Arbeitstagung, 1955, LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5 – 30 – 02 sowie DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 25, Februar 1958, BArch, B 142/2043. Vgl. DAJEB: Jahresbericht 1949/50, 1950, S. 7, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle sowie DAJEB: Jahresbericht 1951. Detmold [1952], S. 3, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. z. B. J[oachim] Fischer an Ludwig, Brief, 30. November 1953, BArch, B 189/2815, Bl. 7 sowie [Carl] Coerper an Osterloh, Brief, 27. April 1954, BArch, B 189/2815, Bl. 37. Vgl. DAJEB: Plakat/Anzeige, 1956, BArch, B 189/2815, Bl. 67. Vgl. Fischer, Jahre, 1959, S. 38.
154
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Innerhalb der DAJEB dienten Informationsrundschreiben der Kommunikation. Die Schreiben liegen von der dritten Ausgabe 1949 bis zur 27. Ausgabe 1958 geschlossen vor. Danach ist für den Untersuchungszeitraum lediglich die Ausgabe 46/ 47 von 1961 erhalten. Dass es für die zweite Hälfte der 1960er-Jahre Ausgaben mit noch höherer Nummerierung gibt, deutet darauf hin, dass die Rundschreiben weiter fortlaufend erschienen.⁵⁴² Die fehlenden Ausgaben waren jedoch nicht aufzufinden. Zu Beginn dienten die Informationsschreiben vor allem dazu, die Arbeitstagungen zu organisieren.⁵⁴³ Mit der Anrede „Sehr verehrte Mitarbeiter!“⁵⁴⁴ bat der Vorstand um Mithilfe. Die Empfänger sollten „als die wichtigste Aufgabe Ihrer Mitarbeit“⁵⁴⁵ die Kurse für Eheberater bewerben. Den Schreiben lagen zu diesem Zweck immer wieder Berichte über die Kurse bei. Als nächste wichtige Aufgabe galt, finanzielle Zuwendungen zu vermitteln.⁵⁴⁶ Die Informationsschreiben kündigten des Weiteren Kurse an oder empfahlen Dozenten. Außerdem wünschten die Verantwortlichen sich Rückmeldungen mit Verbesserungsvorschlägen und forderten zu Berichten, Buchbesprechungen oder Presseartikeln auf. Zum Beispiel bat der Vorstand für die kommende Mitgliederversammlung um eine „geistige Umlage in Form eines kurzen Tätigkeitsberichtes“.⁵⁴⁷ Darüber hinaus sollten die Mitglieder sich insgesamt im Bereich Familie engagieren. Sie erhielten die Anregung, sich beispielhaft den Jugendämtern beziehungsweise Wohlfahrtsorganisationen zur Verfügung zu stellen, um Vormundschaften zu übernehmen.⁵⁴⁸ Vor allem die Informationsschreiben der ersten Jahre zeigten deutlich die Erwartungshaltung, dass die Mitglieder sich für die DAJEB und deren Ziele stark engagieren sollten. Ab dem neunten Informationsschreiben 1954 stand Organisatorisches weniger im Fokus. Vielmehr sollte es nun darum gehen, Erfahrungen auszutauschen und die fachliche Arbeit anzuregen.⁵⁴⁹ Die Schreiben gingen nicht mehr nur an Mitglieder, sondern auch an die Leiter der Eheberatungsstellen sowie der Arbeitsagenturen. Die Rundschreiben druckten sowohl unkommentiert Erlasse der Ministerien wörtlich ab wie auch Literaturhinweise, Auszüge aus Publikationen zu Jugend, Ehe
Vgl. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 74, März 1966, BArch, B 189/2817, Bl. 222 ff. Vgl. die Rundschreiben bis zur Nummer 8, z. B. DAJEB: 3. Rundschreiben, 10. September 1949, ADE, JF 31 sowie DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 8. Januar 1954, BArch, B 189/2815, Bl. 29 ff. Z. B. DAJEB: 3. Rundschreiben, 10. September 1949, S. 1, ADE, JF 31 sowie DAJEB: 5. Rundschreiben, 1. Februar 1950, ADE, JF 31. Ebd. Vgl. DAJEB: 6. Rundschreiben, 20. Mai 1950, ADE, JF 31. DAJEB: 7. Rundschreiben, 20. September 1950, S. 1, ADE, JF 31. Vgl. DAJEB: 6. Rundschreiben, 20. Mai 1950, S. 2, ADE, JF 31. Vgl. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 8, Januar 1954, BArch, 189/2815, Bl. 29 ff.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
155
und Familie und Buchbesprechungen. Letztere stammten vor allem von Joachim Fischer, dem Vorstandsvorsitzenden der DAJEB.⁵⁵⁰ Damit stand ab 1950 die inhaltliche Information im Mittelpunkt. Dies deckt sich mit dem Selbstverständnis und dem Anspruch der DAJEB, die Eheberatung fachlich voranzubringen, und zeugt von ihrer Professionalisierung.⁵⁵¹ Auch die Rundschreiben erfuhren 1957, wie der Verband selbst festhielt, in Ausgestaltung und Inhalt eine „weitere Verbesserung, ihre Verbreitung eine weitere Ausdehnung“.⁵⁵² Das Layout wurde überarbeitet, ein Deckblatt mit Inhaltsverzeichnis eingeführt und die Texte ausführlicher gestaltet. Der Inhalt blieb jedoch unverändert. Da keine Angaben zur Verbreitung vorliegen, lässt sich nicht überprüfen, inwiefern der Empfängerkreis sich vergrößerte.⁵⁵³ In zwei Informationsrundschreiben forderte die DAJEB ihre Mitglieder dazu auf, die Interessen der Arbeitsgemeinschaft zu verteidigen. Eines warnte davor, dass vermehrt der DAJEB „völlig unbekannte Referenten“ bei Behörden und Arbeitsgemeinschaften sexual-pädagogische Vorträge anboten, ohne „ersichtliche Legitimation vorlegen zu können“.⁵⁵⁴ Die Leser erhielten die Empfehlung, in einem solchen Fall mit den Veranstaltern Kontakt aufzunehmen, auf geeignete Dozenten der DAJEB hinzuweisen und dieser die unbekannten Referenten zu melden. Eine weitere Ausgabe gab Ratschläge, wie Mitglieder öffentliche Veranstaltungen ausrichten könnten. Die Arbeitsgemeinschaft wertete dies als Öffentlichkeitsarbeit.⁵⁵⁵ Zusätzlich zu den Informationsschreiben plante die Arbeitsgemeinschaft ein Archiv für Jugend- und Eheberatung in mehreren Bänden. Der erste Band sollte die „Stammvorlesungen“ der Kurse enthalten.⁵⁵⁶ Aufgrund der angespannten Finanzsituation war es nicht möglich, das Archiv zu verwirklichen.⁵⁵⁷ Für den ersten Band liegen jedoch einzelne Manuskripte vor, die aus Kursvorträgen entstanden waren.⁵⁵⁸ Auch eine zwischenzeitlich geplante Literaturkartei wurde nicht umgesetzt.⁵⁵⁹ „Als
Vgl. z. B. DAJEB: Informationsschreiben Nr. 9, März 1954, ADE, JF 31. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 11, August 1954, BArch, B 142/418, Bl. 237 ff. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 19, Juli 1956, BArch, B 142/418, Bl. 251 ff. Vgl. Kapitel 3.3 Selbstverständnis und Professionalisierung. DAJEB an Bundesminister des Innern, Brief, 14. Februar 1958, BArch, B 142/2043, Bl. 54 f. Vgl. z. B. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 23, Oktober 1957, BArch, B 142/ 2043, Bl. 78 ff. sowie DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 24, Januar 1958, BArch, B 142/2043, Bl. 92 ff. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 18, S. 1, Januar 1956, ADE, JF 31. Vgl. auch im Folgenden. Vgl. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 45/46, Sonderheft, Oktober 1961, BArch, B 189/2815, Bl. 238 ff. Vgl. DAJEB: 5. Rundschreiben, 1. Februar 1950, ADE, JF 31. Vgl. DAJEB: 6. Rundschreiben, 20. Mai 1950, S. 1, ADE, JF 31. Vgl. Fischer, J[oachim] (Hrsg.): Archiv für Jugend- und Eheberatung. Bd. 1, 1950, unveröffentlichtes Manuskript. DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. DAJEB: Informationsschreiben Nr. 13, Juli 1955, S. 1, JF 31.
156
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Ausdruck für die betont vorbeugende Tendenz unseres ganzen Aufgabenverständnisses“ war ein Merkblatt für Eheschließende geplant.⁵⁶⁰ Die Jahresberichte der DAJEB sind von 1949 bis 1953 erhalten. Für die Jahre danach waren keine mehr auffindbar. Zumindest erschien jedoch 1954/55 noch ein Jahresbericht. Hierzu liegt auch eine Kostenaufstellung vor.⁵⁶¹ Die Berichte gingen nicht nur an Mitglieder, sondern auch an Ministerien, Behörden, Dachorganisationen und Fachzeitschriften. Sie bewarben die Tagungen und Publikationen der DAJEB. Darüber hinaus gaben sie Informationen zu vergangenen und zukünftigen Veranstaltungen.⁵⁶² Damit sollte die Unverzichtbarkeit der DAJEB bestätigt und verdeutlicht werden, dass sich diese bewährt hatte. Die Arbeitsgemeinschaft nahm für sich in Anspruch, auf den Bedarf einer sachgerechten Eheberatung hingewiesen, sämtliche Bemühungen in diesem Bereich verbunden und einen Austausch ermöglicht zu haben. Laut eigener Einschätzung kam ihr damit eine zentrale Bedeutung zu: „Somit darf jetzt gesagt werden, daß im Rahmen der ‚Deutschen Arbeitsgemeinschaft‘ alle Kräfte und Belange der deutschen Jugend-, Ehe- und Familienberatung ihren fachlichen und menschlichen Sammelpunkt gefunden haben.“⁵⁶³ Dieses selbstbewusst gezeichnete Bild entsprach allerdings nicht zwangsläufig der Wahrnehmung in Fachkreisen. Denn viele Eheberater standen bereits vor Gründung der DAJEB miteinander in Kontakt und waren sich ihres Beitrags zur Beratung durchaus bewusst. So verwundert es nicht, dass die Darstellung der DAJEB auf Widerspruch stieß, was auf einer Tagung 1952 näher thematisiert werden sollte. Nachdem der entsprechende Referent jedoch erkrankt war, finden sich keinerlei Hinweise auf eine weitere Auseinandersetzung damit.⁵⁶⁴
3.3.6 Beruf oder Profession? In den 1960er-Jahren professionalisierte sich die Eheberatung. Die innerhalb der DAJEB bewusst vorangetriebene Systematisierung von Aus- und Weiterbildung, aber auch das 1962 in Kraft getretene Bundessozialhilfegesetz spielten dabei eine wichtige Rolle. Professionalisierung diente auch als Legitimationsstrategie, insbesondere um Fördermittel einzuwerben.
DAJEB, Jahresbericht 1953, [1954], S. 7, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Ob das Merkblatt erstellt wurde, lässt sich am vorliegenden Material nicht feststellen. Vgl. [DAJEB]: Kostenplan, [1956], BArch, B 142/2043, Bl. 6. Vgl. z. B. DAJEB: Jahresbericht 1949/50, 1950, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle sowie DAJEB: Jahresbericht 1952. Detmold [1953], DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. DAJEB: Jahresbericht 1951. Detmold [1952], S. 3, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. Landesgesundheitsamt: Bericht, 1952, LAB, B Rep. 012, Nr. 176.
3.3 Eheberatung in der DAJEB und den Beratungsstellen
157
Eheberatung entwickelte sich zu einem Beruf mit Qualitätsanforderungen und standardisierten Ausbildungswegen. Allerdings setzte sie sich nicht als Profession im Sinne eines akademischen Berufs mit hohem Prestige durch. Vielmehr blieben praxiserfahrene Laien, meist Psychologen, Mediziner und Juristen, die mit flexiblen Methoden und auch auf christlicher Basis arbeiteten, als Berater erfolgreich. Sie integrierten in der Nachkriegszeit besonders psychologisches Wissen. Damit zeigten sich in der Eheberatung übergreifende gesellschaftliche Phänomene, die schließlich in den „Psychoboom“ der 1970er-Jahre mündeten und damit in die weitreichende Popularisierung von Psychologie und Psychotherapie. Eine Voraussetzung hierfür war auch die Bildungsexpansion in den 1960er-Jahren und besonders das große Interesse der Studierenden am Fach Psychologie.⁵⁶⁵ Die Eheberatung durchlief damit eine ähnliche Entwicklung wie die Soziale Arbeit, die sich ab Ende der 1950er-Jahre ebenfalls zunehmend professionalisierte. Dazu trugen eine Ausbildungsreform bei sowie mehr Fortbildungsveranstaltungen und Arbeitskreise.⁵⁶⁶ Allerdings setzte sich in der Sozialen Arbeit ab den 1970erJahren eine „Therapeutisierung der Praxis“⁵⁶⁷ sowie eine „Ver(sozial‐)wissenschaftlichung“⁵⁶⁸ durch, die letztendlich zu einer Akademisierung führten. Ab 1971 entstanden neue Fachhochschulen mit eigenen Studiengängen, bereits zwei Jahre zuvor waren einige Bereiche Sozialer Arbeit Teil der universitären Erziehungswissenschaft geworden. Doch nicht alle Berufe der Sozialen Arbeit erfuhren eine Akademisierung, davon ausgenommen waren etwa die Erzieherinnen und Erzieher.⁵⁶⁹ Allerdings blieb in der Sozialen Arbeit umstritten, ob sie zu einer Profession wurde. Ein Einwand lautet, dass eine Profession frei von Auftrags- und Trägerinteressen handeln können müsse, die Soziale Arbeit aber an die Erfüllung von Verwaltungs- und Hoheitsaufgaben gebunden sei und letztlich Hilfsarbeit leiste. Andere Stimmen wiederum sprachen sich bewusst gegen eine Professionalisierung aus, da die Konzentration auf Standards zu technokratischem Handeln zwinge.⁵⁷⁰
Vgl. Tändler, Jahrzehnt, 2016, S. 111 f. Vgl. Neuffer, Kunst, 1990, S. 103 ff. Wendt, Geschichte, 2008, S. 321. Eßer, Geschichte, S. 26. Vgl. ebd., S. 26 ff. sowie Lambers, Helmut: Theorien der Sozialen Arbeit. Ein Kompendium und Vergleich. Opladen 2018, S. 392. Zusammenfassend Staub-Bernasconi, Silvia: Der Professionalisierungsdiskurs zur Sozialen Arbeit (SA/SP) im deutschsprachigen Kontext im Spiegel internationaler Ausbildungsstandards. Soziale Arbeit – eine verspätete Profession? In: Becker-Lenz, Ronald / Busse, Stefan / Ehlert, Gudrun u. a. (Hrsg.): Professionalität in der Sozialen Arbeit. Standpunkte, Kontroversen, Perspektiven. Wiesbaden 2009, S. 21– 46, hier S. 23 – 28.
158
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Weite Teile der Sozialen Arbeit vertraten hohe Professionalisierungsansprüche. Kritiker bemängelten jedoch, dass die vorhandenen Standards den Anforderungen des Tätigkeitsfelds nicht entsprächen. Außerdem fehlten Privilegien wie ein Zeugnisverweigerungsrecht.⁵⁷¹ Dies betraf auch Eheberater. Weder Soziale Arbeit noch Eheberatung waren als in sich geschlossener, von einem einheitlichen Selbstverständnis getragener Berufsstand anerkannt. Kriterien für Berufe, die das Zeugnisverweigerungsrecht erhalten, sind bis heute eine besonders qualifizierte Ausbildung, ein hohes Standesethos und die Einheitlichkeit des Berufsstands. Diese Voraussetzungen sah das Bundesverfassungsgericht für die Soziale Arbeit noch 1972 nicht in ausreichendem Umfang gegeben, da deren Aufgaben von Angehörigen anderer Berufe wie Theologen, Medizinern, Psychologen oder Juristen erfüllt würden.⁵⁷² Ähnlich wie in der Eheberatung waren Leitungspositionen bis in die 1970er-Jahre vor allem mit Juristen, Theologen und Medizinern besetzt. Später machte es die Akademisierung möglich, sozialpädagogisch geschultes Leitungspersonal einzusetzen.⁵⁷³ Die Eheberatung erreichte eine Professionalisierung ihrer Arbeit und legte Ausbildungsrichtlinien fest, setzte aber keine Akademisierung durch, auch weil die vielfach kirchlich geprägten Akteure in Methodendiskussionen zumindest während der 1950er- und frühen 1960er-Jahre zurückhaltend blieben. Es zeigen sich gewisse Parallelen zur Fürsorge, die bis in die 1950er-Jahre noch von christlichen Leitmotiven dominiert war.⁵⁷⁴
3.4 Zusammenarbeit und Konkurrenz der DAJEB mit konfessioneller Eheberatung Offiziell war die DAJEB paritätisch ausgerichtet, hatte jedoch enge Verbindungen zur evangelischen Kirche und galt teilweise auch als evangelisch geprägt. Der evangelischen Eheberatung fehlte damit eine exklusive, eigenständige Repräsentation. Sie entwickelte zwar bei der Gründung ihres eigenen Fachverbandes und Zentralinstituts ein Profil, das aber unscharf blieb. Gleichzeitig verfestigte sich dadurch die Konfessionalisierung in der Beratung.⁵⁷⁵
Vgl. Müller, Professionalisierung, 2002, S. 726 ff. Vgl. Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 19. Juli 1972, Nr. 2 BvL 7/71. Verfügbar unter: https://openjur.de/u/192852.html, besucht am 14. Januar 2021. Vgl. Eßer, Geschichte, 2011, S. 27. Vgl. ebd., S. 26. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 232 sowie Silies, Liebe, 2010, S. 225.
3.4 Zusammenarbeit und Konkurrenz der DAJEB mit konfessioneller Eheberatung
159
3.4.1 Die Begründung einer eigenständigen evangelischen Eheberatung Evangelische Kreise betrachteten die DAJEB in verschiedenem Ausmaß als evangelisch beeinflusst, was angesichts der Prägung ihrer Akteure zutraf.⁵⁷⁶ Zwar gab es seit der Nachkriegszeit Überlegungen, Eheberatung in der evangelischen Kirche eine eigene Organisation zu geben,⁵⁷⁷ allerdings fehlte eine Definition, wie der damit verbundene Auftrag aussehen sollte. Entsprechend verhielten sich die in der Beratungsarbeit Tätigen abwartend.⁵⁷⁸ Interne Uneinigkeit und die Einsicht, dass die DAJEB in gewisser Weise evangelische Bestrebungen repräsentierte, trugen dazu bei, dass ein eigener Verband zunächst nicht systematisch angestrebt wurde.⁵⁷⁹ Joachim Fischer vertrat als Vorsitzender der DAJEB gar den Standpunkt, die Arbeitsgemeinschaft sei evangelisch ausgerichtet, womit sich eine getrennte Vereinigung erübrige. So explizit kommunizierte er seine Haltung allerdings nur in evangelischen Kreisen selbst.⁵⁸⁰ Er akzeptierte den Standpunkt der Inneren Mission nicht, die DAJEB könne als offiziell paritätischer Verband nur bis zu einem gewissen Punkt evangelisch ausgerichtet sein.⁵⁸¹ Auch Lothar Loeffler, Mitglied im DAJEBVorstand, warb für die Einrichtung von Stellen, die offiziell als paritätisch galten, in denen aber evangelische Berater in enger Zusammenarbeit mit der Inneren Mission tonangebend waren.⁵⁸² Die Bemühungen der DAJEB-Vorsitzenden, eine eigenständige Struktur evangelischer Eheberatung zu verhindern, scheiterte jedoch. Ab Mitte der 1950er-Jahre schien es evangelischen Kreisen zunehmend notwendig, eine eigene Organisation aufzubauen. Das hatte auch mit einer Satzungsänderung der DAJEB zu tun: Diese hatte bisher Eheberater als Einzelmitglieder aufgenommen, strebte nun jedoch
Vgl. z. B. [Friedrich] Münchmeyer an Stuckel, Brief, 21. Juni 1954, ADE, CAW 1117 sowie Ranke an [Friedrich] Münchmeyer, 29. Mai 1957, Brief, ADE, CAW 1118. Die evangelische Tendenz wurde sowohl positiv als auch negativ gewertet. Vgl. [Innere Mission], Protokoll zu Bericht und Aussprache bei der Arbeitstagung der evangelischen Eheberater, 6. Dezember 1956, ADE, CAW 1118. Siehe für das Folgende auch Giehler, Rassen- und Sozialhygieniker, 2023. Vgl. z. B. [Innere Mission], Aktenvermerk, 5. November 1951, ADE, CAW 412 sowie [Innere Mission], Aktenvermerk, 20. Dezember 1951, ADE, CAW 408. Vgl. Jäger, Protestantismus, 2019, S. 324. Zeitgenössisch vgl. Hermine Bäcker an Ruppel, Brief, 17. September 1948, ADE, CAW 412. Vgl. [Innere Mission]: Evangelische Eheberatung – Praxis und Organisation, [1956], ADE, CAW 419. Vgl. z. B. Jürges an Hermine Bäcker, Brief, 2. Juli 1951, ADE, CAW 412 sowie Innere Mission Lippe an [Friedrich] Münchmeyer, Brief, 10. Juni 1954, ADE, CAW 1117. Vgl. z. B. [Maria Blech], Aktenvermerk, 19. Juli 1951, ADE, CAW 412 sowie [Innere Mission], Aktenvermerk, 23. Juni 1956, ADE, CAW 419. S. [Hermine Bäcker], Aktennotiz, 29. September 1951, ADE, CAW 1117.
160
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Landesarbeitsgemeinschaften von Beratungsstellen an, deren Vertretung die DAJEB auf Bundesebene wahrnehmen sollte. Die Befürchtung wuchs, dass die evangelische Eheberatung in dieser Konstellation ihre Interessen nicht genügend vertreten könne.⁵⁸³ Dabei orientierte sich die Innere Mission auch an der Reaktion des Katholischen Zentralinstituts.⁵⁸⁴ Hinzu kam, dass das Familienministerium inoffiziell die Bildung einer evangelischen Arbeitsgemeinschaft anregte, da sie die DAJEB eben nicht als alleinige Vertretung evangelischer Beratungseinrichtungen betrachtete.⁵⁸⁵ Loeffler war aufgrund der Beratungen evangelischer Kreise „in großer Sorge“ um die Zusammensetzung der DAJEB.⁵⁸⁶ Er versuchte, einen Zusammenschluss evangelischer Eheberater zu verhindern.⁵⁸⁷ Kurz darauf beauftragte der Direktor der Inneren Mission Friedrich Münchmeyer den zu diesem Zeitpunkt nicht als Vorsitzenden der DAJEB fungierenden Fischer mit der Gründung eines Fachverbandes.⁵⁸⁸ Die Konferenz für Evangelische Familienberatung (EKFuL) nahm 1959 ihre Arbeit auf.⁵⁸⁹ Evangelische Träger schieden damit aus der DAJEB aus, die daraufhin etwa 50 Prozent ihrer Mitglieder verlor.⁵⁹⁰ Die ursprüngliche Zielsetzung der Konferenz war es, Experten zusammenzubringen. Sie griff auf Kursen und Arbeitstagungen besonders zeitgenössisch stark diskutierte Themen wie zum Beispiel die „Mischehe“ auf. Fischer hatte zu Beginn bedeutenden Einfluss. Bereits zwei Jahre nach Gründung der Konferenz beauftragte Münchmeyer aber den Leiter der Hauptberatungsstelle für die Evangelische Kirche im Rheinland, Guido Groeger, Fischers Macht zurückzudrängen. Groeger leitete die Konferenz im Anschluss bis Mitte der 1960erJahre. Er galt als brillant und zu diesem Zeitpunkt als der bedeutendste evangelische Eheberater.⁵⁹¹
Vgl. z. B. [Hermine] Bäcker, Aktenvermerk, 10. Dezember 1953, CAW 1117 sowie [Innere Mission]: Evangelische Eheberatung – Praxis und Organisation, [1956], ADE, CAW 419. Vgl. Kapitel 3.4.2 Katholisches Zentralinstitut. Vgl. Irene Schneider, Aktenvermerk, 2. November 1956, ADE, CAW 1118. [Innere Mission], Aktenvermerk, 19. Januar 1957, ADE, CAW 1118. Vgl. Innere Mission, Aktenvermerk, 13. November 1956, ADE, CAW 1118. Vgl. auch im Folgenden Lippold, Church, 2014, S. 312 ff. sowie Jäger, Protestantismus, 2019, S. 324 ff. Im Jahr 1968 hatten sich ihr insgesamt 92 Beratungsstellen und etwa 220 Eheberater angeschlossen. Vgl. Große-Schönepauck, H[elene]: Die Eheberatung in Deutschland und in anderen Ländern, [1968], S. 10, BArch, B 189/2807, Bl. 265 ff. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 234. Vgl. von Hase an von Staa, Brief, 7. Oktober 1964, ADE, HGSt 2334. Zu Groegers Sicht auf evangelische Beratung nach der Ausgliederung aus der DAJEB vgl. Groeger, Guido: „Evangelische Beratung“. In: Die Innere Mission. Zeitschrift des Diakonischen Werkes Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland 49 (1959), Nr. 10, Oktober, S. 1– 2, DZI.
3.4 Zusammenarbeit und Konkurrenz der DAJEB mit konfessioneller Eheberatung
161
Die evangelische Eheberatung war lange von Suchbewegungen ihren theologischen Inhalt betreffend bestimmt. Unklar war, wie sie das Verhältnis von Beratung, Seelsorge und Psychotherapie gestalten und die institutionelle Verbindung von Kirche und Beratungsstellen festlegen sollte. Bis Ende der 1950er-Jahre blieb die Beratung unter pastoraler Leitung. Die Entwicklung der 1960er-Jahre hin zu Therapeutisierung und Professionalisierung machte sich jedoch auch in der evangelischen Richtung bemerkbar.⁵⁹² Fischer und Groeger waren seit der Nachkriegszeit wichtige und bekannte Akteure innerhalb der evangelischen Eheberatung.⁵⁹³ Ihr Machtkampf, der bis Ende der 1960er-Jahre andauerte, zeigte auch exemplarisch das Ringen um den Wandel der Eheberatung. Beide repräsentierten zwei entgegengesetzte Sichtweisen. Groeger war der Überzeugung, dass ein professionalisiertes psychotherapeutisches Vorgehen Standard innerhalb der Beratungsarbeit werden sollte. Er ging so weit, einen universitären Abschluss in Ehe- und Familienkunde anzustreben. Sein Ziel war es, Seelsorge und Beratung klar zu trennen. Fischer hingegen sah zwar die Notwendigkeit von Fortbildungen, lehnte allerdings akademische Studien und professionelle Eheberater ab. Er befürchtete, am Ende entstünden unreife Spezialisten anstatt emotional und spirituell kompetenter Berater. Der Psychotherapie wies er lediglich eine unterstützende Funktion zu, sie war in seinen Augen ein Aspekt unter vielen. Befürworter fand Fischer sowohl innerhalb des Diakonischen Werks als auch in einigen Landeskirchen. Letztere stellten zudem den Anspruch der Konferenz für Evangelische Familienberatung (EKFuL) in Frage, eigenständig zu arbeiten. Deren Einfluss blieb begrenzt. Eine neue Möglichkeit, evangelische Eheberatung stärker zu profilieren, ergab sich jedoch aus der Diskussion um die Beantragung von Fördermitteln. Da die Ausbildung in der Eheberatung bis zum Beginn der 1960er-Jahre planlos blieb und starke regionale Unterschiede aufwies, mehrten sich die Forderungen nach einer strukturierten und zentralen Organisation. Dies war auch auf das Bundessozialhilfegesetz sowie einen klar empfundenen Rückstand gegenüber der Entwicklung der katholischen Eheberatung zurückzuführen.⁵⁹⁴ Resultat der Auseinandersetzungen um die evangelische Beratung war 1964 die Gründung des Evangelischen Zentralinstituts für Familienberatung (EZI) mit Schwerpunkt als Aus- und Fortbildungsinstitut.⁵⁹⁵ Beteiligt waren die EKFuL, die Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen, das Diakonische Werk und
Vgl. Jäger, Protestantismus, 2019, S. 324 ff. Vgl. im Folgenden Lippold, Church, 2014, S. 313 ff. Vgl. z. B. von Hase, Aktenvermerk, 30. Mai 1963, ADE, HGSt 2334 sowie Schober an Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, Brief, 18. März 1964, Evangelisches Zentralarchiv in Berlin (EZA), 2/4358. Vgl. [EZI], Gesellschaftsvertrag, [1964], EZA, 2/4358.
162
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg. Zu diesem Zeitpunkt bestanden bundesweit 45 evangelische Eheberatungsstellen. Sie finanzierten sich unter anderem aus Mitteln des Familienministeriums. Das Diakonische Werk hatte ebenfalls einen entscheidenden Beitrag geleistet.⁵⁹⁶ Es verhielt sich dem Institut gegenüber jedoch ambivalent. Zu Beginn bat es die Landeskirchen, die dem EZI ebenso wie der EKFuL Widerstand entgegenbrachten, um Zusammenarbeit.⁵⁹⁷ Innerhalb kurzer Zeit wuchsen jedoch die Bedenken über die Ausrichtung des EZI, die Psychotherapeuten bestimmten.⁵⁹⁸ Deren Zielsetzung, Beratung zu professionalisieren und Ehen zu individuellem Glück zu verhelfen, entsprach nicht den Intentionen des Diakonischen Werkes. Dieses betrachtete den Einsatz Ehrenamtlicher als wichtigsten Aspekt evangelischer Beratungsarbeit. Eheberatung galt ihm als Möglichkeit, evangelische Positionen zu Ehe und Familie zu vermitteln sowie Ratsuchende wieder mehr in die Kirche und das Gemeindeleben zu integrieren. Folglich sollte das EZI als Partner der Kirche und des Verbandes Methodenfindung betreiben, um die Bevölkerung besser erreichen zu können. Bis Ende der 1960er-Jahre gelang es dem EZI jedoch, den psychologischen Ansatz durchzusetzen.⁵⁹⁹ Er wurde zum einzigen Modell evangelischer Beratungsarbeit. Der Fokus richtete sich damit zunehmend auf die Eigenverantwortung von Ratsuchenden.⁶⁰⁰ Dieser Wandel äußerte sich auch in der Praxis.⁶⁰¹ Die Eheberater mussten zwar weiterhin evangelisch sein, ihre Arbeit war es jedoch nicht mehr. Nur wenige erkannten Seelsorge als einen Aspekt ihrer Tätigkeit an, meist im Zusammenhang mit von Pfarrern überwiesenen Ratsuchenden. Die Leiter des EZI trugen wesentlich zu dieser Entwicklung bei. Von 1964 bis 1967 stand mit Bertha Sommer eine Psychotherapeutin an der Spitze des Instituts.⁶⁰² Dass eine Frau die Leitung übernahm, Vgl. Schober an Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, Brief, 18. März 1964, EZA, 2/4358 sowie Große-Schönepauck, H[elene]: Die Eheberatung in Deutschland und in anderen Ländern, [1968], S. 10, BArch, B 189/2807, Bl. 265 ff. Vgl. Schober an Kirchenleitungen der Evangelischen Landeskirchen, Brief, 30. Juli 1965, ADE, HGSt 2334. Vgl. im Folgenden Lippold, Church, 2014, S. 312 ff. Zeitgenössisch vgl. z. B. Schröder an von Hase, Brief, 10. Dezember 1965, ADE, HGSt 2334 sowie von Hase an Schröder, Brief, 15. Dezember 1965, ADE, HGSt 2334. Zeitgenössisch vgl. von Hase: Zur Entwicklung der Evang. Erziehungs- und Eheberatung, 20. September 1967, ADE, HGSt 2334. Jäger, Protestantismus, 2019, S. 367. Vgl. im Folgenden Lippold, Church, 2014, S. 312 ff. Bertha Sommer (geb. 11.6.1899, Todesdatum unbekannt), deren Ehemann und Sohn früh verstarben, begann 1928 ein Medizinstudium. Nach einer mehrjährigen Unterbrechung nahm sie dieses 1939 wieder auf und absolvierte parallel eine Ausbildung zur Psychotherapeutin in Zürich. Nach dem Abschluss in Medizin und Psychotherapie sowie verschiedenen beruflichen Stationen erhielt sie 1950 eine Berechtigung als Lehr- und Kontrollanalytikerin. Im selben Jahr wurde sie Oberärztin
3.4 Zusammenarbeit und Konkurrenz der DAJEB mit konfessioneller Eheberatung
163
bedeutete einen seltenen Rückgriff auf die ursprünglich weibliche Führung in der evangelischen Eheberatung. Für die neuen, professionalisierten Strukturen innerhalb der Eheberatung war charakteristisch, dass der Einfluss von Frauen zurückgedrängt wurde. Ab 1968 übernahm Groeger die Leitung des EZI. Die Gründung von EKFuL und Katholischem Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen hatte die stärkere Profilierung und Professionalisierung evangelischer Eheberatung zur Folge. Die DAJEB verlor daraufhin nicht nur Mitglieder, sie musste auch den Anspruch, evangelische Beratung mitzurepräsentieren, aufgeben. Dies zog einen klaren Bedeutungsverlust nach sich, was nicht die Intention der Inneren Mission gewesen war.⁶⁰³ Sie plädierte weiter dafür, dass die evangelischen Mitglieder in der DAJEB verbleiben sollten.⁶⁰⁴
3.4.2 Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen Die Gründung der DAJEB führte der katholischen Eheberatung vor Augen, dass sie dringend handeln musste, wollte sie ihre Führungsrolle sichern. Ausschlaggebend für das entscheidende Engagement der Bischofskonferenz wurden konkret die Fortbildungen der DAJEB, die auch das Thema Geburtenkontrolle vermittelten und von katholischen Eheberaterinnen besucht wurden. Im Jahr 1952 entstand das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen (KZI).⁶⁰⁵ Zwar beabsichtigte die Arbeitsgemeinschaft, die gesamte Eheberatung in der Bundesrepublik zu repräsentieren. Eindeutig war aber auch, dass die katholische Eheberatung sich zu stark abgrenzte, um integriert werden zu können. Die DAJEB erkannte zudem die Notwendigkeit an, dass es aufgrund der katholischen Ehelehre dezidiert katholische Stellen geben musste.⁶⁰⁶ Allerdings war sie auch an der Beteiligung von konfessionellen Zentralstellen interessiert. Dennoch rieten die Bischofskonferenz beziehungsweise später das KZI katholischen Beratungseinrich-
der Abteilung für psychosomatische Medizin der Universitätsklinik Heidelberg. Nach ihrer Promotion 1955 war Sommer als Dozentin am Stuttgarter Institut für Psychotherapie und Tiefenpsychologie tätig. Später übernahm sie die Leitung der Evangelischen Beratungsstelle für Familien- und Erziehungsfragen in Stuttgart, 1961 wurde sie die Leiterin der Landesstelle für Familien- und Erziehungsfragen der Landeskirche Württemberg. Drei Jahre später trat sie die Leitung des EZI an, die sie bis 1967 innehatte. Als erste Leiterin prägte Sommer die psychotherapeutische Orientierung des Instituts mit.Vgl. o. A., Aktenvermerk, 1967, ADE, PB 847. Zur Entwicklung des EZI unter ihrer Leitung vgl. von Hase, Aktenvermerk, 3. November 1966, ADE, HGSt 2334. Vgl. [Hermine] Bäcker, Aktenvermerk, [Mai 1957], ADE, CAW 1118. Vgl. [Hermine] Bäcker, Aktenvermerk, 23. Mai 1957, ADE, CAW 1118. Vgl. Kapitel 4.2.1 Vorgeschichte und Gründung. Vgl. [Innere Mission], Aktenvermerk, 5. November 1951, ADE, CAW 412.
164
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
tungen von der Mitgliedschaft in der DAJEB ab. Einzelmitgliedschaften für Eheberater waren allerdings möglich und wurden ab Ende der 1950er-Jahre auch empfohlen.⁶⁰⁷ In welchem Ausmaß Beraterinnen dies nutzten, ist unklar.⁶⁰⁸ Von zwei der DAJEB angeschlossenen Beratungsstellen war bekannt, dass dort ein Tag für eine katholische Sprechstunde zur Verfügung stand, deren Personal auch dem Arbeitskreis angehörte.⁶⁰⁹ Mit kirchlichen Stellen gab es teilweise eine enge Zusammenarbeit, in der auch gemeinsam Fälle besprochen wurden.⁶¹⁰ So berichtete beispielsweise die Arbeitsgemeinschaft in Hannover in ihren Jahresberichten auch von den Erfolgen der katholischen Beratungsstelle.⁶¹¹
3.4.3 Zusammenarbeit mit katholischen und evangelischen Organisationen Obwohl DAJEB, EZI und KZI konfessionell unterschiedlich ausgerichtet waren, erkannten sie es als gemeinsames Ziel an, Ehen und Familien zu erhalten. „Gerade dieser Respekt vor so verschieden begründeter Verantwortung schaffte eine segensreiche Atmosphäre des Vertrauens, das wiederum der fachlichen Arbeit zu allererst zugute kam. So hat diese Fachgesellschaft […] es darum auch begrüßt, daß im Lauf der nächsten Jahre auf katholischer und evangelischer Seite eigene Organisationen entstanden.“⁶¹² Diese positive Selbstdarstellung ist allerdings zu relativieren. Die DAJEB hatte durchaus versucht, eine eigene evangelische Organisation zu verhindern.⁶¹³ Zunächst betrachtete sie die Zusammenarbeit mit anderen Verbünden als eher zweckhaft. Mit der Zeit wuchs jedoch die Erkenntnis, dass Kooperationen überraschende Möglichkeiten mit sich brachten, und die Interaktion intensivierte sich.⁶¹⁴ Ab 1957 waren unter Federführung der DAJEB zumindest einmal jährlich Treffen mit EZI und KZI geplant, um Probleme zu diskutieren sowie Veranstaltungspläne aufeinander abzustimmen. Die Idee, über Rundschreiben der DAJEB in einen regelmäßigen Gedankenaustausch zu treten, stand ebenfalls im
Vgl. [Walter] Raupach: Niederschrift über die Besprechung am 2.12.1957, [1957], BArch, B 189/ 2815, Bl. 105 f. Es liegt lediglich im Jahresbericht 1949/50 eine Namensliste vor. Dort sind mindestens zwei katholische Fürsorgerinnen aufgelistet. Da jedoch keine Unterscheidung zwischen Kursteilnehmern und Mitgliedern vorgenommen wird, kann es sich bei diesen auch lediglich um Kursteilnehmerinnen handeln. Vgl. DAJEB: Jahresbericht 1949/50, 1950, S. 5 ff., DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. [Fischer], Erfahrungen, 1953/54, S. 361, ADE, JF 31. Vgl. DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 25, Februar 1958, S. 7, BArch, B 142/2043. Vgl. z. B. Tägert, Bericht, 1952, DZI sowie dies., Arbeitsbericht, 1954, BArch, B 142/418, Bl. 223 ff. Fischer, Jahre, 1959, S. 36. Vgl. Kapitel 3.4.1 Die Begründung. Vgl. Loeffler, Lothar: Ehe und Familie als Gabe und Aufgabe. Göttingen 1959.
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
165
Raum. Ob die Verbände dies umsetzten, ist unklar. Den Plan, gemeinsam zu einigen Veranstaltungen der DAJEB einzuladen, verwirklichten sie nicht.⁶¹⁵ Das Familienministerium begrüßte die grundsätzliche Zusammenarbeit.⁶¹⁶ Bei ihren Treffen erörterten die Verbandsvertreter verschiedene Fragen, wie die Aufnahme konfessioneller Vertreter in den Vorstand, aber auch Themen, denen DAJEB, EZI und KZI inhaltlich unterschiedlich gegenüberstanden. Ein Beispiel dafür war die Geburtenregelung. Im Jahr 1959 vertraten DAJEB, KZI und EZI auf einer internationalen Konferenz der Union Internationale des Organismes Familiaux gemeinsam ihre Positionen, auch wenn diese teilweise voneinander abwichen.⁶¹⁷ Ende der 1960er-Jahre publizierten sie eine Stellungnahme zur Empfängnisregelung.⁶¹⁸ Hinzu kam die Zusammenarbeit im Rahmen des Deutschen Arbeitskreises Jugend-, Ehe- und Familienberatung. Diese intensive Kooperation ermöglichte es der DAJEB, ihre einflussreiche Rolle zu verteidigen, obwohl ihre Mitgliederbasis schrumpfte.⁶¹⁹ Dass die Verbände sich im Bereich der Geburtenkontrolle einigten, war auch auf das zunehmende Gewicht von Pro Familia Ende der 1960er-Jahre zurückzuführen, die zur Konkurrenz geworden war, seit Frauen sich dort die „Pille“ verschreiben lassen konnten.⁶²⁰
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort Im Folgenden stehen Selbstverständnis und Praxis der Berater, die in den DAJEBStellen vor Ort tätig waren, im Vordergrund. Ein umfassender Bericht von 1953 gibt Auskunft über das Profil der Einrichtungen und der Besucher, aber auch zu Krisendiagnosen und Haltungen der Eheberater. Offenbar bestand keine Auflage,
Vgl. Raupach, Niederschrift über die Besprechung, [2. Dezember 1957], BArch, B 189/2815, Bl. 105 f. sowie [Joachim] Fischer an [Helene] Große-Schönepauck, Brief, 17. Dezember 1957, BArch, B 189/2815, Bl. 88. Vgl. auch Kapitel 3.3.5 Kommunikation. Vgl. [Helene] Große-Schönepauck an [Joachim] Fischer, Brief, 13. Februar 1958, BArch, B 189/2815, Bl. 89 f. Vgl. o. A.: epd (Evangelischer Pressedienst) ZA Nr. 249, 31. Oktober 1959, BArch, B 191/63, Bl. 34. Vgl. DAJEB/KZI/EZI: Stellungnahme, September 1967, BArch, B 189/2815, Bl. 238 f. 1969 hatte die DAJEB nur noch 21 Mitglieder. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 234. Die DAJEB lehnte die Haltung von Pro Familia ab und suchte darüber hinaus ein Beratungsmonopol durch diese sowie Ärzte zu verhindern. Im Zuge gemeinsamer Klausurtagungen sowie Gesprächen im Bundesfamilienministerium entstand mit der Zeit jedoch ein vertrauensvolleres Verhältnis. Ende 1968 wurde Pro Familia in den DAK aufgenommen.Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 237 ff. sowie Bundesministerium für Familie und Jugend: Niederschrift über die Besprechung, 10. Oktober 1967, BArch, B 189/2816, Bl. 281 ff. Große-Schönepauck, H[elene]: Die Eheberatung in Deutschland und in anderen Ländern, [1968], S. 11, BArch, B 189/2807, Bl. 265 ff.
166
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
systematische Rückmeldungen an Trägerorganisationen zu senden. Vermutlich hatten die oftmals ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter keine Kapazitäten dafür. Daher finden sich insgesamt nur wenige Jahresberichte. Dies machte es schwer, die Arbeit zu kontrollieren und Erfolge zu dokumentieren. Die fehlende Berichterstattung widersprach damit dem Professionalisierungsanspruch der DAJEB. Es gab jedoch Ausnahmen. Die ganz im Sinne des Verbandes operierende Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung in Hannover veröffentlichte ihre Berichte sogar in Fachzeitschriften. Auch die Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe legte jährlich Rechenschaft über ihre Arbeit ab. Von ihr liegen 14 Berichte vor, die fundierte Rückschlüsse auf das Selbstbild der lokalen Berater zulassen. Diese beiden Einrichtungen werden im Folgenden näher betrachtet, ebenso wie die Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Hamburg, von der zwei Berichte erhalten sind, und die Einrichtung in Berlin-Reinickendorf mit 24 Berichten. Letztere erlauben mit den von dort überlieferten Fallakten eine Tiefenanalyse der Praxis vor Ort. Außerdem wird die evangelische Eheberatung behandelt. Darüber hinaus liegen Berichte des Landesgesundheitsamtes sowie zahlreiche Monatsberichte der weiteren bezirklichen Beratungsstellen Berlins aus den Jahren 1948 bis 1956 vor, mit Schwerpunkt auf 1949 und 1950. Die Alliierten hatten diese Meldungen eingefordert.⁶²¹ Sie beziehen sich jedoch auf sämtliche Aufgabengebiete dieser Ämter. Die darin enthaltenen Hinweise zur Arbeit der Eheberatung sind zwischen zwei Wörtern und einer halben Seite lang und daher nur teilweise geeignet, um Selbstbild und Beratungspraxis nachzuvollziehen.⁶²² Weitere Berichte enthalten lediglich Angaben zur Besucherzahl.⁶²³
3.5.1 Versuch der Bestandsaufnahme In der Nachkriegszeit gründeten sich neben den bereits genannten Beratungsstellen viele weitere mit unterschiedlichsten Trägerschaften. In Frankfurt beispielsweise arbeiteten Einrichtungen der Caritas⁶²⁴ sowie der Arbeiterwohlfahrt und ab 1952
Vgl. Kapitel 3.6 Fallstudie. Vgl. z. B. Ges. IV C: Monatsbericht IV C November 1952, [Dezember 1952], LAB, B Rep. 012, Nr. 29 sowie Bezirksamt Zehlendorf, Bericht über die Tätigkeit der Abteilung Gesundheitswesen, 22. November 1949, LAB, B Rep. 012, Nr. 106. Vgl. z. B. Wilmersdorf: Monatsbericht Abt. Gesundheitswesen, 6. August 1948, LAB, B Rep 12, Nr. 102 sowie Wilmersdorf: Monatsbericht Abt. Gesundheitswesen, 5. Januar 1949, LAB, B Rep 12, Nr. 102. Vgl. Kapitel 4.5.5.1 Eheberatung in der Großstadt.
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
167
eine sozialwissenschaftlich ausgerichtete Familienberatung.⁶²⁵ Auch eine Ehe- und Familienberatung für Kriegsversehrte und zivile Körperversehrte bot als Spezialeinrichtung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Sprechstunden an.⁶²⁶ Weitere Beratungsstellen lassen sich in Aachen, Barmen, Bremen,⁶²⁷ Bielefeld, Cuxhaven, Düsseldorf, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Kiel, Lübeck, München,⁶²⁸ Münster, Neustadt, Wiesbaden und Wilhelmshaven nachweisen.⁶²⁹ Eine Schätzung geht für 1950 von 50 behördlichen Einrichtungen aus, wovon elf den Gesundheitsämtern und zwölf den Sozialämtern angeschlossen waren. Weitere existierten in der Wohlfahrtspflege.⁶³⁰ Da es keine Gesamtübersicht gab, trug die DAJEB ab 1950 Informationen von ihnen bereits bekannten Stellen sowie den Stadtverwaltungen zusammen.⁶³¹ Auch die Innere Mission versuchte, sich einen Überblick zu verschaffen.⁶³² Dort war man 1951 der Ansicht, dass selbst die Landes- und Provinzialverbände nicht wussten, welche Einrichtungen es vor Ort gab.⁶³³ An Eheberatung interessierte Behörden stellten Anfragen an andere Stadtverwaltungen, bei denen ihnen Einrichtungen bekannt waren.⁶³⁴ Die DAJEB verschickte Fragebögen an verschiedene Städte und bekannte Beratungsstellen und bat um Auskunft, ob diese Kenntnis von weiteren Einrichtungen hätten.⁶³⁵ Eine Bestandsaufnahme erwies sich selbst regional als schwierig. Die Zahlen waren deshalb widersprüchlich. 1952 kam die DAJEB auf eine Schätzung von
Vgl. Bayer, Lucie et al.: Zur Gründung einer Familienberatungsstelle Frankfurt a. M., o. D., Stadtarchiv Frankfurt, Magistratsakten, 8877. Vgl. o. A.: „Aus den Landesverbänden“. In: DPWV-Nachrichten 1 (1951), H. 4, S. 2, DZI. Vgl. Innere Mission Bremen: Bericht über die Arbeit des Vereins für Innere Mission Bremen 1949/50, Bremen [1951], S. 7, Landeskirchliches Archiv der Bremischen Evangelischen Kirche (LkABEK). Vgl. Spangenberg, Johanna: „Gedanken zu einer Eheberatungsstelle“. In: SPD-Mitteilungsblatt, 10. September 1948, S. 2, Stadtarchiv Frankfurt, Stadtgesundheitsamt, 186. Vgl. für die übrigen Städte [Fischer, J.], Erfahrungen, 1953/54, S. 361, ADE, JF 31. Vgl. Fischer-Erling, Eheberatung, 1956, Sp. 154. Vgl. z. B. Direktion des Städtischen Wohlfahrtsamtes, Aktenvermerk, 3. November 1950, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/SJB, Nr. 31 sowie [Joachim] Fischer, Umfrage Jahresbericht, Dezember 1953, BArch, B 189/2815, Bl. 15 ff. Vgl. Central-Ausschuss für die Innere Mission an Landesverbände der Inneren Mission, Mitteilung, 28. Juni 1952, S. 1, ADE, CAW 1117. Vgl. Bä[cker, Hermine], Aktennotiz, 19. April 1951, ADE, CAW 1117. Vgl. [Friedrich] Münchmeyer, Bericht über die Arbeitstagung für evangelische Eheberatung am 26./27. September 1951, ADE, CAW 1117. Vgl. z. B. Sozialverwaltung Kreis Detmold an Stadtverwaltung Karlsruhe, Brief, 21. Mai 1949, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr 5188 sowie Senator für Gesundheitswesen an Stadtrat München, Brief, 10. Juli 1953, LAB, B Rep 012, Nr. 176. S. DAJEB: Fragebogen. 17. Oktober 1950, Staatsarchiv Hamburg, 352– 6 Gesundheitsbehörde, Nr. 1061.
168
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
60 Beratungseinrichtungen,⁶³⁶ eine andere Quelle nannte 56.⁶³⁷ Im Jahresbericht von 1952 erschienen sie namentlich. Elf davon waren katholisch. Hinzu kamen 39 Arbeitsgemeinschaften.⁶³⁸ Der Jahresbericht von 1953 verzeichnete jedoch lediglich 49 Stellen, davon wiederum mindestens fünf katholische, außerdem wurden 38 Arbeitsgemeinschaften aufgezählt, bei denen es sich um kirchliche Gemeinden sowie kommunale Jugend- und Gesundheitsämter handelte.⁶³⁹ Nicht alle gelisteten Beratungsstellen und Arbeitsgemeinschaften waren damals oder auch später Mitglieder der DAJEB.⁶⁴⁰ So trat beispielsweise die Vertrauensstelle Karlsruhe dem Verband erst 1960 bei.⁶⁴¹ Nicht nur aufgrund der geringeren Anzahl der Einrichtungen im späteren Jahresbericht ist es offensichtlich, dass nicht alle von ihnen erfasst waren. Im für die vorliegende Arbeit ausgewerteten Material sind 22 weitere überkonfessionelle oder behördliche Einrichtungen belegt.⁶⁴² Da das Landesgesundheitsamt Berlin (LGA) spätestens ab 1951 nachweislich in Kontakt mit der DAJEB stand, hätten dieser mindestens sämtliche Stellen der bezirklichen Gesundheitsämter bekannt sein können.⁶⁴³ Weitere Listen des Verbands sind nicht überliefert. Erst für den Zeitraum nach 1968 liegt der nächste Hinweis auf in der Arbeitsgemeinschaft organisierte Angebote vor. Dabei geht es um 60 „hauptamtliche Kräfte“.⁶⁴⁴ Zu vermuten ist, dass damit Eheberater und nicht Einrichtungen gemeint sind. Deren Zahl dürfte noch niedriger gewesen sein. Wie viele
Vgl. Fischer, J[oachim]: Über den Stand der Eheberatung in einigen europäischen Ländern und den USA. [1952], S. 46, ADE, CAW 1117. Vgl. [Fischer, J.], Erfahrungen, 1953/54, S. 361, ADE, JF 31. Vgl. DAJEB, Denkschrift, 1953, S. 15 ff., DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. DAJEB, Jahresbericht, [1954], S. 9 ff., DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Kuller geht davon aus, dass die gelisteten Arbeitsgemeinschaften unter anderem Beratungsstunden anboten. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 228. Allerdings ist die Liste der Arbeitsgemeinschaft damit überschrieben, dass diese ohne beziehungsweise abgesehen von Eheberatungen existierten. Daher wird in der vorliegenden Untersuchung davon ausgegangen, dass die Arbeitsgemeinschaften nur teilweise Beratungen anboten. Vgl. DAJEB, Jahresbericht, [1954], S. 12, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. zu Mitgliederzahlen Kapitel 3.2.2 Organisation und Aufgabenstellung. Kuller nimmt an, dass die gelisteten Beratungsstellen und Arbeitsgemeinschaften in der DAJEB organisiert waren. Damit wäre diese bis Mitte der 1950er-Jahre der stärkste Verband im Bereich der Eheberatung gewesen.Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 228. Die Auflistung ist jedoch mit „Liste der der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung bekannten Eheberatungsstellen“ überschrieben. Daher ist davon auszugehen, dass die DAJEB mit diesen lediglich in Kontakt stand. DAJEB, Jahresbericht, [1954], S. 9, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. Kapitel 3.5.4 Vertrauensstelle. Vgl. Kapitel 3.1 Eheberatung in Nachkriegszeit. Vgl. LGA: Monatsbericht III C Mai 1951, [Juni 1951], LAB, B Rep. 012, Nr. 96. Große-Schönepauck, H[elene]: Die Eheberatung in Deutschland und in anderen Ländern, S. 5 f., BArch, B 189/2807, Bl. 265 ff.
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
169
davon konfessionell waren, ist zudem unklar. Auch wenn vorherige Untersuchungen bereits ergeben haben, dass die Stellen zu Beginn der 1950er-Jahre kaum institutionalisiert waren, verwundern die unvollständigen Angaben. Nach 1954 stellte der Verband die Versuche, sich eine Übersicht zu verschaffen, offenbar ganz ein. Die Forschung geht für den Beginn der 1970er-Jahre von einer Gesamtzahl zwischen 273 und 323 Beratungsstellen aus. Zu diesen zählten sowohl kirchliche als auch nichtkirchliche Angebote sowie diejenigen von Pro Familia.⁶⁴⁵ Laut eigener Angabe hatten zu diesem Zeitpunkt 2 Prozent der Männer und 3 Prozent der Frauen von der Gesamtbevölkerung bei Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen das Gespräch gesucht.⁶⁴⁶ Einige Einrichtungen handelten mit monatlichen Teambesprechungen erkennbar nach den Vorstellungen der DAJEB.⁶⁴⁷ Andere verwiesen zudem explizit auf den Nutzen der Ausbildungslehrgänge, welche die Arbeitsgemeinschaft abhielt.⁶⁴⁸ Auch über Tagungen finden sich öfter Berichte.⁶⁴⁹ Sexualberatungsstellen stießen bei der DAJEB auf Ablehnung, weil sie empfängnisverhütende Mittel abgaben. Befürwortet wurden hingegen paritätische und konfessionelle Angebote. Sie würden umfassend beraten, ihr Personal sei menschlich und fachlich qualifiziert und seine Eignung stimme mit dem Programm des Verbands überein.⁶⁵⁰
3.5.2 Profil der DAJEB-Stellen, Besucher und Beratungsanlässe In einem 1953 erschienenen Sonderdruck der Zeitschrift Öffentlicher Gesundheitsdienst gab die DAJEB einen Überblick über die Beratungsarbeit der nach ihren Grundsätzen vorgehenden Stellen.⁶⁵¹ Die Veröffentlichung ist ungewöhnlich, da sie
Vgl. Silies, Liebe, 2010, S. 228 sowie Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 364, Fn. 319. Vgl. Silies, Liebe, 2010, S. 228. Vgl. z. B. o. A.: „Die Göttinger Eheberatungsstelle“. In: Wege zum Menschen. Monatsschrift für Seelsorge, Psychotherapie und Erziehung und zur Förderung der Zusammenarbeit von Arzt und Seelsorger 6 (1954), S. 343, DZI sowie Groeger, Verfahren, 1955, S. 10 f., DZI. Vgl. z. B. ebd., S. 10 sowie Schorsch, Arbeit, 1956, DZI. Vgl. z. B. o. A.: „Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung“. In: Wege zum Menschen. Monatsschrift für Seelsorge, Psychotherapie und Erziehung und zur Förderung der Zusammenarbeit von Arzt und Seelsorger 8 (1956), S. 371– 373, DZI sowie B.: „Jahrestagung der Eheberater“. In: Die Innere Mission. Zeitschrift des Diakonischen Werkes Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland 47 (1957), S. 211– 214, DZI. S. Groeger, Verfahren, 1955, S. 4, DZI. Vgl. im Folgenden [Fischer, J.], Erfahrungen, 1953/54, ADE, JF 31.
170
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
als einzige ihrer Publikation eine Art analytischen Fokus auf die Praxis richtete, wenn auch stark eingeschränkt auf Statistik. Der Überblick basierte auf Jahresberichten von sechs Eheberatungsstellen, deren Grundlage wiederum Fragebögen der DAJEB waren.⁶⁵² Die Fragebögen deuten auf eine angestrebte Systematisierung hin, die der Verband jedoch nicht weiterverfolgte.⁶⁵³ Hinzu kamen freie Jahresberichte elf weiterer und Informationen von 56 der Arbeitsgemeinschaft näher bekannten Einrichtungen. Damit ist die Anzahl der abgedeckten Angebote sehr hoch. Ein vergleichbarer Bericht liegt für den Untersuchungszeitraum nicht vor. Auch die umfassende Auswertung von Beratungsanlässen ist im Untersuchungszeitraum einmalig. Die DAJEB präsentierte sich mit der Veröffentlichung als gut informierte, systematisch arbeitende Fachgesellschaft. Die meisten Beratungen bezeichneten sich als „Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute“ oder „Jugend- und Eheberatungsstelle“. Handelte es sich um Eheberatung im Sinne der DAJEB, dominierte eine private oder frei gemeinnützige Trägerschaft. Allgemein ging die Tendenz zu einem größeren Mitarbeiterstab, „um die auf die Dauer gar nicht mögliche Arbeitsbelastung der Ein-Mann-Beratung […] gleichmäßig und regelmäßig zu verteilen“.⁶⁵⁴ Die Anzahl der wöchentlichen Beratungsstunden lag in der Regel bei drei, einige Stellen waren aber auch täglich geöffnet. Pro Beratungstag kamen in größeren Städten zwischen drei und fünf Neuzugänge, insgesamt zwischen 200 und 400 pro Jahr. Durchschnittlich kamen Ratsuchende drei- bis sechs Mal zur Sprechstunde, in extremen Fällen über 20 Mal, sodass eine „längerdauernde Lebensführung“ stattfand.⁶⁵⁵ Dies ergab einen Schnitt von 500 bis 1.000 jährlichen Einzelberatungen. In zwei Städten stand ein Beratungstag für eine katholische Sprechstunde zur Verfügung. Ohne nähere Begründung schloss die DAJEB, dass bei sachgemäß umfassender Arbeit die Nachfrage schnell die Kapazität der Beratungsstellen übersteige. Sie erwähnte auch schriftliche Beratungen, die jedoch als zu aufwendig für die reguläre Arbeitszeit galten. Frauen suchten die Beratung doppelt bis drei Mal so häufig zuerst auf. In vielen Fällen war es schwierig, den Ehepartner überhaupt zu erreichen. Die in diesem Punkt erfolgreichste Beratungsstelle berichtete von einer Erfolgsquote von 75 Prozent. Die DAJEB bedauerte diesen Zustand. Ihr Vorsitzender Fischer war der Überzeugung, dass es eine „unbedingte Voraussetzung optimaler Hilfe“ sei, beide Partner einzubeziehen.⁶⁵⁶ Auch versuchten die Berater zum Teil, mit weiteren
Vermutlich handelt es sich um folgende Fragebögen: [Joachim] Fischer: [Umfrage] Jahresbericht, Dezember 1953, BArch, B 189/2815, Bl. 15 ff. Vgl. Kapitel 3.2.4 Rassen- und Sozialhygieniker und Kapitel 3.5 Arbeit. [Fischer, J.], Erfahrungen, 1953/54, S. 361, ADE, JF 31. Ebd., S. 362. Ebd., S. 363.
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
171
Personen Kontakt aufzunehmen, die in die Eheprobleme involviert waren, etwa Schwiegereltern. Die meisten Beratenen gehörten der Altersgruppe um die 45 Jahre an, wobei langjährige Ehen von 20 Jahren überwogen. Die Paare hatten größtenteils keine oder ein bis zwei Kinder. Da die Zahl der Ratsuchenden aus Ehen mit hoher Kinderzahl am geringsten war, folgerte die DAJEB, dass Partner in kinderlosen Ehen oder solchen mit wenigen Kindern eher den Entschluss zur Scheidung fassten. Statistisch wird zwar eine niedrigere Scheidungsrate von Ehen mit mehreren Kindern bestätigt.⁶⁵⁷ Wieso diese Paare die Beratungsstellen selten aufsuchten, lässt sich aus dieser Tatsache jedoch nicht eruieren. Die Beratung in Anspruch zu nehmen, bedeutete weder zwangsläufig eine Scheidung noch auch nur deren Planung. Über die eigentlichen Gründe, weshalb kinderreiche Partner selten zur Beratung kamen, ist somit nichts ausgesagt.⁶⁵⁸ Vielmehr erscheint die Interpretation der DAJEB hier beliebig. Der unterproportionale Anteil von Versehrten unter den Ratsuchenden deutete sie beispielsweise nicht als geringen Beratungsbedarf, sondern Zurückhaltung. Insgesamt entsprach die soziale Gliederung der Besucher weitestgehend derjenigen in den Städten Westdeutschlands. Es handelte sich überwiegend um gelernte Arbeiter, Handwerker, Angestellte und ähnliche Berufsgruppen. Akademiker und ungelernte Arbeiter waren unterproportional vertreten. Unter den weiblichen Ratsuchenden überwogen diejenigen ohne Beruf. Dies ist insofern auffällig, als in der DAJEB die Berufstätigkeit von Ehefrauen als problematisch galt und deren Partnerschaften im Grunde als krisenanfälliger betrachtet wurden.⁶⁵⁹ Ratsuchende kamen laut Bericht der DAJEB von 1953 vor allem mit juristischen Fragen. Sie erschienen aus eigenem Antrieb oder weil Bekannte, die bereits in der Sprechstunde waren, sie auf das Angebot hinwiesen. Dies betrachtete die Arbeitsgemeinschaft als günstige Entwicklung. Die nächstgrößere Gruppe waren jedoch Personen, die ein Gericht wegen ihres Scheidungsbegehrens schickte. In diesem Zusammenhang waren Versöhnungsversuche wenig aussichtsreich. Weitere Fälle kamen, weil Fürsorgerinnen der Wohlfahrtspflege dies in die Wege leiteten. Andere Berufsgruppen wie Mediziner, Pfarrer und Anwälte waren zum Bedauern der DAJEB hingegen sehr zurückhaltend darin, die Beratungsstellen zu empfehlen.
Vgl. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung: Ehelösungen. Geschiedene Ehen nach der Kinderzahl in Deutschland (1960 – 2018). Verfügbar unter: https://www.bib.bund.de/Permalink.html? id=10240912, besucht am 19. Oktober 2020. Da keine konkreten Zahlen angegeben werden, kann auch nicht überprüft werden, ob es sich um eine geringe Beratungsfrequenz im Verhältnis zu der Anzahl von westdeutschen Ehen mit mehreren Kindern handelt oder ob die geringe Besucherfrequenz dieser Gruppe ihrer Anzahl in der Bundesrepublik proportional entspricht. Vgl. Kapitel 3.3.1 Vorstellungen von Ehe.
172
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Um Angaben zu den Beratungsanlässen machen zu können, hatte die DAJEB 1.138 Fälle ausgewertet. Sie betonte das häufige Zusammenwirken mehrerer Faktoren und listete die Themen nach Häufigkeit auf: eheliche Kontaktstörungen (23 Prozent), Untreue des Mannes (21 Prozent), Schwiegereltern (7,5 Prozent), Partnerwahl (6,6 Prozent), Unterhalt (6,5 Prozent), Alkoholsucht (5 Prozent), Finanzen (4,4 Prozent), Fehlformen der Sexualität (4,2 Prozent), Krankheit (4,1 Prozent), Wohnung (4 Prozent), Untreue der Frau (3,1 Prozent), Sexualpädagogik (2,8 Prozent), Geburtenregelung (2,6 Prozent), uneheliches beziehungsweise voreheliches Kind (1,9 Prozent), Erziehungsfragen (1,9 Prozent), Weltanschauung (1,3 Prozent). Was eheliche Kontaktstörung bedeutete, erklärte ein Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung Hannover. Kontaktstörung diene als weiter „Begriff, der alle Fehlformen und Schwierigkeiten des ehelichen Kontaktes, der Partnerschaft und der Liebe, alle Probleme der inneren Erfülltheit oder Ausgeleertheit einer Ehe umfaßt.“⁶⁶⁰ Darunter waren somit sowohl emotionale als auch sexuelle Schwierigkeiten zu verstehen.⁶⁶¹ Das Phänomen galt zwar als sehr schwer zu definieren, aber in der Praxis leicht zu erfassen.⁶⁶² Dennoch ist der Nutzen des Begriffes nicht ersichtlich. Er verwundert vielmehr, da die DAJEB sich ansonsten sehr um eine klare statistische Aufschlüsselung bemühte. Der am häufigsten konkret benannte Beratungsanlass war ein Seitensprung des Ehemannes. Laut DAJEB lag die Ursache für dieses Verhalten bei der Ehefrau, die oft noch oder wieder berufstätig sei, oder bei einer Arbeitskollegin. Auf den letzten Plätzen rangierten Konflikte wegen Erziehungsfragen und Weltanschauung, was als „[b]ezeichnend für die heutige allgemeine Mentalität“ galt.⁶⁶³ Aus den insgesamt vielfältigen Anlässen wurde geschlossen, dass kein einzelnes akademisches Fach dem gerecht werden könne. Gleichzeitig betonte sie, ein mitarbeitender Arzt sei für die Beratungsfälle bei Krankheit und Fehlformen der Sexualität unentbehrlich,⁶⁶⁴ obwohl diese nur 4 Prozent ausmachten. Hier wird ein gewisser medizinischer Ausrichtungsschwerpunkt der angestrebten Beratung sichtbar.
o. A.: „Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung in Hannover“. In: Gesundheitsfürsorge. Zeitschrift für die gesundheitlichen Aufgaben im Rahmen der Familienfürsorge 7 (1958), S. 187– 188, hier S. 187. Silies vermutet dahinter Fragen der Familienplanung und Empfängnisverhütung. Vgl. Silies, Liebe, 2010, S. 224 f. Vgl. Kowalewsky, Wolfram: „Aus der Tätigkeit der hannoverschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung“. In: Bovet, Theodor et al. (Hrsg.): Wege zum Menschen. Monatsschrift für Seelsorge, Psychotherapie und Erziehung und zur Förderung der Zusammenarbeit von Arzt und Seelsorger 8 (1958), S. 423 – 429, hier S. 427. [Fischer, J.], Erfahrungen, 1953/54, S. 634, ADE, JF 31. Ebd., S. 364.
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
173
Statt einer Erfolgsstatistik zitierte die DAJEB eine nicht näher benannte Beratungsstelle damit, dass das seelische Geschehen zahlenmäßig schwer zu erfassen sei. Dennoch lautete das Fazit, „daß in einem hohen Prozentsatz der Fälle den Ratsuchenden menschlich genützt werden konnte. Diejenigen Eheleute, die aus ihren Eheschwierigkeiten heraus zur Versöhnung und wirklichen Neubelebung der Ehe finden, pflegen für die Beratung sehr dankbar zu sein. Geht eine Ehe trotz der Beratung in Scheidung, so ist doch die Beratung niemals sinnlos gewesen.“⁶⁶⁵ Von der Zielsetzung, vorbeugende Eheberatung zu leisten, waren die Beratungsstellen nach eigener Aussage weit entfernt.⁶⁶⁶ Fast alle boten aber in diesem Sinne Vorträge sowie teilweise auch Kurse für Verlobte an. Die DAJEB beobachtete, dass diejenigen Ehen am stabilsten seien, in denen die Partner nur geringe Altersunterschiede aufwiesen. Paare hingegen, in denen die Frau älter war, suchten anscheinend häufiger die Beratungsstellen auf. Dieser Konstellation galt es nunmehr durch vorbeugende Eheberatung entgegenzuwirken. Der Verband wollte daher unter anderem „den natürlichen Altersunterschied von 3 bis 5 Jahren zugunsten des Mannes […] fördern“,⁶⁶⁷ außerdem das von ihr errechnete günstigste Ehealter bei Männern von etwa 30 bis 35 und bei Frauen zwischen 25 und 30. Die im Selbstverständnis der DAJEB stark verankerte vorbeugende Eheberatung fand aufgrund mangelnder Nachfrage kaum statt, die tendenziell medizinische Ausrichtung der Einrichtungen erwies sich als unnötig. Da vor allem Frauen kamen und es den Beratern nur schwer gelang, Ehepaare zu einem gemeinsamen Besuch zu bewegen, scheiterte auch dieses als fundamental betrachtete Vorgehen in der Praxis. Der Begriff der „Kontaktstörungen“ verweist sowohl auf Unsicherheiten, wie Diagnosen gestellt werden könnten, als auch auf eine methodische Lücke. In der Eheberatung ist somit, wie in der gesamten Sozialen Arbeit, eine Kluft zwischen Selbstverständnis beziehungsweise Anspruch und Praxis zu verzeichnen.⁶⁶⁸
3.5.3 Modell-Beratungsstelle Hannover Die Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung in Hannover veröffentlichte ihre Berichte in Fachzeitschriften. Das ist beim zugänglichen Material einmalig, denn in der Regel verfassten Beratungsstellen ihre Jahres- oder Tätigkeitsberichte lediglich für Trägerorganisationen beziehungsweise vorgesetzte Institutionen.⁶⁶⁹ Im
Ebd., S. 365. Vgl. dazu auch Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 231. [Fischer, J.], Erfahrungen, 1953/54, [S. 4], ADE, JF 31. Vgl. Neuffer, Kunst, 1990, S. 118. Vgl. Kapitel 3.5.4 Vertrauensstelle.
174
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Gegensatz zu anderen Jahresberichten sollten diejenigen aus Hannover somit auch der eigenen Darstellung in Fachkreisen gelten. Es handelt sich um mehrere statistisch teilweise sehr detailliert ausgearbeitete Dokumentationen, anhand derer sich die Arbeit der Beratungsstelle von 1951 bis Mitte 1958 nachvollziehen lässt. Sie beinhalteten die ersten Beratungszahlen, die in der Bundesrepublik überhaupt veröffentlicht wurden. Zudem wird deutlich, dass der DAJEB-Gesamtbericht stark auf dieser statistischen Auswertung aus Hannover fußte.⁶⁷⁰ Der Leiter der entsprechenden Stelle, Lothar Loeffler, war im Vorstand der DAJEB und Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung Niedersachsen.⁶⁷¹ Die Arbeit der Einrichtung sowie deren Auswertung entsprachen den Vorstellungen der DAJEB und hatten insgesamt Modellcharakter. Sichtbar sind übereinstimmende eugenische, psychologische und sittliche Vorstellungen. Der Landesarbeitsgemeinschaft gehörte die Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung an, die aus einer paritätischen sowie einer katholischen Eheberatungsstelle bestand. Beide arbeiteten eng zusammen.⁶⁷² Die paritätische Einrichtung existierte seit 1950 und wurde von Loeffler geführt. Im Herbst 1951 wurde die Stelle auf drei Räume erweitert. Wie üblich war die Beratung kostenlos. Ende 1950 überwies die katholische Stelle einige Ratsuchende mit schweren seelischen Konflikten an das paritätische Angebot, das mit Ilse Tägert⁶⁷³
Vgl. [Fischer, J.], Erfahrungen, 1953/54, ADE, JF 31 sowie Tägert, Ilse: „Bericht der Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung in Hannover“. In: Hogrefe, C. J. (Hrsg.): Psychologische Rundschau. Überblick über die Fortschritte der Psychologie in Deutschland, Österreich und der Schweiz 3 (1952), S. 229 – 234, hier S. 232, DZI. Vgl. Kapitel 3.2.4.3 Lothar Loeffler. Zur Niedersächsischen Landesarbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung gehörten 1952 sieben Eheberatungsstellen sowie die freien Wohlfahrtsverbände, Berufs- und Sozialorganisationen und verschiedene Ministerien Niedersachsens. Im Jahr 1953 waren es bereits neun Eheberatungsstellen. Jahresbericht 1953. Vgl. Tägert, Bericht, 1952, S. 230, DZI sowie DAJEB: Jahresbericht 1953. Detmold [1954], S. 9 ff., DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. Tägert, Ilse: „Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung Hannover. Bericht über das Geschäftsjahr 1954/55“. In: Gesundheitsfürsorge. Zeitschrift für die gesundheitlichen Aufgaben im Rahmen der Familienfürsorge 5 (1955), H. 8, S. 146 – 147, hier S. 146, DZI. Ilse Tägert (1913 – 2005) absolvierte zu Beginn der 1930er-Jahre eine Ausbildung an der Schule für Soziale Arbeit in Berlin. Ab 1945 studierte sie Psychologie, 1951 schloss sie ihre Promotion ab. Bereits in den 1950er-Jahren bildete sich Tägert in den USA und Großbritannien weiter.Während der Zeit des Nationalsozialismus hatte sie zum Teil in einer Erziehungsberatungsstelle sowie im Jugendamt gearbeitet. Der Jugend- und Erziehungsberatungsstelle Hannover gehörte sie von 1951 bis 1956 an. Danach war die Psychologin als Dozentin im Pestalozzi-Fröbel-Haus Berlin und in der Methodikfortbildung tätig. 1960 übernahm Tägert die Leitung der„Lehrfallkommission“ der Schulen für Sozialarbeit. Mit einer Herausgabe von Fällen trug sie dazu bei, dass erstmals anhand von deutschen Praxisbeispielen gelehrt werden konnte. Später befasste sie sich mit forensischer Psychologie im Bereich Familienrecht und erstellte Gutachten für Familiengerichte. Von 1956 bis 1961
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
175
eine fest angestellte Psychologin beschäftigte.⁶⁷⁴ Tägert hielt auch zahlreiche Vorträge. Während einer Studienreise durch die USA auf Einladung des State Department hatte sie Gelegenheit, dortige Einrichtungen kennenzulernen.⁶⁷⁵ Die Reise ist auf Bemühungen der amerikanischen Besatzung zurückzuführen, in der Sozialen Arbeit einen Fachaustausch und eine Weiterentwicklung zu ermöglichen.⁶⁷⁶ In der paritätischen Beratungsstelle waren neben der Psychologin zwei Sekretärinnen beschäftigt. Hinzu kamen ehrenamtliche Mitarbeiter, ohne deren Einsatz das Pensum nicht zu bewältigen gewesen wäre. In der Regel handelte es sich um verheiratete Frauen, die zuvor in der Sozialarbeit, Pädagogik oder juristisch tätig gewesen waren.⁶⁷⁷ Die Stadt Hannover sowie Wohlfahrtsverbände und die Evangelische Landeskirche finanzierten das Angebot.⁶⁷⁸ Träger der katholischen Beratung war die Caritas. Dort arbeiteten ehrenamtliche Eheberaterinnen.⁶⁷⁹ Die hauptamtlichen Beschäftigten verfassten die Jahresberichte der paritätischen Stelle.⁶⁸⁰ Sie integrierten zum Teil auch statistische Daten der katholischen Beratung.⁶⁸¹ Die Hannoversche Arbeitsgemeinschaft ging davon aus, dass nicht die Ehe als Institution in der Krise war, aber viele Ehen sich krisenhaft gestalteten. Sie vertrat die Ansicht, dass „eine nicht faßbare, […] größere Zahl von Ehen in ernsten Schwierigkeiten aller Schattierungen und Bereiche von der leichten Mißstimmung zwischen zwei noch innerlich verbundenen Partnern bis zur fast völligen Loslösung existiert“.⁶⁸² Die Eheberatungsstelle Hannover warb für fachliche Arbeit, Teamwork und die DAJEB. Sie ging davon aus, dass die Eheberatung größere Organisations-
war Tägert Vorstandsmitglied des Berufsverbandes Deutscher Psychologen.Vgl. Neuffer, Kunst, 1990, S. 249 sowie Feustel, Adriane: Geschichte der Alice Salomon Hochschule – eine Chronik bis 1971. Verfügbar unter: www.alice-salomon-archiv.de/geschichte/geschichte-der-alice-salomon-hochschule/, besucht am 5. November 2020 sowie o. A.: Bisherige Vorstände des BDP.Verfügbar unter: www.psycholo gie.de/ueber/ vorstand/bisherig/bdp/, besucht am 22. Januar 2021. Vgl. Kowalewsky, Tätigkeit, 1958, S. 424 f., DZI. Zu Gehaltsbedingungen sich in der Eheberatungsstelle Hannover bewerbender Psychologen vgl. Hans Baacke an L[othar] Loeffler, Brief, 11. Februar 1963, BArch, B 189/2815, Bl. 306 f. sowie [Walter] Raupach an Bundesminister für Familien- und Jugendfragen, Brief, 6. März 1963, BArch, B 189/2815, Bl. 308 f. Vgl. Tägert, Arbeitsgemeinschaft, 1955, S. 147, DZI. Zu den Austauschprogrammen für Sozialarbeiter vgl. Neuffer, Kunst, 1990, S. 84 ff. Vgl. Kapitel 3.1.1 Eugenik oder psychologische Konfliktberatung?. Vgl. Tägert, Arbeitsgemeinschaft, 1955, S. 146, DZI. Vgl. o. A.: „Jahresbericht 1956 der Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung in Hannover“. In: Gesundheitsfürsorge. Zeitschrift für die gesundheitlichen Aufgaben im Rahmen der Familienfürsorge 7 (1958), H. 10, S. 187– 188, hier S. 188, DZI. Vgl. Tägert, Arbeitsbericht, 1954, S. 3, BArch, B 142/418, Bl. 223 ff. Vgl. z. B. dies., Bericht, 1952, S. 229, DZI sowie Kowalewsky, Tätigkeit, 1958, S. 423, DZI. Vgl. z. B. ebd. sowie Tägert, Bericht, 1952, DZI. Dies., Arbeitsbericht, 1954, S. 2, BArch, B 142/418, Bl. 223 ff.
176
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
formen forderte, da die Probleme solche Ausmaße angenommen hätten, „daß ihre Lösung nicht mehr von der Zufälligkeit einzelner mehr oder weniger intuitiv begabter Menschen abhängig bleiben darf“.⁶⁸³ Mit der Gründung der DAJEB wurde laut Tägert „das Frühstadium mehr oder weniger ungeordneten Experimentierens in noch recht unbekanntem Neuland überwunden und ist jetzt auf dem Wege zur Erarbeitung von Zielsetzungen und Methoden“.⁶⁸⁴ Im Verständnis der Beratungsstelle war die Eheberatung nunmehr in eine neue Phase eingetreten. Professionalisierung sollte „den auf diesem schwierigen Gebiet tätigen Menschen Hilfen und Sicherung geben, soweit dies überhaupt möglich ist“.⁶⁸⁵ Dies war jedoch noch durch Unsicherheit und Zweifel an den Möglichkeiten geprägt. Im Sinne der DAJEB befasste sich die Beratungsstelle zunehmend systematischer damit, die aktenmäßige Erfassung und statistische Auswertung auszubauen. Dies ließ in der Folge erstmals verifizierbare Schlussfolgerungen über Ratsuchende und ihre Besuchsgründe zu. Gleichzeitig stand von Beginn an die Aussagekraft der statistischen Auswertung in der Diskussion.⁶⁸⁶ Im Jahresbericht 1956 ist beispielsweise vermerkt, es müssten Einschränkungen gemacht werden, da viele Ehekonflikte mehrere Ursachen hätten. Da diese von verschiedener Tiefe und Bedeutung seien, könne man sie statistisch keineswegs vergleichen. Selbstkritisch wurde angemerkt, dass es auf die Ausrichtung der Beratungsstelle und die Zusammensetzung des Beraterteams ankomme, welche Themen die Besucher ansprächen. Daher ließen die lokalen Beobachtungen sich nicht auf Ehen und Ehekonflikte generell übertragen: „Es besteht also ein enger Zusammenhang zwischen unserer Auszählung der Konfliktursachen und der Art unserer Arbeitsgemeinschaft […]. Es gibt manche Beratungsstellen, die ganz andere Konfliktursachen als wir erwähnen und z. T. sogar an wesentlicher Stelle auszählen. Die Aufzählung von Konfliktursachen ist also weitgehend eine Frage des Blickpunktes des Beraters.“⁶⁸⁷ Dieser Hinweis auf den Zusammenhang zwischen der Ausrichtung der Beratungsstelle beziehungsweise des Personals mit der Problemdarstellung der Ratsuchenden ist im vorliegenden Material einmalig. Ein Jahr später war die rückläufige Zahl der Ratsuchenden Thema, obwohl mit nur elf Fällen weniger die Summe relativ konstant blieb. Wenn der geringfügige Rückgang bei den Neuzugängen in der Eheberatung auch keinerlei statistisch signifikante Bedeutung hat, so sind wir doch bemüht, uns über seine Ursachen
Dies., Bericht, 1952, S. 229, DZI. Dies., Arbeitsgemeinschaft, 1955, S. 146, DZI. Ebd. Vgl. Tägert, Bericht, 1952, S. 231, DZI. o. A., Jahresbericht, 1958, S. 187, DZI.
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
177
Rechenschaft abzulegen.Wir konnten nun häufig beobachten, daß Ratsuchende, welche uns bei Eheschwierigkeiten aufsuchten und nicht sofort empfangen werden konnten, dann zu den später für sie festgesetzten Terminen nicht wieder erschienen.⁶⁸⁸
In diesen Reflexionen wird eine zunehmend professionalisierte und kritischere Sicht der Eheberater auch auf die eigene Arbeit deutlich. Die meisten Besucher der Beratungsstelle kamen auf Empfehlung ihres privaten Umfelds, meist früherer Ratsuchender. Des Weiteren machten im Wesentlichen Ämter auf die Beratungsmöglichkeit aufmerksam.⁶⁸⁹ Die Berufe der Besucher entsprachen in etwa der Verteilung in der allgemeinen Bevölkerung, wobei ungelernte Arbeiter unterrepräsentiert waren. Die meisten männlichen Ratsuchenden waren Facharbeiter, danach folgte die Gruppe der Angestellten und die der ungelernten Arbeiter.⁶⁹⁰ Überrepräsentiert waren hingegen mit 16 Prozent Arbeitslose. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ebenfalls überrepräsentiert waren ratsuchende Akademiker, Künstler und höhere Beamte. Dies war für eine DAJEB-Beratungsstelle ungewöhnlich.⁶⁹¹ Waren 1951 noch 23 Prozent der ratsuchenden Ehefrauen berufstätig, so stieg deren Zahl bis 1954 auf 62 Prozent. Die berichtende Beraterin hatte zu diesem Thema eine differenzierte Meinung. Sie betonte, dass ihrer Erfahrung nach weibliche Erwerbsarbeit niemals prinzipiell zu bewerten sei. Diese könne je nach Situation Ehe und Familie sowohl belasten als auch entlasten. „Sie kann in manchen Fällen – besonders wenn kleine Kinder vorhanden sind – zum Konfliktstoff werden oder die anderweitig entstandene Krise verschärfen, während sie ein andermal dagegen wesentlich zur Entlastung auch der spezifischen Eheschwierigkeiten dienen kann.“⁶⁹² Die Berater interessierte sehr, wie lange ihre Besucher bereits verheiratet waren. Die meisten waren im zweiten bis fünften, dann wieder ab dem 20. Ehejahr. Je nach Berichtsjahr hatte die Mehrzahl der Ratsuchenden ein oder zwei Kinder. Die dritte Gruppe bildeten stets die kinderlosen Paare.⁶⁹³ Zu etwa zwei Dritteln waren es die Ehefrauen, die zuerst Rat suchten. Dies entspricht der allgemeinen Beobachtung der DAJEB, dass die Initiative überwiegend von Frauen ausging. Nur in wenigen Ausnahmen erschienen von Beginn an beide Eheleute gemeinsam. In den meisten Fällen schloss sich der Partner aber dem Zweitgespräch an, wenn er beim ersten nicht dabei gewesen war. Den Beratern
Kowalewsky, Tätigkeit, 1958, S. 423, DZI. Vgl. z. B. Tägert, Bericht, 1952, S. 230, DZI sowie o. A., Jahresbericht, 1958, S. 187, DZI. Vgl. z. B. Tägert, Bericht, 1952, S. 230, DZI sowie dies., Arbeitsgemeinschaft, 1955, S. 146, DZI. Vgl. Kapitel 3.5 Arbeit. Tägert, Arbeitsbericht, 1954, S. 5, BArch, B 142/418, Bl. 223 ff. Vgl. z. B. dies., Bericht, 1952, S. 231, DZI sowie dies., Arbeitsgemeinschaft, 1955, S. 146, DZI.
178
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
zufolge kam es relativ häufig vor, dass Ratsuchende sich zunächst weigerten, den anderen einzubeziehen. Allerdings ließen sich die meisten vom Gegenteil überzeugen. Die Psychologin betonte, dass ihr lokal keine Fälle bekannt seien, in denen die Beteiligung des Ehepartners den Konflikt verstärkt hätte. Daher forderte die Beratungsstelle den fehlenden Partner je nach Fall mit unterschiedlicher Begründung auf, ebenfalls zu erscheinen. Nur wenige verweigerten sich.⁶⁹⁴ Berater nahmen selbst Kontakt mit den Partnern auf. Dies schien der Norm zu entsprechen, auch wenn sich in anderen Publikationen nur wenige Hinweise finden lassen.⁶⁹⁵ Je nach Berichtsjahr zogen die Mitarbeiter in Hannover bei 10 bis 30 Prozent der Fälle auch Dritte hinzu, die in den Konflikt verstrickt waren, beispielsweise Schwiegereltern oder das „Verhältnis“.⁶⁹⁶ Bei Bedarf fand der Austausch brieflich oder telefonisch statt, sofern die Ratsuchenden bereits bekannt waren.⁶⁹⁷ Nachdem die Sprechstunden täglich angeboten wurden, stieg die Zahl der Besucher von 200 im Jahr 1952 auf 285 sechs Jahre später.⁶⁹⁸ Eheberatung wurde in Hannover als Arbeit mit vorwiegend „gedrückten, gereizten oder verzweifelten Menschen“ beschrieben.⁶⁹⁹ 16 Prozent litten unter nervösen Beschwerden. 8 Prozent berichteten von Selbstmordversuchen aufgrund ihrer Verzweiflung, weitere sprachen von depressiven Gedanken.⁷⁰⁰ Zu Beginn der 1950er-Jahre spielten wirtschaftliche und soziale Not eine große Rolle in der Beratung. Besonders betroffen waren die gesamtgesellschaftlich stark wahrgenommenen Heimkehrerehen. In der Region Hannover endete jede dritte Ehe von „Russlandheimkehrern“ mit der Scheidung. Damit passt ins Bild, dass aus dieser Gruppe zu Beginn viele Personen in der Beratungsstelle Hilfe suchten.⁷⁰¹ Zudem waren viele Paarbeziehungen besonders belastet, da sie sich wenig Wohnraum mit anderen Familienangehörigen teilten. Für Konfliktstoff sorgten auch die Haushaltsführung beziehungsweise die Verteilung des Geldes. Die Hälfte aller Ehekrisen war auf die Untreue eines Partners zurückzuführen, überwiegend der Ehemänner. Die Eheberaterin in Hannover beobachtete aber „immer wieder, daß die Ehen einer solchen Belastung oft eher standhalten als einer langsam fort-
Vgl. dies., Bericht, 1952, S. 231, DZI. Vgl. Kapitel 3.6.1 Selbstverständnis der Eheberatungsstelle. Vgl. z. B. Tägert, Arbeitsgemeinschaft, 1955, S. 146, DZI sowie dies., Arbeitsbericht, 1954, S. 5, BArch, B 142/418, Bl. 223 ff. Vgl. Kowalewsky, Tätigkeit, 1958, S. 426, DZI. Vgl. Tägert, Bericht, 1952, S. 233, DZI sowie Kowalewsky, Tätigkeit, 1958, S. 423, DZI. Zwischenzeitlich lag die Beratung bei 306 Fällen. Vgl. Tägert, Arbeitsgemeinschaft, 1955, S. 146, DZI. Ebd. Vgl. Tägert, Bericht, 1952, S. 233, DZI. Vgl. ebd. S. 232, DZI.
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
179
schreitenden Entfremdung und Entleerung, daß solche ‚Verhältnisse‘ wie eine Krankheit überwunden werden können und einen neuen echten Anfang zulassen“.⁷⁰² Auch später blieben Seitensprünge eine häufige Konfliktursache. Auf dem ersten Platz fanden sich jedoch ab 1953 sogenannte „eheliche Kontaktstörungen“.⁷⁰³ Auch in der statistischen Auswertung der DAJEB von 1953, die einen großen Kreis an Einrichtungen umfasste, rangierte diese Ursache mit 23 Prozent ganz vorne. Finanzielle Fragen erschienen erst an dritter Stelle. Dies änderte sich jedoch im Laufe der Zeit. Im letzten Berichtsjahr rückten Krankheiten und Abnormitäten an deren Platz.⁷⁰⁴ Auch eine neue Kategorie floss in die Statistik ein: „autoritatives und extrem patriarchalisches Verhalten“ des Ehemannes als Ursache für 5 Prozent der Krisen.⁷⁰⁵ „Krankheiten sind häufig Ursachen, ebenso oft aber auch Folgen von Ehekonflikten.“⁷⁰⁶ Diese Überzeugung vertrat die Verfasserin des ersten Jahresberichts, obwohl die Statistik der Beratungsstelle umgerechnet nur 9 Prozent der Konflikte darauf zurückführte. Die Aussage der Beraterin deutet auf eine eugenisch gefärbte Interpretation. Sie problematisierte Krankheit als konfliktauslösende Problematik stärker, als es der relativ geringe prozentuale Anteil an den vorgetragenen Konfliktursachen rechtfertigte. Ebenfalls auffällig ist die mehrfach beobachtete, aber nicht näher quantifizierte seelische Entfremdung von Ehepaaren nach Abtreibungen. „Die Abhängigkeit der Verletzung von diesem Eingriff war den meisten gar nicht bewußt, gelegentlich konnte man aber sogar körperliche Erscheinungen nervöser Art bis zu diesem Zeitpunkt zurückverfolgen.“⁷⁰⁷ Diese „Erscheinungen“ wurden weder eindeutig als Krankheit klassifiziert noch statistisch erfasst. Dennoch untermauerte die Beraterin damit einerseits die These, Krankheiten seien häufige Konfliktursache, und andererseits bewertete sie Abtreibungen als schädlich für die Beziehung. Beides entsprach den Ansichten der DAJEB⁷⁰⁸ und Loefflers, des Leiters der Beratungsstelle, „der durch seine sozialbiologischen Erfahrungen die gesamte Arbeit in besonders intensiver Weise stützt“.⁷⁰⁹ Seine Geschäftsführung war für die Einrichtung von wesentlicher Bedeutung.⁷¹⁰ Dazu passt, dass die Ana-
Ebd. Zur Definition ehelicher Kontaktstörungen vgl. Kapitel 3.5 Arbeit. Vgl. Tägert, Arbeitsbericht, 1954, S. 5, BArch, B 142/418, Bl. 223 ff. sowie Kowalewsky, Tätigkeit, 1958, S. 427, DZI. Vgl. ebd., S. 427. Tägert, Bericht, 1952, S. 233, DZI. Ebd. Vgl. Kapitel 3.3.1 Vorstellungen von Ehe. Kowalewsky, Tätigkeit, 1958, S. 424, DZI. Vgl. o. A., Jahresbericht, 1958, S. 187, DZI.
180
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
mnese in manchen Fällen mit Unterstützung der Fürsorge bis zur Großelterngeneration betrieben wurde. Parallel betonte der Bericht jedoch die psychologischen Untersuchungsmethoden: „Von den Psychologinnen der Beratungsstelle wurden mit Hilfe moderner – meist projektiver – diagnostischer Verfahren beide Partner einer eingehenden Untersuchung unterzogen.“⁷¹¹ Bereits 1951 stand zumindest bei Gutachten die Befragung der Ratsuchenden im Mittelpunkt. Als Testverfahren dienten unter anderem der Rorschach- sowie der Thematische Auffassungstest, die Assoziationsreihen von Jung sowie der AS-Test von Allport.⁷¹² Letzterer galt noch in den 1970er-Jahren als der „integrativste Ansatz zur Persönlichkeitstheorie der Gegenwart“.⁷¹³ Die Arbeit in Hannover reiht sich in ihrer Ausrichtung somit in die bereits beobachtete Vermischung von Eugenik, Sittlichkeitsvorstellungen und Psychologie.⁷¹⁴ Arbeits- und Wohnungsvermittlung sowie insbesondere Erholungskuren für Mütter galten als besonders erfolgreiche Maßnahmen, um Ehekrisen zu beenden.⁷¹⁵ Die Zahl der Fälle, in denen die Stelle weiteres Fachpersonal hinzuzog, stieg im Laufe der Jahre. Die Berater werteten dies positiv als Bestrebung, den Ratsuchenden auch Hilfe zukommen zu lassen, welche sie selbst nicht bieten konnten.⁷¹⁶ Während die Menge der Besucher stieg, sank die durchschnittliche Zahl an Konsultationen pro Fall über die Jahre. Lag diese 1951 noch bei sechs Besuchen, so fiel sie bis 1958 auf 3,3.⁷¹⁷ Weder kamen die Gründe zur Sprache, noch finden sich dazu indirekte Hinweise. Das Ziel der Beratungsarbeit lautete, der individuellen Ehe die passende Hilfe zukommen zu lassen. Ein Ansatz war, die „Möglichkeit ihrer weiteren Entwicklung“ abzuschätzen, durch welche „die Beratung vorwiegend auf diese […] für jede Ehe verschieden hohe reale Entwicklungsgrenze“ gerichtet werden sollte.⁷¹⁸ Dabei galt es immer zu versuchen, „dem individuellen Fall in seiner Einmaligkeit gerecht zu werden“, auch auf psychologischer Ebene. Die Konfliktursachen sah die Beraterin Ilse Tägert häufig in „Schwerpunktverlagerungen zwischen den Ehegatten, die für den einen oder für beide Teile nicht tragbar zu sein scheinen“. Lösen wollte die
Tägert, Arbeitsbericht, 1954, S. 7 f., BArch, B 142/418, Bl. 223 ff. Vgl. dies., Bericht, 1952, S. 234, DZI. Evans, R[ichard] I[sadore]: „Gordon Allport“. In: Psychologie im Gespräch. Berlin 1976, S. 209 – 223, hier S. 209. Vgl. Kapitel 3.3.1 Vorstellungen von Ehe. Vgl. z. B. Tägert, Bericht, 1952, S. 234, DZI sowie dies., Arbeitsbericht, 1954, S. 7, BArch, B 142/418, Bl. 223 ff. Vgl. o. A., Jahresbericht, 1958, S. 187, DZI. Vgl. Tägert, Bericht, 1952, S. 230, DZI sowie Kowalewsky, Tätigkeit, 1958, S. 425, DZI. Ebd., S. 426.
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
181
beratende Psychologin dies durch „vorsichtige Hilfe zur Selbsterkenntnis und zum psychologischen Verständnis des Partners“.⁷¹⁹ Das Ziel der DAJEB, Ehen zu erhalten, war nicht das einzige, das man in Hannover verfolgte. Vielmehr sollten dort auch diejenigen Unterstützung finden, deren Ehen scheiterten. „Außerdem aber sehen wir unsere Aufgabe nicht nur in der Beratung von heilbaren Ehekrisen, sondern auch sehr wesentlich im Unterstützen solcher Menschen, deren Ehe nicht mehr zu retten ist, die ihr Schicksal aber noch nicht alleine meistern können.“⁷²⁰ Ob dies gelang, war für die Beraterin nur schwer zu eruieren: „Jede Erfolgsstatistik widerspricht der Natur der Eheberatung. Einmal sind schwer Maßstäbe zu finden, wo ein ‚Erfolg‘ anfängt, oder ob es sich z. B. nicht nur um eine zeitliche beschränkte Lösung, ohne dauerhaften Bestand, handelt.“⁷²¹ Obwohl zu anderen Punkten ausführliche statistische Angaben existierten, gab es in der Erfolgsfrage keine Schätzung. Diese Einstellung blieb über die Jahre erhalten, auch, da ein „Zustand, der für die eine Ehe eine Lösung des Konflikts bedeuten kann, […] für die andere noch eine belastende Not sein“ könne.⁷²² Als ebenso wichtig wie die Eheberatung selbst galt in Hannover die vorbeugende Beratung und Erziehung zur Ehe.⁷²³ Im Gegensatz zur Eheberatung mit verzweifelten Ratsuchenden empfand die Beraterin die Verlobtengespräche als wesentlich freundlicher. Allerdings kamen nur die wenigsten freiwillig mit psychologischen oder eugenischen Fragen. Ihr Anteil sank zudem von 36 Prozent Mitte 1950 auf 16 Prozent bis 1958. Die meisten schickte das Jugendamt oder Vormundschaftsgericht mit der Bitte um ein Gutachten zum anhängigen Ehemündigkeitsverfahren. Die Beratungsstelle befürwortete eine Heirat nur bei etwa einem Viertel der Anträge. Dabei war es uns lieber, wenn die Verlobten sich schon während der Beratungszeit voneinander entfernten und entlobten […], damit nicht hinterher die ‚Schuld‘ für das Misslingen des ganzen Lebensplanes dem Jugendamt, dem Vormundschaftsgericht oder der Beratungsstelle zugeschoben werden konnte und die betreffenden jungen Leute sich jeder Selbstverantwortung enthoben wähnten.⁷²⁴
Gleichzeitig wurde damit die Unehelichkeit von Kindern in Kauf genommen, denn in 80 bis 97 Prozent der zu begutachtenden Fälle bestand eine Schwangerschaft beziehungsweise waren bereits Kinder geboren. Die Statistik der Beratungsstelle
Tägert, Bericht, 1952, S. 233, DZI. Dies., Arbeitsgemeinschaft, 1955, S. 147, DZI. Ebd. Kowalewsky, Tätigkeit, 1958, S. 426, DZI. Vgl. im Folgenden ebd., S. 427 f. sowie Tägert, Arbeitsgemeinschaft, 1955, S. 147, DZI. Ebd.
182
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
stimmt hier mit Schätzungen auf Bundesebene überein.⁷²⁵ Eheberater sahen sogenannte Frühehen insgesamt sehr kritisch, da sie verhältnismäßig häufig in einer Scheidung endeten. Sie standen auch gesamtgesellschaftlich als stark wahrgenommenes Thema in der Diskussion. Die Hannoveraner Berater befürworteten diese Eheschließungen nur selten. Als Entscheidungsgrundlage dienten nicht näher benannte, meist projektive Verfahren und später ein Fragebogen, der sich auf Partnerschaftsprobleme bezog.⁷²⁶ Der Jahresbericht von 1956 enthielt auch eine Gesamteinschätzung zur Beratungsarbeit in Hannover. Er konstatierte, dass die Arbeit weitgehend stabil und beständig sei, auch in anderen Stellen. Der Autor ging davon aus, dass eine gleichbleibende Zahl von Besuchern kam, um in großem Vertrauen auf die Fähigkeiten der Berater objektive und fachkundige Hilfe zu suchen.⁷²⁷ Dies entsprach dem Selbstbild der Eheberater.
3.5.4 Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe Die Satzungen der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Vertrauensstelle für Jugend- und Eheberatung in Karlsruhe legten die Aufgaben der dortigen Eheberatung fest: Sie sollte Jugendliche und Verlobte in allen mit der Eheschließung zusammenhängenden Schwierigkeiten beraten und darauf hinwirken, „Fehlehen“ zu verhüten. Des Weiteren sollte Eheleuten bei allen auftretenden Eheproblemen mit Rat und Tat geholfen werden. In der Zusammenarbeit mit Seelsorgern, Ärzten, Psychologen, Juristen, Pädagogen und Fürsorgern gelte es alles daran zu setzen, die noch heilbaren Ehen zu erhalten.⁷²⁸ Dabei zielte der Auftrag nicht nur auf die Entspannung von Ehekrisen für die Ratsuchenden selbst, sondern befasste sich auch mit der Hilfe für die übrigen Familienmitglieder, die von den Problemen ebenfalls betroffen waren.⁷²⁹ Diejenigen, die sich an die Vertrauensstelle wandten, wünschten eine Aussprachemöglichkeit in familiären Krisen und auch, zu einer
Vgl. dazu Kapitel 2.3 Liebe und Sexualität. Vgl. dazu auch Tägert, Arbeitsbericht, 1954, S. 7, BArch, B 142/418, Bl. 223 ff. S. o. A., Jahresbericht, 1958, S. 187, DZI. Vgl. Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Vertrauensstelle für Jugend- und Eheberatung in Karlsruhe: Satzungen der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Vertrauensstelle für Jugend- und Eheberatung in Karlsruhe. Ehe-, Familien- und Partnerschaftsberatungsstelle Karlsruhe (Eheberatung Karlsruhe). Vgl. Schulze, [Renate]: Jahresbericht 1956 der Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute. März 1957, Eheberatung Karlsruhe.
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
183
gesunden und ruhigen Atmosphäre zurückzufinden.⁷³⁰ Die seit Ende 1951 stattfindende Beratung war damit klar auf eheliche Konflikte und deren Vorbeugung eingegrenzt. Sie arbeitete überkonfessionell. Dies spiegelte sich auch in der personellen Besetzung wider. Die dort beschäftigten Frauen waren jüdischen Glaubens, katholisch oder evangelisch. Ihre religiöse Zugehörigkeit schien zwischen ihnen kein Thema gewesen zu sein.⁷³¹ Die Einrichtung selbst war vor allem mit der evangelischen Kirche vernetzt. Zwar wurde versucht, die katholische Kirche ebenso einzubeziehen, doch diese war misstrauisch, was die Einstellung der Beratungsstelle zur Ehe anging.⁷³² Geprägt war die Arbeitsgemeinschaft von Frauenorganisationen, insbesondere dem Club berufstätiger Frauen, dessen Mitgründerin Alice Haidinger⁷³³ über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft war. Sie nutzte ihre gute Vernetzung insbesondere in juristischen Kreisen gezielt für die Vertrauensstelle.⁷³⁴ Besonderen Bedarf sah sie in der Beratung bei Ehekonflikten um das Haushaltsgeld, mit dem die Ehemänner ver-
Vgl. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe]: Jahresbericht 1958. [1959], Eheberatung Karlsruhe. Vgl. Interview mit Alice Haidinger, ehemalige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Vertrauensstelle für Jugend- und Eheberatung, Karlsruhe, persönliche Kommunikation, 30. und 31. Mai 2017. Vgl. [Alice] Haidinger an Caritasdirektor, Brief, 16. August 1961, Eheberatung Karlsruhe sowie Klaas, Jahre, 2003, S. 8 f. und S. 16. Alice Haidinger (geb. Rée, 2. 2.1921 bis 12.10. 2019) übte nach Arbeitsdienst und Pflichtjahr eine Tätigkeit als Sekretärin aus. Aus dem Wunsch nach beruflichem Aufstieg heraus begann Haidinger 1942 ein Studium in Hamburg. Offiziell in Volkswirtschaft eingeschrieben, studierte sie Jura, was ihr aufgrund ihres jüdischen Großvaters unter den Nationalsozialisten eigentlich verwehrt war. Haidinger hoffte, dass bis zu ihrem Abschluss das „Dritte Reich“ beendet wäre. Mit dem Ziel, Jugendrichterin zu werden, wurde sie nach dem Zweiten Weltkrieg über englisches Jugendstrafrecht promoviert. Als ihr Mann, Oskar Haidinger, zu einem der ersten Bundesrichter ernannt wurde, folgte sie ihm nur ungern nach Karlsruhe, da für sie dort kaum Aussichten auf ein Richteramt bestanden. Doch hatte Alice Haidinger „ihm nach dem damaligen Eherecht zu folgen, sonst hätte ich mich des böswilligen Verlassens schuldig gemacht“. Die Juristin arbeitete stattdessen in einer Kanzlei, in der sie sich auf Wiedergutmachungsverfahren sowie Familienrecht spezialisierte und später Partnerin wurde. 1953 trat sie dem Deutschen Juristinnenbund (djb) bei. Haidinger setzte sich ehrenamtlich für die Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe ein, war Gründungsmitglied und Vorstand des Clubs berufstätiger Frauen sowie im Vorstand der Juristischen Studiengesellschaft Karlsruhe. Vgl. o. A.: Traueranzeige Alice Haidinger. In: Badische Neueste Nachrichten, auf: https://trauer.bnn.de/gedenkseite/Alice-Haidinger-geb-Ree-2_2_1921, besucht am 18. Mai 2021 sowie o. A.: „Nachruf auf Dr. Alice Haidinger“. In: Deutscher Juristinnenbund e.V. (Hrsg.): djbZ Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes 22 (2019), H. 4, S. 229 – 230. Z. B. war Alice Haidinger mit der Bundesverfassungsrichterin Erna Scheffler freundschaftlich verbunden. Vgl. ebd., S. 229.
184
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
suchten, ihre Machtposition zu sichern.⁷³⁵ Häufig berichtete die lokale Presse, mit der die Vertrauensstelle auch bewusst Kontakt suchte. Dies galt als einzig wirksame Werbemaßnahme für die Beratung.⁷³⁶ Die Mitarbeiter beurteilten die eigenen Leistungen selbstbewusst. Bei der Detmolder Zentralstelle [DAJEB] bringt man der Arbeit der Karlsruher Stelle besonderes Interesse entgegen, da sie die erste Beratungsstelle in Süddeutschland ist, die in größerem Umfang arbeitet. Auch unterscheidet sich die Karlsruher Stelle von den meisten übrigen Eheberatungsstellen dadurch, dass die Ratsuchenden zum grössten Teil spontan, aus eigenem Antrieb in die Sprechstunde kommen […]. Die Karlsruher Beratungsstelle hat sich also allein durch ihre Arbeit Vertrauen in der Bevölkerung erworben.⁷³⁷
Die Eheberatung in Karlsruhe erweiterte und professionalisierte sich im Laufe der Zeit.Von Beginn an erstellten die Mitarbeiter regelmäßig Kostenvoranschläge sowie Tätigkeitsberichte und führten Buch über Ausgaben. Diese Dokumentationen umfassten in der Regel mehrere Seiten.⁷³⁸ Dabei war die Berichterstattung zum Teil dem Empfänger angepasst.⁷³⁹ Außer für die ersten Halbjahre 1953 und 1956 sind sämtliche Berichte des Untersuchungszeitraums erhalten. Die Berater verschriftlichten ihre Fälle außerhalb der Sprechstunden und legten die Notizen mit der zusammenhängenden Korrespondenz ab. Diese Aufzeichnungen waren nur den Beratern zugänglich. Berichte über Ratsuchende, die anonym bleiben wollten, wurden gesondert geführt. Für die Büroarbeiten stand spätestens 1953 eine Sekretärin zur Verfügung.⁷⁴⁰ Im selben Jahr zog die Vertrauensstelle in eigene Räum-
Vgl. Klaas, Jahre, 2003, S. 8 f. sowie Interview mit Dr. Alice Haidinger, ehemalige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Vertrauensstelle für Jugend- und Eheberatung, Karlsruhe, persönliche Kommunikation, 30. und 31. Mai 2017. Vgl. z. B. h. n.: „Landrat entschied: Landwirtschaftsschule Graben bleibt geschlossen“. In: Badische Neueste Nachrichten, 25. Juni 1958, Nr. 144, Eheberatung Karlsruhe. lp: „Hier betreut der Mensch und nicht ein Amt“. In: [Badische Neueste Nachrichten], November 1961. Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/SJB, Nr. 628 sowie [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe]: Jahresbericht 1961. [1962], Eheberatung Karlsruhe. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe]: Tätigkeitsbericht, 28. Februar 1953, S. 1, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188. Vgl. ebd. sowie Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute: 1958/59 Finanzen Voranschlag. [1959], Eheberatung Karlsruhe. Vgl. z. B. Haidinger, [Alice]: Jahresbericht 1956 der Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute. 25. März 1957, Eheberatung Karlsruhe sowie Schulze, [Renate]: Jahresbericht 1956 der Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute. März 1957, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe]: Tätigkeitsbericht der Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute. Eheberatungsstelle Karlsruhe 1952. 28. Februar 1953, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188.
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
185
lichkeiten um und engagierte für einige Stunden zusätzlich einen Rechtsberater.⁷⁴¹ Zu diesem Zeitpunkt bot eine Beraterin wöchentlich acht Sprechstunden an. Drei Jahre später war die Einrichtung ganztägig besetzt.⁷⁴² Damit erhöhte sich die Anzahl der Sprechstunden weiter und die Beraterin stand in dringenden Fällen auch außerhalb der offiziellen Zeiten zur Verfügung. Zu Beginn der 1960er-Jahre vergrößerte sich der Personalstamm, sodass ab 1964 drei Beraterinnen und ein Berater für die Vertrauensstelle tätig waren.⁷⁴³ So konnten deutlich mehr Ratsuchende das Angebot nutzen. Wöchentlich wurden 15 Sprechstunden angeboten, zudem feste Termine für wiederholt Kommende.⁷⁴⁴ Das Team war sehr engagiert und hielt deutlich mehr Sprechstunden ab, als die Bezahlung vorsah.⁷⁴⁵ Zu Beginn betrug der monatliche Etat 255 DM.⁷⁴⁶ Weil zunehmend Förderung vor allem vom Stadt- und Landkreis kam, stiegen die Mittel bis 1964 auf einen jährlichen Betrag von 14.400 DM.⁷⁴⁷ Die Zusammenarbeit mit Behörden, Gerichten und Verwaltungsbehörden galt zu Beginn noch als mangelhaft. Doch verbesserte sie sich schnell und galt später als ausgezeichnet. Geschätzt wurde in der Vertrauensstelle nicht nur die Unterstützung für die Ratsuchenden, die sich aus diesen Kontakten ergaben, sondern auch gemeinsame Besprechungen, die Gelegenheit boten, fachkundigen Rat einzu-
Vgl. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe]: Tätigkeitsbericht der Eheberatungsstelle für die Zeit vom 1.6.–31.12.1953. 31. März 1954, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188. Vgl. Schulze, Jahresbericht, 1957, Eheberatung Karlsruhe. Beraterinnen waren Lotte Paepcke (ca. 1949 – 1953), Johanna Sprotte (1953 – 1955), Renate Schulze als Leiterin (1956 – 1963), zudem kamen ab ca. 1961 Ilse Spieler als Beraterin, ab 1963 Sitta Michael und ein Berater hinzu. Für weitere Informationen zu den Eheberaterinnen vgl. Ehe-, Familien- und Partnerschaftsberatungsstelle (Hrsg.): 50 Jahre Eheberatung in Karlsruhe. Karlsruhe 2003. Zu Lotte Paepcke vgl. Scheichl, Sigurd Paul: „Paepcke, Lotte“. In: Andreas B. Kilcher (Hrsg.): Metzler Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur. Jüdische Autorinnen und Autoren deutscher Sprache von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Stuttgart 2012, S. 394– 395 sowie Interview mit Alice Haidinger, ehemalige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Vertrauensstelle für Jugend- und Eheberatung, Karlsruhe, persönliche Kommunikation, 30. und 31. Mai 2017. Zu Johanna Sprotte vgl. Johanna Sprotte, Lebenslauf, [1953], Stadtarchiv, Abt. 1/ H-Reg., Nr. 5188. Zu Renate Schulze vgl. Renate [Schulze] an Alice [Haidinger], Brief, 14. Juli 1963, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, 1954, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/ H-Reg., Nr. 5188 sowie [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe]: Jahresbericht 1964. [1965], Eheberatung Karlsruhe. Vgl. Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Vertrauensstelle: Protokoll, 9. August 1961, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. [Alice] Haidinger an Stadtverwaltung Karlsruhe, Brief, 20. Oktober 1951, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188. Vgl. Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute: Voranschlag. [1964], Eheberatung Karlsruhe.
186
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
holen, wo es notwendig erschien.⁷⁴⁸ Offenbar ging die Zusammenarbeit sogar über das übliche Maß hinaus: „Selbst die Allgemeine Ortskrankenkasse erteilte, als es sich nötig erwies, vertrauliche Auskunft.“⁷⁴⁹ Auch die Vertrauensstelle selbst stellte ihr Wissen zur Verfügung und beteiligte sich an der Einführung einer kirchlichen Telefonseelsorge in Karlsruhe sowie der Einrichtung einer Eheberatungsstelle in Stuttgart.⁷⁵⁰ Fachliche Weiterbildungen liefen über die Evangelische Akademie Baden sowie die DAJEB.⁷⁵¹ Kontakt zur dieser bestand spätestens seit 1952.⁷⁵² Im Jahr darauf lud die Vertrauensstelle zu einem Vortragsabend mit Carl Coerper ein.⁷⁵³ Mitglied des Verbands wurde sie jedoch erst 1960, als im Zuge einer Konferenz zufällig festgestellt wurde, dass noch keine Mitgliedschaft bestand.⁷⁵⁴ Die Karlsruher Mitarbeiter nutzten Hilfsmittel für die Beratung, wie sie die DAJEB auf ihren Veranstaltungen lehrte, und passte sie an die lokalen Gegebenheiten an.⁷⁵⁵ Nachdem die Richtlinien des Deutschen Arbeitskreises Jugend-, Ehe- und Familienberatung in Kraft getreten waren, nahm das Personal an den Ausbildungslehrgängen teil und die DAJEB erkannte die Vertrauensstelle an.⁷⁵⁶ Die Besucherzahlen der Vertrauensstelle zeigen, dass die Beratungen weitgehend kontinuierlich anstiegen, von 414 im Jahr 1953 auf 775 1964. In der Regel waren zwei Drittel der Ratsuchenden Frauen, ein Drittel Männer. Etwa 70 Prozent kamen
Vgl. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Jahresbericht, [1965], Eheberatung Karlsruhe. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, 28. Februar 1953, S. 2, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188. Vgl. zudem Sprotte, [Johanna]: Tätigkeitsbericht. 12. Januar 1955, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, 28. Februar 1953, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188 sowie Spieler, Ilse: Jahresbericht 1962 [1963], Eheberatung Karlsruhe. Vgl. o. A.: Ein persönlich gefärbter Bericht, der nur für den internen Gebrauch bestimmt ist, über meinen Besuch der Jahrestagung der DAJEB, [1960], Eheberatung Karlsruhe sowie Klaas, Jahre, 2003, S. 8 f. Vgl. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, 28. Februar 1953. Der DAJEB war in Karlsruhe auch eine Eheberatungsstelle im Seminar für Sozialarbeit bekannt. Zu dieser liegen jedoch keinerlei weitere Informationen vor. Vgl. DAJEB, Jahresbericht 1953. [1954], S. 10, DAJEB-Bundesgeschäftsstelle. Vgl. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe]: Einladung, 20. April 1953, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188. Vgl. o. A., Bericht, [1960], Eheberatung Karlsruhe. Vgl. Kutscher/Schäffler: Bericht. 12. Dezember 1960. Eheberatung Karlsruhe sowie [Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung Hannover]: Fragebogen, [1960], Eheberatung Karlsruhe. Vgl. o. A.: „Paarbeziehungen werden wieder nach altem Muster gelebt“. In: Ehe-, Familien- und Partnerschaftsberatungsstelle (Hrsg.): 50 Jahre Eheberatung in Karlsruhe. Karlsruhe 2003, S. 12– 13, hier S. 12.
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
187
aus Karlsruhe, die anderen aus dem Landkreis.⁷⁵⁷ Den Versuch, dort Ableger für die Beratung zu schaffen, gab man schnell auf. Ratsuchende scheuten den Besuch dort aus Furcht davor, von Bekannten gesehen zu werden. Sie nahmen lieber die Fahrt nach Karlsruhe in Kauf, um den Besuch verschweigen zu können.⁷⁵⁸ Die meisten Ratsuchenden kamen mehrfach – zu Beginn der 1950er-Jahre zwei- bis dreimal. Dies steigerte sich, 1964 kamen Besucher häufig zehn Mal in die Sprechstunde.⁷⁵⁹ Auch die Zahl der zu verfassenden Gutachten für Volljährigkeits- und Ehegenehmigungsverfahren stieg von etwa 40 auf über 176.⁷⁶⁰ Dies führte man in der Stelle selbst sowohl darauf zurück, dass sich die eigene Arbeit intensivierte, als auch auf eine im Laufe der Jahre immer engere und bessere Kooperation mit anderen Einrichtungen sowie Behörden.⁷⁶¹ Hausbesuche, 1954 noch als „ganz wichtige Arbeitshilfe“ bezeichnet,⁷⁶² waren bereits im Jahr darauf zum Bedauern der Beraterin aus Zeitmangel immer weniger möglich.⁷⁶³ Gegen Mitte der 1960er-Jahre fanden jedoch wieder vermehrt Hausbesuche statt.⁷⁶⁴ Die Vertrauensstelle registrierte Ehekonflikte, die nach der Eheschließung im Zeitraum von drei Monaten bis hin zu 40 Jahren auftraten.⁷⁶⁵ Die schwersten Ehestörungen beobachteten die Mitarbeiter entweder bei sehr kurz oder bereits seit über 20 Jahren Verheirateten.⁷⁶⁶ Meist kamen die Ratsuchenden mit juristischen Fragen, hinter denen die Berater jedoch in den 1950er-Jahren oft unbewusste Kindheitskonflikte vermuteten, beispielsweise eine enge oder nicht gelöste Elternbeziehung, eine unglückliche Jugend oder eine unbewusst gesuchte und nicht gefundene
Vgl. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, 1954, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188 sowie [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Jahresbericht, [1965], Eheberatung Karlsruhe. Vgl. Haidinger, Jahresbericht 1956, 25. März 1957, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, 1954, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188 sowie [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Jahresbericht, [1965], Eheberatung Karlsruhe. Zur Entwicklung der Beratungsstunden vgl. auch Klaas, Jahre, 2003, S. 7. Vgl. Schulze, [Renate]: Jahresbericht 1957. Januar 1958. Eheberatung Karlsruhe sowie Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe: Jahresbericht 1959. [1960], Eheberatung Karlsruhe. Vgl. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Jahresbericht, [1965], Eheberatung Karlsruhe. Sprotte, Tätigkeitsbericht, 12. Januar 1955, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. Geschäftsführerin: Jahresbericht 1955 der Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute. 30. Dezember 1955, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Jahresbericht, [1965], Eheberatung Karlsruhe. Vgl. Spieler [Ilse]: Jahresbericht 1960. [1961], Eheberatung Karlsruhe. Vgl. Geschäftsführerin, Jahresbericht, 30. Dezember 1955, Eheberatung Karlsruhe.
188
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
religiöse Bindung.⁷⁶⁷ Eine hohe Zahl der Ratsuchenden hatte gesundheitliche Probleme. Frauen litten vor allem an Herz-, Gallen- und Schilddrüsenstörungen, während bei Männern Neurosen überwogen. Dies wurde darauf zurückgeführt, dass Eheschwierigkeiten und ungelöste Konflikte bei Betroffenen gesundheitliche Probleme auslösten. Hier zeigt sich eine zur DAJEB konträre Sicht auf Erkrankung. Im Jahr 1953 wurde eine schwere Gefährdung von Ehen Kriegsversehrter festgestellt, welche die Einrichtung relativ häufig aufsuchten. Auch in späteren Jahren herrschte die Neigung, Schwierigkeiten älterer Ehen auf Kriegserlebnisse des Mannes zurückzuführen. Ansonsten beruhten die häufigsten Krisen während des Untersuchungszeitraums auf dem Ehebruch des Mannes. Hinzu kamen Wohnungsnot beziehungsweise die Wohngemeinschaft mit Verwandten, Arbeitslosigkeit und Mischehen,⁷⁶⁸ des Weiteren knapp bemessenes Wirtschaftsgeld, schlechte Wirtschaftsführung der Ehefrau und Konflikte mit der Schwiegermutter. Frauen klagten zudem über Trunkenheit des Ehemannes, häufig im Zusammenhang mit Misshandlungen.⁷⁶⁹ Am ausführlichsten gingen die Berichte auf das Konfliktthema Ehebruch ein. Die Beratenden stellten hier über die Jahre hinweg immer wieder Verknüpfungen mit der Rolle der Ehefrau als Hausfrau her: Der Frau fehle ein Verständnis für die beruflichen Belastungen des Ehemannes, zudem sei sie naiv. Ein großer Teil dieser älteren, ratsuchenden Ehefrauen hat oft keine Ahnung von der oft nervenzehrsetzenden Tätigkeit ihrer Ehemänner, und sie verstehen es nicht, ihm nach der Arbeit das Zuhause zu einem Ort des Ausruhens zu machen. In ihren Augen ist die Ehe eine wechselseitige Verpflichtung von gewissen Leistungen, Tätigkeiten, Duldungen. Mit dieser Einstellung haben sich beide Partner unmerklich auseinander gelebt, und es fällt dem Manne nicht schwer, andere Wege zu gehen, wenn eine jüngere Frau winkt.⁷⁷⁰
Die Beraterin sah damit auch ihre Aufgabe darin, den ratsuchenden Frauen ihre eigenen Fehler sichtbar zu machen.⁷⁷¹ Die vermeintlich fehlende Fähigkeit der Frau, das Zuhause gemütlich zu gestalten, war zehn Jahre später allerdings kein Thema
Vgl. z. B. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, 28. Februar 1953, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188 sowie Schulze, Jahresbericht, März 1957, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. z. B. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, 1954, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188 sowie Schulze, [R.], Jahresbericht, März 1957, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. Spieler, Jahresbericht, [1961], Eheberatung Karlsruhe. Sprotte, Tätigkeitsbericht, 12. Januar 1955, S. 1 f., Eheberatung Karlsruhe. Vgl. auch Geschäftsführerin, Jahresbericht, 30. Dezember 1955, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. Sprotte, Tätigkeitsbericht, 12. Januar 1955, Eheberatung Karlsruhe.
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
189
mehr. Doch dass es Hausfrauen an beruflicher Erfahrung fehle, blieb weiterhin Gegenstand verschiedener Überlegungen und Deutungen. Im Gegensatz zu anderen Beratungseinrichtungen bewertete die Vertrauensstelle die Berufstätigkeit von Ehefrauen 1966 positiv. Stehe die Frau im Erwerbsleben, sei die Ehe weniger anfällig für untreues Verhalten der Ehemänner. Langjährige Hausfrauen seien im Gegensatz zu Berufstätigen in ihren Lebenserfahrungen stark auf diesen Bereich fokussiert, sodass die Gefahr bestehe, „mit der Weiterentwicklung des Mannes in der Auseinandersetzung mit Beruf, Mitarbeitern und anderen außerhäuslichen Umweltfaktoren nicht Schritt halten zu können“.⁷⁷² Diese Frauen verstünden „die beruflichen Belastungen ihrer Ehemänner und die Gefährdungen, die sich durch die Zusammenarbeit von Mann und Frau am Arbeitsplatz ergeben“, nicht wirklich.⁷⁷³ Ebenso wie in Hannover war somit auch in Karlsruhe die Berufstätigkeit der Ehefrau ein viel diskutiertes Thema. Die Diagnose, dass eine Hausfrau sich nicht in die Lage ihres Mannes versetzen könne, bedeutete zumindest bis Mitte der 1950erJahre jedoch nicht, dass die damalige Eheberaterin die Berufstätigkeit von Ehefrauen im Umkehrschluss günstig beurteilte. Die in der Arbeitsgemeinschaft tätigen Frauen legten zwar durchaus Wert auf eine weibliche Leitung der Beratungsstelle, auch um Frauen Mut für eine eigene Berufstätigkeit zu machen.⁷⁷⁴ Während die Beratung in Hannover sich bemühte, keine Pauschalaussagen über arbeitende Ehefrauen zu treffen und jeden Fall individuell zu beurteilen, lehnten beispielsweise die Vorsitzenden der DAJEB die Berufstätigkeit von Ehefrauen jedoch ab.⁷⁷⁵ Damit stimmte eine Karlsruher Beraterin, die zu Beginn der 1950er-Jahre aus ihrer Arbeit berichtete, noch überein. Sie konstatierte ein Versagen aufgrund der Doppelbelastung von Beruf und Haushalt. „Daß auch die Berufstätigkeit vieler Frauen die tiefere Ursache ihrer Ehekrise ist, läßt sich nicht übersehen. Körperlich und seelisch stark überfordert, versagen die Frauen dem Ehemann gegenüber.“⁷⁷⁶ Berufstätige Frauen hatten keine Zeit, ihren Haushalt zu durchdringen und sparsam zu wirtschaften. Einkäufe und Küchenzettel im Galopp sind immer unwirtschaftlich. Aber die jungen Frauen sind abends müde, nervös und
[Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe]: [Tätigkeitsbericht 1965]. [1966], S. 2, Eheberatung Karlsruhe. Ebd. Vgl. Interview mit Alice Haidinger, ehemalige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Vertrauensstelle für Jugend- und Eheberatung, Karlsruhe, persönliche Kommunikation, 30. und 31. Mai 2017. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 231. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, März 1954, S. 1, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188.
190
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
gereizt. Wenn nun noch, wie meist üblich, die Möbel auf Raten gekauft sind und regelmäßige, sehr einschneidende Geldbeträge vom Lohn abgeführt werden müssen, ist es um die Harmonie der jungen Ehe gar bald geschehen.⁷⁷⁷
Die darauffolgenden Berichte problematisierten die Berufstätigkeit von Ehefrauen nicht mehr. Ein Zeitungsartikel von 1958 zeigt jedoch auf, dass auch die nachfolgende Eheberaterin weibliche Erwerbstätigkeit zumindest für Mütter mit kleinen Kindern ablehnte. Sie registrierte vielmehr mit Optimismus, dass sich bei einigen Verlobten die Ansicht durchsetze, Frauen gehörten nur ins Haus. Dies unterstrich sie auch in einem Vortrag vor dem Club berufstätiger Frauen. Letztere fanden die Forderung nach einer nicht berufstätigen Ehefrau aber utopisch und forderten stattdessen, berufstätige Frauen und Mütter mehr zu unterstützen.⁷⁷⁸ Eine gewandelte Einstellung wird mit der dritten Eheberaterin im Jahresbericht 1965 deutlich. Sie kritisierte die fehlende Gleichberechtigung in der Ehe und patriarchalische Vorstellungen, die sich in der Ausnutzung von Machtverhältnissen bei finanzieller Abhängigkeit zeigten. Bei den Problemen, welche Frauen aus ländlichen Verhältnissen zu uns führen, fällt auf, daß dort in weiten Kreisen die Gleichberechtigung der Frau in der Ehe nicht verwirklicht ist. Besonders jüngere Frauen, die vor der Ehe berufstätig waren, leiden unter vielfach noch recht patriarchalischen Ehevorstellungen ihrer Männer. Sie finden sich schwer in die wirtschaftliche Abhängigkeit und empfinden es als unwürdig und ehezerstörend, wenn der Mann versucht, sie zu beherrschen; vor allem, wenn das über die geringe „Zuteilung“ von Wirtschaftsgeld geschieht. Hier ergeben sich Gefahren für die Ehen.⁷⁷⁹
In dieser Ansicht stimmte sie mit der Vorsitzenden überein. Die Ansichten innerhalb der Vertrauensstelle veränderten sich somit einerseits im Laufe des Untersuchungszeitraums und zeigten eine zunehmende Akzeptanz der weiblichen Berufstätigkeit. Andererseits wird die unabhängige Meinung der Eheberaterinnen deutlich, die sich in den 1950er-Jahren teilweise stärker im Sinne des Alleinverdienermodells der Ära Adenauer äußerten, während die Vorsitzende sowie der die Beratungsstelle prägende Club berufstätiger Frauen weibliche Erwerbsarbeit befürwortete. Dass es den Frauen möglich war, ihre divergierenden Ansichten innerhalb des Netzwerks der Vertrauensstelle zu vertreten, deutet auf eine offene Diskussionskultur innerhalb von Arbeitsgemeinschaft und Beratungs-
Sprotte, Tätigkeitsbericht, 12. Januar 1955, S. 3, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. o. A.: „Ehekonflikte unter der Lupe“. In: [Badische Neueste Nachrichten], Nr. 258, o. D., Eheberatung Karlsruhe. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], [Tätigkeitsbericht], [1966], S. 2, Eheberatung Karlsruhe.
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
191
einrichtung hin. Darüber hinaus bestätigt die Beobachtung erneut, dass das Selbstverständnis der Akteure innerhalb einer Institution variieren konnte. Auch stimmte die Haltung der direkt in der Praxis Tätigen nicht zwangsläufig mit derjenigen von Personen überein, die zwar auf übergeordneter Ebene in die Eheberatung, aber nicht in die Sprechstundenarbeit eingebunden waren. Im Falle der Karlsruher Vertrauensstelle zeigt sich im Gegensatz zu den Angeboten der Gesundheitsämter Berlins dabei der umgekehrte Fall: Teile der Arbeitsgemeinschaft weichten das zeitgenössisch in der Familien- und Steuerpolitik vertretene Ideal der Hausfrauenehe auf, während die Beratungspraxis es eher mittrug.⁷⁸⁰ Die meisten Jahresberichte gingen sehr ausführlich auf die Art der Gesprächsführung ein. Die Beratung in der Vertrauensstelle dauerte eine Stunde. Reichlich Zeit zur Verfügung zu haben und die Sprechstunde intensiv zu gestalten, galt als Voraussetzung einer erfolgreichen Arbeit. Dies ermöglichte es den Beraterinnen, gut auf den Einzelnen einzugehen, was sie sowohl für sich selbst als auch die Besucher als notwendig betrachteten. „Dabei kommt es fast immer zu einem fruchtbaren und vertieften Gespräch. Der Ratsuchende empfindet deutlich, daß der Berater für ihn auch wirklich ganz da ist, und der Berater hat die innere Ruhe zum Hören und Eingehen auf sein Gegenüber.“⁷⁸¹ Ratsuchende wurden oft zuerst telefonisch gehört. Im Anschluss fiel dann die Entscheidung, welche Beraterin oder welcher Berater am besten zum Fall passen würde.⁷⁸² Meist besuchte ein Ehepartner die Sprechstunde zunächst alleine, woraufhin der zweite ebenfalls zu einem Gespräch eingeladen wurde. Auch hier war zum Einstieg ein Einzelgespräch die Regel. Für die Beratung bedeutete dies, den Fall von der Gegenseite neu zu betrachten und das Bild von der Ehe sowie den beiden Partnern zu vervollständigen. Danach kam es bei einem weiteren Besuch zu einer gemeinsamen Aussprache. Die Eheleute machten sich gegenseitig auf Fehler aufmerksam und stellten Zusammenhänge her. Anschließend erarbeitete die Beraterin mit ihnen gemeinsam das weitere Vorgehen.⁷⁸³ Deutlich wird, dass das Paar selbst im Zentrum der Gespräche stand. Die Beraterin nahm die Verheirateten als Gesprächspartner sowie gestaltende Akteure ihrer eigenen Ehe ernst, sie traute ihnen zu, Probleme lösen zu können. Es gibt keine Hinweise, dass Ratschläge aufoktroyiert wurden. Die Bera-
Vgl. Kapitel 3.1.1 Eugenik oder amtliche Konfliktberatung? Spieler, [Ilse]: Jahresbericht 1964. [1965], S. 2, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. Interview mit Alice Haidinger, ehemalige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Vertrauensstelle für Jugend- und Eheberatung, Karlsruhe, persönliche Kommunikation, 30. und 31. Mai 2017. Vgl. z. B. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, 1953, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188 sowie Schulze, Jahresbericht, Januar 1958, Eheberatung Karlsruhe.
192
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
terin zeigte durch ihr Verhalten, dass ihr die Ratsuchenden wichtig waren. Sie verwies auf die außerordentliche Konzentration und das starke Einfühlungsvermögen, das für die Arbeit erforderlich sei. Größte innere Anstrengung sei notwendig, „da es sich ja meist um mehrere, völlig verschieden gelagerte Fälle handelt“. Die Fälle beschäftigten die Berichterstatterin auch über die Sprechstunde hinaus. Dies erschien ihr „umso notwendiger, als die Beraterin die alleinige Verantwortung für oft wesentliche Entscheidungen trägt“. Da in den Sprechstunden nicht mit Akten gearbeitet wurde, hatte sie den Anspruch an sich, alle laufenden und soweit möglich auch alle früheren Fälle im Gedächtnis zu haben. Dies stellte ein wichtiges Signal an die Besucher dar: „Alles behördliche muss vermieden werden und die Ratsuchenden müssen das Gefühl haben, dass ihre Angelegenheit der Beraterin wichtig genug ist, dass sie sie im Gedächtnis behält.“⁷⁸⁴ Die Verfasserin begriff Eheberatung als langwierige, anstrengende Arbeit, die für das Verständnis der Probleme jedoch notwendig war. Wie sie die Beziehung zwischen Ratsuchenden und Beratern beschrieb, erinnert an die Grundlagen der Casework.⁷⁸⁵ Die Beratungsstelle […] setzt sich zum Ziel, menschlich-soziale Hilfe auf einer persönlichen Beziehung basierend zu bieten […]. Es liegt in der Bedeutung des Gespräches […], durch die Aussprache ein nahes Verhältnis zum Berater herzustellen, der wiederum aus der subjektiven Darstellung die Kontaktfähigkeit des Ratsuchenden feststellen kann. Durch die direkte Beziehung des Beraters zum Ratsuchenden wird der betreffende [sic] […] zu den echten menschlichen Beziehungsformen hingeführt.⁷⁸⁶
Im Gespräch zu dritt kam der Beraterin eine koordinierende Rolle zu, durch die eine Verständigung der Eheleute ermöglicht werden sollte.⁷⁸⁷ Dass die Zahl der Dauerberatungsfälle im Laufe der Zeit stark zunahm, galt als positiver Effekt, den die intensive Betreuung und der enge Kontakt zu den Beratenden mit sich brachten. Mitte der 1960er-Jahre kamen über 40 Prozent der Besucher in der Regel bis zu zehn Mal. „Bei diesen Fällen darf man wohl hoffen, daß hier ein wirkliches Geleit durch Krisen hindurch und zu ihrer Überwindung gegeben werden kann.“⁷⁸⁸ Die Beraterinnen blickten positiv auf ihre Arbeit und Beratungshäufigkeit. Andere Einrichtungen wie Bremen betrachteten dies allerdings
[Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, 1953, S. 5, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188. Vgl. Kapitel 3.3.4 Methoden. Schulze, Jahresbericht, Januar 1958, S. 2, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. ebd. Spieler, Jahresbericht, [1965], S. 2, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. auch [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, 1953, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188.
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
193
nicht zwangsläufig als Zeichen einer funktionierenden Krisenbegleitung, sondern vielmehr als Abhängigkeit der Ratsuchenden, die vermieden werden sollte.⁷⁸⁹ Wie die meisten Stellen betrieb auch diejenige in Karlsruhe vorbeugende Beratungsarbeit. Wie die Bezeichnung der Vertrauensstelle verdeutlicht, betrachtete sie sich für Verlobte ebenso zuständig wie für Ehepaare. Als „prophylaktische Eheberatungstätigkeit“⁷⁹⁰ galten in der Regel jedoch nur die angebotenen Kurse und die Gutachtertätigkeit für Ehemündigkeits- und Volljährigkeitsverfahren. Diese Formulierung findet sich in keiner der anderen untersuchten Beratungsstellen. Ende der 1950er-Jahre stießen die angebotenen Verlobtenkurse offenbar auf ein reges Interesse.⁷⁹¹ Bereits zu Beginn der 1960er-Jahre lohnten sie sich jedoch nicht mehr: Die notwendige Mindestteilnehmerzahl wurde kaum erreicht. Fehl schlug auch, insbesondere die Antragsteller auf Volljährigkeit zu den Kursen zu motivieren. Weshalb das Interesse sank, blieb unklar, auch wenn die Heiratswilligen verschiedene Gründe wie schlechte Busverbindungen zu den Abendveranstaltungen nannten.⁷⁹² Als erfolgreich galt hingegen die Gutachtertätigkeit für Ehemündigkeits- und Volljährigkeitsverfahren. Zu Beginn waren dies jährlich etwa 45 Fälle. Bis 1960 stieg die Zahl auf 195. Nach eigenen Angaben legten die Beraterinnen bei der Beurteilung einen besonders strengen Maßstab an, da die Prognose für sehr jungen Ehen als äußerst ungünstig galt. Gleichzeitig war die Anzahl befürwortender Gutachten hoch.⁷⁹³ „Die Eheberaterin hat in all diesen Fällen sich nicht damit begnügt, ihr Urteil abzugeben, sondern die jungen Paare eingehend beraten. Sie hält eine Betreuung dieser oft von Anfang an gefährdeten Ehen zumindest für die erste Zeit für dringend erforderlich.“⁷⁹⁴ Mit jedem Partner wurden einzeln ausführliche Gespräche geführt, um die inneren und äußeren Bedingungen für eine Ehe zu beur-
Vgl. Gemeinhardt, Eheberatung, 1956. Vgl. Spieler, Jahresbericht, [1965], Eheberatung Karlsruhe. Dies ist zugleich der einzige Jahresbericht, in dem Verlobtenberatung erwähnt wird, die nicht im Zusammenhang mit der Gutachtertätigkeit der Vertrauensstelle steht: „Echte Eheprophylaxe können wir auch in den gar nicht so seltenen Fällen treiben, wo junge unverheiratete Frauen oder Männer in die Beratungsstelle kommen, um sich über Probleme auszusprechen, die sich aus einer Freundschaft oder Verlobung ergeben. Sei es, weil Zweifel daran entstanden sind, ob man zueinander paßt, ob man sich an einen bestimmten Menschen binden soll, einen stark muttergebundenen Mann heiratet.“ Ebd., S. 4. Vgl. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Jahresbericht, [1959], Eheberatung Karlsruhe sowie Schneider, Hilde: Tätigkeitsbericht 1959, [1960], Eheberatung Karlsruhe. Vgl. z. B. Spieler, Jahresbericht, [1963], Eheberatung Karlsruhe. Schneider, Hilde: Jahresbericht der vorbeugenden Beratung. [1963]. Eheberatung Karlsruhe. Vgl. z. B. Spieler, Jahresbericht, [1965], Eheberatung Karlsruhe. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Jahresbericht, [1962], Eheberatung Karlsruhe. Geschäftsführerin, Jahresbericht 1955, 30. Dezember 1955, S. 2, Eheberatung Karlsruhe.
194
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
teilen sowie über Probleme zu sprechen und auf diese einzugehen.⁷⁹⁵ Mit der Einschätzung für das Gericht ging damit einher, „spezielle Hinweise für die künftige Eheführung zu geben, die sich aus der jeweils sehr verschiedenen persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Situation der jungen Leute ergeben“.⁷⁹⁶ Dieses Vorgehen schien der Beraterin gelungen, es werde „von den Brautpaaren dankenswert empfunden, dass sie die Möglichkeit zu dieser Information finden, da der elterliche Beistand nicht immer gegeben ist“.⁷⁹⁷ Gab es später Probleme, wussten die Eheleute bereits, an wen sie sich wenden konnten.⁷⁹⁸ Dieser explizite Ansatz, Gutachten über die Beurteilung der Paare hinaus als Beratung zu behandeln, ist in keiner anderen Beratungsstelle nachzuweisen. Gleichzeitig unterschied sich die prophylaktische Arbeit in Karlsruhe von der in vielen anderen Einrichtungen dadurch, dass die Eugenik keinerlei Rolle spielte. Sie wurde in keinem der vorliegenden Materialien thematisiert. Als Voraussetzung für eine erfolgreiche Beratung galt, dass die Ratsuchenden freiwillig kamen. Daher war die aus der Praxis stammende Beobachtung plausibel, dass amtliche Überweisungen von der Stadt- oder Kreisverwaltung nur dann Aussicht auf Gelingen hatten, wenn Betroffene ein eigenes Beratungsbedürfnis verspürten. War das nicht der Fall, lehnten sie die Beratung als unerwünschte Einmischung ab. „Erfolgreiche Beratungsarbeit läßt sich nur tun, wo die Ratsuchenden völlig freiwillig kommen und damit echte Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zum Hören des Geratenen mitbringen.“⁷⁹⁹ Gelang ein gemeinsames Gespräch mit Mann und Frau, galten die Erfolgsaussichten als gut, da in diesem Fall meist beide Partner Interesse an einer Klärung hatten.⁸⁰⁰ Frühzeitige Beratungen, die zu Beginn einer Krise stattfanden, waren am vielversprechendsten, vor allem, da die Konfliktursachen noch genau festgestellt werden konnten und die Fronten sich nicht verhärtet hatten. Zudem wollten beide Partner sich noch versöhnen.⁸⁰¹ Daher sollte dieser Aspekt Mitte der 1960er-Jahre verstärkt in der Öffentlichkeitsarbeit betont werden.⁸⁰² Die explizite Aufforderung
Vgl. z. B. Spieler, Jahresbericht, [1961], Eheberatung Karlsruhe sowie [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Jahresbericht, [1962], Eheberatung Karlsruhe. Spieler, Jahresbericht, [1965], S. 3, Eheberatung Karlsruhe. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Jahresbericht, [1959], S. 2, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. Spieler, Jahresbericht, [1963], Eheberatung Karlsruhe. Spieler, Jahresbericht, [1965], S. 1, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Jahresbericht, [1962], Eheberatung Karlsruhe. Vgl. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, 28. Februar 1953, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188. Vgl. Spieler, Jahresbericht, [1965], Eheberatung Karlsruhe.
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
195
an Ehepaare, auf Krisen frühzeitig zu reagieren, lässt sich nur in Karlsruhe nachweisen. Andere Stellen verbanden rechtzeitige Hilfe hingegen in der Regel lediglich mit vorehelicher, eugenischer Beratung. Weder bei der Gründung der Karlsruher Stelle noch später wurde eine Notwendigkeit eugenischer Beratungen gesehen oder auch nur thematisiert. Komplizierter gestaltete sich die Beratung bei bereits getrenntlebenden Eheleuten. Sie wünschten meist nur Rat in juristischen Fragen. Dennoch suchten die Beraterinnen der Vertrauensstelle auch hier noch nach Ansatzpunkten. Am schwierigsten zu betreuen waren diejenigen Fälle, in denen der Scheidungsprozess bereits begonnen hatte. Andere als juristische Gesichtspunkte einzubringen, war kompliziert, die Standpunkte waren auch meist zu verhärtet. Dennoch gelang es in der Beratung mehrmals, Eheleute so weit zu versöhnen, dass sie versuchten, ihr gemeinsames Leben neu aufzunehmen.⁸⁰³ Im Jahr 1957 ging die Karlsruher Eheberaterin davon aus, dass für fast alle Ratsuchenden „die geführte Aussprache und die Kenntnisnahme der grundsätzlichen Voraussetzungen einen sehr nützlichen und konstruktiven Einfluss auf das Verstehen der Ehepartner zu einander nach sich zog“.⁸⁰⁴ Eine Erfolgsstatistik zu führen, galt als unmöglich. Gleichzeitig ging man in der Vertrauensstelle von einer positiven Bilanz aus. Als Erfolg betrachteten die Beraterinnen es nicht nur, wenn frühere Ratsuchende die Rückmeldung gaben, dass ihre Ehe wieder in Ordnung sei. Vielmehr gingen sie auch davon aus, dass bei vielen Ratsuchenden, die nicht wiederkamen, die Ehe nach der Beratung in einem besseren Zustand war, da die Betroffenen ansonsten zurückgekehrt wären. Da die Zahl der Scheidungsfälle bei steigender Bevölkerungszahl gleichblieb, hieß es außerdem, dass im Verhältnis weniger Ehen geschieden würden als zuvor. Dies verbuchte man in der Vertrauensstelle ebenfalls als eigenen Verdienst.⁸⁰⁵ Konnten die Beraterinnen einen Konflikt nicht mehr lösen, war dies für sie mit Frustration verbunden. Beratungsschwierigkeiten ergaben sich auch, wenn nicht beide Ehepartner zur Beratung erschienen. Kamen in den 1950er-Jahren noch viele nach Aufforderung,⁸⁰⁶ so resümierte die Eheberaterin zu Beginn der 1960er-Jahre, dass sich trotz individueller Einladungen Partner von Ratsuchenden nur selten
Vgl. z. B. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, 28. Februar 1953, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188 sowie [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, 31. März 1954, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188. Schulze, Jahresbericht, März 1957, S. 4, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. Spieler, Jahresbericht, [1965], Eheberatung Karlsruhe. Vgl. z. B. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Jahresbericht, [1959], Eheberatung Karlsruhe sowie [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, 28. Februar 1953, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188.
196
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
einer Aussprache stellten. In diesem Fall seien wiederholte Gespräche notwendig, da die Schwierigkeiten für die Betroffenen oft qualvoll seien. Die Beraterin stellte dabei fest, dass insbesondere für Frauen eine Unterhaltung mit ihr fast immer eine Erleichterung bedeute, die ihnen neue Kraft gebe und häufig auch Einsicht in eigene Fehler ermögliche.⁸⁰⁷ In mehreren Fällen hätten Ratsuchende nach dem Gespräch bewusster und klarer auftreten können, was ihren Partner positiv beeindruckt habe.⁸⁰⁸ Auch bei einseitigen Beratungen habe die Ehe damit günstig beeinflusst werden können.⁸⁰⁹ Allerdings empfand die Beraterin dieses Vorgehen als mühsam, da die Unterstützung der Gegenseite fehlte.⁸¹⁰ Erreichte die Beratungsstelle ihr Ziel, die Scheidung zu vermeiden, nicht, war es den Beraterinnen dennoch wichtig, mit den Ratsuchenden in Kontakt zu bleiben. Sie wollten ihren Einfluss geltend machen, um zu einer in ihren Augen möglichst entspannten und vernünftigen Atmosphäre beizutragen und das Verhältnis der Verheirateten zu verbessern. Ebenso wie bei Ehekonflikten kümmerten sie sich auch um praktische Hilfe. Sie unterstützten Frauen dabei, eine Arbeit aufzunehmen, um sie finanziell unabhängiger zu machen und von ihrem Kummer abzulenken. Zum Teil ermöglichten sie Erholungskuren.⁸¹¹ Die ausführlichen Jahresberichte verdeutlichten voneinander abweichende Ansichten der Beraterinnen, die diese unabhängig vertraten. Gemeinsam war ihrem Selbstbild ein hoher Anspruch an die eigene Arbeit. Konflikte zu beraten und vorzubeugen, stand für sie im Mittelpunkt. Dabei setzten sie sich inhaltlich intensiv mit den Anliegen der Ratsuchenden auseinander und zeigten auch einen großen zeitlichen Einsatz. Ihre Vorgehensweise und das Verständnis, das sie von der Beziehung zwischen sich und den Ratsuchenden hatten, erinnert dabei bereits zu Beginn der 1950er-Jahre an die in Deutschland erst später populärer werdende Casework. Die Beraterinnen nahmen die Besucher als Akteure wahr, mit denen sie gemeinsam nach Lösungen ihrer Probleme suchten. Ihre Arbeit empfanden sie als anstrengend, aber erfolgreich.⁸¹² Das galt selbst in Fällen, in denen es zu einer Scheidung kam, da sie den Konflikt entschärfen und zu einer entspannteren Atmosphäre beitragen konnten. Die Selbstwahrnehmung in der Beratungspraxis
Vgl. ebd. sowie [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Jahresbericht, [1962], Eheberatung Karlsruhe. S. Spieler, Jahresbericht, [1961], S. 1 f., Eheberatung Karlsruhe. Vgl. auch [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Jahresbericht, [1962], Eheberatung Karlsruhe. S. ebd., S. 2 f. Spieler, Jahresbericht, [1961], Eheberatung Karlsruhe. Vgl. z. B. [Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe], Tätigkeitsbericht, 28. Februar 1953, Stadtarchiv Karlsruhe, Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188 sowie Sprotte, Tätigkeitsbericht, 12. Januar 1955, Eheberatung Karlsruhe. Vgl. auch Renate [Schulze] an Alice [Haidinger], Brief, 14. Juli 1963, Eheberatung Karlsruhe.
3.5 Die Arbeit der DAJEB-Beratungsstellen vor Ort
197
entsprach damit der Satzung der Vertrauensstelle. Sie ging sogar über die dort definierten Aufgaben hinaus, indem auch Geschiedene betreut wurden. Rückmeldungen Ratsuchender und amtlicher Stellen sowie anderer Beratungseinrichtungen bestätigten die Beraterinnen in ihrem Stolz auf die eigene Arbeit – sie fühlten sich auch von außen anerkannt.
3.5.5 Evangelische Eheberatung Bis zur Ausgründung des Evangelischen Zentralinstituts aus der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung liegen kaum Berichte evangelischer Eheberatungseinrichtungen vor.⁸¹³ Mit Berichten von Maria Blech, der Leiterin der Evangelischen Ehehilfe in Berlin, und Guido Groeger, dem Leiter der Evangelischen Jugend- und Eheberatungsstelle Düsseldorf, sind zwar Dokumentationen von zwei der wesentlichen evangelischen Akteure und Beratungsstellen vertreten. Aufgrund der geringen Aussagekraft der Berichte lassen sich jedoch nur wenige Erkenntnisse aus dem Material ziehen. Im Bericht der Evangelischen Ehehilfe Berlin von 1953 wird in erster Linie das Selbstverständnis als evangelische Einrichtung deutlich. Beratung galt als Seelsorge. Darüber hinaus sticht das Bemühen heraus, auf die Ratsuchenden einzugehen. Ziel der Eheberatung war, wie in den anderen Beratungsstellen auch, Scheidungen zu verhindern. Die Besucherzahlen der einzelnen Sprechstunden schwankten stark zwischen vier und 15 Ratsuchenden. „Das ist viel, gemessen an dem grundsätzlichen Bemühen der Eheberatung, jedem Ratsuchenden möglichst viel Zeit zu widmen.“⁸¹⁴ Die Beratungsstelle umfasste mehrere bezirkliche Niederlassungen. Dabei war die Besucherzahl in denjenigen Bezirken am größten, in denen die seit zwanzig Jahren in der evangelischen Ehehilfe tätige Rechtsanwältin Sprechstunden anbot. Offenbar hatten die Besucher Vertrauen zu der langjährigen Mitarbeiterin. Auch den Beraterinnen war ein persönlicher Kontakt wichtig. Sie legten Wert darauf, beiden Ehepartnern die Gelegenheit zur Aussprache zu geben. In der Praxis beobachteten sie, dass ein an die Beratung anschließender Brief sich bewährte. Dort hielten sie die wesentlichen Punkte der Aussprache und seelsorgerischen Hilfe fest. Wenn es ihnen passend schien, verwiesen sie zudem auf die örtliche Kirchengemeinde. Die Beratungsstelle war innerhalb der evangelischen Kirche gut vernetzt. Die Bezirksstellen der Inneren Da für die vorliegende Arbeit evangelische Eheberatung vor allem im Zusammenhang mit der DAJEB relevant ist, werden spätere Berichte evangelischer Beratungsstellen im Folgenden nicht berücksichtigt. Blech, Maria: Bericht über das Jahr 1952 der Eheberatungsstelle der Berliner Inneren Mission, [1953], S. 1, ADE, CAW 413.
198
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Mission unterstützten die Arbeit und kündigten Veranstaltungen über ihren Öffentlichkeitsdienst an. Besonders erfreut war Blech darüber, dass die Kirchengemeinden öfters Ratsuchende an die Eheberatung verwiesen und sie als Leiterin in Gemeinden Vorträge halten konnte. Im Rahmen einer fortlaufenden Vortragsreihe, der sogenannten Eheschule, arbeitete sie unter anderem mit Groeger zusammen. Den Erfolg der Arbeit zu beziffern, fiel ihr allerdings schwer, da sich Seelsorge statistisch nicht erfassen lasse.⁸¹⁵ Sie ging jedoch davon aus, dass in etwa der Hälfte der Fälle eine Scheidung verhindert werden könne. „Dies […] beweist […] die Richtigkeit der Einordnung der evangelischen Eheberatung in den weitgespannten Rahmen der Inneren Mission mit allen ihren Hilfsmöglichkeiten.“⁸¹⁶ Im Gegensatz zum Bericht der Berliner Eheberatungsstelle besteht derjenige der Evangelischen Jugend- und Eheberatungsstelle Düsseldorf vor allem aus statistischen Angaben. Eine evangelische Ausrichtung oder ein entsprechendes Selbstverständnis lassen sich darin nicht erkennen, nur indirekt über den Namen sowie die Tatsache, dass die Stelle fast ausschließlich von evangelischen Ratsuchenden in Anspruch genommen wurde.⁸¹⁷ Hingegen zeigt der Bericht von 1951 deutlich Groegers Versuch, Daten systematisch zu erfassen und zu deuten. Dennoch ist er nur begrenzt aussagekräftig, da nicht zwischen Jugend- und Eheberatung unterschieden wird. Eine eindeutige Zuordnung zu Besuchern und Beratungsanlass ist damit nur in Einzelfällen möglich. Als häufigste Ursachen von Ehekonflikten nannte Groeger das Fehlen einer geistigen Gemeinschaft der Partner, die Untreue des Mannes und dessen Weigerung, sich auf die Ehe wirklich einzulassen.⁸¹⁸ Von der Beratungsstelle für Mütterhilfe und Ehenot der Inneren Mission Bremen liegen mehrere Jahresberichte vor. Diese umfassen allerdings nur wenige Zeilen und geben somit kaum Einblick in Selbstverständnis oder Praxis. Jährlich nahmen etwa 150 Ratsuchende die 1948 gegründete Einrichtung in Anspruch. Dabei handelte es sich in etwa der Hälfte der Fälle um reine Eheberatungen.⁸¹⁹ Der Zustand der Ehen bedrückte die Beraterinnen.⁸²⁰ Ihr Ziel war es, Scheidungen zu verhindern. War dies jedoch nicht möglich, legten sie Wert darauf, „zu einem
Ebd., S. 2. Ebd., S. 4. Im letzten Quartal 1951 kamen 108 Ratsuchende. Von diesen waren 95 evangelisch, neun katholisch, einer griechisch-orthodox, drei machten keine Angaben. Vgl. Groeger, Guido: Tätigkeitsbericht über das 4. Vierteljahr 1951, ADE, CAW 413. Vgl. z. B. Heyne, B.: Bericht über die Arbeit des Vereins für Innere Mission Bremen 1953, [1954], S. 11, LkABEK, S 470 sowie Innere Mission Bremen: Jahresbericht 1955, [1956], S. 12, LkABEK, S 470. Vgl. Heyne, B.: Bericht über die Arbeit des Vereins für Innere Mission Bremen 1950/51, [1952], S. 11, LkABEK, S 470 sowie Heyne, B.: Wegweiser durch die Arbeit des Vereins für Innere Mission Bremen. Jahresbericht 1957. [1958], S. 14, LkABEK, S 470.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
199
friedlichen Auseinandergehen beizutragen, was auch in Hinblick auf die Kinder von wesentlicher Bedeutung ist“.⁸²¹ Die Arbeit wurde nicht beworben, vielmehr fand sie, um die Vertraulichkeit zu wahren, bewusst „im Verborgenen“ statt.⁸²²
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf Das Material zur juristischen Eheberatung in Berlin-Reinickendorf ermöglicht eine exemplarische Fallstudie. Es liegen Jahresberichte vor, aus denen die beabsichtigte Entwicklung für die Beratung hervorgeht. Sie enthalten außerdem regelmäßig erhobene statistische Angaben. Das Konvolut zur Rechtsberatung umfasst 470 Fälle. Diese sind unterschiedlich dicht überliefert und reichen von knappen Standardeinladungen an Ehepartner von Ratsuchenden, die eine halbe Seite umfassen, bis hin zu komplett nachvollziehbaren Fällen mit bis zu 200 Schriftstücken. Besonders aufschlussreich dokumentiert die Überlieferung Selbstverständnis und Praxis der amtlichen Eheberatung Berlins, etwa die Konkurrenz zwischen Gesundheits- und Sozialamt in der Frage, wer für die Eheberatung zuständig sein sollte. Zutage tritt aber auch die Diskrepanz zwischen den Erwartungen, die das Landesgesundheitsamt (LGA) an eugenische Beratung richtete, und der Praxis der Eheberater des bezirklichen Gesundheitsamtes, die sich für die Schlichtung zerrütteter Ehen einsetzten. Ebenso präsent sind Klagen über die geringe Besucherzahl und Bemühungen, sie zu steigern. Wie unterschiedlich Eheberater mit ihren Aufgaben umgingen und damit die Beratung prägten, ist genauso nachvollziehbar wie ihr teilweise großes Engagement. Darüber hinaus scheint auch die auf verbandlicher Ebene diskutierte Problematik des fehlenden Zeugnisverweigerungsrechts auf. Damit spiegeln sich in der Eheberatung Reinickendorfs deutlich typische Entwicklungen. Charakteristisch ist etwa, dass die Eheberatung in Reinickendorf sich bereits in der Weimarer Republik etabliert hatte. Es gab in dieser Zeit eine städtische Sexualberatungsstelle, die im Rathaus Tegel Sprechstunden anbot.⁸²³ Zudem existierte
Heyne, B.: Bericht über die Arbeit des Vereins für Innere Mission Bremen 1949/50. [1951], S. 7, LkABEK, S 470. Heyne, Bericht über die Arbeit des Vereins für Innere Mission Bremen, [1954], S. 11, LkABEK, S 470. Der Berliner Bezirk Reinickendorf umfasste die Ortsteile Frohnau, Heiligensee, Hermsdorf, Konradshöhe, Lübars, Reinickendorf, Tegel, Waidmannslust und Wittenau. Vgl. Bezirksamt Reinickendorf von Berlin. Verfügbar unter: www.berlin.de/ba-reinickendorf/ueber-den-bezirk/ortsteile/, besucht am 25. Juli 2021.
200
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
seit 1927 eine amtliche Eheberatung im Gesundheitsamt, die fast ausschließlich zu Geburtenregelung beriet.⁸²⁴ Wie sich diese Stellen entwickelten, lässt sich aus dem für die vorliegende Arbeit untersuchten Material nicht nachvollziehen. Auffällig ist, dass beide in den vorliegenden Dokumenten nicht erwähnt sind. Weder das Gesundheitsamt noch die Eheberatungsstelle beriefen sich in der Nachkriegszeit auf die Weimarer Republik, obwohl dies in der Beratungsarbeit ansonsten üblich war.⁸²⁵ Da die Alliierten die Berliner Gesundheitsämter 1946 verpflichtet hatten, zunächst vierteljährlich, ab 1952 halbjährlich einen Bericht einzureichen, ist die Entwicklung der Eheberatungsstelle des Gesundheitsamts Reinickendorf für diesen Zeitraum gut nachzuvollziehen.⁸²⁶ Gegründet 1948, bot sie zu Beginn ärztliche und fürsorgerische Beratungen.⁸²⁷ Sprechstunden fanden zu verschiedenen Zeiten im Ortsteil Reinickendorf oder im Rathaus Wittenau statt.⁸²⁸ Im ersten Jahr nutzten 93 Personen das Angebot, zwei Drittel davon waren Frauen. Auf einem ähnlich niedrigen Niveau blieb die Besucherzahl auch im darauffolgenden Jahr.⁸²⁹ 1950 zeigte sich Unzufriedenheit mit der niedrigen Beratungsfrequenz, die vermutlich auf die oben beschriebene mangelnde Akzeptanz eugenischer Beratung zurückzuführen war. Doch ist in diesem Jahr gleichzeitig erstmals eine deutliche Steigerung zu beobachten.⁸³⁰ Die Eheberatungseinrichtung verzeichnete 136 Ratsuchende und 332 Beratungen. Dies lag nach Ansicht der Akteure vor Ort an der neu gestalteten Fürsorgestelle, die nach eigener Einschätzung besonders attraktiv war, was als wichtiger Anreiz für einen Besuch galt. Im selben Jahr intensivierte sich die Arbeit in der Fürsorge, sie widmete sich wieder vermehrt der vorbeugenden Gesundheitspflege, die das Gesundheitsamt als eigentliche Aufgabe betrachtete. Dabei kam Vgl. Soden, Sexualberatungsstellen, 1988, S. 176 ff. Vgl. z. B. Kapitel 3.1 Eheberatung in Nachkriegszeit. Vgl. Landesgesundheitsamt an die Amtsärzte und Leiter der Gesundheitsämter Neukölln: Abschrift, 6. August 1946, LAB, B Rep. 012, Nr. 102 sowie Senator für Gesundheitswesen an Bezirksämter, Brief, 23. Juli 1952, LAB, B Rep. 012, Nr. 32. Vgl. Bezirksamt Reinickendorf: Situations- und Tätigkeitsbericht des Gesundheitsamtes Reinickendorf Jahr 1948, 31. März 1949, LAB, B Rep. 012, Nr. 104. In Reinickendorf lautete die Adresse: Alt-Reinickendorf 38, in Berlin-Wittenau Eichborndamm 223 – 229. Vgl. [Kurt] Schulze-Danneberg an M. B., Brief, 12. März 1953, LAB, B Rep. 220, Nr. 197. Vgl. z. B. Bezirksamt Reinickendorf: Situations- und Tätigkeitsbericht des Gesundheitsamtes Reinickendorf September 1949, 30. September 1949, LAB, B Rep. 012, Nr. 106 sowie Bezirksamt Reinickendorf: Situations- und Tätigkeitsbericht des Gesundheitsamtes Reinickendorf Oktober 1949, 29. Oktober 1949, LAB, B Rep. 012, Nr. 106. Vergleiche zwischen den Jahren sind nicht immer eindeutig, da die Statistik verschieden geführt wurde. Sie enthält entweder Angaben zur Gesamtbesucherzahl, zu neu hinzugekommenen Ratsuchenden oder der Zahl der durchgeführten Beratungen. Auch beziehen sich die Angaben teilweise auf verschiedene Zeiträume.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
201
es zu Konflikten mit dem Sozialamt, die der bereits beschriebenen Auseinandersetzung zuzuordnen sind, welche grundsätzliche Einbettung die amtliche Eheberatung erfahren sollte. Die Rechtsberatung des Sozialamts beeinträchtigte nach Ansicht der Beratungsstelle Reinickendorf die Eheberatung des Gesundheitsamtes, da sie in großem Umfang Scheidungsfälle beriet.⁸³¹ Federführend für die Rechtsberatung waren die bezirksamtlichen Abteilungen im Sozialwesen.⁸³² Obwohl der Jurist der Rechtsberatung des Sozialamtes offenbar selbst der Ansicht war, dass die Hälfte der Ratsuchenden eine ärztliche statt juristische Beratung benötigten, überwies die Stelle keinen Fall an das Gesundheitsamt. Bemühungen um eine Zusammenarbeit scheiterten am Leiter des Sozialamtes, der die Eheberatung in der Zuständigkeit seiner Behörde sah. Im Jahresbericht der Eheberatungsstelle hieß es, das Sozialamt versuche „anscheinend auf Weisung des Hauptsozialamtes“, die „Eheberatungsfälle an sich zu reissen“.⁸³³ Hier machte sich die zwischen Landesgesundheits- und Sozialamt bestehende Konkurrenz auch auf bezirklicher Ebene bemerkbar.⁸³⁴ Das Gesundheitsamt forderte eine Lösung vom Senat.⁸³⁵ Die Eheberater hatten dagegen die Praxisebene im Blick und schlugen vor, die juristische Sprechstunde in die Eheberatungsstelle des Gesundheitsamts einzugliedern. Diese Beratung übernahm der Leiter der Rechtsberatungsstelle des Sozialamtes. Die Anzahl der Besucher in der Eheberatung stieg daraufhin auf 151.⁸³⁶ Mit diesen zwei Rechtsberatungsstellen wurden zwar weitere parallele Strukturen etabliert, sodass der grundsätzliche Konkurrenzkonflikt nicht geklärt war. Das Gesundheitsamt kam allerdings dem Ziel, die Bedeutung der eigenen Beratung zu steigern und mehr Besucher zu empfangen, näher. In der Praxis fanden Sozial- und Gesundheitsamt sogar zunehmend Berührungspunkte. „Die Zusammenarbeit mit der juristischen Beratung des Sozialamtes hat sich als wesentliche Vereinfachung der Eheberatung erwiesen, da die Fälle […] an Ort und Stelle umfassend beraten werden konnten.“⁸³⁷
Vgl. Bezirksamt Reinickendorf: Tätigkeitsbericht 1950, 15. März 1951, LAB, B Rep 012, Nr. 110. Zu Scheidungszahlen in Berlin vgl. Schneider, Einigkeit, 2001, S. 209. Vgl. Verwaltungsvorschriften für die Rechtsberatungsstellen der Bezirksämter von Berlin, 15. Januar 1963, LAB, B Rep. 004, Nr. 1601. Vorbild für die Rechtsberatungsstellen Berlins sollte die Rechtsberatung Hamburgs sein. Vgl. Senator für Sozialwesen an Bezirksamt Reinickendorf, Brief, 14. November 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 197. Zu der Rechtsberatung in Hamburg vgl. Kapitel 3.1 Eheberatung in Nachkriegszeit. Le[mke]: Jahresbericht 1950 über die Eheberatungsstelle Reinickendorf, 23. Januar 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 1686. Vgl. Kapitel 3.1 Eheberatung in Nachkriegszeit. Vgl. Bezirksamt Reinickendorf, Tätigkeitsbericht 1950, 15. März 1951, LAB, B Rep. 012, Nr. 110. Davon waren 40 Männer und 111 Frauen. Vgl. Le[mke], Jahresbericht 1950, 23. Januar 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 1686. Eheberatungsstelle: Berichtsjahr 1953/53, o. D., LAB, B Rep. 220, Nr. 1686.
202
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Ab 1955 galt die Zusammenarbeit mit dem Sozialamt als „fruchtbar“.⁸³⁸ Die Konkurrenzsituation zwischen Landesgesundheitsamt und Hauptsozialamt verlor auf der Bezirksebene ihre Bedeutung zumindest für die Eheberatung Reinickendorf. Das Ziel der Eheberatung Reinickendorf war es, Scheidungen zu verhindern.⁸³⁹ Gleichzeitig bemühten sich die Berater, psychologische und gesundheitliche Probleme zu klären. Sie banden gelegentlich Psychologen in die Arbeit ein.⁸⁴⁰ Innerhalb dieser Konstellation sollte die juristische Eheberatung dazu beizutragen, eine überflüssige Inanspruchnahme der Gerichte und einseitige Streithilfe zu vermeiden. Den Richtlinien für die städtischen Rechtsberatungsstellen in Berlin von 1952 zufolge oblag es ihr, Interessenkonflikte durch eine außergerichtliche Einigung anzustreben.⁸⁴¹ Im Wesentlichen blieben diese Auf- und Vorgaben über den gesamten Untersuchungszeitraum bestehen.⁸⁴² Die Aufgabe der Eheberatung war damit eindeutig Konfliktberatung, obwohl das Landesgesundheitsamt eigentlich die voreheliche eugenische Beratungsarbeit als Ziel betrachtete. Eugenische Beratung lässt sich in Reinickendorf nicht nachweisen. Quellenkritisch ist hier allerdings zu beachten, dass lediglich Beratungsfälle der juristischen Eheberatung vorliegen. Da es kein Material zur ärztlichen und fürsorgerischen Sprechstunde gibt, ist nicht auszuschließen, dass dort eugenische Beratungen stattfanden. Nach Einführung der Rechtsberatung nahm die Zahl der Eheberatungen zu, auch weil Ratsuchende aus früheren Jahren bei erneuten Schwierigkeiten wieder erschienen.⁸⁴³ Im Geschäftsjahr 1953/54 fanden bereits 308 juristische Beratungen statt. In diesem Jahr stieg nicht nur das Besucheraufkommen, sondern nach Einschätzung der Leitung auch die Qualität der Arbeit. Besonderes Lob erfuhr der Jurist Fröde,⁸⁴⁴ der sich bis zu einer Stunde Zeit pro Beratung nahm und Ratsu-
Lemke: Jahresbericht 1955/56, 16. Mai 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 1686. Vgl. ebd. Vgl. Bezirksamt Reinickendorf: Tätigkeitsbericht 1950, 15. März 1951, LAB, B Rep. 012, Nr. 110 sowie [Kurt] Schulze-Danneberg, Aktennotiz, 21. Oktober 1953, LAB, B Rep. 220, Nr. 209. Vgl. Öffentliche Rechtsberatung an R. K., Brief, 6. Dezember 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 220 sowie Fröde an Bürgermeister, Brief, 22. Dezember 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 218. Sie wurden 1963 der Terminologie des Bundessozialhilfegesetzes angepasst. Vgl. Verwaltungsvorschriften für die Rechtsberatungsstellen der Bezirksämter von Berlin, 15. Januar 1963, LAB, B Rep. 004, Nr. 1601 sowie Lindner, Vermerk, 11. Januar 1963, LAB, B Rep. 004, Nr. 1601. Vgl. Lemke: Eheberatung Jahresbericht 1953, 14. Mai 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 1686. Dieser war von 1954 bis 1958 in der Rechtsberatung tätig und zu diesem Zeitpunkt „Amtsrichter a. D.“. Weitere Informationen sind nicht überliefert.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
203
chende zur psychologischen Beratung überwies. Die Leiterin schloss daraus, dass die Arbeit qualitativ wesentlich wertvoller geworden sei.⁸⁴⁵ Im Jahr 1955 verzeichnete die Eheberatung 261 Neuaufnahmen. Ärztliche Beratungen fanden in 122 Fällen und fürsorgerische in 332 Fällen statt. Beide Richtungen arbeiteten bei 363 Beratungen zusammen. Die juristische Sprechstunde beriet 328 Mal.⁸⁴⁶ Obwohl sich immer mehr Ratsuchende an die Eheberatung wandten, beklagte diese, dass der Zulauf besser sein könnte, wenn die Existenz der Beratungsstelle mehr bekannt gemacht würde.⁸⁴⁷ Der letzte Bericht liegt für das Geschäftsjahr 1959/60 vor. Darin wurden 280 Neuaufnahmen verzeichnet. Der Anteil der Männer lag in diesem Jahr bei knapp der Hälfte der Ratsuchenden. Die fürsorgerische Beratung war am stärksten frequentiert, die juristische bearbeitete 283 Fälle. Am geringsten war der Anteil rein ärztlicher Beratungen.⁸⁴⁸ Von Beginn an fällt auf, dass die Rechtsberatung auf einen gewissen Zulauf ausgerichtet und stark bürokratisiert war. So konnten juristische Berater auf formalisierte Vorgänge zurückgreifen, die im Laufe der Zeit weiter ausgebaut wurden. Zu Überweisungen, Protokollen und Vorladungskarten existierten Vordrucke.⁸⁴⁹ Ein Stempel mit folgender Aufschrift lag bereit: „Dieses Schriftstück ist nach den Angaben des Antragstellers, für deren Richtigkeit keine Gewähr übernommen wird, von der Rechtsberatungsstelle Reinickendorf abgefaßt worden. Es enthält keine amtliche Stellungnahme.“⁸⁵⁰ Die Daten Ratsuchender fanden Eingang in eine systematisch gepflegte Kartei, die auch Notizen über Beratungen enthielt. Um Vertraulichkeit zu garantieren, stellte Fröde mehrfach einen Antrag auf verschließbare Karteikästen.⁸⁵¹ Da der Andrang so groß war, dass Besucher teilweise mehrere Stunden warten mussten, wurde eine Voranmeldung empfohlen.⁸⁵²
S. Lemke: Jahresbericht 1954/55 der Eheberatung, 17. Mai 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 1686. Zur veranschlagten Beratungszeit vgl. P. H. an [Eheberatung], Brief, 18. Januar 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 219. Vgl. Lemke: Jahresbericht 1955/56, 16. Mai 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 1686. S. Lemke: Jahresbericht 1956/1957 der Eheberatung, 29. Mai 1957, LAB, B Rep. 220, Nr. 1686 sowie Lemke, Eheberatung Jahresbericht 1953, 14. Mai 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 1686. Vgl. [Bezirksamt Reinickendorf ]: Jahresbericht 1959/60 der Eheberatung, 24. Mai 1960, LAB, B Rep. 220, Nr. 1686. Vgl. z. B. Amtsarzt Bezirksamt Reinickendorf an juristische Eheberatungsstelle, Überweisung, 15. September 1950, LAB, B Rep. 220, Nr. 196 sowie [Kurt Schulze-Danneberg], Protokoll, 21. Mai 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 206. [Kurt] Schulze-Danneberg an K. H., Brief, 21. Januar 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 223. Vgl. Fröde an Stadtrat, Brief, 18. Mai 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 219. Vgl. z. B. Fröde an Amtsgericht Wedding, 25. Oktober 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 197 sowie Dämpfert, Bescheinigung, 15. November 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 223.
204
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Die Rechtsberatungsstellen berieten ausschließlich sogenannte „Minderbemittelte“, deren Einkommen einen bestimmten monatlichen Betrag nicht überstieg. Dieser lag 1951 bei 150 DM und stieg bis 1953 auf 175 DM zuzüglich 30 DM für jeden weiteren zu unterstützenden Familienangehörigen.⁸⁵³ In Berlin lag beispielsweise der Verdienst eines Bauarbeiters im Gründungsjahr der Eheberatungsstelle bei 211,20 DM und der eines Fabrikarbeiters bei 231,20 DM.⁸⁵⁴ Überschritt der Verdienst den festgelegten Betrag, wurden die Betreffenden abgewiesen.⁸⁵⁵ Kam es zu einer Gerichtsverhandlung, konnten Ratsuchende das Armenrecht beantragen und damit von den Kosten befreit werden.⁸⁵⁶ Nur in Ausnahmefällen stand ihnen ein Rechtsanwalt honorarfrei zur Verfügung, in der Regel mussten sie diesen selbst beauftragen und finanzieren.⁸⁵⁷ Der Berater Kurt Schulze-Danneberg kritisierte, dass diese Regelung Frauen ohne Geld völlig von einer Prozessführung ausschließe.⁸⁵⁸ Die Rechtsberatung selbst empfahl keine Rechtsanwälte, auch keine ehemaligen Kollegen, da dies den Richtlinien widersprach.⁸⁵⁹ Sobald das Armenrecht bewilligt und ein Anwalt beigeordnet oder bezahlt wurde, konnte die Rechtsberatung keinen Einfluss mehr auf das Verfahren nehmen.⁸⁶⁰ Ratsuchenden war es jedoch möglich, sie als korrespondenzbevollmächtigte Vertretung beizubehalten.⁸⁶¹ Zumindest ein Jurist arbeitete dabei vertraulich mit Rechtsanwälten zusammen. Schulze-Danneberg legte Wert darauf, über in der Rechtsberatung begonnene Verfahren weiterhin informiert zu sein, und bat daher darum, auf dem Laufenden gehalten zu werden.⁸⁶² Offenbar um Ratsuchenden zu helfen, reichte er eigentlich vertrauliche Notizen an Rechtsanwälte weiter.⁸⁶³
Vgl. z. B. [Kurt] Schulze-Danneberg an W. B., Brief, 29. November 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 198 sowie [Kurt] Schulze-Danneberg an A. H., Brief, 4. Februar 1953, LAB, B Rep. 220, Nr. 202. Vgl. Thurnwald, Gegenwartsprobleme, 1948, S. 67 ff. In der Bundesrepublik betrug das Durchschnittseinkommen von Arbeitern 1950 monatlich 243 DM. Vgl. Haustein, Mangel, 2007, S. 41. Vgl. Dämpfert, Bescheinigung, 29. November 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 212. Vgl. z. B. Landgericht Berlin: Beschluss, 16. September 1953, LAB, B Rep. 220, Nr. 201 sowie Fröde an A. J., Brief, 28. September 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 203. Für Anträge auf Armenrecht vgl. z. B. Zeugnis zur Erlangung der Kostenbefreiung, Vordruck, LAB, B Rep. 220, Nr. 202 sowie S. L., Zeugnis zur Erlangung der Kostenbefreiung, [1950], LAB, B Rep. 220, Nr. 196. Vgl. Fröde an K. K., Brief, 9. Februar 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 220. S. [Kurt] Schulze-Danneberg an R. S., Brief, 2. April 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 204. Vgl. z. B. Fröde an Kurt Schulze-Danneberg, Brief, 3. März 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 222 sowie Fröde an Bürgermeister, Brief, 22. Dezember 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 218. Vgl. [Kurt] Schulze-Danneberg an E. H., Brief, 11. April 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 202. Vgl. [Kurt] Schulze-Danneberg an Amtsgericht Amberg, Briefentwurf, 13. November 1953, LAB, B Rep. 220, Nr. 212. Vgl. [Kurt] Schulze-Danneberg an R. S., Brief, 23. Februar 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 204. Vgl. z. B. [Kurt] Schulze-Danneberg an R.S., Brief, 2. April 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 204 sowie [Kurt] Schulze-Danneberg an R. S., Brief, 13. April 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 212.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
205
Rechtsberatungsstellen besaßen weitgehende Befugnisse gegenüber anderen öffentlichen Stellen Berlins. Bat die Rechtsberatung Reinickendorf bei Behörden um Auskunft, ging sie davon aus, eine Antwort zu erhalten. Die Berater erwarteten mit der gleichen Selbstverständlichkeit auch, dass Verwaltungseinrichtungen in Westdeutschland oder die Arbeitgeber der Betroffenen kooperierten.⁸⁶⁴ Obwohl dies nicht der Gesetzeslage entsprach, betonten die Rechtsberater gegenüber Besuchern und Rechtsanwälten nicht nur die Vertraulichkeit der Beratungen, sondern versicherten ihnen sogar, ein Zeugnisverweigerungsrecht zu besitzen.⁸⁶⁵ Auch in Reinickendorf existierte somit der Wunsch, die Vertraulichkeit der Beratungen durchzusetzen und die für alle Beteiligten unbefriedigende Rechtslage zu ändern. Erhielten Berater in Scheidungsverfahren eine Gerichtsvorladung zu einer Zeugenaussage, verweigerte das Personalamt unter Berufung auf das Berliner Beamtengesetz eine Aussagegenehmigung für die betreffenden Mitarbeiter. Es argumentierte, dass eine zeugenschaftliche Vernehmung das Vertrauen in die Eheberatungsstelle wesentlich erschüttern und damit die Durchführung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden würde.⁸⁶⁶ Die Besucher der Eheberatung jedenfalls gingen von einer Schweigepflicht aus, die ihnen auch zugesichert wurde. Das Gericht akzeptierte dies zwar in der Regel, beharrte teilweise aber dennoch auf einer Aussage.⁸⁶⁷ In einem Fall sollte eine Fürsorgerin vor Gericht die mangelnden haushälterischen Fähigkeiten der Ehefrau bezeugen. Die Fürsorgerin löste das Dilemma, indem sie eine Aussage machte, die keinen der Betroffenen belastete.⁸⁶⁸ Für die Rechtsberatung war stets ein Jurist zuständig.⁸⁶⁹ Ein nicht nur unter Ratsuchenden, sondern auch unter den Kollegen besonders angesehener Berater war wieder der ehemalige Amtsrichter Fröde.⁸⁷⁰ In seiner Aussage über einen
Vgl. z. B. [Kurt] Schulze-Danneberg an S., Brief, 29. Mai 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 208 sowie Fröde an Oberstadtdirektor Hannover, 10. September 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 200. Vgl. z. B. Fröde an W. S., Brief, 15. März 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 201 sowie Fröde an A. P., Brief, 5. April 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 202. S. Bezirksstadtrat an Landgericht Berlin, Brief, 24. April 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 218 sowie Rechtsamt an Landgericht Berlin, Brief, 26. März 1957, LAB, B Rep. 220, Nr. 216. Vgl. z. B. Landgericht Berlin an [Eheberatungsstelle Reinickendorf ], Brief, 28. April 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 217 sowie Bezirksamt Reinickendorf an Landgericht Berlin, Abschrift, 7. März 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 216. Vgl. Leppin, Notiz, 21. März 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 216. Aufgeschlüsselt nach Jahren: Kuntze (1950), Kurt Schulze-Danneberg (1950 – 1954), Fröde (1954– 1958), Hiller (1958) und Casparius (ab 1958). Weitere Informationen liegen nicht vor, die Zuständigen sind nur aus den vorliegenden Briefwechseln ersichtlich. Vgl. Winfried Lösche an Schneider, Brief, 12. Januar 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 218 sowie Lemke, Jahresbericht 1954/55 der Eheberatung, 17. Mai 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 1686.
206
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
mitarbeitenden Gerichtsreferendar wird deutlich, dass er besonderen Wert darauf legte, sich auf die persönliche Situation der Ratsuchenden einzulassen.⁸⁷¹ Spätestens ab 1955 arbeitete eine Sekretärin in der Beratungsstelle.⁸⁷² Die Berater konnten medizinische oder fürsorgerische Expertise einholen, in der Regel involvierten sie vor allem letztere.⁸⁷³ Der ab 1956 tätigen Familienfürsorgerin bescheinigte man „eine besondere Neigung und Begabung für diese Arbeit“.⁸⁷⁴ Einen negativen Eindruck hinterließ hingegen Kuntze, der als erster die Stelle des Rechtsberaters innegehabt hatte. Nachdem er die Einrichtung 1952 verlassen hatte, erhielt sein Nachfolger Hinweise auf Verfehlungen Kuntzes. Offenbar hatte dieser finanzielle Vorteile aus Beratungen gezogen und war seiner Pflicht zur Interessenvertretung Ratsuchender nicht nachgekommen.⁸⁷⁵ Betroffene wurden auf die Möglichkeit einer Strafanzeige hingewiesen.⁸⁷⁶ Es kam zu einem Gerichtsverfahren.⁸⁷⁷ Dies verdeutlicht, wie unterschiedlich Beratende handeln konnten.
3.6.1 Selbstverständnis der Eheberatungsstelle und der Berater Fröde, der Jurist der Rechtsberatung in Reinickendorf, bezeichnete sich als von Amts wegen verpflichtet, die Parteien zunächst aufzufordern, ihren Streit schiedlich-friedlich zu lösen.⁸⁷⁸ „Die oberste Verpflichtung jeder Eheberatungsstelle ist, den Partnern bei der Beseitigung von Spannungen zu helfen, zu versuchen, diese zu überbrücken und schliesslich die Harmonie in der Ehe herzustellen.“⁸⁷⁹ Er wollte, dass Ratsuchende in ihrer Ehe glücklich waren.⁸⁸⁰ Dies bezeichnete er gar als das eine Ziel, dass die Eheberater verfolgten: „Die Wiederherstellung einer ungetrübten glücklichen Lebensgemeinschaft.“⁸⁸¹ Damit ging Frödes Verständnis von Beratung
Vgl. Fröde, Dienstbescheinigung, 29. September 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 212. Vgl. Dämpfert, Bescheinigung, 15. November 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 223. Vgl. z. B. Fröde an K., Brief, 3. August 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 220 sowie Leppin, Vermerk, 4. Januar 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 219. Lemke: Jahresbericht 1956/1957 der Eheberatung, 29. Mai 1957, LAB, B Rep. 220, Nr. 1686. Vgl. z. B. [Kurt] Schulze-Danneberg, Aktennotiz, 28. Dezember 1950, LAB, B Rep. 220, Nr. 208 sowie [Kurt] Schulze-Danneberg, Aktennotiz, 29. Dezember 1950, LAB, B Rep. 220, Nr. 208. Vgl. z. B. E. U. an [Kurt] Schulze-Danneberg, Brief, 26. Januar 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 213 sowie [Kurt] Schulze-Danneberg an E. U., Brief, 8. März 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 213. Vgl. z. B. [Kurt] Schulze-Danneberg an I. H., Brief, [1952], LAB, B Rep. 220, Nr. 213 sowie E. U. an [Kurt] Schulze-Danneberg, Brief, 5. Juni 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 213. S. Fröde an H. S., Brief, 29. September 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 217. Fröde an E. B., Brief, 27. März 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 216. Vgl. Fröde an W. F., Brief, 31. Oktober 1957, LAB, B Rep. 220, Nr. 217. Fröde an J. C., Brief, [April 1955], LAB, B Rep. 220, Nr. 199.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
207
deutlich über die Vorschriften der Rechtsberatung hinaus. Diese geben eine Schlichtung zwar als erstrebenswert an, jedoch nicht als verpflichtend.⁸⁸² Fröde kann als engagierter Berater beschrieben werden, der mit einem ausgeprägten Expertengestus der Rationalität an die Eheberatung heranging und daran glaubte, dass in nahezu allen Fällen eine sachliche Konfliktlösung möglich war. Die Intention, wieder eine harmonische Ehe herzustellen, zeigt die Ausrichtung der Beratung in Reinickendorf als Krisenberatung. Dem fühlten sich die Berater umso mehr verpflichtet, sofern minderjährige Kinder involviert waren.⁸⁸³ Ein Eheideal im engeren Sinne formulierten sie nicht, es lassen sich jedoch Hinweise darauf finden. Fröde betrachtete die Ehe als unverbrüchliche Lebensgemeinschaft.⁸⁸⁴ Bei jüngeren Paaren erwähnte er das Ideal einer, wie es zeitgenössisch hieß, Ehekameradschaft.⁸⁸⁵ Gegenseitige Liebe und Liebe zu den Kindern stellten die Grundlage der Ehe dar.⁸⁸⁶ Differenzen, die sich Frödes Ansicht nach zwangsläufig ergäben, sollten die Partner durch den Willen zur Verständigung und gegenseitigen Rücksichtnahme aufarbeiten.⁸⁸⁷ Ein anderer Eheberater ging davon aus, dass Missverständnisse aufträten, „da bekanntlich die Psyche einer Frau gänzlich anders ist als die eines Mannes“.⁸⁸⁸ In erster Linie waren die Eheleute sich gegenseitig verpflichtet, das Verhältnis zu Verwandten musste dahinter zurücktreten.⁸⁸⁹ Eine Ehescheidung war nur dann gerechtfertigt, wenn „wirklich ernste Gründe“ vorlagen.⁸⁹⁰ Die gesetzliche Basis der Beratungsstelle bildete einen wichtigen Pfeiler im Selbstverständnis der Berater. Diese sahen sich berechtigt und verpflichtet, bei Ehedifferenzen, die ihnen zur Kenntnis gelangten, zu schlichten – sofern sie darum gebeten wurden.⁸⁹¹ Die Beratung war dabei nicht nur für die Verheirateten da, sondern erfüllte wie die Ehe selbst eine staatliche Aufgabe. Fröde schrieb an einen Ratsuchenden: „Der heutige Staat legt mit grösserer Eindeutigkeit wieder Wert auf eine normale Ehe, in der sich beide Partner darüber völlig im klaren sind, dass es für sie nicht nur Rechte, sondern auch gemeinsame Pflichten gibt.“⁸⁹² Verhielten die
Vgl. Kapitel 3.6 Fallstudie. Vgl. z. B. Fröde an G. S., Brief, 12. Oktober 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 211 sowie Fröde, Vermerk, 15. Oktober 1957, LAB, B Rep. 220, Nr. 218. Vgl. Fröde an W. F., Brief, 3. Oktober 1957, LAB, B Rep. 220, Nr. 217. Vgl. Fröde, Vermerk, 20. Dezember 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 212. Vgl. Fröde an H. B., Brief, 7. September 1954, H. B., LAB, B Rep. 220, Nr. 197. Vgl. Fröde an H. B., Brief, 21. September 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 197. [Kurt] Schulze-Danneberg an W. W., Brief, 20. August 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 214. [Kurt Schulze-Danneberg], Aktenvermerk, 11. März 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 207. Fröde an G. S., Brief, 12. Oktober 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 211. Vgl. Fröde an G. P., Brief, 28. Januar 1955, LAB, B Rep 220, Nr. 209. Fröde an E. B., Brief, 27. März 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 216.
208
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Ratsuchenden sich nicht entsprechend, ging der Berater davon aus, dass sie sich über diese Rechte und Pflichten nicht im Klaren waren.⁸⁹³ Fröde war der Ansicht, dass die Ehegatten selbst über ihren weiteren Lebensweg entscheiden müssten.⁸⁹⁴ Diese zunächst liberal anmutende Haltung war jedoch mit der Gewissheit verknüpft, juristisch im Vorteil zu sein: „Sollte nun ein Teil uneinsichtig sein, so ist es nicht unsere Aufgabe, weiter den betreffenden Ehepartner mit Schreiben zu einem schiedlich-friedlichen Ausgleich zu bringen, sondern wir müssen ihn dann pflichtgemäss auf die rechtlichen Folgen aufmerksam machen.“⁸⁹⁵ Gleichzeitig bestand Fröde darauf, dass die Partner versuchen sollten, sich zu versöhnen. Erst wenn er für einen Ausgleich keine Möglichkeit mehr sah, überließ er es laut eigener Aussage den Parteien, ihre Scheidung zu betreiben.⁸⁹⁶ Allerdings zeigt die Praxis, dass er dies nicht immer einhielt. Als beispielsweise nach einer Beratung der eingeschaltete Rechtsanwalt die Einschätzung abgab, „dass irgendwelche Versuche schiedlich-friedlicher Lösung des Ehestreits in jedem Falle erfolglos sein müssen, weil mein Mandant die Ehe unter keinen Umständen fortzusetzen beabsichtigt“,⁸⁹⁷ stimmte der Jurist ihm zu. Dennoch forderte er den Ehemann erneut auf, zu seiner Frau zurückzukehren.⁸⁹⁸ Die Beratung trug teilweise patriarchal-autoritäre Züge, denn die Vorschläge zur Schlichtung waren über jeden Zweifel erhaben. Die Berater waren überzeugt, dass die Besucher es später bedauern würden, wenn sie mit einer negativen Einstellung ins Gespräch gingen. „Sie werden die Erfahrungen machen, dass es uneinsichtige Menschen gibt, die den Eheberatern – mögen es Ärzte, Juristen oder Fürsorger sein – Schwierigkeiten machen, die sie später bereuen.“⁸⁹⁹ Daher erwarteten sie Einsichtigkeit, auch bezüglich des Vorgehens. Ratsuchende sollten das Diktum der Experten als absolut ansehen. Fröde verlangte, „dass die Mahnung zu einer Versöhnung […] einer ernsten Prüfung unterzogen wird“.⁹⁰⁰ Denn „[w]ir haben Sie bisher gut und richtig beraten. Es tut uns doch leid, wenn Sie […] Fehlentscheidungen treffen, die Sie nur mit Kosten belasten […]. Dazu sind wir eben da, um durch unseren Rat unsere minderbemittelten Rechtsschutzsuchenden vor Schaden
Vgl. [Kurt] Schulze-Danneberg an B. L., Brief, 24. Mai 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 206. S. Fröde an J. B., Brief, 12. Januar 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 216. Fröde an B. K., Brief, 24. Mai 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 219. S. Fröde an H. S., Brief, 29. September 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 217.Vgl. auch Fröde an H. B., Brief, 7. September 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 197. H. S. an Fröde, Brief, 3. Oktober 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 217. Vgl. Fröde an H. S., Brief, 14. Oktober 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 217 sowie R. F. an Fröde, Brief, 14. Februar 1956, Brief, LAB, B Rep 220, Nr. 217. Fröde an E. B., Brief, 27. März 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 216. Ebd.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
209
zu bewahren. Wir wollen gar nicht, dass uns dafür ein ‚Dankeschön‘ gesagt wird, aber dass Sie es wenigstens einsehen, das können wir wohl erwarten.“⁹⁰¹ Gleichzeitig waren sich die Berater sehr wohl bewusst, wie dankbar ihnen Beratene waren und welche wichtige Rolle sie mit ihrer Bereitschaft zuzuhören spielten.⁹⁰² Berater wünschten, umfassende Hilfestellung zu geben, die über das Juristische hinausging. „Es ist bedauerlich, dass hin und wieder bei diesem wirklich schwierigen Amt, durch Uneinsichtigkeit mancher Ehepartner Schwierigkeiten bereitet werden. Für uns ist es viel schöner, in Frieden alle Differenzen zu beseitigen und Spannungen zu lösen, um damit eine glückliche Ehe wiederherzustellen, als dass wir uns lediglich auf die juristische Beratung beschränken.“⁹⁰³ Dieser Anspruch wurde in der Praxis sowohl aufgrund der generell schwierigen Lebenssituation von Ratsuchenden als auch des Verhaltens Einzelner als Herausforderung empfunden, die den Berater durchaus belastete. So formulierte Fröde gegenüber dem Vormund einer Ratsuchenden: Ich stelle Ihnen gern anheim, diese schwierige Aufgabe einmal in der Praxis zu exerzieren […]. Sie werden erleben, dass es eine Zumutung an die äusserst angespannten Nerven eines gewissenhaften Eheberaters ist, dem tagtäglich das seelische Leid „auseinandergelebter“ Eheleute gegenübertritt, wenn, anstatt auf die mahnenden sachlichen Vorschläge einzugehen, eine junge […] Ehefrau es sich erlaubt, auf ihren Ehepartner in dem Dienstraum einzuschlagen.⁹⁰⁴
Waren in den Augen der Berater die Grenzen der Beratungsmöglichkeiten erreicht, reagierten sie je nach Situation. Ein Ehepaar war in der gemeinsamen Aussprache so erregt, dass die involvierten Berater von einer temporär eingeschränkten Zurechnungsfähigkeit ausgingen. Sie brachen die Diskussion ab und forderten die Besucher auf, die Beratungsstelle zu verlassen.⁹⁰⁵ Ein anderes Mal informierten sie die Polizei über eine Beleidigung.⁹⁰⁶ Andere Fälle wurden an weitere Behörden überwiesen, oder die Eheberater baten diese um Mitarbeit.⁹⁰⁷ Frödes Selbstverständnis ging aus seinen Briefen an Ratsuchende deutlich hervor. Er betrachtete Sachlichkeit und juristische Objektivität als Grundlage seiner Fröde an J. B., Brief, 9. August 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 216. Vgl. z. B. Fröde an J. C., Brief, [April 1955], LAB, B Rep. 220, Nr. 199 sowie Fröde, Vermerk, 12. Oktober 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 216. Fröde an B. K., Brief, 20. März 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 219. Fröde an E. B., Brief, 27. März 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 216. Vgl. auch [Kurt] Schulze-Danneberg an Sozialamt, Brief, 29. März 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 202. Vgl. [Kurt Schulze-Danneberg], Aktenvermerk, 14. Januar 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 213. Vgl. Bezirksstadtrat an Polizeidirektion, Brief, 9. September 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 208. Vgl. z. B. [Kurt] Schulze-Danneberg an Sozialamt, Brief, 29. März 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 202 sowie Beratungsstelle für Nerven- und Gemütskranke: Protokoll, 20. April 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 209.
210
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Arbeit. Sein Bestreben war, die Eheleute „in der objektivsten Weise […] auf die tatsächliche Rechtslage hinzuweisen und […] beiden Eheleuten in sachlich gerechtfertigter Weise [zu] helfen“.⁹⁰⁸ Hingegen lehnte er es ab, individuelle Forderungen zu erheben, die vor Gericht keinen Bestand haben könnten.⁹⁰⁹ Fragen beantwortete er nach eigener Einschätzung objektiv, wie es dem juristischen Zuschnitt der Beratungsstelle entsprach.⁹¹⁰ Dass die Berater als Außenstehende eine Ehe gleichzeitig kaum objektiv beurteilen konnten, musste er jedoch selbst zugeben. Der dennoch grundlegende Anspruch, objektiv zu sein, hinderte die Berater allerdings nicht daran, ihre anschließende Bewertung zu kommunizieren – beispielsweise, wenn sie ein bestimmtes Verhalten missbilligten: „[S]o dürfte es jetzt wirklich bei der großen Notlage, in der sich Ihre Frau befindet, unangemessen sein, ihr noch Schwierigkeiten zu machen.“⁹¹¹ Das Urteil war deutlich: „Es ist daher unverständlich, dass Sie nach Entlassung aus der Gefangenschaft es nicht für notwendig erachtet haben, sich auch nur ein einziges Mal nach Ihrer Familie zu erkundigen. Dies hat naturgemäss dazu geführt, dass wahrscheinlich der Sohn heute eine Ihnen [gegenüber] feindliche Einstellung einnehmen dürfte.“⁹¹² Neben Sachlichkeit war es Fröde auch wichtig, zugewandt zu sein. „Deshalb legen wir grössten Wert darauf, unsere Eheberatungsstelle so zu besetzen, dass […] Menschen, die die Beratung durchführen, ein warmes Verständnis für durch […] Spannungen ausgelöste innere Beunruhigung der beiden Ehepartner haben.“⁹¹³ Fröde machte seinen Anspruch auf Objektivität häufig bereits in Anschreiben an die Partner der Ratsuchenden deutlich. Damit suchte er sie zu überzeugen, in die Eheberatung zu kommen und Vertrauen aufzubauen. Die Gespräche sollten nicht nur demjenigen dienen, der als Erstes erschienen war: „[W]ir bitten Sie, uns in Ihrem Interesse baldigst aufzusuchen, damit wir auch Ihnen behilflich sein können, die früher doch zweifellos glückliche Ehe wiederherzustellen […]. Dazu gehört, dass beide Teile Vertrauen zu uns gewinnen und sich objektiv hier beraten lassen.“⁹¹⁴ Auch drückte er sein Bedauern über Eheprobleme aus. Gleichzeitig legte er häufig bereits im Anschreiben kurz die Rechtslage dar. Aus diesen Zeilen wird durchaus deutlich, dass ein Nichterscheinen rechtliche Schritte nach sich ziehen würde. Doch das seien „alles Dinge, über die wir am besten persönlich sprechen, damit gerichtliche, kostspielige Auseinandersetzungen, die beide Teile nicht nur seelisch
Fröde an G. R., Brief, 30. November 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 221. Vgl. ebd. Vgl. Fröde an F. L., Brief, 19. Oktober 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 221. Fröde an F. S., Brief, 27. Juli 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 212. [Kurt] Schulze-Danneberg an W. W., Brief, 17. Mai 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 214. Fröde an R. P., Brief, 5. November 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 209. [Fröde] an L. B., Brief, 2. April 1957, LAB, B Rep. 220, Nr. 216.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
211
belasten, sondern auch Ihnen unnützes Geld kosten, vermieden werden“.⁹¹⁵ Sofern Betreffende sich uneinsichtig zeigten, betonte Fröde die drohenden rechtlichen Folgen nochmals. Es „geht […] natürlich nicht so, dass Sie sich nun derart ablehnend gegen eine vom Gesetz eingerichtete Stelle, und zwar die Eheberatungsstelle, verhalten […]. [Es] liegt uns die Verpflichtung ob, einen für beide Teile gerechten Ausgleich anzustreben. Wenn Sie uns dabei nicht unterstützen wollen, was wir aber nicht annehmen, so müssten Sie die Konsequenzen schon tragen.“⁹¹⁶ Dabei zeigte Fröde diese Konsequenzen, welche die Betreffenden vermutlich vermeiden wollten, konkret auf. Einigen Schreiben liegt damit eine gewisse Drohung zugrunde. Unsere Erfahrungen lehren, dass beide Ehepartner für diesen wohlgemeinten Rat, der sich auf langjährige Übung stützt, sehr dankbar sind, und sie bereuen sehr, wenn sie den Ratschlag nur leicht aufgefasst haben, etwa mit dem Hinweis, dass es sich ja nur um eine Beratung handelte. Wir sind natürlich verpflichtet[,] wenn wir sehen, dass die notwendige Einsicht fehlt, dann auch unsere Bemühungen einzustellen und die weitere Verfolgung der Angelegenheit den gerichtlichen Instanzen zu überlassen. Wir haben Ihnen so offen geschrieben, weil […] Sie als Beamter entscheidenden Wert darauf legen, möglichst diese bedauerlichen ehelichen Differenzen nicht zur Kenntnis Ihrer Dienststelle kommen zu lassen, was ja bei einer Unterhaltspfändung notwendig wäre.⁹¹⁷
Der Verweis, dass ein Nichterscheinen in der Beratung berufliche Auswirkungen haben konnte, findet sich in erster Linie bei Beamten oder Akademikern.⁹¹⁸ Damit stellte sich Fröde selbst als objektiver Berater dar, der beide Seiten vertrat, aber das Recht durchsetzte. Seine Einrichtung beschrieb er dabei wie folgt: „Unsere Rechtsberatungsstelle ist weit über den Rahmen Reinickendorfs hinaus dafür bekannt, dass sie Höflichkeit und Sachlichkeit in ihrer Arbeit und in ihren Schreiben an erste Stelle stellt.“⁹¹⁹ Sämtliche Eheberater informierten die Verheirateten jeweils über die Ansicht des anderen, sandten Briefe in Durchschrift auch an den nicht angeschriebenen Partner und ließen sich Schriftstücke als gelesen gegenzeichnen.⁹²⁰
Ebd. Fröde an P. D., Brief, 11. August 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 199. Fröde an A. W., Brief, 8. Dezember 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 223. Vgl. z. B. Fröde an P. D., 11. August 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 199 sowie Fröde an K. Z., Brief, 17. November 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 223. Fröde an H. S., Brief, 11. April 1957, LAB, B Rep. 220, Nr. 218. Vgl. z. B. [Kurt] Schulze-Danneberg, an F. S., Brief, 7. Mai 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 212 sowie Fröde an W. L., Brief, 23. Juli 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 206.
212
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Nicht alle Anschreiben Frödes waren gleich ausführlich.⁹²¹ Welche Kriterien kürzeren oder längeren Briefen zugrunde lagen, lässt sich anhand der vorliegenden Quellen nicht eruieren. Doch fällt auf, dass die anderen Berater sich in der Regel wesentlich kürzer fassten und häufig auf wenige Zeilen beschränkten: „Ihre Ehefrau hat sich wegen verschiedener Angelegenheiten ratsuchend an uns gewandt. Da die aufgetretenen Fragen auch für Sie von Interesse sind, bitten wir um Ihren Besuch.“⁹²² Sie forderten die Adressaten weniger dazu auf, die Beratungsstelle zu besuchen, sondern klärten sie teilweise lediglich über die Rechtslage auf.⁹²³ Während Fröde mehrmals zum Erscheinen aufforderte, gaben andere nach einem Versuch auf und äußerten, nichts mehr veranlassen zu können.⁹²⁴ Fröde hingegen war mindestens in einem Fall sogar unter seiner Privatadresse für Ratsuchende erreichbar.⁹²⁵ „Der große Erfolg, den die Ihnen ja als vorbildlich bekannte Eheberatungsstelle in Reinickendorf bisher in solchen Fällen erzielt hat, beweist die Notwendigkeit dieser gesetzlich fundierten Institution.“⁹²⁶ Ob die Beratungseinrichtung tatsächlich objektiv als erfolgreich zu bezeichnen oder ob dies lediglich eine Wahrnehmung der dortigen Akteure war, lässt sich nicht eruieren. Statistische Angaben dazu fehlen und lassen sich aus dem vorliegenden Material nicht gewinnen. Auch zur Außenwahrnehmung, die Eheberatung sei vorbildlich, kann nichts gesagt werden. Indirekt involvierte Dritte wie Zeugen oder Verwandte der Ratsuchenden erkannten die Bemühungen der Eheberater allerdings durchaus an.⁹²⁷ Die Berater schätzten die Gespräche mit den Betroffenen teilweise subjektiv anders ein als diese selbst. So musste Fröde in einigen Fällen durchaus feststellen, dass seine Bewertung der Situation oder der Beratenen nicht zutraf. Beispielsweise äußerte er sich erstaunt, als ein Ehemann einen Rechtsanwalt engagierte, nachdem doch „eine – man könnte fast sagen freundschaftliche – Aussprache“ mit ihm
Vgl. z. B. Fröde an P. D., Brief, 24. Juni 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 199 sowie Fröde an W. G., Brief, 27. April 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 201. [Kurt] Schulze-Danneberg an A. N., Brief, 3. Januar 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 208. Vgl. z. B. [Kurt] Schulze-Danneberg an H. C., Brief, 30. März 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 199. Kuntze an W. K., Brief, 13. Juli 1950, LAB, B Rep. 220, Nr. 196. Vgl. z. B. Fröde an G. P., Brief, 28. Januar 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 209 sowie Casparius an W. K., Brief, 5. Dezember 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 220. Vgl. C. G. an Fröde, Brief, 13. April 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 217. Fröde an H. S., Brief, 29. September 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 217. Vgl. z. B. F. M. an Fröde, Brief, 27. Februar 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 209 sowie W. K. an Bezirksamt, Brief, 6. August 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 220.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
213
stattgefunden habe.⁹²⁸ Auch verwahrte er sich gegen vorwurfsvolle Reaktionen nach dem Gespräch.⁹²⁹ In der Beratung zeigten sich aus verschiedenen Gründen Grenzen. Möglich war, dass Betroffene sich verweigerten, aber auch, dass Berater sich zurückzogen. Lehnten Ratsuchende oder Angeschriebene die Beratung oder die Ratschläge ab, zeigte dies Fröde und seinen Kollegen die Grenzen ihres Einflusses. Insbesondere Fröde versuchte zwar, diese Hürde zu überwinden, indem er wiederholt zur Rücksprache aufforderte, Appelle an die Ratsuchenden richtete oder Erklärungen gab, womit er jedoch nur teilweise erfolgreich war. In einigen Fällen war es wegen bestimmter Umstände wie Erkrankungen auch nicht möglich, zu helfen. Aber die Berater zogen auch selbst Grenzen. Sie verbaten sich etwa Respektlosigkeit: in Anschreiben, aber auch, indem sie Anzeige erstatteten oder die Betroffenen der Einrichtung verwiesen. Beratungssituationen wurden somit von Beratern als auch Ratsuchenden gestaltet. Galten die Verheirateten aber auch als eigenständige Akteure? Die Antwort darauf zeigt Ambivalenzen. Einerseits erwarteten die Berater von den Betroffenen, Entscheidungen für sich und ihre Ehe zu fällen. Andererseits sollten Einsichten und Verhalten mit den Vorstellungen des Beraters konform sein. War dies nicht der Fall, löste es Erstaunen aus und hatte Ermahnungen zur Folge. Besucher waren in Frödes Augen Personen, die einen Rat empfingen und sich im Grunde adäquat verhalten sollten. Waren sie nicht gewillt, in seinem Sinne zu handeln, sah er zwangsläufig negative Konsequenzen auf sie zukommen. Um diese abzuwenden, engagierte sich der Jurist mehr als andere Berater, auch stärker als vorgeschrieben, und übertrat teilweise seine eigenen Vorstellungen beziehungsweise Grenzen, wann Versöhnungsversuche enden sollten. Zwar suchte er seinem Verständnis nach objektiv zu handeln, doch wird auch deutlich, dass er in der Praxis teilweise durchaus Sympathien oder Antipathien erkennen ließ.
3.6.2 Blick der Ratsuchenden auf Berater und Beratung In der Beratungssituation traten die Ratsuchenden als selbstbewusste Akteure und Vertreter ihrer eigenen Interessen hervor. Dies spiegelt sich sowohl in den von ihnen verfassten Egodokumenten als auch indirekt in Äußerungen der Berater.
Fröde an F. L., Brief, 19. Oktober 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 221. Vgl. auch [Fröde] an H., Brief, 28. Januar 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 219. Vgl. Fröde an J. B., Brief, 9. August 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 216 sowie Fröde an G. R., Brief, 30. Oktober 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 221.
214
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
„Citizens make their views about social services known when they use or avoid them, when they accept, reject, or seek out their […] benefits, or when they actively oppose them“, konstatiert Timm im Zusammenhang mit einem anderen Thema, der Bevölkerungspolitik.⁹³⁰ Damit beschreibt sie eine Ermächtigung der Bürger, die von Zielobjekten dieser Politik zu Akteuren wurden. Ihre Beobachtung ist auch auf das Verhältnis von Eheberatern und Ratsuchenden anwendbar. Ratsuchende waren der Ansicht, eine Ehe basiere auf Achtung und Vertrauen.⁹³¹ Eheleute sollten eine Lebensgemeinschaft bilden,⁹³² seelischen und geistigen Kontakt zueinander pflegen sowie eine gemeinsame Wertebasis haben.⁹³³ Männer sagten zudem, dass körperliche Liebe sie an ihre Frau binde.⁹³⁴ Ein Mann, dessen Eltern Fröde beriet, beschrieb die von ihm ausgesprochen negativ betrachtete Ehe seiner Eltern und folgerte: „Mein Bestreben war deshalb immer gewesen […] selbst eine Ehe unter anderen Verhältnissen zu führen.“ ⁹³⁵ Im Gegensatz zu seinen Eltern habe er mit seiner Ehe wirklich das große Los gezogen […], weil meine Frau ein wirklicher Ehekamerad und eine tüchtige Hausfrau ist. Ich stehe keineswegs unter dem Pantoffel, bin aber auch selber kein Haustyrann. Wir haben eine Lebensgemeinschaft, wie man sie leider selten findet. Böse Worte sind bei uns selbst den Kindern gegenüber sehr verpönt, weil mir die Ehe meiner Eltern stets als abschreckendes Bild in Erinnerung ist.⁹³⁶
Damit schilderte er das zeitgenössische Ideal der Kameradschaftsehe. Die Ratsuchenden empfanden ihre Partnerschaft teilweise nicht einmal mehr als ein der Ehe ähnliches Verhältnis.⁹³⁷ Eine Frau sagte, für ihren Mann sei sie der nebensächlichste Mensch.⁹³⁸ Ratsuchende schilderten den Umgang miteinander als unfreundlich. Viele verspürten Einsamkeit.⁹³⁹ „Immer wieder frage ich: warum der Mann mich so schlecht behandelt[,], [warum] kommt er so oft betrunken nach
Timm, Politics, 210, S. 30. Vgl. C. L. an Bezirksamt, Brief, 25. Juni 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 206. K. G. an Fröde, Brief, 16. Februar 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 201. Vgl. W. K. an Bezirksamt, Brief, 6. August 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 220. Vgl. R. P. an Fröde, Brief, 18. November 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 209. Vgl. z. B. Fröde, Protokoll, 12. Oktober 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 198 sowie G. P., Aufzeichnung, Juli 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 209. W. K. an Bezirksamt, Brief, 6. August 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 220. Ebd. Vgl. C. G. an Fröde, Brief, 26. August 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 217. Vgl. R. K. an [Casparius], Brief, 3. November 1958, LAB, B Rep 220, Nr. 220. Vgl. z. B. R. P. an Fröde, Brief, 18. November 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 209 sowie Fröde, Vermerk, 20. Dezember 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 212.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
215
Hause[,] ist er nicht ehrlich zu mir[,] hält er nicht das Wort, daß er vor dem Altar gegeben hat.“⁹⁴⁰ Eheprobleme belasteten die Betroffenen stark. Sie litten unten den Auseinandersetzungen selbst, aber auch unter der damit einhergehenden Unsicherheit, was die eigene Lebenssituation anging. Ihr Leidensdruck war sowohl ihnen selbst als auch den Beratern bewusst.⁹⁴¹ Teilweise waren körperliche und psychische Probleme die Folge. „Ich habe die Wohnung verlassen um Ruhe zu haben, um Gesund [sic] zu bleiben, den[n] ich möchte ungern in einer Nervenheilanstalt enden. Ich bitte höflichst mir diese zu gönnen.“⁹⁴² Ein anderer Brief enthielt die Klage: „Meine Gesundheit leidet unter diesen ewigen Hetzereien […]. In mir ist alles erstorben.“⁹⁴³ Die Belastung konnte so stark werden, dass Betroffene Selbstmordgedanken äußerten.⁹⁴⁴ Auch Kinder litten unter den Auseinandersetzungen ihrer Eltern, teilweise auch aufgrund bewusst gegen sie gerichteter Lieblosigkeit oder unter Aggressionen, mit denen der Ehepartner indirekt bestraft werden sollte.⁹⁴⁵ Nur wenige Ratsuchende betrachteten die Gesamtsituation kritisch und suchten nach dem eigenen Anteil an den Ehekonflikten. Eine Frau befand, es hätte manches vermieden werden können, wenn sie und ihr Mann einander mehr vertraut hätten.⁹⁴⁶ Ratsuchende wandten sich an die Eheberatung, da sie hofften, ihre Situation verbessern zu können, entweder in finanzieller oder emotionaler Hinsicht. Die meisten wollten sich trotz teilweise schwieriger Umstände außergerichtlich mit ihrem Ehepartner einigen, was dem Aufgabenverständnis der Berater entgegenkam. Betroffene kommunizierten diesen Willen auch explizit. „Wir bemerken, dass Ihre Ehefrau den allergrössten Wert darauf legt, ohne Inanspruchnahme des Gerichtes sich in Güte mit Ihnen zu einigen […]. Wir hoffen schon aus diesem Grunde, dass Sie unserer Bitte umgehend nachkommen werden.“⁹⁴⁷ Viele Ratsuchende sa-
G. S. an Fröde, Brief, 20. Juni 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 211. Vgl. z. B. [Charlotte] Leppin, Vermerk, 4. Januar 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 219 sowie H. W. an Amtsvorsteher des […]amtes, Brief, 10. September 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 223. W. L. an Bezirksamt, Brief, 1. August 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 206. A. S. an [Fröde], 3. November 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 212. Vgl. z. B. G. P.: Aufzeichnung, Juli 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 209 sowie S. an K. [S.], Brief, [1955], LAB, B Rep. 220, Nr. 212. Vgl. z. B. Jugendamt an Rechtsberatung, Bericht, 11. Oktober 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 202 sowie Fröde, Vermerk, [19. März 1958], LAB, B Rep. 220, Nr. 217. Vgl. H. B. an Fröde, Brief, 13. September 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 197. Fröde an H. N., Brief, 20. Juli 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 208.Vgl. auch Fröde an W. G., Brief, 27. April 1954, LAG, B Rep. 220, Nr. 201.
216
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
hen die Ursache ihrer Probleme nur beim anderen.⁹⁴⁸ Selten gestanden beide Partner eine gemeinsame Schuld ein.⁹⁴⁹ Auch das Gesundheitsamt würdigte Fröde als besonders engagiert. Eine Ratsuchende formulierte selbst, sie nehme ihn über jedes dienstlich zulässige Maß in Anspruch.⁹⁵⁰ Dankesschreiben charakterisieren ihn zudem als anteilnehmend, hilfsbereit und fachlich kompetent. Frödes Umgang mit Besuchern löste bei einer Frau freudiges Erstaunen aus. Offenbar hatte sie nicht damit gerechnet, in der Rechtsberatungsstelle so freundlich behandelt zu werden. Ich war zuerst erstaunt und dann sehr angenehm berührt u. erfreut über die sehr entgegenkommende, hilfsbereite Art des Herrn Dr. Fröde. Man hat in seiner Gegenwart sofort ein beruhigendes Gefühl u. das Bewusstsein, dass man einem Menschen gegenübersitzt, dem man ganz unverblümt all seine grossen u. kl. Nöte u. Sorgen […] vortragen kann. Ich bin darüber sehr froh u. zufrieden u. Herrn Dr. Fröde sehr sehr dankbar dafür.⁹⁵¹
Darüber hinaus hatte die Besucherin von anderen gehört, die Frödes Fachkompetenz sowie entgegenkommende Art schätzten.⁹⁵² Weitere Ratsuchende beschrieben den Juristen als zugewandt, darüber hinaus aber auch als schnellen und tatkräftigen Helfer. In einigen Fällen verwiesen sie explizit darauf, dass seine Beratung die Eheleute wieder versöhnt habe. Obwohl ich […] mit verschiedenen Amtsstellen in unserem Bezirk nicht zufrieden bin, möchte ich es nicht versäumen, eine der betreffenden Stellen zu loben. Gemeint ist Herr Dr. Fröde (Rechtsberatung), der mit seiner persönlichen Anteilnahme und guten Ratschlägen eine Ehe, die in die Brüche gehen wollte, wieder zusammenschmiedete. Ich möchte dieser amtl. Stelle und damit diesem Herrn hierdurch meinen Dank aussprechen.⁹⁵³
Auch einem weiteren Berater sowie der Sekretärin wurde Dank zuteil.⁹⁵⁴ Viele Ratsuchende nahmen die Gespräche als positiv wahr.⁹⁵⁵ Auch während der Beratungen bedankten sie sich bereits. Sie betonten, sonst niemanden zum Reden zu
Vgl. z. B. W. S. an Landgericht, Klage, 20. Juli 1951, LAB, B Rep 220, Nr. 211 sowie P. S. an Landgericht, Klageabweisung, 8. August 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 211. Vgl. z. B. H. B. an Fröde, Brief, 13. September 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 197 sowie G. J. an Bezirksamt, Brief, 22. Februar 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 219. S. C. G. an Fröde, Brief, 11. Mai 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 217. E. H. an Bezirksbürgermeister, Brief, 7. Mai 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 219. Vgl. ebd. W. K. an Bürgermeister, Brief, 1. Mai 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 220. Vgl. z. B. E. H. an Bezirksbürgermeister, Brief, 7. Mai 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 219 sowie R. W. an [Kurt] Schulze-Danneberg, 6. Mai 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 214. Vgl. z. B. I. K. an Stadtrat, Brief, 31. Juli [1952], LAB, B Rep. 220, Nr. 219 sowie H. L. an Fröde, Brief, 30. August 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 220.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
217
haben, und wie sehr sie den Beratern vertrauten.⁹⁵⁶ Diese Wahrnehmung stimmte mit dem Selbstbild der Berater überein, die sich als Helfer verstanden. Jedoch zeichneten die Betroffenen weniger das Bild des vor allem auf Sachlichkeit, Objektivität und Höflichkeit bedachten Beraters, sondern lobten vielmehr Verhaltensweisen wie persönliche Anteilnahme und das Engagement. Dabei betrachteten sie die Eheberater teilweise als ihre Anwälte.⁹⁵⁷ Machten die Beratenen gute Erfahrungen, kamen sie mit erneuten Problemen oder anderen Rechtsfragen in die Rechtsberatung.⁹⁵⁸ Doch nicht alle Eheleute oder über die Beratungsstelle Angeschriebenen begrüßten die Arbeit. Eine Besucherin beschwerte sich über die für sie zuständige Fürsorgerin. Diese habe der Ehefrau gesagt, ihr Mann könne sie nicht betrogen haben, da er impotent sei. Sie reagierte empört darauf, dass die Eheberatung ihrem Mann offenbar eine Trennung nahegelegt hatte. Ich wurde mit Vorwürfen überhäuft so daß ich mich sehr aufregte […]. Ich bin der Meinung, daß man eine Ehefrau […] besonnener zu behandeln hat zumal, als Eheberaterin die möglichst versuchen soll eine Ehe wenn noch möglich ist wieder zusammen zu führen und nicht wie mein Mann mir sagt er sollte von der Eheberatungsstelle erlaubt bekommen, von mir getrennt zu leben. Ich glaube, daß ist […] nicht die richtige Instanz für solche Äußerung.⁹⁵⁹
Außerdem seien alle möglichen Personen hinter ihrem Rücken vorgeladen worden. Ein Urteil über einen Menschen zu fällen, der nicht anwesend sei und sich nicht verteidigen könne, sei jedoch falsch.⁹⁶⁰ Eine andere Frau empfand die Forderung des Eheberaters, ihrem Mann einen Versöhnungskuss zu geben, als übergriffig: „Sind Sie eigentlich eine Rechtsberatung oder ein Vermittlungsbüro?“⁹⁶¹ Eheberatung war längst nicht immer erwünscht, einige Besucher wollten sich auf Rechtsauskünfte beschränken. „Ich habe Ihnen schon einmal geschrieben, daß ich mich über Ihre Rechtsberatung sehr gewundert habe. Wir haben Ihre Beratung damals in Anspruch genommen, um von Ihnen eine Rechtsauskunft zu erhalten und weiter nichts.“⁹⁶² Einige Beratene waren zudem bereit, sich über Rechtsauskünfte
Vgl. z. B. C. G. an Fröde, Brief, 13. April 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 217 sowie Fröde, Vermerk, 12. Oktober 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 216. Vgl. z. B. R. P. an Kuntze, Brief, 6. Oktober 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 209 sowie R. K. an [Casparius], Brief, 3. November 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 220. Vgl. z. B. Fröde an O. S., Brief, 8. Februar 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 211 sowie [Rechtsberatung], Vermerk, 29. Januar 1957, LAB, B Rep 220, Nr. 219. K. G. an Fröde, Brief, 16. Februar 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 201. S. ebd. E. B. an Fröde, Brief, 13. März 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 216. Ebd.
218
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
hinwegzusetzen, die sie als unpassend empfanden.⁹⁶³ Sie verteidigten ihre eigenen Gefühle auch gegen die Ansicht des Eheberaters, beispielsweise wenn dieser Trennungsgründe für objektiv nicht gerechtfertigt hielt. „Ob die Gründe, die mich zu einer dauernden Trennung von meiner Frau veranlasst haben, objektiv gewichtig genug sind, um ggf. zu einer Scheidung zu führen, steht dahin. Für mich waren sie subjektiv gewichtig genug, nach langen und ernsthaften Überlegungen diesen Schritt zu vollziehen.“⁹⁶⁴ Betroffene setzten sich zur Wehr, wenn sie einem Urteil über ihre Ehe nicht zustimmten.⁹⁶⁵ In einem Fall betrachtete ein Berater eine Partnerschaft als so zerrüttet, dass mit der Herstellung einer dem Wesen der Ehe entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht mehr gerechnet werden könne. Er forderte das Paar auf, gemeinsam die Scheidung zu besprechen.⁹⁶⁶ Später erhielt er jedoch die Rückmeldung, das Paar habe sich versöhnt und die Scheidung sei hinfällig.⁹⁶⁷ Fröde war einmal mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er die Gefühle der Beteiligten nicht verstehen könne, da er nicht persönlich betroffen sei.⁹⁶⁸ Kritik gab es auch, wenn Ratsuchende den Eindruck gewannen, ihre Interessen würden ignoriert. „In Ihrem Schreiben […] wurden […] lediglich Standpunkte meiner Frau in Bezug auf die Wiederaufnahme der Ehe und meine Frage über ihre Ansicht für die Zukunft, bei Beibehaltung der Trennung wird überhaupt nicht eingegangen […]. Auf diese Art, wie es meine Frau vorhat, wird sich das Problem wohl kaum lösen lassen.“⁹⁶⁹ Beratene beschwerten sich zudem über eine ihrer Meinung nach zu kurze Sprechstunde. Eheberater könnten in dieser Zeit unmöglich ein klares Bild ihrer Situation bekommen. In einem Fall schilderte der Mann seine Lage daher ausführlich nochmals schriftlich.⁹⁷⁰ Andere gaben dem Eheberater bereits zu Beginn der Beratung schriftlich klar formulierte Forderungen, die durchzusetzen seien.⁹⁷¹ Ein besonders eindrückliches Beispiel dafür, dass Eheleute ihre eigenen Interessen vertraten, waren Versuche, Dritte zu ihren Gunsten in die Beratung zu involvieren. Dass sie Zeugen für die eigene Sichtweise benannten oder zur Unter Vgl. z. B. E. B. an Fröde, Brief, 11. August 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 216 sowie K. Z. an Fröde, Brief, 24. Oktober 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 223. Ebd. Vgl. C. L. an Bezirksamt, Brief, 25. Juni 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 206. S. [Kurt Schulze-Danneberg] an K. G., Brief, 22. April 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 201. S. Dt., Aktenvermerk, 30. April 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 201. S. H. N. an Fröde, Brief, 12. Oktober 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 208. R. F. an Fröde, Brief, 14. Februar 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 217. S. K. G. an Fröde, Brief, 16. Februar 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 201. Vgl. z. B. T. K. an Fröde, 11. Januar 1957, LAB, B Rep. 220, Nr. 220 sowie C. G. an Fröde, Brief, 23. August 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 217.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
219
stützung in die Beratung mitbrachten, war der häufigere Fall.⁹⁷² Doch gibt es auch Beispiele, Dritte außerhalb der eigentlichen Beratungssituation zu verpflichten, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Eine Ehefrau schrieb beispielsweise an den Vorgesetzten ihres Mannes, um diesen unter Druck zu setzen, seiner Unterhaltsverpflichtung nachzukommen: „Meine schwierige wirtschaftliche Notlage und die schmutzige Handlungsweise meines Mannes veranlasst mich, an Sie mit der Bitte heranzutreten, meinen Ehemann aufzufordern den mir fehlenden Unterhaltsbetrag […] unverzüglich zu zahlen um eine Unterhaltspfändung bei seiner Dienststelle und die damit verbundenen Weiterungen zu vermeiden!“⁹⁷³ Die Beispiele verdeutlichen, dass Ratsuchende klar ihre eigenen Interessen vertraten. Sahen sie ihr Anliegen nicht ausreichend gewürdigt, wiesen sie darauf hin. Ihre Erwartungen wichen zum Teil von den Vorstellungen des Beraters ab. War dies der Fall, handelten sie eigenständig und teilweise auch konträr zu dem, was der beratende Jurist empfahl oder verlangte. Einige Ehepartner lehnten die Aufforderung, in die Beratung zu kommen, ab. Dies galt nicht zwangsläufig als Verweigerung. Je nach Hintergrund nahmen die Berater auch an, dass sich die Angelegenheit zur Zufriedenheit der Beteiligten gelöst habe.⁹⁷⁴ Verschiedene Angeschriebene sprachen ihre Ablehnung offen aus, teilweise mit dem Hinweis, ihre Ehe sei ihre Privatangelegenheit: „Ihrer Bitte, zu einer persönlichen Rücksprache zu kommen, weil Sie zu einem klaren Bild gelangen wollen, bedauere ich, nicht entsprechen zu können. Ich sehe keine Veranlassung, mit Dritten über Eheangelegenheiten zu verhandeln.“⁹⁷⁵ Erschienen die Angeschriebenen nicht, fand keine Aussprache statt. Zwar versuchten die Berater, die Partner zu überzeugen, doch mussten sie sich zu ihrem Bedauern teilweise darauf beschränken, Rechtsvorschriften mitzuteilen.⁹⁷⁶ In den Quellen werden Ratsuchende in mehrfacher Hinsicht als Akteure sichtbar: indem sie die Beratungsstelle überhaupt aufsuchten und aufgrund ihres Handelns in der Beratungssituation selbst, aber auch darüber hinaus. Nach der Beratung verfolgten sie unter Umständen weitere juristische Schritte, waren mit-
Vgl. z. B. Fröde an F. M., Brief, 17. Februar 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 209 sowie [Fröde], Protokoll Eheberatung, 15. Juni 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 209. H. W. an Amtsvorsteher des […]amtes, Brief, 10. September 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 223. Vgl. auch K. G. an Fröde, Brief, 16. Februar 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 201. Vgl. z. B. [Kurt] Schulze-Danneberg an H. S., Brief, 15. Juli 1953, LAB, B Rep 220, Nr. 211 sowie Fröde an R. S., Brief, 27. Februar 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 222. K. H. an Bezirksamt Reinickendorf, Brief, 17. Januar 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 202. Vgl. auch B. K. an Bezirksamt, Brief, 5. März 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 219. Vgl. z. B. [Kurt] Schulze-Danneberg an K. H., Brief, 21. Januar 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 202 sowie Fröde an P. D., Brief, 11. August 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 199.
220
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
einander als Paar konfrontiert oder versöhnten sich. Einige versuchten Dritte sowohl innerhalb der Beratungssituation als auch danach einzubeziehen. Die Persönlichkeit der Berater bzw. ein Handeln, das über juristische Aufklärung hinausgeht, scheinen im vorliegenden Material hingegen seltener durch. Dies mag einerseits am juristischen Zuschnitt der Rechtsberatung gelegen haben, andererseits könnte es auch darauf zurückzuführen sein, dass die Berater ihre Rolle bewusst beschränkten, um nicht sich selbst, sondern Ratsuchende in den Vordergrund zu stellen.
3.6.3 Beratungsthemen Aus der Rechtsberatung in Reinickendorf liegt Material zu 470 Eheberatungsfällen im engeren Sinne vor.⁹⁷⁷ Der Zeitraum, in dem die Stelle mit diesen Fällen zu tun hatte, variierte zwischen einer einzelnen Beratung und dem Maximum einer Betreuungszeit von sieben Jahren.⁹⁷⁸ Über 70 Prozent der initial Ratsuchenden waren Frauen, 13 Prozent Männer. Diese Verteilung bestätigt bereits beschriebene Befunde der Arbeit, denen zufolge der Frauenanteil deutlich höher war. Dies könnte wenigstens im Fall der Rechtsberatung Reinickendorf damit zusammenhängen, dass Frauen bei Scheidungs- und Unterhaltsfragen in Partnerschaften oft benachteiligt waren. Sie hatten demnach ein größeres Interesse daran, zu verpflichtenden Regelungen zu kommen. Nur zwei Paare kamen von Beginn an gemeinsam in die Beratung.⁹⁷⁹ Da das Geburts- oder Heiratsjahr in den wenigsten Fällen angegeben wird, bleibt unbekannt, welches Alter die Ratsuchenden in der Regel hatten oder seit wann sie verheiratet waren. Nachweisen lässt sich jedoch, dass sämtliche Altersgruppen in die Beratung kamen. Die jüngsten Beratenen waren unter 20 Jahre und erst seit Kurzem verheiratet, die ältesten fast 80 Jahre und seit etwa 60 Jahren verheiratet.⁹⁸⁰ Die häufigsten Beratungsthemen stellten in absteigender Reihenfolge Unterhalt, Trennung und Scheidung, Sexualität sowie Alkohol- und Gewalterfahrungen dar. Darüber hinaus ging es auch um Erziehung und Verwandtschaftsbeziehungen,
Nicht mitgezählt und analysiert werden die Beratungen bereits Geschiedener, auch wenn diese in der Rechtsberatung teilweise als Eheberatung bezeichnet wurden. Vgl. z. B. Fröde, Protokoll, 25. Mai 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 202 sowie Quellen zu M. F. / H. F. 1951– 1958 in LAB, B Rep. 220, Nr. 217. Es bleibt eine Anzahl von Fällen, in denen sich nicht nachweisen lässt, wer zuerst zur Beratung erschien. Vgl. z. B. Fröde an E. B., Brief, 27. März 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 216 sowie T. K. an Fröde, Brief, [Juni 1957], LAB, B Rep. 220, Nr. 220.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
221
allerdings nur in 4 Prozent der Fälle, obwohl nachweislich mindestens 40 Prozent der Ratsuchenden Kinder hatten.⁹⁸¹ Themen wie „Mischehe“ oder Sexualität vor der Ehe, die andere Beratungsstellen und Eheratgeber als konflikthaft besprachen, kamen nur vereinzelt vor und wurden kaum problematisiert.⁹⁸² Auch die zeitgenössisch viel diskutierte Gleichberechtigung war lediglich in Einzelfällen Thema, was vermutlich mit dem spezifischen Charakter der Reinickendorfer Stelle als Rechtsberatung zu tun hatte. So erhielt beispielsweise eine Frau den Hinweis, nach Einführung der Gleichberechtigung dürfe nun auch ihr Mann einkaufen. Anderen Ratsuchenden wurde mitgeteilt, dass der Mann nicht mehr alleine den Wohnort bestimmen könne.⁹⁸³ Allerdings spielten Fragen der Gleichberechtigung und geschlechtlichen Rollenverteilung indirekt eine große Rolle in den Beratungen zum Unterhalt. Sparsam vertreten war die innerhalb der allgemeinen Beratungsarbeit viel diskutierte Notwendigkeit, sich von Vater oder Mutter zu lösen. So äußerte sich ein Eheberater: „Der Ehemann wurde darauf hingewiesen, dass er sich in erster Linie um die Interessen und Belange seiner Frau zu kümmern habe und dass seine Mutter im Hintergrund stehen muss.“⁹⁸⁴ Obwohl Eugenik in der DAJEB stark präsent war, findet sich in den Akten lediglich eine Anfrage mit der Absicht, über eugenische Argumente eine Scheidung zu begründen. Der Berater ging jedoch nicht darauf ein.⁹⁸⁵ In einem weiteren Fall gibt es Hinweise auf eugenisches Gedankengut, die mit den beschriebenen Eheproblemen aber nichts zu tun hatten. Die Ratsuchenden verfolgten das ebenso wenig weiter wie der Eheberater: Nach Angaben des Herrn […] sind es nur Nichtigkeiten, die zu der Trübung der Ehe geführt haben. Er habe erst jetzt erfahren, dass die Mutter seiner Ehefrau einmal vorübergehend in einer Heilstätte gewesen sei. Auch sei in der Familie der Ehefrau ein Geisteskranker gewesen,
Vgl. z. B. Jugendamt an Rechtsberatung, Bericht, 11. Oktober 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 202 sowie P. S. an [Eheberatung], Brief, [März 1958], LAB, B Rep. 220, Nr. 215. Die Religionszugehörigkeit der Ratsuchenden lässt sich nur in einzelnen Fällen bestimmen, da sie nicht systematisch erfragt wurde. In der Mehrheit scheinen Ratsuchende evangelisch gewesen zu sein. Vgl. z. B. Klageschrift an Landgericht, 13. April 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 207 sowie G. S. an Fröde, Brief, 20. Juni 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 211. Zu Religion als Problematik vgl. [Rechtsberatung], Vermerk, 23. Mai 1957, LAB, B Rep. 220, Nr. 222. Zu vorehelicher Sexualität vgl. Aktenvermerk, 25. März 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 197 sowie G. P., Aufzeichnung, Juli 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 209. Vgl. z. B. Fröde, Protokoll, 19. April 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 203 sowie [Kurt] Schulze-Danneberg an C. L., Brief, 7. August 1953, LAB, B Rep. 220, Nr. 198. [Kurt Schulze-Danneberg], Aktenvermerk, 11. März 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 207 sowie Fröde, Protokoll, 7. September 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 215. Vgl. F. S. an [Kurt] Schulze-Danneberg, Brief, 27. April 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 212 sowie [Kurt] Schulze-Danneberg an F. S., Brief, 7. Mai 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 212.
222
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
ein anderer Verwandter habe sich aufgehangen. Die Eheleute haben sich vor drei Jahren zwei bis drei Mal geschlagen. Jetzt sei das nicht mehr vorgekommen.⁹⁸⁶
Diese geringe Anzahl an Fällen verwundert, da die Rechtsberatung zum Gesundheitsamt gehörte. Andererseits ist es möglich, dass eugenische Fragestellungen direkt in der medizinischen Beratung des Gesundheitsamtes diskutiert wurden. Zur Eheberatung zählte auch die Verlobtenberatung, die jedoch lediglich 3 Prozent der vorliegenden Fälle ausmacht.⁹⁸⁷ Dabei handelte es sich nicht, wie von der DAJEB oder anderen Beratungsstellen anvisiert, um ehevorbereitende Gespräche, sondern vor allem um Rechtsfragen, wie das Zusammenleben der Verlobten durchgesetzt werden könnte.⁹⁸⁸ 3.6.3.1 Unterhalt und Haushalt In den Beratungen wird die Aufgabenverteilung innerhalb der Ehe deutlich. Männer sorgten für Frau und Kinder durch finanziellen Unterhalt, Frauen für Mann und Kinder, indem sie den Haushalt und die Erziehung übernahmen. Es liegen Einzelfälle vor, in denen Frauen offenbar von ihren Ehemännern erwarteten, dass diese mehr verdienen sollten.⁹⁸⁹ In der Regel handelte es sich jedoch um Auseinandersetzungen wegen zu geringer Unterhaltszahlungen. Sowohl während der Ehe als auch nach Scheidungen suchten Ehemänner Unterhaltsansprüchen zu entkommen, indem sie innerhalb Deutschlands den Wohnort wechselten oder sich im Ausland niederließen. Insbesondere nach einem Umzug ins Ausland waren die Ansprüche nur schwer oder gar nicht durchzusetzen, was die Frauen teilweise in große Notlagen brachte.⁹⁹⁰ Bei fast 70 Prozent der aus der Eheberatung erhaltenen Fälle, dem prozentual größten Anteil, spielten Konflikte um Unterhaltszahlungen beziehungsweise Haushaltsgeld eine Rolle. Allerdings war dies häufig nicht der einzige Streitpunkt, weitere offenbarten sich meist in der Beratung.Wohnten die Männer in Berlin, gelang es meist, die Unterhaltspflichten durchzusetzen; teilweise sofort, teils jedoch erst nach längerer Diskussion oder über Gerichtsurteile.⁹⁹¹ Im vorliegenden
Fröde, [Vermerk], 30. Juli 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 201. Die vor dem Aufsuchen der Beratung bereits gelösten Verlobungen sind in die Auswertung nicht mit aufgenommen. Vgl. z. B. Fröde an W. W., Brief, 22. Mai 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 219 sowie H. B. an Rechtsberatung, Brief, 2. Februar 1957, LAB, B Rep. 220, Nr. 216. Vgl. z. B. W. K. an Bezirksamt, Brief, 6. August 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 220 sowie G. J. an Bezirksamt, Brief, 22. Februar 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 219. Zu Unterhaltszahlungen an geschiedene Frauen vgl. Niehuss, Familie, 2001, S. 103 ff. Vgl. z. B. Fröde an W. L., Brief, 23. Juli 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 206 sowie Fröde, Vermerk, März 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 219.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
223
Material ist nur ein Fall zu finden, in dem die Ehefrau ihrem Mann zu Unterhalt verpflichtet gewesen wäre.⁹⁹² In der Regel sind keine Aussagen der Ehemänner festgehalten, in denen sie die Unterhaltsverweigerung begründeten. In den seltenen Fällen, in denen sie sich dazu äußerten, sahen sie jedoch keine Schuld bei sich. Vielmehr verwiesen sie auf die in ihren Augen schlechte Ehe, ihre Unzufriedenheit mit der Familie oder die ungenügende Haushaltsführung der Ehefrau.⁹⁹³ Kritik an der Haushaltsführung wurde zum Teil allerdings auch in Fällen geäußert, in denen der Mann seinen finanziellen Pflichten nachkam.⁹⁹⁴ Verweigerte ein Mann den Unterhalt oder teilte Wirtschaftsgeld zu, diente dies teilweise als Instrument, um Kontrolle auszuüben oder Kritik zum Ausdruck zu bringen. Dies ging im Extremfall so weit, der Ehefrau keinerlei Ausgaben für sich zuzugestehen und ihre Handlungsfähigkeit damit massiv einzuschränken. „Ehemann gibt diese Woche kein Gehalt ab, weil Ehefrau vorherige Woche nicht in seinem Sinne gewirtschaftet hat.“⁹⁹⁵ In einem Fall verbot der Ehemann seiner Frau, selbst über ihren eigenen Verdienst zu verfügen.⁹⁹⁶ Frauen trugen in der Regel zum Familienerwerb bei, indem sie Hausarbeit leisteten. Forderten die Ehemänner ihre Frauen auf, eine Berufstätigkeit anzunehmen, um den Unterhalt selbst zu bestreiten, widersprach der Rechtsberater.Von einer Ehefrau, die den Haushalt ordnungsgemäß versorgte und die Kinder betreute, konnte der Mann nach den familienrechtlichen Bestimmungen nicht verlangen, arbeiten zu gehen. Im Gegenteil erkannte die Rechtsprechung ausdrücklich an, dass Hausarbeit mit einem Beitrag für die gemeinsame Haushaltsführung gleichzustellen war. Der Mann unterschätzte dem juristischen Berater Fröde zufolge latent die Hausarbeit.⁹⁹⁷ Viele ratsuchende Männer und Frauen betrachteten es als die Pflicht der Frau, den Haushalt zu führen. Kritik an der Haushaltsführung gab es nur in 5 Prozent der Auseinandersetzungen. In diesen Konflikten werden die Erwartungen an ein Familienleben deutlich, zu dem Sauberkeit, Ordnung, die Einteilung des Haushaltsgeldes, das Kochen von Mahlzeiten und die Erziehung der Kinder gehörten.
Vgl. Casparius an I. B., Brief, 4. Dezember 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 216. Vgl. z. B.W.W. an [Kurt] Schulze-Danneberg, Brief, 1. Mai 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 214 sowie W. L. an Bezirksamt, Brief, 1. August 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 206. Vgl. W. K. an Bezirksamt, Brief, 6. August 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 220. Vgl. auch B. P. an Landgericht, Antrag, 18. September 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 209. Fröde, Protokoll, 25. Mai 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 202. [Rechtsberatung], Vermerk, 3. Dezember 1957, LAB, B Rep. 220, Nr. 221. Vgl. z. B. Fröde an W. G, Brief, 1. Februar 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 201 sowie A. W. an [Fröde], Brief, 16. Dezember 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 223.
224
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Es ist nicht angängig das [sic] die Kinder […] nie einen gedeckten Frühstückstisch gesehen haben. Sondern jeder selbst vom Brot schneidet und im stehen ist [sic]. Es ist nicht angängig daß das Mittagessen in der Küche auf den Tisch in der Küche gestellt wird ohne gedeckt zu sein, und die Kinder das Fleisch in die Hand nehmen und Kartoffeln + Sose [sic] mit dem Löffel essen.⁹⁹⁸
Frauen benannten klar die erschwerten Lebensumstände, die sich daraus ergaben, wenn der Mann sich seiner Verantwortung für sie und die Kinder entzog. Diese Schilderungen zeigen sowohl die Situation von Armut betroffener Frauen und Kinder als auch Bemühungen der Frauen, mit striktem Wirtschaften oder Zusatzverdiensten zurechtzukommen und ihr Leben zu verbessern.⁹⁹⁹ Um ihre Kinder bestmöglich zu versorgen, sparten viele vor allem, wenn es um ihre eigenen Bedürfnisse ging – sowohl in finanzieller als auch emotionaler Hinsicht.¹⁰⁰⁰ Einige waren stolz darauf, wie sie mit der Situation zurechtkamen. Eine Mutter formulierte: „Ich […] habe einen einwandfreien Lebenswandel geführt, mein Kind zu einem anständigen Menschen erzogen und sogar in dieser schweren Zeit eine Lehrstelle für […] [es] gesucht und gefunden.“ Gleichzeitig hatte sie den Wunsch, ihr Mann möge für diese schwere Situation geradestehen müssen. „Durch diese seit Jahren währende seelische Belastung und Einwirkung der Kriegsjahre dazu, sowie Überarbeitung habe ich mir ein Herzleiden zugezogen […]. Hoffentlich gibt es eine ausgleichende Gerechtigkeit, welche diesen Mann für sein Handeln zur Verantwortung zieht!“¹⁰⁰¹ Die Ehefrauen verbanden mit der Beratung die Hoffnung, dass sich ihre finanzielle Situation konkret besserte. „Nach meiner Rechtsauffassung habe ich und meine Kinder denselben Lebensstandard wie mein Mann zu beanspruchen.“¹⁰⁰² Dies bestätigte die Beratungsstelle.¹⁰⁰³
W. L. an Bezirksamt, Brief, 1. August 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 206. Vgl. z. B. C. L. an Bezirksamt, Brief, 25. Juni 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 206 sowie A. K. an Eheberatungsstelle, Brief, 6. März 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 219. Vgl. z. B. C. L. an Bezirksamt, Brief, 25. Juni 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 206 sowie C. G. an Fröde, Brief, 11. Mai 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 217. R. W. an [Kurt] Schulze-Danneberg, Brief, 6. Mai 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 214. Vgl. auch C. L. an Bezirksamt, Brief, 25. Juni 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 206. C. L. an Bezirksamt, Brief, 25. Juni 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 206. Vgl. z. B. [Kurt] Schulze-Danneberg an A. Q., Brief, 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 210 sowie [Kurt] Schulze-Danneberg an G. W., Brief, 30. Mai 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 214.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
225
3.6.3.2 Trennung und Scheidung Ich bitte Dich innigst, anläßlich des Weihnachtsfestes und Neuen Jahres mir meinen größten Herzenswunsch doch zu erfüllen und wieder in unser gemeinsames Heim zurückzukommen und die eheliche Gemeinschaft wieder aufzunehmen. So wie die vergangenen […] Jahre, die ja doch für uns so manche schöne wie auch ernste Stunden brachten. Ich selbst will an dem zuletzterlebten mit Dir nicht mehr rütteln. Es soll dann so sein als wärst du nur verreist gewesen.¹⁰⁰⁴
Dieser Briefauszug einer Ehefrau an ihren Mann verweist auf eine breite Gruppe innerhalb der Beratenen: Fast 40 Prozent von ihnen lebten getrennt, 15 Prozent wollten sich scheiden lassen. Allerdings hingen Trennung und Scheidungswunsch nicht zwangsläufig zusammen. Nur knapp 4 Prozent der Paare lebten getrennt und wollten sich auch scheiden lassen. Bei denjenigen, die sich bereits vor der Beratung getrennt hatten, lässt sich der Grund nur in Ausnahmen nachvollziehen. In der Regel beschränkten sich die Auseinandersetzungen auf die Unterhaltspflicht.¹⁰⁰⁵ Anhand derjenigen Fälle, bei denen es während der Beratung zur Trennung kam oder die Ratsuchenden Scheidungswünsche aussprachen, lässt sich jedoch feststellen, dass Trennungs- und Scheidungswünsche subjektiven Empfindungen folgten. Selbst bei Gewalt in der Ehe hatte die Frau nicht automatisch den Wunsch zu gehen, während andere Gründe durchaus zu Trennungen führten. Wünschten Partner die Scheidung, hing dies nicht zwangsläufig damit zusammen, wie intensiv ihre Streitigkeiten gewesen waren. Im Unterschied zu den weiter unten behandelten Heimkehrerehen ist in vielen Fällen zu beobachten, dass Eheberater sich Mühe gaben, auch nach jahrelanger Trennung eine Scheidung zu verhindern und die Eheleute wieder zu einem gemeinsamen Leben zusammenzuführen. Ebenso belegt ist jedoch auch das Gegenteil, der Vorschlag zur Trennung. Doch auch hier blieb die Versöhnung die langfristige Perspektive, auf welche die Berater erhebliche Energie verwandten. In einem Fall wollte ein Mann die Scheidung, da er der Überzeugung war, seine Frau verwöhne und verziehe die Kinder so, dass er an ihnen keine Freude habe und nicht zu seinem Recht komme. Offenbar ging es ihm um Aufmerksamkeit und Folgsamkeit. Er kritisierte, die Kinder ließen sich nicht lenken und leisteten passiven Widerstand gegen ihn. „Meine Frau nimmt mir dadurch jedes Ziel und alle Lebensfreude.“¹⁰⁰⁶ Der Mann war sowohl in der ärztlichen als auch der juristischen Eheberatung gewesen, eine Fürsorgerin klärte seine Familiensituation mit einem Hausbesuch ab. Sämtliche Berater rieten ihm von einer Scheidung ab. Die Kinder
H. W. an A. W., Brief, 14. Dezember 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 223. Vgl. Kapitel 3.6.3.1 Unterhalt und Haushalt. P. S. an [Eheberatung], Brief, [März 1958], LAB, B Rep. 220, Nr. 215.
226
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
machten auf sie einen sehr ordentlichen Eindruck, der Mann leide hingegen an Minderwertigkeitskomplexen.¹⁰⁰⁷ In einem anderen Fall reichte der Ehemann die Scheidung ein, da er wütend war, weil seine Frau seit kurzem mehr Geld verdiente.¹⁰⁰⁸ Einige Beratene litten massiv unter ihrer Ehe, befanden sich aber aus Verantwortungsgefühl in einem Dilemma: Darf ich meine Frau alein [sic] lassen? Sie fordert mich immer wieder auf, endlich zu verschwinden, sie will mich nicht mehr sehen. Fragen Sie die Dame vom Gesundheitsamt, in welchem Zustand sie meine Frau vorgefunden hat. Wenn ich nicht da bin, verkommt sie noch mehr. Bleibe ich hier, gehe ich seelisch zu Grunde oder es geschieht ein Unglück. Was soll ich tun?¹⁰⁰⁹
Oder sie entschieden sich, anderen zuliebe zu bleiben. Eine Ehefrau wollte sich nicht scheiden lassen, obwohl ihr Mann sie schlug, zu wenig Unterhalt zahlte, eine Freundin hatte und die Scheidung verlangte. Sie war jedoch der Überzeugung, dies aushalten zu wollen, um den Kindern nicht ihren Vater zu nehmen.¹⁰¹⁰ Getrennt lebende Ehepaare hatten verschiedene Gründe, warum sie keinen gemeinsamen Haushalt führten. Einige gaben an, dass es einfacher sei, außerhalb Berlins Arbeit zu finden, andere, dass sie nicht mehr zusammen leben wollten; Letzteres vor allem aufgrund einer neuen Beziehung.¹⁰¹¹ Andere wohnten zwar in derselben Wohnung, betrachteten sich jedoch als getrennt und regelten den Haushalt und die Finanzen entsprechend.¹⁰¹² Trennten sich Partner während der Zeit der Beratung, fanden dort Verhandlungen über Unterhaltszahlungen statt und wurden bei Erfolg verschriftlicht.¹⁰¹³ Eine Trennung konnte in einzelnen Fällen auch als vorübergehende Lösung gelten in der Hoffnung, dass später doch noch eine Versöhnung stattfinden würde. Entweder wollten die Betroffenen dieses Vorgehen selbst¹⁰¹⁴ oder der Eheberater sprach eine Empfehlung aus. Der Jurist Fröde schlug einem Ehepaar, das er nicht versöhnen konnte, eine räumliche Trennung vor. Die
S. Fröde, Vermerk, 7. März 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 215. Vgl. Fröde, Aktenvermerk, 2. September 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 212. Fröde an G. S., Brief, 2. September 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 212. T. K. an Fröde, 11. Januar 1957, LAB, B Rep. 220, Nr. 220. Vgl. C. L. an Bezirksamt, Brief, 25. Juni 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 206. Vgl. z. B. K. T. an Rotes Kreuz, Brief, [1950], LAB, B Rep. 220, Nr. 213 sowie G. N. an Rechtsberatung, Brief, 16. Juli 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 208. Vgl. z. B. Kuntze an A. W., Brief, 24. August 1950, LAB, B Rep. 220, Nr. 196 sowie C. G. an Fröde, Brief, 13. April 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 217. Vgl. z. B. Kuntze an A. W., Brief, 24. August 1950, LAB, B Rep. 220, Nr. 196 sowie Fröde an P. M., Brief, 22. Juli 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 176. Vgl. Fröde an M. S., Brief, 23. Juli 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 176.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
227
Partner wollten sich jedoch jeden Sonntag treffen und der Mann plante, Frau und Kind einmal wöchentlich zu besuchen.¹⁰¹⁵ Auch wenn Paare schon lange getrennt waren, wünschten sie nur in wenigen Fällen eine Scheidung. „Ihre Frau ist der Ansicht, dass eine Fortsetzung dieser nur noch dem Namen nach und auf dem Papier bestehenden Gemeinschaft keinen Sinn hat und dass klare Verhältnisse geschaffen werden mögen.“¹⁰¹⁶ Andere Ratsuchende wiederum fühlten sich trotz der Trennung ihrem Ehepartner weiterhin emotional verbunden und wollten deshalb einer Scheidung nicht zustimmen – selbst wenn dies nicht mit der Wahrnehmung des anderen übereinstimmte. Fröde schrieb beispielsweise an einen in Westdeutschland lebenden Mann, dass seine Frau trotz der Trennung noch sehr viel für ihn übrighabe und glücklich wäre, wenn er zu ihr zurückfinde. Wir bitten Sie also, sich ganz gewissenhaft Ihren Schritt einer Ehescheidung zu überlegen. Erfreulicherweise hat auch Ihre Freundin, wie mir Ihre Gattin sagte, religiöse und innere Bedenken gegen die Fortsetzung des Freundschaftsverhältnisses geäussert. Sie müssen selbst entscheiden, ob Ihre Zuneigung nur durch eine momentane, durch vorübergehende äussere Gründe bedingten Einstellung entstanden ist. Sie werden umso leichter zu einer Erkenntnis kommen, wenn Sie einmal die Vorzüge und die glücklichen Jahre Ihrer […] [langjährigen] Ehe bedenken.¹⁰¹⁷
Der Ehemann antwortete, er habe die Ehe mit seiner Frau als Hölle erlebt, Zank und Streit seien nie abgerissen. „Es waren nicht glückliche Jahre, sondern nur wenige glückliche Stunden. Dies schreibt mir auch meine Frau in ihrem letzten Brief. Als ich vor fast drei Jahren fortging, war ich innerlich vereinsamt.“¹⁰¹⁸ Dennoch zog er seinen Scheidungswunsch zurück. Gerade Frauen verweigerten die Scheidung, wenn sie der Ansicht waren, sie hätten sich nichts zuschulden kommen lassen, oder wenn sie befürchteten, von dem zu erwartenden Unterhalt nicht leben zu können.¹⁰¹⁹ Andere Paare wiederum schienen ohne ersichtliche Gründe ein Zusammenleben wieder in Betracht zu ziehen. So reagierte eine Frau überrascht, als sie 1953
Vgl. Fröde, Vermerk, 3. März 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 212. Vgl. auch Fröde, Aktenvermerk, 19. April 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 199. [Kurt] Schulze-Danneberg an A.W., Brief, 29. April 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 214.Vgl. auch [Kurt] Schulze-Danneberg an W. W., Brief, 12. November 1953, LAB, B Rep. 220, Nr. 214. Fröde an R. P., Brief, 5. November 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 209. Vgl. auch Fröde an H. N., Brief, 5. August 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 208. R. P. an Fröde, Brief, 18. November 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 209. Vgl. z. B. [Kurt] Schulze-Danneberg an H. F., Brief, 24. Juli 1953, LAB, B Rep. 220, Nr. 200 sowie G. S. an Fröde, Brief, 20. Juni 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 211.
228
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
über einen Rechtsanwalt die Aufforderung ihres Mannes erhielt, zu ihm nach Westdeutschland zu ziehen. Das Paar lebte seit 1939 getrennt, der Ehemann war seit Jahren nicht nach Berlin gekommen und hatte sich bei den Besuchen der Ehefrau ablehnend verhalten. Daher mahnte der Eheberater den Mann, es müsse die ehrliche und aufrichtige Überzeugung vorhanden sein, die Ehe in rechter Form wiederaufzunehmen und weiterzuführen. Des Weiteren bat er ihn, genau zu erläutern, wie er sich das Zusammenleben vorstelle, denn die Ehefrau sei nach ihren bisherigen vergeblichen Versuchen skeptisch geworden und müsse daher gewisse Sicherheiten haben, bevor sie in Berlin alles aufgebe.¹⁰²⁰ Erst knapp zwei Jahre später fand der nächste Kontakt statt, erneut über einen Rechtsanwalt. Der Mann war in der Zwischenzeit seiner Unterhaltspflicht nicht nachgekommen, ließ die Frau jedoch erneut auffordern, zu ihm zu kommen. Sein Rechtsanwalt drohte damit, sein Mandant werde auf Herausgabe des Kindes klagen, sollte dessen Frau nicht innerhalb von zwei Wochen zu ihm ziehen. In diesem Fall hatte der Eheberater wenig Hoffnung auf eine Versöhnung und antwortete: „Unter diesen Umständen ist doch wirklich nicht damit zu rechnen, dass ohne einen ernsten versöhnenden Schritt eine der Ehe entsprechende Lebensgemeinschaft […] zwischen den Eheleuten wiederhergestellt werden kann.“¹⁰²¹ Dies ist das letztdatierte zu dem Fall vorliegende Schreiben, sodass der Ausgang offenblieb. Einige Scheidungswünsche wies das Gericht ab,¹⁰²² andere verfolgten die Partner aus unbekannten Gründen nicht weiter, selbst wenn bereits Rechtsanwälte involviert und beide einverstanden waren.¹⁰²³ Scheidungsverfahren waren in der Regel mit heftigen Auseinandersetzungen verbunden. Der Rechtsberater Fröde informierte daher einen Ehemann, dass sein Verhalten Konsequenzen haben werde: „Wir wollen Ihnen nicht verschweigen, dass Ihre Drohung, die Sie Ihrer Ehefrau gegenüber ausgesprochen haben (wenn sie sich Ihren im Vergleich vorgeschlagenen Bedingungen nicht fügen würde), bei der kommenden gerichtlichen Auseinandersetzung mit verwandt werden wird.“¹⁰²⁴ Nur wenige Partner bemühten sich, respektvoll miteinander umzugehen, was meist der Rücksicht auf die gemeinsamen Kinder geschuldet war. Eine Ratsuchende beschrieb ihre Ehesituation als eng verbunden mit ihren Vorstellungen von Mütterlichkeit.
S. [Kurt] Schulze-Danneberg an C. L., Brief, 7. August 1953, LAB, B Rep. 220, Nr. 198. Fröde an C. L., Brief, 24. März 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 198.Vgl. auch W. K. an A. F., Brief, 21. Juni 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 217. Vgl. z. B. o. A.: Klageschrift, 13. April 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 207 sowie Fröde an B. G., Brief, 16. März 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 217. Vgl. z. B. ebd sowie Fröde an W. K., Brief, 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 217. Fröde an K. B., Brief, 17. September 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 198. Vgl. auch Beratungsstelle für Nerven- und Gemütskranke, Protokoll, 20. April 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 209.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
229
Aus Erklärungen meines Mannes weiß ich, daß er mir eine ‚Nichtigkeitserklärung‘ der Ehe anstrebt, mit dem Ziel, mir die Kinder zu nehmen. Das ist unmöglich! Ich kann niemals meine Kinder aufgeben, die ich genauso liebe wie mein Mann. Kann er ihnen denn das bieten, was ich als Mutter mit den 1000 kleinen Handreichungen und guten Worten ich ihnen jeden Tag gebe? Ich muß und ich werde also für meine Kinder kämpfen. Und dabei wird so viel Schmutz aufgerührt werden. Wir müssen aber noch viele Jahre, wenn nicht als Eheleute, dann doch als Eltern der Kinder zusammenstehen.
Um die Situation insbesondere für die Kinder zu verbessern, appellierte die Frau an Fröde, seinen Einfluss auf ihren Mann zu nutzen: Bitte, verhindern Sie dieses Schmutzaufrühren! Sie haben einen guten Einfluß auf meinen Mann. Ich denke an eine Schuldlösung halbe-halbe. Dann können wir ohne Groll auseinandergehen, vielleicht sogar gemeinsam unter Ihrer Führung, sehr geehrter Herr Amtsrat, die Aufenthaltsregelung der Kinder durchführen. Ich wäre sehr froh und dankbar, wenn wir zu einer Lösung in diesem Sinne kämen!¹⁰²⁵
Dies war im Sinne der Eheberater, die sich dafür einsetzten, Ehescheidungen so zu gestalten, dass keiner der Beteiligten verletzt und Nachteile für die Kinder vermieden wurden.¹⁰²⁶ Die Einschätzungen, die der Eheberater und die Betroffenen über den Zustand der Ehe trafen, konnten deckungsgleich sein oder voneinander abweichen, auch was die Notwendigkeit einer Scheidung anging. Obwohl Fröde sich bemühte, die Ehen objektiv zu beurteilen, musste er zugeben, dass dies nicht möglich war. Die Betroffenen handelten letztlich nach ihren eigenen Einschätzungen und Bedürfnissen.¹⁰²⁷ 3.6.3.3 Sexualität In 14 Prozent der Beratungsfälle war Sexualität ein Thema. In der Regel ging es dabei um Ehebruch oder die sogenannten ehelichen Pflichten beziehungsweise den ehelichen Verkehr. Je nachdem, wie es um Letzteren stand, galt dies als Zeichen der Zerrüttung oder Versöhnung – unabhängig davon, wie die Partner ihre Ehe ansonsten lebten und empfanden. Sexualität war damit ein bedeutender Gradmesser des Ehezustandes, sowohl für die Diagnose der Eheberater als auch als wichtiges Argument im Scheidungsverfahren.
E. K. an [Fröde], Brief, 15. Juni 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 205.Vgl. auch [Kurt] Schulze-Danneberg an W. W., Brief, 12. November 1953, LAB, B Rep. 220, Nr. 214. Vgl. z. B. ebd. sowie [Kurt] Schulze-Danneberg an A. W., Brief, 29. April 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 214. Vgl. Kapitel 3.6.2 Blick der Ratsuchenden.
230
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Nur selten schien hinter dem Begriff die tatsächlich gelebte Sexualität durch,¹⁰²⁸ wie bei einem Paar, das sich vor der Eheschließung über Sexualität ausgesprochen hatte. Der Mann hatte erklärt, er sei in sexueller Hinsicht nicht voll leistungsfähig. Die Frau fand, dies sei für sie kein Hinderungsgrund, denn eine Ehe beruhe auf Achtung und Vertrauen. Da sie in ihrer vorherigen Ehe ihren Mann an eine andere Frau verloren habe, stellte die Situation sogar eine Erleichterung für sie dar. Sie ging davon aus, dass ihrer neuen Ehe keine andere Frau gefährlich werden könne. Sie habe stets Rücksicht auf ihren Mann genommen und sei mit dem zufrieden gewesen, was er ihr geboten habe. Ihr Mann bestätigte dies bei einer Untersuchung des Gesundheitsamtes. Ihre Haltung änderte sich, als Eheprobleme auftraten und sie begann, ihren Mann der Untreue zu verdächtigen. „Auf solchen Mann habe ich nun so große Rücksicht im ehelichen Verkehr genommen um ihn zu schonen, da er also nicht genug an mir hatte betrog er mich und mißbrauchte meine Treue und mein Vertrauen.“¹⁰²⁹ Voreheliche Sexualität oder Beziehungen waren selten Gegenstand der Gespräche. Die Berater gingen 1954 davon aus, dass beides zeitgenössisch akzeptiert war, auch wenn die einschlägige Literatur dies noch problematisierte. In einem Protokoll findet sich der Fall, dass ein Mann sich scheiden lassen wollte, weil seine Frau vor ihm andere Beziehungen gehabt hatte. Darüber war er bereits informiert gewesen, bevor er die Frau heiratete, was bereits Jahre her war. Laut Berater gab der Ehemann zu, dass seine Ansicht wahrscheinlich falsch sei und mit derjenigen der Gesellschaft nicht übereinstimmte. Dennoch war er nicht zu einer Versöhnung bereit.¹⁰³⁰ In dem einzigen weiteren dokumentierten Fall, in dem voreheliche Sexualität ein Thema war, beschwerte sich der Ehemann, seine Frau habe mit ihm kurz vor der Hochzeit Verkehr gehabt und dabei einen routinierten Eindruck hinterlassen. Er vermutete, sie sei entgegen ihrer Behauptung nicht jungfräulich gewesen, woraufhin er die Hochzeit eigentlich habe absagen wollen.¹⁰³¹ Welche Relevanz eheliche Sexualität hatte, wird in den Scheidungsverfahren deutlich. Dort wurde stets auf den Zeitpunkt des letzten ehelichen Verkehrs hingewiesen. Verweigerung galt als Scheidungsgrund.¹⁰³² Sowohl Männer als auch Frauen nutzten dies als Möglichkeit, ihr Scheidungsvorhaben voranzubringen, in-
Vgl. z. B. Fröde, Vermerk, [Oktober 1957], LAB, B Rep. 220, Nr. 218 sowie Fröde, Vermerk, [19. 3. 1958], LAB, B Rep. 220, Nr. 217. K. G. an Fröde, Brief, 16. Februar 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 201. S. [Kurt Schulze-Danneberg], Aktenvermerk, 25. März 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 197. Vgl. G. P., Aufzeichnung, Juli 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 209. Vgl. z. B. o. A., Klageschrift, 20. Juli 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 221; o. A., Klageschrift, 13. April 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 207.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
231
dem sie erklärten, der andere Partner verweigere den ehelichen Verkehr oder sie selbst würden ihn künftig ablehnen.¹⁰³³ Um eine Scheidung zu verhindern, die durch verweigerten Geschlechtsverkehr möglich wurde, traf ein Ehepaar eine schriftliche Vereinbarung: „In Rücksicht auf den Gesundheitszustand der Ehefrau verzichtet der Ehemann auf den ehelichen Verkehr und erklärt sich damit einverstanden, dass die Ehefrau in einem anderen Zimmer getrennt schläft.“¹⁰³⁴ Auch die Eheberater nutzten ausbleibenden Geschlechtsverkehr als Argumentationshilfe. Als ein Mann seine Frau aufforderte, zu ihm zurückzukehren, antwortete ihm der Berater, dass der Mann beim letzten Besuch in seinem Auto geschlafen habe und nähere Beziehungen unterblieben seien. Die Ehe sei zerrüttet. Dies war im Sinne der Frau.¹⁰³⁵ Ehebruch wurde häufig diskutiert. In der Regel war dabei der Mann der untreue Partner. Je nach Fall stellte ein Seitensprung den zentralen oder nur einen von mehreren Streitpunkten dar. Die Betroffenen gingen damit sehr unterschiedlich um. Ehefrauen konfrontierten des Öfteren die Geliebte oder vermeintliche Geliebte. „Ich habe meinem Mann darüber einen Auftritt gemacht […]. Ich habe dieses Mädel zweimal gewarnt, sie solle von meinem Manne ablassen denn unsere Ehe war sonst harmonisch. Denn ich wollte meinen Mann den ich überalles liebe nicht an eine Andere verlieren. Aber ich habe immer wieder beobachtet, daß sie meinem Mann nach lief.“¹⁰³⁶ Meist beklagten die Betrogenen die Untreue zwar, sie führte jedoch nicht zwangsläufig zur Scheidung, auch wenn der Partner die Affäre nicht beendete. Ein außereheliches Verhältnis war jedoch ein Scheidungsgrund, auch wenn es bereits lange zurücklag.¹⁰³⁷ Meistens schien der untreue Partner trotz der Beratung seine Handlungsweise nicht verändert zu haben, wie etwa der Ehemann, der auf einer Reise eine Frau kennengelernt hatte und nicht von ihr lassen wollte.¹⁰³⁸ In einem anderen Fall war die Ehe noch ein Jahr nach der Beratung in Ordnung, dann aber lernte der Mann eine andere Frau kennen und brachte sie in einer Wohnung unter. Die Ehefrau wollte sich nicht scheiden lassen, bat in der Beratung aber, ihrem Mann vorzuhalten, dass dieser morgens, bevor er arbeiten ging, die andere Frau besuchte, um dort zu frühstücken.¹⁰³⁹ Auch eine andere Frau war der Ansicht, dass
Vgl. z. B. ebd. sowie [Kurt Schulze-Danneberg], Aktenvermerk, 25. März 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 197. S. F. / W. F., Aktennotiz, 8. Oktober 1957, LAB, B Rep. 220, Nr. 217. Vgl. [Kurt] Schulze-Danneberg an C. L., 7. August 1953, LAB, B Rep. 220, Nr. 198. K. G. an Fröde, Brief, 16. Februar 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 201. Vgl. Fröde: Protokoll, 12. Oktober 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 198. Vgl. [Kurt Schulze-Danneberg], Protokoll, 21. Mai 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 206. Vgl. [Fröde] Aktenvermerk, 4. Januar 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 211. [Fröde] Aktenvermerk, 1 Februar 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 211.
232
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
eine langjährige Ehe nicht wegen einer Geliebten geschieden werden müsse. Offenbar stand dahinter sowohl ein Bewusstsein für die eigenen Leistungen in der Ehe als auch das Bedürfnis, weiter finanziell angemessen versorgt zu sein. „Sie selbst, die dem Kläger 3 Kinder geboren hat, braucht nicht darauf verwiesen zu werden, als geschiedene Frau Sozialunterstützung zu beziehen, wenn der Ehemann in der Lage ist, für seine Familie sorgen zu können. Es liegt daher kein Bedürfnis und kein triftiger Grund für eine Ehescheidung vor.“¹⁰⁴⁰ Auch wenn Ehefrauen unter der Situation litten, lehnten sie eine Scheidung häufig ab, besonders dann, wenn sie sich in keiner Weise ehewidrigen Verhaltens schuldig fühlten.¹⁰⁴¹ Dies galt jedoch nicht für alle Frauen. Eine Ehefrau hörte von dritter Seite, dass ihr Mann untreu sei, zog aus der gemeinsamen Wohnung aus und klagte auf Scheidung.¹⁰⁴² In nur einer Besprechung wird deutlich, dass der untreue Partner versuchte, die Situation zu ändern: Der Ehemann versprach, nachts nicht mehr fortzubleiben. Der Berater kommentierte, es bleibe abzuwarten, ob er dies einhielte.¹⁰⁴³ Wie vielschichtig sich Konfliktsituationen darstellten und welche verschiedenen Perspektiven darauf möglich waren, zeigt der folgende Fall. Der Ehemann hatte ein Verhältnis, aus dem ein uneheliches Kind hervorging. Offenbar wandte er sich an die Eheberatung des Gesundheitsamtes. In deren Akten erscheint die Frau als Grund für die schlechte eheliche Situation. Sie habe sich verändert und sei unzugänglich geworden, als sie von dem unehelichen Kind erfahren habe, da ihr Mann nun Alimente zahlen müsse. Den Mann beschreibt das Protokoll in seinen Unterhaltsleistungen als großzügig, er sei Nichtraucher und Nichttrinker. Das eheliche Leben sei gestört, die Ehe zeige Anzeichen von Zerrüttung. „Frau S. kommt ihren ehelichen Pflichten nicht nach und scheint überhaupt psychisch so verändert zu sein, dass die Rücksprache mit dem Ehemann allein eine Lösung des Konfliktes nicht herbeiführen kann, zumal auch die Kinder gegen den Vater Stellung nehmen.“¹⁰⁴⁴ Unter Einschaltung eines Arztes galt es zu erwägen, auf welche Weise die Ehefrau in dieser ehelichen Krise beraten werden könne.¹⁰⁴⁵ Als die Frau zur Besprechung kam, schilderte sie die Situation anders. Nach Rückkehr aus der Gefangenschaft habe ihr Mann gesagt: „‚Ich bin enttäuscht (!), dass ihr noch lebt, ich
W. S. an Landgericht, Klage, 20. Juli 1951, LAB, B Rep 220, Nr. 211 sowie P. S. an Landgericht, Klageabweisung, 8. August 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 211. Vgl. [Fröde], Vermerk, 6. Februar 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 219. Fröde an H. S., Brief, 7. Februar 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 219. Vgl. W. H. an Öffentliche Beratungsstelle, Brief, 28. März 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 202. S. Fröde: Protokoll, 18. Mai 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 214. [Fürsorgerin]: Abschrift, 2. Oktober 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 212. Vg. ebd.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
233
dachte, ich fände nichts mehr vor‘!!“¹⁰⁴⁶ Er habe sie eine Woche nicht beachtet. Sie aber entdeckte Briefe seiner Freundin mit der Nachricht, dass sie schwanger sei. Dann habe sich ein einigermaßen normales eheliches Verhältnis angebahnt, ehe ihr Mann 1948 eine weitere Beziehung eingegangen sei. „Ist seit dieser Zeit grob, benimmt sich hässlich, kein ehelicher Verkehr mehr. Schikaniert Kinder, bes. Sohn, hat ihn ohne Grund geschlagen, nur weil er Partei der Mutter ergreift. Wirft Frau vor Geld zu verbringen.“¹⁰⁴⁷ Als das Ehepaar zu einer erneuten Aussprache gemeinsam erschien, folgte ein Streit, da der Mann die Nacht zuvor völlig betrunken zu Hause randalierte, tätliche Auseinandersetzung mit seinem Sohn hatte, so dass der Funkwagen 2x geholt werden musste. Dadurch ist das gegenseitige Verhältnis erneut stark belastet. Frau […] beherrscht (z. Zt. etwas sehr aggressiv und wenig einsichtig) die Situation. Es werden beiden Teilen die Fehler vorgehalten u. angeregt, jeder solle zuhause in Ruhe überlegen, was er selbst falsch gemacht habe. Bei gutem Willen beiderseits sei eine Normalisierung des Ehe- und Familienlebens durchaus wieder möglich.¹⁰⁴⁸
Als der Ehemann die Scheidung einreichte, wurde die Ehefrau an die Rechtsberatung überwiesen.¹⁰⁴⁹ Der Rechtsberater arbeitete mit ihrem Rechtsanwalt zusammen und gab diesem auf vertraulicher Basis Unterlagen über die Beratungen weiter,¹⁰⁵⁰ obwohl dies dem Selbstverständnis der Beratungsstelle nicht entsprach.¹⁰⁵¹ Der Rechtsanwalt bat darum, dass der Eheberater auf seine Mandantin einwirke, einer einvernehmlichen Scheidung zuzustimmen. Er befürchtete, dass sonst ungünstiges Verhalten der Frau zur Sprache kommen und sich für diese nachteilig auswirken könnte. „Ich bemerke noch, dass das Gericht die Ehe für vollkommen zerrüttet und wertlos hält und die Frau auf jede Weise zu bewegen suchte, in eine Scheidung einzuwilligen.“¹⁰⁵² Die Ehefrau galt dort als zänkisch und aufsässig, ihr wurde vor Gericht vorgeworfen, sie verweigere ihrem Mann grundlos und beharrlich den ehelichen Verkehr. Zudem drohte eine Zeugenaussage, dass sie ihn des Öfteren als „Drecksau“ und „altes Schwein“ beschimpft und sich in einen Streit mit der Tochter eingemischt habe. Dabei habe sie den Ehemann mehrmals in einen
Vollmar: Abschrift, 16. Oktober 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 212. Ebd. Ebd. [Fürsorgerin]: Abschrift, 7. April 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 212. Vgl. [Kurt] Schulze-Danneberg an R. S., Brief, 13. April 1954, LAB, B Rep. 220 Nr. 212. Vgl. Kapitel 3.6.1 Selbstverständnis der Eheberatungsstelle. [Kurt] Schulze-Danneberg, Aktenvermerk, 21. Mai 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 212.
234
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Sessel zurückgestoßen und sich mit den Nägeln beider Hände in seine Wangen gekrallt.¹⁰⁵³ Die Ehefrau erklärte sich mit der Scheidung einverstanden.¹⁰⁵⁴ Teilweise nutzte ein Partner den Seitensprung des anderen, um die eigene Position zu stärken. Eine Frau schrieb an den Vorgesetzten ihres Mannes und bat ihn, sie dabei zu unterstützen, ihren Unterhalt durchzusetzen. Sie flocht dabei die möglichen Auswirkungen auf das Ansehen der Behörde, in der ihr Mann tätig war, ein. Ihr Mann habe während der Ehe bereits früher ein uneheliches Kind gezeugt und lebte nun mit einer anderen Frau zusammen. Seit […] 1955 hat mich mein Mann ohne ersichtlichen Grund böswillig verlassen und hält sich unangemeldet bei einer geschiedenen Frau […] auf und setzt seine ehebrecherischen Beziehungen mit dieser Frau welche noch einen 14 jährigen Sohn hat, in nur Stube u. Küche ohne Schamröte als Beamter fort!! Meine Beobachtung seit über 1 Jahr haben ergeben; das diese Frau […] sogar die Frechheit besitzt und mein Mann vom […]amt abholt. Die schriftlichen Aufforderungen zur Wiederherstellung der Ehegemeinschaft blieben von meinem Mann unbeantwortet […]. Hinsichtlich meiner ausreichenden Begründung bitte ich Sie ebenso höflichst wie dringend Herr Amtsvorsteher meinem Ehemann doch zu erklären; wie derselbe sich als Beamter […] zu verhalten hat um den polizeilichen sowie gerichtlichen Instanzenweg bei seiner Dienststelle zu vermeiden!.¹⁰⁵⁵
Es wäre zu erwarten gewesen, dass von zeitgenössischen sexuellen Normvorstellungen abweichendes Verhalten in der Beratung kommentiert würde. In der Regel verhielten sich die Berater jedoch zurückhaltend, beispielweise als eine Ehe aufgrund der Homosexualität des Mannes aufgehoben werden sollte,¹⁰⁵⁶ ebenso in der Besprechung mit einem Mann, der offenbar die benutzte Unterwäsche seiner Frau betrachtete. Gerne hätte der Rechtsberater Fröde, der den Fall betreute, den Mann scharf ermahnt. Gleichzeitig enthielt er sich zumindest seinen eigenen Aufzeichnungen zufolge offenbar eines persönlichen Urteils. Vielmehr machte er den Mann allgemein darauf aufmerksam, „dass sein Tun in den Augen anderer als anormal erscheinen müsste“ und ein Gericht in seiner Handlung womöglich eine Verletzung der weiblichen Würde sehen könnte.¹⁰⁵⁷ Der Ratsuchende bedankte sich für das Gespräch.¹⁰⁵⁸
Vgl. [Kurt] Schulze-Danneberg, Aktenvermerk, 4. Mai 1954, LAB, B Rep 220, Nr. 212. R. S. an Rechtsberatung, Brief, 12. Mai 1954, LAB, B Rep 220, Nr. 212. Vgl. [Kurt] Schulze-Danneberg, Aktenvermerk, 21. Mai 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 212. H. W. an Amtsvorsteher des […]amtes, Brief, 10. September 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 223. Vgl. Hiller an M.B., Brief, 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 216. Fröde, Vermerk, 12. Oktober 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 216. Vgl. ebd.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
235
Gelegentlich werden sexuelle Normvorstellungen der Ehepaare selbst sichtbar. Eine Frau hatte eine enge Beziehung zu einer Freundin, an der sich der Ehemann störte. Frage, ob zwischen beiden Frauen intime Beziehungen bestehen, ist nicht erörtert, auch nicht gestreift worden, jedoch behauptet Frau […], dass ihr Mann sie bei uns perverser Beziehungen zu Frau […] beschuldigt hätte […]. Nachträglich kommt […] (die Kleine) zu mir und beschwert sich darüber, dass der Ehemann […] sie perverser Beziehungen […] bezichtige. Ich habe ihr erklärt, dass ich nicht in der Lage sei, ihr einen Rat zu geben, jedoch menschlich nur empfehlen könne[n], sich im Interesse der Aufrechterhaltung der Ehe zu distanzieren.¹⁰⁵⁹
In einem anderen Fall ging es darum, dass die Frau ihren Mann zuhause in Frauenkleidern vorgefunden hatte. Der Berater hielt „eine feminine Veranlagung des Ehemannes, die sich darin äussert, dass er es vorziehe, in Frauenkleidern umherzugehen“, fest. Die Frau verlangte eine Klärung, ob tatsächlich eine derartige Veranlagung bestehe und ob diese unheilbar sei. Nur unter dieser Voraussetzung wollte sie der vom Ehemann verlangten Scheidung zustimmen. Die Fürsorgerin wies darauf hin, „dass einzig und allein eine Scheidung in Betracht käme[,] mit der auch alle Beteiligten einverstanden seien, der wahre Grund dürfte jedoch hierbei nicht genannt werden“.¹⁰⁶⁰ In der darauffolgenden Besprechung erklärte der Ehemann, dass seine früher gemachten Angaben zu seiner Veranlagung nicht den Tatsachen entsprächen und er nicht an eine Scheidung denke. Dagegen erklärte nun die Frau, sie hielte die frühere Erklärung ihres Mannes für richtig und verlange nun eine Scheidung. Eine ärztliche Untersuchung sei nicht mehr erforderlich.¹⁰⁶¹ Nur in zwei Fällen bewerteten die Berater sexuelle Vorstellungen beziehungsweise Äußerungen negativ und teilten dies auch entsprechend mit. Ein Protokoll der Beratungsstelle für Nerven- und Gemütskranke berichtet über einen Mann, der sich scheiden lassen wolle, weil seine Frau „seine sexuellen (abnormen) Ansprüche nicht befriedigen will“.¹⁰⁶² Worum es sich genau handelte, fand keinen Eingang in die Aufzeichnungen. In einem anderen Zusammenhang wies ein Rechtsberater einen Ehemann darauf hin, dass es „nur als eine ungehörige Zumutung und Beleidigung aufzufassen“ sei, wenn dieser seiner Frau sage, er mache die Zahlung von Geld
[Kurt] Schulze-Danneberg, Aktennotiz, 21. Oktober 1953, LAB, B Rep. 220, Nr. 209. Vgl. auch [Kurt] Schulze-Danneberg an M. P., Brief, 15. Oktober 1953, LAB, B Rep. 220, Nr. 209. Vgl. [Kurt] Schulze-Danneberg, Vermerk, 14. Januar 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 213. S. ebd. Beratungsstelle für Nerven- und Gemütskranke, Protokoll, 20. April 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 209.
236
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
davon abhängig, dass seine Frau zu ihm in die Kammer komme und sich dadurch etwas verdiene.¹⁰⁶³ 3.6.3.4 Alkohol- und Gewalterfahrungen Gewalterfahrungen lassen sich in über 8 Prozent der vorliegenden Beratungen nachweisen. Die Vermutung einer höheren Dunkelziffer liegt nahe, da gewaltsame Handlungen häufig nur nebenher zur Sprache kamen und selten im Fokus der Beratung standen. Der Großteil der gewaltsamen und schwereren gewaltsamen Handlungen ging auf Ehemänner zurück. Jedoch gab es auch Gewalt von Frauen gegen ihre Männer.¹⁰⁶⁴ Ebenso sind Klagen von Vätern wie Müttern zu finden, die Gewalthandlungen des jeweils anderen gegen die Kinder betrafen. Auch kam es innerhalb weiterer Verwandtschaftsbeziehungen zu Gewalt,¹⁰⁶⁵ teils in Verbindung mit Alkoholmissbrauch. Allerdings war dieser Zusammenhang nicht zwingend. Alkohol stellte ebenfalls eine eigenständige Problematik dar, die 7 Prozent der Beratungsfälle betraf. Betroffene und Berater bewerteten Gewalt in der Ehe oder Familie je nach Fall sehr unterschiedlich. Juristen verwiesen generell darauf, dass tätliche Angriffe dazu berechtigten, die eheliche Gemeinschaft zu verlassen, und als ehewidriges Verhalten einen Scheidungsgrund darstellten.¹⁰⁶⁶ Je nach Ehesituation gingen die Beteiligten damit jedoch verschieden um. Als es in einer Ehe zur vorübergehenden Trennung kam, berichtete die Ehefrau, der Mann habe sich auch tätlich an ihr vergriffen. Grundsätzlich schien sie jedoch eine gute Meinung von ihm zu haben. Dem Berater gegenüber führte sie die Probleme in ihrer Ehe nicht auf Gewalt, sondern fehlendes Vertrauen und mangelnde Kommunikation zurück.¹⁰⁶⁷ Der Mann hatte in einer Besprechung auf den Eheberater einen sehr günstigen Eindruck gemacht, die Situation bedauert sowie glaubwürdig versichert, dass er seine Frau und Kinder sehr liebe.¹⁰⁶⁸ Der Berater folgerte, dass gerade in den Anfangsjahren einer Ehe wegen der Verschiedenheit der Charaktere Differenzen aufträten. Da aber der gute Wille vorhanden sei, sich zu verständigen und aufeinander Rücksicht zu nehmen, lasse sich dies lösen. Dennoch dürften natürlich „unter keinen Umständen die Auseinandersetzungen in tätliche Angriffe ausarten. Wir werden gerade über diesen Punkt Ihrem Mann sehr ernste [Kurt Schulze-Danneberg] an K. T., Brief, 2. Mai 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 213. Vgl. S. B. P. an Landgericht, Antrag, 18. September 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 209 sowie [Kurt] Schulze-Danneberg an H. P., Brief, 7. Juni 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 206. Vgl. z. B. [Kurt] Schulze-Danneberg an H. P., Brief, 7. Juni 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 206 sowie [Fröde], Vermerk, 13. September 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 218. Vgl. z. B. ebd. sowie Fröde an L. H., Brief, 2. Februar 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 219. S. H. B. an Fröde, Brief, 13. September 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 197. S. Fröde an H. B., Brief, 7. September 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 197.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
237
Vorhaltungen machen.“¹⁰⁶⁹ Kurz darauf versöhnte sich das Ehepaar, die Frau bedankte sich bei der Beratungsstelle.¹⁰⁷⁰ Aus dem vorliegenden Material lässt sich nicht eruieren, ob sich die Frau mit ihrer Rückkehr in die Ehe in eine Unterordnung begab oder die Situation tatsächlich zur Zufriedenheit aller gelöst werden konnte. Kam es in Ehen zu massiverer Gewalt, war dies auch ein größeres Thema in der Beratung. Weitere Behörden wurden involviert, vor allem das Sozialamt.¹⁰⁷¹ Bei gewalttätigen Vätern befürchtete das Gesundheitsamt auch Folgen für die Kinder. Die Behörde sah es als notwendig an, dass sich das Ehe- und Familienleben normalisierte, „insbesondere im Hinblick auf die psychische Belastung der Kinder u. der Gefahr der Dauerschäden (Neurosen aus psychischen Trauma [sic])“.¹⁰⁷² Schlugen Eltern ihre Kinder, wurde das aber nicht grundsätzlich kritisiert. Körperliche Strafen waren mit den Erziehungsvorstellungen der Rechtsberatung und der gesetzlichen Situation vereinbar. Die Berater tadelten allerdings als grundlos oder massiv eingeschätzte Gewalt gegen Kinder.¹⁰⁷³ War der Mann schwer gewalttätig, lebte die gesamte Familie in Angst. Deutlich nachvollziehbar ist dies in einem Fall, in dem der Mann sowohl die Kinder als auch seine Frau schlug. Diese erschien in der Beratung, da der Mann sie aus der Wohnung geworfen hatte.¹⁰⁷⁴ Der Bruder der Ehefrau, der sich trotz örtlicher Entfernung ebenfalls vor dem Schwager fürchtete, schilderte die Situation: „Die […] Ehe meiner Schwester hat eigentlich noch nie glücklich genannt werden können. Meine Schwester hat ein hartes Leben hinter sich. Ich weiß überhaupt nicht, daß sie nach all dem Erleben noch lebt […]. Auch die Kinder haben eine harte Jugend hinter sich.“¹⁰⁷⁵ Für seinen Schwager scheine die Frau nur ein Arbeitstier zu sein. Er teile Befehle aus und die anderen müssten gehorchen. Obwohl er als katholischer Theologe Scheidungen eigentlich ablehnte, stellte sich der Bruder der Ratsuchenden ihrem Scheidungswunsch nicht in den Weg. Er befürchtete, seine Schwester und deren Kinder würden, wenn die Ehe bestehen bleibe, „die Hölle auf Erden“ erleben.¹⁰⁷⁶ Der Berater befürwortete die Scheidung und überwies die Ehefrau zur
Fröde an H. B., Brief, 21. September 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 197. Vgl. Fröde, Aktenvermerk, 12. Oktober 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 197. Vgl. z. B. [Kurt] Schulze-Danneberg an Sozialamt, Brief, 29. März 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 202 sowie Fröde an Fürsorgestelle, Brief, 16. Dezember 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 215. Fürsorgerin, Aktennotiz, 16. Oktober 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 212. Vgl. auch Langer, Vermerk, 25. Juni 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 202. Vgl. z. B. Fürsorgerin, Abschrift, 2. Oktober 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 212 sowie Jugendamt an Rechtsberatung, Brief, 11. Oktober 1955, Bericht B Rep. 220, Nr. 202. Vgl. [Fröde], Notiz, [1955], LAB, B Rep. 220, Nr. 215. Fröde an H. C., Brief, 17. November 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 215. H. C. an [Fröde], Brief, 7. Dezember 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 215. Ebd.
238
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Unterstützung an das Sozialamt.¹⁰⁷⁷ Andere mit massiver Gewalt verbundene Situationen ließen sich auch mit der Eheberatung und trotz gerichtlicher oder polizeilicher Unterstützung nicht lösen.¹⁰⁷⁸ In einem Fall hatte die Ehefrau bereits mehrfach Polizeischutz gegen ihren Mann beantragt, außer der Eheberatung waren Säuglings- und Jugendfürsorge involviert. Ihrem Mann war gerichtlich verboten worden, die gemeinsame Wohnung zu betreten. Der Scheidungstermin war angesetzt. Dennoch zog das Ehepaar wieder zusammen und die Frau nahm den Klagetermin offenbar zurück.¹⁰⁷⁹ Extremfälle stellten Drohungen durch Ehemänner dar, ihre Frau totzuschlagen.¹⁰⁸⁰ In anderen Fällen waren Schuldige nicht so eindeutig zu benennen, es herrschte ein „jeder gegen jeden“.¹⁰⁸¹ In einem Beispiel schlug der Mann die Ehefrau, wenn diese eines der Kinder schlug.¹⁰⁸² Da dies in Gegenwart des Kindes geschah, kritisierte die Eheberatung das Verhalten des Mannes als Untergrabung der mütterlichen Autorität.¹⁰⁸³ Zudem gab der Ehemann der Frau kein Wirtschaftsgeld, wenn sie den Haushalt nicht in seinem Sinne führte.¹⁰⁸⁴ Gleichzeitig verweigerte die Mutter insbesondere demjenigen Kind zum Teil tagelang Essen, mit dem sich der Vater am besten verstand, wenn sie verärgert über ihn war. Auch ließ sie es im Winter im feuchten Bett schlafen, wenn es sich einnässte. Dass die Eheprobleme sich auf die ganze Familie auswirkten, wird insbesondere daran deutlich, dass ein Kind mit 16 Jahren noch ins Bett nässte. Das Jugendamt kritisierte, dass keiner der Beteiligten Konsequenzen zog, und schloss nach mehreren Hausbesuchen: „Die Familiensituation ist ungeklärt und unausgereift, es ist kaum möglich, sich ein objektives Bild zu machen.“¹⁰⁸⁵ Die Fürsorge schätzte die Beteiligten unterschiedlich ein. Der Mann hatte bereits vor Jahren einen Scheidungsantrag gestellt, war damit jedoch gescheitert. „Die Ehe […] ist zerstört. Sie besteht formal noch, hat aber keine
Vgl. Fröde an Fürsorgestelle, Brief, 16. Dezember 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 215. Vgl. z. B. Fürsorgerin, Notiz, 16. Oktober 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 212 sowie Fürsorgerin, Abschrift, 2. Oktober 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 212. Vgl. [Charlotte] Leppin, Vermerk, 23. April 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 220. Landgericht Berlin, Beschluss; [1958], LAB, B Rep. 220, Nr. 220. Vgl. [Kurt] Schulze-Danneberg an Sozialamt, Brief, 29. März 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 202 sowie [Fröde], Notiz, [Juni 1955], LAB, B Rep. 220, Nr. 206. Jugendamt an Rechtsberatung, Bericht, 11. Oktober 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 202. Zu Streit über das Schlagen von Kindern vgl. auch Fröde, [Vermerk], 30. Juli 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 201. Auch in einem anderen Fall wurde dieses Verhalten als besonders gravierend vermerkt. Vgl. [Kurt] Schulze-Danneberg an H. L., Brief, 6. Juni 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 206. Vgl. Fröde: Protokoll, 25. Mai 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 202 sowie Fröde, Aktenvermerk, 6. September 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 202. Jugendamt an Rechtsberatung, Bericht, 11. Oktober 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 202.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
239
Bindung mehr zwischen den Eheleuten.“¹⁰⁸⁶ Dennoch wollte die Frau sich nicht scheiden lassen, obwohl sie sichtlich unter ihrer Ehe litt. Der Mann wiederum hoffte, die Behörde werde zu seinen Gunsten eingreifen, und erklärte, dass er seine Frau ansonsten rauswerfen werde.¹⁰⁸⁷ Die Eheberatung erzielte keine Fortschritte. Teilweise war mit den Gewaltausbrüchen Alkoholmissbrauch der Ehemänner verbunden. Allerdings richteten sich die Ausfälle nicht zwangsläufig gegen andere Personen. Vielmehr wurden im Rausch auch Möbel zerschlagen.¹⁰⁸⁸ Verringertes Wirtschaftsgeld oder Schulden waren ebenso eine Folge starken Alkoholmissbrauchs.¹⁰⁸⁹ Die Berater setzten sich in diesen Fällen in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt dafür ein, die Situation zu verbessern. Ein Mann erteilte offenbar auf Anraten der Beratungsstelle der Ehefrau eine Vollmacht für das weitere Vorgehen: Hiermit gebe ich meiner Frau […] schriftlich, daß ich mich nie mehr so fürchterlich betrinken will, daß ich nicht mehr weiß was ich tue. Und meine Familie durch mich nicht mehr in Angst und Schrecken versetze. Sollte ich trotzdem Rückfällig [sic] werden, soll meine Frau die Schritte einleiten, die sie für richtig hält.¹⁰⁹⁰
Ein anderer Mann ließ sich nach der Eheberatung auf eine Betreuung durch die Beratungsstelle für Nerven- und Gemütskranke ein.¹⁰⁹¹ „Er zeigt ein einsichtsvolles Verhalten und äussert glaubhaft den festen Vorsatz, sich des Alkohol-Genusses zu enthalten. – Nach seinen Angaben soll das eheliche Einvernehmen jetzt gut sein. – Seitens der Ehefrau sind hier inzwischen keine weiteren Klagen mehr geäussert worden.“¹⁰⁹² In einem anderen Fall kam es immer wieder zu kurzzeitigen Verbesserungen, die jedoch nicht dauerhaft waren. Die Ehefrau erschien mehrfach in der Beratung, da der Mann nach kurzer Abstinenz immer wieder seinen Lohn vertrank.¹⁰⁹³
Langer, Vermerk, 25. Juni 1955, LAB, B Rep 220, Nr. 202. S. Fröde, Aktenvermerk, 6. September 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 202. Vgl. z. B. Fröde: Protokoll, 19. April 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 203 sowie [Fröde], Protokoll, 14. Juni 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 223. Vgl. z. B. Fröde an S. S., Brief, 23. Juni 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 211 sowie H.W. an Amtsvorsteher des […]amtes, Brief, 10. September 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 223. W. P.: Vollmacht, 7. September 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 221. Vgl. Fröde an O. M., Brief, 7. Oktober 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 208. Raabe an [Fröde], Brief, 11. November 1954, LAB, B Rep. 220, Nr. 208. Vgl. Fröde: Protokoll, [1955], LAB, B Rep. 220, Nr. 211 sowie Fröde an S. S., Brief, 23. Juni 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 211.
240
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
3.6.3.5 Heimkehrerehen Wie viele der Ratsuchenden während des Krieges oder durch Gefangenschaft von ihren Ehepartnern oder Familien getrennt waren, gibt das vorliegende Material nicht preis. Es liegen sowohl Beispiele vor, in denen der Mann bewusst den Kontakt abbrach, als auch solche, in denen unklar bleibt, ob die Eheleute beide den Kontakt mieden oder an äußeren Umständen scheiterten.¹⁰⁹⁴ Der Eheberater ging davon aus, dass die Partner sich entfremden konnten, wenn sie jahrelang getrennt waren. Um diese Distanz zu überwinden, brauchte es nicht nur eine gewisse Zeit, sondern auch großes gegenseitiges Verstehen.¹⁰⁹⁵ Gerade bei den Heimkehrerehen wird jedoch deutlich, dass Eheberater wenigstens in den vorliegenden Fällen nicht stark auf eine Versöhnung drängten. Offenbar galten diese Partnerschaften als zu komplex und die Probleme als unüberwindbar. Häufig konnten Eheberater nur noch eine gescheiterte Beziehung feststellen. Forderungen, zur Harmonie zurückzukehren, sind keine zu finden, vielmehr passten sich die Berater an die jeweilige Lage der Ratsuchenden an. Teilweise führten Partner ihre Probleme klar auf die Zeit des Krieges oder der Gefangenschaft zurück. Ein Paar war bereits fast während des ganzen Krieges getrennt gewesen, anschließend noch bis 1950 durch die Gefangenschaft des Mannes. Beide hatten die Absicht, die Ehe wiederaufzunehmen, alles zuvor Geschehene sollte vergeben und vergessen sein. Doch scheiterte die Beziehung schließlich an den für Heimkehrerehen häufig genannten typischen Schwierigkeiten. Mann und Frau hatten sich durch die lange Trennung entfremdet, die Ehefrau war selbstständiger geworden, der Mann untreu. Der Eheberater erkannte diese Entfremdung an und forderte keine Versöhnung. „Die Parteien haben zunächst versucht, sich wieder zu finden. Dies scheiterte jedoch […] auch daran, dass sie sich im Laufe der langen Zeit, in welcher sie getrennt waren, völlig auseinandergelebt haben und sich aufeinander nicht mehr einstellen konnten.“¹⁰⁹⁶ Nachdem der Mann zurückgekehrt war, lehnte die Frau es ab, ihn wieder als Verwalter ihrer Immobilie einzusetzen oder ihm Einblick in ihre finanziellen Verhältnisse zu geben. Darüber hinaus brachte sie zum Ausdruck, dass sie ihn nicht mehr liebe. Früher habe sie ohne ihn leben müssen, nun wolle sie ihn nicht mehr, nachdem er alt geworden sei.¹⁰⁹⁷ Darüber hinaus habe der Mann ein langandauerndes Verhältnis, aus dem auch zwei uneheliche Kinder hervorgegangen seien.¹⁰⁹⁸
Vgl. z. B. [Kurt] Schulze-Danneberg an W. G., Brief, 18. Oktober 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 201 sowie L. R. an Bezirksamt, Brief, 4. April 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 221. S. [Kurt] Schulze-Danneberg an W. W., Brief, 20. August 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 214. W. S. an Landgericht, Klage, 20. Juli 1951, LAB, B Rep 220, Nr. 211. S. ebd. Vgl. P. S. an Landgericht, Klageabweisung, 8. August 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 211.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
241
Weitere Ehen werden bereits während der Zeit des Nationalsozialismus als problematisch beschrieben.¹⁰⁹⁹ Eine Frau berichtete, ihr Mann habe sich damals sehr verändert, darunter hätten sie und das Kind zu leiden gehabt. Während er Parteiarbeit vortäuschte, um sich zu vergnügen, sei sie mit dem damals noch kleinen Kind immer allein zuhause gewesen. Als sie darüber stritten, habe er zu ihr gesagt: „Erst kommt mein Führer, dann meine Parteiarbeit und dann erst meine Familie!“¹¹⁰⁰ Über die Situation bei Kriegsende berichtete die Frau: An meinem 19. Hochzeitstage (ich war damals mit meinem Kinde evakuiert) bekam ich von meinem Mann einen Brief, er wäre zu der Einsicht gekommen, wir passen nicht zu einander (nach 19 Ehejahren!), er wolle sich scheiden lassen […], aber da[nn] war bereits der Russe in Berlin und somit konnte er wunderbar untertauchen und sich 6 Jahre lang seinen Pflichten gegenüber seiner Familie entziehen.¹¹⁰¹
Der Ehemann hatte sich nach Kriegsende nicht mehr bei seiner Familie gemeldet. Seine Frau hatte angenommen, er sei tot, und Jahre später nur durch Zufall erfahren, dass er noch lebte. Auch in diesem Fall sprach der Eheberater eine eindeutige Empfehlung aus und riet ihr zu einer Scheidungs- und Unterhaltsklage.¹¹⁰² Der Ehemann bestätigte, dass das Verhältnis zu seiner Frau bereits während des Krieges nicht mehr das beste gewesen sei. Als er sich in der Kriegsgefangenschaft eine chronische Nierenerkrankung zugezogen habe, aufgrund derer er in den ersten Monaten nach seiner Entlassung längere Zeit erwerbsunfähig gewesen sei, habe er seiner Frau nicht zur Last fallen wollen.¹¹⁰³ Beim Eheberater verfing dies nicht. Er zeigte Unverständnis, dass der Ehemann sich bei Kriegsende nicht nach seiner Familie erkundigt habe.¹¹⁰⁴ Auch ein Jahr später war sich der Mann keiner Schuld bewusst, weder was seine Ehe noch die schlechte Beziehung zu seinem Sohn anging, der ihn ablehnte. Nach Berlin seien Kriegsgefangene damals nicht entlassen worden, daher sei er nach Westdeutschland gegangen, um nicht nach Frankreich abgeschoben zu werden. Zum Geburtstag des Sohnes habe er ein Päckchen geschickt, das aber anscheinend nicht angekommen sei. Daraufhin habe er angenommen, dass seine Frau mit ihm überhaupt nichts mehr zu tun haben wolle. Eine böse Absicht liege nicht vor.¹¹⁰⁵
Vg. auch L. R. an Bezirksamt, Brief, 23. April 1958, LAB, B Rep. 220, Nr. 221. R. W. an [Kurt] Schulze-Danneberg, Brief, 6. Mai 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 214. Ebd. Vgl. [Kurt] Schulze-Danneberg an R. W., Brief, 24. September 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 214. S. W. W. an [Kurt] Schulze-Danneberg, Brief, 1. Mai 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 214. S. [Kurt] Schulze-Danneberg an W. W., Brief, 17. Mai 1951, LAB, B Rep. 220, Nr. 214. S. W. W. an [Kurt] Schulze-Danneberg, Brief, 12. Juli 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 214.Vgl. auch W. W. an [Kurt] Schulze-Danneberg, Brief, 3. Oktober 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 214.
242
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
Wie unterschiedlich Paare die Wiederaufnahme von Kontakt und Beziehung empfanden oder zumindest schilderten, wird an folgenden Briefen an die Eheberatung deutlich. Die Eheleute hatten verschiedenen Erwartungen, wie der Umgang miteinander und das Sexualleben aussehen sollten. Enttäuschung stellte sich ein. Hinzu kamen Missverständnisse, die zu Streit führten. Beide Seiten schilderten meist dieselben Situationen, die die jeweiligen Partner als problematisch erkannten, jedoch unterschiedlich bewerteten. Im vorliegenden Fall ist zu erkennen, dass der Rechtsberater zunächst den Kontakt zwischen den Eheleuten herstellen wollte und deshalb den Ehemann anschrieb. Dieser meldete sich daraufhin bei seiner Frau. Er schrieb „die herrlichsten Briefe, er versprach mir den Himmel auf Erden – und ich glaubte an seine Ehrlichkeit“.¹¹⁰⁶ Der in Westdeutschland lebende Ehemann fuhr über Weihnachten 14 Tage zu seiner Familie nach Berlin. Alles sei harmonisch gewesen, aber die Ehefrau empfand den Umgang als sehr kühl, ohne Herzlichkeit. Ehelicher Verkehr habe keiner stattgefunden, offenbar hatte der Mann dies abgelehnt. Sie hatten besprochen, dass der Mann sich um eine Arbeit in Berlin bemühen werde. Doch die Angelegenheit verzögerte sich. Da sie sich in ihren Augen versöhnt hatten, drängte die Ehefrau auf ein Zusammenleben. Schließlich nahm ihr Mann eine mehrwöchige Arbeit in Berlin an. Sein Besuch sei aber eine seelische Qual für sie gewesen. Ihr Gesundheitszustand habe so gelitten, dass sie sich in ärztliche Behandlung begab. „Schon bei seiner Ankunft merkten wir, dass er nicht wie ein liebender Mann u. Vater kam, sondern wie ein Fremder. Keine Spur von Liebe oder Herzlichkeit. Unterhaltungen gingen um allgemeine Dinge, [über] die man sich mit jedem Fremden unterhält. Sonst wurde nur Abend für Abend gelesen u. Kreuzworträtsel geraten genau das gleiche den lieben langen Sonntag.“¹¹⁰⁷ Das von der Frau gewünschte Miteinander habe es nicht gegeben.¹¹⁰⁸ Auch der Ehemann schilderte die Situation aus seiner Sicht: Er habe mit seiner Frau wieder ein gutes Verhältnis herstellen wollen. Nach seinem Besuch in Berlin habe er auch den Eindruck und die Hoffnung gehabt, dass alles wieder in Ordnung komme. Doch darin sei er arg enttäuscht worden. Ein Streit über einen ruinierten Anzug habe die Liebe nicht herzlicher werden lassen und so habe er seine Freizeit meist mit Lesen verbracht. „Mein Versuch, meiner Frau eine Freude durch Mitbringen von Obst und dergl. zu machen, wurde gelegentlich durch Bemerkungen wie ‚brauchst mir gar nichts mitbringen‘ wieder vereitelt.“¹¹⁰⁹ Im Nachhinein vermutete der Ehemann, dass bereits die ersten gemeinsamen Tage seine Frau ent
R. W. an [Kurt] Schulze-Danneberg, Brief, 11. Juni 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 214. Ebd. S. ebd. W. W. an [Kurt] Schulze-Danneberg, Brief, 12. Juli 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 214.
3.6 Fallstudie amtliche Beratung: Rechtsberatungsstelle Berlin-Reinickendorf
243
täuscht hatten. Er machte dies daran fest, dass er ihren sexuellen Wünschen nicht nachkam: Während sie früher nicht viel Interesse am ehelichen Geschlechtsverkehr zeigte, verlangte sie jetzt des guten zu viel. Es ist verständlich, daß man sich nach den langen Jahren der Trennung erst wieder einander nach und nach zusammenfinden kann. Ich versuchte trotzdem ihrem Wunsche gerecht zu werden. Aber jeden Abend war es mir physisch nicht möglich und so war sie dann am 3. Abend schon unzufrieden, weil ich es nicht haben konnte, daß sie nicht Ruhe ließ.¹¹¹⁰
Die Ehefrau wiederum schilderte: „Immer wieder habe ich in aller Güte u. Liebe auf ihn eingeredet, bis er mir dann endlich eines Abends gestand, er könnte nicht aus seiner Haut heraus u. hatte eben keine Herzlichkeit u. Liebe für mich. Ehelichen Verkehr könne er überhaupt nicht für mich aufbringen. Nun das reichte mir vollends u. nun war mir ja seine komische Handlungsweise klar.“¹¹¹¹ Sie habe sich bemüht, aber nachdem ihr Mann sie abgewiesen habe, sei auch sie zu ihm nicht mehr liebevoll und herzlich gewesen. Er habe ihr klar bewiesen, dass sie ihm lästig sei. Sie verlangte die Scheidung.¹¹¹² Laut Ehemann sagte die Frau: Ich habe schon September und Weihnachten bei deinem Besuch gemerkt, daß du doch nicht die richtige Liebe für mich übrig hast, ich fühle mich noch nicht zu alt, um auf Liebe zu verzichten […]. Es ist am besten, wir gehen im guten [sic] auseinander. Ich entgegnete ihr darauf in ruhigem Tone, daß mir das leid tue, ich versucht hätte, zu ihr nett und freundlich zu sein, aber eben nicht dafür könne, wenn ich ihr die Liebe (ehelicher Verkehr) nicht gleich so entgegen bringen könne, wie ich gerne wolle, ich kann eben nicht aus meiner Haut heraus.¹¹¹³
Als der Mann seine Arbeit in Berlin verlor, beschloss das Ehepaar nach Angaben des Mannes, dass er nach Westdeutschland zu seiner alten Stelle zurückkehren solle. Der Mann schilderte, er sei sehr erstaunt gewesen, als er eine Woche später einen Brief erhielt, dass seine Frau die Scheidung wolle. Der Ehemann war einverstanden, allerdings komme dies nur in Frage, wenn beide eine unüberwindbare beiderseitige Abneigung als Scheidungsgrund angäben. Er war nicht bereit, wie offenbar gefordert, die Alleinschuld zu übernehmen. „Eine Heranziehung alter Sachen, die angeblich zur Zerrüttung der Ehe geführt haben, sind ja gegenstandslos geworden
Ebd. R. W. an [Kurt] Schulze-Danneberg, Brief, 11. Juni 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 214. S. ebd. W. W. an [Kurt] Schulze-Danneberg, Brief, 12. Juli 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 214.
244
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
durch die Tatsache, daß durch ehelichen Verkehr (und zwar auf Wunsch meiner Frau) Verzeihung gewährt ist.“¹¹¹⁴ In manchen Beratungen ist nur nebenbei ein Bezug zu Krieg oder Gefangenschaft erkennbar, ohne dass Probleme darauf zurückgeführt worden wären.¹¹¹⁵ Zudem konnten auch Ehepaare, die erst in der Nachkriegszeit heirateten, in ihrer Beziehung von Kriegs- oder Nachkriegszeit geprägt sein, beispielsweise durch spezifische Opfer, die sie nicht honoriert sahen: „Für diesen […] Mann hat man jahrelang 1947/1949 auf der Landstraße gelegen, Kartoffeln, Brot & was sonst beschafft = heute erntet man Schimpf & Schande.“¹¹¹⁶
3.7 Zwischenfazit Der vorliegende Untersuchungsteil beschäftigte sich mit dem Verhältnis von Selbstverständnis und Praxis in der institutionalisierten nichtkonfessionellen und evangelischen Eheberatung von der Nachkriegszeit bis zur Mitte der 1960er-Jahre. Zentrales Ergebnis ist, dass Selbstbild und aktive Beratungstätigkeit sich teilweise widersprachen. Während die vorliegenden Quellen darauf hindeuten, dass die Berater dies nur in seltenen Fällen reflektierten, zeigt die Kritik der Ratsuchenden an den Beratungsstellen durchaus Widersprüchlichkeiten. Zielsetzungen, die auf höherer Ebene in Interessenvertretungen oder Gesundheitsämtern formuliert wurden, spiegelten sich nur selten im Selbstverständnis der Praktiker. Letztere richteten ihre Arbeit weitgehend unabhängig vom maßgeblichen Verband, der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (DAJEB), oder sogar vorgesetzten Dienststellen aus. Sie orientierten sich in der Regel an den Bedürfnissen der Ratsuchenden, die auch als eigenständige Akteure sichtbar werden. Das Kapitel analysierte Briefwechsel, die Eheberater mit Ratsuchenden, aber auch mit Rechtsanwälten und Behörden führten, sowie Beratungsprotokolle. Ebenso flossen Berichte von Beratungseinrichtungen und zeitgenössische Beratungsliteratur ein. Herausgearbeitet wurde dabei besonders das Selbstverständnis der in der Beratung Tätigen, wie es in Fachartikeln sowie ihrer Aus- und Weiterbildung greifbar war. Diese breit gefächerte Herangehensweise ermöglichte sowohl den Blick auf die verbandliche Ebene und Führungspersonen als auch auf Ehebe-
W.W. an [Kurt] Schulze-Danneberg, Brief, 12. Juli 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 214.Vgl. auch W.W. an [Kurt] Schulze-Danneberg, Brief, 3. Oktober 1952, LAB, B Rep. 220, Nr. 214. Vgl. z. B. Fröde: Protokoll, 12. Oktober 1954, LAB, B Rep. B 220, Nr. 198 sowie H. W. an A.W., Brief, 14. Dezember 1955, LAB, B Rep. 220, Nr. 223. C. G. an Fröde, Brief, 11. Mai 1956, LAB, B Rep. 220, Nr. 217.
3.7 Zwischenfazit
245
rater und Ratsuchende. Die Forschung hat bisher kaum Egodokumente zur Praxis ausgewertet. In der Institution Ehe wurden Zusammenbruch und Neuorientierung der Gesellschaft nach 1945 besonders deutlich. Da die Ehe in unmittelbarem Zusammenhang mit gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen stand, wuchs der Wunsch nach Einflussnahme auf konkrete Partnerschaften, was unter anderem über die Eheberatung gewährleistet werden sollte. Diese war damit nicht nur den Verheirateten verpflichtet, sondern sollte auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe erfüllen. Die Eheberatung orientierte sich nach 1945 sowohl in ihrem Selbstverständnis als auch in der Praxis an ihren Anfängen in der Weimarer Republik. Über das „Dritte Reich“ hinaus bestehengebliebene Stellen wurden in personeller Kontinuität weitergeführt und erste Beratungsstellen wiedereröffnet oder neu gegründet. Die Einrichtungen trafen auf Bedarf und erfuhren häufig einen Ausbau. 1949 entstand mit der DAJEB der erste Verband, der sich der Eheberatung widmete. Mit den Gründungsmitgliedern und Vorständen Joachim Fischer, Carl Coerper und Lothar Loeffler prägten bereits im „Dritten Reich“ tätige Sozial- und Rassenhygieniker die Ausrichtung der Organisation. Eugenische, insbesondere voreheliche Beratung war eines der wichtigsten Anliegen. Die Mediziner setzten sich auch in der Bundesrepublik für eugenische Maßnahmen ein. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Eugenik oder der nationalsozialistischen Vergangenheit fand weder auf persönlicher Ebene noch innerhalb der DAJEB statt. Dieser Umgang fügte sich somit in die zeitgenössische Herangehensweise im medizinischen und pädagogischen Bereich ein. Die Arbeitsgemeinschaft vertrat eugenische Tendenzen und war von einer religiös-metaphysisch geprägten Definition von Ehe dominiert. Sie galt offiziell als paritätisch, hatte aber enge Verbindungen zur evangelischen Kirche und wurde teilweise auch als evangelisch ausgerichteter Verband betrachtet. Die evangelische Eheberatung erfuhr damit eine gewisse Repräsentanz und konnte auch innerhalb der DAJEB ihre bewusst religiöse Ausrichtung beibehalten. Der Arbeitsgemeinschaft gelang es langfristig jedoch nicht, den Wunsch nach einem dezidiert evangelischen Verband abzuwehren. Mit der Gründung der Konferenz für Evangelische Familienberatung (EKFuL) und des Evangelischen Zentralinstituts für Familienberatung (EZI) entwickelte die evangelische Kirche ein eigenständiges Profil in der Eheberatung und trieb deren Professionalisierung für den eigenen Bereich wesentlich voran. Das Ausscheiden der evangelischen Berater bedeutete für die DAJEB einen klaren Bedeutungsverlust, gleichzeitig erfuhr die Beratungslandschaft einen Konfessionalisierungsschub. Die DAJEB publizierte erstmals Anforderungen an Eheberatung und Eheberater und gab damit wichtige Impulse zur Vereinheitlichung. Dies trug entscheidend zur Bekanntheit des Verbandes und auch zu seiner fachlichen Wahrnehmung bei. Er
246
3 Nichtkonfessionelle und evangelische Eheberatung
wirkte in erster Linie durch Kurse und Tagungen für künftige und bereits tätige Eheberater. Die Arbeitsgemeinschaft betrieb damit sowie durch ihr späteres Engagement in der Standardisierung der Beratungsausbildung früh und maßgeblich die Professionalisierung der Eheberatung. In dieser Hinsicht und mit ihrem Anspruch auf Vielfalt in der Beratungsarbeit war sie auch für Berater relevant, die nicht mehr sozialhygienisch orientiert waren, sondern psychologisches Wissen integrieren wollten. Gleichzeitig blieben die Entwicklung und Formulierung von Methoden auf einem fachlich marginalen Niveau, Eheberatung konnte nicht als Profession durchgesetzt werden. Einige Beratungsstellen waren erkennbar nach den Vorstellungen der DAJEB aufgebaut. Die Praxis war jedoch weit davon entfernt, die vom Verband angestrebte vorbeugende und eugenische Beratung umzusetzen. Das lag entweder am Desinteresse der Ratsuchenden an dieser Beratungsform oder an der Ausrichtung der Stellen auf Konfliktberatung für bestehende Ehen. Diese Lücke zwischen Selbstverständnis und Praxis führte zwar zu Klagen der DAJEB, dass die voreheliche Beratung nicht durchsetzbar sei, doch der Verband ging in der Konsequenz nicht darüber hinaus. Dies gilt auch für die amtliche Eheberatung, vor allem diejenige der Gesundheitsämter. Die Arbeit war von ihrer Umsetzung durch Eheberater vor Ort abhängig.Vorgesetzte Stellen oder offizielle Zielsetzungen hatten für deren konkrete Tätigkeit jedoch nur wenig Relevanz. Ohne dies explizit zu formulieren, folgten die Eheberater vielmehr ihrem eigenen Verständnis von Beratung und richteten sich an der sozialen Realität verheirateter Paare aus. Dabei ist zu beobachten, dass zunehmend Psychologen in der Eheberatung arbeiteten, die sich somit analog zur Erziehungsberatung als Arbeitsfeld für die angewandte Psychologie etablierte. In der Praxis löste die Eheberatung sich teilweise aus ihrer Abhängigkeit von medizinischen Akteuren, die sie seit ihrer Gründung in der Weimarer Republik geprägt hatte. Das Selbstverständnis der Berater zeigt vor allem den Willen, objektiv und zugewandt auf die Ratsuchenden einzugehen. Gemeinsam war den meisten ein hoher Anspruch an ihre Arbeit sowie ein großer zeitlicher Einsatz. Dabei gingen sie, wie auch in der Zielsetzung ihrer Beratungen, über die Intentionen ihrer jeweiligen Einrichtung teilweise hinaus. Das Verhalten Ratsuchender und deren Lebenssituation belastete die Eheberater ebenso wie selbst formulierte Anforderungen an die Beratungsarbeit. Sie versuchten, den unter Eheproblemen stark leidenden Beratenen die Situation durch Zugewandtheit und vor allem Zuhören zu erleichtern. Diese Form des Gespräches kann bis in die Anfänge der Eheberatung nachgewiesen werden und stellt einen wichtigen Aspekt der Arbeit dar. Eheberater nahmen ihr Engagement als relevant und auch erfolgreich wahr. Ihre Vorgehensweise und das Verständnis, das sie von ihrer Beziehung zu den Ratsuchenden hatten, zeigen eine große Bandbreite, von einseitiger Raterteilung bis hin zu ersten methodischen
3.7 Zwischenfazit
247
Ansätzen der Casework. Ratsuchende wurden zumindest insofern als eigenständige Akteure wahrgenommen, als deren Willen, die Verantwortung für sich und ihre Ehe zu übernehmen, als entscheidend galt. Andererseits erwarteten die Beratenden oft Einsichten und Verhaltensweisen von ihrem Gegenüber, die mit den eigenen Vorstellungen konform gingen. Diese Ambivalenz erkannten sie jedoch nicht. Inhalte und Vorgehensweise der Beratungen variierten. Darin spiegelten sich zeitgenössisch stark beachtete Themen wie die Frühehe, aber auch offiziell nicht problematisierte Fragestellungen wie Gewalt in der Ehe. Wichen die Vorstellungen von Beratung und Berater von dem ab, was Ratsuchende erlebten, handelten diese eigenständig und missachteten die Empfehlungen oder Forderungen des Eheberaters. Ratsuchende sind somit als eigenständige Akteure zu begreifen, welche die Beratungssituation stark beeinflussten, indem sie ihre eigenen Interessen verteidigten, emotionale Reaktionen zeigten und als Gestalter ihrer Ehe auftraten. Verweigerten sich Ratsuchende, zeigten sie Beratern die Grenzen ihres Einflusses. Doch auch Eheberater zogen Grenzen, wenn sie Handlungen von Ratsuchenden als respektlos wahrnahmen.
4 Katholische Eheberatung Der folgende Untersuchungsteil ist dem Verhältnis von Selbstverständnis und Praxis der institutionalisierten katholischen Eheberatung in Westdeutschland von der Nachkriegszeit bis in die 1960er-Jahre gewidmet. Zentral ist, dass beides nicht deckungsgleich, sondern von Ambivalenzen geprägt war. Begründet war dies vor alm in Spannungen zwischen Kirchenrecht und Praxis, beeinflusst durch weitere Aspekte wie beispielsweise das katholische Eheideal. Bisher hat die Forschung keine Egodokumente zur Praxis der katholischen Eheberatung ausgewertet. Diese Lücke gilt es im Folgenden zu schließen. Die Sorge um Ehe und Familie war eines der entscheidenden kirchlichen Anliegen in den Rechristianisierungsbemühungen der Nachkriegszeit. Da den Akteuren Eheberatung als wichtiges Instrument diente, um ihre Ordnungsvorstellungen umzusetzen, spiegeln sich in der Praxis daher sowohl gesamtgesellschaftliche als auch kirchenrechtliche Fragestellungen wider. Eheberatung galt als Domäne der Laienarbeit. Diese Sicht prägte das Selbstverständnis der meist weiblichen Beratenden. Sie betrachteten die Ehe häufig als personale Liebes- und Lebensgemeinschaft. Damit befanden sie sich in einem deutlichen Gegensatz zum offiziellen Lehramt, das die Ehe als abstrakte Institution beschrieb. Gleichzeitig setzte das Kirchenrecht ihrer Arbeit klare Grenzen. Den damit konfrontierten Akteurinnen fiel es teils schwer, die Lehrmeinung der Kirche mit den Bedürfnissen der Ratsuchenden in Einklang zu bringen. Die durch kirchliches Recht gesetzten Grenzen waren für die Beraterinnen ein wesentlicher Frustrationspunkt. Die Beratungsstellen arbeiteten in Rückbesinnung auf die katholische Eheberatung der Weimarer Republik. Wesentlich beeinflusst wurde der institutionelle und inhaltliche Aufbau durch die Abgrenzung und Konkurrenz zur nichtkonfessionellen und evangelischen Richtung. In diesem Kontext ist auch die Gründung des Katholischen Zentralinstituts für Ehe- und Familienfragen (KZI) zu verorten. Fachliche Expertise gewann an Bedeutung, das KZI förderte diese Entwicklung entsprechend. Dies führte gegen Ende des Untersuchungszeitraums zu einer Professionalisierung und psychologischen Ausrichtung der katholischen Eheberatung.
https://doi.org/10.1515/9783111097534-005
4.1 Katholische Kirche und Theologie im Wandel
249
4.1 Katholische Kirche und Theologie im Wandel 4.1.1 Gesellschaft, Laienarbeit und Kirchenbild Die unmittelbare Nachkriegszeit war „eine Stunde der Kirche“,¹ mit der in Deutschland eine kurze, intensive Phase der religiösen Reorientierung einherging.² Erzbischof Lorenz Jaeger³ forderte „Wiederaufbau für Gott und mit Gott“.⁴ Vor allem die katholische Kirche nahm mit dem Zusammenbruch des Staates eine wichtige öffentliche Rolle an. Sie galt als weniger durch den Nationalsozialismus korrumpiert als andere Institutionen. Zudem verfügte sie als einzige Großorganisation noch über einen funktionierenden Apparat. In der Folge sah sich die Kirche großen Erwartungen gegenüber. Dies drückte sich auch in der Zahl der Kirchgänger aus, die bis 1950 um über 8 Prozent auf 48,7 Prozent aller katholischen Gläubigen
Große Kracht, Klaus: Die Stunde der Laien? Katholische Aktion in Deutschland im europäischen Kontext 1920 – 1960. Paderborn 2016, S. 287. Vgl. im Folgenden ebd. sowie Rölli-Alkemper, Familie, S. 51 ff. Lorenz Jaeger (23.9.1892– 1.4.1975) wurde nach dem Theologiestudium 1922 zum Priester geweiht. Im Zweiten Weltkrieg zunächst Divisionspfarrer, wurde er 1941 Erzbischof von Paderborn. Neben der Jugendseelsorge galt sein Interesse der Ökumene. Er förderte diese insbesondere durch den Jaeger-Stählin-Kreis, einen noch heute bestehenden Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen. Auch das von Jaeger 1957 gegründete Johann-Adam-Möhler-Institut für Konfessions- und Diasporakunde ist innerhalb der katholischen Kirche eine führende Einrichtung zu ökumenischen Fragen. 1965 wurde Jaeger zum Kardinal ernannt. Vgl. Wagner, Harald: „Lorenz Jaeger“. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 2. Herzberg 1990, Sp. 1435 – 1436. Während des „Dritten Reiches“ wurde Jaeger von der Gestapo als Gegner des NS-Staates beobachtet. Ab 1964 führte eine fehlerhafte Zitation seines Fastenhirtenwortes von 1942 zu verschiedenen Medienaffären, in denen ihm die geistige Unterstützung des Nationalsozialismus vorgeworfen wurde. Vgl. Gruß, Heribert: Erzbischof Lorenz Jaeger als Kirchenführer im Dritten Reich. Tatsachen – Dokumente – Entwicklungen – Kontext – Probleme. Paderborn 1995. Seit 2018 widmet sich ein Forschungsprojekt der Kommission für kirchliche Zeitgeschichte der Biografie Jägers: „Lorenz Kardinal Jaeger (1892– 1975)“. Vgl. Fleckenstein, Gisela: Tagungsbericht: Lorenz Jaeger als Seelsorger, 26.08. 2021– 27.08. 2021. Verfügbar unter: H-Soz-Kult, auf: www.hsozkult.de/conferencereport/id/ tagungsbe richte-9073, besucht am 6. Oktober 2021. Jaeger, Lorenz: Fastenhirtenbrief 1946 über den Wiederaufbau für Gott mit Gott, 2. Februar 1946, S. 73 – 85, hier S. 74. Zitiert nach Große Kracht, Stunde, 2016, S. 290. Zu den Rechristianisierungsbemühungen und damit einhergehender Nothilfe der Caritas vgl. Frie, Ewald: „Kontinuitäten und Trümmer. Sieben Thesen zu Katholizismus und Caritasarbeit in der Zusammenbruchsgesellschaft“. In: Manderscheid, Michael / Wollasch, Hans-Josef (Hrsg.): Die ersten hundert Jahre. Forschungsstand zur Caritasgeschichte. Freiburg im Breisgau, 1998, S. 115 – 118.
250
4 Katholische Eheberatung
anstieg.⁵ Der katholischen Kirche gelang es bis weit in das 20. Jahrhundert hinein, ihre Mitglieder konfessionell und weltanschaulich zu binden. Katholische Verbände wiesen hohe Mitgliederzahlen auf. 1960 stellten die katholischen Frauen- und Müttergemeinschaften mit 600.000 Mitgliedern den größten Frauenverbund dar. Doch waren bereits in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg Säkularisierungstendenzen spürbar gewesen. Dagegen wandte sich Papst Pius XI. mit der Aufwertung der Laienbewegung. 1922 rief er mit der „Katholischen Aktion“ die Laien dazu auf, am Apostolat der amtskirchlichen Hierarchie teilzunehmen. Er bediente sich damit einer italienischen Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichte.⁶ Die deutschen Bischöfe begannen 1928, diesen Impuls zu rezipieren, der die Oberaufsicht des Episkopats über Laienaktivitäten sichern sollte. Obwohl es bereits ein umfangreiches katholisches Vereins- und Verbandswesen gab, blieb die Umsetzung marginal und auf einzelne diözesane Initiativen beschränkt. Kirchliche Amtsträger verhinderten den bistumsübergreifenden Ausbau teilweise aktiv. Dennoch hatte die Katholische Aktion auch in Deutschland zu einer Laienmobilisierung geführt, die allerdings 1938 von den Nationalsozialisten unterbunden wurde.⁷ Die Bischöfe, die ihre gesellschaftlichen Führungsansprüche durchzusetzen suchten, betrachteten die Beteiligung von Laien am Wiederaufbau nach 1945 teilweise argwöhnisch. Versuche, die Katholische Aktion neu aufleben zu lassen, waren wenig erfolgreich. Es gelang nicht, sie als Dachorganisation über dem Vereins- und Verbandswesen zu etablieren. Aufgrund der Rückkehr der Verbände mit ihren überdiözesanen Strukturen befürchteten die Bischöfe, in ihrem Machtanspruch zurückgedrängt zu werden. Daher siedelten die Bischöfe der Kölner und Paderborner Kirchenprovinz in Köln eine Hauptarbeitsstelle für Frauenseelsorge an. Die Bischöfe hatten sich bereits im Sommer 1945 darauf geeinigt, die früheren großen Verbände nicht wieder aufleben zu lassen, sondern diözesane Seelsorgestellen unter bischöflicher Leitung zu schaffen. Hier konnten sie direkteren Einfluss ausüben.⁸ Der Versuch, die Handlungsspielräume der Verbände zu begrenzen, konnte jedoch nicht durchgesetzt werden, da der Papst im November 1945 gegenüber der Fuldaer Bischofskonferenz festhielt, dass bewährte Verbände wieder aufgebaut werden sollten, allerdings unter Einfluss und Aufsicht der Bischöfe. Die Verbände erfuhren in Kirche und Gesellschaft immer mehr Anerkennung für ihre Arbeit.
Zu Statistiken bezüglich katholischer Kirche vgl. auch: Großbölting, Thomas / Goldbeck, Markus: „Religion“. In: Ralph, Thomas (Hrsg.): Research Report. Deutschland in Zahlen. Zeitreihen zur Historischen Statistik. Bonn 2015, S. 172– 185. Vgl. Große Kracht, Stunde, 2016, auch für das Folgende S. 44– 56; vgl. Steinmaus-Pollack, Angelika: Art. „Katholische Aktion“. In: Theologische Realenzyklopädie. Bd. 18, Berlin u. a. 2008, S. 43 – 45. Vgl. ebd., S. 44. Vgl. Hammerschmidt, Wohlfahrtsverbände, 2005, S. 112.
4.1 Katholische Kirche und Theologie im Wandel
251
Parallel stiegen jedoch auch der bischöfliche Einfluss sowie die religiöse Prägung der Laienarbeit. Der Grad dieser Einflussnahme ist dabei umstritten.⁹ Festzuhalten ist, dass Laien ihren Mündigkeitsanspruch immer stärker geltend machten, ein gestiegenes Selbstbewusstsein wurde sichtbar. Dies war auch das Resultat der Mobilisierung unter dem Banner der Katholischen Aktion, die in den 1930er- und 1940er-Jahren vor allem in Frankreich missionarische Züge angenommen hatte, was verschiedene Akteure nach dem Krieg auch in Deutschland rezipierten.¹⁰ Viele Laien gaben sich mit einer passiven Rolle in der Kirche nicht mehr zufrieden. 1951 fand in Rom der Erste Weltkongress für das Laienapostolat statt. Eine entsprechende Theologie hatte unter anderem Karl Rahner entwickelt. Die Laien forderten vom Klerus, ihnen mehr Verantwortung zu übertragen und ihre Initiativen anzuerkennen. Reformorientierte Theologen nahmen diese Entwicklung mit Interesse auf. Bereits 1952 war die Rede von der „Stunde der Laien“.¹¹ Prälat Hermann Klens, der Generalpräses des Verbandes der Frauen- und Müttergemeinschaften Deutschlands, unterstützte den Drang zum Laienapostolat. Er berichtete, Frauen empfänden sich noch mehr als männliche Laien lediglich als Objekt der Seelsorge, und forderte, die Selbstständigkeit der Frau im religiösen Leben anzuerkennen und ihre Mitarbeit zu fördern. Dabei diente ihm Maria als Vorbild der sich engagierenden mütterlichen Frau und Inspiration für eine besondere apostolische Sendung. Mitarbeiterinnen von Klens beschrieben im Rückblick nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass er mit seiner Haltung einen maßgeblichen Anteil an der veränderten Frauenseelsorge gehabt habe.¹² Die katholische Eheberatung widmete sich konkret der Sorge um Ehe und Familie als einem Kirchenanliegen. Sie galt als entscheidend „auf diesem außerordentlich schwierigen Gebiet der katholischen Laienarbeit“¹³. Die 1950er-Jahre waren eine wichtige Phase der Gründung und des Aufbaus katholischer Familienarbeit, wobei die Eheberatung neben Mütterschulung und Familienbildung eines der wichtigsten Elemente darstellte.¹⁴ Eheberaterinnen begriffen ihre Arbeit
Vgl. Raabe, Felix: „Laienarbeit zwischen Kriegsende und Konzil“. In: Gatz, Erwin (Hrsg.): Geschichte des Kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Bd. 8: Laien in der Kirche, Freiburg im Breisgau 2008, S. 253 – 280, hier S. 253. Vgl. auch für das Folgende Große Kracht, Klaus: Die katholische Welle der ‚Stunde Null‘. Katholische Aktion, missionarische Bewegung und Pastoralmacht in Deutschland, Italien und Frankreich 1945 – 160. In: AfS 51 (2011), S. 163 – 186. Große Kracht, Stunde, 2016, S. 14. Vgl. Rocholl-Gärtner, Anwalt, 1978, S. 84, S. 103 f. und S. 167 ff. Dagmar Herzog bezeichnet Klens als „streitbaren Katholiken“. Herzog, Politisierung, 2005, S. 348, Fn. 41. [Eugen] Rucker an die Teilnehmer(innen) am Schulungskursus für Eheberatung (28.–30.3.55), Brief, 22. Juli [19]55, AEK, DBK, KZI 29. Vgl. Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 411 f.
252
4 Katholische Eheberatung
dabei nicht nur als Hilfe für Verheiratete, sondern auch als Dienst an der Kirche, mit der sie sich in Übereinstimmung wähnten. Der Zweite Weltkongress für das Laienapostolat 1957 und das Zweite Vatikanische Konzil ab 1962 wirkten sich deutlich auf den weiteren Professionalisierungsprozess der Laienarbeit aus. Die Eigenständigkeit der Laien in der Seelsorge wurde theologisch abgesichert und mit einem kirchlichen Auftrag verbunden.¹⁵ Zuvor hatte das Kirchenrecht sie in eine untergeordnete, passive Rolle verwiesen, während die Kleriker die Rechtsträger der Kirche darstellten. Bis zum Beginn des Konzils waren kaum Zeichen einer kirchlichen Wende sichtbar und auch die Ankündigung des Konzils rief zunächst kein breites Interesse hervor.¹⁶ Erst später erhielt es weltweit Aufmerksamkeit. Das wichtigste Konzilsdokument trug den Titel „Lumen gentium“. Diese 1964 verabschiedete Konstitution erlangte für das Selbstverständnis der katholischen Kirche starke Bedeutung. Sie beschrieb die Kirche als „mystischen Leib Christi“. Diese Formel hatte bereits Pius XII. mehrfach vertreten, etwa 1943 in der Enzyklika „Mystici corporis“. Die darin enthaltene gnadentheologische Interpretation vereinte alle Kirchenmitglieder zu einem mystischen, von Christus gekrönten Leib. Auch wenn Laien explizit in diesen organischen Körper eingeschlossen waren, hielt die Enzyklika am Primat der innerkirchlichen Hierarchie fest.¹⁷ „Lumen gentium“ erwähnte die christologische Deutung ebenfalls. Das Hauptmotiv war jedoch die Vorstellung von der Kirche als pilgerndem Gottesvolk, welche die hierarchische Ordnung nicht aufgab, die „Glaubenden als Träger des Geistes“ aber stärker in den Vordergrund rückte.¹⁸ Die Laien, die eigentlich „als bloße Durchführungsorgane der Hierarchie gedacht waren“, wurden damit „anerkannt und ekklesiologisch gewürdigt“.¹⁹ Sie sollten mit ihrem Alltagsleben zur Heiligung der Welt beitragen, womit sie laut Lehramt von Objekten der Seelsorge zu mündigen Akteuren des katholischen Glaubens wurden. Diese Aufwertung der Laien machte sich institutionell zwar kaum bemerkbar, doch sie griff die bereits vorhandenen Erneuerungstendenzen auf. Innerhalb weniger Jahre veränderte sich das Kirchenbild fundamental. Das Konzil löste ein über die katholische Kirche
Vgl. Sohn, Andreas / Sohn-Kronthaler, Michaela: „Frauen in der Kirche“. In: Gatz, Erwin (Hrsg.): Geschichte des Kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Bd. 8: Laien in der Kirche. Freiburg im Breisgau 2008, S. 483 – 520. Vgl. im Folgenden Gatz, Erwin: „Vom Zweiten Vatikanischen Konzil bis zur Gegenwart“. In: Ders. (Hrsg.): Geschichte des Kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Bd. 8: Laien in der Kirche. Freiburg im Breisgau 2008, S. 282– 318. Vgl. Große Kracht, Stunde, 2016, S. 177. Beinert, Wolfgang, Das Bild von der Kirche nach den Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils. In: Löser, Werner: Die römisch-katholische Kirche. Berlin u. a. 1986, S. 11– 46, hier S. 32. Große Kracht, Laien, 2016, S. 399.
4.1 Katholische Kirche und Theologie im Wandel
253
hinausgehendes Interesse an einer kirchlichen Wende und ökumenischen Öffnung aus, auch die Theologie durchlebte einen Wandel. Gleichzeitig machten sich im Katholizismus bereits ab Mitte der 1950er-Jahre tiefgreifende Transformationsprozesse bemerkbar. An die Stelle der Rechristianisierung trat eine größere Bereitschaft, sich mit einer pluralen Gesellschaft auszusöhnen und zuversichtlicher auf die Stabilität von Ehe und Familie zu blicken.²⁰ Den Kulminationspunkt dieses Prozesses stellten die 1960er-Jahre dar. Gesamtgesellschaftliche Veränderungen führten zu einer Infragestellung herkömmlicher katholischer Identität. Zwar blieben die Mitgliederzahlen der katholischen Kirche bis in die frühen 1960er-Jahre weitgehend stabil, aber persönliche Werte verschoben sich. Die Säkularisierung zeigte sich in einem Rückgang der Akzeptanz kirchlicher Glaubenssätze. Nach wie vor spielte die Beichtpraxis eine wichtige Rolle, um insbesondere die individuelle Geburtenregelung bekämpfen und die Einhaltung der Sexualnormen sicherstellen zu können.²¹ Bis zum Beginn der 1960er-Jahre beichtete über die Hälfte der Katholiken etwa einmal im Monat. In der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre brach diese Praxis jedoch zusammen. Gläubige empfanden es zunehmend als belastend, dass bei Fragen von Ehe und Familie lediglich das Thema Geburtenregelung interessierte.²² Viele Ehepaare, die sich selbst als religiös sahen, betrachteten bereits in den 1950er-Jahren die katholischen Sexualnormen als wirklichkeitsfremd. 1949 hatten bereits 67 Prozent der regelmäßigen Kirchgänger sexuelle Beziehungen vor der Ehe. Die Folge war, dass kirchliche Ideale und die tatsächlich gelebte Ehe immer stärker auseinanderdrifteten.²³ In der Seelsorge wurde dies als „Ehenot“ charakterisiert. Die katholische Milieudichte erlebte auch durch die Zunahme der sogenannten „Mischehen“, d. h. Verbindungen konfessionsverschiedener Partner, einen wesentlichen Einbruch. Je nach Auswertung machten diese „Mischehen“ Ende der 1950er-, Anfang der 1960er-Jahre 20 bis 30 Prozent aller Ehen aus.²⁴ Nur noch eine Minderheit der Gläubigen betrachtete
Vgl. Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 84 ff. Vgl. Fleckenstein, Gisela: „Ehe und Familie“. In: Gatz, Erwin (Hrsg.): Geschichte des Kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Bd. 8: Laien in der Kirche, Freiburg im Breisgau 2008, S. 521– 558, hier S. 535 f. Vgl. im Folgenden Großbölting, Thomas: „Von der ‚heiligen Familie‘ zur Lebensgemeinschaft mit Kind(ern). Religion, Familienideale und Wertewandel zwischen den 1950er und 1970er Jahren“. In: Dietz, Bernhard et al. (Hrsg.): Gab es den Wertewandel? Neue Forschungen zum gesellschaftlichkulturellen Wandel seit den 1960er Jahren. München 2014, S. 227– 243, hier S. 236 ff. Aussagen Gläubiger zu ihrer Kirchengebundenheit und Ehe finden sich in Schreuder, Osmund: Kirche im Vorort. Soziologische Erkundungen einer Pfarrei. Freiburg 1962, S. 410 ff. Vgl. auch Owetschkin, Dimitrij: „Religiöse Sozialisation in bikonfessionellen Kontexten. Zur Stellung konfessionsverschiedener Ehen und Familien im religiösen Wandel der 1960er Jahre“. In:
254
4 Katholische Eheberatung
eine rein katholische Ehe als angemessener. Zunehmend forderten sie Fortschritte in dieser ökumenischen Frage.²⁵ „Mischehen“ wurden kirchlicherseits jedoch aufgrund der Konfessionsverschiedenheit der Ehepartner als Problem betrachtet. Durch ihre Orientierung an individuellen Bedürfnissen stellten sie die Ehemoral in Frage. Diese Entwicklungen beeinflussten auch die Laienarbeit. Eheberaterinnen bemerkten ab Mitte der 1960er-Jahre, das Kirchenrecht werde der auch religiösen Not in diesem Bereich nicht gerecht. Ein großer Teil befürwortete zudem die Möglichkeit der Scheidung.²⁶ Die meisten betrachteten die Ehe jedoch als erhaltenswerte Institution, auch wenn Heiraten und Geburten weiter zurückgingen, sich Frauenrollen wandelten und selbst praktizierende Katholiken sich einer veränderten Sexualmoral zuwandten. Die Kluft zwischen kirchlichen Wertvorstellungen und der Gesellschaft trat immer deutlicher zutage.²⁷
4.1.2 Eheideal und Eherecht in der katholischen Kirche Die katholische Kirche begriff die Nachkriegszeit als Chance, Deutschland zu rechristianisieren. Ehe und Familie galten als Keimzelle der Gesellschaft und damit wichtiger Zugriffspunkt. Dabei ist zu beachten, dass beides im kirchlichen Sprachgebrauch eine Einheit darstellte.²⁸ Konsequenz daraus war die Förderung der Familienseelsorge mit Ehe und Familie als Hauptthema der Laienarbeit.²⁹ Gleichzeitig wähnte die Kirche Ehe und Familie in einer tiefen Krise. Mehrere deutsche Bischöfe erklärten Familienseelsorge 1951 zu einem Schwerpunktthema in ihrem Bistum, was sich auch auf Ehevorbereitung und Elternschulung bezog. Das wachsende Kursangebot trug dazu bei, dass die Ansprüche an die Ehe stiegen. Häufig leiteten Laien die Kurse, die eine breite Schicht von Katholiken ansprachen. Amtskirche und Klerus traten so in den Hintergrund, Laien förderten eine über das
Lepp, Claudia / Oelke, Harry/ Pollack, Detlef (Hrsg.): Religion und Lebensführung im Umbruch der langen 1960er Jahre. Göttingen 2016, S. 237– 258. Vgl. das „Memorandum zur Mischehenfrage“ von 1967 in Interkonfessioneller Arbeitskreis für Ehe- und Familienfragen (Hrsg.): Christliche Einheit in der Ehe. Mainz 1969, S. 16 ff. Vgl. Jost, Ingrid / Zelazny, Käthe: „25 Jahre Verband Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberater – Rückblick und Perspektiven“. In: Verband Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater e. V. (Hrsg.): Blickpunkt Beratung. Kontakt – Begegnung – Beziehung. Diagnostik und Intervention im Prozeß der Beratung. 25 Jahre Verband Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater e. V. Jahrestagung 1988 in Augsburg. [Augsburg 1988], S. 61– 83, hier S. 76 f. Vgl. Raabe, Laienarbeit, 2008, S. 272. Vgl. Fleckenstein, Ehe, 2008, S. 555. Zu den Begriffen Ehe und Familie im Katholizismus vgl. auch Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 34 ff. Vgl. im Folgenden Fleckenstein, Ehe, 2008, S. 536 ff.
4.1 Katholische Kirche und Theologie im Wandel
255
institutionelle Eheverständnis hinausgehende personale Interpretation von Ehe und Sexualität.³⁰ Insgesamt wurde die Familienarbeit mit Mütterschulung, Eheberatung und Familienbildung systematisch aufgebaut. Die Amtskirche erkannte diese Bereiche als Domäne der Laienarbeit und der Verbände im Rahmen des Laienapostolats an. Die Caritas plädierte für ein Familienmodell, in dem beide Ehepartner gemeinsam die Führung innehaben sollten. Auch wenn dies aus verschiedenen Gründen schwer zu erreichen sei, stelle die Partnerschaft von Mann und Frau eine durchaus geläufige Idee von Liebe und Ehe dar.³¹ Dennoch blieben traditionelle Frauenrollenbilder vorherrschend. Familienthemen und Caritas waren hauptsächlich in weiblicher Hand. Dies bot Frauen auch Möglichkeiten, sich strategisch zu positionieren.³² Berieten sie zum Thema Ehe, befanden sich Laien Illemann zufolge „in einem Spannungsverhältnis zwischen Kirche und Welt“. Nicht immer seien die aus einer christlichen Lebensweise und Haltung erwachsenen Ansprüche, Normen und Haltungen konform mit den gelebten Ehen.³³ Die katholische Ehelehre zu befolgen, war ein Aspekt des Gehorsamsgebots. Lange definierte die Kirche den Zweck der Ehe im Wesentlichen religiös-transzendental, gleichzeitig war und ist die Ehe als kleinste gesellschaftliche Einheit Gegenstand des Kirchenrechts. Der sakramentale Charakter der Ehe zog rechtliche Folgen nach sich und war faktisch gleichbedeutend mit einem Ehevertrag. Als Eheideal findet sich der Verweis auf Genesis 2,24:³⁴ „Darum läßt ein Mann Vater und Mutter und bindet sich an sein Weib und sie werden ein Leib.“³⁵ Eine Publikation der Bischöflichen Hauptstelle für Frauenseelsorge bestimmte die Ehe 1950 als Abbild des Liebesbundes zwischen Christus und seiner Kirche.³⁶ Mann und Frau verpflichteten sich dabei zum gegenseitigen Vgl. dazu auch Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 304 ff. S. Wollasch, Hans: „Die Partnerschaft von Mann und Frau in der Familie“. In: Berufsverband Katholischer Sozialarbeiter Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Familiennot und ihre Überwindung, o. O. [1955], S. 53 – 57. Vgl. Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 305 und 152. Fleckenstein, Ehe, 2008, S. 521. Die vorliegende Übersetzung von Genesis 2,24 entspricht derjenigen der im Folgenden aufgeführten Publikation der Bischöflichen Hauptstelle für Frauenseelsorge von 1950. Alfes, Georg: „Zwei in eins geben. Über den ‚Una caro‘-Begriff der Ehe“. In: Bischöfliche Hauptarbeitsstelle für Frauenseelsorge Düsseldorf (Hrsg.): Die Frau in Kirche und Volk. Köln 1950, S. 34– 39, hier S. 38. Die Theologie greift im Verhältnis von Mann und Frau vor allem auf Gen. 1– 3 zurück. Das daraus abgeleitete hierarchische Modell sah die Frau als „Gehilfin“ des Mannes zur Zeugung und Aufzucht von Kindern. Eine naturrechtlich begründete Zuschreibung von Eigenschaften machte die Frau dem Mann unterlegen und diente der Stabilisierung der patriarchalen Familie. S. Heimbach-Steins, Marianne: „Mann und Frau“. In: Baumgartner, Konrad et al. (Hrsg.): Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 6. Freiburg im Breisgau 2017, Sp. 1275 – 1276. Vgl. Alfes, Begriff, 1950.
256
4 Katholische Eheberatung
Dienst, wobei der Mann das Haupt darstelle und die Frau ihm untertan sei.³⁷ Denn die „Frau dient in ihrem Manne Christus selbst, wie der Mann in seiner Gattin die Braut des Herrn, die Kirche (deren Urbild Maria ist) zu sehen hat“.³⁸ Diese patriarchale kirchenrechtliche Ordnung diente somit dem geistlichen Ziel, das Christusheil zu erlangen.³⁹ Für Hermann Klens erfüllte sich im Sakrament der Ehe das Laienpriestertum von Mann und Frau.⁴⁰ Auch in katholischen Eheratgebern findet sich diese Sakralisierung der Ehe wieder, deren Sinn in der gegenseitigen Vervollkommnung der Eheleute und ihrem gemeinsamen Weg zu Gott bestand. Diesbezüglich wurden christliche Deutungen mit der Vorstellung von romantischer Liebe verflochten, die sich auch auf die Unauflöslichkeit der Ehe stützte.⁴¹ Das katholische Eherecht ist im Codex Iuris Canonici (CIC) geregelt. Dies stellt eine Besonderheit dar, denn die meisten anderen christlichen Kirchen besitzen kein eigenes Eherecht.⁴² Im Untersuchungszeitraum galt die Version des Kirchenrechts von 1917. Der CIC machte deutlich, dass die katholische Ehe der Zeugung von Kindern und ihrer christlichen Erziehung sowie der Ordnung der Sexualität diene. Die Rechte und Pflichten der Eheleute sollten dafür die geeigneten Rahmenbedingungen schaffen. Laut Kirchenrecht berechtigt und verpflichtet die Eheschließung zu einer Lebensgemeinschaft, die durch den Tod aufgelöst wird (CC 1111, 1128). Unauflösbar ist sie, sobald die Ehe durch Geschlechtsverkehr vollzogen ist. Zwar kann eine sakramentale Ehe staatlich geschieden werden. Da der Staat sie aber in den Augen der Kirche nicht auflösen kann, bleibt sie bestehen. Ist jemand durch eine frühere Ehe gebunden, kann er keine neue schließen (C 1069).
Vgl. dazu auch Dressler, Bedrohung, 2013, S. 108 ff. Alfes, Begriff, 1950, S. 38 f. Vgl. im Folgenden Lüdicke, Klaus: Zur Vorlesung: Kirchliches Eherecht. Westfälische WilhelmsUniversität Münster [2008] sowie zeitgenössisch Kaiser, Matthäus: „Grundzüge des Eherechts der katholischen Kirche“. In: Struck, Günter/ Loeffler, Lothar (Hrsg.): Einführung in die Eheberatung. Mainz 1971, S. 228 – 297; Neumann, Johannes: „Die Möglichkeiten des geltenden katholischen Eherechts“. In: Interkonfessioneller Arbeitskreis für Ehe- und Familienfragen (Hrsg.): Christliche Einheit in der Ehe. Mainz 1969, S. 44– 61; Schroll, Josef P.: „Die Ehe im kirchlichen Recht. Das katholische kirchliche Eherecht“. In: Scherer, Alice et al. (Hrsg.): Ehe und Familie. Grundsätze, Bestand und fördernde Maßnahmen. Freiburg im Breisgau 1956, Sp. 53 – 74. Rocholl-Gärtner, Anwalt, 1978, S. 196. Zu Klens Ehe- und Rollenvorstellungen vgl. auch Klens, Hermann: Eine Brautlehre. Worte des Priesters an die Brautleute. Düsseldorf 1950. Vgl. Eckardt, Sarah: „Zwischen Konkurrenz und Synthese. Christliche und romantische Deutungsmuster in Eheratgebern der 1950er Jahre“. In: Scholz, Sylka et al. (Hrsg.): In Liebe verbunden. Zweierbeziehungen und Elternschaft in populären Ratgebern von den 1950ern bis heute. Bielefeld 2013, S. 79 – 98. Zur Rechtsauffassung der evangelischen Kirche vgl. Müller-Freienfels, Ehe, 1962, S. 79 ff.
4.1 Katholische Kirche und Theologie im Wandel
257
Für geschiedene Katholiken zog der CIC Konflikte im Glaubensalltag nach sich.⁴³ In Einzelfällen war es jedoch möglich, nach einer Scheidung wieder zu heiraten. Dafür musste die Ehe in einem kirchlichen Eheprozess als ungültig anerkannt oder durch einen päpstlichen Gnadenerweis aufgelöst werden. Beide Möglichkeiten waren schwer durchzusetzen und nur einer Minderheit zugänglich. Das Kirchenrecht beanspruchte dabei bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil auch Geltung für nichtkatholische Christen. Die Ehe zwischen Katholiken und Andersgläubigen war verboten, da der katholische Partner dadurch vom Glauben abfallen könne (C 1060). Kam die Ehe dennoch mit einer standesamtlichen oder evangelischen Trauung zustande, war sie laut Kirchenrecht ungültig. Der katholische Ehepartner lebte damit in permanenter Sünde. Den Hintergrund für die Bewertung des Eherechts bildet das katholische Eheideal. Bereits in der Weimarer Republik geriet die katholische Ehemoral in die Diskussion, besonders in der Liturgischen Bewegung und der Jugendbewegung.⁴⁴ Darauf antwortete der Papst mit der Enzyklika „Casti connubii“. Das darin festgeschriebene Familienleitbild galt bis zu Beginn der 1960er-Jahre.⁴⁵ Erstmals ging ein Papst ausführlich auf die Bedeutung der ehelichen Liebe ein und hob die Ehe als Lebensgemeinschaft hervor. An der zweckgebundenen Sexualität zur Zeugung von Nachkommen hielt aber auch „Casti connubii“ fest. Alles andere sei „Ehemissbrauch“. Die Enzyklika lehnte Empfängnisverhütung ab, gestand der Zeitwahlmethode aber einen gewissen Spielraum zu. Auch außerkirchlich erfuhr dieses Vorgehen Zustimmung. Der Leiter der bekannten Hamburger Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute äußerte dazu begeistert: Es ist bemerkenswert, mit welcher Instinktsicherheit und praktischen Klugheit wiedereinmal von der katholischen Kirche ein Ausweg gefunden wurde. Wie Sie wissen werden, besteht eine ganz feste Beichtpraxis, wonach die Methode der sogenannten unfruchtbaren Tage […] empfohlen wird. Diese halten zwar viele Ärzte für unzureichend usw. […]. Hier ist aber wenigstens eine klare Stellungnahme vorhanden, die weder in den Gesundheitsämtern noch bei der Aerztekammer zu finden ist.⁴⁶
Zu Beginn der 1950er-Jahre setzte sich in der deutschen katholischen Theologie zunehmend eine ganzheitliche Sicht auf die Ehe durch. Die Betonung lag auf einer personalen Liebes- und Lebensgemeinschaft, die auch eine personale Sexualität beinhaltete.⁴⁷ Die grundsätzliche Ablehnung der individuellen Geburtenregelung
Vgl. Fleckenstein, Ehe, 2008, S. 525. Vgl. auch Kapitel 4.5 Praxis der Eheberatung. Vgl. im Folgenden Fleckenstein, Ehe, 2008. Vgl. dazu auch Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 41 ff. Hannes Kaufmann an Bundesjustizministerium, Brief, 23. Juni 1953, BArch, B 141/49456, Bl. 50 ff. Vgl. Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 366.
258
4 Katholische Eheberatung
galt aber weiter. Eine neue Wendung trat ein, als 1961 die „Pille“ auf den Markt kam. Damit stand nunmehr Verhütung im Mittelpunkt der Diskussion, nicht mehr die Bewertung der Sexualität in der Ehe.⁴⁸ An der Auseinandersetzung nahm die Öffentlichkeit breiten Anteil. Die Geburtenregelung war damit ein zentrales Problem der kirchlichen Ehelehre.⁴⁹ Laien wollten Ehefragen weniger unter moralischen Gesichtspunkten und mehr als Heilsweg der Verheirateten verstanden wissen. Dies gelang mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ (GS) von 1965.⁵⁰ Zudem setzte der Papst 1963 eine Kommission zur Revision des kirchlichen Gesetzbuches ein. Eine der daraus folgenden Maßnahmen war die Verbesserung der rechtlichen Bestimmungen über „Mischehen“ 1966, die in „Casti connubii“ noch verurteilt worden waren.⁵¹ „Gaudium et spes“ sollte die Beschreibung der „Kirche in der Welt von heute“ sein.⁵² Die Pastoralkonstitution entwickelte eine moderne Theologie der Partnerschaft, die Ehe und Familie unter den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beschrieb (GS 47– 52).⁵³ In der Konstitution verband sich „die institutionelle Dimension der Ehe mit der personalen Haltung von Liebe und Treue und öffnet der Ehe den vollen Lebensraum“.⁵⁴ Der Aspekt der Lebensgemeinschaft hielt Einzug in die sakramentale Wesensdefinition der Ehe, deren Sinn sich nunmehr in der personalen Beziehung der Partner begründete. „Gaudium et spes“ beinhaltete auch ein Leitbild, das verantwortungsbewusste Elternschaft hervorhob und Sexualität als Ausdruck der Liebe positiv bewertete. Gleichzeitig blieb die traditionelle Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, die sich in „Lumen gentium“ wiederfand, bestehen. Jedoch verzichtete man auf eine naturrechtliche
Vgl. Fleckenstein, Ehe, 2008. Vgl. dazu auch Große Kracht, Klaus: „‚Elternrecht‘ und ‚Ehenot‘. Familienbilder und Wertewandel im westdeutschen Katholizismus der 1950er und 1960er Jahre“. In: Centrum für Religion und Moderne (Hrsg.): Preprints and Working Papers of the Center for Religion and Modernity. Münster 2018. Verfügbar unter: https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/religion_und_moderne/pre prints/crm_working_paper _18_gro__e_kracht.pdf, besucht am 18. Oktober 2020. Zur Haltung des KZI vgl. Adenauer, Paul: „Ein ‚Constanze‘ Interview“. In: Kölner Pastoralblatt, Nr. 11, November 1963, S. 342– 345. Pastorale Konstitution „Gaudium et Spes“. Über die Kirche in der Welt von heute, Papst Paul VI., 7. Dezember 1965. Eine weitere Neuregelung des Mischehenrechts erfolgte 1971. Pastorale Konstitution „Gaudium et Spes“. Über die Kirche in der Welt von heute, Papst Paul VI., 7. Dezember 1965. Vgl. Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 155 ff. Fleckenstein, Ehe, 2008, S. 528.
4.1 Katholische Kirche und Theologie im Wandel
259
Definition sowie Gehorsamsvorschriften.⁵⁵ Damit machte das Lehramt beim Geschlechterverhältnis zwischen Männern und Frauen Zugeständnisse an das auch unter Katholikinnen gestiegene Selbstbewusstsein und die veränderte Sicht auf partnerschaftliche Rollenverteilung.⁵⁶ Die Frage der Geburtenregelung wurde allerdings vertagt, was die Entfaltung der Konzilsaussagen schmälerte. Katholische Eheleute praktizierten bereits eine verantwortliche Elternschaft, bevor die offizielle Lehre der Kirche sie formulierte. Schon Ende der 1950er-Jahre lag das katholische Ideal von vier bis sechs Kindern weit über den gesellschaftlichen Vorstellungen einer Zweikindfamilie als Normalfall. Auch katholische Familien näherten sich immer mehr diesem Trend. Das KZI erkannte die veränderte Familienplanung an und auch das individuelle Bedürfnis nach Geburtenregelung: Während früher Kinder mit einer gewissen Selbstverständlichkeit hingenommen werden konnten, ist heute eine bewußte Entscheidung zum Kind notwendig. Verantwortliche Elternschaft ist deshalb nicht nur ein Zugeständnis an den Zeitgeist, sondern ein Feld der Bewährung im christlichen Glauben. […] Die Planung der Zahl und des Abstandes der Geburten unterliegt daher ausschließlich dem Gewissensurteil der Eltern.⁵⁷
Das Institut konstatierte, dass die Liebesheirat dazu führe, Ehe und Familie zu unterscheiden.⁵⁸ Es beobachtete, dass viele erst als Paar gemeinsam ihre Ehe leben und dann nach einigen Jahren Kinder bekommen wollten.Wenn die Kinder aus dem Haus waren, bestand die Ehe weiter. Sie wurde zum permanenten, die Familie überdauernden Faktor. Die Sexualethik des KZI entsprach damit derjenigen der kirchlichen Eheberatung. Beeinflusst von den allgemeinen Entwicklungen in der Gesellschaft machte das katholische Milieu innerhalb weniger Jahre tiefgreifende Wandlungen durch.⁵⁹ Sich verändernde Moralvorstellungen beeinflussten das Ehe- und Familienideal der
Zur Haltung des ehemaligen Leiters des KZI Paul Adenauer nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil vgl. Adenauer, Paul: „Ehe- und Familienseelsorge im Lichte des Konzils“. In: Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften 07/08 (1966/67), S. 175 – 183. Adenauer, Paul et al.: Christliche Einheit in der Ehe. München 1969. Zur Haltung Adenauers sowie des am KZI tätigen Rudolf Rüberg vgl. Konferenz der deutschsprachigen Pastoraltheologen (Hrsg.): Ehe und Familie. Pastorale 2, Handreichung für den pastoralen Dienst. Mainz 1973. Vgl. dazu auch Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 91 ff. Interkonfessioneller Arbeitskreis für Ehe- und Familienfragen (Hrsg.): Christliche Einheit in der Ehe. Mainz 1969, S. 13 f. Vgl. im Folgenden Rüberg, Rudolf: „Ehe und Familie im Wandel. Soziologische Aspekte“. In: Struck, Günter/ Loeffler, Lothar (Hrsg.): Einführung in die Eheberatung, Mainz 1971, S. 73 – 91, hier S. 78 f. Vgl. dazu Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 171 ff. Die Forderungen nach einer Liberalisierung des Scheidungsrechts stieß teilweise auf Widerstand. Vgl. Herzog, Politisierung, 2005, S. 182 ff.
260
4 Katholische Eheberatung
Gläubigen. Dies war auch in Laienarbeit und Theologie spürbar. Laien engagierten sich mit viel Selbstbewusstsein für ihren Auftrag, Ehen zu beraten und rezipierten die Dynamiken einer sich modernisierenden Gesellschaft.⁶⁰ Besonders katholische Akademiker standen dem zunehmenden gesellschaftlichen Pluralismus offen gegenüber.⁶¹ Eheberaterinnen hatten häufig einen akademischen Hintergrund, der ihre Sicht auf die Gesellschaft mitprägte. Das Eheideal der katholischen Kirche erfuhr von der Nachkriegszeit bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil eine tiefgreifende Transformation, die mit der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ Einzug in das offizielle Lehramt hielt. Die Ehe entwickelte sich von einem Vertrag zum Zweck der Zeugung von Nachkommen zu einer personalen Gemeinschaft, die von Gottes Liebe gesegnet war.⁶² Nach dem Konzil baute die Amtskirche die Eheberatung als nunmehr festen Bestandteil der Seelsorge aus.⁶³ Das Umfeld des KZI betonte bereits seit der Gründung den personalen Charakter der Ehe. Ein Referent auf der Tagung des Zentralinstituts von 1957 formulierte besonders deutlich den Gegensatz zum Lehramt: Ehe ist Gemeinschaft dieses ganz bestimmten Mannes und dieser einen ganz bestimmten Frau, die eins werden durch den vollpersonalen geistigen Akt des Ehegelübdes und die dieses Einssein vollziehen durch den leiblichen Akt der geschlechtlichen Vereinigung […]. Das bedeutet, daß die Feststellung, der Zweck der Ehe sei: 1. die Nachkommenschaft, 2. die gegenseitige Hilfeleistung und 3. das Heilmittel gegen die böse Begierlichkeit, daß dies zwar sachlich
Zur Tätigkeit der Caritas und ihrem Verhältnis zur Säkularisierung vgl. Kircher, Veronica: „Gedanken zum Wandel des Selbstverständnisses christlicher Caritas in den letzten Jahrzehnten“. In: Deutscher Caritasverband Freiburg (Hrsg.): 1897– 1972. 75 Jahre Deutscher Caritasverband. Freiburg im Breisgau [1972], S. 147– 151. Henkelmann, Andreas: Caritasgeschichte zwischen katholischem Milieu und Wohlfahrtsstaat. Das Seraphische Liebeswerk (1889 – 1971). Paderborn 2008, S. 413 ff. Vgl. ebd., S. 421 f. Doch auch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde in einer Publikation des KZI 1967 die Auffassung der Ehe, wie das Lehramt sie vertrat, als zu wenig personal kritisiert. Revers, W[ilhelm] J[osef ]: „Personales Werden – entscheidend für die Ehe“. In: Katholisches Zentralinstitut für Eheund Familienfragen (Hrsg.): Partnerbild und Ehe. Freiburg im Breisgau 1967, S. 7– 25, hier S. 10. Vgl. Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 367. Rölli-Alkemper schließt daraus: „Die Laienarbeit wurde damit innerkirchlich institutionalisiert und gleichzeitig professionalisiert.“ Dem wird in der vorliegenden Arbeit widersprochen. Die Institutionalisierung und Professionalisierung der Beratungsarbeit begann bereits zuvor, spätestens mit der Festlegung von Rahmenordnung und Richtlinien zur Eheberatung sowie dem Strukturausbau in den Diözesen wurden noch während des Vatikanischen Konzils die entscheidenden Schritte unternommen. Vgl. Kapitel 4.3 Professionalisierung.
4.1 Katholische Kirche und Theologie im Wandel
261
richtig ist. Jedoch in Hinblick auf das eigentliche Wesen der Ehe und auf ihre Sinnhaftigkeit in ihrer Aussage an der Peripherie bleibt.⁶⁴
Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil befasste sich der stellvertretende Direktor des KZI mit den Auswirkungen der pluralistischen Gesellschaft auf die Sicht der Ehe. Günter Struck⁶⁵ war der Ansicht, aufgrund der sozialen Wirklichkeit biete das katholische Milieu keinen verlässlichen Halt mehr. Er folgerte, in der Anonymität der Großstadt sei eine das Milieu verstärkende Sozialkontrolle nicht mehr möglich. Nun gehe es um die Fähigkeit des Einzelnen zur selbstständigen Gewissensentscheidung, was er positiv beurteilte. Die Hoffnung des modernen Menschen ruhe nun darauf, wesentliche Sinnerfahrungen in Liebe, Ehe und Familie zu machen. Diese Erwartungen überforderten insgesamt jedoch, wodurch Eheberatung zum Massenphänomen werde. Angesichts der Kirchenkritik erstaunte Struck, dass der kirchlichen Beratung großes Vertrauen entgegengebracht werde.⁶⁶ Dies stellte für ihn sowohl eine große Verpflichtung als auch eine besondere Chance für die Kirche dar. Dabei kam Eheberatung als Laiendienst eine wichtige Funktion zu.
4.1.3 Umgang mit katholischer Eugenik Bereits in der Nachkriegszeit boten kirchliche Organisationen vereinzelt Schulungskurse für Eheberaterinnen an. Auf einer Veranstaltung des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) machte sich 1950 aber Kritik bemerkbar: Die Eheberatung sei „katholischerseits zu wenig fundiert“ und verlaufe „weithin noch in den von Prof. Hermann Muckermann festgelegten Gleisen“.⁶⁷ Diese Andeutung,
Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen: Rundbrief an die Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen 2 (1958), H. 1, Vortrag Friedrich von Gagern, S. 12, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Günter Struck (25.6.1923 – 14.6. 2017) war als Facharzt für Neurologie und Psychiatrie tätig. Von 1964 an war er vier Jahre Leiter des medizinisch-anthropologischen Referats und stellvertretender Direktor des KZI. Danach wurde Struck bis zu dessen Auflösung 1974 Direktor des Zentralinstituts. Im Jahr 2006 wurde er mit der „Schauwecker-Medaille“ des Bundesverbandes der Deutschen Schriftsteller-Ärzte ausgezeichnet. Vgl. Küsters, Hanns Jürgen (Hrsg.): Konrad Adenauer – Der Vater, die Macht und das Erbe. Das Tagebuch des Monsignore Paul Adenauer 1961– 1966. Paderborn 2017, S. 317 sowie Zuber, Ulrike / Weller, Dietrich: „Günter Struck in memoriam“. Verfügbar unter: Bundesverband deutscher Schriftstellerärzte, http://bdsae.org/guenther-struck-in-memoriam-ulrike-zu ber-und-dietrich-weller/, besucht am 18. Oktober 2020. S. Struck, Günter: Ehenot – Ehehilfe. Geschichte und Gestalt katholischer Eheberatung in Deutschland. Limburg 1966, S. 34 ff. Maria Bornitz: Bericht, 12. April 1950, ADCV, 349.4, Fasz. 02.
262
4 Katholische Eheberatung
die Beratungspraxis habe eine nicht mehr zeitgemäße Kontinuität im ideellen Bereich, ist der einzige kritische Hinweis auf den Eugeniker Muckermann und die fortdauernden Auswirkungen seiner Ansichten, der in den vorliegenden Quellen zu finden ist.Vielmehr wurde Muckermann ansonsten im KZI und dessen Umfeld eher neutral oder sogar positiv erwähnt. Im Zusammenhang mit der angestrebten „Erneuerung der christlichen Ehe“⁶⁸ hieß es 1950, diese sei „von den Gedanken des verdienten Biologen Hermann Muckermann“ befruchtet.⁶⁹ Auch der erste Leiter des KZI erwähnte den Eugeniker 1955 lobend.⁷⁰ Die bekannte Eheberaterin Josepha Fischer-Erling bedauerte 1956, dass die Ansichten einiger verantwortungsbewusster Eugeniker nicht die verdiente Popularität erlangt hätten. Das gesellschaftliche Misstrauen lastete sie dem Missbrauch der Eugenik im Nationalsozialismus an.⁷¹ Wollte das KZI die ungebrochene Fortdauer katholischer Eheberatung betonen, berief es sich in der Regel auf Anna Beckmann, die bereits in der Weimarer Republik als Beraterin und Geschäftsführerin des Reichsausschusses für katholische Eheberatung tätig gewesen war. In manchen Fällen fiel auch ein Kommentar zu Muckermann als Vorreiter der Eheberatung oder des KZI. In den Jahren 1960 und 1961 verwies das Zentralinstitut auf Muckermann als Anstoß für die katholische Beratungsarbeit, die dann von Anna Beckmann in praktische Bahnen gelenkt worden sei.⁷² Nach Kriegsende hatte Muckermann weiterhin zu eugenischen Themen publiziert.⁷³ Er forderte 1946, die in seinen Augen vernachlässigte „erbgesunde Familie“ im Sinne einer positiven Eugenik zu unterstützen. Dies kontrastierte er mit der Beschreibung angeblich guter Zustände in Heil- und Pflegeanstalten. Die Aussage ist vor dem Hintergrund auffällig, dass im „Dritten Reich“ Menschen mit Behinderung und psychisch Kranke ermordet worden waren. Muckermanns erstmals 1938 mit kirchlicher Druckerlaubnis publizierter Eheratgeber Der Sinn der Ehe erschien 1947 in einer weiteren Auflage.⁷⁴ Darin verwies er auf die Erfolge der Eugenik und riet zu entsprechender Partnerwahl. Einige Jahre später revidierte der Theo-
Alfes/Schmitz, Wege, 1950, S. 108. Ebd., S. 109. Vgl. Korte, Bernhard: Verzeichnis der Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen im Bundesgebiet und Berlin 1955, [1955], S. I, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Vgl. Fischer-Erling, Eheberatung, 1956, Sp. 152 f. S. [Maria] Bornitz / [Hermann] Klens: Bericht über die Besprechung in der erweiterten Trägerschaft des Katholischen Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen am 16.05.1960, AEK, DBK, KZI 295, S. 2. Vgl. auch [Klens, Hermann]: Bericht über das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen, 14. April 1961, AEK, DBK, KZI 295, S. 3. Vgl. im Folgenden Klee, Ernst: Was sie taten – Was sie wurden. Ärzte, Juristen und andere Beteiligte am Kranken- oder Judenmord. Frankfurt am Main 1986, S. 147 ff. Muckermann, Hermann: Der Sinn der Ehe. Biologisch – ethisch – übernatürlich. Bonn 1947.
4.1 Katholische Kirche und Theologie im Wandel
263
loge zum Teil seine eugenischen Positionen. Der Sinn der Ehe scheint aber im Umfeld der katholischen Eheberatung keine relevante Rolle gespielt zu haben. Hinweise auf die Nutzung der Publikation sind nicht zu finden. Nicht nur Muckermann befasste sich weiterhin mit der Eugenik. Auch der bekannte Pastoralmediziner Albert Niedermeyer wertete 1952 eugenische Ansätze als regulären Baustein der Eheberatung und warnte vor biologischen „Mischehen“ ebenso wie vor religiösen und sozialen.⁷⁵ Seine Ansichten fanden sich auch innerhalb des KZI wieder.⁷⁶ Eugenik wurde tendenziell als positiv wahrgenommen, während ihre Umsetzung im Nationalsozialismus Ablehnung erfuhr.⁷⁷ Eine kritische Auseinandersetzung mit katholischer Eugenik ist, mit Ausnahme des erwähnten Schulungskurses, nicht festzustellen. Zumindest im Umfeld des Zentralinstitutes fand keine Aufarbeitung statt,⁷⁸ obwohl seit Beginn der 1960erJahre Anklagen gegen das Verhalten führender Katholiken im Nationalsozialismus den Beginn einer innerkatholischen Kirchenkritik darstellten.⁷⁹ Die Öffentlichkeit schien die katholische Beratungsarbeit allerdings nicht mit der Eugenik in Verbindung gebracht zu haben. Daher lobten auch christliche Autoren Muckermann anscheinend unwidersprochen.⁸⁰ Fischer-Erling schrieb 1951, dass konfessionelle Beratungsstellen einen stärkeren Zuspruch als öffentliche fänden, da letztere als Erbe der nationalsozialistischen Politik zuerst noch Vertrauen zurückgewinnen müssten.⁸¹ Hier zeigten sich die Nachwirkungen eugenischen Denkens, auch wenn sie nur noch wenig Einfluss auf die Praxis hatten.⁸²
4.1.4 Katholische Eheberatung in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik In der Nachkriegszeit orientierte sich die katholische Eheberatung an ihren Anfängen in der Weimarer Republik. Bestehende Einrichtungen arbeiteten mit hohen personellen Kontinuitäten weiter, neue Angebote entstanden. Eine schwierige Finanzlage und fehlender Überblick über die vorhandenen Stellen erschwerten den
Niedermeyer, Handbuch, 1952, S. 402 ff. Vgl. Kapitel 4.3.1 Vorstellungen von Ehe. Vgl. dazu Kapitel 4.5.1.4 Verwandtschaftsbeziehungen. Vgl. Kaminsky, Dunkel, 2008. Die Geschichte der Eugenik sowie katholischer Eugenik nach 1945 stellt ein Desiderat der Forschung dar. Vgl. Gatz, Konzil, 2008, S. 283. Vgl. Herzog, Politisierung, 2005, S. 124. Fischer-Erling, Josepha: „Katholische Eheberatung“. In: Caritas, H. 3 – 4, [Freiburg] 1951, S. 62– 68, hier S. 66, DZI. Vgl. Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 365 f.
264
4 Katholische Eheberatung
Start, wobei sich Caritas und KDFB weiterhin als Trägerverbände engagierten. Verschiedene Akteure warben für eine gemeinsame Organisationsstruktur mit dem Ziel, Weiterbildungen für Eheberaterinnen anbieten zu können und das Arbeitsgebiet zu vernetzen. Dafür setzte sich insbesondere Anna Beckmann ein, die wie in der Weimarer Republik eine zentrale Rolle in der Beratung einnahm. Aufgrund mangelnder Verschriftlichung lassen sich die in der Praxis besprochenen Themen kaum nachvollziehen. Zu beobachten ist jedoch eine entscheidende Diskrepanz. Ratsuchende empfanden ihre Lebensverhältnisse in der unmittelbaren Nachkriegszeit und die daraus resultierenden Schwierigkeiten in ihren Beziehungen als sehr belastend. Die Kirche hingegen führte Eheprobleme vor allem auf eine Abkehr von Gott zurück. Neben der Anknüpfung an Bekanntes wurden auch neue gesellschaftspolitische Akzente gesetzt.⁸³ Die Akteure bewerteten die Zeit des Nationalsozialismus negativ, hinterfragten aber beispielsweise die katholische Beteiligung an der Eugenikdebatte nicht. In ihrem Selbstverständnis knüpften die Eheberaterinnen an die katholischen Wurzeln ihrer Arbeit in der Weimarer Republik an, wobei sie die Sexualberatungsstellen explizit ablehnten.⁸⁴ Engagierte Beraterinnen führten noch existierende katholische Einrichtungen aus der Zeit der Weimarer Republik oder des Nationalsozialismus weiter. Ununterbrochen bestanden die Stellen in Berlin, Bochum, Bonn, Bremen, Frankfurt, Freiburg, Karlsruhe, Köln, München und Stuttgart, wobei nicht alle durchgehend für Ratsuchende geöffnet waren.⁸⁵ Personelle Kontinuität war ebenfalls gegeben. Beispielsweise war in der Eheberatung der Caritas Frankfurt durchgehend dieselbe Beraterin tätig. Weitere bereits in der Weimarer Republik existierende Einrichtungen, wie in Trier, Koblenz und Saarbrücken, eröffneten in der Nachkriegszeit wieder, häufig mit einem neuen Trägerverein.⁸⁶ Und auch Beckmann nahm in Bonn in der bereits 1931 gegründeten Beratungsstelle⁸⁷ „die Arbeit mit erfreulichem Erfolg wieder auf“.⁸⁸
Vgl. Raabe, Laienarbeit, 2008, S. 277. Vgl. Niedermeyer, Handbuch, 1952, S. 382. Vgl. Anna von Schoenebeck an Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen, Brief, 3. November 1952, AEK, DBK, KZI 296 sowie o. A.: [Rückmeldung] Zum Bericht über die Besprechung vom 22.1.1952, AEK, Gen. II 13.2a, 1 sowie Korte, Bernhard: Verzeichnis der Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen im Bundesgebiet und Berlin 1955, [1955], AEK, Gen. II 13.2a, 1. o. A.: Niederschrift der Gründung der vorbereitenden Sitzung / eines Kuratoriums für Eheberatung im Bistum Trier, Entwurf, 15. Oktober 1953. AEK, DBK, KZI 28. Vgl. Korte, Bernhard: Verzeichnis der Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen im Bundesgebiet und Berlin 1955, [1955], S. 9, AEK, Gen. II 13.2a, 1. [H. Klens]: Bericht über das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen, 14. April 1961, AEK, DBK, KZI 295, S. 3.
4.1 Katholische Kirche und Theologie im Wandel
265
Zumindest bis in die frühe Bundesrepublik waren Angebote selbst in Kirchenkreisen noch derart wenig bekannt, dass beispielsweise die von Josepha Fischer-Erling geleitete „kirchliche Beratungsstelle für Ehe- und Familienfragen“ 1949 in der kirchlichen Organisationsstruktur Kölns in den Verdacht geriet, sie führte ihren Namen zu Unrecht.⁸⁹ Auch den Landesbehörden in Rheinland-Pfalz waren die katholischen Beratungseinrichtungen in Trier und Koblenz kein Begriff.⁹⁰ Zwar bestanden Anfang 1949 etwa 25 katholische Eheberatungsstellen,⁹¹ aber selbst die Beteiligten hatten wenig Informationen zu deren Organisation und Anbindung, geschweige denn einen Gesamtüberblick. Das galt auch für die Caritas, die bei Kriegsende als große kirchlich-konfessionelle Wohlfahrtsorganisation weitgehend intakt geblieben war⁹² und auf regionaler Ebene Bemühungen für einen Neuaufbau von Stellen unterstützte.⁹³ Anna Beckmann, die ihre Einrichtung durch die Zeit des Nationalsozialismus hindurch aufrechterhalten hatte, gelang es 1946 erst nach mehreren Versuchen, der Caritas mitzuteilen, dass sie ihre Arbeit erneut aufgenommen hatte.⁹⁴ Dabei war bis mindestens 1948 weder ihr noch der Caritas klar, wer als Trägerverband für ihr Angebot fungierte.⁹⁵ Die Zentrale hatte fast ausschließlich Kenntnis von Beratungsstellen, die sich im näheren Umfeld des Hauptsitzes in Freiburg befanden. Sie lag in der streng abgeschotteten französischen Besatzungszone und war sowohl über Verkehrs- als auch andere Kommunikationswege schwer erreichbar, was sich negativ auf Informationsflüsse sowie die Steuerung ihrer Aktivitäten auswirkte.⁹⁶ Im Jahr 1949
Vgl. Grosche: Bescheinigung, 7. Juli 1949, AEK, Gen. II 13.2, 2a sowie Erzbischöfliches Generalvikariat: Anfrage, 1. Juli 1949, AEK, Gen. II 13.2, 2a. Vgl. Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz an Bundesminister der Justiz, Stellungnahme, 14. Mai 1956, BArch, B 141/49456, Bl. 77 f. Vgl. [Deutscher Caritasverband]: Rückmeldung zum Bericht über die Besprechung vom 22. Januar 1952, o. D., ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. Deutscher Caritasverband: „Die freie Wohlfahrtspflege in Deutschland, ihre Aufgaben und ihre Lage nach Zusammenbruch und Geldentwertung“. In: Ders. (Hrsg.): Denkschriften und Standpunkte der Caritas in Deutschland. Bd. 1: Die Zeit von 1897 bis 1949. Freiburg im Breisgau 1997, S. 701– 704. Vgl. im Folgenden Deutscher Caritasverband: Bericht über den augenblicklichen Stand katholischer Eheberatung, 18. März 1949, AEK, Gen. II 13.2, 2a/169 sowie Kreutz an Muhl-Schwarzenberg, 17. Juni 1949, AEK, Gen. II 13.2, 2a/169. Vgl. Anna Beckmann an Präsident, 15. April 1946, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. Anna Beckmann an Prälat Kreutz, 6. Januar 1948, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. Frie, Kontinuitäten, 1998, S. 117. Zur Lage der Caritas und deren Wiederaufbau vgl. Eder, Manfred: „Wiederaufbau und Neuorientierung“. In: Gatz, Erwin (Hrsg.): Caritas und Soziale Dienste. Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Die katholische Kirche, Bd. 5. Freiburg im Breisgau 1997, S. 280 – 294; Hammerschmidt, Wohlfahrtsverbände, 2005.
266
4 Katholische Eheberatung
arbeiteten in der dortigen Erzdiözese fünf neu gegründete „Kirchliche Beratungsstellen in Ehe- und Familienfragen“, die auch an Weiterbildungen teilnahmen, vermutlich solchen der Caritas. Drei weitere Einrichtungen befanden sich im Aufbau. Selbst einer ehemaligen Eheberaterin, die zu diesem Zeitpunkt auch Vorträge hielt, waren die Institutionen vor Ort nicht bekannt: „Ich habe noch nie davon gehört. Wer schult die Beraterinnen? Wie arbeiten diese? Wenn deren Arbeit so unspürbar ist, wie das hier in Freiburg der Fall ist, erhoffe ich nicht allzuviel Besserung von daher.“⁹⁷ Insgesamt ist für das Jahr 1949 von 25 bis maximal 30 Beratungsstellen in Westdeutschland auszugehen.⁹⁸ Vermutlich kannten auch nur wenige potenzielle Ratsuchende das Angebot, sodass die Sprechstunden nicht gut besucht waren. Als weitere Hindernisse kamen hinzu, dass die katholische Eheberatung aus Sicht der Caritas keine große Anziehungskraft besaß oder überhaupt Eheprobleme nicht als solche identifiziert wurden. Ratsuchende ließen sich „durch die katholische Wegweisung“ der Eheberatung „abschrecken“ oder suchten für persönliche Probleme, hinter denen letztlich Eheschwierigkeiten steckten, andere Angebote auf.⁹⁹ Auch Fischer-Erling empfand die Aufgabe, Eheberaterin zu sein, in der Nachkriegszeit als anspruchsvoll.¹⁰⁰ Somit war zwar bereits seit Kriegsende „eine ungehemmtere Entwicklung“¹⁰¹ der Eheberatung möglich, allerdings war die Arbeit wenig bekannt und kaum einheitlich koordiniert.
Elisabeth Muhl-Schwarzenberg an [Kuno] Joerger, 22. Juni 1949, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Elisabeth Muhl-Schwarzenberg hatte von 1930 bis 1932 die Soziale Frauenschule besucht und war die Leiterin der Kölner Eheberatungsstelle gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte sie in Baden, wo sie Vorträge zu Eheberatung und Ehevorbereitung hielt. Ursprünglich plante sie zudem eine Schule für Eheberaterinnen. Muhl-Schwarzenberg publizierte sehr bekannte, explizit katholische Eheratgeber. Vgl. [Caritas] an Bernhard Welte, Brief, 5. Juli 1945, ADCV, 349.4, KZI, Fasz. 02. Vgl. Elisabeth MuhlSchwarzenberg an Kreutz, Brief, 2. Juni 1949, ADCV, 349.4, Fasz. 02, sowie Muhl-Schwarzenberg, Elisabeth: Ehekompaß für alle Tage. München 1958. Zu Muhl-Schwarzenbergs Ratgeber vgl. Dressler, Bedrohung, 2013, S. 99 – 126. Vgl. o. A.: [Rückmeldung] Zum Bericht über die Besprechung vom 22.1.1952, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Anna Beckmann an [Josef ] Frings, 5. Mai 1949, AEK, Gen. II 13.2, 2a, S. 2. [o. A.]: Tagesordnung für die Sitzung des Zentralrates des Deutschen Caritasverbandes, 4. bis 6. April 1951, S. 22 f., ADCV, 111.055 – 1951/1. Noch 1971 sah der Leiter des KZI dasselbe Phänomen. Vgl. dazu Struck, Günter: „Entwicklung und Aufbau der Ehe- und Familienberatung“. In: Ders. / Loeffler, Lothar (Hrsg.): Einführung in die Eheberatung. Mainz 1971, S. 1– 19, hier S. 1 f. Auch der Umstand, dass in der Bundesrepublik eine Vielzahl von Beratungseinrichtungen mit oft unklaren Zuständigkeiten bestand, machte es Ratsuchenden womöglich schwer, die für sie adäquate Beratung zu finden. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 243. Vgl. Deutscher Caritasverband: Niederschrift der Beratungen vom 29. und 30. Oktober 1952, auszugsweise Abschrift, 1952, S. 2, ADE, JF 13. Ebd., S. 2.
4.1 Katholische Kirche und Theologie im Wandel
267
Im Jahr 1949 formulierte Beckmann ein Grundsatzpapier zur katholischen Eheberatung.¹⁰² Sie sollte denjenigen Menschen helfen, die einen Rat in Eheangelegenheiten benötigten. An die Person der Beraterin richtete sie klare Anforderungen. Diese solle eine „eigens vorgebildete verheiratete Frau“ sein. Im Sinne einer Seelsorgehilfe müsse die Hauptaufgabe „in der Pflege und Förderung des katholischen Eheideals“ liegen.¹⁰³ Die Autorin betonte die Sicherung eines körperlich und geistig gesunden Nachwuchses in kinderreichen Ehen, denn dies galt als Mitarbeit am Reich Gottes. Auch müssten Scheidungen verhindert und „wilde“ beziehungsweise nicht kirchlich geschlossene Ehen saniert werden. Über die direkte Eheberatung hinaus formulierte Beckmann Angebote an junge Eheleute und Heimkehrer, die bei nach Geschlecht getrennten Zusammenkünften Fragen der Eheführung diskutieren sollten. Mit welchen Wünschen die Ratsuchenden die Beratungsstellen in Anspruch nahmen, ist anhand der Aktenlage nicht nachzuvollziehen. Wiederkehrende Themen waren in der Nachkriegszeit jedoch Existenzängste, durch den Krieg hervorgerufene Gesundheitsprobleme, überreizte Nerven, langjährige Trennung und Wohnungsnot.¹⁰⁴ Aus den Beratungsbeispielen des KZI in den 1950er- und 1960erJahren lässt sich zudem rückschließen, dass kirchenrechtliche Fragestellungen einen breiten Raum eingenommen haben könnten.¹⁰⁵ Die Caritas sah die Ehe vor allem durch die wirtschaftlichen Verhältnisse und Heimatlosigkeit gefährdet, was mit einer inneren Zerrüttung einhergehe. Auch vorehelichen Geschlechtsverkehr betrachtete der Verband als eine der Hauptursachen für Eheprobleme.¹⁰⁶ Dies bereitete der katholischen Kirche ebenfalls Sorgen. Ansonsten führte sie Probleme in den Ehen jedoch weniger auf äußere Lebensverhältnisse zurück als vielmehr auf einen Abfall von Gott. Die Lösung lag für die katholische Amtskirche damit in einer Rechristianisierung der Ehe als Sakrament zu Gottes Verherrlichung.¹⁰⁷ In diesem
Vgl. im Folgenden [Beckmann, Anna]: Katholische Eheberatungsstellen, [1949], AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Ebd., S. 1. Vgl. Beckmann, Anna: Die Ehe ein Wagnis? Köln 1948, S. 26.Vgl. Meyer, Sibylle / Schulze, Eva: Von Liebe sprach damals keiner. Familienalltag in der Nachkriegszeit. München 1985. Vgl. Kapitel 4.5 Praxis der Eheberatung. Vgl. [o. A.]: Tagesordnung für die Sitzung des Zentralrates des Deutschen Caritasverbandes, 4. bis 6. April 1951, S. 24, ADCV, 111.055 – 1951/1. Vgl. [unleserlich]: Die Frau in Ehe und Familie, 15. Mai 1949, AEK, Gen. II 13.2, 2a / 156 – 161. Vgl. Alfes, Begriff, 1950. Ders. / Schmitz, Josef: „Erprobte Wege zur Erneuerung der christlichen Familie“. In: Bischöfliche Hauptarbeitsstelle für Frauenseelsorge Düsseldorf (Hrsg.): Die Frau in Kirche und Volk. Köln 1950, S. 108 – 112.
268
4 Katholische Eheberatung
Zusammenhang ist auch die Ablehnung interkonfessioneller Eheberatungen zu sehen.¹⁰⁸ Mit der Publikation Die Ehe ein Wagnis? ¹⁰⁹ von Beckmann erschien 1948 einer der ersten explizit katholischen Eheratgeber der Nachkriegszeit.¹¹⁰ Darin setzte die Autorin „die Anerkennung christlich-katholischer Grundsätze voraus“¹¹¹ und warnte vor Ehen, in denen die Partner verschiedenen Konfessionen angehörten. In diesen fehle eine einheitliche Linie des Denkens zum sittlichen Tun sowie zur Kindererziehung, was zu Enttäuschungen und Missverständnissen aller Art führe. Als weitere Ehegefahren nannte Beckmann Eifersucht, eine zu hohe Erwartungshaltung, ein größeres Interesse der Frau an ihren Kindern als an ihrem Mann, eine sehr kinderreiche oder auch kinderlose Ehe und die Frustration von Frauen, nachdem sie ihren Beruf für die Ehe aufgegeben hatten. Ebenso verwies sie auf „die kleinen Unebenheiten wie Vernachlässigung, Unhöflichkeit, Selbstsucht, Nörgeleien, Rechthabereien“. Diese „kleinen ständigen Belastungen“ seien sehr oft Ursachen der Zerrüttung, weniger „bewußte Gemeinheit oder Bosheit“.¹¹² Die Beraterin plädierte daher einerseits dafür, zur Vorbereitung der Ehe den freundschaftlichen Rat besonders der Mütter anzunehmen. Sie verdeutlichte jedoch auch, dass sich Dritte in eine bereits geschlossene Ehe nicht mehr einmischen sollten. Ihr Buch verstand Beckmann als Möglichkeit, Ehegefahren durch frühzeitiges Erkennen zu überwinden. Sie empfahl den Verheirateten, sich gegenseitig zu helfen und Verantwortung füreinander zu übernehmen, außerdem Vertrauen auf Gott, Bescheidenheit, Treue und „das zeitliche und ewige Glück des anderen zu fördern“.¹¹³ Beckmann versuchte, Schwierigkeiten zu lösen, indem sie zuvörderst auf die Frauen einwirkte. Dies entsprach der allgemeinen Tendenz in der Ratgeberliteratur.¹¹⁴ Die Seelsorge erkannte bereits an, „daß der heutigen Ehenot nicht allein mit moralischen Anweisungen beizukommen ist – so wichtig sie am rechten Orte sind“.¹¹⁵ Damit konnten in den Augen der Ratgeber wirtschaftlichen Sorgen, Erschöpfung und Angst nicht genügend begegnet werden.¹¹⁶
Vgl. Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 362. Beckmann, Ehe, 1948. Beckmann hatte der Caritas ein Manuskript gegeben, das dort den Eindruck machte, es sei eine Broschüre, „wie sie den Neulingen unter den Eheberaterinnen und den Organisatoren von Beratungsstellen Not täte“. M[aria] Bornitz an [Anna] Beckmann, Brief, 19. Februar 1948, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Beckmann, Ehe, 1948, S. 3. S. auch im Folgenden. Ebd., S. 15. Ebd., S. 28. Vgl. Kapitel 3.6.3.5 Heimkehrerehen. Alfes, Begriff, 1950, S. 34. Vgl. ebd.
4.1 Katholische Kirche und Theologie im Wandel
269
Noch bevor Die Ehe ein Wagnis? erschien, fand eine erste „Ehetagung“ mit etwa 40 Teilnehmern statt.¹¹⁷ Die Spannweite der Themen war breit. Anwesende diskutierten theologische Fragen, die Konflikte von Frauen und Müttern in der Ehe, die Flüchtlingsproblematik sowie Vergewaltigungen und damit zusammenhängende Gewissensentscheidungen von Medizinern.¹¹⁸ Die große Anzahl anwesender Theologen bedingte das Klima einer „Männerdiskussion“, wobei Beckmann den Umgang der Beraterinnen und Theologen miteinander als sehr positiv und anerkennend wahrnahm. Ihre Zusammenfassung an den Frauenbund war enthusiastisch und lässt ein Aufbruchsgefühl durchscheinen: Die Tagung habe „eine Höhe, die wirklich bemerkenswert ist, und uns allen, die wir aufgeschlossen sind, geradezu glücklich macht und neue Hoffnung schöpfen läßt […]. Die katholische Weite und Offenheit innerlich und äusserlich waren grossartig und wahrhaft belebend.“¹¹⁹ Zwei Jahre nach Kriegsende erschien die Eheberatung auch wieder auf der offiziellen Agenda des KDFB, der sich erneut in der Beratungsarbeit etablierte.¹²⁰ Aus den vorliegenden Quellen ist indirekt zu ersehen, dass katholische Träger die Beratungsstellen zunächst finanziell unterstützten. Diese Förderung brach mit der Währungsreform im Juni 1948 allerdings weg. Die Caritas sah ihre Existenz durch die Folgen der Reform stärker gefährdet als durch den Nationalsozialismus.¹²¹ Selbst Beckmanns Einrichtung in Bonn erhielt keine Finanzierung mehr. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Caritas „als einziger der Trägerverbände unentwegt zu den Unkosten der Geschäftsstelle in etwa beigetragen“.¹²² Danach musste die Eheberaterin ihre Beratung aus eigenen Mitteln aufrechterhalten.¹²³ Vereinzelt gingen jedoch kirchliche Spendenbeiträge ein.¹²⁴ Beckmanns Unkostenrechnung ergab von Juni 1948 bis 1949 einen Gesamtbetrag von 1.200 DM.¹²⁵ Auch dem KDFB war Beckmanns finanzielle Situation bewusst. Er gestand ein, dass die Eheberatung
Vgl. Gertraud Kempken an Frauenbund, Brief, 26. [unleserlich] [19]47, AKDFB, Ordner Ehetagung Hohenheim. Aus der Beschreibung der Diskussion lässt sich schließen, dass sich katholische Mediziner in einem „unlösbaren Konflikt zwischen Pflicht und Menschlichkeit“ dafür entschieden, aufgrund von Vergewaltigungen Abtreibungen durchzuführen. Ein Mediziner äußerte, dass „er diese Pflicht zugunsten der Menschlichkeit mehrmals verletzt habe, er, der sein Leben lang bekannt und stolz gewesen sei auf sein christliches Gewissen. Er danke Gott, dass es Beichtväter gebe, die dieses Martyrium zwar nicht aufheben aber doch erleichtern würden.“ Ebd., S. 6. Ebd., S. 3. Vgl. Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 135 ff. Vgl. Deutscher Caritasverband, Wohlfahrtspflege, 1997, S. 701– 704. Vgl. Anna Beckmann an Prälat Kreutz, 6. Januar 1948, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. Anna Beckmann an [Josef ] Frings, 5. Mai 1949, AEK, Gen. II 13.2, 2a, S. 1. Erzb. Geheimsekretär an Anna Beckmann, 12. Dezember 1949, AEK, Gen. II 13.2, 2a. Vgl. Anna Beckmann an [Josef ] Frings, 5. Mai 1949, AEK, Gen. II 13.2, 2a, S. 1.
270
4 Katholische Eheberatung
ohne solide Finanzbasis nicht arbeiten konnte.¹²⁶ Eigentlich war für Beraterinnen eine monatliche Vergütung in Form einer Aufwandspauschale von 60 bis 100 DM vorgesehen.¹²⁷ Noch bis mindestens 1958 blieb die Bezahlung hauptamtlicher Mitarbeiterinnen des KDFB unterdurchschnittlich. Die ideelle Motivation und die Verbundenheit der Eheberaterinnen mit ihrem Verband war daher wesentlich.¹²⁸ Aufgrund der finanziellen Situation sowie der fehlenden organisatorischen Zusammenführung der Stellen ging der Wiederaufbau nur langsam voran. Insbesondere die notwendigen Fortbildungen der Beraterinnen fanden nur eingeschränkt statt.¹²⁹ Daher warb Beckmann ab 1949 bei katholischen Verbänden¹³⁰ und Bischöfen für den Aufbau einer neuen Organisationsstruktur. Sie verlieh ihren Forderungen Autorität, indem sie an ihre früheren Verdienste und den Auftrag der Fuldaer Bischofskonferenz von 1927 erinnerte.¹³¹ Zudem schrieb sie ihre Korrespondenz zum Teil unter dem Absender „Geschäftsstelle der katholischen Eheberatungen Deutschlands“ oder „Konferenz der Kath. Eheberatungsstellen Deutschlands“.¹³² Es handelte sich dabei um Bezeichnungen, die nur in zwei weiteren Quellen¹³³ vorkamen und lediglich von ihr benutzt wurden.¹³⁴ Beckmann signalisierte mit dieser vermutlich eigenen Namensschöpfung sowohl eine Kontinuität ihrer Arbeit als auch einen Neuanfang. In ihrem Plädoyer für einen Zusammenschluss der katholischen Einrichtungen betonte sie die Notwendigkeit, gegen den Einfluss nichtkonfessioneller Sexual- und Eheberatungsstellen in liberalen Städten anzugehen. Explizit forderte sie die Männer auf, für eine Professionalisierung und
[Gertrud] Ehrle an [Anna] Beckmann, Brief, 15. Februar 1949, AKDFB, Ordner Eheberatung Korrespondenz 1946 bis 1952. Vgl. [Beckmann, Anna]: Katholische Eheberatungsstellen, [1949], AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Vgl. Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 28 f. Ein erster Hinweis auf Schulungskurse des KDFB findet sich für Januar 1948. Vgl. M. Bornitz an [Anna] Beckmann, 19. Februar 1948, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. Anna Beckmann an [Gertrud Ehrle], Brief, 20. April 1950, AKDFB, Ordner Eheberatung Korrespondenz 1946 bis 1952. Vgl. im Folgenden Anna Beckmann an [Josef ] Frings, Brief, 5. Mai 1949, AEK, Gen II 13.2, 2a. Anna Beckmann an [Gertrud Ehrle], Brief, 20. April 1950, AKDFB, Ordner Eheberatung Korrespondenz 1946 bis 1952. Vgl. Erzb[ischöflicher] Geheimsekretär an Anna Beckmann, Brief, 12. Dezember 1949, AEK, Gen. II 13.2, 2a sowie o. A.: Auszug aus dem „Nachriechtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge“ Nr. 6/50, [1950], ADE, CAW 1117. 1949 wird zudem in einem vermutlich von Beckmann verfassten Grundsatzpapier unter ihrer Adresse eine „Geschäftsstelle der Trägerverbände“ erwähnt. In diesem wird sie weiterhin als „Leiterin der Reichskonferenz kath. Eheberatungsstellen“ bezeichnet. Vgl. [Beckmann, Anna]: Katholische Eheberatungsstellen, [1949], AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963.
4.1 Katholische Kirche und Theologie im Wandel
271
Ausdifferenzierung der Beratungsarbeit tätig zu werden – und letztlich die Führung zu übernehmen. Katholische Eheberatung dürfe nicht allein auf den Schultern vorgeschulter, wohlmeinender Frauen ruhen. Alle kath. Organisationen, vorallem [sic] die kath. Akademiker u. unter ihnen die Sachverständigen: Seelsorger, Ärzte, Psychiater, Juristen etc. müssen sich mitverantwortlich fühlen. Die kath. Frauenorganisationen können nicht viel mehr leisten als die Bereitstellung von Eheberaterinnen. Nach meiner Meinung müßte ein Gremium von führenden kath. Akademikern nach außenhin [sic] die Kath. Eheberatungsidee mitvertreten. […] Wir müssen etwas Besonderes tun […]. Ich glaube, daß wir in Zukunft nur dann erfolgreich sein werden, wenn die Autorität der Kirche betont hinter uns steht.¹³⁵
Der KDFB arbeitete eng mit Beckmann zusammen.¹³⁶ Auch die Caritas hatte bereits 1948 den Wunsch nach größerer Vernetzung,¹³⁷ die schließlich sowohl innerhalb des Verbands im Sinne diözesaner Arbeitsgemeinschaften als auch auf einer die Wohlfahrtsorganisationen übergreifenden Ebene anlief.¹³⁸ Treibendes Element wurde mit der Zeit die Sorge, bewährte Eheberaterinnen könnten aufgrund ihres Alters ausscheiden.¹³⁹ Die Beraterin war 1950 68 Jahre alt, und besonders für ihr einzigartiges Engagement galt es, eine Nachfolge zu finden. In dieser Rolle sah sich der KDFB: „Meiner Meinung nach ist die Eheberatung eine solch wichtige Aufgabe des Frauenbundes, daß sie unbedingt tatkräftig von uns in die Hand genommen werden müßte […]. Schließlich muss sie doch auch von einer verheirateten Frau getragen werden. […] Wer wird sich denn nun um die Eheberatung kümmern? Wir können Frau Beckmann auf keinen Fall damit allein lassen.“¹⁴⁰ In diesem Sinne war auch der Nachruf verfasst, den der KDFB nach ihrem Tod 1952 veröffentlichte.¹⁴¹ Einigkeit herrschte, dass ein Überbau notwendig war, der eine möglichst breite Grundlage haben und den beide Geschlechter tragen sollten. Es wäre erforderlich, daß die katholischen Verbände auf diesem Gebiet arbeitsgemeinschaftlich vorgingen. Nicht bloß Frauenbund, Frauenseelsorge und Caritasverband, […] sondern nicht minder Kolpingsfamilie, Arbeitervereine (Werkvolk), Junge Mannschaft (Junge Familie), Männerwerk, Berufsverbände und Katholische Jugend […]. Die beratende Arbeit ist sowohl von
Anna Beckmann an [Josef ] Frings, Brief, 5. Mai 1949, AEK, Gen. II 13.2, 2a. Vgl. Gerta Krabbel, Brief, 17. Januar 1950, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. Kreutz, Brief, 4. Oktober 1948, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. Franz Müller an [Hermann] Klens, 10.10.51, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. Struck, Ehenot, 1966, S. 49. o. A. an [Berna] Kirchner, Brief, 12. Dezember 1950, AKDFB, Ordner Eheberatung Korrespondenz 1946 bis 1952. Vgl. Krabbel, Anna Beckmann, 1952. Vgl. Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 139.
272
4 Katholische Eheberatung
Männern wie von Frauen durchzuführen […]. Es bedarf […] der Erarbeitung neuer Grundlagen durch katholische Fachleute.¹⁴²
Auch wenn der KDFB ein gemeinsames Vorgehen wünschte, betonte er immer wieder die ihm von der Fuldaer Bischofskonferenz zugewiesene Kompetenz.¹⁴³ Die Briefwechsel innerhalb der Caritas verdeutlichen, dass die innerkirchliche Konkurrenz, wie sie bereits in der Weimarer Republik vorhanden gewesen war, weiterbestand.¹⁴⁴ Ab 1950 traten verschiedene katholische Organisationen in gemeinsame Beratungen ein.¹⁴⁵
4.2 Das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen 4.2.1 Vorgeschichte und Gründung Die Bischöfe begrüßten den Wiederaufbau katholischer Eheberatung als diözesane Aufgabe zwar, die Notwendigkeit einer Dachorganisation sahen sie jedoch nicht.¹⁴⁶ Mit der Gründung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (DAJEB) wurde allerdings offensichtlich, dass ein größeres Engagement notwendig war, um sich gegen diese Konkurrenz durchzusetzen. Auch eine stärkere Koordination war erforderlich, sollte die katholische Beratungsrichtung wie erwünscht eine Führungsrolle einnehmen. Ab 1950 befasste sich der Paderborner Erzbischof Lorenz Jaeger im Auftrag der Bischofskonferenz mit der Aufgabe, ein katholisches Gegenstück zur DAJEB einzurichten. Sein Verdacht, diese stimme bei der Geburtenregelung nicht mit der katholischen Kirche überein, führte dazu, dass er katholischen Stellen abriet, dort Mitglied zu werden. Ausschlaggebend für ein weiteres Engagement der Bischofskonferenz wurden die Fortbildungen der DAJEB.¹⁴⁷ Dort ging es ebenfalls um das Thema der Geburtenkontrolle. Da katholische Eheberaterinnen bereits die Kurse der DAJEB besuchten, bestand aus Sicht der Bischöfe nun Handlungsbedarf. Spätestens ab diesem Zeitpunkt nahmen sie verstärkt Einfluss.¹⁴⁸
Maria Bornitz, Aktennotiz, 12. April 1950, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. Gerta Krabbel, Brief, 28. September 1950, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. Maria Bornitz, Aktennotiz, 12. April 1950, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. o. A. an Frau Hopmann, 17. März 1950, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. im Folgenden Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 362 f. Vgl. dazu auch Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 231 f. Vgl. Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 138.
4.2 Das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen
273
Seit Ende 1951 trafen sich Vertreter der Frauenverbände sowie der Caritas, um über ein gemeinsames Institut zu beraten. Die Eheberaterin Anna Beckmann versuchte, über einen Fragebogen systematische Informationen zur Anzahl und Arbeit der katholischen Beratungsstellen zu erhalten.¹⁴⁹ Am 2. April 1952 wurde das Katholische Zentralinstitut (KZI) gegründet. Mit den Vorbereitungen hatte Jaeger Prälat Hermann Klens beauftragt. Dieser Schritt stellte in der Rückschau auch katholischer Beraterinnen den Beginn einer zentral organisierten Eheberatung dar.¹⁵⁰ Bemühungen darum waren allerdings nicht neu. Zuvor hatten sich bereits Beckmann sowie die Caritas um eine entsprechende Zusammenarbeit in der Katholischen Arbeitsgemeinschaft Ehe- und Familie bemüht.¹⁵¹ Letztere sollte unter der Geschäftsführung des Caritasverbandes sowohl in den einzelnen Diözesen als auch überdiözesan Beratungsstellen fördern, diese betreuen und die Weiterbildung von Beraterinnen sichern.¹⁵² Das Bemühen der Verbände, die Bischöfe für einen Ausbau der Eheberatung zu gewinnen, zeigte erst durch die Konkurrenz zur DAJEB Wirkung.¹⁵³ Dabei entwickelte sich Jaeger zu einem Fürsprecher im Sinne der Verbände.¹⁵⁴ Vonseiten der Bischofskonferenz blieb er für das KZI zuständig.¹⁵⁵ Mit dem Auftrag, eine zentrale Einrichtung zu gründen, verringerte die Kirche nunmehr den Einfluss von Frauen in der Eheberatung auf institutioneller Ebene. Zudem wirkte sie auf die vormals allein von den Verbänden getragene Beratungsarbeit ein.¹⁵⁶ Letztere suchten zu begründen, warum ihre Kooperation bei der Gründung des Instituts relevant sei. Der Frauenbund nutzte darüber hinaus bereits kurz nach Gründung des KZI seinen Nachruf auf Beckmann, um die eigene Rolle zu betonen.¹⁵⁷ Darin hieß es, eigentlich habe Beckmann selbst die Gründung angestoßen.¹⁵⁸ Der Zentralverband der katholischen Frauen- und Müttergemeinschaften (KFD) verwies dagegen auf Klens’ Rolle: „Seit 1952 gibt es mit Unterstützung der Bischöfe das ‚Katholische Zentralin-
o. A.: Niederschrift der Gründung der vorbereitenden Sitzung / eines Kuratoriums für Eheberatung im Bistum Trier, Entwurf, 15. Oktober 1953, AEK, DBK, KZI 28. Jost/Zelazny, Jahre, [1988], S. 63. Vgl. Kapitel 4.2 Das KZI. Vgl. Dold, Elisabeth: Tagesordnung für die Sitzung des Zentralrates des Deutschen Caritasverbandes vom 03. bis 05. Oktober 1951, o. D., ADCV, 111.055 – 1951/1. Vgl. Kapitel 4.4 Zusammenarbeit mit DAJEB und EZI. Vgl. o. A. an Werner Mühlenbrock, Brief, 14. Januar 1951, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Ab 1963 war Bischof Josef Stangl für das KZI zuständig. Vgl. Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 144. Vgl. ebd., S. 139. Vgl. Krabbel, Beckmann, 1952, S. 94.
274
4 Katholische Eheberatung
stitut für Ehe- und Familienfragen‘ in Köln, dessen Aufbau von Hermann Klens maßgeblich gefördert wurde.“¹⁵⁹
4.2.2 Organisation Mit der Gründung des KZI im Jahr 1952 wurde die Vernetzung, die sich die Akteure der katholischen Eheberatung gewünscht hatten, endlich erreicht. Was dies nun konkret bedeuten sollte, führte von Beginn an zu Diskussionen. Mangelnde Organisation hatte zur Folge, dass die rechtliche Konsolidierung des Zentralinstituts erst 1961 abgeschlossen war. Bis in die 1960er-Jahre hatte das KZI zudem mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen, die zwischenzeitlich sein Fortbestehen gefährdeten. Im Zuge des rechtlichen und finanziellen Ausbaus erfolgte dann eine strukturelle Neuorganisation, mit der eine Professionalisierung der Arbeit einherging.¹⁶⁰ Prälat Hermann Klens betrachtete das KZI als einen „Neuaufbau des im Jahre 1932 gebildeten ‚Reichsausschusses für katholische Eheberatung‘“.¹⁶¹ Ursprünglich bestand der Plan, das Institut in Bonn anzusiedeln, wofür Anna Beckmann in ihrem Haus Räume zur Verfügung stellen wollte.¹⁶² Nach ihrem Tod 1952 sprach aus Sicht der Trägerverbände aber nichts mehr für diesen Standort.¹⁶³ Am 2. April 1952 gründeten in Köln folgende katholische Verbände das Zentralinstitut für Eheberatung: der Deutsche Caritasverband, der KDFB, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, das Katholische Männerwerk, die Katholische Arbeiter-Bewegung sowie der Zentralverband der Katholischen Frauen- und Mütter-
Rocholl-Gärtner, Anwalt, 1978, S. 123. Dieser Ansicht ist auch Ernst Beier, der ab 1963 eine „kontinuierliche Entwicklung“ ausmacht. Beier, Ernst: „50 Jahre Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Bistum Regensburg“. In: Diözese Regensburg (Hrsg.): 50 Jahre Kath. Ehe- Familien- u. Lebens-Beratung. Diözese Regensburg 1955 – 2005. [Regensburg 2005], S. 12– 19, hier S. 13. Klens, Hermann: Bericht über die Besprechung betr. Neuaufbau der Eheberatung und Errichtung eines Institutes für Eheberatung am 22.1.1952, o. D., ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. [Hermann Klens] an Bischöfliche Finanzkammer Münster, Brief, 9. Oktober 1952, AEK, DBK, KZI 295. Auch die evangelische Kirche sah das KZI als Wiedergründung. Vgl. Eckart, Individuation, 1999, S. 213. Klens, Hermann: Bericht über die Besprechung betr. Neuaufbau der Eheberatung und Errichtung eines Institutes für Eheberatung am 22.1.1952. An die Teilnehmer an der Besprechung zur Nachprüfung und evtl. Ergänzung, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Vgl. [Hermann] Klens an die Trägerverbände, Brief, 12. Mai 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Die Leitung der Bonner Eheberatung übernahm Käthe Kramer. Viereinhalb Stunden die Woche war die Beratungsstelle geöffnet, Träger waren das Dekanat Bonn sowie die Caritas. Vgl. Korte, Bernhard: Verzeichnis der Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen im Bundesgebiet und Berlin 1955, [1955], S. 9, AEK, Gen. II 13.2a, 1.
4.2 Das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen
275
gemeinschaften.¹⁶⁴ Alle waren im Vorstand vertreten. Als Träger fungierte eine Arbeitsgemeinschaft. Um eine bessere Finanzierung zu garantieren, traten ihr bis 1961 elf zusätzliche Verbände bei, darunter die Gemeinschaft der Elisabeth-Konferenzen.¹⁶⁵ Im selben Jahr erfolgte dann die Umwandlung in einen Trägerverein, der auch einen Eintrag im Vereinsregister erhielt. Damit hatte das „Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen e. V.“ erstmals eine klare Struktur erhalten. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Institut „ohne feste Form“ gewesen,¹⁶⁶ da sich die beteiligten Verbände bei der Gründung nicht auf eine Organisations- und Rechtsform geeinigt hatten. Selbst der Name des Instituts war unklar und wurde verschieden wiedergegeben.¹⁶⁷ Eine Vereinsgründung stand zur Debatte, erfolgte aber nicht.¹⁶⁸ Als Arbeits- und Verwaltungsstruktur war ursprünglich ein aus den Trägerverbänden bestehender Verwaltungsrat sowie ein Arbeitsausschuss aus ständigen Mitgliedern vorgesehen. Hinzu sollten korrespondierende Mitglieder verschiedener Fakultäten kommen, die je nach Bedarf zur Mitarbeit hätten herangezogen werden können.¹⁶⁹ Weshalb dies nicht umgesetzt wurde, geht aus den Akten nicht hervor. Die Caritas kritisierte die fehlende Struktur bereits nach der Gründung.¹⁷⁰ Auch der KDFB mahnte im Laufe der Jahre immer wieder Handlungsbedarf an, konnte sich jedoch nicht durchsetzen.Wiederkehrende Fragen, zum Beispiel die nach dem Verhältnis des KZI zu anderen katholischen Einrichtungen, wurden erst angegangen, als die finanzielle und personelle Lage die Existenz des
Explizit wurde darauf hingewiesen, dass das Zentralinstitut auch von den katholischen Männervereinen mitgetragen werden solle, die im Reichsausschuss nicht vertreten gewesen seien. Entgegen der Wahrnehmung, Eheberatung sei bis zu diesem Zeitpunkt nicht von ihnen unterstützt worden, waren sie jedoch sehr wohl bereits im Reichsausschuss zugegen gewesen. S. o. A.: Reichsausschuss für katholische Eheberatung, Abschrift, ADCV, 349.4, Fasz. 02; vgl. o. A.: [Rückmeldung] Zum Bericht über die Besprechung vom 22.1.1952, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Vgl. Bericht über das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen in Köln, AEK, DBK, KZI 295, S. 5. [Bernhard] Korte: Jahresbericht 1961 des Katholischen Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen, 24. Februar 1962, S. A. Klens nannte es „Institut für Eheberatung“. Vgl. Hermann Klens, Bericht, [Januar] 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 07 oder „kath. Zentralarbeitsgemeinschaft für Eheberatung“. [Hermann] Klens an [Alois] Eckert, Brief, 16. Mai 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Die Caritas schlug den Namen „Katholische ZentralArbeitsgemeinschaft für Eheberatung“ vor, vgl. Kuno Joerger an [Hermann] Klens, 15. Februar 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Letztlich setzte sich die Bezeichnung „Zentralinstitut für Eheberatung“ durch, da „die Bischofskonferenz in Fulda eine Gründung unter diesem Namen beschlossen hat und weil Erzbischof Dr. Jäger auch immer diese Bezeichnung gebraucht“. [Hermann] Klens an [Alois] Eckert, Brief, 16. Mai 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Vgl. [Alois Eckert] an Hermann Klens, Brief, 22. April 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Vgl. [Maria] Bornitz an [Walter] Baumeister, Bericht, 14. Februar 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. [Alois Eckert] an Hermann Klens, Brief, 22. April 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 07.
276
4 Katholische Eheberatung
Institutes ab 1959 in Frage stellte.¹⁷¹ Der mit der Beurteilung der Situation beauftragte Justiziar konstatierte, dass bei der Gründung „nicht die Maßnahmen vollzogen worden sind, die nun einmal für ein Funktionieren einer derartigen Zentralstelle unerläßlich sind“.¹⁷² Für ihn waren die rechtlichen Grundlagen nicht erkennbar und er konnte die Frage, ob die Trägerverbände eine Gesellschaft nach bürgerlichem Recht oder ein nicht rechtsfähiger Verein waren, nicht beantworten.¹⁷³ Da die Rechtsform eine wesentliche Bedeutung für Verbindlichkeiten und Haftungen hatte, riet er dringend zu einer Klärung. Dabei ging es ihm auch darum, die katholische Beratung zu konturieren und gegen Konkurrenz zu abzugrenzen: „In Hinblick auf die […] sehr ernst zu nehmende, auf interkonfessioneller Basis arbeitende Tätigkeit der DAJEB [Name gekürzt] in Detmold sollte unverzüglich die gesamte kath. Arbeit in dem genannten Sachbereich auf einen neu zu bildenden Rechtsträger zugeführt werden“, damit dieser „ein vollwertiges und ernst zu nehmendes Instrument für diese kath. Facharbeit und ein Gegengewicht gegen die bestehenden nicht katholischen Einrichtungen darstellt“.¹⁷⁴ Der Prozess, den die Trägerverbände mit der rechtlichen Konsolidierung des Instituts begonnen hatten, wurde mit der Umstrukturierung der Arbeit und des Personals fortgesetzt. Ergebnis war die Professionalisierung der katholischen Eheberatung.¹⁷⁵ Ursprünglich hieß es in der Planung des Zentralinstitutes: „Besetzt werden soll die Arbeitsstelle mit einem Leiter und einer Leiterin.“¹⁷⁶ Mit dem Mediziner Bernhard Korte¹⁷⁷ amtierte schließlich jedoch lediglich ein Leiter, den eine Sekretärin unterstützte. Die gleichberechtigte Einbeziehung einer Frau in die Führung entfiel mit der Begründung, dass sich Beckmann ehrenamtlich an der Arbeit beteiligen sollte.¹⁷⁸ Als diese allerdings kurz nach der Gründung 1952 überraschend
Vgl. Kapitel 4.2.4 Finanzstruktur. [Maria] B[ornitz] an [Hermann] Klens, Briefanhang Dr. Klein, 14. Mai 1959, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Auch das Gründungsdatum des KZI wurde z. T. verschieden wiedergegeben. Dennoch lässt sich dieses eindeutig auf den 2. April 1952 festlegen.Wenn von einer späteren Gründung gesprochen wird (z. B. Erzbischöfliches Generalvikariat [Köln], Bescheinigung, 26. März 1953, AEK, Gen. II 13.2a,1), bezieht sich dies auf das Datum des Arbeitsbeginns Bernhard Kortes, der als Leiter des Zentralinstitutes im Mai 1952 seine Arbeit aufnahm, und nicht auf die Gründungsversammlung. Ebd. Vgl. Kapitel 4.3 Selbstverständnis. [Maria] Bornitz an [Walter] Baumeister, Bericht, 14. Februar 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Bernhard Korte (geb. 18. 8.1920) wurde in Medizin promoviert und erhielt seine Approbation 1947. Eine bereits begonnene psychotherapeutische Ausbildung brach er ab, als er 1952 Leiter des KZI wurde. Mit der Erweiterung des Zentralinstituts wurde Kortes Position 1962 einem Direktor (Paul Adenauer) untergeordnet, er selbst wurde Leiter des medizinisch-anthropologischen Referats. Im März 1963 übernahm Korte die Leitung der Höheren Fachschule für Sozialarbeit in Köln. Vgl. [Hermann] Klens an [Alois] Eckert, Brief, 16. Mai 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 07.
4.2 Das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen
277
starb, fehlten dem KZI sowohl eine bekannte Führungspersönlichkeit als auch eine wesentlich am Institut beteiligte Frauenfigur. Dabei war eine weibliche Leitung oder zumindest eine Doppelspitze für die Verbände ein wichtiges Thema.¹⁷⁹ Insbesondere der KDFB beklagte die fehlende weibliche Führung und bemühte sich, Frauen einen größtmöglichen Einfluss zu verschaffen.¹⁸⁰ Für die Bischofskonferenz spielte das jedoch keine Rolle. Sie lehnte eine personelle Ausweitung wegen fehlender finanzieller Mittel mehrfach ab.¹⁸¹ Korte war nach einer Besprechung mit dem Beauftragten der Bischofskonferenz und der Zustimmung der Verbände eingestellt worden.¹⁸² Mit der Institutsgründung verringerte sich der Einfluss von Frauen in der katholischen Eheberatung. Die weibliche Leitung gab es nicht mehr.¹⁸³ Fischer-Erling versuchte, als Präsidiumsmitglied des Frauenbundes und dessen Vertreterin im Institut die Leerstelle durch „intensive Mitarbeit“¹⁸⁴ auszugleichen. Sie war sowohl eine anerkannte Expertin als auch unter ihren Kolleginnen beliebt.¹⁸⁵ Im Jahr 1962 erfuhr das KZI eine Umstrukturierung und Erweiterung, doch auch dies führte nicht zu mehr weiblicher Beteiligung an den Führungsaufgaben. Korte unterstand nunmehr einem Direktor, er selbst wurde Leiter des neu geschaffenen medizinischanthropologischen Referats. Leiter des Gesamtinstituts war zu Beginn Klens¹⁸⁶, Berater zu moraltheologischen Fragen Augustinus Frotz¹⁸⁷. Dieser fungierte zu-
Vgl. dazu Kapitel 4.2.5 Auseinandersetzungen um die Ausrichtung. Vgl. Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 138 ff. Vgl. [Hermann] Klens an [Alois] Eckert, Brief, 16. Mai 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 07. [Hermann] Klens an Trägerverbände Zentralinstitut, Brief, 24. Juni 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. Klens, [Hermann]: Bericht über die Sitzung am 17. April 1959, o. D., AEK, DBK, KZI 295. Vgl. Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 144. Josepha Fischer-Erling an [Maria] Bornitz, Brief, 17. Mai 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. [Elisabeth Dold] an [Bernhard] Korte, Brief, 18. September 1956, AEK, DBK, KZI 385. Hermann Klens wurde zeitgenössisch zwar ebenso wie Bernhard Korte als „Leiter“ bezeichnet, hatte jedoch eher die Funktion eines Vorstandes. Vgl. [Bernhard] Korte: Jahresbericht 1961 des Katholischen Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen, 24. Februar 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Augustinus Frotz (25. 5.1903 – 12.11.1994) begann nach der Volksschule eine kaufmännische Lehre, die er abbrach, um Priester zu werden. Er holte zunächst das Abitur nach. Anschließend studierte Frotz Theologie und schloss mit Promotionen in Philosophie und Theologie ab. 1930 empfing er die Priesterweihe. Während des „Dritten Reiches“ war er als Diözesanjugend- und Evakuiertenseelsorger tätig. Nachdem er 1962 zum Weihbischof in Köln ernannt worden war, nahm der Theologe als Konzilsvater am Zweiten Vatikanischen Konzil teil. Gleichzeitig geistlicher Beirat des KDFB und Mitglied von dessen Zentralvorstand, setzte er sich dafür ein, in „Gaudium et spes“ Frauen stärker zu berücksichtigen. Auch trat er für die Erneuerung des Diakonats ein. 1968 führte Frotz im Kölner Dom die weltweit erste Weihe verheirateter Männer zu ständigen Diakonen durch. Vgl. Sauser, Ekkart: „Weihbischof Dr. Augustinus Frotz“. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. VIX. Herzberg 1998, Sp. 1009 – 1012. Vgl. Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 379 f.
278
4 Katholische Eheberatung
gleich als geistlicher Beirat des Frauenbundes, wo er sehr geschätzt war.¹⁸⁸ Die Bischofskonferenz wünschte zudem, das Institut um einen Theologen zu erweitern. Ende 1962 übernahm Paul Adenauer¹⁸⁹ die Direktion des KZI. Ihm zugeordnet wurden in den folgenden zwei Jahren ein medizinisch-anthropologisches, ein sozialwissenschaftlich-juristisches und ein theologisches Referat. Da die Referate ihre Aufgaben möglichst selbstständig wahrnehmen sollten, übernahm derjenige Referatsleiter die Direktoratsaufgaben, der dazu jeweils am geeignetsten schien.¹⁹⁰ Adenauer betreute neben seiner Position als Direktor das theologische Referat,¹⁹¹ das Elemente einer zeitgemäßen Theologie von Ehe und Familie zusammenfügen sollte. Vorgesehen war, diese Erkenntnisse in die Bildungsarbeit sowie die Ehe- und Familienseelsorge einfließen zu lassen.¹⁹² Die Referate wurden im Laufe der folgenden zwei Jahre ausgebaut, bis sie aus jeweils einem Referenten und einer Sekretärin bestanden. Hinzu kamen ein „Dozent und Referent im Außendienst“, der örtliche Initiativen für die Ehevorbereitung und -beratung anregen und über die
Vgl. ebd., S. 267 ff. Paul Adenauer (18.1.1923 – 05.08. 2007) wurde 1951 zum Priester geweiht. Zwei Jahre später begann er ein Studium der Volkswirtschaftslehre, um die katholische Soziallehre mit der gesellschaftlichen Realität vergleichen zu können; 1959 wurde er promoviert. Obwohl das Reichskonkordat Geistliche von Mitgliedschaft und Tätigkeit in politischen Parteien ausschließt, trat Adenauer 1957 in die CDU ein und engagierte sich in der öffentlichen Meinungsbildung. Mit seinem Vater Konrad Adenauer verband ihn ein enges Verhältnis. Trotz seiner politischen Interessen und Verbindungen verfolgte Paul Adenauer keine Karriere in diesem Bereich, sondern widmete sich der praktischen pastoralen Arbeit. Von 1962 bis 1969 war er Direktor des KZI, 1978 wurde er Lehrbeauftragter für Pastoral-Psychologie, 1990 Leiter des Referats „Praxisbegleitung / Praxisberatung“ im Erzbistum Köln. Seine stark vom Zweiten Vatikanischen Konzil geprägten Vorstellungen von Seelsorge brachten ihm das Misstrauen von Teilen des Klerus ein, die den Haltungen des Konzils kritisch gegenüberstanden. Vgl. Küsters, Adenauer, 2017. Vgl. Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen: Jahresbericht 1962, März 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Nach dem Rücktritt Adenauers übernahm Günter Struck 1968 die Leitung des KZI. Er blieb in dieser Position, bis das Institut 1975 aufgelöst wurde. Zur Schließung konstatierte er, dass die Arbeit der Eheberatungsstellen inzwischen anerkannt und unterstützt werde und sich das Angebot in einem stetigen Ausbau befinde, weshalb die Arbeitskapazitäten des KZI nicht mehr ausreichten. Als das Institut aufgelöst wurde, geschah dies ursprünglich, um es besser zu strukturieren. Zu guter Letzt wurden die Aufgaben des KZI jedoch der neu gegründeten Bundesarbeitsgemeinschaft für Beratung übertragen. Diese sollte das gesamte sozialpastorale Angebot der katholischen Kirche umfassender organisieren. Inhaltlich verantwortlich war die Zentralstelle Pastoral bei der Deutschen Bischofskonferenz. Vgl. Fischer, Dienst, 2014, S. 156 f. Vgl. Struck, Entwicklung, 1971, S. 8.
4.2 Das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen
279
Bedürfnisse der Praxis berichten sollte,¹⁹³ sowie auf geringer Stundenbasis Kräfte für Archiv und Bibliothek. Der Jahresbericht 1961 listete als Vorstandsmitglieder Vertreter von Frauenbund, Bischofskonferenz, des Zentralverbands der Katholischen Frauen- und Müttergemeinschaften, der Caritas und des Vereins katholischer Eheberaterinnen und Eheberater auf ¹⁹⁴.¹⁹⁵ Vorsitzender war der Jurist Helmut Friederichs.¹⁹⁶ Klens hatte aus gesundheitlichen Gründen von seinem Posten zurücktreten müssen.¹⁹⁷ Er wurde „Ehrenvorsitzender“, eine Funktion, die in den Akten nicht näher definiert ist. Zudem wurde 1965 ein wissenschaftlich-ärztlicher Beirat berufen, dem insgesamt 14 katholische Hochschullehrer und Mediziner angehörten. Ende 1962 zog das KZI in ein größeres Büro um.¹⁹⁸ Die Träger betrachteten die Umstrukturierung des Instituts 1965 als weitestgehend abgeschlossen.¹⁹⁹ Seit 1963 war das Zentralinstitut gemäß dem Verständnis seiner Leitung in einer neuen Phase der Geschichte katholischer Eheberatung angekommen: dem bedarfsgerechten „Aufbau der Eheberatung als eines offiziellen Dienstes der Kirche“.²⁰⁰ Das KZI galt ihnen strukturell und inhaltlich auf der Höhe der Forderungen des Zweiten Vatikanischen Konzils.²⁰¹ Der Jahresbericht 1966 verkündete, dass sich das KZI in seiner Tätigkeit ganz an den Konzilsaussagen, die Ehe sei eine Liebesgemeinschaft, und ihrer Bedeutung für die Kirche ausrichte.²⁰²
Die Stelle wurde in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus Düsseldorf besetzt, die Kosten zu 80 Prozent aus Mitteln des Bundesjugendplanes getragen. Vgl. [Paul] Adenauer an [Fuldaer Bischofskonferenz], Brief, 14. August 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 06. Vgl. Kapitel 4.3.4.1 Verein Katholischer Eheberaterinnen. Vgl. [Bernhard] Korte: Jahresbericht 1961 des Katholischen Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen, 24. Februar 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Helmut Friederichs (1914– 1995) wurde in Jura promoviert. Als er im Oktober 1961 Vorstandsvorsitzender des KZI wurde, fungierte er als Senatspräsident des Sozialgerichtes Essen. Später wurde Friederichs Richter am Bundessozialgericht, 1978 einer der Vorsitzenden. Vgl. Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 16. Heidelberg 1982, S. 7. Vgl. [Helmut] Friederichs an Joseph Frings, Brief, 8. Februar 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 05. Vgl. Reisch, Erich: Sitzung der Trägerverbände vom 12. Dezember 1960, 14. Dezember 1960, ADCV, R 565, Fasz. 01. Bis Ende 1962 war das Institut in drei Büroräumen in der Breiten Str. 110 in Köln untergebracht, danach erfolgte der Umzug in fünf Büroräume nach Köln-Ehrenfeld, Melatengürtel 101. Vgl. [Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen]: Jahresbericht 1965, [1966], S. 1, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Struck, Ehenot, 1966, S. 44. Vgl. [Stangl, Josef ]: „Vorwort“. In: Struck: Ehenot-Ehehilfe, Limburg 1966, S. 7. Vgl. Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen: Jahresbericht 1966, [1967], AKDFB, Ordner Ehe- und Familienfragen 1964– 1973.
280
4 Katholische Eheberatung
4.2.3 Aufgabenstellung Übergeordnetes Ziel des KZI war, die Eheberatung zu fördern. Umgesetzt werden sollte dies, wie vor der Gründung festgehalten, mit forschender Grundlagenarbeit, der Sammlung von Material und einem Archiv. Des Weiteren galt es, neue Beratungsstellen anzuregen und zu unterstützen sowie Leitende und Mitarbeitende in der Eheberatung auszubilden. Auch wollte das Zentralinstitut kirchlichen und öffentlichen Institutionen für Auskünfte zur Verfügung stehen sowie seine Interessen bei Behörden, über die Mitarbeit an Gesetzen und in der Familienbewegung vertreten.²⁰³ Nicht bearbeiten wollte das KZI die Felder Eheanbahnung und Erziehungsberatung. Dies galt auch 1959, als die gesellschaftlichen Entwicklungen die Aufgaben des Zentralinstituts nicht nur bestätigten, sondern als noch dringlicher erscheinen ließen.²⁰⁴ Die Erweiterung der Referate zielte darauf ab, mehr als zuvor Kontakte zu Politik, Verbänden und Behörden zu knüpfen, um so die öffentliche Meinung zu beeinflussen.²⁰⁵ Das KZI kommunizierte seine Aufgaben nach dem Zweiten Vatikanum 1966 in der Publikation Ehenot – Ehehilfe. Im Vordergrund stand die „Bearbeitung der theoretischen und praktischen Fragen der Eheberatung aus der Verantwortung der katholischen Glaubens- und Sittenlehre“.²⁰⁶ Darüber hinaus verwies das Institut darauf, dass es Beratungsstellen errichte, in der Ausbildung von Beratenden tätig sei und die Öffentlichkeit informiere. Die Formulierungen waren andere als vor der Gründung des Instituts, die offizielle Aufgabenstellung hatte sich 14 Jahre später dennoch kaum gewandelt. Die Erziehungsberatung in Form der „Anregung und Hilfe bei der Familienerziehung, Jugenderziehung“²⁰⁷ war jedoch ein neuer Aspekt, der zu Beginn explizit ausgeschlossen worden war. Ihre Aufnahme war auf den kurz zuvor erfolgten Auftrag der Bischofskonferenz zurückzuführen, christliche Elternbriefe herauszugeben und einen katholischen Familienbildungsplan zu entwickeln.²⁰⁸ Ab 1965 erschien ein Aktueller-Zitat- und Informations-Dienst. Auch danach Vgl. Klens, Hermann: Bericht über die Besprechung betr. Neuaufbau der Eheberatung und Errichtung eines Institutes für Eheberatung am 22.1.1952, o. D., ADCV, 349.4, Fasz. 02. S. Klens, [Hermann]: Ergebnis-Bericht über die Sitzung der Trägerverbände des Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen am 15. September 1959, o. D., AKDFB, Ordner Eheberatung Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen 1949 – 1963. Vgl. Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen: Jahresbericht 1963, [1964], ADCV, 349.4, Fasz. 07. Struck, Ehenot, 1966, S. 54. Ebd. Vgl. [Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen]: Jahresbericht 1965, [1966], S. 1, ADCV, 349.4, Fasz. 07.
4.2 Das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen
281
blieb der wichtigste Aufgabenbereich jedoch, „die institutionelle Eheberatung als eine neue und spezielle Form des Dienstes am Mitmenschen zu etablieren“.²⁰⁹
4.2.4 Finanzstruktur Da 1952 noch keine eigene Geschäftsstelle für das KZI existierte, übernahm die Bischöfliche Hauptarbeitsstelle für Frauenseelsorge die finanziellen Angelegenheiten. Sie hatte in Düsseldorf den gleichen Sitz wie der Zentralverband der Frauen- und Müttergemeinschaften.²¹⁰ Leiter war Prälat Hermann Klens, zuständiger bischöflicher Referent für Frauenseelsorge Lorenz Jaeger.²¹¹ Klens trennte, ebenso wie andere Akteure, nicht klar zwischen beiden Stellen und somit auch nicht zwischen seinen Funktionen.²¹² Überweisungen an das KZI wurden daher zu Beginn auch über das Konto der Frauenseelsorge getätigt,²¹³ eine Praxis, die das Erzbischöfliche Generalvikariat Köln kritisierte, da sie zu Unklarheiten in der Zuordnung von Mitteln führte.²¹⁴ Die jährlichen Kosten für das Zentralinstitut sollten vor dessen Gründung Schätzungen zufolge ca. 30.000 DM betragen. Außerdem erwartete man Zuschüsse für eine erste Einrichtung. Erzbischof Jaeger lehnte dies ab, mit einem solch hohen Betrag wolle er nicht vor die Bischofskonferenz treten. Der Kompromiss war ein Gesamtetat von 18.000 DM.²¹⁵ Davon zahlten die Diözesen 9.000 DM,²¹⁶ die andere Hälfte brachten die Trägerverbände auf. Der Etat erwies sich jedoch als zu gering, um auch nur die Kosten zu decken. Bereits 1953 wurden die Beiträge der Verbände erhöht.²¹⁷ Für 1955 lag der Zuschuss der Diözesen für das KZI bei 12.000 Struck, Entwicklung, 1971, S. 8. Vgl. [Hermann Klens] an Bischöfliche Finanzkammer, Brief, 23. Juni 1952, AEK, DBK, KZI 295. Vgl. Jäger, Lorenz: „Geleitwort“. In: Bischöfliche Hauptarbeitsstelle für Frauenseelsorge Düsseldorf (Hrsg.): Die Frau in Kirche und Volk. Köln 1950, S. 5. Vgl. Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 109. Dass Klens von der Bischofskonferenz beauftragt wurde, die Geschäftsführung der Hauptarbeitsstelle „einstweilen“ über die Geschäftsstelle der Katholischen Frauen- und Müttergemeinschaften und deren Finanzierung laufen zu lassen, verdeutlicht dies ebenfalls. Rocholl-Gärtner, Anwalt, 1978, S. 36. Vgl. [Hermann Klens] an Bischöfliche Finanzkammer Münster, Brief, 9. Oktober 1952, AEK, DBK, KZI 295. Vgl. Erzbischöfliches Generalvikariat an Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen, Brief, 5. Mai 1956, AEK, Gen. II 13.2a, 1 sowie [Erzbischöfliches Generalvikariat] an Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen, Brief und Prüfungsbericht, 16. Dezember 1958, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Vgl. Klens, Hermann: Bericht über die Besprechung betr. Neuaufbau der Eheberatung und Errichtung eines Institutes für Eheberatung am 22. Januar 1952, o. D., ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. [Hermann] Klens an Bischöfliche Finanzkammer, Brief, 31. Januar 1953, AEK, DBK, KZI 295. Vgl. [Hermann Klens] an J. Teusch, Brief, 8. Mai 1958, AEK, DBK, KZI 295.
282
4 Katholische Eheberatung
DM.²¹⁸ Die anfänglich geschätzten Ausgaben von 30.000 DM erreichte das Institut 1954.²¹⁹ Mitte 1959 stiegen die Kosten auf 57.000 DM, obwohl die Trägerverbände bereits Schwierigkeiten hatten, ihren Eigenanteil aufzubringen; insbesondere, da sich der Bund der Deutschen Katholischen Jugend mit der Begründung, er profitiere nicht vom Zentralinstitut, aus der Arbeitsgemeinschaft zurückgezogen hatte.²²⁰ Bereits 1955 betrug das Defizit fast 8.000 DM.²²¹ Im selben Jahr war das Kolpingwerk ausgetreten,²²² zudem zahlte die ebenfalls involvierte kirchliche Hauptstelle für Männerseelsorge und Männerarbeit trotz wiederholter Mahnungen seit Jahren keine Beiträge.²²³ Klens musste selbst den im Zentralinstitut ursprünglich sehr engagierten Frauenbund wiederholt mahnen, seinen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.²²⁴ Auch wies er 1958 die kirchlichen Geldgeber mehrfach darauf hin, ihren Beitrag für das laufende Jahr zu leisten, sodass der Zentralverband der Frauen- und Müttergemeinschaften einen Vorschuss von 25.000 DM vorlegte.²²⁵ Klens erhielt für seine Verdienste um die Finanzierung des KZI Anerkennung.²²⁶ Dennoch konnte das Institut aufgrund der immer wieder schwierigen Finanzlage nicht so arbeiten wie geplant. Das KZI war nicht in der Lage, Vertreter auf internationale Konferenzen zu schicken,²²⁷ Vorhaben wie eine Expertentagung musste es jahrelang aufschieben.²²⁸ Zur Debatte stand, „ob das Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen den in wachsendem Maße an es gestellten Anforderungen gerecht werden kann, oder ob es seine Tätigkeit nicht sogar noch einschränken
Vgl. Bischöfliche Finanzkammer der Kölner Kirchenprovinz an alle Überdiözesanen Einrichtungen, Aufstellung Überdiözesaner Finanzbedarf für das Jahr 1955, 10. Dezember 1954, AEK, DBK, KZI 295. Die bayerischen Diözesen waren an der Finanzierung des KZI nicht beteiligt. Vgl. dazu auch Bischöfliche Finanzkammer der Kölner Kirchenprovinz Münster an Zentralinstitut für kath. Eheberatung, Anlage IV, 30. November 1956, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Vgl. Korte, [Bernhard]: Abrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Kath. Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen in Köln im Jahre 1954, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Vgl. [Maria] Bornitz an [Hans] Wollasch, Aktennotiz, 10. Mai 1959, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. o. A. [Revisor] an Bischöfliche Finanzkammer, 12. Mai 1956, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Vgl. [Hermann Klens] an J. Teusch, Brief, 8. Mai 1958, AEK, DBK, KZI 295. 1960 trat das Kolpingwerk dem KZI wieder bei. Vgl. Klens, [Hermann]: Bericht über die Sitzung der Trägerverbände des Katholischen Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen am 10. Februar 1960, o. D., AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Vgl. KZI an Erzbischöfliches Generalvikariat, Brief, 21. Juni 1960, AEK, DBK, KZI 295. Seit wann keine Beiträge gezahlt wurden, lässt sich aus den Akten im Nachhinein nicht eruieren. Vgl. [Hermann] Klens an Gertrud Ehrle, Brief, 14. März 1960, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Vgl. [Hermann Klens] an J. Teusch, Brief, 8. Mai 1958, AEK, DBK, KZI 295. Vgl. [Maria] B[ornitz] an Hermann Klens, Brief, 14. Mai 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01. Vgl. [Hermann Klens] an die Bischöfliche Finanzkammer, Brief, 8. Mai 1958, AEK, DBK, KZI 295. Vgl. Klens, [Hermann]: Bericht über die Sitzung am 17. April 1959, o. D., AEK, DBK, KZI 295.
4.2 Das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen
283
muß“.²²⁹ Im Laufe des Jahres 1959 ergaben Schätzungen, dass ein jährlicher Etat von mindestens 60.000 DM notwendig war, um das Institut zu führen. Die Trägerverbände hofften, das fehlende Geld durch eine Erweiterung der Trägerschaft, Zuschüsse der Diözesen und des Familienministeriums sowie Spenden aufzubringen.²³⁰ Aus den Akten lässt sich nicht rekonstruieren, ob die Verbände einen an den realen Finanzverhältnissen orientierten Kostenvoranschlag von vorneherein nicht anstrebten oder dies aus anderen Gründen nicht gelang. Verbesserungsvorschläge des Generalvikariats fielen nicht auf fruchtbaren Boden.²³¹ Um die Kosten zu decken, genehmigte die Bischofskonferenz einen Zuschuss. Dennoch stand am Ende des Geschäftsjahres 1959 ein Minus. Die Aussage des Zentralinstituts war eindeutig: „Die finanzielle Lage. Sie ist schlecht.“²³² Auf der Bischofskonferenz 1961 war das KZI „Gegenstand ausführlicher Beratungen“.²³³ Die Bischöfe forderten eine stärkere Beteiligung der Trägerverbände an den Finanzen.²³⁴ Diese hatten jedoch einerseits nicht die Mittel, sich stärker einzubringen, und sahen sich andererseits auch nicht in der Pflicht.²³⁵ Sie argumentierten, dass sie die Trägerschaft des Institutes nicht nur aus Eigeninteresse übernommen hätten, „sondern auch darum, weil sie die Mitarbeit der Laien in den entscheidenden Fragen des Lebens der Kirche und des Volkes für notwendig erachten“. Ihre eigenen Mitglieder selbst würden der Beratung und sonstigen Hilfe durch das Institut aber am wenigsten bedürfen.²³⁶ Somit sahen die Beteiligten Ratsuchende in Ehefragen offenbar nicht in ihren eigenen Reihen.²³⁷ Sie kritisierten vielmehr, dass die Kirche zu wenige Mittel in die Eheberatung als „Zentralaufgabe
Vgl. [Hermann Klens] an J. Teusch, Brief, 8. Mai 1958, AEK, DBK, KZI 295. Vgl. Klens, [Hermann]: Ergebnis-Bericht über die Sitzung der Trägerverbände des Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen, 15. September 1959, o. D., AEK, DBK, KZI 295. Vgl. Erzbischöfliches Generalvikariat an KZI, Brief, 5. Mai 1956, AEK, Gen. II 13.2a, 1 sowie [Erzbischöfliches Generalvikariat] an KZI, Brief und Prüfungsbericht, 16. Dezember 1958, AEK, Gen. II 13.2a, 1. KZI, Bericht, 10. Februar 1961, AEK, DBK, KZI 295. [Lorenz Jaeger] an [Hermann] Klens, Abschrift Brief, 24. Februar 1961, ADCV, 349.4, Fasz. 05. Vgl. [Hermann] Klens an die Trägerverbände des KZI, Brief, 8. Mai 1958, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Zu den Finanzen des Caritasverbandes, der spätestens ab Ende der 1950er-Jahre über ein umfangreiches Vermögen verfügte, vgl. Hammerschmidt, Wohlfahrtsverbände, 2005. KZI, Bericht, 10. Februar 1961, AEK, DBK, KZI 295. Der Caritasverband kommentierte die Argumentationslinie insgesamt allerdings als „Schwach, schwach!“. KZI an die Erzbischöfe und Bischöfe der Kölner und Paderborner Kirchenprovinz, Brief, 10. Februar 1961, handschriftlicher Vermerk, ADCV, 349.4, Fasz. 05.
284
4 Katholische Eheberatung
des ganzen deutschen Katholizismus“ investiere.²³⁸ Die Akteure beobachteten zudem, dass die evangelischen Kirchen ihrer Beratung mehr Geld zukommen ließen. Trotz der prekären Finanzlage stiegen die Ausgaben jedoch weiter, der Voranschlag des KZI für das Jahr 1962 sah einen Betrag von fast 73.000 DM vor. Den größten Anteil am Etat hatten die Gehälter für die Mitarbeiter mit knapp 50.000 DM.²³⁹ Als Friederichs erfuhr, dass die Konferenz der Evangelischen Familien- und Lebensberatung (EKFuL) für 1963 einen Etat von 506.000 DM aufgestellt hatte, suchte er das Gespräch mit Jaeger.²⁴⁰ Auch unter diesem Eindruck einer akuten Konkurrenzsituation stellte der Vorsitzende Ende 1961 einen Antrag auf Gleichstellung des KZI mit einer bischöflichen Hauptarbeitsstelle.²⁴¹ Die Idee war bereits 1960 im Zentralinstitut aufgekommen,²⁴² ein Antrag ist jedoch nicht vermerkt. Der Aufbau und die Aufgaben des KZI waren denen der Bischöflichen Hauptarbeitsstellen bereits sehr ähnlich.²⁴³ Die Finanzierung der dortigen Angestellten übernahmen die Bistümer.²⁴⁴ Was diese Gleichstellung für das Zentralinstitut außer einer breiteren finanziellen Basis bedeuten sollte, lässt sich aus den Akten nicht rekonstruieren. Die Bischofskonferenz beglich die Schulden des KZI Mitte 1961.²⁴⁵ Im Anschluss sorgte eine solidere Finanzgrundlage dafür, dass die Arbeit sich stabilisierte und ausgebaut werden konnte. Resultate waren eine bessere Buchführung, ein Journal und Bestandskladden.²⁴⁶ Als das Erzbischöfliche Generalvikariat das KZI 1962 einer erneuten Revision unterzog, ergaben sich keine Beanstandungen mehr.²⁴⁷ Der Haushaltsplan für 1964 sollte „die dauerhafte Basis für eine langfristig geplante Arbeit darstellen“. Die Planung des Instituts „sollte nicht weiter von provisorischem Denken in Finanzfragen bestimmt sein; denn dies würde eine Lähmung der Arbeit
[Maria] Bornitz: Aus den Beratungen über das kath. Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen vom 15.7.60, 15. Juli 1960, ADCV, R f565, Fasz. 01. Vgl. [Bernhard Korte] an Hermann Klens, Kostenvoranschlag, 18. April 1961, AEK, DBK 295. S. Friederichs, [Helmut], Aktenvermerk, 6. Februar 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 05. Vgl. [Helmut] Friederichs an Joseph Frings, Brief, 8. Februar 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 05. Vgl. Klens, [Hermann]: Bericht über die Sitzung der Trägerverbände des Katholischen Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen am 10. Februar 1960, o. D., AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Vgl. Bayerische Bischofskonferenz: Richtlinien für den Aufbau der Bischöflichen Hauptstellen und Arbeitsstellen. 1955, Diözesanarchiv Würzburg, Bestand Julius Döpfner, 81. Vgl. o. A.: Grundsätze für Bischöfliche Hauptarbeitsstellen. S. 9 f. Diözesanarchiv Würzburg, Bischöfliche Manualakten Stangl, 4178. Klens, H[ermann]: Bericht über die Sitzung der Trägerverbände des Zentralinstitutes für Eheund Familienfragen am 11. August 1961, 16. August 1961, AKDFB, Ordner Eheberatung Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen 1949 – 1963. Vgl. Friederichs, [Helmut] an [Trägerverbände], Brief, 2. Juli 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 06. Vgl. Else Mann an Erich Reisch, Brief, 16. Februar 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 06.
4.2 Das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen
285
und Vergeudung von Mitteln bedeuten“.²⁴⁸ Mit dem Verweis auf die Finanzen des Evangelischen Zentralinstituts für Familienberatung (EZI) ging an die Diözesen die Aufforderung, in Zukunft zwischen 170.000 und 200.000 DM für das Zentralinstitut aufzubringen, um so der Gefahr einer Rückständigkeit des KZI zu begegnen.²⁴⁹ Die Konsolidierungsbemühungen waren erfolgreich. Die Bischofskonferenz erkannte das KZI als eine mit einer bischöflichen Hauptarbeitsstelle gleichgestellte Einrichtung an. Der Trägerverein blieb dabei jedoch in seiner Selbstständigkeit unangetastet. Wie bei der Institutsgründung hatte die Konkurrenz mit einer anderen Einrichtung den Ausschlag gegeben. Aus der Sorge, das katholische Pendant gerate im Vergleich in eine schlechtere Lage, entstand Handlungsdruck. Nachdem 1961 mit der Eintragung in das Vereinsregister die notwendige rechtliche Basis für das Zentralinstitut geschaffen worden war, brachte die Gleichstellung die finanzielle Wende. Sie hatte eine Neuorganisation und Ausdifferenzierung der Struktur sowie mehr Personal zur Folge.
4.2.5 Auseinandersetzungen um die Ausrichtung des Katholischen Zentralinstituts Die Trägerverbände und die Leitung des Katholischen Zentralinstituts interpretierten dessen Aufgaben unterschiedlich, was bis zum Beginn der 1960er-Jahre zu Auseinandersetzungen führte. Größter Kritiker war die Caritas. Sie stellte sogar das Weiterbestehen des Instituts in Frage. Problematisiert wurden vor allem die schwierigen finanziellen Verhältnisse und die mangelnde Struktur. Darüber hinaus entsprach die Arbeitsweise des Leiters Bernhard Korte nicht den Vorstellungen der Verbände. Schließlich gaben die ab 1959 nicht mehr zu übersehenden Schwierigkeiten den Ausschlag, das KZI neu zu strukturieren und seine Arbeit zu professionalisieren. Dieser Prozess war 1963 abgeschlossen. Die Caritas sah das Zentralinstitut als Arbeitsstelle, die den Verbänden zugeordnet sein und nicht unabhängig Aufgaben übernehmen sollte. Darauf legte sie besonderen Wert.²⁵⁰ Das KZI sollte den Verbänden zuarbeiten und, ähnlich wie der Reichsausschuß, eine Vernetzung katholischer Eheberatungsarbeit ermöglichen.²⁵¹ Der Caritasverband wünschte keine Zentrale, in der sich einseitig Macht akkumulierte, sondern einen gemeinsamen Fachbereich, der die Verbände unterstützte. Als [Paul] Adenauer an [Fuldaer Bischofskonferenz], Brief, 14. August 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 06. Vgl. ebd. Vgl. [Hans Wollasch] an [Hermann] Klens, Brief, 22. April 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Zu den Wünschen der Caritas an das KZI sowie damit verbundene Auseinandersetzungen vgl. auch Lippold, Church, 2014, S. 335 ff.
286
4 Katholische Eheberatung
„Facharbeiter“ wollte sie einen Mann und explizit auch eine Frau. Dass Korte bereits vor der Gründung des Zentralinstituts ohne Rücksprache hinzugezogen worden war, kritisierte sie deutlich.²⁵² Auch der KDFB hatte sich dafür eingesetzt, die Institutsleitung mit einer Frau zu besetzen. Prälat Hermann Klens lehnte ein Tandem im Namen des Erzbischofs Lorenz Jaeger aufgrund fehlender Finanzmittel jedoch ab.²⁵³ Die Beraterin Josepha Fischer-Erling zeigte Verständnis und bot an, die Lücke durch ihre eigene ehrenamtliche Mitarbeit auszugleichen. Dabei betonte sie ihre Qualifikation: [I]ch habe mich zu einer intensiven Mitarbeit bereit erklärt, weil ich praktisch seit über einem Jahr in verschiedenen Städten Eheberatungskurse abhalte und wirklich sehr in der Problematik stehe. Meines Erachtens ist der Etat so bescheiden, daß davon keine zwei Kräfte leben können. […] Ich habe persönlich im letzten Jahr in folgenden Städten durch einen vorangegangenen Kursus Eheberatungsstellen begründen helfen: Würzburg, Bochum, Düsseldorf, Aachen und Leverkusen. Ich schreibe das nur, um Ihnen darzutun, daß das weibliche Element in der Beratungsarbeit nicht vernachlässigt werden soll.²⁵⁴
Klens nahm das Angebot gerne an.²⁵⁵ Das KZI erhielt durch Fischer-Erling, die eine bekannte Kapazität in der Eheberatung war, wesentliche weibliche Unterstützung. Seinen Wunsch, das KZI mit einer offiziell weiblichen Führungsperson zu versehen, hatte der Frauenbund aber nicht durchsetzen können. Fischer-Erlings Mitarbeit war freiwillig und unbezahlt. Sie und auch der KDFB bewegten sich weiterhin in den Gleisen weiblicher ehrenamtlicher Laienbeschäftigung. Dass eine Frau professionelle Gehaltsarbeit leistete, gelang zumindest auf Leitungsebene des KZI nicht.²⁵⁶ Dem Leiter des KZI Bernhard Korte zufolge war die Aufgabe des Zentralinstituts in erster Linie, theoretische Grundsatzfragen wissenschaftlich zu beantworten.²⁵⁷ Dies entsprach der offiziellen Sicht seines Hauses.²⁵⁸ Hieran übte der Frauenbund 1954 Kritik. Theorie beziehungsweise Wissenschaft seien in der Arbeit des KZI genügend berücksichtigt, nun sei die Praxisorientierung an der Reihe, vor Vgl. [Hans Wollasch] an [Hermann] Klens, Brief, 22. April 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Zu den Wünschen des KDFB für eine weibliche Besetzung der Stelle vgl. auch Lippold, Church, 2014, S. 336 f. Josepha Fischer-Erling an [Maria] Bornitz, Brief, 17. Mai 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 02. o. A.: Protokoll „aus der Konferenz über Fragen der Eheberatung“, 4. Juni 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Dies schließt an Lippolds Ansicht an. Vgl. Lippold, Church, 2014, S. 337. Zur Auseinandersetzung zwischen dem KDFB und Korte vgl. im Folgenden Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 139 ff. Vgl. [Klens, Hermann]: Bericht über das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen, 14. April 1961, AEK, DBK, KZI 295, S. 4.
4.2 Das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen
287
allem bei der Ausbildung von Eheberaterinnen. Der Bund kritisierte, das Zentralinstitut habe bisher zu wenig praktische Unterstützung bei der Beratungsarbeit geleistet.²⁵⁹ Fischer-Erling verfolgte als namhafte Expertin des KDFB ebenfalls eine starke Ausrichtung auf die Praxisarbeit. Auch sie lehnte einen Theoriefokus für das Zentralinstitut ab. Korte und Fischer-Erling besprachen schließlich eine Neujustierung: In den folgenden Jahren sollte laut Einschätzung des KZI „die wissenschaftliche Arbeit gegenüber der organisatorischen und praktischen zurückgestellt“ werden.²⁶⁰ Korte sah das allerdings nicht als Richtungsänderung, sondern dem Zeit- und Personalmangel geschuldet. Dem KDFB gelang es nicht, Kortes Einfluss zurückzudrängen. Der Frauenbund hatte auch auf die Strukturmängel des Instituts sowie dessen Finanzprobleme verwiesen. Diese Kritik blieb jedoch folgenlos. Da der Caritasverband mit den Leistungen des KZI beziehungsweise Kortes zunehmend unzufrieden war, regte Maria Bornitz,²⁶¹ die Referentin für Familienfürsorge der Caritas, 1958 Änderungen an. Im Bericht an ihren Vorgesetzten konstatierte sie, das Interesse der Verbände am Zentralinstitut scheine minimal. Außer ihr waren nur Klens und Korte sowie ein Vertreter des Katholischen Männervereins zur jährlichen Vorstandssitzung erschienen. Bornitz schlug vor, das Zentralinstitut solle die Geschäftsführung des Arbeitskreises Ehe und Familie im Zentralkomitee der deutschen Katholiken übernehmen.²⁶² Dies lehnte Klens ab, da er eine Überlastung Kortes befürchtete.²⁶³ Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen im Zentralkomitee gab die Caritas die Idee selbst auf, da das Komitee nicht interessiert war. Es nahm das KZI lediglich als eine Organisationsform unter vielen wahr, was den Vorschlag uninteressant machte.²⁶⁴ Da die Caritas 1959 eine ähnliche Kritik vorbrachte, vermutet Illemann, dass sie 1952 ebenfalls einen Mangel an Praxisorientierung beklagte. Zwar liegt die Vermutung nahe, im vorliegenden Aktenmaterial sind darauf jedoch keine Hinweise zu finden. Der Caritasverband bemängelte zwar die Institutsausrichtung, die Hauptkritik scheint 1959 allerdings in der mangelnden Zusammenarbeit mit den Verbänden gelegen zu haben. Vgl. Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 140. Klens, [Hermann]: Bericht über die Sitzung der Trägerverbände des Zentralinstitutes für Eheund Familienfragen am 12. März 1957, 12. März 1957, S. 1, ADCV, R 565, Fasz. 01. Maria Bornitz arbeitete im Hauptsitz des Caritasverbandes als Referentin für Familienfürsorge sowie Referentin für die Elisabeth-Konferenzen. Bornitz war promoviert worden (in welchem Fach, ließ sich nicht eruieren). Ab 1950 hatte sie die Geschäftsführung der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Müttererholung inne und vertrat später die Caritas im Zentralverband der deutschen Katholiken. Vgl. Illemann, Frauenbewegung, 2016. Zum Zentralkomitee der deutschen Katholiken vgl. Grossmann, Thomas: Zwischen Kirche und Gesellschaft. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken 1945 – 1970. Mainz 1991. Vgl. [Maria] Bornitz an [Kuno] Joerger, 24. März 1958, Protokoll, ADCV, R 565, Fasz. 01. Vgl. [Deutscher Caritasverband]: Vorschläge des DCV an Prälat Klens, 12. August 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01.
288
4 Katholische Eheberatung
Im Jahr 1959 vertrat Berna Kirschner²⁶⁵ den KDFB im Zentralinstitut.²⁶⁶ Vonseiten des Frauenbundes hatte Fischer-Erling zuvor Kortes Arbeit kritisiert. Kirschner hingegen hatte ein gutes Verhältnis zu dem Leiter des KZI, mit dem sie in ihrer Funktion als stellvertretende Vorsitzende des Familienbundes deutscher Katholiken bereits seit einigen Jahren zusammenarbeitete.²⁶⁷ Sie zeigte sich über den Tonfall der Auseinandersetzungen „entsetzt“.²⁶⁸ Als sie stellvertretende Vorsitzende des KDFB wurde, folgte ihr Else Mann²⁶⁹ als Vorstandsmitglied im KZI nach. Auch Mann schätzte Kortes Arbeit.²⁷⁰ Dass der KDFB in der Hochphase der Konflikte um Korte und die Institutsausrichtung keine Kritik mehr übte, dürfte Illemann zufolge an diesem Personalwechsel gelegen haben.²⁷¹ Kirschner setzte sich für Korte ein, der Frauenbund erkannte seine Arbeit nunmehr positiv an. An einer Klärung der rechtlichen und finanziellen Grundlagen des KZI war der KDFB jedoch weiterhin interessiert. Er engagierte sich für eine praktische und koordinierende Ausrichtung des Instituts und fühlte sich für dessen Mitgestaltung zuständig. Die im Vorstand des KDFB tätige Helene Weber²⁷² beriet sich aus diesem Grunde immer wieder mit den Beteiligten. Kirschner setzte sich auch für eine weibliche Mitarbeiterin ein, erneut ohne Erfolg.²⁷³
Berna Kirschner (geb. Böckenförde, 1895 – 1973) war ab 1943 Vorsitzende der Ehe- und Familienkommission des KDFB. Sie war Leiterin der Eheberatungsstelle Recklinghausen und seit 1952 Mitglied des Zentralvorstandes.Von 1953 an fungierte sie zehn Jahre als Stellvertretende Vorsitzende des Familienbundes deutscher Katholiken und ab 1960 als dessen Vertreterin im KZI. Für ihr Engagement wurde sie vom Papst ausgezeichnet. Zudem erhielt Kirschner 1963 das Bundesverdienstkreuz. Vgl. Illemann, Frauenbewegung, 2016. Fischer-Erling war 1955 aus Präsidium und Vorstand des KDFB zurückgetreten. Ob Berna Kirschner den KDFB bereits ab diesem Zeitpunkt im KZI vertrat, ist unklar. Vgl. Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 141. Vgl. Bernhard Korte an Berna Kirschner, Brief, 18. September 1959, AEK, DBK, KZI 52. Berna Kirschner an [Helene] Weber, Brief, 27. Mai 1959, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Else Mann war promovierte Juristin und Mitarbeiterin der katholischen Eheberatungsstelle Köln. Von 1960 bis 1963 war sie Vorstandsmitglied im KZI. Vgl. Fischer-Erling, Josepha: Jahresbericht der katholischen Beratungsstelle für Ehe- und Familienfragen für das Jahr 1960, [1960], LAB, B Rep 142 – 09 Nr. 5/30 – 02 sowie o. A.: Niederschrift über die Vorstandssitzung am 30. Oktober 1962, o. D., ADCV, 349.4, Fasz. 03. Vgl. Else Mann an Vorstand des KZI, Brief, 14. Dezember 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 06. Vgl. im Folgenden Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 141 f. Zur Biografie Webers vgl. ebd., S. 33 ff. Briefe und Protokolle weisen laut Illemann auf Aktivitäten der KDFB-Vertreterinnen zur Entwicklung des KZI hin, Umfang und insbesondere inhaltliche Mitwirkung am KZI ließen sich aber nicht umfassend feststellen. „Die Art der Einflussnahme des Frauenbundes auf die Reformen des Institutes unterschied sich jedenfalls deutlich von den programmatischen Schriftstücken des
4.2 Das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen
289
Bornitz stellte schließlich die Frage, welchen Nutzen das Institut den Trägerverbänden bringe. Der Vorwurf stand im Raum, der Leiter kümmere sich „mit Vorliebe eben nicht um die Verbände“.²⁷⁴ Außerhalb des Zentralinstituts geriet Korte bereits 1954 in den Verdacht, sie nur als Finanzgeber für die Eheberatung zu betrachten. Wie das bischöfliche Generalvikariat für Frauenseelsorge in Trier rückmeldete, löste dies bei den Trägern selbst „Erregung“ aus. Korte begebe sich „auf Glatteis“.²⁷⁵ Dieser antwortete: Aber wenn wir von den Aufgaben der katholischen Eheberatung ausgehen, dann müssen wir doch sehen […] daß die katholische Eheberatung so nahe in die eigentliche Seelsorge hineingehört, wie es keine Vereinstätigkeit tut […]. Auch wird man klar sehen müssen, daß z. B. auch die Ehevorbereitung nicht Aufgabe von Vereinen ist, sondern Anliegen der Pfarreien.²⁷⁶
Korte machte deutlich, dass er die Eheberatung im Grunde als Aufgabe der Seelsorge in den Pfarreien sah. Inwiefern dies den ins KZI involvierten Verbänden bewusst war, ist anhand der vorliegenden Akten nicht zu eruieren. Der Briefwechsel mit dem Generalvikariat Trier deutete jedoch an, dass Korte anders als die Verbände die Beratungsarbeit keineswegs als Aufgabe der Laienarbeit begriff. Die Vertreter der Träger vermissten mehr und mehr eine Wertschätzung ihrer Arbeit.²⁷⁷ Zu den Zentralversammlungen erschienen sie kaum noch. Von den 20 Vereinen, die anfänglich ihr Interesse an einer Trägerschaft für das Zentralinstitut bekundet hatten, war nicht mehr die Rede. Bornitz wertete dies nicht nur als ein Zeichen für Kortes Untätigkeit, sondern auch die von Klens. Sie schloss, dass es Letzterem nicht geglückt sei, „das Interesse der tragenden Verbände in den letzten Jahren auch nur zu erhalten, geschweige denn zu verstärken und auszuweiten“,²⁷⁸ obwohl er grundsätzlich für sein Geschick im Umgang mit Verbänden und Institutionen bekannt war. Nach Bornitz’ Einschätzung hatten in letzter Zeit außer der Caritas nur noch der KFD, der Familienbund der Deutschen Katholiken sowie eventuell der KDFB und das Katholische Männerwerk Interesse am KZI gezeigt.²⁷⁹ Trotz jahrelanger Bemühungen der Caritas, „Prälat Klens zu einer stärkeren Aktivität anzuregen, bleibt wohl nur der Weg, in den Führungskreis selbst einen
Caritasverbandes, die als Quellen leichter zugänglich sind und ausgewertet werden können.“ Illemann, Frauenbewegung, S. 144. [Maria Bornitz], o. D., handschriftliche Einfügungen zu Klens, [Hermann]: Bericht über die Sitzung am 17. April 1959, o. D., ADCV, R 565, Fasz. 01. Jenny Bachem an [Bernhard] Korte, Brief, 13. März 1954, AEK, DBK, KZI 28. [Bernhard Korte] an [Jenny] Bachem, 20. März 1954, AEK, DBK, KZI 28. Vgl. Georg Hüssler an [Hermann] Klens, Brief, 26. September 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01. Maria Bornitz an [Georg Hüssler], Brief, 7. Februar 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01. Vgl. [Maria] B[ornitz] an Hermann Klens, Brief, 14. Mai 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01.
290
4 Katholische Eheberatung
deutlicheren Kurs hineinzubringen“.²⁸⁰ Dies wollte Bornitz erreichen, indem sie einerseits einen Wechsel im Vorsitz anstrebte und andererseits den Caritaspräsidenten persönlich einband.²⁸¹ So hätte die Caritas eine Mitträgerschaft, die dem Ansehen und der Autorität von Klens entspreche. Noch bevor die Caritas nach außen sichtbar tätig wurde, zog sich der Bund der Deutschen Katholischen Jugend 1959 aus dem KZI zurück, da er nach eigener Einschätzung vom Zentralinstitut nicht profitiere.²⁸² Die Caritas beauftragte den hausinternen Justiziar damit, die Lage zu beurteilen. Dieser konstatierte, dass bei der Gründung des KZI erforderliche Maßnahmen nicht vollzogen worden seien und auch die rechtlichen Grundlagen nicht erkennbar seien. Er riet dringend zu einer Klärung.²⁸³ Mitte 1959 trat Bornitz daher direkt an Klens heran: „Ohne daß eine durchgreifende Änderung in der Trägerschaft und in der Handhabung dieses Institutes erfolgt, sieht der Deutsche Caritasverband sich nicht länger in der Lage, die Verantwortung dafür mit zu tragen.“²⁸⁴ Aus dem KZI sei „eine Fachstelle geworden, deren Kapazität auf die Persönlichkeit und die fachlichen Voraussetzungen des Leiters begrenzt war“.²⁸⁵ Kurz darauf legte der Verband Vorschläge vor, in denen er eine Lösung forderte.²⁸⁶ Zur Diskussion stand sogar grundsätzlich, ob das KZI den gesamten Bereich der Ehe- und Familienfragen bearbeiten oder sich auf Ehe- und Familienberatung spezialisieren sollte. Von vorneherein vermeiden wollte die Caritas die Bezeichnung „Zentralinstitut“, „um jeden Anschein zu beseitigen, daß es sich nur um eine Aufwärmung der alten Einrichtung handelt“.²⁸⁷ Sie drängte darauf, strukturelle Fragen zu klären, beispielsweise, wer den Vorstand wählen solle oder wie zwischen Mitgliederversammlungen und anderen Vereinsorganen besser unterschieden werden könne. Auch plädierte sie für einen hauptamtlichen Geschäftsführer und fragte, wie weit der kirchenamtliche Einfluss im Vorstand gehen solle. Der Verband vermutete, dass die Bischöfe mehr Mitsprache anstrebten, da sie erhebliche Zuschüsse geben sollten. Um eine grundlegende Änderung zu erreichen, sollte die Satzung sicherstellen, dass das KZI keine selbstständige Funktion mehr hatte. Die Caritas war Maria Bornitz an [Georg Hüssler], Brief, 07. Februar 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01. Vgl. Georg Hüssler an [Hermann] Klens, Brief, 26. September 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01. Vgl. [Maria] Bornitz an [Hans] Wollasch, Aktennotiz, 10. Mai 1959, ADCV, 349.4, Fasz. 02. [Maria] B[ornitz] an [Hermann] Klens, Briefanhang Dr. Klein, 14. Mai 1959, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Vgl. auch Kapitel 4.2.2 Organisation und Kapitel 4.2.4 Finanzstruktur. [Maria] B[ornitz] an Hermann Klens, Brief, 14. Mai 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01. Ebd. [Deutscher Caritasverband]: Vorschläge des DCV an Prälat Klens, 12. August 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01. [Deutscher Caritasverband]: Konzeptentwürfe Betr. Satzungsentwurf Zentralinstitut Köln, 11. August 1959, ADCV, 349.4, Fasz. 02.
4.2 Das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen
291
der Auffassung, daß das Zentralinstitut eine Fachabteilung des Vereins zu sein hat, daß der Leiter des Instituts mit ganz spezifischen Aufgaben Angestellter des Vereins und damit dem Vorstand restlos untergeordnet ist. Damit wird auch vermieden, daß eine Einzelpersönlichkeit auch im neuen Träger von vornherein auf Grund seiner satzungsgemäßen Stellung eine Sonderpolitik treibt.²⁸⁸
Ihr Ziel war es, die Aufgaben des Zentralinstituts zu überprüfen und in eine Arbeitsgemeinschaft der 17 Trägerverbände umzuwandeln. Hier zeigte sich erneut der Wunsch, die Verbände stärker an der Arbeit des KZI zu beteiligen sowie eine größere Praxisorientierung durchzusetzen.²⁸⁹ Konkret sollte die angestrebte „kath. Arbeitsstelle für Ehe- und Familienberatung“ vor allem vermittelnd und koordinierend wirken, um auch „die vorhandene Arbeit der Verbände“ auszuwerten und zu fördern.²⁹⁰ Das Zentralinstitut stand somit grundsätzlich zur Diskussion. Die Vorschläge des Caritasverbandes wurden aber erst kommuniziert, nachdem dieser erneut deutlich protestiert hatte.²⁹¹ In der Folge initiierte er Briefwechsel und Treffen. Auch die oberste Leitungsebene insistierte, Änderungen im KZI voranzutreiben.²⁹² Dabei rückte die seit Jahren prekäre Finanzsituation wieder in den Fokus.²⁹³ Korte musste sich mit Vorwürfen auseinandersetzen, es gebe Unklarheiten in der Jahresrechnung und er weiche Antworten aus.²⁹⁴ Die finanzielle Misere verdeutlichte erneut, wie dringlich es war, das Institut und seine Strukturen klar zu gliedern. Ende 1959 hoffte die Caritas auf „eine Morgenröte […] für die weitere Zusammenarbeit“.²⁹⁵ Zu diesem Zeitpunkt war die Krise so massiv, dass Klens Ende 1960 eine Beratung einberief, um zu entscheiden, „ob und gegebenenfalls in welcher Form das
Ebd. Vgl. [Deutscher Caritasverband]: Vorschläge des DCV an Prälat Klens, 12. August 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01, S. 1. Ebd., S. 2. Vgl. handschriftliche Bemerkungen von [Maria] Bornitz, 07. Oktober 1959, auf [Hermann] Klens an Georg Hüssler, Brief, 30. September 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01.Vgl. handschriftliche Bemerkungen von [Maria Bornitz], o. D., auf [Hermann] Klens an Georg Hüssler, Brief, 8. Oktober 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01. „In dieser Situation sind wir, nachdem die Angelegenheit in der Direktion besprochen wurde, nahezu versucht, auf eine weitere Mitarbeit im Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen zu verzichten.“ [Georg] Hüssler an Hermann Klens, Brief, 14. Oktober 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01. Vgl. [Maria] Bornitz an [Georg] Hüssler, Notiz, 21. Oktober 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01.Vgl. G[eorg] Hüssler an katholische Verbände, Brief, 24. Oktober 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01.Vgl. G[eorg] Hüssler an [Bernhard] Korte, Brief, 25. April 1960, ADCV, R 565, Fasz. 01. Vgl. Kapitel 4.2.4 Finanzstruktur. Vgl. [Maria] B[ornitz] an [Hermann] Klens, Brief, 30. Mai 1959, ADCV, R 565, Fasz. 01. [Georg] H[üssler] an [Hermann] Kens, Brief, 26. Oktober 1959, ADCV, R 565, Fasz 01.
292
4 Katholische Eheberatung
Institut weitergeführt werden kann“.²⁹⁶ In der Frage, welchen Namen das KZI erhalten sollte, konnte sich der Caritasverband nicht durchsetzen. Die Beteiligten lehnten die Beschränkung des Namens auf Ehe- und Familienberatung als zu eng ab. Es blieb bei der bisherigen Bezeichnung. Im Laufe des Jahres 1960 kristallisierte sich heraus, dass die meisten Verbände die Bildung eines eingetragenen Vereins unterstützten. In einem ersten Satzungsvorschlag hieß es, das KZI solle die „Bearbeitung und Sammlung der wissenschaftlichen Ehe- und Familienfragen und deren Auswertung für Eheberatung und Ehevorbereitung“ betreiben.²⁹⁷ Dem stimmten die Verbände begeistert zu.²⁹⁸ Den Bemühungen Bornitz’, sie stärker in die Arbeit des KZI einzubinden, begegneten sie aber ambivalent. Zwar bestand der Wunsch nach größerem Einfluss und einer anderen Ausrichtung des Zentralinstituts, jedoch betrachteten die Verbände dies nicht als ihre Aufgabe. Zwar diene das KZI auch ihnen, sei jedoch vor allem ein Anliegen der Diözesen. Klens war derselben Meinung.²⁹⁹ Auch finanziell wollten sich die Einrichtungen nicht umfänglicher beteiligen, da sie aus ihrer Sicht das KZI nicht aus Eigeninteresse unterstützten, sondern um die Laienarbeit repräsentiert zu sehen.³⁰⁰ In den Augen der Caritas war diese Argumentation nicht ausreichend. Tatsächlich verwundert sie, hatten die Trägerverbände sich doch ursprünglich dafür eingesetzt, die Eheberatung und die beteiligten Institutionen enger zu vernetzen.³⁰¹ Da das KZI nicht ihren Vorstellungen entsprach, zogen sich einige zurück. Zum gegebenen Zeitpunkt wäre es jedoch möglich gewesen, das KZI neu zu formen. Die Beteiligten waren sich einig, dass das Zentralinstitut nicht nur erhalten, sondern auch ausgebaut werden solle; auch müsse „Endgültiges zur Ausformung des Instituts geschehen“.³⁰² Die Aktenlage zeigt jedoch nur die Caritas als wesentlichen Akteur. Erst 1961 waren die Bemühungen um eine Neuaufstellung des KZI erfolgreich. Im Januar fand ein Gespräch mit Erzbischof Jaeger statt. Ergebnis war, das Thema vor die Bischofskonferenz zu bringen. Dem stimmten alle Verbände zu.³⁰³ Bornitz aber war dennoch unzufrieden. Sie wollte die Zusage für diesen Schritt davon ab-
[Hermann] Klens an Trägerverbände, Brief, 28. Nov. 1960, ADCV, R 565, Fasz. 01. Bornitz, Maria / Galler, Renate: Protokoll der Sitzung der Trägerverbände vom 15. Juli 1960, 22. August 1960, ADCV, R 565, Fasz. 01. Vgl. [Maria] Bornitz: Aus den Beratungen über das kath. Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen vom 15.7.60, 15. Juli 1960, ADCV, R 565, Fasz. 01. Vgl. Reisch, Erich: Sitzung der Trägerverbände vom 12. Dezember 1960, 14. Dezember 1960, ADCV, R 565, Fasz. 01. Vgl. Kapitel 4.2.4 Finanzstruktur. Vgl. H[ermann] Klens an Kuno Joerger, Brief, 23. Juli 1958, ADCV, R 565, Fasz. 01. Reisch, Erich: Sitzung der Trägerverbände vom 12. Dezember 1960, 14. Dezember 1960, S. 2, ADCV, R 565, Fasz. 01. Vgl. [Hermann] Klens an [Georg] Hüssler, Brief, 7. Februar 1961, ADCV, 349.4, Fasz. 05.
4.2 Das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen
293
hängig machen, den Zweck des Instituts auf Eheberatung und Ehevorbereitung zu begrenzen und so die Position der Caritas zu stärken. Dies gelang jedoch nicht. Tatsächlich war gegen den Einspruch der Caritas weiterhin vom KZI als wissenschaftlichem Institut die Rede, was Bornitz als wenig überzeugend und überholt kritisierte.³⁰⁴ Keinen Widerspruch löste hingegen aus, dass im Fall der Auflösung des KZI das katholische Gegenstück zur DAJEB sowie zur evangelischen Familienberatung fehlen würde; ein Zustand, der allein optisch schon untragbar sei.³⁰⁵ Die Bischofskonferenz beriet ausführlich über das Zentralinstitut. Die Bischöfe stellten die Abdeckung der Schulden und weiteres Personal in Aussicht. Ein Experte sollte die rechtliche Grundlage des KZI ordnen,³⁰⁶ zudem sei dringend eine Geschäftsordnung³⁰⁷ zu empfehlen. Beschlossen wurde zudem ein Wechsel in der Leitung des Zentralinstituts. Wie bei der Gründung des KZI war die Bischofskonferenz auch bei der Umstrukturierung ein entscheidender Akteur.³⁰⁸ Im Jahr 1962 wurde Paul Adenauer Direktor des KZI.³⁰⁹ Die Verbände äußerten zwar Bedenken, dass ein Theologe das Institut führen sollte, auf Wunsch der Bischöfe bestätigten sie den Wechsel jedoch.³¹⁰ Die Skepsis gegenüber Adenauer blieb allerdings bestehen.³¹¹ Dieser betrachtete seine Einsetzung als notwendig, um das KZI umzustrukturieren, stellte jedoch in Aussicht, sein Amt nur vorübergehend ausüben zu wollen.³¹² Auf Dauer solle ein verheirateter Laie die Leitung übernehmen.³¹³ Schließlich entstanden drei Referate.³¹⁴ Zwar gab das KZI die Wissenschaftsausrichtung nicht offiziell auf. Doch die neu ausgearbeitete Satzung zeigte, dass
Vgl. [Maria] Bornitz an [Georg] Hüssler, Aktennotiz, Februar 1961, ADCV, 349.4, Fasz. 05. S. [KZI] an die Erzbischöfe und Bischöfe der Kölner und Paderborner Kirchenprovinz, Brief, 10. Februar 1961, ADCV, 349.4, Fasz. 05. Vgl. [Lorenz Jaeger] an [Hermann] Klens, Abschrift Brief, 24. Februar 1961, ADCV, 349.4, Fasz. 05. Vgl. Klens, H[ermann]: Bericht über die Sitzung der Trägerverbände des Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen am 11. August 1961, 16. August 1961, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Vgl. [Paul] Adenauer an Vorstand [KZI], 23. Januar 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 06. Zu Adenauer vgl. auch Lippold, Church, 2014, S. 339 f. Vgl. o. A.: Niederschrift über die Vorstandssitzung am 30. Oktober 1962, o. D., ADCV, 349.4, Fasz. 03. Vgl. Else Mann an Vorstand [KZI], Brief, 14. Dezember 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 06. Vgl. Helmut Friederichs an Vorstand [KZI], Brief, 7. Februar 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 06. Vgl. [Maria] Bornitz an [Erich] Reisch, Aktennotiz, 20. September 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 06. Zu Adenauers Sicht auf die Arbeit eines Theologen in der Eheberatung vgl. Adenauer, Paul: „Der Theologe im Team einer Eheberatungsstelle“. In: Lebendige Katechese, Bd. 3. Würzburg 1981, S. 169 – 173. S. [Paul] Adenauer an [Fuldaer Bischofskonferenz], 14. August 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 05. Vgl. Kapitel 4.2.2 Organisation.
294
4 Katholische Eheberatung
künftig die Unterstützung der Eheberatungsstellen im Vordergrund stand. Wissenschaftliche Ausrichtung bedeutete nun, dass diese direkt auf Beratung und deren Konzeption fokussiert war, anstatt allgemein auf Ehe und Familie.³¹⁵ Adenauer äußerte, das KZI habe „also eine praktische, keine wissenschaftliche oder organisatorische Aufgabe. Allerdings soll es sich zur Erreichung dieses praktischen Zieles aller geeigneten Mittel bedienen, z. B. der Auswertung wissenschaftlicher Ergebnisse.“³¹⁶ Das KZI sollte in diesem Sinne „als Brücke zwischen allen einschlägigen Wissenschaften und der Praxis aller Bemühungen der Kirche und ihr nahestehender Stellen auf dem Gebiet von Ehe und Familie“ dienen.³¹⁷ Dies entsprach den Vorstellungen, die Außenstehende bereits zuvor mit dem Zentralinstitut in Verbindung gebracht hatten.³¹⁸ Der oberste Zweck des Vereins sollte die „Bearbeitung der grundlegenden praktischen und der damit zusammenhängenden Fragen der Eheberatung aus der Verantwortung der katholischen Glaubens- und Sittenlehre“ sein,³¹⁹ vor allem durch die Sammlung von Material, Anregungen zur Errichtung von Beratungsstellen und Ausbildung von Beraterinnen. Alle vier Jahre war ein neuer Vorstand zu wählen, der aus einem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und höchstens drei weiteren Mitgliedern bestehen sollte. Dazu wurde ein Beauftragter der Fuldaer Bischofskonferenz bestimmt. Korte rückte in der Hierarchie des Instituts nach unten, auch finanziell, da er als Referent Adenauer künftig untergeordnet war. Daraufhin bewarb er sich um den Posten des Direktors der Höheren Fachschule für Sozialarbeit, den er 1963 antrat. Als Nachfolger suchte das KZI einen Mediziner mit einer guten psychologischen Ausbildung.³²⁰ Während der Umstrukturierung hielt das KZI seine Arbeit wegen eines hohen Krankenstands unter den Mitarbeitern „nur notdürftig […] aufrecht[…]“.³²¹ Infolge des allgemeinen Personalmangels war das Institut im Jahr 1963 nur zu etwa 40 Prozent besetzt.³²² Es herrschte eine chronische Arbeitskräftenot. Briefe blieben
Vgl. o. A.: Satzung vom 11.8.1961 für das Kath. Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen, 11. August 1961, ADCV, 349.4, Fasz. 03. [Paul] Adenauer: Aufgaben und Organisation des kirchlichen Zentralinstituts für Ehe- und Familienfragen, 27. Oktober 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 03. Struck, Ehenot, 1966, S. 54. Vgl. o. A.: Niederschrift aus der Besprechung in der erweiterten Trägerschaft des Kath. Zentralinstituts für Ehe- und Familienfragen am 16. Mai 1960 in Köln, S. 2, AEK, DBK, KZI 295. [KZI]: Satzung für das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen, o. D., S. 1, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Vgl. auch im Folgenden. Vgl. [Paul] Adenauer an Vorstand [KZI], 23. Januar 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 06. [Helmut] Friederichs an [Vorstand KZI], 15. Oktober 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 06. Vgl. KZI: Jahresbericht 1963, [1964], ADCV, 349.4, Fasz. 07.
4.2 Das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen
295
wochenlang unerledigt liegen.³²³ Dabei galt die Aufgabe, das Personal aufzustocken, seit Jahren als sehr dringlich,³²⁴ der Zustand als „unhaltbar“.³²⁵ Adenauer, der dem KZI für den kirchlichen Aufgabenbereich eine große Verantwortung beimaß,³²⁶ suchte daher eine höhere Besoldung aller Mitarbeiter durchzusetzen, auch indem er auf die Konkurrenz verwies: Die Erfahrung der Monate seit der Erweiterung des Institutes zwingen Vorstand und Institutsleitung zu der Erklärung, daß bei einer Fortsetzung der von der Finanzkommission gehandhabten Praxis in Gehaltsfragen die Verantwortung für eine Bewältigung der dem Institut gestellten Aufgaben kaum zu tragen ist, weil anhaltender Personalmangel die Arbeit lähmt und vor allem zu niedrige Gehaltssätze die Folge haben, daß es nicht gelingt, der Gefahr einer Rückständigkeit oder Minderwertigkeit des Katholischen Zentralinstitutes im Vergleich zu anderen Instituten seiner Art zu begegnen […], die entsprechend hochqualifizierte und höher besoldete Mitarbeiter bereits haben oder noch neu einstellen.³²⁷
Dennoch lehnte die Finanzkommission das Anliegen ab, da alle überdiözesanen Stellen gleich behandelt werden sollten.³²⁸ Eine Rolle spielte auch die Überzeugung, das Institut würde bei einem höheren Angebot nicht die nötigen Idealisten gewinnen. Damit befand sich das KZI in derselben Lage wie andere konfessionelle Dienste, die ebenfalls Rekrutierungsprobleme hatten.³²⁹ Dies war nicht nur auf die vergleichsweise schlechte Entlohnung zurückzuführen, sondern auch auf die Einmischung des kirchlichen Arbeitgebers in das Privatleben, die Mitarbeiter angesichts der zunehmenden Säkularisierung als immer unangemessener betrachteten. Das genaue Ausmaß des Personalmangels zu quantifizieren war nicht möglich, doch herrschte die einmütige Ansicht, dass er dramatisch war und sich zu verschlechtern drohte. Daher wurden die Gehälter der konfessionellen Mitarbeiter an die Tarif-
Vgl. [Paul] Adenauer an [Fuldaer Bischofskonferenz], 14. August 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 05. Vgl. [Lorenz] Jaeger an Helene Weber, Brief, 27. Juli 1961, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. H[ermann] Klens: Bemerkungen zum Voranschlag 1961 des „Katholischen Zentralinstituts für Ehe- und Familienfragen“, 20. Mai 1960, AEK, DBK 295. Am 4. März 1964 schrieb Adenauer in sein Tagebuch: „Es ist nicht leicht. Man muss sehen, wie man mit seiner eigenen Arbeit und den Sorgen fertig wird. Die Verantwortung, die unser Institut für die Kirche hat, wird mir immer schwerer und größer bewusst. Dazu die personellen Schwierigkeiten […]. Der dauernde Kampf gegen Schluderei, gegen Ungenauigkeiten, gegen den Schlamm in unserem Betrieb aus früheren Zeiten, der immer noch seine Spuren hinterlassen hat.“ Küsters, Adenauer, 2017, S. 414. In Bezug auf das KZI tauschte sich Adenauer regelmäßig mit seinem Vater über Schwierigkeiten aus, vgl. ebd., S. 66 f., S. 212, S. 222, S. 337 und S. 339. [Paul] Adenauer an [Fuldaer Bischofskonferenz], Brief, 14. August 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 05. Die Gehaltsstufe der Leitung wurde auf A 13 festgelegt. Vgl. im Folgenden Hammerschmidt, Wohlfahrtsverbände, 2005, S. 295 ff.
296
4 Katholische Eheberatung
ordnung für Angestellte im öffentlichen Dienst angeglichen, auch wenn dies Proteste auslöste. Die nächste Krise zeigte sich, als der neue Vorstandsvorsitzende zu Beginn des Jahres 1963 Vorwürfe wegen mangelhafter Buchführung erhob.³³⁰ Kurz darauf kündigte eine Sekretärin wegen der schlechten Stimmung im KZI. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Vorsitzenden des KZI, Helmut Friederichs, und dem Vorstandsmitglied Mann. Diese warf Friederichs vor, die Angestellten nicht gut zu behandeln und Kündigungen herbeizuführen; er unterstellte ihr, sich in Personalangelegenheiten einzumischen, wozu sie keine Berechtigung habe.³³¹ Die Situation bedrückte die Vorstandsmitglieder. Die Vorgängerin Manns, Kirschner, bezeichnete Friederichs als „vollkommen ahnungslos“.³³² Der Konflikt endete mit dem Rücktritt Manns von ihrer Position.³³³ Friederichs hatte sich durchgesetzt, nachdem er mit Austritt gedroht hatte, solle die Vertreterin des KDFB weiterhin im Vorstand bleiben.³³⁴ Der Institutsleiter bzw. Direktor war zwar umstritten, doch auch bestimmend für die Arbeit des KZI. Unter Kortes Leitung begann eine Entwicklung, die sich immer mehr von der amtskirchlichen Ehepastoral entfernte.³³⁵ In der ersten Monografie zur Geschichte und Organisation der Beratungsarbeit schloss der Autor, dass auch wegen des jahrelangen „Ein-Mann-Betriebs“ zwar Schwierigkeiten bestünden. Dennoch sei eine Ausbreitung der Arbeit auf die ganze Bundesrepublik möglich gewesen.³³⁶ Der Caritasverband wollte das KZI reformieren, um einen größeren Nutzen für die Verbände zu schaffen. Dies gelang allerdings nicht vollständig. Zwar entsprach es den Wünschen der Caritas, dass sich das Institut rechtlich und finanziell konsolidierte und auf die Praxis ausrichtete. Ebenso das Ausscheiden Kortes. Andere Vorstellungen konnte sie jedoch nicht durchsetzen. Auffällig ist, dass Veränderungen erst eintraten, als die Bischofskonferenz ihren Einfluss geltend machte. Nach dem Ausbau des KZI und einer Professionalisierung der Kurse für Eheberaterinnen 1965 veröffentlichte das Institut eine Broschüre über seine Arbeit.³³⁷ Vgl. [Helmut] Friederichs an Vorstand [KZI], 3. Januar 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 06. Vgl. Else Mann an Erich Reisch, Brief, 16. Februar 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 05. Berna Kirschner an Helene Weber, Brief, 3. September 1961, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Vgl. o. A.: Niederschrift über die Vorstandssitzung am 30. Oktober 1962, o. D., ADCV, 349.4, Fasz. 03. Vgl. Helmut Friederichs an Vorstand [KZI], Brief, 07. Februar 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 06. Vgl. Große Kracht, Elternrecht, 2018, S. 8 f. Halberstadt, Beratungsarbeit, 1986, S. 65. Zur Einschätzung der Rolle Paul Adenauers als Leiter des KZI vgl. auch Küsters, Adenauer, 2017, S. 67 f. Vgl. [KZI]: Jahresbericht 1965, [1966], S. 1, ADCV, 349.4, Fasz. 07.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
297
Die Publikation lobte das Institut und verdeutlichte, dass man in einer neuen Phase der Geschichte katholischer Eheberatung angekommen sei.³³⁸ Nach jahrelangen Auseinandersetzungen und mitten in der Umstrukturierung bestehe für das KZI die Aussicht auf eine positive Zukunft: „Aus der Entwicklung der Aufgaben des Institutes ergibt sich, daß nun eine neue zweite Wachstumsperiode beginnt.“³³⁹
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung Unmittelbar nach Kriegsende spielten katholische Verbände wie die Caritas oder auch der spätere Sozialdienst katholischer Frauen eine wichtige Rolle. Sie waren Teil der Notfallhilfe sowie der Rechristianisierungsbemühungen.³⁴⁰ In ihrem Selbstverständnis sahen sie sich damit vorerst bestätigt. Dies änderte sich allerdings mit der zunehmenden Pluralisierung der Gesellschaft, dem wirtschaftlichen Aufschwung sowie dem Ausbau des Wohlfahrtsstaates. Massiver Personalmangel herrschte, denn es fehlte Nachwuchs im Ordensbereich. Spätestens ab 1957 nahm die Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter ab, Laien mussten engagiert werden. Mit der veränderten Zusammensetzung ging auch ein Wandel der Arbeitsmotivation einher. Nachdem in der Sinndeutung des katholischen Milieus lange eine Tätigkeit in der Fürsorge dominant gewesen war, traten nun immer mehr professionelle Fachkräfte in den Vordergrund. Mit diesem „Wandel von der Fürsorge zur Sozialarbeit als Dienstleistung“³⁴¹ fand sich der katholische Glaube zu einem Teilaspekt der Arbeit heruntergestuft. Das Selbstverständnis der Verbände geriet in eine Krise, sie mussten sich neu orientieren. Schließlich fanden sie zu einer Integration in den Wohlfahrtsstaat und arbeiteten an einer professionellen Ausgestaltung ihrer Tätigkeit. Auch die katholische Eheberatung sah sich mit dem Wandel der Gesellschaft und des katholischen Milieus in der Nachkriegszeit konfrontiert. Die Auseinandersetzungen um ihr Selbstverständnis waren jedoch nicht ganz so ausgeprägt. Das KZI sowie die Beratungsstellen hatten zwar ebenso wie andere kirchennahe Insti-
Struck, Ehenot, 1966, S. 44. KZI: Jahresbericht 1962, März 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Vgl. im Folgenden Henkelmann, Caritasgeschichte, 2008, S. 413 ff.; Osten, Petra von der: Jugendund Gefährdetenfürsorge im Sozialstaat. Der Katholische Fürsorgeverein für Mädchen, Frauen und Kinder auf dem Weg zum Sozialdienst katholischer Frauen 1945 – 1968. Paderborn 2002, S. 232 ff. Ebd., S. 129.
298
4 Katholische Eheberatung
tutionen mit Personalmangel zu kämpfen,³⁴² doch nur in wenigen Ausnahmefällen handelte es sich bei ihren Beschäftigten um Ordenspersonal. In der Regel war Eheberatung Laienarbeit, was für das Selbstverständnis der Akteurinnen eine große Rolle spielte. Das sollte sich auch in der Bundesrepublik nicht verändern. Dennoch wandelte sich die Sicht auf Eheberatung und Beraterinnen. Das KZI trieb diese Entwicklung federführend voran. Es förderte zudem die Professionalisierung der Arbeit und ihre Ausrichtung auf die Psychologie. Daran beteiligten sich die Eheberaterinnen je nach Interesse, teilweise stellten sie sich diesen Tendenzen aber auch entgegen. Über den gesamten Untersuchungszeitraum bildete der katholische Glaube für sie einen wichtigen Aspekt ihres Selbstbilds. Doch traten das Milieuverständnis und die katholische Sicht auf die Ehe im Laufe der Zeit zusehends in den Hintergrund.³⁴³ Paul Adenauer formulierte als Direktor des KZI 1963: „Ehe und Familie in ihrem Sein geht vor Ehemoral, Eherecht usw. ‚Um die Ehe zu heilen und zu retten‘ – dafür allein ist Eheberatung da.“³⁴⁴ Dass diese nun nicht mehr einfach bedeutete, Rat zu erteilen, sondern als professionelle therapeutische Arbeit galt, stellte dabei eine erfolgreiche Anpassung an die bundesrepublikanische Gesellschaft dar.
4.3.1 Katholische Vorstellungen von Ehe und Eheberatung in der frühen Bundesrepublik In der katholischen Eheberatung waren die Grundsätze der katholischen Sozialund Sittenlehre maßgebend. Nach dem Zweiten Weltkrieg fügte sich die Beratungstätigkeit damit in die Rechristianisierungsbemühungen ein. Ihre Prinzipien galten als unparteilich und universalistisch. Sie sollten für alle Ratsuchenden gleichermaßen zur Anwendung kommen, auch wenn diese einer anderen Konfession angehörten. Das KZI ging bei seiner Gründung davon aus, daß Ehe und Familie ein Ganzes sind, daß die Ehe sich in der Familie vollendet und dass die Familie aus der Ehe herrührt und nur von ihr her zu verstehen ist. Nur in dieser bewußten Aufgabensicht werden wir Katholiken jene falsche Spezialisierung überwinden können, die die
Vgl. Kapitel 4.2.5 Auseinandersetzungen um die Ausrichtung und Kapitel 4.5.5 Versuch einer Bestandsaufnahme. „Dies kann im Extremfall zu der paradoxen Situation führen, daß Beratende für ihre Klienten Entscheidungsfreiheiten thematisieren, die sie sich selbst aufgrund der eigenen Einbindung in die Kirche versagen.“ Eckart, Individuation, 1999, S. 229. [Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen]: Aus dem Referat von Dr. Adenauer „Bausteine einer Theologie der Eheberatung“, 23. April 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 08.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
299
Ehe allein mit Sexualberatung oder gar Anweisungen über Empfängnisverhütung versieht und die Erziehungsschäden isoliert mit Psychologie zu beheben sucht. Ehe- und Familienberatung gehören bei uns zusammen.³⁴⁵
Das entsprechende Eheideal bildete stets den Hintergrund der Beratungsarbeit. Im Gründungsjahr des KZI erschien Albert Niedermeyers Handbuch der speziellen Pastoralmedizin, eine der letzten größeren Veröffentlichungen in diesem Bereich. Niedermeyer wollte „die Fragenkomplexe der Ehe- und Sexualberatung in einwandfrei wissenschaftlicher Form […] erörtern“³⁴⁶ und die wissenschaftlichen Grundlagen der Eheberatung universalistisch betrachten. Für den Autor, der sich in erster Linie als medizinischer Berater sah,³⁴⁷ war der Weg der katholischen Kirche der einzig mögliche.³⁴⁸ Er nannte die Leitsätze der Fuldaer Bischofskonferenz, an denen er mitgearbeitet hatte.³⁴⁹ Ein universalistischer Blick begnüge sich nicht damit, die biologische oder soziale Seite zu betrachten. Er müsse darüber hinaus auch die ethisch-metaphysische respektive sittlich-religiöse Seite berücksichtigen.³⁵⁰ „Nur auf dieser Grundlage kann Eheberatung so betrieben werden, daß sie der gesamten Tatsächlichkeit gerecht wird.“³⁵¹ Dabei diene sie „der sozialen und moralischen Sanierung von Ehe und Familie“.³⁵² Für Zielsetzung und Organisation bedeute dies, ein Prinzip der Katholizität zu etablieren: „In allen sozialen und sittlichen Fragen gelten als maßgebend die Grundsätze der katholischen Sozial- und Sittenlehre, wie sie insbesondere in den grundlegenden Enzykliken ‚Casti connubii‘ und ‚Quadragesimo anno‘ niedergelegt sind. Diese Grundsätze sind allgemeingültig, ausnahmslos für alle Menschen, gleichviel welchem Religionsbekenntnis sie angehören.“ Explizit sollte katholische Eheberatung allen Konfessionen offenstehen. Die Theologie war für Niedermeyer die das Ziel weisende Wissenschaft und der Garant für Unparteilichkeit.³⁵³ Dieses Verständnis einer wissenschaftlich objektiven katholischen Lehre findet sich ähnlich auch bei Anna Beckmann, einer einflussrei-
o. A.: Protokoll aus der Konferenz über Fragen der Eheberatung, 4. Juni 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Niedermeyer, Handbuch, 1952, S. 357. Vgl. ebd., S. 483. In seiner Autobiografie beschreibt Niedermeyer die Entwicklungsschritte hin zu seiner Ansicht, nur die katholische Lehre könne eine Antwort auf alle Fragen zu Ehe und Familie geben. Vgl. Niedermeyer, Wahn, 1956. Zu der von ihm als universalistisch bezeichneten Betrachtungsweise der Pastoralmedizin vgl. ebd., S. 181 ff. und S. 248. Vgl. Kapitel 1.2 Kirchliche Beratungsstellen. Vgl. Niedermeyer, Handbuch, 1952, S. 393. Ebd., S. 394. Ebd., S. 394 f. Vgl. ebd., S. 438 und S. 443.
300
4 Katholische Eheberatung
chen Persönlichkeit der Beratungspraxis. Sie wünschte sich ein Zentralinstitut, das entsprechend ausgestaltet sein sollte.³⁵⁴ Niedermeyer glaubte, es bedeute eine rettungslose Verstrickung in Irrtümer, weiche man von der katholischen Lehre auch nur im Geringsten ab, um Zugeständnisse an den Zeitgeist zu machen. Darin erblickte er eine größere Gefahr als in der strikten Ablehnung katholischer Ansichten.³⁵⁵ Der Pastoralmediziner konstatierte eine Krise der Ehe und schloss daraus, dass Eheberatung notwendig sei. Als Beweis zählte er Geschlechtskrankheiten, Scheidungen, Sterilität, Abort, Geburtenrückgang, die Zunahme von Erbleiden, Neurosen und Psychosen, dazu sexuelle Frühreife sowie vor- und außerehelichen Geschlechtsverkehr auf. Wie andere Autoren ging er hier von einer allseits bekannten Grundproblematik aus, die er nicht weiter erläutern musste.³⁵⁶ Auf diesen Konsens bezog er sich in seiner Argumentation: „So leicht es wäre, den Beweis für die Notwendigkeit der Eheberatung auf die Statistik zu stützen, so bedürfen wir seiner nicht; es genügt der Hinweis auf die Problematik der Zeit selbst, um die zeitbedingte besondere Notwendigkeit der Eheberatung zu erweisen.“³⁵⁷ Niedermeyer kritisierte, moderne Menschen hätten sich von der Seelsorge gelöst. Eheberatung sei generell notwendig, weil die Heirat einen der wichtigsten Schritte im Leben darstelle. Sie entscheide über das individuelle Lebensglück, gehe über das individuelle Wohl hinaus und wirke sich auch auf künftige Generationen aus. Die Ehe sei nicht nur eine Angelegenheit des Individuums, sondern auch der Gemeinschaft von Familie, Volk, Staat und Gesellschaft sowie der kirchlichen Gemeinschaft. Damit offenbarte sich bei dem Autor eine gewisse Kontinuität des Denkens, welche die Ehe in einen über die Beteiligten hinausreichenden Auftrag einordnet. Auch in diesem Sinne konnte er resümieren, dass die Eheberatung eine öffentlich anerkannte Institution sei, die aufgrund ihrer Bedeutung immer weiter wachse. Diese Entwicklung sah er positiv, kritisierte aber einige Akteure nicht nur als unprofessionell, sondern sogar als destruktiv. Insbesondere nannte er Zeitschriften, die Beratungen als lukrativen Geschäftszweig entdeckt hätten, vor allem sexualwissenschaftliche Publikationen.³⁵⁸ Er stellte Prinzipien auf, mit denen öffentliche Beratungsstellen Vertrauen gewinnen sollten: Freiwilligkeit, Sittlichkeit und Menschenwürde. Der
Vgl. Anna Beckmann an [Josef ] Frings, Brief, 5. Mai 1949, AEK, Gen. II 13.2, 2a. Vgl. Krabbel, Beckmann, 1952, S. 95. Vgl. Niedermeyer, Wahn, 1956, S. 179 f. Vgl. z. B. Stonner, Anton: „Die Krise der christlich-abendländischen Form der Ehe und Familie“. In: Berufsverband Katholischer Sozialarbeiter Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Familiennot und ihre Überwindung. o. O. [1955], S. 5 – 17. Niedermeyer, Handbuch, 1952, S. 386. Vgl. ebd., S. 357.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
301
Menschenwürde widersprächen beispielsweise praktische Maßnahmen „wie z. B. Sperma Untersuchungen per modum masturbationis oder eine fecundatio arteficialis cum semine alterius viri“.³⁵⁹ Auch müsse die praktische Arbeit sich an der katholischen Ehe orientieren. Dies bedeutete für Niedermeyer nicht, dass die Beratung Unverheirateter abzulehnen sei. Jeder Ratsuchende solle angehört und beraten werden, jedoch nach dem „Prinzip der Ehelichkeit“. Der Mediziner betrachtete jede Form der Empfängnisverhütung als auf die Dauer gesundheitsschädlich; je sicherer die Methode, desto gefährlicher. Dennoch sprach er sich dagegen aus, Verhütungsberatung generell abzulehnen. Ratsuchende könnten sich dann von der katholischen Beratung abwenden und andere Stellen aufsuchen, was einen noch größeren Schaden nach sich ziehe. Dort würden sie „zwar nicht einwandfreier, aber dafür in einer ihren Wünschen entgegenkommenden Weise beraten“ werden. Für Niedermeyer zeigte sich in dieser Frage die hohe volkspädagogische Anforderung der Eheberatung: Es genüge nicht, „die Menschen mit dem Aplomb moralischer Selbstgerechtigkeit abzuweisen und ihren Wunsch nach Raterteilung über Empfängnisverhütung entrüstet abzuweisen“; erfüllt sei die Aufgabe „erst mit einer wirklichen und wirksamen Belehrung der Parteien und mit einer überzeugten Bekehrung zu einem besseren Standpunkt“. Der Autor forderte also, Ratsuchende nicht durch ein moralisches Verbot abzuschrecken, sondern sie durch die Tatsache zu überzeugen, dass Verhütung schwere gesundheitliche, soziale und eugenische Folgen habe und unweigerlich in der Ehezerrüttung ende. Dieser volkspädagogische Auftrag der Eheberatung stellte Niedermeyer zufolge besonders hohe Anforderungen an den Berater, denn die „Erfüllung dieser Aufgabe ist naturgemäß viel schwerer und erfordert den Einsatz der ganzen Persönlichkeit des Beraters. Er muß im Stande sein die Ratsuchenden zu überzeugen, wenn er sie belehren und bekehren will.“³⁶⁰ Der Pastoralmediziner erkannte damit an, dass es schwierig war, Widerstrebende zu belehren, besonders wenn diese bereits Verhütung praktizierten. Sie hätten dann schon wissenschaftliche Fehlurteile und Rationalisierung verinnerlicht. „Aber die Aufgabe darf nicht a priori abgelehnt werden; man muß sich ihr unterziehen, mag sie noch so schwer und undankbar sein. Das Ziel dieser Aufgabe muß sein die Überwindung des Ehemißbrauchs.“³⁶¹ Diese Haltung durfte nur bei sorgfältigst ausgewählten Fällen durchbrochen werden, zum Beispiel, wenn eine Schwangerschaft eine Lebensgefahr hervorrufen würde. Dann könne eine periodische Enthaltung nach Knaus-Ogino in Frage kommen. Eher noch
Im Folgenden ebd., S. 396. Ebd., S. 431 f. Ebd., S. 432.
302
4 Katholische Eheberatung
riet Niedermeyer in solchen Fällen zu Abstinenz, da dies zuverlässiger sei.³⁶² Auch der KDFB plädierte dafür, die „marktschreierische Propaganda für die Knaus-OginoMethode“ einzustellen und diese „nur in echten Notfällen in persönlicher Beratung mit fachkundigen Persönlichkeiten zu behandeln […], damit jeweilig eine echte Gewissensentscheidung der Eheleute erreicht wird“.³⁶³ Beckmann befürchtete zwar eine „Gefährdung der seelischen Lebensgemeinschaft […], denn der weibliche Teil würde besonders empfindlich von einer nüchternen ‚Berechnung‘ in der Eheführung in seinem feinen Empfinden verletzt werden“.³⁶⁴ Doch gestand sie den Ehepartnern eine freiere Entscheidung zu. Sie betonte sogar, „daß die Nutzbarmachung einer naturgegebenen Einrichtung nicht sündhaft in sich sein kann“³⁶⁵ und zog die päpstliche Enzyklika „Casti connubii“ als Beleg hinzu.³⁶⁶ Des Weiteren begrüßte sie die Möglichkeit, dass die Knaus-Ogino-Methode, um die fruchtbaren Tage zu berechnen, auch ungewollt kinderlose Paare ermutigen könne.³⁶⁷ Hier wird ersichtlich, dass Eheberatung innerhalb des von der Kirche gesetzten Rahmens eine große Bandbreite aufwies. Niedermeyer gab auch Empfehlungen zur konkreten Ausstattung einer Eheberatungsstelle. Ihr sollte ein Seelsorger vorstehen, dem weitere Berater wie Ärzte, Juristen und Psychologen sowie Fürsorger zugeordnet waren. Für jeden Beratungsfall sah Niedermeyer übersichtliche Aufzeichnungen vor, die eine spätere Rekonstruktion und wissenschaftliche Auswertung ermöglichten. Statistiken und Tätigkeitsberichte empfahl er, jedes Kalenderjahr initiativ zu verfassen.³⁶⁸ Als Pastoralmediziner betrachtete er die Arbeitsweise einer Beratungsstelle als Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen. Der Psychologie stand er positiv gegenüber und verstand sie als Hilfe sowohl bei vorehelicher als auch innerehelicher Beratung:³⁶⁹ „Jedenfalls vermag die psychologische Beratung bedeutsame Aufgaben zu erfüllen auch in jenen Fällen, in denen es sich um die Schlichtung von Streitigkeiten und Schwierigkeiten handelt.“³⁷⁰ Damit waren bei einem wichtigen Vertreter der
Ebd., S. 433. Katholischer Deutscher Frauenbund: Stellungnahme, 16. März 1949, AEK, Gen. II 13.2, 2a/166. Beckmann, Ehe, 1948, S. 21. Ebd., S. 20. Vgl. Pius XI., Casti connubii, 1930, 59. Vgl. Beckmann, Ehe, 1948, S. 21 f. Vgl. Niedermeyer, Handbuch, 1952, S. 450. Niedermeyer hatte während des Nationalsozialismus selbst Psychotherapie als ärztliche Seelsorge betrieben und unterzog sich später aus Interesse einer Lehranalyse. Vgl. Niedermeyer, Wahn, 1956, S. 437 ff. Ebd., S. 436. Zur Umsetzung seiner Vorstellungen vgl. auch Niedermeyers Beschreibung der von ihm geleiteten Eheberatungsstelle in Wien; ebd., S. 321 ff.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
303
Eheberatung deutlich weniger Vorbehalte gegen die Psychologie zu beobachten als bei vielen leitenden Persönlichkeiten der amtlichen und evangelisch geprägten Beratungsrichtung. Über eine einschlägige Fachzeitschrift verfügte die katholische Beratungsarbeit im Untersuchungszeitraum nicht. Doch meldeten sich in den 1950er-Jahren neben Niedermeyer auch Beraterinnen aus der Praxis in verschiedenen Publikationen zu Wort. Erst ab 1965 gab das KZI den Aktuellen Zitat- und Informations-Dienst heraus, der Fragen wie Frühehe oder Geburtenregelung behandelte.³⁷¹ Bei den Rundbriefen, die das Institut 1957 und 1958 an die Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen verschickte, handelte es sich nicht um eine Fachzeitschrift im eigentlichen Sinn, zudem liegen nur vereinzelte Exemplare vor.³⁷² Vermutlich wurde der Rundbrief danach eingestellt. In den Fachzeitschriften der Caritas und der Elisabeth-Konferenzen, die an kirchlicher Beratung Interessierte lasen, fanden sich jedoch auch Artikel zur Eheberatung. Hinzu kamen Aufsätze in Zeitschriften katholischer Prägung wie Die katholische Frau.Verfasserinnen waren häufig bekannte Eheberaterinnen wie Josepha Fischer-Erling, Berna Kirschner und Käthe Zelazny³⁷³. Insgesamt handelte es sich nur um einzelne Artikel ab dem Jahr 1950, in denen allerdings Selbstverständnis und Anspruch der Eheberaterinnen deutlich hervortraten. Durchgängig diskutierten die Autorinnen ihre breite fachliche Qualifikation. Sie betonten, wie wichtig es sei, Situationen individuell zu betrachten und sich modernen Entwicklungen zu öffnen. Oft verwiesen sie auch explizit auf die christliche Haltung der Eheberatung, von der insgesamt ein sehr positives und vertrauenerweckendes Bild entstand. Welche Eindrücke die Beraterinnen von ihrer Klientel hatten, ist nicht so eindeutig, da dies nicht im Vordergrund stand. Auffällig ist aber, dass sie gelegentlich anmerkten, Ratsuchende wüssten oft nicht, welche Ursachen ihre Konflikte hätten; außerdem schien die Erwartungshaltung an die Ehefrauen durch, mit verständnisvollem und zurückhaltendem Verhalten die Situation zu verbessern. In den Artikeln stechen einige Themen heraus, die als besonders praxisrelevant galten. Die Autorinnen problematisierten die junge Ehe beziehungsweise Frühehe,
Vgl. KZI: Moraltheologische Bewertung der Empfängnisregelung, AZD, Nr. 3, Köln 1965 sowie KZI: Frühehe in Deutschland, AZD, Nr. 4, Köln 1965. Vgl. AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963 sowie ADCV, R 565, Fasz. 01. Käthe Zelazny war promovierte Medizinerin. Als Eheberaterin arbeitete sie zeitweise im Haus der Volksarbeit in Frankfurt. Von 1964 bis 1979 betätigte sich Zelazny, mit einer kurzen Unterbrechung, in verschiedenen Funktionen im Vorstand des Vereins Katholischer Eheberaterinnen und Eheberater. Vgl. o. A.: Chronik des Verbandes Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater. o. D., Bundesverband Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater e. V. sowie Caritas-Verband für die Diözese Limburg an Erich Reisch, Brief, 9. Oktober 1959, ADCV, 349.4, Fasz. 05.
304
4 Katholische Eheberatung
die alte Ehe, die berufstätige Ehefrau, Untreue sowie kirchenrechtliche Schwierigkeiten durch „Mischehe“, Scheidung und Wiederheirat. Die meisten Punkte standen auch zeitgenössisch stark in der Diskussion. Die Mehrheit der Themen spiegelte sich in der Beratungspraxis wider. Nicht dort nachzuweisen sind allerdings Probleme der „alten Ehe“ und solche aufgrund der Berufstätigkeit der Ehefrau.³⁷⁴ Diese Aspekte wurden somit eher in Bezug auf ihre gesellschaftspolitische Relevanz als auf nachweisbaren Praxisbezug hin ausgewählt. Die in den Artikeln beschriebenen Interaktionen mit Ratsuchenden verdeutlichen zudem, dass die hohe Erwartungshaltung der Eheberaterinnen sich selbst und den Ratsuchenden gegenüber teilweise scheiterte. Fischer-Erling schilderte in einem Artikel aus dem Jahr 1951 ihre Beratungsarbeit als sehr sorgfältig und differenziert. Damit wollte sie auch für den Besuch von Eheberatungsstellen werben. Am Ende ihres Beitrags gab sie selbst zu, mittlerweile „Propaganda nach amerikanischen Methoden“ zu machen, obwohl sie diesbezüglich Hemmungen habe.³⁷⁵ Plakate und Anschläge an Schwarzen Brettern in Krankenhäusern, Pfarrämtern, Kirchen und Standesämtern verwiesen auf ihre Einrichtung. Gerade Artikel, Kurzhinweise und Annoncen zu veröffentlichen, erwies sich immer wieder als großer Erfolg, da die Besucherzahlen danach deutlich anstiegen. Vor allem kamen mehr männliche Ratsuchende in die Sprechstunden. Zu diesem Thema druckte die Caritas in ihrer Verbandszeitschrift einen Vortrag von Lothar Loeffler über „Grundsätzliche Gedanken zur Frage der Jugend- und Ehekrise“ ab.³⁷⁶ Für die darauffolgenden Jahre beschränkten sich die Artikel über Eheberatung auf einen Bericht Kirschners zu einer internationalen Arbeitstagung und die Schilderung eines Besuchs in einem Müttergenesungsheim.³⁷⁷ Wenige Jahre, nachdem Niedermeyers Handbuch der speziellen Pastoralmedizin erschienen war, äußerte sich Fischer-Erling 1956 nochmals zur Eheberatung.³⁷⁸ Ihre Begriffsdefinition war breiter angelegt als die von Niedermeyer: „Eheberatung gibt Rat, Hilfe und Führung in allen Fragen, die den Bereich der Liebe, Ehe und Familie umfassen.“³⁷⁹ Fischer-Erling begründete die Existenz der Eheberatung nicht mit einer Krise der Institution Ehe, sondern nannte stattdessen die Schwierigkeiten,
Vgl. Kapitel 4.5.4.2 Junge und alte Ehe. Fischer-Erling, Eheberatung, 1951, S. 66, DZI. Vgl. Loeffler, Gedanken, DZI. Vgl. M[argarete] H[ohmann]: „Frauen schütten ihr Herz aus“. In: Die katholische Frau 11 (1958), Nr. 9, S. 7 und S. 15, DZI sowie Kirschner, B[erna]: „Internationaler Austausch über Eheprobleme, Arbeitstagung der Commission des Conseils Matrimoniaux London, 25.–26. Mai 1956“. In: Informationsdienst d. AgdkdF, Nr. 6/7, [Köln] 1956, S. 6 – 8, DZI. Vgl. im Folgenden Fischer-Erling, Eheberatung, 1956. Ebd., Sp. 149.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
305
die Ehe selbst zu gestalten. Diese verlange danach, dass die Beteiligten sie im Sinne einer personalen Gefühlsbeziehung bewusst füllten und lebten. Die Beziehung sei der tragende Grund der Ehe geworden, die damit zerbrechlicher und ratbedürftiger geworden sei. Damit folgte Fischer-Erlings Ehebild nicht dem offiziellen Lehramt, sondern dem in der Laienarbeit bereits verbreiteten personalen Verständnis.³⁸⁰ Die bekannte Beraterin erblickte die Hauptpunkte der Arbeit in der Sexualberatung, der Eugenik, der Rechtsberatung und der Psychohygiene sowie in Störungen und Krisen der Ehe selbst. Explizit schloss sie Unverheiratete in die Zielgruppen ein. Das spezifisch Katholische der Eheberatung sah sie darin, dass die kirchliche Ehe- und Sittenordnung befolgt werde. Das kirchliche Eherecht sei von großer Bedeutung für die Praxis. Im Gegensatz zu Niedermeyer zeichnete sie ein konkretes, wohlwollendes Bild der Ratsuchenden, die daran interessiert seien, ihre Ehe aufrechtzuerhalten und so Verantwortungsbewusstsein zeigten. Fischer-Erling zufolge stammten die Besucher vor allem aus der Mittelschicht, dem Bürgertum und der gehobenen Arbeiterschicht. Dabei beobachtete die Juristin, dass Männer eher in die voreheliche Beratung kamen, während Frauen bei Eheschwierigkeiten stärker präsent waren. Obwohl Fischer-Erling sich der katholischen Eheordnung verpflichtet sah, begriff sie Beratung bereits als individuelle Unterstützung und nicht mehr als Anweisung. Zudem war es für sie ein wichtiges Ergebnis, wenn die Ratsuchenden sich eigenverantwortlich um ihre Ehe kümmerten. Im Mittelpunkt stand somit nicht die abstrakte Institution Ehe, sondern der Ratsuchende.³⁸¹ Im Vergleich zu den Ansichten, die Lehramt und Seelsorge zu diesem Zeitpunkt noch vertraten, war das eindeutig ein neuer Ansatz.
4.3.2 Die Beraterinnenpersönlichkeit Josepha Fischer-Erling ging in ihrer Publikation auch auf die Persönlichkeit der Eheberaterin ein. Dazu taugten in ihren Augen vor allem verheiratete weibliche Laienkräfte. Zudem besprach sie die Methoden der Beraterinnen, die eng mit deren Fähigkeiten verknüpft waren. Diese Methoden sind bei ihr allerdings nicht im Sinne bestimmter festgelegter Vorgehensweisen zu verstehen. Vielmehr ging es um das Gespräch, das den Ratsuchenden bei der Wahrheitsfindung helfen sollte und in dem
Vgl. Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 366. Vgl. Fischer-Erling, J[osepha]: „Methode der Eheberatung“. In: B[ernhard] Korte: Erster überdiözesaner Kursus für Eheberatung, März 1953, S. 8 – 9, AEK, Gen. II 13.2a, 1.
306
4 Katholische Eheberatung
beide Partner anzuhören waren.³⁸² Eine wichtige Rolle spielten dabei die Schweigepflicht, die persönliche Glaubwürdigkeit der Beraterin, ihre Fähigkeit, Vertrauen zu gewinnen und uneigennützig zu handeln, aber ebenso eine universale Bildung im juristischen, seelischen und medizinischen Bereich sowie eine entsprechende Ausbildung. Insbesondere Scheidungswillige sollten die Möglichkeit erhalten, Abstand zu ihren Konflikten zu finden, damit der Streit sich nach der Scheidung nicht weiter fortsetzte. Die Aufgabe der Beraterin sah die Juristin darin, Hilfe bei der Erkennung der Konfliktursachen zu geben und die Ratsuchenden zu einer eigenen Entscheidung zu ermutigen. Diese dürfe ihnen niemand abnehmen. Auch durfte nicht gegen den Willen der Besucher gehandelt werden. Fischer-Erling verstand Ratsuchende damit als selbstbestimmte Akteure, die ihre persönlichen Interessen vertreten konnten. Ihre Vorstellung von Eheberatung wies zwar noch keine klar definierte professionelle Methode auf. Erkennbar ist jedoch, dass sie sich der Sozialen Arbeit annäherte, indem sie die Zurücknahme der Beraterin, ihre Offenheit und die von ihr gesteuerte vertrauliche Aussprache zwischen den Eheleuten in den Vordergrund stellte.³⁸³ In einem Artikel von 1951 ging Fischer-Erling auf organisatorische Details ihrer Tätigkeit ein.³⁸⁴ In einer dreistündigen Sprechstunde rechnete sie damit, fünf bis acht Personen beraten zu können. Ob sich dies auf eine erste Fallerfassung bezog oder auf den gesamten Verlauf, vertiefte sie nicht. Sie kooperierte mit verschiedenen Akteuren, beispielsweise mit dem Arbeitsamt, der Müttererholung, Altersheimen, mit Organisatoren von Bräutekursen, Helfern der nachgehenden Fürsorge, Zuständigen der Trinkerfürsorge und dem Wohnungsamt. Hinzu kamen Frauenorganisationen oder andere kirchliche Kreise, die Fischer-Erling Ratsuchenden empfahl, um sie von ihren Ehenöten und ihrer Vereinsamung abzulenken. Beraterinnen sollten sich während des ganzen Prozesses kritisch hinterfragen und ihre Ansichten zur Diskussion stellen: „Hier muß sich zeigen, ob der Berater wirklich dienen oder aus falscher Eitelkeit alles allein machen will. Eine gute Kontrolle zur Selbstkritik gibt die Methode, die Fälle aktenmäßig zu skizzieren einschließlich des gegebenen Rates und gelegentlich diese Fälle mit den Kollegen methodisch zu besprechen.“³⁸⁵
Die immer wieder in Praxisberichten und Fachartikeln wiederholten Hinweise, beide Partner anzuhören, widersprechen der Beschreibung Angelika M. Eckarts, wegen der psychoanalytischen Ausrichtung der Beratung sei die Frage der Einbeziehung von Partnern der Ratsuchenden lange Zeit strittig gewesen, da Übertragungsphänomene befürchtet wurden. Dies lässt sich in den vorliegenden Materialien nicht nachweisen. S. Eckart, Individuation, 1999, S. 217. Vgl. dazu auch Fischer-Erling, Methode, 1953, S. 8 – 9, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Dies., Eheberatung, 1951, S. 66. Ebd.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
307
Die Beraterin zielte darauf ab, zwischen den Eheleuten Frieden zu stiften, egal ob eine Trennung anstand oder nicht.³⁸⁶ Sie sollten zu einem Zwiegespräch finden, zu einem objektiven Urteil kommen und Abstand zu ihren Konflikten gewinnen. Dies galt auch und gerade bei Scheidungswilligen, die ihren Hass überwinden sollten, damit dieser sich beispielsweise nicht auf den Umgang mit den Kindern auswirkte. Um zu diesem Frieden zu kommen, müssten die Betroffenen auch ihr eigenes Versagen und nicht nur das des anderen erkennen. Für diese Aufgabe nannte Fischer-Erling Psychologen als Lehrmeister. Damit empfahl bereits 1951 eine katholische Eheberaterin psychologische Methoden. Im Gespräch selbst folgte Fischer-Erling dem wichtigen Grundsatz, beide Partner anzuhören, um sich ein Urteil bilden zu können. Im Anschluss sollte eine „klärende, entgiftende und heilende Aussprache zwischen den Eheleuten“³⁸⁷ stattfinden. „Nichts darf ungenannt bleiben, was heimlich in einem der Eheleute weitere Bitternis schafft. Dazu gehört von seiten [sic] der Berater viel Zivilcourage, aber auch viel Takt und Fingerspitzengefühl.“ Die Beraterin war auch zu Hausbesuchen bereit. Frauen hätten teilweise Angst, dass ihre Männer auf den Besuch der Eheberaterin mit „Zorn und Ungezogenheit“ reagierten, dies sei aber sehr selten. Grundsätzlich verließ sich Fischer-Erling nicht nur auf sich selbst, sondern vertraute auf Gott und empfahl dies auch ihren Kolleginnen. „Man sollte kein solches Gespräch veranlassen, ohne als Christ zuvor innigst den Beistand des Heiligen Geistes erfleht zu haben und Ihm [sic] und nicht nur sich selbst zu vertrauen. Das ist die rechte Atmosphäre für eine fruchtbringende Auseinandersetzung, auf daß ein Partner dem anderen Gerechtigkeit widerfahren lasse.“³⁸⁸ In dieser Deutlichkeit finden sich religiöse Motive im Selbstverständnis der Beraterinnen sonst kaum, meist ging es eher allgemein um die christlichen Grundsätze der Arbeit. Wurden religiöse Motive der Berater angesprochen, dann in der Regel seitens des Zentralinstituts im Zusammenhang mit dem Hinweis, diese genügten nicht als fachliche Qualifizierung.³⁸⁹ In einem Artikel aus dem Jahr 1954 betonte Fischer-Erling stärker als zuvor, wie wichtig Offenheit gegenüber der modernen Ehe sei: „Allen Beraterinnen geht es ja darum, zeitoffen zu sein, um Gesicht und Lebensgefühl einer modernen christlichen Ehe zu wissen, keiner Ehenot ausweichen zu müssen, sondern sie benennen zu können. Sie müssen ja die Wege ertasten, die die Betroffenen dann befähigen,
Vgl. im Folgenden ebd. Ebd., S. 64, auch die folgenden Zitate. Fischer-Erling, Eheberatung, 1951, S. 62, DZI. Vgl. auch im Folgenden. Vgl. Kapitel 4.3 Selbstverständnis.
308
4 Katholische Eheberatung
ihre Ehenot im Angesichte Gottes durchzutragen.“³⁹⁰ Diese moderne Ehe konnotierte die Autorin gleichzeitig christlich und band sie so in das kirchliche Eheideal ein. Darauf zielte auch ihre Bemerkung, den Ratsuchenden fehlten manchmal grundlegende Kenntnisse, sodass eine elementare Aufklärung befreiend wirke. Offenbar meinte sie damit die Unauflöslichkeit der katholischen Ehe. Dabei sah sich die Eheberaterin gleichzeitig in der Pflicht, eine individuelle, nicht normierte Beratung zu leisten. „So vielfältig wie die Menschen sind auch ihre Nöte. Und jedes Leid ruft nach einer nur diesem Menschen gemäßen Antwort.“ Erneut betonte Fischer-Erling, beide Seiten anzuhören und den Ratsuchenden die Möglichkeit zu geben, eigene Fehler zu erkennen. Erstmals erweiterte sie das undeutliche Bild der Ratsuchenden um das aktive Element der Selbsterkenntnis. Wenn „ein seit Jahren unterbrochenes Gespräch zwischen den Eheleuten wieder aufgenommen“ wird, liege ein erster Erfolg vor. Dieser wirke sich positiv aus: „Man darf sagen, daß wenigstens ein Drittel der beratenen Ehen wieder in Ordnung kommt, daß ein weiterer Teil befähigt wird, die nicht zu beseitigende Not durchzutragen, und daß selbst unvermeidbare Scheidungen immerhin mit menschlichem Anstand und größter Schonung der Kinder durchgeführt werden.“ Fischer-Erlings Eindruck war, dass die ganz jungen und die älteren Ehen am meisten gefährdet seien; erstere durch die Berufstätigkeit beider Eheleute und die damit einhergehende Müdigkeit, letztere durch erkaltete Liebe und Lieblosigkeit. Die meisten Ratsuchenden in ihrer Sprechstunde waren Frauen, sie schätzte deren Anteil auf etwa zwei Drittel. Sie hatte den Eindruck, diese seien deutlich interessierter, ihre Ehe und Familie zu erhalten. Es war ihr sehr wichtig, gerade verlassene Frauen zu stärken und deren Rechtsposition zu klären. Auch Maria Simmon-Kaiser zeigte in einem Fachartikel von 1964 ein hohes Maß an Selbstreflexion. Wie häufig auch vom KZI hervorgehoben, betonte sie, dass fachliches Wissen, das über Gottvertrauen und einen vernünftigen Rat hinausgehe, für eine Eheberatung notwendig sei.³⁹¹ Grundsätzlich unterschied sie zwischen Ehesorgen und Ehekrisen. Bei Ersteren genüge ein guter Rat, bei Letzteren solle man zur Beratung gehen und das Problem mit einem Fachmann besprechen. Die Beratungstätigkeit werde immer differenzierter und professioneller. Simmon-Kaisers eigene Arbeit hatte zumindest in den Anfangsjahren nicht ihren jetzigen Ansprüchen entsprochen. Sie blickte kritisch auf ihren ersten Fall zurück und und nutzte ihn, um zu verdeutlichen, wie notwendig Fachkenntnisse seien. Zitate im Folgenden Fischer-Erling, Josepha: „Wozu Eheberatung“. In: Die katholische Frau: Monatsblatt für christl. Lebensgestaltung 7 (1954), H. 3, S. 6, DZI. Vgl. im Folgenden Simmon-Kaiser, Maria: „Wie weit reicht unsere Eheberatung in der offenen Arbeit?“. In: Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1964), H. 4, Juli/ August, S. 98 – 101, DZI.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
309
Daß der erste „Fall“, den ich zu bearbeiten hatte, sehr schnell wieder in Ordnung kam, geschah nicht wegen, sondern trotz meiner Eheberatung: Wenn sich die beiden jungen Leute mit ihrem reizenden kleinen Jungen nicht so herzlich liebgehabt hätten … weiß Gott: vielleicht hätte ich sie beratenderweise auseinandergebracht! Denken Sie bitte nicht, ich würde übertreiben! Ich hatte damals eben nur guten Willen und einige Lebenserfahrung; Sachkenntnis aber hatte ich nicht! Seither habe ich – wie alle Eheberaterinnen – sehr viel lernen müssen, Dinge, von denen ich früher teilweise nicht einmal den Namen kannte. Ich habe umdenken müssen, alte Vorstellungen den neuen Gegebenheiten anpassen müssen – nicht im Sinne eines bequemen Konformismus, sondern um der sachgerechten Hilfe willen.³⁹²
Die letzte Bemerkung deutet auf eine gewisse Verteidigungshaltung hin. In diesem Zusammenhang sprach die Beraterin explizit die Frage der Geburtenregelung an, mit der fast jede Ehe mehr oder weniger belastet werde. Es ging ihr darum, insbesondere an Frauen das Signal zu senden, über diese Thematik sprechen zu dürfen. Mit dem Verweis, dass sich Ratsuchende gerade mit einer katholischen Frau und kinderreichen Mutter darüber unterhalten könnten, spielte sie auf sich selbst an. Sie wolle nicht verurteilen und oberflächlich vertrösten; es sei ein grundlegender Irrtum, diese Frage mit moralischen Aufmunterungen bewältigen zu wollen. Wer die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema nicht kenne, dürfe nicht den Anspruch haben, dass seine Empfehlung richtig und zu befolgen sei. Unbedingt nötig sei der sachgemäße Rat, „der nicht nur einer augenblicklichen Erleichterung dient, sondern der beide Eheleute und eben diese Ehe in den Blick faßt und von daher in grundlegender Weise helfen kann“.³⁹³ Diese Vorgehensweise sei typisch für die Arbeit der Eheberatung. Sie sei „nicht wertend, nicht urteilend, sondern zur Erkenntnis führend. Erkenntnis: das bedeutet Selbsterkenntnis, Erkennen des Partners an sich und in seiner Bezogenheit auf den Gatten, Erkennen aber auch gerade dieser Ehe und ihrer Möglichkeiten“.³⁹⁴ Um Leser zu überzeugen, bot der Artikel ein differenziertes, religiös orientiertes und doch zeitgemäßes Bild einer fachlich professionellen, die Ratsuchenden ernst nehmenden katholischen Beratungsarbeit. Simmon-Kaiser zeigte dabei das Selbstverständnis einer überzeugten Katholikin, die sich differenziert mit ihrem Gegenüber befasste sowie gesellschaftlichen und fachlichen Entwicklungen gegenüber aufgeschlossen war.
Ebd., S. 99 f. Ebd., S. 100. Ebd., S. 101.
310
4 Katholische Eheberatung
4.3.3 Beratung oder Therapie? Psychologie und katholische Eheberatung in den 1960er-Jahren Mitte der 1960er-Jahre erläuterte das KZI, aus welchem Grund Eheberatung notwendig sei.³⁹⁵ Gesellschaftliche Veränderungen vollzögen sich in einem bisher nicht gekannten Ausmaß, es komme zum Verlust von Leitbildern. Daraus folge eine Unordnung im Privaten, die oft zu einer existenziellen Bedrohung werde. Ehekrisen seien damit sowohl Ausdruck einer gestörten inneren wie äußeren Ordnung. Das KZI ging so weit, in seiner Publikation von 1966 Ehe und Familie als das „größte Feld heutiger Not“³⁹⁶ zu bezeichnen. Demnach seien zu sachgerechter Hilfe besonders vorgebildete Fachleute legitimiert. Behörden, Ärzte, Psychotherapeuten und Kleriker galten jedoch als mit dem Thema überfordert oder wurden als nicht zuständig befunden.³⁹⁷ Dieser Gruppe kam nach Maßgabe des KZI damit lediglich eine unterstützende Funktion zu. Umso auffälliger ist, dass die genannten Berufe dennoch die Leitungsebene des Instituts stellten. Die Psychologie kristallisierte sich im Laufe der Jahre für die Beratungsarbeit als die Disziplin heraus, die zunehmend an Bedeutung gewann. Obwohl die Kirche Pastoralmedizin als älteste Form der angewandten Psychologie verstand, hatten Theologie und Psychologie ein kritisches Verhältnis.³⁹⁸ Das Lehramt betrachtete vor allem die Psychoanalyse beziehungsweise Psychotherapie mit Misstrauen. Man befürchtete, dass Glaubenswahrheiten aus dem Blick geraten könnten und eine Moral jenseits christlicher Ethik begründet würde. Dem stand die klare Forderung nach christlichen Lebensnormen gegenüber. Theologische Kreise betonten, der Mensch sei mehr als das Opfer unbewusster seelischer Prozesse. Ein Teil ihrer Skepsis rührte daher, dass Theologie und Psychologie moralische Fragen unterschiedlich bewerteten. Psychologische Beratung stand damit im Verdacht, eine Konkurrenz zur sakramentalen Beichte darzustellen. Noch 1961 verbot die Kirche Psychotherapie für Seelsorger und innerhalb der Seelsorge. Dennoch ist Anfang der 1950er-Jahre eine erste Annäherung der Kirche an die Psychologie zu beobachten: Das Lehramt würdigte sie als Wissenschaft in ihrem Bemühen, die Psyche zu verstehen, und als möglichen Beitrag, die Seele zu heilen. Jedoch blieb das Verhältnis
Vgl. im Folgenden Struck, Ehenot, 1966, S. 10. Ebd., S. 10. S. ebd., S. 13. Vgl. im Folgenden Fischer, Dienst, 2014, S. 237 ff.Vgl. auch Pompey, Heinrich: „Zur Geschichte der Pastoralpsychologie“. In: Baumgartner, Isidor (Hrsg.): Handbuch der Pastoralpsychologie. Regensburg 1990, S. 23 – 40, hier S. 36 ff.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
311
bis in die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils belastet, auch wenn die Psychoanalyse nicht offiziell verurteilt wurde. In der katholischen Beratungsarbeit spiegelte sich die kirchliche Diskussion um Seelsorge und deren Vereinbarkeit mit Psychologie jedoch nicht. Gingen die Akteure überhaupt auf den Konflikt ein, dann mit der Aufforderung, die konfrontative Gegenüberstellung aufzugeben und beide Bereiche zu nutzen.³⁹⁹ Im vorliegenden Material sind für den Untersuchungszeitraum lediglich zwei Bemerkungen aus dem Umfeld des KZI zu finden, die das Verhältnis zwischen Lehramt und Psychologie betreffen. Dabei handelte es sich in einem Fall um eine Verteidigung der Psychologie, die keineswegs wie befürchtet alles im Menschen ergründen könne, wie die Eheberaterin und Psychologin Johanna Läpple⁴⁰⁰ äußerte: Die Tiefenpsychologie legt […] frühkindlichen Erlebnissen ganz besondere Bedeutung bei. Leider erleben wir auch und gerade in unseren katholischen Kreisen gegen die Tiefenpsychologie noch recht viel Widerstand […]. Den Psychotherapeuten wird oft vorgeworfen, sie wollten immer alles aufdecken, sie ließen kein Geheimnis mehr. Nein, das ist nicht wahr, es bleibt noch so vieles stehen.⁴⁰¹
Zweitens wies die Caritas darauf hin, dass man katholische Voreingenommenheiten gegen die Psychologie kenne, die aber nicht gerechtfertigt seien. Ebenso wenig solle
Vgl. Teichtweier, G.: „Entwicklung der Persönlichkeit und Reifungsstufen der Ehe“. In: Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen (Hrsg.): Partnerbild und Ehe. Freiburg im Breisgau 1967, S. 51– 67, hier S. 57. Johanna Läpple (1904– 1976) arbeitete als Eheberaterin in Stuttgart und referierte häufig in den Kursen des KZI. Die promovierte Psychotherapeutin war die Initiatorin der Psychotherapeutischen Klinik Stuttgart-Sonnenberg, die 1967 eröffnet wurde. Im Ausbildungsprogramm des KZI fungierte Läpple ab 1964 als Mentorin neuer Eheberaterinnen. Seit 1956 fand vermutlich unter ihrer Leitung jeden Monat ein Arbeitskreis für Ehe- und Familienfragen statt, in welchem Ehrenamtliche die Beurteilung schwieriger Fälle aus ihren Beratungen besprachen. Vgl. Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Bestand J 191, verfügbar unter: https://www2.landesarchiv-bw. de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=5563&sprungId= 3055711&letztesLimit=suchen, besucht am 18. Oktober 2020 sowie Poker, Heinz H.: Chronik der Stadt Stuttgart, 1976 – 1979. Stuttgart 1990, S. 43. Vgl. Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen: Verzeichnis der Mentor(innen) und Ausbildungsleiter(innen), 1. Januar 1964, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Vgl. Pesch, Hilde: „Die Konferenz als Rückhalt in Fragen der Eheberatung“. In: Generalsekretariat der Elisabeth-Konferenzen (Hrsg.): Elisabethbrief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1964), H. 4 (Juli/August), S. 106 – 108, DZI. Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen: Rundbrief an die Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen 2 (1958), H. 1, S. 4 f., AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963.
312
4 Katholische Eheberatung
man jedoch einer absolut gesetzten Psychologie folgen.⁴⁰² Gefordert wird in diesen Aussagen beides: psychologische Erkenntnisse anzuerkennen und die christliche Grundordnung beizubehalten. Eheberaterinnen begriffen ihre Tätigkeit als relativ unabhängig. Dies war ein zentraler Punkt ihres Selbstverständnisses. Sie suchten entsprechend nach Möglichkeiten, psychologische Erkenntnisse in die Arbeit zu integrieren. Bereits Bernhard Korte, der erste Leiter des KZI, hatte eine psychologische Ausbildung begonnen. Der Bericht über die Entstehung des Zentralinstituts erwähnt, dass dort insbesondere die wissenschaftlichen Ergebnisse aus Anthropologie, Tiefenpsychologie und Therapeutik, Medizin und Pädagogik für die Eheberatung auszuwerten seien.⁴⁰³ Eheberaterinnen fanden somit letztlich einen praxisnahen Zwischenweg im uneindeutigen Verhältnis von Theologie und Psychologie. Aber auch hier herrschte zwischen Seelsorge und Beratung eine gewisse Konkurrenzsituation.⁴⁰⁴ Dass psychologische Beratungsarbeit zunahm, führte zu der Schwierigkeit, sie von der Therapie unterscheiden zu müssen. Dabei umfasste Ehe- und Familienberatung explizit keine Erziehungsberatung, obwohl bei ersterer häufig auch Kinder betroffen waren.⁴⁰⁵ Einen ersten Versuch, den Unterschied zwischen Beratung und Therapie zu benennen, unternahm der Leiter des medizinisch-anthropologischen Referats und stellvertretende Direktor des KZI, der Facharzt für Neurologie und Psychiatrie Günter Struck, im Jahr 1966.⁴⁰⁶ Beratung verstehen wir nicht in dem Sinne, daß von festen Vorstellungen her autoritär Weisungen erteilt würden. Auch geht es nicht ausschließlich um das Hergeben von Informationen. Berater und Ratsuchender treten in eine Art Arbeitsgemeinschaft, in der zuerst ergründet werden muß, was den Ratsuchenden wirklich bewegt und worin das wahre Problem der Ehe besteht. Danach müssen Lösungsmöglichkeiten erwogen werden.⁴⁰⁷
Beratung bedeutete für Struck somit eine Arbeitsgemeinschaft zwischen Ratsuchendem und Berater. Der Ratsuchende galt als Akteur, der im Sinne seines eigenen Wohlergehens handelte. Struck verstand Beratungsleistungen als zeitlich begrenzt. Dabei bestand der Sinn der Beratungsbeziehung nicht in sich selbst, sondern ruhte
Wollasch, Hans: „Vorbemerkungen zu einer caritativen Ehe- und Familienhilfe“. In: Caritas. Zeitschrift für Caritasarbeit und Caritaswissenschaft 53 (1952), H. 1– 2, S. 16 – 26, hier S. 25, DZI. [Klens, Hermann]: Bericht über das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen, 14. April 1961, AEK, DBK, KZI 295, S. 3. Vgl. im Folgenden Halberstadt, Beratungsarbeit, 1986, S. 113 ff. Der Theologe Halberstadt lieferte damit die erste Monografie zu Geschichte und Organisation der Beratungsarbeit. Vgl. Struck, Entwicklung, 1971, S. 3. Vgl. dazu Struck, Ehenot, 1966, S. 12 ff. Ebd., S. 12.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
313
auf dem Fundament der Hilfsbereitschaft. Dafür mussten gewisse Grundvoraussetzungen erfüllt sein. Was der Ratsuchende mitbringen musste, besprach der Mediziner nur knapp. Er nannte jedoch indirekt die Bereitschaft, das Problem in der Ehe zu erkennen und einzusehen. Welche Eigenschaften der Berater haben musste, fasste er präziser: Hier zählten besonders Haltung,Wissen sowie Methoden. Dabei fällt auf, dass die Haltung des Beraters nach Struck vor allem durch sein Verhältnis zu Psychologie, Psychoanalyse und Psychotherapie geprägt wurde. Struck stellte diese Einflüsse vor das christliche Denken und markierte sie somit als relevanter. Er unterschied zwischen Beratung und Therapie, wenn er auch keine eindeutige Abgrenzung traf. Beratung beinhalte Wege und Methoden der Tiefenpsychologie, über die Eheberater einschlägig informiert sein sollten. Dennoch könne „Beratung grundsätzlich keine Psychoanalyse und keine Psychotherapie“ sein. Es gelte aber zu beherzigen: „Eine neue Selbstverständlichkeit des Handelns kann nur herbeigeführt werden auf dem Weg durch Bewußtmachung“ der eigenen Motive.⁴⁰⁸ Die Ähnlichkeit, die seine Definition mit Casework hat, ist auffallend, sowohl mit Blick auf die Beziehung zwischen Ratsuchendem und Berater als Arbeitsgemeinschaft als auch auf die innere Haltung des Beraters und die angewandten psychologischen Methoden.⁴⁰⁹ Gleichzeitig lassen sich in den vorliegenden Quellen keinerlei Hinweise darauf finden, dass sich Akteure der katholischen Eheberatung mit Casework auseinandersetzten. Eine explizite Ablehnung von Casework lässt sich ebenso wenig nachweisen wie deren Anwendung.⁴¹⁰ 1971 verwies Struck, zu diesem Zeitpunkt Direktor des KZI, darauf, dass eine noch nicht abgeschlossene methodische Entwicklung im Gange sei.⁴¹¹ Erneut versuchte er, eine Unterscheidung zwischen Beratung und Therapie zu formulieren.⁴¹² Psychotherapie befasse sich mit dem Unbewussten und mache es für die Therapie nutzbar, während Berater kein unbewusstes Material nutzten.⁴¹³ Therapie und
Ebd., S. 13. Vgl. Kapitel 4.3.1 Vorstellungen von Ehe. Es steht lediglich fest, dass der Präsident des Caritasverbandes sich gegen eine Festlegung auf Casework in den Lehrplänen der Wohlfahrtsschulen wandte. Vgl. Neuffer, Kunst, 1990, S. 86. Vgl. dazu Struck, Entwicklung, 1971. Halberstadt nennt dies als ersten Versuch einer Definition von Beratung. Vgl. Halberstadt, Beratungsarbeit, 1986, S. 113. Ein Jahr später definierte Struck Familienberatung: „Man weist auf die vielfältigen zivilisationsbedingten Konflikte bei Menschen hin, die gleichsam zwischen Psychotherapie und unbehandelten, auf die familiäre Umwelt negativ wirkenden Symptomen stehen. Dieses Zwischenfeld ist die Domäne einer therapeutischen Familienberatung.“ Struck, Günter: „Spezielle Schwerpunkte der Eheberatung“. In: Deutscher Caritasverband Freiburg (Hrsg.): 1897– 1972. 75 Jahre Deutscher Caritasverband. Freiburg im Breisgau [1972], S. 244. Im Widerspruch dazu steht die Aussage der Psychotherapeutin und Eheberaterin Johanna Läpple, z. B. Träume in der Beratung zu nutzen. Allerdings verwies sie darauf nur im Zusammen-
314
4 Katholische Eheberatung
Beratung sei jedoch gemein, Ratsuchende zur Einsicht in eigene Handlungsweisen bringen zu wollen, um diese und die sichtbar werdenden Konflikte zu bearbeiten. Darüber hinaus verbinde beide, dass sie es Ratsuchenden ermöglichen sollten, Normen bewusst erkennen und bearbeiten zu können, um eine befriedigende Lösung zu finden. Die Grenzen zwischen Beratung und Therapie ließen sich daher nicht immer scharf ziehen.⁴¹⁴ Struck schloss: „Wir verstehen Beratung im weitesten Sinne als Orientierungshilfe für Fragen der Menschen; als Hilfe zu eigener freier Entscheidung in Lebenssituationen, die der jeweilige Ratsuchende allein nicht bewältigen zu können glaubt.“⁴¹⁵ Ähnlich betrachtete er die Erwartungshaltung der Ratsuchenden.⁴¹⁶ Beratung sollte immer deren Individualität und persönliche Freiheit respektieren.⁴¹⁷ Eheberatung durfte nicht zur Dauereinrichtung werden und musste zeitlich befristet sein, um die Gefahr der Selbstüberforderung für den Berater und die der Abhängigkeit für den Ratsuchenden zu minimieren.⁴¹⁸ Dazu sollten vor allem dem Beratenden seine Grenzen bewusst sein, er hatte sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Der Mediziner nannte verschiedene Aspekte, die sich negativ auswirken konnten, wie Machtbedürfnisse oder Distanzlosigkeit. Die Ratsuchenden brauchten vor allem einen aufmerksamen Zuhörer. Zuhören ist ein Wahrnehmen des anderen, das den anderen aber in seiner Individualität beläßt […]. Der wesentliche Wert der Beratung liegt im gegenseitigen Bezug und in verstehender, distanzierter, aber dennoch einschließender Nähe zum anderen. Dies führt zu Vertrauen und Verläßlichkeit und zur Annahme des anderen in seinem Anderssein. Doch darf sich der Ratsuchende nicht durchschaut oder gar entlarvt fühlen.⁴¹⁹
Diese Form der Beratung sollte Ratsuchende in die Lage versetzen, allein und frei zu sprechen, um so die eigene Situation, persönliche Fähigkeiten zur Partnerschaft sowie eigene Grenzen zu erkennen. In der Folge standen katholische Paare dem
hang mit Kindern oder Jugendlichen in der Beratung. Vgl. Läpple, Johanna: Christliches Dasein in Ehe und Familie: Hindernisse und Verwirklichung. Auszug aus drei Vorträgen gehalten am 10. und 11. Juli 1957 in Königswinter auf dem 6. überdiözesanen Kursus für Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts für Ehe- und Familienfragen, S. 5, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Zu einem einheitlichen Beratungskonzept äußerte sich die Vorsitzende des Verbandes Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater 1988. Ihrer Ansicht nach existierte es, konnte aber noch nicht genau definiert werden. Vgl. Jost/Zelazny, Jahre, [1988], S. 79. Struck, Entwicklung, 1971, S. 1. Vgl. ders., Ehenot, 1966, S. 42. Zur weiteren Entwicklung der Eheberatung als eigenständiger Ansatz vgl. Eckart, Individuation, 1999, S. 218 ff. Vgl. im Folgenden Struck, Ehenot, 1966, S. 15 ff. Ebd., S. 18.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
315
wertschätzenden Gespräch und praktischen Rat erfahrener Laien näher als der amtskirchlichen Botschaft einer Sakramentalität der Ehe.⁴²⁰ Im Verständnis der kirchlichen Eheberatung kam eine spezifisch katholische Beratung dann zum Tragen, wenn sich der katholische Eheberater mit seinem christlichen Menschenbild in diese einbrachte.⁴²¹ In diesem Sinne schrieb Struck 1966: „Der Berater muß, um fachgemäßen und seinsgerechten Rat erteilen zu können, über ein fest umrissenes christliches Leitbild verfügen, aus dem heraus Beratung betrieben wird.“⁴²² Was dieses Leitbild beinhalten sollte, beschrieb er jedoch nicht. Allerdings wies er darauf hin, dass mit dem Ratsuchenden ein unverwechselbares Geschöpf Gottes vor dem Berater stehe. Dieser solle sich dessen ebenso bewusst sein wie des Wesens der Ehe als Heilsgemeinschaft und vor dem Ratsuchenden Ehrfurcht haben. Dies galt Struck als Ausdruck einer Haltung, die nicht allein auf Fachwissen beruhte.⁴²³ Im KZI praktizierten die Mitarbeiter den katholischen Glauben: Jede Arbeitswoche begann mit einer Lesung und einem Schriftgespräch, einmal im Monat fand zudem eine Institutsmesse statt.⁴²⁴ Thematisiert wurde aber nicht nur der Glaube der Beratenden, sondern auch derjenige der Ratsuchenden sowie die Frage, welchen Einfluss die Beratung gerade auf Gläubige hatte. Innerhalb des Zentralinstituts gab es dazu verschiedene Überlegungen. Der Direktor des KZI, Paul Adenauer, war 1963 davon überzeugt, der Entschluss von Ratsuchenden, in eine Einrichtung zu kommen, könne direkt auf Gottes Antrieb zurückgeführt werden.⁴²⁵ Eheberatung sei am wirkungsvollsten, wenn bewusst darauf verzichtet werde, kirchliche Interessen zu vertreten.⁴²⁶ Damit schlug die katholische Eheberatung früh eine neutrale Ausrichtung ein. Diese als „absichtslos“ bezeichnete Beratung setzte sich in den 1970er-Jahren auch in anderen Bereichen katholischer Sozialer Arbeit durch.⁴²⁷ Das Gespräch mit den Ratsuchenden stellte für das KZI somit keinen direkten Weg dar, um kirchenferne Katholiken zurückzugewinnen.⁴²⁸
Vgl. Große Kracht, Elternrecht, 2018, S. 8 f. Vgl. Fischer, Dienst, 2014, S. 349. Struck, Ehenot, 1966, S. 12. Vgl. ebd., S. 20. Vgl. [KZI]: Jahresbericht 1965, [1966], ADCV, 349.4, Fasz. 07. Vgl. [KZI]: Aus dem Referat von Dr. Adenauer „Bausteine einer Theologie der Eheberatung“, 23. April 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 08. Vgl. ebd., S. 41 ff. Ziemann, Benjamin: „Zwischen sozialer Bewegung und Dienstleistung am Individuum. Katholiken und katholische Kirche im therapeutischen Jahrzehnt“. In: Archiv für Sozialgeschichte 44 (2004), S. 357– 393, hier S. 381. Vgl. Lippold, Church, 2014, S. 300 f.
316
4 Katholische Eheberatung
Gleichzeitig war Struck der Überzeugung, dass Ratsuchende durch gewisse Voraussetzungen auch zu einem erneuerten Glauben und zur Kirche finden konnten. Die Besucher einer Beratungsstelle erwarteten aus seiner Sicht zwar keine Belehrung oder Ermahnung, jedoch sehr wohl eine über Informationen hinausgehende „Wegweisung auf dem Hintergrund eines weiten Glaubens und einer großen Hoffnung“. Es sei eine der wesentlichen Erfahrungen der Eheberatung, daß sich „oft eine Bereitschaft zur Änderung des Lebens“ zeige, die zu einem wahren und reifen Glauben und einem selbstständigen Gewissen führe. Dies gelte auch für Menschen, die der Kirche völlig entfremdet seien, aber eher den Weg zur Eheberatung als in eine Kirche fänden.⁴²⁹ Struck stellte damit das Ideal des selbstbewussten Gläubigen heraus, das durch eine erfolgreiche Beratung erreicht werden könne. Die Ehe folgte dabei dem Ziel einer individuellen Gestaltung des Lebens, das die Gläubigen meistern könnten, indem sie ihrer Persönlichkeit zu Wachstum verhalfen und Reifungsrückstände aufarbeiteten. Darüber hinaus gestalteten sie mit ihren Partnern den gemeinsamen Lebensweg, der idealerweise eine immer neue Entscheidung füreinander bedeutete.⁴³⁰ Damit war die Ehe sowohl eine permanente Aufgabe als auch eine Möglichkeit einerseits für das Paar, gemeinsam Glück und Liebe zu erfahren, sowie andererseits für den Einzelnen, sich individuell weiterzuentwickeln.⁴³¹ Eheberater stießen sich somit nicht am Konkurrenzverhältnis zwischen Theologie und Psychologie. Sie bemühten sich von Beginn an, psychologische Methoden und Ziele zum Nutzen der Ratsuchenden anzuwenden. Da diese Methoden im Laufe der Zeit immer stärker ausgebaut wurden, entstand mit der psychologisch fundierten Beratung ein neuer Fokus. Stellte die Eheberatung zu Beginn noch eine Art Fürsorgeleistung dar, wandelte sie sich im Laufe der Zeit zu einer „fachlichen sozialen Arbeit im therapeutischen Dialog“.⁴³² Die Entwicklung ging somit von der theologischen Seelsorge zur therapeutischen Beratung. Ratsuchende galten zunehmend als aktive, ihre Probleme mit dem Berater partnerschaftlich lösende Akteure. Die Eheberatung gab somit nach dem Prinzip der katholischen Soziallehre Hilfe zur Selbsthilfe, womit ein Kriterium für den Wandel der Fürsorge zur mo-
[KZI]: Aus dem Referat von Dr. Adenauer„Bausteine einer Theologie der Eheberatung“, 23. April 1963, S. 42, ADCV, 349.4, Fasz. 08. Vgl. Teichtweier, Entwicklung, 1967. Vgl. dazu auch Däumling, A[dolf ] M[artin]: „Probleme der Partnerwahl – psychologisch gesehen“. In: Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen (Hrsg.): Partnerbild und Ehe. Freiburg im Breisgau 1967, S. 26 – 50 sowie Revers, Werden, 1967. Hauschildt, Familienberatung, 2016, S. 259. Raphael verweist darauf, dass religiöse und moralische Argumentationen durch humanwissenschaftliches Wissen bzw. die „Verwissenschaftlichung des Sozialen“ abgeschwächt wurden. Vgl. Raphael, Verwissenschaftlichung, 1996, S. 168.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
317
dernen Sozialarbeit erfüllt war.⁴³³ Die damit notwendigerweise verbundene Aneignung von Fachwissen und der Ausbau der Strukturen führten zu einer zunehmenden Professionalisierung der beraterischen Tätigkeit.⁴³⁴ Eheberatung stellte weiterhin eine spezialisierte Dienstleistung dar, die nicht vollständig in die Kirchenstrukturen eingebunden war und von den Praktikerinnen explizit als Laienarbeit betrachtet wurde. Es gelang, sich an die moderne psychotherapeutische Ära anzupassen. Das KZI beobachtete „überraschende Symptome eines eigenen Standesbewußtseins erfahrener Eheberater im Dienst der Kirche“⁴³⁵. Das soziale Engagement der katholischen Kirche avancierte zu einem Teilbereich der modernen Sozialarbeit.⁴³⁶ Die Beraterinnen vermuteten, dass die katholische Bezeichnung für die Ratsuchenden keine große Rolle spiele.⁴³⁷ In der gelingenden Arbeit bewahrheitete sich gewissermaßen die Befürchtung der Kirche, Psychologie beziehungsweise Psychotherapie könnten zur Seelsorge in Konkurrenz stehen. Andererseits gründete darauf der Erfolg der konfessionellen Beratungen, der auch Hoffnung gab, Gläubige an die Kirche zu binden. Obgleich sich die Eheberatung durch Laien zunehmend als wirksamstes Mittel gegen Eheprobleme herausstellte, erkannte die Amtskirche dies bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil nicht an.⁴³⁸
4.3.4 Standardisierung und Professionalisierung der Ausbildung Das KZI hielt bereits 1953, im ersten Jahr seines Bestehens, fest, wie wichtig die wissenschaftliche Fortbildung von Eheberatern sei. Jeder lebendige Christ erlebt gerade in den entscheidenden Stunden christlichen Daseins an sich selbst, daß die Kraft, die er zum Weitergehen nötig hat, nicht aus den menschlichen Wissenschaften kommt, sondern von oben. Doch kennt jeder, der um die Zusammenhänge im Leben weiß, auch die große Hilfe, welche in einer gediegenen psychologischen, ärztlichen, juristischen und anthropologischen Beratung liegt. Es gehört deshalb zu den unabdingbaren Pflichten jedes Beratenden, sich eine wissenschaftliche Grundlage anzueignen, die es ihm
Vgl. Kopp, Matthias: „Professionalisierung und Gestaltwandel“. In: Gatz, Erwin (Hrsg.): Caritas und Soziale Dienste. Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Bd. 5: Die katholische Kirche. Freiburg im Breisgau 1997, S. 309 – 342, hier S. 310. Vgl. im Folgenden Lippold, Church, 2014, S. 300 ff. Vgl. auch Jost/Zelazny, Jahre, [1988], S. 64 f. Struck, Ehenot, 1966, S. 41. Vgl. Kircher, Gedanken, [1972], S. 147. Vgl. Jost/Zelazny, Jahre, [1988], S. 75. Vgl. Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 366 f.
318
4 Katholische Eheberatung
neben anderen Voraussetzungen ermöglichen soll, eine personen- und sachgerechte Beratung durchzuführen.⁴³⁹
Auch die Caritas war überzeugt, dass die Eheberatungsarbeit den fachlichen Anforderungen der Zeit nur gerecht werden könne, wenn sie Wissenschaft und Praxis verbinde.⁴⁴⁰ Wer diesem Anspruch im KZI nicht folgte, galt als ungeeignet. „Wer glaubt, auf dieses Wissen zu verzichten oder sich mit einem Minimum davon zufrieden geben zu können, irrt, handelt lieblos und sollte lieber heute als morgen seine Tätigkeit in der Beratung aufgeben.“⁴⁴¹ Auch wenn eine christliche Überzeugung und ein gläubiges, gutmeinendes Herz als Voraussetzungen für die Arbeit zum Kanon gehörten, so genügten diese Eigenschaften spätestens seit der Gründung des KZI nicht mehr als Qualifikationsmerkmale. Gleichzeitig aber galt wissenschaftliche Spezialisierung durchaus als zweischneidiges Schwert, denn die Befürchtung stand im Raum, die katholische Grundlage zu verlieren. Der Direktor des Seminars für Wohlfahrtspfleger der Caritas, Hans Wollasch, äußerte, so würde Eheberatung zu einem, [sic] Konglomerat von hygienischen, juristischen und geistlichen Ratschlägen […]. Die Welle der Spezialisierung geht offenbar auch über uns Katholiken hinweg […]. Wenn wir unsere Eheberatungsstellen auf dem mechanischen Bild der Ehe aufbauen, das Liberale und Sozialisten produziert haben, und nur als Schmuckstück und Abzeichen das Kreuz darüber hängen, sollen wir die Finger davon lassen.⁴⁴²
Von Beginn an bemühte sich Bernhard Korte als Leiter des Katholischen Zentralinstituts um die Weiterbildung der meist ehrenamtlichen Beraterinnen und deren Vernetzung. Einmal jährlich fand eine überdiözesane Tagung statt, die jeweils unter einem bestimmten Thema stand. An der Schwerpunktsetzung lassen sich auch die Veränderungen in der Beratungsarbeit ablesen.⁴⁴³ Kortes anthropologische Sicht und die von ihm eingebrachte methodische und psychoanalytische Grundorientierung waren, im Gegensatz zu den sonst häufig vertretenen biologisch-medizinischen Auffassungen, neu und prägten die katholische Beratung langfristig.⁴⁴⁴ Regionale Tagungen und Vorträge ergänzten die Jahrestagungen. Darüber hinaus
KZI: Jahresbericht 1953, o. D., S. 2, ADCV, 319.4, 601/02, Fasz. 01. Vgl. [Maria] Bornitz: Zur katholischen Eheberatung. Bericht an Caritasdirektor Baumeister, 14. Februar 1952, ADCV, 349.4, Fasz 02. KZI Rundbrief an die Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen, 1. Jg., Nr. 1, Januar 1957, S. 2. ADCV, R 565, Fasz. 01. Vgl. auch [Helmut] Friederichs an Joseph Frings, Brief, 8. Februar 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 05. [Hans] Wollasch an [Maria] Bornitz, Abschrift, 18. Februar 1952, S. 1, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Dies gilt auch für die evangelische Kirche. Vgl. Halberstadt, Beratungsarbeit, 1986, S. 31 ff. Vgl. Fischer, Dienst, 2014, S. 150 sowie Struck, Ehenot, 1966, S. 49.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
319
arbeiteten die Leitenden des KZI in verschiedenen Gruppen mit, die sich der Thematik Ehe und Familie widmeten, beispielsweise im Rhein-Ruhr-Arbeitskreis. Hinzu kam Anfang der 1960er-Jahre die Gründung eines Berufsverbandes sowie die Ausarbeitung einer standardisierten Ausbildung. Dass die katholische Eheauffassung wegen der regen Vortragstätigkeit über das eigene Milieu hinaus Verbreitung fand, betrachtete die Leitung des Zentralinstituts als wichtige Öffentlichkeitsarbeit.⁴⁴⁵ Mit folgenden Elementen erfüllte die katholische Eheberatung Professionalisierungskriterien: Das Zentralinstitut sorgte für die Weiterbildung der Beraterinnen und schuf einheitliche Ausbildungsrichtlinien. Ein Berufsverband entstand und die Beratung wurde in die diözesanen Strukturen eingebunden.⁴⁴⁶ Einheitliche Organisation trug wesentlich dazu bei, dass die Eheberatung Standards absicherte und sich konsolidierte. Da psychologische Kenntnisse in der Ausbildung eine Rolle spielten, wurde die Psychologisierung der Beratungsarbeit gefördert. Das Katholische Zentralinstitut verschickte 1963 ein Rundschreiben über den Entwicklungsstand ihrer Bemühungen: In der Entwicklung der Eheberatung in Deutschland scheint eine gewisse Wachstums-Stufe erreicht zu sein: immer mehr Menschen nehmen ihre Dienste in Anspruch, die Wissenschaft bietet ihr eine Fülle von Ergebnissen, der Staat erkennt ihre zunehmende Bedeutung an und wünscht eine Qualifikation, die Kirche trägt der wachsenden Aufgabe auch unseres Instituts Rechnung und hat es ausgebaut.⁴⁴⁷
4.3.4.1 Verein Katholischer Eheberaterinnen und Eheberater Die katholischen Eheberaterinnen pflegten einen Arbeitskreis, der auf den überdiözesanen Kursen des KZI seine Jahresversammlung abhielt und zunehmend Mitsprache- und Vertretungsrechte einforderte. Absicht war zunächst, gute Verbindungen der Eheberatungsstellen untereinander, aber auch zwischen diesen und dem Zentralinstitut zu ermöglichen.⁴⁴⁸ Als der Theologe Paul Adenauer 1962 die Leitung des KZI antrat, nahmen die Eheberaterinnen dies jedoch mit Empörung auf.⁴⁴⁹ Die Entscheidung überraschte sie, denn sie waren in die Diskussionen um den Personalwechsel nicht einbezogen worden. Adenauer selbst stellte große Wut im Kreis der Beraterinnen fest, vor allem, da diese seinen Vorgänger Korte sehr
[Hermann] Klens: Ergebnis Bericht über die Sitzung der Trägerverbände des Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen am 15. September 1959, o. D., ADCV, R 565, Fasz. 01. Zur Professionalisierung in der Sozialen Arbeit vgl. Hammerschmidt/Sagebiel, Einführung, 2010. KZI an Damen und Herren, Brief, 18. März 1963, AKDFB Eheberatung KZI 1949 – 1963. Vgl. KZI an [Bernhard] Korte, Brief, 18. September 1956, AEK, DBK, KZI 385. Vgl. im Folgenden Jost/Zelazny, Jahre, [1988] sowie Fischer, Dienst, 2014, S. 152 f.
320
4 Katholische Eheberatung
geschätzt und bewundert hatten. Auf der folgenden Jahrestagung stand erstmals außerhalb des Arbeitskreises ein Zusammenschluss katholischer Eheberaterinnen zur Diskussion, um sich gegen das KZI zu „wehren“⁴⁵⁰. Im Rückblick galt dieser Moment als „Urknall“⁴⁵¹ für die Entwicklung einer beruflichen Interessenvertretung. Adenauer ging mit der Situation offensiv um. Da er sich selbst zu dem Zeitpunkt, an dem er die Leitungsfunktion übernommen hatte, noch keine Kompetenz im Beratungsbereich zusprach, hatte er ebenfalls an eine Verbandsgründung gedacht, um das Fachwissen der Beraterinnen zu bündeln. Er regte an, gemeinsam ein Berufsbild zu erarbeiten und die Ausbildung systematisch weiterzuentwickeln. Damit befand sich Adenauer auf einer Linie mit kirchlichen Organisationen, die Berufsverbände förderten, um angesichts des herrschenden Personalmangels im kirchlichen Sozialbereich vorhandene Mitarbeiter an die Wohlfahrtspflege zu binden.⁴⁵² Darüber hinaus zeigt sein Engagement, inwiefern Berufsbilder im Prozess der Professionalisierung eine wichtige Rolle spielten.⁴⁵³ Noch im selben Jahr entstand eine Kommission, die Einzelheiten der Zulassung und Fortbildung der Eheberaterinnen regelte. Der geplante Verein konnte somit gleich bei seiner Gründung einen berufspolitischen Schwerpunkt vorweisen. Auch wenn ein konkretes Berufsbild erst 1979 entworfen wurde, gab es in der katholischen Eheberatung bereits zu Beginn der 1960er-Jahre den bewussten Versuch, ein solches zu erarbeiten.⁴⁵⁴ Damit ging die katholische Seite einen Schritt weiter als die nichtkonfessionelle und evangelische Beratung. Diese professionalisierte sich zwar ebenfalls und entwickelte auch ein Berufsbild, ohne dies aber vergleichbar explizit angestrebt zu haben.⁴⁵⁵ Vor allem sollte der Verein eine berufliche Interessenvertretung gegenüber kirchlichen und staatlichen Stellen sein, denen die Eheberaterinnen vermitteln wollten, dass Erfahrungen aus der Praxis und der unmittelbare Kontakt zu Ratsuchenden nicht durch Weisungen oder Postulate zu ersetzen waren.⁴⁵⁶ 1963 bildete sich ein Gründungsausschuss und eine vorläufige Satzung wurde beschlossen.⁴⁵⁷
Jost/Zelazny, Jahre, [1988], S. 64. Ebd. Vgl. Hammerschmidt, Wohlfahrtsverbände, 2005, S. 297. Vgl. Raphael, Verwissenschaftlichung, 1996, S. 180. Vgl. Neuffer, Kunst, 1990, S. 103 ff. Vgl. Kapitel 3.3 Selbstverständnis. In den Augen der Vereinsmitglieder bewährte sich dieses Konzept der Unabhängigkeit insbesondere in der späteren Auseinandersetzung um die päpstliche Enzyklika „Humanae vitae“. Vgl. im Folgenden o. A.: Chronik des Verbandes Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater. o. D., Bundesverband Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater e. V. Verein Katholischer Eheberaterinnen und Eheberater: Satzungen. Detmold, 24. Mai 1963, Bundesverband Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater e. V. Chronik und Satzung widersprechen sich im Datum der
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
321
Auf der nächsten Jahrestagung wurde der Verein Katholischer Eheberaterinnen und Eheberater⁴⁵⁸ dann vorgestellt. In den folgenden Jahren dienten die Tagungen der Eheberaterinnen dazu, die Satzung zu überarbeiten, die Organisation rechtsfähig zu machen und eine Geschäftsordnung zu verabschieden. Der Verein wollte ein Zusammenschluss von Personen sein, die „aus der Verantwortung der katholischen Glaubens- und Sittenlehre heraus an einer katholischen Eheberatungsstelle tätig sind“.⁴⁵⁹ Die Vereinszwecke umfassten den Meinungs- und Erfahrungsaustausch sowie die gegenseitige Unterstützung, die Auswahl und Förderung von Nachwuchskräften sowie eine intensive Zusammenarbeit mit dem KZI. Diese Kooperation drückte sich auch in einer personellen Verflechtung der Vorstände aus. Ab 1967 erschien mit finanzieller und inhaltlicher Unterstützung des KZI eine eigene Zeitschrift, die den Mitgliedern unter dem Titel Eheberatung zweimal jährlich Material an die Hand gab. Die Zusammenarbeit zwischen Verein und KZI war zu Beginn gut, wurde aufgrund unterschiedlicher Interessen im Laufe der Jahre allerdings zunehmend problematisch. In erster Linie kam es zu Konflikten um den Schwerpunkt der Beraterausbildung. Der Verein Katholischer Eheberaterinnen und Eheberater wandte sich gegen die zunehmende psychologische Orientierung der Ausbildung, worauf weiter unten im Zusammenhang mit den Richtlinien noch eingegangen wird.⁴⁶⁰ 4.3.4.2 Jahreskurse, Ausbildungsrichtlinien und Mentoren: Eheberatung als Beruf Da die Beraterinnen ihre Arbeit nebenberuflich und ehrenamtlich leisteten, waren sie laut Bernhard Korte „oft nicht in der Lage, sich mit den in der Beratung auftretenden Fragen und Problemen exakt wissenschaftlich und gleichmäßig tiefgehend zu befassen, was aber in Anbetracht der großen und differenzierten Not, welche es oft zu beheben gilt, notwendig ist“.⁴⁶¹ Daher nahm das KZI als erste Aufgabe die Ausbildung von Leiterinnen der Eheberatungsstellen in die Hand. Bereits ein halbes Jahr nach seiner Gründung fand die erste der nun jährlichen
Vereinsgründung. Da die Chronik im Rückblick verfasst wurde, ist davon auszugehen, dass die dort genannte Jahreszahl der Satzung falsch erinnert wurde. Heute: Bundesverband Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater e. V. Verein Katholischer Eheberaterinnen und Eheberater: Satzungen. Detmold, 24. Mai 1963, Bundesverband Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater e. V. Vgl. Zelazny, Käthe: Bericht über das Verhältnis der katholischen Eheberaterinnen und Eheberater zum katholischen Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen e. V., 4. Oktober 1966, Bundesverband Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater e. V. B[ernhard] Korte: Erster überdiözesaner Kursus für Eheberatung, März 1953, [S. 1], AEK, Gen. II 13.2a, 1. Vgl. auch im Folgenden.
322
4 Katholische Eheberatung
Weiterbildungen statt. Anfangs waren sie noch oft mit „Tagung“ überschrieben, später immer öfter mit „Kurs“. Die Veranstaltungen waren nach einem Gesamtplan konzipiert.⁴⁶² Sie sollten den verstreut arbeitenden Eheberaterinnen Hilfe für die praktische Arbeit an die Hand geben, was sich in den Augen der Beteiligten auch bewährte.⁴⁶³ Die Einladungen gingen stets an aktuelle sowie zukünftige Leiterinnen von Beratungsstellen sowie die Referenten für Ehe- und Familienfragen, die bei den Trägerverbänden des KZI arbeiteten. Der erste Tagungsplan sah fast nur Vorträge von Korte, dem Leiter des KZI, Prälat Hermann Klens und der Beraterin Josepha Fischer-Erling vor. Diskutiert wurden „Die geistesgeschichtliche Situation der Ehe“ und „Das große Sakrament“, aber auch Berichte aus der Praxis mit Vorträgen zu den menschlichen Beziehungen in der Eheberatung und zu praktisch-organisatorischen Fragen: „Wie kann und soll eine Eheberatungsstelle eingerichtet sein?“ Die Abende der mehrtägigen Veranstaltung waren für allgemeine Fragestellungen freigehalten.⁴⁶⁴ Mit der Beteiligung von 48 Personen, davon vier Priester, 42 Frauen und zwei Männer, sowie der großen Aufgeschlossenheit der Zuhörer war man im KZI 1953 sehr zufrieden.⁴⁶⁵ Die zweite Tagung konnte als Aufbau- oder Grundkurs gelten. Es ging sowohl um anthropologische, juristische als auch theologische Themen sowie die Praxis und den Aufbau einer Eheberatungsstelle. Als Referenten spielten Mitglieder des KZI weiterhin eine wichtige Rolle. Auffällig ist, dass Korte einen Vortrag hielt, in dem es um „Sexus, Eros und Agape vor und in der Ehe“ ging.⁴⁶⁶ Damit war Sexualität auch außerhalb der Ehe frühzeitig ein Thema. In seinem Vortrag über das Wesen der Beratung betonte Korte die personale Beziehung.⁴⁶⁷ Auf der dritten Tagung standen Ehevorbereitung und das Verhältnis von Ratsuchendem und Beraterin im Mittelpunkt.⁴⁶⁸ Auf Ehevorbereitung legte das Zentralinstitut großen Wert, um Ehekrisen frühzeitig zu verhindern. Besonders betont wurde, dass das Vorgehen in der Eheberatung entscheidend war.⁴⁶⁹
Vgl. KZI: Bericht über die Sitzung der Trägerverbände am 17. April 1959, AEK, DBK, KZI, DBK 295. Vgl. Jost/Zelazny, Jahre, [1988], S. 63 ff. Vgl. [Hermann] Klens: Zentralinstitut für Ehe- und Familien-Beratung, 4. Oktober 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 08. Vgl. B[ernhard] Korte: Erster überdiözesaner Kursus für Eheberatung, März 1953, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Vgl. Hermann Klens / Bernhard Korte: 2. Kursus für Eheberatung, Einladung, 27. April 1953, ADCV, 349.4, Fasz. 08. Vgl. KZI: Jahresbericht 1953, ADCV, 319.4, 601/02, Fasz. 01. Vgl. Hermann Klens / Bernhard Korte: 3. Kursus für Eheberatung, Einladung, 10. April 1954, ADCV, 349.4, Fasz. 08. Vgl. [Bernhard] Korte: 3. überdiözesaner Kursus für Eheberatung, Bericht, Februar 1955, ADCV, 349.4, Fasz. 08.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
323
Der vierte Kurs behandelte die Stellung des Vaters in Familie, Gesellschaft und Kirche. Interessant ist, dass letzterem Punkt „neben Fragen der Beratungsmethode“ nachgegangen werden sollte.⁴⁷⁰ Die Methodik stellte bereits 1955 den eigentlichen Mittelpunkt der Tagung dar. Korte referierte zu allen damit verbundenen Aspekten: „Über Sinn und Aufgaben der Beratung“, „Über die Methodik der Beratung“ und „Theorie und Praxis der Beratung“. Erstmals fand ein Vortrag zur vaterlosen Familie „in tiefenpsychologisch-anthropologischer Sicht“⁴⁷¹ statt. Die Einladung zum fünften Kurs wurde erstmals auf einem bedruckten Faltblatt versandt. Sie ging nun auch an „Seelsorger, Ärzte, Juristen, Pädagogen, Seelsorgehelferinnen, Fürsorger, Fürsorgerinnen und Familienpflegerinnen“.⁴⁷² Korte fungierte offiziell als Kursleiter. Im Mittelpunkt stand das Verhalten des Mannes in Ehe und Familie. Gestörte Verhältnisse wurden auf Erlebnisse in Kindheit und Jugend zurückgeführt.⁴⁷³ Von den Aussagen seien „nicht wenige Hörer in echter Weise bestürzt“ gewesen. Allerdings hätten sie sich auch „besonders angetan“ gezeigt, „das Verständnis für das menschliche Dasein überhaupt, seine Gefährdung und die Verantwortung der Menschen füreinander, vor allem der Eltern für ihre Kinder und der Ehepartner füreinander zu vertiefen“.⁴⁷⁴ Insgesamt vier von sieben Vorträgen behandelten psychologische Aspekte. Zudem diskutierten die Anwesenden den Kinsey-Report aus der Sicht der katholischen Moraltheologie. Es gab Kritik am Report, aber dessen Anliegen wurde insgesamt positiv bewertet. Korte hielt ein Referat über Formen und Fehlformen der Beratung, wobei er das Phänomen der Übertragung und Gegenübertragung erläuterte. Der Mediziner schloss, dass die Tagung Wissenschaft und Praxis besonders fruchtbar verbunden habe. Insbesondere die Eheberaterinnen äußerten den Wunsch, im folgenden Jahr einen längeren Kurs abzuhalten. Dieser sollte allerdings in der Teilnehmerzahl begrenzt werden, da die Tagung mit insgesamt 120 Personen aus der Bundesrepublik, Berlin und der DDR sehr groß war.⁴⁷⁵ Der sechste überdiözesane Kurs fand als zehntägige Veranstaltung statt. Von insgesamt zwölf Vorträgen widmeten sich fünf Methoden und Praxis der Eheberatung. Themen waren Sinn und Aufgabe der Beratung, Voraussetzungen beim
Hermann Klens / Bernhard Korte: 4. überdiözesaner Kursus für Eheberatung, Einladung, 21. Mai 1955, ADCV, 349.4, Fasz. 08. Ebd. KZI: Einladung zum 5. überdiözesanen Kursus für Eheberatung vom 18. bis 22. Juni 1956, ADCV, 349.4, Fasz. 08. Vgl. im Folgenden KZI: Jahresbericht 1956, ADCV, R 565, Fasz. 01. Ebd., S. 3. Vgl. [Klens, Hermann]: Rundbrief an die Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen, 1. Jg., Nr. 1, Jan[uar] 1957, ADCV, R 565, Fasz. 01.
324
4 Katholische Eheberatung
Beratenden, Gesprächsführung sowie Theorie und Praxis.⁴⁷⁶ Zum Kurs liegen Zusammenfassungen einiger Referate vor, sodass ein Eindruck entsteht, was die Teilnehmer beschäftigte. Diskutiert wurden sowohl das Verhältnis zwischen Lehramt und Beratungspraxis als auch das Selbstverständnis der Beraterinnen.⁴⁷⁷ Die Psychologin und Eheberaterin Johanna Läpple trug zur Diskrepanz zwischen Kirchenrecht und Praxis vor.Wenn aufgrund einer verfehlten frühkindlichen Entwicklung eine falsche Partnerwahl getroffen worden sei, müssten Eheberaterinnen einsehen, dass die entsprechende Ehe nicht weitergeführt werden könne. „Wie weit wir dann doch noch nach den Geboten unseres Glaubens handeln und raten können, das ist dann etwas anderes.“⁴⁷⁸ Die Beraterin schien somit durchaus zu erwägen, den Rat zu einer Scheidung zu geben oder eine solche zu unterstützen. Sie stellte damit die durch das Kirchenrecht gesetzten Grenzen in Frage. Die Referenten, aber auch die Eheberaterinnen äußerten sich auf den Tagungen immer wieder kritisch zur Kirchenlehre.⁴⁷⁹ Läpple betonte allerdings auch andere Herausforderungen. Sie verwies darauf, dass Beraterinnen nicht immer den Anspruch verfolgen könnten, alle Schwierigkeiten von Ratsuchenden lösen zu wollen. Vielmehr sei grundlegend, für die Verheirateten da zu sein: „Ich möchte warnen vor der Meinung, wir könnten alles heilen. Das können wir nicht. Und vielleicht besteht unsere Tätigkeit manchmal nur darin, daß wir da sind für einen Menschen […]. Wir müssen uns immer wieder üben in der Tugend der Demut und der Bescheidenheit.“⁴⁸⁰ Die Psychologin plädierte dafür, sich bewusst zu machen, wie wertvoll bereits das Gespräch an sich sein konnte. „Das wir anhören, daß wir da sind und […] etwas auflockern, aufklären, dann einen Rat geben, das ist viel.“⁴⁸¹ Läpple sprach auch über Voraussetzungen für eine gelungene Ehe. Sie forderte von den Partnern, sich gegenseitig wahrhaft kennenlernen zu wollen. Es müsse in der Ehe „einen Eifer geben den anderen zu erschauen und das Andere in dem
Vgl. KZI: Einladung zum 6. überdiözesanen Kursus für Eheberatung vom 8. bis 19. Juli 1957, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Vgl. KZI: Rundbrief an die Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen, 2. Jg., Nr. 1, 1958, S. I, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Läpple, Johanna: Christliches Dasein in Ehe und Familie: Hindernisse und Verwirklichung. Auszug aus drei Vorträgen gehalten am 10. und 11. Juli 1957 in Königswinter auf dem 6. überdiözesanen Kursus für Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts für Ehe- und Familienfragen, S. 5, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Auch Ferdinand Oertel macht im KZI „oft nicht mit der Kirchenlehre übereinstimmende Ansichten“ aus. Oertel, Ferdinand: Der Kirchenzeitungsmann: Erinnerungen aus fünfzig Journalistenjahren. Münster 2009, S. 159. Vgl. zudem [KZI]: Aus dem Brief von Frau Simmon (verlesen in Freiburg am 23.4.63), „Eheberatung aus der Sicht des Laien“, Aktennotiz, ADCV, 349.4, Fasz. 08. Ebd., S. 4. Ebd., S. 17.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
325
Partner kennenzulernen und nicht zu fürchten, nicht Angst zu haben vor dem Fremden, sondern daß man aus diesem Anderssein und aus diesem Gestatten, daß der Andere wirklich anders sein darf, selbst reif und reifen wird“.⁴⁸² In weiteren Kursen der Jahre 1958 bis 1960 ging es beispielsweise um das eheliche Dasein,⁴⁸³ die „Gestalt der Ehe“ sowie bewusste und unbewusste Störungen zwischenmenschlicher Begegnung. Im Mittelpunkt standen Perspektiven der psychologischen Anthropologie sowie der Theologie.⁴⁸⁴ Im darauffolgenden Jahr wurde die „Mischehe“ in dogmatischer und psychologischer Sicht sowie aus protestantischer Perspektive beleuchtet. Alle Kurse umfassten einen Methodenteil, der dazu beitragen sollte, das erworbene Wissen in die Praxis umzusetzen. Auch den Teilnehmerinnen schienen insbesondere Methodenfragen relevant. Sie regten 1961 an, neben dem jährlichen überdiözesanen Kurs weitere Tagungen abzuhalten, auf denen vor allem Beratungsmethoden besprochen und eingeübt werden sollten.⁴⁸⁵ Daher widmete sich im folgenden Jahr ein zusätzlich angesetzter Kurs vollständig der beraterischen Praxis.⁴⁸⁶ Das Programm umfasste vor allem psychotherapeutische Themen, wie zum Beispiel Übertragung und Gegenübertragung, aber auch Gesprächsführung, Fallbesprechung und Verschriftlichung. Dies entsprach den Forderungen der Teilnehmerinnen, die sich eine langjährige Ausbildung wünschten und systematische Schulung in Gesprächsführung.⁴⁸⁷ Der 11. überdiözesane Kurs im Mai 1962 behandelte Ehescheidung aus tiefenpsychologischer, dogmatischer, juristischer, kirchenrechtlicher und kulturgeschichtlicher Sicht. Zudem kamen Scheidungsfolgen sowie Möglichkeiten und Grenzen der Beratung bei Trennungskrisen zur Sprache.⁴⁸⁸ Auch den grundsätzlichen Anforderungen an die Beraterpersönlichkeit war ein Programmpunkt ge-
Ebd., S. 15. Zu den Vorträgen dieses Kurses vgl. auch KZI (Hrsg.): Ehe und Familie heute. Köln 1960. KZI: Niederschrift aus der Besprechung der erweiterten Trägerschaft am 16. Mai 1960, AEK, DBK, KZI, DBK 295. Vgl. KZI: Einladung zum 9. überdiözesanen Kursus für Ehe-, Familien- und Jugendfragen und zur Jahreshauptversammlung der katholischen Eheberaterinnen vom 17. bis 20. Mai 1960, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Vgl. im Folgenden [Bernhard] Korte: Jahresbericht 1961 des Katholischen Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen, 24. Februar 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Vgl. im Folgenden KZI: Einladung [zum überdiözesanen Kursus „Praxis der Eheberatung“] vom 18. bis 21. September 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 08. Vgl. KZI: Einladung [zum überdiözesanen Kursus „Praxis der Eheberatung“] vom 18. bis 21. September 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 08 sowie KZI: Jahresbericht 1962, März 1963, S. 10 ff., ADCV, 349.4, Fasz. 07. Vgl. KZI: Einladung zum 11. überdiözesanen Kursus für Ehe-, Familien- und Jugendfragen und zur Jahreshauptversammlung der katholischen Eheberaterinnen vom 22. bis 25. Mai 1960, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963.
326
4 Katholische Eheberatung
widmet. Gefordert wurde Fachwissen, das in der vorliegenden Quelle insbesondere auf die Kenntnis neurotischer, psychopathischer und psychotischer Störungen abzielte, um Ratsuchende adäquat an entsprechende Fachleute überweisen zu können. Die Teilnehmerinnen besprachen die Problematik von Übertragung und Gegenübertragung sowie weitere mögliche Fehler in der Beratung. Dazu gehörten „das Über-reden, das Zu-viel-von-dem-Ratsuchenden-fordern, das schnelle Ausweichen auf das religiöse Gebiet“.⁴⁸⁹ Letzteres steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zum eigenen Selbstverständnis, da das Sakrament der Ehe gleichzeitig als wichtigstes Wissen des Beraters genannt wird, das dieser letztlich auch vermitteln sollte. Allerdings galt es, dies den Besuchern der Eheberatung nicht aufzudrängen. Dennoch wurde generell bedauert, dass das christliche Ideal der Ehe und Familie nicht mehr als Leitbild der säkularisierten Gesellschaft gelte. Teilnehmer beobachteten, dass eine kirchliche Trauung häufig keine Glaubensentscheidung mehr war.⁴⁹⁰ Die Diskussion ging so weit zu fragen, ob Geistliche noch unter allen Umständen auf die Ehe drängen sollten und „ob denn alle die heirateten, auch zur Ehe berufen seien“.⁴⁹¹ Die Trennung von Eheleuten müsse zudem in kirchenrechtlicher Hinsicht noch intensiver durchdacht werden, ebenso moraltheologische Aussagen zur Geburtenregelung. Auch die Frage, ob die Kirche getrennt lebende, geschiedene oder wiederverheiratete Menschen zu wenig betreue, wurde diskutiert. Damit bewegten sich einige Aussagen deutlich außerhalb kirchlicher Vorstellungen.⁴⁹² Auf den Veranstaltungen kamen immer wieder direkt und indirekt die Herausforderungen zur Sprache, denen sich katholische Eheberaterinnen ausgesetzt sahen. Gleichzeitig blickten sie und das KZI zufrieden auf ihre Arbeit, da sie sich nach eigener Einschätzung im Einklang mit der grundsätzlichen Entwicklung, wie sie das Zweite Vatikanische Konzil angestoßen hatte, befanden.⁴⁹³ Vielen Eheberaterinnen war es nicht möglich, an den Jahreskursen des KZI teilzunehmen, weshalb dieses zusätzliche Veranstaltungen zu anderen Terminen anbot. Ein weiterer Grund war, dass einzelne Diözesen spezifische Problemstellungen hatten, etwa eine konfessionell gemischte Bevölkerung oder große ländliche Gebiete.⁴⁹⁴ Die Kurse und Tagungen fanden in Zusammenarbeit mit den Diözesen
Ebd., S. 14. Vgl. Kapitel 4.5.2 Grenzen der Beratung. KZI: Einladung zum 11. überdiözesanen Kursus für Ehe-, Familien- und Jugendfragen und zur Jahreshauptversammlung der katholischen Eheberaterinnen vom 22. bis 25. Mai 1960, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Vgl. auch Kapitel 4.5.2 Grenzen der Beratung. Vgl. KZI: Jahresbericht 1964, o. D., S. 3, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Vgl. auch im Folgenden. Vgl. z. B. [Bernhard] Korte: Jahresbericht 1961 des Katholischen Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen, 24. Februar 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 07. [Bernhard Korte]: Systematische inhaltliche
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
327
statt, das Zentralinstitut übernahm die Reisekosten und Honorare der Referenten.⁴⁹⁵ Darüber hinaus waren der Leiter und später auch der Direktor sowie die Referenten des KZI in verschiedene, regelmäßig stattfindende Arbeitskreise zu Ehe und Familie involviert und hielten Vorträge vor Fachpublikum sowie Kirchenpersonal, Brautleuten, Schülern und Studenten.⁴⁹⁶ Besonders Kortes Vorträge waren sehr beliebt. Als „ein ganz großes Erlebnis“⁴⁹⁷ wertete eine Teilnehmerin die von Korte geleitete Tagung. Es kam jedoch auch vor, dass Einrichtungen keine Notwendigkeit für Fortbildungen oder professionalisierte Beratung sahen.⁴⁹⁸ An den Jahrestagungen lässt sich ablesen, welche Themen die Eheberaterinnen beschäftigten. Auch die Entwicklung hin zu einer von psychologischen Methoden geprägten, professionellen Beratung wird sichtbar. Bereits 1953 betonte Korte die personale Beziehung der Eheleute und formulierte damit frühzeitig offiziell die in der katholischen Beratungsarbeit vorherrschende Haltung. Auch bei weiteren zentralen Aspekten setzten sich das KZI und die Kursteilnehmer kritisch mit dem kirchlichen Lehramt auseinander. Zudem wurden immer wieder Punkte aufgegriffen, die in der deutschen Gesellschaft diskutiert beziehungsweise problematisiert wurden. Dazu gehörten beispielsweise der Kinsey-Report, die „Mischehe“ sowie die Frühehe. In diversen Tagungsanmerkungen finden sich Hinweise auf lebhafte Diskussionen, etwa über Scheidung, den Umgang mit Wiederverheirateten oder Geburtenregelung. Der Wunsch an die Moraltheologie war, sich mit diesen Problemen intensiver auseinanderzusetzen. Spätestens 1957 war der Punkt erreicht, an dem die Eheberaterinnen nach Aussage des Zentralinstitutes „unruhiger“ wurden und vieles in Frage stellten.⁴⁹⁹ Ihre durchaus schwierige Situation zwischen kirchlicher Lehre und erlebter Praxis führte ebenso zu Frustrationen wie die Er-
Darstellung der Ergebnisse der Tagungen 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 08. KZI: Einladung zu Ehevorbereitungs Werkwoche für Referenten in der Ehevorbereitung (Grundkurs), 21. bis 24. Oktober 1964 und Aufbaukurs vom 11. bis 15. Mai 1964, o. D., ADCV, 349.4, Fasz. 08. KZI: Jahresbericht 1964, o. D., S. 15, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Vgl. [Bernhard] Korte: Jahresbericht 1961 des Katholischen Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen, 24. Februar 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 07. KZI an Eugen Rucker, Brief, 16. November 1962, AEK, DBK, KZI 29. Vgl. z. B. [Bernhard] Korte: Jahresbericht 1961 des Katholischen Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen, 24. Februar 1962, ADCV, 349.4, Fasz. 07. [Bernhard] Korte: Einladung zum 32. „RheinRuhr-Arbeitskreis“ am 19. Feb[ruar] [19]63, 4. Februar 1963, ADCV, 349.4, Fasz. 08. M. M. an Bernhard Korte, Brief, [1959], AEK, DBK, KZI 422. Vgl. Elisabeth Dold an [Bernhard] Korte, Brief, 19. Dezember 1955, AEK, DBK, KZI 385. Elisabeth Dold an [Bernhard] Korte, Brief, 22. März 1956, AEK, DBK, KZI 385. Vgl. Phillip Boonen an [Günter] Struck, Brief, 30. Juni 1965, AEK, DBK, KZI 297. KZI: Rundbrief an die Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen, 2. Jg., Nr. 1, 1958, S. I, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963.
328
4 Katholische Eheberatung
kenntnis, generell nicht alle Probleme in der Beratung lösen zu können. Doch versuchten Beraterinnen und KZI immer wieder, mit diesen Grenzen konstruktiv umzugehen. Von Beginn an thematisierten sie die Praxis und ab 1954 erstmals explizit das Verhältnis zwischen Ratsuchenden und Beraterin. Ab diesem Zeitpunkt standen Arbeitsmethoden immer wieder im Zentrum des Interesses. Der Wunsch von Eheberaterinnen, sich tiefergehend mit Methoden und Praxis auseinanderzusetzen, schlug sich 1962 in einem speziellen Kurs nieder. Zwar war die Methodik zu Beginn noch nicht ausdifferenziert oder normiert, wurde jedoch bereits früh in die Überlegungen zu Berufsbild und professionellem Handeln mit aufgenommen. Die beginnende psychologische Orientierung wird auf den Jahrestagungen erstmals 1955 mit einem Vortrag aus tiefenpsychologischer Sicht offenbar. Im Jahr 1959 stand die psychologische Anthropologie dann neben der Theologie erstmals im Mittelpunkt. Der Arbeitsplan des Zentralinstituts von 1963 sah in erster Linie vor, eine Prüfungsordnung aufzustellen und alle Eheberaterinnen im Laufe des Jahres entsprechend zu prüfen. Zudem sollten alle Tagungen gemäß diesen Anforderungen ausgerichtet werden. Eine Sicherung der Arbeitsqualität war notwendig, sowohl mit Blick auf die angestrebte fachliche Professionalisierung als auch wegen des neuen Bundessozialhilfegesetzes. Nur so konnte die katholische Eheberatung von Zuschüssen profitieren und ihre dominierende Position sichern.⁵⁰⁰ Zu diesem Zeitpunkt war in erster Linie Günter Struck dafür zuständig, die Ausbildung der Nachwuchskräfte und die Fortbildung bereits aktiver Beraterinnen voranzutreiben.⁵⁰¹ Als Forum diente vor allem die Jahrestagung. Nun lag der Schwerpunkt darauf, systematisch Nachwuchskräfte zu gewinnen, auszuwählen sowie auszubilden. Ein Arbeitsausschuss entwickelte gemeinsam mit einer Ausbildungskommission einen Themenplan für mehrere Bildungsabschnitte. Hinzu kamen Unterrichtsbögen mit Literatur, um Einheitlichkeit zu gewährleisten. Das auf diesem Weg entstandene Berufswegmodell und ein Fragenkatalog wurden mit den Teilnehmern des 12. überdiözesanen Kurses besprochen.⁵⁰² Eingebunden war die Beratung in den Deutschen Arbeitskreis Jugend-, Ehe- und Familienberatung (DAK),⁵⁰³ der im Februar 1963 eine Grundsatzerklärung über Wesen und Methode der Eheberatung beschloss und ein Jahr später eine „Rahmenordnung für die Ausbildung der Eheberater“ festlegte. Beide Schriftstücke dienten als Orientierung für Fördermaßnahmen und wurden dem Bundesminister für Familie und Jugend Vgl. [Helmut] Friederichs an [Vorstand], Brief, 15. Oktober 1962, S. 4, ADCV, 349.4, Fasz. 06. Vgl. auch Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 364. Vgl. im Folgenden Struck, Ehenot, 1966, S. 8 ff. Vgl. KZI an [Eheberater], Brief, 18. März 1963, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963. Vgl. Kapitel 3.3.3 Standardisierung.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
329
übergeben.⁵⁰⁴ Ab 1963 ist eine verstärkte Finanzierung durch das Bundesfamilienministerium zu verzeichnen.⁵⁰⁵ Auch Richtlinien für die katholische Eheberatung wurden erstellt, die sich an denjenigen des DAK ausrichteten.⁵⁰⁶ Alle katholischen Beratungsstellen mussten sich beim KZI registrieren und mindestens eine qualifizierte katholische Eheberaterin sowie ein Team aus Fachpersonen vorweisen können. Auch katholischerseits wurde Eheberatung damit, wie im staatlichen, wohlfahrtlichen und evangelischen Bereich, zu einem Beruf ⁵⁰⁷ – aber, und auch das ist eine Gemeinsamkeit, nicht zu einer akademischen Profession. Neue Eheberaterinnen mussten ein Auswahlverfahren und anschließend eine zwei- bis dreijährige Ausbildung durchlaufen, die sie in Wochenendkursen dezentral in 16 Regionen absolvieren konnten.⁵⁰⁸ Dafür waren 20 regionale Bildungstage vorgesehen. Ausbildungsleiter und Mentoren erhielten in diesem Modell besondere Bedeutung. Regionale Komitees schlugen in den Diözesen Ausbildungsleiter vor, die das KZI anschließend genehmigen musste. Ihre Aufgabe war es, die Bildungstage zu planen und umzusetzen. Eine der Ausbildungsleiterinnen war die Eheberaterin Josepha Fischer-Erling.⁵⁰⁹ Die Mentoren ernannte das KZI im Einvernehmen mit der Diözese. Die auszuwählenden Persönlichkeiten sollten bereits seit mindestens zwei Jahren in der Eheberatung tätig und nach Möglichkeit „Psychologe, Psychotherapeut, Psychiater oder ausnahmsweise praktischer Arzt sein“.⁵¹⁰ Der Mentor war als besondere Vertrauensperson für die Fähigkeiten der einzelnen Beraterin verantwortlich, außerdem bewertete er ihre Eignung und verfügte über ihre Zulassung. Auch unterstützte er sie in der Ausbildung bei schwierigen Beratungsfällen. Eheberaterinnen
Die „Rahmenordnung für die Ausbildung der Eheberater“ vom 4. Februar 1964 ist wiedergegeben in Struck, Entwicklung, 1971, S. 15 f. Vgl. Struck, Ehenot, 1966, S. 50. Vgl. im Folgenden [KZI]: Merkblatt Zulassung zur katholischen Eheberatung, 1. Dezember 1964, AKDFB, Ordner Ehe- und Familienfragen 1964– 1973 sowie Struck, Ehenot, 1966, S. 23 f. Dies umfasste auch Richtlinien zur Kostenerstattung für die Weiterbildung durch das KZI. Vgl. KZI: Richtlinien des Katholischen Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen zur Kostenerstattung für die zentral geleitete regionale Bildungsarbeit in der katholischen Eheberatung, gültig ab 1. Januar 1966. AKDFB, Ordner Ehe- und Familienfragen 1964– 1973. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 233. Vgl. im Folgenden Struck, Ehenot, 1966, S. 25 ff. Vgl. KZI: Verzeichnis der Mentor(innen) und Ausbildungsleiter(innen), 01. Januar 1964, AKDFB, Ordner Ehe- und Familienfragen 1964– 73. Ebd., S. 27.
330
4 Katholische Eheberatung
sollten künftig außerdem entlohnt werden.⁵¹¹ Begründet wurde dies mit dem gesellschaftlichen Wandel sowie damit, dass Frauen mittlerweile andere gute Verdienstmöglichkeiten zur Verfügung stünden. Außerdem sei besonders in der Beratungsarbeit die Zeit knapp und die Ausbildung mittlerweile obligatorisch.⁵¹² Bewerberinnen für die Ausbildung sollten „kontaktfähige, intelligente Persönlichkeiten“⁵¹³ sein und bevorzugt ein Hochschul- oder Fachhochschulstudium absolviert haben. Als besonders prädestiniert galten jüngere Sozialarbeiterinnen oder Ärztinnen und Psychotherapeutinnen, weniger Juristinnen und Theologinnen.⁵¹⁴ Priester hatten bereits länger eine lediglich untergeordnete Funktion in der Eheberatung. In Ausbildung und praktischer Beratung dominierte die Psychologie. Da die Ehe der Ratsuchenden jedoch vor dem Hintergrund der gesamtgesellschaftlichen Situation zu betrachten war, sollten Beraterinnen sich auch mit Soziologie auseinandersetzen.⁵¹⁵ Bereits 1964 fand der erste Zentrale Kurs für Nachwuchskandidaten statt sowie der zweite Ausbildungskurs für Mentoren.⁵¹⁶ Die praktische Ausbildung erfolgte anhand von Fallbesprechungen und im zweiten Schritt als Beratung unter Anleitung. Bereits tätige Eheberaterinnen konnten ein verkürztes Verfahren durchlaufen, das die Beurteilung durch einen Mentor vorsah.⁵¹⁷ Ab dem 1. Januar 1966 benötigte jede von ihnen gemäß den einheitlichen Richtlinien des Deutschen Arbeitskreises eine Eignungsbestätigung ihres Verbandes, um tätig sein zu dürfen. Zudem wurde angestrebt, Eheberatung hauptamtlich auszuüben.⁵¹⁸ Damit war das Ziel der Professionalisierung formal erreicht. Zudem verlagerte das KZI sein
Vgl. [Josepha] Fischer-Erling an KDFB, 27. Mai 1964, AKDFB, Ordner Ehe- und Familienfragen 1964– 1973. Sowie [Josepha] Fischer-Erling, Briefvorlage, 4. Januar 1965, AKDFB, Ordner Ehe- und Familienfragen 1964– 1973. Vgl. Struck, Ehenot, 1966, S. 64. [Josepha] Fischer-Erling, Briefvorlage, 4. Januar 1965, AKDFB, Ordner Ehe- und Familienfragen 1964– 1973. Vgl. dazu auch Zelazny, Käthe: Bericht über das Verhältnis der katholischen Eheberaterinnen und Eheberater zum katholischen Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen e. V., 4. Oktober 1966, S. 2, Bundesverband Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater e. V. Vgl. Jost/Zelazny, Jahre, [1988], S. 72 ff. Vgl. KZI: Jahresbericht 1964, o. D., S. 3, ADCV, 349.4, Fasz. 07. [KZI]: Jahresbericht 1965, [1966], ADCV, 349.4, Fasz. 07. Die ersten Ausbildungsleiter und Mentoren werden aufgeführt in KZI: Verzeichnis der Mentor(innen) und Ausbildungsleiter(innen), 01. Januar 1964, AKDFB, Ordner Ehe- und Familienfragen 1964– 1973. Für einen Einblick in den beruflichen und privaten Hintergrund potenzieller Eheberater vgl. [KZI]: Verzeichnis der zur regionalen Ausbildung (Regionalkurs Freiburg) bereiten Personen, Dezember 1965, AEK, DBK, KZI 385. Vgl. Struck, Ehenot, 1966, S. 23 ff. Vgl. Kapitel 4.3.4.1 Verein Katholischer Eheberaterinnen.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
331
Hauptinteresse auf die Ausbildung der Eheberaterinnen, die Finanzierung übernahm im Wesentlichen der Bund.⁵¹⁹ Im KZI war das Fazit zu den Professionalisierungsbestrebungen positiv. Auch ein Berufsbild war wie geplant entstanden, wie Günter Struck 1966 verkündete: „Die nichtkatholische Eheberatung in Deutschland hat ein Stadium erreicht, in dem die Diskussion um den Sinn der Eheberatung und das daraus sich ergebende Berufsbild und um den Bildungsweg des Eheberaters zu einem gewissen Abschluß gekommen ist.“⁵²⁰ Tatsächlich ist dies bis zu einem gewissen Grad zu bestätigen, mit der Einschränkung der noch bis 1979 fehlenden formalen Festlegung des Berufsbildes.⁵²¹ Eine gute Ausbildung im Sinne des KZI boten die Regionen Frankfurt am Main, Münster, Stuttgart, München und Hannover.⁵²² Im Jahr 1966 erhielten bereits über 100 katholische Eheberaterinnen ihr Diplom, zudem standen über 300 in der Ausbildung.⁵²³ Dennoch resümierte 20 Jahre später der Verein Katholischer Eheberaterinnen und Eheberater, dass es nicht gelungen sei, eine einheitliche Beratung zu schaffen.⁵²⁴ Die Ausbildungsschwerpunkte waren regional verschieden. Eine strukturierte Vergütung hatte sich ebenso wenig durchgesetzt wie hauptamtlich Tätige. Weiterhin war die Eheberatung ein nebenamtliches Feld weiblicher Tätigkeit. Eine Ursachenanalyse fand jedoch nicht statt. Der Verein hatte die neu formalisierte Ausbildung und starke psychologische Orientierung bereits 1966 deutlich kritisiert.⁵²⁵ Eheberaterinnen waren von Beginn an sowohl im Arbeitsausschuss als auch der Ausbildungskommission vertreten, da das Zentralinstitut an ihrer Mitarbeit interessiert war. Als sich die Ausbildungskommission 1966 auflöste, übernahm die Mentorenkonferenz ihre Aufgaben. Damit wurde die Ausbildung den an psychologischen Ansätzen orientierten Mentoren anvertraut und außerdem der Zeitpunkt erreicht, zu dem das KZI aus Sicht der Beraterinnen kein Interesse mehr an ihrer Mitarbeit hatte. Zwar blieben einige Eheberaterinnen als Ausbildungsleiterinnen organisatorisch zuständig, trugen jedoch im Gegensatz zu den Mentoren kaum mehr Verantwortung. Damit wurde die
Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 233. Struck, Ehenot, 1966, S. 57. Vgl. Kapitel 4.3.4.1 Verein Katholischer Eheberaterinnen. S. Paul Adenauer und Günter Struck an J. Weißmüller, Brief, 15. November 1965, AEK, DBK, KZI 296. Vgl. KZI an Katholische Eheberatungsstellen, Brief, 8. Dezember 1966, BArch, B 189/2816, Bl. 493 f. Vgl. im Folgenden Jost/Zelazny, Jahre, [1988], S. 73. Vgl. im Folgenden Zelazny, Käthe: Bericht über das Verhältnis der katholischen Eheberaterinnen und Eheberater zum katholischen Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen e. V., 4. Oktober 1966, Bundesverband Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater e. V.
332
4 Katholische Eheberatung
Praxiserfahrung der Beraterinnen im Vergleich zur psychologischen Ausbildung der Mentoren zurückgestuft. Dies rief Kritik hervor, die sich im Wesentlichen auf drei Punkte bezog: den Verlust der theologischen Seite katholischer Eheberatung, die Zunahme der psychologischen Orientierung in der Methodik und die Vernachlässigung der Praxis. Der Verein Katholischer Eheberaterinnen und Eheberater wünschte ein gewichtiges theologisches Fundament, das sich in der gesamten Ausund Weiterbildung spiegeln sollte. Er kritisierte die Ausbildung insgesamt als zu kurz. Die Vorsitzende Käthe Zelazny forderte eine eigenständige, von psychologischen Ansätzen abgegrenzte Methodik. Darüber hinaus wünschte sie sich mehr Praxiserfahrung der Mentoren. Diese erfüllten häufig nicht die Vorbedingung einer mindestens zweijährigen Eheberatungstätigkeit, sondern seien vielfach neu auf dem Gebiet. Zudem handele es sich ausschließlich um Psychologen, Psychiater und Psychotherapeuten. Damit stehe „den praktisch tätigen Eheberaterinnen ein Team von Psychologen gegenüber, das von der Arbeitsstelle des KZI mit besonderen Vollmachten ausgestattet ist, ohne Erfahrung in direkter Eheberatungsarbeit zu haben. Damit gerät aber die katholische Eheberatung in eine völlig neue Richtung […].“ So wichtig die psychologische Orientierung auch sei, sie dürfe nicht an die Stelle des Ganzen gesetzt werden. Es habe den Anschein, „als ob das ursprüngliche Berufsbild des katholischen Eheberaters seitens der Arbeitsstelle des KZI eine starke Wandlung erfährt. Die katholischen Eheberaterinnen und Eheberater sehen diese Entwicklung mit Sorge.“⁵²⁶ Die Aktiven forderten eine breitere berufliche Zusammensetzung und unterschiedliche Vorbildung der Beraterinnen. Sie richteten sich damit explizit auch an Nichtakademiker. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Arbeit zweigleisig verlaufe und qualifizierte Kräfte abwanderten.⁵²⁷ Obwohl die Eheberatung zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Jahren auf psychologischer Basis arbeitete, scheint dies vielen Beraterinnen in vollem Umfang erst bewusst geworden zu sein, nachdem sie sich 1966 auf die Professionalisierungsrichtlinien festgelegt hatten. Die Haltung des Vereins, sich nicht auf psychologische Orientierung beschränken zu wollen und die Praktikerinnen mehr einzubinden, widersprach den Vorstellungen des KZI. Die Eheberaterinnen bezweifelten, dass das Zentralinstitut sich so stark an psychologische Methoden anlehnen wolle. Dies wird an Zelaznys indirekter Frage deutlich, ob dem KZI diese Ausrichtung klar sei. Sie verlangte vom Vorstand, die psychologische Prägung der Beratung klar zu erkennen und dazu seine Zustimmung zu geben. Offensichtlich konnte sie sich nicht vorstellen, dass es sich hierbei um eine
Zelazny, Bericht, 1966, S. 3 f., Bundesverband Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater e. V. S. ebd., S. 6.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
333
willentliche Entscheidung handelte. Zudem zeigte sich in dieser Entwicklung, dass Frauen nach wie vor eine große Anzahl der Beraterinnen stellten, jedoch gleichzeitig ihre Vorrangstellung gegenüber männlichen Experten immer mehr verloren.⁵²⁸ Ebenfalls in den Bereich der Professionalisierung fallen Überlegungen, für die Beratung und die katholischen Einrichtungen in der Öffentlichkeit zu werben. Bereits in den 1950er-Jahren entstanden Entwürfe zu einheitlichen Plakaten. Da diese für das gesamte Bundesgebiet gelten sollten, war eine Einigung problematisch. „Es ist ausserordentlich [sic] schwierig, einen Entwurf zu bekommen, der sowohl dem Inhalt wie der Gestaltung nach den Anforderungen entspricht, die wir stellen müssen, und der gleichzeitig auch im Hinblick auf die Ansprechbarkeit des Plakates den verschiedenen soziologischen Gegebenheiten Rechnung trägt.“⁵²⁹ Unter der Überschrift „Katholische Beratungsstelle für Ehe- und Familienfragen“ lautete der Text: „Wir erteilen in Fragen der Ehe und Familie verschwiegen und uneigennützig Rat und Hilfe. Wir beraten auch in vorehelichen Fragen. Fachkräfte stehen zur Verfügung.“ Darunter waren die Kontaktdaten sowie Sprechstundenzeiten vermerkt. Die Farbgebung war rot, links befand sich die Skizze eines dünnen weißen Kreuzes mit zwei Ringen. Ein schwarzes Fragezeichen war deutlich durch das Kreuz gezeichnet.⁵³⁰ Ob diese Plakate zum Einsatz kamen, lässt sich anhand des vorliegenden Materials nicht nachvollziehen.⁵³¹ Mit der Formalisierung der Ausbildung wurde die Thematik wiederum akut. Spätestens zu Beginn des Jahres 1965 lag einheitliches Werbematerial in Form von Briefbögen, Plakaten und Prospekten vor, die beim KZI bestellt werden konnten.⁵³² Ebenso waren dort Muster für Anträge und Modellhaushaltspläne für Eheberatungsstellen erhältlich, um Finanzmittel bei den Kommunalverwaltungen zu beantragen. Eine Reihe von Beratungseinrichtungen erhielt bereits solche Zuschüsse. Im Zentralinstitut herrschte die Ansicht, dass sie alle versuchen sollten, auf diesem Weg ein Minimum von 10 Prozent ihrer Ausgaben zu decken.
Vgl. Lippold, Church, 2014, S. 302 f. [KZI] an J. Krechel, Brief, 26. April 1954, AEK, DBK, KZI 28. KZI an Heinrich Pemsel, 11. Dezember 1954, AEK, DBK, KZI 29. Allerdings wird 1955 auf das Plakat einer katholischen Einrichtung eingegangen.Vgl. [Bernhard] Korte an Clemens Weis, 16. April 1955, AEK, DBK, KZI 387. KZI an alle Eheberatungsstellen, Brief, 4. Februar 1965, AKDFB, Ordner Ehe- und Familienfragen 1964– 1973. Wie das Werbematerial aussah, ist unklar. Im Aktenbestand der Deutschen Bischofskonferenz liegt ein Plakat vor, es könnte sich dabei jedoch auch um die Eigenkreation einer einzelnen Beratungsstelle handeln. Vgl. Kath. Beratungsstelle für Ehe- u. Familienfragen, Plakat, o. D., AEK, DBK, KZI 28.
334
4 Katholische Eheberatung
Der Professionalisierungsdruck, der Sozialarbeit und Wohlfahrtspflege kennzeichnete, zeigte sich damit auch in der Eheberatung, besonders in der Normierung und Verbesserung der Ausbildung katholischer Eheberaterinnen sowie deren Zulassung.⁵³³ Mitte der 1960er-Jahre waren persönliches Engagement, natürliche Begabung und katholischer Glaube nicht mehr ausreichend. Mit zunehmender Differenzierung der Arbeit entstand ein wachsender Bedarf an qualifizierten Fachkräften, die als ausgebildete Spezialisten die Stelle Ehrenamtlicher einnehmen sollten. Eheberatung und christliche Ratschläge wurden damit endgültig auch formal getrennt.⁵³⁴ Die psychologische Orientierung katholischer Eheberatung, die das KZI betrieben hatte, setzte sich gegen den Widerstand des Vereins katholischer Eheberaterinnen und Eheberater endgültig durch. Ab 1965 schritt die qualitative Verbesserung der Beratungsarbeit fort, sie entwickelte sich zu einer akademischen Fachdisziplin.⁵³⁵ Die Richtlinien des Deutschen Arbeitskreises Jugend-, Ehe- und Familienberatung legten für nichtkonfessionelle und konfessionell gebundene Beratungsstellen dieselben Kriterien fest, auch wenn von konfessioneller Seite zusätzliche Qualifizierungen möglich waren und entsprechend umgesetzt wurden. Gleichzeitig veränderte sich durch die Sicht der Psychotherapie auf die Ehe auch diejenige der Beraterinnen. Ehe stellte nur noch einen Teil der Lebensgeschichte dar.⁵³⁶ Dies öffnete die Eheberatung einem breiteren Publikum. Ihre Verbindung mit der katholischen Kirche trat für den Ratsuchenden in den Hintergrund, da sie sich nur noch in der Stellenbezeichnung und dem Glauben des Beraters widerspiegelte. Bei dieser Tendenz blieb es. Die katholische Eheberatung sicherte damit ihre Konkurrenzfähigkeit und passte sich erfolgreich an die moderne psychotherapeutische Ära an. Dies zeigt auch der Anstieg von Beratungsstellen und Ratsuchenden.⁵³⁷ Im Bundesministerium wurde „sehr überrascht“ festgestellt, dass der katholischen Beratungsrichtung trotz zunehmender Kirchenkritik offenbar ein hohes Maß an Vertrauen entgegengebracht wurde.⁵³⁸
Vgl. Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 364. Vgl. Kircher, Gedanken, [1972], S. 148 ff. Vgl. Struck, Schwerpunkte, 1972, S. 243 f. Vgl. Kaminsky, Uwe / Henkelmann, Andreas: „Die Beratungsarbeit als Beispiel für die Transformation von Diakonie und Caritas“. In: Damberg, Wilhelm et al. (Hrsg.): Soziale Strukturen und Semantiken des Religiösen im Wandel. Transformationen in der Bundesrepublik Deutschland 1949 – 1989. Essen 2011, S. 89 – 104, hier S. 103. Vgl. Lippold, Church, 2014, S. 300 ff. Große-Schönepauck, H[elene]: Die Eheberatung in Deutschland und in anderen Ländern, [1969], S. 10 f., BArch, B 189/2807, Bl. 265 ff.
4.3 Selbstverständnis und Professionalisierung katholischer Eheberatung
335
4.3.4.3 Strukturausbau in den Diözesen Der 1963 begonnene bedarfsgerechte Aufbau der Eheberatung als offizieller Kirchendienst musste in den Diözesen entsprechend verankert werden.⁵³⁹ Dafür galt es, die dort bisher eher zufällig aufgrund privater Initiativen entstandenen Beratungseinrichtungen systematisch aufzubauen und in die Kirchenstrukturen einzubinden. Gleichzeitig sollte der Status der Beratungsarbeit als fachlich qualifizierte Laienarbeit anerkannt bleiben. Zu diesem Zeitpunkt bestanden knapp 60 katholische Eheberatungsstellen, deren personelle und finanzielle Leistungsgrundlage verbessert und deren Anzahl je nach Aussage bis 1970 verdoppelt bis mindestens vervierfacht werden sollte.⁵⁴⁰ Das erklärte Ziel des KZI war es, in jeder Stadt über 30.000 Einwohner eine Stelle aufzubauen, in begründeten Fällen auch in kleineren Städten.⁵⁴¹ Durch eine größere Reichweite hoffte man, auch viele Menschen zu erreichen, die keinen Gottesdienst mehr besuchten.⁵⁴² Mit einer Finanzplanung, die bis zum Jahr 1970 reichte, konsolidierte sich auch dieser Bereich.⁵⁴³ Nach 1968 arbeiteten über 600 katholische Eheberaterinnen und Eheberater in 150 Stellen, 900 weitere Personen befanden sich in Ausbildung.⁵⁴⁴ Erfahrungen, wie Eheberatung in den Kirchenstrukturen verankert werden konnte, gab es aufgrund von Vorarbeiten des KZI-Referenten im Außendienst in den Diözesen Nordrhein-Westfalens, Niedersachsens, in Rheinland-Pfalz, Würzburg und Bamberg.⁵⁴⁵ Der Bischof ernannte einen Diözesanbeauftragten für die katholische Eheberatung, der diese vor Ort repräsentieren und als Vertrauensperson des KZI fungieren sollte. Gemeinsam mit dem Beauftragten überlegten die Akteure, welche konkreten Maßnahmen getroffen werden sollten. Dazu gehörte auch, einen mehrjährigen Diözesanplan zu erarbeiten. Sie zielten darauf, die Eheberatung nicht mehr in der Trägerschaft einzelner Organisationen, wie beispielsweise der Caritas, zu belassen. Vielmehr sollte idealerweise eine breite Basis aus allen interessierten lokalen Verbänden oder Institutionen als Rechtsträger fungieren. Auf diesem Weg hoffte der Direktor des KZI Günter Struck die schwierige Aufgabe zu lösen, die Eheberatung als offiziellen Kirchendienst zu etablieren und gleichzeitig eine Kle-
Vgl. im Folgenden Struck, Ehenot, 1966, S. 41 ff. Vgl. KZI an [Trägerverbände], Brief, AKDFB, Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963 sowie Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen: Jahresbericht 1964, o. D., S. 16, ADCV, 349.4, Fasz. 07 sowie Struck, Ehenot, 1966, S. 60 ff. Vgl. Struck, Ehenot, 1966, S. 60 ff. Vgl. [Paul] Adenauer an [Rudolf ] Graber, Brief, 11. Juni 1964, AEK, DBK, KZI 297. Vgl. KZI: Jahresbericht 1964, o. D., S. 3, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Vgl. Große-Schönepauck, Eheberatung, [1969], S. 6, BArch, B 189/2807, Bl. 265 ff. Vgl. im Folgenden [Paul] Adenauer an [Rudolf ] Graber, Brief, 11. Juni 1964, AEK, DBK, KZI 297 sowie Struck, Ehenot, 1966, S. 40.
336
4 Katholische Eheberatung
rikalisierung zu vermeiden. Dies gelang, obwohl Eheberatung nunmehr stärker auf diözesaner Ebene eingebunden war.⁵⁴⁶ Eine tendenzielle Verkirchlichung der Arbeit lässt sich durch diese veränderte Organisation dennoch beobachten.⁵⁴⁷ Laut Struck wurde der Ausbau positiv angenommen. „Schon der erste Besuch in den […] Diözesen hat gezeigt, daß die Aufgeschlossenheit der Pfarrklerus und der Laien für eine institutionelle katholische Eheberatung recht groß ist. Man sieht allerorten den wachsenden Bedarf an Eheberatung […]. Fast überall ist das ernsthafte Bemühen spürbar, die Eheberatung als eine Form der überpfarrlichen Seelsorge zu fördern.“⁵⁴⁸ Zu beobachten war somit ein Wandel, der eine größere Unterstützung durch den Klerus mit sich brachte, dessen mangelndes Engagement noch einige Jahre zuvor kritisiert worden war.⁵⁴⁹ Der Ausbau der Eheberatung und ihre Konsolidierung galten auch als Zeichen für eine Kirche, die sich „den wahren Lebensnöten der Menschen, auch der entfremdeten“, zuwandte.⁵⁵⁰
4.4 Zusammenarbeit der katholischen Eheberatung mit DAJEB und EZI Die katholische Beratungsarbeit grenzte sich von Beginn an klar von der staatlichen und nichtkonfessionellen ab. Mit der Gründung des KZI etablierte sie sich auch institutionell als katholisches Gegenstück zur DAJEB. Fortan wurde sie als unabhängig wahrgenommen, konnte das Alleinstellungsmerkmal einer betont katholischen Beratung erhalten und unabhängige Lobbyarbeit betreiben. Im Untersuchungszeitraum sah das KZI keine Notwendigkeit, sich von der evangelischen Beratung abzugrenzen. Diese verfügte nur über eine geringe Anzahl an Stellen und keinerlei unabhängige institutionelle Vertretung.⁵⁵¹ Ihre enge Verflechtung mit der DAJEB galt als positiv: Katholische Akteure hofften, dass damit christliche Aspekte in die nichtkonfessionelle Beratung Eingang finden würden. Eine Konkurrenz stellte die evangelische Beratung damit letztlich nicht dar.
Vgl. Lippold, Church, 2014, S. 302 ff. Diese Tendenz wurde fortgesetzt, 1984 wurden 64,9 Prozent von insgesamt 282 Beratungsstellen nicht mehr durch die Verbände getragen, sondern durch die Kirche. Vgl. Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 365, Fn. 325 sowie Kaminsky/Henkelmann, Beratungsarbeit, 2011, S. 103. Struck, Ehenot, 1966, S. 2. Vgl. zudem KZI: Jahresbericht 1964, o. D., S. 15, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Vgl. Klens, [Hermann]: Bericht über die Sitzung der Trägerverbände des Zentralinstitutes für Ehe- und Familienfragen am 18. März 1958, o. D., ADCV, R 565, Fasz. 01. KZI: Jahresbericht 1964, o. D., S. 3, ADCV, 349.4, Fasz. 07. Es gab etwa doppelt so viele katholische wie evangelische und paritätische Eheberatungsstellen. Vgl. Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 362.
4.4 Zusammenarbeit der katholischen Eheberatung mit DAJEB und EZI
337
Bereits bevor sich die evangelische Eheberatung mit der Gründung der Konferenz für Evangelische Familienberatung von der DAJEB löste, hatten katholische und evangelische Akteure auf der Vorstandsebene der involvierten Verbände eng kooperiert. Auch danach pflegten die konfessionell gebundenen Institutionen ein gutes Verhältnis und gaben sogar vertrauliche Entwicklungen aus dem eigenen Bereich weiter, um die andere Seite rechtzeitig daran teilhaben zu lassen.⁵⁵² Kurz vor Gründung des KZI hoffte die Caritas, dass von evangelischer Seite eine ähnliche Initiative erfolgen würde. Die Einrichtung eines übergeordneten evangelischen Verbands oder Instituts sollte die konfessionelle Arbeit stärken. Allerdings galt eine solche Gründung als unwahrscheinlich.⁵⁵³ Die christlich-konfessionelle Eheberatung insgesamt zu fördern, war für katholische Akteure wichtiger als die Abgrenzung gegenüber der evangelischen Kirche. Es sollten „zwei christliche Gruppen neben der weltanschaulich neutralen Arbeitsgemeinschaft in Detmold [DAJEB] vorhanden“ sein und ihre Stimme geltend machen.⁵⁵⁴ Die katholische Seite betrachtete nichtkonfessionelle und amtliche Eheberatung über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg eher kritisch. Noch 1966 befand der Direktor des KZI, dass in einem gewissen Umfang immer mit einer Tätigkeit staatlicher Stellen auf dem Gebiet der Eheberatung zu rechnen sei, wenn andere Kräfte der Gesellschaft sich als nicht fähig erwiesen, in geeigneter Weise Hilfen anzubieten.⁵⁵⁵ Mindestens die Existenz amtlicher Beratungsarbeit bedeutete im Umkehrschluss, dass die konfessionelle Seite versagt hatte. Bereits vor Gründung des KZI befassten sich die Bischofskonferenz sowie die Caritas mit der DAJEB und ihren „Bestrebungen, die ganze Eheberatungssache im Bundesgebiet einheitlich zu zentralisieren und von dorther zu beeinflussen“.⁵⁵⁶ Es war ihre Absicht, eine einheitliche Stellungnahme beziehungsweise ein einheitliches Vorgehen gegenüber diesen Tendenzen anzustreben. Dies gelang letzten Endes nicht. Die Caritas nutzte jedoch ihre weitreichenden Verbindungen, um die Arbeit der DAJEB näher einzuschätzen. Mit Walter Hemsing, einem im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft engagierten Psychologen, bestand enger Kontakt.⁵⁵⁷ Hemsing beschrieb, dass sich katholische Eheberaterinnen „sehr positiv zu dem durch und
Vgl. z. B. von Heyl an [Paul] Adenauer, Brief, 16. November 1965, EZA, 2/4356 sowie von Heyl an [Paul] Adenauer, Brief, 27. Dezember 1965, EZA, 2/4356. Vgl. Klens, Hermann: Bericht über die Besprechung betr. Neuaufbau der Eheberatung und Errichtung eines Institutes für Eheberatung am 22.1.1952, [Januar 1952], ADCV, 349.4, Fasz. 02. [Maria] Bornitz: Zur katholischen Eheberatung. Bericht an H. Herrn Caritasdirektor Msgr. Baumeister, 14. Februar 1952, ADCV, 349.4, Fasz. 02, S. 4. S. Struck, Ehenot, 1966, S. 47. Maria Bornitz an [Hans] Wollasch, Brief, 31. März 1951, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. DAJEB, Jahresbericht, [1952], BArch, B 142/418, Bl. 418 ff.
338
4 Katholische Eheberatung
durch christlichen Geist“ des offiziell nichtkonfessionellen Verbands äußerten. Er selbst halte die Arbeit der DAJEB für besonders wichtig und versprach: Ich werde Sie dann laufend über die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft unterrichten – als Vorstandsmitglied erhalte ich ja alle Pläne usw. zugestellt und werde mich eindeutig dagegen verwehren, wenn irgendetwas geschehen sollte, was der Caritasarbeit zuwider wäre – aber ich glaube, Sie [sic] versichern zu können, daß dazu absolut kein Anlaß besteht. […] Ich hoffe zuversichtlich, daß Sie zu der Detmolder Arbeit ebenso positiv stehen können wie ich.⁵⁵⁸
Das Verhältnis zur DAJEB blieb dennoch ambivalent. Die Zusammenarbeit auf persönlicher Ebene war offenbar vertrauensvoll, wie beispielsweise das Engagement der Beraterin Josepha Fischer-Erling in den Fortbildungen der DAJEB und ihr Verhältnis zu Lothar Loeffler, einem Vorstandsmitglied der DAJEB, zeigen.⁵⁵⁹ Dennoch wurde die Verbindung zur evangelischen Seite weiterhin bevorzugt.⁵⁶⁰ Auch riet das KZI katholischen Beratungsstellen von der Mitgliedschaft in der DAJEB ab.⁵⁶¹ Im Jahr 1957 strebte die DAJEB eine Satzungsänderung an, um Beratungseinrichtungen in Landesarbeitsgemeinschaften zu organisieren. Die DAJEB sollte deren Vertretung auf Bundesebene wahrnehmen. Geplant war zudem mindestens ein jährliches Treffen unter der Federführung der Arbeitsgemeinschaft, um Probleme sowie Veranstaltungspläne der Verbände zu besprechen. Die konfessionellen Akteure zeigten sich alarmiert. Die evangelische Kirche glaubte, sie könne in dieser Konstellation ihre Interessen nicht mehr zu Genüge vertreten.⁵⁶² KZI und Caritas waren bestürzt und wollten sich keinesfalls darauf einlassen, befürchteten jedoch, vom Familienministerium zu einer gemeinsamen Vertretung der Eheberatung gedrängt zu werden. Über persönliche Verbindungen nahmen sie Kontakt zu den evangelischen Akteuren auf. Sie suchten Einfluss auf diejenigen zu nehmen, die eine klarere evangelische Linie in die Beratungsarbeit bringen wollten.⁵⁶³ Lange Besprechungen zwischen DAJEB, KZI und evangelischen Kreisen folgten.⁵⁶⁴ Lothar Loeffler stellte als Vertreter des nichtkonfessionellen Verbands einen Satzungsentwurf vor und betonte die Vorteile eines Zusammenschlusses, wozu er
Walter Hemsing an [Hans] Wollasch, Brief, 1. Dezember 1950, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. auch DAJEB, Jahresbericht, [1952], BArch, B 142/418, Bl. 418 ff. Vgl. Kapitel 3.3.5 Kommunikation und Kapitel 3.2.4.3 Lothar Loeffler. Vgl. Elisabeth Dold an [Bernhard] Korte, Brief, 18. September 1956, AEK, KZI 385. Vgl. Kapitel 3.4.2 Katholisches Zentralinstitut. Vgl. Kapitel 3.4.1 Die Begründung. Vgl. z. B. [Kuno] Joerger an [Hermann] Klens, Brief, 21. Januar 1957, ADCV, 349.4, Fasz. 22 sowie [Hermann] Klens an [Kuno] Joerger, Brief, 5. Februar 1957, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. ebd.
4.4 Zusammenarbeit der katholischen Eheberatung mit DAJEB und EZI
339
Erfahrungsaustausch und gemeinsame Interessensvertretung gegenüber Behörden und Öffentlichkeit sowie die konzentrierte Verteilung öffentlicher Mittel zählte. Der Vorsitzende des KZI Hermann Klens war auf der Hut, denn aus allem „ging hervor, daß man auf irgend eine Einordnung unseres Institutes in die Detmolder Arbeitsgemeinschaft hinzielte. Das ging so weit, daß für jedes Jahr eine gemeinsame Tagung in Aussicht genommen wurde. Auch die Verteilung evtl. Beihilfen der Bundesregierung sollte vom Vorstand […] vorgenommen werden […].“ Loeffler habe die führende Stellung der DAJEB in diesem Prozess damit begründet, dass „es zuerst da war und daß es auch in seiner Verbreitungsmöglichkeit umfassender sei“. Klens bejahte, dass man eine gemeinsame Aufgabe habe, verwahrte sich aber sowohl gegen eine Einbindung des KZI als auch die Behauptung, der nichtkonfessionelle Verband sei zuerst in der Eheberatung aktiv gewesen. Er verwies auf die bereits in der Weimarer Republik bestehende katholische Eheberatung und die damit befassten Beraterinnen und Frauenorganisationen. Loefflers Plänen erteilte er eine Absage: Ich habe betont, daß es ganz ausgeschlossen sei, daß wir irgendwie in die Detmolder Arbeitsgemeinschaft eingeschlossen würden, auch nicht optisch, d. h. auch wenn praktisch unsere volle Eigenständigkeit bestehen bliebe. Das sei sowohl der Öffentlichkeit als auch den Behörden gegenüber untragbar. Nicht zuletzt würden wir dem Vorschlag bezüglich der Verteilung der behördlichen Gelder niemals zustimmen.⁵⁶⁵
Bestärkt wurde der Leiter des KZI darin durch den Eindruck, der derzeitige Vorsitzende der DAJEB stehe der Geburtenregelung positiv gegenüber.⁵⁶⁶ Gleichzeitig wollte das KZI die DAJEB durchaus unterstützen, wenn auch mehr im Sinne einer Koexistenz. Klens schlug einen Zentralausschuss aus DAJEB, KZI und evangelischer Kirche vor. Das KZI betrachtete die DAJEB zwar als paritätisch aufgebaute, aber praktisch im christlich-evangelischen Sinn arbeitende Organisation. Ihr Ziel war es, diese Struktur zu erhalten und die evangelischen Akteure darin zu bestärken, weiter in der Arbeitsgemeinschaft aktiv zu sein. Klens befürchtete, wenn diese sich sonst auf einen „allgemeinen, […] humanitären Boden stellen müsse, würden zweifellos mit der Zeit andere Kräfte liberalistischer und sozialistischer Art eindringen und mehr und mehr das Ganze beherrschen“.⁵⁶⁷ In der katholischen Eheberatung wurden Diskussionen darüber geführt, wie sie reagieren könnte, sollte auf Bundesebene eine allgemeine Vertretung entstehen. Im Zentralinstitut überlegte man, ob die Konferenz für Evangelische Fami-
Ebd. Vgl. [Hermann] Klens an [Kuno] Joerger, Brief, 8. April 1957, ADCV, 349.4, Fasz. 02. [Hermann] Klens an [Kuno] Joerger, Brief, 5. Februar 1957, ADCV, 349.4, Fasz. 02.
340
4 Katholische Eheberatung
lienberatung (EKFuL) oder das KZI eine konfessionelle Führung übernehmen könnten.⁵⁶⁸ Da das Zentralinstitut die evangelische Selbstständigkeit und christliche Prägung der DAJEB befürwortete, kam der Gedanke auf, einen „Zentralausschuß der Arbeitsgemeinschaften für Ehe- und Familienfragen“ zu schaffen. Die Caritas verfasste einen Entwurf, dessen Ziel darin bestand, innerhalb der DAJEB den christlichen Einfluss zu fördern.⁵⁶⁹ Dies wäre nicht nur eine Umkehrung der Verhältnisse gewesen, welche die DAJEB immer angestrebt hatte, sondern darüber hinaus bis zum gewissen Grad eine heimliche Übernahme des Verbands durch die konfessionellen Akteure. Schließlich einigten sich die Vertreter der verschiedenen Seiten darauf, Einzelmitgliedschaften für Eheberaterinnen in der DAJEB zu ermöglichen. Die konfessionellen Stellen sollten dies in Zukunft auch empfehlen. Darüber hinaus wurden zwei Vorstandssitze der DAJEB mit einer evangelischen und einer katholischen Persönlichkeit besetzt.⁵⁷⁰ Die Zusammenarbeit verstärkte sich und fand schließlich im Deutschen Arbeitskreis Jugend-, Ehe- und Familienberatung ihren Höhepunkt.⁵⁷¹ In der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre führten die katholischen Einrichtungen die Diskussion um Ehe und Familie konzeptionell an,⁵⁷² beispielsweise mit dem 1964 gegründeten „Interkonfessionellen Arbeitskreis für Ehe- und Familienfragen“.⁵⁷³ Die daran beteiligten Eheberater befassten sich mit Sexualität als Schöpfung Gottes, Liebe als Gestaltungsprinzip zwischenmenschlicher Beziehungen und personaler Liebe. Zwei Jahre später veröffentlichten sie eine interkonfessionelle Erklärung, die den gesellschaftlichen Wandel der Ehe reflektierte: Die Ehe bot sich früher den beiden Partnern als eine religiös und gesellschaftlich fest überlieferte Lebensform dar, die ihnen auch bei mangelnder persönlicher Verbundenheit für ihr Leben Sinn und Halt gab. Mit dem Fortfall vieler dieser religiösen und gesellschaftlichen Bedingungen sind die Ehepartner heute in gesteigertem Maß auf sich selbst angewiesen. Sie stellen an ihre persönlichen Beziehungen Forderungen, denen diese nur schwer gewachsen ist. In der Enttäuschung Geduld und Vertrauen zu bewahren, ist damit heute zu einer entscheidenden Aufgabe der Ehe geworden. Als Christen erkennen wir gerade in dieser Situation das Gnadenwirken Gottes und sehen unsere Aufgabe, diese Erkenntnis überzeugend weiter zu geben und zur Lebenshilfe werden zu lassen.⁵⁷⁴
Vgl. [Kuno] Joerger an [Hermann] Klens, Brief, 31. Januar 1957, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. [Kuno] Joerger an [Hermann] Klens, Brief, 20. Februar 1957, ADCV, 349.4, Fasz. 02. Vgl. [Walter] Raupach, Niederschrift über die Besprechung am 2.12.1957, [1957], BArch, B 189/ 2815, Bl. 105 f. Vgl. Kapitel 3.3.3 Standardisierung und Kapitel 3.4.2 Katholisches Zentralinstitut. Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 234. Vgl. Küsters, Adenauer, 2017, S. 337. Interkonfessioneller Arbeitskreis für Ehe- und Familienfragen: Interkonfessionelle Erklärung zu Fragen von Sexualität, Ehe und Familie, [1966], S. 12.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
341
Mit der Bildung der „Arbeitsgemeinschaft katholischer Familienbildung“ und deren Familienbildungsplan 1967 formulierte die katholische Seite Ehe- und Elternbildungsmaßnahmen. Sie erhob den Anspruch, gesellschaftliche Veränderungen nicht nur zu erkennen, sondern auch unterstützend zu begleiten. Beispielsweise sollte eine gute Partnerschaft zwischen den Eheleuten gefördert werden. Damit ging sie über den Stand hinaus, den die entsprechenden Verhandlungen des Zweiten Vatikanischen Konzils zu diesem Zeitpunkt erreicht hatten. Ein Jahr später gaben das KZI und das Evangelische Zentralinstitut für Familienberatung (EZI) gemeinsame „Grundsatzüberlegungen zu Familienbildung und Familienberatung“ heraus, in denen sie ihren Gestaltungsanspruch sowie die Notwendigkeit betonten, sich an den Bedürfnissen der Menschen zu orientieren.⁵⁷⁵ Über Gespräche im Bundesfamilienministerium fand selbst eine Annäherung an Pro Familia statt.⁵⁷⁶
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts und der Beratungsstellen vor Ort Das KZI verstand sich ausdrücklich als Zentrale der Eheberatungsstellen und deren Vertretung im ganzen Bundesgebiet.⁵⁷⁷ Da Ratsuchende das Zentralinstitut aber auch direkt kontaktierten, beriet es in Einzelfällen individuell oder vermittelte an andere Stellen. Sämtliche erhaltenen Briefe hierzu fallen in die Zeit, in der Bernhard Korte Leiter des Instituts war. Seine Haltung zu Ehe, Eheproblemen, Intentionen und Grenzen der Beratung sowie gegenüber den Ratsuchenden sind somit gut dokumentiert und werden im Folgenden näher untersucht. Gleichzeitig spielt sein Verständnis von Eheberatung eine wichtige Rolle, um die Arbeit des KZI einzuordnen. Noch in den 1950er-Jahren stellte das Schlagwort von der „Krise der Ehe“ beziehungsweise der Familie einen wichtigen gesellschaftlichen Bezugspunkt dar.⁵⁷⁸ Nicht so bei Korte, der die zu diesem Zeitpunkt ungewöhnliche Haltung vertrat, es
Vgl. Kuller, Familienpolitik, 2004, 234 ff. Vgl. Bundesministerium für Familie und Jugend, Niederschrift über die Besprechung mit Vertretern der auf dem Gebiete der Familienbildung tätigen Organisationen am 25. September 1967, 10. Oktober 1967, BArch, B 189/2816, Bl. 281 ff. Vgl. KZI an P. K., Brief, 28. Oktober 1953, AEK, DBK, KZI 422 sowie KZI an L. L., 23. November 1954, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. Kapitel 2.5 „Krise der Ehe“.
342
4 Katholische Eheberatung
gebe keine allgemeine Krise, sondern vielmehr eine individuelle Not der Ratsuchenden, die nicht zuletzt aus deren Sozialisation rührte.⁵⁷⁹ Wenige Formulierungen werden heute so oft und gern gebraucht wie diese: „Krise der Ehe“ und „Krise der Familie“. […] Es ist hier nicht der Ort darzulegen, daß es niemals in der Geschichte der Menschheit eine Krise der Ehe gegeben hat, auch nicht eine solche der Familie. […] Jeder Mensch ist während seines gesamten Lebens auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. […] Die eigentliche Not des Menschen besteht darin, daß er – fast immer im Gefolge eines ungenügenden Geliebtseins in Kindheit und Jugend – nicht in eine echte personale Begegnung mit dem Du, endgültig mit dem Du Gottes, tritt, das heißt, daß er nicht liebt oder nicht genügend liebt.⁵⁸⁰
Wer in seiner Kindheit einen Mangel erlebt habe, fehlten Korte zufolge als Erwachsener die Voraussetzungen für eine echte, liebende Begegnung. Vielmehr wiederholten die Betroffenen tendenziell ihre eigenen Erfahrungen. Dieser Leerstelle müsse begegnet werden. Korte ließ hier seine psychologische Ausbildung erkennen, thematisierte aber auch im religiösen Sinne die personale Liebe, die sich sowohl in familiären Beziehungen als auch in der Beziehung zu Gott ausdrücke. Damit verstand er bereits 1955 die Ehe als personale Liebesgemeinschaft, eine Vorstellung, die in der Lehrmeinung der Kirche erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil Fuß fasste. Auffällig ist, dass der Eheberater sich auch gegen das Schlagwort der „Krise der Ehe“ verwahrte, da er Ratsuchende auf ihre persönliche Verantwortung verweisen wollte. Sie sollten sich nicht mit einer allgemeinen Klage über den Zustand der Institution Ehe herausreden können, um keine Anstrengungen zum Wandel unternehmen zu müssen.⁵⁸¹ Auch in den folgenden Jahren änderte sich Kortes Haltung in dieser Frage nicht.⁵⁸²
Vgl. im Folgenden Korte, Bernhard: „Über die Aufgaben der Jugend- und Eheberatung“. In: Berufsverband Katholischer Sozialarbeiter Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Familiennot und ihre Überwindung. o. O. [1955], S. 62– 67. Ebd., S. 62. Vgl. Korte, B[ernhard]: „Die geistesgeschichtliche Lage der Ehe“. In: Ders.: Erster überdiözesaner Kursus für Eheberatung, März 1953, S. 3 – 4, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Vgl. Korte, Bernhard: „Vorbereitung auf die Ehe“. In: Wege zum Menschen 11 (1959), S. 123 – 136, DZI. Im Jahr 1960 äußerte sich Korte auf der Tagung der Internationalen Kommission für Ehe- und Familienberatung. Dort waren sich die Teilnehmer uneins, ob sie einer Familienkrise von gesellschaftszerstörendem Ausmaß gegenüberstünden. Während der Vorsitzende der Kommission von einem Kulminationspunkt sprach, war Korte der Meinung, „im Laufe der westlichen Kulturen sei die Ehe noch nie so in ihrem Wesen erkannt und gelebt worden wie heute“. Dies untermauert, dass sich seine positive Sicht auf die Ehe nicht veränderte. Borgmann, Grete: „Ehe und Familie in unserer Zeit. Erfahrungen aus der Ehe- und Familienberatung“. In: Caritas 61 (1960), S. 242– 244, DZI.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
343
Wie andere wichtige Persönlichkeiten aus der Praxis, etwa Josepha FischerErling, forderte Korte eine personale Begegnung auch zwischen Beraterin und Ratsuchendem. Die Beraterin sollte ein echtes Interesse an ihrem Gegenüber aufbringen und die Fähigkeit wecken, über sich selbst zu sprechen, sowie ein echter Partner sein: „Der Mensch, in welchem die Fähigkeit, sich in der Sprache, im Wort mitteilen zu können, nicht entwickelt worden ist, weiß nicht um sich selbst. Dieses ist ein entscheidender Grund für die Tatsache, daß sehr viele Ratsuchende in die Beratung kommen mit mehr oder weniger geringfügigen Anliegen, hinter denen sich eine tiefe personale Not verbirgt.“⁵⁸³ Für eine gelungene Beratung sollten die Ratsuchenden die eigene Hilfsbedürftigkeit erkennen und zur Einsicht gelangen, etwas verändern zu müssen, um künftig anders zu handeln. Die Aufgabe lag für Korte darin, Beratene auf deren Suche nach der Wahrheit zu unterstützen, um in ihrer Ehe die Liebe zu finden, die er als größte Gabe und Aufgabe des Menschen als Ebenbild Gottes betrachtete.⁵⁸⁴ Ratsuchende sah er somit als aktiv Handelnde, auch dies in Übereinstimmung mit Fischer-Erling. Gleichzeitig war ihm wichtig, auf die Grenzen der Beratung hinzuweisen und sie zu akzeptieren.
4.5.1 Briefwechsel mit dem Katholischen Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen Schon vor der Gründung des KZI kontaktierten Pfarrer, aber auch Gläubige das Erzbischöfliche Generalvikariat Köln mit kirchenrechtlichen Fragen zur Ehe,⁵⁸⁵ besonders zu „Mischehen“ oder einer Wiederheirat nach Scheidung.⁵⁸⁶
Vgl. ebd. Vgl. auch Bilz, J.: Die menschlichen Beziehungen in der Beratung. In: Korte, Bernhard: Erster überdiözesaner Kursus für Eheberatung, März 1953, AKDFB, Ordner Ehe 1946 – 1950. Korte, Aufgaben, [1955], S. 64. Vgl. A. E. an das Generalvikariat Köln, Brief, 4. April 1949, AEK, Gen. II 13.2a. Erzbischöfliches Generalvikariat Köln an A. E., Brief, 8. April 1949, AEK, Gen. II 13.2a. So setzte sich beispielsweise ein Pfarrer dafür ein, eine Ausnahmegenehmigung für die Wiederheirat eines Geschiedenen zu erwirken (vgl. G. an Erzbischöfliches Generalvikariat Köln, Brief, 8. September 1949, AEK, Gen. II 13.2a). Dies wurde ablehnend beschieden (Vgl. Erzbischöfliches Generalvikariat [Köln] an G., Brief, 14. September 1949, AEK, Gen. II 13.2a). Die Haltung der Kirche zu Scheidung und Wiederheirat wurde in der Öffentlichkeit durchaus beobachtet. Deutlich wird dies in mehreren Schreiben an das Generalvikariat im Jahr 1949 zur Eheschließung des bekannten Hollywoodstars Tyrone Power mit der Schauspielerin Linda Cristian. Power war geschieden und hatte nach seiner katholischen Heirat eine Audienz beim Papst erhalten, was Protest hervorrief. Die Schreiber beschwerten sich, dies sei eine Ungerechtigkeit. Weniger prominente Geschiedene würden nicht so bevorzugt behandelt (vgl. AEK, Gen. II 13.2a).
344
4 Katholische Eheberatung
Das KZI erhielt des Öfteren Post von Ratsuchenden mit ähnlichen Anliegen. Offiziell gab es keine Kriterien, nach denen das Institut entschied, welche Fälle angenommen wurden und welche abgelehnt. Es findet sich lediglich der Hinweis, der Leiter Bernhard Korte sei insofern an der praktischen Arbeit beteiligt, als ihm die Kölner Eheberatungsstelle Klienten schicke, mit denen er sich eingehender zu befassen habe.⁵⁸⁷ Ob dies direkte Treffen mit Ratsuchenden beinhaltete, ist unklar, da keine entsprechenden Quellen aufzufinden waren. Sämtliche vorliegenden schriftlichen Anfragen wurden aber beantwortet, sofern es sich nicht um anonyme Briefe handelte. In der Mehrzahl der Fälle ging es um kirchenrechtliche Fragen zu „Mischehen“, Scheidungen beziehungsweise Annullierungen und deren Folgen.⁵⁸⁸ Sie stellten sich, da es sich bei den Absendern um katholische Gläubige handelte. Die Briefe erreichten das Zentralinstitut aus dem ganzen Bundesgebiet, vor allem von Ratsuchenden selbst, aber auch von kirchlichen Amtsträgern, Eheberaterinnen, Medizinern und Rechtsanwälten. Aussagen zu Milieu und Bildungshintergrund der Anfragenden lassen sich nur in Ausnahmefällen treffen. Um Rat ersuchten etwa gleich viele Männer wie Frauen; eine Beobachtung, die den Schilderungen von Eheberaterinnen widerspricht, in deren Erfahrung hauptsächlich Frauen als Ratsuchende auftraten.⁵⁸⁹ Einige Briefeschreiber verwiesen darauf, durch Zeitungsartikel oder einen Vortrag von Korte vom Zentralinstitut gehört zu haben. Sämtliche Schriftwechsel beziehen sich auf die Zeit von 1945 bis 1962 und datieren somit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Ob die untersuchten Briefe repräsentativ für die katholische Eheberatung sind, ist angesichts der Sonderstellung des KZI im Beratungssystem zu bezweifeln. Da es in der katholischen Beratungspraxis an Material mangelt, lässt sich jedoch kein einordnender Vergleich ziehen. Auch wenn sich aus der Überlieferung des Zentralinstituts kein einheitliches Bild ergibt, vermitteln die insgesamt 42 Fälle mit zum Teil mehrfachen Briefwechseln doch einen ersten Einblick vor allem in Bezug auf nachgefragte Themen. Darüber hinaus erhellen die Antwortschreiben die Haltung von Korte in seiner Rolle als Eheberater sowie die Art und Weise, wie Ratsuchende mit ihren Schwierigkeiten umgingen. Immer wieder erreichten das KZI Anfragen nach Adressen von Eheberatungen vor Ort, meist ohne Angabe von Gründen. Korte oder auch die Sekretärin antworteten. In der Regel empfahlen sie eine nahe gelegene Beratungsstelle oder eine
S. [Maria] Bornitz an [Kuno] Joerger, 24. März 1958, Protokoll, S. 1, ADCV, R 565, Fasz. 01. In der folgenden Analyse der Briefe werden diese zum Teil mehr als einem Kapitel zugeordnet, sofern mehrere Themenkomplexe angesprochen werden. Vgl. Kapitel 4.5.5.1 Eheberatung in der Großstadt. Auch Leserbriefschreiber, die sich an Ratgeberspalten wandten, waren Anfang bis Mitte der 1960er-Jahre vor allem Frauen.Vgl. Saathoff, Tjalda: Ein Jahrzehnt Ratgeberspalten. Inhaltsanalyse von Alltagskonflikten in fünf ausgewählten Zeitschriften. Hamburg 1981, S. 115.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
345
konkrete Eheberaterin, leiteten Fälle aber auch direkt weiter.⁵⁹⁰ Manchmal äußerten Ratsuchende oder Zuständige Bitten, Fälle direkt zu übernehmen.⁵⁹¹ Zum Teil lud Korte die Betroffenen daraufhin in das Zentralinstitut ein.⁵⁹² Im Jahresbericht 1953 findet sich der einzige Hinweis, nach welchen Kriterien er seine Auswahl traf: „Vereinzelt wandten sich Eheberaterinnen mit der Bitte um Mithilfe bei der Klärung schwieriger Fälle aus der Beratung an das Institut. Häufiger übernahm der Unterzeichner [Korte] die Beratung und Behandlung solcher Ratsuchender, deren Schwierigkeiten mit den normalen Methoden der Beratung nicht angehbar waren.“⁵⁹³ In der Analyse erscheint es jedoch wahrscheinlicher, dass Korte keine Kriterien anlegte, wie etwa die Schwere des Falls, sondern schlicht diejenigen Anfragen übernahm, die an ihn herangetragen wurden. Außergewöhnliche Beratungsmethoden lassen sich in den vorliegenden Briefwechseln nicht erkennen. Einige Betroffene zeigten deutlich, wie unglücklich sie waren. Sie wünschten sich, „in diskreter Form Eheprobleme zu besprechen u. Ehezwistigkeiten zu schlichten, die in meiner […] Ehe zu einer schweren Ehekrise sich ausgewirkt haben“.⁵⁹⁴ Die Bitte um Adressen von Beratungsstellen komme „aus großer seelischer Not, mit welcher ich mich seit vielen Monaten quäle“.⁵⁹⁵ Manchmal findet sich ein Hinweis auf die Art der Eheprobleme. Neben der Verzweiflung der Schreibenden wird auch die Hoffnung deutlich, die sie mit ihrer Anfrage an das KZI verbanden: „Da ich mich schon seit längerer Zeit in größter seelischer Not betr. meiner Ehe befinde u ich mich hier […] allein ohne irgendwelche Hilfe befinde, wende ich mich vertrauensvoll an Sie, bezw. an Ihr Institut. Alle Versuche, unsere sehr schwer gefährdete Ehe mit irgendeinem Objektiven oder Arzt zu besprechen blieben bislang erfolglos.“⁵⁹⁶ Die Erwartungen der Ratsuchenden an Korte waren somit hoch. Er stellte für sie häufig die scheinbar letzte Möglichkeit dar, ihre Situation zu klären. Sie forderten von ihm als höherer Instanz medizinische, psychologische, theologische, finanzielle, juristische oder soziale Ratschläge. Korte verwies des Öfteren auf weitere qualifizierte Stellen oder machte deutlich, dass er sich mit Experten be-
Vgl. z. B. KZI an A. B., 25. März 1954, AEK, DBK, KZI 422. KZI an R. F., 12. April 1955, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. KZI an M. K., Brief, 2. Juni 1955, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. z. B. Sekretärin an [Bernhard] Korte, Aktennotiz, 20. Mai 1955, AEK, DBK, KZI 422.Vgl. T. F. an [Bernhard] Korte, Brief, 4. Februar 1958, SEK, DBK, KZI 422. Vgl. Vikar […] an [Bernhard] Korte, 6. August 1958, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. KZI an [P.] K., Brief, 31. März 1954, AEK, DBK, KZI 422. E. G. an [Bernhard] Korte, Brief, 17. August 1959, AEK, DBK, KZI 422 sowie Bernhard Korte an E. G., Brief, 26. August 1959, AEK, DBK, KZI 422. Korte, Bernhard: Jahresbericht 1953, S. 5. ADCV, R 565, Fasz. 01. A. B. an KZI, Brief, 23. März 1954, AEK, DBK, KZI 422. G. G. an [Bernhard Korte], Brief, 18. September 1957, AEK, DBK, KZI 422. F. J. an Bernh[ard] Korte, Brief, 31. August 1955, AEK, DBK, KZI 422.
346
4 Katholische Eheberatung
ratschlage. Einerseits traten die Briefeschreiber als aktiv Handelnde auf, indem sie das KZI kontaktierten und sich mit ihrer Situation auseinandersetzten. Ihre Erwartungshaltung, dass eine übergeordnete Autorität ihnen eine Lösung präsentierte, widersprach aber gleichzeitig diesem Ideal des selbstverantwortlichen Ratsuchenden, das auch das KZI vertrat.⁵⁹⁷ Viele Briefe waren thematisch Einzelerscheinungen: eine Anfrage zur Übernahme medizinischer Kosten,⁵⁹⁸ die Erkundigung, wie Informationen über einen im Ausland Lebenden eingeholt werden konnten,⁵⁹⁹ die Wiederaufnahme beziehungsweise der Eintritt eines konvertierten Ehepaares in die katholische Kirche,⁶⁰⁰ das Vorgehen bei einer Schwangerschaftspsychose⁶⁰¹ oder die Anfrage, wie ein Vermisster für tot erklärt werden konnte⁶⁰², sowie die Vermittlung eines „katholischen Psychotherapeuten, der in Eheproblemen nicht nur ‚Fälle‘ erblickt, sondern sie als Christ und Mensch sieht und zu lösen sucht“.⁶⁰³ Trotz der Vielfalt der Beratungsfälle sind wiederkehrende Themenbereiche auszumachen, die Ratsuchende beschäftigten, vor allem „Mischehen“, kirchenrechtliche Verfahren, Sexualität sowie Verwandtschaftsbeziehungen. Besonders „Mischehen“ sowie kirchenrechtliche Verfahren waren für die katholische Eheberatung typische Beratungsanlässe, auch mit ihren religiösen Dimensionen. Allgemein zu konstatieren sind hier Grenzen der Beratung. Kortes vom Beginn der 1960er-Jahre stammende Aussage, in der Eheberatung seien hauptsächlich Probleme in Verbindung mit Untreue, Leere in der Ehe, Potenzstörungen, konfessionellen „Mischehen“, wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Eifersucht und Konflikten mit den Kindern zu sehen, stimmt somit nur teilweise mit den Briefwechseln überein.⁶⁰⁴ 4.5.1.1 „Mischehe“ Bei Mischehen erwiesen sich vor allem die formalen kirchenrechtlichen Konsequenzen für viele Gläubige als belastend. Die Anfragen, die das KZI zu diesem Thema erreichten, hatten meist den Hintergrund, dass eine interkonfessionelle Heirat geplant war. Für die Betroffenen war die kirchenrechtliche Situation zum
Vgl. Kapitel 4.3.1 Vorstellungen von Ehe. Vgl. KZI, Aktennotiz, 9. September 1955, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. Mädchenheimstatt St. Irmgardis an KZI, Brief, 1. September 1955, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. E[…] H[…] an KZI, Brief, [Februar 1956], AEK, DBK, KZI 422. Vgl. Hanna Wiese an Bernhard Korte, Brief, 16. November 1961, AEK, Archiv der DBK, KZI 296. Vgl. Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen an H. L., Brief, 18. Juli 1954, AEK, DBK, KZI 422. U. K. an Bernhard Korte, Brief, 7. Januar 1958, AEK, DBK, KZI 422. Zu Kortes Aussage s. Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 365.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
347
Teil undurchschaubar. Mit eigentlichen Eheproblemen zwischen den Partnern hatte dies zunächst nichts zu tun, sie spielten in den Briefen keine Rolle. Auffällig ist, dass weder die Ratsuchenden noch Korte je von „Mischehen“ sprachen, obwohl es sich dabei um einen feststehenden Begriff handelte, den Theologen und Eheberaterinnen regelmäßig benutzten. Bekannte Beraterinnen benannten die „Mischehe“ klar als schwerwiegende Problematik.⁶⁰⁵ Eine Ratsuchende schilderte, sie habe sich einmal zivilrechtlich trauen und scheiden sowie einmal evangelisch trauen lassen, „ohne die richtige Vorstellung über die Unmöglichkeit meines Verhaltens (hinsichtlich meines Glaubens und der Kirche zu haben)“.⁶⁰⁶ Nachdem sie sich erneut hatte scheiden lassen, lernte sie einen Mann kennen, der ein gläubiger, pflichtbewusster Katholik sei und kirchlich heiraten wolle. Sie selbst bezeichnete sich als gläubige Katholikin. Als sie von ihrem Bekannten gefragt wurde, ob sie kirchlich getraut worden sei, verneinte sie dies. Die evangelisch geschlossene Ehe erwähnte sie nicht. Die Ratsuchende bat Korte darum, ihr „ausführlichst mit[zuteilen], in was für einer Lage ich mich befinde und wie ich hoffen darf, wenn diese schwierig sein sollte, durch all meine Schilderungen, mir Rat zu geben wie ich mein privates Leben so klar wie möglich weiter leben kann“. Da sie selbst unehelich sei, ihre Eltern verschiedenen Konfessionen angehörten und sich ihr Vater gerade selbst in einem Scheidungsprozess befinde, bat sie darum, das Verhältnis aller Beteiligten „zur Kirche klar darzulegen. Würde mich freuen bald eine Antwort zu erhalten und danke Ihnen schon jetzt für Ihr großes Bemühen in meinem [sic] Durcheinander ein wenig Licht zu bringen.“ Kirchenrechtlich ist die Situation eindeutig: Die Schreiberin war nicht katholisch verheiratet gewesen und durfte kirchlich heiraten.⁶⁰⁷ Dies konnte Korte ihr jedoch nicht mitteilen, da der Brief anonym eingegangen war. Die Ratsuchende schrieb zwar, für alle Beteiligten klare Verhältnisse schaffen zu wollen. Gleichzeitig verschwieg sie ihrem Verlobten jedoch ihre zweite Eheschließung und schien ihm diese auch nicht offenlegen zu wollen. Ihr ging es somit um rein formale, kirchenrechtliche Fragen. Sie betonte zweimal, dem neuen Mann in ihrem Leben nur von einer ihrer beiden Trauungen und Scheidungen berichtet zu haben. Abgesehen von diesem Widerspruch hätte ihr
Auch Paul Adenauer lag die Thematik der „Mischehe“ sowie der Geburtenregelung besonders am Herzen. Er wollte die Lebensnähe der Kirche verbessern, da er Christen zunehmend aus ihr ausgegrenzt sah. Adenauer betrachtete die entsprechenden gesellschaftlichen Veränderungen als unaufhaltsam und forderte eine Auseinandersetzung damit. Daher befasste er sich mit Empfängnisverhütung aus theologischer Sicht. Vgl. Küsters, Adenauer, 2017, S. 67. C. an KZI, Brief, 19. Juni 1956, AEK, DBK, KZI 422. Im Folgenden ebd. Vgl. Gespräch mit Prof. Dr. Andreas Weiß, Professur für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, persönliche Kommunikation, 15. November 2019.
348
4 Katholische Eheberatung
das Verschweigen der evangelischen Ehe auch bei einer katholischen Trauung eventuell als Täuschung ausgelegt werden können.⁶⁰⁸ Bemerkenswert ist, dass die konfessionellen und kirchenrechtlichen Verhältnisse für die Ratsuchende so lange kein Problem darstellten, bis sie aus einer konkreten Situation heraus zu einer Klärung genötigt wurde. Dass sich aus einer interkonfessionellen Ehe für den katholischen Ehepartner negative Konsequenzen ergaben, überraschte manchen Betroffenen. Ein Protestant schilderte 1956, dass er seit fast einem Jahr mit einer Katholikin verlobt sei. Vor Kurzem habe seine Braut erfahren, dass sie im Falle einer evangelischen Trauung exkommuniziert werde. Der Verlobte fragte, ob dies zutreffe. Er könne sich „nicht vorstellen, daß von einer christlichen Kirche derartige Maßnahmen ergriffen werden“. In seiner eigenen Familie bestünden mehrere interkonfessionelle Ehen, keine sei auf Schwierigkeiten gestoßen. Er bat um Auskunft, was die Interkonfessionalität für eine Trauung bedeute, und fragte, ob bei einer evangelischen Taufe etwaiger Kinder die katholische Mutter Schwierigkeiten seitens der katholischen Kirche zu erwarten habe. Dem Briefschreiber ging es dabei in erster Linie um Gewissensentscheidungen. „Da ich in Glaubensdingen sehr tolerant bin, bitte ich Sie zu verstehen, daß ich vor der Eheschließung einen Weg suche, der mein Gewissen befriedigt, aber auch das meiner Braut nicht in Konflikte bringt.“ Diese Haltung war ungewöhnlich. In der Regel hatten Nachfragen zur „Mischehe“ einen formalrechtlichen und keinen moralischen Hintergrund. Zudem verdeutlichte der Schreiber, dass es in seiner Umgebung möglich war, in einer interkonfessionellen Ehe zu leben, ohne über damit zusammenhängende Schwierigkeiten auch nur informiert zu sein. Die feststehende Bezeichnung „Mischehe“ war ihm kein Begriff, er nannte sie „kath.-evangel. Ehen“.⁶⁰⁹ Andere Ratsuchende kannten zwar nicht die genauen Konsequenzen, wussten jedoch grundsätzlich um bestehende Vorschriften und stellten dazu entsprechende Fragen.⁶¹⁰ Korte gab die kirchenrechtlich zutreffende Antwort, dass Katholiken, die sich evangelisch trauen ließen, exkommuniziert würden. Damit waren die Gläubigen allerdings nicht von ihren Pflichten dispensiert, wie beispielsweise an Sonnund Feiertagen die heilige Messe zu feiern.⁶¹¹ Somit waren sie zwar nicht generell aus der Kirche, jedoch von den Sakramenten ausgeschlossen. Die Regelung bestand bis 1966. Ob sie für die Betroffenen innere Konflikte mit sich brachte, lässt sich nicht
Vgl. ebd. H. B. an KZI, Brief, 26. September 1956, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. W. C. an KZI, Brief, 03. Februar 1959, AEK, DBK, KZI 422. F. B. an KZI, Brief, 02. Februar 1959, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. Bernhard Korte an F. B., Brief, 12. Mai 1959, AEK, DBK, KZI 422.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
349
generell sagen. Zumindest in einem Fall führte dies jedoch so weit, dass der Ratsuchende sich scheiden lassen wollte, um den negativen Auswirkungen des Kirchenrechts zu begegnen, da „er um jeden Preis mit der Kirche ausgesöhnt sein“⁶¹² wolle. Trotz der wachsenden Zahl der „Mischehen“ wird die Macht der kirchenrechtlichen Konsequenzen sehr anschaulich. In einem anderen Fall war eine verheiratete Frau „aus streng-katholischer Familie“ dagegen bereit, die aus einer Scheidung folgenden kirchenrechtlichen und sozialen Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Sie hatte „den Sohn eines prot. Diakons kennen gelernt, von dem sie erste [sic], wie sie selbst sagt, die ‚richtige Liebe‘ kennen gelernt hat und ist nun bereit über diese Liebe trotz ihrer katholischen Erziehung nicht nur ihre Ehe zu opfern, sondern sogar ihren kath. Glauben. Wie ist hier zu helfen?“⁶¹³ Für die Eheberaterin M. Lioba war die Aussicht darauf, dass die Ratsuchende ihren katholischen Glauben aufgab, schlimmer als die Konsequenzen einer Scheidung. Sie besprach sich mit einem weiteren Fachmann, um die Scheidung womöglich noch abwenden zu können. 4.5.1.2 Kirchenrechtliche Verfahren Diejenigen Briefeschreiber, die sich an das KZI wandten, gaben sich manchmal nicht als die eigentlichen Ratsuchenden zu erkennen. Korte erhielt 1953 das Schreiben eines Mannes, der bei seiner ersten Anfrage vorgab, Auskünfte für einen Freund einzuholen.⁶¹⁴ Später gestand er ein, selbst der Ratsuchende zu sein. Er hatte mit Erfolg im bischöflichen Offizialat geklagt, um die Nichtigkeit seiner Ehe feststellen zu lassen. Seine Ehefrau plante zudem, eine säkulare Aufhebungsklage einzureichen, da er impotent sei. Laut Kirchenrecht sind darunter Störungen zu verstehen, die den Vollzug der Ehe ausschließen. Nun interessierte den Fragenden, ob es medizinisch möglich sei, seine Impotenz zweifelsfrei zu diagnostizieren. Bei Nichtgelingen hätte der Antrag auf eine Annullierung in eine Dispensklage umgewandelt werden müssen. Dieser päpstliche Gnadenakt stellte aber keinen Rechtsweg dar und war daher noch schwerer zu erreichen. Um seine Situation zu erläutern, beschrieb der akademisch gebildete Angestellte auf Latein detailliert die kirchenrechtlichen Richtlinien und verglich sie mit seiner konkreten Situation, um zu schließen, die Virginität seiner Frau und damit auch seine Impotenz seien unbestritten. Als das Paar nach mehreren Jahren Ehe der Familie von seinem Trennungswunsch berichtete, rieten einige Verwandte der Frau, in ein Kloster zu gehen.
Vgl. im Folgenden [Josepha] Fischer-Erling an [Robert] Grosche, Brief, 21. November 1957, AEK, Nachlass Grosche, Nr. 1545. M. Lioba an Rucker, Brief, 9. November 1962, AEK, DBK, KZI 29. Vgl. im Folgenden J. F. an Bernhard Korte, Brief, 25. April 1953, AEK, DBK, KZI 422.
350
4 Katholische Eheberatung
Der Mann zitierte dazu einen Brief, den seine Frau an seine Mutter geschrieben hatte, als diese sie drängte, bei ihm zu bleiben. Die Ehefrau beschrieb ihre Ehe darin als von Beginn an unglücklich. Der Mann selbst schilderte die Beziehung als inzwischen völlig zerrüttet und berichtete von den psychischen Auswirkungen seiner Impotenz, schweren Minderwertigkeitsgefühlen und tiefgehenden Erschütterungen seines seelischen Gleichgewichts. Diese wirkten sich nach seiner Einschätzung auch negativ auf sein berufliches Fortkommen aus. Der Fall sticht aus den Briefwechseln heraus, da der Ratsuchende Rechtsschritte bereits selbst angestoßen hatte, seine Lage psychologisch reflektierte und ausführlich auf die Perspektive seiner Ehefrau einging; ebenso aufgrund der Sicherheit, mit welcher der Schreiber anhand des Kirchenrechts sowie medizinischer Fachliteratur seine Situation erläuterte. Korte schlug vor, das Ehepaar solle ihn gemeinsam aufsuchen, um sich zu besprechen.⁶¹⁵ Er wollte die beiden somit über einen kirchenrechtlichen Rat hinaus unterstützen. Was die Feststellung der Impotenz anging, konferierte er mit dem Vorstand des Erzbischöflichen Ehegerichtes. Im Anschluss riet er dazu, das Verfahren in eine Dispensklage umzustellen, da es für einen katholischen Mann und einen katholischen Arzt keine Möglichkeit gebe, eine Impotenz medizinisch exakt festzustellen. Dies verwundert, da nach Kirchenrecht eigentlich gute Aussichten auf eine Feststellung der Nichtigkeit bestanden hätten.⁶¹⁶ Auch Niedermeyer als Pastoralmediziner hielt Impotenz medizinisch für schnell feststellbar, wenn auch für eine schwierige Frage im kanonischen Eheprozess, da hohe Anforderungen an den Nachweis der Impotenz gestellt würden.⁶¹⁷ Aufgrund von Niedermeyers Bekanntheitsgrad ist damit zu rechnen, dass Korte dessen Publikationen gut kannte. Kirchenrechtliche Verfahren konnten sich über einen langen Zeitraum ziehen. Einer der Briefwechsel zwischen einem Ratsuchenden und Korte umfasste beispielsweise einen Zeitraum von gut zwei Jahren. Bevor der Schreiber mit Korte Kontakt aufnahm, hatte der Mann bereits seit zwei Jahren versucht, kirchenrechtlich eine Ehenichtigkeit in seinem Sinne durchzusetzen.⁶¹⁸ Im Verlauf des Briefwechsels wurde der Ratsuchende immer verzweifelter. Er schrieb von Herzbeschwerden, die seine Energie lähmten. „Offenbar macht sich nun der Kampf bemerkbar und die Unruhe seit vielen Jahren. Sollen wir alles aufgeben? Ich weiß
Bernhard Korte an J. F., Brief, 20. Mai 1953, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. Gespräch mit Prof. Dr. Andreas Weiß, Professur für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, persönliche Kommunikation, 15. November 2019. Diese Einschätzung beruht auf der Annahme der Beweisbarkeit des Nichtigkeitssachverhaltes. Vgl. Niedermeyer, Handbuch, 1952, S. 423. Vgl. auch ders., Wahn, 1956, S. 465 f. Vgl. W. G. an [Bernhard] Korte, Brief, 8. Oktober 1958, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. Facharzt für Nerven- und Gemütsleiden an [Bernhard] Korte, Brief, 21. Oktober 1959, AEK, DBK, KZI 422.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
351
nicht mehr den Mut aufzubringen und den Schwung.“⁶¹⁹ Hier wird die Belastung, die sich für die Betroffenen aus ihrer ungeklärten Lebenssituation ergab, deutlich. Dabei sprachen die Ratsuchenden dem Leiter des KZI mehr Geduld und ein größeres Verständnis der Situation zu als Vertretern der Kirche. „Den Hochw. Herr Bischöfl. Kaplan […], habe ich gestern im Auftrage des Hochw. Herrn Bischof meine Sorgen vorgetragen. Auch dieser kann mir nicht helfen. Solche Hochw. Herren haben mit solchen speziellen Problemen auch keine Erfahrungen und vor allen Dingen hat niemand Zeit.“⁶²⁰ Nicht nur in diesem Fall entsteht der Eindruck, dass mit der kirchenrechtlichen Klärung viele Problematiken hätten grundsätzlich gelöst werden können. Sowohl die Nachfragen als auch die Beratungen konzentrierten sich meist auf das Kirchenrecht. Dass auch die seelischen Belastungen im Sinne einer Lebenshilfe oder Seelsorge begleitet werden sollten, spielte in der Korrespondenz keine Rolle. Dies mag daran gelegen haben, dass das KZI nicht als Eheberatungsstelle vorgesehen war. In der Regel handelte es sich lediglich um kurze briefliche Kontakte oder einzelne Gespräche. Hätten die Ratsuchenden erweiterte Betreuung gewünscht, hätten sie allerdings auch regelmäßiger an weitere qualifizierte Beratungseinrichtungen verwiesen werden können. Eheberaterinnen waren durchaus auch an einer längeren Unterstützung interessiert, um etwa Scheidungen und deren Konsequenzen für die Betroffenen erträglicher zu machen. Die Leiterin der zum KDFB gehörenden Katholischen Eheberatungsstelle Kölns, Josepha Fischer-Erling, forderte im Falle einer Scheidung weitere christliche Begleitung.⁶²¹ Grundlage ihrer Arbeit war ein personales Eheverständnis. Obwohl sie generell gegen Scheidung anging, akzeptierte sie eine solche als in manchen Fällen nicht vermeidbare Entscheidung, mit der es bestmöglich umzugehen galt.⁶²² Dies war mit der katholischen Ehelehre zum Teil nur schwer vereinbar. Fischer-Erlings Arbeit erntete durchaus auch Kritik. Der geistliche Beirat des KDFB Augustinus Frotz suchte ihre Arbeit zu unterbinden, was ihm jedoch nicht gelang. Zwar war Fischer-Erlings Sicht eine sehr persönliche, doch hatte sie als gefragte Expertin einen wichtigen Einfluss auf die Arbeit anderer Beraterinnen.⁶²³
W. G. an Bernhard Korte, Brief, 10. Mai 1960, AEK, DBK, KZI 422. W. G. an [Bernhard] Korte, Brief, 8. Oktober 1958, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. im Folgenden Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 136 ff. Vgl. Fischer-Erling, Eheberatung, 1956. Auch der Konflikt um die Besetzung der Eheberatungsstelle in Heidelberg zeigt, dass katholische Eheberaterinnen von anderen in Hinblick auf ihre katholischen Überzeugungen durchaus kritisch betrachtet wurden. Vgl. Elisabeth Dold an [Josepha] Fischer-Erling, Brief, 27. Februar 1953, AEK, Archiv DBK, KZI 385.
352
4 Katholische Eheberatung
Im Jahr 1957 beschäftigte sich Fischer-Erling mit dem Fall eines Polizeibeamten, der überlegte, sich wegen der negativen Auswirkungen des Kirchenrechts scheiden zu lassen.⁶²⁴ Er war in erster Ehe katholisch verheiratet gewesen und geschieden. Die zweite Ehe wurde evangelisch getraut, der aus dieser Ehe stammende Sohn war ebenso getauft. Der Mann hatte sich in eine andere Stadt versetzen lassen, wo ihn seine zweite Frau manchmal besuchte. Er „leidet nach seinen Angaben sehr darunter, exkommuniziert zu sein. Er sagt, daß er jeden Sonntag – sofern es der Dienst zuläßt – am Gottesdienst teilnimmt und daß er um jeden Preis mit der Kirche ausgesöhnt sein möchte, und daß dieser Gesichtspunkt allein entscheidend sein solle, ob er zu seiner Frau zurückkehre oder nicht.“⁶²⁵ In den Augen der Kirche bestand die katholische Ehe fort, da sie nicht kirchenrechtlich aufgehoben, sondern zivilrechtlich geschieden worden war. Die kirchenrechtliche Konsequenz daraus war die Ungültigkeit seiner zweiten Ehe, wodurch der Beamte zwar nicht aus der Kirche, aber vom Empfang der Sakramente ausgeschlossen wurde, da seine Lebensverhältnisse im Widerspruch zu den kirchenrechtlichen Geboten standen.⁶²⁶ Um seine Situation zu ändern, hätte er sich von seiner zweiten Frau scheiden lassen müssen.⁶²⁷ Ob es so weit kam, lässt sich nicht nachvollziehen. Der Mann schien jedoch dazu bereit. Die Schilderung der Eheberaterin lässt nicht erkennen, wie sie selbst die Situation beurteilte. Sie vermittelte dem Ehemann jedoch ein Gespräch mit einem Vertreter der höheren Kirchenhierarchie. Da der Fall in den Beratungsakten des KZI abgelegt ist, scheint Fischer-Erling dazu in Kontakt mit Korte gewesen zu sein. Als interessant erweist sich ein Beratungsfall von 1955, da der Ratsuchende seine Eheprobleme durch eine rein formale, kirchenrechtliche Klärung zu lösen suchte, während Korte diese rechtlichen Aspekte explizit außer Acht lassen wollte. Der Ratsuchende schilderte, dass in seiner Ehe ein Meinungsstreit darüber ent-
Vgl. im Folgenden [Josepha] Fischer-Erling an [Robert] Grosche, Brief, 21. November 1957, AEK, Nachlass Grosche, Nr. 1545. Ebd. Vgl. Fleckenstein, Ehe, 2008, S. 525. Die kirchliche Rechtsordnung missbilligt die Wiederheirat Geschiedener. Allerdings wird die kirchenrechtlich ungültige Ehe nur durch die leibliche Vereinigung zu einem Dauerzustand der schweren Sünde. Mit dem Ausschluss an der Teilnahme der Sakramente wird daher eine sogenannte Besserungsstrafe ausgesprochen, welche die Grenzen des tolerierten Verhaltens aufzeigen und zur Beachtung der Ordnung anhalten soll. Besserungsstrafen werden bei Änderung des Verhaltens aufgehoben (c 2356, c 855). Vgl. Lüdicke, Klaus: „Kirchenstrafen“. In: Baumgartner, Konrad et al. (Hrsg.): Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 6. Freiburg 2017, Sp. 68 – 69. Vgl. Gespräch mit Prof. Dr. Andreas Weiß, Professur für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, persönliche Kommunikation, 15. November 2019.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
353
standen sei, ob es zur religiösen Erziehung seiner Kinder vorgeschrieben sei, ein Kruzifix mit einem gequälten Christuskörper aufzuhängen. Bisher hatte das Ehepaar ein glattes Holzkreuz und mehrere religiöse Bilder in der Wohnung. Der Mann verbot seiner Frau ein Kruzifix, als sie sich dieses wünschte, in erster Linie, da die Ehefrau in seinen Augen „zahlreiche […] Ehepflichten nicht erfüllt hat“ und auch „die ehelichen Pflichten [verweigert], um mich dadurch zu erpressen, das Kruzifix zu gestatten. Dieser Weg scheint inzwischen rechtswidrig zu sein.“ Die Ehefrau reichte eine Scheidungsklage ein, was der Mann einzig auf seine Haltung zurückführte, gegen das Kruzifix zu sein. Seine Widerklage lautete auf Verweigerung der ehelichen Pflichten. Nun bat er Korte darum, ihm Bibelstellen, Kirchengebote oder einen päpstlichen Erlass zu nennen, die vorschrieben, ein Kruzifix zur Kindererziehung aufzuhängen. In diesem Falle würde er nachgeben. Darüber hinaus wollte er wissen, ob Bibelstellen oder Kirchengebote Eheleuten bestimmte Verhaltensrichtlinien vorgaben. „Halten Sie das Verhalten meiner Frau und ihren Erpressungsversuch, der jetzt die Ehe und das Wohl der Kinder gefährdet, vom katholischen, vom Menschlichen [sic] und rechtlichen Standpunkt aus für richtig? Oder ist die Verweigerung meiner Ehefrau nicht gerade absolut unkatholisch?“ Der Ehemann wies darauf hin, dass es ihm bereits einmal mit Hilfe eines Pfarrers gelungen sei, „meine Frau von einem falschen Wege abzubringen“.⁶²⁸ Der Bericht des Mannes über seine Ehe war ganz von seiner Sicht geprägt, die Frau kam lediglich als störender, sich verweigernder Faktor vor. An der Frage zu Kirchengeboten und Richtlinien wird deutlich, dass der Schreiber seine Ehekrise als ein Rechtsproblem verstand. Wie bei vergangenen Schwierigkeiten, die er über den Pfarrer hatte lösen können, suchte er Hilfe von außen. Sein vertragsorientiertes Eheverständnis bewegte sich dabei durchaus im Rahmen des Kirchenrechts. Im Falle einer kirchenrechtlichen Scheidungsklage der Ehefrau dürfte diese keine Aussicht auf Erfolg gehabt haben.⁶²⁹ Korte aber versuchte in diesem Fall, das Rechtliche zu umschiffen, und beantwortete die Anfrage vor allem im Sinne eines personalen Eheideals. Nachdem er erläutert hatte, dass es keine Vorschriften gebe, aus Erziehungszwecken ein Kruzifix aufzuhängen, schrieb er: „Was das Verhalten Ihrer Frau und ihren ‚Erpressungsversuch‘ betrifft, so kann ich dazu nichts Abschließendes sagen. Nicht selten ist das Verhalten der Frau die Antwort auf das vorherige Benehmen des Mannes. Es gibt sehr wenige Frauen, welche mit Abneigung gegen ihren Mann erfüllt sind, wenn zuvor der Mann sich gegenüber der Frau wahrhaft christlich verhalten hat.“ Korte bemühte sich, den Blick des Mannes auf O. M. an KZI, Brief, 2. Juni 1955, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. Gespräch mit Prof. Dr. Andreas Weiß, Professur für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, persönliche Kommunikation, 15. November 2019.
354
4 Katholische Eheberatung
seine Ehefrau zu ändern. Er nannte Bibelstellen als Vorbilder dafür, wie Eheleute sich zueinander verhalten sollten. Insbesondere machte er den Ehemann auf Matthäus 5,23 – 24 aufmerksam, einen Text, der von Versöhnung handelt. Korte schloss: „Im christlichen Leben wird das Recht nicht etwa für nichtig gehalten, aber es wird von der rechten Liebe überhöht. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß Sie sehr stark in einem einseitigen Rechtsdenken befangen sind, was sehr oft auf Kosten der liebenden Begegnung geht.“⁶³⁰ In einem Fall, den die Eheberaterin Anna Wörle an Korte herantrug, ging es um Gewalt in der Ehe. Die Ehefrau gab 1957 an, ihr Mann habe sie unter Hypnose zur Ehe gezwungen. Wörle hielt sie für glaubwürdig und setzte sich für sie ein. „Sie hat glaubhafte Zeugen dafür, daß der Mann die Fähigkeit besitzt zu hypnotisieren und diese auch angewandt hat. […] Der Mann hat die Gattin und die Kinder, sowie seine eigene Mutter, die mit dem Ehepaar zusammen wohnte, häufig körperlich mißhandelt. Hierüber liegen ärztliche Zeugnisse vor.“ Erst einige Monate, nachdem sie sich getrennt hatte, sprach die Frau über ihre traumatischen Erfahrungen. Sie bemühte sich um eine Scheidung sowie das Sorgerecht und den Unterhalt für ihre zwei Kinder. Für den Scheidungsprozess erhielt sie allerdings kein Armenrecht, mit der „Begründung: Die Frau hat sich nach einer schweren körperl. Mißhandlung, die sie als Scheidungsgrund anführen wollte, wieder unter Zwang dem Manne hingegeben. Der Rechtsanwalt will nun weiter nichts mehr unternehmen […]. Dafür lebt sie in ständiger Angst vor dem Manne, der auch schon versucht hat, sie unter einem Vorwand wieder zurückzuholen.“⁶³¹ Der zuständige Pfarrer hatte den Fall bereits an das kirchliche Ehegericht weitergeleitet.Wie ein Professor der theologischen Hochschule bestätigte, waren die Erfolgsaussichten gut. Da die Frau jedoch keine neue Heirat beabsichtigte, galt ihr Fall als nicht dringlich. Die Eheberaterin versuchte deshalb zusammen mit Korte, doch noch einen zivilgerichtlichen Scheidungsprozess zu ermöglichen. Die Frau war wieder berufstätig und konnte sich nun einen Prozess auf eigene Kosten leisten. Ein fachwissenschaftliches Gutachten über die vorliegende Hypnose sollte die Frau unterstützen. Auch Korte äußerte Mitgefühl. Es „muß festgehalten werden, daß nicht jede eheliche Hingabe ein umfassendes Verzeihen alles dessen, was vorher geschehen ist, bedeutet. Ich habe vor einiger Zeit noch gelesen, daß eine gerichtliche Entscheidung einer unter Zwang vor sich gegangenen ehelichen Hingabe den Charakter des totalen Verzeihens nicht zugesprochen hat.“⁶³²
Bernhard Korte an O. M., Brief, 5. August 1955, AEK, DBK, KZI 422. A[nna] Wörle an Bernhard Korte, Brief, 2. Februar 1957, AEK, DBK, KZI 29. [Bernhard] Korte an Anna Wöhrle, Brief, 18. Februar 1957, AEK, DBK, KZI 29.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
355
Die Schwierigkeit bestand im Nachweis einer unter Zwang beziehungsweise Hypnose erfolgten Ehe. Da Geschlechtsverkehr unter Verheirateten immer als einvernehmlich und eheerhaltend galt, erschwerte die nach heutigem Verständnis vorliegende Vergewaltigung der Frau somit den Trennungsprozess. Jedoch war die Misshandlung offenbar so gravierend, dass auch unter den damaligen rechtlichen Verhältnissen sowohl Korte als auch die Eheberaterin keine positive Wertung des Geschlechtsverkehrs gelten lassen wollten. Die Frau plante daher in einem Scheidungsprozess, „die erzwungene Hingabe mit physischer Angst zu erklären.“⁶³³ Der vorliegende Fall wirft ein Licht auf die damalige zivil- und kirchenrechtliche Praxis. Auffällig ist, dass die Ratsuchende lediglich von katholischer Seite Unterstützung erfuhr. Psychotherapeutisch ausgebildete Nervenärzte sollten die Glaubwürdigkeit der Frau wissenschaftlich untermauern, während auch die theologische Expertise bemüht wurde. Korte und die Eheberaterin hatten keine Schwierigkeiten, beides miteinander zu verbinden und situationsabhängig für die Ratsuchende nutzbar zu machen. 4.5.1.3 Sexualität Ehekrisen, die aus sexuellen Problemen entstanden, waren nur selten Gegenstand der Briefwechsel mit dem KZI. Dies steht deutlich im Gegensatz zu Albert Niedermeyers pastoralmedizinischen Ausführungen. Niedermeyer berichtete aus seiner eigenen Beratungspraxis vor allem von sexuellen Problemen.⁶³⁴ Ihm zufolge machten Potenz- und Empfindungsstörungen einen erheblichen Anteil der Fälle aus. Er verwies dabei insbesondere auf Schwierigkeiten wegen sexueller Unerfahrenheit sowie Klagen über weibliche Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und Frigidität. Zusätzliche Schwierigkeiten entstünden durch voreheliche Bindungen sowie eine falsche Eheauffassung, was Niedermeyer in erster Linie auf Frauen bezog.⁶³⁵ Als Lösung verwies er auf die Techniken eines erfüllten Sexuallebens nach Theodoor van de Velde,⁶³⁶ einem niederländischen Gynäkologen.⁶³⁷ Letztlich be-
Anna Wörle an [Bernhard] Korte, Brief, 28. Februar 1957, AEK, DBK, KZI 29. Vgl. im Folgenden Niedermeyer, Handbuch, 1952, S. 423 ff. Zur Auffassung katholischer Autoren bezüglich vorehelicher Sexualität und Lust von Frauen vgl. Herzog, Politisierung, 2005, S. 99 ff. Theodoor Hendrik van de Velde (12. 2.1873 – 27.4.1937) war Direktor des Gynäkologischen Instituts in Haarlem (Niederlande). Sein 1926 erschienenes Buch Die vollkommene Ehe tritt für Wissen um Sexualität sowie Erotik ein. Das Aufklärungsbuch machte ihn international bekannt. Die katholische Kirche setzte die Bücher van de Veldes 1931 auf den „Index librorum prohibitorum“, obwohl der Autor selbst sie als mit katholischer Moral vereinbar betrachtete. Vgl. Melching, Willem: „Theodoor Hendrik van de Velde“. In: Sigusch, Volkmar/ Grau Günter (Hrsg.): Personenlexikon der Sexualforschung. Frankfurt am Main 2009, S. 717– 720.
356
4 Katholische Eheberatung
trachtete der Mediziner jedoch nicht erotische Techniken als relevant, sondern „den Frauen zur richtigen Einstellung zur Ehe und ihren Pflichten und zum Manne zu helfen. Denn das ist das Entscheidende, daß die Frau die Ehe und die eheliche Pflicht, und vor allem den Mann willig und freudig bejaht.“⁶³⁸ Damit führte Niedermeyer zufolge der Weg der Ehefrau zu einem positiven sexuellen Empfinden über ihre Unterordnung. Sie solle ihre mütterliche Rolle bejahen, womit er auf die Erfüllung des katholischen Frauenideals zielte. Niedermeyer suchte Eheprobleme vor allem über die Bearbeitung der Frau zu lösen; ebenso die Beraterin Anna Beckmann, womit beide der allgemeinen gesellschaftlichen Tendenz dieser Zeit folgten.⁶³⁹ In den Briefen, die Bernhard Korte im KZI erreichten, war im Zusammenhang mit Sexualität Untreue das größte Thema. Sie wurde eher als männliches Phänomen begriffen.⁶⁴⁰ Die beiden Briefe, in denen diejenige zweier Frauen behandelt wurden, führten zur Scheidung, die Fälle männlicher Seitensprünge offenbar nicht. In einem Beispiel ging die Ehefrau während der Kriegsgefangenschaft ihres Mannes ein Verhältnis ein. Sie wollte sich von ihrem neuen Partner auch später nicht mehr trennen. Es kam zur Scheidung.⁶⁴¹ Im zweiten Fall hatte eine Frau nach kurzer Ehe einen anderen Mann und bei diesem die „richtige Liebe“⁶⁴² kennengelernt. Beide Frauen entschieden sich zur Trennung, um mit dem neuen Mann an ihrer Seite leben zu können. Nur im zweiten Beispiel ist die Reaktion der Eheberaterin ersichtlich, die versuchte, die Scheidung abzuwenden. Sie war in Sorge, dass die Frau ihre Ehe und ihren katholischen Glauben opfere. Einmal wandte sich die Beraterin Rose Ophey an Korte, da sie unsicher war, wie sie einen Fall beurteilen sollte: Es ging um das Verhältnis eines älteren, verheira-
Auch wenn Niedermeyer gewisse Aspekte von van de Veldes Buch als problematisch betrachtete, hatte er doch mit dem Gynäkologen zum Thema soziale Eheprobleme zusammengearbeitet.Vgl. Niedermeyer, Wahn, 1956, S. 178 f. Zu Sexualität in der Ehe aus katholischer Sicht vgl. auch Wirtz, Hans: Vom Eros zur Ehe. Die naturgetreue Lebensgemeinschaft. Heidelberg 1946. Wirtz’ Publikation hatte die apostolische Druckerlaubnis und war auch bereits im „Dritten Reich“ erschienen. Als der populärste zeitgenössische katholische Eheratgeber erschien er bis 1966. Zu Wirtz’ Eheratgeber vgl. Herzog, Politisierung, 2005, S. 99 und S. 350, Fn. 68 sowie Eckardt, Konkurrenz, 2013, S. 81, S. 92 f. Niedermeyer, Handbuch, 1952, S. 426. Vgl. Kapitel 3.6.3.5 Heimkehrerehen. Untreue des Mannes war auch in der nichtkonfessionellen Beratungsarbeit mit 21 Prozent ein häufiger Beratungsanlass, Untreue der Frau nur zu 3,1 Prozent.Vgl. [Fischer, J.], Erfahrungen, 1953/54, ADE, JF 31. [Josepha] Fischer-Erling an [Robert] Grosche, Brief, 21. November 1957, AEK, Nachlaß Grosche, Nr. 1545. M. Lioba an Rucker, Brief, 9. November 1962, AEK, DBK, KZI 29.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
357
teten Mannes mit einer jüngeren Frau.⁶⁴³ Die Ehefrau leide darunter, während er sich im Recht sehe. Korte erwiderte, sie solle die zuständige Eheberatung vor Ort einschalten. Zur Untreue der Männer über dem 50. Lebensjahr stellte er grundsätzlich fest, diese habe verschiedene Ursachen, bei denen sicherlich biologische Momente mitspielten. „Meistens jedoch liegt eine seelische Haltlosigkeit vor; der Mann ist in seinem bisherigen Leben noch nicht in den rechten Stand gekommen.“⁶⁴⁴ Korte schloss, dass eine Arbeitstagung sich diesem Thema widmen solle. Im folgenden Beispiel wurde einer Dritten die Schuld an den Eheproblemen eines Paares zugewiesen. Die Eheberaterin Helena Kujawa erklärte, dieses habe „seit ungefähr 3 Jahren ein Ehezerwürfnis dadurch, daß sich eine mehr als gerissene, beinahe satanische Frau dazwischen gedrängt hatte“. Als der Ehemann schwer erkrankte, blieb seine Frau dennoch bei ihm. Sie habe „auch in der Not den Mann nicht verlassen und ihn sehr betreut, was dazu geführt hat, daß sich Herr […] wieder bekehrte und zu den Sakramenten gegangen ist“. Er gebe sich alle Mühe, standhaft zu bleiben. Das sei nicht leicht, „da das betreffende Weib, anders kann ich sie nicht nennen, dauernd das Haus der Familie [..] umschwärmt und dem Mann die glühendsten Liebesbriefe schreibt“. Der Betreffende sei sonst kein „schlechter Mann“. Die Eheberaterin der Caritas bat den Verband darum, der Familie einen Erholungsaufenthalt in einer anderen Gegend zu ermöglichen. „Sie müssen einmal von hier weg, dem Mann muß man helfen, daß ihm die guten Vorsätze nicht zu schwer gemacht werden.“ Mit der Frau habe sie „Jahre hindurch gekämpft um den Erhalt der Familie. Jetzt, wo wir durch das sichtbare Eingreifen Gottes die Verwirklichung beinahe fest haben, wäre es unbedingt nötig, daß sie zu Ihnen kommen könnten. […] [S]onst wäre es nicht ausgeschlossen, daß die ganze Familie vor die Hunde ging.“⁶⁴⁵ Der Mann erschien als willenloses Opfer weiblicher Verführung. Um das befürchtete Unglück abzuwenden, suchte die Eheberaterin mit dem Ferienvorschlag eine externe Lösung. Hier wird ein deutlich anderes Bild gezeichnet als in Kortes Antwort im zuvor dargelegten Fall, bei dem er grundsätzlich formuliert hatte, bei einer Untreue der Männer liege meist eine seelische Haltlosigkeit vor.⁶⁴⁶ Die betrogenen Ehefrauen blieben bei ihren Männern. Sie wurden als unglücklich, aber tendenziell tapfer beschrieben. Um männliche Seitensprünge und deren Ursachen ging es auch bei einer weiteren Ratsuchenden, die Korte ihr Herz in einem Schreiben ausschüttete. Die Frau war der Überzeugung, ihr Ehemann betrüge sie, auch wenn er dies leugne. „Mein Mann streitet ja nun alles ab, aber eine Frau merkt doch was los ist.“ Sichtlich
Vgl. im Folgenden [Rose Ophey] an [Bernhard] Korte, Brief, 13. Juli 1955, AEK, DBK, KZI 297. [Bernhard Korte] an Rose Ophey, Brief, 14. Juli 1955, AEK, DBK, KZI 297. Helena Kujawa an Hasenbrink, Brief Kopie, 3. Juli 1957, AEK, DBK, KZI 422. S. [Bernhard Korte] an Rose Ophey, Brief, 14. Juli 1955, AEK, DBK, KZI 297.
358
4 Katholische Eheberatung
aufgebracht formulierte die offenbar ungeübte Schreiberin ihre Beobachtungen, die sie vor allem auf eine hohe Anzahl weiblichen Personals in der Berufsarbeit bezog. Entsprechend argumentierte sie indirekt gegen die Erwerbstätigkeit von Frauen. Zwar gab sie eine gewisse Eigenverantwortlichkeit der Ehemänner zu: „Die ganze Sache liegt ja am persönlichen Karakter.“ Allerdings schien sie allgemein Männern bzw. ihrem Mann nicht viel zuzutrauen. Korte gegenüber klagte sie über die Konsequenzen der Untreue für ihre Ehe und die fehlende Aufmerksamkeit ihres Mannes. „Eine Frau freut sich wenn der Mann nach hause [sic] kommt und was muß manche Frau hören? ‚ Ich bin müde, ich habe Kopfschmerzen oder anders. Haben nun die Kollegen einen Weg, oder dieselbe Bahnfahrt, dann merkt der Mann nichts von seinen Beschwerden, nur wenn er zu Hause ist.“⁶⁴⁷ Sexualität fand in den untersuchten Briefen lediglich als Problem Erwähnung. Die Ursache dafür ist teilweise auch in der Ausgangssituation zu suchen – Eheberatung wurde genutzt, sofern Leidensdruck entstand. Aus dem vorliegenden Material könnte der Eindruck entstehen, dass Ratsuchende Sexualität im Einklang mit dem Kirchenrecht vor allem funktional betrachteten. Die zuvor besprochenen Fälle, in denen es um Ehenichtigkeit und die Vorenthaltung ehelicher Pflichten ging, sind dazu passende Beispiele.⁶⁴⁸ Jedoch ist quellenkritisch zu vermuten, dass Ratsuchende eher Aspekte und Fragen formulierten, die mit der Sicht der Amtskirche übereinstimmten. Möglicherweise wandten sie sich mit anderen, die Sexualität betreffenden Problemen oder Fragen an nichtkonfessionelle Beratungsstellen. Dass Sexualität für die Ratsuchenden über einen rein funktionalen Geschlechtsverkehr hinausgehen konnte, wird nur in Nebensätzen angedeutet. Die beiden Männer, die sich wegen ihres Ehenichtigkeitsverfahrens an das Zentralinstitut wandten, versuchten, ihre Frauen manuell zu befriedigen. Ein Betroffener erwähnte dies im Zusammenhang mit der in Frage stehenden Jungfräulichkeit der Ehefrau: „In der Depression, unter der natürlich auch meine Frau gelitten hat, und weil ich trotz ärztlicher Behandlung nicht verkehren konnte, habe ich dann mit der Hand und Finger an ihren Organen gespielt. Unter keinen Umständen habe ich im Verkehr die Haut der Unschuld zerstört.“⁶⁴⁹ Im anderen Fall deutete der Briefeschreiber an, dass er manuelle Befriedigung als Möglichkeit sah, seiner Frau Lust zu verschaffen, was diese jedoch nicht wollte: „Ich sage das nicht, weil ich die Ehe aus übertriebener Frömmigkeit heraus ablehne sondern, weil ich den unnatürlichen Vollzug der Ehe ablehne.“ Das Paar hatte versucht, sich auf diesem Weg und durch Potenzmittel eine gemeinsame Sexualität zu erarbeiten. Hier wird der starke Ein-
B. R. an B[ernhard] Korte, Brief, 25. April 1955, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. Kapitel 4.5.1.2 Kirchenrechtliche Verfahren. W. G. an Rechtsanwalt […], Kopie Brief, 24. Januar 1960, AEK, DBK, KZI 422.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
359
fluss offenbar, den der Glaube auf die sexuellen Möglichkeiten eines Paares haben konnte. Der Mann zitierte einen Brief, den seine Frau an seine Mutter geschrieben hatte, als diese sie drängte, bei ihm zu bleiben. Darin schilderte seine Ehefrau deutlich ihre fehlende sexuelle Befriedigung. Sie habe „als Frau noch nie eine eheliche Befriedigung erfahren […]. Daher kann eine spürbare sinnliche Liebe, wie sie aus dem normalen Verkehr zwischen Mann und Frau erwächst, bei uns nicht erwartet werden. […] Wegen des körperlichen Versagens […] geht es nur als Bruder und Schwester. Auf dieser Grundlage bin ich jederzeit bereit, bei […] zu bleiben.“⁶⁵⁰ Als das KZI einen Brief mit der Frage erhielt, was gegen die Angst, Geschlechtsverkehr sei Sünde, zu tun sei, riet Korte in Übereinstimmung mit der Linie des Zentralinstituts zur psychologischen Behandlung.⁶⁵¹ Ein Vikar hatte sich im Namen eines Ehepaares aus seiner Gemeinde an ihn gewandt. Die Frau „leidet an einer durch falsche Erziehung begründeten Fehleinstellung zu allem Geschlechtlichen und zur Ehe und einer unüberwindlichen Sündenangst, der mit aller Belehrung nicht beizukommen“ sei. Die Frau sehe verstandesmäßig ihr falsches Urteil wohl ein, aber aus dem „Unterbewußtsein steigt doch immer wieder die Angst auf und führt zu einer solchen Verkrampfung, daß sie zu jedem natürlichen ehelichen Verkehr unfähig wird“.⁶⁵² Wo die Sündenangst der Frau herrührte, wird aus den Briefen nicht ersichtlich. Sie hatte bereits zwei Kinder. Auch Niedermeyer berichtete in seinem Handbuch der Pastoralmedizin über häufige Klagen über Dyspareunie⁶⁵³ und Frigidität der Frau. Besonders oft beschwere der Mann sich nach der Geburt von Kindern, „daß die Frau ihm gegenüber ‚erkaltet‘ sei […]; die Frauen hingegen klagen, daß der Mann nicht mehr imstande sei, sie erotisch zu erwärmen […] und der eheliche Verkehr werde ihr immer mehr zur Last und zum Abscheu“. Dies sei ernstzunehmen: „Der Mann darf nicht egoistisch nur an die eigene Befriedigung denken, sondern muß auch vor allem die der Frau zu erwecken suchen. Das ist heute fast ein Gemeinplatz geworden.“⁶⁵⁴ Der Eheberater führte die Ursachen der weiblichen Unlust auf Geburtenverhütung und „Perversitäten der verschiedensten Art“, welche die Männer einforderten, zurück. „Die Männer müssen begreifen lernen, wie weit die Schuld an dieser vermeintlichen Frigidität an ihnen selbst liegt. Die Frauen müssen begreifen lernen, daß es von ihnen selbst sehr unklug ist und einen merkwürdigen Mangel an weiblichem Instinkt verrät, wenn sie sich dem Manne entziehen und damit wo-
J. F. an Bernhard Korte, Brief, 25. April 1953, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. [Bernhard] Korte an Vikar F., Brief, 17. Januar 1956, AEK, DBK, KZI 422. Vikar T. an [Bernhard] Korte, Brief, 10. Januar 1956, AEK, DBK, KZI 422. Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Niedermeyer, Handbuch, 1952, S. 424.
360
4 Katholische Eheberatung
möglich beitragen, in ihm polygame Neigungen zu wecken.“⁶⁵⁵ Die Lösung sah Niedermeyer auch hier in der Rückbesinnung auf weibliche Ideale der Hingabe. „Die Frau herrscht durch Dienen und durch Opfer, die sie in Liebe bringt, und ihre Stellung ist umso königlicher, je mehr sie dies vermag und Liebe nicht nur gewährt, sondern sie dabei ‚auf ihre Rechnung kommt‘.“⁶⁵⁶ Hier wird durch Unterordnung sogar sexuelle Erfüllung in Aussicht gestellt. Auffällig ist, dass sich das zuvor erwähnte Ehepaar mit seinem Sexualproblem an den Vikar wandte. In der Eheberatung selbst waren Theologen nicht vorgesehen. Beraterinnen sollten entweder selbst verheiratet sein oder verwitwet. Vermutlich spielte eine Rolle, dass sie als Verheiratete über sexuelle Erfahrungen verfügten, auch wenn dies nicht explizit zur Sprache kam. Im vorliegenden Fall versuchte der Vikar zuerst selbst, die Frau positiv zu beeinflussen, und wandte sich danach an die Eheberatungsstelle der Caritas. Diese verwies ihn wiederum an Korte. Erneut zeigte sich, dass ungewöhnliche Fälle auf Anraten von Eheberaterinnen an den Leiter des KZI herangetragen wurden. Dass Pfarreien für einige Gläubige die erste Anlaufstelle waren, wenn sie Fragen oder Sorgen hatten, geht aus mehreren Schreiben hervor, in denen indirekte Bemerkungen über ein Gespräch mit dem Pfarrer fielen. Auch schrieben verschiedene kirchliche Amtsträger in Vertretung ihrer Pfarrangehörigen an das Zentralinstitut.⁶⁵⁷ Auffallend ist, dass keine Anfragen zur Geburtenregelung zu finden sind, obwohl die Beratenden angaben, diese Fragen würden in der Praxis immer wieder diskutiert.⁶⁵⁸ Auch Korte nannte die Geburtenregelung zu Beginn der 1960er-Jahre als zentrales Thema.⁶⁵⁹ Ebenso wenig kam Homosexualität zur Sprache, weder in den Briefwechseln noch im Zusammenhang mit der Auflistung von Beratungsthemen, die Eheberaterinnen verfassten.⁶⁶⁰
Ebd., S. 425. Ebd., S. 425. Vgl. O. M. an KZI, Brief, 2. Juni 1955, AEK, DBK, KZI 422. Brief aus einer „Pfarre“: E. H. an Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen, Brief, [Februar 1956], AEK, DBK, KZI 422. Schw[ester] K. an Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen, Brief, 21. April 1956, AEK, DBK, KZI 422. Vikar F. an [Bernhard] Korte, Brief, 6. August 1959, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. Kapitel 4.1.2 Eheideal und Eherecht und Kapitel 4.3.4.2 Jahreskurse sowie Jost/Zelazny, Jahre, [1988], S. 75 f. Vgl. Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 365. Lediglich ein Fachartikel von Käthe Zelazny bezeichnete eine Frau im Zusammenhang mit ihrer Scheidung als „primitive Lesbierin“. Die Eheberaterin stellte dies in den Zusammenhang mit einer Neurose, was den zeitgenössischen Ansichten zu weiblicher Homosexualität entsprach. Der Hinweis auf die homosexuelle Neigung der Ratsuchenden stand inmitten einer Schilderung von Scheidungsfällen, in denen sämtlichen involvierten Frauen negative Eigenschaften zugeordnet wurden. Vor allem beurteilte Zelazny diese als „unreif“ (auch dies eine zeitgenössisch häufig genutzte Be-
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
361
4.5.1.4 Verwandtschaftsbeziehungen In einigen Briefwechseln finden sich Hinweise auf Konflikte, die Ratsuchende nicht als Ursache ihrer Eheprobleme nannten, sondern eher nebenbei erwähnten. Das waren vor allem „Störeinwirkungen der Schwiegermutter“⁶⁶¹ beziehungsweise der Schwiegereltern.⁶⁶² Anna Beckmann warnte in ihrem katholischen Eheratgeber besonders vor der Einmischung der Schwiegermütter.⁶⁶³ Hier findet sich ein von der erfahrenen Eheberaterin genanntes Problem in der Praxis wieder. Angehörige mischten sich in bestehende, aber auch in noch zu schließende Ehen ein. Eine Mutter schrieb etwa an Bernhard Korte und bat ihn um einen ärztlichen Rat. Es ging um die Partnerin ihres Sohnes. Diese sei ein sehr häusliches, „religiös gut fundiertes“ und auch „berufstätiges Mädchen“, dem wegen einer Erkrankung aber ein Unterschenkel fehle. „Nun fragt sich mein Sohn, ist es ratsam das Mädchen zu heiraten? Können noch einmal Komplikationen eintreten? Wird sie den Anforderungen, die ein Haushalt mit sich bringt, gewachsen sein?“ Man stelle sich die „bange Frage: Kann man es ihr zumuten, eine Ehe zu leben mit allem, was dazu gehört. – Schwer ist die Entscheidung.“⁶⁶⁴ Wie auch in anderen Fällen wurde die (potenzielle) Braut als „Mädchen“ bezeichnet, obwohl sie bereits einige Jahre berufstätig war.⁶⁶⁵ Die Nachfrage, ob sie zur Ehe geeignet sei, offenbarte die klaren Vorstellungen, die mit einer Heirat einhergingen. Die Ratsuchende setzte voraus, dass die Frau im Falle einer Heirat ihre Berufstätigkeit aufgab und sich Haushalt sowie Kindern widmete. Da die Schreiberin selbst Ehefrau und Mutter war, kannte sie die damit verbundene Arbeitsbelastung und Erschöpfung. Das Rollenbild der künftigen Ehefrau war klar umrissen, ihre Unterstützung durch den Mann offenbar nicht vorgesehen.
schreibung weiblicher Homosexualität) und „oberflächlich“. Zelazny, Käthe: „Möglichkeiten und Grenzen der Beratung bei Trennungskrisen“. In: Soziale Arbeit: Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete 12 (1963), H. 2, S. 59 – 67, DZI. Zur Sicht auf weibliche Homosexualität vgl. Plötz, Kirsten: „‚Echte‘ Frauenleben? ‚Lesbierinnen‘ im Spiegel öffentlicher Äußerungen in den Anfängen der Bundesrepublik“. In: Fachverband Homosexualität und Geschichte (Hrsg.): Invertito. Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten (1) 1999, S. 47– 69. C. an Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen, Brief, 19. Juni 1956, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. auch J. F. an Bernhard Korte, Brief, 25. April 1953, AEK, DBK, KZI 422 sowie W. G. an Rechtsanwalt […], Kopie Brief, 24. Januar 1960, AEK, DBK, KZI 422. [Josepha] Fischer-Erling an [Robert] Grosche, Brief, 21. November 1957, AEK, Nachlass Grosche, Nr. 1545. Vgl. Beckmann, Ehe, 1948. W. B. an Bernhard Korte, Brief, 29. Januar 1956, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. KZI an Mädchenheimstatt St. Irmgardis, Brief, 2. September 1955, AEK, DBK, KZI 422. H. B. an KZI, Brief, 26. September 1956, AEK, DBK, KZI 422. M. Lioba an [Eugen] Rucker, Brief, 9. November 1962, AEK, DBK, KZI 29.
362
4 Katholische Eheberatung
Die Mutter stellte sich im vorliegenden Fall die Frage, ob die potenzielle Heiratskandidatin dieser Aufgabe gewachsen sei. Eine Klärung sollte von außen kommen, die Entscheidung wollte sie selbst oder ihr Sohn treffen, die Kandidatin wurde nicht gefragt. Korte befürwortete die Überlegungen. „Es ist gut, daß Ihr Sohn und Sie sich Gedanken über den Zustand des Mädchens und dessen Leistungsfähigkeit in der Ehe machen.“ Er schlug ein fachärztliches Gesundheitszeugnis vor. „Wenn daraus hervorgeht, daß keine tuberkulösen Herde mehr vorhanden sind, dann steht einer Ehe eigentlich nichts mehr im Wege, vorausgesetzt natürlich, daß Ihr Sohn und dieses Mädchen reif zur Ehe sind, sich genügend kennen und einander lieben.“⁶⁶⁶ Korte interessierte sich für den Ausgang des Falles und bat um Rückmeldung. Dass Dritte es für notwendig hielten, eine Leistungsfähigkeit in der Ehe zu bewerten, erinnert an die eugenischen Gesundheitszeugnisse.⁶⁶⁷ Positive Eugenik fand nach der Zeit des Nationalsozialismus auch weiterhin Zustimmung im Kontext katholischer Eheberatung. Entsprechend äußerte sich beispielsweise Niedermeyer in seinem Werk zur Pastoralmedizin zu eugenischer Heiratsberatung, Ehe- und Erbgesundheit.⁶⁶⁸ Doch spielte die Eugenik weder beim verbandlichen Führungspersonal eine Rolle, noch wurde sie in der Praxis explizit weitergeführt, auch wenn verschiedene Akteure dies bedauerten.⁶⁶⁹ In der Beratung einer Frau, die einen ghanaischen Studenten zum Freund hatte und sich den Anfeindungen ihrer Verwandten ausgesetzt sah, wurden Vorstellungen von „Rasse“ deutlich: „Meine Angehörigen sind […] energisch dagegen, nur weil er eine schwarze Hautfarbe hat und Ausländer ist.“ Die Ratsuchende war Waise und lebte in einem Mädchenheim. Als ihre Patentante erfuhr, dass sie einen afrikanischen Freund hatte, schrieb sie ihr einen Brief. Darin beschimpfte sie die junge Frau als „Negerdirne“. „In der ganzen Sippe […] wirst Du wohl die niederträchtigste
Bernhard Korte an W. B., Brief, 2. Februar 1956, AEK, DBK, KZI 422. Sie erinnert auch an Carl Coerpers Vorstellungen Vgl. Kapitel 3.2.4.2 Carl Coerper. Vgl. Niedermeyer, Handbuch, 1952, S. 402 ff. Zur eugenischen Bewertung vermerkte Niedermeyer allerdings, dass dabei auch immer die Gesamtpersönlichkeit des Ratsuchenden gewürdigt werden müsse. Starke geistige und willensmäßige Kompensation könnten körperliche Unzulänglichkeiten ausgleichen. Es sei wünschenswert, diese im Erbgut festgeschriebenen positiven Werte weiterzuvererben. In diesem Sinne hatte er laut eigener Aussage auch während der Zeit des Nationalsozialismus beraten, wofür er konkrete Beispiele nannte. Dabei war er sich bewusst, dass seine Auffassung in Gegensatz zur damals praktizierten „Rassenhygiene“ stand. Als bedenklich bezeichnete Niedermeyer Eugenik, sobald sie von der katholischen Lehre abwich, denn diese könne auch ein Heilmittel für kranke Erbanlagen sein: „Selbst Menschen mit schwerer Belastung durch krankhafte Erbanlagen können mit Hilfe der [göttlichen] Gnade die niederziehenden dunklen Mächte ihres Blutes, ihres Erbgefüges, weitgehend überwinden.“ Niedermeyer, Wahn, 1956, S. 200. So ließe sich auch im vorliegenden Fall argumentieren. Vgl. Kapitel 4.1.3 Umgang.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
363
Person sein. Wie kann man sich bloß so vergessen und an einen Neger hängen! […] Hast Du denn deinen Verstand verloren? Und schämst Du dich vor gar niemand. Wenn Du kein Herz mehr im Leibe hast so geh doch mit ihm nach Afrika in den Urwald, dort kann er Dich erschlagen, mehr bist Du ja gar nicht wert.“ Sie drohte ihr, sie in ein Arbeitshaus zu bringen, wenn sie sich nicht trenne. Antworte sie nicht auf den Brief ihrer Patentante, würde sie an ihre Heimleiterin schreiben.⁶⁷⁰ Daraufhin bat die junge Frau Korte um seinen Rat. Dieser bezeichnete die Haltung ihrer Verwandten als unsympathisch. Er antwortete, er habe lange über ihre Frage nachgedacht und könne sich „sehr wohl vorstellen, daß Sie den jungen schwarzen Studenten lieben. Aber zwischen lieben und heiraten besteht doch ein großer Unterschied.“⁶⁷¹ Er riet der Frau sehr von einer Heirat ab. Gerade an dieser Stelle wird deutlich, dass Korte im Gegensatz auch zu seinen eigenen Idealvorstellungen von Beratung als wechselseitigem, offenen Prozess eher dazu neigte, unmissverständlich Rat zu erteilen.⁶⁷² Er entsprach damit dem Bild des Eheberaters aus der Weimarer Republik.⁶⁷³ Korte vermutete, die Frau werde im Falle einer Heirat nach Ghana ziehen. Zwar ging er davon aus, dass es sich bei dem Freund der Ratsuchenden um einen Christen handelte und er es daher mit der Ehe entsprechend ernst meine. Er fragte sie dennoch, ob sie die in Ghana herrschenden Sitten und Gebräuche in Hinblick auf das Ehe- und Familienleben kenne. Der Leiter des KZI gab zu bedenken, dass keine Ehe frei von Schwierigkeiten und Konflikten sei. Glauben Sie die Kraft zu besitzen, darüber hinaus noch viele ertragen zu können? […] Sie dürfen nicht übersehen, daß Kinder von Eltern, die sehr unterschiedlichen Rassen angehören, innerlich oft zerrissen sind. Das Erbgut, das die Eltern mitbringen, ist in wichtigen Punkten doch sehr verschieden. Ich spreche gar nicht von einer Wertigkeit. Wer könnte sich anmaßen, von einer höheren Wertigkeit der weißen Rasse zu sprechen?!⁶⁷⁴
Korte empfahl, mit einer Eheberaterin vor Ort zu sprechen, nannte der Briefeschreiberin eine entsprechende Adresse und sagte, sie solle sich auf ihn berufen. Auch lud er sie ins KZI ein. Obwohl er in seinen Augen offenbar kein Werturteil abgab, stellte er einen Rassenunterschied fest, der gemeinsamen Kindern schaden könne. Zwar nannte er kulturelle Prägungen als möglichen Konfliktstoff, führte mögliche Identitätsschwierigkeiten letztlich aber auf das Erbgut zurück. Sein eugenisch geprägtes Denken, das er nicht als Rassismus verstanden wissen wollte,
W. E. an [Bernhard] Korte, Brief, 9. Oktober 1958, AEK, DBK, KZI 422. Die Schreiberin hatte sich zuerst an Bundeskanzler Konrad Adenauer gewandt, der ihr die Adresse des KZI gab. Bernhard Korte an W. E., Brief, 6. Februar 1959, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. Kapitel 4.3.1 Vorstellungen von Ehe. Vgl. Kapitel 1.2 Kirchliche Beratungsstellen. Bernhard Korte an W. E., Brief, 6. Februar 1959, AEK, DBK, KZI 422.
364
4 Katholische Eheberatung
erinnert an Niedermeyer. Der Pastoralmediziner überlegte 1952, dass es zu diesem Zeitpunkt möglich sei, zur „Rassenreinheit“ objektiv Stellung zu nehmen. Wie Korte betonte er, keine menschliche Rasse könne als minderwertig bezeichnet werden. Doch auch wenn man die Gleichwertigkeit aller grundsätzlich anerkenne, könne sich die Eheberatung „der Tatsache weitgehender Verschiedenartigkeit zwischen menschlichen Rassen nicht verschließen“. Niedermeyer stellte sich die Frage, ob diese Verschiedenartigkeit erbbiologisch oder durch soziale, kulturelle und religiössittliche Beziehungen bedingt sei. Letztlich spielte die Antwort für ihn jedoch keine Rolle, da er die erbbiologischen Unterschiede für erheblich genug hielt, um zu konstatieren: Die Rassen in diesem Sinne stellen nun einmal natürliche Ordnungen dar und sind daher zu respektieren […]. Nicht Überheblichkeit, Rassenhochmut oder gar Rassenhaß darf die Eheberatung leiten, wenn sie von Rassenmischehen („biologischen“ Mischehen) bei erheblichen Rassenunterschieden zu warnen für ihre Pflicht hält, sondern eine alle Menschen mit gleicher Liebe umfassende tiefere Erkenntnis darf hier allein leitend sein. ⁶⁷⁵
Diese Prämisse galt für Niedermeyer auch aufgrund der schweren Belastungsproben, denen eine solche Ehe ausgesetzt sei.⁶⁷⁶ Ebenso wie Korte wies er auf die Gefahren für die Nachkommen hin, die mit ihrer Herkunft einen größeren inneren Reichtum gewönnen, aber auch innerlich zerrissen seien. Hier zog er eine Parallele zur „Mischehe“, die er ebenfalls ablehnte, weil die Partner seelisch und weltanschaulich nicht übereinstimmten. Eine ähnliche Rückmeldung erhielt die Ratsuchende offenbar von einem weiteren Eheberater.⁶⁷⁷ Dort finden sich eindeutige rassenhygienische Vorstellungen in der katholischen Beratung.⁶⁷⁸ Zur Frage der Erbanlagen schrieb der Berater außerdem, dass affektive Einstellungen oft den Blick der Beteiligten für wichtige Voraussetzungen einer Ehe trübten: „Die körperliche und geistige Gesundheit einschließlich der Erbgesundheit, d. h. des Freiseins von schweren erblichen Belastungen ist aber ein entscheidender Faktor für den biologischen, sozialen und sittlichen Wert der Ehe; nicht der einzige, nicht der höchste, aber auf jeden Fall der grundlegende Faktor.“⁶⁷⁹ Auch die Kindererziehung war ein Streitpunkt zwischen Ehepaaren. In den geschilderten Fällen war aber nicht das Verhalten der Kinder Auslöser für Konflikte. Eine Mutter formulierte dies explizit: „Unser 16 jähriger Sohn ist der Streitpunkt in
S. im Folgenden Niedermeyer, Handbuch, 1952, S. 403. S. Niedermeyer, Wahn, 1956, S. 217 f. Vgl. W. E. an [Bernhard] Korte, Brief, 18. Februar 1959, AEK, DBK, KZI 422. In Bezug auf Niedermeyers ähnliche Ausführungen zu „Rasse“ während des „Dritten Reiches“ schließt Richter, Niedermeyer stelle sich „damit erstmals auf den Boden der NS-Rassenideologie, wenn auch unter anderen Prämissen“. Richter, Katholizismus, 2001, S. 135 f. Niedermeyer, Handbuch, 1952, S. 384.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
365
unserer Ehe geworden, schuldlos, das möchte ich dazu bemerken. Er steht ganz auf meiner Seite weil er sieht wie mein Mann mit mir umgeht. Ich bin gezwungen den Jungen in ein Internat zu tun […]. Der Junge ist nicht länger gewillt mitanzusehen wie mein Mann mich so grundlos quält.“⁶⁸⁰ Streit entzündete sich an verschiedenen Erziehungsvorstellungen oder dem Verhalten der Eltern gegenüber ihren Kindern. Die Betroffenen berichteten von schweren Ehekrisen. Die Auseinandersetzung über die Frage, „ob zur religiösen Kindererziehung das Aufhängen eines Kruzifixes (mit dem gequälten Christuskörper) vorgeschrieben ist“,⁶⁸¹ führte sogar zu einer Scheidungsklage. Finanzielle Abhängigkeit wirkte sich negativ auf Ehen und das Familienleben aus. Deutlich wird dies bei der nächsten Ratsuchenden, die über die Veränderung ihres Mannes seit der Nachkriegszeit berichtete. So schwer die Zeit u. Not war, es war unsere glücklichste Zeit. Er war der idealste Gatte u.Vater. Als das Geld dann seinen Wert bekam, verlor er sich immer mehr u. Geld bedeutete ihm mehr als das Leben seiner Kinder, die er so sehr liebte. Als er das letzte Mal zuhause war, […] führte [er] sich sehr schlecht auf. Die Kinder fragten schon, ob er denn noch nicht bald wegfährt […]. Er ist der uneingeschrenkten [sic] Vergnügungssucht verfallen u. ich muß für die Kinder allein sorgen.⁶⁸²
Die Situation zeigt, wie abhängig Frauen von ihren Männern waren. Darauf zielte auch die Beobachtung einer Eheberaterin ab, die erklärte, spät geschlossene Ehen seien schwierig zu beraten, da die Frauen selbstständiger seien: „Ich meine hier solche Ehen, die berufstätige, ältere Frauen eingehen, die schon sehr selbständig im Beruf waren, viel verdienten und sich ungemein schwer an die neue Lebensform einer Ehefrau gewöhnen und oft über große Schwierigkeiten klagen. Von ‚Torschlußpanik‘ wird in solchen Fällen gesprochen. Was ist zu tun, wenn die Beziehungsfähigkeit fehlt?“⁶⁸³ Die Frauen erlebten ihre Situation vor der Heirat als großen Kontrast zur Ehe. Die Beraterin schloss daraus auf einen Mangel an Beziehungsfähigkeit. Die Teilnehmerin einer von Korte geleiteten Tagung wollte wissen, ob eine kinderlose Ehe sinnhaft sei. Da sie im Brief auch auf einen weiteren Kurs Bezug nahm, handelte es sich womöglich um eine künftige Eheberaterin.⁶⁸⁴ Korte erwiderte, er sehe den Sinn des Lebens in der Liebe. Diese könne verschiedene Formen haben, wie die Liebe zu Gott oder die Liebe zu den Menschen, denen man im Leben
E. G. an [Bernhard] Korte, Brief, 17. August 1959, AEK, DBK, KZI 422. O. M. an KZI, Brief, 2. Juni 1955, AEK, DBK, KZI 422. M. K. an KZI, 22. Mai 1955, AEK, DBK, KZI 422. M. Lioba an [Eugen] Rucker, Brief, 9. November 1962, AEK, DBK, KZI 29. Vgl. M. M. an Bernhard Korte, Brief, [1959], AEK, DBK, KZI 422.
366
4 Katholische Eheberatung
begegne. „Ein ganz vorzügliches ‚Mittel‘ zum Lieben ist die Ehe, die in ihrem Wesen sicherlich auf das Kind ‚angelegt‘ ist. Aber nicht das Kind als Kind bringt die letzte Erfüllung, sondern das Leben aus dem Liebesgehorsam gegen Gott!“ Dies bedeute, wenn Gott der Schreiberin „das Leid der Kinderlosigkeit zugedacht hat, dann liegt die Erfüllung Ihres Daseins in der Annahme dieses Faktums! Dann ist Ihre Ehe sinnerfüllt!“⁶⁸⁵ Kortes Perspektive entsprach dem katholischen Eheideal, das auch einem übergeordneten geistlichen Ziel mit der Hinführung zu Gott diente. Dies schrieb auch Niedermeyer in seinem Werk zur Pastoralmedizin, der darauf hinwies, der Berater müsse eine Ehe immer als Gemeinschaft beider Gatten sehen. Auch bei Kinderlosigkeit und Unfruchtbarkeit müsse die Ehe als Gemeinschaft nach besten Kräften aufrechterhalten werden. Den Eheleuten sei daher zu vermitteln, dass ihre Ehe als solche ihren Eigenwert behalte und geistig fruchtbar werden könne. Dies sei der Unterschied zwischen einer vitalbiologischen und einer universalistischen Eheberatung, wie er sie im Sinne der katholischen Kirche vertrat.⁶⁸⁶
4.5.2 Grenzen der Beratung Den Eheberaterinnen, die mit den Anliegen Ratsuchender konfrontiert waren, fiel es oft schwer, die Lehrmeinung der Kirche mit den konkreten Fragen oder dem Sexualverhalten der Ratsuchenden in Einklang zu bringen. Auf einer Tagung des Verbandes Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater kam 1967 zur Sprache, dass sich „die katholischen Eheberater, die sich gleichermaßen sowohl der Lehre der Kirche als auch der Not der Ratsuchenden verpflichtet fühlen, dadurch in einem schweren Gewissenskonflikt“⁶⁸⁷ befänden.⁶⁸⁸ Dies soll im Folgenden ein Beispiel verdeutlichen. Eheberaterinnen sollten idealerweise verheiratet oder verwitwet sein, oft hatten sie Kinder. Dies entsprach sowohl den Vorstellungen in der Laienarbeit als auch denen des KZI. Dass es Ausnahmen gab, wird am Beispiel von Pfarrschwester⁶⁸⁹ M. Lioba ersichtlich, die als Ordensfrau in einer katholischen Gemeinde tätig
Bernhard Korte an M. M., Brief, 6. Februar 1959, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. Niedermeyer, Handbuch, 1952, S. 428 ff. Jost/Zelazny, Jahre, [1988], S. 75. Zum Spannungsfeld zwischen Lehramt und Beratung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil vgl. Adenauer, Theologe, 1981, S. 172. So wurden bis Ende der 1960er-Jahre Ordensschwestern bezeichnet, die in Gemeinden als Seelsorgehelferinnen tätig waren. Sie arbeiteten in damals neuen Bereichen wie dem Pfarrbüro
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
367
war.⁶⁹⁰ 1962 war sie bereits mehrere Jahre auch in der Eheberatung aktiv und hatte an entsprechenden Schulungskursen teilgenommen, in denen sie für ihre Arbeit in der Seelsorgehilfe „viel gewonnen“ habe. Im Vorfeld eines Kurses schilderte sie ihrem Ansprechpartner in der Katholischen Aktion Schwierigkeiten, die ihr in der Seelsorge immer wieder begegneten. Diese wolle sie gerne im Kurs besprechen, da sie zu Grundsatzerwägungen führten. Es handele sich vor allem um die Frühehe, die ihrer Erfahrung nach häufig nicht von langer Dauer sei.⁶⁹¹ „Ein Teil der jungen Ehepartner läßt sich kirchlich trauen, vielleicht aus religiöser Haltung, vielleicht auch nur deshalb, weil es eben so der Brauch ist und weil die katholischen Angehörigen darauf drängen. Ein großer Teil unterläßt die kirchliche Trauung.“ Komme es zu einer Scheidung, könnten katholisch Getraute nie mehr kirchlich heiraten und hätten folglich ihr ganzes Leben an den Folgen ihrer frühen Eheschließung zu leiden.⁶⁹² Lioba bedauerte, dass dagegen standesamtlich getraute und anschließend geschiedene Personen eine kirchliche Ehe eingehen konnten. Ihre Ausführungen machten die Diskrepanz zwischen dem kirchenrechtlichen Anspruch und der Praxis deutlich, der sich die Beraterinnen zum Teil gegenübersahen. Waren sie kirchlich verheiratet gewesen, litten Ratsuchende nach einer Scheidung an den Auswirkungen des Kirchenrechts auf ihr weiteres Leben. Diejenigen, die sich hingegen zuerst nicht hatten kirchlich trauen lassen, konnten nach einer Scheidung ohne Schwierigkeiten katholisch getraut werden. Da sie bei ihrer ersten Ehe nicht dem katholischen Eherecht gefolgt waren, blieben ihnen für ihr weiteres Leben alle Möglichkeiten offen. Auch für die Pfarrschwester führte dies zu Schwierigkeiten in der Beratung. „Soll man überhaupt noch zu einer kirchlichen Ehe raten und drängen, wenn man von vorneherein fürchten muß, daß die Ehe nicht auf Dauer ist? Wie soll man sich verhalten gegenüber solchen Leuten, die in 1. Ehe Schiffbruch gelitten haben, kirchlich gebunden sind, und nun ein ganzes Leben daran büßen?“⁶⁹³ Das Kirchenrecht und der Wunsch der Eheberaterin, den bei ihr Ratsuchenden zu helfen, klafften hier deutlich auseinander. Lioba hatte den starken Eindruck, dass die Gläubigen wegen ihrer Entscheidung, sich kirchlich trauen zu oder bei Hausbesuchen in enger Zusammenarbeit mit dem Pfarrer. Vgl. Schiefer, Elisabeth: „Seelsorgehelferin, Seelsorgehelfer“. In: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 9. Freiburg 2000, Sp. 390. Eine weitere Pfarrschwester als Eheberaterin wird 1957 für Straubing genannt.Vgl. [Katholische Aktion]: Bericht über die Arbeit der Katholischen Aktion in Stadt und Diözese Regensburg für das 1. Halbjahr 1957, [1957], AEK, DBK, KZI 29. Außerdem sind Pfarrhelferinnen als Teilnehmerinnen eines Kurses für Eheberatung in der Diözese Regensburg dokumentiert. Vgl. KZI: Kursus für Eheberatung in Regensburg, Aktennotiz, 20. April 1955, AEK, DBK, KZI 29. Zu Frühehen vgl. auch KZI: Frühehe in Deutschland, AZD Nr. 4, Köln 1965 sowie Rüberg, Ehe, 1971. M. Lioba an [Eugen] Rucker, Brief, 9. November 1962, AEK, DBK, KZI 29. Ebd.
368
4 Katholische Eheberatung
lassen, den Rest ihres Lebens litten. Sie stellte den Sinn der kirchlichen Heirat besonders bei sogenannten Frühehen in Frage. Damit bewegte sie sich deutlich außerhalb kirchlicher Vorstellungen. Dies ist umso bemerkenswerter, als sie selbst ihr Leben der Kirche gewidmet hatte. Die Grenzen der kirchlichen Beratungsarbeit werden hier deutlich. Auch die Eheberaterin Josepha Fischer-Erling ging ausführlich darauf ein, dass Ehekrisen aufgrund der katholischen Eheauffassung eine andere Problematik erhielten.⁶⁹⁴ Es sei wichtig und positiv, feste Grundsätze zu betonen, wozu die katholische Beratung erziehen wolle. Dazu gehöre das oberste Ziel, „über alle Schwierigkeiten hinweg die Ehe als unauflösliche Gemeinschaft zu erhalten und anzuerkennen“.⁶⁹⁵ Fischer-Erling sprach konkret Trennungen und Scheidungen, Wiederheirat, aber auch Geburtenregelung und Sexualität an. Auch hob sie hervor, dass die katholische Auffassung heilende Kräfte und Möglichkeiten bereithalte, ohne dies weiter auszuführen. Sie verwies auf die Ratsuchenden, von denen ein großer Teil keine Scheidung suche, sondern einen Rat, wie ihre Krise zu überwinden sei. Ob das die kirchlich interessierten Leser überzeugte, die im gleichen Aufsatz erst eine ausführliche Darstellung der oftmals durch das Kirchenrecht verschärften Ehekrisen gelesen hatten, bleibt offen. Andere Grenzen lagen in der Fähigkeit der Beraterinnen, auf Ratsuchende einzuwirken. Besonders deutlich wird dies in der Schilderung der Eheberaterin Rose Ophey, die sich mit dem grundsätzlichen Problem an Korte wandte, dass es Eheleute gebe, die sich gegenseitig die Schuld an ihrer Situation zuwiesen. Sie wusste nicht, wie sie damit weiter umgehen solle.⁶⁹⁶ Korte erwiderte, die Hilfsmöglichkeiten seien „de facto oft begrenzt: weil unsere Kraft und Zeit nicht ausreicht, dann aber auch, weil die Widerstände auf der anderen Seite zu große sind“.⁶⁹⁷ Für Korte war die Einsicht der Beratenen in ihre Situation absolut notwendig; ebenso wichtig war aber, dass die Eheberaterinnen die Grenzen ihrer Arbeit anerkannten. Auch wenn sich ein Ehepartner dem Gespräch verweigerte, konnte den Ratsuchenden nur bedingt geholfen werden. Eine Frau musste ihren Termin bei Korte absagen, da der Ehemann sich weigerte, mitzukommen. „Leider kann ich den Ter-
Dies führte auf evangelischer Seite zu der Beurteilung: „Der Aufsatz zeigt […] sehr klar, warum die Katholische Kirche eine besondere Eheberatung treiben muß […]. Das die katholische Eheberatung hauptsächlich beschäftigende Problem ergibt sich jedesmal aus der grundsätzlichen Unlöslichkeit der Ehe, zweitens aus dem scheinbar ganz strikt durchgeführten Verbot der Wiederverheiratung.“ o. A.: Katholische Eheberatung, [1951], ADE, CAW 408. Fischer-Erling, Eheberatung, 1951, S. 62, DZI. Vgl. auch im Folgenden. Vgl. [Rose Ophey] an [Bernhard] Korte, Brief, 13. Juli 1955, AEK, DBK, KZI 297. [Bernhard Korte] an Rose Ophey, Brief, 14. Juli 1955, AEK, DBK, KZI 297.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
369
min […] nicht einhalten. Es ist mir nicht möglich meinen Mann zu bewegen mit uns nach Köln zu fahren um mit Ihnen über unsere Eheangelegenheit zu beraten […]. Ich bin ich [sic] in einer so großen inneren Not, weil alles an der Starrheit meines Mannes abprallt.“⁶⁹⁸ Deutlich werden die Grenzen der Beratung an zwei Punkten: In manchen Fällen war die Diskrepanz zwischen kirchlichen Vorgaben und Beratungspraxis unüberbrückbar. Mangelte es bei den Ratsuchenden an Einsicht und sie wollten keine Verantwortung übernehmen, konnten die Beraterinnen ebenfalls nicht mehr viel tun. Dann galt es, diesen Zustand zu akzeptieren.
4.5.3 Neue Fragen in der Beratungsarbeit Im Jahr 1962 erschien in Fachzeitschriften eine Reihe von Artikeln zu Eheberatung, die aktuelle Fragen und Herausforderungen aus der Praxis behandelten. Dazu gehörten vor allem grundsätzliche Beschreibungen, wie die Beratung selbst ablaufen sollte. Paul Adenauer schilderte eine differenzierte, durch Tiefenpsychologie, Anthropologie und Theologie geprägte und professionalisierte Arbeitsweise.⁶⁹⁹ Wie die Eheberaterinnen selbst sah er die Arbeit nicht als Bevormundung oder Ersatz für eine eigene Gewissensentscheidung, sondern als Möglichkeit der persönlichen Entwicklung. Zudem warf er einen neuen Aspekt auf: die Auswirkungen der Eheberatung auf die Kirche und umgekehrt. Er betrachtete katholische Beratungsarbeit als offiziellen Dienst der Kirche, der nicht nur eine Chance für Eheleute, sondern auch für die Kirche selbst biete. „Eheberater und Fachberater werden gesucht. Vielleicht liegt hier die entscheidende Chance für eine Kirche, die dem Menschenleben an der Wurzel dienen will.“⁷⁰⁰ Auch die Zusammenführung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse „im Licht der unwandelbaren Weisheiten über die katholische Ehe“⁷⁰¹ hob er positiv hervor. Die Beraterin Josepha Fischer-Erling konstatierte 1962, dass die Tätigkeit der Eheberatungsstellen zunehme.⁷⁰² Sie führte dies darauf zurück, dass veränderte
E. G. an [Bernhard] Korte, Brief, 17. August 1959, AEK, DBK, KZI 422. Vgl. im Folgenden Adenauer, Paul: „Geschichtlicher Überblick über die katholische Eheberatung in Deutschland“. In: Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1962), H. 3, April/Mai, S. 116 – 119, DZI. Ebd., S. 119. Ebd., S. 117. Vgl. im Folgenden Fischer-Erling, Josepha: „Hilfen zur Bewältigung von Ehe- und Familienproblemen. Eheberatungsstelle“. In: Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1962), H. 3, April/Mai, S. 114– 116, DZI.
370
4 Katholische Eheberatung
gesellschaftliche Bedingungen die Ehe komplizierter machten und eine differenziertere Gestaltung des Familienlebens forderten. Um mit den Verführungen des modernen Lebens umzugehen, müssten Eheleute einen eigenen Weg finden, was viele überfordere. Auch an die Eheberatung würden dadurch „schwierige und zum Teil völlig neue Anforderungen gestellt“.⁷⁰³ Dem versuchte Fischer-Erling durch Schulung des Personals und Teamarbeit unter dem Vorsitz eines Psychotherapeuten zu begegnen, „um so dem Ratsuchenden eine vielschichtige und sorgfältige Hilfe geben zu können“.⁷⁰⁴ Zudem entwickelte sie selbst eine klare Vorstellung davon, wie Beratung vonstattengehen sollte, und besprach dies auch ausführlich in Fachbeiträgen.⁷⁰⁵ Auch andere Artikel vermitteln das Bild einer Beratung, die sich an neue Fragestellungen anpasste, beide Partner anhören und mögliche Maßnahmen mit ihnen absprechen wollte.⁷⁰⁶ Dies bringe den Eheleuten Frieden und eröffne sogar noch im Scheidungsverfahren und auch danach hoffnungsvolle Aussichten, „wenn es um die Auseinandersetzung des Hausrats, um die Regelung des Verkehrs mit den Kindern geht“. Die Erfahrung habe gelehrt, „daß schon geschiedene Ehegatten durch das Eingreifen eines einfühlsamen, klugen und beharrlichen Eheberaters, wenn es ihm gelang, den Auseinandersetzungen die Spitze und Härte zu nehmen, oft nach Jahren wieder den Weg zueinander fanden“.⁷⁰⁷ Die Ratsuchenden selbst wurden nicht ausführlich beschrieben. Die Beratenden nahmen sie tendenziell als leidende, gleichzeitig jedoch auch aktiv Handelnde wahr, vorausgesetzt, sie erhielten Unterstützung. Die Beraterinnen schienen die Einsicht der Eheleute zu erwarten. Ratsuchende, „die in großer seelischer Not kommen, [müssen] darauf aufmerksam gemacht werden, daß der Berater kein Zauberer ist, der mit einer schnellen Patentlösung all das aus dem Wege räumen kann, was sich oft in langen Ehejahren an Konfliktstoffen auf beiden Seiten aufgehäuft hat“.⁷⁰⁸ Gleichzeitig sahen sich die Eheberaterinnen dem Anspruch gegenüber, sich nicht zu schnell entmutigen zu lassen, wenn es darum ging, Ehen zu erhalten. Dies sei schwer, da Ratsuchende oft
Ebd., S. 114. Ebd., S. 116. Vgl. Kapitel 4.3.1 Vorstellungen von Ehe, Abschnitt Josepha Fischer-Erling. Vgl. im Folgenden Mann, E[lisabeth]: „Von der Tätigkeit katholischer Eheberatungsstellen im Bundesgebiet“. In: Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1962), H. 3, April/Mai, S. 50 – 53. Zudem wurde das Thema der Eheberatung in der Müttererholung erneut aufgegriffen. Vgl. Hohmann, Margarete: „Eheberatung in der Müttererholung“. In: Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1962), H. 3, April/Mai, S. 53 – 56, DZI. Ebd., S. 52 f. Ebd., S. 52.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
371
erst sehr spät kämen, beispielsweise, wenn das Paar bereits nicht mehr miteinander spreche oder schon eine Scheidungsklage eingereicht sei.
4.5.4 Eheprobleme aus Beraterinnensicht In den Augen der Beraterinnen blieben gewisse Voraussetzungen für eine gelungene Ehe gleich, auch wenn sich die gesellschaftlichen Bedingungen änderten. Käthe Zelazny konstatierte: Eheprobleme heute sehen sicher anders aus als in früheren Zeiten. Aber das Problem des mitmenschlichen Zusammenlebens bleibt durch alle Zeitveränderungen hindurch bestehen. Man muß schon als Kind gelernt haben, sich in der rechten Art zu behaupten, aber auch in der rechten Art nachzugeben, um es jetzt als Erwachsener zu können. Zusammenleben in der Ehe heißt: helfen und sich helfen lassen, geben und nehmen, berechtigte Ansprüche durchsetzen und verzichten.⁷⁰⁹
Eheprobleme konnten somit weit bis in die eigene Kindheit zurückreichen, etwa dann, wenn Kinder mit ihren Ängsten, Wünschen und Forderungen nicht ernst genommen worden seien und daher nicht lernen konnten, adäquat damit umzugehen. Darüber hinaus erläuterte Zelazny, dass Vollkommenheitsansprüche und übertriebene Idealvorstellungen Ehen gefährdeten. Andererseits lebten viele Verheiratete lose nebeneinander her, ohne zu versuchen, eine tiefere menschliche Beziehung einzugehen. Als Problematik junger Ehen machte sie die Unsicherheit aus, häufig Minderwertigkeitsgefühle des Mannes gegenüber einer tüchtigeren Frau. Ältere Ehen seien durch männliche Untreue, die zu leicht biologisch begründet und entschuldigt werde, gefährdet. Die Beraterin erklärte sich den Ehebruch damit, dass die Frau etwas falsch gemacht habe – etwa die Führung in der Partnerschaft an sich gerissen, sodass der Mann eine Bestätigung bei jüngeren Frauen suche. Männliche Komplexe gegenüber der eigenen Frau waren ein wiederkehrendes Motiv in der Problemanalyse der Eheberaterinnen, sowohl in Hinblick auf Beruf, Führungsanspruch in der Ehe als auch Untreue. Damit einher ging oft der Rat, Frauen sollten sich ihrem Ehemann gegenüber zurücknehmen, weniger tüchtig sein, um die Situation aufzulösen. Kurz nachdem das KZI gegründet worden war, präsentierten kirchliche Publikationen es als wichtige neue Errungenschaft. Ein Organ der Caritas druckte 1965
Zelazny, Käthe: „Welche Eheprobleme und -nöte kommen der Elisabethfrau vor Augen?“. In: Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1964), H. 4, Juli/August, S. 102– 106, hier S. 106, DZI.
372
4 Katholische Eheberatung
die „Grundlegende Erklärung über Wesen und Methode der Eheberatung“ im Wortlaut ab.⁷¹⁰ Auch erschienen Berichte über Eheberatung, in denen deren Aufbau, Ausbau und das dazu notwendige Fachwissen beschrieben wurden. Die Betonung lag darauf, dass die Beratung individuell und nicht moralisierend vorgehen solle.⁷¹¹ Die Autorin und Eheberaterin Magda Grube hatte dabei eine ähnliche Sicht auf Ehekrisen wie Korte: „Wenn soviel von ‚Ehekrisen‘ gesprochen wird, sollte man bedenken, daß es – strenggenommen – überhaupt keine Ehekrisen gibt, sondern immer nur ‚Krisen der Eheleute‘. So setzt auch die Hilfe in der Eheberatung beim einzelnen an.“⁷¹² Als eine der wenigen Beraterinnen beschrieb sie, wie sie das Verhalten von Ratsuchenden und deren Umgebung in der Krise wahrnahm. Jeder erfahrene Eheberater weiß, wie der Konflikt den Ratsuchenden verwirrt, wie er die Dinge und die Menschen nicht zu sehen vermag, wie sie wirklich sind, wie er immer mehr in seine ohnmächtige Wut, in seine Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit verstrickt ist, wie er niemanden hat, der fähig wäre, ihm zuzuhören, ohne gleich dazwischen zu fahren mit seinem Besserwissen, seinen parteiischen Ratschlägen. Zu erfahren, daß man in seiner Not und seiner Verwirrung angenommen und ernst genommen wird, ist oft schon eine wesentliche erste Hilfe.⁷¹³
Insgesamt lässt sich bei den Beraterinnen ein positives Selbstverständnis ausmachen. Sie erschienen als Allrounder, an die hohe Ansprüche gestellt wurden, besonders, was ihre fachliche Qualifikation anging. Offen für neue gesellschaftliche Entwicklungen traten sie den Ratsuchenden differenziert gegenüber und nahmen sie in ihren individuellen Nöten ernst. Als Eheberaterinnen betrachteten sie sich selbst als fest im katholischen Glauben verwurzelt. Sie suchten das Eheideal der Kirche personal auszulegen sowie den Gegebenheiten der jeweiligen Ehe und der Gesellschaft anzupassen. Besonders, was die Interaktion mit Ratsuchenden anging, hegten die Beraterinnen hohe Erwartungen an sich selbst, die in der Praxis teilweise scheiterten. Dabei zeichneten sich in ihrer Arbeit Grenzen ab, wie die Akteurinnen frustriert zur Kenntnis nahmen. Weniger klar konturiert erschienen die Ratsuchenden selbst, sie waren in den Augen der Beraterinnen von Verzweiflung geprägt und richteten gleichzeitig große Ansprüche an die Beratung. Kritisiert wurde oft der erst späte Entschluss, die Beratungsstelle aufzusuchen. Auch die Beraterinnen stellten An-
Vgl. o. A.: „Wesen und Methode der Eheberatung“. In: Vinzenz-Blätter. Zeitschrift für Vinzentinische Caritas 48 (1965), H. 2 (April), S. 45 – 46. Vgl. im Folgenden Grube, Magda: „Eheberatung – Hilfe für die heutige Ehe“. In: Frau und Mutter. Monatsschrift für die katholische Frau in Familie und Beruf 54 (1965), Nr. 10, S. 25 – 26. Ebd., S. 25. Ebd.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
373
sprüche an die Ratsuchenden: Sie sollten sich selbst und ihren Partner wahrhaftig kennenlernen, akzeptieren und sich weiterentwickeln. Dahinter stand das Idealbild aktiver und selbstbestimmter Akteure, die bereit waren, schmerzhaften Wahrheiten ins Auge zu blicken. Wie häufig dies in der Praxis eintrat, lässt sich nicht nachvollziehen. 4.5.4.1 Berufstätigkeit der Ehefrau und Mutter Im Jahr 1959 befasste sich Käthe Zelazny, eine katholische Eheberaterin, erneut mit der institutionellen Beratungsarbeit.⁷¹⁴ Zum ersten Mal lag der Fokus auf weiblicher Berufstätigkeit und damit auf einem Gegenstand, der direkt die Beratungspraxis betraf. Zuvor war es häufig um Fragen der Qualifizierung und das generelle Vorgehen in der Eheberatung gegangen. Die Zahl der berufstätigen Mütter wurde zu diesem Zeitpunkt auf etwa 1,6 Mio. geschätzt, viele davon waren in einfachen Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Zelazny beschrieb, wie diese Mütter ihren Beruf neben der Hausarbeit und der Betreuung von Mann und Kindern ausübten, und verwies damit auf die Mehrfachbelastung der Frauen. Sie beobachtete, dass die Berufsarbeit von Müttern nur selten Ursache für auftretende Konflikte sei. Allerdings mache es ihrer Erfahrung nach viel aus, ob sich die Mutter im Fall von Erziehungsschwierigkeiten tagsüber voll um ihre Kinder kümmern könne. Sie kritisierte die vereinfachende Aussage, eine Frau gehöre ins Haus, da damit Probleme nur abgetan und nicht hinterfragt würden. Andererseits mahnte sie, die Berufsarbeit dürfe nicht auf Kosten der Kinderzahl gehen, und widersprach der Ansicht, weniger Kinder bedeuteten einen höheren Lebensstandard. Dies sei keine Grundlage, weder für die Erziehung der Kinder noch dafür, dass sich eine Familie gesund entfalten könne, und damit aus ethischen Gründen abzulehnen. Hier schien das Idealbild der kinderreichen katholischen Familie durch. Im Folgenden unterschied die Beraterin zwischen berechtigten und nicht berechtigten Gründen der Berufstätigkeit, ohne dies explizit so zu benennen. Ihre Argumentation begann mit der Feststellung, Kinder alleinstehender berufstätiger Mütter gediehen oft recht gut. Die Beraterin führte dies auch darauf zurück, dass Kinder es meist gut verkrafteten, wenn ihre Mutter „aus echten Gründen Geld verdienen muss“.⁷¹⁵ Ein feines Gespür zeige ihnen, ob dies notwendig sei, um den Lebensunterhalt zu bestreiten oder nicht. Auch die Berufstätigkeit der Mütter, die aus geistigen oder künstlerischen Berufen kämen und diese aufgrund ihrer Selbstentfaltung nicht aufgeben wollten,
Vgl. im Folgenden Zelazny, Käthe: „Die berufstätige Mutter im Erfahrungsbereich der Ehe- und Erziehungsberatung“. In: Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1959), H. 5, Sept./Okt., S. 106 – 110, DZI. Ebd., S. 109.
374
4 Katholische Eheberatung
komme der Erziehung der Kinder meist zugute, falls die Frau Beruf und Hausarbeit einigermaßen in Einklang bringen könne. Dass der eigene akademische Hintergrund der promovierten Medizinerin Zelazny eine Rolle spielte, ist nur zu vermuten. Generell wertete sie weibliche Selbstentfaltung als positiv und beschrieb ihre Beobachtung, einige Frauen flüchteten aus Ehekonflikten oder den Anforderungen der täglichen Kleinarbeit heraus in den Beruf. Wenn sie darin Erfüllung fänden, profitierten Ehe und Kinder davon. Dem setzte Zelazny jedoch unnötige und schädliche Berufstätigkeit entgegen, womit sie eine für den Lebensunterhalt nicht notwendige oder erfüllende Tätigkeit meinte. Damit bewegte sie sich im Rahmen der kirchlichen Diskussionen zur Berufstätigkeit von Frauen, wo zu diesem Zeitpunkt zwar noch Widerstand gegen die Erwerbstätigkeit von Müttern zu beobachten ist, sich aber eine zunehmend differenziertere Haltung durchsetzte.⁷¹⁶ Wie wollte die Beraterin nun mit Ehekonflikten im Kontext weiblicher Berufstätigkeit umgehen? Bereits ihre Beschreibung ist aufschlussreich. Sie konzentrierte sich nicht, wie zu vermuten wäre, auf die nicht notwendige Berufstätigkeit. Vielmehr ging es Zelazny im Folgenden um Konflikte als lebenstüchtig beschriebener Frauen mit schwachen Ehemännern. Letztere litten oft an Überlastung, hervorgerufen durch Krieg und Gefangenschaft, während ihre Frauen aufgrund der Umstände selbstständig geworden seien. Männer seien dann überfordert und entwickelten Minderwertigkeitsgefühle. In der Folge müssten die Frauen weiterhin die Familie ernähren. Die spätere Vorsitzende des Vereins Katholischer Eheberaterinnen und Eheberater räumte ein, dass diese Frauen es objektiv betrachtet oft schwer hätten, gleichzeitig wies sie ihnen jedoch mindestens eine Mitschuld an der Situation zu. Denn sie suggerierte, dass die Probleme verschwänden, wenn die Ehefrau das männliche Selbstvertrauen stärke, weniger tüchtig sei und mehr fraulichen Instinkt zeige. Wie dies konkret mit der Realität dieser Frauen, den Lebensunterhalt zu bestreiten, in Einklang zu bringen war, erfuhren die Leser nicht. Die Berufstätigkeit der Ehefrau blieb auch 1962 ein Thema.⁷¹⁷ Sie galt mittlerweile als wichtiger Wert in einer modernen, partnerschaftlichen Ehe, allerdings abhängig davon, wie das Zusammenleben des Paares sich insgesamt gestaltete und ob die Berufstätigkeit eine Bereicherung für beide darstellte. Die weibliche Erwerbstätigkeit spielte auch in der zeitgenössischen gesellschaftlichen Diskussion eine wichtige Rolle. Die Fachartikel bestätigen, dass dies auch die katholische Beratung betraf, aus den Briefen an das KZI ergibt sich jedoch ein anderes Bild,
Vgl. Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 106 ff. Vgl. Simmon-Kaiser, Maria: „Die berufstätige Mutter im Erfahrungsfeld der Eheberatung“. In: Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1964), H. 4, Juli/August, S. 89 – 93, DZI.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
375
diesbezügliche Konflikte lassen sich nicht nachweisen.⁷¹⁸ Daraus lässt sich schließen, dass die publizierten Abhandlungen zumindest, was die Berufstätigkeit der Frau anging, eher aufgrund der gesellschaftspolitischen Relevanz des Themas ausgewählt wurden und weniger, weil dieses in den Sprechstunden viel Raum einnahm. Die beschriebene Praxis deutet darauf hin, dass die Beratung feste Eheideale und Rollenbilder verfolgte, auch wenn Offenheit und individuelles Eingehen auf den jeweiligen Fall einen prominenten Platz einnahmen.⁷¹⁹ An den Artikeln zur Berufstätigkeit von Ehefrauen wird dies besonders deutlich. Doch ist die beschriebene Praxis zu indirekt und knapp dargelegt, um eine definitive Aussage treffen zu können. 4.5.4.2 Junge und alte Ehe Zeitschriftenartikel behandelten verhältnismäßig häufig Konflikte in der jungen und der alten Ehe. Letztere wurde in trostlosen Bildern gezeichnet, sowohl für die Eheleute selbst als auch für die Beraterinnen. Der Blick, den die Eheberaterin Maria Simmon-Kaiser 1964 auf alte Ehepaare warf, und ihr Fazit fielen vernichtend aus. Hätten solche Ehepaare Krisen, sei ihnen kaum zu helfen.⁷²⁰ Dies wiederholte die Autorin im Jahr darauf.⁷²¹ Bei der jungen Ehe träten mangelndes Einfühlungsvermögen in den anderen auf und falsche Vorstellungen, die man sich vor der Ehe entweder von sich selbst oder dem Partner gemacht habe.⁷²² Dabei sprach SimmonKaiser auch die berufstätige Ehefrau an. Sie mahnte kritisch Verständnis für neue Lebenssituationen an und forderte eine Anpassung von Leitbildern. Die Aussage, die Frau gehöre ins Haus, trage nicht zur Lösung bei. „Das war einmal, und wir tun gut daran, uns von Leitbildern zu lösen, die einfach nicht mehr stimmen. Wenn wir – die älteren Frauen – helfen wollen, dann ist geradezu die erste Voraussetzung, daß wir Verständnis für die heutige junge Frau haben. Nur auf diesem Wege kann Vgl. Kapitel 4.5 Praxis der Eheberatung. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Jäger in Bezug auf die evangelische Beratung, wenn sie feststellt, dass das Eingehen auf Individualisierungsprozesse nicht notwendigerweise eine Veränderung des Diskurses zur Geschlechterordnung nach sich zog, sondern vielmehr ein erstes Mitgestalten von Individualisierungsprozessen mit einem Festhalten an Rollenbildern verband. Vgl. Jäger, Protestantismus, 2019, S. 367 ff. Vgl. Simmon-Kaiser, Maria: „Die Bedeutung einer langen Ehegemeinschaft“. In: Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1964), H. 6, November/Dezember, S. 122– 127, DZI. Vgl. dies.: „Am Abend einer langen Ehe. Probleme und Möglichkeiten – eine Eheberaterin berichtet“. In: Die katholische Frau: Monatsblatt für christl. Lebensgestaltung (1965), März, S. 11– 12, DZI. Vgl. im Folgenden Simmon-Kaiser: „Krisen in der jungen Ehe“. Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1965), H. 5, September/Oktober, S. 122– 127, DZI.
376
4 Katholische Eheberatung
sich Vertrauen entwickeln, und erst dann kann Rat erteilt werden.“⁷²³ Diese verständnisvolle Äußerung bedeutete nicht eine grundsätzliche Unterstützung der Berufstätigkeit von Ehefrauen durch die Beraterin. Vielmehr wird deutlich, dass sie es am Anfang der Ehe für notwendig hielt, dass eine junge Frau Einkommen habe; langfristiges Ziel sei es aber, mit einem guten Wirtschaftsplan und Anleitung zur fachlichen Haushaltsführung davon abzukommen. Damit solle der Haushalt auch Freude machen und der Ehemann lernen, dass Hausfrau zu sein ein Beruf und keine spielerische Nebenbeschäftigung sei. Da der Verdienst der Frau dann wegfalle, sprach sich die Beraterin für ein persönliches Taschengeld in angemessener Höhe aus. Mit der alten Ehe wird in den veröffentlichten Artikeln ein Thema behandelt, das sich ansonsten weder in der gesellschaftlichen Diskussion noch in der katholischen Eheberatungsarbeit widerspiegelt. In der Korrespondenz mit dem KZI lässt sich lediglich die Frühehe nachweisen. Da dieser Gegenstand stets von derselben Autorin behandelt wird, scheint es hier eine persönliche Vorliebe gegeben zu haben.
4.5.5 Versuch einer Bestandsaufnahme der katholischen Beratungsstellen Jahresberichte katholischer Eheberatungsstellen sind kaum zu finden. Monatsberichte scheint es keine gegeben zu haben. Für den Untersuchungszeitraum befinden sich im vorliegenden Material insgesamt lediglich 13 Berichte, die meisten beziehen sich auf die 1960er-Jahre. Daraus lässt sich schließen, dass es keine systematische Rückmeldung der Einrichtungen an Trägerorganisationen wie den KDFB oder die Caritas gab, ebenso wenig an die jeweilige Diözese. Auch das KZI erhielt fast keine Berichte. Dies dürfte die Kontrolle der einzelnen Stellen sowie der Berater erschwert haben. Lediglich vom Caritasverband Hamburg lassen sich ab 1961 regelmäßige Jahresberichte an das Erzbistum nachweisen, unter anderem auch über seine Eheberatungsstelle. Die fehlende Berichterstattung ist insbesondere auffällig, da das Zentralinstitut die Professionalisierung sowie den regelmäßigen fachlichen Austausch und die Weiterbildung der Beraterinnen vorantrieb. Beides lässt vermuten, dass eine Systematisierung der Arbeit vorgesehen war, die aber zumindest in diesem Bereich nicht stattfand. Es gibt Hinweise, dass sowohl Anna Beckmann, der KDFB als auch das KZI zu eruieren suchten, wie viele katholische Einrichtungen im Bundesgebiet existierten und wie diese arbeiteten, indem sie Fragebögen und individualisierte Anfragen an
Ebd.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
377
Diözesen und ihnen bekannte Beratungsstellen sandten.⁷²⁴ So ist bekannt, dass Anfang 1949 etwa 25 katholische Einrichtungen bestanden.⁷²⁵ Drei Jahre später hatte sich diese Zahl bereits auf 53 erhöht, weitere 11 Stellen befanden sich in Planung.⁷²⁶ Im Jahr 1955 gab das KZI ein Verzeichnis heraus, um den Beratungsstellen die Zusammenarbeit untereinander zu erleichtern. Explizit wies das Institut auf die Möglichkeit hin, mit Eheberatungen in der DDR zusammenzuarbeiten, deren Adressen bei ihm hinterlegt waren. Es führte insgesamt 62 bestehende Stellen auf, im Falle Berlins mit zusätzlichen Filialen. Insgesamt handelte es sich sowohl um Neugründungen als auch um Wiedereröffnungen von Einrichtungen, deren Arbeit in der Zeit des Nationalsozialismus unterbrochen worden war. Sechs weitere Stellen waren in Planung.⁷²⁷ Die meisten hatten den KDFB oder die Caritas als Trägerverband.⁷²⁸ Im Jahr 1961 nannte das KZI schon 64 Beratungsstellen.⁷²⁹ Für 1965 zählte es allerdings nur noch 59 auf. Der KDFB oder die Caritas waren weiterhin hauptsächlich als Träger vertreten.⁷³⁰ Da die katholische Eheberatung immer weiter ausgebaut worden war, ist unwahrscheinlich, dass die Zahl ihrer Stellen sank. Nachweisen lässt sich lediglich die Schließung von zwei Einrichtungen.⁷³¹ Zum Teil widersprüchliche Zahlenangaben können eher auf die schwache Institutionalisie-
Vgl. Anna Beckmann an Diözese Regensburg, Fragebogen, Februar 1951, AEK, DBK, KZI 29. Berna Kirschner, Fragebogen, August 1954, AKDFB, Ordner Ehe- und Familien-Arbeitskreis 1949 – 1957. [Bernhard Korte]: „Verzeichnis der Eheberatungsstellen“. In: Ders.: Erster überdiözesaner Kursus für Eheberatung, März 1953, S. 13 – 15, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Bernhard Korte an H[anna] Wiese, Brief, 13. September 1952, AEK, DBK, KZI 29. Vgl. Kapitel 4.1.4 Katholische Eheberatung. Vgl. [Bernhard Korte]: „Verzeichnis der Eheberatungsstellen“. In: Ders.: Erster überdiözesaner Kursus für Eheberatung, März 1953, S. 13 – 15, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Vgl. Korte, Bernhard: Verzeichnis der Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen im Bundesgebiet und Berlin 1955, [1955], AEK, Gen. II 13.2a, 1. Als Trägerverband wird 19 Mal der KDFB und 14 Mal die Caritas genannt, neun Stellen wurden gemeinsam betrieben. Weitere Träger von Beratungsstellen waren z. B. Diözesen. Illemann kommt dagegen auf eine andere Verteilung der Trägerverbände mit einem deutlicheren Schwerpunkt auf Seiten des KDFB. Vgl. Illemann, Frauenbewegung, 2016, S. 135 f. Eine Schwankung der Zahlen kann evtl. darauf zurückgeführt werden, „daß viele Beratungseinrichtungen nicht als Einzeleinrichtung institutionalisiert waren“. Kuller, Familienpolitik, 2004, S. 231 f., Fn. 34. Vgl. [Klens, Hermann]: Bericht über das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen, 14. April 1961, AEK, DBK, KZI 295, S. 7. Jedoch werden nur bei wenigen Beratungsstellen die Trägerverbände genannt, sodass diese weitestgehend unklar bleiben. Vgl. [KZI]: Verzeichnis der katholischen Eheberatungsstellen in der Bundesrepublik, Januar 1965, AKDFB, Ordner Ehe- und Familienfragen 1964– 1973. Vgl. o. A.: Bericht über die Situation der Katholischen Eheberatung im Bistum Fulda, September 196[5], AEK, DBK, KZI 186.
378
4 Katholische Eheberatung
rung der oft ehrenamtlich betriebenen Stellen zurückgeführt werden.⁷³² Da die Beratungsstruktur ab Mitte der 1960er-Jahre auf diözesaner Ebene einen Ausbau erfuhr, wuchs die Anzahl der Einrichtungen bis zum Beginn der 1970er-Jahre auf 180.⁷³³ Trotz offensichtlich fehlender Vorgaben zur Berichterstattung verwundert es angesichts dieser Zahl, dass nicht mehr Jahresberichte vorliegen.⁷³⁴ 4.5.5.1 Eheberatung in der Großstadt: Profil der Stellen und Beratungsanlässe Alle aufgefundenen Tätigkeitsberichte der katholischen Beratung behandeln Einrichtungen in Großstädten: Berlin, Dortmund, Frankfurt, Fulda, Hamburg und Kassel. Der älteste vorliegende Bericht stammt von der katholischen Beratungsstelle Berlins 1952.⁷³⁵ Sie war 1928 gegründet worden, Trägervereine waren der KDFB und die Caritas. Im Jahr 1955 war die Beratung in Charlottenburg dreimal die Woche geöffnet mit einem Angebot von acht Sprechstunden. Hinzu kamen weitere Filialen, davon zwei in Ostberlin.⁷³⁶ Die erste Sprechstunde nach Kriegsende fand am 20. März 1946 statt. Bis zum Berichtszeitraum nutzten etwa 240 Ratsuchende das Angebot, die Hälfte von ihnen kam mit Eheproblemen. Der Bericht unterschied zwischen juristischen, materiellen und psychologischen Beratungsanlässen. Als problematisch galten „lange Trennung, Verlust der Heimat, Arbeitslosigkeit, freudlose Unterkunft, Enge des Raumes, Ueberreiztheit [sic], Verbitterung und Untreue auf beiden Seiten“⁷³⁷, also Konflikte, die von der Kriegs- und Nachkriegssituation
Vgl. Rölli-Alkemper, Familie, S. 364, Fn. 319. Vgl. ebd., S. 365. Eva-Maria Silies geht hingegen von 137 Beratungsstellen zu Beginn der 1970erJahre aus. Vgl. Silies, Liebe, 2010, S. 228. Allerdings liegen auch nicht mehr alle ursprünglich verfassten Berichte vor. So findet sich ein Hinweis im Jahresbericht der Dortmunder Beratungsstelle, dass diese auch in früheren Jahren Berichte an den Caritasverband einreichte. Vgl. M. S.: Jahresbericht 1959 der Katholischen Beratungsstelle für Ehe- und Familienfragen zu Dortmund, [1960], S. 2, ADCV, 319.4, 601/02, Fasz. 01. o. A.: Arbeitsbericht der Kirchlichen Beratungsstelle in Ehe und Familienfragen Abteilung Eheberatung, [1952], AEK, DBK, KZI 296. Der Bericht selbst ist undatiert und nennt keine Stadt. Die Datierung sowie Einordnung als Bericht der Beratungsstelle in Berlin erschließt sich aus der Nennung von Hausbesuchen in diversen Berliner Bezirken, der Übereinstimmung der ersten Sprechstunde mit der Wiedereröffnung der Berliner Beratungsstelle und einem mit dem Bericht archivierten Brief Kortes mit der Bitte, Fragen zur Beratung zu beantworten. Vgl. [Bernhard] Korte an H[anna] Wiese, Brief, 13. September [19]52, AEK, DBK, KZI 296. Vgl. Korte, Bernhard: Verzeichnis der Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen im Bundesgebiet und Berlin 1955, [1955], S. 5, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Die Leiterin der Beratungsstelle war im Jahr 1955 Dr. Anna von Schönebeck. Vgl. ebd., S. 5. o. A.: Arbeitsbericht der Kirchlichen Beratungsstelle in Ehe und Familienfragen Abteilung Eheberatung, S. 3, [1952], AEK, DBK, KZI 296.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
379
geprägt waren. Die meisten Ratsuchenden waren Frauen,⁷³⁸ was damit erklärt wird, dass diese mehr unter einem Zerwürfnis litten und „dass den Frauen weit über ihre Leistungsfähigkeit aufgebürdet wird und sie ein grösseres [sic] Bedürfnis zur Aussprache haben. Bevor sie zum Anwalt oder Seelsorger gehen, kommen sie um Rat zu uns“. Die Aussprache erleichterte insbesondere „hochstehende und wertvolle Menschen“⁷³⁹, wie die Beraterinnen beobachteten. Sie betrachteten es daher als wichtigste Pflicht, geduldig zuzuhören, wofür sie sich bis zu einer Stunde Zeit nahmen. Ihrem Selbstverständnis zufolge waren sie Gesprächspartnerinnen, die gemeinsam mit den Ratsuchenden in vertrauensvoller und objektiver Aussprache Schwierigkeiten behoben. Bester Lohn sei ein Besucher, der die Sprechstunde erleichtert verlasse. Im Gegensatz dazu stand die Schilderung der religiösen Not, ausgelöst von kirchenrechtlichen Problemen: Immer treten wir ein für den Weiterbestand der Familie und die Unauflöslichkeit der christlichen Ehe […]. Durch gütiges Verhandeln mit beiden Teilen, energische Ablehnung einer Scheidung von seiten [sic] der Rechtsanwältin und wiederholtem Hinweis auf den Standpunkt der Kirche, ist es in mehreren Fällen gelungen, kranke Ehen wieder zu heilen. Selbst da, wo die Klageschrift schon eingegangen war, zogen vor Gericht die Männer die Klage zurück. Die Frauen sehen von der Scheidung oft ab, wenn man ihnen klar macht, dass sie ihre wirtschaftliche Situation dadurch nur verschlechtern, da erfahrungsgemäss [sic] wenig Unterhaltskosten richtig gezahlt werden.⁷⁴⁰
Aus der Formulierung geht hervor, dass die Beraterinnen Scheidungswünschen mit einer Mischung aus freundlicher Verhandlung, kirchenrechtlich begründeten Konsequenzen und, im Fall der Frau, wirtschaftlichen Mangelszenarien begegneten. Eine gemeinsame Problembehandlung war hier nicht sichtbar. In dieser Beratungsstelle schien eine Hilfe, die an den Wünschen der Ratsuchenden orientiert war, nicht möglich. Vielmehr galt es, Scheidungen abzuwenden und das Interesse der Amtskirche zu vertreten. Stellte sich heraus, dass eine Ehe nicht mehr zu retten war, riet die Eheberaterin zur Trennung, nicht jedoch zur Scheidung. „Wo die Zerrüttung schon zu tief erscheint, die Stellung der Frau zu erniedrigend, besonders da, wo grössere [sic] Kinder sind, wird zu einer Trennung von Tisch und Bett geraten.“ Dennoch kommentierte man in der Beratung die kirchenrechtliche Situation Geschiedener wie folgt: „Als besonders tragisch empfinden wir das Schicksal der
Vgl. auch Rölli-Alkemper, Familie, 2000, S. 365. o. A.: Arbeitsbericht der Kirchlichen Beratungsstelle in Ehe und Familienfragen Abteilung Eheberatung, S. 2, [1952], AEK, DBK, KZI 296. Ebd., S. 2 f.
380
4 Katholische Eheberatung
aus einer kath. Ehe geschiedenen Partner, die nun wieder heiraten wollen. Viele sehen die Unmöglichkeit nicht ein.“⁷⁴¹ Die Beraterinnen lavierten zwischen gemeinsamer Problembewältigung und dem Diktum, die Unauflösbarkeit der katholischen Ehe zu verteidigen. Auf Letzterem lag der Schwerpunkt, sodass die Frauen sich in voller Übereinstimmung mit dem Lehramt befanden. Sie bevormundeten die Ratsuchenden zumindest in Trennungs- und Scheidungsfragen, während sie in anderen Punkten Wünsche deutlicher wahrnahmen und mit den Besuchern gemeinschaftlich handelten. „Das Hauptgewicht liegt auf dem mitmenschlichen Umgang und Gespräch, wobei der Ratsuchende – oft selbst unbewußt – zur Erkenntnis seiner eigenen Fähigkeiten, aber auch seiner eigenen Fehler geführt wird, um von da her die innere Bindung an den Partner zu festigen, auch wo die äußere zu zerreißen droht“,⁷⁴² heißt es im Jahresbericht der Dortmunder Beratungsstelle von 1959.⁷⁴³ Das Zitat bezieht sich sowohl auf die Sicht der Beraterinnen als auch auf die der Ratsuchenden. Welche Wirkung Eheberatung hatte, ließ sich zwar nicht in Zahlen oder Erfolg und Misserfolg ausdrücken, wie betont wurde, dennoch gibt der Bericht ansonsten vor allem Statistiken wieder. Im Gegensatz zu früheren Jahren habe man sich mehr denjenigen Ratsuchenden zuwenden können, die sich noch nicht im Scheidungsprozess befänden.⁷⁴⁴ Die statistische Aufschlüsselung zeigt für 1959 insgesamt 71 Fälle bei einer Besucherzahl von 250, im Jahr zuvor 62 Fälle bei 190 Ratsuchenden und 1957 insgesamt 48 Fälle mit 129 Besuchern. Auffällig ist der deutliche Unterschied zwischen Besuchern und Beratungsfällen. Als Letztere galten
Ebd., S. 3. M. S.: Jahresbericht 1959 der Katholischen Beratungsstelle für Ehe- und Familienfragen zu Dortmund, [1960], S. 2, ADCV, 319.4, 601/02, Fasz. 01. Vgl. auch im Folgenden. Gegründet wurde die Beratungsstelle 1953. Im Jahr 1955 war der Träger der Katholikenausschuß, Leiterin Sophia Thiemann, Sprechzeiten fanden dienstags von 16 bis 19 Uhr statt. Vgl. Korte, Bernhard: Verzeichnis der Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen im Bundesgebiet und Berlin 1955, [1955], S. 17, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Die Beratungsstelle in Dortmund wurde von der Pfarrzentrale über eingegangene Scheidungsklagen vom Landgericht unterrichtet. Im Jahr 1957 umfasste dies 83 Benachrichtigungen, 1958 waren es 80, 1959 hingegen 70. Von diesen reagierten auf die Einladung zum Gespräch in der Eheberatung 1957 20 Prozent der Angeschriebenen, beziehungsweise 18 Prozent 1958 und 17 Prozent im Jahr 1959. Mit einer deutlichen Mehrheit von 67 bis 75 Prozent waren die Ehefrauen die Klägerinnen. „Mischehen“ machten einen Anteil von 50 bis 58 Prozent bei den Scheidungsklagen aus. „Die Beratungssituation bei diesen Ehen ist unfruchtbar, da gewöhnlich beim Einreichen der Scheidungsklage die Fronten schon allzusehr versteift sind und echte Hilfe kaum mehr geboten werden kann.“ Im Jahr 1959 wurden von diesen Ehen drei mit Hilfe der Eheberatung wieder versöhnt. Von zwei weiteren ist bekannt, dass sie geschieden wurden, der Verlauf der anderen Scheidungsklagen ist unbekannt.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
381
vermutlich nur diejenigen, die häufiger kamen, um ihre Situation zu klären. Sogenannte Dauerberatungen waren für zehn Ratsuchende notwendig, die höchste Anzahl an Besuchen einer Einzelperson betrug 31. 56 Sprechstunden fanden statt, bei denen einmalige Besucher etwa 50 Prozent der Ratsuchenden ausmachten. Einmalige Besucher hatten entweder allgemeine Fragen, auf die es sofort eine Antwort gab, oder ein derart spezielles Anliegen, dass sie an einen Fachmann weitergeleitet wurden. Die Besuchsgründe umfassten vor allem nicht näher ausgeführte tiefgehende Störungen und „Fehlhaltungen“,⁷⁴⁵ ein Sammelbegriff für psychische Probleme.⁷⁴⁶ Als wichtigste weitere Punkte erschienen in absteigender Reihenfolge Ehebruch, die negative Einwirkung durch Elternfamilien, Geldschwierigkeiten, die Berufstätigkeit der Frau, Erziehungsfragen, Wohnungsschwierigkeiten, Trunksucht und Gewalt. Die Hintergründe der Besucher werden für die Jahre 1957 bis 1959 sehr unterschiedlich wiedergegeben. 1957 seien vorwiegend Arbeiter und kleine Angestellte gekommen, im Jahr darauf vor allem „Asoziale“ und Arbeiter. Zwei Jahre später suchten hingegen zunehmend mittlere Angestellte, Selbstständige und mehr Akademiker die Beratungsstelle auf. Wie diese stark variierenden Gruppen zustande kamen, lässt sich aus dem Bericht nicht nachvollziehen. Am Ende verwies der Jahresbericht auf die Weiterbildung der Eheberaterin. Sie erfolgte in erster Linie über die Teilnahme an der Jahresversammlung der Eheberaterinnen, die das KZI ausrichtete, und durch Gespräche mit Fachkräften. Dagegen wurde der Rhein-Ruhr-Arbeitskreis aus zeitlichen und finanziellen Gründen nicht besucht.⁷⁴⁷ Ab 1961 liegen regelmäßige Jahresberichte der Eheberatungsstelle Hamburg vor, zudem ein Bericht über den Winter 1957/1958. In der 1953 gegründeten, von der Caritas getragenen Einrichtung standen Besuchern eine Juristin und eine Ärztin zur Verfügung. Zweimal wöchentlich fand eine Sprechstunde statt.⁷⁴⁸ Der eigenen Einschätzung zufolge vergrößerte sich der Zulauf 1957 wesentlich gegenüber dem Vorjahr. Dies ließ sich auf die Eheseminare für jung Verheiratete zurückführen, die auf Bitten der Gemeinden stattfanden und die Beratungseinrichtung stärker bekannt machten.⁷⁴⁹ Zu den Vorträgen kamen rund 200 Paare. Bernhard Korte hielt dort als Leiter des Katholischen Zentralinstituts einen Vortrag zu „Schwierigkeiten
M. S., Jahresbericht 1959, [1960], ADCV, 319.4, 601/02, Fasz. 01. Vgl. Kapitel 4.5.5.2 Katholische Beratungsstelle. Vgl. Kapitel 4.3.4.1 Verein Katholischer Eheberaterinnen und Kapitel 4.3.4.2 Jahreskurse. Vgl. o. A.: Jahresbericht über die Tätigkeit des Caritasverbandes für Hamburg e. V. in der Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 1964, [1965], S. 37, Diözesanarchiv Erzbistum Hamburg, Akte 10 – 05 – 01 1964 sowie Korte, Bernhard: Verzeichnis der Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen im Bundesgebiet und Berlin 1955, [1955], S. 15, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Katholische Eheseminare wurden in diesem Zeitraum von der Inneren Mission als sehr erfolgreich eingeschätzt. Vgl. Innere Mission München an Bäcker, Brief, 14. Juni 1956, ADE, CAW 408.
382
4 Katholische Eheberatung
und Krisen in der heutigen Ehe: Ihre Ursachen und ihre Überwindung“.⁷⁵⁰ Auch 1962 waren die Hamburger Eheberaterinnen außerhalb der Sprechstunden aktiv und boten Eheberatungsabende in den Pfarreien an.⁷⁵¹ Zu den Sprechstunden selbst kamen insgesamt 62 Ratsuchende, die meisten das erste Mal, einige waren bereits im Jahr zuvor da gewesen. Im Gegensatz zu der Dortmunder Beratungsstelle berichteten die Hamburger Akteurinnen, dass die meisten Besucher wegen ernster Schwierigkeiten längere Aussprachen benötigten und viele häufiger in die Sprechstunde kämen. Einzelne Fälle wurden das ganze Jahr hindurch betreut, zum Teil erschienen die Betroffenen nach Vereinbarung auch in der Wohnung der Beraterin. Wenn es angebracht und möglich schien, wurden Ehepartner einbezogen. Der Regel entsprach dies demnach nicht. Obwohl die Beraterinnen sich deutlich engagierten, war ihr Fazit weitestgehend negativ, da die Ratsuchenden bereits zu viel Zeit hätten verstreichen lassen: „Oft wird dann nur noch der Rat der erfahrenen Juristin in Scheidungsnöten erbeten. Die Arbeit der Eheberatungsstelle könnte fruchtbarer sein, wenn ihre Hilfe rechtzeitig, also schon bei Beginn der Schwierigkeiten, in Anspruch genommen würde.“⁷⁵² Dennoch hofften sie, Hilfe geboten zu haben. Ihrer Einschätzung nach „bedeutet die Möglichkeit der ruhigen Aussprache, die meist zu einer Klärung der eigenen Lage führt, und das Gefühl,Verständnis zu finden, für die meisten Ratsuchenden auch dann eine Hilfe, wenn an der Ehekrise selbst nichts mehr zu ändern ist.“ Als besondere Ursache für Eheprobleme galt die „körperliche und nervliche Erschöpfung der Frau“. Die Betroffenen sollten einen Platz in der Müttererholung erhalten. Es kamen umgekehrt aber auch Frauen, die wegen Ehekrisen bereits eine Kur abgeschlossen hatten, in die Beratung. Die Berichte sind für die darauffolgenden Jahre fast wortgleich.⁷⁵³ Für 1963 war mit 82 Ratsuchenden eine höhere Zahl verzeichnet als üblich.⁷⁵⁴ Die Beraterin führte das auf häufigere Anzeigen in Kirchenboten und Prospekten der Caritas zurück. Der Bericht behandelte auch die Neuordnung des KZI, da sich die Reform auf die Hamburger Beratungsstelle aus-
Vgl. o. A.: Halbjahresbericht über die Arbeit innerhalb des Caritasverbandes für Hamburg e. V. Winterhalbjahr 1957/58, [1958], S. 2 f., Diözesanarchiv Erzbistum Hamburg, 10 – 05 – 03 1957/58. Vgl. o. A.: Jahresbericht über die Tätigkeit des Caritasverbandes für Hamburg e. V. in der Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 1961, [1962], S. 18 f., Diözesanarchiv Erzbistum Hamburg, Akte 10 – 05 – 01 1963. Ebd., S. 18. Auch im Folgenden. Vgl. o. A.: Jahresbericht über die Tätigkeit des Caritasverbandes für Hamburg e. V. in der Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 1962, [1963], S. 25, Diözesanarchiv Erzbistum Hamburg, Akte 10 – 05 – 01 1962. Vgl. o. A.: Jahresbericht über die Tätigkeit des Caritasverbandes für Hamburg e. V. in der Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 1963, [1964], S. 15 f., Diözesanarchiv Erzbistum Hamburg, Akte 10 – 05 – 01 1963.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
383
gewirkt habe. Beide Beraterinnen arbeiteten an der Vereinsgründung der Eheberaterinnen mit und steuerten Überlegungen zur Rahmenordnung für die Ausbildung bei.⁷⁵⁵ Da ihnen Nachwuchskräfte ein ernstes Anliegen waren, hofften sie in Zukunft auf eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Zentralinstitut und ihrer eigenen Einrichtung. Im Jahr darauf verstarb eine der Beraterinnen, sodass nur noch eine Juristin die Einrichtung trug. Zwar konnte sie 97 Besuchern helfen, befand jedoch, dass in der Großstadt mehr Personal zur Verfügung stehen müsse, „da die speziellen Eheschwierigkeiten oft auch gesonderter medizinischer, psychologischer oder psychotherapeutischer Natur sind, so daß eine allgemeine Auskunft nicht mehr genügen kann“.⁷⁵⁶ Ehrenamtlich hatten sich ein Frauenarzt und ein Psychotherapeut zur Verfügung gestellt, sodass die Eheberaterin alle sechs Wochen zusammen mit einem Theologen schwierige Fälle besprechen konnte. Die personelle Situation veränderte sich auch im folgenden Jahr nicht, da die Beratungsstelle keine zweite Eheberaterin finden konnte. Dennoch wurden 103 Ratsuchende angehört. Gemeinsam mit dem KZI fand eine Regionaltagung statt. Aufgrund der regen Teilnahme hoffte die Beraterin auf eine Fortführung. Für sie war besonders wichtig, dass auf der Tagung „die Möglichkeit besteht, in Einzelbesprechungen auf die verschiedenen und oft schwierigen Probleme der Eheberatungsstelle einzugehen“.⁷⁵⁷ Die katholische Eheberatung Frankfurts arbeitete durchgehend seit 1929,⁷⁵⁸ 1934 war sie um den Bereich der Eheanbahnung erweitert und mit einer hauptamtlichen Kraft besetzt worden.⁷⁵⁹ Obwohl es sie schon lange gab und sie entsprechend bekannt war, listete das KZI sie lediglich im Verzeichnis von 1952 auf. In späteren Jahren findet sich stattdessen eine andere Beratungsstelle in Frankfurt. Dies verdeutlicht nochmals, wie wenig institutionalisiert die Einrichtungen waren. Die Leiterin Johanna Bargenda⁷⁶⁰ begrüßte die Kombination aus Beratung und
Vgl. Kapitel 4.3.4.1 Verein Katholischer Eheberaterinnen. o. A.: Jahresbericht über die Tätigkeit des Caritasverbandes für Hamburg e. V. in der Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 1964, [1965], S. 37, Diözesanarchiv Erzbistum Hamburg, Akte 10 – 05 – 01 1964. o. A.: Jahresbericht über die Tätigkeit des Caritasverbandes für Hamburg e. V. in der Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 1965, [1966], S. 44, Diözesanarchiv Erzbistum Hamburg, Akte 10 – 05 – 01 1965. Vgl. Kapitel 4.1.4 Katholische Eheberatung. Vgl. im Folgenden Bargenda, Johanna: Stellungnahme zu Abschnitt A im Memorandum des Kath. Zentralinstituts für Ehe- und Familienfragen, 5. April 1963, Archiv Caritasverband Frankfurt, Nr 7100 – 03, Akte Katholische Eheanbahnung und Eheberatungsstelle, Korrespondenz 1963 – 1965. Johanna Bargenda war seit 1934 Eheberaterin in Frankfurt. Als sie die Arbeit antrat, zählte die damals 37-jährige Witwe neben ihrer Ausbildung als Seelsorgehelferin auch sieben Jahre katholische Ehe und acht Jahre Verwaltungsdienst als Berufserfahrung auf. Darüber hinaus konnte sie als Qualifikationen die Ausbildung und Fortbildung durch den Caritasdirektor und die Teilnahme an
384
4 Katholische Eheberatung
Eheanbahnung ihrer Einrichtung, da sich für sie damit die Gelegenheit zu einer vorbeugenden Arbeit ergab. Schätzungsweise nur 5 Prozent der Gespräche betrafen 1962 Konflikte in einer bestehenden Ehe, die anderen bezogen sich auf Ehevorbereitung und -vermittlung.⁷⁶¹ Die ausgebildete Seelsorgehelferin der Beratungsstelle war hauptamtlich beschäftigt, eine selbstständige Sekretärin war ihr beigeordnet. Fachliche Unterstützung erhielt Bargenda vom Caritasdirektor, Geistlichen, dem Justiziar des Caritasverbandes, zwei Rechtsanwälten sowie Ärzten in Krankenhäusern. Drei katholische Psychotherapeuten standen zur Verfügung, die nach Wunsch Beratungen vornahmen. Alle diese Angebote stellten jedoch keinen Arbeitskreis dar, sondern gründeten auf freiwilliger Hilfsbereitschaft. Der Kontakt mit anderen Fachleuten war dennoch eng, da die Beratungsstelle nicht nur im Caritasverband eingegliedert, sondern auch mit den anderen Diensten im Caritashaus untergebracht war. Dort standen der Eheberatung fünf Räume zur Verfügung. Das große Gebäude erlaubte Ratsuchenden eine unauffällige Kontaktaufnahme. Damit war die Eheberatungsstelle außergewöhnlich gut versorgt, sowohl was ihre strukturelle Einbindung als auch ihre räumliche Ausstattung anging. Dass die Beraterin hauptamtlich arbeitete, war ebenfalls eine Ausnahme. Andere Stellen klagten auch später noch über mangelnde finanzielle Förderung und schlechte Unterbringung in ungenügenden Räumlichkeiten.⁷⁶² Gleichzeitig basierte die Teamarbeit, die in der Eheberatung das Ideal bildete, auf Freiwilligkeit. Insgesamt war die Frankfurter Einrichtung personell unterbesetzt. Auch konnte keine Nachfolgerin für die Leiterin gefunden werden, die 1962 bereits über 65 Jahre alt war. Sie selbst regte an, die Eheberatungsarbeit weiter auszubauen, und hoffte auf neue Impulse durch eine Nachbesetzung. Trotz wiederholter Nachfrage bei Fachschulen sowie diversen Annoncen blieb die Suche lange erfolglos. Es mangelte nicht an Interessentinnen, jedoch an geeigneten Kräften. Entweder fehlte Bewerberinnen die notwendige Ausbildung, „oder ihre eigene Lebenssituation schien nicht geeignet, andere Menschen über die Grundsätze katholischer Ehe und Lebensführung zu
Kursen und Veranstaltungen der Berufsgemeinschaft katholischer Seelsorgehelferinnen nachweisen und hatte außerdem Kontakt zum KZI. Trotz hauptamtlicher Anstellung war ihre Bezahlung in den ersten Jahren geringfügig, seit 1953 war die Entlohnung allerdings derjenigen der städtischen Fürsorgerin angepasst. Vgl. [Bernhard Korte]: „Verzeichnis der Eheberatungsstellen“. In: B[ernhard] Korte: Erster überdiözesaner Kursus für Eheberatung, März 1953, S. 13 – 15, hier S. 12, AEK, Gen. II 13.2a, 1.Vgl. Korte, Bernhard: Verzeichnis der Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen im Bundesgebiet und Berlin 1955, [1955], S. 11, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Vgl. o. A. an Anton Maier von Hart, Brief, 6. Juli [19]65, AEK, DBK, KZI 29. Kath[olische] Ehe- und Familienberatung [Regensburg] an KZI, Brief, 4. Oktober 1965, AEK, DBK, KZI 29.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
385
belehren“.⁷⁶³ Die Interpretation Bargendas war, dass die guten und leistungsfähigen Kräfte sich bereits in befriedigenden Arbeitsverhältnissen befänden, die sie nicht aufgeben wollten. Hinzu komme, dass die kirchliche und soziale Arbeit sich generell in einer Notlage befinde, da potenziellem Personal die dienende Grundhaltung zunehmend fehle. Ebenso mangele es an Mut, sich in Ratsuchende hineinzudenken und ein gewisses Risiko einzugehen, da Erfolg in der Beratungsarbeit nicht messbar sei. Die Ausbildung geeigneter Kräfte stellte für die Leiterin die wichtigste Aufgabe dar. Ende 1963 ging sie in den Ruhestand. Ihrer Nachfolgerin wünschte sie, dass diese „in der Arbeit genauso viel Freude und Erfüllung findet, wie ich sie in den 30 Jahren meiner Tätigkeit fand“.⁷⁶⁴ Das starke persönliche Engagement und der Stolz katholischer Beraterinnen auf ihre Tätigkeit wurde auch von außen wahrgenommen.⁷⁶⁵ Aus dem Bericht wird die Schwierigkeit, eine Arbeitsstelle in der Beratung adäquat zu besetzen, ersichtlich ein allgemeines Phänomen dieser Zeit im kirchlichen Sozialbereich. Die Folge war, dass überarbeitetes oder häufig auch Personal im hohen Rentenalter zum Einsatz kam.⁷⁶⁶ Fehlende Nachwuchskräfte stellten auch die Eheberatung in Fulda vor ein unlösbares Problem, nachdem die 70-jährige Beraterin im Jahr 1964 ausgeschieden war.⁷⁶⁷ Ebenso erging es der 1952 gegründeten katholischen Stelle in Kassel.⁷⁶⁸ Die älteren, verheirateten Fürsorgerinnen gingen, nur eine junge, unverheiratete blieb übrig. Ende 1964 hatte sie erstmals an einer Schulung für Eheberaterinnen teilgenommen. Im Bericht stand: „Man kann sich unschwer vorstellen, daß diese junge ledige, mit anderen Aufgaben weitgehend ausgelastete Fürsorgerin keineswegs den Anforderungen, die an eine katholische Eheberaterin in der Großstadt Kassel nun
Bargenda, Johanna: Stellungnahme zu Abschnitt A im Memorandum des Kath. Zentralinstituts für Ehe- und Familienfragen, 5. April 1963, S. 6, Archiv Caritasverband Frankfurt, Nr 7100 – 03, Akte Katholische Eheanbahnung und Eheberatungsstelle, Korrespondenz 1963 – 1965. Vgl. [Bargenda, Johanna]: Jahresbericht für das Geschäftsjahr 1963 der Kath. Eheanbahnungsstelle und Eheberatungsstelle, 31.12.1963, S. 2, Archiv Caritasverband Frankfurt, Nr 7100 – 01, Akte Katholische Eheanbahnung und Eheberatungsstelle, Jahresberichte 1934– 1975. Im Familienministerium wurde die Qualität der katholischen Eheberatung zurückgeführt auf „das starke persönliche Engagement der Berater, die, oft unter Verzicht auf eine lukrativere Berufstätigkeit, stolz sind, gewissermaßen Pionierarbeit im unmittelbaren Dienst am Menschen leisten zu dürfen“. Große-Schönepauck, H[elene]: Die Eheberatung in Deutschland und in anderen Ländern, [1969], S. 11, BArch, B 189/2807, Bl. 265 ff. Vgl. Kapitel 4.3 Selbstverständnis. Vgl. im Folgenden o. A.: Bericht über die Situation der Katholischen Eheberatung im Bistum Fulda, September 196[5], DBK, KZI 186. Zum Gründungsdatum etc. vgl. Korte, Bernhard: Verzeichnis der Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen im Bundesgebiet und Berlin 1955, [1955], S. 7, AEK, Gen. II 13.2a, 1.
386
4 Katholische Eheberatung
einmal gestellt werden, selbst beim besten Willen genügen kann. Zudem ist sie auf diese Aufgabe überhaupt nicht vorbereitet.“⁷⁶⁹ Bis 1964 hatte in Kassel eine Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung existiert, die der DAJEB angeschlossen gewesen war. Sie war im Unterschied zu anderen an diese gebundenen Beratungsstellen bewusst konfessionell ausgerichtet gewesen. Die Sprechstunden wurden abwechselnd mit katholischen oder evangelischen Beratern besetzt. Untergebracht war die Stelle in drei Räumen eines interkonfessionell ausgerichteten, zentral gelegenen Wohlfahrtshauses, das die Stadt finanziell unterstützte. Die katholische Eheberatung war jedoch nur gering frequentiert. Als die evangelische Seite 1965 eine eigene, größere Beratungseinrichtung schuf, wurde die Arbeitsgemeinschaft aufgelöst. Dies entsprach der allgemeinen Entwicklung einer sich ausdifferenzierenden protestantischen Eheberatung.⁷⁷⁰ Von 1963 bis mindestens 1965 existierte damit keine funktionsfähige katholische Eheberatungsstelle in der Diözese. 4.5.5.2 Katholische Beratungsstelle für Ehe- und Familienfragen Köln Im Vergleich zu anderen Einrichtungen ist zur katholischen Beratungsstelle für Eheund Familienfragen in Köln mehr Material vorhanden. Sie wurde 1931 gegründet und 1947 wiedereröffnet. Stadtdekanat, Caritas, KDFB und Frauenseelsorgeamt waren gemeinsame Träger.⁷⁷¹ Die Leitung hatte bis 1972 die Juristin Josepha FischerErling inne. Als engagierte katholische, akademisch gebildete, verheiratete Frau mit fünf Kindern entsprach sie dem Idealbild der katholischen Eheberaterin. Trotz ihrer Bereitschaft, das kirchliche Eheideal sehr großzügig auszulegen, galt die Arbeit der viel gefragten Expertin als vorbildlich. Sie setzte bewusst auf Werbung, um die Besucherzahlen zu steigern.⁷⁷² Untergebracht war die Einrichtung zunächst in kleinen, feuchten Kellerräumen. Wegen dieser Zustände und weil sich ihre Arbeit stark ausweitete, bat Fischer-Erling 1956 das Erzbistum Köln um einen finanziellen Sonderbeitrag für einen Umzug.⁷⁷³ Das Erzbistum überwies daraufhin einen Zuschuss von 2.560 DM. Bis zu diesem Zeitpunkt fanden die Beratungsgespräche zumindest teilweise in den Privaträumen der Mitarbeiterinnen statt, da „die Ratsuchenden aus den gebildeten Schichten angesichts des schlechten Zustandes der
o. A.: Bericht über die Situation der Katholischen Eheberatung im Bistum Fulda, September 196[5], DBK, KZI 186, S. 5. Vgl. Kapitel 3.4.1 Die Begründung. Vgl. Korte, Bernhard: Verzeichnis der Katholischen Beratungsstellen für Ehe- und Familienfragen im Bundesgebiet und Berlin 1955, [1955], S. 9, AEK, Gen. II 13.2a, 1. Vgl. Kapitel 4.5.3 Neue Fragen und 4.5.4 Eheprobleme. Vgl. [Josepha] Fischer-Erling an Generalvikar [Teusch], Brief, 23. April [19]56, AEK, Gen. II 13.2a,1.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
387
Räume […] nicht empfangen werden konnten“.⁷⁷⁴ Noch zehn Jahre später beklagte Günter Struck, zwischen 1964 und 1968 Leiter des medizinisch-anthropologischen Referats und stellvertretender Direktor im KZI, die Ausstattung vieler Stellen, die oft provisorisch blieb. Er führte dies auf die Pioniergeneration in der Eheberatung zurück, die selbstlose Hilfe in den Vordergrund gestellt hatte, und befürchtete, die Arbeit könne wegen der schlechten räumlichen Situation geringgeschätzt werden: „Bei vielen Ratsuchenden unserer Zeit erweckt eben – mit gewissem Recht – die unangemessene äußere Bescheidenheit im Einsatz der äußeren Mittel der im kirchlichen Auftrag wirkenden Eheberatung den Eindruck, daß es auch mit dem gegebenen Rat nicht weit her sein könne.“⁷⁷⁵ Das Erzbistum Köln sicherte die Ausstattung seiner Stellen ab 1965 finanziell mit 88.000 DM ab. Davon kam die Hälfte aus Diözesanmitteln, die weiteren Beiträge vom Land Nordrhein-Westfalen, der Kommune und aus anderen kirchlichen Mitteln auf lokaler Ebene.⁷⁷⁶ Das Geld sollte helfen, sowohl die Räumlichkeiten zu verbessern als auch mehr Personal zu beschäftigen. Vorgesehen war, dass neben ehrenamtlichen Mitarbeitern mindestens eine hauptamtliche Beratungskraft vor Ort war. Geplant wurde, an sämtlichen Werktagen Sprechstunden anzubieten und Filialen in zwei Kölner Vororten zu eröffnen.⁷⁷⁷ Außer für 1960 liegen keine statistischen Auswertungen aus der Kölner Beratungsstelle vor. Generell rechnete Fischer-Erling 1956 aber damit, dass in eine gut besuchte Sprechstunde 6,3 Personen kämen. Sie ging von etwa 70 bis 360 Fällen im Jahr aus. Bei der Hälfte vermutete sie, dass sich deren Situation dadurch verbessert habe. Ratsuchende kamen aus allen sozialen Schichten, Erstbesucher waren wie in vielen anderen Einrichtungen vor allem Frauen. Die Gespräche drehten sich überwiegend um Ehekrisen, während Geburtenregelung, Partnerwahl oder Gesundheit nur eine untergeordnete Rolle spielten.⁷⁷⁸ Ein ausführlicher Bericht der Kölner Einrichtung liegt für 1960 vor.⁷⁷⁹ Es kamen 136 Ratsuchende, insgesamt fanden 720 Einzelberatungen statt. 21 Personen waren bereits aus dem Vorjahr bekannt. Zu diesem Zeitpunkt waren neben Fischer-Erling noch Else Mann, ebenfalls promovierte Juristin und zu diesem Zeitpunkt Vor-
Josepha Fischer-Erling an Generalvikar Teusch, Brief, 21. Juni 1956, AEK, Gen. II 13.2a,1. Struck, Ehenot, 1966, S. 65. Vgl. Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen: Finanzierung der Eheberatungsstellen im EB Köln, 9. April 1965, AEK, DBK, KZI 186. Vgl. Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen: Ergebnisprotokoll der Besprechung über den Ausbau der Katholischen Eheberatungsstelle Köln, 10. März 1965, AEK, DBK, KZI 186. Vgl. Fischer-Erling, Eheberatung, 1956, Sp. 158. Vgl. im Folgenden Fischer-Erling, Josepha: Jahresbericht der katholischen Beratungsstelle für Ehe- und Familienfragen für das Jahr 1960, [1961], LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5/30 – 02.
388
4 Katholische Eheberatung
standsmitglied des KZI, sowie eine Fürsorgerin in der Stelle tätig. Am häufigsten beobachtete Fischer-Erling Krisen im zweiten, siebten und 20. Ehejahr. 21 Paare konnten die Beraterinnen versöhnen. Im Fall der 15 Scheidungen klärten sie bereits vor dem Gerichtstermin wesentliche Fragen zu Unterhalt, Besuchsregelung und weiteren juristischen Punkten und führten einen „Waffenstillstand“ herbei. Auch in diesem Jahresbericht wird deutlich, dass sich die Leiterin bemühte, Paare zu einem versöhnlichen Umgang miteinander anzuhalten, auch bei Trennungen.⁷⁸⁰ Wie üblich bildeten Frauen die Mehrheit der Besucher. Die meisten Ratsuchenden waren kaufmännische Angestellte und Behördenmitarbeiter, danach folgten gelernte Arbeiter. Auch weitere Berufsgruppen und Rentner waren vertreten, zahlenmäßig am geringsten die Gruppe der Hilfsarbeiter und Dauerbetreuten der Fürsorge. Fischer-Erling ging auf die Voraussetzungen ein, die gegeben sein mussten, sollten Besucher von der Sprechstunde profitieren. Erfolgreich Rat zu suchen setze voraus, „daß man irgendwie ansprechbar ist und zu seinen Problemen Stellung nehmen kann“.⁷⁸¹ Meist bestehe „die Beratung in auflockernden Gesprächen, die allmählich die Beteiligten zur Einsicht in ihre Konfliktstoffe führten“.⁷⁸² Sie betrachtete die Ratsuchenden als Akteure, die von der Beraterin dazu hingeführt würden, ihre Probleme zu erkennen und zu formulieren. Deutlich wird auch, dass sie die Eheberatung zur Fürsorge abgrenzte. Die meisten Ratsuchenden benötigten zwei Gespräche. Die Beraterinnen ergänzten 1960 ihre tägliche Arbeit, indem sie 40 Vorträge hielten. Statistisch nicht erfasst wurden Telefonate, die mittelbar Hilfe in kritischen Momenten geben sollten. Des Weiteren fanden in 80 Fällen Hausbesuche statt. Beim Hausbesuch wurde zumeist ein intensives, oft recht heftiges, aber auch befreiendes Gespräch zu dreien geführt, das erhebliche Klarheit in die eigentlichen Quellen der Ehenot bringt, die Zungen löst, weil man sich Zeit nimmt. Infolge des spürbaren Erfolges solcher Hausbesuche hat sich gegenüber den Vorjahren die Zahl der Hausbesuche verdoppelt […]. Nach anfänglichem Mißtrauen [sic] und Widerstand wird in der überwiegenden Zahl der Besuch dankbar angenommen.⁷⁸³
Fischer-Erling hielt es für fast unmöglich, einen Überblick über den Konfliktstoff der Beratungen zu geben, so vielschichtig sei dieser. Auf dem ersten Platz sah sie „seelische Fehlhaltungen und Abweichungen vom Normalen“.⁷⁸⁴ Dazu zählten Hysterie, krankhafte Eifersucht, Impotenz des Mannes und in einem Fall Schizo
Vgl. Kapitel 4.3.1 Vorstellungen von Ehe, Abschnitt Josepha Fischer-Erling. Fischer-Erling, Jahresbericht, [1961], S. 3, LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5/30 – 02. Ebd., S. 4. Ebd., S. 3. Ebd., S. 1.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
389
phrenie. Die Diagnosen entstanden in Zusammenarbeit mit Psychiatern und Psychotherapeuten. Weiter nannte die Juristin Kontaktschwäche, seelische Verwahrlosung, krankhaften Geiz und Sadismus. In 30 Fällen war die Untreue des Mannes Anlass, die Beratung aufzusuchen. An dritter Stelle sprach die Juristin Sucht als Grund der Ehekrise an, vor allem Alkohol, aber in einigen Fällen auch Tablettensucht sowie einmal sexuelle Hemmungslosigkeit. Sofern die Betroffenen dafür ansprechbar waren, wurde die Suchthilfe herangezogen. In diesem Zusammenhang benutzte die Eheberaterin zum ersten Mal die Bezeichnung „Klienten“,⁷⁸⁵ wie der spätere Sprachgebrauch lautete, und nicht „Ratsuchende“, wie die Besucher der Stelle im Untersuchungszeitraum eigentlich genannt wurden.⁷⁸⁶ Auch dies ist ein Zeichen für die zunehmende Professionalisierung der Beratung. Sucht, aber auch Untreue konnten wirtschaftliche Not zur Folge haben. Die Familienväter verbrauchten für beides einen erheblichen Teil ihres Verdienstes. Mit dem Suchtverhalten gingen zudem körperliche Misshandlungen und Körperverletzungen einher. „In einigen Fällen mußte von unserer seite [sic] eine Scheidung befürwortet werden, um die Kinder gegen Brutalitäten des Vaters zu schützen.“⁷⁸⁷ Über Fischer-Erling ist aus Publikationen zur Eheberatung bekannt, dass sie in gewissen Fällen eine Scheidung befürwortete.⁷⁸⁸ In Fischer-Erlings Beratungsarbeit hatten die vorehelichen Anfragen mit insgesamt 29 Fällen im Jahr 1960 erheblich zugenommen. Gründe waren vor allem kirchenrechtliche Ehehindernisse. Dazu kontaktierte sie meist das Kirchengericht, „um dem Ratsuchenden durch erhöhte Hilfsbereitschaft die vor Gott richtige Entscheidung zu erleichtern“.⁷⁸⁹ Auch kamen junge Schwangere in die Beratung, die „vor der schwerwiegenden Entscheidung [standen], ob sie unter dem Druck des Geschehens den Erzeuger ihres Kindes heiraten sollten oder nicht“. Die Beraterin berichtete ebenso wenig wie in den meisten anderen geschilderten Fällen, welchen Rat sie erteilte oder wie sich der Fall entwickelte. Lediglich im Zusammenhang mit Seitensprüngen verwies sie interpretierend darauf, dass „hinter diesem juristischen
Ebd., S. 2. Damit verwendet Fischer-Erling 1960 erstmals einen Begriff, den die DAJEB bereits 1953 nutzte. Dieser verweist auf das Konzept der Casework, in dem so der berufliche Aspekt betont und die Beratung als Form der Partnerschaft greifbar werden soll. Vgl. DAJEB, Denkschrift, 1953 sowie Kapitel 4.3.1 Vorstellungen von Ehe. Der Begriff des Klienten wurde ab Ende der 1960er-Jahre wiederum kritisch diskutiert. In der Sozialen Arbeit kam die Bezeichnung „Betroffene“ auf. Vgl. dazu Wagner, Leonie: „Vom Klienten zur Nutzer_in“. In: Böllert, Karin (Hrsg.): Kompendium Kinder- und Jugendhilfe. Wiesbaden 2018, S. 337– 364, hier S. 339 ff. Ebd., S. 3. Vgl. Kapitel 4.3.1 Vorstellungen von Ehe, Abschnitt Josepha Fischer-Erling. Fischer-Erling, Josepha: Jahresbericht der katholischen Beratungsstelle für Ehe- und Familienfragen für das Jahr 1960, [1961], S. 2, LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5/30 – 02, ebenso im Folgenden.
390
4 Katholische Eheberatung
Tatbestand zumeist auch falsche Verhaltensweisen des anderen Partners“ stünden. Ihr Bericht ist der einzige im vorliegenden Praxismaterial, der die Thematik der Homosexualität erwähnte. Auf Wunsch von insgesamt vier Ratsuchenden benannte sie einen Arzt, der diese „auf Grund ihrer Krankheit (Epilepsie, Spasmus, Homosexualität)“ beraten konnte, ob eine Heirat zu verantworten sei. Homosexualität wird somit im Zusammenhang mit medizinischer Eheberatung behandelt. Ungewöhnlich ist, dass Fischer-Erlings Bericht das Verhältnis der Besucher zur Kirche ansprach. Die Mehrzahl der Ratsuchenden war katholisch und auch kirchlich getraut, „aber bei dem überwiegenden Teil stand hinter dem Taufschein kein Bekenntnis, sondern Gleichgültigkeit, aber auch Haß und Abneigung“.⁷⁹⁰ Gerade bei den Personen, die der Kirche offenbar ablehnend gegenüberstanden, war der Besuch einer katholischen Beratungsstelle erstaunlich, da es nichtkonfessionelle und evangelische Alternativen gab. Ob die Paare im Anschluss der katholischen Kirche wieder näherstanden, bleibt offen. Grundsätzlich stellte dies einen erhofften Nebeneffekt katholischer Beratungsarbeit dar.⁷⁹¹ Auffällig ist ferner Fischer-Erlings Bemerkung, dass die evangelische Telefonseelsorge auf sie verweise, obwohl es in Köln auch eine evangelische Stelle gab.⁷⁹² Einen repräsentativen Eindruck der katholischen Arbeit zu gewinnen, ist mit dem vorliegenden Material nicht möglich. Zu gering ist die Anzahl der vorliegenden Berichte, die Entstehungsdaten und -orte sind sehr divers und Schwerpunktsetzungen weichen voneinander ab. Dennoch wiederholten sich im Untersuchungszeitraum gewisse Themen. In der Regel waren die Beraterinnen ehrenamtlich tätig, lediglich in Frankfurt war eine hauptamtliche Kraft vorhanden. Falls erwähnt, wird ein akademischer Hintergrund der Eheberaterinnen deutlich. Obwohl die katholische Beratung ausgebaut wurde, war ein derart eklatanter Nachwuchsmangel zu verzeichnen, dass sogar Stellen deswegen schlossen. Die Ausbildung von Nachwuchskräften galt als dringlichstes Problem, das KZI begrüßte die fortbildenden Maßnahmen. Die Eheberaterinnen unterstützten den Ausbau des Zentralinstituts, da ihnen die Zusammenarbeit wichtig war. Sie engagierten sich öfter über die direkte Beratungsarbeit hinaus, indem sie Vorträge oder Seminare für Eheleute hielten. Die Mehrheit der Besucher in Köln waren Frauen. Die meisten Personen kamen ein bis zwei Mal in die Sprechstunden, manche wurden jedoch auch über Jahre hinweg begleitet. Das Bild, das die Beraterinnen von den Ratsuchenden hatten, wird aus den Berichten nicht sehr deutlich. Grundsätzlich erwarteten sie, dass die Ver Ebd., S. 3. Vgl. Kapitel 4.3.3 Beratung. Vgl. Kohlscheen: Tätigkeitsbericht der Evangelischen Erziehungs- und Eheberatungsstelle im Kirchenkreis Köln für das Jahr 1961, [1962], LAB, B Rep. 142– 09, Nr. 5/30 – 02.
4.5 Praxis der Eheberatung des Katholischen Zentralinstituts
391
heirateten sich ihren Konflikten stellten und im gemeinsamen Gespräch nach Lösungen suchten beziehungsweise den erteilten Rat annahmen. Beratungsarbeit bedeutete idealerweise, gemeinsam zu dritt nach Ursachen zu forschen. Die Eheleute sollten Eigenverantwortung übernehmen. Im schlechtesten Fall hofften die Eheberaterinnen, die Situation durch Zuhören und Verständnis zu erleichtern. Dieses Motiv lässt sich bis in die Weimarer Republik zurückverfolgen. Die Berichte verdeutlichen, dass viele Personen die Sprechstunde erst aufsuchten, wenn bereits die Scheidung drohte. Dies nahmen die Beraterinnen mit Frustration zur Kenntnis. Zudem sahen sie eine ihrer wichtigsten Aufgaben darin, die Unauflöslichkeit der katholischen Ehe zu verteidigen. Befangen durch diesen Auftrag handelten sie teilweise gegen die Wünsche der Ratsuchenden, obwohl sie darauf beharrten, objektiv zu sein. Auch wenn ihnen die Grenzen ihrer Arbeit deutlich bewusst waren, erscheinen sie als engagierte Frauen, die Erfüllung in ihrer Aufgabe fanden. Der Psychologie gegenüber waren sie aufgeschlossen. Ein Beratungsthema, das sich beständig wiederholte, war das Kirchenrecht. Des Weiteren fallen in der Regel sogenannte „Fehlhaltungen“, Untreue und die Erschöpfung weiblicher Ratsuchender als wichtige Punkte auf.
392
4 Katholische Eheberatung
4.6 Zwischenfazit Der zweite Teil der vorliegenden Untersuchung betrachtete die institutionalisierte katholische Eheberatung in der Bundesrepublik. Die Analyse umfasste die Nachkriegszeit bis in die Mitte der 1960er-Jahre. Wie im ersten Teil der Studie lag auch hier der Fokus wieder auf der Frage, wie sich das Selbstverständnis der Akteure, das diese in Publikationen und Verbandsgründungen artikulierten, zur konkreten Praxis der Eheberatung verhielt. Die These und das zentrale Ergebnis lauten, dass Selbstverständnis und Praxis katholischer Eheberatung nicht kongruent waren. Dies war den Beraterinnen in der Regel jedoch nicht bewusst. Zu erklären ist das mit mehreren Spannungsverhältnissen: zwischen Kirchenrecht und den konkreten Nöten der Ratsuchenden, Erneuerungstendenzen des katholischen Eheideals und der Sicht des Lehramts, Theologie und Psychologie, ehrenamtlicher Laienarbeit und Professionalisierung sowie zunehmender struktureller Verkirchlichung bei gleichzeitigem Rückgang von Glaubensinhalten. Im Folgenden werden die zu dieser Beurteilung führenden Ergebnisse aufgeschlüsselt. Zur Praxis katholischer Eheberatung hat die Forschung bisher keine Egodokumente ausgewertet. Der vorliegenden Arbeit gelang es erstmals, diese Praxis einzuschätzen, indem sie Briefwechsel zwischen dem Vorstand des Katholischen Zentralinstituts für Ehe- und Familienfragen (KZI), Eheberaterinnen und Ratsuchenden sowie Berichte von Beratungsstellen untersuchte. Zudem wurde über Fachartikel und zeitgenössische Fachliteratur das Selbstverständnis der fast ausschließlich weiblichen Beratenden erschlossen, was ein differenzierteres Verständnis ermöglicht. Die in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik virulente Wahrnehmung, die Ehe sei in einer Krise, deuteten Akteure innerhalb der katholischen Kirche einerseits als gesamtgesellschaftliches Phänomen, andererseits aber auch als eine Abkehr von Gott. Da die Kirche die Ehe sowohl als gesellschaftliche Kerninstitution als auch als Sakrament zu Gottes Verherrlichung betrachtete, wurde sie zu einem zentralen Objekt der Rechristianisierungsbemühungen. Katholische Eheberatung bedeutete damit nicht nur eine Hilfe in Ehekrisen, sondern im Sinne eines Laienapostolates auch den Dienst an Gott und der Kirche. In der Praxis spiegeln sich daher sowohl gesamtgesellschaftliche Themen wie die Diskussion um die Berufstätigkeit von Ehefrauen als auch kirchenrechtliche Fragestellungen wider. Dabei ist festzuhalten, dass Eheberaterinnen weniger der Lesart einer allgemeinen Krise der Institution Ehe folgten als vielmehr individuelle Ehekrisen diagnostizierten. In der Nachkriegszeit berief sich die Eheberatung sowohl in Selbstverständnis als auch Praxis auf ihre Entstehungszeit in der Weimarer Republik. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Eugenik stieß sie jedoch nicht an. Über das „Dritte Reich“ hinaus existierende Stellen arbeiteten in personeller Kontinuität weiter,
4.6 Zwischenfazit
393
andere öffneten wieder für Besucher, viele wurden neu gegründet. Die Kirche baute die Beratung in den 1950er-Jahren sowohl institutionell als auch inhaltlich aus, wobei wesentlich war, sich von nichtkonfessionellen sowie evangelischen Angeboten abzugrenzen. Die Amtskirche betrachtete Eheberatung als Domäne der Laien- und Verbandsarbeit. Hauptsächliche Trägerverbände waren der KDFB und die Caritas, zwischen denen immer wieder ein Konkurrenzverhältnis deutlich wird. Für das Selbstverständnis der Eheberaterinnen war ihr Laienstatus entscheidend, was sich auch mit zunehmender struktureller Verkirchlichung im Kern nicht veränderte. Das Idealbild sah eine engagierte katholische, akademisch gebildete, verheiratete Frau und Mutter vor, die Ratsuchende zugewandt unterstützte. Eheberaterinnen vertraten ihren Auftrag durchaus selbstbewusst und begriffen sich als weitestgehend unabhängig, was die konkrete Ausübung ihrer Tätigkeit anging. Die Mitarbeit von Theologen sahen sie kritisch, sie galten als für die Beratungsarbeit ungeeignet. Damit war die katholische Beratung personell grundlegend anders besetzt als die evangelische, die sich bis 1959 unter pastoraler Leitung befand. Die Gründung und Personalpolitik des KZI bedeutete eine zunehmende kirchliche Einflussnahme auf die Beratung. Mit dem Auftrag, eine zentrale Einrichtung zu schaffen, begann die stärkere Anbindung der vormals allein von den Verbänden getragenen Arbeit an die Organisation der Kirche. Obwohl Eheberatung eine Frauendomäne mit bekannten Gesichtern war, erhielt das Zentralinstitut 1952 keine weibliche Führung. Die Institutsleitung wurde nicht, wie bei der Gründung intendiert, mit einer gemischtgeschlechtlichen Doppelspitze versehen. Unter der Ägide der Bischofskonferenz waren am Ende des Untersuchungszeitraumes alle wesentlichen Referatsleitungen männlich besetzt. Gegen den Widerstand der Verbände erhielt später sogar ein Theologe den Direktorenposten. Auch wenn sich dieser selbst nur als Interimsleiter bis zur Ernennung eines geeigneten verheirateten Laien verstand, entsprach die Personalie nicht dem Wunsch der Eheberaterinnen. Hier zeigt sich eine der zuvor angesprochenen Ambivalenzen in der Beratungsarbeit: Sie beanspruchte als Laien- und professionelle Domäne Eigenständigkeit, war aber an die Kirchenstruktur gebunden. Als das KZI 1963 als offizieller Dienst der Kirche ausgebaut wurde, verkündete seine Leitung eine neue Phase der katholischen Eheberatung. Spätestens mit der Gründung des Zentralinstituts genügte es für die Beraterinnen nicht mehr als Qualifikation, eine christliche Überzeugung und ein gutes Herz zu haben. Fachliche Expertise gewann, gefördert vom KZI, an Bedeutung. In diesem Rahmen kamen früh Beratungspraxis, Grenzen der Arbeit und Methoden zur Sprache. Ein entscheidender Professionalisierungsschritt war die Grundsatzerklärung zu Zielen und Aufgaben der Eheberatung von 1963 und die Einrichtung eines dreijährigen Ausbildungsprogramms mit zusätzlicher konfessioneller Quali-
394
4 Katholische Eheberatung
fizierung. Gerade im Sinne einer qualitativen Verbesserung durch normative Ausund Weiterbildung sowie die Schaffung einheitlicher Strukturen trug das Zentralinstitut damit wesentlich zur Konsolidierung der Eheberatung bei. Mit dem Ausbildungsprogramm des KZI setzte sich die psychologische Orientierung in der katholischen Beratung endgültig durch, der Glaube wurde zu einem Teilaspekt der Arbeit heruntergestuft. Bereits zuvor hatten sich Eheberaterinnen bemüht, psychologische Methoden und Ziele zum Nutzen der Ratsuchenden anzuwenden. Das Konkurrenzverhältnis zwischen Theologie und Psychologie hatten sie dabei weitestgehend ignoriert. Auch in der Praxis bestätigte sich diese Haltung. Beraterinnen bedienten sich pragmatisch und situationsabhängig der Theologie und Psychologie. Die zunehmende Psychologisierung machte die Beratung konkurrenzfähig zu anderen Angeboten, sodass sie sich erfolgreich an die moderne psychotherapeutische Ära anpasste. Von Beginn an verstanden Beraterinnen die Ehe häufig als personale Liebesund Lebensgemeinschaft, womit sie in einen deutlichen Gegensatz zum offiziellen Lehramt mit seinem institutionellen Verständnis traten. Erneuerungstendenzen des katholischen Eheideals wurden in der Beratung früh sichtbar. Zugleich förderten Beraterinnen den Wandel dieses Ideals, was mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch ins offizielle Lehramt Einzug hielt. Eheberatung wurde als individuelle Unterstützung verstanden. Da die Beraterinnen die Ehe als personale Gemeinschaft begriffen, stellten sie die Ratsuchenden selbst in den Mittelpunkt. Diese galten als aktive Akteure, die ihre Probleme mit der Beraterin in einem offenen Prozess partnerschaftlich lösten. Dass Ratsuchende sich ihrer Schwierigkeiten eigenverantwortlich annahmen, bedeutete ein wichtiges Ergebnis. Gegenüber Lehramt und Seelsorge war dies eine eindeutig neue Herangehensweise.Wie häufig der Anspruch in der Praxis tatsächlich erfüllt werden konnte, lässt sich nicht nachvollziehen. Gerade die analysierten Briefwechsel verdeutlichen allerdings, dass die Praxis diesem Verständnis häufig nicht entsprach. Statt eines offenen, partnerschaftlichen Prozesses zeigen sie, dass die Beratenden klar und unmissverständlich Rat erteilten. Dieses Auseinanderdriften zwischen Selbstverständnis und Praxis nahmen sie jedoch offensichtlich nicht wahr. Einerseits entsprachen die Ratsuchenden zunächst dem Wunschbild des eigenverantwortlichen Akteurs, da sie zu Expertinnen Kontakt aufgenommen und sich teilweise bereits mit der eigenen Situation auseinandergesetzt hatten. Andererseits erwarteten sie aber auch häufig eine Problemlösung „von oben“. Ihre Verzweiflung wollten die Beraterinnen durch Zuhören und Verständnis zumindest erleichtern. Dieser Aspekt der Eheberatung wurde stets betont und lässt sich als wichtiges Motiv bis in die Gründungszeit der Eheberatung zurückverfolgen. Die dabei zutage tretenden Grenzen der Arbeit sorgten nicht selten für Frustration, die das Engagement der Tätigen jedoch nicht schmälerte.
4.6 Zwischenfazit
395
Die Beraterinnen stellten hohe Erwartungen an sich selbst und verbanden dies mit einem positiven Selbstbild. Sie betonten ihre fachlichen Qualifikationen sowie ihre feste Verwurzelung im katholischen Glauben. Auch nahmen sie für sich in Anspruch, Ratsuchenden differenziert gegenüberzutreten, diese in ihren individuellen Nöten ernstzunehmen sowie selbst offen für neue gesellschaftliche Entwicklungen zu sein. Gleichzeitig zeigen ihre Briefwechsel und Fachartikel aber, dass sie von ihren Besuchern vor allem erwarteten, festgelegte Eheideale und Rollenzuweisungen zu erfüllen. Diese Ambivalenz thematisierten sie selbst zumindest nicht. Obwohl die Eheberaterinnen sichtbar auf die Einzelfälle eingingen, setzte das Kirchenrecht klare Grenzen. Beratungsanlässe wie beispielsweise Exkommunikation finden sich lediglich im katholischen Kontext, da sie anderswo keine Rolle spielten. Weitere Themen, wie beispielsweise der Umgang mit sexuellen Problemen, waren zwar durch den katholischen Glauben beeinflusst, aber auch in der nichtkonfessionellen und evangelischen Beratung Gesprächsgegenstand. Den Eheberaterinnen fiel es zum Teil schwer, die Lehrmeinung der Kirche mit den konkreten Fragen oder dem Verhalten der Ratsuchenden in Einklang zu bringen. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben bestand darin, die Unauflöslichkeit der katholischen Ehe zu verteidigen, weshalb sie auch gegen den Willen der Ratsuchenden handelten. Diese Diskrepanz war ihnen sehr bewusst, ohne dass sie sie in der Praxis lösen konnten. Ihre Bereitschaft, das kirchliche Eheideal zugunsten der Ratsuchenden auszudehnen, war unterschiedlich ausgeprägt. Während manche Beraterinnen die unauflösliche Ehe zum Teil auch gegen den Willen der Ratsuchenden vertraten, gingen andere bis an die Grenze des kirchenrechtlich Möglichen. Einige sprachen sich für Ehescheidungen oder sogar gegen kirchliche Heirat aus. Ratsuchende sollten auch nach ihrer Scheidung betreut werden.
Fazit Die vorliegende Arbeit widmete sich der institutionalisierten Eheberatung in Westdeutschland von der frühen Nachkriegszeit bis in die Bundesrepublik der 1960er-Jahre. Sie erschloss, wie sich das propagierte Selbstverständnis und die Praxis der Akteure sowie Institutionen zueinander verhielten. Im Fokus standen zwei Hauptströmungen der Eheberatung: zum einen die offiziell nichtkonfessionelle, aber dennoch teilweise stark evangelisch geprägte Richtung, zum anderen die katholische. Diese beiden befanden sich in einem eindeutigen Konkurrenzverhältnis zueinander. Hintergrund war das Ringen der Konfessionen im westlichen Nachkriegsdeutschland um gesellschaftliche Deutungshoheit. Während die katholische Kirche mit Rechristianisierungsbemühungen begann, bemühte sich die evangelische darum, ihren Einfluss aufrechtzuerhalten, obwohl der Anteil der Protestanten an der Gesamtbevölkerung wegen der territorialen Veränderungen nach dem Zweiten Weltkrieg und infolge der deutschen Zweistaatlichkeit stark gesunken war. Als eines der Felder, auf dem die Kirchen und die mit ihnen verbundenen gesellschaftlichen und politischen Kräfte diese Kämpfe austrugen, erwies sich die Eheberatung. Nach dem Zweiten Weltkrieg zielten die Akteure darauf ab, das in ihren Augen moralisch-sittlich geschwächte Land wieder zu stärken. Sie wollten mit den jeweils eigenen religiös-sozialen Ordnungsvorstellungen die allseits diagnostizierte „Krise der Ehe“ und Familie beenden. Ihr Ansatzpunkt in der Eheberatung lautete zum einen, Verheiratete direkt anzusprechen, und zum anderen, über Publikationen, Verbandsgründungen, Verlautbarungen, Mitwirkungen an Gesetzen und offizielle Stellungnahmen eine politisch-gesellschaftliche Wirkmacht zu entfalten, die über die personale Ebene hinausging. Die gesellschaftlich weit verbreitete Befürchtung einer „Krise der Ehe“ in Nachkriegszeit und früher Bundesrepublik verweist auf die zeitgenössische Vermutung, dass durch Zusammenbruch und Neuorientierung der Gesellschaft die Institution Ehe besonders gefährdet sei. Als Folge suchten nicht nur die Kirchen, sondern auch der Staat nach einem größeren Einfluss auf Ehe und Familie. Diesen fanden sie auch in der institutionellen Eheberatung, die sie für familienpolitische Bestrebungen instrumentalisierten. Entsprechend wurde sowohl von der katholischen als auch der nichtkonfessionellen Ausrichtung erwartet, die alte Eheordnung wiederherzustellen. Die Untersuchung verknüpfte somit kirchengeschichtliche mit gesellschaftshistorischen Perspektiven. Diese setzte sie in Beziehung zur Entwicklung der Sozialen Arbeit, mit der die Eheberatung Berührungspunkte aufwies. Nachgewiesen wurde, dass sich die Beratung in einen Basisprozess der Moderne, die „Verwissenschaftlichung des Sozialen“, eingliederte, da die Berater im Bemühen um Prohttps://doi.org/10.1515/9783111097534-006
Fazit
397
fessionalisierung einen Expertenstatus entwickelten. Sie reklamierten zunehmend, über das Wissen zu verfügen, Ehekonflikte einzuhegen und damit auch die aktuellen gesellschaftlichen Dynamiken zu verstehen und teilweise zu beeinflussen. Die Studie belegte die These, dass sich das offen formulierte Selbstverständnis der Eheberatung und die tägliche Praxis im Umgang mit den Ratsuchenden nicht deckten. Diese Beobachtung gilt für alle untersuchten Beratungsrichtungen. Insbesondere in dem Teil der Eheberatung, der sich selbst als nichtkonfessionell positionieren wollte, aber eine ausgeprägte evangelische Agenda betrieb, sind deutliche Unterschiede sichtbar. Besonders betraf dies die Haltung zum eugenischen Denken, das in den offiziell formulierten Zielen und theoretischen Erwägungen lange präsent blieb, obwohl es in der Praxis schnell einer Konfliktberatung gewichen war. Im katholischen Bereich mussten die Beraterinnen ohnehin eigene Wege finden, wollten sie die Realitäten in den Ehen nicht dem strikten Scheidungsverbot der Amtskirche unterordnen. In der abschließenden Betrachtung verdeutlichen sich noch einmal verschiedene Positionen der Akteure und Entwicklungen im Untersuchungszeitraum. Die Arbeit stützte sich auf die Analyse von Briefwechseln, Beratungsprotokollen, Berichten, Fachartikeln, zeitgenössischer Fachliteratur sowie Material zur Ausund Weiterbildung der Berater. Dies ermöglichte es zum einen, den Blick auf die institutionelle Ebene zu richten und dabei vor allem die beiden im Untersuchungszeitraum wichtigsten Verbände, das Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen (KZI) sowie die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (DAJEB), in ihrer Bedeutung und Ausrichtung zu beschreiben. Da es sich bei der Praxis der Eheberatung im Kern aber um das persönliche Gespräch in einer Beratungssituation handelte, war es ein besonderes Anliegen dieser Studie, die Berater und Ratsuchenden selbst genauer zu betrachten. Dabei galt es, die Frage nach Vorstellungen, Idealen, Selbstbildern und institutioneller Anbindung der Eheberatung zu beantworten und dies mit der gelebten Praxis der einzelnen Einrichtung, deren Leitung und Beratenden in Beziehung zu setzen. Auch das Verhalten der Ratsuchenden erhielt ein besonderes Augenmerk. Der Forschung ist dies bisher für die katholische Eheberatung überhaupt nicht und für die nichtkonfessionelle, evangelisch beeinflusste Richtung kaum gelungen. Die vorliegende Studie leistet mit neuen Quellenfunden und einem dezidierten Blick auf die Praxis einen Beitrag, diese Lücke zu schließen. Um die Entwicklung der Eheberatung in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu verstehen und einzuordnen, war der Blick auf die Umstände und Überlegungen, die zu ihrer Einrichtung in der Weimarer Republik beitrugen, entscheidend. Ein wichtiges Ergebnis dieser Arbeit ist, dass sich sowohl für die einflussreichen Akteure als auch für die gültigen Denkmuster eine hohe Kontinuität über die Zeit des Nationalsozialismus hinweg konstatieren lässt. Eheberatung entstand in der Wei-
398
Fazit
marer Republik auf staatliche Initiative. Sie war im Bereich der Gesundheitsfürsorge angesiedelt und verfolgte das Ziel, die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten zu verhindern und positive Erbanlagen zu „fördern“. Damit basierte die nichtkonfessionelle Arbeit eindeutig auf eugenischem Denken. Die ursprüngliche Idee der Eheberatung war es dementsprechend keineswegs, Verheiratete bei konkreten Problemen zu unterstützen, sondern heiratswillige Paare vor der Vermählung dazu zu bringen, ihre „Ehetauglichkeit“ mit „Gesundheitszeugnissen“ medizinisch bestätigen zu lassen. Diese Zeugnisse stellten eine Maßnahme der sogenannten negativen Eugenik dar. Sie standen im Zeichen des Versuchs, in ihrem „Erbgut“ als minderwertig wahrgenommene Menschen von der Fortpflanzung abzuhalten. Im Zusammenhang steht dies auch mit der Wahrnehmung, die deutsche Bevölkerung mache bedingt durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg einen negativen demografischen Entwicklungsprozess durch, den es aufzuhalten gelte. Als Folge der eugenischen Ausrichtung waren zunächst Mediziner die bestimmenden Akteure. Erst im Laufe der Bundesrepublik gelang es der Eheberatung, sich aus dieser Verknüpfung mehr und mehr zu lösen. Konfessionelle Beratungen versuchten, Ideale einer christlich geprägten, sozialen Mütterlichkeit zu verwirklichen, die in der Sozialen Arbeit einer längeren Tradition entsprachen. Folglich waren es Frauen und mehrheitlich deren entsprechende Verbände, welche die Entwicklung vor allem der katholischen Eheberatung vorantrieben. Wenn auch in der Bundesrepublik verschiedentlich anders kommuniziert, endete ihre Arbeit nicht abrupt mit dem Nationalsozialismus. Nichtkonfessionelle städtische Stellen wurden durch nationalsozialistische, rein eugenische Beratungen ersetzt, die nunmehr verpflichtend waren. Die weniger erfolgreichen konfessionellen Einrichtungen konnten ihre Arbeit fortsetzen, wenn auch unter immer schwereren Bedingungen und in deutlich geringerem Umfang. Eine umfassendere Untersuchung dazu steht noch aus. Die nichtkonfessionellen Beratungsstellen in der Weimarer Republik hegten große Erwartungen an zahlreiche Besucher. Diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Akteure klagten über eine zu geringe Nachfrage, zudem interessierten sich die Ratsuchenden kaum für eugenische Fragen. Selbstverständnis und Praxis stimmten damit bereits zu Beginn der Beratungsarbeit in den 1920er-Jahren nicht überein. Bei katholischen Stellen lassen sich hingegen zunächst keine Diskrepanzen feststellen. In beiden Beratungsrichtungen zeigten sich gewisse Muster, die ihre Ausprägung in Nachkriegszeit und Bundesrepublik bestimmen sollten, sowohl auf katholischer als auch nichtkonfessioneller Seite. Die katholischen Akteure wollten ihren Einfluss nicht verlieren. Sie hatten den Anspruch, ihre Bemühungen möglichst zu zentralisieren und als genuinen Beitrag der Laien zum Dienst an der Kirche auszubauen. Hingegen betrieb die nichtkonfessionelle Richtung ihre Einbindung in amtliche und städtische Strukturen. Beide Entwicklungen waren bereits in der Weimarer Repu-
Fazit
399
blik angelegt. Ebenso lassen sich konstante Grundlinien in der evangelischen Beratung erkennen: eine fehlende klare Gesamtkonzeption sowie ein enger Zusammenhang mit der nichtkonfessionellen Beratung. Auch nach dem Ende des Nationalsozialismus suchten beide Beratungsrichtungen, die gesellschaftliche Ordnung über die Institution Ehe mitzugestalten. Wie schon in ihrer Gründungszeit waren die Sprechstunden der einzelnen Stellen zumindest dem eigenen Anspruch zufolge nicht primär dazu da, um Eheleuten in konkreten Konflikten zu helfen, sondern erfüllten auch die Aufgabe, Ehekrisen als Symptom einer Gesellschaftskrise der Nachkriegszeit zu behandeln. Da für die katholische Kirche die Funktion der Ehe als Sakrament zentral war, bedeutete ihre Beratungsarbeit im Sinne des Laienapostolats auch einen Dienst an Gott und Kirche. Für die katholischen Rechristianisierungsbemühungen der Nachkriegszeit hatte die bereits in den 1920er-Jahren verstärkt betriebene Laienmobilisierung eine große Bedeutung, insbesonders für die Frauen. Der Generalpräses des Verbandes der Frauen- und Müttergemeinschaften Deutschlands, Hermann Klens, verwies dezidiert auf den Willen der Frauen, einen Beitrag in der Eheberatung zu leisten. Seine Forderung begründete er mit der verbreiteten Vorstellung, Frauen seien wegen ihrer mütterlichen und fürsorgenden Rolle besonders gut in der Lage, Ratsuchenden zuzuhören und ihnen auf der Basis eigener Erfahrungen Empfehlungen auszusprechen. Caritas und Katholischer Deutscher Frauenbund (KDFB) stellten die wichtigsten Trägerverbände der Eheberatung dar. Die Familienarbeit und auch die Caritas, deren Organisation den Krieg weitgehend überstanden hatte, waren ohnehin weiblich geprägt. Immer wieder waren es auch einzelne engagierte Beraterinnen wie Anna Beckmann oder Josepha Fischer-Erling, die ihre Arbeit in der Bundesrepublik wieder aufnahmen und für eine bessere Organisation, die Vernetzung und den Ausbau der Beratung eintraten. Innerhalb der nichtkonfessionellen, evangelisch beeinflussten Eheberatung nahmen Frauen hingegen keine vergleichbar prominente Rolle ein. Den Beginn einer Professionalisierung markierte die von Medizinern und Sozialhygienikern mit engen Verbindungen zur evangelischen Kirche betriebene Gründung der DAJEB im Jahr 1949. Der Verband publizierte Anforderungen an Eheberatung und Berater. Er veranstaltete Kurse und Tagungen, auch mit dem Ziel, bundesweit eine Führungsrolle einzunehmen. Die Wahrnehmung von außen zeigte, dass die DAJEB damit erfolgreich war. Dies machte die Weiterbildungen für sämtliche in der Eheberatung Tätigen interessant. Dabei versuchte die DAJEB-Leitungsebene, ihren wissenschaftlichen Anspruch mit einer konfessionellen Grundausrichtung zu verbinden. Allerdings bleibt auffällig, dass nach Ansicht führender Berater und Verbandsakteure die Ehe und das Verhältnis der Geschlechter untereinander insgesamt ein „Geheimnis“ darstellen sollten. Mit dieser inneren Abwehrhaltung ist auch zu erklären, dass Teile der Arbeitsgemeinschaft und besonders ihre Leitungsebene sich trotz angestrebter
400
Fazit
Professionalisierung dagegen wandten, psychologische Methoden oder überhaupt ein näher definiertes methodisches Vorgehen in der Eheberatung einzusetzen. Sie befürchteten, solche Analysen würden das Mystische der Paarbeziehung zerstören. Entsprechende Vorgehensweisen stießen somit bis weit in die 1960er-Jahre auf Skepsis, obwohl sich die Psychologie über die kommenden beiden Jahrzehnte als wichtige Leitwissenschaft in der Beratungsarbeit entwickeln sollte, bis hin zum „Psychoboom“¹ und zur Therapeutisierung der Sozialen Arbeit in den 1970er-Jahren. Trotz dieser Widersprüche betrieb die DAJEB im gesamten Untersuchungszeitraum die Standardisierung der Beraterausbildung und die Professionalisierung der Eheberatung, was bis zu einem gewissen Grad gelang. Am Ende galten für nichtkonfessionelle wie für konfessionelle Stellen dieselben Kriterien. Damit wurde Eheberater zwar ein Beruf, aber keine Profession mit einem eigenen akademischen Profil, ähnlich wie in anderen Bereichen der Sozialen Arbeit. Ein Zeichen dafür ist beispielsweise das fehlende Zeugnisverweigerungsrecht der Beratenden. Anderweitig ausgebildete Experten wie Juristen, Theologen, Psychologen und Mediziner waren in den Einrichtungen tätig, sodass Laien das Feld dominierten. Eheberatung entwickelte sich nicht zu einer Disziplin. Zu zurückhaltend waren die Versuche, ihr z. B. ein klares und wissenschaftliches Methodenspektrum zu unterlegen. Dies wäre aber nach einschlägigen Definitionen ein wichtiges Professionalisierungskriterium gewesen. Als erster Zusammenschluss von Beratungsstellen zwang die Arbeitsgemeinschaft die konfessionelle Beratung, sich ebenfalls stärker zu organisieren. Von Beginn an betrieb die katholische zur nichtkonfessionellen Beratungsarbeit und damit auch zur DAJEB eine klare Abgrenzung, um als unabhängige Richtung wahrgenommen zu werden, die katholische Prägung zu erhalten sowie Lobbyarbeit betreiben zu können. Dass die katholische Eheberatung nicht in die DAJEB integriert werden konnte, hatte diese stets anerkannt; die katholische Ehelehre machte auch in ihren Augen eine explizit katholische Beratungsarbeit notwendig. Eine klare Trennlinie zur evangelischen Beratung betrachteten katholische Akteure hingegen kaum als zwingend, da dieser zunächst die konfessionell eindeutige Institutionalisierung fehlte. Als Konkurrenzverband zur DAJEB gründete die katholische Kirche das KZI. Damit begann eine strukturelle Verkirchlichung der vormals allein von katholischen Verbänden und hier vor allem von Frauenorganisationen getragenen Beratungsarbeit. Darin wird eine Ambivalenz deutlich: Zum einen galt die Beratung weiter als eigenständige und meist weibliche Laienarbeit, auf der anderen Seite wurde sie stark an die katholische Kirchenstruktur angebunden. Dass der weibliche Einfluss zurückgedrängt wurde, zeigt sich beispielsweise daran, dass die ur-
So der Untertitel von Tändler, Jahrzehnt, 2016.
Fazit
401
sprünglich für das KZI geplante Doppelspitze aus einem Mann und einer Frau nicht realisiert werden konnte. Trotz der Bemühungen, eine Frau gleichberechtigt an der Führung des Instituts zu beteiligen, war der Direktorenposten stets männlich besetzt. Während Eheberatung zunehmend zu einem offiziellen Dienst der Kirche wurde, gewann auch fachliche Expertise an Bedeutung. Gerade durch die normative Aus- und Weiterbildung sowie die Schaffung einheitlicher Strukturen trug das KZI wesentlich zu einer Konsolidierung der katholischen Eheberatung bei. Anders als in der nichtkonfessionellen, evangelisch geprägten Richtung stieß der zunehmende Aufstieg der Psychologie im KZI nicht auf große Widerstände; das Institut förderte von Beginn an die neuen Ansätze. In der katholischen Beratung waren bereits früh psychologische Kräfte tätig. Dass das KZI die Arbeit immer mehr auf Psychologie hin ausrichtete, geschah allerdings später gegen den Widerstand des Vereins Katholischer Eheberaterinnen und Eheberater, der sich Mitte der 1960er-Jahre erfolglos eine Abgrenzung wünschte. Dabei ist auffällig, dass dieser Personenkreis selbst davon überrascht war, wie schnell der Paradigmenwechsel hin zur Psychologie Fuß gefasst hatte. Im Gegensatz dazu rückte die Theologie Anfang der 1950er-Jahre zunehmend von ihrer traditionellen Skepsis gegenüber der Psychologie ab, von der sie eine Konkurrenz zur Beichte befürchtete. Das Verhältnis blieb dennoch angespannt, was sich in der Eheberatung jedoch nicht bemerkbar machte. Die katholische Beratung rezipierte die Psychologie somit insgesamt weit früher und bereitwilliger als die anderen Richtungen. Ihr gelang es, aus Eheberatung als Fürsorgeleistung ein professionelles therapeutisches Angebot zu machen. Obwohl die DAJEB offiziell als paritätisch auftrat, hatte sie nicht nur enge Verbindungen zu den evangelischen Kirchen, sondern wurde teilweise auch als evangelisch ausgerichtet verstanden. Auf diesem Weg erfuhr die evangelische Eheberatung eine gewisse Repräsentanz. Eine eigene Organisation hatten die evangelischen Einrichtungen zunächst nicht, da die Integration in nicht an die Kirchen gebundene Angebote als bessere Strategie galt, allgemeine Beratungen stärker konfessionell auszurichten. Darüber hinaus wehrten sich auch die Landeskirchen gegen eine Zentralisierung. Sie waren daran interessiert, jeweils lokal ein eigenes Geflecht an Beratungsstellen aufzubauen und für deren Leitung genug Autonomie zu haben. Da die DAJEB beabsichtigte, die gesamte Eheberatung in der Bundesrepublik zu repräsentieren, hatte sie selbst auch die Eigenständigkeit evangelischer Beratungseinrichtungen zu verhindern gesucht. Der Preis war, dass die evangelische Eheberatung lange kein eigenständiges Profil entwickelte, obwohl das Konkurrenzverhältnis zur katholischen Arbeit dies notwendig erscheinen ließ. Das änderte sich Mitte der 1950er-Jahre. Zu diesem Zeitpunkt plante die Arbeitsgemeinschaft, an sie angebundene Stellen auf Landesebene mit einem organisatorischen Dach zu versehen und diese so auf Bundesebene zu vertreten. Die evan-
402
Fazit
gelischen Akteure befürchteten, dass ihre Ausrichtung dann nicht ausreichend repräsentiert wäre. Zu dieser Entwicklung trug auch das Bundesfamilienministerium bei, das eine separate evangelische Arbeitsgemeinschaft als notwendig erachtete. 1959 bildete sich daraufhin die „Konferenz für Evangelische Familienberatung“ (EKFuL). 1964 entstand das Evangelische Zentralinstitut für Familienberatung (EZI). Dieses setzte auf eine psychologisch orientierte Professionalisierung. Mit der Eigenständigkeit evangelischer Beratung ging einher, dass sich die Konfessionalisierung in der Beratungslandschaft zunächst verfestigte. Die DAJEB verlor aufgrund dessen die Hälfte ihrer Mitglieder und büßte zunehmend an Bedeutung ein. Trotz unterschiedlicher Ansichten erkannten DAJEB, EZI und KZI den jeweiligen Einsatz der anderen für den Erhalt von Ehen und Familien als gemeinsames Ziel an. Die DAJEB hatte die Zusammenarbeit zunächst zweckhaft betrachtet, sah jedoch zunehmend die sich daraus ergebenden Möglichkeiten und intensivierte die Kooperation. Das KZI sowie wichtige katholische Akteure arbeiteten vor allem mit der evangelischen Beratung auf Leitungsebene zusammen. Gegründet und geprägt wurde die DAJEB von bereits während der Zeit des Nationalsozialismus tätigen Sozial- und Rassenhygienikern. Neben dem sozialhygienisch orientierten Arzt Joachim Fischer waren mit Lothar Loeffler und Carl Coerper auch zwei Mediziner führend im Verband vertreten, deren Karrieren eng mit dem Nationalsozialismus verflochten waren. Loeffler und Coerper gehörten zu den Personen, die sich während des Nationalsozialismus in evangelischen Fürsorgeeinrichtungen an der Durchsetzung von Zwangssterilisationen beteiligt hatten. Sie waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Beratung offiziell auf ihrer eugenischen und insbesondere vorehelichen Intention beharrte, da sie ihre alten Denkmuster mit in die Bundesrepublik brachten. Eine kritische Auseinandersetzung mit Eugenik oder der nationalsozialistischen Vergangenheit galt ihnen als nicht notwendig. Der noch heute bestehenden DAJEB bietet sich somit die Möglichkeit einer Aufarbeitung, die sie bisher noch nicht ergriffen hat. Auch die katholische Beratung stellte die Eugenik nicht grundsätzlich in Frage, diese galt tendenziell als positives Instrument. Gleichzeitig war sie jedoch kein Ziel der Beratungsarbeit. Sowohl die Historiografie der Eugenik insgesamt als auch die Geschichte und Geschichtsschreibung katholischer Eugenik nach 1945 stellen aber nach wie vor ein Forschungsdesiderat dar. Zwischen dem klar eugenischen Selbstverständnis beziehungsweise den Zielsetzungen der DAJEB-Führung und der tatsächlichen Arbeit in den Einrichtungen bestand eine deutliche Diskrepanz. In der Praxis besonders der amtlichen Beratung ist zu beobachten, dass die Akteure die offizielle voreheliche Beratungslinie, wie sie beispielsweise auf Leitungsebene des Berliner Gesundheitsamts festgelegt war, unterliefen und entgegen deren Wunsch mit psychologischen Methoden arbeiteten. Sie reagierten damit direkt auf den Bedarf der Ratsuchenden, die keine eugenische
Fazit
403
Beratung nachfragten. Stattdessen kamen Frauen und Männer mit konkreten Konfliktfällen in ihren bereits länger bestehenden Ehen. Offizielle Ausrichtung und Praxis stimmten somit nicht überein. Die Berater problematisierten ihr unabhängiges Vorgehen in den schriftlichen Zeugnissen nicht, es schien weder der DAJEB noch vorgesetzten Dienststellen bewusst zu sein. Dass eine eugenische und voreheliche Beratung nicht mehr durchsetzbar war, führten die amtlichen Leitungsebenen auf fehlende Resonanz in der Bevölkerung zurück, ohne daraus weitergehende Schlüsse für die eigene Arbeit zu ziehen. Andere nichtkonfessionelle Beratungsstellen, wie die Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute Karlsruhe, waren bereits ihrem Selbstverständnis nach als Konfliktberatung ausgelegt und hatten kein Interesse an eugenischer Arbeit. Insofern stimmten hier Zielsetzung und Praxis überein. Allerdings werden auch bei ihnen in Selbstverständnis und Praxis durchaus Ambivalenzen deutlich. Im Selbstverständnis der katholischen Eheberaterinnen war deren Status als Laien prägend. Im Gegensatz zur evangelischen Kirche, deren Beratungsarbeit sich bis zur Gründung der Konferenz für evangelische Familienberatung (EKFuL) 1959 unter pastoraler Leitung befand, lehnten sie die Mitarbeit von Theologen ab. Sie gingen ihrem Auftrag selbstbewusst nach und begriffen sich als weitestgehend unabhängig. In dieser Haltung, die auch dazu führte, dass die Akteurinnen inhaltliche Diskrepanzen mit dem Lehramt gelegentlich ignorierten, zeigen sich Ähnlichkeiten mit dem Selbstverständnis und Vorgehen nichtkonfessioneller beziehungsweise amtlicher Berater. Thematisch spiegeln sich sowohl in der nichtkonfessionellen als auch der evangelisch beeinflussten sowie der katholischen Beratung zeitgenössisch stark beachtete Aspekte, wie beispielsweise die sogenannte Frühehe. Hinzu kamen in der nichtkonfessionellen Richtung auch durch die Öffentlichkeit unbeachtete und nicht problematisierte Schwierigkeiten, während in der katholischen Beratung kirchenrechtliche Fragen eine relevante Rolle spielten. Letztere lösten nicht nur Eheprobleme aus, sondern machten auch die Grenzen der Beratungsarbeit sichtbar. Dass die Beraterinnen immer wieder in einen deutlichen Gegensatz zum offiziellen Lehramt gerieten, war eine besondere Herausforderung der katholischen Arbeit. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben bestand darin, die Unauflöslichkeit der kirchlichen Ehe zu verteidigen. Durch diesen Auftrag zeigten sich die Beraterinnen durchaus befangen und handelten, obwohl sie sich als objektiv erklärten, teilweise gegen die Wünsche der Ratsuchenden. Allerdings scheint es sich hier um eine Minderheit gehandelt zu haben. Andere gingen hingegen bis an die Grenze des kirchenrechtlich Möglichen, in Einzelfällen sogar darüber hinaus. Aufgrund ihres personalen Eheverständnisses erkannten sie an, dass eine Scheidung in manchen Fällen eine Lösung sein konnte. Die sich aus Kirchenrecht und ihrem Selbstverständnis sowie
404
Fazit
ihrer Praxis ergebende Diskrepanz war den Beratenden sehr bewusst, ohne dass sie diese Konflikte jedoch lösen konnten. Insgesamt vermittelt das Selbstverständnis katholischer Beraterinnen hohe Ansprüche. Sie betonten ihre fachliche Qualifikation sowie eine feste Verwurzelung im katholischen Glauben. Ehe wurde in ihren Kreisen bereits früh als personale Liebes- und Lebensgemeinschaft verstanden und weniger als abstrakte Einrichtung. Dabei folgten die weitgehend ehrenamtlich Tätigen explizit weniger der Sicht einer allgemeinen Krise, sondern beschrieben stärker individuelle Ehekrisen. Verheiratete sollten als Einzelpersonen ernstgenommen werden und ihre Schwierigkeiten mit professioneller Unterstützung selbst bewältigen. Die katholische Beratungsarbeit erkannte damit die Rolle Ratsuchender als eigenständige Akteure zumindest in der Theorie an. Die Übernahme von Eigenverantwortung stellte im Selbstbild der Eheberaterinnen ein wichtiges Ergebnis ihrer Tätigkeit dar. Wie häufig dies in der Praxis erreicht und tatsächlich angestrebt wurde, lässt sich zumindest anhand der untersuchten Quellen nicht umfänglich nachvollziehen. Häufig ist jedoch zu beobachten, dass die Beraterinnen durchaus klaren Rat erteilten und wenig Spielraum ließen. Auch das Selbstbild, offen für neue gesellschaftliche Entwicklungen zu sein und den Ratsuchenden differenziert gegenüberzutreten, entsprach nicht durchweg der Praxis. Sichtbar wird vielmehr eine Erwartungshaltung an Ratsuchende, festgelegte Eheideale und Rollenzuweisungen zu erfüllen. Diese Diskrepanzen nahmen die Eheberaterinnen jedoch nicht wahr. Das Selbstverständnis nichtkonfessioneller Berater zeigt vor allem, dass sie bemüht waren, zugewandt auf Ratsuchende einzugehen. Gleichzeitig hatten sie einen hohen Anspruch an ihre Arbeit, der sie mit großem Einsatz nachgingen. Ihre Vorgehensweise innerhalb der Beratung wies eine große Bandbreite auf, die von einseitiger Raterteilung bis hin zu ersten methodischen Ansätzen der Casework reichte. Dabei wird folgende Diskrepanz sichtbar: Ähnlich wie im katholischen Bereich erwarteten die Berater durchaus Konformität von den Besuchern, während sie gleichzeitig betonten, diese müssten eigenständige Entscheidungen treffen. Den darin enthaltenen Widerspruch erkannten Eheberater jedoch nicht. Deutlicher als in der nichtkonfessionellen Beratung wurden Ratsuchende innerhalb der katholischen Beratungsarbeit als aktive, ihre Probleme mit der Beraterin in einem offenen Prozess partnerschaftlich lösende Akteure begriffen. Gemeinsam war nichtkonfessioneller und katholischer Arbeit, dass sie bei den Paaren ein hohes Maß an Verzweiflung beobachteten, was die Beratenden durch Zuhören und Verständnis zumindest zu erleichtern suchten. Dieser Aspekt der Eheberatung lässt sich bis in die Anfänge zurückverfolgen und wurde insbesondere innerhalb der katholischen Beratung betont. Auch die Eheleute selbst vermitteln einen ambivalenten Eindruck. Zwar setzten sie sich mit ihrer eigenen Situation auseinander, doch schien bei ei-
Fazit
405
nigen auch die Erwartungshaltung durch, von einer höheren Instanz eine Lösung präsentiert zu bekommen. In der nichtkonfessionellen Beratung wurde die Rolle Ratsuchender kaum explizit diskutiert. Gleichzeitig treten diese in den untersuchten Egodokumenten deutlicher als in der katholischen Eheberatung als eigenständige Akteure in Erscheinung. In der Auseinandersetzung mit ihren Problemen sowie durch die klare Vertretung ihrer eigenen Interessen und Gefühle werden sie als die Beratungssituation selbst stark beeinflussende Individuen ebenso sichtbar wie als Gestalter ihrer Ehe. Hatten Ratsuchende abweichende Vorstellungen von der Beratung selbst oder dem Verhalten des Beraters, handelten sie eigenständig und teilweise konträr zu dessen Empfehlungen oder Forderungen und zeigten ihm die Grenzen seines Einflusses auf. Innerhalb der nichtkonfessionellen Beratung wurden diese Grenzen somit nicht durch äußere Vorgaben, sondern durch die Ratsuchenden selbst erreicht. Das Verhältnis zwischen Selbstverständnis und Praxis war geprägt von Ambivalenzen und Kontradiktionen. In der nichtkonfessionellen Beratung ist dies auch auf miteinander verwobene institutionelle Ebenen, denen unabhängig agierende Akteure gegenüberstanden, zurückzuführen. Selbstverständnis und Zielsetzung von verbandlicher oder amtlicher Ebene spiegelten sich nur selten in Selbstverständnis und Zielsetzung der Eheberater. Ohne es zu reflektieren, handelten diese weitgehend unabhängig von der DAJEB oder sogar vorgesetzten Dienststellen. Eheberater orientierten sich eher an den Bedürfnissen der Ratsuchenden. Auch Selbstverständnis und Praxis katholischer Eheberatung waren nicht deckungsgleich. Vielmehr bestanden in ihrem Verhältnis Ambivalenzen, welche die Eheberaterinnen in der Regel jedoch nicht reflektierten. Sie erklären sich durch mehrfache Spannungen zwischen Kirchenrecht und den konkreten Nöten der Ratsuchenden, Erneuerungstendenzen des katholischen Eheideals und der Sicht des Lehramts, Theologie und Psychologie, ehrenamtlicher Laienarbeit und Professionalisierung sowie zunehmender struktureller Verkirchlichung bei gleichzeitigem Rückgang von Glaubensinhalten. Dabei sahen sich Beraterinnen in Übereinstimmung mit dem Katholischen Zentralinstitut. Individuelle Hilfe und soziale Kontrolle werden innerhalb beider Beratungsrichtungen sichtbar, ebenso Beratende als Akteure, die durch die dargestellten Entwicklungen und Prozesse geprägt waren, diese jedoch auch umgekehrt beeinflussten. Die zeitgenössisch als gesellschaftlich relevant wahrgenommene Eheberatung stellte ein kompetitives Feld mit einem breiten Spektrum von Akteuren dar, die unterschiedliche gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen vertraten. Nicht nur zwischen nichtkonfessioneller und evangelischer sowie katholischer Eheberatung zeigten sich dabei Konkurrenzverhältnisse. Vielmehr sind auch innerhalb der einzelnen Ausrichtungen Kämpfe um Deutungshoheit zu beobachten, wie beispiels-
406
Fazit
weise im Gegeneinander der Berliner Sozial- und Gesundheitsämter um eugenische Beratung. Diese Konflikte waren zudem beeinflusst vom Verhältnis zwischen Selbstverständnis und Praxis innerhalb der jeweiligen Beratungsrichtungen und auch der einzelnen Stellen. Die dort zu findenden Ambivalenzen zwischen den deklarierten Zielen und deren Umsetzung gingen in der nichtkonfessionellen Beratung bis hin zu eindeutigen Widersprüchen vor allem in der Frage, ob sich die Arbeit auf voreheliche Gesundheitsprüfung oder reale Konfliktsituationen in bestehenden Ehen konzentrieren sollte. Die oftmals kirchlich gebundenen Beratenden setzten sich intensiv mit den gesellschaftlichen Entwicklungen der Zeit auseinander, auf die sie unterschiedliche Antworten in Bezug auf den Wandel der Geschlechterrollen, den Aufstieg der Psychologie oder den zunehmenden Verwissenschaftlichungsdruck im eigenen Arbeitsumfeld fanden. Eheberatung zeigt daher den Versuch der Akteure, Handlungsräume in der Gesellschaft durch Wissenschaft zu erweitern. Sie war damit ein Schauplatz der umkämpften Moderne in der deutschen Geschichte von der Weimarer Republik bis in die 1970er-Jahre.
Abkürzungen AGF AGG
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Familienorganisationen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitswesen
BSHG BT-Drs. CIC DAJEB DAK DBK DPWV DZI EKD EKFuL EZI GG GS KDFB KFD KEFuL KZI LAB LGA StGB UIOF VAB WHO
Bürgerliches Gesetzbuch Bundessozialhilfegesetz Drucksache des Deutschen Bundestages Codex Iuris Canonici Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e. V. Deutscher Arbeitskreis Jugend-, Ehe- und Familienberatung Archiv der Deutschen Bischofskonferenz Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen Evangelische Kirche in Deutschland Konferenz für Evangelische Familien- und Lebensberatung Evangelisches Zentralinstitut für Familienberatung Grundgesetz Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ Katholischer Deutscher Frauenbund Zentralverband der katholischen Frauen- und Müttergemeinschaften Konferenz für Evangelische Familienberatung Katholische Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen Landesarchiv Berlin Landesgesundheitsamt Strafgesetzbuch Union Internationale des Organismes Familiaux Versicherungsanstalt Berlin Weltgesundheitsorganisation
https://doi.org/10.1515/9783111097534-007
Quellen und Literatur Archive Archiv Caritas Frankfurt – Nr. 7100 (Katholische Eheanbahnung und Eheberatungsstelle) Archiv des Deutschen Caritasverbandes (ADCV), Freiburg – 349.4 (Kath. Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen, Köln) – R 565 (Familienfragen, Familienausgleichskassen 1922 – 1960) – 111.055 (Zentralrat Berichte) – 319.4 (SKF) Archiv des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung (ADE), Berlin – JF (Nachlass Joachim Fischer, Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (DAJEB), 1949 – 1968) – CAW (Central-Ausschuss, Geschäftsstelle Bethel) – HGSt (Hauptgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes der EKD) – PB (Präsidialbüro der Hauptgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes der EKD) Archiv des Katholischen Deutschen Frauenbunds (AKDFB), Köln – Ordner Eheberatung KZI 1949 – 1963 – Ordner Ehetagung Hohenheim – Ordner Eheberatung Korrespondenz 1946 – 1952 Bundesarchiv Koblenz (BArch) – B 141 (Bundesministerium der Justiz) – B 142 (Bundesministerium für Gesundheitswesen) – B 189 (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) – B 191 (Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen) DAJEB-Bundesgeschäftsstelle, München – Archiv – Durand-Wever, Anne-Marie: „Eheberatung vor 1933 und nach 1945“. In: Fischer, J[oachim] (Hrsg.): Archiv für Jugend- und Eheberatung. Bd. 1, 1950, unveröffentlichtes Manuskript. Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen, Archiv (DZI), Berlin – Bibliothek Diözesanarchiv Würzburg – Bestand Julius Döpfner – Bischöfliche Manualakten Stangl Ehe-, Familien- und Partnerschaftsberatungsstelle Karlsruhe (Eheberatung Karlsruhe) – Archiv Evangelisches Landeskirchliches Archiv Berlin (ELAB) – 29/550 (Evangelische Eheberatungsstelle / Evangelische Ehehilfe, 1931 – 1948)
https://doi.org/10.1515/9783111097534-008
Online-Ressourcen
409
Evangelisches Zentralarchiv in Berlin (EZA) – 2 (Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche in Deutschland) Historisches Archiv des Erzbistums Köln (AEK) – DBK (Archiv der Deutschen Bischofskonferenz) – KZI (Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen) – Gen II (Bestände der Zentralregistratur im Generalvikariat) – Nachlass Robert Grosche, Stadtdechant (1888 – 1967) Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main (Stadtarchiv Frankfurt) – Stadtgesundheitsamt – Magistratsakten Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart – J 191 (Läpple, Johanna, Dr.) Landesarchiv Berlin (LAB) – B Rep. 004 (Senatsverwaltung für Inneres) – B Rep. 012 (Arbeitsgemeinschaft für öffentliche und freie Wohlfahrtspflege Berlin, Gefangenenfürsorge) – B Rep. 142 – 09 (Deutscher Städtetag) – B Rep. 220 (Bezirksverwaltung Reinickendorf) – B Rep 235 (Helene-Lange-Archiv) Landeskirchliches Archiv der Bremischen Evangelischen Kirche (LkABEK) – S 470 (Bibliothek) Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg (Staatsarchiv Hamburg) – 352 – 6 Gesundheitsbehörde Stadtarchiv Karlsruhe – Abt. 1/H-Reg., Nr. 5188 (Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute) – Abt. 1/SJB (Sozial- und Jugendbehörde)
Online-Ressourcen Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung: Ehelösungen. Geschiedene Ehen nach der Kinderzahl in Deutschland (1960 – 2018). Verfügbar unter: https://www.bib.bund.de/ Permalink.html?id= 10240912, besucht am 19. Oktober 2020. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung: Fakten. Ehescheidungen und rohe Ehescheidungsziffer in Deutschland (1888 – 2018). Verfügbar unter www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/L127Ehescheidungen-Ehescheidungsziffer-ab-1888.html, besucht am 18. Oktober 2020. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung: Fakten. Eheschließungen und rohe Eheschließungsziffer in Deutschland (1841 – 2018). Verfügbar unter www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/L101Eheschliessungen-ab-1841.html, besucht am 18. Oktober 2020. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung: Fertilität. Zusammengefasste Geburtenziffer in Deutschland, 1871 – 2016. Verfügbar unter: https://www.bib.bund.de/ Permalink.html?id= 10241752, besucht am 18. Oktober 2020.
410
Quellen und Literatur
Feustel, Adriane: Geschichte der Alice Salomon Hochschule – eine Chronik bis 1971. Verfügbar unter: www.alice-salomon-archiv.de/geschichte/geschichte-der-alice-salomon-hochschule/, besucht am 05. November 2020. o. A.: Guido Groeger. Auf: https://wiki.de.dariah.eu/display/F1P/Groeger%2C+Guido, besucht am 8. März 2021. o. A.: Bisherige Vorstände des BDP. Verfügbar unter: www.psychologie.de/ueber/vorstand/bisherig/ bdp/, besucht am 22. Januar 2021. o. A.: Die Präsidenten und Direktoren der Diakonischen Werke. 1957 – 1962: Dr. h. c. Friedrich Münchmeyer. Verfügbar unter: www.diakonie.de/praesidenten-und-direktoren-der-diakonischenwerke, besucht am 18. Oktober 2020. o. N.: „Albert Niedermeyer“. In: Wien Geschichte Wiki. Verfügbar unter: https://www.geschichtewiki. wien.gv.at/Albert_Niedermeyer, aufgerufen am 11. Oktober 2021. www.schwulengeschichte.ch, besucht am 16. Oktober 2020. Zuber, Ulrike / Weller, Dietrich: „Günter Struck in memoriam“. Verfügbar unter: Bundesverband deutscher Schriftstellerärzte, http://bdsae.org/guenther-struck-in-memoriam-ulrike-zuber-unddietrich-weller/, besucht am 18. Oktober 2020.
Gedruckte Quellen und Darstellungen Adenauer, Paul: „Ein ‚Constanze‘ Interview“. In: Kölner Pastoralblatt, Nr. 11, November 1963, S. 342 – 345. Adenauer, Paul: „Ehe- und Familienseelsorge im Lichte des Konzils“. In: Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften 07/08 (1966/67), S. 175 – 183. Adenauer, Paul: „Der Theologe im Team einer Eheberatungsstelle“. In: Lebendige Katechese, Bd. 3. Würzburg 1981, S. 169 – 173. Adenauer, Paul: „Geschichtlicher Überblick über die katholische Eheberatung in Deutschland“. In: Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1962), H. 3, April/Mai, S. 116 – 119. Alfes, Georg: „Zwei in eins geben. Über den ‚Una caro‘-Begriff der Ehe“. In: Bischöfliche Hauptarbeitsstelle für Frauenseelsorge Düsseldorf (Hrsg.): Die Frau in Kirche und Volk. Köln 1950, S. 34 – 39. Alfes, Georg / Schmitz, Josef: „Erprobte Wege zur Erneuerung der christlichen Familie“. In: Bischöfliche Hauptarbeitsstelle für Frauenseelsorge Düsseldorf (Hrsg.): Die Frau in Kirche und Volk. Köln 1950, S. 108 – 112. Aretz, Jürgen: „Franz-Josef Wuermeling“. In: Ders. et al. (Hrsg.): Zeitgeschichte in Lebensbildern. Aus dem deutschen Katholizismus des 19. und 20. Jahrhunderts. Münster 2001, S. 245 – 259. Arning, Holger: „Frauen auf den Katholikentagen“. In: Raasch, Markus / Linsenmann, Andreas (Hrsg.): Die Frauen und der politische Katholizismus. Akteurinnen, Themen, Strategien. Paderborn 2018, S. 111 – 150. B.: „Jahrestagung der Eheberater“. In: Die Innere Mission. Zeitschrift des Diakonischen Werkes Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland 47 (1957), S. 211 – 214. Bang, R[uth]: „Verstehen und Helfen in der Einzelfallhilfe (Casework) unter besonderer Berücksichtigung der Voraussetzungen in der Arbeit der Eheberatung“. In: Zeitschrift für analytische Kinderpsychologie, Psychotherapie und Psychagogik in Praxis und Forschung 10 (1961), H. 6, S. 228 – 237.
Gedruckte Quellen und Darstellungen
411
Bang, Ruth: Psychologische und methodische Grundlagen der Einzelfallhilfe (Casework). Wiesbaden 1958. Beck, Barbara / Förster, Alice: „Post-Traumatic Stress Disorder and World War II. Can a Psychiatric Concept Help us Understand Postwar Society?“. In: Bessel, Richard et al. (Hrsg.): Life after Death: Approaches to a Cultural and Social History of Europe During the 1940s and 1950s. Cambridge 2003, S. 15 – 35. Beckmann, Anna: Die Ehe ein Wagnis? Köln 1948. Behrendt-Raith, Nina: Gemeinde Diakonie. Eine qualitative Studie zu Einflussfaktoren und Handlungsperspektiven der Gemeindediakonie am Beispiel des Ruhrgebiets. Berlin 2018. Beier, Ernst: „50 Jahre Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Bistum Regensburg“. In: Diözese Regensburg (Hrsg.): 50 Jahre Kath. Ehe- Familien- u. Lebens-Beratung. Diözese Regensburg 1955 – 2005. [Regensburg 2005], S. 12 – 19. Berghahn, Sabine: „Der Ritt auf der Schnecke. Rechtliche Gleichstellung in der Bundesrepublik Deutschland“. In: Koreuber, M. / Mager, U. (Hrsg.): Recht und Geschlecht. Zwischen Gleichberechtigung, Gleichstellung und Differenz. Baden-Baden 2004. Blech, Maria: „Über die Eheberatung der Inneren Mission“. In: Die Innere Mission. Zeitschrift des Diakonischen Werkes Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland 37 (1947), H. 9 – 10, S. 37 – 43. Blech, Maria: „Evangelische Eheberatung in neuem Stadium?“. In: Die Innere Mission. Zeitschrift des Diakonischen Werkes Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland 41 (1951), H. 12, S. 371 – 374. Borgmann, Grete: „Ehe und Familie in unserer Zeit. Erfahrungen aus der Ehe- und Familienberatung“. In: Caritas 61 (1960), S. 242 – 244. Borries, Kara von: Das Puddelverfahren in Rheinland und Westfalen, volkswirtschaftlich betrachtet. Bonn 1929. Bovet, Theodor: Die Ehe. Das Geheimnis ist gross. Tübingen 1962. Bovet, Theodor: Die Ehe. Ihre Krise und Neuwerdung. Ein Handbuch für Eheleute und ihre Berater. Tübingen 1951. Braun, Hannelore / Grünzinger, Gertraud: Personenlexikon zum deutschen Protestantismus 1919 – 1949. Göttingen 2006. Brombach, Sabine: Literatur als Erkenntnisquelle gesellschaftlicher Wirklichkeit. Interpretationen ausgewählter Eheromane und Analysen ehe- und familiensoziologischer Forschungsarbeiten aus der westdeutschen Nachkriegszeit bis 1961. Frankfurt am Main 1995. Coerper, Carl: „Ärztliche Berufsberatung“. In: Zeitschrift für Schulgesundheitspflege und soziale Hygiene 40 (1927), H. 7, S. 212 – 215. [Coerper, Carl]: „Beitrag zur Eheberatung“. In: Coerper, Karl [sic] (Hrsg.): Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitswesen 1 (1952), H. 10, S. 5 – 7. [Coerper, Carl]: „Eheberatung“. In: Coerper, Karl [sic] (Hrsg.): Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitswesen 1 (1952), H. 4, S. 2. [Coerper, Carl]: „Methoden der Eheberatung“. In: Coerper, Karl [sic] (Hrsg.): Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitswesen 2 (1953), H. 12, S. 5 – 7. Coerper, Carl: „Zur Methodik sachgemäßer Eheberatung“. In: Die Innere Mission. Zeitschrift des Diakonischen Werkes Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland 44 (1954), H. 7, S. 201 – 208.
412
Quellen und Literatur
Coerper, Carl: „Sozialhygiene, ein Abriß ihrer Struktur und ihrer Aufgaben“. In: Der öffentliche Gesundheitsdienst. Monatsschrift für Gesundheitsverwaltung und Sozialhygiene 21 (1959/60), S. 134 – 139. Czarnowski, Gabriele: Das kontrollierte Paar. Ehe- und Sexualpolitik im Nationalsozialismus. Weinheim 1991. Czarnowski, Gabriele: „‚Der Wert der Ehe für die Volksgemeinschaft‘. Frauen und Männer in der nationalsozialistischen Ehepolitik“. In: Heinsohn, Kirsten et al. (Hrsg.): Zwischen Karriere und Verfolgung. Handlungsräume von Frauen im nationalsozialistischen Deutschland. Frankfurt am Main 1997, S. 78 – 95. Däumling, A[dolf] M[artin]: „Probleme der Partnerwahl – psychologisch gesehen“. In: Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen (Hrsg.): Partnerbild und Ehe. Freiburg im Breisgau 1967, S. 26 – 50. Deutsche Bundesbank: Kaufkraftäquivalente historische Beträge in deutschen Währungen. Januar 2020. Deutscher Caritasverband: „Die freie Wohlfahrtspflege in Deutschland, ihre Aufgaben und ihre Lage nach Zusammenbruch und Geldentwertung“. In: Ders. (Hrsg.): Denkschriften und Standpunkte der Caritas in Deutschland. Bd. 1: Die Zeit von 1897 bis 1949. Freiburg im Breisgau 1997, S. 01 – 704. Deutscher Richterbund (Hrsg.): Handbuch der Justiz. Die Träger und Organe der rechtsprechenden Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland, Bd 16. Heidelberg 1982. Dipper, Christof: Art. „Moderne“. In: Docupedia-Zeitgeschichte, 17. 1. 2018. Verfügbar unter: https:// docupedia.de/zg/Dipper_moderne_v2_de_2018, besucht am 29. 7. 2022. Dressler, Sabine: „Bedrohung oder Fundament der Ehe? Gleichberechtigung im politisch-rechtlichen Diskurs und in Eheratgebern der 1950er Jahre“. In: Scholz, Sylka et al. (Hrsg.): In Liebe verbunden. Zweierbeziehungen und Elternschaft in populären Ratgebern von den 1950ern bis heute. Bielefeld 2013, S. 99 – 126. Eckardt, Sarah: „Zwischen Konkurrenz und Synthese. Christliche und romantische Deutungsmuster in Eheratgebern der 1950er Jahre“. In: Scholz, Sylka et al. (Hrsg.): In Liebe verbunden. Zweierbeziehungen und Elternschaft in populären Ratgebern von den 1950ern bis heute. Bielefeld 2013, S. 79 – 98. Eckart, Angelika M.: Bezogene Individuation in der Ehe: eine pastoralpsychologische Studie über den Beitrag systemischer Therapiemodelle für die institutionelle katholische Eheberatung. Frankfurt am Main 1999. Eder, Manfred: „Wiederaufbau und Neuorientierung“. In: Gatz, Erwin (Hrsg.): Caritas und Soziale Dienste. Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Die katholische Kirche, Bd. 5. Freiburg im Breisgau 1997, S. 280 – 294. Ehe-, Familien- und Partnerschaftsberatungsstelle (Hrsg.): 50 Jahre Eheberatung in Karlsruhe. Karlsruhe 2003. Endres, Sonja: Zwangssterilisationen in Köln 1934 – 1945. Köln 2010. Eßer, Florian: „Die Geschichte der Sozialen Arbeit als Profession“. In: EEO Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online. Fachgebiet Soziale Arbeit, 2011, S. 1 – 36, hier S. 26. Verfügbar unter: https://www.beltz.de/fachmedien/erziehungswissenschaft/enzyklopaedie_ erziehungswissenschaft_online_eeo.html, besucht am 22. Juli 2022. Etzold, Raphaela: Gleichberechtigung in erster Instanz. Deutsche Scheidungsurteile der 1950er Jahre im Ost-/West-Vergleich. Tübingen 2019. Evans, R[ichard] I[sadore]: „Gordon Allport“. In: Psychologie im Gespräch. Berlin 1976, S. 209 – 223.
Gedruckte Quellen und Darstellungen
413
Fetscher, R[ainer]: „Aus der Praxis der Eheberatung“. In: Volksaufartung, Erbkunde, Eheberatung 3 (1928), Nr. 7, S. 161 – 164. Fetscher, R[ainer]: „Aus der Praxis der Eheberatung“. In: Volksaufartung, Erbkunde, Eheberatung 3 (1928), Nr. 8, S. 187 – 188. Fischer, Ernst: „Hilfe zum Leben – für die Familie. Über die Arbeit der Ehe- und Erziehungsberatung“. In: Die Innere Mission. Zeitschrift des Diakonischen Werkes Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland 53 (1963), S. 188 – 190. Fischer, J[oachim]: „Carl Coerper verstorben“. In: Wege zum Menschen. Monatsschrift für Seelsorge, Psychotherapie und Erziehung und zur Förderung der Zusammenarbeit von Arzt und Seelsorger 12 (1960), S. 105 – 106. Fischer, J[oachim]: „Zur Einrichtung von Jugend- und Eheberatungsstellen“. In: Volksgesundheitsdienst (1950), H. 11, S. 279 – 282. Fischer, Joachim: „Entwicklung und Beurteilung eugenischer Gesetzgebung in Deutschland“. In: Ärztliche Mitteilungen: deutsches Ärzteblatt 36 (1951), H. 2, S. 19 – 20. [Fischer, Joachim]: „Erfahrungen der Eheberatung im Jahre 1952. Zusammengestellt aus Tätigkeitsberichten von Eheberatungsstellen im Auftrage der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung“. In: Der Öffentliche Gesundheitsdienst. Monatsschrift für Gesundheitsverwaltung und Sozialhygiene 15 (1953/54), H. 9, Sonderdruck, Dezember, S. 361 – 365. Fischer, Jochen: „Erwerbstätigkeit der Ehefrau im Hinblick auf ihre Rolle als Gattin und Mutter“. In: Ehe und Familie 8 (1962), Nr. 1/2, S. 9 – 11. Fischer, Joachim: „Jugend- und Eheberatung als psychohygienischer Auftrag an den Sozialhygieniker“. In: Gesundheitsfürsorge. Zeitschrift für die gesundheitlichen Aufgaben im Rahmen der Familienfürsorge 1 (1951), Sonderdruck. Fischer, J[oachim]: „Neue Formen der Eheberatung“. In: Ärztliche Mitteilungen: deutsches Ärzteblatt 38 (1953), H. 13, Sonderdruck. Fischer, J[oachim]: „Stand und Zukunft der Eheberatung“. In: Der öffentliche Gesundheitsdienst. Monatsschrift für Gesundheitsverwaltung und Sozialhygiene 14 (1952), H. 3, Sonderdruck, S. 90 – 96. Fischer, Jochen: Wir zwei wollen es besser machen. Ein Buch für Verlobte und junge Eheleute. Lahr 1964. Fischer, Jochen: „Zehn Jahre Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung“. In: Loeffler, Lothar (Hrsg.): Ehe und Familie als Gabe und Aufgabe. Göttingen 1959, S. 35 – 41. Fischer, Martin: Dienst an der Liebe. Die katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung in der DDR. Würzburg 2014. Fischer-Erling, Josepha: „Katholische Eheberatung“. In: Caritas, H. 3 – 4, [Freiburg] 1951, S. 62 – 68. Fischer-Erling, Josepha: „Eheberatung“. In: Scherer, Alice et al. (Hrsg.): Ehe und Familie. Grundsätze, Bestand und fördernde Maßnahmen. Freiburg im Breisgau 1956, Sp. 149 – 158. Fischer-Erling, Josepha: „Hilfen zur Bewältigung von Ehe- und Familienproblemen. Eheberatungsstelle“. In: Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1962), H. 3, April/Mai, S. 114 – 116. Fleckenstein, Gisela: „Ehe und Familie“. In: Gatz, Erwin (Hrsg.): Geschichte des Kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Bd. 8: Laien in der Kirche, Freiburg im Breisgau 2008, S. 521 – 558. Frake, Elisabeth: „Wandel mit Weile – oder 50 Jahre DAJEB“. In: Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (Hrsg.): 50 Jahre DAJEB 1949 – 1999. [München] 1999, S. 50 – 85.
414
Quellen und Literatur
Frie, Ewald: „Kontinuitäten und Trümmer. Sieben Thesen zu Katholizismus und Caritasarbeit in der Zusammenbruchsgesellschaft“. In: Manderscheid, Michael / Wollasch, Hans-Josef (Hrsg.): Die ersten hundert Jahre. Forschungsstand zur Caritasgeschichte. Freiburg im Breisgau, 1998, S. 115 – 118. Friedeburg, Ludwig von: Die Umfrage in der Intimsphäre. Beiträge zur Sexualforschung. Stuttgart 1953. Galuske, Michael / Müller, Wolfgang C.: „Handlungsformen in der Sozialen Arbeit“. In: Thole, Werner (Hrsg.): Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. Opladen 2002, S. 485 – 508. Gante, Michael: § 218 in der Diskussion. Meinungs- und Willensbildung 1945 bis 1976. Düsseldorf 1991. Gemeinhardt, Wolfgang: Eheberatung als Aufgabe des Öffentlichen Gesundheitsdienstes; dargestellt an den derzeitigen Verhältnissen in Bremen. Hamburg 1956. Gatz, Erwin: „Vom Zweiten Vatikanischen Konzil bis zur Gegenwart“. In: Ders. (Hrsg.): Geschichte des Kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Bd. 8: Laien in der Kirche. Freiburg im Breisgau 2008, S. 282 – 318. Giehler, Vera-Maria: Rassen- und Sozialhygieniker als Bindeglied der nichtkonfessionellen und evangelischen Eheberatung in der bundesdeutschen Nachkriegszeit. In: Mitteilungen zur Kirchlichen Zeitgeschichte 17 (2023), S. 117 – 143. Groeger, Guido: „Evangelische Beratung“. In: Die Innere Mission. Zeitschrift des Diakonischen Werkes Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland 49 (1959), Nr. 10, Oktober, S. 1 – 2. Groeger, G[uido]: „Verfahren und Probleme der Jugend- und Eheberatung“. In: Mitteilungshefte der Landesarbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und für Geschlechtserziehung, Nordrhein-Westfalen 5 (1955), H. 19, S. 2 – 12. Gröning, Katharina: Entwicklungslinien pädagogischer Beratungsarbeit. Anfänge – Konflikte – Diskurse. Heidelberg 2010. Grossmann, Atina: Reforming Sex: The German Movement for Birth Control and Abortion Reform, 1920 – 1950. New York 1995. Großbölting, Thomas: „Von der ‚heiligen Familie‘ zur Lebensgemeinschaft mit Kind(ern). Religion, Familienideale und Wertewandel zwischen den 1950er und 1970er Jahren“. In: Dietz, Bernhard et al. (Hrsg.): Gab es den Wertewandel? Neue Forschungen zum gesellschaftlich-kulturellen Wandel seit den 1960er Jahren. München 2014, S. 227 – 243. Großbölting, Thomas / Goldbeck, Markus: „Religion“. In: Ralph, Thomas (Hrsg.): Research Report. Deutschland in Zahlen. Zeitreihen zur Historischen Statistik. Bonn 2015, S. 172 – 185. Große Kracht, Klaus: „‚Elternrecht‘ und ‚Ehenot‘. Familienbilder und Wertewandel im westdeutschen Katholizismus der 1950er und 1960er Jahre“. In: Centrum für Religion und Moderne (Hrsg.): Preprints and Working Papers of the Center for Religion and Modernity. Münster 2018. Verfügbar unter: https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ religion_und_moderne/ preprints/crm_working_paper_18_gro__e_kracht.pdf, besucht am 18. Oktober 2020. Große Kracht, Klaus: Die Stunde der Laien? Katholische Aktion in Deutschland im europäischen Kontext 1920 – 1960. Paderborn 2016. Große Kracht, Klaus: Die katholische Welle der ‚Stunde Null‘. Katholische Aktion, missionarische Bewegung und Pastoralmacht in Deutschland, Italien und Frankreich 1945 – 160. In: AfS 51 (2011), S. 163 – 186. Große-Schönepauck, Helene: „Die Scheidungshäufigkeit in Deutschland“. In: Scherer, Alice et al. (Hrsg.): Ehe und Familie. Grundsätze, Bestand und fördernde Maßnahmen. Freiburg im Breisgau 1956, Sp. 131 – 140.
Gedruckte Quellen und Darstellungen
415
Grube, Magda: „Eheberatung – Hilfe für die heutige Ehe“. In: Frau und Mutter. Monatsschrift für die katholische Frau in Familie und Beruf 54 (1965), Nr. 10, S. 25 – 26. Gruß, Heribert: Erzbischof Lorenz Jaeger als Kirchenführer im Dritten Reich. Tatsachen – Dokumente – Entwicklungen – Kontext – Probleme. Paderborn 1995. Hahn, Daphne: „Vom Zwang zur Freiwilligkeit. Eugenisch orientierte Regulierungen im Nachkriegsdeutschland“. In: Wecker, Regina et al. (Hrsg.): Wie nationalsozialistisch ist die Eugenik? Internationale Debatten zur Geschichte der Eugenik im 20. Jahrhundert. Wien 2009, S. 259 – 270. Halberstadt, Helmut: Psychologische Beratungsarbeit in der evangelischen Kirche. Geschichte und Perspektiven. Stuttgart 1986. Hammerschmidt, Peter: Wohlfahrtsverbände in der Nachkriegszeit. Reorganisation und Finanzierung der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 1945 bis 1961. München 2005. Hammerschmidt, Peter / Sagebiel, Juliane: „Einführung: Professionalisierung im Widerstreit – Zur Professionalisierungsdiskussion in der sozialen Arbeit“. In: Dies. (Hrsg.): Professionalisierung im Widerstreit – Zur Professionalisierungsdiskussion in der sozialen Arbeit – Versuch einer Bilanz. Neu-Ulm 2010, S. 9 – 24. Hansen, Eckhard et al. (Hrsg.): Biographisches Lexikon zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1871 bis 1945. Bd. 2: Sozialpolitiker in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus 1919 bis 1945. Kassel 2018, S. 63 – 65. Hauschildt, Eberhard: „Kirchliche Familienberatung in den 1960er Jahren. Der Wandel im Selbstverständnis: von der paternalen Fürsorge in Abwehr der Modernisierung zur fachlichen sozialen Arbeit im therapeutischen Dialog“. In: Lepp, Claudia / Oelke, Harry / Pollack, Detlef (Hrsg.): Religion und Lebensführung im Umbruch der langen 1960er Jahre. Göttingen 2016, S. 259 – 280. Haustein, Sabine: Vom Mangel zum Massenkonsum: Deutschland, Frankreich und Grossbritannien im Vergleich 1945 – 1970. Frankfurt 2007. Heimbach-Steins, Marianne: „Mann und Frau“. In: Baumgartner, Konrad et al. (Hrsg.): Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 6. Freiburg im Breisgau 2017, Sp. 1275 – 1276. Heinemann, Elizabeth: „Die Stunde der Frauen. Erinnerungen an Deutschlands ‚Krisenjahre‘ und westdeutsche nationale Identität“. In: Naumann, Klaus (Hrsg.): Nachkrieg in Deutschland. Hamburg 2001, S. 149 – 177. Heinemann, Elizabeth: What Difference Does a Husband Make? Women and Marital Status in Nazi and Postwar Germany. Berkeley 2003. Heinemann, Isabel: „Die ‚erbgesunde Familie‘ als transatlantisches Projekt: Paul B. Popenoe, Otmar Freiherr von Verschuer und die Kontinuitäten der Eugenik, 1920 – 1970“. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 71 (2023), H. 3, S. 237 – 271. Henkelmann, Andreas: Caritasgeschichte zwischen katholischem Milieu und Wohlfahrtsstaat. Das Seraphische Liebeswerk (1889 – 1971). Paderborn 2008. Hering, Sabine / Münchmeier, Richard: Geschichte der Sozialen Arbeit: eine Einführung. Weinheim 2014. Hering, Sabine / Münchmeier, Richard: „Restauration und Reform – Die Soziale Arbeit nach 1945“. In: Thole, Werner (Hrsg.): Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. Opladen 2002, S. 97 – 118. Hermans, Baldur: „Heinrich Hirtsiefer (1876 – 1941) – ein Christlich-sozialer Zeitgefährte – gehasst und verfolgt“. In: Ders. (Hrsg.): Re-visionen zu Nikolaus Gross und Heinrich Hirtsiefer. Essen 2015, S. 53 – 67.
416
Quellen und Literatur
Herrn, Rainer: Der Liebe und dem Leid. Das Institut für Sexualwissenschaft 1919 – 1933. Frankfurt am Main 2022. Herzog, Dagmar: Die Politisierung der Lust. Sexualität in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. München 2005. Hohmann, Margarete: „Eheberatung in der Müttererholung“. In: Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1962), H. 3, April/Mai, S. 53 – 56. H[ohmann], M[argarete]: „Frauen schütten ihr Herz aus“. In: Die katholische Frau 11 (1958), Nr. 9, S. 7 und S. 15. Illemann, Regina: Katholische Frauenbewegung in Deutschland 1945 – 1962. Politik, Geschlecht und Religiosität im Katholischen Deutschen Frauenbund. Paderborn 2016. Interkonfessioneller Arbeitskreis für Ehe- und Familienfragen (Hrsg.): Christliche Einheit in der Ehe. Mainz 1969. Interkonfessioneller Arbeitskreis für Ehe- und Familienfragen: Interkonfessionelle Erklärung zu Fragen von Sexualität, Ehe und Familie. [1966]. Jäger, Lorenz: „Geleitwort“. In: Bischöfliche Hauptarbeitsstelle für Frauenseelsorge Düsseldorf (Hrsg.): Die Frau in Kirche und Volk. Köln 1950. Jäger, Sarah: Bundesdeutscher Protestantismus und Geschlechterdiskurse 1949 – 1971. Eine Revolution auf leisen Sohlen. Tübingen 2019. Jost, Ingrid / Zelazny, Käthe: „25 Jahre Verband Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberater – Rückblick und Perspektiven“. In: Verband Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater e. V. (Hrsg.): Blickpunkt Beratung. Kontakt – Begegnung – Beziehung. Diagnostik und Intervention im Prozeß der Beratung. 25 Jahre Verband Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberater e. V. Jahrestagung 1988 in Augsburg. [Augsburg 1988], S. 61 – 83. Jütte, Robert: „Rezeptions- und kontroverse Diskursgeschichte der NS-Medizin nach 1945“. In: Ders. (Hrsg.): Medizin und Nationalsozialismus. Bilanz und Perspektiven der Forschung. Göttingen 2011, S. 311 – 323. Kaiser, Matthäus: „Grundzüge des Eherechts der katholischen Kirche“. In: Struck, Günter / Loeffler, Lothar (Hrsg.): Einführung in die Eheberatung. Mainz 1971, S. 228 – 297. Kaminsky, Uwe: Kirche in der Öffentlichkeit – Die Transformation der Evangelischen Kirche im Rheinland (1948 – 1989). Bonn 2008. Kaminsky, Uwe: „Vom eugenischen Dunkel am Fusse des anti-euthanatischen Leuchtturms: Zur Nachgeschichte von Eugenik und ‚Euthanasie‘ am Beispiel der Evangelischen Kirche nach 1945“. In: Daubach, Helia-Verena (Hrsg.): Justiz und Erbgesundheit. Düsseldorf 2008, S. 195 – 210. Kaminsky, Uwe: „Zwischen Rassenhygiene und Biotechnologie. Die Fortsetzung der eugenischen Debatte in Diakonie und Kirche, 1945 bis 1969“. In: Zeitschrift für Kirchengeschichte 116 (2005), H. 2, S. 204 – 241. Kamphuis, Marie: Die persönliche Hilfe in der Sozialarbeit unserer Zeit. Eine Einführung in die Methode der Einzelfallhilfe für Praxis und Ausbildung. Stuttgart 1968. Kamphuis, Marie: „Vorwort zur zweiten Auflage“. In: Dies.: Die persönliche Hilfe in der Sozialarbeit unserer Zeit. Eine Einführung in die Methode der Einzelfallhilfe für Praxis und Ausbildung. Stuttgart 1968, o. S. Kilian, H.: „Der Wiedereinstieg des Heimkehrers in Familie, Ehe und Beruf“. In: Bürger-Prinz, Hans / Giese, Hans (Hrsg.): Die Sexualität des Heimkehrers. Vorträge gehalten auf dem 4. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung in Erlangen 1956. Stuttgart 1957, S. 27 – 37.
Gedruckte Quellen und Darstellungen
417
Kirschner, B[erna]: „Internationaler Austausch über Eheprobleme, Arbeitstagung der Commission des Conseils Matrimoniaux London, 25.–26. Mai 1956“. In: Informationsdienst d. AgdkdF, Nr. 6/7, [Köln] 1956, S. 6 – 8. Kopp, Matthias: „Professionalisierung und Gestaltwandel“. In: Gatz, Erwin (Hrsg.): Caritas und Soziale Dienste. Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Bd. 5: Die katholische Kirche. Freiburg im Breisgau 1997, S. 309 – 342. Kinsey, Alfred C.: Das sexuelle Verhalten der Frau. Berlin 1954. Kircher, Veronica: „Gedanken zum Wandel des Selbstverständnisses christlicher Caritas in den letzten Jahrzehnten“. In: Deutscher Caritasverband Freiburg (Hrsg.): 1897 – 1972. 75 Jahre Deutscher Caritasverband. Freiburg im Breisgau [1972], S. 147 – 151. Klaas, Andrea: „50 Jahre Eheberatung in Karlsruhe – eine Erfolgsstory“. In: Ehe-, Familien- und Partnerschaftsberatungsstelle (Hrsg.): 50 Jahre Eheberatung in Karlsruhe. Karlsruhe 2003, S. 7 – 23. Klautke, Egbert: Rassenhygiene, Sozialpolitik und Sexualität. Ehe und Sexualberatung in Deutschland 1918 – 1945. In: Bruns, Claudia (Hrsg.): Von Lust und Schmerz. Köln 2004, S. 293 – 312. Klee, Ernst: Was sie taten – Was sie wurden. Ärzte, Juristen und andere Beteiligte am Kranken- oder Judenmord. Frankfurt am Main 1986. Klee, Ernst: „Loeffler, Lothar“. In: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Frankfurt am Main 2007, S. 376. Klens, Hermann: Eine Brautlehre. Worte des Priesters an die Brautleute. Düsseldorf 1950. König, René: Materialien zur Soziologie der Familie. Bern 1946. Kolata, Jens: „Zwischen sozialistischer und nationalsozialistischer Eugenik. Friedrich Karl Scheumann und die Eheberatungsstelle Berlin Prenzlauer-Berg“. In: Hermanns, Ludger / Hirschmüller, Albrecht (Hrsg.): Vom Sammeln, Bedenken und Deuten in Geschichte, Kunst und Psychoanalyse. Stuttgart 2013, S. 61 – 82. Konferenz der deutschsprachigen Pastoraltheologen (Hrsg.): Ehe und Familie. Pastorale 2, Handreichung für den pastoralen Dienst. Mainz 1973. Korte, Bernhard: „Über die Aufgaben der Jugend- und Eheberatung“. In: Berufsverband Katholischer Sozialarbeiter Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Familiennot und ihre Überwindung. o. O. [1955]. Korte, Bernhard: „Vorbereitung auf die Ehe“. In: Wege zum Menschen 11 (1959), S. 123 – 136. Kowalewsky, Wolfram: „Eheberatung und Geschlechtserziehung im Einzelgespräch und in der Öffentlichkeit“. In: Die Mitarbeit: Zeitschrift zur Gesellschafts- und Kulturpolitik 1960, S. 323 – 329. Kowalewsky, Wolfram: „Aus der Tätigkeit der hannoverschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung“. In: Bovet, Theodor et al. (Hrsg.): Wege zum Menschen. Monatsschrift für Seelsorge, Psychotherapie und Erziehung und zur Förderung der Zusammenarbeit von Arzt und Seelsorger 8 (1958), S. 423 – 429. Kotowski, Elke-Vera / Schoeps, Julius H. (Hrsg.): Magnus Hirschfeld. Ein Leben im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Berlin 2004. Krabbel, Gerta: „Anna Beckmann“. In: Die christliche Frau 41 (1952), H. 3, S. 94 – 95. Krapp, Peter: Sozialhygienische Untersuchung über schwierige Ehen. Dargestellt an 1554 auf Veranlassung des Landgerichtes während der Jahre 1948 bis 1955 durch die Vertrauensstelle für Verlobte und Eheleute in Hamburg bewirkten Versöhnungsversuchen bei Scheidungsbegehren. Hamburg 1958. Kruse, Ulrich / Schall, Traugott Ulrich: „Kleine Geschichte der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung“. In: Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (Hrsg.): 50 Jahre DAJEB 1949 – 1999. [München] 1999, S. 5 – 49.
418
Quellen und Literatur
Küsters, Hanns Jürgen (Hrsg.): Konrad Adenauer – Der Vater, die Macht und das Erbe. Das Tagebuch des Monsignore Paul Adenauer 1961 – 1966. Paderborn 2017. Kuller, Christiane: „Einführung. Krisendebatten um Ehe und Familie in den 1960er Jahren“. In: Lepp, Claudia / Oelke, Harry / Pollack, Detlef (Hrsg.): Religion und Lebensführung im Umbruch der langen 1960er Jahre. Göttingen 2016, S. 205 – 213. Kuller, Christiane: Familienpolitik im föderativen Sozialstaat. Die Formierung eines Politikfeldes in der Bundesrepublik 1949 – 1975. München 2004. Lambers, Helmut: Theorien der Sozialen Arbeit. Ein Kompendium und Vergleich. Opladen 2018. Lenz-von Borries, Kara: „Eheberatung als Casework“. In: Gesundheitsfürsorge. Zeitschrift für die gesundheitlichen Aufgaben im Rahmen der Familienfürsorge 1 (1952), H. 11, S. 201 – 202. Lienert, Marina / Heidel, Caris-Petra: „Rainer Fetscher (1895 – 1945)“. In: Ärzteblatt Sachsen 21 ( Januar 2010), S. 27 – 29. Lilienthal, Georg: „Lenz, Fritz“. In: Neue Deutsche Biographie, Bd. 14. Berlin 1985, S. 223 – 225. Lippold, Anette: The Church and Modern Marriage: Denominational Marriage Counseling and the Transformation of Mainline Christian Religion in Germany and the United States, 1920 – 1970s. New York 2014. Loeffler, Lothar: „Arbeit, Freizeit, Familie in Hinblick auf die Ehe“. In: Ders. (Hrsg.): Arbeit, Freizeit und Familie im Hinblick auf die Ehe, das Alter und die Jugend. Hannover 1955, S. 6 – 20. Loeffler, Lothar: „Vorehelicher Bereich, voreheliche Beziehungen und Partnerwahl“. In: Struck, Günter / Loeffler, Lothar (Hrsg.): Einführung in die Eheberatung. Mainz 1971, S. 92 – 114. Loeffler, Lothar (Hrsg.): Ehe und Familie als Gabe und Aufgabe. Göttingen 1959. Loeffler, Lothar: „Erziehung zur Ehe in eugenischer Sicht“. In: Ders. (Hrsg.): Ehe und Familie als Gabe und Aufgabe. Göttingen 1959, S. 15 – 21. Loeffler, Lothar: „Erziehung zur Ehe in eugenischer Sicht“. In: Wege zum Menschen. Monatsschrift für Seelsorge, Psychotherapie und Erziehung und zur Förderung der Zusammenarbeit von Arzt und Seelsorger 11 (1959), S. 77 – 83. Loeffler, Lothar: „Grundsätzliche Gedanken zur Frage der Jugend- und Ehekrise“. In: Caritas, H. 1 – 2, [Freiburg] 1952, S. 5 – 15. Loeffler, Lothar: „Die Krise der mitmenschlichen Beziehungen in der Ehe und das Scheidungsbegehren“. In: Soziale Arbeit: Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete 3 (1954), H. 2, S. 49 – 56. Loeffler, Lothar: „Gegenwärtige Probleme der Geschlechterbeziehung“. In: Soziale Arbeit: Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete 4 (1955), H. 4, S. 572 – 582. Löscher, Monika: „… der gesunden Vernunft nicht zuwider …?“ Katholische Eugenik in Österreich vor 1938. Innsbruck / Wien / Bozen 2009. Löscher, Monika: Katholische Eugenik in Deutschland und in Österreich im Kontext der pästlichen Ehenzyklika Casti Connubii. In: Römische Quartalschrift 109 (2014), S. 24 – 55. Lüdicke, Klaus: „Kirchenstrafen“. In: Baumgartner, Konrad et al. (Hrsg.): Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 6. Freiburg 2017, Sp. 68 – 69. Lüdicke, Klaus: Zur Vorlesung: Kirchliches Eherecht. Westfälische Wilhelms-Universität Münster [2008]. Lütgemeier-Davin, Reinhold / Wolff, Kerstin (Hrsg.): Helene Stöcker. Lebenserinnerungen. Die unvollendete Autobiographie einer frauenbewegten Pazifistin. Köln 2015. Lulay, Birgit Eugenik und Sozialismus. Biowissenschaftliche Diskurse in den sozialistischen Bewegungen Deutschlands und Großbritanniens um 1900. Stuttgart 2021.
Gedruckte Quellen und Darstellungen
419
Mann, E[lisabeth]: „Von der Tätigkeit katholischer Eheberatungsstellen im Bundesgebiet“. In: Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1962), H. 3, April/Mai, S. 50 – 53. Mayer, A.: „Zur Heimkehrerfrage. Diskussionsbeitrag zum Vortrag Kilian“. In: Bürger-Prinz, Hans / Giese, Hans (Hrsg.): Die Sexualität des Heimkehrers. Vorträge gehalten auf dem 4. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung in Erlangen 1956. Stuttgart 1957, S. 38 – 41. Mayer, Thomas / Müller, Tobias: „Die Ungleichmacher“. In: Der Standard v. 17./18. April 2010. Verfügbar unter: www.derstandard.at/story/1271374498107/die-ungleichmacher, besucht am 18. Oktober 2020. Melching, Willem: „Theodoor Hendrik van de Velde“. In: Sigusch, Volkmar / Grau Günter (Hrsg.): Personenlexikon der Sexualforschung. Frankfurt am Main 2009, S. 717 – 720. Meyer, Curt: „Eheberatung“. In: Berliner Gesundheitsblatt. Zeitschrift für alle Heilberufe, H. 22, 1950, S. 549 – 551. Meyer, Sibylle / Schulze, Eva: Von Liebe sprach damals keiner. Familienalltag in der Nachkriegszeit. München 1985. Mierke, Karl: Psychohygiene im Alltag. Stuttgart 1967. Moser, Gabriele: „‚Die Zukunft gehört der prophylaktischen Medizin‘ – Sozialhygiene, medizinisches Präventionsverständnis und Gesundheitsbegriff Ende der 1920er Jahre“. In: Schagen, Udo / Schleiermacher, Sabine (Hrsg.): Sozialmedizin, Sozialhygiene, Public Health: Konzepte und Visionen zum Verhältnis von Medizin und Gesellschaft in historischer Perspektive. Berlin 2002, S. 15 – 20. Muckermann, Hermann: Der Sinn der Ehe. Biologisch – ethisch – übernatürlich. Bonn 1947. Mühlhauser, Regina: Vergewaltigungen in Deutschland 1945. Nationaler Opferdiskurs und individuelles Erinnern betroffener Frauen. In: Naumann, Klaus (Hrsg.): Nachkrieg in Deutschland. Hamburg 2001, S. 384 – 404. Müller, Burkhard: „Professionalisierung“. In: Thole, Werner (Hrsg.): Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. Opladen 2002, S. 725 – 744. Müller-Freienfels, Wolfram: Ehe und Recht. Tübingen 1962. Nachbauer, Kurt: „Wollasch, Hans“. In: Maier, Hugo (Hrsg.): Who is who der Sozialen Arbeit. Freiburg 1998, S. 641 – 642. ND: „Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung. In: Polligkeit, W. (Hrsg.): Nachrichtendienst des deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge (1950), Nr. 6, Mai/Juni, S. 137 – 138. Neuffer, Manfred: Die Kunst des Helfens. Geschichte der Sozialen Einzelhilfe in Deutschland. Weinheim 1990. Neumann, Johannes: „Die Möglichkeiten des geltenden katholischen Eherechts“. In: Interkonfessioneller Arbeitskreis für Ehe- und Familienfragen (Hrsg.): Christliche Einheit in der Ehe. Mainz 1969, S. 44 – 61. Nevermann, Hans: Über Eheberatung. Leipzig 1931. Niedermeyer, Albert: Handbuch der speziellen Pastoralmedizin. Bd. 2: Ehe- und Sexualleben: Fakultative Sterilität, Sterilität, Künstliche Befruchtung, Impotenz, Eheberatung. Wien 1952. Niedermeyer, Albert: Wahn, Wissenschaft und Wahrheit. Lebenserinnerungen eines Arztes. Innsbruck 1956. Niehuss, Merith: Familie, Frau und Gesellschaft. Studien zur Strukturgeschichte der Familien in Westdeutschland 1945 – 1960. Göttingen 2001.
420
Quellen und Literatur
Nuys-Henkelmann, Christian: „‚Wenn die rote Sonne abends im Meer versinkt …‘ Die Sexualmoral der fünfziger Jahre“. In: Bagel-Bohlan, Anja / Salewski, Michael (Hrsg.): Sexualmoral und Zeitgeist im 19. und 20. Jahrhundert. Opladen 1990, S. 107 – 146. o. A.: „Die Göttinger Eheberatungsstelle“. In: Wege zum Menschen. Monatsschrift für Seelsorge, Psychotherapie und Erziehung und zur Förderung der Zusammenarbeit von Arzt und Seelsorger 6 (1954), S. 343. o. A.: „Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung in Hannover“. In: Gesundheitsfürsorge. Zeitschrift für die gesundheitlichen Aufgaben im Rahmen der Familienfürsorge 7 (1958), S. 187 – 188. o. A.: „Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung“. In: Wege zum Menschen. Monatsschrift für Seelsorge, Psychotherapie und Erziehung und zur Förderung der Zusammenarbeit von Arzt und Seelsorger 8 (1956), S. 371 – 373. o. A.: „Jugend- und Eheberatung“. In: Wege zum Menschen. Monatsschrift für Seelsorge, Psychotherapie und Erziehung und zur Förderung der Zusammenarbeit von Arzt und Seelsorger 7 (1955), S. 315. o. A.: „Aus den Landesverbänden“. In: DPWV-Nachrichten 1 (1951), H. 4, S. 2. o. A.: „Paarbeziehungen werden wieder nach altem Muster gelebt. In: Ehe-, Familien- und Partnerschaftsberatungsstelle (Hrsg.): 50 Jahre Eheberatung in Karlsruhe. Karlsruhe 2003, S. 12 – 13. o. A.: „Umschau. Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung“. In: [Sozialamt der Landeshauptstadt Hannover (Hrsg.):] Zeitschrift für das Fürsorgewesen (1950), Nr. 16, S. 184 – 185. o. A.: „Wer ist wer“. In: Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (Hrsg.): 50 Jahre DAJEB 1949 – 1999. [München] 1999, S. 148 – 165. o. A.: „Wesen und Methode der Eheberatung“. In: Vinzenz-Blätter. Zeitschrift für Vinzentinische Caritas 48 (1965), H. 2 (April), S. 45 – 46. Oertel, Ferdinand: Der Kirchenzeitungsmann: Erinnerungen aus fünfzig Journalistenjahren. Münster 2009. Oheim, Gertrud et al.: Die gute Ehe. Ein Ratgeber für Mann und Frau. Gütersloh 1959/1965. Osten, Petra von der: Jugend- und Gefährdetenfürsorge im Sozialstaat. Der Katholische Fürsorgeverein für Mädchen, Frauen und Kinder auf dem Weg zum Sozialdienst katholischer Frauen 1945 – 1968. Paderborn 2002. Owetschkin, Dimitrij: „Religiöse Sozialisation in bikonfessionellen Kontexten. Zur Stellung konfessionsverschiedener Ehen und Familien im religiösen Wandel der 1960er Jahre“. In: Lepp, Claudia / Oelke, Harry / Pollack, Detlef (Hrsg.): Religion und Lebensführung im Umbruch der langen 1960er Jahre. Göttingen 2016, S. 237 – 258. Pesch, Hilde: „Die Konferenz als Rückhalt in Fragen der Eheberatung“. In: Generalsekretariat der Elisabeth-Konferenzen (Hrsg.): Elisabethbrief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1964), H. 4 ( Juli/August), S. 106 – 108. Parow-Souchon, Eva: „Eheberatung in Berlin“. In: Volksgesundheitsdienst 9/1951, S. 231 – 232. Pick, Elsa: „Ehe- und Erziehungsberatung“. In: Der Helfer. Nachrichtenblatt der Arbeiterwohlfahrt 6 (1952), Nr. 3, S. 1 – 2. Pierenkemper, Toni: „Arbeit, Einkommen und Lebensstandard“. In: Rahlf, Thomas (Hrsg.): Deutschland in Daten. Zeitreihen zur Historischen Statistik, Bonn 2015, S. 142 – 153.
Gedruckte Quellen und Darstellungen
421
Plötz, Kirsten: „‚Echte‘ Frauenleben? ‚Lesbierinnen‘ im Spiegel öffentlicher Äußerungen in den Anfängen der Bundesrepublik“. In: Fachverband Homosexualität und Geschichte (Hrsg.): Invertito. Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten (1) 1999, S. 47 – 69. Poker, Heinz H.: Chronik der Stadt Stuttgart, 1976 – 1979. Stuttgart 1990. Pommerin, Reiner: „Zwischen Anpassung und Widerstand. Zum 100. Geburtstag von Prof. Dr. Rainer Fetscher“. In: Technische Universität Dresden (Hrsg.): Rainer Fetscher. Gedenkschrift aus Anlaß des 100. Geburtstages. Dresden 1996, S. 15 – 30. Pompey, Heinrich: „Zur Geschichte der Pastoralpsychologie“. In: Baumgartner, Isidor (Hrsg.): Handbuch der Pastoralpsychologie. Regensburg 1990, S. 23 – 40. Raabe, Felix: „Laienarbeit zwischen Kriegsende und Konzil“. In: Gatz, Erwin (Hrsg.): Geschichte des Kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Bd. 8: Laien in der Kirche, Freiburg im Breisgau 2008, S. 253 – 280. Rahden, Till van: „Demokratie und väterliche Autorität. Das Karlsruher ‚Stichentscheid‘-Urteil von 1959 in der politischen Kultur der frühen Bundesrepublik“. In: Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History 2/2005, S. 160 – 179. Raphael, Lutz: „Experten im Sozialstaat“. In: Hockerts, Hans Günter (Hrsg.): Drei Wege deutscher Sozialstaatlichkeit. NS-Diktatur, Bundesrepublik und DDR im Vergleich. München 1998, S. 231 – 258, hier S. 236. Raphael, Lutz: „Die Verwissenschaftlichung des Sozialen als methodische und konzeptuelle Herausforderung für eine Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts“. In: Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft 22 (1996), H. 2, S. 165 – 193. Reinicke, Peter: Soziale Krankenhausfürsorge in Deutschland. Von den Anfängen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Opladen 1998. Revers, W[ilhelm] J[osef]: „Personales Werden – entscheidend für die Ehe“. In: Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen (Hrsg.): Partnerbild und Ehe. Freiburg im Breisgau 1967, S. 7 – 25. Reyer, Jürgen: Alte Eugenik und Wohlfahrtspflege. Entwertung und Funktionalisierung der Fürsorge vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Freiburg im Breisgau 1991. Richter, Ingrid: Katholizismus und Eugenik in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. Zwischen Sittlichkeitsreform und Rassenhygiene. Paderborn 2001. Richter, Ingrid: „Von der Sittlichkeitsreform zur Eugenik. Katholischer Deutscher Frauenbund und eugenische Eheberatung“. In: Muschiol, Gisela (Hrsg.): Katholikinnen und Moderne. Katholische Frauenbewegung zwischen Tradition und Emanzipation. Münster 2003, S. 255 – 280. Rocholl-Gärtner, Ingeborg: Anwalt der Frauen, Hermann Klens. Düsseldorf 1978. Roesch, Claudia: Wunschkinder. Eine transnationale Geschichte der Familienplanung in der Bundesrepublik Deutschland. Göttingen 2021. Rölli-Alkemper, Lukas: Familie im Wiederaufbau. Katholizismus und bürgerliches Familienideal in der Bundesrepublik Deutschland 1945 – 1965. Paderborn 2000. Rothenbacher, Franz / Fertig, Georg: „Bevölkerung, Haushalte und Familien“. In: Rahlf, Thomas (Hrsg.): Research Report. Deutschland in Zahlen. Zeitenreihen zur Historischen Statistik. Bonn 2015, S. 30 – 45. Rudloff, Wilfried: Die Wohlfahrtsstadt. Kommunale Ernährungs-, Fürsorge- und Wohnungspolitik am Beispiel Münchens 1910 – 1933. 2. Teilband, Göttingen 1998. Rüberg, Rudolf: „Ehe und Familie im Wandel. Soziologische Aspekte“. In: Struck, Günter / Loeffler, Lothar (Hrsg.): Einführung in die Eheberatung, Mainz 1971, S. 73 – 91.
422
Quellen und Literatur
S., G.: „Bovet, Theodor“. In: Wilhelm Kosch et al. (Hrsg.): Deutsches Literatur-Lexikon, Bd. 2. München 2002, Sp. 497 – 498. Saathoff, Tjalda: Ein Jahrzehnt Ratgeberspalten. Inhaltsanalyse von Alltagskonflikten in fünf ausgewählten Zeitschriften. Hamburg 1981. Sach, Louisa: Gedenke, daß du eine deutsche Frau bist! Die Ärztin und Bevölkerungspolitikerin Ilse Szagunn (1887 – 1971) in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Berlin 2006, auch verfügbar unter https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/7386, besucht am 4. September 2021. Sachße, Christoph: Mütterlichkeit als Beruf. Sozialarbeit, Sozialreform und Frauenbewegung 1871 – 1929. Frankfurt am Main 1986. Sachße, Christoph / Tennstedt, Florian: Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland. Bd. 4: Fürsorge und Wohlfahrtspflege in der Nachkriegszeit 1945 – 1953. Stuttgart 2012. Sauer, Thomas: Westorientierung im deutschen Protestantismus? Vorstellungen und Tätigkeit des Kronberger Kreises. Berlin / Boston 2009, S. 1 f. Sauser, Ekkart: „Weihbischof Dr. Augustinus Frotz“. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. VIX. Herzberg 1998, Sp. 1009 – 1012. Schagen, Udo / Schleiermacher, Sabine: „Carl Arthur Johannes Coerper“. In: Dies. (Hrsg.): 100 Jahre Sozialhygiene, Sozialmedizin und Public Health. Berlin 2005. Scheichl, Sigurd Paul: „Paepcke, Lotte“. In: Kilcher, Andreas B. (Hrsg.): Metzler Lexikon der deutschjüdischen Literatur. Jüdische Autorinnen und Autoren deutscher Sprache von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Stuttgart 2012, S. 394 – 395. Schelsky, Helmut: Soziologie der Sexualität. Über die Beziehungen zwischen Geschlecht, Moral und Gesellschaft. Hamburg 1955. Schelsky, Helmut: Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart: Darstellung und Deutung einer empirisch-soziologischen Tatbestandsaufnahme. Stuttgart 1955. Scheumann, F. K.: Eheberatung. Einrichtung, Betrieb und Bedeutung für die biologische Erwachsenenberatung. Berlin 1928. Schiefer, Elisabeth: „Seelsorgehelferin, Seelsorgehelfer“. In: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 9. Freiburg 2000, Sp. 390. Schlatter, Margit: „Vorwort“. In: Bang, Ruth: Psychologische und methodische Grundlagen der Einzelfallhilfe (Casework). Wiesbaden 1958, S. 7 – 8. Schmuhl, Hans-Walter: Grenzüberschreitungen. Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik 1927 – 1945. Göttingen 2005. Schmuhl, Hans-Walter: „Hermann Muckermann. Ein Akteur im Spannungsfeld von Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik“. In: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 109 (2014), H. 3 – 4, S. 241 – 255. Schneider, Franka: „Ehen in Beratung“. In: Kaminsky, Annette (Hrsg.): Heimkehr 1948. München 1998, S. 192 – 216. Schneider, Franka: „‚Einigkeit im Unglück‘? Berliner Eheberatungsstellen zwischen Ehekrise und Wiederaufbau“. In: Naumann, Klaus (Hrsg.): Nachkrieg in Deutschland. Hamburg 2001, S. 206 – 226. Scholz, Albrecht: Art. „Rainer Fetscher (1895 – 1945)“. In: Sigusch, Volkmar / Grau, Günter (Hrsg.): Personenlexikon der Sexualforschung. Frankfurt am Main 2009, S. 160 – 165. Schorsch, Helene: „‚Miteinander alles Gute und Böse tragen‘. Aus der Arbeit einer Vertrauensstelle für Ehe- und Familienfragen“. In: Das diakonische Werk, Nr. 3, Stuttgart 1956, S. 3 – 4. Schreuder, Osmund: Kirche im Vorort. Soziologische Erkundungen einer Pfarrei. Freiburg 1962.
Gedruckte Quellen und Darstellungen
423
Schroll, Josef P.: „Die Ehe im kirchlichen Recht. Das katholische kirchliche Eherecht“. In: Scherer, Alice et al. (Hrsg.): Ehe und Familie. Grundsätze, Bestand und fördernde Maßnahmen. Freiburg im Breisgau 1956, Sp. 53 – 74. Schütz, Horst: „Gesundheitsfürsorge zwischen humanitärem Anspruch und eugenischer Verpflichtung. Entwicklung und Kontinuität sozialhygienischer Anschauungen zwischen 1920 und 1960 am Beispiel von Prof. Carl Coerper“. Husum 2004. Silies, Eva-Maria: Liebe, Lust und Last. Die Pille als weibliche Generationserfahrung in der Bundesrepublik 1960 – 1980. Göttingen 2010. Simmon-Kaiser, Maria: „Am Abend einer langen Ehe. Probleme und Möglichkeiten – eine Eheberaterin berichtet“. In: Die katholische Frau: Monatsblatt für christl. Lebensgestaltung (1965), März, S. 11 – 12. Simmon-Kaiser, Maria: „Die Bedeutung einer langen Ehegemeinschaft“. In: Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1964), H. 6, November/Dezember, S. 122 – 127. Simmon-Kaiser, Maria: „Wie weit reicht unsere Eheberatung in der offenen Arbeit?“. In: ElisabethBrief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1964), H. 4, Juli/August, S. 98 – 101. Simmon-Kaiser, Maria: „Krisen in der jungen Ehe“. Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1965), H. 5, September/Oktober, S. 122 – 127. Simmon-Kaiser, Maria: „Die berufstätige Mutter im Erfahrungsfeld der Eheberatung“. In: ElisabethBrief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1964), H. 4, Juli/August, S. 89 – 93. Soden, Kristine von: Die Sexualberatungsstellen in der Weimarer Republik 1919 – 1933. Berlin 1988. Sohn, Andreas / Sohn-Kronthaler, Michaela: „Frauen in der Kirche“. In: Gatz, Erwin (Hrsg.): Geschichte des Kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Bd. 8: Laien in der Kirche. Freiburg im Breisgau 2008, S. 483 – 520. Spangenberg, Johanna: „Gedanken zu einer Eheberatungsstelle“. In: SPD-Mitteilungsblatt, 10. September 1948, S. 2. Staub-Bernasconi, Silvia: Der Professionalisierungsdiskurs zur Sozialen Arbeit (SA/SP) im deutschsprachigen Kontext im Spiegel internationaler Ausbildungsstandards. Soziale Arbeit – eine verspätete Profession? In: Becker-Lenz, Ronald / Busse, Stefan / Ehlert Gudrun u. a. (Hrsg.): Professionalität in der Sozialen Arbeit. Standpunkte, Kontroversen, Perspektiven. Wiesbaden 2009, S. 21 – 46. Steinbacher, Sybille: Wie der Sex nach Deutschland kam. Der Kampf um Sittlichkeit und Anstand in der frühen Bundesrepublik. München 2011. Steinmaus-Pollack, Angelika: Art. „Katholische Aktion“. In: Theologische Realenzyklopädie. Bd. 18, Berlin u. a. 2008, S. 43 – 45. Stonner, Anton: „Die Krise der christlich-abendländischen Form der Ehe und Familie“. In: Berufsverband Katholischer Sozialarbeiter Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Familiennot und ihre Überwindung. o. O. [1955], S. 5 – 17. Struck, Günter: Ehenot – Ehehilfe. Geschichte und Gestalt katholischer Eheberatung in Deutschland. Limburg 1966. Struck, Günter: „Entwicklung und Aufbau der Ehe- und Familienberatung“. In: Ders. / Loeffler, Lothar (Hrsg.): Einführung in die Eheberatung. Mainz 1971, S. 1 – 19. Struck, Günter: „Spezielle Schwerpunkte der Eheberatung“. In: Deutscher Caritasverband Freiburg (Hrsg.): 1897 – 1972. 75 Jahre Deutscher Caritasverband. Freiburg im Breisgau [1972], S. 244. Szöllösi-Janze, Margit: „Wissensgesellschaft in Deutschland: Überlegungen zur Neubestimmung der deutschen Zeitgeschichte über Verwissenschaftlichungsprozesse“. In: Geschichte und Gesellschaft 30 (2004), H. 2, S. 277 – 313.
424
Quellen und Literatur
Tägert, Ilse: Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung für das Geschäftsjahr 1953/54. Sonderdruck aus Soziale Arbeit 3 (1954), H. 11, S. 2. Tägert, Ilse: „Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung Hannover. Bericht über das Geschäftsjahr 1954/55“. In: Gesundheitsfürsorge. Zeitschrift für die gesundheitlichen Aufgaben im Rahmen der Familienfürsorge 5 (1955), H. 8, S. 146 – 147. Tägert, Ilse: „Bericht der Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung in Hannover“. In: Hogrefe, C. J. (Hrsg.): Psychologische Rundschau. Überblick über die Fortschritte der Psychologie in Deutschland, Österreich und der Schweiz 3 (1952), S. 229 – 234. Tändler, Maik: Das therapeutische Jahrzehnt. Der Psychoboom in den siebziger Jahren. Göttingen 2016. Teichtweier, G.: „Entwicklung der Persönlichkeit und Reifungsstufen der Ehe“. In: Katholisches Zentralinstitut für Ehe- und Familienfragen (Hrsg.): Partnerbild und Ehe. Freiburg im Breisgau 1967, S. 51 – 67. Thicken, Hanna: „Aufgaben der Eheberatung“. In: Neues Beginnen 3 (1952), Nr. 6, S. 3. Thurnwald, Hilde: Gegenwartsprobleme Berliner Familien. Eine soziologische Untersuchung an 498 Familien. Berlin 1948. Timm, Annette F.: The Politics of Fertility in Twentieth-Century Berlin. New York 2010. Trüb, Carl L. Paul: Die Terminologie und Definition Sozialmedizin und Sozialhygiene in den literarischen Sekundärquellen der Jahre 1900 bis 1960. Opladen 1978. Wagner, Harald: „Lorenz Jaeger“. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 2. Herzberg 1990, Sp. 1435 – 1436. Wagner, Leonie: „Vom Klienten zur Nutzer_in“. In: Böllert, Karin (Hrsg.): Kompendium Kinder- und Jugendhilfe. Wiesbaden 2018, S. 337 – 364. Weingart, Peter / Kroll, Jürgen / Bayertz, Kurt: Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland. Frankfurt am Main 1988. Weiss, Sheila F.: „Verschuer, Otmar Reinhold Ralph Ernst Freiherr von“. In: Neue Deutsche Biographie, Bd. 26. Berlin 2016, S. 768 – 770. Wendt, Wolf Rainer: Geschichte der Sozialen Arbeit 2. Die Profession im Wandel ihrer Verhältnisse. Stuttgart 2008. Westermann, Stefanie / Ohnhäuser, Tim / Kühl, Richard: Medizin im Dienst der „Erbgesundheit“. Einleitende Bemerkungen. In: Westermann, Stefanie / Kühl, Richard / Groß, Dominik (Hrsg.): Medizin im Dienst der „Erbgesundheit“. Beiträge zur Geschichte der Eugenik und „Rassenhygiene“. Berlin 2009, S. 15 – 21. Wirtz, Hans: Vom Eros zur Ehe. Die naturgetreue Lebensgemeinschaft. Heidelberg 1946. Wollasch, Hans: „Die Partnerschaft von Mann und Frau in der Familie“. In: Berufsverband Katholischer Sozialarbeiter Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Familiennot und ihre Überwindung, o. O. [1955], S. 53 – 57. Wollasch, Hans: „Vorbemerkungen zu einer caritativen Ehe- und Familienhilfe“. In: Caritas. Zeitschrift für Caritasarbeit und Caritaswissenschaft 53 (1952), H. 1 – 2, S. 16 – 26. World Health Organization: Constitution. New York 1946. Wuermeling, Franz-Josef: „Familienbildung – Fundament der Familienpolitik“. In: Beckel, Albrecht et al. (Hrsg.): Erwachsenenbildung 5 (1959), H. 4, S. 109 – 113. Zelazny, Käthe: „Welche Eheprobleme und -nöte kommen der Elisabethfrau vor Augen?“. In: ElisabethBrief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1964), H. 4, Juli/August, S. 102 – 106. Zelazny, Käthe: „Möglichkeiten und Grenzen der Beratung bei Trennungskrisen“. In: Soziale Arbeit: Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete 12 (1963), H. 2, S. 59 – 67.
Gedruckte Quellen und Darstellungen
425
Zelazny, Käthe: „Die berufstätige Mutter im Erfahrungsbereich der Ehe- und Erziehungsberatung“. In: Elisabeth-Brief. Zeitschrift für die pfarrliche Helferarbeit der Frauen (1959), H. 5, Sept./Okt., S. 106 – 110. Ziemann, Benjamin: „Zwischen sozialer Bewegung und Dienstleistung am Individuum. Katholiken und katholische Kirche im therapeutischen Jahrzehnt“. In: Archiv für Sozialgeschichte 44 (2004), S. 357 – 393, hier S. 381.
Register Adenauer, Paul 259, 276, 278, 293 – 295, 296, 298, 315, 319 f., 347, 369 Bang, Ruth 145 f. Bargenda, Johanna 383 – 385 Beckmann, Anna 30, 35, 37, 262, 264 f., 267 – 271, 273 f., 276, 299, 302, 356, 361, 376, 399 Blech, Maria 33, 86 f., 91, 197 f. Bornitz, Maria 287, 289 f., 292 f. Bovet, Theodor 124 f., 151 f. Buurmann, Otto 94, 151 Coerper, Carl 9, 76, 91, 98, 105 – 107, 110 – 113, 117, 122 f., 126 – 130, 133, 138 – 141, 146, 152, 186, 245, 362, 402 Cristian, Linda 343 Durand-Wever, Anne-Marie
94
Fetscher, Rainer 22 – 24, 27 Fischer, Joachim 8, 89 – 93, 98 f., 101, 104 f., 107 – 110, 113, 117 – 120, 122 f., 126, 128 f., 133 f., 138, 155, 159 – 161, 170, 245, 402 Fischer-Erling, Josepha 10, 117, 262 f., 265 f., 277, 286 – 288, 303 – 308, 322, 329, 338, 343, 351 f., 368 – 370, 386 – 390, 399 Friederichs, Helmut 279, 284, 296 Frotz, Augustinus 277, 351 Groeger, Guido 82, 110, 128, 160 f., 163, 197 f. Große-Schönepauck, Helene 103 f. Grotjahn, Alfred 24, 107, 109 Grube, Magda 372 Haeckel, Ernst 16 Haidinger, Alice 13, 80, 183, 184 f., 189, 191 Haidinger, Oskar 183 Harmsen, Hans 94 Hemsing, Walter 337 Hirschfeld, Magnus 18 Hirtsiefer, Heinrich 19 Hitler, Adolf 27, 34
Jaeger, Lorenz
249, 272 f., 281, 284, 286, 292
Kamphuis, Marie 132 Kinsey, Alfred C. 150 – 152 Kirschner, Berna 288, 296, 303 f. Klens, Hermann 36, 251, 256, 273 f., 275, 277, 279, 281 f., 286 f., 289 – 292, 322, 339, 399 Korte, Bernhard 276 f., 285 – 289, 291, 294, 296, 312, 318 f., 321 – 323, 327, 341 – 350, 352 – 366, 368, 372, 378, 381 Kowalewsky, Wolfram 125, 143 f. Kujawa, Helena 357 Läpple, Johanna 311, 313, 324 Lenz, Fritz 147 Lenz-von Borries, Kara 146 f. Lioba, M. 349, 366 f. Loeffler, Lothar 32, 90 f., 100, 104 – 107, 114 – 117, 122 f., 127, 129, 134, 146, 149, 159 f., 174, 179, 245, 304, 338 f., 402 Mann, Else 288, 296, 387 Michael, Sitta 185 Muckermann, Hermann 29, 31, 33 f., 261 – 263 Muhl-Schwarzenberg, Elisabeth 266 Müller-Freienfels, Wolfram 57, 61 Münchmeyer, Friedrich 101, 119, 160 Nevermann, Hans 32, 77 Niedermeyer, Albert 29 f., 34, 263, 299 – 305, 350, 355 f., 359 f., 362, 364, 366 Ophey, Rose
356, 368
Paepcke, Lotte 185 Pick, Elsa 147 f. Pius XI. 250 Pius XII. 252 Ploetz, Alfred 105 Popenoe, Paul B. 9 Power, Tyrone 343 Richmond, Mary
https://doi.org/10.1515/9783111097534-009
141
Register
Salomon, Alice 130 Scheffler, Erna 183 Schelsky, Helmut 50 Scheumann, Friedrich Karl 20 – 24, 26, 34 Scholtz-Klink, Gertrud 35 Schönebeck, Anna von 378 Schulze, Renate 185 Schulze-Danneberg, Kurt 204 Simmon-Kaiser, Maria 308 f., 375 Sommer, Bertha 162 Spieler, Ilse 185 Sprotte, Johanna 185 Stöcker, Helene 18 Struck, Günter 261, 278, 312 – 316, 328, 331, 335 f., 387 Szagunn, Ilse 37 f., 71, 91
427
Tägert, Ilse 132, 174 – 176, 180 Thurnwald, Hilde 48 f. van de Velde, Theodoor 355, 356 Verschuer, Otmar Freiherr von 9, 73, 87, 93, 133 Weber, Helene 288 Wollasch, Hans 93, 94, 318 Wörle, Anna 354 Wuermeling, Franz-Josef 64 f., 153 Zelazny, Käthe
303, 332, 360, 371, 373 f.
Die Buchreihe Family Values and Social Change Wie veränderten sich Normen und Werte unter den Bedingungen intensiven sozialen Wandels in der Moderne? Die Familie bildet die ideale Sonde zur Beantwortung diese Frage, da ihr Zustand gemeinhin als Gradmesser für das Wohlergehen der Gesellschaft gilt. Aus diesem Verständnis von „Familie“ als „Basis der Nation“ beziehen Debatten und Expertendiskurse um das dominante Familienideal und den Umgang mit Abweichungen ihre besondere Sprengkraft. Die Studien, hervorgegangen aus der Münsteraner Emmy Noether-Gruppe „Familie im gesellschaftlichen Wandel: Die US-amerikanische Familie im 20. Jahrhundert“ analysieren den Wandel der Familienwerte und Geschlechternormen in der US-amerikanischen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts aus verschiedenen Blickwinkeln: öffentliche Debatten, Experteninterventionen, Umgang mit Minderheiten, Populärkultur. Sie zeichnen ein differenziertes Bild des spannungsreichen Verhältnisses von Norm und Lebenswirklichkeit in den modernen USA. Die Buchreihe wird sukzessive erweitert um aktuelle Forschungen zu Geschlechternormen und Familienwerten in den USA. Die Titel erscheinen auf Deutsch oder auf Englisch. Die Serie wird herausgegeben von Isabel Heinemann.
Bereits erschienen: Claudia Roesch: Macho Men and Modern Women. Mexican Immigration, Social Experts and Changing Family Values in the 20th Century United States. Berlin/Boston 2015. Andre Dechert: Dad on TV. Sitcoms, Vaterschaft und das Idel der Kernfamilie in den USA, 1981-1992. Berlin/Boston 2018. Isabel Heinemann: Wert der Familie. Ehescheidung, Frauenarbeit und Reproduktion in den USA des 20. Jahrhunderts. Berlin/Boston 2018. Anne Overbeck: At the Heart of it All? Discourses on the Reproductive Rights of African American Women in the 20th Century. Berlin/Boston 2019. Karin Hilck: Lady Astronauts, Lady Engineers, and Naked Ladies. Women and the American Space Community during the Cold War, 1960s-1980s. Berlin/Boston 2019. Jana Kristin Hoffmann: Die Sexualisierung der Religion im 20. Jahrhundert. Diskurse um Sexualität, Familie und Geschlecht in der Methodistischen Kirche in den USA. Berlin/Boston 2021. Zu den Forschungen der Arbeitsgruppe von Isabel Heinemann vgl. auch .


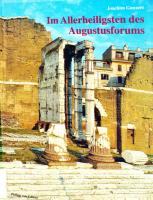

![Lehrsupervision im Fokus [1 ed.]
9783666405679, 9783525405673](https://dokumen.pub/img/200x200/lehrsupervision-im-fokus-1nbsped-9783666405679-9783525405673.jpg)





