Das Geräusch der Stadt: Phänomenologie des Lauten und Leisen 9783495999721, 9783495492703
109 52
German Pages [241] Year 2022
Polecaj historie
Table of contents :
Cover
Verzeichnis der Abkürzungen
Einleitung
1. Vom Geräusch, Rauschen, Tönen und Klingen
Etymologische Bemerkungen
Geräusch-Charaktere und -Gesichter
Geräusche kommen aus dem Leben
Geräusche im Schöpfungsmythos
Urbanes Geräuscherleben
2. Wahrnehmung als Einfühlung
Der Leib als »Einschlagsort« der Gefühle
Wahrnehmung als »leibliche Kommunikation«
»Springende« Wahrnehmung – synästhetisches Hören
3. Geräusche in Worte fassen
Im Konflikt mit der Zeit
Die Grenzen der wörtlichen Rede – Inkommensurabilitäten
Das Geräusch als Ganzes und seine lautlichen Segmente
Zwischen Gegenstands- und Selbstbezug
Hin-Hören als Methode und praktische Zivilisationskritik
4. Das lautliche Gesicht der Stadt
Das Grundgeräusch der Stadt
Örtliche Geräuschgemische
Das hör- und sichtbare Temperament einer Stadt
Die atmosphärischen Gesichter einer Stadt
Das affizierende Drin-Sein im vitalen Raum der Stadt
5. Die leibliche Qualität des Hörens
Die Stadt und die Sinne
Geräusch und Bewegung
Der sinnliche Stoff des Hörens
Mit Scharf- und Tiefsinn hören
Dispositionen des Hörens
Akustische Reize versus lautliches Hören
Das plötzlich Gehörte
Zur Instrumentalisierung des Hörerlebens
6. Geräuschhaftes Raumerleben
Vorder- und Hintergrundgeräusche
Geräusche und Töne temperieren den (leiblichen) Raum
Menschliche Eigengeräusche
Geräusche als Gesten im symbolischen Raum
Geräusche in einer »urbanen Dermatologie«
Geräuschhafter Bewegungsraum
Geräuscherleben im historischen Wandel
7. Zur Verwurzelung von Geräuschen in Situationen
Situationen sind Ganzheiten
Situativ vermischte Geräusche
Zur Situiertheit einer Person in ihrem So-Hören
8. Das Hören von etwas
Das WAS des Gehörten
Hörendes Denken – denkendes Hören
Das hinter den Bildern Gehörte
Zur Zeitlichkeit des Hörens
9. Tag- und Nachtgeräusche
Die atmosphärische Ambivalenz der Nacht
Stille
Die Stille eines Sonntages
10. Auf die Maschinen hören
Das relative Verstummen der Naturgeräusche
Der Ton der Maschinen
Der kulturelle Oberton der Maschinengeräusche
Spätmoderne Hörvergessenheiten
Das Nicht-mehr-Hören im Hören
11. Lärm
Lärm – ein relatives Ereignis
Das »Innere« eines Geräuschs
Wenn ein Geräusch zu Lärm wird
Lärm muss nicht »laut« sein
12. Kunst der Geräusche
Das »Atmen« der Stadt
Der überhörte Sound der Stadt
13. Die Stimmen der Orte
Der Ort der Geräusche
Hörsame Architektur
Vom Turm her die Glocken läuten
Der Klang der Glocken im Geräusch der Stadt
Zur Situiertheit des Schalls der Glocken
Schluss
Literaturverzeichnis
Citation preview
Jürgen Hasse
Das Geräusch der Stadt Phänomenologie des Lauten und Leisen
VERLAG KARL ALBER
https://doi.org/10.5771/9783495999721
.
B
https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Jürgen Hasse
Das Geräusch der Stadt Phänomenologie des Lauten und Leisen
https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
© Titelbild: jwweaver89/shutterstock.com
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-495-49270-3 (Print) ISBN 978-3-495-99972-1 (ePDF)
Onlineversion Nomos eLibrary
1. Auflage 2022 © Verlag Karl Alber – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Baden-Baden 2022. Gesamtverantwortung für Druck und Herstellung bei der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier (säurefrei). Printed on acid-free paper. Besuchen Sie uns im Internet verlag-alber.de https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Verzeichnis der Abkürzungen
DWDS
Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, hrsg. v. d. BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
HWPh
Historische Wörterbuch der Philosophie, 13 Bände, Bände 1–3 hgg. von Joachim Ritter, Bände 4–10 von Karlfried Gründer, Band 11–12 von Gottfried Gabriel. Basel/Stuttgart bzw. Basel 1971 bis 2007.
DWB
Grimm Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, 33 Bände. München 1991.
HWdAgl
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, 10 Bände, hgg. von Hanns Bächtold-Stäubli. Berlin und New York 1987.
RGG
Religion in Geschichte und Gegenwart, 7 Bände. hgg. von Kurt Galling. Tübingen 1957 – 1967.
Wasmuths Wasmuths Lexikon der Baukunst, 5 Bände. Berlin 1929. ÄGrB
Barck, Karlheinz u. a. (Hg.): Ästhetische Grundbegriffe. Histo risches Wörterbuch in sieben Bänden (Studienausgabe) Band 6, Stuttgart/Weimar 2000.
AT
Altes Testament
5 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Inhaltsverzeichnis
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
1. Vom Geräusch, Rauschen, Tönen und Klingen . . .
19
Etymologische Bemerkungen . . . . . . . . . . . . . . .
19
Geräusch-Charaktere und -Gesichter . . . . . . . . . . .
21
Geräusche kommen aus dem Leben . . . . . . . . . . . .
22
Geräusche im Schöpfungsmythos . . . . . . . . . . . . .
23
Urbanes Geräuscherleben . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2. Wahrnehmung als Einfühlung . . . . . . . . . . . .
27
Der Leib als »Einschlagsort« der Gefühle . . . . . . . . .
28
Wahrnehmung als »leibliche Kommunikation« . . . . . .
29
»Springende« Wahrnehmung – synästhetisches Hören . . .
32
3. Geräusche in Worte fassen . . . . . . . . . . . . . .
37
Im Konflikt mit der Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Die Grenzen der wörtlichen Rede – Inkommensurabilitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Das Geräusch als Ganzes und seine lautlichen Segmente .
44
Zwischen Gegenstands- und Selbstbezug . . . . . . . . .
46
Hin-Hören als Methode und praktische Zivilisationskritik
48
4. Das lautliche Gesicht der Stadt
. . . . . . . . . . .
53
Das Grundgeräusch der Stadt . . . . . . . . . . . . . . .
54
Örtliche Geräuschgemische . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Das hör- und sichtbare Temperament einer Stadt . . . . .
62
7 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Inhaltsverzeichnis
Die atmosphärischen Gesichter einer Stadt . . . . . . . .
66
Das affizierende Drin-Sein im vitalen Raum der Stadt . . .
69
5. Die leibliche Qualität des Hörens . . . . . . . . . .
73
Die Stadt und die Sinne . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
Geräusch und Bewegung . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Der sinnliche Stoff des Hörens . . . . . . . . . . . . . .
83
Mit Scharf- und Tiefsinn hören . . . . . . . . . . . . . .
84
Dispositionen des Hörens . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Akustische Reize versus lautliches Hören . . . . . . . . .
89
Das plötzlich Gehörte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
Zur Instrumentalisierung des Hörerlebens . . . . . . . . .
97
6. Geräuschhaftes Raumerleben . . . . . . . . . . . .
101
Vorder- und Hintergrundgeräusche . . . . . . . . . . . .
105
Geräusche und Töne temperieren den (leiblichen) Raum . .
109
Menschliche Eigengeräusche . . . . . . . . . . . . . . .
112
Geräusche als Gesten im symbolischen Raum . . . . . . .
113
Geräusche in einer »urbanen Dermatologie« . . . . . . . .
114
Geräuschhafter Bewegungsraum . . . . . . . . . . . . .
116
Geräuscherleben im historischen Wandel . . . . . . . . .
117
7. Zur Verwurzelung von Geräuschen in Situationen
121
Situationen sind Ganzheiten . . . . . . . . . . . . . . .
123
Situativ vermischte Geräusche . . . . . . . . . . . . . .
127
Zur Situiertheit einer Person in ihrem So-Hören . . . . . .
129
8. Das Hören von etwas . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
Das WAS des Gehörten . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
Hörendes Denken – denkendes Hören . . . . . . . . . . .
139
Das hinter den Bildern Gehörte . . . . . . . . . . . . . .
142
8 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Inhaltsverzeichnis
Zur Zeitlichkeit des Hörens . . . . . . . . . . . . . . . .
144
9. Tag- und Nachtgeräusche . . . . . . . . . . . . . . .
149
Die atmosphärische Ambivalenz der Nacht . . . . . . . .
150
Stille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
Die Stille eines Sonntages . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
10. Auf die Maschinen hören . . . . . . . . . . . . . . .
165
Das relative Verstummen der Naturgeräusche . . . . . . .
167
Der Ton der Maschinen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
Der kulturelle Oberton der Maschinengeräusche . . . . . .
171
Spätmoderne Hörvergessenheiten . . . . . . . . . . . . .
175
Das Nicht-mehr-Hören im Hören . . . . . . . . . . . . .
176
11. Lärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
Lärm – ein relatives Ereignis . . . . . . . . . . . . . . .
183
Das »Innere« eines Geräuschs . . . . . . . . . . . . . . .
187
Wenn ein Geräusch zu Lärm wird . . . . . . . . . . . . .
189
Lärm muss nicht »laut« sein . . . . . . . . . . . . . . .
193
12. Kunst der Geräusche . . . . . . . . . . . . . . . . .
199
Das »Atmen« der Stadt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199
Der überhörte Sound der Stadt . . . . . . . . . . . . . .
202
13. Die Stimmen der Orte . . . . . . . . . . . . . . . . .
205
Der Ort der Geräusche . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205
Hörsame Architektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210
Vom Turm her die Glocken läuten . . . . . . . . . . . . .
213
Der Klang der Glocken im Geräusch der Stadt . . . . . . .
221
Zur Situiertheit des Schalls der Glocken . . . . . . . . . .
224
9 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Inhaltsverzeichnis
Schluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233
10 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Einleitung
Städte sind chaotische Räume des Vielen – des Einen wie des Anderen, des Passenden und sich Widersprechenden. Sie berühren die Sinne auf ganz unterschiedliche Weise – zwischen Extremen der Anziehung und Abstoßung. Sie bieten Orte der Kultur und der Bildung, locken mit verführerischen Sphären, halten Bühnen der Repräsentation ebenso bereit wie Fluchtrouten in Refugien und versteckte Wege in nischenhafte Taburäume. Und in der Mitte des faszinierendsten innerstädtischen Glamours überraschen plötzlich vorspringende Abgründe des Finsteren und Verbotenen. Indem die Städte uns eindrücklich erscheinen, vernehmen wir sie in Bildern, Gerüchen, Texturen und Geräuschen. Die spätmoderne Großstadt zeigt sich in fragmentarisch-dispa raten Teilen. In ihrem performativ strömenden Leben ist die Stadt ein Kosmos voller Gegensätze, Widersprüche und Kontraste. Immer wieder verwandelt sie sich auf unvorhersehbare Weise. Nachdem sie sich so oder so gehäutet hat, ist sie nicht mehr wie sie war. Sie implodiert in gewisser Weise, und das Viele, das sie nun ausmacht, überlagert sich zu Vexiergestalten, kollidiert an Rändern und bildet abermals unerwartete Synthesen. Mischgebilde regen an und auf. In Räumen und an Orten geben sie sich als Milieus der Faszination und Beängstigung zu spüren, der Betörung und Berauschung, der Lust und der Versuchung, der Gerüche und der Klänge. Dieses Buch über »das Geräusch« der Stadt widmet sich der urbanen Welt der Sinne. Im Fokus steht das Auditive, das Hörbare. Im Unterschied zum Gesehenen entzieht es sich der flüssigen Ausspra che in Worten. Der alltägliche Geräuschteppich der Straßen, Plätze, Baustellen und Industriegebiete bedarf im Allgemeinen auch gar nicht der Explikation. Wozu über das Läuten der Glocken sprechen, oder über den durchs Industriegebiet wehenden Wind. Das Meiste dessen, was unsere Sinne berührt, versteht sich von selbst. Es ist was es ist. In einer kulturell verkopften Welt ist es der Rede nur in Ausnahmesituationen wert. Vielleicht hat sich auch deshalb das Wort der Geräusch-Kulisse bewährt. In ihm ist das Wenigste klar und
11 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Einleitung
deutlich; das meiste verschwimmt »irgendwie« ineinander oder liegt disparat nebeneinander. So werden Ton, Laut, Klang und Geräusch nur in begründeten Fällen zu einem Stoff des Denkens – dann, wenn etwas stört, zur Qual wird oder sich als überwältigend und faszinierend zu spüren gibt. Auch wenn wir sie nicht zum Thema machen, teilen uns die urba nen Geräusche in der Mannigfaltigkeit ihrer rumorenden Virulenz auf »stumme« Weise Essentielles mit: über die herumwirkliche Welt und unser mitweltliches Befinden. Richtig hingehört und verstanden lässt uns das Auditive begreifen, in welcher Weise uns »etwas« atmosphärisch umhüllt, vielleicht auch manipuliert oder sediert. Töne und Laute sowie Klänge und Geräusche stimmen unser Ergehen in Umgebungen. Besser verstehen wir diese lautlich-atmosphärischen Umwölkungen und die daraus resultierenden Stimmungen, wenn sie bewusst gemacht werden, so dass sich – diesseits einer abstrakten Theoriesprache – das eine oder andere darüber sagen lässt. Das Vermögen geschärften Hören-Könnens fällt aber nicht vom Himmel. Es erfordert die Mühe genauen Hin-Hörens sowie die übende AusSprache des bewusst Erlebten. Es gibt das Gewöhnliche, über das wir zu sprechen gewohnt sind, aber auch jenes Gewöhnliche, das der Aussprache gegenüber systematisch versiegelt zu sein scheint. Die Welt der Geräusche bietet sich indes geradewegs dafür an, die Beschreibung des Gehörten zu üben. Die wortwörtliche Rede über das Leise und das Laute verlangt nämlich im Prinzip nicht mehr als die Rede über den Fisch, der keinen so überzeugenden Eindruck macht wie erhofft. Ein wesent liches Argument kommt hinzu, das für die Übung des Hinhörens auf die Geräusche spricht: Das Leben ist voll von ihnen. Und da, wo scheinbar nichts tönt, klingt, raschelt oder rauscht, gibt sich das eigene Atmen zu spüren und als ein archaisches Körpergeräusch sogar zu hören. Die Welt ist ein auditives Theater – säuselnd, donnernd, krachend, zischend, raschelnd, knisternd etc. Dabei ertönt nicht erst das von Menschen Gemachte. Die Geräusche der Natur gibt es schon immer, wenn sie in der Gegenwart des massenhaft Hergestellten auch von einem diffusen Hintergrundrauschen der Maschinen verschluckt werden mögen – abgesehen von Unwettern wie Orkan und Gewitter. Im Medium der vier Elemente entfalten sich die Kräfte der äußeren Natur – jetzt lautlos oder leise, dann tosend und lärmend. Eines der naturgeschichtlichen Urbilder schier unvorstellbaren Krachs muss der kosmologische Wettersturm gewesen sein. Mit zischendem Blitz
12 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Einleitung
und bebendem Donner ist er vor Unzeiten über die Erde gefegt. Kein Mensch war Zeuge dieser Ekstasen, die wir uns heute als ein grenzenloses Spektakel noch nicht einmal halbwegs trefflich vorstel len können. Ihre spätmodernen Zivilisationsgeräusche machen die Men schen dagegen selbst. Im hektisch-metropolitanen Treiben drängen sich die amorphen Grundgeräusche von allem und nichts beinahe permanent auf, um sogleich auch wieder überhört zu werden. Allzu schnell wird das beiläufig Wahrgenommene verdrängt – von noch Lauterem, geradezu unerträglichem Lärm oder von der Aufmerksam keit, die plötzlich auf irgend etwas gerichtet wird. Bald darauf jedoch dominiert, meistens wiederum nur in einem Hintergrund, erneut ein unaufhörliches Ticken, Piepsen, Brummen, Summen, Toben und Tosen technischer Töne, das sich in seiner quasi-orchestralen Zuspitzung in einen gnadenlosen Enharmonismus verliert. Nicht jede Vielfalt ist a priori schön, angenehm oder gut. Es kommt darauf an, was sich wie zu dieser oder jener Vielfalt zusammenmischt. Wo sich das Leben in seiner technisch organisierten Höchstform zu Gehör bringt, spielen sichtbare und unsichtbare Maschinen und Apparate produktive wie destruktive Rollen – auf offenen, verdeckten und versteckten Bühnen des Urbanen. Die großen Städte sind demo graphische und performative Dichtefelder, in denen alle nur erdenk lichen Amalgame von Menschen-, Tier- und Technikgeräuschen den sprichwörtlichen Ton der Zeit angeben. Als Brenngläser einer sich ungebremst beschleunigenden Zivilisation übertönen die technischen Medien die meisten »Verlautbarungen« der Natur. Im Sound der Maschinen sammelt sich die Resonanz einer virulenten Dynamik des Ungleichzeitigen: das Schlagen des Hammers in einem Hobbykeller, das Aufheulen der Polizeisirene an einer Unfallstelle, das Kreischen der Kreissäge auf einer Baustelle, das Quietschen der Bremsen eines Sportwagens an der roten Ampel und das tief blubbernde Dröhnen des über die Dächer eines Wohnquartiers fliegenden Helikopters. Über das städtische Leben wird viel geschrieben und gespro chen. In den Wissenschaften in aller Regel in der abstrakten Rede: über politische Utopien und deren Scheitern, über die Faszination vom Glanz ästhetisierter Bauten und die Kritik an postmodernen Lebensstilen. Meistens geht es dabei ums Sichtbare, nur selten ums Hörbare. Das Hören dessen, was in Ton, Klang, Melodie, Akkord, Harmonie und Disharmonie, in einem unaushaltbaren Lärm wie einem kaum wahrnehmbaren Säuseln vernehmbar ist, findet nur sel
13 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Einleitung
ten unsere herausgehobene Aufmerksamkeit. Wenn den Menschen etwas zu Ohren Kommendes bewusst wird, ist eher von Extremen die Rede, von Außergewöhnlichem oder Ungewohntem: von tatsäch lich oder vermeintlich krankmachendem Lärm, von großartiger oder grässlicher Musik, vom süßen Gesang der Nachtigall am romantisch verklärten Waldesrand oder vom aggressiven Bellen des am Zaun drohenden Kampfhundes. Dann werden die Geräusche zu einem Thema der wörtlichen Rede. Es gibt eine ganze Reihe von Filtern, die die Aufmerksamkeit gegenüber bestimmten Geräuschen öffnen. Es gibt auch welche, die daran hindern, zu hören, was hörbar wäre. Nicht alles, was wir hören könnten oder sollen, wollen wir auch tatsächlich hören. So werden die Todesschreie von Schwein und Rind, die sich in den Schachthäusern zu einer unaufhörlichen Melodie des Grauens aneinanderreihen, von dicken Mauern verschluckt, auf dass Gewohnheiten lustvollen Satt-Werdens gar nicht erst bedacht werden. Mehr noch als das überaus Laute wird das ethisch Abgründige zum Verschwinden gebracht. Vor allem dann, wenn es sich schon längst mit liebgewordenen Lebensweisen verbunden hat. Im chaotischen Durcheinander aller nur erdenklichen Oszillo gramme des Urbanen gerät das nahezu immerwährende, langweilige bis gewöhnliche Rauschen von allem Möglichen in den kulturellen Schatten dessen, was die Menschen in der westlichen Zivilisation gelernt haben, wichtig zu nehmen. Wichtig ist ihnen – allem voran – das Sichtbare. Städte sind »Augenwelten«, visuelle Räume par excel lence. So werden sie auch als solche erlebt. Und deshalb können nicht alle sinnlichen Eindrücke mit demselben Grad der Aufmerksamkeit erfasst werden. Zwar sind es die Sinne, die unser Denken und Fühlen berühren und in gewisser Weise mit »Nahrung« versorgen. Aber sie arbeiten weder gleichwertig, noch mit derselben Nachhaltigkeit. Die sich in einem prahlenden Gestus der Hyperästhetisierung gegen seitig überbietenden Wolkenkratzer beeindrucken in ihrer sichtba ren Erscheinung. Die Fallwinde, die die Luft in ihrem räumlichen Umfeld verwirbeln, werden eher stumm registriert. Und die aus der Implantierung der Hochbauten in die ohnehin schon verdichtete Stadt erwachsenden ökologischen und verkehrspolitischen Probleme kommen erst in den Fokus kritischen Nachdenkens, wenn sich der Rausch der Faszination »ernüchtert« hat. Trotz der lärmenden Permanenz des automobilen Straßenver kehrs sehen wir das bunte Gewirr in erster Linie; ebenso das chaotische Gewimmel der Fußgänger in der Rushhour. Die digitalen Werbespots,
14 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Einleitung
die sich in ihrer Ekstatik auf Hausfassaden und öffentlichen Screens in sich selbst ersticken, sind sowieso nur für die Schaulust gemacht. Schon die abgestumpfte Aufmerksamkeit hat genug damit zu tun, die sinnliche Flut des Visuellen zu beherrschen, das ungefragt bis widerwillig Gesehene zu ignorieren und zugleich auf Anderes zu achten – die aufleuchtende Ampel, den Hundehaufen auf dem Geh weg oder einen am Straßenrand strauchelnden Greis. Das Sehen ist nicht nur der erste der »höheren« Sinne. Der Gesichtssinn ist auch die erste Dimension der Erkenntnis, weshalb das sehende Auge mit der Intellektualität verknüpft wird. Brücken zum Denkbaren bilden sich mehr vom Sichtbaren als vom Hörbaren. »Diese Reduktion der Vielfalt der Sinnlichkeit auf das Sehen geht einher mit der Reduktion der Sinnlichkeit auf die Idee, auf ein unsinnliches Aussehen, das Heidegger […] ›Wesen‹ nennt. Es handelt sich um eine zweiphasige oder doppelte Reduktion, bei der Sinnlichkeit zur Sichtbarkeit und diese zur Unsichtbarkeit des Wesentlichen bzw. geistig Eingesehe nen wird.«1 Wenn die Menschen auf gewohnten Wegen im urbanen Raum sind, bewegen sie sich nicht nur in einem allokativen Sinne. Sie sehen zugleich mit den Augen, was um sie herum ist. Zumindest hintergründig hören sie dabei auch die Geräusche der Stadt: den dröhnenden Verkehr, die schrillen Signale hochtourig vorbeifahren der Feuerwehrwagen, das laute Rufen von irgend jemandem in einem Hauseingang. Zugleich ist die Stadt ein taktiler Raum. Deshalb macht es einen Unterschied, ob man (hörend und sehend) durchs feuchte Gras geht, über Beton hetzt (der nach einem Regenschauer ganz eigenartig stickig riecht), an der Kante eines schlecht verlegten Klin kersteins stolpert oder auf glatt poliertem Naturstein ins Rutschen kommt. Und dann geben sich Umgebungen noch in Gerüchen zu spüren, auch wenn wir manche dieser »Äußerungen« gar nicht riechen wollen – wie die typischen Grilldämpfe, die einen Verkaufsanhänger auf dem Supermarktparkplatz umhüllen. Probleme signalisieren nur extrem scharfe, ätzende und angreifende Gerüche. In erster Linie riecht es in der Stadt aber wie gewohnt – unauffällig und sowieso »unpolitisch«. Eben so wie jene Luft, die an bestimmten Tagen frisch ist, an anderen stickig und verbraucht. Zum halbwegs Gewohnten gehört noch der übliche Gestank, den kaputte Autobusse oder veral tete Lastwagen machen. 1
Espinet, Phänomenologie des Hörens, S. 4.
15 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Einleitung
Ein Geruch bleibt ebenso wenig bei sich wie der Anblick eines Bildes oder ein merkwürdiges Gefühl unter den Füßen. Die verschie denen sinnlichen Eindrücke vermischen sich auf direkten und ver zwickten Wegen zu einem bunten Gemenge der Eindrücke. Manches darin passt zueinander, anderes nicht. Aber es gibt Verbindungen. An deren Ende kommt oftmals etwas ganz Anderes heraus als nur eine wie auch immer gedachte Summe von Verschiedenem. Deshalb sprach Friedrich Nietzsche von der großen Vernunft des Leibes, einer »Vielheit mit einem Sinne«2. Gemeint war damit: Im leiblichen Spüren laufen alle Sinneseindrücke zusammen, überkreuzen und überlagern sich, kollidieren miteinander und bilden erwartete wie überraschende Synthesen. Solche Gemische sind die Atmosphären der Stadt. Sie machen bemerkbar, wie eine Gegend gerade ist. In einem gefühlsmäßig spürbaren Akkord der Eindrücke zeigt sich die urbane Welt in ihrem je aktuellen »Vitalton«3: an Orten und in Situationen – flüchtig, beharrend, erfrischend, deprimierend, hell, dunkel, aber nie als etwas, das sich nur einem Sinn verdankt. Städtische Orte und Szenen geben sich in atmosphärischen Grundtönen zu spüren. Beim Zustandekom men urbaner Atmosphären spielen Geräusche eine wichtige und zugleich verdeckte Rolle. Flüchtige Affektbeziehungen zur sinnlichen Wirklichkeit des Urbanen entspinnen sich aber schon im diffusen Begleithören — ganz anders als im pointierten Hinhören. Die sinnliche Stadt ist eine andere als die der Wissenschaften. Im Bann leiblichen Erlebens wird nicht das gleiche zudringlich wie im Fokus der Theorie, die das Sinnliche ins Vokabular einer son dersprachlichen Sphäre verwandelt. Im Blick durch terminologisch gerahmte Fenster verschwindet der Schrei der Elster und der üble Gestank, der um die Ecke einer abgewirtschafteten Kneipenküche weht. Was artifizielle Begriffe aus der sinnlichen Welt machen, hat mit dieser am Ende nicht mehr viel zu tun. Die Theoriefilter der Wissenschaften transformieren das lebendige, eindrücklich werdende Dickicht der sinnlichen Stadt in ein aseptisches Milieu ideengetränk ter Vorstellungen und tragen es in einen terminologisch-verstandes mäßigen Denkraum ohne Geschmack, Krach und affizierende Berüh
2 3
Nietzsche, KSA, Band 4, S. 39. Dürckheim, Untersuchungen zum gelebten Raum, S. 39.
16 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Einleitung
rung. Schon Georg Simmel konstatierte vor hundert Jahren, die Stadt sei eine Welt für »intellektualistische Charaktere«4. Dieses Buch widmet sich dem Hören der Stadt. Aber wozu über das Banalste und Selbstverständlichste im Leben sprechen? Dies all zumal in Hochzeiten begeisternder Errungenschaften des Fortschritts, dank derer das tägliche Leben noch bequemer und noch überversorg ter wird. Was erschließen wir unserem Bewusstsein, wenn wir das sonore Hintergrundrauschen der Stadt und das darin Mitgehörte denkwürdig machen? Die folgenden 13 Kapitel nehmen Spuren in die lautliche Welt der Stadt auf. Sie thematisieren bestimmte Geräusche und verschwom mene Geräusch-Situationen. Und sie fragen, wie wir in unserem mitweltlichen Erleben das lautliche Erscheinen von Straßen, Plätzen, Baustellen, Straßen-Cafés, Kirchenglocken etc. wahrnehmen. Hören wir nur mit den Ohren oder ist im Hören (gleichsam begleitend) ein »Sinn« am Werk, der all das zu einer Synthese bringt, was in der Dauer des Hörens die anderen Sinne im je eigenen Modus gleichzeitig von der Welt verkünden? Das Hören – und mehr noch das Hin-Hören – wird sich als eine unter Umständen anstrengende Übung herausstel len, die dem Ziel folgt, die sinnliche Welt der Stadt besser zu verstehen – nicht durch die Rezeption komplizierter Theorien »über« die Stadt, sondern auf dem Wege der Durchdringung dessen, was sie uns zu hören gibt. Die folgenden Kapitel sind in ihrem Aufbau dynamisch verfugt. Deshalb können sie auch ohne Einhaltung einer Reihenfolge gelesen werden. Gewisse Redundanzen sind dann unumgänglich. Sie sollen dem besseren Verstehen (im Wechsel der Perspektiven) ebenso entgegenkommen wie der nachhaltigen Verzahnung der verschiede nen Themen.
4
Vgl. Simmel, Die Großstädte, S. 120.
17 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
1. Vom Geräusch, Rauschen, Tönen und Klingen
Was sich zu hören gibt, unterscheidet sich zunächst nach großen und kleinen Lautstärken. Darüber hinaus gibt es Töne, Laute, Klänge, Geräusche und – als das extrem Laute – den Lärm. In ihrer Stärke schwanken die auditiven Eindrücke zwischen unüberhörba rem Getöse zum einen (von nahen Baumaschinen, einem Gewitter oder Orkan) und dem kaum Vernehmbaren zum anderen (einem diffusen Rieseln). Aber nicht nur, was sich in bestimmter Weise zu Gehör bringt, ist mannigfaltig; differenziert sind auch die Unter schiede im menschlichen Hörvermögen. Schon die Alltagssprache weiß, dass man »gut, leise, fein, übel, schlecht, schwer, hart [oder] grob hören«5 kann.
Etymologische Bemerkungen Was das Ohr von den Eindrücken der fünf Sinne erfasst, bildet im Ge-räusch ein mannigfaltiges Ganzes. Darunter versteht man im Allgemeinen ein vielstimmiges, eher lautes als leises, in Schall sich ausdrückendes Geschehen. Es gibt aber auch das leise Durcheinan der aller möglichen Schallereignisse – den hintergründig dahinströ menden Straßenverkehr im Unterschied zu einem »geräuschvollen Gewühl von Menschen«6. Ein Geräusch macht aber noch der für das menschliche Ohr beinahe lautlos sich vortastende Schleichgang der Katze, wenngleich im engeren Sinne auch fast nichts davon zu hören sein mag. Geräusch kommt von Rauschen, das es an der reinen Bewegung (des Windes) ebenso gibt wie an sich bewegenden Sachen7 (dem Klappern eines defekten Schutzbleches). Geräusche müssen trotz der Mannigfaltigkeit ihrer Töne, Laute und Klänge nicht verschwommen sein wie ein amorphes Schallge 5 6 7
DWB, Band 10, Sp. 1807. Ebd., Band 5, Sp. 3586. Vgl. ebd., Band 14, Sp. 302.
19 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
1. Vom Geräusch, Rauschen, Tönen und Klingen
bilde. In der Eigenart ihrer Vielstimmigkeit weisen sie auf etwas hin, von dem sie herkommen. So unterscheidet sich der laut rauschende Gebirgsbach in der Art seines Geräusches von einem ebenso laut rau schenden Wind. Ein Rauschen wird erst in der eigenartigen Mischung seiner Töne und Laute zu diesem Geräusch. Sobald es als etwas Eigenes und Eigenartiges erkannt wird, lässt es sich als bestimmtes Geräusch von anderen unterscheiden.8 Deshalb rauscht der dahinpoldernde Bach anders als der stetig wehende Wind. Ein Ge-räusch verdankt sich in seinen breiartigen Vermischun gen (weniger in seiner »Zusammensetzung«) pluraler Laute, Töne, Klänge wie aller möglichen Höreindrücke.9 Ein lautes Geräusch ist dem Lärm verwandt. Zwar ist ein Lärmen das außergewöhnlich Laute schlechthin. Lärm geht nicht nur von Sachen aus (wie das Kreischen der Säge); er wird auch von Menschen verursacht (wie das Grölen des Randalierers, der die Stille der Nacht ruiniert und dadurch gerade erst bewusst macht). Es gibt allerdings auch Lärm, den man mit den Ohren nicht hören kann, weil er gar nicht aus der Welt des Schalls kommt. So kann eine Person »geräuschvoll« auftreten, ohne lärmenden Krach zu machen. Die Wortbedeutung des Geräuschvollen steht nun in einem übertragenden Sinne für einen prahlerischen, aufsehenerregenden Wesenszug.10 Als laute Menschen gelten in die sem Sinne auftrumpfende Charaktere, als leise eher zurückhaltende Wesen. Menschen können sich in ihrer Präsenz unauffällig (leise) geben oder so expressiv und aufschäumend (laut) auftreten, dass jeder auf sie aufmerksam wird. Nicht selten verbinden sich mit lautlichen Eindrücken soziale Bedeutungen. Wie Töne in einem akustischen Sinne über-hört werden können, so gibt es im übertragenen Sinne situationsspezifische Töne, die kognitiv nicht verstanden werden. Jemandem, der in diesem Sinne Simon Runkel hat darauf hingewiesen, dass Geräusche eine etymologische Nähe zum Rauschen haben, »aus diesem in der Wahrnehmung allerdings herausgelöst sind.«; Runkel, Klangräume der Erlebnisgesellschaft, S. 33. Das Open-Air-Konzert auf einem öffentlichen Stadtplatz übertönt in diesem Sinne in der Art seines Klin gens sowie in seiner Lautstärke das Grund- und Hintergrundrauschen der Stadt; es wird als etwas Eigenes erlebt, das man als Ausdruck eines ästhetischen Bedürfnisses hören möchte. 9 »Die Bedeutung geht im Germ. von dem Begriff des Zusammenseins, der Zusammengehörigkeit, der Vereinigung aus« heißt es zum Präfix Ge- im Digitalen Wörterbuch der Deutschen Sprache; https://www.dwds.de/wb/ge- (19.11.2020). 10 Vgl. DWB, Band 5, Sp. 3585. 8
20 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Geräusch-Charaktere und -Gesichter
»keinen Ton verstanden« hat, dem haben nicht die Ohren versagt, sondern das mentale Vermögen. Wer »keinen Ton herausbringen kann«, mag an einer schweren Erkältung leiden, könnte aber auch in seiner Stimmung so blockiert sein, dass ihm die Worte im Halse stecken bleiben. Auch der Ton, in dem sich eine Person »vergreift«, hat mit dem Auditiven nichts gemeinsam, sondern mit sozial inad äquatem Verhalten. Deshalb bewirkt ein »falscher Ton« auch allzu leicht die emotionale Verstimmung einer Atmosphäre. Der »leere Klang der Worte«11 tönt lautlich kaum anders als eine nachdenklich stimmende Rede. Auf den lautlichen Klang kommt es dabei auch nicht an, vielmehr auf den eben nichtssagenden Gehalt einer Aussage.
Geräusch-Charaktere und -Gesichter Bei der Verschiedenheit der Geräusche muss man zwischen dem Cha rakter und dem Gesicht eines Geräusches unterscheiden. In Anleh nung an Hermann Schmitz12 zeichnet sich der Charakter eines Geräu sches durch ein Erscheinen aus, das für sein Wesen kennzeichnend ist. Das in einem Bach dahinfließende Wasser rauscht nicht nur »irgend wie« anders als der Wind. Für einen Bach ist es charakteristisch, dass in ihm Wasser fließt – wenn sich das dabei entstehende Geräusch auch keineswegs stets gleich gibt. Ein bis an seine Ufer angeschwollener Bach stürzt laut rauschend ins Tal, im Unterschied zu demselben Bach, in dem nur wenig Wasser dahinplätschert. Dabei stellt sich die Frage, ob er dann überhaupt noch derselbe ist. Während das charakteristi sche Geräusch des Fließens durch situative Wandlungen hindurch beharrt, variiert sein lautliches Gesicht. Im »Schallgesicht« eines Fließgewässers zeigt sich der je aktuelle Ausdruck seines Fließens. Der sprichwörtlich rauschende Gebirgsbach unterscheidet sich wiederum in seiner lautlichen Eigenart vom dahinrauschenden Fluss, wie den heranrollenden Wellen des Meeres. Trotz aller Variationen schert ein in sich charakteristisches Geräusch, wie auch immer es sich situativ präsentiert, nicht aus seiner Schallfamilie aus. So bleibt ebenso das Rauschen des Windes trotz aller Veränderungen seines Erscheinens ein wehendes Rauschen. Es wird nicht plötzlich ein technisch-maschi 11 12
Ebd., Band 11, Sp. 948. Vgl. Schmitz, System, Band III/5, S. 128ff.
21 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
1. Vom Geräusch, Rauschen, Tönen und Klingen
nistisches. Aber es kann sein Gesicht ändern. Ein seichtes Wehen hört sich anders an als ein stürmendes Toben.
Geräusche kommen aus dem Leben Geräusche bestehen aus Tönen und Klängen, sie werden in Klang folgen und Klangfarben wahrnehmbar und sie folgen lautlichen Rhythmen. Das Viele verbindet sich im Ge-räusch zu einem hörba ren Gesamt-Eindruck, in dem Unterschiedliches zu einem Ganzen verschmilzt. Ein Ton ist etwas Singuläres, anders als der Klang, in dem mehrere Töne schwingen; sonst gäbe es weder Missklang noch Gleichklang.13 Oft dient ein Ton, wie der einer Autohupe, in seiner eindeutigen Singularität als Signal. Das Martinshorn der Polizei- oder Feuerwehrfahrzeuge erzeugt zwar lediglich einfache Töne; in ihrer spezifischen Tonfolge ergeben sie ein alarmierendes Signal. Beim Morsen fungieren lange und kurze Töne, die zu Tonfolgen gruppiert sind, in anderer Weise als Schallsignale. Das monoton piepsende Morsesignal ist das schlechthin Andere des »warmen« Tons einer emotionalisierenden Melodie. Töne übertragen in der Art des von ihnen bewirkten Schallerle bens nicht selten Gefühle ins Erleben einer Person. So spricht man von einem kalten und warmen Ton bzw. Klang, ohne damit eine Temperatur zu meinen (zur Bedeutung der Synästhesien im lautlichen Erleben vgl. auch Kapitel 2). Wenn es bei den Brüdern Grimm heißt, »Ton ist das ›geräusch‹ und der ›schall‹ im allgemeinen«14, so ist damit der Ton als Basiselement aller Geräusche gemeint. Töne sind in allem, was zu hören ist. Sie kommen in der Natur wie und in der technischen Welt vor – im Reich der Tiere wie der Mechanik und Elektronik. Im Tönen des Windes äußert sich die Natur im Modus des Schalls, ganz anders aber als der Donner in seinem Grollen oder der Regenguss in seinem rasselnden Trommeln. Wie Geräusche und Töne, so werden auch Klänge nicht an sich gehört (s. auch Kapitel 7). Sie sind lautliche Resonanzen einer Situa tion. Helle Töne beeindrucken in anderer Weise als dunkle, hallende und langanhaltende. Der Klang einer kleinen und leichten Glocke weckt andere Empfindungen als der einer großen und schweren; 13 14
Vgl. DWB, Band 11, Sp. 947. Ebd., Band 21, Sp. 687.
22 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Geräusche im Schöpfungsmythos
und der einer Harfe ist in keiner Weise mit dem einer Trommel zu vergleichen. Auch der Klang einer Stimme bedarf zu seiner lautlichen Vernehmbarkeit hörbarer Töne. Das Hören einer Stimme ist aber nur Voraussetzung für das Verstehen des mit ihr Gesagten. Zu einer Mitteilung gehört auch der Habitus, in dem etwas (z. B. freundlich oder aggressiv) gesagt wird. So gibt sich im leise zitternden, die Worte verschluckenden Stammeln eine angstvolle, unsichere oder kranke Person zu erkennen, im Unterschied zur lauten, scharfen wie entschlossen artikulierten Rede eines selbstbewussten und durchset zungsorientierten Menschen. Der habituell-gestische Ausdruck eines Individuums tritt zur semantischen Bedeutung einer wörtlichen Rede hinzu. Das Verstehen gesprochener Worte verlangt deshalb auch die Rekapitulation der Gespräch-Situation, aus deren Rahmen sich eine Person äußert. Kein Klang, Ton oder Geräusch kommt aus einem bedeutungs leeren Raum. Das eigenartige Geräusch einer Treppenstufe kann man als gemütliches Knacken hören oder als gefährliches Anzeichen einer morschen und bruchgefährdeten Treppe. Es kann im Sinne eines »psychoanalytischen Hörens« aber auch Kaskaden von Geschichten wachrufen, die vom »sprechenden« Holz aus der biographischen Erinnerung gleichsam hochgespült werden. Wie der sprichwörtliche »Klang der Waffen«15, so gehen auch alle nur erdenklichen Geräusche in ganzheitlichen Eindrücken auf, die sich situativ mit Bedeutungen verknüpfen. Töne, Laute und Geräusche weisen auf etwas hin, weil sie von etwas herkommen.
Geräusche im Schöpfungsmythos Das große urzeitlich-kosmologische Chaos muss ein unvorstellbares visuelles Spektakel gewesen sein, das sich dabei zugleich in einer überschäumenden Ekstase lärmender und krachender Kollisionen, zischend-aufzuckender Blitze, donnernd-bebender Böden und rau schend-feuerspeiender Vulkane entladen hat. Die Schöpfungsmythen erzählen zwar viel vom Sichtbaren; sie schweigen dagegen weitge hend zur lautlichen Seite des Zusammenschießens und Auseinander fliegens aller möglichen Urstoffe, Gase und Massen, aus denen die übermenschliche Ordnung der Sterne und Galaxien erwachsen ist. 15
Ebd., Sp. 947.
23 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
1. Vom Geräusch, Rauschen, Tönen und Klingen
Den Narrativen der Religionen kommt es vor allem darauf an, die Genesis als Akt göttlicher Schöpfung zu suggerieren. Dabei spielen Geräusche eine atmosphärisch herausragende Rolle. Die Genialität Gottes steht im Zentrum der Aufmerksamkeit und kein profanes Getöse, schon gar nicht das der Natur. Das diesseits des göttlichen Wortes archaische Rauschen ist den sich selbst generierenden (auto poietischen) Naturkräften viel zu nahe, um es als Facette des Schöp fungsaktes zu erwähnen. Dieser gilt als das geplante Resultat göttli chen Agierens und nicht als etwas, das von sich aus passiert. Weshalb sollten die Menschen vom Wort Gottes abgelenkt und auf Szenen naturhaften Lärms aufmerksam gemacht werden. Sie mögen sich besser auf das verstehende Hören numinoser Mächte konzentrieren und die Geräusche der Natur als etwas begreifen, das Gott verfügt hat. Das Geräuschvolle einer gleichsam niederen Welt gilt als arbiträr, als ein Abfall derer, die auf den von Gott vorgezeichneten Wegen straucheln und Fehler machen. Gott lärmt nicht; jedenfalls nicht im erhabenen Schöpfungsakt. Die Mythen geben eher spärliche Hinweise auf die auditive Dimension der Geburt der Welt. Hinweise auf lärmende Kampf getöse, die gewaltige Niederwerfung wütender Drachen und die krachende Besiegung dunkler Mächte finden sich nur schwer. Der Aufstieg der Welt aus dem schwarzen Nichts der Allnacht suggeriert sich im Großen und Ganzen als Vorgang, der mit so niederen Ein drücken wie Laut und Geräusch nicht viel zu tun gehabt hat. Aber die Geschichten haben ihre Leerstellen, und aus ihnen ragen Rätsel hervor. Zweifellos stellen die Schöpfungsmythen dem Anfang der Weltwerdung die große Leere eines stummen Nichts voran, das es sogar noch vor dem Noch-nicht-Sein gab. Wie jedoch soll man sich dieses Nichts vorstellen, das im Moment seiner Setzung als Nichts bereits ein »Etwas« gewesen sein muss. Sonst hätte es nicht schon vor allem Noch-nicht-Sein als »pränatale Existenz der Welt«16 in Gestalt einer Allnacht dagewesen sein können. Schöpfungsmythen sind antike Narrative und als solche reine Kopfgeburten. Sie imaginieren die Welt als Produkt einer über menschlichen Schöpferkraft, als Ausdruck einer Macht von unvor stellbarer Größe und Genialität – selbst mit dem größten Geist nicht fassbar. Ganz frei von Geräuschen jeder Art ist die Sphäre der Götter jedoch nicht. Von abgründigen Geräuschen ist z. B. begleitet, was der 16
Reimbold, Die Nacht, S. 55.
24 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Urbanes Geräuscherleben
Herr jene spüren lässt, die von »gottgefälligen« Wegen abweichen. Mit großer Geste strafte der Herr die Seinen, als er auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer vom Himmel fallen ließ und die Stadt vernichtete.17 Aber auch hier sind die Narrative eines lautlich tosenden Untergangs eher dürftig. Die dabei entstehenden Geräusche von ekstatisch-lärmhaftem Charakter sparen sie ebenso aus wie das unermessliche Donnern, das die Erde zum Beben gebracht haben muss. Geräusche muss man den Erzählungen hinzudenken.
Urbanes Geräuscherleben Der vitale Gegenpol zum Schweigen der leeren und dunklen All nacht vor dem Beginn des großen göttlichen Anfangs allen irdischen Lebens18 ist das sich überschlagende Geräusch-Chaos der Stadt. Das sich tagtäglich zur Rushhour ereignende Dröhnen, Kreischen, Rau schen und noch so schrille Tönen ist das Andere des Göttlichen. Aber nicht erst die in den Schöpfungsmythen fehlenden Geräusche lassen eine gewisse Sprachlosigkeit gegenüber dem Lautlichen erkennen. Auch in literarischen Beschreibungen städtischen Lebens spielen Geräusche nur selten eine bemerkenswerte Rolle. Das mag zum einen kulturhistorische Gründe haben, denn die Stadt ist immer als Schauraum erlebt und beschrieben worden, als eine vor allem sichtbare Ereigniswelt. Zum anderen dürfte der Mangel des Tönenden und Geräuschvollen aber auch einen methodischen Grund geben. Wie soll mit den Mitteln der wörtlichen Rede expliziert werden, was mit dem Blick nicht zu erfassen ist, nicht fixiert werden kann, im Ohr eine höchst flüchtige Gestalt annimmt und sich in der Dauer des (Weiter-) Hörens sogleich verliert? Das folgende Kapitel zur Wahrnehmung als Einfühlung soll für das phänomenologische Verständnis der menschlichen Wahrneh mung sensibilisieren. Darin werden auch jene Formen »springender« Wahrnehmung thematisiert, die auf dem Wege der Synästhesien dafür sorgen, dass ein Eindruck von einem bestimmten sinnlichen Bereich (z. B. des Hörens) ins ganzheitliche Erleben transzendiert. Auf welchen Wegen weckt ein weicher Ton (im Unterschied zu einem grellen und harten) eine ruhige, angenehme und behagliche 17 18
Vgl. AT, Gen. 19. Vgl. Reimbold, Die Nacht, S. 35.
25 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
1. Vom Geräusch, Rauschen, Tönen und Klingen
Stimmung und keine angespannte, aufgeregte und alarmierte? Wie werden die Brücken vom lautlichen Hören zum Verstehen symboli scher Bedeutungen geschlagen? In Kapitel 5 über die Leiblichkeit des Hörens werden diese umrisshaft dargestellten Überlegungen wieder aufgegriffen und weitergeführt.
26 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
2. Wahrnehmung als Einfühlung
Im Medium der Leiblichkeit, der gefühlsmäßigen wie spürenden Einlassung auf die Welt, verbinden sich sinnliche Eindrücke zu kom plexen Gestalten, in deren Erlebniswirkung das eine oft nicht klar vom anderen unterschieden werden kann. Auf verschwimmende Gesamt eindrücke des Hörens verweist Willy Hellpach mit den »Klangbil dern« und »Hörnachbildern«. Damit spricht er nicht im engeren Sinne singuläre Eindrücke an (was gerade z.B. mit den Augen oder Ohren wahrgenommen worden ist), sondern Komplexeindrücke in einem ganzheitlichen Verständnis der menschlichen Wahrnehmung. Geräusche, Laute, Klänge und Töne, die eine Person biographisch in charakteristischer Weise in Situationen erlebt hat, „›verfolgen‹ uns oft noch geraume Zeit mit voller Nachbildsinnlichkeit, wenn sie objektiv mit Sicherheit längst aus unserer Hörweite entfernt sind. […] ›Es‹ dröhnt, summt, rasselt, rauscht in uns weiter, nur allmählich abklingend.«19 Lange schon vergessen geglaubte Eindrücke wirken als immer noch vitale Bedeutungsherde in die gelebte Zeit hinein. Allein deshalb hat etwas Gehörtes nie lediglich die Qualität akustischer Datenmengen, die sich nach Lautstärken, Frequenzen und weiteren objektivierbaren Eigenschaften differenzieren ließen. Was wir hören, ist ebenso situationsabhängig wie das, was wir tun. So bewegt man sich in einem Museum anders als auf dem Wochenmarkt (s. auch Kapitel 5). Klangbilder und Hörnachbilder speichern Gravuren der Lebensgeschichte, die sich später zu neuen Situationen in Beziehung setzen. Bestimmte Töne, Klänge und Geräusche erinnern an Gefühle oder wecken sie, wie das »Schluchzen der Geige«20. Ein nur von einem Gegenstand kommendes Geräusch kann ganze Ketten von Gefühlen in Bewegung bringen und ihnen damit zu einem nicht immer unproblematischen Nachleben verhelfen. Das leise und bedachte Gehen durch die Räume einer Kunsthalle wird dem besonderen Ort und seinem ästhetischen Präsentations 19 20
Hellpach, Zwölf Gänge in ihrem Grenzdickicht, S. 28. Schmitz, Der unerschöpfliche Gegenstand, S. 478.
27 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
2. Wahrnehmung als Einfühlung
programm gerecht. Die Bewegungen folgen räumlich angepassten Tempi sowie situationsspezifischen Ruhe-Geboten. In geräuschvollen Szenen kann keine kunstbezogene Kontemplation gelingen. Und so fügen sich die Besucher in die meistens nicht explizierten normativen Ansprüche ein, bewegen sich langsam, geräuscharm und sprechen leise. Auffällig werden die von Menschen gemachten Geräusche, sobald sie von einverleibten Hörerwartungen abweichen.
Der Leib als »Einschlagsort« der Gefühle Geräuscheindrücke bieten sich der Phänomenologie zur Beschreibung und Reflexion an. Aber nicht »für sich«, sondern vor dem Hintergrund ihrer situativen Rahmung durch Bedeutungen und Bedeutungshöfe. Phänomenologie eruiert die subjektive Verwicklung von Individuen und Gruppen in Sachverhalte, die einen Ort für dieses oder jenes stimmen (u. a. durch die Anordnung von Dingen, Personen, Tieren und Pflanzen). Sie geht dabei der Frage nach, wie sich Eindrücke ins befindliche Ergehen übertragen. Von zentraler Bedeutung sind neben den Vermögen der einzelnen Sinne die synchronisierenden Potentiale des Leibes als ganzheitlichem Sinn der Wahrnehmung. Der Leib kann als »Einschlagsort« aller Eindrücke verstanden werden, als ganzheitli ches Wahrnehmungsmedium in einem nicht-körperlichen Verständ nis. Gleichwohl bedarf der Leib schon seiner Lebendigkeit wegen eines materiellen und sichtbaren Körpers, samt aller funktionierenden Organe. Der Leib ist ein spürend wahrnehmendes Medium, das zum Herum einer Person in situationsbezogenen Resonanz-Beziehungen steht. Der »Leib, mit dem wir wahrnehmen, [ist] gleichsam ein natürliches Ich und selbst das Subjekt der Wahrnehmung«21. Im wahrnehmenden Erleben bringt sich eine Position zum eigenen Selbst wie zum »räumlichen Herumgefüge«22 zur Geltung. Deshalb sagt Eugen Fink: »Irgendein Verhältnis des Menschen zum Sein und des Seins zum Menschen muß als Bedingung der Möglichkeit für jegliches Philosophieren, ja für jedes Ich-sagen vorausgesetzt werden.«23 Bei aller Konzentration der Aufmerksamkeit auf den Leib und das darin spürbar werdende Betroffen-Sein geht es »nicht darum, 21 22 23
Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, S. 243. Dürckheim, Der gelebte Raum, S. 32. Fink, Sein, Wahrheit, Welt, S. 79.
28 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Wahrnehmung als »leibliche Kommunikation«
das menschliche Wissen auf Empfindungen zu reduzieren, sondern der Geburt dieses Wissens beizuwohnen, es uns genauso fühlbar zu machen wie das Sinnliche.«24 Andernfalls wäre Phänomenologie gegenaufklärerisch. Sie strebt daher auch weder zur Esoterik noch zu oberflächlicher und selbstverliebter Ich-Bezogenheit. Sie will das Wissen um die leiblich-spürende Verstrickung in lebendige Situatio nen des täglichen Lebens erweitern, um es mit einem kategorial geschärften Vokabular der Reflexion zugänglich zu machen. Sinnli ches Erleben muss dazu aber zunächst in Worte gefasst werden. Solange es nur gefühlig bleibt und stumm in mehr oder weniger diffusen Affektlagen aufgeht, kann es nicht zu einem reflexiven Stoff werden. Explikation setzt eine geschärfte und Details gegenüber aufgeschlossene Haltung der Wahrnehmung voraus, mit anderen Worten, das Vermögen genauen Hinschauens und -hörens. Leibliches Erleben erweist sich als eindrückliches Korrespondenzgeschehen und Ressource tieferen Verstehens subjektiven Mit-Seins in Situationen. Zur Methode der Phänomenologie stellt Edmund Husserl in diesem Sinne fest: »Die Phänomenologie verfährt schauend aufklärend, Sinn bestim mend und Sinn unterscheidend. Sie vergleicht, sie unterscheidet, sie verknüpft, setzt in Beziehung, trennt in Teile, oder scheidet ab Momente. Aber alles im reinen Schauen. Sie theoretisiert und mathe matisiert sind; sie vollzieht nämlich keine Erklärungen im Sinne der deduktiven Theorie.«25
Wahrnehmung als »leibliche Kommunikation« Schauen ist kein Sehen, sondern aufmerksame, sich ins Detail ver ästelnde Wahrnehmung, die einen scharfen Blick aufs Besondere, Einmalige und Lokale wirft, ohne dabei das Ganze zu vernachlässigen, zu dem das Einzelne gehört. Diese gleichsam zweispurige Erkenntnis haltung pointiert Husserl so: »Schauende Erkenntnis ist die Vernunft, die sich vorsetzt, den Verstand eben zur Vernunft zu bringen.«26 Die Methode der Phänomenologie erschließt der Erkenntnis das sich in Gefühlen und sinnlichen Regungen ausdrückende Erleben. In 24 25 26
Merleau-Ponty, Das Primat der Wahrnehmung, S. 50. Husserl, Die Idee der Phänomenologie, S. 58. Ebd., S. 62.
29 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
2. Wahrnehmung als Einfühlung
der praktischen Verwicklung in die umgebende Welt der Dinge und Lebewesen öffnet sich der »wirklich erfahrbare Leib« gegenüber der Bewusstwerdung subjektiven Mit-Seins in Räumen und Situationen. Es ist das sich in der Bewegung vortastende Tun, das »den Reizen zuvorkommend, den Gegenstand […] schon umfaßt und in sich die Gestalt schon vorzeichnet, die ich wahrnehmen werde.«27 Darin klingt ein Modus einfühlender Wahrnehmung an, damit eine Form der ganzheitlichen Gestalterfassung des Wirklichen. Hermann Schmitz spricht hier von »leiblicher Kommunikation«: »Von leiblicher Kommunikation im allgemeinen will ich immer dann sprechen, wenn jemand von etwas in einer für ihn leiblich spürbaren Weise so betroffen und heimgesucht wird, daß er mehr oder weniger in dessen Bann gerät und mindestens in Versuchung ist, sich unwillkür lich danach zu richten und sich davon für sein Befinden und Verhalten in Erleiden und Reaktion Maß geben zu lassen.«28
Leibliche Kommunikation bedarf folglich keiner menschlichen oder tierischen Dialogpartner, sondern allein einer Korrespondenzwelt, auf die ein lebendes Wesen (ein Mensch wie ein zum leiblichen Spüren fähiges Tier) mit spezifischen Äußerungen »antworten« kann. Auch ein toter Stein spricht uns über seine zur Erscheinung kommende Gestalt an, wenn auch anders als der handwerklich zugespitzte Dia mantquader, der wegen seiner abweisenden Suggestion in der Archi tektur der Renaissance im Fassadenbau repräsentativer Gebäude zur symbolischen Steigerung von Macht- und Herrschaftsansprüchen eingesetzt wurde29. Auf leiblicher Kommunikation basiert auch die synästhetisch komplexe Übertragung von Eigenschaften, wonach aus dem Erleben feierlicher Stille ein Befinden persönlicher Zurückhal tung resultiert oder die lähmende Atmosphäre eines sonntäglichen Mittags in ein Gefühl drückender Stille übergeht.30 Die Übertragung eines sinnlichen Eindrucks in ein Gefühl ist weit komplexer als im Falle der einfachen Synästhesien, wonach rot für warm steht, blau für kalt usw. In Bezug auf das Hören folgt daraus, dass »unter »Hören« auch nicht nur die isolierte Leistung des Ohres, sondern eine unter der Vorherrschaft des Ohres stehende Form synästhetischer Wahr Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, S. 99. Schmitz, System der Philosophie. Band III/Teil 5, S. 31f sowie ausführlich auch Schmitz, Der Leib, Kapitel 4. 29 Vgl. dazu auch Hasse, Atmosphären der Stadt, S. 106f. 30 Vgl. Schmitz, Der Leib, S. 38. 27
28
30 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Wahrnehmung als »leibliche Kommunikation«
nehmung verstanden«31 wird, denn: »Träger der Wahrnehmung ist weder das isolierte Sinnesorgan noch die subjektimmanente Synthese ihrer Funktionen; Träger der Wahrnehmung ist vielmehr die Sphäre der Sinnlichkeit in ihrer Totalität«32, das heißt die Sinnlichkeit in ihrer leiblichen Verwurzelung in Erlebniskontexten. Auditive Medien bieten sich deshalb auch für die Kommunika tion verdeckter Bedeutungen an. Dabei kennt das Ohr im Unterschied zum Auge nur die nehmende Geste, steht also in gewisser Weise diesseits des dialogischen Austauschs. Auf die Phänomenologie von Auge und Ohr bezogen, merkt Georg Simmel an: »Das Auge kann seinem Wesen nach nicht nehmen, ohne zugleich zu geben, während das Ohr das schlechthin egoistische Organ ist, das nur nimmt, aber nicht gibt.«33 Erst mit der Sprache »zusammen erzeugt das Ohr den innerlich einheitlichen Akt des Nehmens und Gebens«34. Das Gehör ist in der verständigungsorientierten zwischenmenschlichen Kommunikation auf die Sprache angewiesen. Deshalb bedarf nach Simmel alles Hörenswerte der »Komplettierung« durch die Rede. Doch gerade in der Nicht- bzw. Vorsprachlichkeit der Geräusche gelangt das stumm Kommunizierte höchst wirkungsvoll ans Ziel. Im Bereich nonverbaler Kommunikation perfektioniert sich die Macht dissuasiver Gaben geradezu idealtypisch. Eine gewisse Nichthaftig keit von allem Lautlichen kommt dem entgegen. Was man nur hört und nicht sieht – fast geräuschlos bis extrem laut – kann der kritischen Prüfung nur auf holprigen Wegen unterzogen werden. Vergleichsweise einfache Objekte der Reflexion sind dagegen mate rielle Gegenstände mit all ihren objektivierbaren Merkmalen und Eigenschaften sowie Aussagen über sie. Geräusche sind keine Dinge, sondern Halbdinge – wie die Hitze, die Kälte, die Freude oder das Leiden. Sie hören auf, ohne etwas Substanzielles zurückzulassen, wenn sie nicht mehr da sind. Und wie aus dem Nichts fangen sie wieder an. Halbdinge (allzumal die Geräusche) sind mitunter zudringlich; sie greifen an, fesseln, beunruhigen, faszinieren, schrecken ab, ängstigen, quälen usw.35 Die Flüchtigkeit und Immaterialität des Schalls bringt den Charakter der 31 32 33 34 35
Picht, Kunst und Mythos, S. 388. Ebd., S. 416. Simmel, Soziologie der Sinne, S. 143. Ebd., S. 144. Vgl. Schmitz, System der Philosophie. Band III/Teil 5, S. 134.
31 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
2. Wahrnehmung als Einfühlung
Halbdinge auf den Punkt. Schall verhält »sich zu seiner Äußerung […] wie der Wind zum Wehen«36. Es gibt anschwellende Töne und Geräusche, die verebben, verhallen und leiser werden.37 Was man von etwas (einem Ding oder einer Situation) zu hören bekommt, zeigt sich in einem bestimmten Charakter als dieses oder jenes Geräusch – z. B. als ein Hämmern oder ein Quietschen. Aber es gibt nicht nur ein Hämmern und ein immer gleiches Quietschen, sondern dieses oder jenes Hämmern und Quietschen. Es bringt sich mal in diesem, mal in jenem auditiven Gesicht zu Gehör. Mal tönt das Schlagen eines schweren Vorschlaghammers laut und hart, dann weich und vergleichsweise leise. Mal klingt das Quietschen einer nicht geölten Tür kurz und spitz, dann langgezogen und gequält. Den Gesichtswechsel38 eines charakteristischen Geräuschs nehmen wir als qualitativen Ausdruck von etwas mit dem Metasinn des Leibes wahr. Eine Tür kann quietschen. Je nachdem, wie sie bewegt wird und was im Raum sonst noch zu hören ist, hört sich dieses Quietschen immer wieder anders an. Dagegen quietscht ein Ferkel von Grund auf anders als eine Tür und deshalb in einem lautlich wiederum für sich eigenartigen Erscheinen. Auch dieses Quietschen kann sein Gesicht von Situation zu Situation wechseln; nicht aber seinen Charakter. Es quietscht nicht plötzlich wie ein ausgeleiertes Scheunentor. Das Ohr als Organ erfasst den Schall des einen wie des anderen Quietschens. In der leiblichen Wahrnehmung wird das Schallereignis zu einem lautlichen Eindruck, in dem sich das Gehörte mit situationsverwurzelten Bedeutungen verbindet.
»Springende« Wahrnehmung – synästhetisches Hören Im synästhetischen Sinne übertragen sich auch »lautliche Markierun gen« ganzheitlich. Darunter sollen Geräusche verstanden werden, die einem Objekt gleichsam angeheftet werden, um mit dem so erzeugten Amalgam Bedeutungen zu kommunizieren. Die Automo bilindustrie arbeitet mit solchen Markierungen, z. B. um die »Aura« eines Fahrzeugs zu veredeln. Das Image manch teurer Sportwagen Schmitz, System der Philosophie. Band III/Teil 5, S. 123. Vgl. ebd., S. 123. 38 Vgl. ebd., S. 129: »Das Gesicht pflegt auch bei konstantem Charakter beständig zu wechseln«. 36 37
32 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
»Springende« Wahrnehmung – synästhetisches Hören
ist nicht nur von ihrem ästhetischen Erscheinen wie ihrer bildhaften Präsenz abhängig. Darüber hinaus spielen klangliche »Äußerungen« eine wichtige Rolle (z. B. Auspuffanlagen). Nicht nur der Sound der ins Schloss fallenden Tür nährt den Verdacht von Hochwertigkeit und exaltierter Besonderheit; in diesem Sinne »funktioniert« auch das Rauschen von Klimaanlage und Kühler, das Ticken der Blinker, Schnurren der Fensterheber und selbst das Rollgeräusch der Reifen. Metzger spricht von »sonoren Markierungen«39, markentypischen Klängen und acoustic brands40. Jedoch nur sozialgruppenspezifisch treffend programmierte Geräusche wecken auch die intendierten Gefühle. Die Beispiele zeigen, dass und wie Gefühle zu affizierenden Medien mit ökonomischer Relevanz werden können – weit über ihre unmittelbare Bedeutung in der zwischenmenschlichen Kommunika tion hinaus. Ähnlich wie die Metaphern funktionieren die synästhetischen Charaktere, wonach der helle Ton als spitz und der dunkle als rund empfunden wird. Im Metier bedeutungsähnlichen Spürens wird auf diesem Wege leiblich etwas erfasst, das sich in der wörtlichen Rede nur schwer aussagen lässt. Ein zweiter Grund für die brüchige Über setzung eines lautlichen Eindruckes in die wörtliche Rede liegt daran, dass ein Laut in seinem wechselhaften Gesicht nicht bleibt wie er ist, im Unterschied zu einem Stein in einer Vitrine. Feste Gegenstände beharren, Laute schweben und schwimmen, ähnlich wie die Gerüche. Über ein eigenartig irritierendes Geräusch heißt es im Bau von Kafka, es klinge »einmal wie Zischen, einmal eher wie Pfeifen«41. Das zeugt von Unsicherheiten im verstehenden Hören. Die Bedeutungen, die zum Zischen und zum Pfeifen gehören, lassen sich in der aktuel len Situation unsicheren Hörens einstweilen noch nicht mit dem jeweiligen Schalleindruck verknüpfen. Die Wahrnehmung wird noch vom Wechselwesen des Geräuschs eingenommen. Der Wandel von Eindrucksqualitäten muss nicht allein von der gegenständlichen Sache des Gehörten abhängen. Zum Verstehen und Missverstehen trägt auch das plötzlich anspringende Gefühlswissen bei, das man sich in vergangenen Situationen über die Bedeutung von etwas Zischendem oder Pfeifendem schon einmal angeeignet hat. »Gesicht und Gehör sind fähig, uns Wahrnehmungsverknüpfungen zu bieten, die sowohl 39 40 41
Metzger, Architektur und Resonanz, S. 133. Ebd., S. 134. Kafka, Der Bau, S. 488.
33 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
2. Wahrnehmung als Einfühlung
das Ganzes wie in ihren Teilen einen bestimmten und deutlichen Sinneseindruck machen und sich auch bestimmt und deutlich einprä gen lassen.«42 Und 1910 schreibt Rainer Maria Rilke in den Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge: »Daß ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu schlafen. Elektri sche Bahnen rasen läutend durch meine Stube. Automobile gehen über mich hin. Eine Tür fällt zu. Irgendwo klirrt eine Scheibe herunter, ich höre ihre großen Scherben lachen, die kleinen Splitter kichern. Dann plötzlich dumpfer, eingeschlossener Lärm von der anderen Seite, innen im Hause. Jemand steigt die Treppe. Kommt, kommt unaufhörlich. Ist da, ist lange da, geht vorbei. Und wieder die Straße. Ein Mädchen kreischt: Ah tais-toi, je ne veux plus. Die Elektrische rennt ganz erregt heran, darüber fort, fort über alles. Jemand ruft. Leute laufen, überholen sich. Ein Hund bellt. Was für eine Erleichterung: ein Hund. Gegen Morgen kräht sogar ein Hahn, und das ist Wohltun ohne Grenzen. Dann schlafe ich plötzlich ein.«43
In dieser Beschreibung werden u. a. tote Dinge auf eine irreale Art lebendig, wie man es sonst nur von Menschen oder Tieren kennt. Bemerkenswert ist daran eine Lebendigkeit, die den Geräuschen selbst zukommt, ohne dass sie ihnen erst zugeschrieben werden müsste. Es ist das synästhetische Ausdruckspotential eines Eindrucks, das sich in einer gewissen Lebendigkeit suggeriert. Angesichts der sich überlagernden Modi des Erscheinens urba ner Situationen (in schönen wie grässlichen Bildern, lautlich einschlä fernden wie aggressiven Klängen, weichen wie beißenden Gerüchen, kantiger wie weicher Stofflichkeit etc.) und der abermaligen Überlage rung der Modi des Wahrnehmens (in intellektuell spitzer Wachheit bis völlig unaufmerksamer Gleichgültigkeit, nüchtern-rational bis emotional-erregt, fokussiert bis radikal dumpf-gleichgültig) merkt Franz Xaver Baier zur Recht an: »Raum kann nicht durch bloße Objektbeschreibung erfaßt werden.«44 Im leiblichen Raum vitalen Erlebens haben die Ereignisse und die Dinge immer schon eine sich vorzeichnende Erlebnisgestalt, die vom Vermögen der alltagsweltlich vertrauten wörtlichen Rede nur bedingt erfasst werden kann. Der Volkelt, System der Ästhetik, Band I, S. 99. Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (Roman), Ders.: Das dich terische Werk, S. 927f. 44 Baier, Der Raum, S. 96. 42
43
34 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
»Springende« Wahrnehmung – synästhetisches Hören
vitale bzw. »gelebte Raum« im Sinne von Dürckheim ist mit atmo sphärischen Potenzen aufgeladen. So auch der Hör-Raum der Geräu sche. Wie dieser Raum ist und wie er das eigene Ergehen stimmt, wird auf den Wegen leiblicher Kommunikation erfasst. Wenn irgendetwas auf merkwürdige Weise pfeift, das nicht nur eine einzelne Person wahrnehmen kann, sondern auch anderen Menschen in ähnlicher Weise erscheint, dann klingt darin etwas aus der herumwirklichen Welt an, das es nicht nur in der individuellen Imagination gibt. Mit anderen Worten: In diesem Pfeifen wird etwas gehört, das sich auch einer subjektiven Hördisposition verdankt, denn Ähnliches kann nur hören, wer auch fähig ist, auf ähnliche Weise zu hören.
35 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
3. Geräusche in Worte fassen
Bevor sich etwas Wahrgenommenes beschreiben lässt, muss es zumindest so klar ins Bewusstsein getreten sein, dass sich Worte für die Aussage eines Eindrucks auch anbieten. Eine geschärfte Aufmerk samkeit ist unverzichtbare Voraussetzung der Möglichkeit, überhaupt in der Sache treffend über etwas sprechen zu können. Einen Hinweis auf die Schwierigkeit dieses scheinbar banalen Vorhabens findet sich in einer Bemerkung von Tony Hiss über das atmosphärische Erleben der Schalterhalle des New Yorker Grand Central Terminal. Über das Geräusch seiner eigenen Schritte schreibt er, im Chaos des turbulenten Strömens zahlloser Menschen habe er sie nicht mehr ausmachen können. Für Hiss wird schon die sinnliche Erfassung körperlicher Eigengeräusche zum Problem. Wie hätte er auch noch in Worte fassen sollen, was er kaum zu hören vermochte. Einen anderen Versuch der Explikation von Eindrücken machte der kanadische Musiker Murray Schafer in den 1970er Jahren mit sei nem »World Soundscape Project«, mit dem er sich der Erfassung und Dokumentation urbaner Geräuschkulissen widmete. Das Vorhaben kann auch als Versuch einer erkenntnistheoretischen Schärfung der Aufmerksamkeit gegenüber Umgebungsgeräuschen angesehen wer den. In der Retrospektive hat das Projekt nicht unerheblich dazu bei getragen, dem lautlichen Raum generell eine größere Wertschätzung entgegenzubringen. Mit seiner Hilfe ist es gelungen, die Menschen im Medium der Kunst für das Bedenken tagtäglicher Umgebungsgeräu sche zu sensibilisieren. Die akustische Archivierung urbaner Szenen erfolgte im technischen Medium der Tonaufnahme. Ganz andere Herausforderungen stellen sich in der sprachlichen Erfassung lautlicher Eindrücke zum Zwecke der Anbahnung nachspü render Interpretation subjektiven Geräuscherlebens. Die Herstellung von Tonkonserven stellt in erster Linie technische Anforderungen, die Nieder-Schrift von Geräuscheindrücken dagegen mentale, in kogniti ver wie affektiver Hinsicht. Beide Formen der Reflexion lautlicher Wirklichkeit haben ihre je eigene Berechtigung. Die Tonbandauf nahme archiviert das Hörbare im Medium des Schalls, sie erfasst, wie
37 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
3. Geräusche in Worte fassen
sich etwas zu einer Zeit an einem Ort angehört hat. Die Niederschrift eines auditiven Eindrucks hält im Medium der wörtlichen Rede fest, wie sich etwas zu einer Zeit an einem Ort im Spiegel subjektiven Erlebens zu hören und zu spüren gegeben hat. Der in diesem Buch favorisierte Weg der diskursiven Annähe rung an Szenen der Lautlichkeit der Stadt folgt dem Programm der Phänomenologie. Um das eigene Mit-Sein in einer Welt der Töne, Klänge und Geräusche der selbst- wie weltbezogenen Eindrucksrefle xion zugänglich machen zu können, muss ein hohes Maß geschärf ter Aufmerksamkeit in die detaillierte Beschreibung atmosphärisch erlebter Wirklichkeit investiert werden. Wer hin-hört, hört in bewie gestimmter Weise dieses oder jenes. Was dann zu hören ist, wird, diesseits wirren Durcheinanders, insofern verstehend erfasst, als sich darin etwas in gewisser Weise von selbst zum Thema macht: »Man denke an das Geräusch von Tritten, an das Schnarchen, an das Schlürfen beim Essen, an das Stampfen der Pflasterer, an klappernde Mühlen, tickende Uhren, arbeitende Maschinen, an die Geräusche eines rollenden Eisenbahnzuges, in dem wir sitzen, an den plätschern den Bach, die brandenden Wogen, an den Gesang der Nachtigall, das Krähen des Hahnes u. s. w.«45 Die folgende Beschreibung des Geräusches eines vorbeifahren den Zuges soll einen ersten Einblick in die Methode der phänome nologischen Geräuschbeschreibung geben und an einem orts- wie situationsspezifischen Beispiel Potentiale ihrer erkenntnistheoreti schen Erträge illustrieren, aber auch methodische Schwierigkeiten erkennen lassen. In die folgenden Kapitel werden insgesamt sechs Beschreibungen integriert, um am jeweiligen Beispiel spezifisch städtische Geräusche (in Worten) konkret werden zu lassen. Zum einen zeigen sich dabei Wege der Explikation lautlicher Eindrücke im Medium der wörtlichen Rede. Zum anderen dienen die darauf fußenden Interpretationen von Geräusch-, Ton- und Klangeindrücken der Differenzierung des vertieften Verstehens lautlicher Facetten der Stadt. Die Beschreibungen stehen im methodischen Kontext einer urbanistischen Phänomenologie des Lauten und des Leisen. Die Beschreibungen basieren auf Selbstbeobachtungen. Dabei werden die sinnlichen Eindrücke in situ in möglichst großer Differenziertheit niedergeschrieben und lediglich im Rahmen einer redaktionellen Endbearbeitung sprachlich überarbeitet, nicht jedoch um Sachverhalte 45
Volkelt, System der Ästhetik. Band I, S. 326.
38 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
3. Geräusche in Worte fassen
ergänzt, die über das hinausgehen, was schon in der Situation der Aufzeichnung an Ort und Stelle fixiert worden sind. Die Methode der Mikrologien, die auch diesem Verfahren zugrunde liegt, habe ich an anderer Stelle ausführlich dargelegt und in den Kontext sozialwissen schaftlicher Forschungsmethodologie eingeordnet.46 Geräuschbeschreibung I: Ein vorbeifahrender Zug47 In der relativen Ruhe eines Sonntagnachmittages ist im engeren Sinne wenig zu hören. Es ist auf eine gelähmte wie lähmende Weise ruhig – nur hier und da ein dezent rauschender Luftzug. Hinter einem Gebäude rollt ein Auto heran. Der Motor ist leiser als das Laufge räusch der Reifen. Dann flattert eine Plastikfolie mit knatternden Tönen im Wind und schlägt immer wieder um einen Stapel Klinker steine herum. Danach liegt nur dieses bedrückend leere sonntägliche Grundrauschen in der Luft. Es wird in der nichthaften Leere der zähen Zeit dieses speziellen Wochentages immer dann in seinem leisen Charakter spürbar, wenn »nichts« passiert, wenn sich nichts bewegt, wenn nichts tönt und klingt. Für eine Stadt ist das merkwürdig, fast schon denkwürdig. Vor dem Hintergrund dieser beinahe anästhesierenden lautlichen Halb-Leere nähert sich ein Regionalzug – als wollte er damit drohen, in diese Ruhe regelrecht hineinzufahren. Er kommt »heran«, ohne dass sich genau sagen ließe, woher er kommt. Dass es ein Zug ist und nicht irgend etwas anderes, ist in dieser Situation selbstverständlich. Hinter dem Gebüsch neben der Straße verlaufen ein paar Bahngleise. Die Bahn nähert sich so schnell, dass eine räumlich-örtliche Lokali sierung, die über das Wissen um den Verlauf des Schienenstrangs hinausginge, kaum möglich ist. Das Einzige, das sich unzweifelhaft zu spüren gibt, ist ein sich aufbauendes, in gewisser Weise im Raum ausdehnendes Rauschen: Es kommt etwas heran! Es nähert sich etwas. Das Woher liegt eher in einer diffusen Halb-Ferne als an einem konkreten Ort. Und doch hat dieses Rauschen die Gestalt eines Gesichtes, das sich in seiner Eigenart zu hören und zu spüren gibt. Dabei ist schwer zu sagen, ob das Hören das Spüren dominiert oder das Spüren das Hören. Vgl. Hasse, Die Aura des Einfachen, S. 44 – 91 sowie Hasse, Das Denkwürdige im Infra-Gewöhnlichen. 47 Seehafenstadt Emden, rund 30 Meter neben einer Gleisanlage der Deutschen Bahn, Wohngebiet am Innenstadtrand, Anfang September, 15:00 – 15:30; 20 Grad Celsius; sonnig; leichter Wind. 46
39 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
3. Geräusche in Worte fassen
Das Rauschen insistiert mit dem Näher-Kommen als ein metallenes Poltern und flatternd-zischendes Scheppern. Was sich zu hören gibt, tönt relativ linear, nicht wie eine Amplitude, eine Kurve oder eine hör bare zickzackähnliche Tonfolge. Es ist ein durchgehendes Rauschen, das sich von einem anfänglichen Anrauschen in ein Durchrauschen steigert und dann allmählich (aber in dieser Allmählichkeit doch wiederum schnell) in einem Aus- und Verrauschen verliert. Es verliert sich in der Tat, denn es verläuft in seiner erlebten Zeitlichkeit nicht nach dem Modell einer idealtypischen Kurve, die langsam flacher wird, eher ist es plötzlich weg – wie abgehackt, einfach nicht mehr da. Das genauere Hineinhören in die lautliche Gestalt dieses Geräusches eines vorüberfahrenden Zuges erstickt letztlich im Versuch. Trotzdem ist das Geräusch äußerst konkret; es wird als das erfasst, als was es sich lautlich und situativ präsentiert. Die Worte zur Aussage des Gehörten und zugleich Gespürten stellen sich aber nur zäh ein. Mit anderen Worten: Das Tempo, in dem sie sich verfügbar machen, ist langsamer als das Verschwinden des Zuges. Das Fahrgeräusch geht in keinem singulären Rauschen auf; in einer verwischten Mannigfal tigkeit treten mehrere (wenn auch nur wenige) eigenartige Klänge und Töne aus ihm hervor. Aus dem rauschenden Geräusch lässt sich ein metallenes Schieben und Ziehen heraushören. Sodann ist es ein zischendes Schleifen. Bestimmend ist das ungeteilte Ineinander von Verschiedenem, in dem – kaum hörbar – etwas je Eigenes tönt. Zusammengehalten wird es vom Geräusch des vorbeifahrenden Zuges. Es hat den Charakter eines mächtig-breiten und lautlich-kräf tigen Bandes, das relativ dünn anfängt, dann schnell dicker wird und schließlich in einem hörbaren Abschwellen wieder an Stärke verliert – bevor es schließlich weg und vorbei ist. Es schneidet in die sonntägliche Ruhe hinein wie ein Ereignis in eine bis dahin homogene Atmosphäre. Nach dem lautlichen und tatsächlichen Verschwinden des Zuggeräusches bleibt nichts zurück. Nur ein sich in die Gegenwart hinein dehnendes lautliches Bild, das aber noch nicht den Charakter einer Erinnerung hat. Vielmehr ist es eine bild- wie geräuschlose Geistergestalt, die über den Moment des tatsächlich gegenwärtigen Geräuschs hinaus nachwirkt. Das Geräuschereignis verfliegt allmählich – ähnlich wie ein Geruch, aber langsamer als der Zug vorübergefahren ist. Es ist vorbei, als hätte es sich in die umgebende Luft aufgelöst. Dennoch gibt es ein Danach. Dies ist in etwa dem identisch, was davor war – ein scheinbar leerer Grundton, ein sonntäglich leeres Quasi-Brummen, das hörbar
40 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Im Konflikt mit der Zeit
wird, wenn nichts mehr ist – auf dass sich die sonntägliche Anästhesie wieder breitmachen kann.
Im Konflikt mit der Zeit Im Vollzug der Beschreibung wird eine Paradoxie unmittelbar greif bar. Die zeitlich nur kurze Gegenwärtigkeit eines Geräusches ent zieht sich allzu schnell in eine erlebnismäßige Leere. Im Bestreben seiner Explikation in der wörtlichen Rede öffnet sich ein Spalt des »Dazwischen«, in dessen kaum existierender Dauer der Druck zur Verbalisierung in eine akute Not mündet. Indem jedes Geräusch in Bewegung ist, entzieht es sich der sprachlichen Erfassung und Fixierung. Die Dauer seines Erscheinens ist nämlich kürzer als die Zeit, die das Bewusstsein benötigt, um das Gehörte und Gespürte in seinen Eindrucksqualitäten zu erfassen und das Gehörte in Worte zu kleiden. Die expressis verbis explizierte Beschreibung verlangt mehr Zeit als das Ereignis im Augenblick seiner lautlichen Präsenz dauert. So mündet die Beschreibung des relativ kurzzeitig nur aufblitzenden, gleichsam vorüberziehenden Geräuschs in die mentale Rekonstruk tion eines Eindrucks. Es fragt sich jedoch, ob diese »Rekonstruktion« tatsächlich schon aus der Erinnerung eines in Vergangenheit abgesun kenen Geschehens betrieben wird oder noch in der Gegenwart eines nachwirkenden Eindrucks geschieht. Das Geräusch kommt schnell und es vergeht schnell. Es bleibt aber nicht. Sein charakteristisches Merkmal besteht darin, dass es – solange es existiert – in Bewegung ist. Mehr noch: es ist selbst diese Bewegung. In seinem Beginn keimt schon sein Zu-Ende-Gehen, sein Verschwinden aus der gegenwärtigen RaumZeit. Wie jedes Geräusch, so lässt sich auch dieses – obwohl es Ausdruck eines konkreten sinnlichen Ereignisses ist – nach seiner Auflösung viel schwerer erinnern als ein visuell erfasster Gegenstand oder erst recht ein von jemandem ausgesprochenes Wort. Das Lautliche ist ätherisch und flüchtig. Zugleich verdankt sich seine eindrückliche Wirkung ganz dieser Nicht-Fassbarkeit. Der heranrollende Regionalzug kündigt sich in seiner Näherung zwar hörbar an. Diese lautlich-atmosphärisch anschwellende »Geste« kehrt sich im Moment ihrer Vergegenwärti gung aber schon ins beginnende Verschwinden um. Auf der Höhe der Gegenwart scheint bereits Vergangenheit vor: die baldige Abwesen heit dessen, was gerade erst lauter wurde und die Wiederkehr einer
41 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
3. Geräusche in Worte fassen
Ruhe, die schließlich die lautliche (mehr als nur räumliche) Ferne eines eben noch so präsenten Geräuschs besiegeln wird. Jedes Geräusch hat eine Vorgeschichte; es gibt immer eine Laut lichkeit vor einem Geräusch, das sich (z. B. in seiner Näherung) aus einem Hintergrundgeräusch heraushebt. Ebenso gibt es eine Lautlich keit, die auf das Ende eines Geräusches folgt. Ein solcher Hintergrund ist wie eine Landschaft, die in ihrer Materialität von relativ dauerhaf tem Bestand ist. Ein aktuell hervortretendes Geräusch, das im Feld der Wahrnehmung dominant ist, verwandelt ein Grundgeräusch in ein Hintergrundgeräusch. Eine thematisch sich wie von selbst zu Gehör bringende Bewegung wird – wie am Beispiel des vorbeifahrenden Zuges – für die begrenzte Zeit seiner Dauer zu einem relativ beharren den lautlichen Zwischenbild. Es entsteht eine Augenblickssituation, die sich so lange vor ein hintergründiges Grundgeräusch schiebt, wie sie den Horizont der Aufmerksamkeit ausfüllt. Lautliche Zwischen spiele dieser Art gehen im landschaftlichen Erleben z. B. von einem heftigen Gewitterguss oder einer hereinbrechenden Sturmböe aus. »Hinter« dem lauten Geräusch des vorbeifahrenden Zuges ist kein dif fuses Hintergrundgeräusch mehr vernehmbar. Die relative Lautlosig keit der Gegend wird vom Geräusch des fahrenden Zuges ganz einge nommen. Die vorher eher atmosphärisch als lautlich wahrnehmbare sonntägliche Ruhe verschwindet schon mit der Näherung des sich »aufrichtenden« Zuggeräusches. Ein dezentes Hintergrundrauschen kehrt aber zurück, sobald sich der lautlich-ekstatische »Stoff« aus dem ZeitRaum der Gegenwart wieder entfernt hat. Das Beispiel zeigt: Es gibt nicht nur Hintergrund-Geräusche, die nach dem Abklingen eines aktuell aufmerksamkeitsfüllenden Geräusches wiederkehren; es gibt auch die atmosphärische Leere eines vermeintlichen »Nichts«, das sich nach einem Geräusch wieder durchsetzt.
Die Grenzen der wörtlichen Rede – Inkommensurabilitäten Die sprachliche Explikation von etwas Gehörtem stellt im Vergleich zur Beschreibung visueller Eindrücke gesteigerte Ansprüche. Wenn der dinglich erfüllte Raum schon im Allgemeinen »nicht durch bloße Objektbeschreibung erfaßt werden«48 kann, so erst recht nicht der lautliche Raum, in dem es gar nichts Dingfestes gibt. Das Hörbare ist 48
Baier, Der Raum, S. 96.
42 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Die Grenzen der wörtlichen Rede – Inkommensurabilitäten
flüchtig, andauernd in Bewegung und ohne feststoffliche Substanz. Geräusche bleiben außerdem nie dieselben. Wie der wehende Wind, so ändern auch andere Schallereignisse ihr Gesicht in der Bewegung. Es erfordert viel Übung genauen Hinhörens, um das auditiv Vernom mene durch seine Wandlungen hindurch als etwas zu erkennen, das sein Gesicht zwar ändert, in seinem Charakter jedoch nicht plötzlich etwas Anderes wird. Noch in der Literatur sind es vor allem visuelle Eindrücke, die in der wörtlichen Rede wiedergegeben werden. Vor den Geräuschen bieten sich eher noch die fiktionalen Bilder der Imagination für die Aussprache an. In Edgar Allan Poes unglaublicher Erzählung Der Malstrom berichtet ein Seemann von einem traumatischen Ereignis, in das er mit seiner Schmack (einem eineinhalbmastigen Segelschiff) samt Mannschaft geraten war. Allein der Erzähler überlebte den Schiffbruch, der in grauenvollen Szenen als verzweifelter Kampf mit einer bis dahin unbekannten Naturgewalt beschrieben wird. Die Naturekstase stellte für ihn alles bis dato Erlebte in den Schatten. Wenn die Erzählung auch durch ein überaus großes Maß affizierender Eindrücklichkeit fasziniert und das vernichtende Geschehen ganz und gar nicht lautlos, sondern in einem gigantischen »Getöse des Wassers«49 abgelaufen sein muss, so beschreibt Poe das Geschehen doch hauptsächlich in visuellen Eindrücken und den von ihnen ausge lösten Gefühlen maximaler existenzieller Ergriffenheit. Beinahe rar sind jene Sätze seiner Erzählung, in denen er nicht vom Gesehenen berichtet, sondern von dem, was er gehört hatte. Eine Ausnahme ist auch der folgende Satz, der der Schilderung jenes Momentes gilt, in dem das Boot den Schaumgürtel erreicht, der den Abgrund eines Strömungswirbels zu erkennen gibt: »Zugleich wurde das Brüllen des Wassers von einer Art schrillen Kreischens vollständig übertönt, einem Ton, wie ihn etwa die Pfeifen vieler tausend Dampfer, die gleichzeitig ihren Dampf ablassen, hervor zubringen vermöchten.«50
Im Großen und Ganzen überträgt Poe sein fiktionales Erleben in eine immer facettenreicher werdende Collage katastrophischer Bilder. Damit folgt er einer Tradition der Explikation von Eindrücken, wonach das Gesehene den Stoff der Imagination hergibt und nicht das Gehörte. Das knappe Zitat illustriert allerdings, dass gerade lautliche Eindrücke 49 50
Poe, Der Malstrom, S. 187. Ebd., S. 193.
43 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
3. Geräusche in Worte fassen
die Imagination in besonders faszinierender Weise anzusprechen vermögen, weil sie das Gesehene um eine sinnliche Ebene erweitern und Synästhesien die Phantasie fiktionalen Mit-Seins in einem nur vorgestellten Geschehen intensivieren. Die phänomenologische Erfassung von Geräuschen steht vor einer methodologischen Schwelle der Inkommensurabilität. Was gehört wird, lässt sich zwar prinzipiell mit den Mitteln geschliffener wörtlicher Rede aussagen. Aber solche Aussagen bleiben so lange gebrochen, schillernd und in gewisser Weise sogar mangelhaft, wie sie sich nur auf das stützen, was in einem akustischen Sinne mit den Ohren vernommen worden ist. Lebendig wird eine Beschreibung erst, wenn sie über das Akustische hinaus die Situation zur Geltung bringt, zu der das Gehörte als deren partielle Wirklichkeit gehört. Ähnliche Übertragungsprobleme von einem Eindruck aus der Sphäre der Sinn lichkeit in die der wörtlichen Rede stellen sich im Bereich der Gerüche und des Taktilen. Es ist in besonderer Weise Sache der Metaphern, der expressis verbis explizierbaren Sprache mit Vorstellungsbildern zur Hilfe zu kommen, die mehr zu sagen haben als ein einzelner Sinn. Die phänomenologische Beschreibung lautlicher Situationen strebt keine Objektivierung an. Sie will der Erweiterung des Selbstund Weltbewusstseins dienen und das nuancierte Bedenken individu ellen wie kollektiven Mit-Seins in Umgebungen üben. Phänomenolo gie stellt sich damit unter das politische Programm der Aufklärung und Emanzipation, denn selbst- wie weltbezogene Wissenszuwächse vergrößern die Basis des Denk- und Sagbaren.
Das Geräusch als Ganzes und seine lautlichen Segmente Eine weitere strukturelle Schwierigkeit der Beschreibung von Geräu scheindrücken liegt darin, dass die Lenkung der Aufmerksamkeit die selektive Segmentierung impliziert. Jedes zum Gegenstand einer Beschreibung gemachte Geräusch wird in seiner Fokussierung verein zelt, also in Segmente zerlegt. Damit entstehen in gewisser Weise Abspaltungen, die es in der Vitalität der gelebten Stadt nicht gibt. Geräusche sind als lebendige und in Bewegung befindliche Phäno mene untrennbar in die plurale Lebendigkeit der ganzen Stadt verwi ckelt. Sie sind in die sinnliche Oszillation städtischer Orte integriert und können nur als lautliche Korrespondenzen des je aktuellen Geschehens an einem Ort oder in einem Raum verstanden werden.
44 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Das Geräusch als Ganzes und seine lautlichen Segmente
So gesehen geben sich urbane Geräusche als hör- wie spürbare Falten im Gesicht einer Stadt zu verstehen. Geräusche sind tönende, klingende bzw. schallende Eindrücke; in der Beschreibung verlieren sie zwangsläufig ihren schallartigen Charakter. Ein aufgeschriebenes Geräusch transformiert sich in Buchstabenketten, ein erzähltes ver liert sich an die Lautlichkeit der Stimme eines Erzählers. Töne, Klänge und Laute (und noch ein wild lärmendes Getöse) sind aber zudem in visuelle, olfaktorische und taktile Eindrücke eingebettet, in Gescheh nisse, die im gelebten Raum vor sich gehen. Die oben wiedergegebene Beschreibung ist das Produkt solch fokussierender Segmentierung, die alles weglässt, was es im Augenblick ihrer Niederschrift sonst noch gegeben hat. »Hinter« dem lauten Geräusch des vorbeifahrenden Regionalzuges besteht die sonntagnachmittägliche Nichthaftigkeit aber dennoch fort, denn sie wird von den aktuell durch den Raum gleichsam hindurchschwebenden Fahr- und Rollgeräuschen ja nicht ausgelöscht. Durch die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die Zuggeräusche wird sie aber in einen nicht mehr hörbaren Hinter grund zurückgedrängt. Die detaillierte Beschreibung von Eindrücken ist das erste Anlie gen phänomenologischer Forschung. »The first objective of the phenomenological approach is the enlarging and deepening of the range of immediate experience.«51 Eine Schwierigkeit ihrer Erfassung besteht darin, Voreinstellungen und Erwartungen tatsächlich und nicht nur programmatisch auszuschalten. »To intuit the phenomena seems at first blush a fairly elementary affair, if one approaches this task without preconceptions.«52 Jede sich »nur« aufs sinnliche Erscheinen (im Modus des Sehens, Hören, Schmeckens, Tastens oder Riechens) richtende Wahrnehmung wird jedoch auf produktive Weise durch Wissensfragmente »irritiert«, die in jedem methodolo gisch noch so sorgfältig regulierten Erkenntnisprozess auftauchen wie streunende Hunde. Assoziativ emporschießendes Vorwissen kommt letztlich dem sich Schritt für Schritt annähernden Verstehen (z. B. an einen Lautteppich) aber nicht in die Quere, sondern entgegen. Schon weil es für die meisten mobilitätserfahrenen Menschen gar keiner Anstrengung der Wahrnehmung bedarf, das Geräusch einer Diesellok von dem eines elektrisch betriebenen Höchstgeschwindig keitszuges zu unterscheiden, kann bezweifelt werden, dass eine in 51 52
Spiegelberg, The Phenomenological Movement, S. 656. Ebd.
45 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
3. Geräusche in Worte fassen
Gänze »theorielose« Offenheit gegenüber einem Erscheinen (wie sie die Phänomenologie verlangt) praktisch überhaupt möglich ist. Die Identifizierung einer Diesellok impliziert ja schon die intuitive Anwendung von Erfahrungswissen, dank dessen die extrem aufwen dige und umständliche Beschreibung eines Geräuschs eingespart werden kann, dessen analytische Durchdringung erst zu dem Resultat käme, dass das Geräusch einer Lokomotive (auch diese wird schon aus dem Vorwissen als solche erkannt, ist also von Anfang an nicht nur ein monströses Ungetüm, das merkwürdige Geräusche macht) auf einen Dieselantrieb zurückgeht. Es gibt keine prä-epistemische 0-Position, die frei von allem Wissen ist. Damit existiert aber eine Grenze zwischen einem erkenntnistheoretisch offenen Weltverste hen und dem erkennenden Rückgriff auf Wissen und (einfache) Theorien, die uns die Welt und das in ihr Begegnende verständlich machen. Auch Protentionen im Sinne einfacher Erwartungen, die jede Wahrnehmung begleiten und in der Imagination vorwegnehmen, was sich aus Erfahrung als nächstes suggeriert, gründen in einverleibten Vorerfahrungen, in einem weiteren Sinne also in Theorie.
Zwischen Gegenstands- und Selbstbezug Der Abschluss einer Beschreibung hängt vom Vermögen hinhörenden Unterscheiden-Könnens und der Fähigkeit ab, das Erlebte in Worte zu fassen und bei alle dem, einem weiterlaufenden, in Bewegung befindlichen Prozess eine so lange andauernde und geschärfte Auf merksamkeit zu schenken, bis sich das hörende »Sehen« erschöpft hat. Was Thematisch zum Gegenstand einer Beschreibung werden kann, ist Resultat erkenntnistheoretischer Schärfe. Dank ihrer kann erst die Explikation eines Eindrucks entstehen, die sodann den Cha rakter einer situationsdurchquerenden Autopsie hat. In der Sache der Phänomenologie besteht der Fortschritt darin, »immer genauer zu merken, was merklich ist. Phänomenologie ist ein Lernprozess der Verfeinerung der Aufmerksamkeit und Verbreiterung der Hori zontes für mögliche Annahmen.«53 Dabei sind im Verstehen des lautlich Erscheinenden zwei Bedeutungsrichtungen von Belang, die sich nach John Shotter entlang zweier Perspektiven bewegen: eine 53
Schmitz, Kurze Einführung in die Neue Phänomenologie, S. 14.
46 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Zwischen Gegenstands- und Selbstbezug
ist auf etwas Äußerlich-Gegenständliches wie die Objekthaftigkeit eines Geräusches gerichtet. Eine zweite nimmt die Perspektive des leiblich-gefühlsmäßigen Mit-Seins ein. Mit anderen Worten: Eine jede Beschreibung kommt mit ihrem gelingenden Fortschritt an den Punkt einer thematischen Sättigung, auf dass eine Weggabelung ansteht: erstens in eine gegenstands- und zweitens in eine subjektbzw. selbstbezogene Richtung des Verstehens. Shotter unterscheidet in diesem Sinne zwischen »aboutness-thinking«54 (der Reflexion dessen, als was ein Geräusch erscheint) und »withness-thinking« (der Reflexion dessen, wie es im Fokus persönlichen Mit-Seins empfunden wird). Die obige Beschreibung zeigt zum einen, dass diese perspek tivischen Blicke auf etwas Begegnendes nicht nur nebeneinander liegen, sondern auch ineinander. Diese Grenze kann in der Praxis der Eindrucksbeschreibung nicht immer eindeutig gezogen werden. Die komplementäre Frage, wann eine phänomenologische Refle xion erfolgreich ist, beantwortet sich zunächst durch das Vermögen eines Subjekts, eine Situation als etwas Ganzheitliches zu verstehen. Auf einem gegenstandsbezogenen Niveau stellt sich die Aufgabe einer zentrifugalen Analyse, die sich in der Sache des Gehörten auf die Breite und Tiefe der Eindrücke bezieht, mit anderen Worten auf das WAS eines lautlichen Eindrucks. Im Fokus steht das Verstehen dessen, was auf der Objektseite eindrücklich geworden ist (das Fahrgeräusch eines Zuges, das als an- und durchrauschend beschrieben wird und von dem ein metallenes Poltern, flatternd-zischendes Scheppern etc. zu hören war). Das ist die gegenständliche Seite des Geräuschs. Lebensweltlich könnte man hier auch vom hörenden Verstehen des Geräuschs selbst sprechen. Je differenzierter (nicht zuletzt in der Dauer der Zeit) eine Beobachtung durchgeführt wird, desto mannig faltiger öffnet sich in der Breite und Tiefe des Beschriebenen auch das Feld dessen, was der Interpretation zugänglich gemacht werden kann. Wer wenig hört, vermag auch wenig darüber zu sagen, was in welcher Weise gehört worden ist. Auf einem subjektbezogenen Niveau stellt sich die Aufgabe einer zentripetalen Analyse, die sich auf die Art des Hörens und das davon Berührt-Werden bezieht, auf das sinnliche und damit ein hergehende gefühlsmäßige Geräuscherleben (z. B. die selbstreferen zielle Beobachtung, dass sich die zur Beschreibung reklamierenden Worte nur zäh einstellen). Zum Thema wird nun die Subjektseite 54
Shotter, Goethe and the Refiguration of Intellectual Inquiry, S. 140.
47 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
3. Geräusche in Worte fassen
sinnlichen Erlebens, d. h. das sinnlich-pathische Ergehen im situativ mitspürenden »Drin-Sein« im Raum eines Geräusches. Aber es gibt dieses Erleben nie ohne das WAS eines Geräuschs, ist doch ein hörwie spürbares Geräusch im Bewusstsein immer etwas »von außen« Kommendes. Die Art und Weise, in der ein Eindruck das Bewusstsein berührt, thematisiert implizit zugleich die Aspekte, in denen sich das erkennende Subjekt in seinem Hören seiner selbst gewahr wird. In Geräuschen erklingen Resonanzen der Welt. Indem »der phänomenologische Aufweis des In-der-Welt-seins […] den Cha rakter der Zurückweisung von Verstellungen und Verdeckungen«55 hat, ist das In-der-Welt-Sein wie das daraus mündende Mit-Sein nie auf ein nur räumliches Nebeneinander von Einzelnem zu redu zieren. Jedes Mit-Sein ist auf die Welt (öffentliche Wir-Welt wie häusliche Umwelt56) bezogen. Verstehen aus dem Rahmen sinnlichen Mit-Seins ist ein anderes als aus der Distanz der theorieorientier ten Vergegenständlichung von Isoliertem, Herausgehobenem und thematisch Fixiertem. Es ist »nicht eine aus Erkennen erwachsende Kenntnis, sondern eine ursprünglich existenziale Seinsart, die Erken nen und Kenntnis allererst möglich macht.«57 Erkenntnisleistung, die dagegen auf vergegenständlichender Fragmentierung besteht, lässt das Ganze des (um-)weltlich Gegebenen außer Acht. Auf Mit-Sein basierendes Verstehen wurzelt dagegen im Gegeben-Sein der Welt, in der Erfahrung des Einzelnen im Welt-Kontext des Ganzen, aus dem heraus sich die Welt meldet.58
Hin-Hören als Methode und praktische Zivilisationskritik Für die verstehende Haltung gegenüber Geräuschen folgt daraus eine Aufmerksamkeit gegenüber erscheinenden Situationen, zu denen lautliche Ereignisse gehören. Deren Erfassung verlangt aber wiede rum die segmentierende Fokussierung einzelner lautlicher Eindrücke. Das erscheint wie eine Quadratur des Kreises, bedeutet genaues Hinhören doch gerade gezielte und sich ins Detail vertiefende Auf merksamkeit und keine, die sich auf diffuse Zusammenhänge von 55 56 57 58
Heidegger, Sein und Zeit, S. 58. Vgl. ebd., S. 65. Ebd, S. 123f. Vgl. ebd., S. 75.
48 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Hin-Hören als Methode und praktische Zivilisationskritik
Vielem richtet. Gleichwohl verstößt die segmentierende Aufmerk samkeit nicht a priori gegen die Möglichkeit der Miterfassung eines einbettenden Ganzen. Dieses mehrdimensionale Differenzierungsge bot schließt letztlich sogar ein, auch das eigene Mit-Sein als etwas zu behandeln, das methodologisch zum Ganzen einer eindrücklich wer denden Situation gehört. Die Aufmerksamkeit richtet sich also nicht nur auf das, was man (im Ganzen wie im Einzelnen) hört, sondern zugleich auf das begegnende Hören. Damit kommt die Situation des Erscheinens eines Geräusches in den Blick, zugleich aber auch seine sinnlich facettenreiche Erlebnisweise samt aller synästhetischen und metaphorischen Bedeutungsverknüpfungen. Die phänomenologische Methode unterscheidet sich kategorial von der z. B. in den Sozialwissenschaften verbreiteten konstruktivis tischen Sicht auf die Welt. Diese kommt in der folgenden Bemer kung von Sieglinde Geisel zur technikhistorischen Veränderung von Laut und Lärm sowie der damit verzahnten Hörsensibilität und Höraufmerksamkeit zum Ausdruck. Sie stellt ganz nüchtern fest: »Ein Geräusch wird im Kopf zu Lärm«59. Zwar ist es unbestreitbar, dass die Menschen lernen, sich kognitiv verstehend mit ihrer Welt auseinanderzusetzen, d. h. Schablonen der Weltdeutung einzuüben, die sodann immer wieder auf ähnlich erscheinende Situationen ange wendet werden. Das heißt aber nicht, dass sie in ihren Eindrücken etwas immer nur wiedererkennen, das in den Wissensbeständen und Ressourcen der Erinnerung bereits vorkonstruiert ist. Im Blick der Phänomenologie entstehen sinnliche Eindrücke jedoch nicht im Kopf bzw. im Gehirn, sondern zum einen in der unkalkulierbar erscheinen den wirklichen Welt außerhalb der Subjekte und zum anderen im gestimmten Augenblick ihres atmosphärischen Erlebens. Der Sozialkonstruktivismus bietet eine reduktionistische Sicht auf den Menschen. Seine methodologische Voraussetzung ist die Abspaltung des menschlichen Körpers (samt Gehirn als Organ) von der Person, die sich auf ihr Gehirn nicht reduzieren lässt. Phänome nologie bestreitet nicht die Konstruiertheit von Weltsegmenten für die (z. B. politisch korrekte) Welterkenntnis; sie sieht die Welt aber nicht als ein engmaschiges Netz von Konstellationen, in dem es keine ganzheitlich zur Erscheinung kommenden und diffus wirken den Situationen gäbe. Die Verwurzelung der Welt in ganzheitlichen Situationen zeigt sich in besonderer Weise im Hören von Geräuschen, 59
Geisel, Unerhört, S. 595.
49 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
3. Geräusche in Worte fassen
münden sie in ihrer nicht-diskursiven Ästhetik doch in eine Offenheit des Verstehens, die es in konstruktivistischer Sicht nicht geben kann, weil alles Denkbare kategorial schon als vorstrukturiert gilt. Geräusche sind – würde man der Geräuschauffassung des Bun desimmissionsschutzgesetzes folgen – objektivierbare akustische Quantitäten. Diese Betrachtungsweise spiegelt sich in den von vielen Städten angefertigten Lärmkarten wider, die auf eine »objektive« Geografie akustischer Emissionen abzielen, auf die zahlenmäßige Dokumentation von Lautstärken in Raum und Zeit. Zweifellos erfül len solche statistischen Produkte eine unverzichtbare Aufgabe in der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Im Flächennutzungskonflikt können sie sich als justiziable »Dokumente« erweisen, die sich für die Lenkung erwünschter wie unerwünschter Tendenzen der Raument wicklung anbieten. Geräusche, die von individuellen Personen in spezifischen Situationen und Stimmungen gehört werden, sind mit akustischen Datenmengen jedoch nicht identisch. Laute Geräusche beeinträchtigen unter Umständen die Gesund heit; nicht aber, weil sie »objektiv« sehr laut oder sogar lärmend sind. Ebenso wenig kommen sie der Zufriedenheit des Menschen auf einem geraden Wege schon dann entgegen, wenn sie im akustischen Sinne nur leise genug sind. Die Erlebnisqualität eines sinnlichen Eindrucks ist Produkt der mit ihm verknüpften Bedeutungen, die im Hören schon mitschwingen. So gibt es ästhetisch genossenen »Lärm« und das unangenehme, ja sogar verhasste leise Tönen von etwas. Noch nicht einmal sogenannter »Fluglärm« wird oberhalb einer bestimmten Dezibel-Grenze automatisch zu einer Lärmbelästi gung. Es kommt darauf an, wie die Menschen ein Geräusch zu ihren persönlichen Bewertungen und Bedeutungsordnungen in Beziehung setzen. Geräusche haben, indem sie genussvoll aufgenommen werden (wie die Klänge erwünschter musikalischer Melodien) oder idiosyn kratisch am ästhetischen Geschmacksempfinden abprallen (wie ein übler und unerträglicher Lärm), zwar einen je spezifischen Ausdruck scharakter. Dennoch geben sie dabei etwas vom Wesen eines Geräu sches zu spüren. Geräusche sind in gewisser Weise Individualitäten. Die sprachli che Erfassung der schallartigen Gestalt eines vorbeifahrenden Zuges ist deshalb auch nur bedingt nützlich zu machen für das besser hörende Verstehen eines vorbeirollenden Linienbusses. Auch auf das lautliche Erscheinen eines High-Tech-Zuges (wie einen ICE oder TGV) könnte es nicht einfach übertragen werden, weil Hochge
50 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Hin-Hören als Methode und praktische Zivilisationskritik
schwindigkeitszüge allein aufgrund ihrer Bauweise anders klingen als Regionalzüge (Gewicht, elektrischer Antrieb, Laufgeräusch der Räder, Federung etc.). Schon das Regenwasser fließt nicht »einfach« die Rinnen ent lang. Unabhängig von der Frage, ob es auf den Erlebnishintergrund einer euphorischen oder depressiven Stimmung trifft, bringt es sich in der Art seines Rinnens in je eigenartigen lautlichen Gesichtern zu Gehör – mal in einem schnellen, mal langsamen und spärlichen Dahinrinnen und schließlich in einem massenhaften Stürzen. Wenn Rilke schreibt, »das Regenwasser röchelt in den Rinnen«60, so ist an dieser poetischen Beschreibung nicht viel objektivierbar. Doch weist das »Röcheln« darauf hin, dass hier nicht strömende Mengen niedergegangener Güsse durch die Rohre stürzen, sondern eben nur »röchelnde« Mengen. Die sprachliche Formulierung ist zwar Aus druck spezifisch gestimmten subjektiven Erlebens, aber sie sagt doch auch etwas über die Art des Dahinrinnens. So stehen auch auf sub jektiven Endrücken basierende Beschreibungen in einer Beziehung zur Wirklichkeit tatsächlicher Geschehnisse. Trotz aller Stimmungen kann das Regenwasser nicht »röcheln«, wenn es in wahren Fluten durch die Rohre fällt oder in überaus dürftigen Rinnsalen nur über die Bleche tröpfelt, so dass beinahe gar nichts zu hören ist. Was die Menschen hören, gründet (wie die Stille zeigt, in der es keine akustischen Daten gibt) nicht »zuerst« in physikalischen Quantitäten. In diesem Sinne ist die »seidene Stille«61 kein Schallereignis, dem ein Dezibel-Wert korrespondiert. Noch im fotografischen Bild lassen sich urbane Szenen mit Hin weisen auf Geräusche erfassen und ausdrücken, um sie der Reflexion zugänglich zu machen. Zahlreiche Fotografien, die Berenice Abbott in den 1930er bis 50er Jahren in New York machte, zeigen zwar im engeren Sinne nur Menschen und Gegenstände; dennoch geben sie als momenthaft zur Erscheinung kommende Raum-Zeit-Schnitte auf eindrückliche Weise performative Atmosphären zu spüren, wenn diese auch nie mehr sein können als persönliche Autopsien einer augenblicklich erscheinenden Stadt. Zu seiner Zeit (um 1900) machte der Franzose Eugène Atget über Jahrzehnte seinerseits Aufnahmen in Paris, die geradezu aseptische bis tote Eindrücke der tagtäglich lebendig durchströmten Stadt vermittelt haben. So eigenartig der eine 60 61
Rilke, Herbststimmung (Gedicht), Ders.: Das dichterische Werk, S. 234. Rilke, Die Stille (Gedicht), Ders.: Das dichterische Werk, S. 424.
51 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
3. Geräusche in Worte fassen
wie der andere Blick auf die Stadt auch sein mag, in all diesen letztlich persönlichen Aufnahmen scheinen Facetten eines Eindrucksganzen vor, das man auch »das« Geräusch der Stadt nennen könnte. Mit der Explikation von Geräuschen (sei es im Medium der Sprache, der Bilder oder der Musik) stellt sich nicht nur eine Reihe allein praktischer Herausforderungen. Darüber hinaus schlummert in ihrer Beschreibung eine antizivilisatorisch-progressive Aufgabe. Wo sich die allgemeine Bildung unter dem Druck systemischer Nütz lichkeitserwartungen zur rudimentären Vermittlung basaler Skills hinreißen lässt, wird die kritische Reflexion des eigenen Selbst und seiner Weltverhältnisse zu einer Brache. Die Unempfindlichkeit spätmoderner Wahrnehmungsroutinen (nicht unwesentlich durch szientistisch-simplifizierende Dressuren allgemeinbildender Schulen verschärft) ist Produkt einer seit zweitausend Jahren anhaltenden »Verwechslung des Lebens mit dem Geist, des vitalen Vorgangs mit der Tätigkeit des Willens«62 und anderer gegenüber der sinnlichen Wirklichkeit desensibilisierender Lektionen. Schon die mindestens zweitausend Jahre alten Mythen sahen den Schöpfungsakt als etwas Geistiges an. Alles, was sich in der Weltentstehung an turbulentem und chaotischem Tohuwabohu der Geräusche vollzogen haben muss, fand darin kaum eine besondere Erwähnung (s. oben).
62
Klages, Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck, S. 151.
52 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
4. Das lautliche Gesicht der Stadt
Städte erscheinen in Gesichtern, die trotz aller Wechselhaftigkeit politischer und gesellschaftlicher Verhältnisse etwas davon verraten, was ihren urbanen Rhythmus antreibt und worin ihr atmosphärischer Vitalton im Unterschied zu anderen Städten liegt. Die auf dieses Erscheinen einwirkenden Bedingungen sind facettenreich. Schon auf dem Niveau der Lebensstile ihrer Bewohner gibt sich eine Industrie stadt in einem anderen Habitus zu erkennen als eine Bürostadt. Eine Stadt im Gebirge ist schon wegen ihrer Lage in der natürlich relieffierten Landschaft nicht mit einer am Meer zu vergleichen. Und sie hört sich auch anders an, denn Städte geben sich nicht zuletzt an ihrem Geräusch zu erkennen. Es gibt laute und leise Städte; in ihrem auditiven Habitus zeigt sich eine Stadt von mehreren Seiten ihrer Vitalität. Der Metropolraum Ruhrgebiet ist in anderer Weise laut als ein boomendes Zentrum des Städtetourismus. Und eine Großstadt in der Nacht ist anders leise als dieselbe an einem Sonntag. Eines eint sie alle, denn trotz mitunter großer Unterschiede heben sich Städte in ihren Geräuschkulissen von den lautlichen Profilen der Dörfer und meisten Kleinstädte ab. Das Leben einer Stadt spiegelt sich u. a. in den lautlichen Resonanzen dessen wider, was in ihr vor sich geht. Eine »erste« Geräuschquelle spätmoderner Metropolen ist das nahezu permanente Hintergrundgeräusch des sonor-brummenden bis bebend-donnern den Vorüberrauschens zahlloser Personen- und Lastwagen, das Heu len der Sirenen von Rettungswagen und Polizeifahrzeugen oder das Poltern der Straßenbahnen. Quietschende Autoreifen hört man bei der Einfahrt ins Parkhaus, in scharfen Kurven und vor der auf Rot springenden Ampel. Aber sie machen beim Bremsen vor dem Bahn übergang einen anderen Ton als beim Drehen der Räder auf dem glatt gestrichenen Beton in der Tiefgarage. Auf einem beinahe dezenten Niveau rauscht das hintergründige Stimmengwirr in den Einkaufs straßen der City. Es wird selten laut, fast nie lärmend. Öffentliche und mehr noch halböffentliche Räume werden mit Musik, Werbespots sowie Durchsagen aller Art berieselt. Ähnlich austauschbare Tonspu
53 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
4. Das lautliche Gesicht der Stadt
ren der Belanglosigkeit tauchen die Lebensmittel-Supermärkte und Baumärkte in eine ubiquitäre Geräuschsauce. Ob diese Eindrücke atmosphärisch willkommen sind oder als ein Übel angesehen werden, spiegelt nur persönliche Verhältnisse zur Tonalität des städtischen Lebens wider. Objektivierbar ist außer Lautstärken kaum etwas daran. Noch nicht einmal »Lärm« lässt sich umstandslos als eine Qual brandmarken, die ein gutes Leben zunichte macht (vgl. auch Kapitel 10). Nichtsdestoweniger kann schon alles auch nur halbwegs Laute plötzlich oder im sensiblen Fokus eines Einzelnen zu einem üblen Lärm werden.
Das Grundgeräusch der Stadt Für Michel Serres können sogar Geräusche der Natur belästigen der Lärm sein: »Donner, Wind, Meeresbrandung, Vögel auf den Feldern, Lawinen, das schreckliche Grollen, das einem Erdbeben vorausgeht«63. Eine weitere Lärmquelle geht für ihn vom Kollektiv der Stadtbewohner aus: »Schreie, Hupen, Pfiffe, Motoren, Rufe, Schlägerein, Stereotype, Streit, Kolloquien, Versammlungen, Wahl kämpfe, Polemiken, Dialektik, Beifall, Kriege, Bombenangriffe, jede Nachricht aus sechstausend Jahren spricht nur von einem: von diesem Getöse.«64 Was Serres – nicht frei von einer satirischen Note – mit »Lärm« assoziiert, versammelt nur, was das Leben verlauten lässt; das Leben der Natur wie das der Menschen, sobald diese sich in Räu men urbaner Zivilisation massenhaft organisieren. Indes zeigt seine »Auflistung« schon auf den ersten Blick, dass im Grundgeräusch der Stadt nie alles gleich laut und gleichberechtigt nebeneinander ertönt. Ein Ge-räusch ist kein auditives Konzert, es ist ein eher zufälliges Durcheinander und keine harmonisch abgestimmte Komposition. Tag für Tag treten die Stadtbewohner mit dem Verlassen ihrer Wohnung in eine chaotisch vielstimmige Geräuschkulisse, umhüllend wie ein aufsteigendes Nebelfeld. Aus diesem Eindrucksganzen treten immer wieder einzelne Töne und eigene Geräusche hervor. Es macht die unregelmäßige Mannigfaltigkeit eines Geräusches aus, dass es nicht homogen rauscht. Besonders eine singuläre Tonfolge schreit in einer zufälligen Serialität aus diesem Durcheinander hervor: das schrill63 64
Serres, Die fünf Sinne, S. 139. Ebd., S. 140.
54 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Das Grundgeräusch der Stadt
alarmierende Heulen der Martinshörner und Sirenen, das im Namen ordnungsstaatlich legitimierter Macht die Aufmerksamkeit der Men schen bannt. Die politische Macht in der Stadt und über die Stadt hatte einst, wer über »Glocke und Sirene« verfügte. Gegenwärtig sind es tendenziell unsichtbare, umso mehr jedoch immersive Geflechte optischer wie akustischer Apparate. Vor dem Hintergrund der sich beschleunigenden Industriali sierung intensivierten und pluralisierten sich im 19. Jahrhundert die urbanen Geräusche. Zu einem herausragenden Merkmal der Metropolen wurde das Laute. Um 1900 entstand die Metapher von der „›Brandung der Großstadt‹, einem deutlich vernehmbaren ›Brausen‹ und ›Rauschen‹, einem ›Getöse‹, das den Eindruck einer andauernden, diffusen, scheinbar unaufhaltsam hin und her wogen den Geräuschkulisse vermittelte.«65 Die Stadt hatte sich in ihrer Lautlichkeit immer schon von X-beliebigen »richtigen« Landschaften, allzumal in den ländlichen Gegenden unterschieden. Nun sollte das Aufspringen der Differenz aber einen Quantensprung machen. Dieser vollzog sich nicht mehr in einer nur linearen Steigerung des ohnehin schon Lauten. Das neue technikkulturelle Level, auf dem sich die Lebens- und Arbeitsformen reorganisieren mussten, hatte in einer seiner gravierendsten Wirkungen eine »Steigerung des Nervenle bens«66 zur Folge. Das menschliche Vermögen, dieser Intensivierung aller möglichen sinnlichen Anforderungen noch gerecht werden zu können, geriet an Grenzen. »Der Überwucherung der objektiven Kultur ist das Individuum weniger und weniger gewachsen«67, schrieb Georg Simmel erst vor rund 100 Jahren. Die großen Städte wurden – weit über die schon lange existierende Differenz zur auditiven wie kulturellen Ödnis der Dörfer hinaus – zu sinnlichen Hotspots, ekstatischen Kosmen des Vielen, Sphären des Nicht-Passenden und immerwährend überraschenden Welten. Die chaotischen Oszillatio nen eines gänzlich überschäumenden Getöses führten in die mentale Überhitzung. Schon bald waren die Städte sinnliche Sonderwelten, die entweder mit Extremen überraschten oder zu Tode langeweilten. Das musste Auswirkungen auf das Ergehen der Stadtbewohner haben. Sigmund Freud sah das großstädtische Leben deshalb als ein beun
65 66 67
Payer, Signum des Urbanen, S. 36. Simmel, Die Großstädte und das Geistesleben, S. 119. Ebd., S. 131.
55 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
4. Das lautliche Gesicht der Stadt
ruhigendes und überbeanspruchendes Milieu: »Das Leben in den großen Städten ist immer raffinierter und unruhiger geworden.«68 Bis in die Gegenwart haben die Geräusche einen nicht unerheb lichen Anteil an der Erhitzung großstädtischer Gemüter. Und so wirken sie schon in ihrer akustischen Quantität auf das Befinden der Menschen ein, ganz zu schweigen von dem, was sie zu hören bekommen. Pathologisierende Auswirkungen mussten sie aber nicht deshalb schon haben. Gleichwohl tangiert jedes Geräusch, wie alle darin aufgehenden Töne und Klänge das Befinden der Menschen – je intensiver, desto weiter sie sich dem innerstädtischen Zentrum nähern. Weit vor jeder segmentierenden Wahrnehmung, in der dieser oder jener Ton für sich erfasst und bewusst werden könnte, breitet sich ein diffuser Geräuschteppich in der atmosphärischen Erlebniswelt der Städte aus. Urbanität drückt sich nicht zuletzt in Hörbildern aus, die als auditive Muster zur großstädtischen Lebendigkeit gehören wie der Weihrauch zur liturgischen Dramaturgie im sakralen Raum. Die Stadt zeigt sich in ihren Straßen und Quartieren augenblicklich als eine ganzheitlich zusammenhängende Welt – bevor sie (von »Freun den des Konstruktivismus«) als etwas gesellschaftlich Produziertes in gedachte Teile zerlegt wird. Innerhalb der pluralen Erlebniswelt urbaner Atmosphären spannen Geräusche einen lautlichen Horizont auf. Auditive Sub-Welten bestehen aber nie für sich. Sie verschmelzen in einem in Bewegung befindlichen Akkord mit allen anderen sinnli chen Erlebnisdimensionen. Vor allem großstädtische Ge-räusche sind mannigfaltig, mehr als jedes »einzelne« Geräusch mannigfaltig sein mag. Das Viele verbindet sich in der Rhythmik seiner inneren Synchronisierung, der Dauerhaftigkeit seiner Vernehmbarkeit und seiner stadt- oder quar tiersspezifischen Eigenart zu einem Ganzen, in dem der Klang einer Gegend manchmal wie eine Signatur ist, die auf Identität des Lokalen verweist. Die Differenzen zwischen dem Leisen und dem Lauten, dem Schrillen und dem Dumpfen, den mittäglichen und nächtlichen Stimmen, gehen in einem vielstimmigen Ganzton auf. Oft sind es gerade diese Differenzen, die im Ausdruck einer eigenartigen Dissonanz dafür sorgen, daß man den genius loci einer Straße oder eines Platzes leichter erkennt. Die plurale Lautlichkeit beharrt dann in einem situativ wie raumzeitlich übergreifenden charakteristischen Geräusch. Zum einen bringt sich darin das Tosen der Fahrzeuge und 68
Freud, Die ›kulturelle‹ Sexualmoral und die moderne Nervosität, S. 15.
56 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Das Grundgeräusch der Stadt
Baumaschinen sowie das undeutliche wie verschwommene Geraune der Massen höchst enharmonisch zu Gehör. Zum anderen hat dieses unspezifische wie eigenartige Gemisch aber auch die Qualität einer Melodie, die den pneumatischen Rhythmus einer urbanen Lebensdy namik zu spüren gibt. Die Melodie des täglichen Lebens von St. Petersburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschreibt Alexej Remisow in einer Erzählung facettenreich als Geräusch der Stadt. »Geräusch« ist für ihn dabei mehr als man mit den Ohren hören kann. Wie die Stadt als hochkomplexer sozialer Kosmos ist und sich atmosphärisch äußert, schwingt im performativen Puls des Banalen. So sind auch seine Schilderungen zur Lautlichkeit nicht nur Autopsien des Hörbaren. Eher sind sie Illustrationen dessen, was auf einem mikrologischen Niveau vom Lebensrhythmus der Stadt zu hören ist: Das nächtlich raschelnde Husten des Nachbarn hinter der Wand, ein Husten, das am nächsten Morgen als schrilles Husten wieder von vorne beginnt.69 Und das schreiende Aufbrausen der Agafja Petrowna, das so gellend ist, »als hätte sie drei Hälse«70; das Hungern des Bettlers, der außer dem Wort nichts hat71 oder das »kraftlos-traurige Geläut […], das sich sonntags mit seiner Klage trübsinning aufs Herz«72 legt. Diese Ein druckssplitter – lautliche Korrespondenzen des städtischen Pneumas – haben in ihrer literarischen Essenz keine im engeren Sinne akus tische Bedeutung. In einer Stadt, in der »jedes Fenster ein Ohr«73 ist, repräsentieren sie Sequenzen des Lebens der Leute – in beliebi ger Variation und einer gewissen atmosphärischen Durchsichtigkeit. Letztlich ist es die Anmutungsqualität kleinster städtischer Orte, die durch das Gehörte hindurchdringt. Ganz ähnlich geben sich Elias Canettis Stimmen von Marrakesch zu verstehen. Nicht als eine in Worte übertragene urbane Audiogra phie, viel mehr als Illustration einer aktuell je eigenartigen Vitalität. Was bei Remisow »Geräusch« ist, heißt bei Canetti »Stimme«. Geräu sche sind zwar – wie Stimmen – lautliche Emissionen. Aber weder Stimmen noch Geräusche gehen im Hörbaren auf. Als »Äußerungen« erzählen sie diesseits der wörtlichen Rede etwas vom atmosphäri schen Leben einer Stadt. Was dessen Puls im ereignishaften Dahin 69 70 71 72 73
Vgl. Remisow, Die Geräusche der Stadt, S. 28f. Ebd., S. 32. Vgl. ebd., S. 49. Ebd., S. 65. Ebd., S. 40.
57 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
4. Das lautliche Gesicht der Stadt
strömen in der Zeit ausmacht, ist in den Stimmen einer Stadt wie in ihrem Geräusch nur bedingt »hörbar«. Eher bekommt man es zu spüren. Aber nur, wenn man für das Hören von Zwischentönen auch wach genug ist.
Örtliche Geräuschgemische Wie und als was drückt sich das Geräusch der Stadt in spezifi schen, auch für sich erfassbaren Geräuschen aus, die man an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Gegend vernehmen kann? Die folgende Beschreibung illustriert dazu das lautliche Erleben im Außenraum eines Straßencafés in der Mitte einer Großstadt. Geräuschbeschreibung II: Straßencafé74 Vor einem Straßencafe´ (eigentlich eher einem Platzcafé) münden drei innerstädtische Hauptverkehrsachsen in eine ringartige Straße, die um den Platz herumführt. An dessen Rand liegen mehrere Cafés nebeneinander; am Übergang zu einer Fußgängerstraße befindet sich einer von drei U-Bahn-Ein- bzw. Ausgängen. Zunächst sind nur die Geräusche der nächstgelegenen innerstädti schen Hauptstraße zu hören: ein Rauschen der Autos, die über den regennassen Asphalt rollen. Die Motoren sind relativ leise – nur in einem Hintergrund zu hören. Dann ertönen – vor allem in den »Hörlücken« zwischen den vorüberfahrenden Autos – menschliche Stimmen an einem der Nachbartische. Was dort gesprochen wird, kann man nicht hören, nur ein gedämpftes Geräusch menschlicher Stimmen. Es vermischt sich mit dem Zischen der über die Straße dahingleitenden Wagen. Dann ein plötzliches Spatzengezwitscher! Es ist irritierend, an dieser turbulenten innerstädtischen Stelle Vogel gezwitscher zu bemerken, und dann das immer wieder und dicht vorüberfliegende Federvieh auch noch zu sehen. Die Aufmerksamkeit wird besonders durch die Laute der Vögel geweckt und nicht durch ihr schnell oszillierendes Flugbild. Ein beschleunigender LKW drängt sich in gewisser Weise zwischen und über die in einem verschwommenen Hintergrundton palavern 74 Mitte Oktober, 13:15 – 14:00; 13 Grad Celsius; leichte Regenschauer; unter einer Stoffjalousie; Sitzplatz am Tisch eines Cafés in Frankfurt am Main, mit einer Tasse Kaffee.
58 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Örtliche Geräuschgemische
den Stimmen vom Nebentisch. In das Durcheinander krächzt eine Elster kurz und laut hinein. Dann wieder nur der beinahe schon gewohnte Dauerakkord von dahinzischenden Autos, Stimmensalat und Spatzenkonzert. Aus dieser ungleichmäßigen Gleichmäßigkeit der Töne, Klänge und Laute treten plötzlich die Schritte einer vorüber gehenden Passantin hervor. Sie hat offensichtlich härtere Absätze unter ihren Schuhen. Die anderen Leute, die schon zahlreich vorbei gegangen sind, blieben dagegen in ihrem Gehen »stumm«. Dann wird ein ganz anderes Geräusch dominant und stört geradezu die Aufmerksamkeit gegenüber der Mannigfaltigkeit all der gleichzei tig ablaufenden Audiogramme: das rauschende Krachen, das beim Zerbeißen eines frischen Kekses in meinem Kopf entsteht. Das Gebäck war die Beilage zum Kaffee. Sodann setzt sich wieder das stimmliche Durcheinander am Nachbartisch durch. Vor dem Café fegt ein Elektroroller vorbei; ein Mann steht darauf. Obwohl der Motor lautlos zu sein scheint, macht das Gefährt durch klackernde Töne auf sich aufmerksam. Die entstehen immer dann, wenn dass der Fahrer auf eine Bremse über dem Hinterrad tritt. Vielleicht ist es auch ein Schutzblech aus Plastik, das wie aufgeregt auf- und niederschlägt. Wer auf dem Roller steht, bemerke ich eher zufällig. Der Roller erregt die Aufmerksamkeit, nicht die darauf stehende Person. Das komische Ding ist in seinem im engeren Sinne gar nicht existierenden Fahrgeräusch irritierend – es läuft lautlos dahin, nur beim Bremsen macht es beachtlichen Krach. Ein am Café vorübergehender Mann niest. Sonst ist nichts von ihm zu hören. Dann ein »ja, ja« vom Nachbartisch; was über die beiden Worte hinaus gesprochen wird, geht wieder in einem nicht unter scheidbaren Akkord menschlicher Sprechlaute unter. Auf der Erde springen wieder zwei, dann drei, vier Sperlinge zwitschernd zwischen den Stuhlbeinen umher, als wollten sie ein paar Krümel erbetteln. Von hinten drängt sich ein monotones, vielstimmiges Geschepper von Tellern, Tassen und irgendwelchem Porzellan auf. Dann ein zischendes Rasseln von Messern, Löffeln und Gabeln. Wahrscheinlich wird eine Spülmaschine ausgeräumt. Und erneut ein rauschendes Geschirrgeschepper. Der Kaffeetrinker rechts von mir bewegt sich mit seinem Stuhl ein Stück nach hinten – wie, wenn man es sich beim Sitzen etwas bequemer machen will. Zu hören ist davon nur ein hartes, kurzes und lautes Scharren auf den rauen Sandsteinplatten des Bodens. Was es bedeutet, weiß ich erst, nachdem ich (wie von selbst) hingesehen habe.
59 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
4. Das lautliche Gesicht der Stadt
Und immer wieder die herumfliegenden kleinen Vögel mit ihrem laut-leisen Geschrei. Manchmal – wenn sie ganz nahe an meinem Kopf vorbeijagen – sind sogar ihre Flügelschläge für einen winzigen Augenblick hör- und spürbar. Eine junge Frau geht vorüber – sie kommt eigentlich nur in meinen Blick, weil die Absätze unter ihren Stiefeln sehr viel härter sein müssen als die aller anderen Passanten, die bisher vorbeigegangen sind. Das Geräusch ihres Ankommens, Vorübergehens und Verschwindens bildet eine Gauß´sche Kurve, die sich aufbaut und wieder abflacht. Nur, dass die Person nicht genauso langsam wieder weggeht wie sich genähert hat. Sie scheint plötzlich wie verschluckt zu sein, obwohl sie noch zu sehen ist in ihrem Weiterund Weggehen. Dazwischen zwitschern immer noch die Sperlinge. Sodann abermals und viel aufdringlicher als die über die nasse Straße dahingleitenden Autos: ein vorüberpolternder Elektroroller – ohne vernehmbare Motorengeräusche. Zunächst wird eine nicht abreißende Kette lautlicher Eindrücke gehört, die immer wieder in unerwartete Mischungen münden. Das Nahe geht darin mit dem Fernen eine Synthese ein. Zu den Geräu schen der Stadt gehört neben dem Rauschen der Autos auf dem regennassen Asphalt und den gedämpften Sprechgeräuschen herum stehender und -sitzender Menschen auch weniger Großstädtisches: Das Gezwitscher von Sperlingen, die unter dem Tisch herumspringen, das Krächzen einer Elster oder das (für eine Küche typische) Schep pern von Tellern und Tassen. Schon die wenigen Beispiele zeigen, dass alles, was eine Stadt auditiv von sich preisgibt, im situativen Geschehen an konkreten (Mikro-) Orten im Raum wurzelt. Daher gibt es die mannigfaltigen Geräusche einer Stadt zweifach: Einmal in dem, was man – in gewisser Weise »einzeln« – aus einem Ge-räusch des Ganzen (zufällig sowie absichtlich) heraus-hören kann, und ein zweites Mal in einem geräuschhaften Amalgam, in dem sich alles zu einem Schallbrei vermischt. Das Geräusch einer Stadt ist eine auditive Gestalt vom Charakter einer Synthese, etwas Ganzes, in dem Vieles für sich ist, jedoch stets im Rahmen dessen, was alles gleichzeitig ertönt. Dieses Gemisch ist aber nicht konstant. Es verändert sich, in zeitlichen wie performativen Kurven. An besonderen Orten klingt es immer wieder auf eigenartige Weise anders. Es ist lebendig und wandelt sich permanent in seiner Wirklichkeit. Das Geräusch einer Stadt entspricht deshalb auch keiner akustischen Datenkette, die durch die Addition einzelner Schallmengen zustande käme. Alles, was es in einer Stadt oder einer ihrer Gegenden zu hören gibt,
60 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Örtliche Geräuschgemische
überschneidet sich punktuell und situativ zu dem, was eine konkrete Person sinnlich tatsächlich zu hören bekommt. Ein Individuum kann immer nur hören, was ihm zu einer Zeit an einem konkreten Ort eindrücklich wird. Das hörende Raumerleben eines Menschen ist an dessen Anwe senheit an einer Stelle im Raum gebunden und zugleich durch seine persönliche Situation gestimmt. Unter objektiv wie subjektiv variie renden Bedingungen ist es heute anders als morgen. Das Gehörte ist zudem an den Rändern seiner Lautlichkeit verschwommen, weil (außerhalb von Laborsituationen) neben etwas Gehörten immer anderes mit-gehört wird, das meistens in ein Hintergrundgeräusch eingebettet ist. Hintergrundgeräusche müssen in der Dauer der Zeit jedoch keine bleiben. Mitunter ragt etwas sich Vereinzelndes aus ihnen hervor, das die beiläufige Aufmerksamkeit weckt – wie die wenigen verständlichen Worte, die sich in der Beschreibung zum Straßencafé als ein »ja, ja« aus dem sonst ununterbrochenen Geraune der Stimmen herausgehoben hatten. Was wir hören, ist nicht zuletzt Resultat der Umstände, wie wir hören. Und es ist Ausdruck der Art und Weise des Drin- und Mit-Seins im Raum der Stadt. Wer hinhört, will oder muss etwas Bestimmtes hören. Was sich (daneben, darüber oder darunter) noch zusätzlich zu hören gibt, mag in der Sache des Heraus-Gehörten zwar keine Rolle spielen. In der Mannigfaltigkeit der Geräusche ist es dennoch lautlich präsent. Ins lautliche Erleben mischen sich schließlich – meistens unbemerkt – noch körpereigene Geräusche ein (an der Beispielskizze das Krachen beim Zerbeißen eines frischen Kekses). So entstehen höchst individuelle, situationsgebundene, aber auch anthropologisch begründete Collagen, in denen sich alles auditiv eindrücklich Gewordene überlagert. Die kommenden und gehenden Eindrücke bilden in ihrer autopoietischen Synthese von allem Hör baren immerzu neue atmosphärische Akkorde. Aber die Synthesen basieren, wie die Bedeutung der körperlichen Eigengeräusche im Hörerleben zeigt, nicht allein auf einer Verschmelzung von Gescheh nissen auf einer Objektseite. Aus den Erinnerungsressourcen der »gelebten Zeit«75 wirkt eine Fülle einverleibter Erlebnisbilder nach, die mit aktuellen Eindrücken und Gefühlen Verbindungen eingehen und die atmosphärische Wirklichkeit einer Stadt temperieren. Gleich psychographischen Sedimenten wirken sie auf das Erleben von allem 75
Minkowski, Die gelebte Zeit, Band I.
61 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
4. Das lautliche Gesicht der Stadt
ein, das man üblicherweise einer realen Außenwelt zurechnen würde. Höchst persönliche Einfärbungen von Geräuscheindrücken kommen als Folge synästhetischer Wahrnehmung hinzu: Töne, Klänge oder Laute, die als laut, lärmend, weich, hart, zart oder roh empfunden werden. Das Geräusch der Stadt ist in seinem Erleben eine komplexe und empirisch kaum definierbare Gemengelage affektiv gefilterter Schallereignisse. Zudem wird, was in diesem Erleben eindrücklich wird, durch implizites Laut- und Geräusch-Wissen um den Klang von Orten, Dingen und Geschehnissen interpretiert. In das Geräusch der Stadt fädeln sich schließlich Impressionen ein, die mit dem Hören gar nichts oder nur wenig zu tun haben. Hörbar ist in diesem Sinne nicht nur der Schall, sondern auch die lautliche Leerstelle – die Lücke in einer im Prinzip dauer-turbulenten Dramaturgie urbaner Performanz: der Riss in der Hypernervosität der Stadt, der Bruchteil einer Sekunde, in dem das Dröhnen einer Baustelle aufhört und eine gewisse Nichthaftigkeit spürbar wird.
Das hör- und sichtbare Temperament einer Stadt Städte pulsieren in einem Rhythmus, in dem sich ein multimodaler Akkord sinnlich vernehmbarer Vitalqualitäten des Urbanen u. a. zu hören gibt. Für Henri Lefebvre verdichtet sich dieser weniger im Modus der Lautlichkeit, als in Atmosphären. Der Antrieb für die ses Pulsieren geht von Bewegungen aus76, die sich in Raum und Zeit wandeln. Dabei verbindet sich der »Rhythmus des Selbst« mit dem »Rhythmus des Anderen«77. In diesem Sinne habe ich bereits sehr konkret auf die Bedingungen des hörenden Raumerlebens auf merksam gemacht, wonach es auf der Objekt- wie der Subjektseite eine beinahe unüberschaubare Fülle von Variablen gibt, die auf das aktuelle Erleben ihren Einfluss haben. Lefebvre begründet diese Synthese nur abstrakt. Dabei wäre gerade eine phänomenologische Differenzierung aufschlussreich gewesen, hätte sie doch konkretisie ren können, was in den verschiedenen Rhythmen »des Selbst« und »des Anderen« auf welche Weise pulsiert. Fassbar und verständlich können Synchronisierungen zwischen dem Leben der Stadt und dem ihrer Bewohner allein auf einem anschaulichen Niveau sinnlicher 76 77
Vgl. Lefebvre, Versuch der Rhythmusanalyse der Mittelmeerstädte, S. 3. Ebd., S. 7.
62 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Das hör- und sichtbare Temperament einer Stadt
Eindrücke werden. Ich komme später in verschiedenen Perspektiven erneut darauf zu sprechen. Von entscheidender Bedeutung für das Verstehen der sich syn chronisierenden Rhythmen sind weniger Harmonismen als Enhar monismen. Ein solcher Enharmonismus widerstreitender Bewegun gen bestimmt in der obigen Beschreibung auch die Diskrepanz zwischen dem, was zwar sichtbar und hörbar war, aber infolge der sinnlichen Ungleichzeitigkeit von Gehörtem und Gesehenem zunächst irritierte (s. o. die Bemerkung zu einem vorbeifahrenden Elektroroller, dessen Geräuschlosigkeit im Widerspruch zu seinem bildhaften Erscheinen stand). Es gibt zum einen das Temperament einer Stadt (das einer Behördenstadt im Unterschied zu dem einer Industriestadt) und zum anderen das einer Person (eines hyperak tiven Optimisten im Unterschied zu dem eines depressiven Pessi misten). Es versteht sich von selbst, dass sich das Geräusch einer wirtschaftlich potenten Industriestadt im Erleben eines Depressiven, der sich in ihren dunklen Seiten sowie in ihrer zäh auf ihn wirkenden Dynamik verliert, höchst kontrastreich von dem eines Optimisten unterscheidet, der dieselbe Stadt als hyperaktiv und lebensfroh emp findet. Unabhängig von subjektiv gestimmten Dispositionen der Wahr nehmung merkt Lefebvre in einem Aufsatz zur »Rhythmusanalyse« der Mittelmeerstädte an, dass man einen Platz, einen Markt oder eine Straße in gewisser Weise hören könne.78 Er lässt aber im Dunkeln, woran sich der jeweilige Vitalton lautlich zu spüren gibt. Zwar ist der Vitalton eines Ortes mitunter zu hören – in den Gesichtern des Wetters, der Jahreszeiten, der habituellen Präsenz gerade anwesender Menschen oder auch am Geräusch laufender Dieselmotoren. Hören kann man Orte aber ebenso im mentalen Nachhall politischer und historischer Ereignisse, denn im Hören von etwas ist stets ein Verste hen schon vorgezeichnet. Es ist nicht zuletzt das (meistens implizite) Wissen, das einen Ort für das Hören gleichsam in Stellung bringt. In der Diskussion der Frage, inwieweit sich ein charakteristisches Geräusch mit dem Erleben einer Stadt verbinden kann, verdienen einige Überlegungen zum Zustandekommen von Geräuschen auf der Subjektseite der Individuen sowie der Objektseite des städtischen Raumes Beachtung. Während individuelle Geräuscheinrücke in erster Linie Ausdruck biographischer Prägung und räumlicher Sozialisation 78
Vgl. ebd., S. 2.
63 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
4. Das lautliche Gesicht der Stadt
sind, drückt sich in einem stadtcharakteristischen Schall-Cluster keine individuell spezifische Erlebnisweise aus, sondern eine stadtspezifi sche Erscheinungsweise. In der Dauer kollektiven Erlebens bilden sich stadtspezifische Geräusch-Muster heraus, in denen sich das hörbare Erscheinen einer Stadt und ihr auditives Erleben immer ähnlicher werden. Dies schon deshalb, weil sich in ihrer Spezifik häufig wieder kehrende auditive Profile (z. B. eines Viertels oder einer Straße) in das subjektive Hörbild eines Raumes einprägen. Solche »geräuschhaften« Besonderheiten bestimmter Städte hebt Gernot Böhme in seinen Überlegungen zu Klangatmosphären hervor: »Es macht einen Unterschied, ob es in einer Stadt üblich ist zu hupen oder nicht, welche Art von Fahrzeugen man fährt, ob aus offenen Fenstern Radiomusik zu hören ist, ob die Waren ausgerufen werden oder aus den Boutiquen anmachende Musik ertönt.«79
Das lautliche Gesicht einer Stadt bringt sich für Bewohner in ande rer Weise zur Geltung als für Touristen.80 Touristische Erlebnisper spektiven, die durch zahllose Medien nachhaltig formatiert worden sind, dürften sich mitunter sogar krass von lebensweltlich fundierten Hörbildern langjähriger Bewohner unterscheiden. Regelmäßig wie derkehrende Geräuschkulissen prägen sich im Fokus lebensgeschicht licher Dauer nachhaltig ins Erlebnisbild einer Stadt ein. Dagegen fokussiert die touristische Aufmerksamkeit durch die Tendenz frei zeitpsychologisch exotisierender Überzeichnung von »Highlights« und »Sehenswürdigkeiten« das (vermeintlich) Besondere. Langjäh rige Bewohner kennen »ihre« Stadt aus der eingewohnten Lebenspra xis im eigenen Wohnquartier; Touristen folgen eher den Pfaden der in Reiseführern präsentierten ästhetischen Hotspots. Durchreisende haben abermals einen anderen Affektbezug zum Raum einer Stadt, zu dem sie aufgrund der Art ihrer Bewegung durch und weniger im Raum eher zufällig und oberflächlich in Beziehung treten. Die Frage nach einem möglicherweise typischen Geräusch dieser und nicht irgendeiner Stadt stellt auch Karin Bijsterveld. Dabei unter scheidet sie zwischen den Eigenart vermittelnden keynote sounds, sound marks und sonic icons. Während keynote sounds als Hinter Böhme, Anmutungen, S. 65f. Beispiele dafür gibt Andreas Bosshard mit seinen Klangspaziergängen durch Zürich; vgl. Stadt hören. Zu einer detaillieren Klanganalyse gelangt er aber schon deshalb nicht, weil er sich kaum ins lautliche Erleben des Hörens vertieft. 79
80
64 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Das hör- und sichtbare Temperament einer Stadt
grundgeräusche einer Stadt verstanden werden (wie der Verkehrs lärm einer modernen Metropole), geben sound marks (ähnlich wie land marks) eine Stadt über einen stadt-charakteristischen Sound zu erkennen (man denke an die schweren Klänge von Londons Big Ben). Der Übergang zu den sonic icons ist indes fließend, hängt er doch im Wesentlichen vom »Aufstieg« einer meist historischen sound mark zum Klischee ab. »Often, however, particular sound marks from the past somehow persist and become iconic over time.«81 Keynote sounds und sonic icons verdanken sich nicht zuletzt kultureller Merkmale eines Raumes, zu denen u. a. religiöse Geräu sche gehören. Das lautliche Bild einer Stadt prägen sie aber nur dann in charakteristischer Weise, wenn eine Religion auch aktiv in einer Gesellschaft gelebt wird und ihre symbolische Präsenz im öffentlichen Raum nachhaltig wirksam ist. Eine Glocke kann nämlich auch (wie die Feuerglocke) von einem säkularen Turm erklingen. Nur, wenn sie vom Kirchturm her kommt und sich als sakraler Ton präsentiert, folgt der Klang auch einer religiösen Bedeutung. Es gibt religiöse Grundtöne im lautlichen Modus urbanen Lebens, die nur diese und keine andere Stadt »ausatmet«. Die Glocken des Kölner Doms gehören zur Atmosphäre der Stadt Köln und zu keiner anderen. Ubiquitären Charakter haben diese Klänge insofern nicht, als in einem diffusen »Überall und Nirgends« (in allen möglichen Kirchtürmen) nur kleine, hell sowie etwas dünn und durchschnittlich aber nicht in ähnlicher Weise numinos klingende Glocken läuten. Während in christlichen Kulturen zu bestimmten Zeiten das Geläut der Kirchen glocken die Atmosphäre einer Stadt unüberhörbar einfärbt, sind es in moslemischen Städten wie Istanbul oder Teheran die regelmäßig über Lautsprecher in den öffentlichen Raum übertragenen Gebetsrufe der Muezzin. Sie geben die religiöse Orientierung einer ganzen Gesellschaft zu erkennen. Dagegen ist der ubiquitär-profane Sound der Städte nichts Besonderes; er ist vergleichsweise unspezifisch und weitgehend kulturübergreifend. In ihm tönt das urbane Gemurmel der dastehenden, ausruhenden oder hektisch rennenden Menschen, des fließenden Verkehrs und der rhythmisch ertönenden Maschinen. Dennoch ist auch das profane Geräusch einer Stadt nicht a priori wie das einer beliebigen anderen.
81
Bijsterveld, Soundspaces of the Urban Past, S. 15.
65 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
4. Das lautliche Gesicht der Stadt
Die atmosphärischen Gesichter einer Stadt Ein Hafenquartier zeigt sich in seinem visuellen Bild in ganz anderen Gesichtszügen als das ausgedehnte Elendsquartier einer Stadt im freien Fall sozioökonomischen Niedergangs. Das sich vortastende Nachdenken über die lautliche Seite der Stadt hat deutlich gemacht, dass sich ihr atmosphärisches Gesicht nicht allein sichtbarer Züge ver dankt. Aber noch im Sichtbaren eines Raumes kündigen sich oft auch nicht-visuelle Facetten seiner Wirklichkeit an. Mit anderen Worten: Das Gesicht einer Stadt macht in seinem ganzheitlichen Ausdruck82 nachdenklich und nicht nur, weil wir dieses sehen, jenes hören und ein Drittes riechen. Schließlich spielt das Hören in einem indirekten (sprachlichen Sinne) eine Rolle auch im visuellen Verstehen einer Gegend, denn was wir allein sehend zu verstehen glauben, ist doch durch das imprägniert, was wir davon schon gehört haben. Mit dem, was eine Stadt atmosphärisch von sich preisgibt, meldet sich eine Schleppe von Geschichten – solche, von denen man de facto weiß und solche, die man unsicher vermutet. In der Mannigfal tigkeit dieser Geschichten sind auch lautliche Spuren des historischen Geworden-Seins einer Stadt virulent – in einem gewissen Nachhallen dessen, was an einem Ort »früher« geschehen ist. Georg Simmel sagt über das menschliche Gesicht, »im allgemeinen wird das, was wir von einem Menschen sehen, durch das interpretiert, was wir von ihm hören, während das umgekehrt viel seltener ist.«83 Das Hören ist – nach dem Sehen – in der westlich geprägten Kultur zwar erst der zweite Modus des Weltverstehens. Dennoch bekommt man beim Gehen in einer Stadt gleichzeitig etwas zu Gesicht und zu Gehör. Wenn vom Gesehenen auch eine größere und nachhaltigere Eindrucksmacht ausgeht, so setzt sich doch auch das »nur« Gehörte (wie das Gerochene und Ertastete) zum visuell Wahrgenommenen auf eher unbemerkte Weise ergänzend in Beziehung. Dabei spielen auch synästhetische und metaphorische Übertragungen eine Rolle. Wie eine Stadt in einem finsteren Gesicht erscheinen kann, so kann sie auch ein finsteres Raunen von sich geben. Während die Bilder einer düsteren Stadt vielfältig sind (von halbdunklen Straßen bis zu verwahrlosten Wohnhäusern), verbinden sich finstere Geräusche nicht in gleicher Weise mit Gefühlen und Vorstellungen vom dysto 82 83
Vgl. Simmel, Die ästhetische Bedeutung des Gesichts, S. 153. Simmel, Soziologie der Sinne, S. 141.
66 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Die atmosphärischen Gesichter einer Stadt
pischen Charakter eines ihrer Viertel. Es müssten schon nächtliche Revolverschüsse, wimmernde Hilferufe und irgendwo verhallende Polizeisirenen sein, die auf einem halbwegs geraden Wege eine ungute Gegend erahnen ließen. Mit dem Sichtbaren können wir mehr anfangen als mit dem, was wir nur hören. Während dem Gehörten etwas Sichtbares zu fehlen scheint, mangelt es dem Gesehenen in aller Regel nicht in gleicher Weise an lautlichen Komplementär-Ein drücken. In jeder Stadt gibt es Orte, die nicht nur ihr visuelles Gesicht haben, sondern auch ihre eigene Stimme – eine Stimme, in der das Geschehen im Quartier nachhallt. Solche Stimmen erzählen auf andere Weise etwas als das, was ein Raum zu sehen gibt. Indes wird das Hörbare leichter überhört als das Sichtbare übersehen. Schon in ihrem raumzeitlichen Beharren insistieren die Dinge auf ihre Sichtbarkeit. Was dagegen lautlichen Charakter hat, ist ephemer und flüchtig. Und doch »wissen« wir aus einverleibter Ortserfahrung, dass wir die Tramstation in der scharfen Kurve neben dem Zoo am schleifenden Poltern der Räder in den Schienen erkennen können. Mit anderen Worten: Wenn sich die Bahn nähert, meldet sich der Ort in »seinem« Ton. Hier wie in möglichen weiteren Beispielen können ortsspezifische Geräusche auch als eine Falte im Gesicht des genius loci aufgefasst werden. Sie markieren einen Ort in seinem atmosphärischen Aus-sich-Heraustreten in einer charakteristischen laut-physiognomischen Ausdrucksgestalt. Melodien, Klangfiguren und Töne bereichern die Atmosphären von Räumen und Orten. Sie haben ihren Anteil am Geräusch der Stadt, zu dem die an Orten vernehmbaren »Stimmen der Dinge«84 gehören. Kein Auto fährt abstrakt über eine Straße; es rollt zischend über den noch regenfeuch ten Asphalt, gleitet fast lautlos dahin (s.o.) oder quietscht mit den Reifen, wenn es an den Straßenbahnschienen entlangrutscht. Individuelle Eindrücke stehen mit dem gesellschaftlichen Aus druck des Gesichts einer Stadt in einem eher vermittelten als direk ten Zusammenhang. Persönliche Ortsbedeutungen sind zum einen Produkt biographisch einverleibte Ortsbeziehungen. Da diese ihre Wurzeln aber stets in der RaumZeit einer Gesellschaft haben, tragen sie zum anderen auch die Signaturen der gesellschaftlich gelebten Zeit. Biographische Prägungen verdanken sich der tagtäglich sich wiederholenden sinnlichen Erfahrung einer kollektiven Welt. Das 84
Schmitz, System der Philosophie. Band III/Teil 5, S. 135.
67 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
4. Das lautliche Gesicht der Stadt
heißt aber nur, dass in persönliche Wachstafeln der Erinnerung stets Gravuren aus Politik und Geschichte eingeschrieben sind. Urbane Milieus sind Produkt des gesellschaftlichen Raumes der Stadt, nie aber einer Wüste verinselter Einzelwesen. Sie sind als historisch gewachsene und gemeinschaftlich geteilte Räume Spiegel dessen, was Menschen in und mit ihnen gemacht haben. Und so atmet in ihren Atmosphären noch etwas von den Gefühlen, die das Ergehen ihrer Bewohner gestimmt haben. Atmosphärische Orte einer Stadt können langlebiger sein als ihre realen Artefakte wie Baute, Straßen und Plätze. Als imaginäre Affektlandschaften leben sie mitunter auch dann noch, wenn die einst stimmenden architektonischen Substrate schon lange abgerissen worden sind – vielleicht weil Neues an alter Stelle erbaut wurde oder Altes einfach verfallen und die Reste über wuchert sind. Als psychologische Landmarken leben Bauten und Dinge anders und länger fort denn ihre Materialität. Im »hörend« sich einfühlenden Hineinsehen in scheinbar leere Räume können die Erinnerungen an deren längst schon nicht mehr nachhallende Klänge wieder wach werden. Wenn es bei Alexej Remisow in einem Stück über Die Türklinke heißt: »Die Dinge leben, sprechen – hört ihr? spürt ihr? –, und nur Esel und aufziehbare Vogelscheuchen gehen gleichgültig an ihnen vorbei«85, so ist hier hörendes Sehen wie sehendes Hören gemeint, in dessen metaphorischer Synthese wir die Welt und uns selbst verstehen. Die Stimmen der Orte haben ihre eigene Melodie (s. auch Kapitel 12). Ein Schulhof bringt sich im hintergründigen Geräusch eines unregelmäßig gewirrhaften Raunens von Kinderstimmen zu Gehör, einer chaotischen Vielstimmigkeit, aus der einzelne Schreie und Rufe herausragen. Am Ende der Pausen verliert sich das in einem etwa stündlichen Rhythmus wiederkehrende Geräuschszenario in einer scharfen Abwärtskurve, um sich genauso plötzlich am Anfang einer der nächsten Pausen wieder aufzurichten – bis am Ende der Unterrichtszeit eine erlösende Ruhe spürbar wird und kein erneut anschwellendes Gewitter schnatternder Kinderstimmen zu erwarten ist. Auf ihre eigene Weise tönen die Viehmärkte im heiseren Stöh nen und schweren Brüllen der Bullen. Die Metzgereien schrecken durch das panisch quietschende Schreien der Sauen auf, die über den Innenhof in den Schlachtraum gezerrt werden. Geräusche haben ihre je eigenen Ereignisorte. Viele von ihnen gibt es in allen Städten. 85
Remisow, Die Geräusche der Stadt, S. 159.
68 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Das affizierende Drin-Sein im vitalen Raum der Stadt
Dann gehen sie im Gesamtgeräusch der Stadt auf und unter. Sie verschwinden in einem diffusen Hintergrundrauschen, das jeden Tag dasselbe zu sein scheint – wie das sich jeder Aufmerksamkeit entzie hende Gezwitscher der Spatzen, die in Straßencafés auf und unter den Tischen herumspringen, um fallende Krümel zu erbeuten (s. o.). Schließlich gibt es Geräusche, die nur ab und zu vorkommen: Das krächzende Kotzen der Katze in einer Wohnung, und das schmet ternde Knallen der Fehlzündung eines alten Lastwagens in der Unter führung. Davon müssen jene Geräusche unterschieden werden, die zwar ihrerseits nur gelegentlich vorkommen, aber etwas vom Wesen eines bestimmten Stadttyps anzeigen: das tief, weich und langsam tutende Nebelhorn von einem Ozeanriesen, der in einer großen See hafenstadt in ein Dock geschleppt wird oder die vor einem drohenden Tsunami warnende Sirene in einer Malaysischen Küstenstadt. Es gibt aber auch zahllose Geräusche, die an Rändern der Stadt zu hören sind und nicht in die spätmoderne Welt passen (muhende Kühe und krähende Hähne). Eine amorphe Schallmasse ergießt sich schließlich in den Raum einer jeden Stadt. In ihr unterstreicht sich nur eine unspektakuläre aber überall spürbare Atmosphäre; sie verdankt sich dem dichten und lärmenden Straßenverkehr, dem Rauschen starten der wie landender Flugzeuge, den anhaltenden und wieder anfahren den Straßenbahnen usw. Während infra-gewöhnliche Schallteppiche jede Aufmerksamkeit nur sedieren, lassen »falsche« Geräusche auf horchen. Das sind die, in denen etwas Fremdes auftaucht, das sich weder ins charakteristische Geräusch dieser Stadt einfügt, noch so ordinär ist, dass man es einfach überhören könnte.
Das affizierende Drin-Sein im vitalen Raum der Stadt Das atmosphärische Drin-Sein im Raum der Stadt ist an das gefühls mäßige Erleben des eigenen Selbst gebunden (vgl. auch das folgende Kapitel). Darauf macht Willy Hellpach aufmerksam, wenn er über das landschaftliche Erleben und das Erfasst-Werden von der Atmo sphäre einer Gegend spricht. Auch Städte konstituieren sich als (urbane) Landschaften, deren sinnliche Eindrücke mannigfaltig sind und in ebensolcher Weise berühren. Die »Akkorde«86, in denen 86
Hellpach, Sinne und Seele, S. 61.
69 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
4. Das lautliche Gesicht der Stadt
Geräusche, Gerüche und visuelle Bilder in einem Cocktail der Sinn lichkeit zusammenfließen, verdanken sich einer Vielfalt wechselnder Mengen einzelner Töne, Laute, Klänge und wiederum Geräusche. In einem gegenstandslosen Erleben87 verbinden sie sich mit spezifischen Gefühlslagen, wie sie mit diesen auch kollidieren können. Mal ist das Spektakel der sinnlichen Ekstasen der Stadt beruhigend, mal beängstigend, und dann einschläfernd. Wie man am Ufer des beinahe lautlosen Wattenmeers bei Ebbe in einen beklemmenden Schwebezu stand88 beruhigender und zugleich erregender Gefühlszustände gera ten kann, so lässt auch das atmosphärische Stadterleben die Menschen nicht kalt: wenn sich die akustische Ruhe einer verlassenen Gegend in eine immersive Stille steigert, wenn das permanente Hupen der Automobile plötzlich aufhört oder das durchgängige Geraune und Gerufe eines tumultartigen Marktes sich am Abend allmählich auflöst und eine geradezu irritierende Ruhe sich über den scheinbar immer größer werdenden Platz legt. In sich gewissermaßen »leerenden« Situationen mag ein lebloses Gefühl der Weite beherrschend wer den. Es ist einem merkwürdigen Vakuum ähnlich, in dem sich die städtische Lebendigkeit in einen Zustand der Starre zu verlieren scheint. Bemerkenswert ist daran, dass sich ein solches »Nichts« in einer Geräusch-Lücke verdichtet – in einer Erlebnisqualität ohne »positive« Sinnesdaten. An ihren sinnlichen Ekstasen werden besonders große Städte vom Rang der Weltmetropolen identifiziert. Maximale Beein druckung geht gerade in ihnen von visuellen Gestalten aus. In lautli chen Ekstasen drückt sich die Lebendigkeit einer Stadt dagegen in besonderer Weise in einer Art »Umkehrästhetik« aus, dann nämlich, wenn sie »außer sich« gerät: etwa in der Rushhour, in der alles lär mend durcheinander geht und chaotische Zustände die Oberhand zu gewinnen scheinen. Im sich zusammenbrauenden Kollaps bricht auch das auditive Geschehen aus seinen gewohnten und vorhersehbaren Bahnen. Es gibt eine Reihe von Extremsituationen, in denen sich das städtische Leben temporär sogar dem Chaos nähert, wenn es außer sich gerät: in einer Demonstration, deren aufgeheizte Atmosphäre mit dem Auftauchen der Wasserwerfer ins Beängstigende zu kippen beginnt oder sich in einem plötzlich hereinbrechenden Gewitter an einem unerträglich heißen Tag im Hochsommer auflöst. 87 88
Vgl. Hellpach, Geopsyche, S. 179. Vgl. ebd.
70 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Das affizierende Drin-Sein im vitalen Raum der Stadt
Die Geräusche breiten sich im sinnlichen Erleben der Stadt ganzheitlich aus und in keinem Nebeneinander hübsch separierter Mengen von »Sinnesdaten«, die vom Gehirn zu etwas Ganzem »zusammengesetzt« werden. Im Tohuwabohu des Chaos gerät die hörbare Stadt ebenso außer sich wie im überhitzten Straßenverkehr mit seinem ohrenbetäubenden Hupen oder im lärmenden Reißen eines Orkans, dessen Naturgewalt krachend alles umherwirft, was nicht sturmsicher an seinem Ort fixiert ist. In Vielem unterscheidet sich die tönende Stadt jedoch nicht wesentlich von X-beliebigen Landschaften und Gegenden. Was wir auf welche Weise von unserem Herum erfassen, folgt aus dem menschlichen Vermögen, sich wahr nehmend (d. h. denkend und fühlend) in der Welt zu bewegen. Und doch sind vitale Städte nicht vergleichbar mit verlassenen Dörfern, der Wüste oder einem noch so romantisch sich suggerierendes Flussufer an einem lauen Frühlingsmorgen. Städte sind sinnliche Hotspots, ekstatische Kosmen des Vielen und Zusammenstoßenden. Sie über raschen in ihrem überschäumenden Durcheinander mit Lichtungen der Ruhe, wie sie einem plötzlich in angstmachenden Strudeln gänz lich unerwarteter Getöse den Verstand rauben können. Städte sind sinnliche Sonderwelten, in denen Überraschung und Langeweile sich ganz unerwartet die Hand geben. Sie sind Dichteräume maximaler Beanspruchung der Sinne und der Aufmerksamkeit. Sie konstituieren sich in Beziehungen der Ferne wie grenzverletzender Nähe.
71 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
5. Die leibliche Qualität des Hörens
Hörend stellt sich der multisensorische Raum der urbanen Welt in anderer Weise dar als sehend. Geräusche kommen zur Erscheinung, ohne sichtbar werden. Während das Gesehene auf Abstand bleibt, dringt das im räumlich-mitweltlichen Erleben Gehörte ohne Barrieren immersiv in den Hörenden ein. Es berührt auch in anderer Weise affektiv als das Gesehene. Die visuelle Stadt bleibt »draußen« (außer halb des eigenen Körpers). Was dagegen lautlich von ihr erscheint, dringt im leiblichen Sinne – aber nicht stofflich oder organisch – in uns ein. Die Augen können mit den Augenlidern geschlossen werden, zum Verschließen der Ohren bedarf es der Hände oder technischer Hilfsmittel. Die Immersivität der Geräusche steht für eine sinnliche Reichweite des Hörens, die es beim Sehen nicht gibt. Während wir im Sehen das Nahe und Ferne relativ einfach unterscheiden können, ist das beim Hören anders. »Im Hören fällt das Moment des Abstandes fort. Ob nah oder fern, identifizierbar als ein Rascheln, Läuten, Ton einer Geige oder eines Saxophons – Ton dringt ein, ohne Abstand.«89 Die Erfassung von Schallereignissen aller Art erweist sich in der Eindringlichkeit ihrer Wahrnehmung als leiblich affizierend. Geräu sche berühren in einem aufmerkenden und betroffen machenden Verständnis des Spürens. In organischer und körperlicher Hinsicht scheinen wir in einem anderen Sinne zu hören. Dann sind es näm lich nicht Eindrücke, die unsere Aufmerksamkeit erreichen, sondern akustische Reize, die die Ohren passieren und in den neuronalen Netzen verarbeitet werden. Was hier wie da ertönt, verändert sich aber nur in einem methodologischen Fokus, mit anderen Worten: in der wahrnehmungstheoretischen Perspektive des Verstehens. Was tönt, klingt, rauscht und schallt, bleibt indes ein und dasselbe. Was wir hören, geht in anderer Weise in unser Bewusstsein ein als das, was wir sehen oder ertasten. Ähnlich dem Gerochenen ist das Gehörte im Moment seiner Gegenwärtigkeit auch schon in uns. Weil das Lautliche nicht sichtbar ist, steht es auch in einem 89
Plessner, Gesammelte Schriften III, S. 344.
73 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
5. Die leibliche Qualität des Hörens
spannungsreicheren Verhältnis zu seiner sprachlichen Explikation im Medium der wörtlichen Rede als das Visuelle. Das liegt daran, dass sich der Schall entzieht, sobald er zum Gegenstand des Bedenkens wird. Für die Aussprache muss er gleichsam im Gedächtnis arretiert, aus seinem Immer-Weiter herausgetrennt und auf eine abstrakte Bühne seiner nachdenkenden »Behandlung« verschoben werden. Im Unterschied zu visuell erfassten und in ihrem Da-Sein beharrenden, feststofflichen Dingen, existiert das Geräusch im Moment seiner Aussprache schon nicht mehr (s. auch Geräuschbeschreibung 1 in Kapitel 3).
Die Stadt und die Sinne »Der Mensch verdankt seine Existenz nur der Sinnlichkeit. Die Ver nunft, der Geist macht Bücher, aber keine Menschen. Wenn die Ver nunft, wenn der Geist Herr der Welt wäre, so existierte höchstens ein Menschenpaar«90. Was Ludwig Feuerbach Mitte des 19. Jahrhunderts über die existenzielle Bedeutung der Sinne kritisch angemerkt hatte, verstand sich eigentlich von selbst. Und doch stand es zu seiner Zeit in einer eher negativen Spannung zum mythisch überladenen Zeitgeist der Industrialisierung. Noch in der Gegenwart hat die Aussage ihre zivilisationskritisch unübersehbare Berechtigung. Sie relativiert die fragwürdige Dignität des Hochtechnischen und facht den Zweifel am kulturellen Wert der Abstraktionen an. Und sie entmystifiziert kommunikativ einflussreiche wissenschaftliche Expertenkulturen. Feuerbach sah den Segen der Menschheit aber weder in gefühlsdurch strömten Sinnenspektakeln, noch in der Hingabe an den Genuss, die Affekte und das Schöne. Er hatte die Bedeutung der Sinnlichkeit im Leben der Menschen lediglich herausgestrichen, um auf einem vernunftbasierten Wege gegen ubiquitäre Borniertheiten im Namen eines vorherrschenden Rationalismus zu Felde zu ziehen. Deshalb mündet sein Veto auch in ein Plädoyer für die Differenzierung des Denkens: »Alles sagen die Sinne, aber um ihre Aussagen zu verstehen, muß man sie verbinden. Die Evangelien der Sinne im Zusammenhang lesen heißt denken.«91 Die hochaktuelle Pointe ist offensichtlich: 90 91
Feuerbach, Wider den Dualismus von Leib und Seele, Fleisch und Geist, S. 145. Ebd., S. 150.
74 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Die Stadt und die Sinne
Wo das Denken die Gefühle ausklammert, bleibt es unvollständig und hilflos. Der Jugendstil-Architekt August Endell entdeckte im Lauten noch schöne Facetten: im Krächzen der Raben, Wehen der Winde und Brausen der See.92 Bemerkenswert an seinen poetischen Ein lassungen auf das lautliche Erleben war die Tiefe seiner in Worte gefassten Eindrücke. Im Spiegel seines leiblichen Erlebens zeichnen sie ein ganz eigenes Gesicht der Stadt. So hatte er auch nicht Szenen ekstatischen Lärms beschrieben, sondern ästhetische »Stimmen der Stadt«93, zu denen »das helle Rollen der Droschken« ebenso gehörte wie »das schwere Poltern der Postwagen, das Klacken der Hufe auf dem Asphalt, das rasche starke Stakkato des Trabers, die ziehenden Tritte des Droschkengaules […], die hallenden Schritte einsamer Fuß gänger […], das Schieben und Schurren« der wartenden Menge, die vielfältigen »Stimmen der Automobile, ihr Sausen beim Herannahen, der Schrei der Hupen, und dann, allmählich hörbar werdend, der Rhythmus der Zylinderschläge, bald rauschend, bald grob stoßend, bald fein in klarem Takte, metallisch klingend«94 usw. Geradezu frisch war die Aufmerksamkeit gegenüber der historisch noch relativ unge wohnten Mannigfaltigkeit urbaner Geräusche um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Damals war das, was wir heute unumwunden einen unerträglichen und politisch nicht hinnehmbaren Lärm nennen würden, noch positiv konnotiert, nämlich Ausdruck einer durch und durch vitalen Seite der Stadt. All die von Endell beschriebenen Geräusche sind auch für sich zu hören, sofern sich die Aufmerksamkeit dem einen wie dem anderen Tönen zuwendet. Sogleich verschmilzt es aber in der atmosphärischen Erlebnisqualität des Ortes, an dem all dies passiert. In der lebens weltlichen Wahrnehmung kommen Geräusche vor allem dann zu Bewusstsein, wenn sie als vermeidungs- oder überwindungsbedürf tiger Lärm empfunden werden. Insbesondere in der Stadtplanung und fachbehördlichen Praxis werden sie erst zu einem Thema, wenn sie den Charakter eines (potentiellen) Problems haben, ihnen also prophylaktisch etwas entgegengesetzt werden soll. Auf der einen Seite gibt es eine lebensweltlich vage Vorstellung vom »guten« Ton im Raum der Stadt bzw. der Qualität einer jedenfalls nicht 92 93 94
Vgl. Endell, Die Schönheit der großen Stadt, S. 23. Ebd., S. 24. Ebd.
75 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
5. Die leibliche Qualität des Hörens
störenden Lautlichkeit. Auf der anderen Seite der gesellschaftlichen Systeme sind die Kriterien zur »objektiven« Bestimmung nicht mehr hinnehmbaren Lärms klar definiert. Hier das unbestimmte Gefühl dessen, was dem Menschen als Hörer der Welt gut tut, und dort das scheinbar klar quantifizierbare Maximum des noch Tolerablen. Das Bundesimmissionsschutzgesetz definiert solche Obergrenzen in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift der TA Lärm (der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm). Was gut gemessen werden kann, muss nicht deshalb auch mit Worten gut beschrieben werden können. Selbst in der Literatur sind sensible Geräuschbeschreibungen eher selten zu finden. Zu begabten Sprechern gehören die Hyperästhetiker, die (wie Marcel Proust) beinahe krankhaft an Geräuschen gelitten haben. Spätestens unter dem Einfluss des alles umfassenden Rationa litätsanspruchs der Spätmoderne ist die Sensibilität gegenüber sinn lichen Eindrücken im Allgemeinen unter die Räder gekommen. In der Kompensation gesellschaftlicher Kälte und der Macht systemischer Abstraktionismen wird sie wiederum ins Esoterische gesteigert und metaphysisch verklärt. Dann mündet die von sektiererhaften Gurus begleitete Wiedergeburt »achtsamen« Hörens in eine Art Selbster fahrung vom Typ beseelter Baumumarmungen. Das »irgendwie« im Prozess der Modernisierung Verlorene soll nun für die Innerlichkeit einer heilen Welt gerettet werden – wenn die zivilisatorische Ferne zu den Sinnen schon irreversibel zu sein scheint. Wenn das visuelle Bild der Stadt in der Kommunikation über die Stadt auch das erste – allzumal kulturindustriell zirkulierende – Medium der Repräsentation ist, so kann dies doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst das bildhafte Verstehen der Stadt auf die intuitive Synchronisation aller sinnlichen Eindrücke zu einem Gesamterleben angewiesen ist. Im Fokus der Phänomenologie wie der multisensorischen Anthropologie95 gibt es deshalb auch keinen selbst- wie gegenstandsbezogenen Zugang zur Welt, der allein mit dem Sichtbaren auskäme. Wenn das Hören von Geräuschen und singulären Tönen auch unterhalb des Sehens rangiert, so darf das doch nicht über die große Bedeutung des Nichtsprachlichen in der Wahrnehmung der Welt hinwegtäuschen. Im täglichen Leben ist das Hören neben dem Sehen von ebenbürtiger Bedeutung. Mehr noch in verschiedenen Bereichen der Ästhetik wie der Musik, welche das tagtägliche Dahinleben in 95
Vgl. Diaconu, Sinnesraum Stadt.
76 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Geräusch und Bewegung
seiner tristen Serialität der Abläufe durch die Gabe lustvoll erlebter Ablenkung entlastet und betäubt. Zum Problem werden gerade in Situationen des Musikhörens laute und sehr laute Geräusche. Jedoch weniger die, die man selbst macht, als die der anderen. Die sprich wörtliche »Zimmerlaustärke« macht eine Grenze des Anstandes denkwürdig, deren Einhaltung das ungestörte Wohnen aller garan tieren soll. »Zimmerlautstärke« ist jedoch keine objektivier- und quantifizierbare akustische Quantität. Zwischen Geräusch und Lärm ist nicht einfach zu unterscheiden. Die Differenz entsteht im sozialen Miteinander, als Resultat praktisch gelebter Rücksichtnahme.
Geräusch und Bewegung Zur Illustration der leiblichen Dimension des Hörens wird an dieser Stelle die Beschreibung lautlicher Eindrücke des Besuchs einer Kunst halle folgen – eines typisch städtischen Ortes. Ich werde auf diese auch zurückkommen, um die Ausführungen zum lautlichen Stadt-Erleben mit Hilfe einiger leibphänomenologischer Überlegungen zu konkre tisieren. Geräuschbeschreibung III: Kunsthalle96 Es gibt in meiner aktuellen Umgebung kein Grundgeräusch, das den Raum lautlich rahmt. Ein paar raschelnde Stimmen, hier und da ein Flüstern, ein Knacken von irgendwo, ein paar Schritte, die man nur an ihrem leisen Bodenkontakt hört. Das äußerst dezente auditive Muster einer hintergründigen Schritt-Folge lässt eine geräuschhafte Klangat mosphäre im Raum entstehen. Geräusche von Schritten geben sich nie an sich zu erkennen, sondern stets in einem bestimmten Habitus – zum Beispiel eines schleifenden Gehens, wobei die Füße schleppend, zögerlich und mit nur leichtem Bodenkontakt voreinander gesetzt werden. Das auditive Drin-Sein im Raum wird vornehmlich durch unterschiedlich leise Geräusche bestimmt – meistens von Schritten: - Schleichend-schwebende Gänge, die »zwischen« Hören und Sehen vernehmbar sind. Zu sehen sind sie eigentlich nicht, wenn man Kunsthalle Henri Nannen, Emden 13:40 – 14:15h. Ca. 200 m2 großen Saal mit Gemälden bekannter Maler der Klassischen Moderne; Ende Oktober 2020, zwei Tage vor einem seuchenbedingten landesweiten Lockdown u. a. für öffentliche Einrichtungen wie Museen und Theater ist der Publikumsverkehr noch gering bis normal. 96
77 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
5. Die leibliche Qualität des Hörens
nicht danach Ausschau hält, wo das kaum Hörbare herkommt. Zu hören sind sie eigentlich ebenso wenig, weil die Bodenkontakte eher schwebend als »hart« sind. So kommen immer wieder Menschen mit beinahe »lautlosen« Schritten in den Raum. - Anscheinend zielstrebig durch den Raum hindurchgehende Schritte. Sie folgen weder zufällig noch intuitiv einem hörbaren Pfad, eher gehen sie einer scheinbar exakt vorgezeichneten Route entlang – im Unterschied zu jenen dahinschlendernden Gehern mit ihren Hüten, Jacken und kleinen Handtaschen. - Schritte, die wie ein Subjekt vor einem Gemälde innehalten – Schritte wie Persönlichkeiten. Sie werden weniger (von hier nach da) »gegangen«, wie man einen worauf auch immer hin orientierten Weg geht. Es gibt Schritte und Schrittfolgen, die nicht durch den Raum gehen, sich vielmehr in ihm bewegen. Das sind Schritte, die im Prinzip gar nicht vorwärts-gehen, sich vielmehr zäh von einer Stelle zur anderen schieben, auf der Stelle drehen, hin und her wiegen oder sich gegeneinander versetzen. Sie sind so leise, dass bestenfalls ein fast lautloses Wischen auf dem Parkett zu hören ist. In der Art und Weise, in der sie gesetzt werden, lassen sie sich auch als Gesten verstehen, die nur einer Bewegung folgen, die ganz unter der Macht des ästhetischen Blickes steht, der die kontemplative Erbauung sucht. - Gummisohlen setzen so leise und gedämpft auf dem Holzparkett auf, dass man sie für gänzlich lautlos halten könnte. Eine Ledersohle klingt anders, härter – manchmal etwas kratzend, als wäre noch ein Rest Sand oder Erde darunter – jedenfalls so lange, wie die Schuhe sich beim Gehen durch die Säle noch nicht saubergelaufen haben. - Schritte, die nun wieder anders leise sind – als würden sie mit Pantoffeln über das Parkett geschoben – so, wie jemand sich in der dunklen Nacht zwischen den Möbeln seiner Wohnung unsicher vorwärtsbewegt, halb sehend, halb tastend. - Die Schritte der Aufseher klingen anders; sie streben kein Ziel an, wie die derer, die durch den Saal gehen, um woanders hin zu gelangen. Die Wächter gehen unregelmäßige Kreisbahnen, mal nach links, nach rechts, nach vorne oder nach hinten, schließlich drehen sie sich auf der Stelle, um dann doch – wie von einem rätselhaft bleibenden Entschluss angestoßen – offensichtlich oder auch nur scheinbar irgendwo hinzugehen. - Bei manchen Personen drängen sich »orthopädisch-podologische Impressionen« auf; wenn eine Schrittfolge z. B. eine »Unwucht« zu erkennen gibt. Zwei paarweise zusammengehörende Füße und Beine
78 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Geräusch und Bewegung
erscheinen, als gehörten sie nicht zusammen. Diese Ungleichheit gibt sich manchmal deutlich zu hören. Jeder Schritt drängt sich wie ein Quasi-Individuum auf. Der eine Fuß setzt mit einem klaren Ton auf, der zweite folgt mit einem leicht schleppenden Schleifen – oder andersherum. Es gibt viele Varianten enharmonischer Rhythmen des Gehens, Stehens und Sich-Voranschleppens. Die meisten dürften ungehört bleiben. - Gleichsam unterhalb einer gewissen Schritt-Choreographie wird (zumindest im ruhigen, wenn nicht sogar beinahe stillen Raum) sogar das Stehen als Innehalten einer Bewegung zwischen zwei Schritten hörbar. Während der eine noch nachklingt, tönt der (irgendwann folgende) andere schon in der Erwartung vor. - Es ist, als wäre die Kunsthalle ein Raum der Schritte, in dem das Visuelle vom Milieu der Lautlichkeit kontrastiert würde. Immer und immer wieder lange Pausen, in denen niemand den Saal betritt, durchschreitet oder vor einem Gemälde stehen bleibt. In diesen Momenten breitet sich jenes Nichts aus, in dessen Fülle sich der Raum zwischen den Schritten zu Gehör bringt. In solchen Zwischenzeiten hebt sich ein geradezu hörbares Raumgefühl hervor – ein leeres Rauschen. Es ist eine große Leere, die sich ebenso plötzlich mit etwas kaum Hörbarem füllt, wie sie sich ausdehnt: ein ferner Ton aus einem anderen Saal, das Rauschen der eigenen Atmung. Diese raren Laute sind wie Alarme, die anzeigen, dass »draußen« weitgehende Ruhe herrscht. Wenn scheinbar nichts ist, rettet sich das Gefühl der Leere ins Hören eines diffusen Brummens, das das Vakuum eines »Nichts« im Raum füllt und spürbar macht. Es mag mal der defekte Kondensator einer Neonleuchte hinter einer Decken verkleidung sein und dann wieder ein im Hintergrund sich bemerkbar machendes technisches Gerät – ein Aggregat, das sich an scheinbar nichts abmüht – oder ein metallenes Klingen, das (trotz geringer Laustärke) wie ein Pfeil in die relative Lautlosigkeit hineinfährt. Es ist dann einfach. Mehr noch ist und war es, ohne dass dabei die Frage eine nennenswerte Rolle spielen würde, woher es kommt oder kam. Geräusche machen in diesen Sälen jedoch meistens Menschen und nicht Apparate. Darin erinnert in der gewöhnungsbedingt bereits einverleibten Ruhe auch eine als relativ laut empfundene Stimme, die »tatsächlich« (objektiv betrachtet) eher leise sein dürfte. Den Blick zieht sie nur wegen ihrer Eigenart auf sich. Eine ältere Frau dirigiert ihren männlichen Mit-Geher mit schneidenden Worten an ein nicht erkennbares Ziel in einem anderen Saal – leise aber entschlossen. Es
79 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
5. Die leibliche Qualität des Hörens
muss der untrüglich diktatorische Ton sein, der aus dem Spektrum des gewohnten Ruhe-Pegels ausbricht und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ähnliche Bedürfnisse des Hinsehens wecken andere Bewegun gen nicht. Meistens sieht man eher schemenhafte Bewegungen von »vorbeischwebenden« Personen, ohne sie auch zu hören. Wenn diese wie aus dem Nichts plötzlich stumm hinter einem stehen, fragt man sich intuitiv nach den dazugehörigen Geräuschen. Geräusche treten in der Beschreibung mehrheitlich als Ausdruck kör perlicher Bewegungen in den Fokus der Aufmerksamkeit. Die Skizze bietet sich insofern für die Illustration der Leiblichkeit lautlichen Erlebens an, als sich die situative Besonderheit der überwiegend leisen Geräusche darin zeigt, dass sie in keinem semiotischen Sinne »gelesen«, sondern in einem nachspürenden Sinne atmosphärisch erlebt werden. Ihr Verstehen (z. B. als diese oder jene Bewegung) setzt das ganzheitliche Bemerken lebendiger Personen voraus und nicht das Decodieren akustischer Reize. Das eine leise Geräusch ist nämlich nicht identisch mit dem anderen leisen Geräusch, noch nicht einmal dann, wenn beide (nach Dezibel gemessen) gleich laut sind. Ein leises Geräusch kann leise sein, weil die von einer Person ausgeführten Schritte voller Bedacht und absichtlich leise gesetzt worden sind. Es kann aber auch genauso leise sein, weil die Schuhsohlen eines Vorübergehenden so weich sind, dass das Gehen einem lautlosen Schweben ähnlich ist. Der niedrige Geräuschpegel in den Sälen der Kunsthalle ist in aller Regel Ausdruck situationsan gemessenen Gehens, Sich-Bewegens und Sprechens. Die Menschen gehen ausnahmslos leise, weil es in einer Kunsthalle üblich ist, zur Vermeidung störender Geräusche grundsätzlich leise zu sein. So drückt sich der Charakter des Hauses u. a. in Bedeutungen aus, die an die Einverleibung dieses ungeschriebenen Gebotes appellieren. Das präsentative Museums-Programm impliziert einen Imperativ auditiv situationsgerechten Da-Seins. Die beispielhafte Beschreibung zeigt aber auch, dass es nicht nur eine Art gibt, leise zu gehen, sondern viele. Indem nun alle Menschen leise sind, prägen sie gestaltvielfältige Bewegungsmuster. Diese finden in der Fokussierung des Hörens insofern die herausgehobene Aufmerksamkeit, weil sie in der lebens weltlichen Fassung des Alltages nur ausnahmsweise vorkommen. Das Hören mündet also infolge einer »Auffälligkeit« im Vergleich zum alltagstypischen Gehen in ein sich differenzierendes Hin-Hören. Darin finden weniger die Lautstärken der Schritte Beachtung, als die habituelle Verankerung von Bewegungen in leisen Zwischen-Tönen.
80 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Geräusch und Bewegung
Was sich eher atmosphärisch als akustisch zu hören gibt, ist Spie gel einer sich im Medium der Leiblichkeit ausdrückenden Haltung zur Situation der Kunsthalle. Auch das Verstehen der Bewegungs rhythmen und -muster verdankt sich eher des leiblichen Spürens von Bewegungen als des »Lesens« von Bedeutungen, die aus leisen Schritten erst interpretiert werden müssten. Deshalb können die Bewegungen von Individuen, Paaren oder Gruppen auch weder allein als (allokative) Fort-bewegungen verstanden werden, noch allein als auditive Gestalten. Bewegung ist Moment ganzheitlichen personalen Ausdrucks, und so stellt sie auch eine Haltung dar, eine Gestimmtheit und eine habituelle Fassung (s. auch Anmerkung zum Schmitz´schen Konzept der »leiblichen Kommunikation« in Kapitel 2). Schließlich verweist noch das Hören lautlicher »Pausen« zwi schen dem Eintreten weiterer Personen auf die Leiblichkeit der Wahr nehmung. Ein lautliches »Nichts« wäre im akustischen Sinne (mit den Ohren) ja gar nicht hörbar. Gleichwohl ist es – wie die absolute Ruhe bzw. Lautlosigkeit – im atmosphärischen Spüren der Vitalqua lität eines Raumes vernehmbar. In allen Facetten der skizzenhaften Eindrucksbeschreibung korrespondiert die Wahrnehmung mit dem leiblich-spürenden Mit-Sein im Raum. Sie ist nicht Ertrag dessen, was die einzelnen Sinne vernommen haben. Die Wahrnehmung erfasst vielmehr Situationen, in denen sich Menschen bewegen; sie reißt die Bewegung aus jenem Ganzen nicht heraus, zu dem sie gehört. Das ist kein Hören im organischen Sinne. Die Leiblichkeit des Hörens macht David Espinet auf jener Umschlagsschwelle fest, auf der sich die Sinnlichkeit des Hörens ins Verstehen des Gehörten überträgt.97 »Die sinnliche Seite der Ereignishaftigkeit des Hörens bedingt den Leib.«98 Zwar setzt das Hören das Organ des Ohres voraus. »Ohren haben wir aber auch […], weil wir auf das Lied der Erde hören dürfen.«99 Akustisches Hören ist also nur Bedingung sensibel verstehenden und emotional berührenden Hörens. Mit den Ohren können wir noch das Unverständlichste hören, etwas, das wir gar nicht begreifen und deshalb Schall bleibt. Über das im engeren Sinne organische Hören-Können hinaus erfüllt das Hören seine exis tenzielle Aufgabe erst im erkennenden, verstehenden, begreifenden und nicht zuletzt im empathischen Hören. 97 98 99
Vgl. Espinet, Phänomenologie des Hörens, S. 211. Ebd., S. 215. Ebd., S. 217.
81 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
5. Die leibliche Qualität des Hörens
Was bedeutet die Rede von der Leiblichkeit des Hörens ange sichts der Tatsache, dass der Mensch nicht nur ein leibliches, sondern ebenso ein körperliches Wesen ist? Die Sache hat schon darin ihre Tücken, dass die »wahre Crux der Leiblichkeit« durch »ihre Verschrän kung in den Körper«100 gekennzeichnet ist. Unter dem »eigenen Leib eines Menschen« versteht Hermann Schmitz, was ein Mensch »in der Gegend seines Körpers von sich spüren kann, ohne sich auf das Zeug nis der fünf Sinne«101 zu stützen. Der Leib ist »unteilbar flächenlos ausgedehnt als prädimensionales […] Volumen, das in Engung und Weitung Dynamik besitzt.«102 Gefühle werden als etwas am eigenen Selbst wahrgenommen und nicht als etwas davon, nicht wie die Finger als Teile der Hand. Im Modus der Betroffenheit erfährt sich eine Person im Spiegel eigener Gefühle, ganz gleich, wo sie herkommen. In ihrer Geräuschhaftigkeit affiziert die Stadt in ihren begehbaren Räumen in anderer Weise als ihre ikonographische Widerspiegelung in glamourösen Bildern. Leibliches Mit-Sein setzt sinnliche Vitalität voraus und damit die lebendige Aufmerksamkeit aller Sinne. Dabei kommt es weniger auf das Vermögen der einzelnen organischen Sinne an, als auf das konzertierte Zusammenspiel aller. Diese Synchronisie rung sieht Friedrich Nietzsche im Vermögen des Leibes: Der »Leib ist eine große Vernunft, eine Vielheit mit einem Sinne«103. Den Leib stellt er als eine Weiche heraus, auf der die Eindrücke aller Sinne nach Maßgabe sinnstiftender Bedeutungen zu einem Eindrucksgan zen abgestimmt und verfugt werden. Im Leib-Sein verbinden sich die sinnlichen Eindrücke und die damit verbundenen Gefühle mit selbst- wie weltbezogenen Referenzen. Hören stellt sich bei Hermann Schmitz als ein Modus leiblicher Kommunikation dar. Im Kontakt mit der eindrücklich werdenden Welt sind wir mit allen Sinnen nur unter anderem hörend. Im Medium der Leiblichkeit überschreitet sich das Hören jedoch autopoietisch zugunsten einer spürenden Erfassung akkordartiger Ganzheiten. »Leiblich ist, was jemand in der Gegend (keineswegs, wie z. B. am Blick deutlich wird, immer in den Grenzen) seines materiellen Körpers von sich selber (als zu sich selber, der hier und jetzt ist, gehörig) spüren kann, ohne sich der fünf Sinne (Sehen, Tasten, Hören, Riechen, Schmecken) und des aus ihrem Zeugnis 100 101 102 103
Plessner, Gesammelte Schriften III, S. 368. Schmitz, Der Leib, der Raum und die Gefühle, S. 12. Ebd., S. 12f. Nietzsche, KSA, Band 4, S. 39.
82 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Der sinnliche Stoff des Hörens
abgeleiteten perzeptiven Körperschemas (der habituellen Vorstellung vom eigenen Körper) zu bedienen.«104 Schmitz versteht das Verneh men der fünf Sinne deshalb auch nicht als Summe einzel-sinnlicher Vermögen. Die Sinne sind korrespondierende Sensoren ganzheitlich spürenden Mit-Seins in einer den Sinnen zugänglichen Welt. Wenn es in diesem Buch dennoch um die Geräusche und die lautlich vernehmbare Stadt geht, so doch stets im Rahmen der Simul tanität der Sinne. Simultanität setzt eine Verbindung zu etwas voraus, das es gewissermaßen zweifach gibt: erstens als Verbindung zu einem Ganzen, in dem das Hören (wie das Sehen, Riechen etc.) fokussiert wird, und zweitens als Verbindung mit einem Ganzen, in dem die Eindrücke der einzelnen Sinne schon synchronisiert sind. Man kann einen turbulenten innerstädtischen Patz in seiner sinnlich-pluralen Atmosphäre spürend erfassen; man kann aber ebenso hin-hörend wahrnehmen, was er uns lautlich gewissermaßen »im Einzelnen« zu hören gibt. So riechen wir die Gewürze an einem Marktstand, so hören wir das städtische Treiben der Menschen und so ertasten wir das vom Regen rutschige Pflaster durch die Sohlen der Schuhe hindurch. Das alles spüren wir zugleich im akkordartigen Gesamteindruck eines Ortes, dann jedoch eher hintergründig als prägnant. Wie Geräusche, Laute, Töne und Klänge in einer tatsächlichen Welt gemacht werden oder sich ereignen (wie das Rauschen des Windes), so gründet auch ihr lautliches Erleben nicht nur in subjektiven, sondern ebenso in objekthaften Facetten des Wirklichen. Im Erleben von Geräuschen, Gerüchen, grellen Lichtern und grauen regenschweren Wolken situ ieren sich die Menschen über ihre Eindrücke in sich selbst wie in ihrer Welt.
Der sinnliche Stoff des Hörens Helmuth Plessner schreibt dem Lautlichen eine gewisse Stofflichkeit zu. Das verwundert insofern, als alles, was man hören kann, doch von einer Nichthaftigkeit ist und durch Flüchtigkeit wie Immersivität beeindruckt. Wenn er weiter anmerkt, der »optische Stoff muß […] flächig erlebt werden, […] der akustische Stoff […] räumig«105, so 104 105
Schmitz, Der Leib, S. 5. Plessner, Gesammelte Schriften III, S. 233.
83 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
5. Die leibliche Qualität des Hörens
wird deutlich, dass mit Stofflichkeit hier eine dem atmosphärischen Schall eigene voluminöse Ausdehnung gemeint ist. Atmosphärischstofflichen Charakter haben in der obigen Eindrucksbeschreibung u. a. die Geräusche von Schritten, die in der beinahe lautlosen Art ihres Vorüberwischens etwas von der habituellen Präsenz Anwe sender zu spüren geben. Dieser »akustische Stoff«106 ist in seiner Räumlichkeit gegenwärtig, aber nicht in irgendeiner Materialität. Die spezifische Voluminösität lautlicher Eindrücke beschreibt Plessner so: »Der Schall schwillt im Hallen dahin, und dieses charakteristische »dahin« zeigt schlagender als alle umständliche Beschreibung, was mit Dehnung und Volumen des akustischen Stoffes gemeint ist.«107 Plessner hatte in diesem Punkt ein anderes Verständnis der Geräusche als Johannes Volkelt, der ihre Stofflichkeit an der Materialität der Dinge erkannte, von denen die Laute kommen. »Beim Hören kommt dieses Stoffliche nur in mittelbarer Weise, gleichsam von fern in Betracht. Nur indem wir die gehörten Töne unwillkürlich oder mit Überlegung auf Körper beziehen, von denen sie ausgehen, entsteht uns ein gewisser Eindruck des Stofflichen.«108 Dies ist aber eine »von fern in Betracht« kommende Stofflichkeit, auf die der Schall nur symbolisch verweist. Damit denkt Volkelt die Stofflichkeit des Schalls als etwas, das nur existiert, weil es zu etwas (hier einem feststofflichen Gegenstand) hinzugedacht wird. Dabei dürfte er übersehen haben, dass nicht alles Lautliche in Gegenständen seine Quelle hat. Beispiele für Geräusche, die in sich selbst (in ihrer Halbdinghaftigkeit) ganz aufgehen, sind der rauschende Wind, der Donner des Gewitters und das Zischen seiner Blitze.
Mit Scharf- und Tiefsinn hören Die Allgegenwart komplizierter technischer Geräte verlangt nur auf den ersten Blick das Hören-Können von Zwischentönen und lautli chen Nuancen. Tatsächlich verstehen sich die perfekten Dinge der technisch hergestellten Welt heute – jedenfalls in der Welt der Laien – von selbst, oder sie werden in Texten, Bildern und Videos so hinreichend beschrieben, dass sie keine besonderen Ansprüche an ihr 106 107 108
Ebd., S. 229. Ebd., S. 232. Volkelt, System der Ästhetik. Band I, S. 494.
84 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Mit Scharf- und Tiefsinn hören
Verstehen mehr stellen. Das Hören-Können beschränkt sich auf das »einfache« Verstehen technischer Geräusche; differenzorientiertes Hören ist Sache von Experten. Die sinnlich spezialisierte Kompetenz genauen Hörens wird unter solchen Bedingungen beinahe zu einem elitären Bildungsprojekt. Dies umso mehr, als differenzfreudiges Hören nicht die Erfassung akustischer »Reize« verlangt, sondern die Fähigkeit und Bereitschaft zum ausdauernden und genauen HinHören, zum Zuhören und Horchen auf Nuancen, zum Achten auf feine Unterschiede zwischen ähnlichen Tönen und Klängen, auf dass im Ganzen des Vernommenen Denkwürdiges erschlossen werden kann. Es gibt »von Erwartungen geprägtes Horchen«109 (wie in der obigen Beschreibung der in der Hörerwartung schon vortönende »nächste« Schritt einer Person), aber auch das irritierte Horchen, das noch nie Gehörtes erst Schritt für Schritt an sich heranlässt, um es schließlich im intuitiv hörenden Verstehen110 mit schon ein verleibtem Hörwissen in Beziehung setzen zu können (wie in der obigen Beschreibung der Eindruck einer »Unwucht« in der Schritt folge einer gehbehinderten Person, die vom erwarteten lautlichen Muster abwich). Solches Hören-Können von Neuem, das Sich-Finden in noch unvertrauten Höreindrücken unterscheidet sich vom lebensweltlich gewohnten Hören, das keiner Spezialisierung bedarf. Im phänome nologischen Fokus kommt es aufs Hinhören an, auf das, was in der segmentierenden Aufmerksamkeit in einer ganz eigenen lautlichen Wirklichkeit erscheint – wie die ziehenden Tritte des Droschken gaules in Endells Beschreibung oder die schleichend-schwebenden Gänge, die »zwischen« Hören und Sehen im Ausstellungssaal einer Kunsthalle vernehmbar werden (s. oben). Deshalb setzt das aufspü rende Hören zwei Kompetenzen voraus: Scharfsinn und Tiefsinn. Beide sind nicht leicht zu trennen, hängen vielmehr an- und inein ander. Der Scharfsinn wurzelt im verstandesmäßigen Können. Er impliziert das »Vermögen, die Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit der Dinge zu bemerken«111. Auf andere Weise überschreitet der Tiefsinn die gewöhnliche Aufmerksamkeit. Wenn er dem Scharfsinn in der Schärfe der Aufmerksamkeit auch ähnlich ist, so richtet er sich
109 110 111
Winkler, Landschaft hören, S. 4. Ebd. DWB, Band 14, Sp. 2199.
85 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
5. Die leibliche Qualität des Hörens
doch eher auf die Wahrnehmung von Gefühlen.112 Romano Guardini spricht von einer tiefen »Beziehung zur Fülle des Daseins«113. Zur rational wachen Präzision des Scharfsinns kommt die pathische Sen sibilität des Tiefsinns. Etwas muss zum einen als dieses oder jenes gehört, zum anderen aber auch nach atmosphärischen Zwischentö nen unterschieden werden. Das Gehörte berührt über das Ohr den befindlichen Leib und über das damit geweckte Gefühl das pathische Mit-Sein. Etwas Lautes oder Leises ist als Lautes und Leises in seiner Sache noch nicht gehört und verstanden. Das wird es erst in der situationsbezogenen Differenzierung des »im« Lauten und Leisen Hörbaren, u. a. im Heraus-Hören des Wie und Was des Lauten und Leisen. Hören-Können ist eine spezielle Form der Aufmerksamkeit, die etymologisch von achten kommt. Deshalb hießen die Schöffen Ende des 18. Jahrhunderts Achtsmänner114. Sie mussten auf alles achten, um ein gerechtes Urteil finden zu können. Was sie nicht »in acht nahmen«115, fiel ihnen »aus der acht«.116 In der zeitgemäßen Sprache klingt die nicht selten esoterisch aufgeladene Floskel der »Achtsamkeit« dagegen nach einem geradezu erleuchteten Vermögen mystischen Sehens. Hier soll der Begriff als eine Form von Aufmerk samkeit verstanden werden, bedeutet Achten-auf doch prinzipiell nichts anderes als geschärftes Aufmerken. Wer etwas seine Aufmerk samkeit schenkt, kommt ihm mit einer gewissen »Hochachtung«117, »Aufacht«118 oder Achtsamkeit entgegen (vgl. auch den Hinweis auf das hörende Sehen in der obigen Beschreibung). Indem August Endell den »Rhythmus der Zylinderschläge, bald rauschend, bald grob stoßend, bald fein in klarem Takte, metallisch klingend«119 erlebt, hört er subjektiv, was es gibt. Das weist manchmal Unterschiede zu dem auf, was andere von demselben Ereignis hören. Ein jedes Individuum ist durch seine Biographie für ein bestimmtes Wahrnehmen geprägt. Kein Mensch kann etwas im Allgemeinen hören, geschweige denn so »wie es ist«. Und doch gibt es strukturelle 112 113 114 115 116 117 118 119
Vgl. ebd., Band 21, Sp. 493. Guardini, Übermaß der Lebensflut, S. 128. Vgl. DWB, Band 1, Sp. 166. Ebd., Sp. 165. Ebd. Ebd., Sp. 169. Osman, Kleines Lexikon untergegangener Wörter, S. 35. Endell, Die Schönheit der großen Stadt, S. 24.
86 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Dispositionen des Hörens
Ähnlichkeiten in dem, was und wie die Menschen hören. Um die Offenlegung dieser strukturellen Schnittmengen geht es der Phäno menologie, weniger um die Tiefenanalyse nur individuell beliebiger Hörpräferenzen. Das sinnliche Erleben von Geräuschen, Tönen, Klän gen und Lärm ist schließlich von Bedingungen abhängig, die mit dem situativen Erscheinen auf der Objektseite zu tun haben. Nicht nur die dahinziehenden Wolken und das fließende Wasser sind in Bewegung, auch die scheinbar fixen Dinge bewegen sich und sind dabei zu hören. Ein Felsen sieht im Licht der Morgensonne anders aus als im Mondschein oder bei einem prasselnd niedergehenden Gewitterschauer. Eine Landschaft (noch die der Stadt) erscheint bei hoher Luftfeuchtigkeit und -temperatur anders als in trockener Kälte, in der lauen Böe anders als im tobenden Sturm und bei totaler Windstille, bei Regen anders als im Schnee usw. Schließlich wirkt auf der Seite der Architektur die Schwingungsfähigkeit der Materialien auf das Erleben eines Raumes ebenso ein wie die Art und Weise, in der die Bauten errichtet worden sind (offene oder geschlossene Bauweise), bis hin zu den Schluchten zwischen den Hochhäusern und den Grünräumen innerhalb der Bebauung. Was so oder so zur Erscheinung kommt, erfassen wir in einem sinnlichen Rahmen, in dem alle Eindrücke ineinandergreifen. Bewegung gibt es auch als wechselhaftes Erscheinen und in Gestalt emotionaler Bewegt-heiten. Nicht jede Bewegung macht also Geräusche. Die hoch am Himmel dahinziehenden Wolken bewegen sich lautlos. Andere Bewegungen können wiederum extrem laut sein, wie der durch das enge Tal donnernde Güterzug. Insbesondere sind hier jene Unterschiede zu bedenken, nach denen sich Dinge anders als Halbdinge bewegen.
Dispositionen des Hörens Auf der Subjektseite variiert die Aufmerksamkeit gegenüber sinnli chen Eindrücken mit dem Wandel der Stimmung einer Person sowie vor dem Hintergrund ihrer Sozialisation. Aufmerksamkeiten haben ihre Quellen und Ressourcen, aus denen sie sich energetisch speisen. Sie können für das Erscheinen von Dingen und Situationen sensibi lisieren, aber auch durch Desensibilisierung abgetötet werden. Das Hören wird ebenso durch die Tageszeiten disponiert wie durch die Rhythmen der gelebten Zeit. Es ist ein außerordentlich komplexes Bedingungsgefüge, das uns gut oder schlecht hören lässt, dieses oder
87 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
5. Die leibliche Qualität des Hörens
jenes, das eine genau, das andere gar nicht. Kinder, die kontinuier lich hohem Umgebungslärm ausgesetzt sind (in und außerhalb der Wohnung), hören anders und anderes als solche, die schon in frühen Lebensjahren gelernt haben, die vielen Rufe der Singvögel zu unter scheiden. Junge zukunftsorientierte und erwartungsvolle Menschen hören Neues aufgeschlossener als alte Menschen, die vielleicht gar nicht mehr viel hören wollen. Die Sensibilität gegenüber spezifischen Quellen des Hörens muss erlernt werden. Dabei stellt die Unterschei dung von Vogelstimmen andere Anforderungen als die von Motoren. Die Gewohnheiten des Hörens und des Hören-Müssens, etwa des Permanent-Lauten (z.B. beim Wohnen in der Einflugschneise eines Flughafens), können die Motivation zum Hören des Leisen zunichte machen. Letztlich sind es persönliche Situationen, die ein Individuum für das bewusste Vernehmen des Hörbaren auf- oder verschließen. Dabei sind die Spektren auditiver Sensibilität durch die historische Zeit und den Stand der technischen Zivilisation bedingt. Folglich »schwimmen« die Individuen in den perzeptiven Mustern ihrer Welt erfassung in einem Strom von Veränderungen, der im Laufe ihrer gesamten Biographie in Bewegung bleibt. In diesem Sinne merkte Ludwig Klages an: »Derselbe Weltausschnitt bekommt für dasselbe Tier, eingerechnet den Menschen, ein andres und wieder andres Gesicht, je nachdem es jung oder alt ist, gesund oder krank, hungrig oder satt, frisch oder schläfrig; ferner je nachdem ihm die männliche oder die weibliche Haltung gemäß; ferner je nachdem es sucht oder flüchtet oder jagt oder kämpft oder spielt; ferner je nachdem es im Zustande der Erwartung oder Gleichgültigkeit oder Furcht oder Freude oder Niedergeschlagen heit usw. befindlich; endlich gemäß den von Fall zu Fall nach Grad und Artung verschiedenen Lebensvorgängen, zu denen der fragliche Weltausschnitt oder ihm ähnliche Bilder früher bereits den Anlaß gege ben.«120
Wer das Haus nur noch mit Ohrhörern verlässt und sich »zwischen« der musikalischen Dauerbeschallung und dem vielleicht tristen Raum monotoner Stadtstraßen bewegt, ist der sinnlichen Wahrnehmung der Welt in anderer Weise entzogen als ein gebrechlicher Greis, der beinahe taub ist, weil die Lebenskräfte schon begonnen haben, ihn zu verlassen.
120
Klages, Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck, S. 62.
88 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Akustische Reize versus lautliches Hören
Akustische Reize versus lautliches Hören Alles was uns als Hörbares mental und affektiv erreicht, wird »zunächst« im physiologischen Sinne mit dem Ohr aufgenommen und in neuronalen Netzen verarbeitet. Ohne körperlich gesundes Ohr kein Hören. Es macht aber einen großen Unterschied, ob das Hören naturwissenschaftlich oder phänomenologisch interpretiert wird, ob von komplexen physiologischen Erregungsmustern121 die Rede ist oder von einem situationsverwurzelten, affizierenden Erleben, das auf dem Wege der Synästhesien die Grenzen der einzelnen Sinne überspringt. Im lautlichen Wahrnehmen ist das physiologische OhrOrgan nicht alles. Wie könnte sonst die akustische Leere als eine atmosphärische Eindrucksqualität »gehört« werden. Deshalb ist in der obigen Skizze zum Geräuscherleben vom »Vakuum eines ´Nichts´ im Raum« die Rede. Neurologisches Hören und lautlich-atmosphärisches Hören sind zwei Seiten einer Medaille. Weder ist die eine die bessere als die andere, noch lässt sich die eine durch die andere ersetzen. In der »Nützlichkeit« einer erkenntnistheoretischen Methode drückt sich die Perspektive aus, etwas in den Blick zu nehmen. Auch in den komplexen Geräuschen der Stadt gibt es Töne, die nicht das auf merksame Hinhören herausfordern, sondern lediglich ein neuronales Registrieren verlangen, wie eine adäquate Reaktion von der Qualität des Pawlow´schen Reflexes. Technische Signale wie das Heulen einer Sirene, das Hupen von Bussen oder das Piepsen der auf Grün schal tenden Ampel wollen weder belauscht noch erlebt werden. Sie dienen allein der deterministischen Weckung von Aufmerksamkeit. Sie sind nicht mehr als akustisch-physikalische Signale. Dennoch verdankt sich auch deren Registrierung des Anspringens einer emotionalen Erregung, wird doch durch einen Alarm nur geweckt, wer leiblich auch berührbar ist – wenn auch auf einem niedrigen Niveau. Auch ein noch so einfaches Signal kann sein Ziel nur erreichen, wenn es den »richtigen« Ton trifft und das »richtige« Situationsverstehen bewirkt. Damit wird selbst die Frage des industriellen Geräuschdesigns im phänomenologischen Blick relevant. Ein »harter« Ton klingt nicht nur anders als ein »weicher« und ein »spitzer« ist etwas anderes als ein »runder«. Sie geben sich in jeweils spezifischer Weise anders zu 121
Vgl. Wirtz, Dorsch – Lexikon der Psychologie, S. 119.
89 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
5. Die leibliche Qualität des Hörens
verstehen (s. auch die Anmerkungen zum Design von technischen Autogeräuschen in Kapitel 2). Das Hören-Können mit den Ohren sieht die Natur des Menschen schon vor. Wie das Sehen und Riechen hat es – in Relation zu den anderen sinnlichen Wahrnehmungsvermögen – eine zivilisationshis torisch wechselhafte Rolle gespielt. Gutes Hören bedeutet in der Spätmoderne etwas anderes als zu Urzeiten des Menschen. Bedroh liche Laute natürlicher Feinde wie Wolf und Bär muss im urbanen Leben der Gegenwart kein Mensch mehr erkennen können. An die Stelle existenziell überlebenswichtiger Hörkompetenzen ist das kontemplative und ästhetische Hören medialer Unterhaltungs- und Vergnügungswaren getreten (allen voran der Produkte der Musikin dustrie). Systemisch relevantes Hören (z. B. von Geräuschen defekter Maschinen) wird mehr und mehr durch optische Anzeigen oder spezielle Sensoren ersetzt. Auch deshalb kann der auditive Modus der Welterfahrung nach wechselnden Trends und Moden kulturell neu belegt werden. Wenn die unterschiedlichsten Signale in der technologisch hoch gerüsteten Welt auch in den Geräuschen der Stadt aufgehen, so sind sie in deren Gemengelage doch weniger Signale als auditive Falten im Gesicht einer facettenreichen Gesellschaft. Als Signale emittierte Zeichen (z. B. das Martinshorn eines Streifenwagens) gehen im ganz heitlich vernehmbaren atmosphärischen Klangteppich der Stadt auf, wenn sie auch gemacht werden, um aus diesem herauszuragen. Es gibt den schrillen Ton des Streifenwagens für sich und im lautlichen Gemenge der mit Geräuschen gesättigten Stadt. Und es gibt das darauf bezogene leibliche Aufschrecken. Die Affektion erzeugt den Affekt. Georg Picht merkt an, wir »müssen die »Affektionen« unserer Sin nesorgane und die »Affekte« des Gemüts als Einheit«122 betrachten. Damit setzt er sich vom Wahrnehmungsphysiologismus ab, wonach (wie schon um 1900 z. B. bei Eduard von Hartmann zu lesen) ein Ton oder Klang auf seine Reizqualitäten, physikalischen Wellenlängen und interferierenden Einzelwellen reduziert werden könne.123 Hart mann sah in der »quantitative[n] Ordnung der Stärke und Verteilung der Reizelemente«124 die Gründe für das unbewusste Empfinden von Schönem, das »für die Empfindung zum sinnlich Angenehmen 122 123 124
Picht, Kunst und Mythos, S. 415. Vgl. Hartmann, Philosophie des Schönen, S. 78. Ebd., S. 79.
90 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Akustische Reize versus lautliches Hören
wird.«125 Ein gutes Wahrnehmungsvermögen wäre danach vor allem ein analytisches, das »gewisse Klänge ohne Hilfsmittel in ihre Kom ponenten zerlegen«126 könnte. Physiologistisch argumentierte auch Wilhelm Wundt in seinem Grundriss der Psychologie. Er sprach im Kontext der Schallwahrnehmung über Empfindungen, Schallschwin gungen, pendelartige Schwingungen mit bestimmten Amplituden, die Reaktion von Membranen, die mit Hörnerven verbunden sind usw.127 Die Methode von Wundt, Einrücke atomistisch als Sinnesele mente zu verstehen, sie also aus größeren Erlebniszusammenhängen herauszutrennen, weckte schon früh Zweifel. Felix Krueger merkte bereits 1930 kritisch an: »Sogar von den Affekten lehrte er [Wundt, JH] ausdrücklich, jeder von ihnen lasse sich restlos, außer in Sinnes empfindungen, in soundsoviele ›Partialgefühle‹ […] zerlegen.«128 Krueger wandte sich gegen die Auflösung von Ganzheiten, sah aber dennoch die Notwendigkeit, zwischen einem »Teilganzen« und einem »Gesamtganzen«129 zu unterscheiden und nach Beziehungen zwischen beiden Ausschau zu halten. Die Notwendigkeit zu einer ganzheitlichen Betrachtung von Gefühlen sah er auch darin, dass »das Erleben eines normalen Indivi duums (erst recht alles gemeinsame Erleben) in seiner Hauptmasse aus unscharf begrenzten, diffusen, wenig oder gar nicht gegliederten Komplexen«130 besteht. Mit anderen Worten: Zwar erhöht das laute Signal eines Martinshorns schon als simpler Reiz den aufmerksam keitsweckenden Reflex. Zugleich kann es aber von Anfang an je nach persönlicher Situation und aktuellen gesellschaftlichen Verhält nissen auch ganz andere Bedeutungen wachrufen, die mit dieser Signalwirkung nur noch im weiteren Sinne zu tun haben. Auch nach Hermann Schmitz werden nicht Einzelreize eindrücklich, sondern ganzheitliche Situationen im Modus der »Wahrnehmung mit einem Schlage […]. Beim Blick aus dem Fenster an einem trüben Tag sehen wir oft deutlich, daß es regnet oder diesig ist, ehe wir Farben, Formen, Bewegungen da draußen ins Auge fassen.«131 Gleichwohl kann aus ganzheitlich Erscheinendem auch etwas Einzelnes (in seiner eigenen 125 126 127 128 129 130 131
Ebd. Ebd. Vgl. Wundt, Grundriss der Psychologie, S. 61f. Krueger, Das Wesen der Gefühle, S. 11. Ebd., S. 29. Ebd., S. 14. Schmitz, System der Philosophie, Band III/Teil 5, S. 192 und 189.
91 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
5. Die leibliche Qualität des Hörens
segmentierten Ganzheitlichkeit) herausgehört werden, wie die Art des Regnens oder die Atmosphäre der diesigen Luft – im Sinne von Felix Krueger jeweils als ein »Teilganzes«. Die Wissenschaften glauben in einer gewissen Lust an der Aus rufung aller möglicher »turns« immer wieder neue paradigmatische Strömungen indentifiziert zu haben: einen linguistic turn, einen spa tial turn, einen visual turn, einen body-turn und nun auch noch einen acoustic oder sonic turn.132 All diese Zuschreibungen betreffen aber nicht das Erleben der Menschen, sondern bestenfalls theoretisierende Analysen, mitunter auch nur disziplininterne Akzentverschiebungen zwischen und in (vermeintlich) »großen« Theorien. Der sonic turn spiegelt eine Resonanz auf einen gesellschaftlichen Prozess wider, wonach das Auditive in bestimmten Lebensbereichen an Bedeutung gewonnen hat. Für den Bereich der Freizeit ist eine technikkulturelle Aufwertung des Hörens in der Tat unübersehbar. In größer wer denden Märkten für auditive Produkte (vom Hörbuch über Musik streaming-Dienste bis hin zum boomenden Angebot kostspieliger »Im-Ohr-Lautsprecher«) drückt sich ein Bedürfnis nach auditiven Medien aus und darin zugleich eine Kultur des Hörens, die sich am technisch Möglichen orientiert.
Das plötzlich Gehörte Was sich diesseits der Sprache tönend, dröhnend, rauschend oder raschelnd zu Gehör bringt, ist nie abstrakt. Bevor es als Dieses oder Jenes in Verbindung mit einer Situation verstanden werden kann, affi ziert es. In besonderer Weise wecken Eindrücke die Aufmerksamkeit, die sich aufgrund ihrer Fremdheit nicht in gewohnte Geräuscherinne rungen einbetten lassen und im spontanen Weltverstehen deshalb querstellen. Was die Ohren »akustisch« zwar erreicht, vom Situati onsverstehen aber abgeschnitten bleibt, lässt eine verwirrende und beunruhigende Kluft in der Erkenntnis aufspringen. Darin offenbart sich die sinnliche Welt nicht mehr als ein intuitiv fassbarer Kosmos. Das erstmalig Erscheinende hat in der erlernten Ordnung von Bedeu tungen noch keinen eigenen Platz. Im Vernehmen eines noch nie oder nicht bewusst gehörten Geräusches erstarrt der auditive Stoff schon im Versuch des Verstehens. Wie die ratternden Bilder in einem 132
Vgl. Meyer, acoustic turn.
92 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Das plötzlich Gehörte
festhängenden Film stockt nun der Fluss intuitiven Weltverstehens. Geräusche verbinden sich erst dann mit einem Sinn, wenn sie auch verstanden werden. Sie kommen zwar immer irgendwo her, aber sie haben oft keine Quelle, aus der sie nachvollziehbar kommen. Als etwas Unverstandenes sind sie jedoch mindestens verunsichernd, wenn nicht beunruhigend, irritierend oder sogar ängstigend. In der obigen Geräuschbeschreibung ist es die »große Leere, die sich […] plötzlich mit etwas kaum Hörbarem füllt« – auf dass sodann »wie aus dem Nichts plötzlich« (s.o.) jemand von hinten naht. Irritierend ist dabei das ausbleibende Geräusch, das man aus Erfahrung mit dem Gehen einer Person verbindet. Erwin Straus sagt deshalb, das Plötzliche hängt »nicht von dem Tempo der äußeren Veränderungen ab sondern allein davon, ob bei allem Wechsel der Sinnzusammenhang in der inneren Lebensge schichte gewahrt bleibt oder nicht.«133 Er sieht in der historischen Modalität des Erlebens den Grund für die epistemische Reichweite eines Eindruckes. Ob sich ein Eindruck in die Struktur einer subjekti ven Erlebniswelt einfügt oder seine Erstmaligkeit die Umgestaltung des Orientierungssystems erforderlich macht, hängt davon ab, ob eine Person schon kennt, was ihr eindrücklich wird. Es hängt aber auch davon ab, wie sie in ihrem bisherigen Leben gelernt hat, Neues in Ordnungsstrukturen einzubetten. Deshalb entscheidet für Erwin Straus über Plötzlichkeit wesentlich »die Verfassung, in der sich die Welt des Erlebenden befindet«134. Plötzlich ist danach etwas nicht seiner objektiven Schnelligkeit wegen, sondern weil es sich dem Rhythmus der gelebten Zeit einer Person entzieht. Es gibt jedoch schon jene »milden« Formen des Plötzlichen, in denen etwas in der Art und Weise seines Erscheinens die Auf merksamkeit zwar herausfordert, nicht deshalb aber auch schon eine Entwurzelung der epistemisch geordneten Welt nach sich zieht. Sobald sich ein Eindruck nicht von selbst versteht, affiziert das Wahrgenommene in seiner Auffälligkeit und fordert das »suchende« Nach-Denken heraus. Nur kommt es entscheidend darauf an, ob sich ein plötzlicher Eindruck relativ reibungslos in das (gnostische wie pathische) Orientierungsbewusstsein einfädeln lässt oder ob die Irritation in gewisser Weise »total« ist. Wenn letzteres der Fall ist, läuft die Findung oder Schaffung einer situationsadäquaten Deu 133 134
Straus, Geschehnis und Erlebnis, S. 25. Ebd., S. 26.
93 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
5. Die leibliche Qualität des Hörens
tungskategorie leer. Sodann verfängt sich die Aufmerksamkeit im Nicht-Selbstverständlichen und die situationsimmanente Aufforde rung135 geht ins Leere, das sich dem Verstehen zunächst Verweigernde wenigstens Schritt für Schritt nachdenkend und nachspürend zu erschließen. »Was seine Selbstverständlich verliert, wird fraglich und erklärungsbedürftig: Weil es sich nicht mehr von selbst versteht, muss es jetzt eigens verstanden werden.«136 Auf den Grat der Unsicherheit gerät das Gewohnte jedoch schon im Moment bewussten Hinsehens, -hörens, -spürens etc., d. h. dann, wenn »es als Sichzeigendes bewusst wird.«137 Aber auch das zu einer gewissen Zufriedenheit Verstandene ist noch lange nicht »ganz« verstanden, denn noch das Sich-Zeigende verdeckt stets Facetten seines Seins. Ein unbekanntes Geräusch bleibt auch im Fokus geweckter Aufmerksamkeit so lange als Unverstande nes gegenwärtig, wie es in seinen Bedeutungen und in seinem charak teristischen Erscheinen nicht (relativ) transparent geworden ist. Die Anforderungen an das Gegenstands- wie Situationsverste hen sind aber a priori begrenzt, weil jede Situation das Maß des Verstehens limitiert. Das plötzlich Erscheinende muss zunächst sinn lich eingeordnet werden: Was bedeutet ein Geräusch, z. B. ein lautes oder leises Zischen, das zugleich durch ein merkwürdiges Rascheln gestört wird?138 Das Bedürfnis, die Unsicherheit zu überwinden, verlangt zunächst – vor jedem umfassenden Verstehen –, das Ver nommene in den Kontext seines Erscheinens einzubinden. Schließlich sind Geräusche nicht nur in ihrer Sinnlichkeit verstehensbedürftig, sondern darüber hinaus als etwas, das das Mit-Verstehen seiner Bedeutungen verlangt. Damit rückt nicht nur ein Geräusch in den Fragehorizont, sondern zugleich die Art und Weise seines Erscheinens sowie seine Verwurzelung in einem symbolischen Boden. Aber die Aufdeckung immer weiter gespannter Verweisungszusammenhänge geht im Prinzip ins Unendliche, denn: »Die Möglichkeit des Fort schreitens liegt in den betrachteten Gegenständen selbst, da diese mit jeder Bezugnahme immer schon einen Horizont weiterer mög Vgl. auch Griffero, Places, Affordances, Atmospheres. Feger, Hans Blumenbergs Wirklichkeitsbegriff aus phänomenologischer Per spektive, S. 60. 137 Ebd., S. 61. 138 Die sich damit reklamierende Anstrengung des Bewusstseins läuft auf eine »Konstitutionsleistung« hinaus, »bei der das Bewusstsein mit dem, was sich ihm als Erscheinung zeigt, derart umgeht, dass es dieses innerhalb von einem und zugleich zu einem Verweisungsgefüge ordnet.«; ebd., S. 59. 135
136
94 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Das plötzlich Gehörte
licher Bezugsnahmen bergen.«139 Ein Hör-Gegenstand bietet die potentiellen Stoffe einer sich optional ausdehnenden Vertiefung des Hinhörens und die Differenzierung von Wissen über das Erleben eines Eindrucks sowie über dessen Wirkungsweise in der Erfassung erscheinender Wirklichkeit. Das Plötzliche schreckt in situationsspezifischer Weise auf. Es weckt die Aufmerksamkeit je nach seiner Art. Auch dann also, wenn ein Eindruck der nachspürenden Erklärung gar nicht bedarf, weil das Vernommene prinzipiell schon vertraut ist – wie das plötzliche Quietschen der Straßenbahn in einer scharfen Gleiskurve. Aber dieses Aufmerken hat doch ganz andere Folgen für die Erkenntnishaltung und -gewinnung als ein Eindruck des Plötzlichen, bei dem es sich um eine Neuartigkeit handelt. Nicht jedes Plötzliche mündet in den Impuls nachspürender Exploration. Nicht alles, was plötzlich eindrücklich wird, legt sich wie ein dichter Nebel über die wache Wahrnehmung. Schließlich gibt es individuelle Wahrnehmungsdis positionen und sachverhaltliche Besonderheiten, die etwas (auf der Objektseite) so oder so zu Gehör bringen. Das in der Mitte der Stadt aufheulende Martinshorn eines blau-silbernen Streifewagens der Polizei ist in seiner akustischen Ansprache ebenso plötzlich wie das technisch identische Signal eines zivilen Einsatzfahrzeuges der Kriminalpolizei. In das Erleben des letzteren mischt sich indes das Gefühl eines Rätselhaften und Spektakulären ein, im Unterschied zum selbstverständlichen Hören der immer wieder dahineilenden Streifenwagen. Das Besondere am Plötzlichen des gewissermaßen »in cognito« fahrenden Polizeiwagens verdankt sich weniger des Hin-Hörens, als der intuitiven Synchronisierung von visuellen und lautlichen Eindrücken, denn der akustische Signalton kann erst durch das Hin-Sehen als dieser oder jener erfasst und dementsprechend der einen oder anderen Bedeutungsfamilie zugerechnet werden. Das Plötzliche induziert in erkenntnistheoretischer Hinsicht spezifische Eindruckswirkungen. Zwar wird es im Schreck leiblich spürbar. Der fährt aber je nach der situativen Verankerung eines Ein druckes mehr oder weniger ergreifend in die Glieder. Das Plötzliche ist als »Absage an Kontinuität des Zeitbewußtseins«140 ein erkennt nistheoretisch »gefährlicher Augenblick«141, für Hermann Schmitz 139 140 141
Ebd., S. 50. Bohrer, Plötzlichkeit, S. 43. Ebd.
95 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
5. Die leibliche Qualität des Hörens
ein »absoluter Augenblick«142, der – zumindest für Momente – die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der glatte Lauf intuitiven Ver stehens wird unter der Macht des Plötzlichen rau und widerständig. Aber: »Hinter dem Aufzucken des Plötzlichen schlagen die Wellen der Dauer immer wieder zusammen«143. Das am Plötzlichen Befrem dende und Irritierende reißt das Subjekt nie final in ein Bedeutungs vakuum, sondern nur temporär. Die rettenden Ufer der verstandenen Welt bleiben in Sicht. Es gibt Geräusche, deren erschreckende Wir kung so ergreifend ist, dass das Gefühl, in einem Rahmen sicheren Orientierungswissens in der Welt zu stehen, in weite Ferne rückt. Es gibt aber auch solche Geräusche, deren plötzliches Aufzucken gleichsam auf der Stelle schon wieder in nichts vergeht, weil »hinter« dem Plötzlichen etwas völlig Banales, Bedeutungsloses und schon hundertmal Verstandenes steht. Im Gesicht von Geräuschen deuten sich nicht zuletzt leibliche Richtungen an: das Vorbeirauchen des Eiligen, das Herabrauschen eines morschen Astes, das Auf- und Abwärtsrauschen eines Liftes, das (kokette) Durchrauschen einer sich wichtig nehmenden Person oder das diffuse Rauschen einer Baustelle aus mittlerer Ferne. Es sind dies Richtungen, die es nicht im mathematischen Raum gibt, sondern im prädimensionalen Raum des Leibes. Sie geschehen aus der subjektiven Perspektive in Relation zum eigenen Erleben und Ergehen sowie dem aktuellen Sein an einem Ort. Das Plötzliche hat viele Gesichter. Lautstarke, ekstatisch eigen artige oder in ihrer Frequenz verwirrende Geräusche gehen auf alle möglichen Ereignisse zurück – das staubaufwirbelnde Niederdonnern einer Betonplatte, die beim Abbruch eines Bürogebäudes herabstürzt, der unerwartete Donner eines überraschen hereinbrechenden Gewit ters oder das metallene Niederrasseln eines Scherengitters vor einer Ladentür am Ende der täglichen Geschäftszeiten. Die spezifische Eindrucksmächtigkeit eines Plötzlichen zeigt sich im Spiegel aktueller Situationen. Plötzlich ist, was jetzt passiert und aufschrecken lässt. Es affiziert in seinem unerwarteten Eintreten. Das gewohnte Geräusch (wie das Martinshorn der Streifen- und Rettungswagen in der Mitte der Stadt) bleibt auch dann, wenn es plötzlich zur Erscheinung kommt, auf einem niedrigen Niveau der Erregung. Es schreckt auf, aber es verunsichert nicht. Auch das archaische Zischen eines Gewitterblitzes 142 143
Schmitz, Der unerschöpfliche Gegenstand, S. 257. Ebd., S. 264.
96 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Zur Instrumentalisierung des Hörerlebens
lässt die Irritation nur kurzzeitig aufflackern – sofern das Unwet ter trotz räumlicher Nähe keinen Grund zur Sorge bietet. Andere Qualitäten der Affizierung gehen vom plötzlich Beunruhigenden und Beängstigenden aus. Das hektische, unaufhörliche Läuten der Haustürglocke bewirkt zumindest so lange eine gewisse Verstörung, wie das unsichere Gefühl angesichts des Grundes für das getriebene Läuten vorherrscht. Ebenso lässt ein leises und rätselhaftes Rascheln bei der nächtlichen Durchquerung einer halbdunklen Unterführung wiederum nur so lange fürchten, wie finstere Ahnungen eines unmit telbar bevorstehenden Überfalls rumoren. Das Aufzucken von Momenten des Plötzlichen gehört untrenn bar zum urbanen Geräuscherleben. Der soziale Kosmos der großen Stadt lebt geradezu vom sich immerzu unerwartet wiederholenden Einbruch des Plötzlichen. Es bannt die Aufmerksamkeit und warnt. Ob und wie eine Warnung jedoch verstanden wird, zeigt sich in der Situationsangemessenheit der Bewertung eines Geräusches. Dazu muss (mehr intuitiv als bewusst) gesellschaftlich erworbenes Erfah rungswissen herangezogen werden. Gesellschaftlich ist es formatiert, wenn es in Mustern kollektiv einverleibter Erfahrungen wurzeln. Situationsangemessene Antworten auf einen Eindruck sind, soweit sie sich aus individuell einverleibter Erfahrung speisen, biographisch begründet. Insgesamt unterstreicht das Plötzliche in seiner unter schiedlich ansprechenden Wirkungsbreite und -tiefe den leiblichen Charakter lautlichen Erlebens und die Bedeutung der Gefühle im Leben. Das Plötzliche affiziert.
Zur Instrumentalisierung des Hörerlebens Die Beschallung des Menschen spiegelt zumindest eine Facette der aktuellen technologischen Entwicklung der Gesellschaft wider. Darüber hinaus konstituieren sich auditive Sphären in einem (sub-)kulturellen Rahmen. Ein und dasselbe Geräusch sagt deshalb auch nicht allen Menschen dasselbe. So erzeugte der halluzinative Gebrauch der Trommel in archaischen Stammesgemeinschaften nicht nur Geräusche oder Klänge. Was die Menschen zu hören bekamen, war viel mehr ein mythischer Stoff der Imagination. An die Stelle von Trommeln und Rasseln sind schon lange andere Ausdrucksformen getreten. Autosuggestive Eigengeräusche werden nach wie vor von soziologischen Massen gemacht, um gemeinschaftliche Gefühle zu
97 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
5. Die leibliche Qualität des Hörens
intensivieren (z. B. in den Fußballstadien). In der technischen Zivili sation sind die Klänge der Maschinen immer wichtiger geworden (s. auch Kapitel 10). Die Bedeutungen des Tönens, Raunens und Rau schens haben sich mit dem Lauf technischer Innovationen verändert und den Verhältnissen der Zeit angepasst. Der rituelle Bärentanz mancher Siouxstämme diente der auto suggestiven Selbstertüchtigung und kraftgenerierenden Vorbereitung auf die Jagd nach dem Grizzly. Vom Lautlichen ging die berauschende Macht einer auditiven »Droge« aus. Auf ganz andere Weise sind es in der Gegenwart die sich in ihren Stimmungen rhythmisch aufpeitschenden Sprechchöre demonstrierender Kollektive, die in ihrer geräuschhaften Resonanz den Glauben an die gemeinschaftliche Erreichbarkeit politischer Ziele stärken sollen. Der eine wie der andere Kampf bedurfte bzw. bedarf der Eindrücklichkeit einer am eigenen Leib spürbar werdenden Selbstertüchtigung. In kaum einem anderen Medium können kollektive Atmosphären so wirkmächtig aufgepeitscht werden wie im Geraune der Horde. Deshalb kommt es bei Sprechchören auch nur in Grenzen auf den semantischen Kern des Herausgebrüllten an. Von mindestens ebenso großer Bedeutung ist die Selbsterfahrung eines sich bewegenden sozialen Verbundkörpers, in dem ein ideologisches, mythisches und nicht selten auch ein demagogisches Programm lautlich bebt.144 Geräusche, Töne und Klänge erweisen sich aber auch im alltäg lichen Leben als Medien der Selbstberauschung. Im Bereich der Musik steht die Autosuggestion von Stimmungen im Vordergrund. Die sich verändernden Genres bieten immer wieder neue Wege des Eintauchens in emotionale Sphären. Im Selbstgeräusch der Massen bahnt sich das Erlebnis (neudeutsch »Event«145) im Modus der Selbst berauschung an. Stets hat sich die Musik als »helfendes« Medium 144 Beispielhaft für die hohe Differenzierung der thematischen Breite lautlich ver nehmbarer Ausdrucksformen des Lebens unter historisch spezifischen Verhältnis sen ist die von der Bundeszentrale für Politische Bildung herausgegebene mehr als 600 Seiten umfassende Textsammlung »Sound des Jahrhunderts«; vgl. Paul / Schock, Sound des Jahrhunderts. Die kulturhistorischen Spuren auditiver Sozialisa tion, die allmähliche Gewöhnung an Lärmemissionen, alle möglichen Arten beson deren Schalls, eigenartige Geräusche, seltsame Tönen und Klängen etc. rücken dabei weniger als akustische Phänomene in den Fokus, denn als lautliche Erlebnisqualitä ten. 145 Krumme, Zum narrativen Potenzial (mit Bezug auf O´Callaghan and Nudds), S. 57.
98 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Zur Instrumentalisierung des Hörerlebens
beim befindlichen Aufgehen in Stimmungswolken bewährt. In den 1950er und 60er Jahren konfrontierte die schnelle Verbreitung noch ungewohnter elektronischer Rhythmen die meisten Menschen mit noch ganz neuen Eindrücken. Sie gingen noch einmal über das hinaus, was der Jazz bereits in den 1920er bis 40er Jahren an musikalischen Hörgewohnheiten revolutioniert hatte. Die »neue« Musik erweiterte aber nicht nur die Klangvielfalt in privaten Räumen. Schon früh wurde sie als Werbemedium instrumentalisiert und im Modus der Dauerbeschallung in beinahe jedem Supermarkt zum Tönen gebracht – über dem Nudelregal, an der Fleischtheke, beim Schuhputzzeug. Überall dieselben Endlosbänder. Musik tritt so aus ihrem engeren ästhetischen Rahmen heraus und wird zu einem sedierenden Medium auditiver Überrumpelung.146 Mit der musik-kommerziellen Indienstnahme der Töne, Klänge und Geräusche spitzen sich die kulturindustriellen Methoden sub tiler Formen der Kommunikation auf dissuasive Weise zu. Deren Ziel ist bis heute die Generierung von Massen, die sich als Träger von Lebensstilen, Konsumgewohnheiten und allermöglichen Eigen schaften anbieten, auf dass sie sich schließlich als Resonanzboden für den Verkauf von Industrieprodukten und Dienstleistungen aller Art erweisen. Die mit dem Ziel der Zündung von Begehrnissen überschriebene Lautlichkeit wird mit den verfügbaren Mitteln des technologisch Möglichen zu einer Magistrale der »affective econ omy«147 ausgebaut. Darin verschärft sich der Zwangscharakter der Kulturindustrie, wie er von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer skizziert worden ist: »Die ganze Welt wird durch die Filter der Kulturindustrie geleitet.«148 Ein solches Filter ist auch die Musik, sofern sie sich in der Süffigkeit ihrer Melodien und Gefälligkeit ihrer Rhythmen als betörendes Mittel der Ablenkung eignet. Als Main stream-Medium der Kommerzialisierung drängen vor allem Formate in die Märkte, die dem ästhetischen Klischee westlich geprägter Musikindustrie entsprechen. Der große Diffusionseffekt serieller Massenklänge liegt darin, dass sie zunehmend über Streamingdienste verkauft und damit noch ortsungebundener konsumiert werden können als zu Zeiten des vergleichsweise sperrigen und gewichtigen Walkman. Die Musik aus 146 147 148
Vgl. Taylor, Die Avant-Garde in the Family Room. Ahmed, Affective Economies. Adorno/Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, S. 113.
99 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
5. Die leibliche Qualität des Hörens
der cloud geht nicht nur leicht und schnell übers Ohr auf die coole Stimmung. Sie kontaminiert auch den Habitus des Gehens, noch in den vom Verkehr überschwemmten Zentren der großen Städte. Über die Kolonisierung der Aufmerksamkeit und die Verbreitung ästhetischer Standards setzt die Kommerzialisierung des Hörens letztlich unbemerkt eine neue Kultur der (Un-)Aufmerksamkeit in die Welt. Das nicht endende Coolness-Gefühl, das sich dem prinzipiell permanenten Konsum wohliger Klänge verdankt, verwandelt die reale Welt des »Draußen« in eine Kulisse. Wozu der »harten« Realität mit ihren eklatanten Problemfeldern nachhaltige Aufmerksamkeit widmen, wenn das Leben unter der süßen Klangglocke kabelloser Ohrhörer so göttlich sein kann. Wenn Theodor W. Adorno und Max Horkheimer einst resümierten, die »Produkte der Kulturindustrie können darauf rechnen, selbst im Zustand der Zerstreuung alert konsumiert zu werden«149, so kündigt sich in einer rund 80 Jahre alten Diagnose ein noch heute überaus präsentes Machtpotential an. Zwar haben sich die diagnostischen Voraussetzungen der Kritischen Theorie verändert, nicht jedoch die Prinzipien der Verschmelzung von Kapital und Kultur. Sich gegenwärtig immer wieder an neue Rah menbedingungen anpassende Ausdrucksgestalten der Kulturindus trie diskutiert Gernot Böhme in Spiegelbildern einer »ästhetischen Ökonomie«150, die bestens funktioniert, indem sie in ihren medialen Zumutungen leiblich und gefühlsmäßig ergreift.
149 150
Ebd., S. 114. Böhme, Zur Kritik der ästhetischen Ökonomie.
100 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
6. Geräuschhaftes Raumerleben
Was um uns herum ist, gibt sich in sinnlichen Komplexqualitäten zu spüren. Diese nannte Karlfried Graf von Dürckheim »Vitalqualitä ten«151, derer man im »herumwirklichen«152 Erleben gewahr werden kann. Die Geräuschbeschreibungen I bis VI illustrieren, in welcher Weise etwas Gehörtes zum gesamten sinnlichen Erleben in Beziehung steht. Als Herausgehobenes bzw. Isoliertes nehmen wir das Gehörte (wie das Gesehene, Getastete, Geschmeckte oder Gerochene) erst wahr, wenn es als etwas Bestimmtes bewusst wird, also aus einem Erlebniszusammenhang gleichsam herausragt. Dann bietet es sich auch der Thematisierung an. Was man von einem Herumraum atmo sphärisch zu spüren bekommt, ist oft – vielleicht sogar meistens – auch lautlich imprägniert. Im folgenden Kapitel soll es um die raumprägende Wirkung des Hörens gehen. In den Fokus rückt damit die Frage, welchen Einfluss das Hören auf das Gefühl hat, von einem Raum umschlossen zu sein. Mit den Augen können wir sehen, was vorne und uns nahe ist oder hinten und in der Ferne. Wie sich das Gesehene in eine am dreidimensionalen, mathematischen Raum Maß nehmende Raum vorstellung einfügt, so trägt das eindrücklich Gehörte zur Anreiche rung erlebnisbasierter Raumbilder bei. Der lautlich vernommene Raum ist anders gegliedert als der gesehene. Auch verdankt er sich anderer Erlebnisqualitäten und hat deshalb auf eigene Weise an der Synchronisierung aller übrigen sinnlichen Eindrücke einer Stadt teil. Die uns zu Gehör kommende städtische Welt ist zwar keine andere als die, die man sehen, riechen oder mit den Füßen tastend durchwandern kann. Anders ist nur, was jeweils in bestimmter Weise von ihr im sinnlichen und emotionalen Erleben eindrücklich wird.
151 152
Dürckheim, Untersuchungen zum gelebten Raum, S. 39f. Ebd., S. 36.
101 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
6. Geräuschhaftes Raumerleben
Geräuschbeschreibung IV: Zur Lautlichkeit einer größe ren Baustelle153 Zwei Baustellen befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zuein ander. Vorne ist ein Tiefbau im Gange – die Anlage eines Platzes am Kopf eines Hafenbeckens, 20 bis rund 50 Meter dahinter werden an der Fassade eines denkmalgeschützten historischen Speicherge bäudes, das zu einem postmodernen Wohntempel gentrifiziert wird, Fassadenteile abgebrochen. In der Menge des Hörbaren dominieren die Geräusche in der Nähe. Sie füllen einen lautlichen Vordergrund, während Eindrücke aus der nahen und mittleren Ferne in einem Hintergrund zusammengedrängt sind. Es gibt in der tonhaltigen und klanglichen Hörbarkeit keine räumlichen Ordnungen wie im Bereich der sichtbaren Dinge. Vorne vermischt sich das Brummen eines kleinen auf Hartgummiketten lau fenden Baggers mit einem metallenen Klappern und unregelmäßigen Hin- und Herschlagen seines schweren Eisenlöffels. Das Brummen hat einen eigenartigen Ton, es ist ein surrendes Brummen. Was der Bagger eigentlich macht, kann man weniger hören als sehen. Nach dem Hinsehen kann man aber »dann« das Abtragen und seitliche Verfrachten von Schotter auch hören. Was man hören kann, geht allerdings in schweren Maschinengeräuschen unter. Außerdem ist das Baumaterial (lautlich) so »weich«, dass man, noch nicht einmal wenn es abgeschüttet wird, ein leises und dumpfes Rauschen oder Rutschen davon zu hören bekommt. Von der hinteren Baustelle ist plötzlich ein Zischen und schnell ratterndes Schlagen zu hören. Dazwischen drängt sich immer wieder das rhythmisch wiederkehrende Brummen und Klappern des Bag gers. Das Zischen scheint an einem Schlauchende zu entstehen, das nicht stramm genug an einem Kompressor befestigt ist; das Rattern wird von kleinen Handpresslufthämmern erzeugt, mit denen zwei Arbeiter, die auf der hochgefahrenen Schaufel eines Frontladers ste hen, Klinkersteine eines Fassadenvorsprungs herausmeißeln. Beide Geräuschkulissen konkurrieren immer wieder miteinander – das ratternde Hämmern hinten und das surrend-brummende Klappern vorne. Dazwischen piepst es rhythmisch, wie man es von rückwärts fahrenden Lastwagen kennt. Wo es herkommt, bleibt unklar – viel
153
Anfang August, 11:00 – 11:45; 29 Grad Celsius; sonnig; windstill.
102 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
6. Geräuschhaftes Raumerleben
leicht vom Bagger oder einem Kipper, der irgendwo in der Nähe rückwärts fährt. Das Geräusch des hin- und herfahrenden Baggers ist in gewisser Weise »unvollständig«. Hörbar ist nämlich nur der in einem tiefen und irgendwie weichen Ton vibrierende Motor und das Klappern der eisernen Schaufel; das Drehen der Kabine, das Auf und Ab des sich vor- und seitwärts bewegenden Hydraulikarms scheint stumm vor sich zu gehen. Nahe und ferne Geräusche setzen ein Geschehen erst (so oder so) in Szene – sofern es überhaupt so etwas wie eine »lautliche Szene« gibt. Was ich höre, hat zwar auch eine bildhafte Seite, aber die ordnet sich im Fokus aufmerksamen Hinhörens der Lautlichkeit unter. Außer dieser in Vorder- und Hintergrund gestuf ten Hörlandschaft, in der sich zwei Kulissen übereinander schieben und sich dann zu einer verbinden, ist gar nichts zu hören; kein Fahrzeug, keine Stimme, kein Vogel. Der Baggerfahrer macht eine Pause. Umso mehr drängt – aus der nahen Ferne – das unaufhörlich zischend-ratternde Hämmern von der alten Klinkerfassade herüber. Das Hämmern ist nun, nachdem es das lautliche Feld nahezu allein ausfüllt, in doppelter Weise rhythmisch präsent und nicht einfach nur da. Es tönt zum einen permanent; zum anderen scheint es in seinem Verlauf aber auch amplitudenhaft zu schwingen. Es mögen die Bewegungen der Arbeiter im leichten Wind sein, die den von den kleinen Handmaschinen erzeugten Geräusch teppich mal etwas nach hier und dann wieder nach dort ziehen lassen. Ein neues, wieder ganz anderes diffuses Hintergrundgeräusch verrät weder seine gegenständliche Herkunft seine räumliche Quelle (Schlagen einer Autotür). Da ist auch noch der diffuse Ton irgend eines Motors, der gleichsam ortlos in der Luft hängt. Dazwischen ein verinselter Laut: das fast leise aber doch überaus klar wirkende Aneinanderschlagen zweier Metallteile – es sind die Kupplungsstücke des Schlauches einer Pumpe, die die Baustelle von zu hohem Grundwasser freihalten soll. Die Pumpe dreht sich so leise, dass sie sich gegen das schnatternde Schlagen der Presslufthämmer nicht durchsetzen kann. Vielleicht kommt das konstant, aber leise hörbare und monoton über dem Raum liegende Brummen einer Maschine vom Dieselmotor der Pumpe. Die sich in Geräusch-Kulis sen verlierenden Töne und Klänge haben oft etwas Rätselhaftes. Was man hören kann, ist nicht »platziert« wie die Dinge im Raum. Den noch gibt es Beziehungen zwischen dem, was sich zu Gehör bringt. Diese verdanken sich im Wesentlichen zweier Merkmale. Erstens dem
103 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
6. Geräuschhaftes Raumerleben
eigenartigen Charakter des lautlich Vernehmbaren: dem vibrierenden Brummen eines Baggermotors, dem Dröhnen eines Rüttlers, dem Rattern eines Presslufthammers und einem rätselhaften Piepsen. In der Vielfalt situativ erscheinender Schall-Gesichter gibt es kein allgemeines Vibrieren, Brummen, Rattern oder Piepsen. Die lautlichen Beziehungen verdanken sich zweitens dem Pegel und Oszillogramm eigenartig charakteristischer Geräusche. Damit ist u. a. die Lautstärke gemeint, die in ihrem An- und Abschwellen amplitudenartige Lautge stalten bildet. Szenenwechsel Ein Frontlader verteilt Schotter. Mit seiner Schaufel trägt er das grob körnige Material von einem großen Haufen, den ein Laster abgekippt hat, auf eine freie Fläche. Das dabei entstehende rhythmisch-laute Hin- und Herfahren sowie schleifend-scharrende Ziehen überlagert nahezu alle anderen Geräusche. Gleichzeitig fährt ein zweiter Arbeiter mit einem Rüttler über die schon halbwegs glattgeschobene Fläche. Dabei entsteht ohrenbetäubender Lärm, der sich gleichmäßig ausbrei tet. Je nachdem, ob sich das Fahrzeug eher links oder rechts über den Schotter bewegt, füllt es den Hörraum ganz aus oder lässt kleine »Schall-Lücken« entstehen, in die hinein sich auch andere akustische Eindrücke ausbreiten können. Darüber lässt sich kaum mehr sagen, als dass es ein ratternder und auf bedrängende Weise alles andere überdeckender Megalärm ist. Extremer Lärm wird in seiner Geräusch haftigkeit als ein leiblich um- und angreifendes Volumen erlebt. In seinem wummernd-dröhnenden sowie mächtig-schwer dahinzie henden Getöse geht er ganz auf und umschließt wie eine Wolke. Zwischendurch, wenn der Rüttler in einen »Lärmrand« geschoben worden ist, wird wieder der schotterschiebende Frontlader mit seiner eigenen »Sprache« dominant – mit dem kratzenden Schieben der schweren Metallschaufel auf dem noch lockeren Untergrund aus Splitt. Gleichsam dahinter dröhnen nahezu permanent schwere Die selmotoren. Dann wird der Rüttler abgeschaltet. Bei der Baustelle am Speicher ist Mittagspause. Der Fahrer wartet mit seinem Frontlader bei abge stelltem Motor auf einen LKW. Plötzlich ist es so ruhig, dass man glauben könnte, das Leben stecke in einer Phase der Unterbrechung fest. Lautlos streicht eine Silbermöwe über das Hafenbecken. Aus dem glatten Wasserspiegel taucht ein Kormoran auf, der einen zappelnden Fisch in seinem mächtigen Schnabel hält. Er wendet sich leicht zur
104 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Vorder- und Hintergrundgeräusche
Seite, so dass das vom Tauchen nasse Gefieder in der Sonne glänzt. Dann verschwindet er wieder im dunklen Wasser. Aber bald taucht er abermals auf, reckt sich über den Wasserspiegel hinaus, spannt die Flügel aus und beginnt (zunächst ein kurzes Stück über die Wasseroberfläche laufend) schwerfällig davonzufliegen. All das ist nur zu sehen. Nichts davon ist zu hören. Die beschriebene Baustelle besteht eigentlich aus zwei räumlich unmittelbar aneinander grenzenden Baustellen, die in gewisser Weise ineinander übergehen. Das hier und dort gleichzeitig stattfindende Geschehen wirft die Frage auf, was eigentlich eine Baustelle ausmacht? Oft ist, was in einer solchen Gegend geschieht, eine Collage aus allem, was an mehreren performativ verzahnten Orten vor sich geht. Zu einer Baustelle wird das Viele dadurch, dass das bunte Geschehen an ver schiedenen Orten von der Wahrnehmung zu einem atmosphärischen Raum zusammengefasst wird. So entsteht der Eindruck einer Bau stelle.
Vorder- und Hintergrundgeräusche »Beim Hören können wir nicht wie beim Sehen hier und dort, innen und außen, klar unterscheiden.«154 Georg Picht macht damit auf eine charakteristische Eigenartigkeit des Hörens aufmerksam. Gleich wohl weisen die im hörenden Raumerleben vernehmbaren Nuancen darauf hin, dass die Geräusche die Wahrnehmung eines »Hier und Dort« nicht so weitreichend verwirren, wie Picht das nahelegt. Die räumliche Gliederung der Geräusche ist in der obigen Beschreibung nämlich insoweit differenziert, als in der Fülle des Gehörten zwei oder mehrere Geräuschkulissen voneinander unterschieden werden konnten. Das heißt also, dass lautliche Quellen an wahrnehmbaren Orten halbwegs nachvollziehbar verankert sind. Geräusche füllen keineswegs nur einen diffusen Raum aus. Sie ziehen die Aufmerksam keit auf das hier und dort, nahe und weiter weg Ertönende. Unter bestimmten Bedingungen ihres lautlichen Erscheinens tönt es von benachbarten Orten anders als von weiter auseinander liegenden, so dass ein Unterschied gemacht werden kann zwischen dieser und jener Gegend. Zwar wird »die« Baustelle als »ein« atmosphärischer 154
Picht, Kunst und Mythos, S. 389.
105 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
6. Geräuschhaftes Raumerleben
Raum empfunden. Zugleich setzt sich dieser aber doch auch aus zwei lautlich je für sich wahrnehmbaren Schallfeldern zusammen. Das ist im alltäglichen Erleben auditiver Räume der Stadt sehr ähnlich. So lässt sich z. B. die Geräuschkulisse des Straßenverkehrs von der einer Baustelle unterscheiden, denn die Motoren hören sich hier anders an als dort. Das Hören öffnet uns einen sinnlichen Korridor zum Erleben der Stadt, durch den etwas in einer Weise vernehmbar wird, das sich von dem unterscheidet, was man sehen, tasten oder riechen kann. Das Hörbare und das Sichtbare bilden scheinbar zwei Welten, die im wirklichen Geschehen zu einer Welt verlaufen. In ihr verschwimmen die verschiedenen sinnlichen Eindrücke zu einer lautlichen Gemengelage. Sie ist das Produkt einer Synchronisierung ohne Plan und Regie – Resultat eines Zusammenfließens, das einfach passiert. Geräusche lassen uns den Raum nicht so erleben wie Bauten in visuellen Bildern erscheinen.155 Das Hören erfasst a priori ein aktuelles Geschehen, man könnte auch sagen: die Dauer eines Tönens oder Klingens. Das Sehen findet dagegen seine Objekte zumindest so lange immer wieder an einer Stelle im Raum vor, wie diese Dinge fix an einer Stelle sind, sich also nicht wegbewegen. Aber auch wenn sich etwas bewegt, stellen »sichtbar« werdende Geräusche andere sinnliche Herausforderungen als nur hörbare. Was wir sehen, bewegt sich in seiner Eindrücklichkeit auf eine andere Weise im Raum als das Gehörte. Bewegung hat mindestens zwei Gesichter: ein visuelles und ein auditives. Während Farben einem Gegenüber anhaften und dem gegen ständlichen Erscheinen eines materiellen Objektes (vom Himmel, der kein Objekt ist, abgesehen) ein Gesicht geben, löst sich der Schall von seiner Quelle ab und flottiert ohne feststoffliche Substanz im Raum.156 Der Ton »kommt auf uns zu, erreicht und erfaßt uns, schwebt vorbei, erfüllt den Raum, gestaltet sich in einem zeitlichen Nacheinander.«157 Töne hören wir aber nicht nur als einzelne lautliche Eindrücke. Sie werden auch als zusammengehörig erlebt, z. B. im Gesang eines Vogels oder in der Melodie einer musikalischen Komposition. Zum Ton gehört darüberhinaus die typische Klangqualität eines Resonanz mediums, unterscheidet sich doch der Ton der Saite eines Basses von 155 »Geräusche und Klänge, die wir anhand ihrer Quelle und ihrer Bedeutung defi nieren können, beteiligen uns räumlich. Sie lassen uns den Raum erleben.«; Runkel, Klangräume der Erlebnisgesellschaft, S. 31. 156 Vgl. Straus, Die Formen des Räumlichen, S. 147. 157 Ebd., S. 146.
106 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Vorder- und Hintergrundgeräusche
dem einer Geige und beide abermals von dem einer Gitarre. Schon das Hören der Töne eines Musikinstruments stimmt das Gefühl, in einem Herum-Raum zu sein, der dem tatsächlichen (dem mathematischen bzw. geodätischen) Raum in keiner Weise ähnlich ist. Die lautlichen Modi des Stadterlebens spiegeln sich in zahllosen Varianten wider. In der Mannigfaltigkeit der Eindrücke stehen die Differenzen des sichtbaren und hörbaren Raumerlebens in ihrer je eigenartigen Gliederung nebeneinander. Sowohl im visuellen wie im lautlichen Raum gibt es einen Vorder- und einen Hintergrund. Für den auditiven Hintergrund kennt die Alltagssprache den Begriff des »Hintergrundgeräusches«. Geräusche, die nicht aus einem solchen Hintergrund kommen, die eher um uns herum sind oder infolge ihrer Immersivität schon in uns eingedrungen sind, heben sich von Hintergrund-Geräuschen ab. Während wir in einem visuellen Hinter grund etwas Konkretes sehen können (ein Haus, eine Kirche, einen Kran oder einen baumreichen Waldhorizont), ist ein HintergrundGeräusch in aller Regel durch ein diffuses Rauschen verzeichnet. In ihm tritt im Allgemeinen nichts hervor. Dennoch kann zwischen Vor der- und Hintergrund im Bereich der Geräusche differenziert werden – sofern verschiedene räumlich wahrnehmbare Felder unterscheidbar sind. Dann verbinden sich Töne und Klänge (und Geräusche) in einem »Vorne« zu einem Geräusch. Dieses hebt sich von dem ab, was in einem »Hinten« vielleicht wiederum als charakteristisches Geräuschgebilde vernehmbar ist. Ein visuelles »Vorne« kann durch ein mitunter plötzlich einbrechendes lautliches »Herum« verwirrt werden. Die sinnlichen Eindrücke kommen sich immer wieder in die Quere. Dabei bilden sie nicht immer synchrone Ganzheiten. Auch was sich anhört, als sei es ganz nahe und »gleich vorne«, kann doch weiter weg sein, wenn es nur laut genug ist. In der Beschreibung ist von einer nach Vorder- und Hintergrund gestuften »Hörlandschaft« die Rede. Landschaften im üblichen Sinne gelten jedoch als Einheiten eines visuell erfahrbaren herumräumli chen Ganzen. Bei der Hör-Landschaft handelt es sich aber nicht um einen »Gesichtskreis«158, sondern eine lautliche Sphäre, man könnte auch sagen, um einen »Lautkreis«. Der hebt sich als inselhafter Klang raum aus einem temporären Herum heraus. Was klingt, klingt auf Zeit. Am Beispiel der obigen Beschreibung ist es das ratternde Häm mern, das zusammen mit dem zischenden Schlagen der Presslufthäm 158
Simmel, Philosophie der Landschaft, S. 142.
107 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
6. Geräuschhaftes Raumerleben
mer an einer Gebäudefassade eine »hinten« erkennbare Geräuschein heit bildet. »Vorne« wird dagegen das surrend-brummende Klappern und schwere Hin- und Herschieben von Schotter wiederum in Gestalt einer zusammengehörigen Lautfamilie hörbar. Das Beispiel zeigt u. a., dass in einer Beziehung zueinander steht, was wir sehen und hören. Die räumliche Gliederung des dinglich erfüllten Raumes wird nicht nur durch das Sichtbare, sondern auch durch das von den Dingen Hörbare strukturiert und umstrukturiert. Hörbares und Sichtbares bilden zwar je eigene Wahrnehmungswelten; aber sie stehen doch in einer erkenntnistheoretischen Wechselbeziehung zueinander. Was man gleichsam »hinter« einem akustischen Abschottungswall – schon in Gestalt geräuschdämmender Fensterscheiben – nur sehen kann, steht dem Verstehen in anderer Weise zur Verfügung als wäre es zugleich zu hören. In der Beschreibung machen die ausschließlich visuell wahrgenommenen Bewegungen von See- und Wasservögeln deutlich, wie sinnliche Eindrücke miteinander verschmelzen können. Dominanz- und Kontrastqualitäten eines Geräusches spielen dabei eine wichtige Rolle. Dies umso mehr, als auch ohne den facettenrei chen Baulärm von der Möwe wie vom Kormoran kaum etwas zu hören gewesen wäre. »Das Hintergrundrauschen in einer postmodernen Großstadt ist eine Folge des Sounds einzelner Klanginseln, dem man sich nicht entziehen kann.«159 Es versteht sich von selbst, dass überall da, wo Menschen in Situationen der Dichte wohnen, arbeiten und sich im öffentlichen Raum bewegen, auch Geräusche entstehen und mit ihnen ein wechselhaftes Hintergrundrauschen. Aufmerksamkeit verdient aber weniger dieser grundsätzliche Sachverhalt, als die Frage, in welcher Art und Weise (incl. der Lautstärke) dieses Rauschen auf das Leben der Menschen Einfluss nimmt. Dem nervlich und psychisch beanspruchenden Lärmen steht dabei das Leise und kaum Vernehmbare gegenüber. Die messbare Entfernung eines Schallfeldes ist beim Hören kaum von Bedeutung. Als laut wird empfunden, was im Hörerleben laut ist – ganz gleich, ob es nun aus der Ferne oder der Nähe kommt. Was im euklidischen Raum weit weg sein mag, kann je nach den herrschenden Windverhältnissen auf bedrängende Weise nahekommen. Umgekehrt mag eine im tatsächlichen Raum nahe Geräuschquelle im leiblichen Erleben als relativ fern wahrgenommen werden, z. B. dann, wenn sie vom Wind oder dank technischer Mittel 159
Stahl, Klanginseln – Hintergrundrauschen – Selbstmischungen, S. 561.
108 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Geräusche und Töne temperieren den (leiblichen) Raum
ferngehalten wird. Auch »leise« (nahe wie ferne) Geräusche können auf einem niedrigen dB-Level in der Art ihrer Emission, ihrem Aus breitungsrhythmus und der Dauer ihrer Einwirkung zu einem anhal tend belastenden oder sogar traumatisierenden Problem werden. Das ist bei vielen Windkraftanlagen der Fall, die durch den impulsartigen Ton der drehenden Rotorblätter auch dann die Lebenszufriedenheit am Wohnort beeinträchtigen, wenn sie nach geltendem Recht gar nicht als ein Problem einzustufen sind. Wenn aus Hintergrundgeräuschen auch einzelne Geräusche »herausgehört« werden können160, so beharrt das Ganze doch in einem diffusen Rauschen, in dem das Viele im Durcheinander eines lautlichen Zusammenhangs aufgeht. Dieses Durcheinander könnte man auch den »Schallbrei einer Geräuschkulisse«161 nennen (vgl. dazu auch die obige Beschreibung). Solcher »Brei« stellt sich als räumliches Phänomen dar, weniger als (Geräusch-)»Teppich« denn als voluminöser Klangraum. Schallbrei affiziert den Betroffenen als etwas Ganzes, das im Erleben als räumlich ausgedehnt erfasst wird. An bestimmten Raumstellen (bzw. auf örtlichen Inseln im Raum) werden dagegen eher einzelne, lautlich aus diesem Ganzen hausragende Töne vernommen. Wenn sich in einem Geräusch Töne, Klänge, Laute und wiederum eigenartige Geräusche vermischen, so kann das so entstehende »Gesamtgeräusch« doch eintönig sein. Zwar steht das Eintönige dem Vielstimmigen gegenüber. Jedoch gibt es eintönige und vielstimmige Mannigfaltigkeiten. Während letztere in ihrem Rauschen tendenziell chaotisch anmuten, ist das eintönig mannigfal tige Geräusch in seiner Eigenart überschaubar, etwa in seinem Tonus und Rhythmus.
Geräusche und Töne temperieren den (leiblichen) Raum Es gibt keine eindeutige Abgrenzung zwischen Geräusch, Ton und anderen lautlichen Eindrücken. Ein Geräusch kann einem Ton ähn lich sein, ein Klang ein Geräusch werden, ein Lärm auf einen Ton Man spricht hier vom sogenannten Cocktailparty-Effekt, der »die Fähigkeit des menschlichen Gehörsinns [bezeichnet], bei Anwesenheit mehrerer Schallquellen die Anteile einer bestimmten Quelle aus dem Hintergrundrauschen zu extrahieren.«; ebd. 161 Schmitz, System der Philosophie. Band III/Teil 5, S. 135. 160
109 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
6. Geräuschhaftes Raumerleben
zurückgehen. »Tatsächlich unterscheidet sich das Geräusch vom Ton einzig in den Schwingungen, die es – in Tempo und Intensität schwankend – hervorbringt.«162 Dagegen entsteht ein Ton »aus der gleichmäßigen und periodischen Aufeinanderfolge von Schwingun gen und zwar sowohl dem Tempo als auch der Intensität nach.«163 Ein Geräusch besteht meistens aus unregelmäßigen Bewegungen. Es ist im Unterschied zum Ton im Allgemeinen reicher an Obertö nen.164 »Jedes Geräusch hat einen Ton, bisweilen klingt es wie ein Akkord, der in der Gesamtheit seiner unterschiedlichen Schwingun gen vorherrscht.«165 Unter einem Akkord hatte Willy Hellpach ganz allgemein eine Eindruckswirkung verstanden, in der Vieles zu einer Einheit verschmilzt.166 Zu dem damit einhergehenden räumlichen Eindruck sich über lagernder Geräuscheindrücke hat Tony Hiss ein Beispiel gegeben: »Alle Geräusche, die mich erreichten, schienen sich zu einem einzigen Geräusch verbunden zu haben, das umfassend und ruhig im ganzen Raum gleichmäßig verteilt war.«167 Es habe ihn wie eine »Raumglo cke« eingeschlossen. In der Metapher der Raumglocke scheint der atmosphärische Charakter der Geräusche vor. Luigi Russolo ist nicht nur von Stadtgeräuschen fasziniert, son dern auch von denen der Natur, vom Sausen und Heulen des aufund absteigenden Windes, den verschiedenen Intervallgrößen darin, den tiefen bis grell sich aufschwingenden Tönen, dem andauernden Pfeifen, das dann in ein tiefes und sich entfernendes Heulen abfällt – und sich plötzlich in beinahe lähmende Stille verliert.168 Seine Ein drucksbeschreibungen beziehen sich aber nur scheinbar allein auf die lautliche Erlebnisqualität des Schalls. Tatsächlich sagen sie zugleich etwas über die Art der atmosphärischen Temperierung einer Gegend, in der solche Geräusche erlebt werden. Dazu gehört, dass sowohl Geräusche der Natur, als auch solche der technischen Welt mitunter unerwartet aufhören. Das Tönen und Hämmern geht plötzlich zu Ende und fängt scheinbar unvermittelt wieder an. Gleich einer »Pause« wird dann in einem räumlich ausgebreiteten Geräusch eine lautliche 162 163 164 165 166 167 168
Russolo, Die Kunst der Geräusche, S. 10. Ebd., S. 23. Vgl. ebd., S. 26. Ebd., S. 11. Zum Begriff des Akkordes vgl. auch Hellpach, Sinne und Seele, S. 61. Hiss, Ortsbesichtigung. Wie Räume den Menschen prägen, S. 25. Vgl. Russolo, Die Kunst der Geräusche, S. 28.
110 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Geräusche und Töne temperieren den (leiblichen) Raum
Leerstelle spürbar – wie eine »Lücke«. Sobald sich ein Geräuschfeld zurückzieht, kann ein beharrender Ton, Klang oder auch ein anderes »übrigbleibendes« Geräusch als etwas Eigenes (gewissermaßen als ein »Drittes«) im Raum eindrücklich werden. Eine Geräuschkulisse kann sich schließlich aus der zufälligen Synchronisation prinzipiell unterscheidbarer Töne ergeben, ebenso aus in sich vielfältigen Geräuschen. Ein zunächst nicht im mindes ten als belästigend empfundenes Motorengeräusch kann in einem immens störenden Hintergrundgeräusch aufgehen, wenn es nur lange genug andauert und die Akzeptanz allmählich schwindet, ihm auf Dauer ausgesetzt sein zu müssen. Im unerträglichen Lärm können in sich mannigfaltige Geräusche kulminieren, die auf ganz und gar unangenehme Weise erlebt werden. Aus einer Geräuschkulisse kön nen aber auch einzelne Töne und Laute herausragen. Es gibt jedoch keine allgemeingültigen Kriterien oder objektiven Maßeinheiten, nach denen die Intensität und Reichweite einer Beeinträchtigung des persönlichen Empfindens durch eine Geräuschemission bewertet werden kann. Eine auditiv akzentuierte Atmosphäre ist nicht allein vom Erscheinen eines Geräusches (auf der Objektseite) abhängig, sondern ebenfalls von der Stimmung dessen, der seine Umgebung erlebt. Schon der Begriff der Geräusch-Kulisse impliziert die Bedeu tung eines für jemanden hintergründigen Hörraumes. Das Erleben ist auch im Falle von Schalleindrücken von individuell (wie kollektiv) erlernten Akzeptanzprofilen abhängig. Wenn Geräusche wiederkehren, sind sie als lautliche Gebilde nicht nur an ihrem Charakter erkennbar, wie dem sonor schwingen den Brummen einer Wasserpumpe. Sie haben auch ein Gesicht, wie das plötzliche Quietschen, das einen immer noch beherrschenden surrenden Grundtton in gewisser Weise akzentuiert. Auch das cha rakteristische Tuckern eines rundlaufenden Dieselmotors kann ein besonderes wie aktuelles Gesicht haben, wenn sich ein denkwürdiges Schlagen hinzumischt. Der ungewohnte Klang mag dann den beunru higenden Verdacht eines Schadens suggerieren. Das Gesicht konkur riert nicht mit dem Charakter eines Geräusches. Es verleiht ihm – als Grundmuster seines Erscheinens – nur einen besonderen Ausdruck. Hintergründig schwebende Geräusche können ihre eigenartige Räumlichkeit in einer gewissen Ortlosigkeit entfalten. Dann hängen sie »in der Luft«, ohne auf einen Verankerungsbereich zurückgeführt werden zu können (im obigen Beispiel der diffuse und permanente Ton des Elektromotors einer Pumpe). Zwar lässt sich das Geräusch
111 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
6. Geräuschhaftes Raumerleben
einer Maschine orten, weil sie ja irgendwo an einem konkreten Ort steht. Das Wissen um ihren Ort ist für das Geräuscherleben aber von geringer Bedeutung. Ein im Raum flottierender Laut breitet sich in seiner monotonen Dauerhaftigkeit zwischen bzw. »über« allen anderen Geräuschen einer Gegend aus.
Menschliche Eigengeräusche Menschliche (Eigen-)Geräusche drücken sich im Medium des Leibes zwischen Enge und Weite aus. Daran wird eine existenzielle Dimen sion der Geräusche deutlich, denn: »Jedes Ereignis unseres Lebens wird von Geräuschen begleitet«169. Körperliche Eigengeräusche zeich nen sich dadurch aus, dass sie, wie das Rauschen der Atmung oder das Krachen beim Zerbeißen eines Kekses (vgl. auch Beschreibung II in Kapitel 3) körperliche Resonanzen sind und nicht auf eine »äußere« Quelle oder Herkunft zurückgeführt werden können. Wenn sie auch unterschiedlicher Gründe haben, so kommen sie doch nicht aus der Umgebungswelt des Menschen. Die Atmosphäre einer Stadt lebt dagegen geradezu von den Geräuschen, die die Menschen in ihrer Umwelt machen. Die Mittagszeit an einem heißen Sommertag drückt sich infolge der leicht sedierten Rhythmen der anwesenden Menschen in einer gedämpften Lebendigkeit aus, die sich von Grund auf von der relativen Lautlosigkeit nächtlicher Stunden in einem Industrieviertel unterscheidet. Auf eine ganz andere leibliche Dimension existenzieller Geräu sche macht Charlotte Uzarewicz aufmerksam. In einer Studie zur Geräuschwahrnehmung in der Krankenpflege konkretisiert sie auf der Basis einer empirischen Studie zur Geräuschwahrnehmung von Pflegekräften die Vielfalt situationsgebundener Geräusche Kranker: »Bei den Humangeräuschen steht der Schrei bzw. Hilferuf an oberster Stelle der Häufigkeitsliste: Schreie, Geschrei, ´Hilfe, Schwester!‘«, daneben aber ebenso Töne »(von Gebärden), Lachen, Rülpsen, Schlür fen, Meckern«170. Diese zum Teil alarmierenden Laute und Rufe sind Spiegel leiblichen Befindens, das auf die einschnürende Enge von Schmerz und extremem Unbehagen hinweist und nicht auf die entspannte Behaglichkeit von Gefühlen der Weite. Auch Pflegekräfte, 169 170
Ebd., S. 11. Uzarewicz, Hörbare Pflege? S. 310.
112 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Geräusche als Gesten im symbolischen Raum
die in ihrer spezifischen Berufserfahrung eine Vielzahl unmittelbar vom Menschen ausgehender Eigengeräusche kennen und verstehen müssen, erleben das Gehörte überwiegend in beengenden (alarmie renden) Gefühlen und nicht in solchen der Weite (und Entspannung). Das angespannte und gestresste eigenleibliche Befinden ist in seinem gefühlsmäßigen Vitalton räumlich spürbar – bei Patienten wie bei Pflegekräften in je eigener Weise. Patientengeräusche werden von einer Pflegekraft nie lediglich »akustisch« vernommen, sondern in einer aufmerkenden Weise als lautlicher Ausdruck leiblichen Befin dens. Was mit den Ohren gehört wird, ruft leibliches Wissen über das Ergehen eines Kranken wach. Vor dem Hintergrund einer pathischen Beziehung zum Patienten mündet es in aller Regel in eine situations angemessene Bewertung und ein berufsspezifisch angemessenes Ver halten.
Geräusche als Gesten im symbolischen Raum Geräusche wecken auch in Gestalt von Gesten die Aufmerksamkeit – kommentierend, parodierend, pointierend oder auf andere narrative Weise. Gestische Geräusche sind symbolische Äußerungen. Es gibt sie in einer soziologisch hohen Differenzierung. Angehörige aller sozialer Gruppen bedienen sich ihrer u. a. rollenspezifisch wie identi tätsstrategisch und oft mehr unbewusst als vor dem Hintergrund einer dezidierten Programmatik. Das Aufröhren-Lassen des manipulierten Auspuffs dient nicht dem besseren Fahren eines Automobils, sondern der pointierten Selbstinszenierung. Das leise Räuspern des Mitglie des einer Kommission dient nicht der Verbesserung der Atmung, son dern der »Bekundung« eines gewissen Unbehagens in einer delikaten Verhandlungsphase. Gestische Geräusche mit symbolischem Charak ter fungieren im sozialen Raum als Medien der Kommunikation. Es ist in besonderer Weise der atmosphärische Raum, der z. B. durch gestische Geräusche in seinem Grundton umgestimmt werden soll. Aber nicht immer, wenn Geräusche etwas zu verstehen geben, sind sie auch schon Medien der Kommunikation. So schiebt ein Bagger in der obigen Beschreibung »weiche« Baustoffe von einer Stelle zur anderen. Damit kommuniziert niemand irgend etwas. Es entsteht lediglich prozessbedingt ein Geräusch, das einen taktilen Höreindruck ins atmosphärische Raumerleben überträgt – das Geräusch eines als weich empfundenen Stoffes in ein Gefühl des Weichen.
113 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
6. Geräuschhaftes Raumerleben
Geräusche in einer »urbanen Dermatologie« Wenn Mădălina Diaconu in ihrer multisensorischen Anthropologie urbaner Räume von einer »Haut der Stadt«171 spricht, die gleich einer dermatologischen Schicht die Spuren städtischen Lebens in sich aufnimmt, so kommen damit Lebensäußerungen in den Blick, die sich wie in Häutungen historisch immer wieder aktualisieren. Geräusche scheinen indes – ähnlich wie die Gerüche, denen sich Mădălina Diaconu ausführlich widmet – aber doch mehr über die Haut der Stadt hinwegzuschweben als in sie einzusickern. Sie lassen sich (in einer »urbanen Dermatologie«) nicht entdecken wie Abdrücke in einer archäologischen Schicht. Und doch brechen sie sich am Material, werden von den glatten steinernen und gläsernen Wänden der Bürotürme zurückgeworfen oder von den mit Teppichboden ausgelegten Eingängen der Bürogebäude verschluckt. Sie bleiben im weichen Blattwerk der innerstädtischen Parkvegetation hängen, werden von dicken Friedhofsmauern abgeschirmt und gleiten über aseptisch-glatte Betonflächen modernistischer Stadtplätze hinweg. Wo sich die Stadt in ihrem Leben atmosphärisch verdichtet, macht sie meistens auch im auditiven Raum auf sich aufmerksam. Es gibt Räume und Orte der Stadt, die man in ihrer gedämpften Lautlichkeit erlebt, und solche, die im schrillen Tönen und dröhnen den Donnern des Straßenverkehrs zu hören sind. Die Hintergrund geräusche der Stadt gehen in Atmosphären auf, allzumal dort, wo sich das urbane Leben ortsspezifisch ausdrückt – auf dem Markt, am Bahnhof, in der zentralen Einkaufsstraße. Die Metapher von der Haut der Stadt fordert gerade in ihren stofflichen Implikationen dazu heraus, auf geräuschhafte Spuren zu hören, die sowohl auf feste Substanzen wie auf soziale Ressourcen verweisen. Wenn das Sehen auch der erste Sinn (nicht nur des Raumerlebens) ist, so stellt sich jede Stadt doch als eine plurale ästhetische Welt dar, die sich in sinnlich mannigfaltigen und zugleich heterogenen Eindrücken präsentiert. Das Hörbare spielt darin eine zentrale Rolle, wenn wir es auch nicht wahrnehmen wie die Fassade eines Bauwerks, das sich in bestimmten Stilen und Materialien zeigt. Sobald es Geräusche im herumwirklichen Raum gibt, stimmt das Hörbare auch sein Erleben. Schon das allein mögliche Geräusch ragt in die Erwartung hinein – 171 Diaconu, Sinnesraum spheric ›Skin‹ of the City.
Stadt,
S. 101;
vgl.
auch
Griffero,
The
114 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Atmo
Geräusche in einer »urbanen Dermatologie«
sofern wir es an einem bestimmten Ort in bestimmter Weise seines Erscheinens früher schon einmal kennengelernt haben. Was man heute konstruktivistisch eine Projektion nennen würden, sprach Willy Hellpach als »Erwartungseidese«172 an. Danach vernimmt man einen Laut, den man aus Erfahrung kennt, in gewisser Weise schon, bevor er tatsächlich da ist. Die Erwartung bahnt dann eine Erlebnisperspektive, die schon lebendig wird, obwohl in einem räumlichen Herum (noch) gar nichts geschieht. Die sinnliche Wahrnehmung von Räumen der Stadt verdankt sich nicht nur visuell eindrücklich werdender Bilder, sondern schon einer bildhaften Ästhetik, in der auch Geräusche das Gestalterleben prägen – neben allen anderen Eindrücken, die das mitweltliche Befin den tangieren: die uns gut oder schlecht stimmenden ebenso wie die, die uns aufregen oder langweilen. Sie alle wurzeln im sinnlichen Synchronerleben. Den Charakter einer »Summe« visueller, lautlicher, olfaktorischer oder taktiler Reize haben sie aber nicht. Eindrücke konstituieren in ihrer autopoietischen Simultaneität im metaphori schen Sinne ein »Bild« dessen, was gerade um und mit uns ist. In solchen Ein-Bildungen mögen die visuellen (im engeren Verständnis bildlichen) Elemente dominieren. In den Herumraum einer bildhaft erfahrenen Gegend hören wir dann genauer hinein, wenn etwas aus ihm lautlich hervorsticht oder plötzlich die Aufmerksamkeit weckt. Solche lückenhaften und unterbrechenden Momente gibt es gerade in der Eindruckswelt des Schalls. Die Unterbrechung eines fortdauern den Geräusches öffnet in gewisser Weise einen auditiven Leerraum, der sich in einer eigenen Räumlichkeit als ein »Dazwischen« (s. obige Beschreibung) konstituiert. Im Moment der (plötzlichen) Unterbre chung kontinuierlich dauernder Geräusche strukturiert sich der laut liche Raum um, so dass ein atmosphärisch verändertes Ortsgefüge wahrnehmbar wird. Aus diesem kann nun etwas Einzelnes hervortre ten, auf dass sich alles andere zu einem Hintergrund-Geräusch ver bindet.
172
Hellpach, Sinne und Seele, S. 29.
115 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
6. Geräuschhaftes Raumerleben
Geräuschhafter Bewegungsraum Im genaueren Hin-Hören offenbart sich auch der Bewegungs-Cha rakter der Geräusche. Sie sind nämlich nicht fix an einer Stelle im Raum wie feststoffliche Gegenstände. Geräusche sind Bewegung. Sie können sich deshalb auch (weg-)bewegen. Man kann die Stadt und ihren Rhythmus nur verstehen, wenn man auch auf ihre Geräusche achtet. Wie ein bestimmtes Gefäß nur so und nicht anders klingt, je nach dem, was in ihm ist und wie weit es gefüllt ist, so drückt sich eine Stadt entsprechend ihrem Charakter, ihrer Lage und ihrem gelebten Takt in einer auditiven Physiognomie aus. Eine Stadt am Meer klingt anders als eine im Hochgebirge, eine Industriestadt anders als eine Behördenstadt. Städte »bewegen« sich (in einem mehrfachen Sinne) auf eigene Weise. In einem nicht-materiellen Verständnis »schwimmen« ihre Atmosphären im prädimensionalen Raum; ihre Klangkurven folgen amplitudenartigen Verläufen, setzen aus, fangen wieder an – verändern sich mitunter scheinbar ganz grundlos, vom Gemütlichen ins Hektische, vom Langweiligen ins Aufregende. Was eben noch war, kann im nächsten Moment (als Halbding) einfach weg sein.173 In der obigen Beschreibung ist davon die Rede, dass ein lärmen der Rüttler von einem Arbeiter an einen »Lärmrand« geschoben wird, also in eine Gegend, die merklich an Lautstärke verliert. Mit der »Bewegung« eines Geräuschs erfährt der atmosphärische Raum eine Wandlung. Wenn sich das Gesicht eines Geräusches in einer bestimmten Weise verändert und schließlich in anderen Zügen wie derkommt, hat es sich nicht nur selbst verändert, sondern auch den Raum, in dem es erscheint. Dieser hat zwar keine tatsächlichen Rän der wie eine Kiste, aber er konstituiert sich in seiner Lautlichkeit doch als eine herumräumliche Eindrucksqualität. Der spitze Ton kommt in seiner epikritischen Eigenschaft darin näher und greift »härter« an als der dumpfe Ton, der in seiner protopathischen Eigenschaft »weicher« und distanzierter im räumlichen Hintergrund bleibt. Durch die WegBewegungen suggerieren sich auditiv gleichsam »wandernde« Rän der eines lautlich-atmosphärischen Weniger- oder Blasser-Werdens. Geräusche bewegen sich »schwebend« im Raum wie atmosphärische Schmitz sagt über die Halbdinge, dass sie kommen und gehen, ohne dass es Sinn macht zu fragen, wo sie in der Zwischenzeit gewesen sind, vgl. Schmitz, Sys tem der Philosophie. Band III/Teil 5, § 245.
173
116 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Geräuscherleben im historischen Wandel
Inseln. Was man mit den Augen sieht, kann man ein zweites Mal am selben Ort sehen, sofern es sich nicht von der Stelle bewegt hat. Was man mit den Ohren hört, ist immer in Bewegung, auch wenn die Schallquelle nicht bewegt wird. Man kann alles nur einmal hören. Es gibt nur Schall-Originale und darauf bezogene originäre Höreindrü cke.
Geräuscherleben im historischen Wandel Auf den spezifisch ästhetischen Charakter von Höreindrücken hatte schon Johannes Volkelt, Verfasser der letzten systematischen Ästhetik des 19. Jahrhunderts, hingewiesen: »Und ähnlich [bezogen auf die Bewegungsempfindungen des Auges, JH] schwebt das Reich der Töne an uns heran, ohne daß unter gewöhnlichen Bedingungen irgend etwas von der Verwicklung unserer Leiblichkeit mit den her andringenden Reizen gespürt würde. Wir spüren beim Hören in der Ohrengegend schlechtweg gar nichts.«174 Das Gehörte affiziert in seiner Immaterialität nämlich anders als das Gesehene. Es bringt den Hörenden in eine andere (herum-)räumliche Beziehung zum Gehörten als den Sehenden in Beziehung zu einem visuell erfassten Gegenstand. Eine sanfte Melodie versetzt ihren Hörer in einen im synästhetischen Sinne weichen Weiteraum, während das Geheul eines Wolfes den leiblichen Raum eines nächtlichen Wanderers in die Enge treibt. Geräusche werden schließlich stets aus dem Resonanzraum einer (Sub-)Kultur heraus wahrgenommen und nie aus einem a-semioti schen Hier-und-Jetzt. Sie erreichen die Aufmerksamkeit nicht als inselhafte Reize, die als Entitäten für sich stehen. Sie bedeuten, was man gelernt hat, mit ihnen zu verbinden. »Aus dem Rauschen lernen wir im Lauf unseres Lebens Geräusche herauszulösen, die wir zuordnen, deuten, bedeuten. Dieser Lernprozess strukturiert den uns umgebenden, leiblich erfahrenen Raum in Felder der Bedeutung bzw. reichert ihn mit sich anbietenden Bedeutsamkeiten an.«175 Geräusche geben sich vor einem kulturellen Hintergrund zu verstehen. Das laute Dröhnen eines Baggers beängstigt nicht (s. oben), es beruhigt aber auch nicht. Aber es gibt auch bedrohliche und beängstigende 174 175
Volkelt, System der Ästhetik. Band I, S. 96f. Runkel, Klangräume der Erlebnisgesellschaft, S. 34.
117 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
6. Geräuschhaftes Raumerleben
Situationen, in denen ein Bagger zu hören ist. Im Unterschied zu einem Abbruchbagger erwarten wir von einer Baumaschine, die dabei hilft, ein neues Haus zu errichten, etwas Aufbauendes. Aber nicht jedes Aufbauen ist mit positiven Werten verbunden, gibt es doch eine Reihe durch und durch dystopischer Architekturen, die, bevor sie in Betrieb genommen werden können, zunächst aufgebaut werden müssen (wie z. B. Hinrichtungsstätten). Die Beziehung zum Lauten war vor rund 100 Jahren zur Hoch zeit der Industrialisierung noch ganz durch die neuen Eindrücke von Maschinen gestimmt, die heute selbstverständlich im Rauschen des Alltages untergehen und kaum noch die zugewandte Beachtung finden. Während laute technische Geräusche seinerzeit mit Kraft und Fortschritt assoziiert wurden, haben sich diese Bedeutungen in der Gegenwart verloren. In einigen afrikanischen Kulturen war es der Sound der Trommeln, der die Stärke und Macht der Tradition bedeutete und mitunter immer noch bedeutet.176 Im historischen Rückblick bedurfte es nicht erst der Dampf maschine, um sich mit der Ubiquität des technisch unüberhörbar Tönenden, Klingenden und Lärmenden konfrontiert zu sehen. In der Technikgeschichte hatten die Pferdegespanne noch in der Zeit der beginnenden Ausbreitung des Automobils um 1900 auf gepflasterten Straßen für eine ganz eigenartig laute bis lärmende Geräuschkulisse gesorgt.177 Eine der strukturell größten Umbrüche im tönenden Stadt leben brachte indes die Ausbreitung des Automobils mit sich: »Das gesteigerte Verkehrsgeschehen in den Metropolen zwang nicht nur dem Einzelnen neue Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen auf, sondern revolutionierte auch das Stadt- und Straßenbild und schuf einen völlig neuen akustischen Raum.«178 Um die Mitte des 19. Jahrhunderts entfachte die Erfindung der Eisenbahn mit dem Ausbau der Gleise und Bahnhöfe eine große Debatte um die gesundheitspo litische Akzeptanz von Maschinenlärm. Die Eisenbahn erlebten die Menschen seinerzeit noch vor dem Hintergrund gewohnter (viel leiserer) Geräuschkulissen; deshalb empfanden sie sie auch als über aus lärmend und geradezu krankmachend. Für das damals Übliche
176 177 178
Vgl. Bijsterveld, The Diabolical Symphony of the Mechanical Age, S. 41. Vgl. ebd. Payer, Signum des Urbanen, S. 37.
118 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Geräuscherleben im historischen Wandel
stampften die Züge in einem unvorstellbaren Getöse durch Stadt und Landschaft.179 Die Geräusch- bzw. Lärmquellen haben sich im Laufe der Zeit und mit dem technischen Fortschritt variiert. Neue »Problemgeräu sche« werden entdeckt, alte werden als Folge ihrer Relativierung kaum noch zur Kenntnis genommen. Technische Fortschritte haben einerseits zur Minimierung störender Geräuschimmissionen geführt, andererseits haben Erfindungen immer wieder neue Geräuschherde entstehen lassen. Der Zeitgeist hat stets die noch nicht gewohnten Geräusche zum Anlass der Erregung genommen. In der sich immer wieder mit dem noch nicht Vertrauten auseinandersetzenden Kritik zeigten sich schließlich (diskursive) Praktiken des Fertigwerdens mit dem Lauten. Neue Akzeptanzen machten deutlich, dass und wie die Menschen begannen, sich mit den herrschenden Verhältnissen zu arrangieren. Das betrifft vor allem die Verkehrsmittel – von der Eisenbahn über das Automobil (mit Verbrennungsmotor) und Kraftrad bis hin zum Überschallflugzeug. Es betrifft aber ebenso den sich in seiner Geräuschhaftigkeit wandelnden Raum privater Lebensund Wohnwelten. Technische Innovationen machen oftmals neue Geräusche – so der laut heulende Laubstaubsauger vor dem Haus und der leise surrende Staubsaugerautomat in der Wohnung. Auf einem gesellschaftlichen wie energiepolitischen Niveau sind es heute u. a. die Windkraftanlagen, die mit ihren drehenden Rotoren einen dauerhaften Geräuschteppich über ganzen Wohnsiedlungen ausbrei ten und Debatten über die Zumutbarkeit von technischem Lärm auslösen. Viele Alltagsgeräusche unterstreichen in ihrer Ubiquität und stummen Hinnahme (weit diesseits bewusster Akzeptanz) die Notwendigkeit der ethischen Legitimation von Innovationen, allzu mal solcher Geräte und Maschinen, deren Sinn und Notwendigkeit bestritten werden kann.
179
Vgl. Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, S. 109.
119 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
7. Zur Verwurzelung von Geräuschen in Situationen
Mal plätschert der Gebirgsbach durch sein felsiges Bett, dann donnert er ins Tal und reißt im tosenden Rauschen herumliegendes Gehölz in seinen Strom. Mit dem Wechsel von Klima, Wetter und Hydrologie wandelt sich das Gesicht von Gewässern, Wiesen und Feldern. Der lautlichen Veränderung unterliegen ebenso die Verkehrsströme, die die Städte täglich fluten. In ihren mal lärmend und dann wieder fast schweigsam dahinschleichenden Rhythmen pulsiert das urbane Leben. Sichtbar ist das scheinbar nie endende Hindurch und Dahin in einer Unzahl von Automobilen, die durch die Stadtstraßen rollen – Personenwagen, Kleinlaster, Busse, Traktoren, Sattelschlepper und Tankwagen. Zum bunten und heterogenen Gemisch der gleichsam flimmernden Bildsequenzen gehört auch eine lautliche Seite: die chaotische Vielstimmigkeit der unterschiedlichen Fahrzeuge, die im Raum der Stadt ihre Bahnen ziehen – beschleunigend im aufsteigen den Motorengeräusch sowie bremsend mit quietschenden Reifen. Auf den ersten Blick sind es diese Fahrzeuge selbst, die anders als schwer polternde Züge und abermals anders als kaum hörbare Schiffe, Menschen und Güter in die Stadt bringen oder aus ihr herausfahren. Sämtliche Fahrzeuge werden als Medien der Mobilität aber doch nur bewegt, weil Personen oder Transportgüter von einem Ort zum anderen verfrachtet werden müssen. Meistens sind es Maschinen, die Krach machen – oder beinahe unhörbar dahinzuschweben scheinen wie Raumgleiter. All diese Ströme spiegeln den situativ je aktuellen Rhythmus der Stadt wider. Am frühen Morgen ist der ein anderer als am späten Abend, im tief verschneiten Winter ein anderer als in der lähmenden Hitze des Hochsommers, anders an einem Arbeitstag als an einem Sonn- oder Feiertag. In den je entstehenden Geräuschen der Stadt klingen Resonanzen natürlicher wie gesellschaftlicher Verhält nisse an. Oft sind sie auch ein Widerhall dessen, was politisch gerade vor sich geht. Meistens gehören Geräusche oder andere sinnliche Eindrücke mehr zu einer Situation, als dass sie selber eine begründen. Der
121 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
7. Zur Verwurzelung von Geräuschen in Situationen
knatternde Auspuff eines defekten Fahrzeuges macht Krach. Des halb könnte man schon darin eine (zumindest großmaßstäbliche) Geräuschsituation sehen. Das Knattern ist jedoch insbesondere Aus druck der Situation eines defekt dahinfahrenden Lastwagens, der herumstehende Menschen stört; das Knattern gehört also zu einem Zusammenhang, der sich aus dem Geräusch allein nicht erschließt. Ein leichter Wind kann schon für sich eine Geräuschsituation begrün den, die in die Atmosphäre räumlich ausgebreiteter Stille mündet. Das seichte Wehen kann aber auch lediglich Facette einer sozialen Situa tion von untergeordneter Bedeutung sein (z. B. zweier Spaziergänger am Strand). Ein tobend-rauschender Sturm, der am körperlich festen Stand rüttelt, macht dagegen eher die Essenz einer extremen Wetter situation aus. Das Rauschen der hoch oben am dunklen Nachthimmel vorüberfliegenden Wildgänse fügt sich für den Ornithologen in eine wissenschaftliche Erkenntnis-Situation ein, während es für das Kind, das etwas so Eigenartiges das erste Mal in seinem Leben zu hören bekommt, ein aufregendes Erlebnis ist. Das Rauschen der Lautspre cher nach Programmschluss eines Radiosenders ist ein anderes als das scheinbar gleiche, das als Folge einer technischen Störung während der Mittagsnachrichten für Irritationen sorgt. Auch ein mächtiger Regenguss zeigt sich in seinem rasselnden Niederprasseln situativ anders als im strömend-flächigen Rauschen auf einem Blechdach. Diese einstweilen beispielhaft aufgelisteten Situationsunterschiede weisen nicht zuletzt darauf hin, dass ein sinnlicher Eindruck in seiner Bindung an Situationen höchst unterschiedliche Bedeutungen vermitteln kann – im sozialen oder politischen Sinne, aber auch dank der synästhetischen Übertragung eines sinnlichen Eindrucks in eine Empfindung. So ist das Rauschen der erntereifen Ähren im sommerlichen Kornfeld (im synästhetischen Sinne) weicher als das Geräusch, das beim Ausschütten von hartem Schotter auf einer Baustelle entsteht. Im Kontext spezifischer Bedeutungen hören sich in Bewegung befindliche Textilien wieder ganz anders an: das seidene Rauschen der wogenden Falten eines »feierlichen« Gewandes oder das geradezu »dramatische« Rauschen des am Ende des Schauspiels auf die Theaterbühne sich herabsenkenden Vorhangs. Auf den atmosphä rischen »Ton« einer Atmosphäre wirken noch Eindrücke ein, die vom »Habitus« eines Rauschens ausgehen. Deshalb spielen sich im Erle ben eines Geräusches auch die Bedingungen seiner Schallausbreitung wieder. Schließlich ist es Spiegel der Situation, in der es wurzelt.
122 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Situationen sind Ganzheiten
Situationen sind Ganzheiten Viele Situationen drücken sich in besonderer Weise in Geräuschen aus, oft sogar in auditiv ekstatischen Gesichtern wie dem peitschenden Schlag von Blitz und Donner. Ein Geräusch macht dann den zentralen Sachverhalt einer Situation aus. Unter einer Situation verstand Karl fried Graf von Dürckheim »jede sich für das erlebende Bewußtsein von Augenblick zu Augenblick als Einheit im Zugleich konstituie rende Bewußtseinsmannigfaltigkeit«180. Mit anderen Worten: Eine Situation kommt schon auf den ersten Blick mehr oder weniger als Zusammenhängendes zur Erscheinung: das aus den Höhen des Himmels herunterbrechende Gewitter, wie das in der Mitte der Stadt eskalierende Verkehrschaos. Als eine sich von selbst zu verstehen gebende Ganzheit begreift auch Hermann Schmitz eine Situation. Als Kernstück seiner Neuen Phänomenologie hat der Kieler Philosoph ein systematisch aufgebautes Situations-Konzept entwickelt.181 Ich werde mich im Folgenden auf diesen Situations-Begriff stützen, weil er sich für die Reflexion von Geräuschen anbietet.182 Diese kommen (gewissermaßen auf der Objektseite) von irgendwo her, während sie auf der Subjektseite auf das befindliche So-Sein einer Person einwirken. Situationen versteht Schmitz als Einheiten, die gleichsam schlagartig wahrnehmbar werden und keiner komplizierten Rekon struktion verdeckter Zusammenhänge bedürfen, noch eine aufwen dige Verständigung darüber verlangen, was sie ausmacht. Er spricht sie auch als Horte von Bedeutungen an, als »Heimstätten, Quellen und Partner«183 allen menschlichen Verhaltens. In einer komplexen Welt sind Situationen aber nicht einzeln wie einsame Inseln im Ozean, sondern »unübersehbar in Situationen verschachtelt«184. Dürckheim, Erlebensformen, S. 267. Vgl. Schmitz, System der Philosophie. 182 Der Begriff der Situation ist seit dem 20. Jahrhundert ein wichtiger Terminus in der Philosophie, vor allem der Existenzphilosophie. Nach Nikolai Hartmann besteht das menschliche Leben aus einer nicht abreißenden Kette von Situationen; vgl. Wetz, Franz Josef: »Situation«, Sp. 925. Nach Max Scheeler ist die gegenwär tige Situation der Ausgangspunkt allen menschlichen Handelns; vgl. ebd., 927. Außerhalb der Philosophie bedienen sich auch andere Disziplinen (wie Soziologie, Psychologie, Psychiatrie, Theologie und Umweltwissenschaft) eines je spezifischen Situationsbegriffes. 183 Schmitz, Was ist Neue Phänomenologie?, S. 91. 184 Ebd., S. 92. 180 181
123 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
7. Zur Verwurzelung von Geräuschen in Situationen
Der Schmitz´sche Situations-Begriff weist eine hohe Binnendif ferenzierung auf, die dabei nützlich ist, die Dynamik der Verwicklung von Menschen und Dingen detailreich aufzuschlüsseln. Eine Situation besteht mindestens aus Sachverhalten »(dass etwas ist, überhaupt oder irgendwie)«185, daneben meistens auch aus Programmen »(dass etwas sein soll oder möge)«186 und oft zudem aus Problemen (einer Unsicherheit und der daraus resultierenden Frage, ob etwas ist). Schließlich ist zwischen persönlichen und gemeinsamen Situationen zu unterscheiden sowie zwischen impressiven (die sich in ihrer Ganzheit auf einen Schlag zu verstehen geben) und segmentierten (die der nachspürenden Durchsuchung auf ihre Merkmale hin erst noch bedürfen). Das Beispiel der Baustellengeräusche (s. Beschreibung IV in Kapitel 6) öffnet eine facettenreiche Sicht auf eine komplexe Situation. In der Beschreibung überlagern sich die Geräusche von zwei Baustel len in unmittelbarer Nachbarschaft. An beiden Orten herrschen je eigene technische Abläufe, die separate Arbeitertrupps bewerkstelli gen. Zwar stellt sich jede Baustelle als eine eigene Situation dar (eine des Hoch- und eine des Tiefbaus), jedoch gibt es einen organi satorischen und praktischen Grenzgürtel, auf dem die Personen und Dinge mitunter ihre Orte wechseln (die Arbeiter beider Baustellen sprechen miteinander, manchmal tauschen sie auch Werkzeuge aus). Beide Baustellen sind trotz unternehmerischer und praktischer Eigen ständigkeit zumindest temporär ineinander verzahnt. Ihre Geräusche breiten sich dagegen grenzenlos im Raum aus. Mit anderen Worten: Während die organisatorisch-handwerkliche Seite weitgehend klare Sachverhalte und Programme aufweist, konstituiert sich die lautliche Dimension der ineinander verschachtelten Situationen ohne Barrie ren und diffus im Raum beider Handlungswelten. Sie überwölbt die ganze Gegend des baulichen Geschehens in Gestalt einer Atmosphäre. Beide Baustellen gibt es in ihrer Materialität und Performativität unabhängig vom subjektiven Erleben als etwas Objektives. Dazu gehört die Realität der Dinge, Menschen und auditiven Ereignisse, die erst zusammen die Eindrücke einer dynamisch und lebendig erscheinenden Wirklichkeit entstehen lassen. Die Realität dessen, was es stofflich und tatsächlich gibt, transzendiert ins Wirkliche des Erscheinens. Im Fokus der Realität stehen die Sachverhalte der exis 185 186
Ebd., S. 89. Ebd.
124 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Situationen sind Ganzheiten
tierenden Dinge und Arbeiter. Im Fokus des Wirklichen vernetzt sich alles Existierende zu einem sich bewegenden Ganzen. Die Werkzeuge der Arbeiter gibt es in dieser Sphäre nicht nur als materielle Gegen stände, sondern darüber hinaus als ertönende Dinge, die aus ihren aktuellen Wirkungszusammenhängen heraus »lebendig« werden. Die Wirklichkeit der Welt wird vom Wirkenden getragen, vom sich Bewegenden, dem wechselhaft Erscheinenden, dem Affizierenden etc. Während das Baugeschehen einem absehbaren Programmablauf folgt (z. B. dem Ziel, ein Haus zu bauen), folgen die Geräusche keinem solchen. Am Beispiel sind sie Nebeneffekte von Bautätigkeiten, bei denen eher laute als leise Maschinen eingesetzt werden. Geräusche sind Situationen im weiteren Sinne. Diese bedürfen keiner Programme und keiner Probleme; sie beschränken sich auf Sachverhalte. Sie existieren schon deshalb diesseits von Program men, weil sie sich unabhängig von Absichten im Raum ausbreiten. Ein Geräusch entsteht, wenn Dinge bewegt werden oder Naturereig nisse wie Gewitter oder Vulkanausbrüche geschehen. Kein Geräusch erzeugt sich um seiner selbst willen. Es kann auch kein Problem mit sich selbst haben, denn diese kommen erst mit der subjektiven (indi viduellen wie kollektiven) Betroffenheit von Schallemissionen in die soziale Welt. Sie resultieren aus der personalen Verwicklung in eine auditive Situation. Zu einem Problem wird ein Schallereignis aber nicht schon deshalb, weil es »sehr laut« ist und einen zulässigen akus tischen Grenzwert überschreitet. Zu einem Problem wird es, sobald es ein beengendes Unbehagen auslöst und mit einem ablehnenden Empfinden einhergeht. Eine vielleicht »objektiv« unbestreitbar hohe Lautstärke wird all jene Menschen nicht stören, beeinträchtigen oder unbehaglich berühren, die das Kreischen von Sägen und das Rattern von Betonmeißeln als Zeichen gelingenden Baufortschritts betrachten, es also mit zustimmenden und emotional aufbauenden Bedeutungen assoziieren. Zur Situation eines Geräusches gehören Bewegungen. Ein Geräusch bewegt sich aber nicht nur, es ist in gewisser Weise selbst eine (plurale) Bewegung. Es bewegt sich immer in bestimmter Weise und als Ausdruck von etwas. Akustische Emissionen gibt es auf einer Objektseite, Geräusche auf einer Subjektseite. Schon die Fachtermi nologie unterscheidet zwischen Emission (der Aussendung einer z. B. akustischen Schallmenge) und Immission (dem, was ein Schall im Hörenden bewirkt). Geräusche sind in Situationen gebettet, welche in andere Situationen verwickelt sind. In Bewegung sind alle.
125 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
7. Zur Verwurzelung von Geräuschen in Situationen
Was Individuen subjektiv empfinden, spiegelt sich in komplexen Gesellschaften auf dem Niveau soziologischer Gruppen ähnlich oder abgewandelt wider. Menschen lernen schon in ihrer frühkindlichen Entwicklung, sinnliche Eindrücke mit Bedeutungen zu verknüpfen. Später wirken Schule und Hochschule (je nach Fakultät) mehr oder weniger daran mit, Kenntnisse mit Ideologien einzufärben, auf dass eine Situation im Spiegel geteilter Gefühle in angestrebter Weise affizieren möge. Deshalb gibt es Probleme auch nicht nur auf dem Niveau persönlicher Situationen, sondern ebenso auf dem gemeinsa mer. Das Bundesimmissionsschutzgesetz definiert in diesem Sinne gemeinsame Probleme. Es setzt Normen, die gesellschaftlich allge meinverbindliche Belastungsgrenzwerte festschreiben, die nicht nur für eine einzelne Person gültig sind. Zu Programmen der Geräusch abwehr gehört der Einsatz von schallisolierenden Fensterscheiben oder der Ersatz lauter Baumaschinen durch emissionstechnisch opti mierte Modelle. Solche Programme beziehen sich aber nicht auf ganzheitliche Situationen, sondern lediglich auf die Emission von Schallmengen, die im Allgemeinen als Problem für die menschliche Gesundheit eingestuft werden. Das Beispiel zur Baustelle macht schließlich deutlich, dass nicht alle Geräusche »auf einen Schlag«187 (impressiv) verstanden werden. Das ist nur dann der Fall, wenn sie von vornherein in ihrer Situa tionsverwurzelung verständlich sind (wie das Fahrgeräusch eines Frontladers, der sich vor den eigenen Augen bewegt und Schotter gleichmäßig verteilt). Wenn die Beziehung eines Geräuschs zu einer rahmenden Situation dagegen undeutlich ist und erst der aufschlie ßenden Durchdringung bedarf, verlangt die Reflexion zunächst die Segmentierung eines Eindruckes.188 Segmentiert in diesem Sinne erschien ein hintergründig schwebendes Geräusch, das in seiner eigenartigen Räumlichkeit und gewissen Ortlosigkeit »in der Luft« hing und zunächst auf keinen Ausgangspunkt zurückgeführt werden konnte (s. Beschreibung IV). Ein Geräusch gründet im Allgemeinen in einer aktuellen Situa tion und nicht in einer zuständlichen. Letztere würde bedeuten, dass Veränderungen erst nach längerer Zeit erwartet werden dürften. Etwas, das mehr oder weniger ununterbrochen über die Dauer des ganzen Tages Lärm macht, hätte jedoch weder einen eindeutig aktu 187 188
Schmitz, Kurze Einführung in die Neue Phänomenologie, S. 48. Vgl. ebd.
126 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Situativ vermischte Geräusche
ellen noch eindeutig zuständlichen Situationscharakter.189 In einer zuständlichen Situation der Dauerbeschallung durch Lärm befinden sich die Bewohner zahlreicher im engen Mittelrheintal gelegenen Häuser, die nur einen geringen Abstand zum Schienenstrang der Eisenbahn aufweisen, über den täglich rund 400 Güterzüge rollen.190 Wo eine aktuelle Situation der nächsten folgt, ein Zug gewissermaßen hinter dem anderen herfährt, setzt sich in der Dauerhaftigkeit des dröhnenden Polterns eine zuständliche Situation durch. In eher kur zen Unterbrechungen kann sich keine ausgleichende Kontrasterfah rung entfalten. Schallemissionen von bis zu 100 dB, die von den zum Teil bis zu 50 Jahre alten Güterwaggons mit technisch antiquierten Radreifen ausgehen, bedeuten für die betroffenen Menschen einen unerträglichen Lärm. Die Situation spitzt sich unter ungünstigen Bedingungen ins Unerträgliche zu.
Situativ vermischte Geräusche Was wir hören, ist in eine »Gesamtklanglichkeit« eingebettet, in ein Milieu von welthaftem Charakter, in das man in einem Zustand »sprachlosen Hörens […] eintauchen«191 kann. Etwas lautlich Ver nommenes wird im Unterschied zu etwas Gesehenem als Sachverhalt oder Problem erst bewusst, wenn es sich gegenüber der geradezu monopolistischen Eindrucksmacht des Visuellen behauptet und aus einem Hintergrund des Wahrgenommenen herausragt. Die Situation einer sich nähernden Katze zeigt im fast unhörbar leisen Schleichen des Tieres ein anderes lautliches Gesicht als im warnenden Fauchen. In der Beschreibung IV waren es die allein visuell wahrgenommenen Bewegungen von Möwe und Kormoran, die ganz unerwartet inmitten lauter Baumaschinen einen eindrücklichen Kontrast erzeugt hatten und deshalb in der Wahrnehmung auftauchten. Von Musik abgese hen, ist, was wir hören, oft nur Nebeneffekt situationsimmanenter Vorgänge. Die lautliche Welt ist in eine Gesamtsinnlichkeit integriert, in die sich Geräusche beinahe wie Flüssigkeiten hineinmischen. Eine innerstädtische Straßenkreuzung hört sich anders an als ein innerstädtischer Park und wieder anders als ein Straßencafé oder eine 189 190 191
Vgl. ebd. Vgl. Rippegather, Menschen kämpfen gegen Bahnlärm. Winkler, Übergänge im Hörraum, S. 57f.
127 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
7. Zur Verwurzelung von Geräuschen in Situationen
Tramhaltestelle. Im ganzen Leben einer Stadt bleiben die so verschie denen Geräuschkulissen und -inseln jedoch nicht an »ihren« Orten. Sie verändern sich in einer schwebenden lautlichen Choreographie192 von Situation zu Situation und noch innerhalb einer Situation. So tönt das schon für sich vielfältige Geräusch des Straßenverkehrs mit den menschlichen Stimmen in einem an den Bordstein grenzenden Straßen-Café zusammen. Und durch alles hindurch bringt sich noch das Gezwitscher von Sperlingen, das Krächzen einer Elster und das Aufschlagen hart klingender Schritte einer vorübergehenden Passan tin zu Gehör (s. Beschreibung II in Kapitel 4). Noch die Schreie von Kindern, die lautstark einen Streit ausfechten, könnten sich in spitzen Tönen darüberlegen und aus allem gleichsam hervorragen – auf dass in einem nächsten Moment das ganze Gemisch schon wieder in einem neuen Gesicht erscheinen mag. Mit einer Straßenkreuzung verbinden sich andere Geräusche als mit einem Wochenmarkt und wieder andere als mit dem Rollfeld eines Flughafens. Dies zum einen, weil rein sachverhaltlich an allen Orten etwas je Eigenes geschieht, das auch dementsprechend tönt und rauscht. Dem Hörbaren ist auf der Objektseite eines Geschehens allein jedoch nicht beizukommen, schon weil es erst im subjektiven Erleben zu einem eindrücklichen Geräusch wird. Der Rahmen einer persönlichen Situation verknüpft es mit subjektiven Bedeutungen, solchen der Störung zum einen wie des Behagens zum anderen. Differenzen im Geräuscherleben resultieren aus unterschiedlichen Bedingungen. Vor dem Hintergrund einer Biographie und individuell erlernter Sensibilitäten wird ein Tönen und Schallen (mitunter unab hängig von dB-Werten) zu einem entsetzlichen Lärm oder aber auch zu einer Kulisse, die noch nicht einmal die mindeste Aufmerksamkeit findet. Erst in der Synthese mit situationsspezifischen Bedeutungen wird aus einem akustischen Ereignis ein erlebtes Geräusch. Viele Bedeutungen schlummern unterhalb einer Schicht des Bewusstseins. So mag das hörbare Treiben auf einem gemischten Markt mit seinem weder leisen, noch lauten Stimmengewirr als etwas erscheinen, das scheinbar gar nicht mit Bedeutungen verbunden ist oder aber nur ganz allgemein als vitaler Spiegel des urbanen Raumes erlebt wird. Das Rollfeld eines Flughafens hören und verstehen viele Menschen beinahe unberührt nur als einen Schallraum startender und landen 192 David Seamon spricht hier auch von body-ballet bzw. place choreography; vgl. Seamon, Body-Subject, Time-Space Routines, and Place-Ballets.
128 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Zur Situiertheit einer Person in ihrem So-Hören
der Flugzeuge, so dass der »Lärm« keine affektiven Regungen zur Folge hat. Die durch Bewegung entstehenden Geräuschfelder und -zyklen können zwar durchaus als laut empfunden werden; deshalb müssen sie aber nicht auch schon eine unangenehme und beengende Bedeutung haben. Ohne im üblichen Sinne zu stören, kann der »Lärm« der Flieger über der Stadt als Geräusch gehört werden, das die Bedeutung einer internationalen Verkehrsweiche zu Gehör bringt, oder als Spiegel einer ökonomisch potenten Stadt und Region in einem Netz globaler Ströme. Die meisten Geräusche bedeuten nicht schon für sich etwas; viel mehr weisen sie auf etwas hin. So erkennt man die Kreissäge an ihrem schrill-schneidenden Ton und einen Vorschlaghammer an der wuchtig-dumpfen Schwere seines Schlages. Aus diesem Geräusch wird dieses Werkzeug »herausgehört«, aus jenem ein anderes. Zwar wecken Geräusche oft schon durch ihren Schall die Aufmerksamkeit. Aber mit einem z. B. schrillen und aufschreckenden Ton, der plötzlich in die Glieder fährt, verbindet sich schnell die Frage, wo er herkommt und wovon er ausgeht. Ein Geräusch ist der lautliche Spiegel einer Situation; mal sagt es alles über sie, mal nur etwas von partieller Bedeutung. Um 1900 schrieb Theodor Lessing, der eine Kampagne gegen den Lärm initiierte: »Wer über die russische Steppe gereist ist, der weiß, daß man beim Geheule ganzer Rudel Wölfe ruhig schlafen kann, während der Schrei eines einzelnen hungrigen Wolfes furchtbar beunruhigt und den Schlaf verscheucht.«193 In seinem Beispiel ist es nicht das Geräusch heulender Wölfe im Allgemeinen, das beängstigt. Es ist das situationsspezifische Heulen eines Wolfs, das die Angst schürt. Nur in ihm klingt die Resonanz194 einer feindlichen Welt vor. Allein dieses besondere Wolfsgeheul ist Zeichen einer existenzi ellen Gefahr.
Zur Situiertheit einer Person in ihrem So-Hören Geräusche werden subjektiv als Falten im Gesicht einer Atmosphäre erlebt. Selten tragen sie selbst eine Atmosphäre. Wie und als was Lessing, Der Lärm, S. 54. Hartmut Rosa geht in seiner Soziologie der Weltbeziehung der Frage nach, wie sich Dinge, Tiere und noch die allgemeinsten Verhältnisse, in denen wir leben, als »Resonanzen« zu verstehen geben; vgl. Rosa, Resonanz. 193
194
129 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
7. Zur Verwurzelung von Geräuschen in Situationen
etwas gehört wird, hängt nicht zuletzt von der emotionalen Stimmung eines Hörers ab, aber auch von Hörerwartungen und spezifischen Beziehungen zu einer Geräuschquelle. Der Viehhirte, der die Rufe sei ner verirrten Ziege als deren geradezu »persönliche« Stimme erkennt, hört sein individuelles Tier und nicht ein X-beliebiges. Was wir hören, ist zunächst durch einen objektiv gegebenen Rahmen situiert. Aus ihm tönt hervor, was wir intuitiv mit bestimmten Bedeutun gen verknüpfen. Schließlich wirken Umgebungsbedingungen auf die Schallausbreitung ein und damit auch auf das vernehmbare Geräusch. Im Wehen des Windes bringt sich eine (zudem halbdinghafte) Umge bung wie von selbst zu Gehör. Das Rauschen des Windes entsteht in gewisser Weise aus sich selbst heraus, es geht jedenfalls auf keinen Akt der Erzeugung zurück, wie das von jemandem bewirkte Schlagge räusch eines Hammers. Wenn das Wesen des Windes auch in seinem Wehen aufgeht, so gibt es doch kein Wehen im Allgemeinen und damit auch kein generelles Geräusch, in dem sich Wind schlechthin »äußert«. Als Bewegung befindet er sich in einem ständigen Wandel seiner Erscheinungsweisen, und so mischt er sich – sofern er weht – in alles ein, was wir hören wollen. Windgeräusche können jedoch (z. B. im tobenden Orkan) auch die lautliche Oberhand gewinnen. Dann hört man nur noch sie und spürt ihre Mächtigkeit. Ein Wind kann (selbst als Ausdruck einer göttlichen Geste verstanden) Unheil über die Menschen bringen, sobald sich sein Wehen zu einem barbarischen Getöse aufrichtet und im Gefolge eines geräuschhaften Chaos verhee rende Zerstörungen bewirkt. Er kann aber ebenso leise wie ein Hauch über die Erde streichen und emotional bannen.195 Nicht jedes Wehen zieht die Aufmerksamkeit eines Menschen auf sich. Beachtung finden vor allem solche Windgeräusche, die auf eine gefährliche Situation hinweisen und sich in beängstigenden Affekten zuspitzen. Einen solchen Eindruck beschreibt Theodor Storm im Schimmelreiter. Darin kündigt ein mächtig tobender Sturm eine große Flut an: »Da setzte der Sturm plötzlich aus, und eine Totenstille trat an seine Stelle; nur eine Sekunde lang, dann kam er mit erneuter Wut zurück.«196 Der Wind Vgl. auch Nova, Das Buch des Windes. Storm, Sämtliche Werke, Zweiter Band, S. 811. In der gnostischen Sekte der Sethianer galt der Wind in seiner kosmologischen Bedeutung als geflügelte Schlange; vgl. Reimbold, Die Nacht im Mythos, S. 47f. In der Metapher überträgt sich eine Bewegung in ein Gefühl, das vom Bild eines Tieres repräsentiert wird. Die Bewegung des Windes verwandelt sich darin in das schlängelnde Umwehen von allem, was sich dem Wind in den Weg stellt. So steht die Schlange ihrerseits im 195
196
130 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Zur Situiertheit einer Person in ihrem So-Hören
erscheint hier so gefährlich, dass er wie ein bedrohliches Subjekt auf die Menschen zukommt. Der gleichsam »böse« Wind situiert alle sich bedroht fühlenden Personen in ihrem aktuellen Befinden. Lautliche Eindrücke bilden in ihrem Resonanzcharakter »Zugänge zur Wirklichkeit«. Diese öffnen sich aber nicht nur per sönlich, sondern auch im Allgemeinen.197 Das Hören ist insofern subjektiv disponiert, als es in Folge der persönlichen Ausrichtung der Aufmerksamkeit mehr oder weniger lückenhaft ist. Auf ganz andere Weise ist das Hören Hörgeschädigter »unvollständig«. Wenn sie von einem nuancierten Schallfeld nur ein flach oder verwaschen wirkendes Geräusch hören können, in dem Vorder- und Hintergrund kaum zu trennen sind, so hat dieses Hören physiologische Gründe und nicht solche einer starken oder minderen Aufmerksamkeit. Indi viduell ganz unterschiedliche Hörbilder sind Ausdruck kategorial verschiedener Bedingungen des Hören-Könnens, einmal Resultat von Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit und einmal das schwache Ergebnis kranker Ohren. Abgesehen von der organischen Bedingtheit des Hören-Könnens ist im Hinblick auf das, was wir als Dieses oder Jenes vernehmen, die Situiertheit einer Person in ihrem eigenen biographisch geprägten Leben bedeutsam. Eine Person ist in ihrem So-Hören vielfach situiert – durch ihr Hören-Können in organischer und in verstehender Hinsicht, durch räumliche Abstandsbeziehungen zur Schallquelle sowie durch alle auditiven Eindrücke, die das prinzi piell an einem Ort Hörbare mit anderen Eindrücken vermischen. Was ein Mensch wahrzunehmen vermag, ist nie alleiniges Pro dukt persönlicher Vermögen. Die Subjektivität der Wahrnehmung schließt ein kollektives Moment ihrer Vergesellschaftung nach Inter essen- und Statusgruppen ein. Die Marx´sche Feststellung, wonach die Produktion die Gegenstände nicht nur für die Subjekte her stellt, sondern umgekehrt das Subjekt auch für den Gegenstand gemacht wird198, schließt gruppenspezifische Wahrnehmungsunter schiede ein, die nicht nur die Erfassung von Gegenständen betref fen, sondern ebenso gesellschaftliche Situationen, aus denen heraus Kontext der Weltschöpfung für die Situation einer weltgenerierenden Bewegung. Die Verbindung zur Wirklichkeit, die ein Geräusch herstellt, muss nicht realistisch sein. Sie kann sich eines Mythos verdanken, sich im Lauten verbergen wie im Stil len. 197 Vgl. Baier, Der Raum, S. 32. 198 Vgl. Marx, Einleitung [zur Kritik der Politischen Ökonomie]; http:// www.mlwerke.de/me/me13/me13_615.htm (25.01.2021).
131 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
7. Zur Verwurzelung von Geräuschen in Situationen
etwas wahrgenommen wird. Im 10. Kapitel (über das Hören auf die Maschinen) wird hierauf zurückzukommen sein. Wenn Marx schließ lich »die Bildung der fünf Sinne als Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte« auffasst, so spricht er darin über die Macht der Einverleibung kollektivierender Schablonen der Wahrnehmung.199 Deshalb sind es nicht nur die Gegenstände, für deren Hoch- oder Geringschätzung die menschliche Wahrnehmung eingestellt wird. Das von ihnen Hörbare ist auch Produkt einer gesellschaftlichen Praxis des Hin-Hörens, Weg-Hörens und Hören-Lassens; es hat seine Entstehungsorte in den sozialökologischen Nischen einer von Grund widersprüchen gekennzeichneten Gesellschaft. Vieles von dem, was wir lebensweltlich als etwas »Bedeutungsloses« hören oder in einem »wertneutralen« Sinne zu hören glauben, ist auf einer verdeckten Ebene subkulturell programmiert und symbolisch markiert. Geräusche sind situative Resonanzen, in denen die soziale und natürliche Welt (nach-)tönt. Die Macht bedeutungsgenerierender Programme (z. B. in der Werbung, Produktvermarktung und politi schen Demagogie) situiert auch die Geräusche. Nicht-intentionale Töne und Klänge »entstehen« zwar einfach nur, dennoch schaffen sie einen Rahmen, aus dem heraus eine Situation erlebt wird – wie das Heulen des Windes oder das Scheppern eines umfallenden Kistenstapels. Es sind dann vor allem symbolische und synästhetische Übertragungen, die vom Gehörten Brücken zum gefühlsmäßigen und atmosphärischen Spüren schlagen. In einem atmosphärisch eindrück lichen Bachrauschen suggerieren sich Gefühle zwischen Beruhigung und Erregung, mit dem Rauschen der Maschinen Symbole einer florierenden Ökonomie oder fehlenden Rücksichtnahme. Es gibt eine Reihe von Geräuschen, die programmatisch für spezielle Situationen sogar »komponiert« worden sind, wie »der dumpfe ton der sterbeglocke«200, der ja nicht nur im akustischen Sinne ertönen, sondern als Gefühlsmedium trauerkulturelle Stim mungen wecken soll. Bei den großen und mächtigen Festglocken ist das erst Recht der Fall. Deshalb liegt dem sakralen Programm auch ein technisches Programm für den Glockengießer voraus, muss er durch die Wahl der Materialien für den Guss der Glocke und die Gestaltung des Resonanzkörpers doch sicherstellen, dass der beim Anschlagen erklingende Ton auch die erwünschte Stimmung trifft. 199 200
Vgl. Marx, zitiert bei Holzkamp, Sinnliche Erkenntnis, S. 172. DWB, Band 21, Sp. 700.
132 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Zur Situiertheit einer Person in ihrem So-Hören
Eine Sterbeglocke darf am Ende weder überaus hell, noch allzu tief und schwer klingen. Sie muss situationsgemäß »funktionieren«. Sie muss einen sinnlichen Eindruck spürbar machen, bei dem es nicht in erster Linie aufs Hören mit den Ohren ankommt. Der Klang einer the matisch »programmierten« Glocke kann in einem pathischen Sinne nur »verstanden« werden, wenn er im kollektiv hörenden Gespür der Menschen auch eine einverleibte Gefühlsantwort wachruft. Das Läuten stimmt in einem atmosphärischen Sinne ein und bahnt über das gestimmte »Mitgehen« mit der Gefühlssuggestion der Glocke das leiblich intuitive Situationsverstehen an (s. auch Kapitel 13). Daher kommt es auch nicht nur auf den Klang an, sondern ebenso auf den Rhythmus des Geläuts und seinen Zeitpunkt. Die Situationsbezogenheit der Geräusche spiegelt sich schließ lich in der alltagssprachlichen Redewendung »Der Ton macht die Musik« wider. Der »richtige« Ton tönt in diesem Sinne aber nicht in einem auditiven Sinne. Er steht für die situationsgerechte Präsenz einer Person, für die Art und Weise, wie sich ein Mensch unter seines gleichen zeigt, ob er dem »guten Ton« gerecht wird, herrschenden sittlichen Ansprüchen also genügt oder in seinem rohen »Auftreten« einen schrägen Missklang erzeugt und damit am Ende eine Stim mung verdirbt. In hypermobilen Gesellschaften massentouristischen Unter wegs-Seins sammeln die Menschen – wenn auch eher unbewusst – touristische Eindrücke, deren Erfahrungs-Charakter so lange in den Sternen steht, wie sie nicht nachspürend bedacht und einem zumindest minimalen Aufwand an kritischer Reflexion unterworfen werden. Tony Hiss spricht hier von »experience of deep travel«201. Das betrifft auch viele Geräusche, die mit »typischen« Urlaubssitua tionen assoziiert und retrospektiv als Medien der Romantisierung verzerrt werden.
201
Hiss, In Motion.
133 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
8. Das Hören von etwas
Die Frage was wir hören, wenn wir etwas hören, erscheint paradox. Worauf soll sie abzielen, hören wir doch, was uns zu Ohren kommt. So scheint es zumindest zu sein. Tatsächlich ist die Sache so einfach schon deshalb nicht, weil sich im Hören unbewusst zwei Weltzugänge syn chronisieren: ein sinnlich-spürender und ein geistig-verstehender. Mit anderen Worten: Die Ohren präsentieren uns zwar lautliche Ein drücke; verstanden haben wir damit aber noch nicht, denn Erkenntnis verlangt mehr als gesunde Ohren. Schon lebensweltlich hören wir immer wieder Irritierendes, mit dem wir nichts anzufangen wissen, weil es uns in einen weißen Raum des Ahnens und Suchens stellt. Zwar hören wir so oder so, haben aber deshalb nicht auch schon begriffen. Das lautliche Hören fordert das Verstehen des Gehörten heraus. Über die Grenze führt allein der »Sprung«. Er ist im Sinne von Heidegger ein »Überstieg«202 – hier vom Bereich lautlichen Hörens ins kulturelle Verstehen von Bedeutungen. Erkenntnis bahnt sich allerdings schon auf einem präreflexi ven Niveau an: im einfachen Erinnern von etwas Bekanntem. So erkennt man den eigenen Hund an seinem Bellen, ohne dass dazu ein fokussierendes (Nach-)Denken nötig wird. Das Hören einer feh lerhaft laufenden Maschine reklamiert dagegen das immer genauer werdende und Differenzen erfassende Hin-Hören, auf dass sich aus dem schon vorhandenen, komplexen Wissen um die Funktionsweise des jeweiligen Maschinentyps eine vielleicht hilfreiche Hypothese anbietet, mit welchen Mitteln der Schaden behoben werden kann. Im Bereich des Sozialen hat das verstehende Hören einen anderen Charakter. Dabei geht es nicht um das richtige Hören (z. B. des Wortes »Bett« für das nächtliche Lager im Unterschied zum Brett). Nötig ist ein Hören, das lautlich nur angebahnt wird: ein verstehendes, ganzheitliche Situationen erschließendes Hören. Wenn wir etwas im kognitiven Sinne nicht nur erkennen, son dern im ethischen Sinne auch anerkennen, hören wir tolerierend, 202
Vetter, Grundriss Heidegger, S. 346.
135 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
8. Das Hören von etwas
wertschätzend und einsehend. Die an die Adresse eines eigenwilligen Kindes gerichtete Mahnung: Kannst du denn nicht hören! ist eine Aufforderung zur Anerkennung einer Norm. Die Frage, was wir hören, wenn wir hören, überschreitet – je nach der rahmenden Situation – den Modus des Lautlichen und mündet im sozialen Raum in den Prozess der Verständigung und damit auch oft in die Auseinandersetzung über normative Geltungsansprüche.
Das WAS des Gehörten Die Sinne »sagen« etwas, wenn sie uns einen Eindruck von der herum wirklichen Welt geben. Doch inwieweit verstehen die Menschen die »Sprache« der Sinne in der Gegenwart noch? Haben die spätmodernen High-Tech-Kommunikationsmedien die Individuen schon so irrever sibel mit dem Technischen, Abstrakten, Synthetischen und Artifiziel len verschweißt, dass ihnen bereits trügerisch erscheint, was ohne technisches Interface (gleichsam archaisch) in den Ohren tönt, in der Nase beißt oder auf der Haut juckt? Der Gesichtssinn unterscheidet sich dabei von allen anderen Sinnen, weil er sich zivilisationshisto risch als die sinnliche Magistrale der Welterkenntnis herausgebildet hat. Sein Milieu ist die Welt der Bilder, der Visualisierungen aller Art, vor allem jedoch der Schrift. Derweil ordnen sich auch die Eindrücke der anderen Sinne, indem sie ins Bildhafte transzendieren, den Bild süchten aller Art unter. Ist das »authentisch«-verstehende Hören (des Vogels auf der Zaunlatte oder des Hammers beim Schlagen) als Folge einer gewissen Ubiquität technischen Hörens von Geräuschen, Tönen und Lauten schon aufgerieben und in eine »sekundären Nähe«203 abgedrängt worden? Gesellschaftlich breit diffundierte kulturindustrielle Wahrneh mungsautomatismen haben uns die unvermittelten sinnlichen Ein drücke fremd werden lassen und auf eine zwielichtige Distanz gebracht. In anderer Weise stehen wir jenen ästhetischen Eindrücken, die uns (im Prinzip ähnlich wie in der Kunst) die »Anschauung eines Unanschaulichen« präsentiert, hilflos gegenüber – »begriffsähnlich ohne Begriff«204. In der größer werdenden Distanz zwischen dem intuitiv sicheren Erkennen und dem, was in seinem Fremd-Sein 203 204
Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter, S. 62. Adorno, Ästhetische Theorie, S. 148.
136 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Das WAS des Gehörten
beharrt, zeigt sich eine Schwelle der sinnlichen Wahrnehmung. Sie besteht darin, dass die Brücke vom sinnlichen Eindruck zum mentalen Verstehen denkend erst geschlagen werden muss. Das sinnlich Gegebene muss in eine denkbare Form übertragen werden. In dieser bietet es sich für die Reflexion individuell-subjektiver wie gesellschaftlich-kollektiver Welt- und Selbstverhältnisse an. Im sinn lichen Eindrucksverstehen befruchten sich die Vermögen geistiger Erkenntnis und leiblichen Spürens. Das Gehörte wird als sinnlicher Stoff auf einem pathischen Niveau als Wie eines Hörens erfasst und auf einem semiotischen Niveau als dessen Was. Dieses »dop pelte« Verstehen hat sich zivilisations- und technik-historisch in einen spröden und fehleranfälligen Prozess verwandelt. Ganzheitliche Vermögen »hörenden« Begreifens haben sich nämlich zugunsten abstrakten und theoretisierenden Verstehens abgeschwächt. Die ver stehende Handhabung maschinistischer Systeme fällt heute leichter als das erkennende Hören von Austernfischer, Rabe und Singdrossel oder das sehende Identifizieren von Birke, Kastanie und Eiche. Die abstraktionistische Transformation aisthetischer Basistechniken ist fortgeschritten. In dem breiten Feld jener sinnlichen Eindrücke, die in leiblichen Resonanzen aufgehen, bedarf das Verstehen indes kei ner kognitiven Anstrengung. Im Anblick des sich vor den eigenen Füßen auftuenden Abgrundes wird die Angst intuitiv, unmittelbar spürend verstanden, ebenso die eigenleiblich-existenzielle Gefähr dung durch die aggressive Geste eines uns gegenüberstehenden Raub tieres in Angriffslust. Angesichts der kommunikativen Macht wissenschaftlicher Kon zepte über das sinnliche Verstehen lebensweltlicher Situationen merkt Georg Picht speziell zum Hören an: »Was fassen wir auf, wenn wir hören wie das Meer rauscht oder wie der Wind saust? Das Bewußtsein hat sich gegen die Sprache seiner Sinnes organe blockiert. Es registriert noch Geräusche, aber es nimmt sie nicht wahr. Die synästhetische Wahrnehmung hat sich desintegriert.«205
Der Szientismus hat die Sinne zu willfährigen Knechten eines alles »lesenden« intellektualistischen Verstandes gemacht. Die Spiel räume, auf eine nicht-rationalistisch kolonisierte Weise anders oder sogar eigenwillig zu hören und damit auch ganz Anderes zu hören,
205
Picht, Kunst und Mythos, S. 390.
137 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
8. Das Hören von etwas
haben sich verringert. Was wir hören könnten, klingt dann mitunter wie eine Erzählung aus längst vergangenen Zeiten: »Im Rauschen des Meeres oder im Sausen des Windes vernehmen wir Mächte, Kräfte, dynamische Felder. Wir erfahren durch das Ohr die Natur nicht als Anordnung von Objekten im Raum sondern als einen schwebenden, schwingenden, flutenden, von Spannungen geladenen Bereich. […] Man kann deshalb sagen, daß jene Erfahrung von Natur, die uns durch das Ohr vermittelt wird, dem wahren Wesen von Natur noch näher kommt als die Erfahrung durch das Auge.«206
Wenigstens relikthaft spielt die Eindrücklichkeit der Geräusche im landschaftlichen Erleben fortan eine atmosphärische Rolle (in Wald und Flur wie am Meeresstrand, auf andere Weise ebenso in den besiedelten und industriell genutzten Gebieten in der Mitte der Stadt): im Rauschen der Gewässer, Rascheln des Herbstlaubes, Knistern tro ckener Zweige auf dem Gehweg unter den Füßen, dem Knirschen des Schotters der frischen Wegaufschüttung oder dem sprichwörtlichen Vorbeirauschen eines lärmenden Güterzuges am Bahnübergang. In all diesen Geräuschen bringen sich nicht nur lautliche Korrespondenzen tönenden Materials zu Gehör. Wenn wir etwas hörend erfassen, hören wir auf einer zweiten Ebene des Unanschaulichen einen Ton der Natur des eigenen Leibes, der im Modus leiblicher Kommunikation auf die Dinge der Welt antwortet. Umso bemerkenswerter ist, dass es für Georg Simmel allein der sehende Anteil des schauenden Aktes ist, dank dessen wir eine Landschaft in einem fühlenden Akt erfas sen.207 Auch darin drückt sich als tiefe Spur griechisch-römischer Denktraditionen208 die »Geburt der abendländischen Theorie aus dem Sehen«209 aus. Die Fokussierung des Sehens verdient bei Simmel insofern Beachtung, als gerade er sich in seiner soziologischen Ästhe tik des Umstandes bewusst war, »daß mit der sich verfeinernden Zivi lisation offenbar die eigentliche Wahrnehmungsschärfe aller Sinne sinkt, dagegen ihre Lust- und Unlustbetonung steigt.«210 In Bezug auf das Hören mag sich eine gewisse Verdunkelung der Sinnlichkeit schon über sein eigenes Denken gelegt haben.
206 207 208 209 210
Ebd. Vgl. Simmel, Philosophie der Landschaft, S. 152. Vgl. ebd., S. 81. Espinet, Phänomenologie des Hörens, S. 40. Simmel, Soziologie der Sinne, S. 147.
138 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Hörendes Denken – denkendes Hören
Hörendes Denken – denkendes Hören In einer modernen Gesellschaft, die ihre Prozesse technisch und ökonomisch reguliert, stehen die Menschen den »Gegenstände[n] des wirtschaftlichen Verkehrs nicht mehr unmittelbar gegenüber«211. Unter der Bedingung ausgefeilter Hypersensibilitäten gegenüber ideologisch formatierten Schablonen »richtigen« Sprechens (politi sche Korrektheit) spitzt sich dessen »intellektualistische« Fokussie rung noch einmal zu. Die »Anfälligkeit« selektiven Hörens gegenüber kulturell definierten Verstehens-Imperativen ist schon grundsätzlich hoch, weil für das verstehende Hören (von Geräuschen bis zu gespro chenen Sätzen) die nur lautliche Erfassung auditiver Eindrücke nicht hinreichend ist. Was wir mit einem Wort als ein Rascheln oder Brausen bezeichnen, ist bereits Produkt der Übertragung eines sinn lichen Eindrucks in die expressis verbis explizierte Sprache, mit der sich auch ganz Anderes aussagen ließe. Was in Sätzen über etwas Gehörtes gesagt werden kann, folgt einem etymologisch fließenden Wortschatz, dessen Bedeutungen immer nur bis auf Weiteres gelten. Auch das Hören der Geräusche steht vor der Hürde wortwörtlichen Sprechens. Die treffliche Rede über Geräusche muss ontogenetisch in situ erst erlernt werden – zunächst als ein leiblich-spürendes Ver mögen und sodann als transversale Fähigkeit, das bewusst Gemachte in Worte zu fassen. Denkendes Hören-Können verlangt eine dem Schwimmen-Lernen ähnliche Übung. »Was Schwimmen heißt, sagt uns nur der Sprung in den Strom.«212 So kann auch das Hören nur in seiner Übung verfeinert werden; in einem Üben, das über das nur zählend registrierende Vernehmen von Tönen, Klängen und Geräuschen hinausgeht. Fragend rumort es auf einer Grenze zwischen der Erkenntnis dessen, was da in bestimmter Weise tönt und dem Bemerken einer am eigenen Leib spürbar werdenden Resonanz in Gestalt individueller Weltverwicklungen. Solche Weltverwicklung stütz sich in der Spätmoderne epistemisch hauptsächlich auf (ver meintliches) Wissen um die Welt bzw. das intuitive Vertrauen darauf. Solches Wissen kann im verstehenden Gebrauch der Sinne das finale Missverstehen aber auch vereiteln. Im ungünstigsten Falle, d. h. der tendenziell umfassenden Abhängigkeit des Selbst- und Weltverste Simmel, Soziologische Ästhetik, S. 91. Heidegger, Was heisst Denken?, S. 9. Der Sprung »allein bringt uns in die Ort schaft des Denkens.« ebd., S. 48. 211
212
139 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
8. Das Hören von etwas
hens von den Interpretamenten der (Massen-) Medien, hören die Menschen jedoch nur noch mittelbar, d. h. in der Beglaubigung des verstanden Geglaubten durch die klischeehaft simplifizierenden Ant worten der Medien. Zivilisationskritisch merkt Georg Picht an: »Ist das Verhältnis des Menschen zu seinem Klangraum gestört, so ist sein Verhältnis zur Natur gestört.«213 Diese Störung betrifft nicht nur die äußere Natur der lebendigen Dinge, Erscheinungen und Prozesse, sondern mehr noch das Verhält nis der Menschen zu jener Natur, die das Individuum als leibliches Wesen selbst ist. Auf dem Grat des anthropologischen Vergessens steht das »Wissen, in dem ernstgenommen wird, daß wir selbst Natur sind, d. h. daß wir Natursein an uns selbst erfahren und kennen.«214 Das Hören bietet sich für eine resensibilisierende Selbstgewahrwer dung darin an, dass es uns Eindrücke dessen, was um und mit uns ist und geschieht, prädiskursiv zu spüren gibt. Solche Erfahrung bietet schon der Hauch der Sprache, das Angesprochen-Werden aus intimster Nähe, das Flüstern, das diesseits allen sprachlichen Sinnver stehens als taktile Berührung auf der Haut erfasst wird – bevor die wörtliche Rede uns im semiotischen Sinne etwas zu verstehen oder zu »lesen« gibt. Was wir gleichsam »archaisch« mit den eigenen Sinnen wahrnehmen, ist der Stoff des »Herumwirklichen« (Dürckheim). Hans Ulrich Gumbrecht merkt an: »Wir nehmen Sprache also auf die unaufdringlichste Weise, das heißt ganz buchstäblich, als leichte Berührung ihres Klangs auf der Haut wahr, auch wenn wir nicht verstehen, was ihre Worte bedeuten sollen.«215 Das Gesprochene berührt leiblich – bevor ein in der wörtlichen Rede Angesprochener sinnverstehend hört. Was eine Person hört und und wie sie hörend in der Welt ist, resultiert nicht nur aus gleichsam »thematisch« spezifischen Aufmerksamkeiten. Das So-Fokussieren gibt auch Auskunft darüber, was ein Individuum in seiner persönlichen Situation ausmacht. Das Verstehen sinnlicher Eindrücke »beginnt« indes mit der Berührung. Schon der auf der Haut spürbar werdende Hauch einer Stimme wird als taktile Berührung in emotionalen Stimmungen erlebt – zwi schen äußerster Zuneigung und nacktem Ekel. Was wir u. a. hörend wahrnehmen, vernehmen wir auf dem Resonanzboden gestimmter 213 214 215
Picht, Kunst und Mythos, S. 390. Böhme, Die Stellung des Menschen in der Natur, S. 25. Gumbrecht, Unsere breite Gegenwart, S. 23.
140 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Hörendes Denken – denkendes Hören
Emotionalität gegenüber der erscheinenden Welt. Das aus welchen Gründen auch immer aufmerksame Hören ist durch den Affekt eines »vitalen Antriebs«216 geweckt, der seinen Impuls z. B. durch eine bio graphisch wachgerufene Erinnerung erhält. Im Hinhören fokussiert sich das Hören auf etwas Bestimmtes und zeigt sich darin in einem habituellen Ausdruck des Hören-Wollens, das mit einem fokussieren den Denken einhergeht.217 Die Metapher vom »hörenden Denken« verweist auf eine Bedeu tung des Hörens, die die Grenzen des Akustischen überschreitet. In ihr ist »das Denken ein Hören und Sehen«218, denn was wir hören, ist (oberhalb der auditiven Aufnahme von Lauten und Tönen) in aller Regel als Dieses oder Jenes schon verstanden. Im Hören, das die Brücke zum Denken autopoietisch bereits geschlagen hat, ist ein Geräusch Ausdruck eines verstandenen Ereignisses: das Getöse ist nicht nur ein amorphes Schallen, sondern Lärm von etwas, das eine konkrete Quelle hat. Hören verlangt das Verstehen, setzt es aber auch voraus. Der Donner muss im Moment seines Grollens als Gewitter-Phänomen bereits verstanden worden sein. Sonst wird er nur als irgendet was eigenartig, merkwürdig oder rätselhaft Krachendes erlebt. Ein Geräusch muss mit Bedeutungen verknüpft werden. Wer die bösen Geister »durch Lärm, Geschrei, Peitschenknall, Schießen und Glocken läuten, durch alle Arten von Geräusch«219 vertreiben oder abschrecken will, muss nicht nur wissen, was sich in einer mythischen Welt mit einem wilden Gelärme ausrichten lässt, sondern zunächst, wie sich Geschrei, Peitschenknall, Schießen und Glockenläuten gefühlsmäßig in Atmosphären und Stimmungen zu spüren geben. Im Vernehmen göttlicher Gebote220 tritt das verstehende Hören vor das Sehen. In einer Reihe übertragender Bedeutungen hört in einem lebensweltlichen Verständnis, wer etwas akzeptiert. Die Situa tionen, in denen man auf die eine oder andere Weise etwas bewertend erfasst, sind aber verschieden. Wer etwas nicht gerne hört, empfindet mit Unbehagen, was ihm zu Ohren kommt. Wer sich dagegen selber gerne reden hört, hat ein zumindest ansatzweise narzisstisches Ver Schmitz, Der Leib, S. 83. »Was meint aufhorchen und hellhörig werden anderes, als eben daß Hören den kend werde?«; Espinet, Phänomenologie des Hörens, S. 209. 218 Heidegger, zit. bei Espinet, ebd., S. 31. 219 Reimbold, Die Nacht im Mythos, S. 200. 220 Vgl. auch Jütte, Geschichte der Sinne, S. 78. 216
217
141 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
8. Das Hören von etwas
hältnis zu sich selbst. Und wer einfach nur auf seinen Namen hört, folgt lediglich einer kommunikativen Konvention des AngesprochenWerdens. Wer schließlich in einer Sache vor Gericht nicht gehört wird, darf sich nicht äußern und kann mit einem (potentiellen) Argument deshalb auch nicht die geringste Wirkung erreichen. Diese und andere Redensarten und Bedeutungen haben mit akustischem Hören-Kön nen nur indirekt zu tun. Umso mehr unterstreichen sie, dass Hören im organischen Wahrnehmen mit den Ohren nicht aufgeht, vielmehr als Modus der Situationserfassung von Anfang an in einer Synthese mit anderen Formen der gewahrwerdend-denkenden Verarbeitung von Eindrücken steht.
Das hinter den Bildern Gehörte In der räumlichen, sozialen und ökonomischen Komplexität der Stadt muss sich das bewusste Hören gegenüber dem selbstverständlichen Sehen erst durchsetzen. Wenn die urbanen Geräusche auch noch so ohrenbetäubend sein mögen, so eignen wir uns doch zu aller erst das an, was wir sehen. Die Medien zur Ästhetisierung der Stadt zielen vor allen Dingen auf das Format der Bilder. Die Stadt ist eine Schauwelt. Und so präsentiert sie sich für den Konsum bildhafter Surrogate. Tatsächlich beeindruckt sie im sinnlich herumräumlichen Erleben jedoch mit kaum geringerer Macht in ihrer Lautlichkeit. Jedoch wechseln die optischen und die lautlichen »Bilder« von Quar tier zu Quartier, so dass die Stadt in einer Vielfalt der Gesichter zu sehen und zu hören ist – je nach dem, was hier und dort ist und geschieht. In urbanen Hörbildern sind die ästhetischen Grenzen des Sichtbaren aber schon verwischt. Indem das Hören gewissermaßen nach »Hörbildern« sucht, hebt es die Grenzen zwischen den Sinnen auf, so dass die Vielfalt der Töne, Klänge und Geräusche zugleich mit visuellen Eindrücken verschmilzt. Das Gesehene transzendiert synäs thetisch ins darin Mitgehörte und umgekehrt. Gleichwohl beharren ästhetische Differenzen, so dass sich die Stadt im Bereich des Hörens in einem spürbar anderen Modus der Sinnlichkeit präsentiert als im Milieu des Visuellen. Wie und was von der städtischen Welt erklingt, gibt etwas anderes vom Charakter ihrer Orte zu verstehen als das, was man von ihnen nur sehen kann. Ein Bahnhof zeigt sich im Eindruck seiner Geräuschhaftigkeit in einem anderen Gesicht als in seiner Bildhaftigkeit. Ebenso vermittelt das sichtbare Verladen
142 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Das hinter den Bildern Gehörte
der Container in einem Seehafen einen anderen Eindruck von der maritimen Dynamik einer Hafenstadt als das, was man lautlich von demselben Geschehen hören kann. Und doch sehen wir nicht zuerst, um danach zu hören. Wenn Bilder auch visuelle Medien sind, so implizieren sie doch eine Brücke zum Hören. Das im Bild Sichtbare weist in seinen Bewegungen auf die mit der Bewegung verbundenen Geräusche hin. Was sich bewegt, dringt in aller Regel auch geräuschhaft in die Ohren. Die Werke bekannter Fotografen thematisieren diese Differenz, wenn auch nur implizit. Dabei ist es oft eine Frage des Stils, ob und wie das dem Bild entzogene Geräusch synästhetisch vernehmbar ist und fragwürdig wird. Im Vergleich der Werke zweier Fotografen des frühen und mittleren 20. Jahrhunderts wird das deutlich. Um 1900 macht der Franzose Eugène Atget zahllose Aufnahmen von Paris, auf denen er nicht die urbane Lebendigkeit ins Bild setzt, sondern deren Schatten in Gestalt leerer Gassen und verödeter Hauseingänge. Atgets Paris ist eine tote Stadt, eine schweigende Welt, in der nur ausnahmsweise Menschen zu sehen sind. Zwar zeigen seine Fotogra fien einen urbanen Raum. Aber er wirkt in seiner Bewegungslosigkeit artifiziell. Er erscheint in einer geradezu charakteristischen Stille, die über leeren Straßen und Plätzen liegt, über bewegungslos daste henden Jahrmarkt-Karussells, verlassenen Kutschen ohne Pferd und Mann und verwaisten Wohnungen, die aussehen, als würden Tote darin wohnen. Dennoch lassen regennasse, blankgefahrene Straßen bahnschienen daran denken, dass hier vielleicht bald schon wieder das Quietschen der Eisenräder in einer Kurve zu hören sein wird. Atgets Stadt ist eine wie in Gießharz für die Ewigkeit konservierte Welt, aus der alles Leben herausgesogen worden ist. In dieser Leere breitet sich eine Atmosphäre der Geräuschlosigkeit aus – sichtbar im Unsichtbaren. Ganz anders sind die Bilder des Niederländers Ed van der Elsken, die er um 1950 zahlreich in Amsterdam machte: dicht bevölkerte Stadtstraßen, in denen das abendliche Leben geradezu explodierte: Ein alter Mann, der am Ufer einer Gracht eine Unzahl schreiender Möwen füttert, Schuten und Schlepper, die dampfend durch ein Dock tuckern, ein Demonstrations-Chaos auf einer Fußgängerstraße samt berittener Polizei am Koniginnedaag 1969. Es sind die in Bildern eingefrorenen Bewegungen, die auf stumme Weise eine auditive Wirklichkeit anklingen lassen. Fotografien erweisen sich in diesen so verschiedenen Bildern als Medien des Atmosphärischen. Sie verströ
143 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
8. Das Hören von etwas
men den Atem einer sinnlich pluralen Wirklichkeit, zu der die urbane Lautlichkeit ebenso gehört wie die situative Spannung lebendiger Szenen, die sich wie das Hörbare der Verbildlichung im engeren Sinne entziehen.221 Die Fixierung aller Lebendigkeit – der Preis einer jeden Fotografie – macht darauf aufmerksam, dass nicht nur die Bilder aus dem Fluss der Zeit gleichsam herausspringen, sondern auch das Auditive, auf das sie anspielen, seine eigene Zeitlichkeit hat.
Zur Zeitlichkeit des Hörens Raum und Zeit lassen sich nur analytisch spalten. Im vitalen Strom des Lebens bilden sie eine fest verklammerte Einheit: die RaumZeit. Auch die Geräusche sind in raumzeitlicher Simultaneität im Hier und im Jetzt. Dennoch haben sie ihre eigene Zeit. Ein Geräusch dauert – es ist nur so lange vernehmbar, wie es hier oder dort ist. In der Dauer seiner Hörbarkeit breitet es sich im Raum aus, mit dem Wind anders als gegen ihn, durch eine Wand aus Papier anders als durch eine mächtige Mauer, in jedem Falle aber anders als ein materieller Gegenstand, der allokativ durch den Raum bewegt wird. Wie ein Geräusch nur im Raum und in der Zeit sein kann, so kann es sich nur im Rahmen subjektiver (individueller wie kollektiver) Bedingungen des Hörens entfalten. Mit dem zu Ende gehenden Geräusch endet auch seine Zeit der Präsenz wie seine räumliche Gegenwart. Im Unterschied zu einem materiellen Objekt existieren Töne wie Geräusche (als Halbdinge) nur für die Dauer ihrer auditiven Vernehmbarkeit. Es liegt am Charakter der Halbdinge, dass sie schein bar aus dem Nichts kommen und in gewisser Weise rückstandslos auch wieder in einem Nichts verschwinden. Sie können nicht wie Gegenstände in Raum und Zeit beharren und an einem Ort einen Abdruck hinterlassen. Sie existieren allein in einer atmosphärischen Gegenwart. In ihr können sie eine aktuelle Situation grundieren; vor allem dann, wenn sie die Gegenwart einer Gegend eine Zeit lang atmosphärisch imprägnieren. Im Fortbestand des Gegenwärtigen können Geräusche sogar eine zuständliche Situation im Sinne des Wortes »tönen«, wie das monotone Dauergeräusch einer Maschine die Anwohner mit der Zeit zermürbt, wenn die Industrieanlagen zu dicht neben dem Wohngebiet errichtet worden sind. 221
Vgl. dazu auch Hasse, Photographie und Phänomenologie, Kapitel 9.
144 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Zur Zeitlichkeit des Hörens
In der Beschreibung von Geräuschen bringt sich ihr gegenwarts spezifischer Charakter zur Geltung. Gegenwart ist aber flüchtig. Sie entzieht sich in jedem Augenblick in Vergangenheit. Ein Geräusch kann nicht (wie ein visuell erfasster Gegenstand) in der Zeit behar ren (vgl. dazu auch die Beschreibung I in Kapitel 2). Im Modus der Gegenwart ist die erlebte Zeit flüchtig. Sie entzieht sich in die scheinbare Nichthaftigkeit des Schon-Gewesenen oder Geradeeben-Geschehenden. Umso mehr kontrastieren die Geräusche in der Aktualität ihres sinnlichen Erscheinens das Abstrakte der Ideen. Was und wie ein Geräusch letztlich ist, verdankt es seiner Eindrücklichkeit und damit seiner Art und Weise, gegenwärtig zu sein. Die Frage der Zeitlichkeit der Gegenwart thematisierte William James mit dem Kommentar, dass das Nachdenken über die Gegenwart uns zu der Überzeugung bringt, »that it must exist, but that it does exist can never be a fact for our immediate experience.«222 Mit einem Zitat von E. Robert Kelly (Pseudonym E. R. Clay) führt er aus: »The present, to which the datum refers is really a part of the past – a recent past – delusively given as being a time that intervenes between the past and the future. Let it be named the specious present, and let the past, that is given as being the past, be known as the obvious past. […] Time, then, considered relatively to human apprehension, consists of four parts, viz., the obvious past, the precious present, the real present, and the future.«223 Und so resümiert James treffend: »In short, the practically present is no knife-edge, but a saddle-back, with a certain breadth of its own on which we sit perched, and from which we look in two directions into time. The unit of composition of our perception of time is duration, with a bow and a stern, as it were – a rearward- and a forward-looking end.«224
Die Gegenwart ist kein eingebildeter Scheitelpunkt in der abstrak ten Zeit, sondern ein Korridor in der gelebten Zeit225. In ihr wird etwas als noch anwesend gespürt, das schon vorüber ist oder sich als etwas Bevorstehendes gerade bemerkbar ankündigt, obwohl es tatsächlich noch gar nicht da ist. Der Begriff der »Dauer« hilft über das Dilemma der Begriffe einer physikalischen bzw. astronomischen 222 223 224 225
James, The Principles of Psychology, S. 608f. Ebd., S. 609. Ebd. Zur gelebten Zeit vgl. vor allem Minkowski, Die gelebte Zeit I.
145 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
8. Das Hören von etwas
Zeit auf der einen Seite und einer gelebten Zeit auf der anderen Seite hinweg. Hermann Schmitz spricht die Dauer als erlebtes Weite kontinuum der Zeit an226, ein chaotisch-mannigfaltiges Dahingleiten im Strom der gelebten Zeit, die erst vom Einbruch des Plötzlichen durch ein gewisses Wachwerden im Jetzt zerrissen wird. Die »vage dahingleitende Dauer«227 beschreibt er als reine Modalzeit, die so lange »anonym« ist, wie sie »keinen Anlaß zu der Dinge gibt, was dauert«228. Die individuell erlebte Zeit ist in ihrer geschichtlichen Dauer eine andere als dieDinge DingeDinge Beziehung des Menschen zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hat die Gegenwart das »Daseinsmonopol«229. Der diffuse Fortgang der gleitenden Dauer der Gegenwart insistiert in der oszillierenden Geräuschhaftigkeit der Städte. Das lautlich Vernehmbare entgeht in seinem schwimmenden wie Dinge tsmäßigen Charakter der Bewusstwerdung. Was die Menschen aus der Serialität ihres tagtäglichen Lebens Dinge nDinge ewisser Weise ihre AufDinge amkeit und nimmt sie in einem umhüllenden Sinne ein. Erst im Moment des Plötzlichen bricht das Bewusstsein für das Hier und Jetzt auf. Im Moment der damit einhergehenden Fragwürdigkeit büßt das Gewohnte seine Selbstverständlichkeit ein. Dinge Beschreibung I in Kapitel 2 stellte sich die Aufgabe, etwas zu erfassen, das innerhalb dieser Gegenwart (der des vorbeifahren den Zuges) schon nicht mehr existiert hat. Zeit wurde so aDinge nte Seins-Sphäre erfahren, die mit dem subjektiven Rhythmus der Geschehnisse kollidierteDinge sich in der gelebten Zeit z. B. in Gestalt vorüberziehender Dinge bewegt, folgt einer Chronologie, die dem subjektiven Erleben gleichsam »hinterherläuft«. Subjektiv gDinge ird nie die reine Lagezeit (die Zeit der Physik und Astronomie), sondern – im affektlogischen Strom raumzeitlichenDinge – die modale Lage zeit.230 Sie hat jenen von James beschriebenen Sattel-Charakter, in dem das Vergangene noch gegenwäDinge bar ist uDinge s Zukünftige Vgl. Schmitz, Der unerschöpfliche Gegenstand, S. 50. Ebd., S. 112. 228 Ebd., S. 266. 229 Ebd., S. 247. 230 Vgl. auch Schmitz, Phänomenologie der Zeit, besonders Kap. 3.4. »Die reine Modalzeit als Riss in der Dauer, Geburt der Gegenwart und als Abschied von dem, was nicht mehr ist, ist der Ursprung des Leibes und der Zeit.«; Schmitz, Der Leib, S. 132. Sie hat »daher nicht drei modale Abteilungen wie die modale Lagezeit (das Vergangene, das Gegenwärtige, das Zukünftige), sondern nur zwei: den appräsenten 226
227
146 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Zur Zeitlichkeit des Hörens
aus einer diffus anwesenden Ferne schon vorscheint. Geräusche vor überziehender Dinge machen diesen Sattel jedoch besonders schmal, wenn nicht sogar spitz. Sobald sich die Aufgabe stellt, eine hörbare Bewegung in Worte zu fassen, dauert die Explikation länger als es das Hörbare gibt. Eugène Minkowski versteht die gelebte Zeit mit Henry Bergson als ein Werden.231 Darin verändern sich die Dinge und die Lebewesen – anders jedoch als die Halbdinge (wie die Geräusche), die in ihrem Werden und Vergehen ganz aufgehen. Sie existieren allein in ihrem Anwesend-Sein bzw. An-wesen. Dieses Werden hat in Bezug auf sein Erleben im engeren Sinne keine Objektseite. Geräusche verdanken sich allein der Erlebbarkeit ihrer atmosphärischen Anwesenheit. Ein Geräusch ist in gewisser Weise selbst ein phänomenspezifisches Geschehen, das es als Ge-räusch ausmacht. Alles lautlich Gesche hende erfasst uns in seiner geräuschhaft affizierenden Immersivität und setzt uns selbst dem Werden aus. Es zieht uns in das atmosphäri sche Werden des Erscheinenden hinein. So ist das Werden des eigenen Selbst in das Werden der Geräusche verstrickt. Die geradezu hilflos gehetzte Aufmerksamkeit, in der sich das Zeiterleben in der schnell dahinschrumpfenden Gegenwart eines vorbeifahrenden Zuges bei nahe verloren hat, illustriert diesen Doppelcharakter des Werdens. Das Werden eines Geräusches intensiviert die Bewusstwerdung des darin situativ zu sich kommenden Werdens des eigenen Selbst. Dieses Selbst-Werden irritiert, weil es sich in seiner Dynamik der Erkenntnis ebenso in den Weg stellt, wie es sich seiner dafür notwendigen Vergegenständlichung verweigert.232 Das Was des Gehörten umfasst auch den Modus seiner zeitlichen Erfahrung, in dem es uns verwirrt und seine Flüchtigkeit besiegelt.
Einbruch des Neuen, worin Zukunft und Gegenwart verschmelzen, und das Vergan gensein der zerrissenen Dauer.«, ebd., S. 131f. 231 Vgl. Minkowski, Die gelebte Zeit I, S. 26. 232 »Wir können es auch so ausdrücken, daß wir nie in bezug auf das Werden die nötige Distanz zu erreichen imstande sind, um aus ihm ein Objekt unserer Erkennt nis zu machen. Es ist uns zu nahe.«; ebd., S. 27.
147 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
9. Tag- und Nachtgeräusche
Die Nacht wird nicht erst in der relativen »Lichtlosigkeit« erfahren. Spürbar wird sie schon in einer spezifischen Armut des natürlichen Lichts, dessen atmosphärisches Vakuum in der vorschreitenden Däm merung sukzessive vom künstlichen Licht gefüllt wird. Aber die Dunkelheit entfaltet sich auch in einer ganz eigenartigen lautlichen Sphäre. Das Geräusch einer Stadt ist am Tage ein anderes als in der Nacht. In der Dichtung »rauscht«233 die Nacht. Wenn die Ausbreitung des Schalls auch keinen tatsächlichen Einfluss auf die Helligkeit, das Halbdunkel und die Dunkelheit hat, so ist die leise und mehr noch die nahezu lautlose Stadt doch in besonderer Weise eine spätabendliche und nächtliche Welt, ein Raum dunkler Straßen und Plätze. Zwar ist der dunkle Raum in seinem spezifischen Erscheinen sichtbar, die stumme Ruhe der Nacht dagegen atmosphärisch nur spürbar. Eine Atmosphäre birgt anderes, als nur mit den Augen zu sehen und den Ohren zu hören ist. Nacht ist, wenn »alles Leben ruht und schläft, kein Laut ertönt«, wenn alles »ruhig, stille, geheim, einsam, leer, öde, unfruchtbar, verschwiegen«234, kühl und tot ist. Die motorische und akustische Ruhe steigert sich infolge der Erlahmung urbanen Treibens in die quasi-nichthafte Dichte der Stille. Diese steht dann dem Erleben der melancholischen Nacht nahe, die wie eine finstere Sonderwelt erscheint – Abgrund, Unterwelt, Grab, Kerker, Hölle etc.235 Ins melancholische Farbenspiel mischen sich dystopische Bildelemente undeutlich vorbeihuschender Gestalten, die an dunkle Machenschaften denken lassen.
233 234 235
Guzzoni, Nächtliche Geräusche, S. 85. DWB, Band 13, Sp. 149ff. Vgl. ebd., Sp. 162.
149 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
9. Tag- und Nachtgeräusche
Die atmosphärische Ambivalenz der Nacht Die Nacht ist in ihrer beunruhigenden Lautlosigkeit dem Tode zugewandt. Ihr numinoses Gesicht kehrt in mystischen Geräuschen wieder – im vorüberrauschenden Flug der Eule, der durch Mark und Bein geht und die nächtliche Dunkelheit magisch auflädt. Der wie ein Hauch dahinwischende Schlag ihrer Schwingen intensiviert die plötzlich spürbar werdende Stille der Nacht.236 Aus dem tiefen und mächtig affizierenden Grund der Mythen richtet sich eine Atmo sphäre ruheloser und wiederkehrender Toter auf, eine imaginäre Sphäre der Alps und Wiedergänger237, die sich lautlos nähern, um sich verschwiegen an dich zu schmiegen.238 Auch die Werwölfe und Vampire kommen im Dunkeln – lautlos, stumm. Zwar gibt es in keiner wirklichen Stadt Wiedergänger, Untote, menschenähnliche Fledermäuse und Werwölfe. Dennoch verwirren ihre aufflackernden imaginären Bilder den sicheren Schritt durch menschenleere Gassen. Die Nacht erscheint in Vexierbildern – mal als »bedrängender«, mal als »beruhigender Partner«239. Zum Geräusch der Stadt gehört sein nächtliches Verebben, das sich im Verstummen beinahe ganz verliert. Im Immer-leiser-Werden liegt die eindrücklichste Macht des nächtlichen Geräuschs der Stadt. Es konzentriert sich schließlich in einem Gefühl stiller Dunkelheit. Obwohl oder gerade weil nicht viel zu hören ist, hat noch die Mix tur leiser bis zäher Tonlosigkeit den Charakter eines Geräusches. Keine Stadt kann jedoch ganz und gar lautlos werden. Noch in der scheinbaren Geräuschlosigkeit und Tonleere ist ein hinter- bis unter gründig wisperndes Rascheln und Flüstern als dunkler Grundton zu vernehmen – ein atmosphärisch verinselter Ton, der in die dunkle, alles beherrschende Stille hineinschneidet. Die nächtliche Stadt ist gerade in ihren gedämpften Stimmen eine von mystischen Scheinwe sen erfüllte Welt. Während im Metier des Sichtbaren »alle Formen eine Form annehmen«240, folgt die tonale Metamorphose der Nacht einem ganz anderen Weg. Was in der Schnelligkeit des Wechsels der lautlichen Eindrücke am Tage in der Mannigfaltigkeit der hörbaren Gestalten geradezu untergeht und sein Gesicht im Rauschen des 236 237 238 239 240
RGG, Band IV, Sp. 1293f. Vgl. HWdAgl, Band 6, Sp. 780f. Vgl. Baudelaire, Der Wiedergänger, S. 98. Schmitz, System der Philosophie. Band III/Teil 5, S. 127. Jankélévitch, Zauber, Improvisation, Virtuosität, S. 197.
150 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Die atmosphärische Ambivalenz der Nacht
Vielen verliert, treibt sich in der Dunkelzeit der rar werdenden Laute in den Vordergrund. Es präsentiert sich nun in einer mächtigen Größe, deren Gegenwart das Gruseln lehrt und in die Flucht treibt. Gustav Theodor Fechner machte zur Hochzeit der Industrialisie rung einen Unterschied zwischen der Tagesansicht und der Nachtan sicht, in der wir einen je eigenen Blick auf die Welt und uns darin werfen. Über die Nachtansicht sagt er: »In dieser allgemeinen Finsternis, Öde und Stille, welche Himmel und Erde umfängt, schweben nur einzelne, innerlich helle, farbige und klingende, Wesen, wohl gar nur Punkte, tauchen aus der Nacht auf, versinken wieder darin, ohne von ihrem Licht und Klang etwas zu hinterlassen, sehen einander, ohne daß etwas zwischen ihnen leuchtet, sprechen miteinander, ohne daß etwas zwischen ihnen tönt.«241
Die Stadt lebt – komplementär zur Helle des Tages – in der Wirk lichkeit des Halbdunklen und beinahe Finsteren. In dieser »zweiten« Zeit werden die Schattengestalten der Mythen, der Religionen und des Aberglaubens lebendig. Auch in den Erzählungen wendet sich ihre Schattenwelt vom Habitus der taghellen Stadt ab. An die Stelle nüchterner und lichtdurchfluteter Verstandesrationalität tritt eine dunkle Schwermut der Gefühle. Die Nacht ist nicht wie der Tag die Welt der Lebenden, des Lichtes und der Transparenz. Sie ist eine tem poräre Wirklichkeit der Finsternis, Sphäre der Toten und des Teufels. Sie steht der übersinnlichen Erfahrung nahe. In der Nacht werfen die stofflichen Dinge keine Schatten. Sie ist deshalb im japanischen Shintoismus die Sphäre der noch nicht geborenen und schon verstor benen Menschen, jener schattenlosen Metawesen, die eine formlose, quasi-göttliche Existenz führen (»divine beings«242): »before being born, people are divine beings. […] After death, people become divine beings again«243. Die Nacht ist das »dämonische Gegenüber«, das durch ihre »Äußerungen hindurch den betroffenen Menschen fesselt und bedrängt«244. In der Dunkelheit der Nacht werden nicht nur merkwürdige Lebewesen, Geister und dunkle Mächte zudringlich, sondern selbst neblige Substanzen.245 Die Nacht ist ein kaltes und farbloses Milieu, das wenig Geräusche macht. Das Wenige, das sie 241 242 243 244 245
Fechner, Die Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht. Ogawa, Phenomenology of wind and Atmosphere, S. 34f. Ebd. Schmitz, System der Philosophie, Band III / Teil 5, S. 133. Vgl. ebd., S. 139.
151 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
9. Tag- und Nachtgeräusche
zu Gehör bringt, lässt die Atmosphäre einer mystisch abgründigen Wirklichkeit aufsteigen246, in deren Ruhe die Phantasie wilde Blüten treibt. Zwischen Tag und Traum nimmt das »Gesicht der Nacht«247 eine verstörende Gestalt an – als sei sie eine abgründige Sphäre der Götter, Geister und Dämonen.248 »Im Dunkel, in der Stille und Leere der Nacht begegnet uns die Nichthaftigkeit oder das Nichts.«249 Nächtliche Stille ist aber nie unisono. Dann wäre sie bald keine mehr. Ihrer Erfahrbarkeit wegen bedarf sie der Unterbrechung, der Störung und der Irritation. »Nächtliche Stille und Nachtgesang wechseln einander ab, oder viel leicht eher: sind ineinander verwoben, rufen sich gegenseitig.«250 Die schlafende Stadt hat ihren eigenen pneumatischen Rhythmus, über den Luigi Russolo sagt: »Seltsam faszinierend ist auch das hohe und feierliche Atmen einer schlafenden Stadt«251. Hörbar ist es an dünnen Lauten und Tönen, an einem rätselhaft gedämpften Rascheln, einem sporadisch sich aufrichtenden Knattern oder dezenten Schleifen, das aus dem Hintergrund ausgebreiteter Stille hervortritt oder gegen sie antönt. Die finstere Nacht ist »als gefühlsmäßige Atmosphäre«252 nicht freundlich, behaglich oder lieblich, nicht wärmend, beruhigend noch einladend, sondern böse, beunruhigend, beängstigend und feindlich. Doch nicht nur. Ebenso hat sie ihre ganz eigene Faszination, die gleichwohl mehr mit den Atmosphären flirrender Lichtreklamen und der künstlichen Beleuchtung der Gebäude, Straßen und errichteten Statuen zu tun hat als mit hintergründigen Geräuschen.253 Indem sich in der dunklen Sonderwelt der gelebten Zeit wie des gelebten Raumes eine ganz eigene Sphäre konstituiert, mischen sich auch auditive Eindrücke ins Fahle und Grelle der nächtlichen Lichterwelt und unterstützen die anziehende Macht einer so eigenartig-facetten reichen Wirklichkeit. Die Nähe nächtlicher Gefühle zur Welt mythischer Gestalten und mystischer Gespenster ist ein Nebeneffekt der Art und Weise, wie 246 247 248 249 250 251 252 253
Vgl. HWdAgl, Band 6, Sp. 775. AT, Hiob 20,8. Vgl. HWdAgl, Band 6, Sp. 774. Guzzoni, Nächtliche Geräusche, S. 84. Ebd., S. 93. Russolo, Die Kunst der Geräusche, S. 33. Schmitz, System der Philosophie, Band III / Teil 5, S. 127. Vgl. Neumann, Architektur der Nacht.
152 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Die atmosphärische Ambivalenz der Nacht
wir die uns umgebende Welt in der Dunkelheit erleben. Das betrifft auch die Erfassung ihrer Geräusche. Was lautlich um und mit uns ist, hören wir in der Ruhe der Nacht schärfer und empfindlicher als in der Lautheit des Tages. Das geradezu chaotische Durcheinander aller möglichen Geräusche gehört in die lichte Zeit des Tages. Das Wenige, das davon noch in der Nacht beharrt, erscheint unter dem mächtigen Einfluss der Dunkelheit als unpassend und irritierend. Der mitternächtliche Uhrenschlag suggeriert sich als existenzielle Dimension der gelebten Zeit – einer vitalen Zeit, die dem Rhythmus des Atmens näher steht als dem maschinistischen Lauf der Uhrzeiger. Dagegen ist der Uhrenschlag zur Mittagsstunde nur ein trockener Ton, der über die messbare Lagezeit unterrichtet. Das Geräusch der Stadt ist als beredte Äußerung des Urbanen auch dann vernehmbar, wenn auf ihren Straßen und Plätzen nur überaus wenig noch zu hören ist – wenn die entfernten Schritte eines Humpelnden verhallen und die hinter geschlossenen Fenstern auf einem Klavier gespielte Melodie im Nachtraum der Stadt fast erstickt, als kämen die Töne aus einem Wattemantel nicht heraus. Die Geräusche klingen in ihrer Dämpfung durchs Dunkle irreal überhöht, größer und mächtiger als sie sind. Was sich in der Nacht ereignet, hört sich anders an als das gleiche am Tage. Das liegt daran, dass die prinzipiell identischen Geräusche in der Lebendigkeit des Tages in einem ubiquitären Lautteppich urbaner Geschäftigkeit untergehen. Tatsächlich gehen all die dezenten, luziden wie zerbrechlichen Klänge der Nacht am Tage aber gar nicht unter; viel mehr werden sie vom hämmernden Maschinismus des Tageslebens verschluckt. »Hundegebell in der Nacht bringt Beziehungen zwischen den einzelnen Höfen und Dörfern einer weiten Landschaft zum Tönen«254, die am Tage ungehört bleiben. In der Dunkelheit der Nacht breiten sich die Geräusche nicht nur anders aus. In ihrem eigenen Ausbrei tungsmodus affizieren sie auch anders als in der Helle des Tages. Während ein Hund am Tage einfach nur bellt, weckt das scheinbar gleiche Bellen in der Nacht ein mitunter erhaben ergreifendes Gefühl, wie eine aus der Ferne andrängende Wehklage, die im leiblichen Erstarren persönlich wird. Deshalb merkt Ute Guzzoni auch an: »Aber das Lauschen auf die Geräusche im nächtlichen Außenraum kann auch quälend, zuweilen schmerzlich sein«255. Es macht auf eine 254 255
Guzzoni, Nächtliche Geräusche, S. 87. Ebd., S. 88.
153 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
9. Tag- und Nachtgeräusche
existenzielle Verlassenheit aufmerksam, indem es sich in der Fülle einer merkwürdigen Leere als Etwas zu Gehör bringt und leiblich wie kein sichtbares Bild berührt. Derer wird man in der RaumZeit der Nacht in abgründig ergreifenden Gefühlen gewahr. Rilke sagt im Malte: »Das sind die Geräusche. Aber es gibt hier etwas, was furchtbarer ist: die Stille.«256 In der Ruhe der Nacht, die sich aus einem Gefühl der Weite und Leere in Stille zu steigern vermag, kommt es aufs Hören an – anders als am Tage. Es versammelt das nicht Zusammengehörige und noch das Entfernteste, auf dass »die Geräusche des Holzwurms und des in Bodenraum und Keller dahinhuschenden Getiers mit den an den häuslichen Herd gebundenen Gefühlen zusammenfließen«257. Wenn »Haus- und Erdgeister« auch Gestalten der Einbildung sind, so geben sie sich in der Finsternis der Nacht doch umso eindrucksmächtiger zu spüren – in irrealen, flimmernden wie fragmentarischen Hörbildern. Das situativ besondere Wesen der Nacht bringt sich in einer Reihe von Nachtgeräuschen als atmosphärisch ganz eigenartige Erlebniswelt zur Geltung: Durch das Loch in einer defekten Dachrinne poltern ein paar Tropfen vom Restwasser des letzten Regenschauers in eine große Pfütze. Die jeweiligen Geräusche klingen (für sich genommen) am Tage kaum anders als in der Nacht. Das emotionale Befinden wird aber nicht vom objektiven Ton und Laut gestimmt, sondern vom Vitalton des leiblichen Geräuscherlebens. Die gefühlsmäßige Fassung ist es, die das raumzeitliche Befinden temperiert und ihm ein Gesicht verleiht, das in der Nacht ganz andere Züge hat als am Tage. Deshalb gibt sich das Geläut der Domglocken zur Mittagszeit auch als eines zu spüren, das am späten Abend nicht von denselben Glocken zu kommen scheint. Daher sprechen wir vom Nachtgeläut, vom Nacht gesang, Nachtgeschrei, Nachtgeflüster, Nachthusten, Nachtgespräch und noch dem Nachtgewäsch.258 »In der Nacht sind viele Geräusche, weil wir nicht vom Sehen gestützt, jedenfalls begleitet werden, auffälliger, selbständiger wahrnehmbar. […] Die Geräusche der Nacht widersprechen nicht deren Nichthaftig keit. Vielmehr akzentuieren sie geradezu den nichthaften Raum, sie
256 Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (Roman), Ders.: Das dich terische Werk, S. 928. 257 HWdAgl, Band 6, Sp. 775. 258 Vgl. DWB, Band 13, Sp. 179ff.
154 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Die atmosphärische Ambivalenz der Nacht
unterstreichen, indem sie die Stille der Nacht brechen, diese selbst und ihre unendliche Weite.«259
Das Wenige, das sich durch die Stille hindurch zu Gehör bringt, plakatiert diese geradewegs. Der nächtlich bellende Hund lässt die Ferne auf den Leib rücken. Zugleich macht er eine Gefangenheit im eigenen Selbst bewusst, deren Wahrnehmung am Tage von einer Vielzahl schnell oszillierender Eindrücke übertönt wird. In ihrer Nichthaftigkeit ist die Nacht bedrängend, drückend und immersiv, weshalb sie auch als ein angreifendes Volumen erlebt werden kann. »Während es absurd wäre, die Geruchlosigkeit riechen zu wollen, kann man die Stille hören, weil diese ein akustisches Phänomen von gleicher Fülle wie der Schall ist, den sie an Aufdring lichkeit ein- und überholen kann.«260 Wie schwüle Luft drängt sich die Stille – je nach Situation, in der sie affiziert – als eine quasistoffliche Masse auf.261 Die Spuren, die die kulturhistorisch tief verankerte Macht des gewohnten Blickes im Habitus des Wahrnehmens hinterlässt, sind so tief gefurcht, dass in so mancher Beschreibung dunkler Nächte das Sichtbare dominiert und Bemerkungen zur Dunkelheit auf das Niveau einer Fußnote herabsinken. So verfängt sich auch der Autor einer Erzählung über die nächtliche Stadt262 nahezu ausschließlich in der Welt des Visuellen. In homöopathischen Dosen von Halbsätzen tauchen lediglich implizite Verweise aufs Hörbare auf, um sogleich vergegenständlicht zu werden. Noch in der Subjektperspektive blei ben viele Texte vom Eindruck des Gesehenen gefangen. Und so spre chen sie von einer Welt, die in visuellen Bildern nur bruchstückhaft erscheint, obgleich sie doch im Modus pluraler sinnlicher Eindrücke weit facettenreicher hätten wiedergegeben werden können. In der Nacht ist es vor allem das künstliche Licht, das in seiner artifiziellen Leuchtkraft die Aufmerksamkeit überwältigt und die Sensationen der anderen Sinne auf eine Hinterbühne verweist.
259 260 261 262
Guzzoni, Nächtliche Geräusche, S. 84. Schmitz, System der Philosophie, Band III/Teil 2, S. 203. Vgl. ebd. Vgl. Scraton, In der Nacht und am Tag.
155 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
9. Tag- und Nachtgeräusche
Stille Die Nacht ist die paradigmatische Welt der Stille. In der leiblichen Wahrnehmung wird sie entweder in Gefühlen der Enge (angespannt) oder solchen der Weite (entspannt) erlebt. Es kommt auf den situati ven Rahmen an, in dem sich Stille als bergendes oder entbergendes Gefühl behauptet. Damit stellt sich die Frage nach dem Wesen der Stille, die nur auf den ersten Blick mit der relativen Lautlosigkeit und auditiven Ruhe identisch zu sein scheint. Lautlosigkeit gibt es schon am hellen Tage, sobald eine Geräuschquelle verstummt und Ruhe eintritt. Sie ist von Stille jedoch grundsätzlich zu unterscheiden, geht diese insofern doch über die akustische Qualität der Ruhe hinaus, als sie sich, über die Lautlosigkeit hinweg, in einer immersiven Atmosphäre der Nichthaftigkeit ausbreitet. Daher hat sie im engeren Sinne auch keinen auditiven Charakter, gründet vielmehr in einer Stimmung abgründiger Leere, leiblicher Weite und offener Tiefe. Mit welchen Bedeutungen sich Gefühle der Leere und Tiefe letztlich verbinden, entscheidet sich allein in konkreten Situationen der Stille. Deshalb sollte auch nicht im singulären Sinne nur von »einer« oder »der« Stille die Rede sein. Dass Stille das Ergehen in mannigfaltiger Weise stimmen kann, belegen schon die sprachlichen Ausdrucksweisen, die Rilke in der Beschreibung spezifischer Situationen verwendet. Er spricht z. B. von »seidene[r] Stille«263, die mit der kleinsten Bewegung »sichtbar« wird. Der Kontrast zum Geräuscherleben ist dabei in aller Regel vorausgesetzt, weshalb er auch sagt: »Das sind die Geräusche. Aber es gibt hier etwas, was furchtbarer ist: die Stille.«264 Wer fast immer nichts hört oder nur fragmentarisch bzw. schattenhaft etwas Tönendes vernimmt (wie fast Taube oder schwer Hörgeschädigte), kennt nicht jene Stille, von der Rilke spricht. Wenn lautlose Ruhe auch keine Stille ist, so steht sie doch oft in einer sich anbahnenden Beziehung zu ihr. Die krankheitsbedingte Dauerhaftigkeit ausbleibender auditiver Ein drücke ist selbst eine zuständliche Situation der Stille, wenn ihr auch der Kontrast zum geräuschvollen Mitwelterleben fehlt. Deshalb ist sie auch von anderer Eindrucksqualität als die situativ sich ausbreitende und wieder verschwindende Stille der Hörenden. Rilke, Die Stille (Gedicht), Ders.: Das dichterische Werk, S. 424. Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, Ders.: Das dichterische Werk, S. 928. 263
264
156 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Stille
Ihre intensive wie immersive Eindrucksmacht verdankt sich eines gewissen Verinselungseffektes der Wahrnehmung. Der Ein druck von Stille ist eine Kontrasterfahrung, die aus dem auditiven Relief eines Hintergrundgeräuschs oder einzeln wie zusammenklin gender Laute, Töne und Klänge herausragt. Ein Eindruck der Stille verdankt sich aber auch umgekehrt kontrastierender Situationen. Stille wird bewusst, weil ein rarer Ton oder Laut, eine Stimme oder ein Schrei aus ihr herausspringt, sie also sowohl unterbricht wie zugleich intensiviert. Gerade deshalb ist die Situation der Stille bei Rilke so unbeschreiblich, weil in sie »nur ein einziger wimmernder Laut hin einklang wie eines alten Hundes«265. Die »ergreifende Wirksamkeit atmosphärischer Stille gehört zu den eindringlichsten Ereignissen affektiven Betroffenseins«266. Umso mehr fordern die Gefühle die Sprache zu transversalen Sprüngen der Explikation heraus. Die Stille ist keineswegs nichts. Sie ergreift und stimmt auf immersive Weise. Sonst könnte sie nicht so mächtig (als eine spürbare Eindrucksqualität) in das affektive Befinden eingreifen. Wenn sie in ihrem Dauern auch immer die gleiche zu bleiben scheint, so ist sie atmosphärisch doch mit einer Leere »angefüllt«, die gerade im Modus des Andauerns ihre so eigenartige Eindrucksqualität entfaltet: »die Stille um sie schien eine eigene leere Resonanz zu haben, für jede Silbe die gleiche«267. Ähnlich ist die Stille der Andacht, die ganz auf sich selbst bezogen ist. Andächtige Stille begründet ihr reso nanzspezifisches Äquivalenzverhältnis in sich selbst, d. h. in ihrem Dauern. In den anderen oben annotierten Beispielen war sie Resonanz auf eine zunächst andauernde und dann plötzlich unterbrochene Geräuschhaftigkeit, auf die sie atmosphärisch antwortete. Zu solchen Atmosphären kommt es auch in der geradezu bedrängenden Ruhe, die sich als Keimzelle der Stille erweist. Ihr situativer Nährboden kann z. B. die spürbar knisternde Anspannung eines sich zusammenbrau enden Konfliktes sein oder die kühle Leere in einem sakralen Raum. Ein eindrückliches Beispiel gibt Alain Corbin mit Bezug auf Philippe Jaccottet: »On 30 August 1956, around three a.m., when the rising moon shone on his bed and the silence was total, and he could hear absolutely nothing, no wind, no birds, no traffic, he was gripped by Ebd., S. 946. Schmitz, System der Philosophie, Band III/Teil 2, S. 207. 267 Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, Ders.: Das dichterische Werk, S. 942. 265
266
157 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
9. Tag- und Nachtgeräusche
a terrible dread.«268 In der Stille hört die Stadt aber nicht auf, zu uns zu sprechen, wie Jean-Paul Thibaud und Pascal Amphoux zunächst sagen: »the silence of the city has ceased speaking to us«269. Eher spricht sie anders zu uns als nicht mehr. In diesem Sinne merken die Autoren dann auch an: »Even silence, which could be interpreted as a refusal to communicate, is in itself a form of communication.«270 Weder Ruhe noch Stille sind unmittelbar »hörbar«, jedenfalls nicht wie (akustisch vernehmbarer) Schall. Dennoch überlagern sich sichtbar Stillstehendes und hörbar Lautloses wechselseitig wie inten sivierend. Stille wird als eine spürbare Eindrucks- und Erlebnisqua lität in einem erkenntnistheoretischen Verständnis »gehört« und »gesehen« – wie man hört und sieht, wenn man etwas nicht mit dem nüchternen Verstand, sondern mit dem sensiblen Empfinden versteht. Paradigmatisch ist die aufs Äußerste gespannte Stille vor einer Schlacht. Sie ist das reine Gefühl, eine der wohl dichtesten wie spannungsreichsten Atmosphären, die es im Selbsterleben gibt. Um den pluralen Ausdrucksgehalt der Stille erfassen zu können, merken Thibaud und Amphoux an: »we need to distinguish between the object and the principle of silence«271. Indes ist diese Unterscheidung zwischen dem, was die Stille uns zu verstehen gibt und dem, was sie bewirkt, oft gar nicht möglich; jedenfalls dann nicht, wenn, was sie bedeutet, nur ein gegenständlich aufgefasstes Spiegelbild dessen ist, was sie mit uns macht. Wenn die Stille auch kein Geräusch ist, das man als etwas Lautes oder Leises hören kann, so gibt sie sich doch in verschiedenen Inten sitätsgraden zu spüren. Der lebensweltlichen Vorstellungwelt der Stille als einem »Nichts« par excellence steht ihre leiblich spürende Wahrnehmbarkeit entgegen. Sie drängt sich als eine herumwirkliche (Dürckheim) Eindrucksqualität auf und fließt als stimmende Macht ins aktuelle Ergehen ein; sie bahnt sich auf ganz unterschiedlichen Wegen an und wird in je eigenen Modi verspürt. Doch woher kommt sie, wenn sie im synästhetischen Sinne als etwas Schweres be-drückt, einen imaginären Raum kontemplativer Weite öffnet und sich, wie
268 269 270 271
Corbin, A History of Silence, S. 22. Thibaud/Amphoux, Silencing the City?, S. 65. Ebd., S. 66. Ebd., S. 69.
158 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Stille
in Franz Kafkas Bau, »über mich senkt«272? Sie kann »von hinten«273 kommen, sich aber ebenso von überall nähern. Denn sie ist kein feststofflicher Gegenstand, sondern eine atmosphärische Qualität. Sie hat keinen geographischen Ort. Sie schwebt im Raum wie eine unsichtbare Wolke. Auch wenn es heißt, man könne der Stille »nachhorchen«274 oder in sie »hineinlauschen«275, so ist sie doch kein quasikörperliches Gebilde, sondern eine sphärisch-nichthafte Ausdehnung, in die man nicht eintreten kann wie in ein Zimmer. Aber man kann sich in sie ein-fühlen. Dieses ganz andere »Hinein« spielt auf keinen Ort an, auf den man sich mit der eigenen Wahr nehmung gleichsam zubewegen könnte, vielmehr auf eine Haltung der Wahrnehmung, die eine tentative Beziehung vom Charakter der »Einfühlung« (Worringer) oder »leiblichen Kommunikation« (Schmitz) sucht. Im leiblichen Erleben suggeriert sich Stille in Masseneigenschaf ten als Schwere und Dichte, in aller Regel eindrücklich vermittelt durch eine ausgeprägte Geräuscharmut. Stille ist jedoch auch als Atmosphäre erfahrbar, »die den Schall einbettet«276, also unter dem Einfluss von Geräuschen steht. Gerade dann hat sie mitunter die Macht zur Unterbrechung der Selbstverlautbarung der Stadt.277 Deshalb sind in relativer Lautlosigkeit der Nacht hörbar werdende Einzellaute in ihrer punktualisierenden Eindrücklichkeit auch dafür prädestiniert, ein schon spürbar gewordenes Gefühl der Stille noch zu steigern. Die Masseneigenschaft der Stille unterscheidet sich in ihrem atmosphärischen Charakter ganz offensichtlich von der Masseneigen schaft physischer Stoffe wie Wasser oder Eisen.278 Der andrängende wie umschließende Einfluss von Stille geht auf die synästhetische Wirkung ihres prädimensionalen Volumens zurück. Das sind Volu men ohne Flächen und Kanten. Sie haben eine umhüllende Gestalt ohne feste Begrenzung – wie ein Nebel, durch dessen Feuchtefeld man hindurchgeht, ohne anzustoßen. Prädimensionale Volumen ver mitteln Gefühle der Schwere und ergießen sich leiblich in räumliche
272 273 274 275 276 277 278
Kafka, Der Bau, S. 499. Hasse, Die Aura des Einfachen, S. 132. Kafka, Der Bau, S. 504. Ebd., S. 468. Schmitz, System der Philosophie, Band III/Teil 2, S. 202. Vgl. Thibaud/Amphoux, Silencing the City?, S. 67. Vgl. Schmitz, System der Philosophie, Band III/Teil 5, S. 63.
159 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
9. Tag- und Nachtgeräusche
Weite.279 Ihre atmosphärische Massenqualität wird z. B. in Gestalt bleierner Stille erlebt. Das im synästhetischen Sinne verstandenen Bleierne entspricht dabei ihrer Stofflichkeit. »Diese Stofflichkeit […] ist ihrer Dichte, ihrem Gewicht und ihrer Weite zu verdanken.«280 Die sich im atmosphärischen Stilleerleben vermittelnden Weite gefühle gehen aber nicht a priori mit Gefühlen der Versunkenheit und träumerischen Entrückung einher.281 Das Beispiel der drückenden Stille282 verdeutlicht das. Schon die Art ihrer spezifischen Stofflich keit verweist auf eine sphärische Masse, der – indem sie drückt – Empfindungen kontemplativer Entrückung ganz und gar nicht nahe stehen. Drückende Atmosphären übertragen eher etwas Schweres, das sich lastend über eine aktuelle Stimmung legt. Entlastende, leicht und fröhlich stimmende Empfindungen gehen mit ihnen nicht einher. Wenn Atmosphären in ihrer ergreifenden Wirksamkeit auch »zu den eindringlichsten Ereignissen affektiven Betroffenseins«283 gehören, so transportieren sie in ihrer drückenden Schwere doch eher be-drückende Gefühle, die wiederum stärker zu einem Befinden des Verloren-Seins in beunruhigender Leere tendieren als zur Sorge um etwas oder jemanden. Schließlich können bestimmte Bewegungen die Stille unterstreichen, vielleicht weil an ihnen meistens »nichts« zu hören ist. Über Händler, die in ihren scheinbar verwaisten Geschäften sitzen, sagt Rilke im Malte, sie »haben einen Hund, der vor ihnen sitzt, gut aufgelegt, oder eine Katze, die die Stille noch größer macht, indem sie die Bücherreihen entlang streicht, als wischte sie die Namen von den Rücken.«284
Die Stille eines Sonntages In der hektischen Welt der umtriebigen Stadt ist die Stille außerge wöhnlich und eigenartig. Dennoch kommt und geht sie in wieder kehrenden Rhythmen – in der Tiefe der Nacht und (wenn auch Vgl. Schmitz, System der Philosophie, Band III/Teil 4, S. 639. Schmitz, System der Philosophie, Band III/Teil 2, S. 204. 281 Vgl. ebd., S. 98. 282 Vgl. Schmitz, System der Philosophie, Band III/Teil 5, S. 69. 283 Schmitz, System der Philosophie, Band III/Teil 2, S. 207. 284 Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (Roman), Ders.: Das dich terische Werk, S. 950. 279
280
160 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Die Stille eines Sonntages
seltener und ganz anders) an Sonn- und Feiertagen. Nicht nur die Tageszeiten haben ihre eigenen Atmosphären und Geräusche. Auch Wochentage folgen performativen Rhythmen, die sich atmosphärisch in Bewegungsbildern städtischer Umgebungen ebenso ausdrücken wie in urbanen Geräuschkulissen. Das alltägliche raumzeitliche Befin den in der Fassung eines gewöhnlichen Werktages wird an Sonnund Feiertagen unterbrochen. In der Stimmung eines Sonntages ist »angehalten […], was sonst die Straßen füllt [… und …] sich lähmend auf einen legen kann«285. Darin unterscheidet sie sich vom Vitalton des tagtäglichen Straßenlebens. Das urbane Treiben, das vom Montag bis zum Freitag und anders noch am Samstag die Stadt flutet, folgt lebendigen bis hektischen Zyklen. In der sonntäglichen Stimmung bringt sich ein eigenartiger Habitus sedierter Lebendigkeit zur Geltung. Die Rede ist dabei von den Sonn- und noch den Feiertagen in spätmodernen, westlich geprägten Gesellschaften, in denen die religiösen Programme der Anbetung Gottes schon weitgehend außer Kraft gesetzt sind. Im sonntäglichen Erleben posttraditioneller und säkularer Milieus ent falten sich in erster Linie bunte Szenen ausgelebter Freizeit. Diese suchen zum einen die Kontemplation und Entspannung, zum anderen die Hyperaktivität in Sport und Spiel. Von den Anmutungen eines Sonntages geht deshalb eine so immersive Stimmungsmacht über das persönliche Befinden aus, weil er in seinem offenen und nahezu beliebig nutzbaren Zeitkontingent die alltäglichen Wochentage auf krasse Weise kontrastiert: Das sonntägliche Ergehen hebt sich für viele Menschen vom Zyklus der Wochenzeit ab – und zwar im Cha rakter einer raumzeitlichen Ekstase. Situationen sonntäglich-urbaner Stille sind dem Werktag fremd.286 Und so gibt es auch sonntägliche Geräuschkulissen, die sich anders zu Gehör bringen als die eines Montags oder Mittwochs. Bestimmend sind darin die Ströme »freier« Zeit wie des Sich-Gehen-Lassens im Unterschied zu den eng getakte ten Resonanzen der Arbeitswelt. Den Sonn- und Feiertagen ist eine eigenartig penetrante Immersivität eigen. In einem Gedicht schreibt Ernst Wilhelm Lotz »Und Feierabend läutet von den Türmen der
Hans Lipps, zit. bei Schmitz, System der Philosophie, Band III/Teil 2, S. 99. Zur Bedeutung der Lebendigkeit im Konzept und Phänomen von Urbanität vgl. auch Hasse, Der Leib der Stadt.
285
286
161 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
9. Tag- und Nachtgeräusche
Stadt “287. Darin klingt der Ausbreitungsmodus an, in dem sich die so sonderbaren Sonn- und Feiertagsatmosphären aufs städtische Leben absenken; sie breiten sich aus wie ein Schleier, der über eine ganze Stadt niederfällt, ohne noch Spielräume für die Durchsetzung konkur rierender Atmosphären zu lassen. In Klängen und Tönen drückt sich eben auch an Sonntagen das Leben der Menschen aus, wenngleich in einer ganz eigenen urbanen Vitalität.288 Der sonntägliche Sonderrhythmus des urbanen Lebens gibt sich in außergewöhnlichen, geradezu verinselten Situationen zu spüren, im Unterschied zur dahingehenden Zeit der Wochentage. Die rein praktische und darin zugleich affektive Beziehung zum atmosphä rischen Raum der Stadt verändert sich unter dieser Bedingung in ihrer Grundstimmung. Aber Sonntage sind nicht jedermanns Sache. Und so gibt es neben dem Genuss subjektiver Freiheitssphären auch aversive Gefühle gegenüber dem temporären Zustand relativer Aus gelassenheit. Räumliche Weite kippt dann in beengende Gefühle des Unbehaglichen. Wenn sich der etwas seltsam wirkende Indivi dualist in seiner persönlichen Abwehrstimmung auch der sozialen Macht sonn- und feiertäglicher Atmosphären entgegenstellen mag, so ändert das nichts an deren gemeinschaftsbindender Kraft. Die urbanen Bewegungsrhythmen stellen sich in der atmosphä rischen Einklammerung des tagtäglichen Lebens an einem Sonntag in einem gänzlich anderen Tonus dar als in der RaumZeit gewöhn licher Wochentage, die unter der Last der Regulierung von allem und nichts stehen, vor allem aber ins Korsett von Pflichten und geregelten Abläufen gepresst sind. Allzumal das sonntäglich beinahe betäubte Hörbild des Straßenverkehrs prägt das lautliche Gesicht die ses sonderzeitlichen Korridors. Der Schwerlastverkehr ist weitgehend ruhiggestellt, jenes unaufhörlich laute Strömen, das an Werktagen in geradezu charakteristischer Weise den gewohnten Klangteppich der Stadtstraßen grundiert, ist unterbrochen. Die Stille ist eine Atmosphäre, die sich in Situationen gefühls mäßiger Dichte für die Kommunikation zwischenmenschlicher Stim mungen anbietet. Das nicht Hörbare kann eine immersive Mächtig keit entfalten. Worte können gegenüber der immersiven Macht der Stille überaus schwach sein. Oft machen sie sogar zunichte, was die 287 Lotz, Da sind die Straßen; https://www.zgedichte.de/gedichte/ernst-wilhelmlotz/da-sind-die-strassen.html (06.02.2021). 288 Vgl. Thibaud, A sonic paradigm of urban ambiances?, S. 12.
162 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Die Stille eines Sonntages
Essenz der Stille oder des Schweigens ausmacht. »In 1955, Max Picard said, in love, there is more silence than speech.«289 Wie die Stille in der Liebe ihre kommunikativ überaus eindrückliche Macht entfaltet, so auf konträre Weise in der tiefen Abneigung oder im Hass. Am Beispiel des auf einem Roman von Georges Simenon basierenden Filmes Le chat (Die Katze) aus dem Jahre 1971 verweist Corbin darauf, wie sich in der Kommunikation der beiden Darsteller Simone Signoret und Jean Gabin die Stille steigern kann in »a deep-seated hatred, or at least of a profound disconnection.«290
289 290
Corbin, A History of Silence, S. 98. Ebd., S. 107.
163 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
10. Auf die Maschinen hören
Stimmengewirre, wie es sie zu mittelalterlichen Zeiten auf öffentli chen Märkten gegeben haben mag, sind in der Gegenwart schon in Folge der Organisation der Märkte kaum noch zu hören. Dennoch konstituieren sich auf öffentlichen Wochenmärkten ganz eigenartige geräuschhafte Gesichter urbanen Treibens. Dagegen gibt es die viel größeren, speziellen Märkte für Fisch, Getreide, Holz und vieles andere nur noch in Gestalt von sogenannter closed shops. Einst waren es große Märkte, auf denen die Händler zusammenkommen, auf dass sich im Milieu öffentlicher Schauplätze geradezu vibrierende Atmosphären herausbildeten. Schon lange haben sie sich in eine beinahe schweigsame Welt geschlossener Veranstaltungen zurückge zogen. Als High-Tech-Orte sind sie heute ökonomische Weichen und Schnittstellen einer raffinierten Güterlogistik, und in all dem quasineurale Knoten globaler Warenströme. Das scheinbar chaotische Durcheinander menschlicher Stimmen und wuselnder Bewegungen, das man (vielleicht nur romantisierend) mit »alten« Märkten asso ziiert, ist weitgehend verschwunden. Die Versammlungsorte dieser spätmodernen Märkte sind abstrakt geworden. Immer öfter gehen sie in virtuellen Bildschirm-Sphären auf, die auch die Abläufe in den tatsächlichen Räumen z. B. der Auktionsmärkte mit ihren Tribünen bestimmen. Laut gerufen wird hier selten, geschweige denn herumge schrien. Auf übergroßen Screens spiegeln sich die Phasen des Handels wider. Wer etwas kaufen oder verkaufen will, muss kaum noch auf Rufe reagieren, entscheidend sind nun digitale Anzeigen. Die Auf merksamkeit der Menschen ist in gewisser Weise computergerecht umprogrammiert worden. Im Minutentakt werden hier tonnenweise Fische oder eine LKW-Ladung exotischer Schnittblumen nach der anderen versteigert – in einer nervlichen Konzentration der Händler, die so leise ist, dass schon das geringste Knistern und Rascheln zu hören ist. Der Handel wird durch leistungsstarke Server gesteuert und
165 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
10. Auf die Maschinen hören
vorangetrieben. Sie bilden die Knoten im zentralen Nervensystem zeitgemäßer Märkte.291 Die einst so lautstarken und turbulenten Märkte, die in ihrer vita len Dimension nicht zuletzt Orte der Begegnung waren, haben sich in fast stumme Welten höchster Funktionalität verwandelt. In einer zivilisationshistorischen Fußnote illustrieren sie, dass der technische Fortschritt nicht immer (wie um 1900) mit einem Lauter-Werden städtischer Umgebungsgeräusche einhergehen muss, sondern dass der Pfeil sich auch herumdrehen kann. Ein Trend zum modernitäts bedingten Leiser-Werden der Geräusche ist aber nicht nur in diesen scheinbar geisterhaften Milieus zu beobachten. Die Minderung des Lauten drückt sich jedoch nicht allein in geringeren Lautstärken aus; leiser werden auch die Rhythmen des Lebens, aller prinzipiellen Beschleunigung zum Trotz. Die traditionellen Formen der Kommuni kation befinden sich in allen Lebensbereichen in einem tiefgreifenden Prozess der Häutung. Die sich immer schneller technifizierende, und computerisierende Welt saugt die lebendigen Töne der Menschen zwar nicht aus dem Leben der Städte heraus. Aber im Modus des Hypertechnischen werden viele von ihnen gefiltert und verzerrt. Aller vorschnellen Technik-Kritik zum Trotz fehlen in diesen tendenziell aseptischen Milieus die Geräusche der Natur keineswegs. Wie vor 500 Jahren stößt die Elster ihren scheppernd-keckernden Ruf aus und der Wind rauscht heute nicht anders als zur Zeit der Alten Griechen. Jedoch fallen die einen wie die anderen Geräusche der Natur durch die Maschen technizistischer Relevanzfilter der Aufmerksam keit immer häufiger hindurch. Der spätmoderne Zeitgenosse hört und versteht Anderes – allem voran die Signale der Maschinen. Die Geräusche der Natur werden nun, bestenfalls in einer kompensatori schen Welt der Ästhetik, auf neue Weise gehört.
291 Vgl. dazu meine Beschreibungen einer niederländischen Blumenauktion der Royal Flora in Groningen, bei der es trotz der leiblichen Gegenwart zahlreicher Käufer auf den Rängen eines großen Auktionssaales überaus leise ist. Die anwesen den Händler sind nervlich so angespannt, dass sie während des schnellen Handels nahezu wortlos bleiben. Auch angebotsbezogene Daten leuchten nur auf großen Bildschirmen auf; Hasse, Märkte und ihre Atmosphären, Kapitel 3.2.
166 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Das relative Verstummen der Naturgeräusche
Das relative Verstummen der Naturgeräusche Das dezente Rauschen elektronisch gesteuerter Maschinen ist in der Gegenwart der Stadt ubiquitär. Geräusche der Natur sind dagegen in einen lebensweltlich meist unbedeutenden Hintergrund geraten. Es beginnt sich ein partieller Analphabetismus auszubreiten, in des sen Dunkelfeld die Rufe der Tiere fremd werden. Das monotone Rauschen des dahinströmenden städtischen Verkehrs verschluckt die lautlichen Äußerungen der Natur. Das Rauschen der Bäche, Wälder, Kornfelder und Meere verbindet sich sodann mit einer gewissen Exotik. Die bewusste Wahrnehmung der Naturgeräusche scheint in der Spätmoderne obsolet zu werden. Und so haben sie in ihrer Eindrücklichkeit an Bedeutung verloren. Im postmodernen Jargon gesagt: sie erscheinen nicht mehr als »systemrelevant« und können einfach überhört werden. Wo sie einst hinweisende und warnende Funktion hatten, scheint ihre Erfassung nun keinen erkennbaren Nut zen mehr zu versprechen. Maschinensysteme »melden« krisenhafte Prozessverläufe automatisch – mal über visuelle Anzeigen, mal über Laute und Töne. Die Rufe der Tiere geben den Menschen bestenfalls zu verstehen, dass es sie noch gibt. Zugleich werden sie zu einem anachronistischen Event, in dem vormoderne und gottgläubige Zeiten verhallen. Wo unerwünschte Naturprozesse den Menschen existen ziell bedrohen (bevorstehende Vulkanausbrüche, sich anbahnende Orkane etc.), vermittelt ein zumindest regional aufgespanntes Netz von Sensoren unterschiedlichster Art mehr das Gefühl von Sicherheit als diese selbst. Wozu soll das individuelle Subjekt die Geräusche der Natur verstehend auch noch hören, wenn »exakte« naturwissen schaftliche Methoden der Krisenprophylaxe »hören« und »sehen«, was mit den fehlerfreundlichen Sinnen des Menschen ohnehin nicht zu erfassen ist. Dennoch verspürt der von postmodernen Errungenschaften ver wöhnte Mensch ein ästhetisches wie kontemplatives Bedürfnis, der Natur über das von ihr Hörbare nahe zu sein. Im ästhetischen Abstand zur Natur und im Genuss ihrer »schönen« Seiten rücken die Spätfolgen der technischen Zivilisation in einen erträglichen Hinter grund. Das Subjekt luxurierter Industriegesellschaften sieht sich als Entscheider und universeller Akteur. Natur hat der Mensch als etwas nur noch Äußerliches vergegenständlicht – in einem tiefsitzenden Glauben, sie beherrschen zu können. In der Illusion vollendeter Auto
167 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
10. Auf die Maschinen hören
nomie des Menschen und der Überzeugung, stets rational reflektiert zu agieren, wird Natur zum einen zur Kulisse, zum anderen zur Verfügungsmasse. Insbesondere in demokratisch verfassten Gesell schaften festigen sich aufgrund einer ethischen Überhöhung freier Handlungs- und Selbstbestimmungsrechte hybride Menschenbilder. Schule und Universität wirken an diesen ideologischen Konstruktio nen maßgeblich mit. Danach gilt das Subjekt als eines, das sich von der Natur emanzipiert hat, nicht zuletzt (massenmedial wie massentouristisch) über ästhetische Beziehungen zu Landschaften. Grundlegende Sensibilitäten gegenüber spürbaren Zeichen leiblich erfahrbarer Zugehörigkeit zur Natur sind meistens nur noch rudimen tär vorhanden. Indes wird das spätmoderne Selbstbewusstsein eines naturvergessenen Subjekts auf leidvolle Weise mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert. Für Gernot Böhme stellt sich die Aufgabe einer neuerlichen Selbstgewahrwerdung in der Natur. Die »Frage nach der Stellung des Menschen in der Natur wird nur dadurch zu beantworten sein, daß der Mensch wieder Stand gewinnt und damit zugleich entscheidet, was er ist und sein will.«292 Dabei rekla miert sich ein übendes Umdenken gesellschaftlich vorherrschender Naturverständnisse und -verhältnisse. Von Nöten ist in einer hoch technisierten und verwissenschaftlichten Welt nicht nur ein breites naturwissenschaftliches Basis- und Orientierungswissen. Mit ebenso großem Nachdruck reklamiert sich die Gewahrwerdung der eigenen leibhaftig spürbar werdenden Natur293 – beispielsweise im bewuss ten Hören der Atmung (eigenleiblicher Rhythmus der Natur) oder dem Standhalten gegenüber der Naturkraft einer lärmend andrängen den Sturmböe. Zum Mensch-Natur-Verhältnis resümiert Georg Picht: »Der Mensch zerstört sich selbst, weil er sich der Natur gegenüber als auto nomes Subjekt versteht.«294 Das spätmoderne Naturdenken mündet nicht nur in die Zerstörung jener äußeren Natur, die der Mensch für sein Überleben braucht, sondern auch in die Entfremdung von der eigenleiblichen Natur. Die Wachheit gegenüber den Regungen des eigenen Leibes ist weitgehend betäubt und an medizinische Systeme und das Krankenhauswesen abgetreten. In Zeiten expandierender Erwartungshaltungen an den Staat wird noch die Selbstsorge schein 292 293 294
Böhme, Die Stellung des Menschen in der Natur, S. 23. Vgl. ebd., S. 26. Picht, Der Begriff der Natur und seine Geschichte, S. 357.
168 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Der Ton der Maschinen
bar erfolgreich an Institutionen abgegeben. Zivilisationsbedingte »Schwerhörigkeit« gegenüber der Natur ist nur die Kehrseite vor schreitender Maschinenhörigkeit. Die Menschen hören ja im Allge meinen nicht aufgrund verminderter organischer Vermögen schlecht, wenig oder miserabel. In spezifischen Situationen ihres Lebens haben sie ihr Hörvermögen sogar noch beträchtlich verfeinert, so in vielen Bereichen der Technik und vor allem der digitalisierten Unterhal tungsangebote. Aber dies ist ein »neues« Hören-Können; es ist dem Takt der Maschinen unterworfen. Die Laute, Klänge und Geräusche der Natur erscheinen wie das exotische Echo einer artifiziellen Welt. Außerhalb der Nutzenkalküle von Freizeit und Erlebnis verbinden sie sich nur noch mit marginaler Lebensbedeutsamkeit.
Der Ton der Maschinen In der Spätmoderne hat sich ein »kultureller Ton« der Maschinen durchgesetzt. Es gibt auch den Rhythmus des zeitgemäßen Lebens zu spüren. Laute und leise wie in Gänze unhörbare Maschinen takten das gesellschaftliche Leben mit stets größer werdender Macht, oft unabhängig vom Wollen der Individuen. Paradigmatisch weist das (selbstfahrende) Automobil die Richtung eines Weges, auf dem der Mensch die Sorge um sich und seine Welt an die Algorithmen der Maschinen abtritt. Noch auf einem scheinbar gänzlich banalen und arbiträren Niveau drücken sich solche Verluste an Eigentätigkeit und Selbstverantwortlichkeit im Tönen der Apparate des täglichen Lebens aus: dem Piepsen von Spül- und Waschmaschine am Ende des Waschgangs und vieler anderer Laute und Signale, die eine weitgehende Abhängigkeit des modernen Menschen vom »Gang« der Maschinen repräsentieren. Wo es nicht die Maschinen selbst sind, ist es eine maschinstische Rationalität, die das systemrelevante Geschehen in nahezu allen Lebensbereichen lenkt. Das Hören spielt dabei insofern eine Sonderrolle, als es in einem gewissen Umfang für den menschlichen Service an den Maschinen instrumentalisiert wird. Es sind letztlich weniger die Geräusche der technischen Welt selbst, die uns anzeigen, dass sich das bewusste Mit-Sein in der Natur verloren hat; viel mehr ist es der sich in diesem Tönen zur Geltung bringende Algorithmus der Maschinen, der dem Leben eine Richtung gibt und die Weichen zwischen »wichtig« und »unwichtig« stellt. Dass sich die Maßstäbe der Bedeutsamkeit im Zivilisationsprozess
169 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
10. Auf die Maschinen hören
seit Jahrhunderten verschoben haben und auch in der Zukunft weiter verschieben werden, haben schon die zivilisationshistorischen Stu dien von Norbert Elias gezeigt. Die Sensibilitäten, Bereitschaften und Vermögen, das eine zu hören und das andere zu überhören, spiegeln die Imperative der Zeit nur wider. In der Verfeinerung des menschlichen Hörvermögens und des sen Anpassung an systemische Funktionserfordernisse spielt der wissenschaftliche Fortschritt eine vermittelnde Rolle. Kein wissen schaftlicher »Fortschritt« bedeutet schon a priori auch einen Zuge winn an Lebensqualität. Deshalb sind die dem Fortschritts-Begriff innewohnenden Ideologien zunächst abzuschälen, bevor sich ein produktiver und humaner Blick für die Zukunft öffnen kann. Die sinnliche Umprogrammierung des Menschen verläuft mitunter auf ethisch abgründigen Wegen. Dazu gehören im Prinzip auch alle Praktiken und Produkte der Hyperversinnlichung des Menschen, die zum einen die Spezialisierung der Wahrnehmung zur Folge haben und zum anderen deren Vereinseitigung. Die mit allen Sinnen bewusst erfasste Welt ist eine andere als jene, auf die im technischen Format von Signalen und Anzeigen nur geschlossen werden kann. Schon in den 1950er Jahren diagnostizierte Arnold Gehlen, die »wissenschaft liche ›Spitzenproduktion‹ in den Feldern, wo sozusagen die Fronter eignisse sich abspielen, wird immer abstrakter und unsinnlicher.«295 Implizit war damit auch gesagt, dass sich Entsinnlichung und Neuaus richtung sinnlicher Vermögen als zwei ineinandergreifende, mithin kaum zu trennende Prozesse darstellen. Im Schatten technischer Abstraktionen breitete sich eine Welt der Apparate aus, auf deren technisches Korrespondenzvermögen sich die Individuen wahrneh mungspraktisch erst einstellen müssen. Was Gehlen zu seiner Zeit in den Blick nahm, war Ausdruck einer Entwicklung, die sich zu seiner Zeit noch sehr kontrastreich herausschälte. Jedoch hatte er über seine Zeit hinaus einen allgemeinen Prozess beschrieben, der sich bis in die Gegenwart nicht nur fortsetzen, sondern noch immens beschleunigen sollte. Beschleunigung ist die logische Konsequenz eines ubiquitären Booms technisch hochkomplexer, kleinster und immersiver Geräte und Systeme. Deren geräuschhafter Schatten weist an beiden Enden der Dezibel-Skala Außergewöhnliches auf: das überaus Laute und das Unhörbare. 295
Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter, S. 24.
170 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Der kulturelle Oberton der Maschinengeräusche
Die sozialpsychologische Kritik Gehlens weist heute auf die Wirkung immersiver Hörtechnologien hin, die ihre Märkte finden, weil sie den Nutzern etwas Erwünschtes bieten. Ein Bedürfnis nach Unterhaltung, der Wunsch nach Ablenkung oder die ästhetische Hingabe an Musik bieten dabei allerdings nur epigonale Erklärungen. Bedürfnisse nach Ablenkung und Entspannung gab es zu allen Zeiten in der einen oder anderen Weise. Die Macht immaterieller Produkte über die Massen war in Zeiten analoger Technologien jedoch ungleich geringer. Mit tiefenästhetisch hoher analytischer Präzision bieten sich noch in unseren Tagen die Diagnosen von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno zur Kulturindustrie an. Danach suchen die Menschen in ihrem systembedingten Unbehagen nach Ausgleich und Betäubung. Das Wegsehen angesichts struktureller Mängel wie existenzieller Zukunftsprobleme vermittelt sich jedoch »nicht durchs blanke Diktat, sondern durch die dem Prinzip des Amusements einwohnende Feindschaft gegen das, was mehr wäre als es selbst«296. Auch unter der Glocke süffisanter Beschallung wird das Leben als bequemer, angenehmer und erträglicher empfunden. Es wird aber auch dissuasiv vernebelt, um gegenüber den Gründen seiner Sedie rungsbedürftigkeit abgeschirmt zu sein.
Der kulturelle Oberton der Maschinengeräusche Allzumal in der großen Stadt leidet der Mensch nicht nur unter der lär menden Last der Geräusche: er bedient sich ihrer auch, um es sich auf trügerischen Inseln lustvoller Halluzination bequem zu machen. Dass die Lautstärken in ihrer krankmachenden Intensität der Gewöhnung bedürfen, unterstreicht nur die Not einer Selbstanästhesie, die aus ihr zugrundeliegenden gesellschaftlichen Daseinsbedingungen resul tieren. Das noch so Laute muss im subjektiven Erleben weder krank machen noch stören. Mit mindestens ebenso großem Gewicht, wie Töne und Geräusche auffällig oder unauffällig, aufregend oder ent spannend sind, stehen sie in einem Rahmen kultureller Normen. Das betrifft ihre Verursachung wie ihre Wahrnehmung. Bevor Geräusche im tatsächlichen und atmosphärischen Raum vernehmbar werden, 296
Adorno/Horkheimer, Kulturindustrie, S. 122.
171 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
10. Auf die Maschinen hören
entstehen sie in einer gesellschaftlichen RaumZeit. Die Macht der Konventionen definiert, was als üblich und erlaubt sowie als störend und anstößig gilt. So war in der frühen Zeit des Automobils das beinahe beliebige Hupen im Raum der Stadt selbst bei minderen Anlässen üblich und sozial toleriert. Während der Gebrauch der Autohupe (jedenfalls in den meisten nordeuropäischen Städten) heute weitgehend auf das unbedingt nötige Maße zum Zwecke der Unfallvermeidung reduziert ist und die exzessive Benutzung als sozial unangemessen, ja sogar als unanständig angesehen wird297, gilt das lärmende Hupen in Neu Delhi als probates, wenn nicht gebotenes Mittel der Selbsterhaltung im chaotisch-turbulenten Verkehrsstrom der City. Um 1900 war das Automobil im öffentlichen Raum aber noch ein rares Gefährt. Und die von ihm verursachten Geräusche trafen auf dem gewohnten Erfahrungshintergrund innerstädtischen Lärms auf eine noch viel robustere Sensibilität als in der Gegenwart eines vergleichsweise hysterischen Alarmismus. Bis zu ihrer weitgehenden Verdrängung durch das Automobil sorgte die Pferdekutsche für einen Geräuschteppich, der angesichts der Vielzahl der Gespanne in den großen Städten einen beeindruckenden Lärm auf dem Kopfsteinpflas ter erzeugt haben muss – ein metallenes Rollen, hölzernes Klappern und schweres Aufschlagen der Pferdehufe. Spezifisch technische Hörvermögen reklamierten sich zur Zeit der beginnenden Automobilisierung um 1900 vor allem in den großen Städten. Die technisch noch sehr anfälligen Motorfahrzeuge verlangten wachsame Fahrer. So mussten Probleme, die sich lediglich ankündigten, an kaum auffälligen mechanischen Geräuschen schon frühzeitig erkannt werden. Der Motor wurde zu einem potentiellen Quasipatienten. Alle Geräusche, die vom gewohnten Klangbild einer rund laufenden Maschine abwichen, verlangten die gleichsam urplötzliche Analyse des wachsamen Ohres, um gegebenenfalls die Fahrt in eine Werkstatt zu veranlassen. »The ability to diagnose by listening had to be incorporated as an embodied technique, and the mechanics´ literature emphasized the considerable effort this took.«298. In der Gegenwart ist auch dieses Hören-Können weitgehend überflüssig geworden, weil immer mehr automatische Kontrollsysteme akute oder auch nur drohende Fehlfunktionen von selbst anzeigen. 297 298
Vgl. Bijsterveld, The Diabolical Symphony oft he Mechanical Age, S. 55. Krebs, »Sobbing, Whining, Rumbling«, S. 89.
172 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Der kulturelle Oberton der Maschinengeräusche
Im sozialen Raum der großen Städte ist schließlich eine soziale Hierarchie der Geräusche bemerkenswert. Die einen scheinen von einem gesellschaftlichen »Oben« und die anderen von einem gesell schaftlichen »Unten« zu kommen. Die in »besseren« Quartieren vernehmbaren sonoren Klänge ragen im Allgemeinen aus einem anderen Spektrum sozialer »Lautmarker« hervor als die eher schrillen Töne aus den Quartieren der Massen. Seit sich die soziokulturellen und sozioökonomischen Merkmale zur Bestimmung sozialer Räume jedoch auf unübersichtliche Weise vermischt haben, ist ein »Oben« ebensowenig eindeutig zu identifizieren wie ein »Unten«. Noch jene Geräusche, die in guten alten Zeiten einst relativ klar mit einem Oben oder Unten identifiziert werden konnten, überlagern sich nun in scheinbar chaotischer Weise. Die symbolischen Ordnungen sind brüchig geworden. Immer öfter ist die sozio-kulturelle und sozioökonomische Zusammensetzung der Bewohner eines Viertels asym metrisch. In der Folge werden soziologisch homogene Klangräume vergeblich erwartet. Dennoch suggerieren sich spezifische Geräusche als gelebter Ausdruck des sozialen Raumes: das leise und habituell statusbewusste Sprechen im öffentlichen Raum wird mit einem wahr scheinlich höheren sozialen Rang in Verbindung gebracht als das laut gestikulierende Grölen in unflätiger Sprache. Töne, Klänge, Melo dien und Geräusche werden nach einer imaginären Wertskala der Sinnlichkeit wahrgenommen. Die intuitive Wahrnehmung spiegelt dabei ein »Urverhältnis des Menschen zum Anschauungsraum«299 wider. Danach steht der Oberst in der sozialen Hierarchie oben und der Wohnungslose am denkbar tiefsten Punkt einer geradezu außerweltlichen Werteskala. Klischees sind beharrlich, oft noch gegen besseres Wissen. Geräusche bieten sich nicht zuletzt vor dem Hintergrund ihrer soziologischen Verortung auch der symbolischen Kommunikation an, erst recht, wenn sie für den sozialen »Gebrauch« produziert worden sind. Dann fungieren sie – komplementär zu visuellen Objekten der Distinktion (z. B. Kleidung und Schmuck) – wie soziokulturelle Mar ker. An der symbolischen Programmierung symbolisch aufgeladener Geräusche arbeitet z. B. die Automobilindustrie über das Klangdesign aller möglichen Autogeräusche (vom Motorensound über den Klang der Auspuffanlage bis zum Ton des Blinkers im Innenraum des Fahrzeuges). Die kostbare Limousine hebt sich u. a. im »satten« Klang 299
Klages, Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck, S. 245.
173 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
10. Auf die Maschinen hören
ihrer ins Schloss fallenden Türen vom billigen Kleinwagen ab, wo sich dasselbe nur blechern und hart anhört. Ein Fahrzeug wird auf diese Weise mit einem soziokulturellen Wert verknüpft, der mit seinem Erklingen zur Erscheinung kommt. Das Preiswerte und Einfache hat nach gesellschaftlich herrschender Symbolik einen niedrigen Rang, das Teure und in seiner Gestaltung Übertriebene einen hohen. Geräusche werden aber nicht erst als lautlicher Ausdruck von Gegenständen zu Medien der Zuschreibung von sozialer Identität. Auch die Geräusche, die der Mensch selbst in und mit seinem Körper macht, können zu Katalysatoren des Sozialen werden. Nicht nur von dem, was wir (in einem doppelten Sinne) von und über einen Men schen hören, machen wir uns ein Bild. Mit oft noch nachhaltigerer Eindrucksmacht setzt sich im Bewusstsein fest, wie ein Mensch in sei ner Körperlichkeit und durch seine Organe tönt. Wenn Georg Simmel sagt, »nach seiner Eigenart [liefert jeder Sinn, JH] charakteristische Beiträge für den Aufbau der vergesellschafteten Existenz«300, so ist damit zwar der erkenntnistheoretische Beitrag des Sehens, Hörens, Schmeckens etc. im Aufbau einer Vorstellung sozialer Wirklichkeit gemeint. In einem intransitiven Verständnis äußert sich der Mensch aber auch, indem er sich körperlich zu hören gibt. Nicht indem er expressis verbis spricht, sondern rülpst, spuckt und schreit. Archai sche Menschengeräusche sind nicht nur im Schutz der eigenen vier Wände zu hören, sondern ebenso im öffentlichen Raum. Die Essgeräusche, die die Menschen im Mittelalter an der gemeinsamen Tafel machten, hat Norbert Elias zum Gegenstand zivilisationshistorischer Forschungen gemacht, ebenso die bei der gemeinsamen Nutzung eines Bettes entstehenden Laute. Die unge bremste lautliche Selbstentäußerung stieß schon früh an Grenzen der Akzeptanz, und so setzten sich im späten Mittelalter zunehmend Gebote der Rücksichtnahme durch, wonach vor allem störende Geräu sche reduziert oder vermieden werden sollten – wie das Spucken oder Schnäuzen ohne Taschentuch. Nachdem sich das unerwünschte Tun langsam mit Gefühlen der Peinlichkeit verbunden hatte, begannen sich die Regeln im 18. Jahrhundert zu festigten. Bis in die Gegenwart sind gegen die »guten Sitten« verstoßende Geräusche in manchen sozialen Kreisen Stein des Anstoßes. Die Erzeugung gesellschaft lich inadäquater, unanständiger, sittenwidriger oder despektierlicher 300
Simmel, Soziologie der Sinne, S. 137.
174 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Spätmoderne Hörvergessenheiten
Geräusche ist bis heute Grund genug für die soziale Abwertung einer Person. Von Bedeutung für das städtische Leben sind folglich nicht jene Laute, die in der Privatsphäre einer Wohnung oder eines Hauses gewissermaßen ohne soziale Resonanz verhallen, sondern jene, die in den öffentlichen Raum ausstrahlen oder in ihm entstehen. Am bekanntesten dürfte (im Unterschied zum Gewerbelärm) der soge nannte »Nachbarschaftslärm« sein. Auch er wird in zunehmendem Maße durch die Maschinen des täglichen Lebens befeuert. Zur Ver meidung reichen Peinlichkeitsschwellen nicht aus, sofern sie über haupt verspürt werden. Wo die gefühlsmäßige Selbstregulierung des Verhaltens versagt oder ganz ausbleibt, müssen die Normen des geltenden Rechts das Verbotene definieren oder Zeitkorridore vorschreiben, innerhalb derer jeder weitgehend tun kann, wonach ihm ist. Nachbarschaftslärm ist aber ein weiter Begriff. Er kann noch diesseits von Motorsense und knatterndem Rassenmäher den sozialen Frieden aus dem Lot bringen; dazu reicht schon die »zu laute« Unterhaltung in der Nachbarschaft.
Spätmoderne Hörvergessenheiten Unter der Vormacht des Sehens und des darauf basierenden Lesens (von Texten), fällt das Hören innerhalb der »höheren« Sinne zurück. Das betrifft vor allem die Erfassung von Geräuschen. Diese Situation spitzt sich im Raum der Stadt noch einmal zu, ist dieser in der Art seiner Präsenz doch ein ästhetischer Schauraum par excellence, eine Welt für das Auge. Das nicht auf das Verstehen von Sprache gerichtete Hören gerät schnell ins Hintertreffen. David Espinet spricht deshalb von einer »eigentümlichen Hörvergessenheit«301, die zwei Seiten hat: zum einen drückt sie sich in einer aisthetischen Übermacht des Sehens aus, so dass sich das Hören und mit ihm das Hörbare auf eine Nebenbühne verschiebt: »Die Zugänglichkeit von allem, was ist, wird auf die Dimension des Sehens und der Sichtbarkeit beschränkt.«302 Das ist die technik- und zivilisationshistorische Folge einer gesellschaftlichen Entwicklung, die sich vermehrt über die 301 302
Espinet, Phänomenologie des Hörens, S. 3. Ebd., S. 4.
175 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
10. Auf die Maschinen hören
lebensweltliche und systemische Ausbreitung von Computern voll zieht. Zum anderen drückt sich Hörvergessenheit aber vor einem erkenntnistheoretischen Horizont auch in einem (mentalen) ÜberHören aus, d. h. im strukturellen Nicht-Verstehen all dessen, was abseits der Magistralen des massenkulturell Bedeutsamen existiert. Verstehendes Hören setzt lautliches Hören deshalb nicht voraus. Es hat in seinem Wesen existenziellen Charakter. Heidegger spricht wegen seiner Bedeutung für die Selbstkonstitution der Subjekte von einer »Existenzialität des Hörens«303. Der Ruf der Sorge betrifft das Dasein als »Rufer« und »Angerufener«.304 Das hörend-verstehende Leben eines jeden treibt prinzipiell alles, was sinnlich eindrücklich wird, ins Bedenken – in die »kritische Reflexion«, wie man heute sagen würde. Aber doch nur prinzipiell. Das Hörvergessen betrifft in seiner existenziellen Dimension vor allem das Überhören dessen, was vom Man305 gegenüber seiner Reflexion abgeschirmt wird. Dagegen mündet die Sorge ins Bedenken des Gewohnten und deshalb auch des eigenen Lebens. Der im weiteren Sinne »Hörende« begreift nicht nur seine Mitwelt, sondern zugleich sein eigenes Leben, zumindest strebt er diesem doppelten Begreifen zu. Die eingefleischten Routi nen des Überhörens sind unter dem normalisierenden Druck des »Man« so mächtig, dass noch das Lauteste und Dümmste am eigenen Leib resonanzlos geschieht. Die sich gegen das Bedenklich-Werden von Selbst und Welt stellende Macht kann sich so im Schatten des Nicht-Hörens behaupten und verstecken. Die erkenntnistheoretische Hörvergessenheit, d. h. die Abwendung von allem, was vom großen Strom massenmedial kommunizierter Bedeutsamkeit abweicht, wird durch zeitgemäße Formen transitiven Hörens nach dem Takt der Maschinen gefördert.
Das Nicht-mehr-Hören im Hören Das allzumal im Lärm beharrende Überhören existenziellen Angeru fen-Werdens wird das folgende Beispiel der Unterwerfung unter den genüsslich konsumierten Ton der Maschinen pointieren. Es betrifft in einem ersten Schritt die technologische Innovation des »Walkman« 303 304 305
Heidegger, Sein und Zeit, S. 274. Ebd., S. 277. Vgl. ebd.
176 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Das Nicht-mehr-Hören im Hören
aus den 1980er Jahren. Dessen Funktion und Zweck sollte sich bis in die Gegenwart in immer kleiner werdende, in gewisser Weise immaterielle Formate steigern. Der seinerzeit von Sony erfundene Walkman stellte erstmals eine Technologie bereit, die das Hören (hauptsächlich von Musik) ohne Bindung an einen festen Ort möglich machte. Die Innovation eroberte rasend schnell einen globalen Markt. Nach Shuhei Hosokawa leistete der Walkman vor allem eines: er schuf eine Welt des »Allein-Musik-Hörens«306. Was auf den ersten Blick harmlos erscheint und durch einen evidenten Zugewinn an individueller Freiheit beeindruckt, erweist sich auf den zweiten Blick als Medium der Selbstverinselung, der Herauslösung aus sozialen Bezügen. Was es in der körperlich unmittelbaren Umgebung des Walkman-Hörers gab, verwandelte sich mit einem Schlage in eine nur noch potentiell lautliche Kulisse. Mit anderen Worten: Unter der sphärischen Glocke von Kopf hörern und Ohrknöpfen wird die »draußen« tönende auditive Welt zu einem abständigen und beliebig ausschaltbaren Hintergrund. Von Exklusion betroffen sind alle »externen« Geräusche; neben denen der Natur das in Endlosschleifen ertönende urbane Geraune, stören der Maschinenlärm, ebenso aber auch die stimmlich vernehmbare Gegenwart anderer Menschen. Was der auditive homo aestheticus von der Welt zu spüren bekommt, ist ein maschinenvermitteltes Surrogat, und doch nur Exempel eines unerschöpflichen Angebots für die freie Wahl. Die freie Wahl ist eine doppelte: sie betrifft zum ersten das Was aus der Fülle dessen, was es in der Mannigfaltigkeit unterschiedlichster Musikgenres auf Schallplatten, in Rock-Konzer ten oder Musik-Aufführungen gibt oder einmal gab. Durchgreifender und medientheoretisch radikaler ist zum zweiten aber die freie Wahl des Ortes, an dem gehört wird, was man überall hören könnte. Hosokawa bezeichnet das Walkman-Hören deshalb als »deterritoria lisiertes Hören«. Dessen Effekt bestand vor allem darin, sich von einer situativ »anvertraute[n] Klanglandschaft«307 im Hier und Jetzt zu »emanzipieren«. Die neue ortlose Art des Hören-Könnens setzt das Nicht-Hören von allem voraus, was nicht diese Musik ist. Das Resonanzvermögen der Hörenden wird von ihrer herumwirklichen Welt entfremdet.
306 307
Hosokawa, Der Walkman-Effekt, S. 232. Ebd., S. 243.
177 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
10. Auf die Maschinen hören
Auf der Schwelle von Kultur, Technologie und Ökonomie breiten sich in der Gegenwart Cloud-basierte Musikangebote aus, die die im Prinzip permanente Dauerbeschallung via Kopfhörer ermöglichen, damit das Erleben des städtischen Raumes final aufs kulissenhafte Sehen beschränken und das Hören seiner Geräusche zumindest tem porär in gewisser Weise abschalten. In den Fokus kultureller und poli tischer Aufmerksamkeit kommen diese Praktiken des Sich-Abschot tens hauptsächlich wegen damit zusammenhängender Probleme der Verkehrssicherheit. Zivilisationskritische Herausforderungen wer den bestenfalls in Spurenelementen erkannt. Dagegen reklamiert sich im Sinne einer ganzheitlichen Technologiefolgenabschätzung das von Grund auf radikale Bedenken der Umformatierung der Sinnlichkeit des Hörens als Ausdruck einer strukturellen Verände rung der Wahrnehmung des Menschen. Es versteht sich von selbst, dass es nicht Alte und Gebrechliche sind, die sich mit technisch anspruchsvollen In-Ear-Technologien in ihrem Gehen oder Fahren in der Stadt gegenüber ihrem Herum abschotten und auf lautlichen Inseln platzieren. »Vor allem junge Menschen und Stadtbewohner sind davon [gemeint sind Unfälle, JH] betroffen: Laut Statistik sind sie für zwei Drittel aller Unfälle mit Stöpseln im Ohr verantwortlich. Knapp 90 Prozent solcher Unfälle ereignen sich in Städten – teilweise mit tödlichen Konsequenzen.«308 Es gibt weder wirksame Maßnah men zur Gewährleistung größerer Verkehrssicherheit, geschweige denn einen philosophischen Diskurs zur ethischen Legitimation technischer Nebenfolgen. Das wirtschaftliche Interesse am großen Geschäft mit Musikkonserven dürfte dem kategorial entgegenstehen; die Umsätze aus dem Musikstreaming sind allein in Deutschland in der Zeit von 2008 bis 2019 von 12 auf 895 Millionen Euro gestie gen.309 Der »Walkman« im engeren Sinne ist in der Gegenwart der High-Tech-Produkte des Musikentertainments schon lange auf das Niveau eines musealen Objekts abgesunken. Aber er hat einem Modus des Hörens und Überhörens den Weg geebnet, der sich mit der Erfindung der internetbasierten »Cloud« radikal weiterentwickeln konnte. Er begünstigte u. a. die Stärkung des Prinzips sozialer Verin selung – nicht allein in lautlichen Blasenwelten. Wenn es heute für Rüsche, Vermehrt schwerere Unfälle durch Kopfhörer im Straßenverkehr. Statista: Umsätze mit Musikstreaming (Subscription) in Deutschland in den Jahren 2008 bis 2019; https://de.statista.com/statistik/daten/studie/256269/ umfrage/umsaetze-mit-musik-streaming-in-deutschland/ (17.02.2021). 308
309
178 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Das Nicht-mehr-Hören im Hören
eine ganze Generation selbstverständlich ist, außer dem ubiquitären Smartphone ohne irgendeine weitere technische Hilfe Musik (oder was auch immer sich im Format einer Audiodatei speichern lässt) aus unerschöpflichen Ressourcen anzuzapfen, so geht es dabei sowohl in erkenntnistheoretischer wie in anthropologischer Hinsicht um weit mehr als nur das lautliche Hören. Die Einkapselung in atmosphäri sche Klangblasen folgt schichtübergreifend einem selbstreferenziel len Impuls. Im individualisierten Hörgenuss situiert sich das seiner sinnlich archaischen Welt überdrüssig werdende Individuum in selbst kreierten ästhetischen Klanggärten. Dabei ist es jedoch hintergründig der Rhythmus der Maschinen, der die Inseln der Lüste von ihren einst festen Orten entbindet und ins gelebte Leben implantiert. Im Hören auf die Maschinen wird deren Rhythmus unsichtbar wie unhörbar gemacht und damit dem Bedenken entzogen. In der spätmodernen Welt stehen die Errungenschaften der (technischen) Zivilisation im Fokus der Kritik. Fragwürdig wird damit auch die selbstverständliche Unterwerfung unter die Imperative der Maschinen. Die für jedermann erschwinglichen High-Tech-Produkte verlocken zur Selbstverströmung im Spiel. Georg Picht stellte noch die These auf, »der produzierte Mensch kennt sich selbst in dem produzierten Menschen nicht mehr wieder.«310 Gegenwärtig sieht es eher so aus, als kultiviere dieser ein narzisstisches Verhältnis zu hybriden Selbststeigerungen und werde sukzessive unfähig zur rudimentären Kritik der in der spätmodernen Zivilisation eingeschla genen Wege. Wer jedoch »verantwortlich handeln will, muß wissen, was er tut.«311 Der politische und alltagspraktische Umgang mit der ab 2020 grassierenden Corona-Seuche zeigt das Gegenteil. Zur Abhän gigkeit von maschinistischen Systemwelten gehört die Klammerung politischer Entscheider an sogenannte Experten, die Verwalter ver meintlich exakten Wissens. Indes hatte ihr »guter« Rat oft genug noch das lebensweltliche Wissen der »einfachen Leute« unterboten. Zur Überwindung nicht nur dieser Krise scheint sich nur ein einziger Weg anzubieten: die Beschleunigung des technischen Fortschritts. Das Hören der Maschinen betrifft nur vordergründig, was auf die Ohren geht. Noch das Hören urbaner Geräusche tangiert in einem weiteren Verständnis das Verhältnis des Menschen zu seinen Sinnen und den Bedingungen seiner Selbstkonstitution. Es mag in besonde 310 311
Picht, Zukunft und Utopie, S. 5. Ebd., S. 7.
179 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
10. Auf die Maschinen hören
rer Weise der modernen Kunst vorbehalten sein, die Aufmerksamkeit mit provokanten Mitteln auf das nicht nur ästhetische, sondern mehr noch seinsspezifische Festsitzen in Konventionen des Hörens zu lenken. Bedenklich wird damit zugleich die stumme Akzeptanz all dessen, was sich die Menschen zumuten, um mediale Massenware in Permanenz zu hören. Solange das »glatte« Hören durch kein Wach-Werden im eigenen Dasein unterbrochen wird, vergrößert sich die Macht des Immer-so-Weiter im Gewohnten nur (vgl. dazu auch Kapitel 11).
180 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
11. Lärm
Laute Geräusche gehen unter bestimmten Bedingungen in Lärm über. Etymologisch kommt »Lärm« aus der Militärsprache (von »alarma«312, was Schlachtruf bedeutet). Im 16. Jahrhundert gewinnt der Begriff eine allgemeinere Bedeutung, die auf lautliche Effekte aus der Zusammenkunft von Heerscharen verweist. Er bedeutet aber ebenso den »Zusammenlauf einer Menge«313, wildes Geschrei, Geräusch, Tosen und Getöse314. Die Bedeutung kehrt schließlich in anderen Begriffen wieder, zum Beispiel in der »Lärmglocke«315 (Sturmglocke) oder der »Dampfpfeife«, die in der Seefahrt früher auch »Lärmpfeife«316 hieß. In einem übertragenden Sinne stand auch ein Aufruhr dem Lärm nahe, und damit zugleich der sozialen Unruhe, dem Getöse, Gemetzel, Gepolter317 und Geschrei318, der Schlägerei und dem Kampf. Für letztere Formen der Unruhe war auch »Rumor« gebräuchlich. Deshalb hieß das Gefängnis auch Rumorhaus319 und die Polizeiwache Rumorwache.320 Lärm hat viele Gesichter, die nicht a priori mit großen Lautstärken zu tun haben. Die Metapher der Alltagssprache »viel Lärm um nichts«, deutet mit Bezug auf William Shakespeare aber darauf hin, dass die Sprache auch Lärm-Konnota tionen kennt, die gar keine lautliche Dimension haben. Was wir heute in einem lebensweltlich verbreiteten Verständnis recht pau schal »Lärm« nennen, differenziert Payer nach fünf Hauptkategorien: »Verkehrslärm, Gewerbe- und Industrielärm, Nachbarschaftslärm,
312 313 314 315 316 317 318 319 320
DWB, Band 12, Sp. 202. Ebd., Sp. 203. Vgl. ebd., Sp. 204. Ebd., Sp. 206. Stenzel, Deutsches Seemännisches Wörterbuch, S. 230. Vgl. DWB, Band 14. Sp. 1485. Vgl. ebd., Sp. 1484. Vgl. ebd., Sp. 1485. Vgl. ebd., Sp. 1486.
181 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
11. Lärm
Freizeitlärm, Baulärm.«321 Ein gemeinsames Merkmal überspannt die Unterschiede: Lärm ist vor allen Dingen laut. Lärm dürfte es geben, seit Menschen unter ihresgleichen leben. Schon das Fällen eines Baumes und die darauf folgende Bearbeitung des Stammes mit einer Axt kann in seiner Lautstärke das Spektrum dessen weit überschreiten, woran die Menschen in ihrem Alltag gewohnt sind und worauf sie gelassen reagieren. Lärm ist aber relativ. Stets wird er vor dem Hintergrund historisch einverleibter Sensibilitäten bewertend erlebt. Es gab zu allen Zeiten Menschen, die Lärm machten – aus welchen Gründen auch immer. Und so waren auch Praktiken verbreitet, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Über Richard Wagner heißt es bei Theodor Lessing, er habe »Glassplitter und Scherben unter seine Fenster streuen [lassen], um Kindergeschrei von seiner Wohnung fernzuhalten.«322 Jeweilige Sensibilitäten wei sen auf die Relativität der Laustärke von Geräuschen hin, und die Abwehrmaßnahmen lassen erkennen, dass es höchst unterschiedliche Empfindlichkeiten gibt, die aus ein und demselben Geräusch etwas höchst Angenehmes oder aber auch etwas Skandalöses machen kön nen. Vor dem Hintergrund von Simmels Ästhesiologie der Sinne resümiert Lessing: Der »moderne Mensch scheint so »nervös« zu sein, daß ihn nur das ganz zarte oder das ganz laute Geräusch zu fesseln vermag.«323 In Grundstrukturen mag sich die Ästhetik der Sinne – zumindest in der Massenkultur – zugunsten einer Vorliebe fürs Laute und weniger fürs Leise fortentwickelt zu haben. Nur wer auf einer sprichwörtlich einsamen Insel lebt und außer den Geräuschen des eigenen Körpers nur die der umgebenden Natur kennt, mag einen Sinn für das kaum Vernehmbare haben und die durchs Laub der Bäume fegende Sturmböe als lärmend empfinden. Das gemein schaftliche Leben der Menschen in den Städten drückt sich in einem ungleich höheren Lärmpegel aus, als das des einsamen, ganz für sich lebenden Insulaners. Die zivilisationshistorisch allein auf der menschlichen Muskel kraft basierenden Geräusche sind in ihrer »Lautstärke« mit denen der Payer, Stadt und Lärm im 19. und frühen 20. Jahrhundert, S. 10. Lessing, Der Lärm, S. 71. 323 Ebd., S. 75. Bei Georg Simmel heißt es: »zwischen Hypersensibilität und Unempfindlichkeit schwankenden Nerven können nur noch die abgeklärteste Form und die derbste Nähe, die allerzartesten und die allergröbsten Reize neue Anregun gen bringen.«; Simmel, Soziologische Ästhetik, S. 92.
321
322
182 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Lärm – ein relatives Ereignis
Maschinen nicht vergleichbar. Wenn letztere auch nicht im Allgemei nen Lärm machen, so gibt es unter ihnen doch eine Vielzahl höchst lauter Typen – von der Ramme über den Presslufthammer und die elektrische Bohrmaschine bis zu manchen Güterzügen, die in hoher Geschwindigkeit übers nahe Gleis donnern. Wenn wir an Geräusche denken, melden sich in der Erinnerung schnell zuerst die lärmenden unter ihnen. Leise Töne, Klänge und Geräusche werden (nicht nur in der Erinnerung) vom Lauten übertönt. Das Hören von Geräuschen sieht die Natur des Menschen schon zur intuitiven Gefahrenabwehr vor. Die Ohren können das Aufschre cken aber nur vermitteln, sofern eine Gefahr auch ein auditives Gesicht hat. Zerstörerische und sogar tödliche Gefahren kündigen sich aber nicht immer in lärmenden Geräuschen an. Mitunter sind gerade die leisen in besonderer Weise bedrohlich. In seiner Geschichte der Sinne widmet sich Robert Jütte in einem Kapitel über das Gehör dem Lärm als Problemquelle (Fluglärm, Freizeitlärm, Musik). Die unauffälligen Geräusche des täglichen Lebens kommen dabei eher marginal zur Geltung.324 Auch beim Thema der »Wiederentdeckung der Sinne im 20. Jahrhundert« muss der Eindruck entstehen, was wir hören, sei überwiegend eine Zumutung, und wir würden mit Watte in den Ohren ein besseres Leben führen. Das täuscht darüber hinweg, dass der Mensch auch seine leise Welt als beängstigend erleben kann. Diesseits »problematischen« Hörens ist er im allgemeinsten Sinne ein Zugehöriger und Zuhörer seiner Welt. Hörend spürt er sich schließlich in seiner Teilhabe an beinahe allem, was um ihn geschieht. Wir bedenken die Schwingungen der Welt nicht nur, wir hören sie auch – im Lauten, im Leisen wie im gänzlich Unauffälligen.
Lärm – ein relatives Ereignis Im Jahre 1931 pointiert Fritz Engel die Stadtgeräusche von Berlin mit einer Metapher: Symphonie Berlin. Die Immersivität der lärmenden Geräuschkulisse der Stadt erlebt der Autor jedoch weder beengend noch einschnürend. Vielmehr feiert er mit seinen Zeilen eine gewisse Faszination angesichts urbaner Turbulenzen, die die neue Zeit nicht zuletzt auditiv mit sich brachte: »Riesenorchester, aufschwärmend 324
Vgl. Jütte, Geschichte der Sinne, S. 300ff.
183 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
11. Lärm
in Tönen | Ein Brausen, ein Rauschen, ein Rollen, ein Dröhnen | Des Lebens Gesänge, der Arbeit Gesänge | Ein Sichverketten, ein Lösen der Klänge, Grelles und Schnelles, – der Wagen Geklirre | Der Drohruf der Hupen, der Menschen Geschwirre | Ein wanderndes, wogendes, wälzendes Heer – Und immer mehr […]“325. Die poetische Aufzählung macht auf ein Charakteristikum des Lautlichen im Allgemeinen aufmerksam, das auch in dem Gedicht »Da sind die Straßen« von Wilhelm Lotz hervorsticht. Dort heißt es: »Lärm stößt an Lärm«326. Darin steckt eine bemerkenswerte Beobachtung. Nicht nur Töne und Laute können einzeln sein, sondern auch Geräusche. Sonst könnten sie nicht als aneinanderstoßend bzw. nebeneinanderliegend erlebt werden. Dies illustriert auch das fol gende Beispiel, in dem die im Außenbereich eines Cafés eindrücklich gewordenen Geräusche beschrieben werden, die ein mancher als Lärm empfinden mag. Geräuschbeschreibung V: Das Tönen am Straßenrand327 Eine Unzahl von einzelnen Geräuschen geht in einem chaotisch-kon zertierten Ge-räusch durcheinander. Es will nicht gelingen, Klarheit darüber zu gewinnen, was sich als erstes zu Gehör bringt; nach dem Eindruck der Lautstärke gibt es dennoch ein Vorne und ein Hinten. In diesem urbanen Getöse treten manchmal menschliche Stimmen lautlich nach »vorne«. Meistens sind sie »neben« den Fahrgeräuschen der Automobile. Sie kommen aus der Gegend des Schiebefensters einer Bäckerei, an dem Brot und Brötchen an Passanten auf dem Gehweg verkauft werden. Die Stimmen »tönen« aber nur; sie klingen nicht wie in wörtlicher Rede sprechende Stimmen. Es rollt eine Tram heran; ich weiß nicht, ob ich sie höre, weil sie nicht zu überhören ist oder ob ich hinhöre und deshalb einen sich von hinten in mein Hörfeld hineinschiebenden eigenartigen Ton vernehme, der plötzlich einfach »da« ist. Die Bahn ist aber nicht laut; auf keinen Fall macht sie Lärm, eher ein unspektakuläres, aber doch eigenartiges Geräusch (bezogen auf all die Eindrücke, die an dieser Stelle bisher das Hören bestimmt haben). Einer der Antriebsmotoren macht sich bestenfalls in einem leisen Schnurren bemerkbar. Weitaus prägnanter Zitiert bei Bollerey, Mythos Metroplis, S. 56. Lotz, Da sind die Straßen. 327 Mitte Oktober, 12:30 – 13:00; 13 Grad Celsius; bedeckt, trocken, am Straßen rand einer Hauptverkehrsstraße mit Tram-Schienen in der Mitte der Straße (ohne Haltestelle). 325
326
184 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Lärm – ein relatives Ereignis
mischt sich das schwere metallene Rollen der Tramräder auf den Schienen in die auditive Kulisse ein. Von einem Tisch neben mir hebt sich das Geklapper von Geschirr, Tellern, Tassen, Untertassen oder Ähnlichem gleichsam empor – als könnten Geräusche hochsteigen wie heiße Luft. Dann kommt wieder eine Straßenbahn – auf demselben gleichmäßig-ruhigen Lautteppich wie die, die gerade erst weitergefahren ist. Die Bahn schnurrt kaum hörbar, stoppt, dann fährt sie leise an – und ist (wie abgeschnitten) weg. Was sich, diese Leerstelle gleichsam auffüllend, wie ein amor phes Rauschen anhört, ist der wellige Ton einer scheinbar endlosen aber doch hier und da unregelmäßig sich abspulenden Kette von Personenwagen. Dann fährt ein Kleinlaster in dieses lautliche Band hinein. Sein Motor tönt eindringlicher als das Rollen der Reifen auf dem Pflaster. Die Motoren der Personenwagen sind so leise, dass sie sich gegen die Fahrgeräusche auf der Straße kaum durchsetzen können. Wenn die Räder über einen eisernen Kanaldeckel fahren, klatscht es manchmal – aber nicht bei allen Autos in gleicher Weise. Von hinten sticht der schrille Ton einer Hupe durch alle anderen Laute hindurch. Dann immer wieder sprechende Leute am Verkaufsfenster der Bäckerei. Autos fahren an, rollen fast lautlos übers Pflaster – dennoch hörbar zischend und rollend. Wenn irgendwo in der Nähe eine Ampel auf Rot schaltet, hören die Laute auf. Das ist dann wie die Posa im höfischen Tanz – eine kurze »Einfrierung« aller hörbaren Bewegungen. Danach (bei Grün) zieht das scheinbar unauf hörliche Band der Töne und Laute erneut vorüber, in einer gewissen Unregelmäßigkeit. Diese hat die Gestalt eines Stockens und wird von etwas verursacht, das den gleichmäßigen Hintergrundton für kurze Momente unterbricht: erst von einem Laster, dann einem alten Motorroller und schließlich von einem beschleunigenden Motorrad (mit aufheulendem Motor). Es gibt immer wieder Verkehrsmittel, die das Einerlei der Autogeräusche unterbrechen, wie ein kaputter Smart, der knatternd vorüberfährt. Eine direkt darauffolgende, mächtig wir kende S-Klassen-Limousine gleitet im Vergleich dazu wie eine von Geisterhand getragene Sänfte vorbei. Am Gehweg auf der anderen Seite der Straße startet ein Motorroller mit einem spitzen metallenen Schnarren. Als er sich in den Straßen verkehr einfädelt, scheppert er laut und macht ein paarmal so viel Krach wie ein durchschnittlicher Personenwagen. Ein koreanischer Kleinwagen wendet mitten auf der Straße. Wo die Tramschienen liegen, quietschen die Reifen vom scharfen Einschlagen der Räder.
185 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
11. Lärm
Und wieder eine Tram mit ihrem schweren, metallenen Rollgeräusch und dem leisen Schnurren des Elektroantriebs. Ein kleiner weißer Toyota dreht (wie der Koreaner vor ihm) auf der Mitte der Straße. Es kommt gerade kein Auto. Es quietscht auch nun wieder an der Stelle, wo die Reifen die Schienen im spitzen Winkel queren. Einige Autos fahren jetzt schneller vorbei. Dabei wird es zwar lauter; aber das sind nur die Rollgeräusche der Reifen auf dem Pflaster. Sie sind eindringlicher als der Ton der Motoren. Aus der Bäckerei tönt abermals ein diffuses Geklapper von Tellern und Metallzeug. Dagegen hört man die auf der Straße neben dem Gehweg vorüberfahrenden Fahrräder gar nicht; man sieht sie nur. Wieder nähert sich eine Tram, bremst, wird etwas schneller und macht dabei einen schleifenden Ton. Dann steht sie (vielleicht eine Viertelsekunde), fährt leise an, steht erneut, fährt, stoppt noch einmal, startet mit einem ansteigenden Ton und ist plötzlich (jedenfalls als tönendes Ding) weg. Das dabei entstehende lautliche Vakuum wird von beschleunigenden Autos sofort wieder ausgefüllt. Von hinten schreckt mich eine hell-grell klingende Hupe auf – als würde etwas Spitzes in ein sich unentwegt voranwälzendes Ganzes hineingewor fen. Eine Autotür fällt mit einem fett-dumpfen Schlag ins Schloss – es ist ein Mercedes-Taxi, das kurz gehalten hat. Dann bildet das Rauschen der in beide Richtungen vorüberfahrenden Autos wieder einen unaufhörlichen wie unüberhörbaren Grundton. Man gewöhnt sich daran, als wäre es so etwas wie eine lautliche »Tischdecke«, auf die alles mögliche gelegt wird – Teller, Bestecke, ein Buch, ein Päckchen, das die Postbotin gebracht hat usw. Was sich zu hören gibt, ist scheinbar immer dasselbe; und doch variiert es unendlich mannigfaltig – eine in der Menge und Stärke der Laute ununterscheidbare Mischung aus (meistens) sonoren Moto renklängen, die von laut vernehmbaren Rollgeräuschen der Reifen auf dem Pflaster der Straße übertönt werden. Erst wenn irgendwo, vielleicht nur 100 Meter weiter (in welcher Richtung auch immer) eine Ampel auf Rot schaltet, gibt es eine kurze Pause. – Fahrräder hört man dann manchmal doch! Wenn sie ein schepperndes Schutzblech haben oder eine kratzend-schleifende Kette. Trotzdem sind sie noch das Leiseste, das es hier an herumflitzenden wie -kriechenden FahrZeugen gibt. Es kommt eine alte Tram. Die ist lauter als die modernen Gefährte. Aber nicht der Motor bringt sich stärker zu Gehör. Es ist das Rollen der Räder auf den Eisenschienen, das nun so schwer klingt – obwohl eine
186 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Das »Innere« eines Geräuschs
moderne High-Tech-Bahn tatsächlich doch viel mehr wiegen dürfte. Ein Motorroller nähert sich – nun von hinten – und übertönt alles, was sonst noch die Aufmerksamkeit herausfordert. Während es bei Wilhelm Lotz heißt: »Lärm stößt an Lärm« (s.o.), so sind es hier Einzel-Geräusche und Töne, die scheinbar nebeneinan der liegen und insgesamt vielfältige Geräusche machen. Trotz ihrer mitunter hohen Lautstärke werden sie in der Beschreibung an keiner Stelle als Lärm bezeichnet, auch wenn sie nach gültigen Rechtsnor men überwiegend als ein solcher hätten angesehen werden müssen.
Das »Innere« eines Geräuschs Was »in« einem Geräusch als auditiv mannigfaltige Binnengestalt zu hören ist, hat in seinem Erleben zwei Dimensionen: zum einen ist es »in« der Menge dessen aufgelöst, was dieses Geräusch (als ein Ganzes) ausmacht. Zum anderen treten aus der Schallmasse eines Geräuschs singuläre Töne, Laute oder wiederum eigene Geräusche hervor. So vermag sich ein einzelner Ton als etwas Singuläres gegen über dem Rauschen eines Geräuschs zu behaupten, wenn er auch nur dessen lautliche Facette ist. Das spezielle oder »einzelne« Geräusch, das in ein »größeres« Geräusch eingebettet ist, suggeriert sich zwar wiederum als eine lautliche Einheit, aber nicht in einem singulären Charakter wie ein klarer Ton (z. B. von einer Hupe), sondern in einem pluralen Sinne als etwas Eigenes. Es besteht ja seinerseits aus einem Gemenge verschiedener Töne und Klänge (wie das Geräusch einer Bohrmaschine innerhalb des Geräuschs einer Baustelle). Wenn ein Ge-Räusch auch gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass es einen umfassenden, integrierenden, verganzheitlichenden und orchestralen Synthese-Charakter hat, so bietet es sich der Wahrnehmung doch als eine zumindest optional auflösbare Mannigfaltigkeit der Eindrü cke an. Die obige Beschreibung illustriert, dass die (intuitive wie poin tierte) Aufmerksamkeit auf einer Weiche stets zwischen zwei Rich tungen in Bewegung ist und wählen muss – mehr unbewusst denn als Ausdruck einer Entscheidung. Entweder es tritt »alles« in den Fokus der Wahrnehmung, was ein Geräusch ausmacht, oder etwas wird im Sinne einer Auszugsgestalt von der pointierten Aufmerksamkeit
187 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
11. Lärm
erfasst.328 Man hört dann hin und reflektiert – wenn auch nur für eine Sekunde. Auf solch hinhörendes Bemerken machen in der obigen Beschreibung Formulierungen aufmerksam, wonach ein Geräusch mal von »vorne«, dann von »hinten« kommt oder »hochsteigt« und dann wieder »neben« den Fahrgeräuschen der Automobile zu hören ist. Damit unterstreicht sich aber nicht nur die Isolierbarkeit eines Geräuschsegmentes, sondern zugleich der Sachverhalt, dass Geräuschfacetten nicht immer diffus und in ihrer Richtung unbe stimmt im Raum umherwehen. Sie können auch richtungsbezogen wahrgenommen werden. Die Illustration pointiert implizit auch den Unterschied zwischen einem intuitiv ganzheitlichen Erfassen von Geräuschen und dem hinhörenden Bemerken seiner lautlichen Komponenten in Gestalt einzelner Laute, Töne oder abermals (geräuschimmanenter) Geräu sche. Eigenartige Geräusche oder Töne werden eher in der bewussten und fokussierenden Wahrnehmung erfasst. Das belegen vor allem die Hinweise auf die Fahrgeräusche der Tram, insbesondere das schwere metallene Rollen der Räder in den Eisenschienen. Bei Wilhelm Lotz ist von einem grellen Schleifton in der Kurve die Rede329, einem Geräusch, das bei den Bahnen seiner Zeit unvergleichlich lauter gewe sen sein mag als das, was heute von einer technisch hoch modernen Straßenbahn zu hören ist. Ihr Elektroantrieb schnurrt nur; sie fährt mit einem fast leise schleifenden Ton an und der Motor bringt sich beim Beschleunigen in jenem ansteigenden Ton zu Gehör, den schon Luigi Russolo bemerkt hatte (vgl. auch Kapitel 5). Das Geräusch der an- und wenig später wieder wegfahrenden Straßenbahn zeigt sich in lautlich wechselnden Gesichtern. Erst das mikrologische Hinhören öffnet ein Ge-räusch mit einem beinahe obduzierenden Effekt zugunsten der Vernehmbarkeit seiner Laute, Töne und Klänge, mitunter sogar Melodien. Erst im Hinhören erscheint das Innenleben eines Geräusches in seinem ganzen Facettenreichtum. Eine ähnlich differenzfreudige Wahrnehmung zeigt sich bei der Erfassung der Automobile. Auch sie werden zu »Individuen«, die sich in bestimmter Weise im Raum der Straßen bewegen, sich insgesamt aber doch auch anhören wie eine interferierende Eindrucksmannigfal tigkeit ähnlicher lautlicher Eindrücke, die sich wiederum zu einem 328 Hermann Schmitz spricht hier von »segmentierten« Situationen im Unterschied zu impressiven, welche »schon im Augenblick mit ihrer integrierenden Bedeutsam keit ganz zum Vorschein kommen«; Schmitz, Was ist Neue Phänomenologie?, S. 91. 329 Vgl. Lotz, Da sind die Straßen.
188 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Wenn ein Geräusch zu Lärm wird
Geräusch verbinden, das im Moment aufmerksamen Hinhörens zwei lautliche Quellen erkennen lässt: Motorengeräusche und Rollgeräu sche der Räder bzw. Reifen. Es sind insbesondere die Pausen und Unterbrechungen (meistens ausgelöst durch eine rote Ampel), die bewusst machen, dass es weder unentwegt weitergehende, noch nur eintönige und monotone Straßengeräusche in der dynamischen Welt der Stadt gibt. Auch erweist sich ein Geräusch nicht als etwas Geschlossenes, viel mehr als eine poröse Ganzheit, »innerhalb« derer sich lautliche Komponenten vernehmen lassen.
Wenn ein Geräusch zu Lärm wird Etwas Gehörtes verbindet sich situativ immer wieder mit dem Gese henen. Nur so kann in der Wahrnehmung aus einem knatternd vorüberfahrenden Gefährt ein anscheinend kaputter Smart werden. Die Töne »in« einem Geräusch erweisen sich schon im diffusen Mithören als überaus mannigfaltig. Noch facettenreicher werden sie im expliziten Hinhören. Die Mannigfaltigkeit der Töne, Klänge und Laute eines Geräusches dürfte im Übrigen den etymologischen Sinn des Wortes »Geräusch« begründet haben. In der Vorsilbe »Ge« drückt sich das Moment des Zusammengehalten-Seins von Vielem in Einem aus. Zur geräuschhaften Aktualität der Stadt gehört Vieles im Zugleich: die Räder eines Personenwagens, die klatschend über einen Kanaldeckel fahren, die dahinschnurrende und rauschende Bahn, das aufheulende Motorrad, das knatternde Auto, der in einem spitzen metallenen Schnarren startende Roller, der surrende Elektromotor der Tram, die quietschend und schleifend dahingleitet, die spitz schrillende Autohupe, die mit einem fett-dumpfen Schlag ins Schloss fallende Tür einer großen Limousine, das scheppernde Schutzblech eines Fahrrades mit kratzender Kette. Im Geräusch zeigt sich all dies als etwas Ganzes. Wenn die Geräusche im Außenbereich eines Cafés am Straßen rand auch nur eine Variation des Immer-Gleichen sein mögen, so zerfällt diese Einheit im aktuell hinhörenden Erleben doch schnell in eine Vielzahl des Besonderen. Im Immer-Gleichen zeigen sich dann mannigfaltige auditive Gesichter einer Situation. Sobald das Ganze in den Fokus pointierter Aufmerksamkeit gerät, zerfällt der verschwommene Akkord in ein Muster unterschiedlicher lautlicher Gesichter. Aus einer impressiven Situation, in der sich alles »im
189 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
11. Lärm
Ganzen« intuitiv versteht, wird eine segmentiere Situation, in der das Einzelne bestimmend ist. In der subjektiven Verwicklung in das an einer Stelle im städt ischen Raum sich geradezu überschlagende Geräusch von allem und nichts drängt sich auch bei größeren Lautstärken nicht zuerst die Frage auf, ob es sich dabei um Lärm handelt. Jedenfalls bietet sich die Problematisierung einer Laut-Stärke so lange kaum an, wie mit einem Ton oder Geräusch ein »Thema« anklingt, das die zugewandte Auf merksamkeit bindet. Wo die erlebnismäßige Beanspruchung jedoch größer wird als das, worauf ein Geräusch verweist, ist die Schwelle zum Lärmerleben überschritten. Jede normative Erfassung von Lärm orientiert sich letztlich am subjektiven Geräuscherleben. So wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Lärmschutzvereine initiiert, die sich allesamt gegen die Verstetigung unzumutbar lauter Geräu sche einsetzten.330 In den ersten Dekaden des neuen Jahrhunderts erwachte eine bemerkenswerte Sensibilität gegenüber der lauten Stadt. Vielerorts wurden Projekte realisiert, die sich zunächst der Auflistung störender Geräusche widmeten. Neben ganz alltäglichen metropolitanen Klängen wurden in langen Listen »objektiv« störende bzw. lärmende Geräusche zusammengetragen – Geräusche von Kin dern, Vögeln, Hunden und Katzen oder nächtlich zuschlagenden Autotüren.331 Der Lärm vermischt das eine mit dem anderen, das Laute des Hundegebells mit dem Leisen des im Wind rauschenden Blattwerks.332 Nur geht das Leise im Lärm weniger auf als unter. Zum Anlass einer Kritik am Lauten und Lärmenden wurde alles, was sich im beginnenden Industriezeitalter von gewohnten Geräusch kulissen abhob: nächtliches Hundegebell, schreiende Katzen, das Ausklopfen von Polstern und Teppichen oder die Hausmusik. Noch das Gewöhnlichste unter den sonntäglichen Geräuschen wird nun im Fokus einer hypersensiblen Aufmerksamkeit als potentieller Lärm notiert, u. a. das Glockengeläut der Kirchen. Wenn jedoch selbst die hinter Zoomauern rufenden Tiere zu einem Lärm-Problem werden, so muss solche Empfindlichkeit ethisch aufschrecken, spiegeln sich darin doch gesellschaftlich gelebte Gewalt-Beziehungen zu Tieren Vgl. Bjisterveld, The Diabolical Symphony oft he Mechanical Age, S. 50ff. Vgl. Bijsterveld, Spundspaces oft he Urban Past, S. 12. 332 »Überhaupt würde der Mensch das Lärmen und Schreien der Haustiere mit vollkommen anderen Ohren hören, wenn er verstehen könnte, wieviel Geplagtheit dahintersteckt.«; Lessing, Der Lärm, S. 65. 330
331
190 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Wenn ein Geräusch zu Lärm wird
wider, allen voran unbedachte Praktiken der seriellen Produktion und massenhaften Konsumption von Tieren. Gerade beim Lärmempfinden spielt die Subjektivität eine große Rolle. Sie macht aus einem harmlosen Klang einen »unerträglichen« Ton, aus einem lärmenden Getöse aber auch eine angenehme Atmo sphäre großstädtischer Vitalität. Lessing fundierte seine Kampfschrift gegen den Lärm in einer Psychologie »seelischer Untergründe«, in denen »all das geräuschvolle Tosen des Lebens notwendig veran kert liegt«.333 Lärm war für ihn »Ausdruck unausrottbaren menschli chen Triebes«334. Ganz anders als kulturhistorisch schon lange mit fixen Bedeu tungen belegte Symbole bieten sich diffuse und multivalente sinnliche Eindrücke in ihrer leiblich an- bis eindringenden Immersivität als affizierende Stoffe an. Im aktuellen Erleben verbinden sie sich mit Gefühlen und gehen noch offene Verbindungen mit symbolischen Bedeutungen ein. Im Prinzip werden urbane Geräusche aber nicht anders wahrgenommen als beliebige Geräusche oder Musik, d. h. in der mehr oder weniger polarisierenden Affizierung zwischen Faszina tion und Aversion. »What is music to the ears of some residents may be unwanted sound, and thus noise, to the ears of the neighbours.«335 Die Wahrnehmung von Geräuschen (nicht nur der Stadt) verändert sich indes historisch. Sie wandelt sich mit dem technischen Fortschritt, aber auch mit dem Wechsel der Rhythmen einer Stadt sowie der ihr zugeschriebenen Identität.336 Es liegt auf der Hand, dass in der frühen Zeit der Industrialisierung noch bewusst gehört wurde, was später gleichsam namenslos in Hintergrundkulissen eingeht: »Industrielle Laute generieren Lautstärken, die wir so früher nicht gekannt haben. Maschinen aller Art bevölkern den Planeten. Selten sind sie zurückhaltend, meist sind sie aufdringlich in ihrem Blasen, Brummen, Burren, Surren, Schneiden, Schlagen, Sprengen, Fräsen, Sägen Hämmern, Plärren, Klappern, Sausen, Saugen, Dröhnen, Quiet schen. Der Lärm weidet im Dasein.«337
Formal definierte Obergrenzen von Lautstärken bilden Entschei dungsgrundlagen in der behördlichen Genehmigung schallemit 333 334 335 336 337
Ebd., S. 50. Ebd. Bijsterveld, Soundspaces oft he Urban Past, S. 14. Vgl. ebd., S. 14. Schandl, Im Kontinuum des Lärms.
191 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
11. Lärm
tierender Anlagen. Solche umwelt- und immissionspolitischen Instrumente sind in Industriegesellschaften schon wegen der Ubi quität lärmtechnisch problematischer wie genehmigungsbedürftiger Maschinen unverzichtbar, um die Menschen vor Beeinträchtigun gen ihrer Gesundheit zu schützen. Sie basieren jedoch auf einer methodischen Basis der Datenerhebung und -bewertung, der wahr nehmungstheoretisch gänzlich andere Präliminarien zugrunde liegen als einer phänomenologischen Beschreibung und mikrologischen Reflexion lautlicher Eindrücke. Bezugsgrößen sind statistische Werte, die auf quantitativen Erhebungen beruhen. Dagegen sind Eindrücke nicht-quantifizierbare emotionale Grundbausteine vitalen Mitwelter lebens. Dazu stellt Franz Schandl fest: »Lärm ist im Bewusstsein der Bevölkerung kein Umweltproblem, sondern ein persönliches Problem.«338 Die Subjektivität des Geräuscherlebens mündet in die Kritik am allzu Lauten, zum anderen aber auch in die Hypersensi bilität gegenüber leisen Tönen und Geräuschen. Das Klischee der generell Lärm machenden Maschinen wird weder der Eigenart unter schiedlichster Maschinentypen gerecht, noch den letztlich immer individuell ausgeprägten Sensibilitäten des Geräuscherlebens. Im Spiegel schnell anspringender Erregbarkeit merkt Franz Schandl das niederschwellige Surren von Klimaanlagen an, die sich als »Knallef fekt der Klimaerwärmung« zunehmend auch in privaten Haushalten ausbreiten und oft »nerviger als jeder Krach«339 seien. Weitaus krasser stellt sich die Problematik leiser, geradezu schleichend wirkender Geräuschimmissionen bei Windkraftanlagen dar, die als Instrumente des Klimaschutzes tatsächlich rechtlich definierte Grenzwerte ein halten. Trotz aller Legalität kann auch die Kontinuität von leisem, rhythmisch-schleifendem Schwingen – ähnlich dem tropfenden Was serhahn – auf Dauer jede Möglichkeit der Entspannung rauben. Der technische Fortschritt kennt selbstverständlich nicht nur die Richtung der »Verschlimmerung von allem«. Er geht auch in die entgegenge setzte Richtung, in die der Minimierung von Geräuschen. Die rechtliche Durchsetzbarkeit einer Norm verlangt zu ihrer Begründung zunächst die objektivierte und statistisch nachprüfbare Quantifizierung von Schallmengen. Die TA Lärm des Bundesimmis sionsschutzgesetzes340 setzt angesichts der Ubiquität von immer 338 339 340
Ebd., S. 4. Ebd., S. 6. Die Bundesregierung, TA Lärm.
192 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Lärm muss nicht »laut« sein
neuem Lärm Maßstäbe, an die die Behörden in ihrer Genehmi gungspraxis gebunden sind. Politische Parteien und Institutionen identifizieren Lärm aber nicht in erster Linie nach Erwägungen der Gesundheitsvorsorge, sondern mitunter viel mehr nach politischen Interessen und dem Begehren von Lobbyisten. Die Genehmigung von siedlungsnahen Standorten von Windkraftanlagen bietet ein breites Spektrum an Beispielen. Von Kritikern an »Windparks«, die keine immissionssicheren Abstände zur Wohnbebauung halten, werden die Entscheidungskriterien und -prozesse der zuständigen Gebiets körperschaften oft bestritten. Nicht selten setzen sich die Interessen politischer Parteien durch, auf dass die Belastung von Anwohnern unterbewertet wird. Entscheidungsrelevant sind in Zeiten des Klima wandels energiepolitische Zielmarken, aber – ganz unabhängig davon – auch Profitinteressen lokaler Akteure und Investoren.341 Lärm gibt es nicht an sich. Von Lärm ist die Rede, wenn die lautli che Gestalt von Tönen oder Geräuschen als belästigend bzw. »nervtö tend« empfunden wird. Deshalb ist das Bundesimmissionsschutzge setz auch ein äußerst kompromisshaftes Instrument der Steuerung. Die Kulturgeschichte des Lärms macht überaus deutlich, in welcher Weise das Erleben eines Geräusches höchst wechselhaft schwanken kann. Wer den periodischen Schall des Rotors einer Windkraftanlage heute noch als unerträgliche Belästigung empfindet, mag dasselbe Geräusch nach hinreichend nachhaltiger Überzeugungsarbeit politi scher Akteure schon bald als hörbare Resonanz »klimarettender« Politik erleben.
Lärm muss nicht »laut« sein Der historisch erreichte Stand der technischen Zivilisation spiegelt sich nicht zuletzt im Geräusch einer Stadt wider, auf dem mikro logischen Niveau aber schon im Resonanzraum der eigenen vier Wände. Der mittelalterliche Ausrufer, der auf dem Marktplatz mit der Glocke auf sich bzw. seine zu verkündenden Mitteilungen aufmerk sam machte und Neuigkeiten lautstark herausschrie, wurde im 19. Jahrhundert mit der Verbreitung der Zeitung obsolet. Darin mag ein Fortschritt liegen. Der mediale Wechsel bedeutete aber auch eine Veränderung der lautlichen Erlebniswirklichkeit öffentlicher Plätze 341
Vgl. z.B. Hanke, Windräder verursachen mehr Lärm als gedacht.
193 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
11. Lärm
und Orte der Städte. Ein anderes höchst wandlungsreiches Technolo giefeld ist das Verkehrswesen. Das metallene Lärmen der hölzernen Speichenräder von Pferdefuhrwerken wurde einst vom ganz anderen Lärm der ersten Automobile verdrängt. Diese sollten im Laufe ihrer technologischen Entwicklung dann aber immer leiser werden. In der Gegenwart sind sie schon deshalb zu einer Gefahr für andere Ver kehrsteilnehmer geworden. Der Fortgang der technischen Zivilisation zeigt eines seiner Gesichter darin, dass sich mit der Ausbreitung neuer Apparate und Geräte auch die lautliche Welt verändert. In den Wohnungen sind es heute hypermoderne elektronische Haushaltsgeräte, die sich von selbst mit Tönen melden, wenn sie in Betrieb gegangen sind und ihre »Aufträge« erfüllt haben. In den 1920er und 30er Jahren war es noch das sonore Brummen des Röhrenempfängers, das die Menschen angesichts einer noch gewöh nungsbedürftigen Innovation faszinierte. Das technisch Gewohnte verändert sein Gesicht in der Spätmoderne schnell. In der Folge wird die Rede darüber, was das subjektive Wohlergehen beeinträchtigen könnte, zu einem relativistischen Balanceakt. Die Dampflokomotiven des 19. Jahrhunderts setzten die Reisenden einem »ohrenbetäubenden Lärm« aus342; aber es war das damalige Empfinden, in dessen emo tionalem Spiegel als unerträglich erschien, was zuvor noch niemand kannte. Um 1900 waren die Pferdefuhrwerke »lauter als Automobile, denn die metallbeschlagenen Reifen machten auf dem Pflaster einen ungeheuren Krach.«343 In der Gegenwart rauschen die modernen High-Tech-Züge mit abstrakten bis mythischen Namen (ICE, TGV oder Eurostar) so leise ins Bahnhofsgleis wie ein geräuschminimier ter Staubsauber, der seine Bahnen wie von Geisterhand gesteuert scheinbar ganz von selbst über den Teppich zieht. Dafür herrscht in zahllosen Supermärkten eine nicht abschaltbare Dauerbeschallung mit Werbetexten, die die Menschen suggestiven Programmen der Überrumpelung zum Kauf von Waren aussetzt. Dabei schrecken die Arrangeure solcher Zumutungen nicht vor der »Gabe« sogenannter »Informationen« zurück, die tatsächlich den Charakter der reinen Dissuasion haben. Lärm muss nicht laut sein. »Krach« kann auch leise sein. Vom Gewitter kommt der lärmende Donner. Aber auch das eigentlich fast leise Zuschlagen der Zimmertür kann als Krach empfunden werden – je nachdem, wem sie aus der Hand gefallen ist. 342 343
Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, S. 109. Geisel, Unerhört, S. 593.
194 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Lärm muss nicht »laut« sein
Auditiv bedrängend, nötigend wie ärgerlich bis unerträglich ist mitun ter schon das nur halbwegs Laute. Akzeptanzentscheidend sind nicht allein messbare Lautstärken. Oft ist es viel mehr der Inhalt dessen, was da zum Tönen kommt. Das in sich mannigfaltige Geräusch der Spätmoderne hat insofern eine urbanistisch-symbolische Qualität, als es eine Stadt (im Unterschied zum Dorf) regelrecht markiert. In einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, in die 27 deutsche Städte mit mehr als 250.000 Einwohnern einbezogen wurden, sollten besonders laute und leise Städte ausgemacht werden. Statistisch wurde dazu die im Tagesdurchschnitt an signifikanten Orten gemessene Lautstärke von 55 Dezibel auf die Stadtfläche bezogen. Berücksichtigt wurden Daten zu Straßen-, Schienen, Flugsowie Industrie- und Gewerbelärm. Als besonders laut erwiesen sich am Ende Hannover, Frankfurt am Main, Nürnberg, Bonn und Köln. Mit Sicherheit gibt »es kleine Gemeinden, die noch stärker vom Lärm belastet [sind] als Hannover – etwa Kommunen mit Durchgangsver kehr.«344 Am geringsten waren die Messwerte in Münster.345 Die Ergebnisse geben aber nur statische Durchschnittswerte wieder. Den noch wecken sie die Erwartung, es gäbe »ein« Geräusch der ganzen Stadt. Tatsächlich korrespondieren urbane Geräuschpegel eher mit der quartiersspezifischen Dynamik großstädtischen Lebens als mit dem performativen Rhythmus der »ganzen« Stadt. Geräusche der Stadt geben in gewisser Weise nur etwas von der Eigenart eines Viertels zu hören. Über subjektiv empfundene Lebensbedeutsamkeit sagen die Befunde gar nichts. In besonderer Weise kommt es auf die Bewertung eines sinnlichen Eindrucks im Fokus emotionaler Ortsbeziehungen an, denn Lärm ist mehr als Krach, und lauter Ton vor allem ein »Beziehungsdelikt«346. Was Menschen an Geräuschen zu hören bekommen, weist nur darauf hin, dass die Art und Weise, etwas so oder so zu erleben, Ausdruck ihrer persönlichen Verwur zelung in Situationen ist. Um 1900 symbolisierte das Laute und Lärmende, das aus der Maschinenwelt der aufstrebenden Industrie kam, noch Fortschritt, Stärke, Modernität und Vitalität.347 Doch auch N.N.: Lärm in deutschen Städten. Laut, lauter, Hannover. Süddeutsche Zeitung vom 20. 09. 2011; s. auch https://www.sueddeutsche.de/wissen/laerm-in-deutsch en-staedten-laut-lauter-hannover-1.1146491 (19.03.2022). 345 Vgl. ebd. 346 Geisel, Unerhört, S. 596. 347 Vgl. Payer, Stadt und Lärm im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
344
195 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
11. Lärm
diese Gesellschaft war schon eine heterogene soziale Welt, in der nicht gleich klang, was im Geräusch zu einem lautlichen Teppich verrann. Im Ganzen, Zusammenhängenden und schwer Trennbaren der Geräusche hinterließ jedoch eine höchst ungleiche Gesellschaft ihre auditiven Spuren. Kulturhistorisch war die Verursachung von Lärm und lauten Geräuschen Privilegierten vorbehalten. Kinder und Personen mit niedriger sozialer Hierarchie hatten leise zu sein.348 Nach der Konsolidierung der Industriegesellschaften war der Lärm jedweder Herkunft schnell allgegenwärtig und in den großen Städten herrschte (noch bis in die 1960er Jahre) ein unüberhörbarer »sound of technology« 349 – allem voran der Motoren- und Auspufflärm der Fahrzeuge, das Dröhnen ungedämmter Kompressoren, das Schreien der Kreissägen und Donnern der Presslufthämmer. Es versteht sich von selbst, dass zur sinnlichen Wirklichkeit einer jeden Stadt auch lärmende Geräuschkulissen gehören, in deren oft unvorhersehbare Dynamik man ganz plötzlich hineingeraten kann. Letztlich ist auch Lärm ein lautliches Ereignis, das sowohl als Ganzes thematisiert, wie in einzelne (bedeutungstragende) Komponenten zerlegt werden kann. Lärm macht vor allem eines deutlich: Über Geräusche – gleich welcher Eindrucksqualität – wird auf dem for malisierten Niveau objektivierter Daten anders gesprochen als im Fokus subjektiven Erlebens. Die so disparaten Modi der Erfassung sinnlicher Ereignisse basieren auf gänzlich unvereinbaren Denkvor aussetzungen. Aber es gibt praktische Brückenschläge zwischen der statistischen Dokumentation von Geräuschen zum Zwecke der Set zung einer rechtlichen Norm und dem persönlichen Ergehen in einem geräuschhaften Milieu. Ohne solche Vermittlungen gäbe es keine (noch so kompromisshaften) Rechtsnormen, die uns sagen, was als zumutbar oder im sozialen Miteinander als erstrebenswert gilt – wenn auch immer nur bis auf weiteres. Wann geht der Lärm der Stadt ins geradezu heimatliche Geräusch über, in eine Melodie vertrauter Klänge? Wann stiftet, was die einen Lärm nennen, des anderen Behagen und Zufriedenheit? Das kurz getaktete Starten und Landen der Flieger, die den Stadthimmel auf imaginären Straßen überqueren, mag Geräuschempfindlichen ein Gräuel sein. Mit dem Stillstand der Vielfliegerei zu Zeiten des ersten »Lockdown« in der Corona-Krise wurde die vereinzelte Wiederkehr 348 349
Vgl. Bijsterveld, The Diabolical Symphony of the Mechanical Age, S. 44. Ebd., S. 60.
196 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Lärm muss nicht »laut« sein
der Flieger am städtischen Himmel zum Symbol eines kläglichen Neubeginns ökonomischer Prosperität. Schon der sogenannte Freizeitlärm erinnert daran, dass Krach und Getöse keineswegs immer mit Belästigung und Beeinträchtigung der Lebensqualität einhergehen. Zu besonders bemerkenswerten Lautstärken bringen es die Open-Air-Konzerte der Rockmusik. Wenn sie aus medizinischer Sicht gesundheitlich auch ruinös sein mögen, so wird das Beben der Bauchdecke von begeisterten Fans doch als Genuss erlebt. Ganz anderer Lärm ist Ausdruck einer Tradition, die alljährlich zum Jahreswechsel praktiziert wird: Das Krachen und Knallen mit mehr oder weniger harmlosem Sprengzeug. Es ist heute an die Stelle dessen getreten, was in früheren Jahrhunderten zwar kaum weniger Krach machte, mit einfacheren Mitteln aber dem gleichen Mythos diente. Je nach regionalem Brauch waren es Flintenschüsse, Peitschen schläge und alles nur erdenkliche Getöse, das der Geisteraustreibung diente oder die Götter zugunsten der Menschen stimmen sollte.350 Das Geläut der Kirchenglocken hatte zu allen Zeiten in der Nähe der Kirchtürme ganz absichtsvoll beträchtlichen Krach verursacht. Unter der Herrschaft der Kirche waren es bis zur Französischen Revo lution überwiegend religiöse Anlässe, die die Glocken zum Läuten brachten. Ende des 18. Jahrhunderts gab es nach der obrigkeitlichen »Zähmung« der Kirche vermehrt das säkulare Geläut. Es diente der politischen Bekanntmachung, dem Aufruf zu Vergnügungen, und es war sogar suggestives Element politischer Zeremonien351 (s. auch Kapitel 12). Besonders in jener Zeit wurde deutlich, dass es nicht der Schall an sich ist, der ein Geräusch zum Problem macht, sondern das, was er bedeutet. Der Lärm hatte diesseits der reinen Störung stets vor allem rufende und warnende Funktion. In der Gegenwart ist es insbesondere das Vergnügen, das sich lärmend in Affektausbrüchen der Massen entlädt. Dann zeugt das Laute aber von Begeisterung und nicht von Protest, Unbehagen und Verzweiflung. Allzumal die spekta kulären Spiele in den riesigen Fußballstadien sind ohne grölende Fans eine fade Sache.
350 351
Vgl. auch HWdAgl, Band 6, Sp. 1025. Vgl. Corbin, Die Sprache der Glocken, S. 48.
197 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
12. Kunst der Geräusche
Um 1900 herrschte in Bezug auf die auditive Welt der großen Städte eine alarmbereite Sensibilität. Eine bemerkenswerte Aufmerksamkeit gegenüber den Geräuschen brachte der italienische Futurist Luigi Russolo auf. Im Unterschied zu zivilisationskritisch eingestellten Zeitgenossen wie Theodor Lessing, die sich gegen den im Geräusch erkannten Lärm zur Wehr setzten und politisch organisierten, nahm Russolo die Vielfalt der neuen großstädtischen Klanglandschaft zum Anlass, seine Wahrnehmung hinhörend zu intensivieren. Er wollte die Aufnahmefähigkeit des Ohres steigern und das Hören schärfen, dies in methodischer Hinsicht (das lautliche Vernehmen betreffend) wie gegenstandslogisch (die Unterscheidung des Gehörten betref fend).
Das »Atmen« der Stadt In seinem musikalischen Manifest Die Kunst der Geräusche schrieb Luigi Russolo 1916: »Durchqueren wir eine moderne Großstadt, halten wir unsere Ohren offener als unsere Augen, und unterscheiden wir genussvoll die Was ser-, Luft- und Gaswirbel in den Metallrohren, das Brummen der unbestreitbar animalisch atmenden und pulsierenden Motoren, das Pochen der Ventile, das Hin und Her der Kolben, das Kreischen der Motorsägen, das Rattern der Straßenbahn auf den Schienen, das Knal len der Peitschen, das Flattern der Vorhänge und Fahnen. Wir finden Gefallen an der idealen Orchestrierung des Getöses von Rollläden, der auf- und zuschlagenden Türen, des Stimmengewirrs und Trampelns der Menge, der verschiedenen Geräusche von Bahnhöfen, Eisenhütten, Druckereien, Elektrizitätswerken und Untergrundbahnen.«352
352
Russolo, Die Kunst der Geräusche, S. 9.
199 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
12. Kunst der Geräusche
Dem neuen akkordartigen353 »Geräusch-Ton« der Stadt gewann er sogar eine im weiteren Sinne musikalische Qualität ab. Dieser unor thodoxe Erfahrungsmodus setzt allerdings eine Revision überkom mener Wahrnehmungsroutinen voraus, denn sonst können wir nicht den »engen Kreis reiner Töne durchbrechen und den unerschöpflichen Reichtum der Geräusch-Töne erobern.«354 Russolo will das im Detail Hörbare, das durch die pointierte Wahrnehmung Segmentierte, aus dem Vielen heraushören, ohne das Ganze dabei seiner Faszination zu berauben. Aber er will die mit dem Gehör erfassten Töne und Geräusche nicht lassen wie sie sind. Was im menschlichen Ohr ankommt, das auditive Konzert der gelebten Stadt, ist ihm nur Roh stoff. Als Künstler will er das Viele rekombinieren, neu zusammen setzen, als Stoff der Komposition benutzen, um ein musikalisches Ereignis daraus zu machen. Und so begann er, eine neue Musikäs thetik zu entwickeln, die den Massengeschmack in hohem Maße irritieren sollte. Seine »futuristische Musik« artifiziell anmutender Maschinenklänge sollte die gewohnte Ästhetik und den zu seiner Zeit herrschenden Musikgeschmack revolutionieren. Die Vielfalt der unterschiedlichsten Maschinenklänge hatte ihn hoch affiziert. Er sah darin den auditiven Ausgangstoff einer neuen Kunst. In deren Ästhetik wollte er einem breiten Publikum das lautliche Wesen der Stadt zu Gehör bringen. Russolo war der »kühne Provokateur und Überwinder bildungs bürgerlicher Hörgewohnheiten«355. Deshalb richteten sich seine »Intonarumori« (Geräuschintonatoren), mit denen er die »natürli chen« Laute der Maschinen technisch reproduzierte, in einem krassen Kontrast zu den ästhetischen Gewohnheiten im Konsum vor allem klassischer Musik. Was in seinen Tonstudios entstand, war nicht Musik im traditionellen Verständnis. Darin lag auch nicht seine Intention. Er wollte gegen Konventionen der Wahrnehmung von Melodien, Rhythmen und Klangfolgen opponieren. Was in den Kon zerthallen und Theatern der bürgerlichen Gesellschaft tagein tagaus zu hören war, bot ihm eine sinnliche wie ästhetische Kontrastwelt. Seine Geräuschkunst betrachtete er als eine »Verurteilung all derer, die glauben, Musik zu machen, und dabei doch nur das übliche sentimentale Geklimper, die abgegriffenen melodischen Phrasen und 353 354 355
Vgl. ebd., S. 6f. Ebd., S. 7. Vgl. Ullmaier, Nachwort zu Russolo, S. 80.
200 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Das »Atmen« der Stadt
die auf Violinen und Trompeten aufbauenden, inhaltsleeren melo dramatischen Situationen wiederholen.«356 Immerhin konnte er mit seinen für die meisten Menschen höchst irritierenden, wenn nicht gar provozierenden Klängen Komponisten wie Igor Strawinsky und Sergei Prokofjew begeistern.357 Dass die Grenzen zwischen Geräusch und Musik zu keiner Zeit klar gezogen werden konnten, zeigen die Kompositionen von Strawinsky und Prokofjew allzu deutlich. Mit anderen Worten: Um die machtvolle Eindruckswirkung neuer Musik entfalten zu können, bedienten sich ambitionierte Komponisten auch unmelodischer und enharmonischer Kompositionen, um etablierten musikästhetischen Erwartungen etwas Neues entgegenzusetzen. Für Russolo waren es in besonderer Weise die Geräusche der Stadt, mit deren auditivem Rohstoff er seine Aufführungen komponierte. Luigi Russolo traf in den europäischen Metropolen zwar auf eine unerwartet große Auf merksamkeit. Dennoch blieb sein Erfolg ein Strohfeuer. Durchsetzen konnte sich seine neue Musik-Ästhetik nicht. Im Grunde war sie auch eher eine mimetische Antwort auf die Irritationen und Herausforde rungen angesichts der sinnlichen Zumutungen der Stadt und einer Welt der Maschinen, deren Eindrücke noch ganz ungewohnt waren. Wenn es einen Nachhall von Russolos Schaffen gibt, dann drückt er sich in den verschiedenen Genres zeitgenössischer elektroakusti scher Musik aus. Es ist aber weit hergeholt, in Russolo den ersten Propheten »jeder wirklich zeitgenössischen Musik« zu sehen oder gar als »Urbild des urbanen DJs«358. Dazu folgen die gängigen Formate jüngerer elektroakustischer Stilrichtungen wie Eurodance-Music, House oder Techno einem viel zu eingängigen Grundrhythmus. Der Mehrheitsgeschmack fordert seinen Tribut. Neue und ökonomisch verlockende Märkte können nur im Resonanzraum einer Ästhetik erschlossen werden, die sich in der Masse als zustimmungsfähig erweist. Einer radikal neuen Ästhetik, wie Russolo sie propagierte, fehlen schon die subkulturellen, geschweige denn massenkulturel len Akzeptanzvoraussetzungen. Eine Nähe zu heute gängigen und akzeptierten Hörgewohnheiten hatten Russolos Klänge nicht. Als Werke der freien Kunst wollten sie aber auch keiner konventionel len Geschmacksästhetik verpflichtet sein. Ebenso wenig sollten sie 356 357 358
Russolo, Die Kunst der Geräusche, S. 77. Vgl. Ullmaier, Nachwort zu Russolo, S. 83. Ebd., S. 80.
201 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
12. Kunst der Geräusche
genüsslich konsumiert werden. Sonst wären sie wohl auch viel zu schnell dem ähnlich geworden, wovon Russsolo sich distanzieren wollte. Die Kompositionen für Geräuschintonatoren brachten viel mehr ein »Rumoren« gegen den bürgerlichen Geschmack der Zeit zu Gehör. Russolos Faszination hatte die metropolitane Maschinenwelt zum Gegenstand. Neben der Provokation der seinerzeit etablierten Musikästhetik galt seine Arbeit der Würdigung einer neuen artifiziel len Welt schneller Rhythmen und voller Maschinenklänge, die den Menschen noch ganz seltsam erschienen. Hätte ihn die neue Stadt nicht in so atemberaubender Weise begeistert, hätte er ihre elektrisie rende Atmosphäre kaum als ein »nächtlich gedehnte[s], feierliche[s] und hohe[s] Atmen«359 pointiert. Seine Kompositionen sollten u. a. das »Erwachen einer Stadt« in Hörbildern explizieren. Darin kündigt sich ebenso eine Hymne an die Stadt an wie die begeisterte Aufforde rung, ihr in maximaler sinnlicher Aufmerksamkeit zu begegnen. »Die Maschine hat heute nicht nur in der tosenden Atmosphäre der Großstädte, sondern auch auf dem vor kurzem üblicherweise noch ruhigen Land eine solche Vielzahl und ein derartiges Zusammentreffen von Geräuschen geschaffen, dass der reine Ton in seiner Spärlichkeit und Eintönigkeit nirgendwo mehr Gefühlsregungen hervorruft.«360
Der überhörte Sound der Stadt Ein halbes Jahrhundert später (Ende der 1960er Jahre) sollte der kanadische Komponist R. Murray Schafer mit seinem bis heute viel beachteten Projekt Soundscape361 abermals einen Weg erschließen, um den Menschen mithilfe auditiver Medien eine lautliche Welt zu präsentieren.362 Trotz aller »Normalität« und Gewöhnlichkeit gab sie sich in einer bemerkenswerten Eigenartigkeit zu hören. Und in der Fixierung auf Tonkonserven sollte sie sogar exotisch bis irritierend klingen. Aber Schafer widmete sich nicht ausschließlich der Stadt als urbaner Welt der Maschinen. Er wendet sich bis heute der lautlichen Russolo, Die Kunst der Geräusche, S. 9. Ebd., S. 7. 361 Vgl. auch https://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/WSP/index.html (19.03.2022). 362 Winkler, Landschaft hören, S. 3. 359
360
202 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Der überhörte Sound der Stadt
Welt insgesamt zu, um sie dem Bewusstsein der Menschen zugänglich zu machen. Vielleicht sollte man sagen, er will die Sensibilität für die Mannigfaltigkeit der tönenden Welt wieder erwecken und das bewusste Bemerken des Gehörten alphabetisieren. Insofern arbeitet er mit seinen Geräusch-Mitschnitten, in denen er Klänge, Laute und Geräusche städtischer Orte wie der offenen Landschaft festhält, auf seine Weise einem urbanistischen Zivilisationseffekt entgegen. Den hatte schon Arnold Gehlen in seiner sozialpsychologischen Analyse hochindustrialisierter Gesellschaften in einem schnell vorschreiten den Erfahrungsverlust, der immer größere Segmente der sinnlichen Wirklichkeit absorbiert363, herausgestrichen. Schafer erfasst auditive Landschaften, in denen räumliche Umgebungen klingen. Zugleich macht er die Eigengeräusche des menschlichen Körpers hörbar. Die eigenleibliche Involviertheit in die sinnliche Wahrnehmung wird – wenn auch ganz anders als bei Russolo – zu einem Thema der Bewusstseinsschärfung. Während Russolos musikalisches Werk der Kunst zugeordnet werden kann, ist das bei Schafers Soundscape-Projekt im engeren Sinne nicht so. Beide Einlassungen auf die Lautlichkeit der Stadt schärfen jedoch das »Sinnenbewusstsein«364 und schaffen damit Aus gangs- und Bezugspunkte eines differenzierteren Bedenkens des per sönlichen wie gesellschaftlichen Lebens in urbanen Welten, die unter einem diffusen Druck der Beschleunigung schon lange in den Ein flussbereich eines maschinstischen Paradigmas geraten sind. Weder Russolo noch Schafer geben in ihren Arbeiten ein verklärtes Votum für die Rückkehr in ruhigere Zeiten ab, in denen der Ruf des Raben und das Plätschern des Bergbaches als lautliche Zeichen einer besseren Welt gedeutet werden könnte. Aber sie opponieren gegen das stumpfe Immer-so-weiter-Hören, mehr noch gegen das selbstverständliche Nicht-Hören. Russolo wollte die lauten Geräusche der Stadt nicht abschalten, nicht einmal den Lärm zum Verstummen bringen. Mit Schafer wäre er sich darin einig gewesen, die auditive Welt erst in die Denkwürdigkeit treiben zu müssen, bevor man den Menschen das Grundgeräusch der Stadt zu Bewusstsein bringen könnte. Der Versuch, urbane Klangbilder metaphorisch zu fassen, mit den Mitteln der poetischen Sprache ästhetisch zu binden oder in
363 364
Vgl. Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter, S. 47f. Zur Lippe, Sinnenbewußtsein.
203 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
12. Kunst der Geräusche
eine Musik der dritten Art zu transformieren365, bleibt auf den Wirkungsbereich der Kunst beschränkt. Wirksamkeit entfalten sol che synästhetischen Brückenschläge, wenn es ihnen gelingt, das Unbedachte denkwürdig zu machen. Dafür gilt es aber, Abstände zum Spektakel zu wahren. Die Illuminationsfestivals, mit denen in manchen Großstädten das Licht zum Rohstoff und Medium der Even tisierung des öffentlichen Raumes gemacht wird366, halten diesen Abstand meistens nicht ein. In ihrer ekstatischen Ästhetik fordert das Illuminationsspektakel einen dauerhaft hohen Adrenalinpegel: in der Schaulust und Sucht nach immer Neuem und immer Bizarre rem. Dagegen bleibt die Inszenierung der urbanen Tonalität durch künstlerische Arbeiten vergleichsweise dezent. Die »Verlautbarung« der Stadt ist das Andere ihrer sozialen und ökonomischen Realität. Indem ihre hörbare Wirklichkeit jedoch – wenn auch nur in Facetten – der Selbstverständlichkeit entrissen wird, rückt indirekt der Wohnund Lebensraum Stadt in den Fokus politischer Aufmerksamkeit. Die gebaute und gelebte Stadt ist es ja, und nicht eine imaginäre Sphäre, die sich in ihrer sozioökonomischen Realität zu hören gibt – in Gestalt von Tönen, Klängen und Geräuschen. So arbeitet gerade die moderne Kunst in ihrer spannungsreichen Beziehung zur Gesellschaft der Dethematisierung gravierender Probleme der Stadtentwicklung entgegen. Sie verweigert sich den ästhetischen Imperativen einer uferlosen Oberflächen-Ästhetisierung. Zweifellos werden die Pro blemgehalte der sozialen, politischen und ökonomischen Realität der spätkapitalistischen Stadt durch die Präsentation ihrer Geräusche nicht entschärft. Interventionen der Klangkunst dürften vielleicht am ehesten da Früchte tragen, wo sie gar nicht erst aufs Politische setzten, sondern – in einem ästhetisch-anthropologischen Sinne – dem Ziel zustreben, die Menschen in ihrem sinnlichen Dasein mit einer Welt technischer Reproduktionen zu konfrontieren.
Vgl. dazu Metzger, Christoph: Architektur und Resonanz. Berlin 2015, S. 86 f. Große nationale und internationale Aufmerksamkeit findet die alle zwei Jahre in Frankfurt am Main stattfindende Luminale, in deren Rahmen nicht nur öffentli che Gebäude und Unternehmenssitze wirkungsvoll illuminiert, sondern auch Sym posien zur kulturellen Bedeutung des Lichts sowie zu neuen Illuminationstechnolo gien arrangiert werden. 365
366
204 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
13. Die Stimmen der Orte
Ein Geräusch hat seinen Ort. Es kommt irgendwo her, wenn diese Herkunft auch nicht mit einem topographisch konkret lokalisierbaren Ort identisch sein muss. Das Grollen des Donners kommt vom Him mel, in dem sich noch nicht einmal »Gegenden« ausmachen lassen, nur eine Ferne. Viele Geräusche werden von der Bewegung eines Gegenstandes hervorgerufen. Im Allgemeinen lassen sie sich aber auf einen Ort im tatsächlichen Raum zurückführen. Dort haben sie ihre Quelle. Sobald sich ein Ton oder Klang aber von seinem Ausgangsort entfernt, ist er – je weiter er sich in den Raum ausdehnt – nur noch »schwimmend« in einem atmosphärischen Milieu gegenwärtig. Noch die lebensweltliche Wahrnehmung kennt die Differenz zwischen Herkunftsort und Ausbreitungsraum. So sagt man, »da ist ein merk würdiges Pfeifen« und meint damit den Ausbreitungsraum. Zugleich kommt dieses Pfeifen »von dort«, d. h. von einem Herkunftsort, der im engeren Sinne wiederum eher eine Gegend ist als ein Ort.
Der Ort der Geräusche Franz Kafka spricht vom »Ort des Geräusches«367, von »GeräuschStellen«368 und »Geräuschcentren«369. Wie auch immer ein Her kunftsort oder -raum bezeichnet wird, er bleibt so lange undeutlich und in gewisser Weise fraglich, wie er sich der genauen Verortung entzieht. Genau darin ist in Kafkas Erzählung Der Bau das nerven zehrende Problem eines Geräusches begründet, das sich nicht genau orten lässt. Der rätselhafte Erzähler wird von ihm heimgesucht und bis an den Rand des Wahnsinns geplagt. Gerade in seiner örtlichen Unbestimmtheit ist es so beunruhigend. Es scheint mal von hier und 367 368 369
Kafka, Der Bau, S. 488. Ebd., S. 496. Ebd., S. 490.
205 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
13. Die Stimmen der Orte
mal von dort zu kommen. In einem Moment raschelt es aus der Ferne, dann wieder scheint es erschreckend nahe zu sein. Geräusche haben nicht selten den Charakter gespenstischer wie flüchtiger Gestalten. Meistens suggeriert sich etwas Lautes als Nahes und etwas Leises als Fernes. Es kann aber auch ganz anders sein. Mit unter kommt das Laute aus der Ferne und das Leise aus der Nähe. Und oft gibt sich der Ort einer Emission gar nicht zu erkennen. Dann liegt er für die Dauer seines Ertönens im Nebel. Für das Geräuscherleben kann das von entscheidender Bedeutung sein, denn für das affektive Befinden (z. B. das beengende Gefühl infolge eines Lärms oder die Steigerung der Nervosität durch das leise und kontinuierliche Tropfen eines Wasserhahns) kommt es nicht nur darauf an, was, sondern auch von wo her sich etwas zu Gehör bringt. Ein Geräusch fesselt die Aufmerksamkeit mehr oder weniger, je nachdem ob es immer oder nur manchmal zu hören ist, ob es von »dort hinten« oder von einem Nirgendwo her kommt. Es macht einen bedeutenden Unterschied, ob ein merkwürdiges Rasseln, das in seiner beunruhigenden Hinter gründigkeit am Einschlafen hindert, von draußen aus dem Garten zu kommen scheint, von der Straße oder ob es unter dem Bett befürchtet werden muss. Wenn schließlich der Wunsch drängend wird, eine Störung abzustellen, entsteht das augenblickliche Suchprogramm, die Quelle der Verursachung im Raum endlich aufzudecken. Aber es sind nicht nur Dinge, die so oder so klingen und tönen. Auch Orte haben ihre auditiven Atmosphären. Mit anderen Worten: Nicht nur ein Automobil ist mit seinen Motor- und Fahrgeräuschen gegenwärtig. Ebenso hört man die Straße, über die sich vor allem in der Rushhour in nahezu ununterbrochener Folge ungezählte Fahrzeuge voranbewegen. Eine Straße klingt aber nicht selbst. Es sind die Fahrzeuge, die rauschend, heulend und röhrend über sie hinwegfahren. Luigi Russolo hatte schon auf diese Differenz aufmerk sam gemacht: »Das permanente tiefe Geräusch liegt auf verkehrsreichen Straßen immer vor und wird wahrscheinlich durch die hohen Schwingungen und Resonanzen des Straßenpflasters verursacht. Es darf also nicht mit den jeweiligen Geräuschen der Fortbewegungsmittel selbst (Reibung und Rattern der Straßenbahn auf den Schienen, der Kutschenräder und Autoreifen, des Trabs) verwechselt werden, sondern entsteht
206 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Der Ort der Geräusche
vielmehr durch das Zittern und die Schwingungen der Fahrzeuge auf dem Straßenpflaster.«370
Zur Straße gehört eine orts- bzw. raumspezifische sowie situative Wirklichkeit der Geräusche. Was ertönt, spiegelt performativ wider, was sich in einer Gegend ereignet. Die alltägliche Wahrnehmung sieht im aktuellen sinnlichen Erleben jedoch von Unterscheidungen ab, die erst in der Schärfe analytischer Anstrengungen ans Licht kämen. Deshalb werden auch keine »Kausalitäten« situativ erfasst, sondern sinnliche Eindrücke, die ganzheitlich im Herumraum zu schweben scheinen. In diesem Sinne kennt die Alltagssprach die »laute Ecke« wie die »ruhige Gegend«, wenngleich tatsächlich weder eine Ecke laut, noch eine Gegend ruhig sein kann. Orte sind in ihrer Lautlichkeit nur Resonanzmilieus für das, was irgendwo geschieht. Sie sind situativ mit Bedeutungen geladen. Zur (mehr zuständlichen als aktuellen) Situation einer Straße gehört in der belebten Zeit des Tages das ten denziell dauerhafte Vorüberfahren aller möglichen Fahrzeuge und das dabei entstehende Geräusch – eine Mischung aus Surren, Brummen, Schnattern, Knattern, Rasseln, Schnurren etc. Aber nicht nur Dinge klingen so oder so. Gerade Menschen haben ihren je persönlichen habituellen »Ton«. Eine Person erkennen wir – sofern wir sie individuell kennen – u. a. an ihrer Stimme. Und schließlich wird die Hundehalterin ihren Dackel an seiner Stimme (seinem Bellen) erkennen. Zahllose Orte sind uns dank der in ihrer Gegend vorkommenden charakteristischen Geräusche und Töne ver traut – der Bahnhof in anderer Weise als die Markthalle. Die von Dingen, Personen und Orten ausgehenden lautlichen Resonanzen sind aber nicht allein im aktuellen Geschehen begründet. In das, was wir gerade jetzt hören, mischen sich mnemonische Gestalten. Oft hat sich, was die Menschen an einem Ort, mit einer Person oder einem Gegenstand in der Vergangenheit erlebt haben, tief in die Erinnerung eingeprägt; besonders dann, wenn es mit einem gefühlsmächtig affizierenden und ergreifenden Geschehen verbunden war. Wenn die von einem aktuellen Eindruck wachgerufene Erinnerung emotional mächtig genug ist, um ins Bewusstsein aufzusteigen, dann ist sie auch stark genug, um das gegenwärtige Erleben zu färben. So mag das Geräusch des in einen Bahnhof einfahrenden Zuges die Erinnerung an einen schicksalhaften Abschied wachrufen und das dumpfe Ertönen 370
Russolo, Die Kunst der Geräusche, S. 32.
207 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
13. Die Stimmen der Orte
der Nebelhörner eines Schiffes bei einem bestimmten »Luftton«371 eine folgenreiche Begegnung in Bildern wieder aufflackern lassen. Geräusche rufen in der Erinnerung nur selten allein auditive Eindrü cke wach. Im Allgemeinen sind sie atmosphärisch eingebettet und mit visuellen, olfaktorischen und taktilen Erinnerungen verbunden. Tonino Griffero merkt hierzu an: »In short, the charm of materials […] lies largely in their affordances, that is, in their atmospheric potentiality.«372 Atmosphärisches Potential ist neben Dingen und Halbdingen (wie der Wind oder die Freude) auch Personen, Orten und Situationen eigen. Angesichts seiner Faszination für die Geräusche der Stadt sah gerade Luigi Russolo in der Straße eine geradezu orchestrale Quelle aller möglichen tonalen Gemische: »Die Straße ist eine wahre Fundgrube an Geräuschen: die rhythmi schen Gangarten der Pferde im Vergleich zu den enharmonischen Ska len der Straßenbahnen und Automobile, die starke Beschleunigung der Motoren, konfrontiert mit anderen Motoren, die bereits einen hohen Geschwindigkeitston aufweisen; das rhythmische Wanken eines Wag gons oder eines Wagens mit eisernen Rädern im Gegensatz zum fast flüssigen Gleiten der Autoreifen […]“373
Was sich zu hören gibt, lässt oft Charakteristisches vom Wesen eines Gegenstandes oder einer Situation vorscheinen. Ein Geräusch kann nämlich in gewisser Weise zu einem Gegenstand, einem Ort, einer Person, einem Tier oder einer Situation gehören. Deshalb überspringt die Wahrnehmung auch die Hürde der analytischen Zuordnung eines Geräusches zu einer akustischen Quelle. Hörend erkennen wir oft auf einen Schlag, was und wie etwas ist. Dann muss man über das Gehörte nicht erst nach-denken. Es sei denn, das lautlich Vernommene ist rätselhaft, vielleicht sogar erschreckend oder beunruhigend und drängt wie in Kafkas Bau zum immer genaueren Hinhören.
Willy Hellpach spricht mit dem Begriff des »Lufttons« das Ergehen in einem bestimmten Wetter an. Dabei geht es nicht um objektive, klimatologisch-metereo logische Situationen, sondern um das Befinden darin; vgl. Hellpach, Sinne und Seele, S. 63–65. So liegt es auf der Hand, dass es nicht allein das regnerische, nasse oder kalte Wetter ist, das sich mit einer Situation verbindet und die ihr anhaftenden Geschichten ins aktuelle Bewusstsein gleichsam hochspült, sondern mehr noch der atmosphärische Erlebniswert einer ganz bestimmten Wettersituation. 372 Griffero, Places, Affordances, Atmospheres, S. 103. 373 Russolo, Die Kunst der Geräusche, S. 33. 371
208 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Der Ort der Geräusche
Das Hören ist in zahllosen Situationen dem Sehen überlegen. Dazu sagt Hermann Schmitz mit einem Beispiel: »Einen mit Eisen stangen beladenen Wagen, der über eine holprige Straße fährt, kann man als Ding dieses Charakters ebenso sinnfällig hören wie sehen, und das gehörte Gesicht verrät von ihm in mancher Beziehung mehr als das gesehene«374. Aber es soll hier nicht auf ein Mehr oder Weniger im Sehen oder Hören ankommen. Denkwürdig ist der Sachverhalt, dass sich im Sehen wie im Hören je charakteristische Profile einer Person, eines Gegenstandes oder einer Situation zeigen (s. auch die Beschreibung des Geräusches eines vorbeifahrenden Zuges in Kapitel 3). Russolo hatte aus der Perspektive des Passagiers über die »komplexen Geräusche eines fahrenden Zuges«375 gesprochen. Ein fahrender Zug klingt so wie er fährt, d. h. ein rasender hört sich anders an als einer, der langsam in den Bahnhof rollt. »Das Fahrgeräusch gibt auch zu erkennen, ob die Fahrt über eine Eisen- oder Steinbrücke, über ein Viadukt oder eine an- bzw. absteigende Strecke führt.«376 Russolo vermochte es zweifellos in ausgezeichneter Weise, die lautliche Komplexität eines Höreindrucks im Wege konkreter Beschreibungen sehr präzise ins Einzelne aufzulösen, ohne dabei den ganzheitlichen Charakter einer Situation zu zerstören. Die unge schulte lebensweltliche Wahrnehmung sieht sich angesichts dieser Aufgabe in der Regel vor fast unüberwindliche Schwierigkeiten gestellt. Wie soll in überzeugender Schärfe der Details ein Ge-räusch in seinen »internen« Tönen, Klängen und abermals Geräuschen genau erfasst und sprachlich trefflich expliziert werden? Die in der Sache klare Beschreibung z. B. eines »typischen« Zuggeräusches (oder des Stimmengewirrs auf einem Wochenmarkt zur Mittagsstunde) setzt voraus, dass ein konkreter sinnlicher Eindruck in passenden Worten erfasst werden kann. Die Herausforderung erleichtert sich, wenn ganzheitlich-ästhetische Explikationsmodi zur Verfügung stehen wie die Fotografie oder Videographie.
374 375 376
Schmitz, Der unerschöpfliche Gegenstand, S. 218. Russolo, Die Kunst der Geräusche, S. 35. Ebd.
209 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
13. Die Stimmen der Orte
Hörsame Architektur Auch Bauten können ihren Klang haben. Über ihren allzu evidenten Zweck hinaus stimmen sie den atmosphärischen Raum, ganz gleich, ob es sich dabei um eine Brücke, ein Hochhaus oder eine Kirche handelt.377 Architektur funktioniert nicht nur im engeren Sinne, sie funktioniert auch, wenn sie auf die richtige Weise (ihrem Gebrauch entsprechend) »klingt«. Wie Räume klingen, liegt auch an ihren archi tektonischen Eigenschaften. Große, weite und offene Räumen hallen, enge und kleine Zimmer verschlucken menschliche Stimmen, Schritte sind auf Teppichböden kaum hörbar; auf Fliesen klingen sie dagegen hart. In der Nähe von Hochhäusern pfeifen die Fallwinde, und in einem Operationssaal hört sich alles in seiner Tonalität etwas »kantig« an. Die »weichen« Wände eines Tonstudios verschlucken möglichst viele Laute, um unerwünschte Störungen von den empfindlichen Mikrophonen fernzuhalten. In der Architektur können akustische Bedingungen des Raumer lebens sogar programmatisch von essentieller Bedeutung sein. Zu allen Zeiten spielten sie in der Baukunst eine mitunter sogar herausra gende Rolle. »Akustik« übersetzt das Wasmuths Lexikon der Baukunst mit dem Begriff der »Hörsamkeit«378 – eine aus heutiger Sicht unzeitgemäß wirkende Wortwahl, allzumal in der Gegenwart einer in Anglizismen und Abstraktionismen verliebten Sprache. Hörsamkeit anstrebende Raumgestaltung konzentriert sich auf die Art und Güte entstehender Klangwirkungen und nicht allein auf visuelle Effekte. Dabei spielen nicht nur Fragen der Dämpfung und Lautstärkeregulie rung, des Schallrückwurfs und der Klangfarbe eine Rolle, sondern auch symbolische Gesten und synästhetisch kommunizierte Bedeu tungen. Je nach dem Zweck eines Bauwerkes können thematische Affizierungsarrangements in den Fokus rücken. So stellt der Entwurf eines sakralen Raumes andere Anforderungen an seine Hörsamkeit als der Hörsaal einer Universität oder eine Konzerthalle.
377 378
Vgl. dazu auch Hasse, Atmosphären. Wasmuths Lexikon der Baukunst, Band 1, S. 82.
210 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Hörsame Architektur
Abb.1: Ehrenmal für die Opfer des Ersten Weltkrieges, Frankfurter Hauptfriedhof, Außenansicht (erbaut 1928), (Bild: Jürgen Hasse).
Am Beispiel eines Ehrenmales für die Opfer des Ersten Weltkrieges, das im Jahre 1928 auf dem Frankfurter Hauptfriedhof eingeweiht wurde, soll das skizziert werden (s. Abb. 1 und 2). Das Krieger-Ehren mal geht auf einen Entwurf von Hermann Senf zurück. Er schuf eine aus Basaltsteinen gemauerte Rotunde379, die mit einem umfriedenden Wassergraben als Raum im Raum des Friedhofs beeindruckt. Eine Treppe führt über eine kleine Brücke an ein eher enges als weites Por tal, das mit einer zweiflügeligen, schmiedeeisernen Tür geschlossen werden kann. Dahinter liegt der Innenraum der Rotunde. Gegenüber vom Zugang liegt auf einem gemauerten Sockel die Skulptur eines in Bronze gegossenen »sterbenden Kriegers« am Boden. Sie wurde von dem Bildhauer Paul Seiler angefertigt. Die Rotunde ist etwa in der Hälfte ihrer nach oben gewölbten Form zum Himmel hin offen. Die kreisrunde Aussparung betont im Blick nach oben die Verbindung von allem Irdischen mit der ewigen Sphäre des Himmels. Man könnte auch sagen, sie fungiert als Gelenk zwischen Himmel und Erde. Seine atmosphärische Wirkung verdankt der Innenraum aber nicht der nachspürenden Annäherung an seine optische Gestalt. Viel beeindruckender ist seine Klanglichkeit. Schon beim Eintreten in den kreisrunden Raum kündigt sich ein leichtes Hallen der Schritte an, das sich zur Mitte hin verstärkt. Die Architektur der Rotunde ist in ihrer Akustik so konzipiert, dass der 379
Vgl. auch Denkmalamt der Stadt Frankfurt, S. 382f.
211 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
13. Die Stimmen der Orte
unüberhörbare Nachhall der eigenen Schritte das atmosphärische Raumerleben stimmt. Der bauakustischen Konstruktion des Raumes ist es zu verdanken, dass sich seine architektonische Gestalt im Moment der eigenleiblichen Bewegung ins Erhabene steigert. Die bloße Anwesenheit genügt jedoch nicht, um diese besondere, syn ästhetisch so eindringlich affizierende Atmosphäre zu spüren. Erst die körperliche Bewegung setzt die Lebenden in eine schlagartig denkwürdig werdende Beziehung zu den unbewegten und für immer bewegungslosen Toten. Die sichtbare wie hörbare Architektur tran szendiert im leiblichen Spüren ihrer ganz spezifischen Vitalqualität schließlich ins Numinose.
Abb. 2: Ehrenmal für die Opfer des Ersten Weltkrieges, Frankfurter Hauptfriedhof, Innenansicht (Bild: Jürgen Hasse).
Wenn es auch in besonderer Weise die Lautlichkeit ist, die den Innen raum der Rotunde vom Erhabenen ins Numinose des Sakralbaus aufsteigen lässt, so ist das erste Medium beharrender Raumgestal tung doch der Stein. Vom Steinernen geht die beeindruckende wie immersive Wirkung des Halls aus. Und so schreibt Hans Gerhard Evers über die Macht des Steins in der Architektur der Sakralbauten, »daß die gesetzte Ordnung dauern soll. Es handelt sich nicht um
212 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Vom Turm her die Glocken läuten
eine Verabredung für heute, die morgen wieder umgestoßen werden darf. Zur Architektur greifen die Menschen, wenn sie ihrem Gebot und ihrer Satzung ewige Dauer verleihen wollen.«380 Das Bauwerk unterscheidet sich genau dadurch von jeder nur temporären Insze nierung: es dauert und beharrt, trotz seines situativ immer wieder neuen Erlebens.
Vom Turm her die Glocken läuten Zum Geräusch einer jeden Stadt in der christlich geprägten Welt gehört das regelmäßige Erklingen der Kirchenglocken. Sie verweisen auf ein Moment der Sakralität inmitten des profanen Raumes der Stadt. Während sie einer liturgischen Ordnung folgen, schlagen die weltlichen Glocken auch nach einem weltlichen Takt – zur Mitteilung der Uhrzeit zur vollen oder halben Stunde sowie zum Alarm bei einem Brand. In säkularisierten Gesellschaften ist die mythische Emission der Kirchenglocken geschwächt; dennoch sind sie in ihrer Klangästhe tik unverzichtbare Wirkgrößen urbaner Atmosphären. Der Glocke eignet ein hohes suggestives Potential der Beeindruckung. Neben allem, was die Menschen über die Besonderheit einer Glocke und ihre Geschichte wissen, überträgt sich ihre sinnliche Macht im Milieu des Schalls ins subjektive Befinden. Eine Glocke kommt in einer unverwechselbaren lautlichen Eigenart zur Erscheinung. Jede Glocke ist ein Individuum. In der Art und Weise, wie sie das sinnliche Erleben stimmt, drängt sich die Frage nach ihrem klingenden und schallenden Wesen auf. Ihre Hörsamkeit basiert auf einer schallartigen Ausstrahlung. Aber darüber hinaus verbinden sich mit einer Glocke auch nicht hörbare Bedeutungen. Der Naturphilosoph Carl Gustav Carus (1789 – 1869) begriff den Schall der Glocke als Ausdruck der Gesetze eines kosmologischen Zusam menhangs. Wenn dieses Verständnis den Menschen in der modernen Zeit auch fremd geworden sein dürfte, so repräsentiert es doch ein ganzheitliches Denken, das in der phänomenologischen Betrachtung von Geräuschen im Allgemeinen und Glocken im Besonderen eine erkenntnisvermittelnde Rolle spielt. 380
Evers, Tod, Macht und Raum als Bereiche der Architektur, S. 5.
213 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
13. Die Stimmen der Orte
Carl Gustav Carus geht es beim Hören um zweierlei: das akusti sche Erfassen eines Lautes mit dem Ohr und das vitale Hörerleben dessen, was da zum Tönen und Klingen gelangt. Denn, »was wir Schall und Ton nennen, [ist] noch nicht an und für sich wirklicher Schall und wirklicher Ton, sondern wird erst hierzu durch den Konflikt, in welchen es mit dem Ton-Organe, dem Ohr, zu treten bestimmt ist.«381 Dem Klingen der Glocke geht für ihn daher auch mehr voraus als nur eine Pendelbewegung des Metalls, vielmehr ein innerliches »Flüs sig-seyn und Wellenschlagen, welches doch die wahre Bedingung des Tönens ausmacht.«382 Das Geheimnis gründet für ihn darin, »daß jene ursprünglichen Strebungen des Weltganzen – Schwerseyn und Leichtseyn – Zusammenziehung und Ausdehnung – durch den Bann irgend einer Idee in irgend einem gewissen Maße fest […] gehalten werden.«383 Es ist in diesem Sinne eher ein Lebensprinzip, das sich im Ton der Glocke zur Geltung bringt, als nur ein physikalischer Prozess. Es ist ein »Flüssig-Sein und Wellen-Schlagen, welches doch die wahre Bedingung des Tönens ausmacht«384, eine »zeitweilige Verflüssigung des Inneren«. Denn »bald gewinnt das Beharren wieder die Oberhand und die Masse kehrt zu periodischer Ruhe zurück«385. Bemerkens wert ist an Carus´ Sicht, dass er das Hören vitalistisch erklärt, das organische Hören also vom spürenden Hören nicht abspaltet. Es ist für ihn nicht so sehr die metallene Resonanz des mechanisch an den Glockenkörper anschlagenden Klöppels, die das Tonerleben ausmacht, als eine dynamische »innere« Bewegung. Deshalb rückt er das Sich-Bewegende in den Fokus. Bewegung gibt es hier auf zwei Seiten: der des tönenden Objekts und der des hörenden Subjekts. Die Bewegung des Materials eines Gegenstandes hallt auf ganz andere Weise im hörenden Menschen wider als das Material schwingt. Nun schwingen aber die Menschen auch mit den Dingen und alles geht in einem Schwingungsganzen auf. An dieser Sichtweise lässt sich anknüpfen, so dass sie schließlich für eine Phänomenologie des Lauten und Leisen nutzbar gemacht werden kann. Das setzt aber ein ganzheitliches Denken in Zusam menhängen und Zusammenwirken voraus. Dieses soll aus der modernen Sicht nicht als Ausdruck eines göttlichen, aufs Weltganze 381 382 383 384 385
Carus, Physis, S. 429. Ebd., S. 429f. Ebd., S. 430. Ebd., S. 429f. Ebd., S. 431.
214 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Vom Turm her die Glocken läuten
bezogenen Planes aufgefasst werden, sondern als situatives Zusam menwirken. Darin ist ein physikalischer Ton und Klang im subjek tiven Erleben aber nicht akustisch gegenwärtig. In seinem atmo sphärischen Erleben affiziert er vielmehr das befindliche Ergehen. Ganzheitlich und lebensweltlich betrachtet geht es beim Schallerleben nicht um naturwissenschaftlich gedachte Kausalzusammenhänge, in denen ein physikalischer Ton dieses oder jenes Hören determiniert. Statt dessen geht es um ganzheitliche Bewirkungsverhältnisse, die von Ausdrucksbedingungen auf der Objektseite des Schallenden ebenso abhängig sind, wie von Bedingungen stimmungssensiblen Eindruckserlebens auf der Subjektseite einer Person. Dieser erlebnismäßige Wirkungszusammenhang verdankt sich keiner komplementären Bestrebungen eines Weltganzen, sondern spezifischer (hier lautlicher) Modi des Erscheinens und eines situativ darauf bezogenen Erlebens. Auf beiden Seiten variieren die Spiel räume des Ausdrucksgeschehens wie individuellen Ergehens. Zwar lassen sich lautliche Modalitäten des klingenden Zur-Welt-Kommens einer Glocke durch eine Programmierung des Instruments steuern. Und die Erlebniswirkungen lassen sich in der Anwendung von pro fessionellem Wissen um das Hören-Können, -Wollen und -Sollen schärfen. Beides ist unverzichtbar, denn eine Glocke soll für jemanden (in der Regel viele Menschen) ertönen. Keine Glocke schallt für sich; sie wird für Menschen geläutet, auf dass diese sie in bestimmter Weise gefühlsmäßig hören, das Läuten also berühren möge. Dennoch ist das Läuten auf der Objektseite und das emotionale Eindruckserleben auf der Subjektseite kein jeweils »geschlossenes« Spiel, in dem auf einfachen Wegen Stimmungsziele erreicht werden könnten. Die beinahe unüberschaubare Mannigfaltigkeit der Ausdrucksund Eindruckswirkungen eines Glockengeläutes soll am Beispiel einer letzten Geräuschbeschreibung etwas deutlicher werden. Geräuschbeschreibung VI: Glockengeläut Frankfurter Dom386 In der Nähe des Doms ist atmosphärisch ein typisch städtisches Geräusch bestimmend: Das Zischen vorbeifahrender Autos auf dem regennassen Asphalt. – Doch dann hebt sich davon der markante Klang einer (einzigen) Glocke ab. In langgestreckten Abständen wird sie angeschlagen. Der Ton bleibt so zurückhaltend und hintergründig, 386 Ende November, 18 – 18:30 h vor dem Frankfurter Dom St. Bartholomäus, 1 Grad Celsius.
215 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
13. Die Stimmen der Orte
als sollte er gar nicht zu voller Ausdruckskraft gelangen. Einen klaren räumlichen Quellpunkt hat der Klang nicht. Wie der auditive Ausdeh nungsraum schwammig bleibt und lediglich um den Glockenturm »herum« zu vernehmen ist, so mangelt es an einem eindeutigen Verankerungspunkt, obwohl die Glocke ja tatsächlich hoch oben im Turm des Domes hängt. Der Glockenton (des Vorgeläuts) wabert in gewisser Weise – mal ist er »oben« und zugleich »vorne«. Und plötz lich schwebt und verhallt er »in der Luft«, bevor er sich in ein Nichts verliert und die Glocke sodann ein weiteres Mal ertönt. Es ist nicht nur der Schlag des Klöppels, der relativ leise bleibt, sondern auch das langsam abschwellende Nachschwingen einer Resonanz, die in einem geringen Klangvolumen zunächst etwas andauert, bevor sie dann verhallt. Indem die Schläge nur nach ziemlich großen Pausen zu hören sind, ziehen »leere« Zwischenphasen die Aufmerksamkeit auf sich (als ein vermeintliches Nichts und bedeutungsvolles Dazwischen). Der atmosphärisch bemerkenswert rare Ton hat trotz seiner geringen Lautkraft eine nachhaltige Signalwirkung. Das liegt auch an seinem doppelten Verinselungscharakter: der Verinselung in der Zeit und in der Situation. In der Gegend des Glockenturmes wird es erst wieder ruhig, bevor ein nächster Schlag in den Raum hinausschwingt. – Dann reißt die lockere Serie der fast verloren erscheinenden solitären »Rufe« ab und es entsteht eine zur Stille sich dehnende Ruhe, deren immersiver Eindruckscharakter sich durch die löchrige Folge der Anschläge geradezu aufgebaut hat. Eine Straßenbahn fährt vorbei, ohne dass die Glocke noch einmal ertönt. Die Gegend des Domes wird nun von einer sich im Raum ausbreitenden Ruhe beherrscht. Außer den leisen Geräuschen vor beirollender Fahrzeuge und weniger menschlicher Stimmen ist nun nichts mehr zu hören. Zur vollen Stunde setzt plötzlich – wie mit einem Schlage – ein geradezu orchestrales Hauptgeläut mit vielen Glocken ein. Ein Mehrund Vielklang heller, mittlerer und hoher Klänge. Das mannigfaltige Ertönen weist zunächst eine Vielfalt der Klangwellen, -kurven und -verläufe auf. Das Ganze wird von einem enharmonischen Akkord umfasst. Die Frage, wie viele Glocken da klingen, stellt sich gar nicht. Die Vielen tönen von Anfang an als ein (singuläres wie orchestrales) Geräusch, das in einer plötzlich im Raum präsenten Massivität und Voluminösität emotional berührt und überwältigt. Von »oben« breitet es sich vom Turm her aus, strahlt aber weit in den Raum der Stadt hinein. Die Lautstärke entfaltet neben ihrer akustischen Qualität eine
216 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Vom Turm her die Glocken läuten
Autorität gebietende Macht. Diese widerspricht nun ganz dem, was die zuvor ertönte solitärhafte Glocke ausgestrahlt hat. Die Schläge mehrerer schwerer Metallklöppel, die eindrücklich auf den Glocken rand schlagen, hallen mit großer tonaler Intensität nach, und die Resonanz des nachschwingenden Materials dehnt sich im Raum aus. Der anfangs hörbare vereinzelte Ton einer seicht angeschlagenen Glocke gibt sich nun – in der Retrospektive – als Vorspiel und Einstimmung aufs eigentliche Geläut zu verstehen; dieses Läuten war nur eine Ankündigung vom Charakter eines Signals. Das in seinem auditiven Charakter so vielfarbige Hauptgeläut beein druckt durch den mannigfaltigen und doch zugleich gebrochenen Mischklang aller Glocken. Der daraus entstehende unsynchroni sierte Schwingungsverlauf gibt sich schlagartig als ein unauflösba res Ganzes zu spüren. Erst bei konzentriertem Hin-Hören schim mern gewisse »Anteile« einzelner Glocken durch. Bestimmend bleibt zunächst aber die Ausbreitungsgestalt des ganzen, vielstimmigen Klanges – der schwere Anschlag der Klöppel, die unmittelbar dar auffolgenden mächtigen Schwingungen, deren Abschwellen durch das fortwährende Weiterdröhnen anderer Glocken übertönt wird. Es mögen drei oder vier Glocken sein. Genau lässt sich dies in der Überlagerung der lautlich zwar verschiedenen aber doch durchein ander tönenden Geläute nicht ausmachen. Die je eigenen Klangfar ben der verschieden großen und schweren Glocken gehen in einem Geläut-Geräusch auf, das durch eine Mannigfaltigkeit der Höhen und Tiefen überwältigt. Ebenso durch die Heterogenität mehr und weniger nachhallender Klänge und Resonanzen, die zumindest so lange hörbar abschwellen, wie das Geläut im Gange ist. Erst nach der unaufhörlichen Vermischung des Vielen zu Einem, werden einzelne Glocken in ihrer eigenen Klangausbreitung vernehmbar. Der Eindruck des Geläuts verändert sich schließlich. Zunächst wird eine der Glocken weniger oft angeschlagen, so dass sich im Gesamt erleben nun eine Verminderung der Vielfalt der Klänge und Töne bemerkbar macht. Das bevorstehende Ende des Geläuts kündigt sich an. Dieses setzt sich zunächst scheinbar entschlossen und schnell durch, so dass schon nach wenigen Momenten nur noch eine ein zige »übriggebliebene« Glocke zu hören ist. Das damit »eigentlich« endende Geläut flackert aber dann wider Erwarten erneut und unre gelmäßig auf. Hin und wieder tönt eine andere Glocke in das schon beinahe kontinuierliche Langsamer- und Ruhiger-Werden hinein. Die nachschlagenden Glocken verhallen in ihrem Ton und verlieren
217 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
13. Die Stimmen der Orte
sich in der Dunkelheit des Abends. Nach dem scheinbaren Ende abermals ein Schlag und erneut eine abschwellende Resonanz. Erst jetzt gelingt es, einen Ton einer Glocke zuzuordnen. Dann wieder nichts – aber sodann abermals ein Anschlag. Es entsteht der Eindruck eines Geläuts, das in die Klänge vereinzelnder Glocken zerfällt. Schließlich wird es lautlos im atmosphärischen Raum um den Dom herum. Das Geläut scheint sein Ende gefunden zu haben. Dennoch – wieder ein Schlag, der abermals langsam und ganz für sich und allein verhallt – allein, weil er sich nicht mehr mit den Resonanzen anderer Glocken vermischt. Tatsächlich dürfte er sich kaum langsamer und anders in die Ruhe des Glockenturmes zurückziehen als die Schläge der Glocken zuvor. – Nun herrscht scheinbar Ruhe und Leere in der Luft und im Raum neben dem Dom. Doch abermals ertönt ein einzelner Schlag. Er scheint nun gänzlich verloren, wenn nicht sogar von den schon längst verstummten Klängen der anderen Glocken verlassen zu sein. – Es wird leise und lediglich hier und da sind ein paar Schritte auf dem feuchten Pflaster vor dem Dom zu hören. – Und doch: Abermals ein einziger Schlag! Er hört sich an, als wäre er vergessen worden und müsste nun, gewissermaßen nachträglich, noch in die Leere der Dunkelheit hinaus – ganz ohne die aufnehmend-bergende Klanggemeinschaft anderer Glocken. Sodann ist es endgültig lautlos und leer. Die Stadtstraße bringt sich wieder zu Gehör, als wäre sie ein Subjekt, das sich nun endlich ohne Zurückhaltung wieder äußern darf. Es scheint indes mehr die Luft zu sein, die man über dem Pflaster, unter den Laternen und zwischen den Häusern zu hören glaubt als die Straße. Kein Geräusch eines Automobils, eines Motorrades; kein schepperndes Fahrrad. Nach einer Phase der Lautlosigkeit schließlich der leise dahinschnurrende Motor einer vorbeirollenden Limousine, Schritte, ein klappernder Kinderwagen und ein paar in den Abend hineinkreischende Kinder. Über das abendliche Alltagstheater des Straßenlebens ragt der mäch tige Turm des Domes zum Himmel hinauf. Nach dem Ende des Geläuts wirkt er noch größer als zu Beginn des Ertönens der ersten Glocke vor der Vielheit aller. Gleichsam im Schatten der sich in die atmosphärische Macht der Stille steigernden Ruhe erhebt er sich in einer gestischen Autorität zu einem mehr spürbaren als sichtbaren Monument. Erst jetzt erscheint der mächtige Bau in der bannenden Atmosphäre des Numinosen. Eine geradezu stumm machende Macht geht unmittelbar nach dem Geläut von einem Nachklang der Glo cken aus, obwohl diese sich doch tatsächlich schon gar nicht mehr
218 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Vom Turm her die Glocken läuten
bewegen. In dieser Situation scheint ihr Nicht-Ertönen in gewisser Weise geradezu hörbar zu sein. Tatsächlich machen die Glocken aber keinen einzigen Laut mehr. Sie sind schon seit zwei oder drei Minuten verstummt. Die Leere im Raum vor dem Dom bestimmt den aktuellen Eindruck. Das Wenige, das sich ereignet, verliert sich in ein Nichts. Die Straße scheint für Momente nur noch Pflaster zu sein – kein lautlicher Ausdruck der großen Stadt. Ein paar Stimmen vorübergehender Passanten sind dann wieder die ersten Laute, durch die sich die Stadt in Erinnerung ruft. Vor- wie Hauptgeläut betten sich in die aktuelle Situation einer Stadt ein. Aber das Vorgeläut bleibt inselhaft. Es behauptet sich im solitärhaften Klang einer einzelnen Glocke nicht gegen das Rauschen der Stadtgeräusche in der nahen Umgebung des Domes. Das liegt auch an der geringen Lautstärke der ertönenden Glocke. Diffus bleibt schließlich der Herkunftsort des Läutens. Dafür insistiert der Klang der Glocke zu wenig. Er dringt nicht in den Raum der Stadt ein, schallt eher verloren und vereinzelt, fast verlassen. Es mangelt ihm an einem gleichsam »selbstbewussten« Habitus. Deshalb übertönt die Glocke das Geräusch der Stadt auch nicht. Sie vermag es noch nicht einmal zurückzudrängen. Eher gesellt sich ihr Läuten zu allem hinzu, was gleichzeitig zu hören ist. Immer noch quietschen die Straßenbahnen in den Schienen, die Fahrzeuge surren dahin und sogar die viel leiseren menschlichen Stimmen raunen neben all dem. Im Unterschied dazu hören sich die im Hauptgeläut erklingenden Glocken weder verloren noch dezent an. Für die Dauer des gleichsam orchestralen Tönens, Klingens und Schallens beanspruchen sie die lautliche Hoheit über die Stadt. Das Geläut ist etwas Zusammenhän gendes und Zusammengehöriges. Es ist etwas Ganzheitliches, das als Einheit des Vielen seine Wirkung entfaltet. Während die Glocke des Vorgeläutes einzeln und »für sich« klingt, beeindruckt das Hauptge läut durch eine große Mannigfaltigkeit der Klänge und Schwingungs verläufe. Zwar kommt es als etwas Herausgehobenes zur Erschei nung, ist jedoch nichts Einzelnes, sondern etwas Akkordartiges. Weit mehr noch als die solitärhafte Glocke des Vorgeläuts ragt es in seiner klanglichen Eigenart aus allem anderen hervor, was sich in der Gegend des Domes zu Gehör bringt. Die Eindrucksmacht der schlagenden Glocken drängt sich mit einem gewissen Geltungsanspruch atmo sphärisch sogar auf. Es übertönt alles, was sich am Boden des Turmes in der Stadt ereignet. Es »begräbt« auch das noch unter sich, was gar
219 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
13. Die Stimmen der Orte
keinen lautlichen, sondern hauptsächlich visuellen Charakter hat. Das Hauptgeläut ist ein überwältigendes Ganzes. Es verdankt sich der Versammlung von fiktiv Einzelnem. Fiktiv bleibt das darin wirksame Einzelne aber nur so lange, wie das volle Geläut dauert. Erst nach der Verarmung seines orchestralen Charakters können sich Klänge für Momente vereinzeln, ähnlich wie das verloren wirkende Schlagen der Glocke des Vorgeläuts. Die Eindrucks- und Erlebnisqualität des Geläuts geht aber nicht nur auf die Klangqualität besonderer, geradezu individueller (zusam menklingender) Glocken zurück. Atmosphärisch bestimmend sind auch die Schwingungskurven, ebenso die Modi des eher enharmo nisch als melodisch abgestimmten Zusammenklingens, schließlich die Mischklänge der vielen Glocken und das Nachhallen einzelner und aller. Dies ist ein Nachhallen, das sich von Moment zu Moment verändert, je nach der Klangfolge und der dadurch entstehenden (mitunter nur Bruchteile einer Sekunde andauernden) »Pausen«, die zwischen den Akkorden des unsynchronisierten Zusammenspiels entstehen. Das große Geläut ist eine Mannigfaltigkeit, das Fußnoten aufs Einzelne nie ganz verbergen kann. Dieses Ganze ist aber stets auch von der Erwartung überwölbt, dass es bald enden muss und dann wieder Einzelnes zu hören sein wird, Einzelnes, das im Ge-läut so lange verschwommen bleibt, wie der Akkord alle (besonderen) Klänge in sich aufnimmt. Der Schall des großen Geläuts wächst wie eine sich ausdehnende Masse in den Raum hinein, und breitet sich über der Stadt aus, akustisch wie atmosphärisch. Dennoch werden Teile des Ganzen in der Fokussierung aufs Einzelne darin immer wieder hörbar. Mit dem beginnenden Ende des Geläutes zerfällt die Ganzheit des choralen Schallens und Klingens allmählich. Doch das Geläut sammelt sich erneut, löst sich abermals auf und findet zu einer umge stalteten Einheit, bevor es dann endlich die Fassung eines Ganzen verliert. Was aufhört, verliert sich selbst. Beim Enden des Geläuts ist dies jedoch ein abrupter Prozess, denn es geht nicht zu Ende wie ein abgeschalteter Motor. Es verliert sich langsam in Phasen anders werdender Schwingungen und Rhythmen. Es klingen immer weniger Glocken in einem sich lockernden Rhythmus der Gleichzeitigkeit – nun mehr nebeneinander als miteinander. In dieser Phase treten einzelne Glocken in ihrer Resonanz lautlich hervor. Dieses oder jenes Instrument wird erkennbar. Aktuell gehören sie zu keinem Ganzen mehr, das ja gerade zu Ende geht. Aber in gewisser Weise bildet sich dennoch etwas Zusammenhängendes, wenn dies auch nur noch von
220 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Der Klang der Glocken im Geräusch der Stadt
den seriellen Nachwirkungen des auslaufenden Geläuts lebt. Immer wieder vereinzeln sich Glocken aus dem porös werdenden, akkordarti gen Band, an dessen Zustandekommen sie noch eben mitwirkten. Die Vielfarbigkeit der Klänge und Töne verliert an Pracht, Tiefe und Aus drucksmacht. Indem sich die Phasen der lautlichen Leere zwischen den immer lockerer werdenden Enden des Zusammenspiels ausdeh nen, dringt eine eindrucksmächtige Stille in die Atmosphäre des in gewisser Weise noch existierenden, sich zugleich aber auch schon zurückziehenden Geläuts ein – als wolle sie in ihrer Erhabenheit ins Göttliche weisen. Indes ist die atmosphärische Macht des Ganzen, trotz aller Porösität und Löchrigkeit doch noch so beharrend, dass sich nicht das mindeste Stadtgeräusch dagegen durchzusetzen vermag. An die Stelle der lautlichen Dominanz, die alle anderen Geräu sche überprägt hat, tritt nun die atmosphärische Macht einer sich zu spüren gebenden Stille. Sie bezieht ihre Energie aus den Wechselpha sen des Nachläutens und dem daraus resultierenden Ruhiger-Wer den. Der Rückzug des Lauten öffnet Spielräume für die Erlebbarkeit einer Stille, die im Kontrast zur klanglichen Fülle so immersiv spür bar werden kann. Dieser Rückzug geschieht aber nicht schlagartig. In der Schlussphase des Hauptgeläuts kehrt die klangliche Fülle, wenn auch nur für rare Momente, gleichsam interferierend immer wieder aufs Neue zurück. Diese Kontrastierung spitzt sich nach dem »endgültigen« Ende des Läutens in einer Situation zu, in der die Stille beharrt (nun »um den Glockenturm herum« lokalisierbar). Die Atmosphäre dieses vermeintlichen »Nichts« ist so stark, dass sie auf das Erleben der Architektur des Domes zurückwirkt. Dieser steigert die gestische Ausdruckskraft seiner baulichen Gestalt nun in eine numinose Ausstrahlung. Das Bauwerk wird größer als es ist – weniger als Turm denn als atmosphärische Geste, die der steingewordene Mythos verewig hat. Daraus erklärt sich schließlich auch, weshalb die profane Welt am Boden des Turmes erst wieder allmählich in den Geräuschen von menschlichen Stimmen und Fahrgeräuschen zu sich kommt – nachdem sich die numinose Macht des Geläuts, in der lautlichen Leere gleichsam schwebend, allmählich aufgelöst hat.
Der Klang der Glocken im Geräusch der Stadt All das hört nur, wer hin-hört. Das typische Stadtgeräusch saugt in gewisser Weise noch das lauteste Geläut in sich auf. Die zur vollen
221 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
13. Die Stimmen der Orte
Stunde schlagende Glocke geht zum einen in die lautliche Kulisse aller Stadtgeräusche ein, zum anderen ragt sie aus diesem Akkord hervor, ohne deshalb schon die fokussierende Aufmerksamkeit zu wecken. Am Klang der verschiedenen Glocken kündigt sich ihr Anteil am diffusen städtischen Geraune an. Glocken gehören zur Stadt, anders als zum dörflichen Lebensraum. Sie unterscheiden sich nicht nur nach ihrer Größe, sondern auch nach Schall und Ton. Von den Türmen der mächtigen Kathedralen her tragen die schweren Glocken ihre tiefen und lange nahhallenden Resonanzen in die Weite des Stadtraumes. Auf dem Dorf stiftet das kleine, in hellen Frequenzen tönende Glöcklein dagegen eher das behagende Gefühl, von einer vertrauten Gemeinschaft bergend umfasst zu sein. Zwar kommen Glocken vorwiegend im Geltungsraum normati ver Ordnungen von Religionen zum Einsatz. Aber auch außerhalb der sakralen Welt sind sie in Gebrauch. Vor allem fungiert die Glocke als »Signalinstrument«387. Das liturgische Läuten folgt einer anderen Symbolik. Es ist mit synästhetischen Programmen zur Verdichtung suggestiver Wirkungen verzahnt, deren Bedeutungen in religiösen Mythen wurzeln. Eher im Süden Europas als im überwiegend pro testantischen bis heidnischen Norden gibt es spezielle Glocken, die in ihrem Ton und Rhythmus ein Thema anklingen lassen, um die Menschen atmosphärisch in eine religiöse Situation einzufädeln. Zur wirkungsvollen Glocken-Kommunikation »sollte jede Pfarrkirche über drei Glocken verfügen; doch kann die Zahl je nach den Ver hältnissen bis auf neun erhöht werden.«388 Die Autochthonen einer Region kennen die Sprache der Glocken. Sie wissen die Taufglocke, Totenglocke und Gebetsglocke389 in ihrer Bindung an ein je eigenes soziales Programm »verstehend« zu hören. Außerhalb kirchlicher Welten kommen in institutionellen Zusammenhängen vornehmlich situationsspezifische Glocken zum Einsatz (wie die Rats-, Gerichtsoder Sturmglocke). Seit Glocken gegossen werden, weiß man, dass die Verwendung bestimmter Metalllegierungen über Klang und Resonanz sowie über Voluminösität, Schwere und atmosphärische Mächtigkeit entschei det. Gegossene Glocken gibt es in China schon seit 1.000 vor der Zeitrechnung, im europäischen Raum seit dem 13. Jahrhundert. Der 387 388 389
RGG, Band II, Sp. 1622. Ebd., Sp. 1624. Vgl. ebd., Sp. 1622.
222 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Der Klang der Glocken im Geräusch der Stadt
Schall einer Glocke ist jedoch nichts Singuläres wie das Piepsen der Waschmaschine am Ende der Wäsche. Ihr Eindruck verdankt sich zweier aufeinander folgender Klangqualitäten: dem Schlagton, der beim Kontakt des Klöppels mit der Glockenwand entsteht und dem Hintergrundsummton, in dem es wiederum Teiltöne gibt, die kurz oder lange nachwirken. Die Wirkung des Klanges insgesamt breitet sich je nach Resonanz- und Schwingungsfähigkeit, Schwere des Materials und Größe einer Glocke im Raum aus. Klang- wie resonanzentscheidend ist die Wahl der Materialien. Während man von der Frühzeit bis ins Mittelalter Bronze- und Eisenbleche ver nietete, werden später für den Guss Legierungen aus Bronze und Zinn üblich. Seit dem 17. Jahrhundert werden Glocken zudem aus Gusseisen gefertigt. Gebräuchlich wurden ebenso »Zink-, Silikat- und Aluminiumlegierungen, gelegentlich auch Porzellan. Doch schafft die Bronze immer noch die klanglich besten Bedingungen für das rechte Verhältnis von Schlagton und Summtonharmonie.«390 Je nach Materialeigenschaften klingt eine Glocke eher spitz und grell, hallt entweder gut nach oder tönt nur flach und kurzatmig. Eine atmosphärisch wirkmächtige Glocke ist meistens groß und schwer, und sie beeindruckt durch einen eindrucksvollen Schlagton sowie einen lang auslaufenden Summton. Nachhaltig affizierend ist ein Geläut in seiner atmosphärischen Ausstrahlung, wenn es den Cha rakter eines insofern harmonischen und nicht dissonanten Akkordes hat, als mehrerer Glocken mit unterschiedlichen Schlagtönen in ihrer Klangwirkung zu einer konsonanten Ganzheit verschmelzen. Bei der Schallausbreitung kommt es aber nicht nur auf die Art und Qualität einer Glocke an, sondern ebenso auf die Aufhängtechnik am Joch in der Glockenstube. Die beste Resonanz folgt aus der Aufhängung am geraden Joch. Die am gekröpften Joch, bei der der Drehzapfen tiefer als die Krone liegt und der Läutewinkel größer ist391, hat eher einen starren Klang zur Folge. Auch wenn in einem Glockenstuhl mehrere Glocken hängen, so werden alle Instrumente doch meistens nur bei besonderen Anlässen und Hauptgottesdiensten auch gleichzeitig geläutet. Die Art des Akkordes gibt also die Situation spürend zu verstehen, derentwegen die Glocken läuten. Auch die Dauer des Läutens hängt bis heute von Anlässen bzw. situativen Bedeutungen ab (Taufe, Begräbnis, Haupt 390 391
Ebd., Sp. 1623f. Vgl. ebd., Sp. 1625.
223 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
13. Die Stimmen der Orte
gottesdienst etc.). Einst sorgte der Glöckner in der Art seines Läutens für eine gleichsam »persönliche« Handschrift. Schon lange arbeiten jedoch elektrische Läutemaschinen, so dass sich Rhythmus, Schwin gung und Tonfolge des Glockengeläuts nur noch einem maschinenge steuerten Automatismus verdanken.392
Zur Situiertheit des Schalls der Glocken In Ländern und Regionen, in denen der Takt des täglichen Lebens fortan in religiösen Werten Orientierung sucht, teilt der Schlag der Glocke den Tag hörbar nach rituell bedeutsamen Segmenten ein. Ob dem Ruf der Glocke dann auch tatsächlich Unterbrechungen des Arbeitstages folgen, dürfte in spätmodernen Zeiten eher fraglich sein. Im Unterschied zur Macht der Religion in der moslemischen Welt ist die Bedeutung christlicher Rituale in der Gegenwart eher schwach geworden. Das stündliche Läuten wird dann nur noch als nüchterner Hinweis auf die chronologische Weltzeit zur Kenntnis genommen. Mitunter haben sich vor allem in peripheren Räumen, in denen sich die kulturellen Erneuerungen der Spätmoderne erst spät durchgesetzt haben, religiöse Riten noch bis in die frühe Zeit des 20. Jahrhun derts erhalten. Dagegen integrieren spätmoderne Kulturen religiöse Mythen aus atmosphärischen Gründen in die säkulare Welt. So wird das von den Kirchtürmen über die Stadt sich ausbreitende Geläut auch in der Gegenwart noch als eine willkommene Facette in der Vielfalt urbaner Atmosphären begrüßt. Als Aufruf zum Gebet wird es indes nur noch von einer immer kleiner werdenden Community vornehmlich Älterer verstanden. Die symbolische Metamorphose des Glockengeläuts ist der ganz ähnlich, die bereits die Weihnachtsbeleuchtung erfahren hat. Einst wurzelte das vorweihnachtliche Erstrahlen der Stadt in der Lichtsym bolik christlicher Mythologie. Vor dem Hintergrund kommunalpoli tisch intensivierter Kultur- und Tourismuspolitik ist sie nur noch Erlebniskomponente eines ubiquitären, vor allem aber säkularen Illu minationsspektakels. Das vielfältige, bunte und gestaltreiche Leuch ten wird in der dunklen Jahreszeit als eine willkommene Erhellung wie atmosphärische Auffrischung ansonsten finsterer Stadtstraßen ästhetisch genossen. Wie mit den Mitteln des Lichts der Raum der 392
Vgl. ebd., Sp. 1626.
224 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Zur Situiertheit des Schalls der Glocken
Stadt (viel weniger der des Dorfes) in eine romantizistisch verklärte Atmosphäre getaucht werden kann, reichert die Klangkulisse der vom Kirchturm her vernehmbaren Glocken die Vielfalt des typischen Stadtgeräusches an, auch wenn die Geläute nur noch säkular erlebt werden. So finden sich die Menschen in ihrem pathischen Mit-Sein in der Stadt und nicht in irgendeiner beliebigen dörflichen Weltnische abseits der schnellen Dynamik des technischen und sozialen Fort schritts. Wenn ein Glockengeläut atmosphärisch auch etwas in Gänze anderes ist als das sprichwörtliche Rauschen des innerstädtischen Straßenverkehrs, so gliedert es sich atmosphärisch doch überaus produktiv in die vielstimmige Kulisse des Stadtgeräuschs ein. Der Gebrauch der Kirchenglocken war vor allem in der franzö sischen Geschichte nach der Revolution immer wieder Anlass mit unter schwerster Auseinandersetzungen zwischen Klerus und politi scher Gemeinde. Die Kirche verlor nicht nur in weitgehendem Umfang ihre Rechte zum Läuten der Glocken, sondern ebenso das Eigentum an ihnen. Über außerordentlich krasse Konflikte und wun dersame Nutzungspraktiken berichtet Alain Corbin in seiner histori schen Studie über die »Sprache der Glocken«. Mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte am 26. August 1789 war der Katholi zismus als Staatsreligion zwar abgeschafft. In der Folge entbrannte dennoch immer wieder der Streit zwischen Staat und Klerus über den Gebrauch der Glocken. So kam es im 19. Jahrhundert in Frankreich zu rund 10.000 Glockenaffären.393 Die meisten drehten sich um Kon kurrenzen in Bezug auf ihren kirchlichen und weltlichen Einsatz. Die Glocken dienten im säkularen Kontext nicht mehr nur dem Alarm, sondern ebenso der Information über alle möglichen Anlässe und Ereignisse des kommunalen Lebens (u. a. zum Ruf zur Versammlung des Gemeinderates oder zur politischen Wahl; Schulbeginn und -Ende wurden eingeläutet, zur nächtlichen Ausgangssperre wurde geläutet, bei der Ankunft des Steuereintreibers, und sogar zur Impfung wurde mit der Glocke gerufen394). In der Hoheit des Staates hatte die Glocke den rein akustischen Vorteil einer besseren Reichweite als das welt liche Instrument der Trommel. Damit baute sich ein scharfer Gegen satz der Nutzungspraktiken auf. Nach den Regeln der kirchlichen Lit urgie war die Glocke vor allem ein Medium zum Ruf der Gläubigen.
393 394
Vgl. Corbin, Die Sprache der Glocken, S. 16. Vgl. ebd., S. 242 ff.
225 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
13. Die Stimmen der Orte
Nach den neuen politischen Regeln diente sie zusätzlich als Signal bei nahezu beliebigen säkularen Anlässen. Wenn die Klanggewalt auch nun beim Staat lag, hingen die Menschen emotional doch weiterhin an kirchlichen Traditionen, christlich-normativen Ordnungen und religiösen Riten. Mit großer Entschlossenheit strebte die Regierung in einer regelrechten »Glo ckenpolitik«395 die immer weitgehendere Übernahme der Gebrauchs hoheit über die Glocken an. Wo dem Klerus das Läuten verboten war, griffen die örtlichen Geistlichen mitunter zu Notlösungen. Dazu gehörte die Praxis, den Gottesdienst durch Kinder im öffentlichen Raum mit dem Horn ankündigen zu lassen. Oder die Priester »ließen Kinder durch die Straßen laufen, mit kleinen Schellen in der Hand, die das Läuten von oben ersetzen.«396 Im 19. Jahrhundert war die Macht über die Glocken schon so weit in die Hände des Staates über gegangen, dass sich die politischen Gemeinden regelrechte »Klang konfrontationen« boten, in denen sie um die wirkungsvollste Präsenz wetteiferten.397 Infolge überaus häufigen Läutens schon bei gerings ten Anlässen verlor die Glocke an Symbolkraft und Prestige. Mit dem Vordringen visueller Medien trat die lebensweltliche und emotionale Bedeutung des Geläuts noch mehr zurück. »Die Glockengeschichte gerät justament mit dem Siegeszug der Lese- und Schreibfertigkeit ins Abseits.«398 Darin spiegelt sich nur wider, was auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen vor sich ging: eine kulturelle Erstarkung des Abstrakten zulasten sinnlicher Weltkontakte. In Ländern mit christlichen Wurzeln hat sich bis heute eine zwei fache Symbolik im Gebrauch der Glocke behauptet. Zum einen läuten sie weiterhin aus einem kirchlichen (der Liturgie folgenden) Anlass. Zum anderen unterstehen sie der weltlichen Nutzung. Beispiel für das profane Läuten ist das landauf landab übliche Silvesterläuten. Im Mittelalter gab es noch Menschen, die keine eigene Uhr besaßen; das Läuten gab ihnen dann zu verstehen, dass die Zeit des Jahreswechsels gekommen war. In Frankfurt am Main ist auch das sogenannte »Stadt geläute« in weltlichen Interessen der Stadt begründet. Es geht auf eine Vereinbarung zurück, die der Magistrat 1878 mit der katholischen Kirche geschlossen hat. Die Norm ist bis heute gültig. Sie erlaubt 395 396 397 398
Ebd., S. 47. Ebd., S. 52. Vgl. ebd., S. 112. Ebd., S. 414.
226 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Zur Situiertheit des Schalls der Glocken
der Stadt viermal im Jahr ein großes Geläute (zu Ostern, Pfingsten, Weihnachten und am Samstag vor dem Ersten Advent).399 Es soll der Bereicherung der Bürger dienen und einen »Beitrag zur Förderung des Fremdenverkehrs«400 leisten. Gleichsam zwischen Klerus und Politik sind die Glocken zu einem Instrument höchst ambivalenter Mitteilung geworden. Vielerorts sind die Gesellschaften in eine reli giöse und eine säkulare Welt gespalten. Aufgrund ihrer historisch immensen Bedeutung sowie ihrer sinnlichen Ausdrucksmacht sind die Glocken in beiden Welten präsent geblieben. Deshalb gehören sie auch nach wie vor zu den unverzichtbaren Medien in der Konstitution urbaner Atmosphären.
399 Erleichtert wurde die Vereinbarung, nachdem im Rahmen der Säkularisation 1802 die Kirchengebäude samt aller Glocken in das Eigentum der Stadt übergegan gen waren; https://frankfurt.de/frankfurt-entdecken-und-erleben/stadtportrait/ty pisch-frankfurt/das-grosse-stadtgelaeute-von-frankfurt-am-main ; (05.03.2021). 400 https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Stadtgeläute; (05.03.2021).
227 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Schluss
Die auditive Wirklichkeit der Stadt drückt sich in den Grundmodi des Lauten und des Leisen aus. Es gibt ihr dröhnend-hämmerndes Lärmen, das seine eigenen Orte hat wie das kaum Hörbare, das sich in eine zerbrechliche Stille zu verlieren scheint. »Dazwischen« gibt es aber viel mehr noch den rhythmisch in einem überaus breiten Spektrum der Geräusche oszillierenden Vitalton der lebendigen Stadt, der sich im Ohr und im Gefühl zur Geltung bringt. Die Stadt ist eine sinnlich multivalente Welt. Sie wird weniger mit den einzelnen Sinnen erfasst, als mit allen Sinnen zugleich – in einer simulta nen Synchronisation der Eindrücke, die in akkordartig vielstimmige Atmosphären münden. Was sich scheinbar so selbstverständlich im Ohr zu hören oder im Blick zu sehen gibt, ist stets schon im Moment seiner Erfassung auf dem »Sprung« zu etwas ganz Anderem. Erst das Hinhören auf die Welt der Laute, Töne, Klänge und Geräusche macht bewusst, dass sich im gewohnten Hören viele Falten des Gesichts der Stadt verbergen. Hören erhebt sich im Hin-Hören zu einem erkennenden Hören. Ganz ähnlich bedarf das Sehen des Hin-Sehens, um genauer »sehen« zu können, was da vor den Augen steht. Was sich über das Leise und Laute der Stadt sagen lässt, ist im Bereich der anderen Sinne prinzipiell kaum anders. Die sinnliche Welt des urbanen Raumes verdankt sich in ihrer Lebendigkeit oft schärfster Kontraste. Hier ist das Leise und dort das Laute. Das Leise gibt es aber auch jetzt und das Laute gleich. Der ratternde und rauschende Lärm des mittäglichen Verkehrs hat seinen Ort in der Mitte der Stadt und seine Zeit in der hektischen Mitte des Tages. Auf andere Weise scheint das Schleichen der Katze mehr in die Atmosphären der Nacht zu gehören als in die des Tages. Und doch schleicht das Tier in der mittäglichen Sonne kaum anders dahin als in der abgründigen Stille einer Vollmondnacht. Die Geräusche der Stadt kommen zwar aus dem Raum und darin von Orten, und in der Zeit haben sie ihre Momente. Aber über ihre Herkunft aus der RaumZeit hinaus tönen sie in besonderer Weise aus Situationen.
229 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Schluss
Laut und leise sind nicht nur die Apparate und Maschinen der modernen Welt. Schon die Menschen machen Geräusche, sobald sie sich äußern, im Gehen anders als im Sprechen und wieder anders als im Ausdruck ihrer Gefühle. Laut ist der herausgeschriene Jammer und der grölende Jubel, der tobende Zorn und das fröhliche Lachen. Im Lauten keimt zugleich das Leise, das zu eindringlichster Immersivität anwachsen kann. Umgekehrt gilt aber auch, dass der Jammer trotz seiner Lautheit ganz leise erscheinen mag, wenig anders der innerlich bleibende Jubel und der stumme Zorn. Das auditiv Leise gibt es nicht zuletzt als etwas fast Geräuschlo ses – wie das Schleichen des Raubtieres und das Dahinziehen des Fuchses. Es ist das Andere demonstrativen Polterns und ungeschick ten Lärmens. Zwar ist es noch mit den Ohren hörbar. Aber dies ist nur ein »einfaches« Hören, das im Flüstern noch vernehmbar ist – im krassen Gegensatz zum machtvollen Schreien. Es gibt aber auch das auf ganz andere Weise Leise, das den Ohren entgeht. Komplementär zum unhörbar Lauten vernehmen wir das unhörbar Leise. Im Falle des Stutzens ist es mehr ein temporäres Stehen-Bleiben des Immerso-Weiter als ein auditives Verstummen. Dennoch ist es hörbar. Aber nicht mit den Ohren, vielmehr in einem atmosphärischen Sinne vernehmbar wie das Knistern der Stille. In diesem Sinne ist auch das Heimliche leise, abermals nicht als etwas nur schwach Ertönendes, sondern als etwas, das sich kryptisch zu spüren gibt. Das Leise steht dem Unhörbaren nahe. Wie das Laute kommt es in unterschiedlichen Charakteren zur Erscheinung (als schwache Stimme wie als sedierte Stimmung) und in abermals unterschied lichen Gesichtern (als jammernd leise Stimme oder verzweifelte Betäubtheit). Schließlich kann etwas leise sein, das mit Laut und Ton gar nichts mehr zu tun hat – wie das Sanfte, das Milde, aber auch das Verstohlene. Es sind die »leisen« Wesenszüge befindlichen Seins, die den Ohren meistens verschlossen bleiben und sich allein der intuitiven Erspürung mit Hilfe des pathischen Sinns anbieten. Für das Hören »zwischen den Zeilen« dessen, was lautlich tönt, reklamiert sich ein »leises Gehör«401; mit anderen Worten: ein scharfes Gehör, das im erkenntnistheoretischen Sinne nicht nur eines gesunden Ohres bedarf, sondern mit mindestens ebenso großem Gewicht einer ganzheitlichen und unterscheidungsfreudigen Aufmerksamkeit. Wie sollten sonst die Schreie erhört werden, die bei Rilke als das »atemlose 401
DWB, Band 12, Sp. 718.
230 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Schluss
Bangen« oder die »weite, weiße Stille«402 atmosphärisch hinter Ton und Laut gleichsam versickern.
402 Rilke, Wie meine Träume nach dir schrein (Gedicht), Ders.: Das dichterische Werk, S. 320.
231 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Literaturverzeichnis
Adorno, Theodor W.: Ästhetische Theorie, Gesammelte Schriften, Band 7. Frankfurt am Main 1970. Adorno, Theodor W./Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung (zuerst 1947). Frankfurt am Main 1971. Adorno, Theodor W./Max Horkheimer: Kulturindustrie. Aufklärung als Mas senbetrug. In: Adorno, Theodor W./Max Horkheimer (zuerst 1947): Dialektik der Aufklärung. Frankfurt am Main 1971, S. 108 – 150. Ahmed, Sara: Affective Economies. In: Social Text 79. Vol 22. No. 2 (2004), pp. 117 – 139. Baier, Franz Xaver: Der Raum. (= Kunstwissenschaftliche Bibliothek, Band 2). Köln 2000. Baudelaire, Charles: Der Wiedergänger. In: Ders.: Blumen des Bösen (übertra gen von Carlo Schmid). Frankfurt am Main 1986. Bijsterveld, Karin (Hg.): Soundspaces of the Urban Past. Staged Sound as Medi ates Cultural Heritage. Bielefeld 2013, S. 11–28. Bijsterveld, Karin: The Diabolical Symphony of the Mechanical Age: Technology and Symbolism of Sound in European and North American Noise Abatement Campaigns, 1900–40. In: Social Studies of Science 31/1 February 2013), S. 37 – 70. Böhme, Gernot: Anmutungen. Über das Atmosphärische. Ostfildern 1998. Böhme, Gernot: Die Stellung des Menschen in der Natur. In: Altner, Günter/ Böhme, Gernot/Ott, Heinrich (Hg.): Natur erkennen und anerkennen. Kus terdingen 2000, S. 11 – 29. Böhme, Gernot: Zur Kritik der ästhetischen Ökonomie. In: Zeitschrift für Kri tische Theorie. H. 12 (7. Jg.), 2001, S. 69 – 82. Bohrer, Karl Heinz: Plötzlichkeit. Frankfurt am Main 1981. Bollerey, Franziska: Mythos Metroplis. Die Stadt als Sujet für Schriftsteller, Maler und Regisseure. Berlin/Delft 2006. Bosshard, Andreas: Stadt hören. Klangspaziergänge durch Zürich. Zürich 2009. Carus, Carl Gustav: Physis. Geschichte des leiblichen Lebens. Stuttgart 1851. Corbin, Alain: Die Sprache der Glocken. Frankfurt am Main 1995. Corbin, Alain: A History of Silence. From the Renaissance to the Present Day (zuerst 2026). Translated by Jean Birrell. Cambridge 2019. Denkmalamt der Stadt Frankfurt (Hg.): Der Frankfurter Haupt-Friedhof (von Bettina Erche). (= Beiträge zum Denkmalschutz in Frankfurt am Main. Band 11; in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege in Hessen). Frankfurt 1999.
233 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Literaturverzeichnis
Diaconu, Mãdãlina: Sinnesraum Stadt. Eine multisensorische Anthropologie. Wien/Münster 2007. Die Bundesregierung (Hg.): Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503). Dürckheim, Karfried Graf von: Erlebensformen. Ansatz zu einer analytischen Situationspsychologie. Ein Beitrag zur Psychologie des Erlebens (Archiv für die gesamte Psychologie, XLVI). Leipzig 1924. Dürckheim, Karlfried Graf von: Untersuchungen zum gelebten Raum (zuerst 1932). Hgg. von Jürgen Hasse (mit Einführungen von Jürgen Hasse, Alban Janson, Hermann Schmitz und Klaudia Schultheis) (= Natur – Raum – Gesellschaft, Bd. 4). Frankfurt am Main 2005. Endell, August: Die Schönheit der großen Stadt (zuerst 1908). Berlin 1984. Espinet, David: Phänomenologie des Hörens. Eine Untersuchung im Ausgang von Martin Heidegger (= Philosophische Untersuchungen, Band 23). Tübin gen 2016. Evers, Hans Gerhard: Tod, Macht und Raum als Bereiche der Architektur. München 1939. Fechner, Gustav Theodor: Die Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht; https:/ /home.uni-leipzig.de/wundtbriefe/wwcd/opera/fechner/tagnacht/TagNa1 .htm. Feger, Sonja: Hans Blumenbergs Wirklichkeitsbegriff aus phänomenologischer Perspektive. In: Phänomenologische Forschungen 2020, Heft 1, S. 41 – 64. Feuerbach, Ludwig: Wider den Dualismus von Leib und Seele, Fleisch und Geist (zuerst 1846). In: Gesammelte Werke, Kleine Schriften, Band III. Berlin 1971, S. 122 – 150. Fink, Eugen: Sein, Wahrheit, Welt. Vor-Fragen zum Problem des PhänomenBegriffs. Den Haag 1958. Freud, Sigmund: Die ›kulturelle‹ Sexualmoral und die moderne Nervosität (zuerst 1908). In: Ders.: Kulturtheoretische Schriften. Frankfurt am Main 1974, S. 9 – 32. Gehlen, Arnold: Die Seele im technischen Zeitalter. Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft (zuerst 1957). Frankfurt am Main 2007. Geisel, Sieglinde: Unerhört. Veränderungen des Geräusch- und Lärmempfin dens. In: Paul, Gerhard/Ralph Schock (Hg.): Sound des Jahrhunderts. Bonn 2013, S. 592 – 597. Griffero, Tonino: The Atmospheric ›Skin‹ of the City. Ambiances. Interna tional 2013. Griffero, Tonino: Places, Affordances, Atmospheres. A Pathic Aesthetics. Lon don/New York 2019. Guardini, Romano: Übermaß der Lebensflut. In: Horstmann, Ulrich (Hg.): Die stillen Brüter. Hamburg 1992, S. 122–129. Gumbrecht, Hans Ulrich: Unsere breite Gegenwart. Aus dem Englischen von Fran Born. Berlin 2010.
234 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Literaturverzeichnis
Guzzoni, Ute: Nächtliche Geräusche. Raumerfahrung in literarischen Bildern. In: V. Jahrbuch für Lebensphilosophie (hgg. von Jürgen Hasse und Robert Kozljanič): Gelebter, erfahrener und erinnerter Raum. München 2010, S. 83 – 95. Hanke, Steven: Windräder verursachen mehr Lärm als gedacht. In: ener|gate messenger; https://www.energate-messenger.de/news/181368/ windraeder-verursachen-mehr-laerm-als-gedacht (28.02.2021). Hartmann, Eduard von: Philosophie des Schönen (zuerst 1887). Berlin 1924. Hasse, Jürgen: Atmosphären der Stadt. Aufgespürte Räume. Berlin 2012. Hasse, Jürgen: Der Leib der Stadt. Phänomenographische Annäherungen. Frei burg/München 2015. Hasse, Jürgen: Die Aura des Einfachen. Mikrologien räumlichen Erlebens. Band 1. Freiburg/München 2017. Hasse, Jürgen: Atmosphären. Räumliches Erleben als Zweck der Architektur. In: Der Architekt, Heft 6/2018, S. 40–42. Hasse, Jürgen: Das Denkwürdige im Infra-Gewöhnlichen. Zur Explikation von Eindrücken. In: Synthesis Philosophica No. 66, Vol. 334. Zagreb 2018, S. 328 – 342. Hasse, Jürgen: Märkte und ihre Atmosphären. Mikrologien räumlichen Erle bens. Band 2. Freiburg/München 2018. Hasse, Jürgen: Photographie und Phänomenologie. Mikrologien räumlichen Erlebens. Band 3. Freiburg/München 2020. Heidegger, Martin: Sein und Zeit (zuerst 1927). Tübingen 1993. Heidegger, Martin: Was heisst Denken? (zuerst 1951/52). Tübingen 1997. Hellpach, Willy: Sinne und Seele. Zwölf Gänge in ihrem Grenzdickicht. Stutt gart 1946. Hellpach, Willy: Geopsyche. Die Menschenseele unter dem Einfluß von Wetter und Klima, Boden und Landschaft. Stuttgart 1950. Henry, Michel: Das Wesen des In-Erscheinung-Tretens. Freiburg/Mün chen 2019. Hiss, Tony: Ortsbesichtigung. Wie Räume den Menschen prägen, und warum wir unsere Stadt- und Landschaftsplanung verändern müssen (zuerst 1990); (aus dem Amerikanischen von Ebba D. Drolshagen). Hamburg 1992. Hiss, Tony: In Motion. The Experience of Travel. London 2017. Holzkamp, Klaus: Sinnliche Erkenntnis – Historischer Ursprung und gesell schaftliche Funktion der Wahrnehmung. Frankfurt am Main 1973. Hosokawa, Shuhei: Der Walkman-Effekt. In: Barck, Karlheinz/Peter Gente (Hg.): Aisthesis. Leipzig 1990, S. 229 – 251. Husserl, Edmund: Die Idee der Phänomenologie (Vorlesung von 1907). Haag 1958. James, William: The Principles of Psychology, Vol. 1 (zuerst 1890). New York 1950. Jankélévitch, Vladimir: Zauber, Improvisation, Virtuosität. Schriften zur Musik (zuerst 1955). Berlin 2020. Jütte, Robert: Geschichte der Sinne. Von der Antike bis zum Cyberspace. Mün chen 2000.
235 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Literaturverzeichnis
Kafka, Franz: Der Bau. In: Ders.: Die Erzählungen (hgg. von Roger Hermes). Frankfurt am Main 1996, S. 465 – 507. Klages, Ludwig: Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck (zuerst 1913). Leipzig 1942. Krebs, Stefan: »Sobbing, Whining, Rumbling«: Listening to Automobiles as Social Practice. In: Bijsterveld, Karin/Trevor Pinch (Ed.): The Oxford Hand book of Sound Studies. New York 2013, S. 79 – 101. Krueger, Felix: Das Wesen der Gefühle. Entwurf einer systematischen Theorie. Leipzig 1930. Krumme, Lisa: Zum narrativen Potenzial von Geräuschen (= Studies in Social Sciences and Cultures. Aus der Forschung des Fachbereichs Sozial- und Kul turwissenschaften der HSD, Nr. 4). Düsseldorf 2018. Lefebvre, Henri: Versuch der Rythmanalyse der Mittelmeerstädte (übersetzt von Justin Winkler); vgl. http://www.iacsa.eu/jw/lefebvre_1986_rhythmanalys e_mittelmeerstaedte.pdf (22.08.2020). Lessing, Theodor: Der Lärm. Eine Kampfschrift gegen die Geräusche unseres Lebens (zuerst 1908). In: Brandstätter, Horst / Theodor Lessing: Der Lärm. Stuttgart/Berlin 1999. Lotz, Wilhelm: Da sind die Straßen (zuerst 1913); https://www.zgedichte.de/g edichte/ernst-wilhelm-lotz/da-sind-die-strassen.html (06.02.2021). Marx, Karl: Einleitung [zur Kritik der Politischen Ökonomie]; http:// www.mlwerke.de/me/me13/me13_615.htm (25.01.2021). Merleau-Ponty, Maurice: Phänomenologie der Wahrnehmung (zuerst 1945) (aus dem Französischen übersetzt und eingeführt durch eine Vorrede von Rudolf Boehm). Berlin 1966. Merleau-Ponty, Maurice: Das Primat der Wahrnehmung. Aus dem Französi schen von Jürgen Schröder. Frankfurt am Main 2003. Metzger, Christoph: Architektur und Resonanz. Berlin 2015. Meyer, Petra Maria: acoustic turn. Paderborn 2008. Minkowski, Eugène: Die gelebte Zeit. I. Über den zeitlichen Aspekt des Lebens (zuerst 1933). Ins Deutsche übersetzt von Meinrad Perrez und Lucien Kayser. Salzburg 1971. Neumann, Dietrich (Hg.): Architektur der Nacht. München u. a. 2002. Nietzsche, Friedrich: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, hgg. von Giorgio Colli und Azzioni Montinari (KSA). München 1999. Nova, Alessandro: Das Buch des Windes. Das Unsichtbare sichtbar machen. München/Berlin 2007. Ogawa, Tadashi: Phenomenology of Wind and Atmosphere (translated and edited by Lorenzo Marinucci). (Atmospheric spaces n. 9). Mimesis Internatio nal 2021. Osman, Nabil (Hg.): Kleines Lexikon untergegangener Wörter. München 1971. Paul, Gerhard/Ralph Schock (Hg.): Sound des Jahrhunderts. Bonn 2013. Payer, Peter: Signum des Urbanen. Geräusch und Lärm der Großstadt um 1900. In: Paul, Gerhard/Ralph Schock (Hg.): Sound des Jahrhunderts. Bonn 2013, S. 36 – 41.
236 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Literaturverzeichnis
Payer, Peter: Stadt und Lärm im 19. und frühen 20. Jahrhundert. In: Ingenieur.de; https://www.ingenieur.de/fachmedien/laermbekaempfung/umgebungsla erm/stadt-und-laerm-im-19-und-fruehen-20-jahrhundert/ (09.08.2020). Picht, Georg: Kunst und Mythos (= Vorlesungen und Schriften. Studienausgabe, hgg. von Eisenbart, Constanze in Zusammenarbeit mit Enno Rudolph). Stuttgart 1986. Picht, Georg: Der Begriff der Natur und seine Geschichte. Stuttgart 1990. Picht, Georg: Zukunft und Utopie. Stuttgart 1992. Plessner, Helmuth: Gesammelte Schriften III. Die Einheit der Sinne. Grundlinen einer Ästhesiologie des Geistes (zuerst 1923). Frankfurt am Main 1980. Poe, Edgar Allan: Der Malstrom. In: Ders.: Erzählungen. München 1966, S. 180 – 200. Reimbold, Ernst Thomas: Die Nacht im Mythos, Kultus, Volksglauben und in der transpersonalen Erfahrung. Köln 1970. Remisow, Alexej: Die Geräusche der Stadt (zuerst 1921). Aus dem Russischen übersetzt von Ilma Rakusa. Frankfurt am Main 1996. Rilke, Rainer Maria: Das dichterische Werk von Rainer Maria Rilke. Berlin/ Zürich 2009. Rippegather, Jutta: Menschen kämpfen gegen Bahnlärm. In: Frankfurter Rund schau vom 25.04.2018; s. auch https://www.fr.de/rhein-main/menschenkaempfen-gegen-bahnlaerm-11004852.html (27.01.2021). Rosa, Hartmut: Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Berlin 2019. Runkel, Simon: Klangräume der Erlebnisgesellschaft. Eine phänomenologische Untersuchung (= Wahrnehmungsgeographische Studien, Band 27). Olden burg 2014. Rüsche, Alexandra: Vermehrt schwerere Unfälle durch Kopfhörer im Straßenver kehr. In: Mittelstand Nachrichten vom 17.02.2021; https://www.mittelstand -nachrichten.de/technologie/vermehrt-schwere-unfaelle-durch-kopfhoerer -im-strassenverkehr/ (17.02.2021). Russolo, Luigi: die Kunst der Geräusche (zuerst 1916). Aus dem Italienischen von Owig DasGupta. Mainz 2000/2005. Schandl, Franz: Im Kontinuum des Lärms. Beiträge zu einer Phänomenologie gegenwärtigen Lautseins. In: Streifzüge 2019–76, S. 3; https://www.streif zuege.org/2019/im-kontinuum-des-laerms/ (02.03.2021). Schivelbusch, Wolfgang: Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert. München/Wien 1977. Schmitz, Hermann: System der Philosophie. 5 Bände in 10 Büchern. Bonn 1964 – 1980. Schmitz, Hermann: System der Philosophie. Band III: Der Raum. Teil 2: Der Gefühlsraum (zuerst 1969). Bonn 1981. Schmitz, Hermann: System der Philosophie. Band III: Der Raum. Teil 5: Die Wahrnehmung (zuerst 1978). Bonn 1989. Schmitz, Hermann: Der unerschöpfliche Gegenstand. Bonn 1990. Schmitz, Hermann: System der Philosophie. Band III: Der Raum. Teil 4: Das Göttliche und der Raum (zuerst 1977). Bonn 1995. Schmitz, Hermann: Der Leib, der Raum und die Gefühle. Ostfildern 1998.
237 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Literaturverzeichnis
Schmitz, Hermann: Was ist Neue Phänomenologie? (= LYNKEUS. Studien zur Neuen Phänomenologie, 8). Rostock 2003. Schmitz, Hermann: Kurze Einführung in die Neue Phänomenologie. Frei burg/München 2009. Schmitz, Hermann: Der Leib. Berlin/Boston 2011. Schmitz, Hermann: Phänomenologie der Zeit. Freiburg/München 2014. Scraton, Paul: In der Nacht und am Tag. Oder: Wie sich die Stadt verändert, wenn die Lichter angehen. In: Lubkowitz, Anneke (Hg.): Psychogeografie. Berlin 2020, S. 131 – 141. Seamon, David: Body-Subject, Time-Space Routines, and Place-Ballets. In: Buttimer, Anne/David Seamon (Ed.): The Human Experiemce of Space and Place. London 1980, S. 148 – 165. Serres, Michel: Die fünf Sinne. Eine Philosophie der Gemenge und Gemische (zuerst 1985); übersetzt von Michael Bischoff). Frankfurt am Main 1994. Shotter, John: Goethe and the Refiguration of Intellectual Inquiry: From `About ness`-Thinking to `Withness`-Thinking in Everyday Life. In: Janus Head, Vol. 8/2005, S. 132 – 158. Simmel, Georg: Soziologische Ästhetik (Zuerst 1896). In: Lichtblau, Klaus (Hg.): Georg Simmel. Soziologische Ästhetik. Bodenheim 1998, S. 77 – 92. Simmel, Georg: Die ästhetische Bedeutung des Gesichts (zuerst 1901). In: Ders.: Brücke und Tür. Essays des Philosophen zur Geschichte, Religion, Kunst und Gesellschaft (hgg. von Michael Landmann). Stuttgart 1957, S. 153 – 159. Simmel, Georg: Philosophie der Landschaft (zuerst 1913). In: Simmel, Georg: Brücke und Tür. Essays des Philosophen zur Geschichte, Religion, Kunst und Gesellschaft. Hg. Von Michael Landmann. Stuttgart 1957, S. 141 – 152. Simmel, Georg: Die Großstädte und das Geistesleben (zuerst 1903). In: Licht blau, Klaus (Hg.): Georg Simmel. Soziologische Ästhetik. Bodenheim 1998, S. 119 – 133. Simmel, Georg: Soziologie der Sinne (zuerst 1907). In: Lichtblau, Klaus (Hg.): Georg Simmel. Soziologische Ästhetik. Bodenheim 1998, S. 135 – 149. Spiegelberg, Herbert: The Phenomenological Movement. A Historical Introduc tion. The Hague/Boston/London 1978. Stahl, Heiner: Klanginseln – Hintergrundrauschen – Selbstmischungen. Der Sound der postmodernen Großstadt. In: Paul, Gerhard/Ralph Schock (Hg.): Sound des Jahrhunderts. Bonn 2013, S. 558 – 563. Stenzel, A. (Hg.): Deutsches Seemännisches Wörterbuch. Im Auftrage des Staatssekretärs des Reichs-Marine-Amts (zuerst 1904). Reprint. Wölfenbüt tel 2013. Storm, Theodor: Sämtliche Werke, Zweiter Band. Berlin u. a. 1963. Straus, Erwin: Die Formen des Räumlichen. Ihre Bedeutung für die Motorik und die Wahrnehmung (zuerst 1930). In: Ders.: Psychologie der menschlichen Welt. Gesammelte Schriften. Berlin u. a. 1960, S. 141 – 178. Straus, Erwin: Geschehnis und Erlebnis (zuerst 1930). Berlin u. a. 1978.
238 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
Literaturverzeichnis
Taylor, Timothy D.: Die Avant-Garde in the Family Room: American Adver tising and the Domestication of Electronic Music in the 1960s and 1970s. In: The Oxford Handbook of Sound Studies, edited by Trevor Pinch and Karin Bijsterveld (online publication November 2012, pp. 387 – 408; https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/ 9780195388947.001.0001/oxfordhb-9780195388947-e-016 (18.03.2022). Thibaud, Jean-Paul: A sonic paradigm of urban ambiances? In: Journal of Sonic Studies. Vol. 1, No 1 (2011); s. auch http://journal.sonicstudies.org/vol01/ nr01/a02. Thibaud, Jean-Paul/Pascal Amphoux: Silencing the City? In: SoundEffects. An Interdisciöinary Journal of Sound and Sound Experience, Vol. 3, No. 3 (2013), S. 61 – 70. Ullmaier, Johannes: Nachwort zu: Russolo, Luigi: Die Kunst der Geräusche (zuerst 1916). Aus dem Italienischen von Owig DasGupta. Mainz 2000/2005, S. 80 – 97. Uzarewicz, Charlotte: Hörbare Pflege? Der Beitrag der Akustik zur klinischen Atmosphäre. In: Wolf, Barbara/Christian Julmi (Hg.): Die Macht der Atmo sphären = GNP Band 31). Freiburg/München 2020, S. 305 – 326. Vetter, Helmuth: Grundriss Heidegger. Ein Handbuch zu Leben und Werk. Hamburg 2014. Volkelt, Johannes: System der Ästhetik. Band I (Grundlegung der Ästhetik). München 1905. Wasmuth, Günther (Hg.): Wasmuths Lexikon der Baukunst. Berlin 1929. Wetz, Franz Josef: »Situation [I. Philosophie]«. In: HWPh, Bd. 9, sp. 923 – 929. Winkler, Justin: Übergänge im Hörraum. In: Rolhsoven Johanna/Justin Winkler (Hg.): Übergänge im Stadtraum. Texte von Wahrnehmungsübungen. Basel 1996, S. 55 – 58. Winkler, Justin: Landschaft hören. In: Forum Klanglandschaft (Hg.): Klangland schaft wörtlich. Akustische Umwelt in transdisziplinärer Perspektive. Basel 2010, S. 3 – 10. Wirtz, Markus Antonius (Hg.): Dorsch – Lexikon der Psychologie. Bern 2013. Wundt, Wilhelm: Grundriss der Psychologie (zuerst 1896). Leipzig 1905. Zur Lippe, Rudolf: Sinnenbewußtsein. Reinbek 1987.
239 https://doi.org/10.5771/9783495999721 .
https://doi.org/10.5771/9783495999721 .



![Inklusion–Exklusion: Funktion und Formen des Rechts in der spätmittelalterlichen Stadt. Das Beispiel Köln [1 ed.]
9783412504397, 9783412511654](https://dokumen.pub/img/200x200/inklusionexklusion-funktion-und-formen-des-rechts-in-der-sptmittelalterlichen-stadt-das-beispiel-kln-1nbsped-9783412504397-9783412511654.jpg)




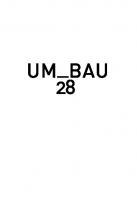
![Das älteste Bürgerbuch der Stadt Linz (1658–1707): Edition und Auswertung [1 ed.]
9783205208877, 9783205208853](https://dokumen.pub/img/200x200/das-lteste-brgerbuch-der-stadt-linz-16581707-edition-und-auswertung-1nbsped-9783205208877-9783205208853.jpg)
