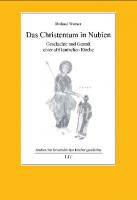Das Christentum und der Staat: Annäherungen an eine komplexe Beziehung und ihre Geschichte 9783737002875, 9783847102878, 9783847002871
162 116 1MB
German Pages [134] Year 2014
Polecaj historie

- Author / Uploaded
- Christian Hillgruber
- Udo Di Fabio
- Wolfgang Huber
- Josef Isensee
- Hans Maier
- Robert Spaemann
Citation preview
Christian Hillgruber (Hg.)
Das Christentum und der Staat Annäherungen an eine komplexe Beziehung und ihre Geschichte
V& R unipress Bonn University Press
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-8471-0287-8 ISBN 978-3-8470-0287-1 (E-Book) Veröffentlichungen der Bonn University Press erscheinen im Verlag V& R unipress GmbH. Gedruckt mit freundlicher Unterstützung des Kölner Erzbistums. Ó 2014, V& R unipress in Göttingen / www.vr-unipress.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Printed in Germany. Titelbild: Buchmalerei: Decretum cum glossis Bartholomaei Brixiensis, UB Graz, Abtl. für Sondersammlungen, HS. MS 92, fol. 1r Druck und Bindung: a Hubert & Co, Göttingen Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Aus der Mailänder Vereinbarung von 313: »Nachdem wir, sowohl ich Konstantinus Augustus, als auch ich Licinius Augustus glücklich zu Mailand uns eingefunden hatten und alle Angelegenheiten der öffentlichen Wohlfahrt und Sicherheit in Beratung nahmen, so glaubten wir unter den übrigen Anordnungen, von denen wir uns Nutzen für die Gesamtheit versprachen, vor allem die Dinge ordnen zu müssen, auf denen die Verehrung der Gottheit beruht, und zwar in der Art, dass wir sowohl den Christen wie auch allen übrigen freie Befugnis gewährten, der Religion sich anzuschließen, die jeder sich wählen würde, auf das alles, was von göttlicher Wesenheit auf himmlischem Sitze thront, uns und allen, die unter unserer Herrschaft stehen, gnädig und gewogen sein möge. Und so glaubten wir in heilsamer und vernünftiger Erwägung den Entschluss fassen zu müssen, durchaus keinem die Erlaubnis zu versagen, der entweder der Religionsübung der Christen oder jener Religion sich zuwenden wollte, die er für sich als die geeignetste erachtete, auf dass die höchste Gottheit, deren Verehrung wir aus freiem Herzen ergeben sind, uns in allem die gewohnte Huld und Gnade erweisen könne. […] so dass jetzt frei und unbehindert jeder, der die Religion der Christen zu beobachten geneigt ist, ohne alle Beunruhigung und Belästigung dieser Beobachtung obliegen mag. Und dies glauben wir […] zur Kenntnis bringen zu sollen, […] dass wir freie und unbeschränkte Ausübung ihrer Religion den nämlichen Christen gewährt haben. Und indem […] wir dieses den Christen gestattet haben, so erkennt […], dass wir auch den übrigen eine ähnlich offene und uneingeschränkte Ermächtigung zur Ausübung ihrer Religion im Interesse der Ruhe unserer Zeit eingeräumt haben, so dass jeder in der Verehrung dessen, was er sich erwählt hat, ungehinderte Freiheit hat. Und dies ist von uns geschehen, damit keine Art von Gottesverehrung und keine Religion durch uns irgendwelchen Abbruch erfahre […]«.* * Zitiert nach: Bibliothek der Kirchenväter, Reihe 1, Bd. 36, 1919, Nr. 48, S. 57 f.
Inhalt
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Robert Spaemann Die christliche Sicht des Politischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Hans Maier Christentum und Staat: Modelle des Rechts, Entwicklungsphasen der Geschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Josef Isensee Der lange Weg zu »Dignitatis humanae« – Konvergenzen und Divergenzen von kirchlichem Wahrheitsanspruch und verfassungsstaatlichem Freiheitsverständnis . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Udo Di Fabio Staat und Kirche: Christentum und Rechtskultur als Grundlage des Staatskirchenrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
Wolfgang Huber Kirche und Verfassungsordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Vorwort
Die Frage nach dem Verhältnis des Christentums1 zu staatlich organisierter politischer Herrschaft im Allgemeinen und nach seinem Beitrag zur Herausbildung und geistigen Fundierung des modernen neuzeitlichen Staats im Besonderen ist eine viel gestellte und – im Verlauf der Geschichte ebenso wie gegenwärtig – ganz unterschiedlich beantwortete. Dies kann angesichts der langen, durchaus wechselhaften Beziehungshistorie, die von Nähe wie Distanz gleichermaßen zeugt, nicht wirklich überraschen. Es dürfte nicht zuletzt die aktuelle Situation zunehmender religiöser Pluralität2 sein, die ihr nun eine neue Aufmerksamkeit zuteil werden lässt;3 denn diese Pluralität macht einerseits einmal mehr die unabweisbare Notwendigkeit eines die religiöse Wahrheitsfrage nicht selbst beantwortenden, insofern religiös neutralen Staates bewusst, der allein die Heimstatt aller seiner Bürger ungeachtet ihrer ganz unterschiedlichen religiösen Bekenntnisse sein kann. Sie wirft aber andererseits auch die Frage auf, ob der für uns so selbstverständliche demokratische Verfassungsstaat möglicherweise auf noch nicht hinreichend reflektierte sozio-kulturelle Vorausset1 Von »Christentum« statt von christlichen Kirchen und Religionsgemeinschaften wird hier gesprochen, weil in dem behandelten Zusammenhang primär nicht das sie voneinander unterscheidende, sondern der allen Christen gemeinsame Glaube an Jesus Christus als Mensch gewordenen Sohn Gottes und seinen Erlösungstod und die in dieser christlichen Heilsbotschaft liegende Herausforderung für die politische Herrschaft in Rede steht. Dass die geschichtlich-institutionelle Entwicklung der Christenheit und ihre verschiedenen Aufspaltungen und Ausprägungen auch insoweit Differenzierungen notwendig machen, soll damit nicht bestritten werden. Die Autoren nehmen diese Differenzierungen, so sie ihnen geboten erscheinen, vor und bestimmen im Übrigen auch jeweils ihre eigene, teilweise auf die katholische oder evangelische Kirche fokussierte Perspektive. 2 Siehe dazu nur E. Jüngel, Religion, Zivilreligion und christlicher Glaube. Das Christentum in einer pluralistischen Gesellschaft, Essener Gespräche 39 (2005), S. 53 ff. 3 Siehe als Beleg nur M. Rhonheimer, Christentum und säkularer Staat. Geschichte – Gegenwart – Zukunft, 2012; K. Gabriel/C. Gärtner/D. Pollack (Hrsg.), Umstrittene Säkularisierung. Soziologische und historische Analysen zur Differenzierung von Religion und Politik, 2012; T. Stein, Himmlische Quellen und irdisches Recht. Religiöse Voraussetzungen des freiheitlichen Verfassungsstaates, 2007.
10
Vorwort
zungen als Gelingensbedingungen angewiesen ist, die allein das bisher im westlichen Europa in der Mehrheitsposition befindliche und wirkungsmächtige Christentum westlich-abendländischer Prägung zu gewährleisten vermag.4 Die im vorliegenden Band versammelten Beiträge von Robert Spaemann, Hans Maier, Josef Isensee, Udo Di Fabio und Wolfgang Huber sind sich bei aller Perspektivenvielfalt und ungeachtet mancher Bewertungsunterschiede im Einzelnen in der wissenschaftlich begründeten Einschätzung einig, dass auch die politische Welt, in der wir leben, ohne das Christentum eine gänzlich andere wäre.5 So formuliert Udo Di Fabio: »Der moderne Staat wurde, was er ist, im Ringen und im Bündnis mit Kirche und Religion, in der Einheit und der Trennung beider Sphären, in wechselseitigen Übergriffen, aber ebenso in der Kooperation des sich respektierenden Miteinanders. Ohne die wechselvolle Geschichte von politischer Herrschaft und christlicher Religion, stammend aus den antiken Wurzeln und über die mittelalterliche Prägung, ist weder das moderne Recht noch der moderne Staat zu verstehen, aber auch nicht die körperschaftliche Struktur der christlichen Religionsgemeinschaften« (S. 91). Dabei sind die wechselseitigen Einwirkungen aufeinander vielfältig und lassen sich gewisse Widersprüche in der historischen Entwicklung weder leugnen noch ohne weiteres harmonisierend auflösen. Es bleibt also insgesamt eine komplexe Wirkungsgeschichte, die sich als solche aber schlechterdings nicht in Abrede stellen lässt. 1. Die Schwierigkeiten fangen schon im Grundsätzlichen an. In der christlichen Sicht des Politischen, Thema des Beitrags von Robert Spaemann, ist die politische Ordnung »nicht die wahre Heimat derer, die Gott lieben« (S. 22). Für die Christen gilt vielmehr : »Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir« (Hebräer 13,14). Das wahre Zuhause ist das verheißene Reich Gottes; ihm gilt die Hoffnung und Sehnsucht der Christen. So bleiben gläubige Christen in gewisser Weise »Fremdlinge auf Erden« (Hebräer 11,13).6 Dies führt indes nicht zwingend zu einer apolitischen Abwendung vom Staat, wohl aber zu einer prinzipiellen Scheidung der Sphären von Politik und Religion. »Mein Königtum«, so antwortet Jesus Pilatus, »ist nicht von dieser Welt […] mein Königtum ist nicht von hier« (Johannes 18,36). Die von Jesus verkündete Botschaft vom Reich Gottes verfolgt also kein unmittelbares politisches Ziel, auch wenn sie gerade wegen der politisch-religiösen Einheit der vorchristlichen 4 E.-W. Böckenförde, Der säkularisierte Staat, 2006, S. 41 hält es immerhin für denkbar, dass es »ein nicht aufgebbares Vernunftfundament oder, wenn man so will, ›Naturrecht‹ des säkularisierten Staates [geben könne], das womöglich an den antik-jüdisch-christlichen Kulturkreis im Reflexionshorizont der Aufklärung gebunden ist«: 5 H. Maier, Welt ohne Christentum – was wäre anders?, 1999, S. 108 ff.. 6 Siehe auch Epheser 2,19 und Augustinus, De Civitate Dei, XV, 1.
Vorwort
11
Antike hochpolitische Wirkungen zeitigt, »den größten Umschlag, der jemals vorgekommen ist«7, bewirkt. Die weltliche Gewalt des Kaisers wird von Jesus ausdrücklich anerkannt: »So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört« (Matthäus 22,21; Markus 12,17; Lukas 20,25), antwortet Jesus auf die Frage nach der kaiserlichen Steuer den Pharisäern, die ihn zu einer Äußerung verleiten wollen, die ihn des zivilen Ungehorsams gegenüber der römischen Besatzungsgewalt überführen soll. Das Christentum erkennt die Notwendigkeit und Legitimität weltlicher Herrschaft, die durch Selbstliebe begründete civitas terrena, um des irdischen Friedens an. Nach der von Augustin entwickelten christlichen Staatslehre »strebt der irdische Staat, der nicht im Glauben lebt, nach irdischem Frieden und versteht die Eintracht der Bürger im Befehlen und Gehorchen als gleichmäßige Ausrichtung des menschlichen Wollens auf die zum sterblichen Leben gehörenden Güter. Der himmlische Staat dagegen, oder vielmehr der Teil desselben, der noch in der vergänglichen Welt auf der Pilgerfahrt sich befindet und im Glauben lebt, bedient sich notwendig auch dieses Friedens, bis das vergängliche Leben selbst, dem solcher Friede not tut, vergeht, Solange er darum im irdischen Staate gleichsam in Gefangenschaft sein Pilgerleben führt, trägt er, bereits getröstet durch die Verheißung der Erlösung und den Empfang des Unterpfandes der Geistesgabe, kein Bedenken, den Gesetzen des irdischen Staates, die all das regeln, was der Erhaltung des sterblichen Lebens dient, zu gehorchen«.8 Das Christentum ist dabei nicht auf eine ganz bestimmte Staats- und Regierungsform festgelegt. Der himmlische Staat, der auf Erden pilgert, »fragt nicht nach Unterschieden in Sitten, Gesetzen und Einrichtungen, wodurch der irdische Frieden begründet oder aufrechterhalten wird, lehnt oder schafft nichts davon ab, bewahrt und befolgt es vielmehr, mag es auch in den verschiedenen Völkern verschieden sein, da alles ein und demselben Ziel irdischen Friedens dient«.9 Da der irdische Frieden, die Legitimation weltlicher Herrschaft, dem himmlischen Frieden, dem wahren Frieden, d. h. dem Frieden mit und in Gott zu dienen bestimmt ist, ist die christliche Folgebereitschaft gegenüber der politischen Gewalt aber auch von vornherein begrenzt; sie darf die Ausübung der Religion, »die den einen höchsten und wahren Gott zu verehren lehrt, nicht hindern«.10 Spaemann formuliert es so: »Ihre [der Christen] Verantwortlichkeit für das Gemeinwohl gründet nicht in unbedingter Staatsloyalität, sondern ihre
7 8 9 10
J. Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen (1905), 31949, S. 149. De Civitate Dei, XIX, 17. Ebd. Ebd.
12
Vorwort
Staatsloyalität in ihrer unbedingten Verantwortlichkeit für das Gemeinwohl« (S. 23). Selbst angesichts der unter römischer Herrschaft erlittenen Verfolgung bleibt das Christentum grundsätzlich staatsbejahend. Im Römerbrief fordert Apostel Paulus die Christen nachdrücklich dazu auf, »der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam zu leisten« (Römer 13,1), und zwar weil die staatliche Gewalt von Gott eingesetzt und in Gottes Auftrag handelt (Römer 13,1 – 2 u. 6). Die staatliche Gewalt »steht im Dienst Gottes« (Römer 13,4) und ist deshalb legitim. Ungeachtet der prinzipiellen Scheidung irdischer Staatlichkeit vom Reich Gottes stehen diese sich nicht unverbunden gegenüber : »Denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt« (Römer 13,1). Der Staat und die von ihm ausgehende Gewalt empfangen ihre Legitimation also von Gott, ohne dass dieser Staat dadurch selbst zum Heilsbringer würde. Aus dieser Ableitung der staatlichen von der göttlichen Gewalt ergeben sich zugleich die Grenzen der Gehorsamspflicht, die nur soweit reicht, wie dieser Legitimationszusammenhang besteht und nicht durch selbstherrliche Absolutheitsansprüche der staatlichen Obrigkeit aufgelöst wird. Die unbedingte Hingabe an Gott macht es dem Christen unmöglich, weltlicher Herrschaft göttliche Weihe zuzusprechen, Staatskult zu betreiben. Erhebt der Staat einen auf den ganzen Menschen gerichteten Totalitätsanspruch, beansprucht er also etwas für sich, was nach Jesu Wort vom Zinsgroschen allein Gott gebührt (Markus 12,17), dann ist der Konflikt unausweichlich. Im Fall der Apotheose konkretisiert sich die in der Apostelgeschichte ausgesprochene Verpflichtung des Christen: »Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen (Apostelgeschichte 5,29). 2. Eine – so begrenzte – Autonomie des Politischen gegenüber der christlichen Religion setzt sich politisch-praktisch allerdings erst mit dem Ausgang des Investiturstreits (1057 – 1122), und nur im abendländischen Europa durch. Zunächst wird im 4. Jahrhundert die überkommene Einheit von Staat und Religion, von »imperium« und »sacerdotium« wiederhergestellt, wenn auch unter neuen, christlichen Vorzeichen. Der Investiturstreit bildet, wie Hans Maier in seinem Beitrag festhält, den »Anfang dessen, was wir den Dualismus des Geistlichen und Weltlichen, die Dualität von Staats- und Gewissenssphäre nennen« (S. 36). Der deutsche König und Kaiser wird auf seine weltliche Aufgabe reduziert, sein Königtum entsakralisiert. Aus dem rex et sacerdos wird der bloße rex terrenus. Auch als bloß weltlicher Herrscher bleibt er zunächst, gesalbt und gekrönt, Herrscher von Gottes Gnaden. »Aber die Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt führte auf Dauer im Herrschaftsbereich der römischen Kirche, also in West- und Mitteleuropa, zu einer Säkularisierung staatlicher Macht«11. 11 H. Schulze, Staat und Nation in der europäischen Geschichte, München 1994, S. 36.
Vorwort
13
Das Ergebnis des Investiturstreits und der langen Kämpfe zwischen Papsttum und Kaisertum im Hochmittelalter bildet daher den »Ausgangspunkt für das allmähliche Auseinandertreten von Staat und Kirche und damit für die Herausbildung zweier Freiheitsprinzipien, die für die weitere Geschichte der europäischen Staaten grundlegend sein sollten: Freiheit des Glaubens von staatlicher Zwangsgewalt einerseits, Freiheit der Politik von kirchlicher Gängelung andererseits«12. Das Trennungsprinzip schafft mit der Anerkennung der in der christlichen Botschaft ausweislich der Zinsgroschenparabel von Anfang an im Sinne »einer Grundorientierung des christlichen Glaubens selbst« (Wolfgang Huber, S. 115) angelegten Dualität von Politik und Religion, ihrer Distanzierung, eine notwendige, wenn auch noch nicht hinreichende Bedingung für die spätere Gewährleistung der Religionsfreiheit. In den Worten Maiers: »Machtpolitisch blieb der Streit der Universalgewalten unentschieden, was sich herausbildete, war eine zweipolige Ordnung, mit Zonen der Überschneidung und solchen der Selbständigkeit – Voraussetzung für die freiheitlichen Ordnungen der Neuzeit« (S. 44). Dagegen hat die römische Erbschaft der Einheit von Staat und Kirche »die östlichen Kirchen auf stärkste geprägt« (Maier, S. 34). »Die Symphonia-Lehre«, d. h. die Lehre vom Gleichklang von Bischofsamt und Kaisermacht, »bildete das staatskirchenrechtliche Fundament der byzantinischen Reichskirche – und später aller orthodoxen Kirchen der Welt« (Maier, S. 33). 3. Ob die Reformation infolge der durch sie hervorgerufenen Glaubensspaltung zu einer »zweiten Stufe der Säkularisation« geführt hat, wie insbesondere Böckenförde annimmt,13 ist umstritten.14 Eine solche Wirkung lag jedenfalls nicht in der Intention der Reformatoren. Luthers in der Schrift »Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei« (1523) niedergelegte »Staatslehre«, seine später sog. »Zwei-Reiche-Lehre«, die Scheidung von weltlichem und geistlichem Regiment, ist im Kern15 noch ganz augustinisch, in der Begründung der Notwendigkeit einer gottgewollten weltlichen Herrschaft des Rechts und des Schwerts, der Charakterisierung ihrer Ausübung als Gottesdienst wie auch in der Bestimmung der Grenzen ihres Wirkungsbereichs und ihres Gehorsamsanspruchs: »Das weltlich Regiment hat Gesetz, die sich nicht weiter strecken, denn über Leib und Gut, und was äußerlich ist auf Erden. Denn über die Seele kann und will Gott niemand lassen regieren, denn sich selbst 12 H. Schulze (Anm. 11), S. 37. 13 E.-W. Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation (1967), in: ders., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt a.M. 1991, S. 92 ff. 14 Eingehende Kritik bei C. Hillgruber, Staat und Religion, 2007, S. 7 – 30. 15 Vgl. aber zur grundlegenden Weiterentwicklung der augustinischen Unterscheidung der civitates terrena und caelestis zu einem »luzide[n] System« durch Luther E. Herms, Leben in der Welt, in: A. Beutel (Hrsg.), Luther Handbuch, 2 2010, S. 425 – 428.
14
Vorwort
allein. Darum wo weltlich Gewalt sich vermisse, der Seele Gesetz zu geben, da greift sie Gott in sein Regiment«.16 In der Staatsphilosophie der frühen Neuzeit wird politische Herrschaft dann erstmals rein innerweltlich begründet. Die großen Vordenker des souveränen Staates, allen voran Bodin und Hobbes, legitimieren politische Herrschaft nun ohne unmittelbaren Rückgriff auf die (christliche) Religion, weisen dem Politischen den Primat zu, funktionalisieren aber zugleich Glaube und Religion, die in den Dienst der Schaffung oder Erhaltung einheitlicher Staatsgewalt gestellt werden. »Jesus is the Christ« erscheint bei Hobbes als der religiöse Minimalkonsens, in dem die Anhänger der anglikanischen Bischofskirche, des katholischen Bekenntnisses und der Fülle christlicher Sekten – die Juden ausgeschlossen – zusammen finden; es ist dies die christlich beschränkte Neutralitätsformel, die als öffentliches Bekenntnis von den Bürgern eines Staates eingefordert werden darf. Die säkulare Staatsbegründung führt zwar nicht notwendig zu säkularer Staatlichkeit, lässt sie aber theoretisch, später auch praktisch zu. Die Verknüpfung des Staates mit einer bestimmten Religion oder Konfession verliert ihre ewige Gültigkeit, wird historisch kontingent. Die Verbindung mit dem Christentum oder einer christlichen Konfession ist in der gegebenen historischen Situation »eine tatsächlich vorhandene und vorausgesetzte, aber keine notwendige Bedingung mehr«.17 Dies wird bei Hobbes ganz deutlich, der bereits die Möglichkeit politischer Herrschaft eines Nichtchristen über Christen reflektiert und die Christen diesem gegenüber jedenfalls in temporalibus zum unbedingten Gehorsam verpflichtet.18 4. Die amerikanische und französische Revolution gegen Ende des 18. Jahrhunderts markieren schließlich den Beginn des modernen Verfassungsstaates, der sich legitimatorisch auf das Prinzip der Volkssouveränität stützt und durch Gewaltenteilung sowie die Anerkennung von als Grundrechten gewährleisteten Menschenrechten als seinen konstituierenden Merkmalen auszeichnet (vgl. Art. 16 der Allgemeinen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789). Gegen die so in Erscheinung tretende politische Moderne nimmt namentlich die katholische Kirche, wie Josef Isensee in seinem Beitrag näher darlegt, jahrhundertelang eine rigide Abwehrhaltung ein. Sie verwirft die Ideen von 1789 in Bausch und Bogen. Sie weist das Prinzip der Volkssouveränität zurück, weil es – vermeintlich – die Bindung an den maßgeblichen Willen Gottes, die Unterordnung unter das Gesetz Gottes, in Abrede stellt. Sie lehnt den Freiheitsbegriff der 16 M. Luther, Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei (1523), Der zweite Teil: Wie weit sich weltliche Obrigkeit erstrecke. 17 Insoweit ganz zutreffend E.-W. Böckenförde (Fn. 13), S. 105. 18 T. Hobbes, De cive, 1642, Chapter XVIII, Art. XIII.
Vorwort
15
Grundrechte ab, soweit dieser, als Freiheit der Beliebigkeit, auch die Freiheit einschließt, »die Wahrheit zu missachten, den Irrtum zu verbreiten, das Böse zu tun« (S. 79). »Die Kirche verwirft die Säkularität des modernen Staates, weil sie ihr die Abkehr von der Wahrheit bedeutet, die sich in dem – allein wahren – christlichen Glauben verkörpert« (S. 74). Das irrende Gewissen soll keine menschenrechtliche Freiheit für sich reklamieren können, wird der Mensch doch erst durch die Wahrheit frei (Johannes 8,32). Auch der kontinentaleuropäische, namentlich der deutsche Protestantismus tut sich mit den Menschenrechten, der Volkssouveränität und demokratischer Herrschaftslegitimation schwer.19 So orientiert sich das Luthertum lange Zeit eher »an der mittelalterlichen Reichsvorstellung oder dem vormodernen Ständestaat«, »nicht aber an den Koordinaten moderner Staatlichkeit«.20 Kann vor diesem Hintergrund überhaupt davon gesprochen werden, dass das Christentum einen geistigen Beitrag zur Grundlegung des modernen Verfassungsstaates geleistet hat? Hans Maier weist in diesem Zusammenhang zunächst auf die Herstellung spezifischer Verantwortlichkeit hin: »Auch der moderne Verfassungsstaat hat, wenigstens indirekt, einen seiner Ursprünge im christlichen Umgang mit der Zeit. Denn das Christentum machte politisches Handeln rechenschaftspflichtig vor Gott und dem Gewissen« (S. 49). Darüber hinaus lassen sich Verbindungslinien zwischen den Herrschaftslimitierungen ziehen, die sich aus der Ablehnung totalitärer Herrschaftsansprüche in der christlichen Staatsauffassung einerseits, sowie »Selbstbegrenzungspotentiale[n] öffentlicher Macht, […] etwa durch die moderne Gewaltenteilung, den Menschenrechtsgedanken und durch die Selbstbindung staatlicher Ordnung«21 andererseits ergeben, auch wenn erst der moderne Staat politische Verantwortlichkeit organisiert (Maier, S. 49 nach Fn. 43). Schließlich dürfte die verfassungsmäßige Anerkennung von Menschenwürde und Menschenrechten im modernen Verfassungsstaat das gemeinsame moralische Erbe des Christentums und der Aufklärung sein, wobei sich viele Humanisten ihrerseits auf christliche Glaubenssätze berufen konnten und berufen haben. Das Christentum ist insoweit einer von vielen geschichtlich wirksam gewordenen Faktoren gewesen. »Das bedeutet jedoch nicht, dass die Botschaft des Christentums sich auf die Prinzipien des Verfassungsstaates richtete oder 19 Siehe dazu nur A. Dörfler-Dierken, Luthertum und Demokratie. Deutsche und amerikanische Theologen des 19. Jahrhunderts zu Staat, Gesellschaft und Kirche, 2001; W. Huber, Protestantismus und Demokratie, in: ders. (Hrsg.), Protestanten in der Demokratie, München 1990, S. 11 – 36; R. v. Thadden, Protestantismus und Demokratie, in: H. Renz/F.W. Graf (Hrsg.), Protestantismus und Neuzeit, 1984, S. 103 – 119. 20 R. Anselm, Zweireichelehre I. Kirchengeschichtlich, TRE, Bd. 36 (2004), S. 776, 779. 21 Ebd.
16
Vorwort
dass es einen direkten Ableitungszusammenhang, sei er theologischer oder sei er juridischer Art zwischen biblischer Verkündigung und menschenrechtlichdemokratischer Staatsverfassung gäbe« (Isensee, S. 57 bei Fn.20). Es gibt jedenfalls erhebliche geistige Vorarbeiten, mit denen das Christentum dem modernen säkularen freiheitlichen, den Menschenrechten verpflichteten Staat den Weg bereitet hat. So bricht die christliche Heilsbotschaft in die antike Welt der Ungleichheit und Unfreiheit mit einem radikalen Gleichheits- und Freiheitsanspruch ein, der in der Gottebenbildlichkeit des Menschen gründet. »Es gibt nicht mehr Juden noch Griechen, nicht mehr Sklaven noch Freie, nicht mehr männlich noch weiblich; denn ihr seid alle einer in Christus Jesus« (Galater 3,28). »Zur Freiheit hat uns Christus befreit« heißt ein zentraler Satz der paulinischen Theologie im Neuen Testament (Galater, 5,1). Das alles ist »christlicher Dynamit«22. Gewiss ist diese, sich der Güte Gottes verdankende Gleichheit und Freiheit in Christus etwas anderes als die Gleichheit und Freiheit im politisch-aufklärerischen Sinne, und beide Gleichheits- und Freiheitsbegriffe müssen daher voneinander unterschieden werden (siehe dazu sowie näher zum rechten Verständnis der christlichen Freiheit Huber, S. 117 ff.). »Das Christentum zeigt den Menschen in seiner Beziehung zu Gott. Diese aber präjudiziert nicht ohne weiteres die Beziehung des Menschen zur Staatsgewalt; aber sie bereitet sie vor. […] Die Analogie von transzendenten auf immanente Vorstellungen liegt nahe, und sie hat sich in der Geschichte realisiert« (so Isensee, S. 64 f.). Die »christliche Freiheit«, so drückt es Wolfgang Huber aus, »drängt nach gesellschaftlichen Umständen und nach einer Verfassungsordnung, in welchen die Entfaltung dieser Freiheit möglich ist« (S. 119; siehe auch Di Fabio, S. 100 bei Fn. 35). Es sollte allerdings bei der Katholischen Kirche bis zum II. Vatikanischen Konzil dauern, bis der Prozess allmählicher Annäherung und Aussöhnung mit den Grundgedanken des modernen Verfassungsstaates abgeschlossen war und kirchlicherseits mit der Erklärung »Dignitatis humanae« 1965 die Anerkennung der Religionsfreiheit erfolgen konnte. Erst dann setzte sich endgültig die Einsicht durch, dass sich das staatlicherseits zu gewährleistende Menschenrecht der Religionsfreiheit »nicht gegen die Religion [richtet], sondern gegen staatlichen Zwang in Fragen der Religion« (Isensee, S. 85) und eben deshalb auch gar nicht die religiösen Pflichten tangiert, die im Gewissen begründet sind. So kann die Katholische Kirche ohne Widerspruch zur Anerkennung von Religionsfreiheit im Verhältnis des Einzelnen zum Staat den von ihr erhobenen religiösen Wahrheitsanspruch aufrechterhalten. »Und die Tatsache, dass sie den Pluralismus im politischen Raum ohne Hintergedanken anerkennt, bedeutet nicht, dass 22 F. Nietzsche, Der Antichrist. Fluch auf das Christenthum, 1894, 62., in: ders., Kritische Studienausgabe. Sämtliche Werke, 1988, S. 252.
Vorwort
17
sie die Unbedingtheit ihres eigenen Anspruchs aufgegeben hätte« (Spaemann, S. 23). Heute ist es communis opinio der christlichen Kirchen, »dass der Übergang zu einer aufgeklärten Säkularität der staatlichen Verfassungs- und Rechtsordnung einen Freiheitsgewinn verbürgt, der aus Gründen des Glaubens ebenso zu begrüßen ist wie aus Gründen der verfassungsstaatlichen Überzeugung« (so Wolfgang Huber in seinem Beitrag, S. 113).23 Die staatlich garantierte Religionsfreiheit schafft erst den notwendigen Freiraum für individuelle und kollektive Glaubensbildung und -betätigung, schützt auch und gerade das religiöse Wirken der Kirchen selbst, und ermöglicht ihnen dadurch, »Werkzeug der Erlösung zu sein, die Welt mit dem Wort Gottes zu durchdringen und die Welt in die Einheit der Liebe mit Gott zu verwandeln«24. 5. Es lässt sich »nicht leugnen, dass die soziale Durchsetzungsmacht und die traditionsbildende Kraft der christlichen Kirchen in Europa seit dem Zeitalter der Aufklärung und der Französischen Revolution zurückgegangen sind« (Huber, S. 113). Ist der Rückgang der Bedeutung des Christentums vielleicht gerade dem Umstand geschuldet, dass die christliche Sicht vom Menschen im modernen Verfassungsstaat in säkularisierter Form so sehr und so wirksam politische Gestalt angenommen hat, dass selbst vielen Christen die civitas terrena wie die civitas divina erscheint? Josef Isensee sieht die Gefahr der Selbstsäkularisation der kirchlich verfassten Christenheit und damit einer neuen, aber nicht weniger problematischen Einheit von Staat und christlicher Religion. »Nach einer historischen Phase, in der sie das politische Werk der Aufklärung verworfen, nach einer weiteren Phase, in der sie mit ihm zum Ausgleich gefunden hat, scheint nun die Phase gekommen zu sein, dass sie sich mit ihm identifiziert und in ihm aufgeht, sich damit auf Religion in den Grenzen der Vernunft reduziert, die ihr die Aufklärung seit jeher zugestanden hat« (S. 87). Es könne aber nicht ihr Ziel sein, »in der Aufklärung aufzugehen, sondern sich mit ihr auseinanderzusetzen, sich in ihr zu läutern und anzureichern, letztlich aber durch sie hindurchzugehen, weil sie durch andere Epochen der Kulturgeschichte hindurchgegangen ist« (S. 88). In christlicher, auf Gott ausgerichteter Heilsperspektive kann in der Tat keine säkular bemessene Epoche der Weltgeschichte für sich reklamieren, deren Ende zu sein; das Ende 23 Vgl. auch Kirchenamt der EKD/Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Demokratie braucht Tugenden: Gemeinsames Wort des Rates der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz zur Zukunft unseres demokratischen Gemeinwesens, Gemeinsame Texte 19, 2006, S. 12: »Die Kirchen werden auch in Zukunft für die freiheitliche Demokratie des Grundgesetzes eintreten, weil diese in besonderer Weise dem christlichen Menschenbild entspricht.« 24 So umschreibt Papst Benedikt XVI. in seiner Freiburger Rede vom 25. 9. 2011 (abgedruckt in: J. Erbacher [Hrsg.], Entweltlichung der Kirche? Die Freiburger Rede des Papstes 2012, S, 11, 14) den Auftrag der Kirche.
18
Vorwort
der Weltgeschichte tritt erst mit der Wiederkunft Christi ein, wenn sich die Heilsgeschichte vollendet und das Reich Gottes endgültig und vollständig aufgerichtet wird. Als aufklärerische Zivilreligion verlöre das Christentum sein transzendentes Proprium und der moderne Staat ein gemeinförderliches Widerlager. »Ihr seid das Salz der Erde; wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr« (Matthäus 5,13). Die christlichen Kirchen müssen daher den ihnen gestellten umfassenden Verkündigungsund Sendungsauftrag wahrnehmen, dürfen nicht der Versuchung erliegen, die christliche Botschaft stets jour, d. h. mit dem jeweiligen, die Gesellschaft dominierenden Zeitgeist kompatibel zu halten. »Wenn die Kirchen eine schleichende Politisierung ihrer Glaubenswelt unbesehen mitmachen, dann drohen sie postmoderne Landeskirchen zu werden« (Di Fabio, S. 108). Sie müssen vielmehr aufrütteln und anecken. Mit der »Vorstellung, dass das staatliche Recht zwar vom Christen befolgt wird, aber das weltliche Gesetz ihn nicht von der eigenen Gewissensentscheidung und der eigenen Beurteilung der Welt entbinden kann«, erweist sich das Christentum stets als sperrig, »seit seinen römischen Anfängen« (Di Fabio, S. 107). »Die Kirche leistet dem Verfassungsstaat die wertvollsten Dienste als komplementäre Größe. Deshalb aber muss sie in die pluralistische Gesellschaft ihre meta-aufklärerische Substanz einbringen« (Isensee, S. 89). Eine lebendige Demokratie »braucht Kräfte, die in Freiheit und Unabhängigkeit am gesellschaftlichen Willensbildungsprozess mitwirken und dabei den Sprachlosen eine Stimme verleihen« (W. Huber, S. 124). Vitaler christlicher Glaube und seine unverstellte Artikulation wirkt damit auch der aktuellen Gefahr entgegen, »die Freiheit Schritt für Schritt stärker konformistisch zuzurichten und immer weniger Toleranz für die Abweichung von ideologischen Tageseinsichten zuzulassen« (Di Fabio, S. 107). Die Verkündigung des Evangeliums findet dabei »innerhalb der weltlichen Ordnung und zu ihrem Besten statt. Um ihrer Klarheit willen erfordert sie auch Abgrenzungen gegenüber bestimmten politischen Vorstellungen, Zielen oder Zuständen. Zugleich bleiben die Andersartigkeit der Kirche und das Besondere ihres Auftrags gewahrt« (W. Huber, S. 126). Dies war auch das besondere Anliegen Papst Benedikts XVI., welches er auf den häufig bewusst missverstandenen Begriff der »Entweltlichung« gebracht hat, gegen die Tendenz gewendet, dass »die Kirche sich in dieser Welt einrichtet, selbstgenügsam wird und sich den Maßstäben der Welt angleicht«. »Um ihrem eigentlichen Auftrag zu genügen, muss die Kirche immer wieder die Anstrengung unternehmen, sich von der Weltlichkeit der Welt lösen. Sie folgt damit den Worten Jesu nach: ›Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin‹ (Johannes 17,16). […] Die von ihrer materiellen und politischen Last befreite Kirche kann sich besser und auf
Vorwort
19
wahrhaft christliche Weise der ganzen Welt zuwenden, wirklich weltoffen sein. Sie kann ihre Berufung zum Dienst der Anbetung Gottes und zum Dienst des Nächsten wieder unbefangener leben.«25 6. In seiner Rede vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg vom 8. 10. 198826 hat Papst Johannes Paul II. hellsichtig gemahnt: »Wenn die religiöse und christliche Grundlage dieses Kontinents in ihrer Funktion als inspirierende Quelle der Ethik und in ihrer gesellschaftlichen Wirksamkeit an den Rand gedrängt werden sollte, dann würde nicht nur das gesamte Erbe der europäischen Vergangenheit geleugnet, sondern – mehr noch – wäre eine Zukunft für den europäischen Menschen […] für jeden europäischen Menschen, gläubig oder ungläubig – schwer gefährdet«. Ohne die Kenntnis von diesem Erbe lässt sich in der Tat die Vergangenheit und Gegenwart des abendländischen Europas nicht begreifen, ohne Erneuerung, die dieses Erbe lebendig erhält, die Zukunft nicht gewinnen. Diese Erneuerung aber kann nur gelingen, wenn das Christentum als Religion weiter seine heilbringende Wirkung entfaltet, und dies »nicht nur als Beitrag zu Kulturgeschichte […], die man sich ästhetisch gefallen lässt, sondern […] als ewig strömende Quelle der Kraft, die um Bindung weiß und doch Freiheit gibt«.27 Zu übertriebenen Pessimismus besteht trotz mancher Kassandrarufe kein Anlass. Mit Recht stellt Udo Di Fabio fest: »Wer meint, dass Glaubensfestigkeit erst heute durch einen angeblichen Megatrend der Säkularisierung erschüttert ist, der wird vielleicht doch Opfer eines unhistorischen linearen Fortschrittsdenkens. Ist die Geschichte des Christentums nicht voll Etappen des Niedergangs, der Korruption, der Identitätsbedrohungen? Sie ist doch aber ebenso voll von höchst überraschenden Erholungen, der Wiederkehr ihrer ursprünglichen Botschaft, der erneuten Verbreitung des Glaubens« (S. 108). Um Staat und Gesellschaft in ihrer freiheitlichen Verfassung aus dem Glaubensvollzug im Hier und Heute heraus zukunftsoffen mitgestalten zu können, bedarf es der Orientierung. Man muss sich vergewissern, welche Wegstrecke bereits zurückgelegt ist und an welchem Punkt man gegenwärtig steht. Die nachfolgenden Beiträge, für die ich den Autoren herzlich danke, wollen in diesem Sinne eine Orientierungshilfe geben. Gewidmet sei der Band der Erinnerung an die vor 1700 Jahren geschlossene Mailänder Vereinbarung zwischen den römischen Kaisern Konstantin und Li-
25 Freiburger Rede vom 25. 9. 2011 (Fn. 24). 26 AS 1988, S. 808. 27 Th. Heuss in seiner Rede über »Bindung und Freiheit« vom 6. 1. 1946, abgedruckt in: ders., Aufzeichnungen 1945 – 1947, 1966, S. 164 – 183, 172.
20
Vorwort
cinius vom 13. Juni 313, einem eindrucksvollen frühen Dokument der Gewährung von Religionsfreiheit zur Förderung des gemeinen Wohls. Bonn, im August 2013
Christian Hillgruber
Robert Spaemann
Die christliche Sicht des Politischen
Cicero definiert in seinem Werk »de re publica« den Staat als »res populi« (populus = Volk), aber im Unterschied zu einer beliebigen Menschenmenge als »coetus iuris consensu et utilitatis communione sociatus«. In seinem Buch »de civitate Dei« diskutiert Augustinus diese Definition und bemerkt, wenn sie richtig sei, so sei Rom nie eine res publica gewesen, weil es ohne Verehrung des wahren Gottes keine wahre Gerechtigkeit und für Menschen, die gottlos leben, keinen wirklichen Nutzen geben könne. Da aber das römische Volk doch offensichtlich ein Volk und der römische Staat eine res publica ist, schlägt Augustinus eine wertneutralere Staatsdefinition von »populus est coetus multitudinis rationalis rerum quas diligit concordi communione sociatus« (de civitate Dei 19.24) vor. Diese Definition schließt nur die Tyrannis aus, die nicht »auf einträchtiger Wertschätzung beruht«. Sie lässt jedoch offen, welches die Wertschätzungen eines Volkes sind. Augustinus sagt nur: Je besser sie sind, desto besser ist das Volk, je schlechter sie sind, desto schlechter ist das Volk. Ein Staat kann also eine res publica und trotzdem eine große Räuberbande sein: »Remota iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?« Diese wertneutrale Staatsdefinition ist die Folge einer tiefgreifenden Wandlung in dem für alle Philosophie der Antike so zentralen Begriff des höchsten Gutes. Aristoteles hatte das »bürgerliche« höchste Gut, die Verwirklichung der bürgerlichen Tugend in der Polis, unterschieden von jenem Lebensziel, das eigentlich mehr göttlich als menschlich sei, nämlich der philosophischen Kontemplation des Ewigen, die nur Sache weniger sein könne und auch deren Sache nur zeitweilig. Augustinus dagegen geht davon aus, dass jeder Mensch für die Anschauung Gottes, die ewige Gemeinschaft mit Gott, geschaffen ist und dass die Alternative zur Erreichung dieses Zieles nicht die Bescheidung im bürgerlichen Glück ist, sondern das ewige Verderben. Erreicht wird das Ziel allerdings nicht in diesem Leben und nicht durch philosophische Theorie, sondern nach dem Tode; und nur jene erlangen sie, deren Lebenspraxis in der Nachfolge Christi von der Gottes- und Nächstenliebe – amor Dei usque ad contemptum sui
22
Robert Spaemann
– motiviert war. Daneben gibt es keine andere wahre Gerechtigkeit und keinen anderen wirklichen Nutzen. Da jedoch, wie Augustinus weiß, nicht alle Menschen, ja nicht einmal die meisten, wahre Christen sind, so kann die Ordnung des irdischen Zusammenlebens der Menschen nicht allein gegründet werden auf die Bekehrung der Herzen. Wenn es im Römerbrief (15,4) heißt, der Obrigkeit sei das Schwert gegeben, um die Guten zu belohnen und die Bösen zu bestrafen, so setzt das schon eine Welt der Sünde voraus. Die wirklich »Guten« warten auf Gott selbst als ihren Lohn und fürchten die ewige Entfernung von ihm. Staatliche Sanktionsmittel greifen gewissermaßen bei ihnen nicht. Und dennoch besitzt die staatliche Autorität eine echte Legitimation. Ihr Ursprung wird vielleicht am eindrucksvollsten deutlich in der Geschichte vom ersten Brudermord. Kain, der Brudermörder, fürchtet die Vogelfreiheit: »Wer mich findet, wird mich erschlagen.« Gott aber erklärt: »Wer Kain erschlägt, soll siebenfacher Rache verfallen.« (Gen 4,14 f.) Manche Kirchenväter sahen an dieser Stelle den Ursprung des Staates beschrieben. Hier wird erstmals eine legitime Gewaltandrohung eingesetzt zur Eindämmung privater Gewalt von Menschen gegen Menschen, zum Beispiel gegen Blutrache. Diese legitime Gewalt setzt die Sünde voraus und ist als Beschränkung ihrer Folgen gedacht. Nicht als ob nicht auch das Zusammenleben von Heiligen einer Koordination, also einer Art staatlicher Ordnung bedürfte. Aber diese Koordination hätte nicht den spezifischen Charakter einer mit Sanktionsgewalt ausgestatteten und die Gewalt monopolisierenden Ordnung. Ist für Augustinus auch die politische Ordnung nicht der Ort der Eudaimonia, der eigentlichen Selbstverwirklichung des Menschen, und nicht die wahre Heimat derer, die Gott lieben, so hat sie doch ihre eigene Legitimität, da sie ein Gut sichert, das denen, die Gott über alles lieben, und denen, die sich selbst über alles lieben, gemeinsam ist, nämlich den Frieden: »Pax illis et nobis communis«. Zwar ist der Friede nicht der Friede Christi, sondern der Friede, »wie die Welt ihn gibt«. Er ist nicht jene Harmonie aller Willen, die sich einstellt, wenn Gottes- und Nächstenliebe zur dominierenden Motivation aller Menschen geworden ist. Der weltliche Friede enthält immer das Moment des In-Schach-Haltens der konkurrierenden egoistischen Interessen. Aber auch als solcher wird er von den Christen nicht verachtet. Der politische Friedensbegriff des heiligen Augustinus ist nicht der Minimalbegriff des Hobbes, der nur durch Abwesenheit physischer Tötungsgewalt definiert ist. Er enthält das Moment des wirklichen Konsenses – Concors communio –, der immer einen gewissen gerechten Ausgleich natürlicher und daher nicht beliebig manipulierbarer Interessen voraussetzt. Die christliche Staatslehre des Mittelalters hat durch Aufnahme der antiken Naturrechtstradition diesen Begriff des Friedens als opus iustitiae inhaltlich stärker aufgefüllt und damit die Funktion des Staates aufgewertet: Auch für den Christen sind die Güter, um deren Sicherstellung willen der Staat existiert, nicht
Die christliche Sicht des Politischen
23
bloße Adiaphora. Dass zu diesen Gütern auch subjektive Freiheiten gehören, die die Möglichkeit irrtümlicher oder missbräuchlicher Betätigung einschließen, ist eine Einsicht, die sich erst in der Neuzeit Bahn gebrochen hat. Der Kirche selbst geht es freilich nie primär um das bloße Vermögen der Vernunft, sondern um die Wahrheit, nicht um das bloße Vermögen des Wählenkönnens, sondern um die Wahl des Guten. Und in der Tat kann ja auch kein Staat jede Betätigung eines irrenden Gewissens freigeben. Er wird Witwenverbrennung sogar dann als Mord verfolgen, wenn eine Religion sie gebietet. Wenn dennoch die katholische Kirche sich im II. Vatikanischen Konzil zum Prinzip der Religionsfreiheit bekannt hat, dann deshalb, weil Freiheit zum Wesen eines im tiefsten personalen Gottesverhältnisses gehört und weil eben deshalb Freiheit durch diese Hinordnung auf das »Absolute« schon als solche und unabhängig von ihrer adäquaten Verwirklichung eine unantastbare Würde besitzt. Gleichwohl ist es jene adäquate Verwirklichung, um die es der Kirche im letzten geht. Und die Tatsache, dass sie den Pluralismus im politischen Raum ohne Hintergedanken anerkennt, bedeutet nicht, dass sie die Unbedingtheit ihres eigenen Anspruchs aufgegeben hätte. Sie kann jedoch die ihr anvertraute Botschaft niemals adäquat in eine politische Sprache übersetzen. Das heißt jedoch nicht, dass diese Botschaft politisch folgenlos wäre. Schon die frühchristlichen Apologeten des 2. Jahrhunderts haben die Kaiser, von denen sie verfolgt wurden, darauf hingewiesen, dass sie doch im Grunde die zuverlässigsten Bürger des politischen Gemeinwesens seien, obwohl oder sogar weil sie dessen Totalitätsanspruch unter Gefahr von Leib und Leben zurückwiesen. Das gleiche gilt noch heute für Christen in totalitären Ländern. Zwar sehen die Regierungen dieser Länder in gläubigen Christen stets ihre »geborenen Feinde« oder doch so etwas wie unassimilierbare Fremdkörper, denn das Prinzip »Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen« ist mit dem politischen Totalitätsanspruch unvereinbar. Gläubige Christen sind in keinem Staat zu allem bereit und für alles zu haben. Der Funktionalisierung ihrer Moral sind unüberwindliche Grenzen gesetzt. Innerhalb dieser Grenzen jedoch sind sie sogar in totalitären Staaten, wo immer es um das alltägliche Gemeinwohl geht, verlässlicher als die meisten anderen Untertanen, da ihre Sitten – aus anderen als politischen Quellen gespeist – von der allgemeinen Korruption und dem durch staatlichen Missbrauch bedingten Verfall des Bürgersinns nicht in gleicher Weise betroffen sind. Ihre Verantwortlichkeit für das Gemeinwohl gründet nicht in unbedingter Staatsloyalität, sondern ihre Staatsloyalität in ihrer unbedingten Verantwortlichkeit für das Gemeinwohl. Drei aktuelle Beispiele mögen das christliche Verständnis von Politik kurz erläutern: das Beispiel der Abtreibungsdiskussion, das Beispiel der Diskussion um die sogenannte Befreiungstheologie und als letztes schließlich das Beispiel der Diskussion um Friedenssicherung durch Abschreckung. 1. Der katholischen
24
Robert Spaemann
Kirche wird in der Frage der Abtreibung immer wieder der Vorwurf gemacht, sie versuche durch Einwirkung auf die staatliche Gesetzgebung Andersdenkenden ihre Moralvorstellungen aufzunötigen. Dies versucht sie in der Tat. Sie versucht es auch, wenn sie ihre Stimme gegen die Tötung Geisteskranker oder gegen rassische Diskriminierung erhebt. Auch wer Kindesmissbrauch oder Vergewaltigung mit allen geeigneten Maßnahmen zu verhindern wünscht, sucht Andersdenkenden »seine Moralvorstellungen« aufzunötigen. Und wer für die Abschaffung der Sklaverei eintrat, tat dies ebenfalls. Es ist dies nämlich immer dann legitim, wenn Handlungsweisen zur Diskussion stehen, bei denen andere als der Handelnde selbst betroffen sind und geschädigt werden. Der Schutz des Menschen vor dem Menschen ist die elementarste Aufgabe des Staates, solange nicht universale Brüderlichkeit solchen Schutz überflüssig werden lässt. Wer der Meinung ist, ungeborene Kinder seien keine Menschen, der mag sie für nicht schutzwürdig halten. Aber sogar einmal unterstellt, es sei dies seine ehrliche Überzeugung, so kann ihm doch zugemutet werden zuzugeben, dass jeder, der diese Wesen für Menschen hält, nicht nur verpflichtet ist, deren Leben selbst zu respektieren, sondern auch verpflichtet ist, ihnen beizustehen und ihre Tötung durch andere nach Möglichkeit zu verhindern. Den Christen kann daher billigerweise nicht vorgeworfen werden, sie versuchten die Gewissen anderer in dieser Sache zu vergewaltigen, sondern allenfalls, sie irrten sich hinsichtlich der Menschlichkeit ungeborener Kinder. In diesem Streit allerdings haben die Christen gerade angesichts des Standes heutiger wissenschaftlicher Erkenntnisse die guten Gründe auf ihrer Seite. Und sie berufen sich auf die jedermann zugängliche Vernunfteinsicht, das natürliche Sittengesetz und auf eine evidente Wertrangordnung, nach welcher das Leben eines Menschen nicht der Preis sein darf für das subjektiv größere Wohlbefinden eines anderen Menschen. Aufgrund der gleichen Rangordnung ist es freilich auch ungerechtfertigt, viele Tausende von Verkehrstoten in Kauf zu nehmen als Preis für die Möglichkeit, möglichst schnell Auto fahren zu dürfen. Solche Rangordnungen sind sehr leicht einzusehen, solange nicht interessenbedingte Parteilichkeit den Blick trübt. Wenn vorwiegend Christen sich zu Anwälten des Lebens machen, so nicht deshalb, weil sie diese Einsicht für sich gepachtet hätten, sondern deshalb, weil ihr Glaube an den göttlichen Ursprung der Schöpfungsordnung und ihre daraus folgende spezifische Motivation die einsichtstrübende Parteilichkeit in Schach halten. 2. Der Bereich des Politischen hat mit dem Menschen zu rechnen, wie er ist. Wie ist er? Er ist zum Guten, zur Gerechtigkeit und zur Liebe berufen und prinzipiell frei und somit befähigt, diesem Ruf zu folgen, faktisch aber steht er weithin unter der Herrschaft der Sünde, der eigennützigen Parteilichkeit und der Selbstbehauptung auf Kosten anderer. Politik hat beidem Rechnung zu tragen: Dem Menschen, wie er von Gott angelegt ist; sie darf seine größten und edelsten Möglichkeiten nicht an ihrer Entfaltung hindern. Andererseits muss sie doch
Die christliche Sicht des Politischen
25
auch mit dem Menschen rechnen, wie er faktisch nun einmal ist. Sie darf weder auf radikales Misstrauen noch auf radikales Vertrauen setzen. Sie muss die richtige Mitte zwischen Zynismus und Utopismus finden. Dabei kann man beobachten, dass der radikale Utopismus regelmäßig nach kurzer Zeit in Zynismus oder Resignation umschlägt. Der Fehler bestimmter Formen der sogenannten Befreiungstheologie lag darin, dass sie glaubte, die Befreiung, von der das Evangelium spricht, unmittelbar politisch interpretieren und unmittelbar in politische Aktion umsetzen zu können. Das aber führt ebenso zu schlechter Politik wie zu einer Verkümmerung der spezifisch christlichen Hoffnung. Denn diese hat zum Inhalt die Überwindung von Sünde und Tod: das ewige Leben. Was Politik bestenfalls versprechen kann, ist dagegen immer nur eine gewisse Verbesserung irdischer Lebensbedingungen für die kurze Dauer dieses Lebens. Dieses Ziel – Wohlstand, Gerechtigkeit, Frieden – ist jeder Anstrengung und unter Umständen auch des Kampfes wert. Aber dieser Kampf, der so etwas wie »Befreiung« im Sinne einer fundamentalen Transformation der Conditio humana mit äußeren Mitteln verfolgt, jagt einem illusionären Ziel nach. Diese Transformation, diese Revolution kann nur jeder in sich selbst vollziehen lassen. Sie mit politischen Mitteln bewirken wollen, führt notwendigerweise zur totalitären Politik. Die Utopie, die sich den Glanz des himmlischen Jerusalem borgt – »ubi Lenin, ibi Jerusalem« (Ernst Bloch) –, verliert diesen Glanz spätestens einige Wochen nach der erfolgten Revolution. Und wenn die Kirche die Verheißung, die ihr anvertraut ist, auf die politische Utopie reduzieren würde, dann müsste sie an diesem Tag den Offenbarungseid leisten, indem sie erklärte »Das war’s!« Im Übrigen gilt, dass nach einem Wort Pascals jeder, der die Erde zum Himmel machen will, sie zur Hölle macht. Der »neue Mensch« kann nur durch die im Innersten des Herzens wirkende Gnade geschaffen werden. Wo dies nicht anerkannt wird, kommt es zu nicht endender Gewalttätigkeit. Der Schutz des Menschen vor dem Menschen wird der verordneten Brüderlichkeit geopfert und die Gerechtigkeit dem Ideal der Produktion jenes Überflusses, der Gerechtigkeit nach der Auffassung von Marx schließlich überflüssig machen wird. Befreiung im politischen Sinn kann nur einen Rechtsakt bedeuten, in welchem eine bisher unterprivilegierte Gruppe Gleichberechtigung erlangt. Wo Befreiung als radikale Emanzipation, radikale Verwandlung der Conditio humana verstanden wird, als Emanzipation von der Natur, wird sie theologisch verstanden. Aber wo sie theologisch verstanden wird, wo das Bild des Auszugs aus Ägypten und des himmlischen Jerusalem ins Spiel kommt, da kommt auch das Wort der Schrift »Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich« (Mt 12,30) ins Spiel. Dieses Wort aber macht dadurch, dass es eine für jedermann vollständige Alternative formuliert, einen göttlichen Anspruch geltend. Als politisches Prinzip formuliert ist es unvermeidlich totalitär und muss von Christen zurückgewiesen werden. Legitim ist es nur im Munde Jesu Christi. Und zwar im Singular. Im Plural, also
26
Robert Spaemann
bezogen auf die Jüngergemeinde, sagt derselbe Christus: »Wer nicht gegen uns, der ist für uns.« 3. Von hier aus ergibt sich auch die christliche Sicht auf das Problem des Friedens und der Friedenssicherung. Auch sie kann nur vor dem Hintergrund des Verhältnisses von Sünde und Erlösung verstanden werden. Der Kirche ist das Geheimnis des wahren Friedens anvertraut. Es gibt keine Alternative zu jener Verwandlung der Herzen, die Jesus Christus gelehrt hat. Wahren, verlässlichen Frieden kann es nur in der gemeinsamen Liebe zur Ordnung der Wahrheit geben: opus iustitiae pax. Zwei Alternativen empfehlen sich immer wieder, die utopische und die »realistische«. Die utopische ist von Marx am deutlichsten formuliert worden: Das Endziel der Geschichte ist die Überwindung von Knappheit, eine Entfaltung der Produktivkräfte, die es erlaubt, aufgrund von Überflussproduktion alle Bedürfnisse der Menschen so zu befriedigen, dass es keiner Verteilung und somit auch keiner Verteilungsgerechtigkeit mehr bedarf. Der Gegensatz zwischen »Pleonexia«, Mehr-haben-Wollen einerseits und Gerechtigkeit andererseits verschwindet, weil jeder alles haben kann, was er will, ohne damit einem anderen ins Gehege zu kommen. Sittlichkeit ist nicht mehr erforderlich, denn Sittlichkeit ist ein Produkt von Knappheit, und Knappheit ist überwindbar. Das ökologische Bewusstsein hat inzwischen zur allgemeinen Einsicht geführt, dass diese Sicht nicht stimmt. Wesentliche Ressourcen der Welt sind im Verhältnis zu menschlichen Bedürfnissen immer knapp. Menschliche Bedürfnisse sind nicht instinktiv an die ökologische Nische des Menschen angepasst, sondern wesentlich plastisch und potentiell expansiv. So musste denn auch der Marxismus seiner Utopie den Gedanken des neuen, sozialistischen Menschen hinzufügen. Dieser Mensch soll freilich nicht das Ergebnis einer Bekehrung, sondern der Manipulation durch gewandelte Umstände sein. Auf dem Weg zu dieser Utopie des »Friedens« rechnete der Marxismus indessen mit jeder Art von Gewalt, Terror und Krieg. Inzwischen ist freilich auch die Illusion zerstört, mit der Überwindung des Privateigentums an Produktionsmitteln sei die Ursache für Kriege beseitigt. Der utopischen Perspektive liegt die Meinung zugrunde, der Mensch sei »von Natur« gut, und was den Unfrieden hervorbringe, seien die »Verhältnisse«. Die umgekehrte »realistische« Perspektive hält den Menschen stattdessen für ein prinzipiell nicht zu befriedendes, potentiell stets aggressives Wesen, das durch Mechanismen der Furcht in Schranken gehalten werden kann. Thomas Hobbes hat diesem Gedanken vollendet Ausdruck geschaffen. Es gibt, so schreibt er, kein höchstes Gut, durch dessen Erlangung der Mensch zur Ruhe käme. Der Mensch wird getrieben von Begierde zu Begierde und nur in Schranken gehalten durch die Furcht vor dem größten Übel, dem gewaltsamen Tod. Dieser Furcht entspringt der Staat, und die schlimmsten Feinde des Friedens sind die, welche die Furcht vor der Friedensmacht des Staates mindern durch die Lehre, man müsse
Die christliche Sicht des Politischen
27
Gott mehr gehorchen als den Menschen. Diese Sicht ist, weil auch sie das Wesen des Menschen verkennt, ebenso utopisch wie die »utopische«. Die Mechanismen der Furcht aber, mit denen Staaten nach außen den Frieden zu sichern versuchen, schaffen nur ein prekäres Gleichgewicht des Schreckens. Dieses wirkt nur, solange die Einschätzung und Bewertung der Risiken auf allen Seiten ähnlich sind. Es kann im Übrigen jederzeit durch rüstungstechnische Vorteile einer Seite umkippen. Und so leben wir heute in einer Welt, in der außerhalb des Schattens der Atombombe seit dem Zweiten Weltkrieg schon wieder -zig Millionen Menschen durch Kriegseinwirkung getötet wurden. Der Friede bei uns ist der Bereitschaft zu verdanken, im Falle des Krieges unvorstellbare Verbrechen zu begehen. Dies ist nicht der »wahre Friede«. Und die Kirche wird nicht aufhören, die Bedingungen des wahren Friedens, die Bekehrung der Herzen, zu verkünden. Sie weiß, dass diese Bekehrung ein Geheimnis des Zusammenwirkens von Gnade und Freiheit ist, das keinem menschlichen Zugriff von außen unterliegt. Und sie weiß auch, dass der irdische Friede, der Friede, »wie die Welt ihn gibt«, immer noch besser ist als sein Gegenteil, Krieg und Gewalt. »Vor Pest, Hunger und Krieg bewahre uns, o Herr«, ist eines ihrer alten Gebete. Dieser äußere Friede, diese »pax illis et nobis communis«, ist freilich nicht direkt ihre Sache. Sie kann seine Bedingungen nicht formulieren. Sie kann nicht neben der Lehre Christi noch eine andere Lehre für die Welt parat haben, die der Lehre Christi nicht folgt. Dennoch wird sie alle ermutigen, die in diesem Raum das ihre tun, um den äußeren Frieden zu retten und das Schlimmste zu verhüten. Das II. Vatikanische Konzil hat das System der Abschreckung als ungenügend erklärt: »Wie immer man auch zu dieser Methode der Abschreckung stehen mag – die Menschen sollten überzeug sein, dass der Rüstungswettlauf, zu dem nicht wenige Nationen Zuflucht nehmen, kein sicherer Weg ist, den Frieden zu sichern, und dass das daraus sich ergebende sogenannte Gleichgewicht kein sicherer und wirklicher Friede ist.« (Gaudium et spes 81) Aber es hat nicht gesagt, welche Schritte erforderlich sind, um aus ihm herauszukommen, und es hat ausdrücklich die Forderung nach einseitiger Abrüstung verworfen: »Man soll wirklich mit der Abrüstung beginnen, nicht einseitig, sondern in vertraglich festgelegten gleichen Schritten und mit echten und wirksamen Sicherungen.« (Gaudium et spes 82) Denn einseitige Abrüstung kann unter Umständen vertragliche und kontrollierte Abmachungen gerade verhindern und die Kriegsgefahr sogar erhöhen. Außerdem gilt zwar für den Frieden Christi, dass jeder ihn unabhängig von allen äußeren Umständen jederzeit haben kann, zum äußeren Frieden aber gehören immer zwei. Ein Christ, der nach dem Gebot der Bergpredigt lebt, wird zweifellos eine besondere seelische und geistige Disposition haben, auch dem irdischen Frieden zu dienen, wie es zum Beispiel der heilige Klaus von der Flüe für die Schweiz seinerzeit tat. Er wird frei sein von falschen Ängsten und falschen Hoffnungen.
28
Robert Spaemann
Aber er verfügt nicht über eine »Lösung«, denn eine echte Lösung wäre wiederum nur die Bekehrung der Herzen. Gerade die aber kann er nicht allgemein erzwingen. Und den Staat als irdische Zwangsgewalt gibt es ja gerade deshalb, weil diese Bekehrung nicht unsere allgemeine Wirklichkeit ausmacht. Die Weisung der Bergpredigt, »Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin« (Mt 5,39), ist nicht an Staaten gerichtet. Staaten haben keine Backen. Regierungen aber könnten nur die Backen ihrer Bürger hinhalten. Und das ist es nicht, was die Bergpredigt meint. »Sorgt euch also nicht um morgen« (Mt 6,34) oder »Verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, … dann komm und folge mir nach« (Lk 18,22), kann zwar von der Person des Finanzministers befolgt werden, ist jedoch niemals eine Anweisung für seine Verwaltung der öffentlichen Kassen. Und doch wird etwas vom Geist Jesu Christi auch in dieser Verwaltung durchscheinen, wenn die Verwalter Christen sind. Ebenso wird bei Christen etwas durchscheinen vom Geist Jesu Christi im Verhalten zu armen Ländern wie in der politischen Friedenspraxis, ganz unabhängig davon, welche Friedensstrategie sie für die erfolgversprechendste halten. Das Gebot der Feindesliebe gilt für sie immer und überall. Freilich befiehlt dieses Gebot nicht, sich einzureden, man hätte keine Feinde und man müsste das eigene Land nicht vor potentiellen Feinden schützen. Wenn die Kirche auch nicht neben der Lehre des besten Weges – des »Weges der Wahrheit und des Lebens« – noch über einen alternativen zweitbesten Weg verfügt, sondern diese Suche der Weisheit, Klugheit, Demut und Uneigennützigkeit den Staatslenkern überlassen muss, so muss sie doch auch in diesem Bereich Grenzen bezeichnen, die niemand überschreiten darf, ohne mit dem Kern des Humanen Gottes Gebot zu verletzen Die Kirche kann nie davon absehen, dass es schließlich individuelle Personen sind, die ihre Taten zu verantworten haben, und dass keine Systemtheorie die ethische Dimension aufheben kann. Diese letzte Grenze besteht einerseits darin, dass es niemandem erlaubt ist, sich an einem Krieg aktiv zu beteiligen, dessen Ungerechtigkeit er klar erkannt hat. Und wo diese Ungerechtigkeit für jedermann offenkundig ist, da darf auch die Kirche nicht so tun, als wäre sie außerstande, sie wahrzunehmen. Als »gerechte Sache« kann aber angesichts der Schrecken des modernen Krieges nur noch die pure Verteidigung des eigenen Landes oder die Hilfe bei der Verteidigung eines anderen gelten, nicht aber die Durchsetzung irgendwelcher anderer politischer Ziele, seien sie auch noch so gerecht, also z. B. das Ziel der Durchsetzung des parlamentarischen Systems außerhalb der eigenen Grenzen. Auch bei der gerechten Verteidigung allerdings gibt es eine Grenze. Die unterschiedslose Vernichtung von Zivilbevölkerung, sei es durch Waffen, die dies ihrer Natur nach zur Folge haben, sei es durch massenhafte Anwendung anderer Waffen wie im letzten Weltkrieg, ist niemals gerechtfertigt. Da das gegenwärtige System der Friedenssicherung auf der gegenseitigen Bedrohung mit
Die christliche Sicht des Politischen
29
diesem Verbrechen beruht, und da diese Drohung zumindest auf der Seite der Soldaten die Bereitschaft impliziert, sie im Ernstfall tatsächlich wahrzumachen, ist dieses System von einer tiefen moralischen Paradoxie gekennzeichnet. Nie wurde die Paradoxie des »Friedens, wie die Welt ihn gibt« so deutlich. Auch hier kann die Kirche nur, was den Ernstfall betrifft, ein klares »Non licet« sprechen, ohne deshalb Anweisungen zu geben, wie aus diesem Dilemma eines objektiven Status peccati herauszukommen ist. Die Aufrechterhaltung dieses Status peccati hat sicher auch etwas zu tun mit der mangelnden Bereitschaft einer hedonistischen Gesellschaft, zu ihrer gerechten Selbstverteidigung die nötigen Anstrengungen auf sich zu nehmen. Man verlässt sich lieber auf die bequemere Möglichkeit, gigantische Verbrechen zu begehen. Aber wie gesagt, der Ausweg aus dieser Situation ist wiederum eine Aufgabe politischer Klugheit. Der Arzt, dem während einer Abtreibung die Unmoralität seines Handelns bewusst wird, kann nicht plötzlich das Gerät wegwerfen und Mutter und Kind verbluten lassen. Er muss die Sache lege artis zu Ende bringen. In vergleichbarer Situation befindet sich auch der Politiker, der die Unmoralität der atomaren Abschreckungssituation erkennt. Es sind ihm Grenzen gesetzt, wo seine Verantwortung endet. Zwar ist seine Moral Verantwortungsmoral, aber es gibt nicht so etwas wie Totalverantwortung. Der Mensch ist nicht Herr der Geschichte. Aber der christliche Staatsmann, der es innerhalb dieser Grenzen des Humanen auf sich nimmt, ein Gemeinwesen durch die Paradoxien einer Welt zu steuern, die das nicht anerkennt, wovon sie stündlich lebt, und der mitten in dieser Welt eine Ahnung von dieser Quelle des Lebens wachzuhalten vermag, von dem gilt das Wort des heiligen Thomas von Aquin: »Eminentem obtinebunt coelestis beatitudinis gradum, qui officium regis digne et laudabiliter exequuntur.« (De regimine principium 1,9)
Hans Maier
Christentum und Staat: Modelle des Rechts, Entwicklungsphasen der Geschichte
Von Beginn an steht das Christentum als Religion in einem Verhältnis zum Staat, allgemeiner gesprochen zur politischen Gewalt.1 Modellhafte Formen dieses Verhältnisses haben sich im Lauf der Zeit entwickelt und sind zum Teil bis heute wirksam. Historisch bieten die Beziehungen von Christentum und politischer Gewalt unter verschiedenen Völkern und in wechselnden Epochen ein reiches Anschauungsmaterial. Die Grundmodelle des Verhältnisses von Staat und Religion wirken formend auf die Geschichte ein – die Geschichte wiederum variiert und differenziert die Modelle. Im folgenden sei versucht, diese Grundmodelle in ihren charakteristischen Zügen herauszuarbeiten. Es sind im wesentlichen drei: Symphonia, Zweigewaltenlehre und Trennung (I). Ein Blick auf die Geschichte schließt sich an. Ich beschränke mich auf eine Skizze der Grundkonstellationen, die für die Beziehungen von Christentum und Staat historisch von Bedeutung waren. Im einzelnen werden behandelt: die christliche Relativierung des Politischen in der Spätantike (Augustinus), der mittelalterliche Schritt zur Eigenständigkeit der Kirche (Investiturstreit), die Spannungen, aber auch der Austausch zwischen Christentum und weltlicher Ordnung in der Moderne, endlich das neue, im wesentlichen auf christliche Anstöße zurückgehende Verhältnis von Zeit und Verantwortung im modernen Verfassungsstaat (II).
1 Ich verwende im folgenden den Begriff »Staat« in einem weitgefaßten Sinn, der die anders konturierten angelsächsischen Begriffe »political power« und »Government« einschließt – ungeachtet der Tatsache, dass »Staat« (lo stato) eine spezifisch kontinentaleuropäische Prägung der frühen Neuzeit darstellt.
32
Hans Maier
I.
Grundmodelle des Verhältnisses von Christentum und Staat
1.
Symphonia
»Mein Reich ist nicht von dieser Welt« hatte Jesus gesagt. Jahrhundertelang lebten die Christen nach diesem Grundsatz, waren sie doch in der spätantiken Welt nur eine kleine, auf Duldung der Herrschenden angewiesene Minderheit. Solidarisches In-der-Welt-Sein und geheime Zugehörigkeit zum »Reich in den Himmeln« bestimmten gleichermaßen ihre Existenz – in jener Gleichzeitigkeit, von welcher der frühchristliche Diognetbrief (kurz vor 200) Zeugnis gibt, in dem es heißt: »Sie (die Christen) bewohnen ihre eigenen Heimatländer, aber als Beisassen. Sie nehmen an allem teil als Bürger, und alles ertragen sie als Fremde. Jede Fremde ist ihr Heimatland, und jedes Heimatland eine Fremde (…). Auf Erden weilen sie, aber sie haben ihre Heimat im Himmel.«2 Je mehr jedoch das Christentum sich verbreitete und schließlich zur herrschenden Religion wurde, je mehr die Christen aus ihrer alten Minderheits- und Diasporasituation heraustraten, desto mehr waren sie genötigt, ihr Verhältnis zur Welt genauer zu bestimmen. War ihr Reich tatsächlich nur »in den Himmeln« – oder hatte es einen Platz auch auf Erden? Und wie sah dieser Platz aus? Teilten die Christen ihn gleichrangig mit der weltlichen Gewalt, waren sie ihr gleichgeordnet, vielleicht sogar übergeordnet – oder waren sie ihr umgekehrt eingeordnet, ja möglicherweise untergeordnet? In späteren Begriffen zu sprechen: War die Kirche im Staat, über dem Staat – oder gar unter dem Staat? Diese Fragen – der »theopolitisch« verfassten antiken Welt ganz fremd – sollten in den folgenden Jahrhunderten die geistliche und weltliche Geschichte im christlichen Zeitalter aufs stärkste beeinflussen; um sie entbrannten geistige Auseinandersetzungen, theologische Grundsatzdebatten, aber auch höchst reale öffentliche Konflikte, Kämpfe, Bürgerkriege, Staatenkriege. Die christliche Spätantike hat für diese Fragen eine erste, vorläufige Lösung gefunden, die klassisch in der Vorrede zur VI. Novelle des justinianischen Codex Iuris (535) formuliert ist. Dort heißt es: »Von der höchsten Güte des Himmels sind den Menschen zwei erhabene Gaben zuteil geworden: das Bischofsamt und die Kaisermacht. Das erste dient dem Göttlichen, die zweite hat die oberste Leitung der menschlichen Angelegenheiten. Beide gehen hervor aus dem einen und selben Urquell und sind die Zierde des menschlichen Daseins. Darum liegt den Kaisern nichts so sehr am Herzen als die Ehrfurcht vor dem Bischofsamt, wie umgekehrt die Bischöfe zu immerwährendem Beten für die Kaiser verpflichtet sind. Denn wenn dieser Gebetsdienst makellos und voll Gottvertrauen 2 An Diognet, übersetzt und erklärt von Horacio E. Lona (= Kommentar zu frühchristlichen Apologeten, hrsg. von Norbert Brox u. a., Bd. 8), 2001, S. 151 f.
Modelle des Rechts, Entwicklungsphasen der Geschichte
33
vollzogen wird, wenn umgekehrt die Kaisermacht sich nach Recht und Zuständigkeit der Entfaltung des ihr anvertrauten Staatswesens annimmt dann gibt es einen guten Zusammenklang (Symphona tis agath¦).«3
Die enge wechselseitige Zuordnung von Staat und Kirche, die hier gefordert wird, war ein Erbe der vorchristlichen Zeit. In ihr wirkte die Machtstellung des römischen Gott-Kaisers fort – und ebenso der Gedanke, der Kaiser sei die Quelle des Rechts, das lebende Gesetz (lex animata). Die alte Einheit von Religion und Politik dauerte also auch im christlichen Zeitalter zunächst noch fort.4 Das Christentum wurde 313 durch Konstantin religio licita – nach Jahrhunderten der Rechtsunsicherheit und der Verfolgungen. Unter Theodosius wurde 380 der Glaube nach dem nicäanischen Bekenntnis allen Reichsangehörigen verbindlich vorgeschrieben, 392 wurden alle überlieferten Götterkulte verboten, und in der Gesetzgebung Kaiser Justinians (527 – 565) nahm die Einheit von Reich und Kirche endgültig Form an. Die Symphonia-Lehre bildete das staatskirchliche Fundament der byzantinischen Reichskirche – und später aller orthodoxen Kirchen der Welt. Im Osten wurden die Kaiser die obersten Lenker der Kirche, und nach dem Untergang Ostroms (1453) sahen sich die Zaren in der Nachfolge von Byzanz in dieser Rolle (Moskau, das »Dritte Rom«).5 Wie sah diese Staatskirchen-Einheit im Einzelnen aus? Einmal hatte der Kaiser Anteil an der geistlichen Gewalt, er galt als »Epskopos ton ektûn« (Bischof der Äußeren). Bei kirchlichen Zeremonien trat er in einer Kleidung und mit einer Mitra auf, welche die Pracht der Patriarchen übertraf. Dem Kaiser stand die oberste Definitionsmacht in theologischen Fragen zu. Er regierte daher ständig ins Innere der Kirche hinein. Die Patriarchen wurden nach kaiserlichem Hinweis gewählt und aus ihren Ämtern entlassen. In der Gesetzgebung beschritt man einen doppelten Weg: Konzilsbeschlüsse »waren als Synodalbeschlüsse kirchliches Recht, sie wurden aber noch einmal in kaiserlichen Gesetzen bestätigt und durch staatliche Strafbestimmungen ergänzt.«6 Die Bischöfe erhielten richterliche und verwaltungsmäßige Befugnisse öffentlich-rechtlicher Natur, der höhere Klerus wurde in die byzantinische Aristokratie eingefügt, wo er wichtige Aufgaben, z. B. in der Diplomatie, übernahm. Endlich: Bei Konflikten 3 Corpus Iuris Civilis, ed. Kroll, Berlin 1912, III, S. 35 f. 4 H. Rahner, Kirche und Staat im frühen Christentum, 1961; A. A. T. Ehrhardt, Politische Metaphysik von Solon bis Augustin, Bd. 3: Civitas Dei, 1969; A. Angenendt, Kaiserherrschaft und Königstaufe. Kaiser, Könige und Päpste als geistliche Patrone in der abendländischen Missionsgeschichte, 1984; A. M. Ritter, »Kirche und Staat« im Denken des frühen Christentums, 2005. 5 K. Kostjuk, Der Begriff des Politischen in der russisch-orthodoxen Tradition, 2005 (auch zum Folgenden). 6 F. Winkelmann, Die östlichen Kirchen in der Epoche der christologischen Auseinandersetzungen (5. bis 7. Jahrhundert), 1980, S. 132.
34
Hans Maier
zwischen Kirche und Staat entschied der Kaiser gemeinsam mit dem – von ihm berufenen – Konzil; später entschied der Kaiser allein, da seit 787 im Osten kein ökumenisches Konzil mehr tagte. Diese römische Erbschaft der Einheit von Staat und Kirche hat die östlichen Kirchen aufs stärkste geprägt. Die Symphonia entwickelte sich dort vielfach zu einer Herrschaft des Kaisers über die Kirche – zu dem, was man später, nicht ohne polemischen Unterton, Cäsaropapismus nannte.7 Das römische Erbe war aber auch im Westen wirksam. Der »christliche Kaiser« ist ein Modell nicht nur in der griechischen, sondern auch in der römischen Patristik – man denke nur an das Bild der glücklichen Kaiser Konstantin und Theodosius in Augustins »De civitate Dei«.8 Allerdings gibt es charakteristische Unterschiede. So geht im Westen der Titel Pontifex aus der römischen Überlieferung nicht auf den Kaiser, sondern auf den Papst über. Aus den monarchischen Überlieferungen verschwinden im Lauf der Zeit die Reste des spätantiken Gottkönigtums. So wird das Kaisertum in den Krönungsordines der deutschen Könige und Kaiser zu einem Amtscharisma und büßt seine numinosen Qualitäten ein. Daher gibt es »Könige als Wundertäter«, Herrscher als Träger einer übernatürlichen Kraft, im europäischen Mittelalter und in der Neuzeit nur noch im Frankreich und England.9 Immerhin existiert im Deutschen Reich eine Reichskirche mit Bischöfen, die zugleich weltliche Regenten sind; der Kaiser wird von der Kirche gesalbt, er ist als Schutzherr der Kirche (Patronus Ecclesiae) der Christenheit gegenüber verantwortlich. Es gibt auch Parallelen zum Gleichlauf kirchlicher und weltlicher Gesetze im Osten; der Kaiser investiert die Bischöfe, er besitzt bei kirchlichstaatlichen Konflikten de facto eine Schiedsrichterstellung (Einberufung von Konzilien, Einwirkung auf Papstwahlen usw.). Man kann diese Nachwirkung spätrömischer Modelle bis in die Neuzeit hinein verfolgen: Das System der Staatskirchenhoheit, die vom modernen Staat erstrebte Souveränität über die Kirche, ist dafür ebenso ein Beispiel wie der Versuch der Kirche, ihrerseits eigene Privilegien durch Anschluss an den Staat zu befestigen. In Ländern katholischer Tradition erstrebte man für die eigene Konfession den Status einer Staatskirche oder Staatsreligion; die letzten Gebilde dieser Art (in Spanien, Italien und Lateinamerika) sind erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 – 65) endgültig beseitigt worden. In der protestantischen Welt gibt es auch heute noch »staatlich privilegierte Volkskirchen«, so in einzelnen skandinavischen Ländern, in England und in Schottland, wenn sie auch inzwischen ihre frühere Exklusivität verloren haben, der Staat auch andere 7 J.-M. Sansterre, EusÀbe de C¦sar¦e et la naissance de la th¦orie »c¦saropapiste«, in: Byzantion 42 (1972), S. 131 – 195 und 532 – 594. 8 Augustinus, De civitate Dei V, 25, 26. 9 M. Bloch, Les Rois thaumaturges. ðtude sur le caractÀre surnaturel attribu¦ la puissance royale particuliÀrement en France et en Angleterre, 1923 u. ö.
Modelle des Rechts, Entwicklungsphasen der Geschichte
35
Religionen anerkennt und sich zur Religionsfreiheit bekennt. Die protestantischen Staatskirchen sind – zusammen mit den orthodoxen Kirchen – die letzten geschichtlichen Ausläufer einer Kirche und Staat gemeinsam umfassenden Einheit, die ihren Ursprung in den antiken theopolitischen Ordnungen und ihren christlichen Fortsetzungen im Mittelalter und in der Neuzeit hat. So wirken Überlieferungen der Symphonia auch im Westen nach. Sie führen hier freilich nie zu einer dauerhaften, endgültigen Prägung der staatskirchlichen Verhältnisse. Ganz in Gegenteil: Früh zeigen sich im Westen Tendenzen zur Verselbständigung der Kirche, zur Emanzipation der geistlichen Gewalt vom Staat. Dabei bildet sich – bei gleichen Ausgangspunkten – ein neues Modell des Staat-Kirche-Verhältnisses heraus: die Lehre von den Zwei Gewalten Staat und Kirche. Diese Gewalten stehen zwar »im Rapport« zueinander, sind jedoch keineswegs zum strikten »Gleichklang« (Symphonia) verpflichtet; und ihre Beziehungen werden nicht durch Über- und Unterordnung, sondern durch freie vertragliche Abmachungen bestimmt.
2.
Zweigewaltenlehre
Diese Entwicklung zu kirchlicher Selbständigkeit und Autonomie setzt schon früh, in spätrömischen Zeiten, ein. Berühmt ist der Konflikt zwischen dem Mailänder Bischof Ambrosius und dem machtbewussten Kaiser Theodosius. Als dieser im Jahr 390 mit einer Kollektivstrafe gegen die Bevölkerung in Thessalonike vorging (sie hatte einen missliebigen kaiserlichen Offizier ermordet), verlangte Ambrosius vom Kaiser die Rücknahme des Befehls und eine Kirchenbuße. Theodosius gehorchte widerwillig. Damit bildeten sich neue Grundsätze für das Verhältnis von Kaiser und Kirche heraus: Der Kaiser steht in der Kirche, nicht über der Kirche; der Kaiser ist ein Sohn der Kirche, nicht ein Bischof der Kirche. Kein Laie – und auch der Kaiser ist ein Laie! – kann kirchliche Rechte für sich beanspruchen. Auch der Mächtige muss sich den sittlichen Forderungen der Kirche beugen, und er muss, wenn er sie verletzt, in aller Öffentlichkeit Kirchenbuße tun.10 Am klarsten ist dieser Grundsatz von Papst Gelasius I. in einem Brief an Kaiser Anastasius I. im Jahr 494 formuliert worden: »Zwei sind es, erhabener Kaiser, von denen hauptsächlich diese Welt gelenkt wird: die geheiligte Autorität der Priester und die königliche Gewalt. Unter ihnen ist das Gewicht der Priester
10 Ambrosius, Brief 51 an Kaiser Theodosius, und Theodoret, Kirchengeschichte V, 17, 18, zitiert bei H. Rahner (Fn. 4), S. 184 – 201.
36
Hans Maier
um so schwerer, als sie sogar für die Könige der Menschen im göttlichen Gerichte Rechenschaft ablegen werden.«11 Das sind fast die selben Worte wie in den oben angeführten, fast ein Halbjahrhundert später formulierten justinianischen Maximen. Theoretisch ist der Ausgangspunkt für das Nachdenken über das Verhältnis des Christentums zum Staat also im Westen zunächst derselbe wie im Osten. Zwei Gewalten stehen einander gegenüber ; die antike Einheit von Religion und Politik ist aufgelöst; sie wird durch den christlichen Dualismus von Herrschern und Priestern relativiert. Während aber im Osten der praktische Umgang der zwei Gewalten miteinander zu einer Vorherrschaft des Kaisers führt bei immer deutlicher schwindender Selbständigkeit der Kirche, setzen sich im Westen jene Kräfte durch, die auf eine umfassende Freiheit und Selbständigkeit der Kirche, eine Libertas Ecclesiae abzielen. Offen bleibt in diesem Prozess nur, wie weit die Rechte der von der politischen Gewalt emanzipierten geistlichen Gewalt gegenüber den – ihrerseits von der Kirchen »veramtlichten« – Herrschern gehen. Den geschichtlichen Durchbruch bildet der Investiturstreit. Das neue Modell des Staat-Kirche-Verhältnisses, das sich in ihm herausbildet, unterscheidet sich grundsätzlich von dem des Ostens. Im Investiturstreit erreichen die Bestrebungen des Reformpapsttums ihren Höhepunkt. Nachdem schon früher die Simonie beseitigt und der Priesterzölibat befestigt worden war, ging es jetzt um die jahrhundertealte Übung einer Einsetzung der Bischöfe (teilweise auch der Priester) durch weltliche Gewalten. Die Kirche als zentrale christliche Institution beanspruchte, Herrin im eigenen Haus zu werden, sie wollte sich nicht mehr damit abfinden, dass Nicht-Geweihte über Geweihte entschieden. Sie wollte, modern gesprochen, autonom sein – Kirche, und nicht einfach ein Anhängsel des Staates. Das leuchtet heute ohne weiteres ein – bildet doch die Autonomie des geistlichen Bereichs das charakteristische Merkmal, durch das sich Europa (und die westliche Welt im Ganzen!) bis heute von Gottesstaaten und Sakralreichen, von Tendenzen zur Vergeistlichung der Politik (und zur Politisierung der Religionen) unterscheiden. Dass Politik am geistlichen Bereich endet, dass sie das Religiöse nicht mitumfasst und einschließt, ist uns seit langem selbstverständlich geworden. Insofern steht der Investiturstreit, steht Gregor VII. mit Canossa am Anfang dessen, was wir den Dualismus des Geistlichen und Weltlichen, die Dualität von Staats- und Gewissenssphäre nennen.12 Der mittelalterliche Papst hat hier eine Entwicklung vorangetrieben, die ältere Wurzeln hat und die über 11 H. Rahner (Fn. 4), S. 254 – 263 (256 f.). 12 Guter Überblick über den aktuellen Forschungsstand in: Canossa 1077. Erschütterung der Welt. Geschichte, Kunst und Kultur am Aufgang der Romanik, Bd. I (Essays), hrsg. von Christoph Stiegemann und Matthias Wemhoff, 2006.
Modelle des Rechts, Entwicklungsphasen der Geschichte
37
Gelasius und Augustin bis ins Neue Testament zurückreicht: »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist« (Mk 12, 13 – 17). Das Ergebnis war neu und ungewohnt. In der einen Christenheit existierten nun zwei rechtlich selbständige Gebilde: Kirche und Staat, Gebilde, die miteinander rivalisieren und kämpfen, aber auch verhandeln und Verträge schließen konnten. Entscheidend war, dass sie »im Rapport« miteinander standen. In den Konkordaten von Westminster und Troyes (1107) und im Wormser Konkordat vom 1122 – den ersten Konkordaten der Weltgeschichte – wurde ein Modell erprobt, das sich von da an für Jahrhunderte behaupten und bewähren sollte: Staat und Kirche im Verhältnis des Vertrags, auf gleicher Höhe miteinander sprechend und verhandelnd, gemeinsame Probleme in »gemischten Zonen« schiedlich-friedlich regelnd, beiderseits grundsätzlich auf Vereinnahmung des anderen verzichtend. Das war eine zukunftsträchtige Form der Freiheit und des Ausgleichs – gleichweit entfernt vom Cäsaropapismus des Ostens, wo der Kaiser der Kirche die Regeln vorgab, wie auch von einer päpstlichen Theokratie, die zwar einzelnen machtvollen Inhabern des Heiligen Stuhls als Leitbild vorschweben mochte, die jedoch als Alternative zum Gewalten-Dualismus von Staat und Kirche nie eine ernsthafte Chance hatte und de facto auch bald aus der europäischen Geschichte verschwand.13
3.
Trennung
Der dritte Typus, der sich im Verhältnis von Christentum und Staat herausbildet, die Trennung, hat sich (erst) in der Neuzeit entwickelt. Sie tritt prototypisch in drei aufeinander folgenden Formen auf: der amerikanischen, französischen und (sowjet)russischen. Die amerikanische Form der Trennung14 bildet eher ein Vorspiel zu den beiden jüngeren Formen. Man kann sie als ein Mittelding zwischen der ZweiGewalten-Ordnung und den späteren radikalen Trennungssystemen betrachten. Sie will die Kirchen nicht unterdrücken, sondern im Gegenteil ihre Freiheit sichern: den R¦fugi¦s der europäischen Religionskriege – aus ihnen sind ja die Vereinigten Staaten geschichtlich hervorgegangen – soll Sicherheit geboten werden, dass nicht irgendeine Religion, die zu gesellschaftlicher Macht gelangt 13 Schon Gregor VII. scheiterte mit weitergreifenden Plänen einer päpstlichen Suprematie, erst recht Bonifaz VIII., der in seiner Bulle »Clericis laicos (1296) die Besteuerung der Kleriker durch weltliche Behörden in Frage stellte, damit aber den Einspruch französischer Juristen provozierte – mit ersten, die Neuzeit vorwegnehmenden Proklamationen des säkularen staatlichen Rechts. 14 Sie ist – nach dem Vorgang mehrerer Einzelstaaten – 1790 im ersten Amendment der Verfassung für den Bund formuliert worden (no-establishment-clause).
38
Hans Maier
ist, den Staat erobern und mit seiner Hilfe die anderen unterdrücken kann. Die Trennung sichert hier mit Hilfe des Verbots einer Staatskirche die Pluralität der religiösen Bekenntnisse; sie hält den Staat außerhalb der Sphäre religiöser Konflikte, statt ihn – wie im europäischen Absolutismus – im Konfliktfall zum Zwangsschlichter der streitenden Bekenntnisse zu machen. Die französische Form der Trennung15 geht im Gegensatz zur amerikanischen nicht von der Inkompetenz des Staates in puncto Religion aus, sondern von seiner Allzuständigkeit. Dementsprechend nimmt der Staat der Kirche nicht nur ihren bisherigen öffentlichen Status, sondern versucht auch, ihr die künftige innere Verfassung bindend vorzuschreiben: in der Revolution durch die Zivilverfassung des Klerus, in den Trennungsgesetzen von 1905 durch das Gebot privatrechtlicher Neuorganisation in Gestalt der associations cultuelles.16 Obwohl dies in beiden Fällen misslingt und die rigorose Form der Trennung im Lauf des 20. Jahrhunderts schrittweise abgemildert wird, begreift sich der Staat der Vierten und Fünften Republik ausdrücklich als Êtat lac und lehnt einen – wie immer gearteten – »Rapport« mit der Kirche ausdrücklich ab. Noch weiter ging die (sowjet)russische Form der Trennung im Gefolge der Oktoberrevolution: hier ist die Trennung ausgesprochenermaßen ein Mittel zur Unterdrückung der Kirche.17 Die Kirche kann hier auch nicht in eine grundrechtlich gesicherte Bekenntnisfreiheit oder in einen sozialen Dienst an der Gesellschaft ausweichen, weil es eine solche Sphäre der Eigenständigkeit in einem totalitären Staat nicht gibt. Welche Zukunft haben die verschiedenen Trennungssysteme? Gehört der Trennung von Staat und Kirche in den modernen Demokratien die Zukunft, wie 1926 ein Gelehrter vom Rang Zaccaria Giacomettis meinte?18 Das ist heute keineswegs so sicher, wie es damals, in der Zwischenkriegszeit, erschien. Einmal ist der Hinweis auf die statistische Zunahme der Trennungssysteme angesichts ihrer Pluralität nicht zwingend: Es gibt, wie man in Frankreich zu sagen pflegt, 15 In der Französischen Revolution seit 1790 sich anbahnend, de facto vollzogen 1795, endgültig verfügt in den Trennungsgesetzen von 1905. 16 T. Tackett, Religion, Revolution and Regional Culture in Eighteenth.Century France: The Ecclesiastical Oath of 1791, 1985; E. M. Accomb, The French Laic Laws, 1941; A. Dansette, Histoire religieuse de la France contemporaine, 2 tom., 1948/1951. 17 So heißt es in einer offiziellen Erklärung der KPdSU von 1933: »Es ist notwendig zu betonen, dass das Dekret über die Trennung der Kirche vom Staat und der Schule von der Kirche von Anfang an gegen die Religion gerichtet war. Die sowjetische Regierung hat nie eine zweideutige Politik der gleichstarken Mitarbeit mit der Religion und dem Atheismus geführt. Während (daher) die Trennung von Kirche und Staat beim Kapitalismus zu freier und höchst intensiver Entwicklung der Religion führt, erreicht sie beim Kommunismus den freien und endgültigen Tod der Religion.« Vgl. R. Pipes, Die Russische Revolution, Bd. 3: Russland unter dem neuen Regime, 1993, S. 545 – 593. 18 A. Frh. v. Campenhausen, Staat und Kirche in Frankreich, 1962; M. Albert, Die katholische Kirche in Frankreich in der Vierten und Fünften Republik, 1999.
Modelle des Rechts, Entwicklungsphasen der Geschichte
39
freundschaftliche Trennungen und stürmische Konkordate. Sodann hat die Übersteigerung der antikirchlichen Dynamik des Trennungsgedankens in den modernen Totalitarismen einen Rückschlag des Pendels herbeigeführt und die radikalen Formen der Trennung innerhalb des westlichen Staatenkreises – nach 1989/90 auch in der postkommunistischen Welt – entschärft, teilweise sogar abgebaut. Am deutlichsten ist das in Frankreich. Den Trennungsgesetzen von 1905 lag eine positivistische Vorstellung von Kirche und Staat zugrunde. Man sah in beiden reinlich zu scheidende, mit juristischen Mitteln trennbare Sozialkörper. Die vom Staat einseitig verfügte privatrechtliche Organisation der Kirche scheiterte freilich am Widerstand der Bischöfe. Weitere Bestimmungen bezüglich der Kultgebäude, der Kultuspolizei und der kirchlichen Organisationsgrundsätze sind durch die Rechtsprechung des Conseil d’Êtat entschärft bzw ad absurdum geführt worden. Nach dem Ersten Weltkrieg vollzog sich dann Schritt um Schritt eine Wiederannäherung von Staat und Kirche, beginnend mit der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zum Heiligen Stuhl (1920) über die Einführung einer politischen Klausel bei Bischofsernennungen (1920) bis hin zur Bildung von Diözesanvereinen zur Organisation des kirchlichen Vermögens (1923). Das hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt und umfasste Zug um Zug auch die heiklen Bereiche der Schulpolitik, des Rundfunkwesens und der (auswärtigen!) Militärseelsorge.19 Nimmt man hinzu, dass die Trennungssysteme des Ostens nach 1989/90 mit wenigen Ausnahmen untergegangen sind und im Bereich der Orthodoxie sich gleichfalls eine Annäherung von Staat und Kirche vollzogen hat,20 so wird man sagen können, dass die Möglichkeiten sowohl der Staatskircheneinheit (Symphonia) wie der Trennung inzwischen historisch »ausgelotet« sind. Dagegen steht die Zweigewaltenlehre möglicherweise erst am Anfang ihrer geschichtlichen Wirkung. Im posttotalitären Zeitalter suchen viele Kräfte nach einem geregelten, berechenbaren »Rapport« von Kirche und Staat – ohne die Selbständigkeit beider anzutasten und die Spielräume von Religionsfreiheit und Toleranz einzuschränken.
19 A. Frh. v. Campenhausen, Staat und Kirche in Frankreich, 1962; M. Albert, Die katholische Kirche in Frankreich in der Vierten und Fünften Republik, 1999. 20 G. Albert/J. Oeldemann (Hrsg.), Renovabis faciem terrae. Kirchliches Leben in Mittel- und Osteuropa an der Jahrtausendwende, 2000; K. Nikolakopoulos u. a. (Hrsg.), Orthodoxe Theologie zwischen Ost und West (FS Theodor Nikolaou), 2002; R. Uertz/L. P. Schmidt (Hrsg.), Beginn einer neuen Ära? Die Sozialdoktrin der Russisch-Orthodoxen Kirche vom August 2000 im interkulturellen Dialog, 2004; Th. Nikolaou, Die Orthodoxe Kirche im Spannungsfeld von Kultur, Nation und Religion, 2005.
40
Hans Maier
II.
Historische Konstellationen
1.
Die Reduktion politischer Macht im christlichen Denken der Spätantike
Das Christentum tritt hervor in einer Welt, die durch die Pax Romana universell befriedet ist. Das hat zweifellos zu seiner erstaunlich raschen Verbreitung im antiken Leben beigetragen. Doch der römische Staat stellt das Christentum auch auf die erste große Bewährungsprobe seiner Geschichte: den Christen tritt im Kaiserkult eine universelle »politische Religion« entgegen, die von ihnen Anerkennung und Unterwerfung verlangt. Bereits auf der Höhe der augusteischen Epoche wird das goldene Zeitalter ausgerufen: die Götter sollen für immer versöhnt, der Friede soll auf ewige Zeiten gesichert werden. Eine politische Eschatologie breitet sich aus in der gesamten von Rom beherrschten Welt, mit verschiedenen Akzenten in West und Ost, aber mit gleichem universellem Anspruch: Während der Kaiser in Rom als princeps auctoritate regiert, wird er in der östlichen Reichshälfte als Gottheit verehrt, zu der man um die Fortdauer des Friedens betet.21 Der römische Staat war der Erbfolger der griechischen Polis-Idee. Er hatte diese Idee ins Ökumenische erweitert, indem er das Bürgerrecht der Stadt ausgeweitet hatte zu einem römischen Weltbürgerrecht; er hatte zugleich die alte Polis-Einheit von Kult und Politik erneuert und sie zum zwingenden Gesetz des Reiches gemacht. In der Verehrung des römischen Kaisers gipfelte der Kult der Götter. An diesem Punkt, dem Kaiseropfer, entbrannte der Streit mit dem jungen Christentum. Es ging dabei nicht sehr um Glaubensinhalte, die in einer Zeit des Synkretismus fast austauschbar geworden waren, es ging um den cultus Deorum, um den Anspruch der Polis, Kirche ihrer eigenen Religion zu sein. Die Haltung der frühen Christenheit zu Kaiser, Obrigkeit, politischer Gewalt ist, wie bekannt, nicht auf eine einfache Formel zu bringen. Quietistische Bescheidung, duldender Gehorsam finden sich in den Zeugnissen ebenso wie die herausfordernde These »Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen« (Apg 5, 29) – Vorbote jahrhundertelanger Kämpfe zwischen christlicher Kirche und weltlichem Regiment. Als Kontinuum in den wechselnden Situationen der Zeit treten zwei Züge hervor: Die Christen gehorchen, apostolischer Weisung folgend, der Obrigkeit22 und sie beten – selbst in Verfolgungszeiten und unge-
21 A. A. T. Ehrhard (Fn. 4). 22 O. Cullmann, Der Staat im Neuen Testament, 1956, 2. Aufl. 1961; J. Gnilka, Die frühen Christen. Ursprünge und Anfang der Kirche, 1999; Ch. Markschies, Das antike Christentum, 2006; P. Veyne, Quand notre monde est devenu chr¦tien, 2007 (dt. unter dem Titel Als unsere Welt christlich wurde, 2008).
Modelle des Rechts, Entwicklungsphasen der Geschichte
41
achtet ihrer entschiedenen Ablehnung des Kaiseropfers – für den Kaiser und das Heil des Reiches.23 Freilich, wem gehorchen sie, für wen beten sie? Sie gehorchen einer Obrigkeit, die unter Gottes Gericht steht; und sie beten für einen Kaiser, der ein Herrscher ist, nicht ein Gott. Wo Obrigkeit ist, da ist sie im christlichen Verständnis von Gott verordnet. Wo ein Kaiser herrscht, da hat er keine Macht, es sei denn, sie wäre ihm von oben gegeben. So ist aller Gehorsam eingebettet in eine fundamentale Reduktion weltlicher Macht: Kein irdischer Herrscher kann sich post Christum natum noch absolut setzen, keiner kann die Geschichte ans Ende bringen, die Götter versöhnen, den Weltfrieden ausrufen. Mit Christi Inkarnation und Opfertod ist »die Zeit erfüllt«, der Bann irdisch-geschichtlicher Macht gebrochen. Alle Mächte und Gewalten werden durch Christus »zur Schau gestellt« und ihres dämonischen Charakters entkleidet. Dämonisch ist nach christlicher Lehre, »was sich Gott nennt, ohne es zu sein«.24 Kaiser und Reich, Staat und Herrscher werden zu Dämonen, wenn sie göttliche Allmacht für sich beanspruchen. Diesem Anspruch darf, ja muss der Christ widerstehen, denn er weiß, dass er auf Usurpation beruht und daher nichtig ist; er durchschaut die Faszination des Scheingöttlichen als eitles Blendwerk, als Maskerade, als pompa diaboli. Damit aber sind Staat und Politik etwas anderes, als sie bis dahin waren – sie enthüllen sich in einem radikalen Sinn als menschliche Schöpfung. Das Politische ist nichts Göttliches. Es wird zu sich selbst, zu seinen irdischen Zwecken, befreit. Seine eigene, nicht mehr mit Religion und Kult verwobene Geschichte beginnt. In mancher Hinsicht beginnt sie erst jetzt. Es ist Augustinus, der am Römischen Staat die christliche Reduktion des Politischen vollzieht. Er löst das christliche Denken aus der Verbindung mit dem politischen Rom. Die Christen sollen irdischen Reichen, wenn sie vergehen, keine Träne nachweinen, da sie ein anderes, ein höheres, himmlisches Reich erwarten. Die eschatologische Botschaft des Christentums, die verdunkelt schien, wird in ihrer ganzen Strenge wiederhergestellt.25 Gegenüber der Rom- und Reichsbegeisterung älterer christlicher Autoren wie Lactanz und Eusebius waltet bei Augustinus in Bezug auf den Staat ein kritischer, ja rauer und schroffer Ton. Er steigert sich nicht selten zu richterlicher Strenge. Nicht nur der Kaiser, auch der Staat hat für Augustinus keinerlei Anspruch auf kultische Verehrung, er genießt keinen Vertrauensvorschuss; vielmehr hat er sich vor den Menschen erst kraft seiner Dienst- und Hilfsfunktion zu rechtfer23 H. Rahner (Fn. 4); H. U. Instinsky, Die alte Kirche und das Heil des Staates, 1963. 24 W. Kasper, Die Lehre der Kirche vom Bösen, in: Stimmen der Zeit 196 (1978), S. 507 ff. (511 f.). 25 Zum Folgenden: H. Maier, Augustins Civitates und die Welt von heute, in: P. Gordan (Hrsg.), Säkulare Welt und Reich Gottes (Salzburger Hochschulwochen 1987), 1988, S. 11 – 27.
42
Hans Maier
tigen und zu bewähren. Hier schwingen antik-kosmopolitische, ins Christliche transponierte Stimmungen mit: »Was verschlägt es, unter welcher Herrschaft der Mensch lebt, der doch sterben muss, wenn ihn nur die Machthaber nicht zu Gottlosigkeit und Unrecht nötigen.«26 Es wundert nicht, dass Augustinus zwar nicht den Kriegsdienst, aber doch die Kriege, sofern sie nicht zur Rechtsverteidigung gegen Rechtsbrecher geführt werden, und den Kriegsruhm ablehnt und dass er im Weltstaat jedenfalls nicht die oberste Stufe der Daseinsordnung sieht, sondern ihn, wie alles Irdische, sub specie aeternitatis relativiert: »Die ersten seien dir Vater und Mutter ; höher als selbst die Eltern soll dir das Vaterland stehen; was die Eltern gegen das Vaterland befehlen, darauf soll man nicht hören, oder was das Vaterland gegen Gott befiehlt, auch darauf soll man nicht hören.«27 Klar und unmissverständlich wird der Staat aus dem Rechtszweck gerechtfertigt und zugleich auf ihn beschränkt; es sind berühmte Worte: »Was sind Reiche ohne Gerechtigkeit anderes als große Räuberbanden? Sind doch auch Räuberbanden nichts anderes als kleine Reiche! Denn es sind Menschengruppen, geleitet vom Willen eines Führers, die durch einen Gesellschaftsvertrag zusammengehalten werden und die Beute nach vereinbartem Gesetz verteilen. Wächst eine solche üble Bande durch den Beitritt verworfener Menschen derart an, dass sie Gebiete besetzt, Niederlassungen gründet, Staaten erobert, dann legt sie sich ganz unverhüllt den Namen Reich bei…Darum war die Antwort fein und wahr, die ein Seeräuber jenem großen Alexander gab, als der König fragte, wie er denn dazu käme, das Meer unsicher zu machen. Da sagte der Mann mit freimütigem Stolz: Und wie kommst du dazu, den Erdkreis unsicher zu machen? Ich freilich mit meinem winzigen Schiff werde Räuber genannt, aber dich mit der großen Flotte nennen sie den siegreichen Feldherrn.«28
2.
Die mittelalterliche Spannung: Kirche und weltliche Ordnung auf dem Weg zur Eigenständigkeit
Ist das frühe Christentum eine Zeit der Purgierung, des kirchlichen Exorzismus am selbstbezogenen, den Dämonen verhafteten Staat, so zeigen die folgenden Jahrhunderte ein anderes Gesicht. Die Bewegungsrichtung ändert sich: der Dienst der Kirche am Staat ist jetzt kein negativer, begrenzender, reduzierender mehr (zumindest nicht mehr in erster Linie) – er nimmt vielmehr positive, modellhafte, exemplarische Züge an. So dringt die Kirche seit der Zeit der Völkerwanderung immer stärker in die entleerten staatlichen Bereiche ein. 26 De civitate Dei V, 17. 27 Sermo 62. 28 De civitate Dei IV, 4.
Modelle des Rechts, Entwicklungsphasen der Geschichte
43
Kirchliche Dienste entwickeln sich, die weit ins Staatliche (in unserem heutigen Verständnis) hineinreichen. Mit dem Christlich-Werden ganzer Völker wächst die Kirche im Abendland aus ihrer alten Minderheits- und Diasporasituation heraus. Kirche und Staat beginnen die Menschen eines bestimmten Raumes gemeinsam zu umfassen. Eine Identifikation der Kirche mit der politischen Gemeinschaft des Volkes wird möglich. Staat und Kirche bilden konzentrische Kreise, der Staat wird zum erweiterten Leib des Kirchenvolkes. Alles, was wir »Volkskirche« nennen, nimmt seinen Anfang aus dieser Zeit. So versteht man, dass sich im Schoß der Kirche im Mittelalter eine Vielzahl von Tätigkeiten entwickeln, die wir heute eher dem Staat zuschreiben würden: das Personenstandswesen, beginnend mit den Taufbüchern, die Sorge für Arme und Kranke, Einrichtungen der Erziehung, Bildung, Wissenschaft. Das sind keine Usurpationen. Dem Staat – der noch kaum existiert – wird nichts weggenommen. Vielmehr entstehen diese Tätigkeiten aus dem bewussten Eingehen der Kirche auf die Welt. Sie stehen im Dienst der christlichen Ordnung des Lebens. So der Personenstand: der einzelne wird in seiner Individualität erkannt, er erhält einen unverwechselbaren Namen.29 So Erziehung und Bildung: die Ausbreitung christlicher Lehren ist nicht möglich ohne ein bescheidenes Fundament des Hörens und Verstehens, das allen gemeinsam ist. So das Armenund Krankenwesen: in einer christlichen Umgebung darf niemand ins Leere fallen.30 Hier sind Elemente moderner Staatstätigkeiten vorgeprägt. Das fürstliche Gebotsrecht und die Ordnungen der »guten Policey« orientieren sich später an diesem Kanon des christlichen Lebens. Es dauert noch lange, bis die christlichen Exempla durch eine gesellschaftliche Nützlichkeitsmoral ersetzt werden. Christliche Direktiven des Staatslebens sind in Europa bis an die Schwelle der modernen Revolutionen wirksam. Sehen wir hier eine enge Beziehung, eine konstantinische Nähe von Kirche und Staat, so ist das Mittelalter doch ebenso unzweifelhaft auch eine Zeit, in der Kirche und Staat sich voneinander sondern und differenzieren, in der man sich langsam, oft widerstrebend, bewusst wird, dass die eine Christenheit, in der man ganz selbstverständlich lebt, aus zwei Teilen zusammengesetzt ist, nämlich aus 29 Das englische »Christian name« (für Vorname drückt das bis heute anschaulich aus – wie auch in den angelsächsischen und skandinavischen Ländern die Zeugnisse mittelalterlicher, den Staat umfassender kirchlicher Verwaltung am deutlichsten erhalten geblieben sind: die Beteiligung der Kirche an der Führung der Standesregister, kirchliche Eheschließungen mit bürgerlicher Wirkung, sozialstaatliche Prüfungsrechte der Geistlichen usw. 30 Die Armen- und Krankenpflege im vorchristlichen Altertum reichte zwar über individuelle Wohltätigkeit hinaus, verfestigte sich aber nirgends in dauerhaften Institutionen (Krankenhäusern, Sozialstationen); vgl. A. R. Hands, Charities and Social Aid in Greece and Rome, 1968. »Dass öffentliche materielle Unterstützung von der Zugehörigkeit zur Bürgerschaft abhängt, ist der entscheidende Unterschied zum christlichen Verständnis von Armenpflege«, urteilt einer der besten Kenner, W. Nippel (Brief an mich vom 28. 5. 2007).
44
Hans Maier
der Kirche und dem Staat. Der aufschlussreichste Vorgang (und der eindrücklichste Lernprozess für die Christen im politischen Leben) war – wie oben dargetan – der Investiturstreit. Hier ging es nicht so sehr um einen Machtkampf der Universalgewalten – es ging um ein neues Freiheitsbewusstsein in der Kirche, um die organisatorische und rechtliche Selbständigkeit, die sie brauchte, um ihre Botschaft zu verkünden und ihre Gebote im Leben zu verankern.31 Dieses Eingehen der Kirche in die Welt war ein konfliktreicher, oft schmerzlicher Prozess; man denke nur an die Kämpfe zwischen Kaiser und Papst, an den kaum je endenden Streit zwischen Geistlichen und Laien im Mittelalter. Auch die Kirche, die sich zwischen Mittelalter und Barockzeit tief auf die Welt einließ, musste sich immer wieder aus weltlichen Bindungen befreien, um ihre Eigenständigkeit zu bewahren. Ihre rechtliche und soziale Autonomie hat sich gerade in dieser Zeit herausgebildet – und damit ein Grundzug der inneren Ordnung Europas. Das Ergebnis des langen Ringens um die rechte Ordnung in der christlichen Welt war weder die »Symphonisierung« von Kirche und Staat wie in der östlichen Tradition noch ein theokratisches Gebilde mit einem päpstlichen Oberherrn. Machtpolitisch blieb der Streit der Universalgewalten unentschieden. Was sich herausbildete, war eine zweipolige Ordnung, ein Nebeneinander von Staat und Kirche, mit Zonen der Überschneidung und solchen der Selbständigkeit – Voraussetzung für die freiheitlichen Ordnungen der Neuzeit. Dabei darf man die Kirche nicht als ein monolithisches Gebilde sehen. Ist schon die Zweiteilung in Klerus und Laienschaft, das Hervortreten des Klerus als Stand (mit dem Merkmal der Tonsur), die Hierarchiebildung zwischen den »duo genera Christianorum«, wie sie seit Gratian genannt werden, ein schwieriger, windungsreicher Prozess, so kompliziert sich das Bild noch einmal, wenn man die »regulierten Kleriker«, die Religiosen, hinzunimmt. Und doch liegt gerade im Verhältnis von Laien, Klerikern und Ordensleuten eine dem Christentum eigentümliche geschichtliche Dynamik, ohne die man weder die mittelalterlichen Kämpfe von Klerikern und Laien (bis hin zu Papst und Kaiser) versteht noch die säkularen und laizistischen Strömungen der Moderne. Das Wort Säkularisation bezeichnet ursprünglich den Übergang vom Ordenskleriker zum Weltpriester. Um den personenrechtlichen Kern des Wortes saecularisatio legt sich im Lauf der Zeit ein eigentumsrechtlicher Mantel.32 Ein 31 Den für Mittelalter und Moderne konstitutiven »Kampf um die rechte Ordnung in der christlichen Welt« stellt in unübertroffener Dichte dar G. Tellenbach, Libertas. Kirche und Weltordnung im Zeitalter des Investiturstreites (1936), Nachdruck 1996, bes. S. 77 – 108 u. 151 – 192. Zusammenfassend K. Schmid (Hrsg.), Reich und Kirche vor dem Investiturstreit (Gerd Tellenbach zum 80. Geburtstag), 1985. 32 Näheres in meinem Aufsatz: Säkularisation. Schicksale eines Rechtsbegriffs im neuzeitlichen Europa, in: A. Schmid (Hrsg.), Die Säkularisation in Bayern 1803, 2003, S. 1 – 28. Dort der
Modelle des Rechts, Entwicklungsphasen der Geschichte
45
Stück »Welt« war stets in die Kirche inkorporiert. Weltentsagung wie Weltzuwendung hatten ihren Platz in der Christenheit – sie standen in einem Balanceund Ergänzungsverhältnis. So wie der mit kirchlicher Erlaubnis aus dem Kloster Entlassene zwar die Ordenstracht ablegte, aber im übrigen weiterhin in der Welt ein geistliches Leben führen konnte, so konnte auch klösterliches Eigentum, wenn es »säkularisiert« wurde, in veränderter Form kirchlichen und geistlichen Zwecken dienen: der Seelsorge, der Armenpflege, der religiösen Unterweisung, der Erziehung und Wissenschaft. Viele Schulen und Universitäten des Abendlandes sind aus klösterlichem Besitz dotiert worden. Die Mehrgliedrigkeit des kirchlichen Körpers, sein variabler Aufbau aus Klerikern, Laien, Regularen gestattete immer wieder Austausch und Transfer aus dem einen in den anderen Bereich. Das galt für Personen wie für Sachen, für Institutionen wie für finanzielle Mittel. Zugespitzt gesprochen: Etwas konnte in weltliche Bereiche verlagert und damit »säkularisiert« werden, was gleichwohl dem Geist der evangelischen Räte verpflichtet blieb. Die Kirche verlor das saeculum nie gänzlich aus dem Blick – und das galt natürlich auch vice versa. Nicht einmal die Reformation hat – entgegen gängigen Meinungen – an dieser Situation Grundsätzliches geändert. Gewiss, sie verschloss dem Laien die Klosterpforte, sie stellte die vita contemplativa als privilegierten Weg des Lebens nach dem Evangelium in Frage – aber doch nur, weil nun für sie die ganze Welt »ein Kloster« war und der Christ in ihr Gottes Willen zu vollstrecken hatte. »Du glaubst, du seist dem Kloster entronnen«, sagte der Reformator Sebastian Frank, »es muss jetzt jeder sein Leben lang ein Mönch sein.«33 Eine »virtuelle Klösterlichkeit« der Welt blieb auch in nachreformatorischer Zeit erhalten – zumindest gilt das für die Ära des Altprotestantismus. Max Weber hat für diese Transformation des regulierten Lebens ins Weltliche, Berufliche, Intellektuelle, Kaufmännische den Ausdruck »innerweltliche Askese« geprägt.
3.
Christentum und weltliche Ordnung in der Moderne
Auch in der Neuzeit bleibt der Staat zunächst christlicher Staat, Anwalt der Kirche, Vereinigung der Getauften, Hüter christlicher Moral und Tradition. Auch die Theoretiker des modernen Verfassungsstaates, Locke, Montesquieu, Nachweis, dass das Wort saecularisatio – entgegen einer lange vertretenen Meinung – nicht erst im 17., sondern schon im 16. Jahrhundert vorkommt und ursprünglich einen innerkirchlichen Vorgang bezeichnet, nämlich den Übergang von Ordensgeistlichkeit zu Weltgeistlichkeit in seinen personen- und eigentumsrechtlichen Aspekten. 33 Zit. bei F. Steinbach, Der geschichtliche Weg des wirtschaftenden Menschen in die soziale Freiheit und politische Verantwortung (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 15), 1954, S. 5 ff., 42.
46
Hans Maier
die Autoren der »Federalist Papers«, hielten zumindest die moralischen Werte und Wirkungen des Christentums für unentbehrlich in einem modernen Staat, sie erachteten die Integration von Nichtchristen in diesen Staat für schwierig, die von Atheisten sogar für unmöglich: welchen Eid sollten sie leisten, wie konnte man sich ihres Gehorsams versichern?34 Selbst die frühe Aufklärung, partiell von kirchlichen Kräften mitgetragen, sah in einer vom »Aberglauben« gereinigten Religion ein nützliches moralisches Fundament des Staates, und selbst ein so enragierter Kirchengegner wie Voltaire glaubte zumindest, sie sei unentbehrlich für das Volk: »Il faut un dieu pour le peuple.«35 Dies ändert sich grundsätzlich mit den modernen Revolutionen. Der aus ihnen hervorgehende Staat gründet nicht mehr auf religiösen Traditionen, versteht sich nicht mehr als advocatus ecclesiae. Sein Fundament ist das Vernunftrecht. Christliche Gehalte sind ihm nicht imprägniert wie dem älteren Staat – er versteht sich als Sachwalter aller Bürger, unter denen sowohl Christen wie Nichtchristen sind. Institutionelle Verbindungen von Kirche und Staat werden nun überall gelöst oder doch gelockert: in den USA waren sie nie vorhanden, in Frankreich werden sie in einem schmerzhaften Kampf zwischen Revolution und Kirche beseitigt, im Alten Reich fallen sie mit dem Untergang der Reichskirche und der Säkularisation von 1806 dahin. Je mehr sich der Staat auf eine Position religiöser Neutralität zurückzieht, desto weniger werden die Dienste der Kirche begehrt. Sie scheinen überflüssig zu werden; zumindest halten immer weniger Menschen sie für unentbehrlich. Der moderne Staat übernimmt viele Tätigkeiten, die bisher in den Händen der Kirche lagen, in seine eigene Regie. Jetzt entsteht ein weltliches Gesundheitsund Sozialwesen, ein staatliches Bildungs- und Erziehungswesen. Öffentliche Tätigkeiten, einst als Hilfe zu christlichem Leben initiiert, erhalten jetzt ein allgemeineres, humanitäres Vorzeichen. Der Staat nimmt das bisher von der Kirche verwaltete (oder mitverwaltete) eigene Innere in Besitz. Die Kirche wird durch diesen Vorgang einerseits in ihrem Tätigkeitsbereich geschmälert – sie wird aber auch von mannigfachen Bürden befreit. Sie kann sich freier und unbelasteter ihrem eigentlichen Auftrag zuwenden. Auch ist nicht zu verkennen, dass der Staat, wo er sich um Gerechtigkeit, Entfaltung der Person, sozialen Ausgleich, Hilfe für Arme, Kranke, Schwache bemüht, ein Werk fortführt, das die Kirche begonnen hatte. Weltliche Wirkungen des Christentums gehen in viele Sachstrukturen von Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur ein – im 20. und 21. Jahrhundert noch deutlicher als im 18. und 19. Jahrhundert. 34 In Lockes Essay concerning toleration (um 1667) werden Atheisten als »Bestien« bezeichnet; der Verfasssungsentwurf von Carolina, an dem Locke wahrscheinlich mitgewirkt hat, sprach ihnen sogar den bürgerlichen Status und das Recht auf Besitz und Niederlassung ab. 35 Ein Echo noch bei Goethe: »Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, hat auch Religion; wer jene beiden nicht besitzt, der habe Religion« (Hamburger Ausgabe, Bd. I, S. 367).
Modelle des Rechts, Entwicklungsphasen der Geschichte
47
Gegenüber dem nachrevolutionären Staat verfolgt besonders die Katholische Kirche ein doppeltes Ziel. Den liberalen »Not- und Verstandesstaat« versucht sie aus ihrem sozialen Ethos heraus zu ergänzen; den liberalen Erziehungsstaat versucht sie zu korrigieren. Dementsprechend nimmt ihr Dienst an diesem Staat eine überwiegend kritische Gestalt an: auf der einen Seite steht der Kampf gegen die soziale Abstinenz des Frühliberalismus,36 auf der anderen Seite die Selbstbewahrung und Verteidigung im Kulturkampf.37 Beides sind Vorspiele zu den sehr viel radikaleren Frontstellungen des 20. Jahrhunderts. Inmitten einer weltweit gewordenen sozialen Frage, unter den Selbstbestimmungs- und Befreiungsforderungen von Einzelnen wie Gruppen und Völkern, sucht die Kirche nach neuen Konzepten der Verkündigung. Zugleich begegnet sie in den modernen Totalitarismen erneut der alten Selbstbezogenheit des Staates – der pompa diaboli, der »Maskerade des Bösen« (Dietrich Bonhoeffer)38 – ganz wie in den Anfängen der Christenheit.
4.
Zeit und Verantwortung im modernen Verfassungsstaat
Ein Fundament des modernen Verfassungsstaates hängt deutlich mit christlichen Überlieferungen zusammen: ich meine das Gefühl für den Wert der Zeit, ihre Unwiederbringlichkeit und Unwiederholbarkeit – und das daraus erwachsende »responsible government« die Wahrnehmung politischer Aufgaben in festen, kontrollierbaren Verantwortungszeiten und –räumen. Es hat sich dem westlichen Menschen in Jahrhunderten christlicher Erziehung tief eingeprägt, dass die Zeit eine Frist ist, begrenzt und kostbar, und dass 36 Grundlegend J.-B. Duroselle, Les d¦buts du catholicisme social en France (1822 – 1870), 1951; J. N. Moody (ed.), Church and Society. Catholic Social and Political Thought and Movements 1789 – 1950, 1953; E. Ritter, Die katholisch-soziale Bewegung in Deutschland im 19. Jahrhundert und der Volksverein, 1954; C. Bauer, Deutscher Katholizismus. Entwicklungslinien und Profile, 1964. – Zu parallel verlaufenden Entwicklungen im evangelischen Deutschland siehe W. O. Shanahan, Der deutsche Protestantismus vor der sozialen Frage 1815 – 1871, 1962. 37 Auf dem europäischen Kontinent tritt der liberale Staat der katholischen Kirche vor allem als – keineswegs liberale – Erziehungs- und Kulturmacht gegenüber ; daher die spezifisch kontinentale Problematik des »Kulturkampfs«, die in dieser zugespitzten Form in den Ländern der angelsächsischen Demokratie nicht vorkommt. 38 D. Bonhoeffer, Nach zehn Jahren (1943), jetzt in: Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Neuausgabe 1970, S. 11 ff.: »Die große Maskerade des Bösen hat alle ethischen Begriffe durcheinander gewirbelt. Dass das Böse in der Gestalt des Lichts, der Wohltat, des geschichtlich Notwendigen, des sozial Gerechten erscheint, ist für den aus unserer tradierten Begriffswelt Kommenden schlechthin verwirrend; für den Christen, der aus der Bibel lebt, ist es gerade die Bestätigung der abgründigen Bosheit des Bösen« (12). – Zu den modernen Totalitarismen vgl. H. Maier (Hrsg.), Totalitarismus und Politische Religionen, 3 Bde., 1996 – 2003; engl. unter dem Titel: Totalitarianism and Political Religions, 2004—2007.
48
Hans Maier
sie unaufhaltsam voranschreitet, dem Ende zu. Aus diesem Gefühl erwuchs eine strenge Kultur der Lebensgestaltung, eine Ordnung des Zählens, Messens, Einteilens, die vom Stundengebet der Mönche bis zum Kalender der Kaufleute, vom altchristlichen »Ora et labora« bis zum modernen Countdown, von Computus der Computisten, die im Frühmittelalter den Ostertermin berechneten, bis zum modernen Computer reicht.39 Das Christentum hat deutliche Spuren in unserem Zeitbewusstsein hinterlassen.40 Die Abkehr von sozial differenzierten Ortszeiten, die Zählung und Messung der Zeit nach allgemeinen Maßstäben, die Entstehung einer einheitlichen Weltzeit41 – das alles hängt mit der Kultur der Zeiteinteilung und Zeitverwendung zusammen, wie sie seit den Anfängen der Christenheit vor allem in den Klöstern (aber auch in der Liturgie, im christlichen Kalender, im Kirchenjahr) entwickelt worden war. Ganz selbstverständlich zählen wir unsere Jahre nach einem Ereignis, das nicht am Anfang, sondern in der Mitte der Geschichte liegt, der Geburt Jesu Christi. In Handel und Kommunikation, in der Erinnerungskultur, in den Datierungen geschichtlicher Ereignisse gilt die christliche Zeitrechnung inzwischen sogar global. Selbst in Gebieten mit anderer Zeitrechnung (China, die islamischen Länder usw.) wird – zumindest ergänzend – nach ihr gerechnet. Auch die modernen Instrumente der Zeitmessung sind in einer christlichen Zivilisation entstanden. Moderne Zeit als »gezählte Zeit«42 beginnt mit der mechanischen Uhr, beruhend auf der Spindelhemmung mit Waagbalken, die im späteren Mittelalter – Europas »Erster Moderne« – erfunden wurde. Zwar folgte die Konjunktur der Uhren bald eigenen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und modischen Regeln. Aber noch in der europäischen Expansion seit dem 15. Jahrhundert, in Mission und Kolonisation erscheinen Uhren zunächst in einem christlichen Kontext. Als europäische Jesuitenpatres im 16. Jahrhundert in China missionierten, führten sie Uhren mit sich – diese öffneten ihnen sogar die Pforten des kaiserlichen Palastes in Peking. Bis zur Auflösung ihrer Mission leitete immer ein Jesuit die Uhrenwerkstatt und die Uhrensammlung des Kaisers. Auch Franz Xaver soll schon 1550 Yoshitaka Ouchi, dem Gouverneur von Yamaguchi, eine Uhr überreicht haben – nach
39 Diese sprachlichen und geschichtlichen Zusammenhänge sind eingehend dargestellt bei A. Borst, Computus. Zeit und Zahl in der Geschichte Europas, 21991. 40 Hansjörg Auf der Maur, Feiern im Rhythmus der Zeit, I: Herrenfeste in Woche und Jahr (= Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft, Teil 5), 1983; A.-D. v. d. Brincken, Historische Chronologie des Abendlandes. Kalenderreformen und Jahrtausendrechnungen, 2000; H. Maier, Die christliche Zeitrechnung, 72012. 41 H. Zemanek, Kalender und Chronologie, 41987. 42 C. M. Cipolla, Gezählte Zeit. Wie die mechanische Uhr das Leben veränderte, 1996.
Modelle des Rechts, Entwicklungsphasen der Geschichte
49
allgemeiner Ansicht die erste mechanische Uhr europäischer Herkunft in Japan (Carlo M. Cipolla). Auch der moderne Verfassungsstaat hat, wenigstens indirekt, einen seiner Ursprünge im christlichen Umgang mit der Zeit. Denn das Christentum machte politisches Handeln rechenschaftspflichtig vor Gott und dem Gewissen. Damit wurden die überlieferten Formen politischer Identifikation des Einzelnen mit der Bürgergemeinde brüchig. Es genügte jetzt nicht mehr, dass der politisch Handelnde für die Bürgerschaft das Äußerste wagte und sich mit seiner Gemeinde – wenn er erfolgreich war und nicht unterging – in ewigem Ruhm verband. Die bedingungslose bürgerliche Hingabe, der »Heimfalls ans Allgemeine« (Jacob Burckhardt) – Kern des antiken politischen Ethos – wurde in christlichen Zeiten in Frage gestellt. Die Vergöttlichung erfolgreicher Feldherrn, Magistrate, Kaiser erschien nun als Blasphemie. Während die Antike in Gestalt des Heros und der Tragödie die Vergangenheit unmittelbar in die Gegenwart hineinreißen (und sie damit aus Zeit und Vergänglichkeit herausnehmen) wollte, stellte das Christentum Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als Verantwortungsräume der politisch Handelnden klar und scharf nebeneinander. Am Beispiel des Ruhms enthüllte Augustin die Selbstbezogenheit, die latente Verantwortungs-Unfähigkeit der antiken politischen Kultur. Der Staat wurde von ihm entschlossen in die Zeit gestellt und auf das Recht gegründet. Denn ohne Gerechtigkeit – siehe oben – sind die Staaten nichts als »große Räuberbanden«. Verantwortung wird in christlichen Zeiten neu und strenger gefasst: Wie der Mensch über sein ganzes Leben Rechenschaft ablegen muss vor dem ewigen Richter, so wird jetzt auch der politische Bereich zum Raum persönlicher Verantwortung.43 Den entscheidenden Schritt zur Organisation von Verantwortlichkeit tut dann der moderne Verfassungsstaat: er schafft klare Verantwortungsräume und Verantwortungszeiten, er macht deutlich, wer sich zu verantworten hat, in welchen zeitlichen Abständen, vor welchen Instanzen, mit welchen Verfahren der Bestätigung oder Verwerfung. Vor allem: Er zerlegt die Machtausübung und macht sie dadurch der Übersicht und Kontrolle zugänglich. So dehnen sich in der modernen Demokratie die Kontrollrechte auf die ganze Breite des Staatslebens aus: responsible government heißt schließlich, dass die Herrschenden insgesamt den Beherrschten verantwortlich sind. 43 In den Fürstenspiegeln entwickeln sich Formen einer religiös-pädagogischen Ethik. Mittelalterliche Politik arbeitet mit religiös begründeten Leitlinien und Sanktionen. In der Neuzeit macht der Katholizismus die Herrscher rechenschaftspflichtig gegenüber Kirche, Priestertum, Gewissen. Im Protestantismus sind die institutionellen Gewichte schwächer, die inneren Gewissensinstanzen aber bestehen fort – von der bewusst kirchlichen Politik evangelischer »Betefürsten« zur Zeit der Reformation bis zu dem individualistischen Umgang Bismarcks mit den Losungen der Brüdergemeine.
Josef Isensee
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae« – Konvergenzen und Divergenzen von kirchlichem Wahrheitsanspruch und verfassungsstaatlichem Freiheitsverständnis
I.
Das widerspruchsvolle Bild der Geschichte
1.
Sic et non: Ideen von 1789, Menschenrechte, Demokratie
»Der römische Papst kann und soll sich mit dem Fortschritt, mit dem Liberalismus und mit der modernen Zivilisation aussöhnen und abfinden«, so spricht Papst Pius IX. im Jahre 18611, freilich nicht in der Absicht, ein Ziel seines Pontifikats zu verkünden, sondern eine Gefahr zu benennen, gegen die er ankämpft, und einen Zeitirrtum zu definieren, den er verurteilt. Die Definition geht ein in den »Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores« von 1864, als letzter der 80 lehramtlich katalogisierten »hauptsächlichen Zeitirrtümer«2. Nimmt man die Textstelle des Syllabus beim Wort, wie es die Zeitgenossen taten3, unter Vernachlässigung aller exegetischen Überlagerungen durch die 1 »Romanus Pontifex potest ac debet cum progressu, cum liberalismo et cum recenti civilitate sese reconciliare et componere« (Ansprache »Iamdudum cernimus«, 18. 3. 1861). 2 Pius IX., Syllabus als Anhang der Enzyklika »Quanta cura« vom 8. 12. 1864. Zitiert wird nach der Quellensammlung von A. F. Utz/B. Gräfin von Galen (Hrsg.), Die katholische Sozialdoktrin in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 1976 (= U-G), Bd. I, S. 52 f. 3 Das Wortverständnis deckt sich nicht mit dem, was der Papst an sich meint. Im originalen Kontext der Rede vom 18. 3. 1861, aus dem der Satz 80 stammt, versteht der Papst unter »moderner Zivilisation und Liberalismus« Maßnahmen gegen die Klöster, Quälereien der Geistlichen, Unterstützung der Feinde der Kirche, kurz: ein »System, dazu angetan, die Kirche zu schwächen oder zu stürzen«. Dieser an sich beinahe unverfängliche Text, aus dem Zusammenhang gerissen und als selbständige Sentenz publiziert, ändert im Syllabus seine Bedeutung und wird zur grundsätzlichen Kampfansage an Fortschritt, Liberalismus und moderne Zivilisation. Er provoziert den Spott der antiklerikalen Gazetten, daß der Papst, der Fortschritt und Zivilisation verdamme, im Kirchenstaat Eisenbahnen, Dampfmaschinen und Gasbeleuchtungen verbieten wolle (vgl. R. Aubert, Der Syllabus von 1864, in: StdZ 175 [1965], S. 1 [S. 16]). Überhaupt sind die verhängnisvollen Konflikte, die der Syllabus errorum zwischen Kirche und Welt und zwischen innerkirchlichen Kräften (»liberalen« und »ultramontanen«) ausgelöst hat, teilweise das Ergebnis von Mißverständnissen, die sich aus der unseligen Zitiertechnik und der scheinbaren Klarheit der Zitate ergeben. Zur Geschichte des Syllabus und
52
Josef Isensee
seitherige Beschwichtigungstheologie, so mag man die These wagen, daß just der von Pius IX. verurteilte »Zeitirrtum« in weitem Maße das Papsttum der Gegenwart leitet: im Aggiornamento an die moderne Zivilisation und in der Zuwendung zu den politischen Ideen des Liberalismus, zu Menschenrechten und Demokratie. Papst Johannes Paul II. begrüßt in seiner Enzyklika »Centesimus annus« den Sieg der liberalen Ideen, der im Jahre 1989 in den Ländern Mittel- und Osteuropas seinen Höhepunkt erreicht, aber auch im Zusammenbruch von Diktaturen anderer Weltgegenden sichtbar wird. Mit Genugtuung stellt der Papst fest, daß »einen wichtigen, ja entscheidenden Beitrag« dabei die Kirche in ihrem Einsatz »für die Verteidigung und die Förderung der Menschenrechte« erbracht habe4. Er verwirft den Totalitarismus, zumal in seiner marxistisch-leninistischen Ausprägung, und bekennt sich zum Prinzip der Freiheit, zu den Menschenrechten, zur Demokratie (freilich mit Vorbehalten gegenüber manchen ihrer realen Erscheinungen und ideologischen Begründungen), zur Gewaltenteilung und zum Rechtsstaat, in dem das Gesetz herrscht und nicht die Willkür des Menschen5. Der Sache nach bekennt sich der Papst damit zum Konzept des Verfassungsstaates, in dem menschenrechtliche und staatsorganisatorische Prinzipien, zentriert um die subjektive Freiheit des Individuums, sich zu integraler Einheit verbinden: die demokratische Begründung der Staatsgewalt und ihre rechtsstaatliche Begrenzung, ihre Strukturierung durch Gewaltenteilung und ihre Bindung an Grundrechte6. Der Verfassungsstaat, im gängigen Sprachgebrauch die freiheitliche Demokratie, ist das politische Werk der Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Das historische Geburtsereignis auf kontinentaleuropäischem Boden ist die französische Revolution. Jedoch ergibt diese kein eindeutiges Paradigma. Sie steht für die Menseiner Wirkungen: R. Aubert, a. a. O., S. 17 ff.; ders., Vaticanum I, (dt.) 1965, S. 25 ff.; ders., Die Religionsfreiheit von »Mirari vos« bis zum Syllabus, in: Concilium 1 (1965), S. 588 ff.; K. Schatz, Vaticanum I 1869 – 1870, Bd. I, 1992, S. 29 ff. Neuere Apologien des Syllabus: J. Listl, Kirche und Staat in der neueren katholischen Kirchenrechtswissenschaft, 1978, S. 139 ff.; J. Ratzinger, Wie entscheidet die Kongregation für die Glaubenslehre?, dt. in: Deutsche Tagespost v. 11. 9. 1986/Nr. 109, S. 7. 4 Enzyklika »Centesimus annus« vom 1. 5. 1991, n. 22 (dt. Ausgabe des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz, 1991, S. 26). 5 »Centesimus annus« (Fn. 4), n. 44 – 48 (S. 52 ff.). 6 Zu den Leitgedanken neuerer päpstlicher Staatslehre, vor allem der Wahrung von Freiheit und Menschenwürde, damit den Grundrechten, und dem sozialen Staatsziel: H. Schambeck, Zur Staatsordnung, in: GS für Anton Burghardt, 1982, S. 95 (97 ff., 100 ff.). – Zum Idealtypus des Verfassungsstaats: J. Isensee, Staat, in: Staatslexikon, hrsg. von der Görres-Gesellschaft (= StL), Bd. 5, 71989, Sp. 133 (140 f., 150 ff.). Zur Realisierung des Idealtypus in Deutschland: ders., Staat und Verfassung, in: ders./Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland (= HStR), Bd. II, 32004, § 15 Rn. 166 ff.
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
53
schenrechte und für deren Perversion zu Jakobinerphrasen und für die liberale Demokratie und für deren Umschlag in Totalitarismus. Die historischen Umstände der französischen Revolution, in der sich der Verfassungsstaat in Kontinentaleuropa Bahn brach, irritieren jedoch den heutigen Papst nicht. Im Gegenteil: bei seinem Besuch in Frankreich bekundet er seine Achtung den Revolutionsidealen der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit als im Grunde christlichen Ideen, auch wenn er wisse, daß jene, die diese Ideale formulierten, sich nicht auf das Bündnis des Menschen mit der Ewigen Weisheit berufen hätten. Der Papst hält ihnen zugute, daß sie zum Wohle der Menschheit hätten handeln wollen7. Auf dieser Linie liegt es, daß die katholische Kirche heute Abstand hält zu politischen Kräften, die gegen die Ideen von 1789 angehen, und darauf Bedacht nimmt, sich nicht von Integristen vereinnahmen zu lassen. Im September 1993 hält sie sich zurück bei der Gedenkfeier für den Aufstand der Vend¦e und an die Greuel seiner Niederwerfung. Der Erzbischof von Paris, Kardinal Jean Marie Lustiger, verhindert, daß am 21. Januar 1993 ein Requiem für König Ludwig XVI. in der Kathedrale Notre Dame zelebriert wird, am Todestag des Königs, 200 Jahre nach seiner Hinrichtung8. Vergessen scheint heute, daß die katholische Kirche die Hinrichtung als Frevel gegen den christlichsten König, den Gesalbten des Herrn, verdammt und die Revolution als Empörung gegen die gottgewollte Ordnung des Staates verworfen und gegen sie in der Allianz mit den alten Mächten angekämpft hat. Heute geht die Kirche schweigend darüber hinweg, daß sie unter der Verfolgung der Revolution furchtbar hat leiden müssen und ihre Getreuen gewaltigen Blutzoll erbracht haben, von denen viele sogar zur Ehre der Altäre erhoben worden sind, zuerst im Jahre 1906 die 16 Karmeliterinnen von CompiÀgne, zuletzt 1955 die 16 Märtyrer von Laval9. Die Sympathie, die Johannes Paul II. den Ideen der Revolution bekundet, und die Gelassenheit gegenüber deren realer Erscheinung steht in schroffem Kontrast zu dem leidenschaftlichen Abwehrkampf der Päpste des 19. Jahrhundert gegen die Ideen von 1789. Die Revolution war das ungeheure Trauma der Kirche, prägend wie kein anderes seit der Reformation. Repräsentativ ist das Urteil, das sich noch 1895 im Staatslexikon der Görres-Gesellschaft findet: »Die Lobredner der großen Revolution scheinen unempfindlich gegen ihre Gräßlichkeiten zu sein. Der unsägliche Jammer des französischen Volkes rührt sie nicht. … Die Tugend verfällt dem Martyrium, und das Laster wird gekrönt; aber die Apologeten der Revolution merken nichts, nicht einmal von ihrer eigenen Einfalt und 7 Die Äußerungen bei einem Besuch Frankreichs 1980 werden zitiert nach A. Grosser, Der schmale Grat der Freiheit, 21982, S. 16. 8 Dazu J. Altwegg, Der verdrängte Vatermord, in: FAZ v. 21. 1. 1993, Nr. 17, S. 27. 9 Die Namen der in sieben Proklamationen zwischen 1906 und 1955 seliggesprochenen »Märtyrer von Frankreich«: O. Wimmer/H. Melzer, Lexikon der Namen und Heiligen, 51984, S. 894 ff.
54
Josef Isensee
Charakterlosigkeit. Sie fahren fort im Lobe der großen Revolution«10. Joseph de Maistre, der die katholische Negation zu äußerster Schärfe zuspitzt, erkennt in der Revolution den »satanischen« Charakter : »Elle est satanique dans son essence«11. Als der Papst erstmals nach Ausbruch der Revolution das Wort ergreift – Pius VI. 1791 in seinem Breve »Quod aliquantum«, herausgefordert durch die kirchenfeindlichen Maßnahmen der Nationalversammlung im Zuge der Zivilkonstitution12 –, verurteilt er den neuen Freiheitsgedanken als völlig absurde, aus der Luft gegriffene Doktrin (»absurdissimum eius libertatis commentum«), als Widerspruch gegen göttliches Recht und Naturrecht und gegen die Lehre der Kirche, als Frevel, erneut vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Dem politischen Emanzipationsdrang und dem Willen zu demokratischer Selbstbestimmung stellt er die Gehorsamspflicht gegen die gottgewollte, monarchische Obrigkeit entgegen, unter Berufung auf Paulus (Röm. 13) und auf Augustinus: »Generale quippe pactum est societatis humanae obedire regibus suis«13. Der Papst verwirft die Gedanken- und Handlungsfreiheit, wie sie die Nationalversammlung der Natur des Menschen zuschreibt, vor allem die Religionsfreiheit, jene aus der Gleichheit aller Menschen und aus ihrer natürlichen Freiheit abgeleitete »wahre Ungeheuerlichkeit« (»quae sane monstra«), daß kein Mensch in der Ausübung seiner Religion behindert werde, und daß jeder selbst darüber befinde, was er über religiöse Fragen denke, rede, schreibe, publiziere. Die Prinzipien der Freiheit und Gleichheit liefen auf nichts anderes hinaus als darauf, die katholische Religion zu vernichten14. Mit dem Widerspruch, den der Papst gegen die neuen Freiheits- und Gleichheitsrechte sowie gegen die Demokratie erhebt, tritt die Kirche in prinzipielle Opposition zu den politischen Bestrebungen, aus denen der Verfassungsstaat hervorgeht. Der Widerspruch macht kirchengeschichtliche Epoche. Die Nachfolger Pius’ VI. nehmen ihn auf und vertiefen ihn. Der Ton, der im Jahre 1791 angestimmt wird, hallt durch das 19. Jahrhundert bis in die Mitte des 20. Sein Nachklang ist noch vernehmbar in den Debatten des Zweiten Vatikanischen Konzils; er verstummt erst, als 1965 die Erklärung über die Religionsfreiheit (»Dignitatis humanae«) zustande kommt. 10 G. E. Haas, Revolution, in: StL, 4. Bd., 11895, Sp. 915 (922). Keine Spur von dieser Polemik findet sich nunmehr in der ausgewogenen, distanzierten und relativierenden Bewertung der Revolution in der jüngsten Auflage des Staatslexikons: E. Schmitt, Französische Revolution, in: StL, Bd. 2, 71986, Sp. 664 (667 f.). 11 J. de Maistre, Du Pape, 21821, S. XXIII. Vgl. auch ders., Consid¦rations sur la France, 1795, S. 66. 12 Pius VI., Breve »Quod aliquantum« v. 10. 3. 1791, in: U-G III, S. 2652 (2662 ff.). 13 Zitiert nach Pius VI. (Fn. 12, S. 2664). 14 Pius VI. (Fn. 12), S. 2662 ff.
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
2.
55
Das theologische Dilemma
Die Theologie hat derzeit ihre liebe Not, das »Sic et non« der Päpste zum verfassungsstaatlichen Erbe der Aufklärung, darin den Verfassungsideen der französischen Revolution, zu bewältigen15. Der Wahrheitsanspruch der Kirche wehrt sich gegen geschichtliche Relativierung. Sie will sich der Identität ihrer Lehre im Wechsel der Zeiten vergewissern. Das gilt sogar dort, wo ihre Essenz als Kirche allenfalls am Rande berührt wird, wie in den Aussagen zur legitimen Staatsform und zu der Freiheit des Bürgers gegenüber der Staatsgewalt. Die Kirche verschmäht alle bequemen Auswege, die der Zeitgeist offenhält. Sie distanziert sich vom Relativismus und vom Historismus. Sie ergreift auch nicht die Option der Philosophie Hegels, daß sich die Wahrheit im dialektischen Prozeß der Geschichte enthüllt und entfaltet. Schwierigkeiten ergeben sich auch daraus, daß es nicht zum Stil der Kurie gehört, frühere Stellungnahmen förmlich zurechtzurücken oder ausdrücklich zu widerrufen. Im Gegenteil: wenn das Lehramt sich von bisherigen Äußerungen abkehrt und zu neuen Aussagen vorstößt, neigt es in besonderem Maße dazu, sich auf die Tradition zu berufen und auf den Hort der immer schon vorhandenen Erkenntnisse. So versteht sich die Erklärung des Zweiten Vaticanum zur Religionsfreiheit nicht etwa als Wende oder als Neuerung, sondern als Kontinuum. Das Konzil will Antwort geben auf die heute herrschenden Bestrebungen und befragt »die heilige Tradition und Lehre der Kirche, aus denen es immer Neues hervorholt, das mit dem Alten in Einklang steht«16. Die jüngere Verlautbarung ersetzt nicht die ältere, sondern legt sich über sie. Schicht lagert auf Schicht. Die obere wirkt auf die untere ein, die untere auf die obere zurück, eine Art Kompostierungsprozeß. Die Theologen, die sich heute mit Eifer der neuen Thematik der Menschenrechte und der Demokratie widmen, zeigen wenig Neigung, sich mit den sperrigen Positionen des Lehramtes aus vorkonziliarer Zeit, zumal aus dem 19. Jahrhundert, auseinanderzusetzen und zu entscheiden, ob hier Kontinuität oder Diskontinuität waltet17. Soweit sie an das Problem rühren, zumeist nur 15 Näher zur Interpretation der päpstlichen Verlautbarungen zu den Menschenrechten und ihren Problemen: J. Isensee, Keine Freiheit für den Irrtum, in: ZRG kan. Abt. LXXIII (1987), S. 296 (299 ff., 302 ff.). 16 Vaticanum II, Declaratio de libertate religiosa (»Dignitatis humanae«) n. 1, v. 7. 12. 1965 (zitiert nach K. Rahner/H. Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, 1966, S. 661 f.). Dem Kontinuitätsanspruch dieser Deklaration stimmt zu W. Kasper, Wahrheit und Freiheit, 1988, S. 14 ff. (37). Ablehnend: E.-W. Böckenförde, Einleitung zur Textausgabe der Erklärung über die Religionsfreiheit (1968), in: H. Lutz (Hrsg.), Zur Geschichte der Toleranz und Religionsfreiheit, 1977, S. 401 (416 f.). Differenzierend J. Fuchs (Kontinuität kirchlicher Morallehre?, in: StdZ 1987, S. 242 ff.). 17 Analyse: R. Sebott, Religionsfreiheit und Verhältnis von Kirche und Staat, 1972, S. 194 ff. –
56
Josef Isensee
beiläufig, neigen sie überwiegend dazu, Kontinuität anzunehmen und darzutun, daß die heutige Affirmation der Menschenrechte und der Demokratie einer durchgehenden Leitlinie kirchlicher Staatslehre entspricht18. Die Äußerungen der Päpste, von Pius VI. über Pius IX. bis Pius XII., werden im Lichte der heutigen Auffassungen gedeutet und dabei nicht selten rückwirkend harmonisiert, als zeitbedingt und obsolet beiseite geschoben oder schlicht verdrängt. Die herrschende Tendenz geht dahin, die heutige Position der Kirche historisch zu fundieren und aufzuweisen, daß die Quellen des Verfassungsstaates – auch – im Christentum liegen und daß die Kirche in Lehre wie Praxis den Menschenrechten von jeher zugetan war19. Auch für diese Sicht gibt die Geschichte Argumente und Belege in Fülle.
3.
Differenzierende Sicht der Staats- und Verfassungstheorie – Fünf Thesen
Die theologische Auflösung der Widersprüche ist hier nicht das Thema. Vielmehr geht es um ihre Deutung aus der Sicht der säkularen Staats- und Verfassungslehre. Dabei ist von Anfang an Unterscheidung geboten zwischen den lehramtlichen Äußerungen der katholischen Kirche und der Wirkungsgeschichte des Christentums. Die historischen wie die aktuellen Wirkungen aber, nach denen hier gefragt wird, sind nicht die religiösen Kräfte als solche, sondern ihre politischen und soziokulturellen Folgen für die Genese und für das Leben des Verfassungsstaates. Damit aber wird der Weg frei zu differenzierender Betrachtung. Im Wechsel der Perspektiven ergeben sich folgende Thesen: 1. Die Menschenrechte sind geschichtliches Derivat des Christentums. 2. Die christliche Vorprägung der Gesellschaft, mag sie auch vielfach säkular gebrochen und vermittelt sein, ist heute eine soziokulturelle Voraussetzung für den Verfassungsstaat. 3. In seiner geschichtlichen Entwicklung stieß der Verfassungsstaat auf prinzipiellen Widerstand der katholischen Kirche, der sich gegen wesentliche seiner Elemente richtete: gegen die souveräne Friedens- und Entscheidungseinheit des Staates und gegen seine Säkularität, gegen VolkssouveräLiteraturbericht: P. Huizing, Über Veröffentlichungen und Themenstellungen zur Frage der Religionsfreiheit, in: Concilium 2 (1966), S. 621 (627). 18 Vgl. J. Ratzinger (Fn. 3), S. 7; J. Punt, Die Idee der Menschenrechte, 1987, S. 209 ff.; W. Kasper (Fn. 16), S. 8 ff.; A. F. Utz, Vom Sinn religiöser Toleranz, in: Deutsche Tagespost v. 18. 4. 1987/ Nr. 46, S. 23 f. Dagegen konstatiert J. Fuchs eine »konziliare Wende« (Fn. 16, S. 248 ff.) 19 Theologische Tiefendimension: W. Kasper (Fn. 16), S. 14 ff., 36 ff. Historisches Material: J. Punt (Fn. 18), S. 17 ff., 87 ff., 175 ff. Kritik an der Harmonisierungstendenz: E.-W. Böckenförde (Fn. 16), S. 416 f.
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
57
nität und Demokratie, gegen die Freiheitsrechte der Meinung, der Presse und der Wissenschaft, vornehmlich aber wider die Religions- und Gewissensfreiheit. 4. Die katholische Kirche hat in langem historischen Prozeß zum Ausgleich mit den Menschenrechten wie überhaupt mit dem Verfassungsstaat gefunden und das in ihnen verkörperte Erbe der Aufklärung sich anverwandelt und zu eigen gemacht. 5. Heute regen sich in der Kirche Bestrebungen, sich dem säkularen Verfassungsstaat in Form wie Inhalt anzupassen, ihre Botschaft auf das der Aufklärung kompatible Maß zurückzuschneiden und so ihre genuin religiöse Sendung aufzugeben. Doch in dieser Anpassung würde die Kirche eine Erwartung des Verfassungsstaates enttäuschen, die sich auf sie als komplementäre Kraft richtet: daß sie darauf hinwirkt, seine religiösen und sittlichen Grundlagen zu festigen, die er, säkular, religiös neutral und grundrechtsgebunden, wie er von Verfassungs wegen ist, nicht sicherstellen kann. Die Thesen bedürfen der Erläuterung.
II.
Der Verfassungsstaat als Derivat des Christentums
1.
Politische Wirkung
Der Verfassungsstaat entwickelt sich im Kulturraum des Christentums: Europa und Nordamerika. Hier, und nur hier, treibt er tiefe Wurzeln, zeigt er Lebenskraft, erlangt er Dauer. Das ist kein Werk des Zufalls, sondern Ergebnis vielfältiger geschichtlich wirkender Faktoren. Einer von diesen ist das Christentum20. Das bedeutet jedoch nicht, daß die Botschaft des Christentums sich auf die Prinzipien des Verfassungsstaates richtete oder daß es einen direkten Ableitungszusammenhang, sei er theologischer oder sei er juridischer Art, zwischen biblischer Verkündigung und menschenrechtlich-demokratischer Staatsverfassung gäbe. Das Evangelium enthält kein staatspolitisches Programm und kein sozial20 Zu den christlichen Voraussetzungen des Verfassungsstaates: E.-W. Böckenförde, Zum Verhältnis von Kirche und Moderner Welt, in: R. Koselleck (Hrsg.), Studien zum Beginn der modernen Welt, 1977, S. 154 ff.; ders., Kirche und modernes Bewußtsein, in: Communio 15 (1986), S. 153 ff.; ders., Religionsfreiheit, 1990, S. 73 ff., 113 ff.; J. Schwartländer (Hrsg.), Modernes Freiheitsethos und christlicher Glaube, 1981; E.-W. Böckenförde/R. Spaemann (Hrsg.), Menschenrechte und Menschenwürde, 1987; M. Kriele, Befreiung und politische Aufklärung, 1980, S. 248 ff.; A. Uhle, Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Identität, 2004, S. 120 ff.; ders., Staat – Kirche – Kultur, 2004, S. 65 ff.
58
Josef Isensee
ethisches System. Die wenigen neutestamentarischen Aussagen über den Staat ergeben kein Konzept über seine richtige Verfassung. Das Reich, das im Evangelium verkündet wird, ist das Reich Gottes.21 Und dieses Reich ist nicht von dieser Welt. Vor ihm versinken die diesseitigen Dinge, die politischen Probleme und die rechtlichen Unterscheidungen ins Wesenlose. Ob einer Herr oder Sklave ist, erweist sich aus eschatologischer Sicht als gleichgültig. Es zählt allein, daß der von Christus erlöste Mensch, sei er Herr oder Sklave, den Willen Gottes erfüllt22. Es kommt auch nicht darauf an, ob das jüdische Volk frei ist oder ob es dem römischen Kaiser Steuer zahlen muß. Entscheidend ist, ob es Gott gibt, was Gottes ist (Mt 22, 21). Das Evangelium verkündet nicht den idealen Staat und nicht die optimale Verfassung. Es will nicht das Paradies irdischer Gerechtigkeit heraufführen. Die menschlichen Maßstäbe der Gerechtigkeit werden im Reich Gottes gerade aufgehoben, so daß die Arbeiter im Weinberg des Gleichnisses, wie unterschiedlich auch Arbeitszeit und Arbeitsanstrengung des einzelnen gewesen sind, am Ende alle den gleichen Lohn erhalten; das Prinzip rechenhafter Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung sub specie aeternitatis gilt nicht mehr (Mt 20, 1 – 16). Vom Inhalt der Offenbarung muß unterschieden werden die Wirkungsgeschichte. Wenn das Neue Testament auch keine Staatslehre enthält, so zeitigt es doch Wirkungen auf das staatliche Denken und Handeln. »Das Evangelium ist nicht soziale Botschaft, aber es wirkt als soziale Forderung. … Dieses Evangelium verlangt Entscheidung über alle Weltverhältnisse hinweg. Es setzt sich als Botschaft von einer anderen Welt aufs stärkste ab von dieser Welt; es fordert, nicht um die Welt nach Möglichkeit zu verbessern, sondern um den Menschen für das Reich zu wandeln. Dem Evangelium eignet also unbedingte Aktualität; es enthält radikale ›Kritik und radikale Forderung‹.«23 Keine politische Theorie und kein geschichtliches Ereignis hat das Staatsbewußtsein und die Staatsrealität so grundstürzend verändert wie das Christentum, das doch seinem Ursprung nach gar nicht auf solche Änderung ausgeht. Seine Wirkungen sind indirekter Natur, in praktischen Folgerungen aus der religiösen Botschaft, in Auseinandersetzung mit der vorgefundenen staatlichen und kulturellen Umwelt und Aneignung ihrer Gehalte, in philosophischer Reflexion und naturrechtlicher Deduktion. Die Wirkungen vollziehen sich im Prozeß der Säkularisierung: der Mutation religiöser Substanz in innerweltliche
21 Dazu H. Merklein, Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft, 1983. 22 Aufschlußreich der Fall des Onesimus im Philemon-Brief. Zu der Stellung des Christentums zur Sklaverei: J. Höffner, Christentum und Menschenwürde, 1947, S. 60 ff., 195 f. 23 M. Dibelius, Das soziale Motiv im Neuen Testament, in: ders., Botschaft und Geschichte, Bd. II, 1953, S. 178 ff. –Zur neutestamentarischen Sicht auch E. Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, 3. Neudruck der Ausgabe 1922, 1977, S. 16 ff.
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
59
Denkweisen und Handlungsmuster24. Säkularisierung aber ist eine Eigentümlichkeit des Christentums; für Hegel bedeutet die Verweltlichung des Christentums geradezu seine Sinnerfüllung durch Realisierung in der Welt25. Vergleichbare Säkularisierungsprozesse gehen von anderen Weltreligionen wie dem Islam nicht aus. Geschichtliche Wirkungen müssen nicht den Absichten derer entsprechen, welche die geschichtlichen Ursachen setzen. Sie entziehen sich ihrer Herrschaft und können sich sogar gegen sie kehren. So kann das Christentum in seinen historischen Wirkungen die Entstehung und Anerkennung der Menschenrechte begünstigen, obwohl das Lehramt der Kirche sich ihnen in einer bestimmten historischen Situation widersetzt. Auch in den Beziehungen zwischen Verfassungsstaat und Kirche waltet Hegel’sche List der Vernunft. Ein der Moderne gnädiger Gott schreibt gerade auf den krummen Linien päpstlicher Enzykliken. Die These, daß der Verfassungsstaat ein Derivat des Christentums ist, bedeutet nicht, daß diese politische Form die einzig mögliche, die zwingende Konsequenz des Christentums sei. Die Geschichte kennt andere politische Derivate des Christentums; und manche davon sind inkompatibel dem Verfassungsstaat. Vielmehr sagt die These nur, daß das Christentum zu seinen historischen Ursachen gehört. Der Verfassungsstaat ist auf dem Kulturboden des Christentums entstanden. Hier nur ist seine Entstehung möglich gewesen.
2.
Wechselwirkungen zwischen Christentum und politischer Umwelt – Ausstrahlung und Rezeption
Weltgeschichtlich gesehen, liegen in der »unpolitischen« Botschaft des Christentums die Keime zu zahlreichen politischen Entwicklungen. Die eschatologischen Offenbarungsgehalte werfen Schatten in der Realität der Welt. So ist im Glaubenssatz von der Erlösung und der endzeitlichen Verantwortung des Menschen der Schluß auf die weltimmanente Personalität des Menschen angelegt, auf seine rechtliche Würde und Freiheit. Aus dem existentiellen Gebot der Nächstenliebe lassen sich institutionelle Folgerungen ableiten, daß das Gemeinwesen die Not des Schwächsten als die Sache der Allgemeinheit begreift und Solidarität übt. 24 Zum Begriff und zum Phänomen der Säkularisierung: M. Heckel, Säkularisierung (1980), in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. II, 1989, S. 773 ff., bes. 822 ff.; H. Blumenberg, Säkularisierung und Selbstbehauptung, 21983, S. 9 ff. 25 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Der Geschichte der Philosophie zweiter Theil, Philosophie des Mittelalters, pr. (zuerst gehalten 1805/6), in: ders., Sämtliche Werke (Jubiläumsausgabe in zwanzig Bänden, hrsg. von H. Glockner), 19. Bd., 3 1959, S. 107.
60
Josef Isensee
Die Botschaft des Neuen Testaments verweist den Christen auf die konkretindividuelle Lage, in welcher er den Anruf Gottes erfährt. Sie verweist damit auf die Geschichte. Aus offenbarungstheologischer Sicht ist das Christentum offen zur geschichtlichen Welt, wenn es sich um eine gerechte Ordnung im politischgesellschaftlichen Bereich bemüht. Da das Christentum kein eigenes Staatskonzept mitbringt, ist es beweglich und vermag, sich den unterschiedlichen staatlichen Ordnungen, die es in seiner Ausbreitung über die Erde und im Gang durch die Geschichte vorfindet, einzufügen, ohne sich mit einer von ihnen zu identifizieren oder sich vorbehaltlos anpassen zu müssen. Es findet seinen Ort im römischen Imperium der Spätantike wie im Reich des Mittelalters, im Feudalismus wie im Absolutismus, in Monarchien wie in Republiken und heute in der freiheitlichen Demokratie. Die geistige Auseinandersetzung mit der vorgefundenen säkularen Umwelt kann es nicht allein mit Hilfe der Offenbarungstheologie bestreiten, die auf die Fragen nach Staatsform, Staatszweck und Stellung des Bürgers, wenn überhaupt, dann keine abschließende Antwort gibt. Damit ist es verwiesen auf die natürliche Vernunft als Erkenntnisquelle und auf das Gespräch mit der »Welt«. Die Kirche öffnet sich der Welt, auf die sie einwirken will. Die Entwicklung christlicher Staatsauffassungen vollzieht sich durch Annahme und Aneignung vor- und außer-christlicher Gehalte. Wichtig wird vor allem die Rezeption naturrechtlicher Lehren durch die Kirche. Am Anfang der christlichen Staatslehre steht die Rezeption des stoischen Naturrechts, als die Kirche in die spätantike Gesellschaft hineinwächst und die Reflexion über diese Gesellschaft notwendig wird26. Die stoische Vorstellung von einem goldenen Zeitalter der Tugend, seinem Zerfall durch die Leidenschaftlichkeit der Menschen, dem weltbürgerlichen Menschheitsziel, der universalen Weltvernunft lassen sich mit der christlichen Offenbarung verbinden: mit der Lehre vom paradiesischen Urzustand, von Sündenfall und Erlösung, von der göttlichen Lenkung des Weltgeschehens. Die Grundstrukturen dieser Naturrechtskonzeption bleiben für die christliche Staatsphilosophie offen oder latent wirksam, nicht minder für ihre säkularen Ableger in der Neuzeit bei Hobbes, Locke, Rousseau. Ihre höchste Reife erlangt die kirchliche Sozialphilosophie im Mittelalter, als Thomas von Aquin die aristotelische Philosophie aufnimmt und in ein universales System einschmilzt, in dem biblisch-stoische Tradition, römische und germanische Rechtsvorstellungen, kirchliche, imperiale wie feudale Institutionen, patriarchalisches Staatsdenken auf der Grundlage von Autorität und Pietät, ständisches Ethos von Treue und Fürsorge sowie das christliche Liebesgebot zusammenfinden. Die Rezeption säkularer Gehalte ist allerdings nur einer der Vorgänge in der 26 Unübertroffene Darstellung, ungeachtet aller kulturprotestantischen Patina, E. Troeltsch (Fn. 23), bes. S. 148 ff., 178 ff.
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
61
Symbiose von Christentum und Welt. Beide Seiten geben und nehmen. Vorrangige Aufmerksamkeit fordert der Einfluß des Christentums auf die Welt, wie er beschrieben wird im Gleichnis vom Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert.
3.
Ambivalenz des Christentums
a)
Distanz zum Staat und Umgestaltung des Staates
Wenn das Reich, das Christus verkündet, nicht von dieser Welt ist, kann kein irdischer Staat beanspruchen, die Verheißung zu erfüllen und das endzeitliche Reich des Heils zu sein. Zwischen der diesseitigen Welt und dem Reich Gottes besteht eine unaufhebbare Differenz, die keine Analogie zuläßt. Die Botschaft des Neuen Testamentes ist weder konservativ noch progressiv. Sie dient weder dazu, die bestehende Ordnung zu rechtfertigen, noch dazu, die Revolution zu heiligen. Dennoch wirkt das Christentum, so wie es in der Spätantike politische Wirksamkeit erlangt, kraft seines geistlichen Anspruchs auf die bestehende staatliche Ordnung ein und verwandelt diese von Grund auf. Es sprengt die staatlich-religiöse Einheit, innerhalb deren Religion und Kult im Dienst des Imperiums stehen, und unterwirft die staatliche Herrschaft dem Wort des Christentums: »der größte Umschlag, der jemals vorgekommen«27. Die Revolution vollzieht sich freilich nicht im ganzen Wirkungskreis des Christentums, sondern allein in seiner westlichen, der lateinischen Hemisphäre. Sie erfaßt nicht die östliche Hemisphäre, die griechische und die russische Orthodoxie. In Konstantinopel wie in Moskau, im zweiten wie im dritten Rom, tritt an die Stelle der heidnischen Imperialreligion die christliche Imperialreligion des Cäsaropapismus. Der religiöse Inhalt wechselt, die politische Struktur bleibt: die monolithische Einheit des Staatswesens, das sich die Kirche einverleibt und das sie als Gegenstand wie als Instrument der Herrschaft behandelt. Auch die lateinische Welt hält an der staatlich-kirchlichen Einheit des Corpus Christianum fest. Doch die Einheit differenziert sich aus zur Polarität von Imperium und Sacerdotium, lädt sich auf mit innerer Spannung, die in der Krise des Investiturstreites dazu führt, daß Kaiser und Papst ihre Sphären unterscheiden und die Reichweite des weltlichen wie des geistlichen Schwertes abgrenzen müssen. Thomas betrachtet zwar wie Aristoteles den Staat als societas perfecta; aber er relativiert die Deutung, indem er dem Staat die Kirche, ihrer27 Zitat: J. Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen (1905), Ausgabe von R. Stadelmann 1949, S. 149.
62
Josef Isensee
seits als societas perfecta, an die Seite stellt und die eine vollkommene Gemeinschaft dem natürlichen, die andere dem übernatürlichen Bereich zuordnet28. Damit setzen Entwicklungen ein, die in der Neuzeit, als die Glaubenseinheit zerbricht, zum Rückzug des Staates aus der Sphäre der Religion führt, zur Beschränkung auf innerweltliche Aufgaben, kurz: zu seiner Säkularisierung29. Doch bereits in der mittelalterlichen Staat-Kirche-Polarität wird der christliche Dualismus geschichtsmächtig: zwischen Immanenz und Transzendenz, Profanem und Sakralem, Gesetz und Gewissen30. Die Unterscheidungen treiben in der Neuzeit weitere, analoge Unterscheidungen hervor: zwischen Recht und Moral, zwischen Institution und Geist. Die Entzweiung, die vom Christentum ausgeht, führt in ihren politischen Wirkungen das Prinzip Gewaltenteilung herauf, zunächst in der Beziehung von Staat und Kirche, sodann in der von Staat und Gesellschaft, schließlich im Innenbereich der Staatsorganisation zwischen ihren verschiedenen Funktionen. Die Entwicklung mündet schließlich ein in den Verfassungsstaat: den Typus des sektoralen, säkularen, gewaltenteiligen Staates. Von jeher akzeptiert die katholische Kirche nur den in seinen Zielen und Mitteln begrenzten Staat. In alle politischen Epochen bringt sie das Postulat ein von vorgegebenen Grenzen der Staatsgewalt. Seit dem Jakobinerterror wird sie immer wieder mit politischen Totalitärismen konfrontiert, die, jedwede Gewaltenteilung aufhebend, Staat und politische Kirche zugleich, auf den ganzen Menschen zugreifen, auf Verhalten wie auf Gesinnung. Dagegen stellt die Kirche ihren Anspruch auf spirituelle und auf institutionelle Selbstbehauptung. Sie bleibt sich im Wandel der Zeiten treu. Wenn sie auch zuweilen Sukkurs sucht bei einem autoritären Staat, so erkennt sie den totalitären Staat in allen seinen Erscheinungen als ihren Feind, der, unbegrenzt in seinen Zielen, hemmungslos in seinen Mitteln, jedwede Gewaltenteilung rückgängig macht, auf den ganzen Menschen zugreift und selber Kirche sein will, Kirche einer politischen Heilslehre31. Noch einmal: Die Entwicklung zur Gewaltenteilung erfaßt nicht die ganze Welt der Christenheit. Der Osten, der Raum der Orthodoxie, nimmt nicht daran teil. Nur in der lateinischen Welt ereignen sich Renaissance und Aufklärung, die 28 Zur Societas-perfecta-Lehre J. Listl (Fn. 3), S. 104 ff. (Nachw.). 29 Zur Säkularisierung als Geburtsakt des modernen Staates: E.-W. Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation (1967), in: ders., Staat-Gesellschaft-Freiheit, 1976, S. 42 ff.; H. Quaritsch, Staat und Souveränität, Bd. I, 1970; A. Uhle, Staat – Kirche – Kultur, 2004, S. 67 ff.; C. Hillgruber, Staat und Religion, 2007, S. 7 ff. 30 Zum Dualismus des Christentums: E.-W. Böckenförde, Zum Verhältnis von Kirche (Fn. 20), S. 159 ff.; M. Rhonheimer, Christentum und säkularer Staat, 2012, S. 33 ff. 31 Vgl. H. Maier, Das totalitäre Zeitalter und die Kirchen, in: Historisches Jahrbuch 112 (1992), S. 383 ff.; J. Isensee (Fn. 15), S. 324 f. Zu Begriff und Sache des Totalitarismus: K. D. Bracher, Zeitgeschichtliche Kontroversen, 21976, S. 33 ff; B. Seidl/S. Jenkner (Hrsg.), Wege der Totalitarismus-Forschung, 31974.
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
63
Geburt der Moderne und die Inkubation des Verfassungsstaates. Doch brechen sich diese Entwicklungen nicht an den konfessionellen Grenzen, wie sie seit der Reformation bestehen. In ihrer säkular-politischen Dimension wahrt die lateinische Christenheit über die konfessionelle Spaltung hinweg ein hohes Maß an Gemeinsamkeit32. b)
Rechtfertigung und Relativierung des Staates
Mit dem Christentum gerät jede irdische Ordnung unter Rechtfertigungszwang vor einer transzendenten Ordnung, die ihr unverfügbar vorgegeben ist. Der Christ akzeptiert den Staat, wie immer er verfaßt ist, nur deshalb, weil er seine Gewalt von Gott empfängt. Er leistet ihm den bürgerlichen Gehorsam, doch nicht aus Furcht vor dessen Sanktionen, sondern aus Einsicht in die Anordnung Gottes (Röm 13). Diese aber ist nicht nur Grund, sondern auch Grenze der Staatsgewalt. Die bürgerlichen Pflichten enden am Widerstandsrecht, das der Christ sich vorbehält, weil er Gott mehr gehorchen muß als den Menschen (Apg 5, 29). In der Transzendenzperspektive gewinnt der Christ geistige Freiheit gegenüber der diesseitigen Autorität. Er akzeptiert sie nicht, weil sie selbst es will, sondern weil Gott es will. Die christliche Rechtfertigung des Staates bedeutet seine Relativierung. Der Christ gehorcht ihm, indem er zu ihm auf Distanz geht. Der christliche Letztvorbehalt gegenüber menschlichen Normen, wie er in der Clausula Petri (Apg 5, 29) aufscheint, ist theonom begründet. In der Geschichte war es lange Zeit die Kirche, die der Obrigkeit und dem Bürger interpretierte, was Gottes Wille, mithin was Staats- und was Bürgerpflicht sei, wann Normalfall und wann Widerstandsfall bestehe. Doch nach christlicher Lehre spricht Gott auch unvermittelt zum Einzelnen im Anruf des Gewissens. In der theonomen Rechtfertigung des Staates liegt der Keim zu seiner säkular-autonomen Rechtfertigung aus der Subjektivität des Individuums.
32 Auf reformatorischer Seite weist die geschichtliche Entwicklung deutliche Parallelen zur katholischen auf: von der Ablehnung der Menschenrechte und der Demokratie zu ihrer Annahme. Dazu: M. Heckel, Die Menschenrechte im Spiegel der reformatorischen Theologie (1987), in: ders. (Fn. 24), Bd. II, S. 1122 ff. (Nachw.). Freilich verbleiben durch alle Säkularisierung hindurch konfessionstypische Unterschiede der politischen Mentalität und des sozialen Verhaltens. Aufschlussreich: G. Schmidtchen, Protestanten und Katholiken, 1973; A. Püttmann, Ziviler Ungehorsam und christliche Bürgerloyalität. Zum Zusammenhang von Konfession und Staatsgesinnung in der grundgesetzlichen Demokratie, 1994, S. 169 ff., 315 ff.
64 4.
Josef Isensee
Christliches Menschenbild und Menschenrechte
Im Menschenbild des Christentums, das auf Schöpfung und Erlösung gründet, sind wesentliche Züge der modernen Menschenrechte angelegt: die Einheit des Menschengeschlechts, das auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgeht, die Gleichheit aller, die von Gott erschaffen sind, die Einmaligkeit jedes einzelnen Menschen, in dem sich ein Gedanke Gottes verkörpert, seine Personalität und Eigenverantwortung.33 Die Schöpfungs- und Erlösungslehre begründet die Würde des Menschen, und zwar nicht nur für das Abstraktum Menschheit, sondern für jeden einzelnen, der geschaffen und erlöst, zum ewigen Heile berufen und deshalb zu irdischer Bewährung gehalten ist.34 Die dignitas humana kommt dem Menschen als Person zu. Die dignitas gründet im göttlichen Ursprung des Menschen als Gottes Ebenbild und in der Menschwerdung Gottes. Die Papst Leo dem Großen zugeschriebene Weihnachtsoration der römischen Meßliturgie faßt die christliche Begründung großartig in Worte: »Deus, qui humanae substantiae dignitatem et mirabiliter condidisti et mirabilius reformasti: da, quaesumus, nobis Jesu Christi filii tui divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostrae fieri dignatus est particeps.«35 Dagegen vermag die Verfassung, die Würde des Menschen, ihr oberstes Prinzip, nur anzunehmen, nicht aber zu begründen. Die Philosophie des säkularen Staates kann sie postulieren, nicht aber ableiten, weil die Würde, die dem Menschen unverlierbar, unverfügbar und unabwägbar eigen ist, innerhalb des säkularen Horizonts kein höheres Prinzip über sich kennt. Die Entsprechung des christlichen Menschenbildes zu den modernen Menschenrechten darf jedoch nicht als Kongruenz verstanden werden. Das Christentum zeigt den Menschen in seiner Beziehung zu Gott. Diese aber präjudiziert nicht ohne weiteres die Beziehung des Menschen zur Staatsgewalt; aber sie 33 Zum christlichen Menschenbild und seinem Einfluß auf die modernen Menschenrechte: W. Kasper (Fn. 16), S. 14 ff.; M. Heckel (Fn. 32), S. 1122 ff.; F.-L. Hossfeld, Grundzüge des biblischen Menschenverständnisses, in: A. Rauscher (Hrsg.), Christliches Menschenbild und soziale Orientierung, 1993, S. 9 ff.; H. Maier, Überlegungen zu einer Geschichte der Menschenrechte, in: FS für P. Lerche, 1993, S. 43 (48 ff.); A.Uhle (Fn. 20) Freiheitlicher Verfassungsstaat, S. 126 ff., 153 ff.; A. Angenendt, Toleranz und Gewalt, 2009, S. 110 ff, 190 ff. – Exegetische Kritik an kurzschlüssigen Deduktionen: K. Berger, Die Wahrheit ist Partei, 2007, S. 149 ff. – Position der Irrelevanz des Christentums für die Genese der Menschenrechte und ihr heutiges Verständnis: H. Hofmann, Methodische Probleme der juristischen Menschenwürdeinterpretation, in: I. Appel/G. Hermes (Hrsg.), Mensch – Staat – Umwelt, 2008, S. 47 (54 ff.); H. Dreier, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. I, 22004, Art. 1 Abs. 1 Rn. 5 ff. 34 Zur Bedeutung des Christentums für das Verständnis der Menschenwürde im säkularen Verfassungsrecht: J. Isensee, Würde des Menschen, in: D. Merten/H.-J. Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte, Bd. IV, 2011, § 87 Rn. 58 ff. 35 Text in: E. Moeller (Hrsg.), Corpus orationum 2, 1993, S. 361 (1692a).
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
65
bereitet sie vor. Daß Gott den Menschen als sein Bild und Gleichnis geschaffen hat,36 zeitigt schon im Kontext der Genesis ethische Reflexe in dem Verbot, Menschen zu töten: »Wer Menschenblut vergießt, des Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen ja zu seinem Bilde gemacht.«37 Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen macht den Mord zu einem Sakraldelikt. Das Leben des einen entzieht sich der Macht des anderen, weil es Gott gehört. Dem Menschen ist Verfügung über die niedere Kreatur gegeben, nicht aber über seinesgleichen. Die Analogie von transzendenten auf immanente Vorstellungen liegt nahe, und sie hat sich in der Geschichte realisiert. Die individualistischen Beziehungen zu Gott strahlen aus auf die innerweltlichen Beziehungen und beeinflussen das gesellschaftliche Klima. Eine tatsächliche Affinität des Christentums zur Demokratie amerikanischer Art wird schon von Tocqueville festgestellt: Christen, deren religiöses Gemüt von Wahrheiten des Jenseits zehre, erwärmten sich »für die Freiheit des Menschen, die Quelle aller sittlichen Größe. Das Christentum, das alle Menschen vor Gott gleich werden ließ, wird sich nicht dagegen sträuben, daß alle Bürger vor dem Gesetz gleich werden«38. Vor Gott gilt kein Unterschied zwischen Freien und Sklaven. Damit tritt das Christentum in tiefen Widerspruch zur antiken Gesellschaft, die, auf einem mächtigen Fundament von Sklaven aufbauend, nur einer kleinen Schicht das volle Bürgerrecht vorbehielt und nur den wenigen Großen die volle Entfaltung des Menschseins zuerkannte: »Humanum paucis vivit genus.«39 Gleichwohl will das Christentum deshalb nicht die bestehende Gesellschaftsordnung abschaffen. Nicht diese ist sein Thema, sondern ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Dennoch führt die christliche Botschaft auf indirektem Wege zur Delegitimation der Sklaverei. Sie löst einen historischen Prozeß aus, der im 16. Jahrhundert zu ihrem Verbot durch Papst Paul III. und schließlich auch zu ihrer Abschaffung führt.40 Der Glaube, daß es vor Christus nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau gibt, sondern in ihm alle eins sind,41 bereitet der allgemeinen Rechtsgleichheit den Boden. Eben darum wird Nietzsche das Christentum verfluchen: »Die ›Gleichheit der Seelen vor Gott‹, diese Falschheit, dieser Vorwand für die rancunes aller Niedriggesinnten, dieser Sprengstoff von 36 Gen 1, 27. 37 Gen 9, 6. 38 A. de Tocqueville, De la d¦mocratie en Am¦rique (1835 – 40), (dt.) Über die Demokratie in Amerika (hrsg. von J. P. Mayer), 1976, I. Teil Einleitung (S. 14). 39 Lucanus, Bellum civile (»Pharsalia«), 5, 343 – Julius Cäsar in den Mund gelegt. 40 Dazu bereits J. de Maistre, Du Pape, Tome Second, Lyon, 1836, S. 118 ff. (libert¦ civile des hommes). Heutige Sicht J. Höffner (Fn. 22), S. 60 ff., 195 f. 41 Gal 3, 28. Vgl. auch Kol 3, 11; Röm 10, 12; 1. Kor 12, 13.
66
Josef Isensee
Begriff, der endlich Revolution, moderne Idee und Niedergangs-Prinzip der ganzen Gesellschaftsordnung geworden ist – ist christlicher Dynamit.«42 Das Christentum hat sich im Mittelalter mit patriarchalischen Gewaltverhältnissen und mit universalistischem Staatsdenken verbunden. Erst in der Neuzeit bricht sich der Individualismus politische Bahn, und der Einzelne begreift seine Freiheit, Gleichheit und Würde als Recht, sich von hergebrachten Autoritäten und aus tradierten Ordnungen zu emanzipieren. Die Rolle der Kirche in der Wirkungsgeschichte der Freiheitsidee ist ambivalent. Sie hat den Entwicklungsprozeß der Menschenrechte behindert, und sie hat ihn gefördert. Das Urteil wechselt mit dem jeweils gewählten Abschnitt der Geschichte. Doch auch dort, wo sie, bei unhistorischer Rückprojektion heutiger Maßstäbe, sich im krassesten Widerspruch zu den Menschenrechten befand, als sie dem Häretiker weder die Gewissensfreiheit zuerkannte noch das Recht auf Leben und ihn in den Feuertod stieß, achtete sie die geistliche Essenz seiner Person, maßte sie sich nicht an, über sein ewiges Heil zu verfügen und dem Spruch Gottes vorzugreifen. Wenn nach Thomas die staatliche wie die kirchliche Autorität den häretischen oder den abtrünnigen Christen (nicht jedoch den Heiden oder den Juden) zwingen durften, auch mit Drohung der Todesstrafe, ihr einmal gegebenes Taufversprechen zu erfüllen43, also insoweit die Berufung auf das Gewissen nicht half, so erkannte Thomas dennoch dem Gewissen, sogar dem schuldlos irrenden Gewissen, sittliche Letztverbindlichkeit zu. Im Konflikt mit dem staatlichen oder dem kirchlichen Gebot gehe das Gebot des Gewissens vor, auch auf die Gefahr der Exkommunikation hin44. Wer im Gewissen überzeugt sei, der Glaube an Christus sei etwas Schlechtes, sei auch kraft seines Gewissen verpflichtet, sich diesem Glauben fernzuhalten45. Gewissensfreiheit im menschenrechtlichen Sinne war das nicht. Vor dem Ketzergericht bot die Berufung auf die Gewissenspflicht keinen Rechtfertigungsgrund. Doch sie wies auf die Rechtfertigung vor Gott. Darin aber ist der Kern des christlichen und der Keim des staatsethischen Individualismus bezeichnet: Der Einzelne steht, kraft seines Gewissens, wenn es um die letzten Dinge geht, unmittelbar zu Gott. Er ist insoweit nicht auf Vermittlung durch irdische Instanzen angewiesen. Dem Gewissen vermag auch der Scheiterhaufen nichts anzuhaben. Es bildet den unzerstörbaren und den unverfügbaren Grund der Person. Auf diesem religiösen Grund erwächst der
42 F. Nietzsche, Der Antichrist (1888), in: ders., Sämtliche Werke (Ausgabe Colli/Montinari), 6. Bd., 1999, S. 252. 43 Summa theologica, II 2 qu. 10, 8 und qu. 11, 3 ad 3. Dazu und zum Folgenden H. Welzel, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, 41962, S. 63 ff. Zu Häretikerbehandlung und Inquisition: A. Angenendt (Fn. 33), S. 245 ff., 263 ff. 44 Summa theologica, II 2 qu. 104, 1 ad 1; De veritate XVII 5 ad 4. 45 Summa theologica, II 1 qu. 19, 5.
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
67
Anspruch auf sittliche und auf rechtliche Autonomie auch gegenüber den Institutionen des Diesseits46.
5.
Aktivität und Rationalität
Die jüdisch-christliche Religion enthält in sich vielfache Kräfte der Aufklärung. Sie ergeben sich schon aus dem Gottesbild. Da Gott sich als Geist offenbart, hat die Dingwelt nicht göttlichen Charakter. Sie ist weltlich und so dem Zugriff des Menschen verfügbar. Die Religion bannt die magische Angst vor der Natur, entzaubert die Erde und fordert den Menschen auf, sie sich untertan zu machen. Sie entbindet Zuwendung zur Welt im Handeln wie im Erkennen, Aktivität und Rationalität. Aufklärerisch ist auch die neutestamentarische Kritik am äußerlichen, verkrusteten Verständnis des Gesetzes. Aktivität und Rationalität sind Wesenszüge des modernen Staates, der dazu organisiert und mit Blankovollmacht ausgestattet ist, daß er den jeweiligen Erfordernissen des Gemeinwohls situationsgemäß und wirksam Genüge tut47. Dennoch ist seine Kompetenz, die Leistungen zu erbringen, die das Gemeinwohl erfordert, nur subsidiär. Die primäre Gemeinwohlkompetenz fällt den Bürgern und freien Verbänden zu. Das Gemeinwesen, das seinen Bestand wie sein Gedeihen auf die private und die politische Freiheit seiner Bürger gründet, baut auf ihre Initiative, Leistungsbereitschaft und Tüchtigkeit und vertraut auf ihre praktische Vernunft. Der Wille zur Aktivität des Individuums und das Vertrauen in seine Rationalität leiten denn auch den Emanzipationsdrang, der die politische Moderne kennzeichnet48. Auswirkungen des Christentums auf die säkulare Mentalität werden deutlich im Kontrast zum Hinduismus. Wenn im Glauben an die Wiedergeburt das Leben als wiederholbar erscheint, ersteht eine Seelenverfassung des Gleichmuts und der Gleichgültigkeit angesichts der Daseinsprobleme, eine lethargische Kultur der stehenden Zeit in der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Der christliche 46 H. Welzel deutet die thomasische Gewissenslehre als »einen Höhepunkt im Entwicklungsprozeß um die Herausbildung des auf sittliche Autonomie gegründeten Persönlichkeitsbegriffs« (Fn. 43), S. 63. Vgl. auch E.-W. Böckenförde, Zum Verhältnis von Kirche (Fn. 20), S. 162. 47 Zu Rationalismus und Aktivität als Merkmalen des modernen Staates: H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, 21966, S. 53 ff., 62 ff. Vgl. auch M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (1922), Studienausgabe von J. Winckelmann, 2. Hbb. 1964, S. 1034 ff. – Zum Einfluß des Christentums, zumal dem des Katholizismus auf die okzidentale Rationalität: G. Eisermann, Max Weber und die Nationalökonomie, 1993, S. 159 ff. 48 Zu diesen Verfassungserwartungen: J. Isensee, Grundrechtsvoraussetzungen und Verfassungserwartungen an die Grundrechtsausübung, in: HStR IX, 32011, § 190 Rn. 223 ff, 233, 277 ff.
68
Josef Isensee
Glaube an die Einzigkeit des Lebens als diesseitige Bewährung für das ewige Heil gibt das Kairûs-Bewußtsein. Die knappe, rasch und unwiederbringlich verrinnende Lebenszeit ist hier und heute optimal zu nutzen: als Anstrengung des Läufers in der Rennbahn, als Vorsorge des Bauern für den Tag der Ernte – alles freilich im Blick auf das transzendente Ziel, nicht aber auf die irdischen Güter, die Rost und Motten verzehren. Doch jenseitsorientierte Aktivität, Werkfrömmigkeit und Spiritualität kehren sich in der Neuzeit auf diesseitige Ziele, schlagen um in Entdeckungsdrang, Unternehmerinitiative, Arbeitsethos, innerweltliche Askese49. Die christliche Einsicht, daß auf Erden kein Paradies herstellbar ist, bedeutet nicht Resignation und heiligt nicht Quietismus. Sie hebt die Pflicht des Christen nicht auf, sich hier und heute in der Welt, wie sie ist, zu bewähren, wohl aber läutert sie die irdischen Hoffnungen und Enttäuschungen, wenn sie zeigt, daß das Ziel der Vollkommenheit niemals erreicht werden kann, obwohl die Lebensaufgabe im Diesseits darin besteht, es nach Kräften anzustreben.
6.
Das Prinzip des Amtes
Der moderne Staat, der das mittelalterliche Feudalwesen ablöst, übernimmt von der katholischen Kirche das Prinzip des Amtes50. Das Amt umfaßt einen rechtlich definierten Ausschnitt von staatlichen Befugnissen, die ihrem Inhaber zur treuhänderischen Ausübung im ausschließlichen Dienst und Interesse der Allgemeinheit überantwortet werden, unter Ausschluß des privaten Eigennutzes des Inhabers und seiner subjektiven Eigenmacht. Im Amt verwandelt sich die Handlungsmacht der Organisation in die persönliche Pflicht des Inhabers. Potestas wird officium. Das Amt ist der kleinste Baustein der verfassungsstaatlichen Organisation. An das Prinzip des Amtes knüpft die rechtsstaatliche Bindung der Staatsgewalt, die föderale Kompetenzverteilung, die demokratische Legitimation51. 49 Dazu M. Weber (Fn. 47), S. 413 ff. 50 Zu den Ursprüngen E. Dassmann, Ämter und Dienste in den frühchristlichen Gemeinden, 1994. – Zur staatlichen Rezeption des Ämterprinzips H. Hattenhauer, Geschichte des deutschen Beamtentums, 21993, S. 11 ff. Vgl. auch E.-W. Böckenförde, Zum Verhältnis von Kirche (Fn. 20), S. 166 f. 51 Zu Tradition und aktueller verfassungsrechtlicher Bedeutung des Amtsprinzips: W. Hennis, Amtsgedanke und Demokratieprinzip, in: FS für R. Smend, 1962, S. 51 ff.; W. Loschelder, Vom besonderen Gewaltverhältnis zur öffentlichrechtlichen Sonderbindung, 1982, S. 227 ff.; P. Graf Kielmansegg, »Die Quadratur des Zirkels«, in: U. Matz (Hrsg.), Aktuelle Herausforderungen der repräsentativen Demokratie, 1985, S. 9 ff.; O. Depenheuer, Das öffentliche Amt, in: HStR III, 32005, § 36; J. Isensee, Kanonistisches Erbe im säkularen Staat, in: Festschrift für R. Sobnski, 2000, S. 113 ff.
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
69
Die mittelalterliche Kirche kämpft im Investiturstreit um die Unabhängigkeit der Stellenbesetzung und der Amtsführung von der weltlichen Gewalt. Sie kämpft auch um die Lauterkeit, die Sachlichkeit, die hierarchische Loyalität des Amtes in der Abwehr von Simonie und Nepotismus. Der Zölibat fordert die vorbehaltlose Hingabe an die Sachaufgabe; er schließt die Erblichkeit des Amtes aus, damit private Verfügbarkeit. Mit dem Amtsgedanken übernimmt die Kirche antikes Staatsethos, daß Herrschaft nicht im Eigeninteresse des Herrschenden ausgenützt werden darf und das gute Gemeinwesen durch das Gemeinwohl konstituiert wird: res publica res populi. Die Res-publica-Tradition wird über die katholische Kirche dem neuzeitlichen Staat vermittelt, wie sie ihm denn auch sonst antikes Erbe, etwa das römische Recht, weitergibt. Sie sichert europäische Kontinuität und wirkt mit, das staatsethische Fundament des modernen Staates zu legen: daß legitim nur die staatliche Herrschaft für das Volk ist. Dieses republikanische Prinzip geht dem demokratischen Prinzip voraus, daß legitim ist nur die Herrschaft durch das Volk52. Der moderne Staat findet in der Kirche auch sein Organisationsmodell: die zweckrationale, hierarchisch strukturierte Anstalt.
III.
Das Christentum als soziokulturelle Voraussetzung des Verfassungsstaates
1.
Fortdauernde Bedeutung der christlichen Ursprungsbedingungen
Zwischen Christentum und Verfassungsstaat besteht nicht allein ein historischer, sondern auch ein aktueller Wirkungszusammenhang. Der Verfassungsstaat lebt weiter auf dem europäischen Kulturboden, in dem er entstanden ist, aus dem Humus seiner Geschichte, und er zehrt von seinen Substanzen, zu denen das Christentum gehört, das diesen Boden im Laufe der Jahrhunderte durchdrungen und geprägt hat. Hier kommt es nicht darauf an, wie weit sich die Gesellschaft von der Religion ihrer Herkunft gelöst hat. Die Herkunft aus dem Christentum ist ihr unablöslich mitgegeben, auch ohne daß sie sich deren erinnern und sich zu ihr bekennen müßte. Säkularisiert und vielfältig vermittelt, wirken christliche Momente in Psyche und Verhalten der Gesellschaft, in Ethos und Normen. Damit aber wirken sie auch auf die Institutionen des Verfassungsstaates ein. Mehr als jeder andere Staatstypus ist er abhängig von Voraussetzungen, die 52 Zum Res-publica-Prinzip: J. Isensee, Staat (Fn. 6), Sp. 141 f.; R. Gröschner, Die Republik, in: HStR II, 32004, § 23 Rn. 13 ff., 53 ff.
70
Josef Isensee
seinem Zugriff nicht unterliegen53. Er gründet auf der Freiheit der Bürger, und, was ihm an Ordnungsmacht zukommt, geht aus ihren Leistungen hervor, die er, aufs Ganze gesehen, nicht erzwingen und nicht ersetzen kann. Daher steht und fällt er damit, daß die Bürger, wenn nicht in der Absicht, so doch im Effekt, von ihrer Freiheit einen gemeinwohlförderlichen Gebrauch machen. Seine Erwartungen richten sich auf Aktivität, Tüchtigkeit, Ethos der Bürger, auf Potenzen der Moral und der Religion, in ihnen auf das christliche Erbe. Doch das Erbe wäre rasch verbraucht, wenn es sich nicht stetig erneuerte und mehrte und wenn die religiöse Quelle versiegte, aus deren Aufkommen der säkulare Staat schöpft. Damit richtet sich auf das Christentum eine Erwartung des säkularen Verfassungsstaates, die nicht seiner eigentlichen, religiösen Botschaft gilt, sondern deren säkularen, gemeinwohldienlichen Nebenwirkungen54. Diese werden von den Theoretikern des Verfassungsstaates von jeher aufmerksam beobachtet. Nach Tocqueville rufen auch die Anhänger des modernen Freiheitsgedankens, »deren Blicke mehr auf die Erde als zum Himmel gerichtet sind«, die Religion eilig um Hilfe; »denn sie müssen wissen, daß man das Reich der Freiheit nicht ohne die guten Sitten zu errichten und die guten Sitten nicht ohne den Glauben zu festigen vermag«55. Montesquieu untersucht die verschiedenen Religionen der Welt auf den Nutzen hin, den der Staat aus ihnen zieht, und zwar gleich, ob es sich um eine Religion handele, die ihren Ursprung im Himmel habe, oder um die vielen anderen, die auf der Erde wurzelten. Er stellt fest, daß eine gemäßigte, freiheitliche Regierung gerade der christlichen Religion entspreche und daß diese, indem sie den Menschen befehle, einander zu lieben, auch darauf hinwirke, daß jedes Volk die besten politischen und bürgerlichen Gesetze habe. »Es ist wunderbar : die christliche Religion, die nur auf die Glückseligkeit des Jenseits zu zielen scheint, beschert uns auch das Glück im irdischen Leben«56.
53 Dazu E.-W. Böckenförde (Fn. 29), S. 69; ders., Der Staat als sittlicher Staat, 1978, S. 36 f.; J. Isensee (Fn. 48), § 190 Rn. 195 ff. 54 Näher J. Isensee, Verfassungsstaatliche Erwartungen an die Kirche, in: Essener Gespräche Bd. 25 (1991), S. 105 ff. (bes. S. 136 ff.). S. auch E.-W. Böckenförde (Fn. 29), S. 60 f. 55 A. de Tocqueville (Fn. 38), S. 14. 56 C. de Montesquieu, De l’Esprit des Lois (1748), XXIV, 1, 3 (dt. von E. Forsthoff, 21992, S. 160 f., 163). Zur Instrumentalisierung der Religion für Zwecke der Aufklärung: C. Link, Christentum und moderner Staat, in: L. Lombardi Vallauri/G. Dilcher (Hrsg.), Christentum, Säkularisation und modernes Recht, 1981, S. 853 (854, 858 ff. – »natürliche Religion« als Gebot der Staatsraison); H. Lübbe, Religion nach der Aufklärung, 1986, S. 219 ff.
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
2.
71
Universalisierbarkeit des Verfassungsstaates als Problem
Der Verfassungsstaat strebt nach weltweiter Verbreitung57. Sein Erfolg ist heute größer denn je, seit sein wichtigster Rivale im 20. Jahrhundert, der totalitäre Staat des Sozialismus, politisch am Boden liegt, ökonomisch und moralisch diskreditiert. Unter den Staatstypen der Gegenwart hat der Verfassungsstaat des Westens die ideelle Hegemonie erlangt. Die Idee, die er verkörpert, erweist sich heute als die mächtigste aller politischen Ideen: die Freiheit in ihrer zwiefachen Ausprägung als grundrechtliche Selbstbestimmung des Individuums und als demokratische Selbstbestimmung des Volkes, die aus der Mitbestimmung des Bürgers hervorgeht. Die Menschenrechte, ihrer Intention nach angelegt auf universale Geltung, für einen jeden, der Menschenantlitz trägt, werden weltweit anerkannt in Staatsverfassungen wie in internationalen Deklarationen und Pakten. Nahezu kein Staat, der sich nicht als demokratisch deklarierte. Neuerlich mehren sich auch die Bekenntnisse zu Rechtsstaat, Gewaltenteilung und Parlamentarismus. Alle Welt erweist den Gedanken des Verfassungsstaates zumindest semantische Reverenz. Freilich handelt es sich weitgehend auch nur um Semantik, wenn sie außerhalb ihres europäisch-amerikanischen Herkunftsraumes Zustimmung finden. Der Konsens im Namen der Menschenrechte und der Demokratie ist vielfach Formelkonsens, der den Dissens in der Sache verschleiert. Menschenrechte und Demokratie erweisen sich in der babylonischen Sprachenverwirrung, die in der Staatenwelt herrscht, als sinnvariabel. Hier wirkt sich der unterschiedliche Verständnishorizont der Kultur aus, und in dieser die Religion. In Asien und Afrika ist es im wesentlichen die europäisierte Oberschicht, welche die genuin europäischen Staatsgedanken aufnimmt. Die Oberschicht aber ist dünn und fragil. Noch steht der Nachweis aus, ob der Verfassungsstaat tiefere Wurzeln treiben kann, ob etwa in Indien die »Westminster«-Demokratie den ganzen Demos erreicht oder ob die Menschenrechte unter heterogenen soziokulturellen Voraussetzungen effektive Wirksamkeit erlangen, etwa in einer afrikanischen oder asiatischen Gesellschaft, der emanzipatorische Bestrebungen fremd sind, die nicht auf die Freiheit des Individuums sieht, sondern auf seine Einbindung in 57 Zu den Universalisierungstendenzen der Menschenrechte: C. Tomuschat, Probleme des Menschenrechtsschutzes auf weltweiter Ebene, in: T. Berberich/W. Holl/K.-J. Maaß (Hrsg.), Neue Entwicklungen im öffentlichen Recht, 1979, S. 9 ff.; ders., Human Rights in a WorldWide Framework, in: ZaöRV 45 (1985), S. 547 ff.; L. Kühnhardt, Die Universalität der Menschenrechte, 1987, bes. S. 107 ff. (Nachw.); J. Isensee, Staat (Fn. 6), Sp. 139 f., 141 f.; W. v. Simson, Überstaatliche Menschenrechte, in: FS für K. J. Partsch, 1989, S. 47 ff.; K. Stern, Idee der Menschenrechte und Positivität der Grundrechte, in: HStR V, 22000, § 108 Rn. 45 ff., 54 ff.; B. Fassbender, Idee und Anspruch der universalen Menschenrechte in der Gegenwart, in: J. Isensee (Hrsg.), Menschenrecht als Weltmission, 2009, S. 11 ff.
72
Josef Isensee
Familie, Sippe, Orts- oder Stammesgemeinschaft. Zunehmend regen sich Zweifel daran, ob der Islam, dem die Trennung von Staat und Religion fremd ist, jemals zu einem modus vivendi wird finden können mit dem säkularem Verfassungsstaat, mit der Religionsfreiheit wie überhaupt mit individuellen Freiheits- und Gleichheitsrechten.58 Aus dem Islam wie aus anderen außereuropäischen Kulturkreisen erhebt sich prinzipielle Kritik am »Eurozentrismus« der Menschenrechte59. Die Kritik läßt sich nicht leichter Hand abtun, indem man sich auf ein kosmopolitisches Menschenbild beruft. Denn die Menschenrechte wie auch die demokratischen Rechte kommen den Menschen zu, wie sie kraft ihrer kulturellen Herkunft und ihrer sozialen Umwelt tatsächlich sind, und sie können nur Wirksamkeit verlangen, wenn sie sich mit den autochthonen Kulturen und Strukturen verbinden. Die Frage, ob die europäischen Staatsgedanken tatsächlich universalisierbar sind, also über den christlich-europäischen Kulturkreis hinauswachsen können, läßt sich heute noch nicht beantworten. Das Experiment der Universalisierung läuft. Immerhin ist schon die weltweit verbreitete Semantik der Menschenrechte und der Demokratie ein Hoffnungszeichen für einen erfolgreichen Ausgang des Experiments. Die Geschichte gerade der jüngsten Zeit zeigt: Das Wort kann der Sache den Weg bereiten.
3.
Das Europäische der Europäischen Gemeinschaft
Die Frage der soziokulturellen Fundierung des Verfassungsstaates gewinnt praktische Bedeutung für die Europäische Union, wenn sie sich zu entscheiden hat, welchem Beitrittsbegehren weiterer Staaten sie sich öffnen soll. Die Entscheidung stellt sich gegenüber der Türkei und den osteuropäischen Staaten. Der Staatenverein mit seiner wachsenden Kompetenzausstattung und Integrationsdichte und der zunehmenden Reichweite des Mehrheitsprinzips ist auf Homogenität seiner staatlichen Mitglieder angewiesen60. Diese ergibt sich wesentlich aus ihren Verfassungen, doch nicht aus der verbalen Übereinstimmung 58 Dazu M. Rhonheimer (Fn. 30), S. 38 f., 328 ff. 59 Dazu mit Nachw. L. Kühnhardt (Fn. 57), S. 107 ff.; O. Depenheuer, Risiken und Nebenwirkungen menschlicher Universalität, in: J. Isensee (Fn. 57), S. 81 ff. Ein Dokument des (halb verdeckten) Dissenses: Die »Allgemeine Islamische Menschenrechtserklärung« von 1981. Dazu A. Frhr. v. Campenhausen, Religionsfreiheit, in: HStR VII, 32009, § 57 Rn. 46. Vgl. auch A. Uhle (Fn. 29), , S. 155 ff. 60 Dazu H. P. Ipsen, Über Verfassungs-Homogenität in der Europäischen Gemeinschaft, in: FS für G. Dürig, 1990, S. 159 ff. Näher J. Isensee, Europa – die politische Erfindung eines Erdteils, in: ders. (Hrsg.), Europa als politische Idee und als rechtliche Form, 1993, S. 103 (122 ff.). – Zur europäischen Identität P. Häberle, Europäische Verfassungslehre, 62009, S. 53 ff.; A. Uhle, Freiheitlicher Verfassungsstaat (Fn. 20), S. 505 ff.; ders. (Fn. 29), S. 125 ff., 150 ff.
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
73
der Verfassungstexte, sondern aus der substantiellen Gemeinsamkeit der rechtlichen Grundordnungen. Diese aber hängen ab von soziokulturellen Voraussetzungen. Kultur und gesellschaftliches Ethos sind nicht nur mittelbar bedeutsam im Hinblick auf die Verfassungen. Sie sind letztlich die Sache selbst: das Europäische an der Europäischen Union. Europa ist keine Einheit der physischen Geographie, sondern eine Einheit des in langer Geschichte gewachsenen und gereiften sittlichen und kulturellen Bewußtseins61. Dieser Kontinent des Geistes ist wesentlich geformt durch das Christentum, genauer : durch das lateinische Christentum, das der Ort übernationaler säkularer Erfahrung ist, wie sie sich in Renaissance und Barock, Aufklärung und in der wissenschaftlich-technischen Epoche vollzogen hat. Das ostkirchliche Europa hat diese Entwicklung nicht mitvollzogen. Im politischen Bewußtsein reicht »Europa« nicht bis zum Ural, sondern nur bis Finnland und zum Baltikum, bis Polen und Ungarn, Slowenien und Kroatien – aber nicht darüber hinaus. Auf dem Balkan stoßen die religiös vorgeformten Elemente des Erdteils aufeinander : das lateinische Element, das orthodoxe und das islamische.
IV.
Die historische Abwehrhaltung der katholischen Kirche gegen die politische Moderne
Mit einigem Recht, wie wir gesehen haben, darf man die Menschenrechte und die Demokratie, darin allgemein den Verfassungsstaat, als Kinder des Christentums bezeichnen. Doch, in geschichtlicher Hinsicht, sind sie illegitime Kinder, gezeugt ohne den Segen der Kirche, von ihr verleugnet und verstoßen. Spät erst kommt es zur legitimatio per matrimonium subsequens.
1.
Konservierung des Ideals der vormodernen Einheitswelt wider den modernen Staat
Der prinzipielle Gegensatz zwischen Katholizismus und politischer Moderne reißt auf, als sich im Zeitalter der konfessionellen Bürgerkriege des 16. und 17. Jahrhunderts der moderne Staat herausbildet, und zwar vorerst im Verfassungsgewande der absolutistischen Monarchie62. Sein primäres Ziel ist die Herstellung eines Gesamtzustandes der inneren Sicherheit. Der Weg dazu führt 61 Näher J. Isensee (Fn. 51), S. 107 ff. (110 ff.). 62 Zur Entstehung des modernen Staates H. Quaritsch (N 29), S. 243 ff., 395 ff.; H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, 21966, S. 32 ff.; E.-W. Böckenförde (Fn. 9), S. 42 ff.
74
Josef Isensee
über Entwaffnung der potentiellen Bürgerkriegsparteien und Entmachtung der alten Feudalherren zur Aufrichtung der staatlichen Souveränität nach innen wie nach außen, auch gegen Kirche und Papst. Am Ende erhebt sich der moderne Staat als machtbewehrte, gewaltmonopolistische Friedenseinheit und als souveräne Entscheidungseinheit im Horizont säkularer Zwecke. Er löst das Dilemma, das der Zerfall der übernationalen Glaubenseinheit in der Reformation heraufführte: daß der Glaube, bisher Grundlage der staatlichen Einheit, sich in deren Sprengstoff verwandelt, indem er zunächst die konfessionelle Einheit auf seinem Territorium erzwang, er sich am Ende jedoch – unter dem Einfluß der Aufklärung –mit keiner Religion identifizierte und auf innerweltliche Aufgaben zurückzog.63 Der Verfassungsstaat übernimmt die Grundstruktur der Staatlichkeit von der absolutistischen Monarchie, gibt ihr die demokratische Legitimation und steckt ihr die rechtsstaatlichen Ziele und Grenzen64. Doch er teilt diese Grundstruktur mit allen Staatsformen der Gegenwart. Sie bildet den gemeinsamen Nenner der Staatlichkeit, auf dem die universale Ordnung des Völkerrechts aufbaut. Die Kirche stellt sich der Entwicklung des souveränen Staates von Anfang an entgegen. Die Souveränität tastet die Existenz der geistlichen Stände an. Sie trifft die politische Superiorität des Papstes. Die Kirche sieht den modernen Staat als generelle Gefährdung ihrer Unabhängigkeit; mit Grund fürchtet sie, daß er sie für seine Zwecke instrumentalisieren will. In erster Linie sind freilich ihre außergeistlichen Belange gefährdet. In den prinzipiellen Absagen der Päpste an die politische Moderne schwingt denn auch die Sorge um die Temporalien mit. Für Pius VI. ist im Jahre 1791 die Zivilkonstitution der französischen Nationalversammlung Anlaß zur Abrechnung mit den Ideen der Revolution im Breve »Quod aliquantum«. Für Pius IX. geht es 1864 in seiner Kampfansage an die »freigeisterischen Irrlehren« in der Enzyklika »Quanta cura« mitsamt ihres SyllabusAnhangs auch um den Bestand der weltlichen Herrschaft des Papstes im römischen Kirchenstaat65. Die Kirche verwirft die Säkularität des modernen Staates, weil sie ihr die Abkehr von der Wahrheit bedeutet, die sich in dem – allein wahren – christlichen Glauben verkörpert. Der Staat entzieht sich dem Heilsauftrag, der ihm obliegt wie der Kirche, wenn sie beide ihn auch jeweils auf ihrer Ebene und mit den ihnen eigenen Mitteln erfüllen, er indirekt, sie direkt, aber doch in gemeinsamer Verantwortung, einander zugeordnet wie Leib und Seele. Ein Staat ohne Gott 63 S. o. Fn. 29. – Zur Säkularität des heutigen Staates: A. Uhle, Staat – Kirche – Kultur, 2004, S. 54 ff., 120 ff.; Hillgruber (Fn. 29), S. 7 ff.; E.-W. Böckenförde. Der säkularisierte Staat, 2006, S. 11 ff.; K. F. Gärditz, Säkularität und Verfassung, in: O. Depenheuer/C. Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2010, S. 153 ff.; M. Rhonheimer (Fn. 30), S. 195 ff., 419 ff. 64 Dazu J. Isensee, Staat (Fn. 6), Sp. 135 ff. 65 Ausdrücklich thematisiert im Syllabus n. 113 – 115 (Fn. 2), U-G Bd. I, S. 50 f.
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
75
oder ein Staat, der sich zu allen Religionen neutral verhält und sie ohne Unterscheidung auf ihren Wahrheitsgehalt als gleichberechtigt anerkennt, stellt sich nach Leo XIII. in Widerspruch zu Gerechtigkeit und Vernunft66. Wenn der Staat das Wohl seiner Bürger klug und zweckdienlich fördern will, muß er auch die Kirche erhalten und schützen, wie diese ihrerseits die staatliche Ordnung festigt und ihr Schutz bietet vor den Gefahren von Revolution und Reaktion67. Eine Trennung von Kirche und Staat wird daher verworfen68. Die versunkene Einheitswelt des Mittelalters erscheint in der Rückschau als die gottgewollte, wahre Ordnung. Sie stellt sich nun dar als das politische Ideal. Die Kirche hält an ihm fest, obwohl die religiösen und politischen Fundamente längst zerborsten sind. Was beim Aquinaten das ideale Abbild der zeitgenössischen Wirklichkeit gewesen ist, gerät jetzt zu deren kritischem Gegenbild, um sich am Ende zu verklären zum romantischen Traumbild vom verlorenen Paradiese. Eine Staatslehre, die sich mit dem Aquinaten erhoben hatte wie ein gotischer Dom über Markt und Giebelhäuser, über die ganze mittelalterliche Lebenswelt, wirkt nunmehr, in der Fortschreibung und Nachahmung des 19. und 20. Jahrhunderts, wie eine neugotische Vorstadtkirche im Ensemble der Werkhallen und Fabrikschlote; sie steht da als rührender Atavismus, wie die pseudomittelalterliche New Yorker St.-Patricks-Kathedrale inmitten der Wolkenkratzer.
2.
Universalismus versus Individualismus
Die altständische Ordnung gibt die historische Folie für die Deutung des Staates als Organismus. Hier findet ein jeder seinen sicheren Ort, seine vorbestimmte Aufgabe, seine Pflichten69. Der Einzelne gliedert sich ein in das Ganze. Das Ganze aber ist vor dem Teil. An dem christlich adaptierten Universalismus aus der Schule des Aristoteles bricht sich der moderne Individualismus. Der Teil und das Ganze stehen einander nicht als Rechtssubjekte gegenüber. Der Teil hat kein Eigenrecht gegen das Ganze, da er doch um des Ganzen willen da ist. Zwischen den verschiedenartigen Gliedern des Organismus gibt es keinen Ansatz für abstraktes Gleichheitsdenken und unter dem Gesetz der Funktionsnotwendig66 Leo XIII., Enzyklika »Libertas praestantissimum« v. 20. 6. 1888 (U-G Bd. I, S. 200 ff., 210 f.). Vgl. auch ders., Enzyklika »Immortale dei« v. 1. 11. 1885 (U-G Bd. III, S. 2134 ff.). Dazu P. Tischleder, Die Staatslehre Leos XIII., 1925, S. 282 ff. 67 Leo XIII., »Libertas« (Fn. 66), S. 204 f. Weit. Nachw. J. Isensee (Fn. 15), S. 323 f. 68 Ausdrücklich Pius IX., Syllabus U 92 (Fn. 2), S. 46 f. 69 Zum Folgenden näher mit Nachw. J. Isensee (Fn. 15), S. 309 ff., 322 ff. Zu der weitgehend parallel laufenden Entwicklung im Bereich der evangelischen Kirche: M. Heckel (Fn. 32); C. Link (Fn. 56), S. 868 ff.
76
Josef Isensee
keit der Glieder keinen Ansatz für ein abstraktes Prinzip der Freiheit. Das einseitige Bild des Menschen in seiner Vereinzelung, von dem die liberalen Freiheitsrechte ausgehen, fordert den Widerspruch der Kirche heraus. Papst Pius VI. verwirft die Gedanken- und Handlungsfreiheit, die von der französischen Nationalversammlung proklamiert werden, mit dem Argument, daß die Menschen nicht nur einzeln, um ihrer selbst willen, geschaffen worden sind, sondern auch um ihrer Mitmenschen willen und zu ihrer Unterstützung. »In ihrer natürlichen Schwäche bedürfen sie zu ihrer Erhaltung der gegenseitigen Hilfeleistung«70 – die vorgegebene Grundpflicht zur Solidarität also als Einwand gegen den liberalen Freiheitsentwurf. Die Kirche beschwört die organische Einheit des Ständewesens gegen den Pluralismus der offenen Gesellschaft, die Statik und Geschlossenheit der vormodernen Welt gegen Unruhe, Wettbewerb, Antagonismus. Noch im Jahre 1931 baut Pius XI. darauf, daß ein modernisiertes Ständemodell von berufsgemeinschaftlichen »ordines« den Klassenkampf überwinden und die innere Ruhe des Gemeinwesens wiederherstellen könne71. Auch nach ihrem epochalen Bekenntnis zum Subsidiaritätsprinzip zeigt die Kirche wenig Gespür für die Selbststeuerungskräfte einer offenen pluralistischen Gesellschaft. Insbesondere mißtraut sie dem Markt, den gemeindienlichen Wirkungen des wirtschaftlichen Eigennutzes im freien Ausgleich von Angebot und Nachfrage. Sie hält sich lieber an altruistische Modelle und hat daher eher eine Affinität zu sozialistischer Zwangsmoral der Wirtschaft als zum liberalen Ethos des marktgerechten Verhaltens. Mit noch größerer Verspätung als die Öffnung zum Verfassungsstaat vollzieht sich die Öffnung zur Marktwirtschaft, obwohl diese dessen freiheitliches Pendant ist. Der enge und schiefe, marxistoide Dualismus von Kapital und Arbeit bestimmt die Perspektive Johannes Paul II. in »Laborem exercens« und verstellt die Sicht auf die Marktpolarität von Angebot und Nachfrage. Nach der Implosion der real-sozialistischen Staaten findet der Papst in »Centesimus annus« zwar ein gutes, doch sehr kurzes Wort für die Marktwirtschaft, hingegen sehr viele Worte für deren Mängel, Grenzen, Korrekturbedarf, im Ergebnis für einen ausgedehnten staatlichen und überstaatlichen Interventionismus72. Noch immer tut sich die Kirche schwer mit der Rahmenordnung der Freiheit. 70 Pius VI. (N 12), S. 2662 f. 71 Pius XI., Enzyklika »Quadragesimo anno« v. 15. 5. 1931, n. 81 – 95 (U-G Bd. I, S. 602 ff.). Zu diesem vieldeutigen Modell: A. Merkl, Der staatsrechtliche Gehalt der Enzyklika »Quadragesimo anno«, in: Zeitschrift für Öffentliches Recht XIV (1934), S. 208 ff.; E. Voegelin, Der autoritäre Staat, 1936, S. 206 ff., 226 ff.; G. Gundlach, Fragen um eine berufsständische Ordnung, in: StdZ 125 (1933), S. 217 ff.; A. Rauscher, Sozialphilosophische und ökonomische Realität, in: Ordo XII (1960/61), S. 433 ff. 72 Johannes Paul II., »Centesimus annus«, n. 30 ff. (N 4, S. 35).
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
77
Das organische Staatsdenken entspricht dem unpolitischen Intellektualismus der Kirche: daß die richtige Ordnung des Gemeinwesens in ehernen Prinzipien des Gemeinwohls und der Gerechtigkeit schon vorgegeben sei und nur erkannt und umgesetzt werden müsse. Hier ist kein Ort für voraussetzungslose politische Entscheidung und für die Souveränität des Volkswillens. Der staatliche Organismus ist gewachsen. Er wird nicht gemacht. Just das aber ist Ziel der politischen Moderne, seitdem die Renaissance den »Staat als Kunstwerk«73 begreift. Von der Machbarkeit des Staates gehen die verfassungspolitischen Bewegungen aus, die ihn als Gegenstand des Planens und Gestaltens begreifen. Auf dieser Prämisse gründet seit Thomas Hobbes die Philosophie, die ihn als Produkt menschlicher Vernunft rechtfertigt. Sie versteht ihn auch nicht als Organismus, vielmehr als Mechanismus. Allerdings bezieht sie sich nur auf den Staat im engeren Sinne als Staatsorganisation, als das Gegenüber der Gesellschaft, also nur als Teil des Gemeinwesens, indes der weitere Staatsbegriff gerade das Gemeinwesen umgreift und das Ganze meint, das noch nicht geschieden ist in Regierung und Regierte, in Ämterwesen und Gesellschaft. Der engere Staatsbegriff bezeichnet den Adressaten der Grundrechte sowie das Substrat der rechtsstaatlichen Freiheitsgarantien. Die Kirche aber meint das Gemeinwesen in seiner Ganzheit und Fülle als societas perfecta et completa, wenn sie vom Staat spricht74. Der Verfassungsstaat aber ist seiner Intention nach imperfekt und inkomplett: fragmentarische und subsidiäre Rahmenordnung der Freiheit. Schon im Staatsbegriff waltet Dissens zwischen Kirche und moderner Welt. Sie reden aneinander vorbei. Die Verständigung wird erschwert durch die scholastische Begrifflichkeit, deren sich die katholische Staats- und Soziallehre bedient bis tief in das 20. Jahrhundert hinein und mit der sie sich abschottet gegen den modernen Geist und seine Sprache, gegen die philosophischen Gründe des Verfassungsstaates und gegen seine juridischen Formen. Die prinzipielle Abwehrhaltung wird eindrucksvoll dokumentiert durch förmliche Bücherverbote. Der Index Romanus führt nahezu alle Klassiker der politischen Moderne auf: Machiavelli, Guicciardini und Bodin, Hobbes, Locke und Pufendorf, Montesquieu, Rousseau und Kant75. 73 J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien (1860), Überschrift des Ersten Abschnitts (Ausgabe 1981, S. 27). 74 Ein engerer Staatsbegriff liegt allerdings der Lehre zugrunde von den Pflichten des Untertanen gegen die Obrigkeit (»potestas« im Sinne von Röm. 13). Zu den verschiedenen Staatsbegriffen J. Isensee, Staat (Fn. 6), Sp. 144 ff.; ders., Gemeinwohl im Verfassungsstaat, in: HStR IV, 32006, § 71 Rn. 20 ff. 75 Ausweislich des Index librorum prohibitorum aus dem Jahre 1835 (Ausgabe: Index librorum prohibitorum iuxta exemplar romanum iussu sanctissimi domini nostri, Mechliniae (Mecheln) 1838; vgl. auch Index Romanus. Verzeichnis sämtlicher auf dem römischen Index stehenden deutschsprachlichen Bücher, desgleichen aller wichtigen fremdsprachlichen
78 3.
Josef Isensee
Parteinahme für das monarchische Prinzip
Im politischen Konflikt, der mit der französischen Revolution in Europa aufflammt, steht die katholische Kirche im Lager der alten Mächte. Sie nimmt Partei wider die demokratische Bewegung, für die monarchische Ordnung. Der Papst begrüßt im Jahre 1814 die Restauration des Königtums der Bourbonen in Frankreich mit besonderer Freude darüber, daß nunmehr wieder ein Nachkomme aus dem Geschlecht des heiligen Königs Ludwig dazu berufen sei, die französische Nation zu regieren. Die Freude werde allerdings dadurch getrübt, daß der Entwurf der neuen Verfassung die Religions- und Gewissensfreiheit allen Konfessionen ohne Rücksicht auf Wahrheit oder Irrtum zugestehe, und daß er die Pressefreiheit gewährleiste, die größte Gefahren für Sitte und Glauben heraufbeschwöre76. Die Absage an die Demokratie wird theologisch untermauert durch die Ableitung der Staatsgewalt aus dem Willen Gottes (Röm 13), die eine Ableitung aus dem Willen des Volkes ausschließe. Das Prinzip der Volkssouveränität wird somit verworfen. Der Gehorsam, den der Christ nach Paulus der – nicht durch eine besondere Staatsform spezifizierten – »potestas« schuldet, wird gedeutet als dynastische Treupflicht77. Die Absage an die Volkssouveränität wirkt lange nach im politischen Katholizismus, der mit der demokratischen Grundnorm, daß alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, seine Glaubensnot hat, obwohl dieser Satz nur die innerweltliche Legitimation der Staatsgewalt zum Thema hat, die Negation der Autokratie, Bücher seit dem Jahre 1750, hrsg. von A. Sleumer, 111956) waren verboten (in Klammern der Zeitpunkt des Verbotes): N. Machiavelli, Opera omnia (1564); J. Bodin, De Republica libri VI (1592); ders., De Magorum Daemonomania (1594); ders., Methodus ad facilem Historiarum cognitionem (1596); ders., Universae Naturae Theatrum (1633); F. Guicciardini, La Historia d’Italia con le postille in margine delle cose pi¾ notabili, con la vita dell’Autore di nuovo riveduta, e corretta per Francesco Sansovino, con l’aggiunta di quattro libri lascati addietro dall’Autore (1627); ders., Loci duo ob rerum, quas continent, gravitatem cognitione dignissimi, ex ipsius Historiarum libris tertio et quarto dolo malo detracti, nunc ab interitu vindicati (1603); ders., Historiam sui temporis libri XX, ex Italico in latinum sermonem conversi. Coelo Secundo Curione interprete (1596); T. Hobbes, Opera omnia (1703); J. Locke, An essay concerning human understanding (1734); ders., The reasonableness of christianity as delivered in the Scriptures (1737); C. de Montesquieu, De l’esprit des loix (1751); ders., Lettres persanes (1762); S. v. Pufendorf, Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten in Europa (1692, in latein. Sprache: 1736); ders., De iure naturae et gentium, libri VIII (1711); ders., De officio hominis et civis iuxta legem naturalem, libri II (1751); ders., De statu imperii germanici liber I, notis ad praesens saeculum accomodatis auctus a. Jo. Godofr. Schaumburg (1753); J.-J. Rousseau, Du contrat social, ou principes du droit politique (1766); I. Kant, Critica della Ragione pura (1827). 76 Pius VII., Litterae Apostolicae »Post tam diuturnas« v. 29. 4. 1814 (in: U-G Bd. I, S. 462 ff.). 77 Vgl. Pius VI. (N 12), S. 2664 f.; Gregor XVI. (Fn. 81), S. 150 ff.; Leo XIII., Enzyklika »Diuturnum illud« v. 29. 6. 1881 (in: U-G Bd. III, S. 2094 f.). Dazu: P. Tischleder (Fn. 66), S. 208 ff.
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
79
indes die Frage der religiösen theonomen Begründung jenseits des säkularen Verfassungshorizontes liegt. Das Problem löst noch im Jahre 1948 bei der Beratung des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat eine Debatte aus78.
4.
Keine menschenrechtliche Freiheit für den Irrtum
Als sich in der französischen Revolution das moderne Freiheitsbegehren radikal und geschichtsmächtig entlädt, tritt ihm der Papst schroff und prinzipiell entgegen. Er sieht in ihm die Hybris und den Abfall Luzifers, das unheilige »Non serviam«79, die Rebellion gegen jenes Gebot, mit dem Gott schon im Paradiese die Freiheit der ersten Menschen beschränkt hat: nicht den Apfel vom Baum der Erkenntnis zu essen80. Im Griff nach der Gewissensfreiheit und der Meinungsfreiheit vollzieht sich der Höllensturz der modernen Gesellschaft; Gregor XVI. gibt in seiner Enzyklika »Mirari vos« eine apokalyptische Vision81. Dem negativen Freiheitsentwurf der liberalen Menschenrechte setzt die Kirche ihren eigenen, positiven Freiheitsentwurf entgegen: Freiheit als Fähigkeit des Menschen, den Willen Gottes zu tun und darin das eigene Wesensgesetz zu erfüllen. Die Freiheit ist ausgerichtet auf die Wahrheit, und sie erhält aus dieser ihr Recht. Der Mensch hat nicht die Freiheit, die Wahrheit zu mißachten, den Irrtum zu verbreiten, das Böse zu tun. Gregor XVI. beruft sich auf Augustinus, daß es keine Freiheit für den Irrtum gebe: »At quae peior mors animae quam libertas erroris.«82 Auf dieser Linie liegt die Auffassung Leos XIII., daß das liberale Postulat der Freiheit der Lehre dazu angetan sei, von Grund auf die Hirne zu verkehren, wenn jeder glaube, nach Belieben zu lehren, was ihn gutdünke; eine solche Zügellosigkeit dürfe die Staatsgewalt den Bürgern nicht gewähren.83 Die katholische Kirche, die das Recht der Wahrheit einfordert, ist sich sicher, im Besitz der Wahrheit zu sein. Als höchste und sicherste Lehrerin der Völker fördere sie die menschliche Freiheit, weil nach dem Wort Christi der Mensch durch die Wahrheit frei werde.84 Hier werden zwei heterogene Begriffe von Freiheit verknüpft: einerseits die heilsgeschichtliche Freiheit von Unglauben 78 Dazu Nachw. in JöR n. F. 1 (1951), S. 198 f.; H. v. Mangoldt, Das Bonner Grundgesetz, 11953, Art. 20 Anm. 5 (S. 136). 79 Leo XIII., »Libertas« (N 66), S. 194 f. Zur Abwehrhaltung der Päpste des 19. Jahrhunderts, J. Isensee (Fn. 15), S. 296 ff.; R. Uertz, Vom Gottesrecht zum Menschenrecht, 2005, S. 33 ff., 193 ff., 363 ff.; M. Rhonheimer (Fn. 30), S. 134 ff. 80 So Pius VI. (N 12), S. 2662 f. 81 Gregor XVI., Enzyklika »Mirari vos« v. 15. 8. 1832, in: U-G Bd. I, S. 148 f. 82 Augustinus, psal. contra part. Donat. Zitiert von Gregor XVI. (Fn. 81), S. 148 f. 83 Leo XIII., »Libertas« (Fn. 66), S. 206 f. 84 Leo XIII., »Libertas« (Fn. 66), S. 208 f.
80
Josef Isensee
und Sünde (»et veritas liberabit vos«, Joh 8, 32), andererseits die grundrechtliche Freiheit von den Vorgaben des staatlichen Rechts. Das moderne Dilemma, daß die Wahrheit ungewiß ist, ein Ziel des Suchens, eine Ursache des Streits, erschüttert die Päpste des 19. Jahrhunderts nicht, weil sie kraft ihres Lehramtes die Wahrheit bereithalten. Sie verwerfen die menschenrechtliche Lösung des Verfassungsstaates, sich der Entscheidung über die Wahrheitsfrage zu enthalten und sie den Individuen zuzuweisen. Sie trauen diesen nicht zu, die Wahrheit unter den Bedingungen subjektiver Freiheit zu finden. Denn sie teilen nicht den naiv-aufklärerischen Glauben an das Gute im Menschen. Vielmehr stellen sie ab auf die durch Erbsünde verderbte Natur. Diese aber bedarf der Autorität des Staates. Daß nicht nur die menschenrechtliche Freiheit, sondern auch die Autorität erbsündigen Menschen anvertraut ist, bedeutet keinen inneren Widerspruch, jedenfalls solange die staatliche Autorität über die kirchliche Autorität den Konnex mit der ewigen Wahrheit hält. In den modernen Freiheitsrechten reißt dieser Zusammenhang ab. Gregor XVI. prophezeit die Folgen: »Denn wenn der Zügel zerrissen ist, mit dem die Menschen auf den Pfaden der Wahrheit gehalten werden, dann stürzt ihre ohnehin zum Bösen geneigte Natur rasend schnell in den Abgrund. … Die Erfahrung bezeugt es, und seit uralter Zeit weiß man es: Staatswesen, die in Reichtum, Macht und Ruhm blühten, fielen durch dieses eine Übel in sich zusammen, nämlich durch zügellose Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Neuerungssucht«85. Die Kirche verwirft auch den Rückzug des Verfassungsstaates auf die Legalität, seinen Verzicht darauf, Moralität zu erwirken, und seine Selbstbescheidung darin, nur das ethische Minimum zu gewährleisten. Dieser Begrenzung der Staatsgewalt entspricht der negative Freiheitsentwurf der liberalen Grundrechte, die der Wahrheit wie dem Irrtum offenstehen und den guten wie den bösen, den verständigen wie den törichten Gebrauch ermöglichen.86 Die praktischen Konvergenzen werden ein letztes Mal formuliert im Jahre 1962 bei den Beratungen des Zweiten Vatikanischen Konzils, und das in einer Deutlichkeit, die nichts zu wünschen übrig läßt, und zwar in einem Entwurf »Über die Kirche« zum Thema »Religionsfreiheit«: Wenn die Mehrheit der Menschen in einem Staat katholisch sei, dann müsse auch der Staat katholisch sein. Für die Angehörigen eines anderen Glaubens gebe es kein Recht, ihren Glauben öffentlich zu bekennen. Der Staat könne und müsse aber unter Umständen aus Gründen des Gemeinwohls ihr Bekenntnis dulden. Sei dagegen die Mehrheit nicht katholisch, so müsse sich der Staat nach dem Naturrecht richten, 85 Gregor XVI., »Mirari vos« (N 81), S. 148 f. – Zum Freiheitsbegriff der Päpste: J. Isensee (Fn. 15), S. 310 ff. (Nachw.). 86 Zu den Freiheitsbegriffen des Verfassungsstaates J. Isensee, Was heißt Freiheit?, in: FS für E. Schmidt-Jortzig, 2011, S. 269 ff. (insbes. S. 282 f.).
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
81
d. h. er habe sowohl den einzelnen Katholiken als auch der katholischen Kirche alle Freiheit zu lassen.87 Aus der säkular-menschenrechtlichen Sicht der Religionsfreiheit erscheint die Position in sich unstimmig: Recht nach zweierlei Maß. Doch die traditionelle Position stützt sich nicht auf die Religionsfreiheit, sondern auf das Recht der Wahrheit, und dieses sieht zweierlei Maß vor: das eine für die Wahrheit, das andere für den Irrtum.88
V.
Allmähliche Annäherung und Aussöhnung
Zwischen der Verwerfung, die das verfassungsstaatliche Werk der Aufklärung nach 1789 durch die Päpste erfuhr, und der Zuwendung, die ihm heute der Papst bekundet, liegt eine kopernikanische Wende. Diese vollzieht sich nicht uno actu. Vielmehr verläuft sie in einem langen, schwierigen Prozeß, der sich durch zwei Jahrhunderte hinzieht. Er bewegt sich auf vielen, oft verschlungenen und unsichtbaren Wegen. Die Annäherung erfolgt schrittweise. Der Konfliktstoff wird nach und nach entschärft. Immerhin läßt sich der historische Zeitpunkt klar bestimmen, an dem die Kirche ihren letzten Dissens mit dem Verfassungsstaat amtlich beilegt, den Dissens über die Religionsfreiheit. Das Datum ist der 7. Dezember 1965, als das Zweite Vatikanische Konzil die Erklärung »Dignitatis humanae« annimmt.
1.
Verbürgerlichung der Kirche
Vor jeder lehramtlichen Annäherung vollzieht sich die soziologische Anpassung der Kirche an das bürgerliche Zeitalter, das sich mit der französischen Revolution in Europa etabliert hat. Seit sie ihre weltliche Herrschaft in der Säkularisation eingebüßt hat, rekrutiert sie ihr Führungspersonal kaum noch aus dem Adel, sondern überwiegend aus dem Bürgertum; es sind nicht zuletzt Handwerker- und Bauernsöhne, die nun die Bischofsstühle besetzen. Damit löst sich die hergebrachte Verflechtung der Kirche mit den regierenden Häusern und der Aristokratie. Die äußere Anpassung an das Bürgertum wird begleitet durch die innere Verbürgerlichung der Kirche. Sie öffnet sich zunehmend bürgerlichen Wertvorstellungen und macht sich bürgerliche Tugenden, ein moralisches Erbe der 87 IX. Kapitel des Entwurfs, zitiert nach K. Rahner/H. Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, 1966, S. 655. 88 In diesem Sinne A. Ottaviani, Rede vom 2. 3. 1953 (zitiert nach F. Heer, Die dritte Kraft, 1959, S. 597). Vgl. auch A. Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiatici, Vol. II, Ecclesia et status, 41960, S. 46 f., 55 f., 66 f.
82
Josef Isensee
Aufklärung, zu eigen: Arbeitsamkeit, Pünktlichkeit, Ordnungssinn, Sauberkeit, Sittsamkeit. Joseph Haydn, Katholik dörflicher Herkunft und barockhöfischer Berufsprägung, seufzt noch, als ihm sein aufklärerischer Librettist und Mentor van Swieten zumutet, ein »Lob des Fleißes« für das Oratorium der »Jahreszeiten« (1801) zu komponieren89. Eine Generation später wird die Trägheit als Sünde im Beichtspiegel aufgeführt. Folgenschwer für die Kirche wird die Übernahme der bürgerlichen Sexualmoral, wie sie in der Aufklärung Gestalt angenommen hatte. Das Bürgertum hatte sich gerade in seiner Sittenstrenge abgesetzt von der Frivolität des Rokoko und von der Verderbtheit des ancien r¦gime. Lessings »Emilia Galotti« ist hier literarisches Zeugnis. Die Kirche, im Barockzeitalter selbst einbezogen in die höfische Kultur der Sinnlichkeit, geht nun dazu über, die bürgerliche Moral mit eigenen Traditionen paulinischen, manichäischen, cluniazensischen Ursprungs zu verbinden, sie zu verinnerlichen und zu überhöhen. Literarisches Zeugnis sind hier Manzonis »I promessi sposi«. Die Beichtmoral des katholischen Volkes fixiert sich zunehmend auf das sechste Gebot, das vom Verbot des Ehebruchs zum Verbot der Unkeuschheit mutiert und sich mit absoluter Todsünden-Sanktion bewehrt. Die verbürgerlichte Kirche gewinnt an Spiritualität. Aber sie nimmt auch anämische Züge an. Die alte Symbiose der katholischen Lebenswelt mit der Kultur, die den süddeutschen Barock hervorgebracht hatte und noch in Haydn und Mozart lebendig ist, zerfällt. Der Katholizismus zieht sich in ein Kulturghetto zurück, das ihn von den herrschenden geistigen Bestrebungen der Zeit abschirmt. Erst im 20. Jahrhundert tritt er zögernd aus ihm heraus. Es ist eine merkwürdige Fügung der Geschichte, daß, als der Katholizismus sein Ghetto vollends niedergelegt hat und die Kirche ihren letzten Vorbehalt gegen das politische Erbe der Aufklärung zurücknimmt, in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts, die bürgerliche Welt samt bürgerlichem Sexualethos in der Kulturrevolution zusammenbricht. Während die Konzilserklärung zur Religionsfreiheit eine Mauer zur modernen Welt niederlegt, richtet die Enzyklika Pauls VI. »Humanae vitae« eine neue, naturrechtlich fundierte Mauer auf, obwohl sie nur die bisherige Morallehre der Kirche fortschreibt, nunmehr jedoch nicht mehr mit bürgerlicher Rückendeckung, und führt in eine innerkirchliche Gehorsams- und Glaubwürdigkeitskrise, wie sie keine lehramtliche Verlautbarung des 19. Jahrhunderts ausgelöst hat, weder der Syllabus noch das Unfehlbarkeitsdogma.
89 Dazu H. E. Jacob, Joseph Haydn, 1954, S. 340.
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
2.
83
Peripetie unter Leo XIII.
Der Abwehrkampf, den die Päpste seit Pius VI. gegen die Ideen der französischen Revolution führen, findet seinen Höhepunkt unter Leo XIII. Tiefer und differenzierter als seine Vorgänger begründet er das Recht der Wahrheit. Aber gerade in seiner Differenziertheit leitet er die Wende ein, die auf Dauer zu Annäherung und Ausgleich führen wird. Er öffnet den Freiheitsrechten wenigstens einen Spalt breit die Tür, indem er anerkennt, daß in Ermessensfragen, die Gott den Menschen anheimgegeben habe, die Meinungs- und Pressefreiheit nicht zur Unterdrückung der Wahrheit verleite, sondern gerade deren Entdeckung und Offenlegung bewirken könne90, also: in dubiis libertas. Echte grundrechtliche libertas fordert der Papst in den Bereichen des Elternrechts, der Vereinigungsfreiheit, des Eigentums. Leo XIII. kündigt das Bündnis der Kirche mit der Monarchie auf, erklärt die Neutralität in der Frage der Staatsform und findet so einen modus vivendi mit der Republik und der Demokratie. Pius XII. wird sich in seiner Weihnachts-Rundfunkbotschaft vom 24. Dezember 1944, ungeachtet grundsätzlicher Vorbehalte, aktiv und positiv der modernen Demokratie zuwenden. Leo XIII. erkennt die Lösung der sozialen Frage – mithin die Bewältigung der Folgeprobleme des Liberalismus – als Aufgabe des Staates. Die sozialstaatliche Dimension, die dem Verfassungsstaat im 19. Jahrhundert zuwächst, findet von Anfang an die Zustimmung und den Zuspruch der Kirche. Der Hiatus zwischen Kirche und moderner Welt bleibt auch nach Leo XIII. gewaltig, zumal in den Fragen der liberalen Menschenrechte, die dem Individuum die Letztkompetenz zur Entscheidung der Wahrheitsfrage geben, der Religions- und Gewissensfreiheit, der Meinungsfreiheit, der Presse- und der Lehrfreiheit. Gleichwohl setzt nun ein, wenn auch vielfach verzögerter Prozeß der Annäherung ein, der von Indifferenz zu Zuwendung führt, von pragmatischer Duldung zu lehramtlicher Annahme.
3.
Innerkirchliche Kräfte des Ausgleichs
Der Annäherungs- und Rezeptionsprozeß kann nicht nur in der externen Beziehung zwischen Kirche und moderner Welt gesehen werden, sondern auch in den innerkirchlichen Strömungen. Das »weltliche« Gedankengut dringt aus dem Kirchenvolk über die unteren Stufen der Hierarchie in die Kirche ein, bis es sich im Abklärungsprozeß der innerkirchlichen Kontroversen von unten nach oben durchsetzt. Ehe Ideen des Liberalismus ihre Aufnahme in die Lehrschreiben Papst Leos XIII. finden, vergeht fast ein Jahrhundert, in dem der katholische 90 Leo XIII., »Libertas« (Fn. 66), S. 206 f., 209 ff.
84
Josef Isensee
Liberalismus um einen Platz in der Kirche kämpfen muß. Am Anfang der Entwicklung, die mit »Diuturnum illud«, dem Friedensschluß der Kirche mit den modernen Staatsformen, ihren Abschluß findet, stehen französische Bewegungen einer »d¦mocratie chr¦tienne« sowie der tragische Vermittlungsversuch des Abb¦ Lamennais91. Die päpstlichen Lehrverlautbarungen bilden somit in zweierlei Richtung ein Resümee: Sie resümieren Bewegungen, die extra muros ihren Ursprung haben, und solche, die intra muros wirken. Dieses Resümee kann nur vorsichtig gezogen werden, weil die autoritative Kraft und der universale Adressatenkreis Zurückhaltung gebieten. Es kann auch zeitlich nur in einer Phasenverschiebung gegenüber der allgemeinen Entwicklung erfolgen, weil es nicht darum geht, mit dem Anspruch der Originalität politische Initialzündungen zu geben und sozialtheoretische Pionierleistungen zu erbringen, sondern aus der Distanz heraus, wie sie eine alte Tradition ermöglicht, das Beharrende der naturrechtlichen Ordnungsvorstellungen im Wechsel der Zeitströmungen geltend zu machen – mögen dabei im Ergebnis die Maßstäbe auch vom geschichtlichen Lebenssubstrat umgeprägt werden. Kräftiger als alle doktrinären Öffnungsversuche ist der pragmatische Ausgleich mit dem Verfassungsstaat über die tatsächliche Nutzung der Freiheitsrechte durch kirchliche Verbände und Parteien, über die Partizipation der katholischen Bevölkerung an der Demokratie, über den Genuß rechtsstaatlichen Schutzes, kurz: über die Erfahrung mit dem Verfassungsstaat, die gerade nicht die apokalyptischen Ängste bestätigt, wie sie Päpste des 19. Jahrhunderts heimsuchen. In der angelsächsischen Welt arrangiert sich der Katholizismus von Anfang an zwanglos mit der liberalen Demokratie. Tocqueville berichtet mit Erstaunen, daß Amerika das demokratischste Gebiet der Erde sei und gleichzeitig das Land, in dem die katholische Religion den größten Fortschritt aufweise92. Die angelsächsische Welt realisiert ihrerseits ein pragmatisches Modell des Verfassungsstaates, das, anders als das französische, keinen geschlossenen Weltentwurf darstellen und keine politische Religion inaugurieren will. Darin eben ruft die französische Revolution den Widerstand der katholischen Kirche auf den Plan93. Der Fundamentalkonflikt spielt sich auch nur im Wirkungsfeld dieser Revolution ab, vornehmlich also auf dem europäischen Kontinent. Er greift nicht über auf die angelsächsische Demokratie, in der die Katholiken ohnehin eine Minderheit bilden und auf menschenrechtlichen Schutz angewiesen sind. Gerade aus dem amerikanischen Katholizismus kommen wichtige Impulse, die im 20. Jahrhundert zum Ausgleich führen. 91 Dazu H. Maier, Revolution und Kirche, 31973. 92 A. de Tocqueville (Fn. 38), II. Teil, 6. Kapitel, S. 513. 93 Dazu H. Maier, Kirche und Demokratie, 1979, S. 84 ff.
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
85
Dagegen hat die neuscholastisch operierende katholische Soziallehre keinen nennenswerten Beitrag zur verfassungsstaatlichen Wende der Kirche geleistet. Menschenrechte, Gewaltenteilung und Demokratie lassen sich nicht aus abstrakten Gemeinwohl- und Gerechtigkeitsprinzipien einer ungeschichtlichen Naturrechtsdoktrin deduzieren. Jene sind konkrete Antworten auf geschichtliche Erfahrung, auf Unterdrückung des Humanum, Vorkehrung gegen Gefahr, Entwurf politischer Hoffnung. Das praktische Interesse ist ein wirksameres Vehikel der Menschenrechte als die philosophische Spekulation. Ein politisches Bedürfnis der Kirche, den Zugriff des Staates auf die Erziehung zurückzudrängen, leitete ihren eigenen schöpferischen Beitrag zu den Menschenrechten: die Entwicklung des Elternrechts, im verfassungsrechtlichen Ergebnis ein liberales Grundrecht, das die Erziehung und die Entscheidung über deren Ziele den Eltern, gleich, ob Christen oder Nichtchristen, überantwortet94.
4.
Die Auflösung des Widerspruchs in »Dignitatis humanae«
Der Widerstreit zwischen kirchlichem Wahrheitsanspruch und modernem Freiheitsanspruch kulminiert in den Auseinandersetzungen des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Religionsfreiheit. Das Konzil löst den Konflikt, aber nicht dadurch, daß es sich einseitig für die eine oder die andere Position entscheidet, sondern sachgerecht differenziert. Die Differenzierung aber ist vollkommen ausgereift. Das Konzil nimmt die Unterscheidungen auf, die dem Menschenrecht der Religionsfreiheit zugrunde liegen. Sie richtet sich nicht gegen die Religion, sondern gegen staatlichen Zwang in Fragen der Religion. Der Staat selbst hat keine Religion, und er entscheidet auch nicht, was wahre Religion sei oder nicht sei. Die Entscheidung trifft ein jeder für sich. Die Frage nach der wahren oder falschen Religion stellt sich also für das Menschenrecht nicht. Sie beantwortet ein jeder selbst. Seine höchstpersönliche Sache ist es, was er glaubt oder nicht glaubt, ob und wie er seinen Glauben bekennt und lebt. Die Religionsfreiheit tastet die religiösen Pflichten nicht an, die im Gewissen begründet sind. Das Zweite Vaticanum nimmt diese Distinktion auf, wenn es die Religionsfreiheit als Abwehrrecht gegen den Staat anerkennt, den heteronomen Zwang zur Wahrheit verwirft, aber die autonome religiös-moralische Pflicht zur Wahrheit um so deutlicher hervorhebt: daß die Menschen im Gewissen gehalten sind, die Wahrheit zu suchen, besonders über Gott und die Kirche, die erkannte Wahrheit aufzunehmen und zu bewahren und das Leben nach den Forderungen der Wahrheit zu ordnen. Über die Wende in der Menschenrechtsfrage hinaus 94 Dazu: J. Isensee, Elternrecht, in: StL, Bd. 2, 71986, Sp. 222 ff.
86
Josef Isensee
wahrt die Kirche ihre Identität, wenn sie auf der Pflicht zur Wahrheit beharrt. »Da nun die religiöse Freiheit, welche die Menschen zur Erfüllung der pflichtgemäßen Gottesverehrung beanspruchen, sich auf die Freiheit von Zwang in der staatlichen Gesellschaft bezieht, läßt sie die überlieferte katholische Lehre von der moralischen Pflicht der Menschen und der Gesellschaften gegenüber der wahren Religion und der einzigen Kirche Christi unangetastet.«95 Das Dekret über die Religionsfreiheit geht aus von der Würde der menschlichen Person, die, von jeher Thema kirchlicher Verkündung, sich nun unter neuem Aspekt darstellt: als Forderung nach Freiheit von gesellschaftlichem Zwang, insbesondere nach religiöser Freiheit. Diese Freiheit wird abgeleitet aus der Menschenwürde, »so wie sie durch das geoffenbarte Wort Gottes und durch die Vernunft selbst erkannt wird.«96 Die Religionsfreiheit ist daher keine kontingente Gunst des positiven Rechts, sondern eine Vorgabe des ius divinum und ius naturale. Das Konzil entfaltet die Religionsfreiheit als Recht der Individuen wie als Recht der Religionsgemeinschaften, in Reichweite und Schranken, als Gleichheit aller Religionsgemeinschaften und als Schutz vor Diskriminierung – das alles genauer, vollständiger und folgerichtiger als je eine staatliche Verfassung oder völkerrechtliche Konvention es vorgemacht hat. Das Konzil beschreibt auch die innere Schranke, den Mißbrauch der Religionsfreiheit: daß Religionsgemeinschaften in ihrem Wirken den Anschein erwecken, als handele es sich um Zwang oder um unehrenhafte oder ungehörige Überredung, zumal im Umgang mit weniger Gebildeten und Armen.97 Der Staatsgewalt obliegt der Schutz und die Förderung der Religionsfreiheit wie der Menschenrechte überhaupt. Er hat für die rechtlichen und außerrechtlichen Voraussetzungen zu sorgen, »damit die Bürger wirklich in der Lage sind, ihre religiösen Rechte auszuüben und die religiösen Pflichten zu erfüllen«.98 Damit entsagt das Konzil allen Vorstellungen, daß der Staat als bracchium saeculare der Kirche fungieren könne. Die Wahrheit des Glaubens hat auch keinen weltlichen Arm nötig. Das Konzil bekennt sich dazu, »daß die Pflichten die Menschen in ihrem Gewissen berühren und binden, und anders erhebt die Wahrheit nicht Anspruch als kraft der Wahrheit selbst, die sanft und zugleich stark den Geist durchdringt.«99 Diese Linie der Distanzierung der Kirche von äußerer Macht zieht Papst Benedikt XVI. weiter aus, wenn er die Säkularisierungen der Geschichte, wie die Enteignung von Kirchengütern und die Streichung der Privilegien, als heilsame Entweltlichung der Kirche deutet, als »Anspruch einer Armut, die sich zur Welt 95 96 97 98 99
»Dignitatis humanae« (Fn. 16), n. 1, 2, 3, 11. Dignitatis humanae (Fn. 16), n. 2. Dignitatis humanae (Fn. 16), 4. Dignitatis humanae (Fn. 16), n. 6. Dignitas humanae (Fn. 16), n. 1.
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
87
geöffnet hat, um sich von ihren materiellen Bindungen zu lösen« und in ihrem missionarischen Handeln wieder glaubhaft zu werden.100
VI.
Gefahren der Identifikation von kirchlichem Auftrag und politischer Aufklärung
1.
Gefahren für die Kirche
Wenn die Kirche am Ende des 20. Jahrhunderts sich für Menschenrechte und Demokratie gegen totalitäre und autoritäre Despotie einsetzt, kann sie breiter Zustimmung sicher sein. Seit dem Zusammenbruch der totalitär-sozialistischen Systeme steht sie jedoch in Ost und West nicht mehr vor der Aufgabe, für die Freiheit zu kämpfen, sondern die verfassungsstaatlich etablierte Freiheit zu nutzen. Damit aber gerät sie in ein Dilemma neuer Art. Nach einer historischen Phase, in der sie das politische Werk der Aufklärung verworfen, nach einer weiteren Phase, in der sie mit ihm zum Ausgleich gefunden hat, scheint nun die Phase gekommen zu sein, daß sie sich mit ihm identifiziert und in ihm aufgeht, sich damit auf Religion in den Grenzen der bloßen Vernunft reduziert, die ihr die Aufklärung von jeher zugestanden hat. Auf dieser Linie liegen kirchliche Bekenntnisse zu den Menschenrechten, zur Demokratie, zu den jeweils aktuellen Staatszielen wie soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz. Alter kirchlicher Übung gemäß werden die verfassungsrechtlichen und politischen Kategorien verinnerlicht und überhöht: bei den Menschenrechten genüge nicht die Anerkennung des »Buchstaben«, es bedürfe der Aufnahme ihres »Geistes«; Demokratie dürfe nicht nur »formal« verstanden werden, sondern »material«, sie sei nicht bloß triviale Staats- und Regierungsform, sondern tief und umfassend zu begreifende »Lebensform«. Auf dieser Linie liegt es, wenn die Kirche sich auf solche Dienstleistungen beschränkt, die säkularen Interessen kompatibel sind: soziale, volkspsychiatrische und volkspädagogische Aufgaben, Entwicklungshilfe, Kulturpflege, Denkmalschutz. Eine dergestalt aufklärungskompatible Kirche relativiert ihre Rolle als Dienstleister, Sinnanbieter, Moralvermittler, eine unter vielen Organisationen dieser Art auf dem pluralistischen Markt der Beliebigkeiten. Die vorbehaltlose Hingabe an die Aufklärung wird gefördert durch die Phobie der Kirche, sich das Stigma des Fundamentalismus zuzuziehen. Im Ergebnis ist aber die unkritische Anpassung für die Kirche nicht minder verhängnisvoll als 100 Benedikt XVI., Ansprache am 25. 9. 2011 in Freiburg i. Br., in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 189, Apostolische Reise Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. nach Berlin, Erfurt und Freiburg 22.–25. September 2011, Bonn 2011, S. 145 (149).
88
Josef Isensee
vormals die unkritische Verwerfung. Mit der Selbstsäkularisation gibt sie die wesentliche Substanz der christlichen Offenbarung preis101. Es kann nicht ihr Ziel sein, in der Aufklärung aufzugehen, sondern sich mit ihr auseinanderzusetzen, sich in ihr zu läutern und anzureichern, letztlich aber durch sie hindurchzugehen, weil sie durch andere Epochen der Kulturgeschichte hindurchgegangen ist.
2.
Gefahren für den Verfassungsstaat
Die Selbstsäkularisation der Kirche gefährdet auch den Verfassungsstaat102. Da er eingebunden ist durch ein System von Beschränkungen, da sich ihm die grundrechtliche Freiheit der Bürger nur negativ, als Abwehr gegen hoheitliche Eingriffe, darstellt, richtet sich seine Erwartung auf nicht entsprechend eingebundene gesellschaftliche Potenzen wie die Kirche, die auf den positiven, den gemeinwohldienlichen Gebrauch der grundrechtlichen Freiheit hinwirken können. Die Kirche leistet nicht darin dem Staat einen unentbehrlichen Dienst, daß sie ihn über die Grundrechte der Religions- und Gewissensfreiheit belehrt, sondern dadurch, daß sie christliche Religion ausübt und im Volke lebendig hält, und dadurch, daß sie das Gewissen der Menschen schärft und ihnen sittliche und religiöse Maßstäbe vermittelt. Der Verfassungsstaat, seiner Anlage nach nur sektorale Ordnung, kann und will nur den Bürger erfassen, nicht aber den ganzen Menschen. Und selbst seine begrenzte Aufgabe kann nur glücken, wenn auch die anderen Dimensionen des Menschen sich entfalten. Auf die Kirche richtet sich die Verfassungserwartung, daß sie gerade dem Bedürfnis des Menschen Genüge tut, vor dem der säkulare Staat versagt: dem religiösen Streben nach dem Absoluten. Solange die Menschen die absolute Wahrheit in der Transzendenz suchen, werden die Probleme der Immanenz relativiert, wird Politik von absoluter Heils- und Unheilsgewißheit entlastet, und es bleibt jenes gemäßigte Klima erhalten, auf das die liberale 101 Zu diesen Gefahren unter verschiedenen Aspekten: G. Schmidtchen, Was den Deutschen heilig ist, 1979, S. 194 ff.; M. Kriele, Befreiung und politische Aufklärung, 1980, S. 218 ff.; W. Weber, Wenn aber das Salz schal wird …, 1984; R. Hofmann, Zur neuen Ökumene von Christen und Marxisten, in: Münchener Theologische Zeitschrift 35 (1984), S. 218 ff.; ders., Die eschatologische Versuchung, in: Die neue Ordnung 1986, S. 54 ff.; ders., Politik als Religion, in: FS für H. Kuhn, 1989, S. 77 ff.; W. Ockenfels, Politisierter Glaube?, 1987; F. Hilterhaus/M. Zöller (Hrsg.), Kirche als Heilsgemeinschaft – Staat als Rechtsgemeinschaft, 1993; O. Depenheuer, Religion als ethische Reserve der säkularen Gesellschaft, in: ders. et alii (Hrsg.), Nomos und Ethos, 2002, S. 3 (4 ff., 14 ff.). 102 Dazu H. Lübbe (Fn. 56), S. 257 ff.; M. Kriele (Fn. 101), S. 248 ff.; J. Isensee, Die Säkularisierung der Kirche als Gefährdung der Säkularität des Staates, in: G. W. Hunold/W. Korff (Hrsg.), Die Welt für morgen, 1986, S. 164 ff.; ders. (Fn. 48), § 115 Rn. 258 ff.
Der lange Weg zu »Dignitatis humanae«
89
Demokratie angewiesen ist, mit offenem Diskurs, Kompromißzwang, Mehrheitsentscheid und Minderheitenschutz. Der Transzendenzglaube schützt vor der Flucht in die innerweltlichen Heilsreligionen, ihren politischen Absolutheitsansprüche und ihren totalitären Neigungen. Die aufklärungsoffene Religion, die fides und intellectus vereint, sich aber nicht in aufklärerischer Intellektualität erschöpft, verhindert, daß die Religiosität sich in voraufklärerische Primitivformen flüchtet, in Sektiererwesen, Schwarmgeisterei, Obskurantentum und daß just das gefördert wird, was eine aufklärungseifrige Kirche vermeiden will: aufklärungsfeindlicher Fundamentalismus. Die Kirche leistet dem Verfassungsstaat die wertvollsten Dienste als komplementäre Größe. Deshalb aber muß sie in die pluralistische Gesellschaft die meta-aufklärerische Substanz einbringen. Diese Verfassungserwartung formuliert schon Tocqueville bei der Betrachtung der ersten modernen Massendemokratie: »Was mich betrifft, so bezweifle ich, daß der Mensch jemals völlige religiöse Unabhängigkeit und totale politische Freiheit ertragen kann; und ich bin geneigt, zu denken, daß er, wenn er nicht gläubig ist, hörig werden, und wenn er frei ist, gläubig sein muß.«103
103 A. de Tocqueville (Fn. 38), S. 506.
Udo Di Fabio
Staat und Kirche: Christentum und Rechtskultur als Grundlage des Staatskirchenrechts1
I.
Moderner Staat und kulturelle Identität
Der moderne Staat wurde in Europa geboren. Die Staatsidee geht nicht nur auf antike Herrschaftstraditionen zurück, sondern wird auch entwicklungsgeschichtlich vorbereitet durch die römische Kirche mit ihrer Ordnung und ihrem Recht2, die zu den Rationalitätsmustern beitragen, die dann zur neuzeitlichen Vernunft zusammenwuchsen. Die Idee politischer Ausdifferenzierung – also die Lösung politischer Herrschaft aus sozialen, traditionalen und religiösen Bindungen – gewann im Renaissancelabor der oberitalienischen Stadtstaaten Gestalt und mehr noch ihren Geist. Sie setzte sich während und unmittelbar nach der Reformation in den Territorien der Fürsten letztendlich durch, hier zunächst mehr mit Gewalt als mit Inspiration3. Der moderne Staat wurde, was er ist, im Ringen und im Bündnis mit Kirche und Religion, in der Einheit und der Trennung beider Sphären, in wechselseitigen Übergriffen, aber ebenso in der Kooperation des sich respektierenden Miteinanders. Ohne die wechselvolle Geschichte von politischer Herrschaft und christlicher Religion, stammend aus den antiken Wurzeln und über die mittelalterliche Prägung, ist weder das moderne Recht noch der moderne Staat zu verstehen, aber auch nicht die körperschaftliche Struktur der christlichen Religionsgemeinschaften. Genau zu ergründen, wer oder was für wen oder was die Grundlagen gelegt hat, ist in den Bahnen 1 Nochmals überarbeitete Fassung eines Vortrags vom 12. 3. 2007 anlässlich der 42. Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, in: H. Marr¦/J. Stüting (Hrsg.), Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, 42. Band, 2008, S. 129 ff., abgedruckt in: U. Di Fabio, Gewissen, Glaube, Religion, 22009, S. 79 – 104. 2 So die nach wie vor bemerkenswerte Ableitung von H. J. Berman, Recht und Revolution. Die Bildung der westlichen Rechtstradition, 1995. 3 Nach M. Heckel lässt sich eine beachtenswerte Interdependenz zwischen Reichsreform und Reformation feststellen, so bot die ständische Reichsreform der Reformation den Schutz der reichsständischen Liberalität der deutschen Fürsten gegen den katholischen Kaiser, freilich um den Preis der territorialen Zersplitterung. M. Heckel, Deutschland im konfessionellen Zeitalter, 1983, S. 114.
92
Udo Di Fabio
einfachen kausalen Denkens unmöglich. Möglich und unentbehrlich ist es aber, strukturelle Voraussetzungen für gesellschaftliche Entwicklungen zu diskutieren, Wechselwirkungen, Bedingungen und Isomorphien. Es würde vielleicht über das Thema hinausgreifen, wer der Frage nachginge, wieweit der moderne Verfassungsstaat und seine Rechtskultur überhaupt im Christentum ihr notwendiges Fundament finden. Wobei »notwendig« verstanden werden kann im Sinne historischen Werdens, aber auch im Sinne anhaltender funktioneller Notwendigkeit. Das Thema verlangt jedenfalls eine Portion spekulativen Wagemuts. Der ist ohnehin immer dann unentbehrlich, wenn die kulturellen Grundlagen einer Gesellschaft in Bewegung geraten, wenn Fragloses fragwürdig wird. Unsere Welt ist ihrer Grundlagen unsicher geworden, ohne indes neue gelegt zu haben. Deshalb mussten wir die ausgerufene »Postmoderne« im Grunde widerrufen, weil sie schon im Begriffsansatz ihr Dementi mit sich führte, denn gegen die temporalisierende Moderne kann man sich nicht wiederum temporalisierend abgrenzen, man müsste in der Epochenprätention schon eine sachliche Aussage treffen, so wie das Mittelalter sich nicht als solches, sondern als die Einheit christlichen Glaubens verstand, und dies ohne gewollte Zäsur zur christlichen Antike. Unsere Zeit hat kennzeichnenderweise inzwischen den Anspruch einer Epochenzäsur größtenteils zurückgenommen und spricht etwas bescheidener von der »Spätmoderne«. Jedenfalls belegen die mitunter etwas künstlich wirkenden Versuche, die allerorten gespürte Veränderung auf einen großen Nenner zu bringen, vor allem Unsicherheit, die auch das scheinbar fest gefügte Staatskirchenrecht erfasst. »Wie lange halten wir bzw. unsere Gesellschaft eine kontinuierliche Ausweitung des Anwendungsbereiches der Religionsfreiheit aus? Berauben wir uns da auf diese Weise nicht zunehmend unserer eigenen Identität« (Bischof Genn)4 ? Andere fürchten die kulturelle und religiöse Fragmentierung westlicher Gesellschaften, wobei in das »entkirchlichte« Vakuum hinein neue fundamentalistische Strömungen islamischer, aber auch christlicher Herkunft Boden gewinnen könnten, und dem dann durch scharfen Laizismus begegnet werden soll. Damit steht nicht alles, aber vieles zur Disposition. Ist die kooperative Nähe zwischen Staat und Kirchen noch zeitgemäß, verpflichtet Neutralität zur unbedingten Äquidistanz des Staates gegenüber allen religiösen Bekenntnissen oder darf er eine kulturelle Option fördern, weil sie seinen Werte- und Funktionsgrundlagen oder seinen körperschaftlichen Organisationserwartungen entspricht5 ? Mit solchen Fragen wird das Staatskir4 B. Kämper/H.-W. Thönnes (Hrsg.), Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, 39. Band, 2005, S. 6. 5 »[…] das Grundgesetz beließ es bei der traditionellen Sonderrolle von Religion und Kirche, wenngleich – wie schon in der Weimarer Reichsverfassung – in einem religiös und weltanschaulich ›neutralen‹ Staat. Wie sich dies vereinbaren lässt, ist allerdings das bis heute nur zum teil gelöste verfassungsrechtliche Rätsel.« P. Badura, Das Grundgesetz vor der Frage des
Christentum und Rechtskultur als Grundlage des Staatskirchenrechts
93
chenrecht, dieser besondere und anspruchsvolle Zweig des öffentlichen Rechts, dazu genötigt, sich erneut seiner Grundlagen zu vergewissern, um die Zukunft nicht nur als unverstandene Institution auf einem Abstellgleis erdulden zu müssen, sondern sie selbstgewiss mitgestalten zu können.
II.
Religion des Logos: Christentum und Vernunft
Der moderne Staat konnte erst dann weitgehend unangefochten wachsen, als die Einheit und Harmonie der mittelalterlichen Welt der Christenheit faktisch untergegangen und auch nicht mehr als bloße Idee zu retten war. Natürlich wissen wir, dass die Einheit der mittelalterlichen Christenheit nur ein Leitbild war. Man dachte im Horizont des »orbis christianus«6, dabei immer in Spannung gehalten durch widerstrebende Kräfte der politischen Herrschaftsverbände und der christlichen Kirche7. Und dennoch musste sich vor der Zäsur der Reformation jede Territorialherrschaft in Beziehung setzen zum christlichen Glauben und zur dort aufgehobenen Ordnung der Welt. Die mittelalterlich-christliche Ordnung gewann ihre Einheit nicht etwa in betonter Abgrenzung zur Antike, sondern in dem Ringen um die Wiedergewinnung der beiden verflochtenen kulturellen Stränge aus dem Christusglauben der Frühkirche, ihrer Evangelien und ihrer bischöflichen Gliederung einerseits und der imperialen Einheitsidee des Römischen Reiches andererseits8. Die beiden Säulen wurden im Mittelalter sichtbar in dem Anspruch des römischen Papsttums, der mit der Krönung des Franken Karl zum römischen Kaiser wirksam erhoben wurde. Danach hatte der römische Bischof als Nachfolger Petri und als Stellvertreter Christi im Bilderstreit mit Byzanz deren Unwürdigkeit erkannt und in (eigenmächtiger) christlicher Verantwortung die römische Reichsgewalt auf die Franken übertragen – translatio religiösen und weltanschaulichen Pluralismus, in: G. Baadte/A. Rauscher (Hrsg.), Religion, Recht und Politik, 1997, S. 39 ff. (41). 6 Siehe dazu O. v. Nell-Breuning SJ, Gerechtigkeit und Freiheit. Grundzüge der katholischen Soziallehre, 1980, S. 255. Dieses Leitbild der »mittelalterlichen Einheit« war freilich eine Vorstellung von dauerhafter Strahlkraft, auch wenn Nietzsche davon überzeugt war, dass jede vermeintliche »Einheit« oder »Ordnung« tatsächlich nur das Produkt von Herrschaft und Macht sein könne und keinesfalls ein Indikator einer inhärenten Systemrationalität. 7 Der große Konflikt zwischen Kaiser und Papst war ein Streit über divergierende Amtsverständnisse innerhalb der einen »res publica christiana«, O. Depenheuer, Religion als ethische Reserve der säkularen Gesellschaft, in: O. Depenheuer u. a. (Hrsg.), Nomos und Ethos, Hommage an J. Isensee zum 65. Geburtstag von seinen Schülern, 2002, S. 3 ff. (11). 8 M. Heckel beschreibt die transzendente Bindung der Staatsgewalt zur Durchsetzung des Dekalogs und den sittlich gebotenen Schutz der wahren Kirche als Axiom des »Konstantinischen Systems« – die irdischen Regimenter dienten dem Vollzug des göttlichen Gesetzes als Erhaltungsordnung für die Erlösungsordnung. M. Heckel (Fn. 3), S. 114.
94
Udo Di Fabio
imperii Romanorum ad Francos9. Die Neuzeit geht dieser Einheit verlustig. Verloren ging eine Einheit, die nach Martin Heckel die Zusammenschau des Wissens und aller Weisheit der Heiligen Schrift zu ihrer Rechtfertigung aufbot. Die theologischen Grundelemente waren vor der Neuzeit mit dem physikalischen, astronomischen, historischen und geographischen Wissen viel stärker verschmolzen. Der weltliche Geschichtsverlauf war theologisch geradezu determiniert und durch die Kirche erschlossen, er ließ sich aus der Heiligen Schrift erklären10. Mit der Pluralisierung der Bekenntnisse als dem Ringen um die rechte Lehre als Grund und Grenze der Verkündigung (Heckel)11 war der Einheitsanspruch schon deshalb nicht mehr zu halten, weil es nicht um Glaubensrichtungen in einer religiösen Gemeinschaft ging, sondern um konkurrierende Gemeinschaften, gestützt zwar auf dieselbe Quelle der Offenbarung, aber eben mit unterschiedlichem Bekenntnis12. Die mittelalterliche Idee einer Einheit der Christenheit geht allerdings mit der Reformation nicht gänzlich unter, sondern sie wird in einer neuen Unterscheidung aufgehoben, sie lagert sich in einen neuen Dualismus ein, letztlich in den von rationalem Humanismus und christlichem Traditionalismus, aber auch in die konstruktive Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft. Die neue Rechtskultur souveräner Territorien nahm im Grunde dasjenige auf, was das Christentum in Rezeption und KoEvolution mit der griechischen Philosophie und der römischen Herrschaftsrationalität als Geist bewahrte, vor allem das Verständnis des Gesetzes und das Bild vom Wert und der Gleichheit der Menschen. Dabei greift der nach Souveränität drängende moderne Staat durchaus in die Sphäre der Religion. Ernst-Wolfgang Böckenförde beschreibt die mit dem Souveränitätsanspruch aufkommender Staaten einhergehende Bemächtigung ureigener geistlicher Angelegenheiten der Kirche. So gesehen wurde das »ius reformandi« und das »cuius regio eius religio« zu einem Zugriff auf die innere Kirchenhoheit. Vor dem Hintergrund einer staatlichen Vereinnahmung des Eherechts, der Eidesfragen und der geistlichen Gerichtsbarkeit wirkt die Vereinnahmung der Kirche als kontrollierbare Korporation oder gar als abhängige Anstalt eher beunruhigend13, während die
9 C. Adresen/A. M. Ritter, Geschichte des Christentums I/2, 1995, S. 63. 10 M. Heckel (Fn. 3), S. 228. 11 M. Heckel, Gesammelte Schriften: K. Schlaich/M. Heckel (Hrsg.), Staat, Kirche, Recht, Geschichte, 2004, S. 212. 12 »Die Einheit, Wahrheit, Einzigkeit und Ausschließlichkeit der universalen christlichen Verkündung wurde nun […] von allen, den großen wie den kleinen Kirchentümern in voller Absolutheitsbehauptung jeweils für sich beansprucht«, so schreibt M. Heckel die intellektuelle Zumutung des Konfessionskampfes, die insbesondere nach der Etablierung der durchorganisierten Bekenntniskirchen, Bekenntnisstaaten und Bekenntnisbünde zu Tage trete, in: M. Heckel (Fn. 3), S. 227. 13 E.-W. Böckenförde, Staat – Gesellschaft – Kirche, in: F. Böckle/F.-X. Kaufmann/K. Rahner
Christentum und Rechtskultur als Grundlage des Staatskirchenrechts
95
spätere Aufklärung mit ihrer politischen Machtperspektive bis hinein in den Kulturkampf Bismarcks die Religion und die Kirchen als bedrohlich zeichnet, jedenfalls solange sie staatlich (national) unkontrolliert bleiben. Diejenige Herrschaft, die gestützt auf Macht und Anerkennung, territorial und personell begrenzt, sich dauerhaft stabilisieren wollte, musste den Frieden wahren und das Recht; sie kam auch nicht umhin, in ihren neuen partikular territorialen Grenzen eine neue weltliche Idee von gesellschaftlicher Einheit auf sich zu beziehen und zu garantieren. Doch an diesen Ehrgeiz der Aufklärung war vor der Reformation und auch im Jahrhundert danach noch nicht in aller Konsequenz zu denken, weil die Menschen Europas die Welt weiter nach christlichen Maßstäben beurteilten, auch wenn sie im Epochenübergang verunsichert und verstört waren. »Die neuen Beobachtungen und Beweise der Physik, […] Historie und Jurisprudenz waren alarmierend: Sie stimmten mit den Aussagen der Bibel nicht überein. Die Erde stand nicht im Mittelpunkt des Weltalls, […] war keine vom Ozean umflossene Scheibe, die theologische Schau der Welt wich der kausalen Erklärung, das ganzheitliche Denken wurde in stupender Einseitigkeit durch das atomisierende, qualifizierende ersetzt.«14 Das Christentum Europas15 war – im Gefolge kolonialer Missionierung dann immer weiter ausstrahlend – mehr als nur ein Glaubensbekenntnis: Es war zugleich Anschauung und Erklärung der Welt, Paradigma für das moralische Urteil, war ausschlaggebend für den Willen und die Bedingungen jedes Wissens über die Natur. Mit der Schöpfungsgeschichte und dem Sündenfall des Alten, mit dem menschgewordenen liebenden und vernünftigen Gott des Neuen Testaments16 war die Idee der Kausalität gegen jeden Geister- und Aberglauben, die Idee der Humanität gegen jede Menschenverachtung, die Idee des für alle Menschen gleich geltenden Rechts in die Welt gesetzt und konnte so lange nicht zurückgerufen werden, wie der christliche Glaube gesellschaftlich determinierend war. Im Christentum, das mit dem antiken Menschen- und Gemeinschaftsbild verflochten war, und dann in der immer stärkeren scholastischen Öffnung zur Einheit von Glauben und Vernunft findet sich der Boden, auf dem der Renaissancehumanismus mit sei(Hrsg.), Enzyklopädische Bibliothek, Bd. 15, Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, 1982, S. 23. 14 M. Heckel (Fn. 3), S. 230. 15 »Das Christentum ist zwar nicht von Europa ausgegangen, und es ist daher auch nicht einfach als eine europäische Religion, die Religion dieses Kulturkreises einzustufen. Aber es hat in Europa seine am meisten geschichtswirksame kulturelle und intellektuelle Ausprägung gefunden und bleibt insofern auf eine einzigartige Weise mit Europa verflochten.« J. Ratzinger, Europa in der Krise der Kulturen, in: M. Pera/J. Ratzinger, Ohne Wurzeln. Der Relativismus und die Krise der europäischen Kultur, 2005, S. 62 ff. (65 f.). 16 Dazu näher die Enzyklika DEUS CARITAS EST von Papst Benedikt XVI., gegeben am 25. 12. 2005. Libreria Editrice Vaticana, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 171, hrsg. vom Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz, 2006.
96
Udo Di Fabio
nen beiden Polen eines Machiavelli und eines Erasmus von Rotterdam überhaupt erst entstehen konnte und an den Rationalismus, Wissenschaft und Aufklärung dann anknüpfen. »Das Christentum hat sich von Anfang an als die Religion des Logos, als die vernunftgemäße Religion verstanden. Es hat seine Vorläufer prinzipiell nicht in den anderen Religionen, sondern in der philosophischen Aufklärung erblickt […]. Insofern ist die Aufklärung christlichen Ursprungs und ist nicht ohne Grund gerade und nur im Raum des christlichen Glaubens entstanden« (Joseph Ratzinger)17.
III.
Papstkirche und moderne Rechtskultur
Für das Verständnis der Entwicklung der modernen Rechtskultur scheint die Arbeit »Recht und Revolution« von Harold J. Berman (1918 – 2007) nach wie vor ein gelungener Ausgangspunkt zu sein18. Die von Berman seit 1938 verfolgte These fasziniert, obwohl sie zu eng geschnitten sein dürfte. Er sieht im Recht der Papstkirche und ihrer Amtsorganisation eine Blaupause für die Entwicklung zumindest für das moderne Recht, aber auch für den Staat der Neuzeit. Für ihn sind die 100 Jahre zwischen 1050 und 1150 von ausschlaggebender Bedeutung für die Möglichkeit der modernen Rechtskultur19. Dabei lenkt er seinen Blick nach Bologna und er fällt etwa auf Gratian, der vielleicht als Stammvater der modernen Rechtswissenschaft gelten kann. Dessen »Theologia practica externa« ist kirchliche Rechtswissenschaft, erste bedeutende Ausdifferenzierung, die mit der »Concordia discordantium canonum« wieder systematisiert, Widersprüche ausgleichen will, eine Hierarchie der Rechtsquellen liefert und das gesetzte Recht in einen prämodernen Rang erhebt. Berman erklärt, warum dies in Bologna geschieht und warum es überhaupt geschieht: Er pointiert den Vorgang als päpstliche Revolution, verbindet gregorianische Reformen mit dem Geist von Cluny und dem Investiturstreit zu einem Vorgang der organisatorischen Verselbständigung, der Durchsetzung von Amtshierarchien und der geistigen Rationalisierung der römisch-päpstlichen Kirche20. Die Papstkirche prägt für Berman quasi Regierungsformen21, die aus der Jurisdiktion stammend den 17 J. Ratzinger (Fn. 15), S. 78 f. 18 Siehe entsprechende Hinweise schon bei C. Starck, Das Christentum und die Kirchen in ihrer Bedeutung für die Identität der europäischen Union und ihrer Mitgliedsstaaten, in: H. Marr¦/J. Stüting (Hrsg.), Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, 31. Band, 1997, S. 8 f. und W. Huber, Rechtfertigung und Recht. Über die Wurzeln der europäischen Rechtskultur, 2001. 19 Ausdrücklich H. J. Berman (Fn. 2), S. 19. 20 H. J. Berman (Fn. 2), S. 149 ff. 21 Zur päpstlichen Regierung mit Legaten, Beauftragten und Untergebenen: H. J. Berman (Fn. 2), S. 347.
Christentum und Rechtskultur als Grundlage des Staatskirchenrechts
97
Nukleus bilden, aus dem sich neue, rationale Herrschaftsformen bilden: gegründet auf gesetztem Recht und hierarchischer Körperschaftsgliederung, die von der päpstlichen Regierungsgewalt über die Erzbischöfe der Provinz, die Bischöfe der Diözese, das Diakonat und die Pfarrei bis zur Laiengemeinde reicht. Der (aus der Spätantike rezipierte) Amtsbegriff, die Methode der Dekretierung, Entscheidung, Aufsicht, die Pflege der Rechtsprechung, die anspruchsvolle Systematisierung des kanonischen Rechts, all das sind für Berman Gerätschaften in einem großen Labor, ein Prototyp für die weltliche Herrschaft, die zunächst noch ganz anders denkt: personal, in Treue- und Lehensbegriffen, und die sich in eine größere traditions- und religionsbestimmte Ordnung eingebunden sieht. Für diesen paradigmatischen Vorgang braucht das päpstlich dekretierte Recht nicht nur eine ideelle Rückvergewisserung beim weltlich-idealen Recht Ostroms in Gestalt des Corpus iuris civilis22, sondern auch für den praktisch wichtigeren Corpus iuris canonici die Fähigkeiten juristischer Spezialisten, die eine Rechtsschule durchlaufen haben. Die Kirche (parallel und in Konkurrenz mit dem Kaisertum) fördert, teils willentlich, teils gegen ihren Willen, den rationalen Geist des wieder entdeckten Römischen Rechts, nutzt ihn zum Zwecke der päpstlichen Selbstbegründung und Selbstverfassung, leitet also Souveränität in durchaus schon modernem Sinne her und pflegt einige Zeit später mit scholastischen Methoden den evolutionären Vorteil einer Schriftkultur23. Zwei Jahrhunderte nach Beginn der Systematisierung des Körperschaftsrechts wurden Kompetenzstreitigkeiten ausgetragen, die in der Frage, ob monokratisch für die Gemeinschaft gehandelt oder auf den Willen der Mitglieder radiziert werden muss24, durchaus modern wirken und das nicht nur als entfernte Isomorphie, sondern im Sinne substantieller Identität. Findet in dieser körperschaftlichen Entwicklung der Kirche seit den gregorianischen Reformen nicht das Staatskirchenrecht seine erste Plausibilität und seinen geschichtlichen Untergrund? Ist es nicht nahe liegend, dass diejenige politische Herrschaft, die auf rationale kirchliche Organisationsformen trifft und sie kopiert, dann auch auf gleicher Verständnisebene mit dieser Kirche um geistige Vorherrschaft ringt, mit ihr aber auch paktiert und kooperiert25 ? 22 H. J. Berman (Fn. 2), S. 337 ff. 23 H. J. Berman (Fn. 2), S. 341. Auch für die weitaus spätere Reformationsbewegung war die Nutzung von Schriftmedien ein entscheidender Baustein des Erfolgs. So konnten nach H.-C. Rublack »[…] die Druckschriften […] die Meinungsführer erfassen, die literaten Städter, auch die leicht zu mobilisierenden Studenten und die niederen Kleriker, die Ideen an illiterate Stadtbewohner und Bauern weitergeben konnten. Luther durchstieß die Schranken akademischer lateinischer Publizistik und nutzte wie seine Anhänger ein differenziertes Medienspektrum.« H.-C. Rublack, Gesellschaft und Christentum, in: G. Müller (Hrsg.), Theologische Realenzyklopädie, 13. Band, Gesellschaft und Christentum, 1984, S. 1 ff. (5). 24 H. J. Berman (Fn. 2), S. 364 f. 25 Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich neben den formal ordnenden Prinzipien
98
Udo Di Fabio
IV.
Kirchliche Prägung des Rechts
Aber schon Berman und ebenso Paolo Prodi in seiner Geschichte der Gerechtigkeit26 sehen auch, dass es nicht nur um Herrschafts- und Denkformen geht. Die Botschaft des Christentums wirkt auch materiell, sie soll über die stärker rationalisierte Körperschaft gewiss verstärkt werden, aber sie entfaltet auch eine eigene Logik, die mit weltlichen Institutionen reagiert. Dies wird sichtbar am kanonischen Eherecht. Wenn heute die immer noch zahlreichen Vertreter einer unreflektierten Stufe der Aufklärung die christlichen Kirchen und ihre Geschichte mit ihren angeblich überholten Moralvorstellungen wie lebenslanger Ehe und mit der Unterdrückung der Frau in Zusammenhang bringen, so bekämpfen sie vielleicht unbewusst nur die geistigen Quellen ihrer eigenen Freiheits- und Gleichheitsvorstellungen. Denn das kanonische Eherecht hat womöglich mehr zur Einsicht in die soziale Gleichheit der Menschen und der Gleichheit von Mann und Frau vor dem Gesetz beigetragen als manche gesellschaftspolitische Bewegung der vergangenen 150 Jahre. »In heidnischen Kulturen, in denen Polygamie, festgelegte Heiraten und die Unterdrückung der Frau vorherrschten, vertrat die Kirche den Gedanken der monogamen Ehe aufgrund des freien Einverständnisses beider Gatten. Im Westen musste sich dieser Gedanke mit tief verwurzelten Stammes-, Dorf- und Feudalsitten auseinander setzen. Vom 10. Jahrhundert an verkündeten Kirchensynoden Dekrete über Ehe, Ehebruch, die Ehelichkeit von Kindern und damit Zusammenhängendes; trotzdem wurden weiter Kinder in der Wiege verheiratet, und die Familienbeziehungen wurden weiter von den hergebrachten Volkssitten der germanischen, keltischen und anderen Völker Westeuropas bestimmt. Im Volksrecht der europäischen Völker wie auch im klassischen römischen Recht war die Heirat zwischen Angehörigen verschiedener Klassen verboten, die Scheidung auf Wunsch jedes der Ehegatten möglich – in der Praxis hieß das gewöhnlich auf Wunsch des Mannes. Es gab nicht einmal irgendwelche formalen Voraussetzungen für die Scheidung. Für die Gültigkeit einer Ehe war die väterliche Zustimmung nötig. Nur wenige Pflichten der Ehegatten gegeneinander waren juristisch festgelegt.27«
Das Tridentinum (19. Ökumenisches Konzil in Trient, 1545 – 1563) nannte erstmals die Liebe als wesentliches Motiv der Ehepartner, neben der gegenseitigen Hilfe und der Nachkommenschaft. Wurde die Ehe bislang weithin als wirtschaftliche Versorgungseinrichtung und soziales Zweckbündnis verstanden des kanonischen Rechts der Katholiken und den Kirchenordnungen der Protestanten auch die kirchlichen Soziallehren etablierten, die das Handeln in der Gesellschaft selbst normierten, formten und in Wechselwirkung zu staatlichen Entfaltungen standen, so H.-C. Rublack (Fn. 23), S. 13 ff. 26 P. Prodi, Eine Geschichte der Gerechtigkeit. Vom Recht Gottes zum modernen Rechtsstaat, 2003. 27 H. J. Berman (Fn. 2), S. 372 f.
Christentum und Rechtskultur als Grundlage des Staatskirchenrechts
99
und praktiziert, so verstärkte sich nunmehr der sakramentale Charakter der Ehe. Die Vorstellung von der göttlich gewollten Ordnung in und durch die Ehe verfestigte sich. Und zwar noch nicht in einem romantisch verklärten Sinn, sondern im Verständnis eines Sakraments, das die Ehepartner sich in freiem Willensentschluss selber spenden. Mit der Durchsetzung des Zölibats der Priester wurde jedenfalls das Eingebundensein und die Abhängigkeit der Kirche von Stammestraditionen und die Nähe zum politischen wie ökonomischen Verwertungskalkül, aber auch das Risiko einer Verwicklung in weltliche Leidenschaften deutlich gemindert. Die Formalisierung der Ehe, ihre lebenslange Bindung, das Prinzip der Freiwilligkeit nicht nur bei Eingehung, sondern auch beim körperlichen »Vollzug« der Ehe, die Gültigkeit von Eheschließungen über Klassen und Stände hinweg, die Vertragsvorstellung beim Verlöbnis, die Vorstellung einer Bindung aus Liebe, all das hat Frauen ganz konkret und über Jahrhunderte zähen Kampfes hinweg regelmäßig geschützt, ihre Freiheit und Gleichheit zumindest als Merkposten über die Zeiten gerettet und das moderne bürgerlichrechtliche Eherecht nicht nur vorbereitet, sondern bis heute geprägt. Die kirchliche Rechtsprechung zum Sakrament der Ehe als freiwilliger Vereinigung von Mann und Frau ist seit Gratian ebenso wie das Erbrecht der Ausgangspunkt für ein besonderes, systematisiertes Rechtsgebiet. Das Eigentumsrecht blieb zwar ohne sakramentale Basis, doch die Kirche hatte als reiche, indes durch Gewaltakte bedrohte Körperschaft alle Veranlassung, das Besitzrecht und das Eigentumsinstitut zu pflegen, wobei der Reichtum an sich in seinen moralischen Folgen jedoch ein Problem blieb. Gerade die christliche Botschaft hat immer wieder Gläubige dazu veranlasst, sich von persönlichem Eigentum völlig zu lösen, um mit Gleichgesinnten eine andere Lebensform zu wählen, so wie heute noch die aktiven Mendikantenorden (Dominikaner, Franziskaner, AugustinerEremiten) und auf protestantischer Seite die Radikalpietisten, die nach der Auswanderung in ihren amerikanischen Siedlungen die Eigentumslosigkeit eingeführt hatten und für Friedrich Engels als Vorbild einer kommunistischen Gesellschaft galten. Aber als legitime und unentbehrliche Institution war das Privateigentum ein Wert und als solcher unbestritten. Kanonisten und die Glossatoren der wieder entdeckten justitianischen Texte entwickelten zudem ein Vertragsrechtsverständnis, das seit der wirtschaftlichen Blüte des 12. Jahrhunderts auf Nachfrage stieß und auf das erwachende städtische Leben Einfluss gewann28, mit entsprechenden Rückwirkungen auf die Rechtskultur. Wie immer man die Schlussfolgerungen Bermans historisch richtig gewichten mag29, an der Grundthese dürften wenig Zweifel erlaubt sein: Das moderne Zivilrecht entsteht 28 H. J. Berman (Fn. 2), S. 398. 29 Der Anteil der großen oberitalienischen Handelsstädte mit ihrem Bürgertum, ihren Potentialen, ihren Wirtschafts- und Verkehrinteressen wird wohl doch deutlich unterschätzt.
100
Udo Di Fabio
in der (auch) von Rom geförderten, selbstbewusst systematisierenden Aneignung und Fortbildung der Digesten zu einem kanonischen Vertragsrecht, das zusammen mit den familien- und körperschaftsrechtlichen Rechtsvorstellungen zur abendländischen Rechtskultur wächst, wenngleich in langer Konkurrenz zu Volksrechten und den dort gepflegten Gerechtigkeitsvorstellungen30. Gegen Ende des Mittelalters, zu Beginn der Neuzeit, zersetzt sich die kosmologisch konsistente Ordnungsvorstellung der gerechten christlichen Gesellschaft und gibt nunmehr dem umstürzenden Gedanken Raum, man könne neues Recht in der weltlichen Sphäre praktisch beliebig setzen31. Damit wird die Einteilung der Gesellschaft, ihre Orientierung auf personales Charisma, gottgewollter Hierarchie und ständischer Pluralität allmählich aufgegeben; sie weicht einer beweglichen, gestaltbaren Auffassung mit einem individualisierten Menschenbild, man geht – mit den bei dem Durkheim-Schüler Louis Dumont entliehenen Worten Paolo Prodis – über vom Homo hierarchicus zum »Homo aequalis«, von der kosmischen Ordnung zur geschichtlichen32. Die Gesellschaft beginnt sich im geistigen Ambiente von Rationalismus und Humanismus in Funktionskreise der Wirtschaft, der Wissenschaft, des Rechts, der Politik und der Religion zu gliedern, und die politische Institution des nach innen und außen souveränen Staates entwindet dem Christentum der Kirche das zentrale Mandat, für Ursprung und Einheit der Gesellschaft zu stehen. Aus der konstantinischen Schenkung wird der Hobbes’sche Urvertrag, nichts zeigt besser die Verschiebung der Prätentionen. Dabei liegen das neue Bild vom Menschen in der Welt und die Tugendprobleme der Freiheit33 im Grunde ganz nahe an der Botschaft des Neuen Testaments34. Denn die »neue« (antike Denkrichtungen wie die der Stoa gewiss verarbeitende) Auffassung von der Würde des Menschen, seine Gleichheit und seine selbstverantwortliche Offenheit im Leitbild des Humanismus entsprechen der christlichen Botschaft im Grunde viel besser als die Wirklichkeit einer zu Gewalt und Willkür neigenden Adels- und Lehensordnung, die keine rechte Stütze im Wort Christi findet35. Wer die bemerkenswerte 30 31 32 33
Vgl. dazu auch F. v. Halem/ L. Luks, Recht oder Gerechtigkeit?, 2004. P. Prodi (Fn. 26), S. 115 f. P. Prodi (Fn. 26), S. 116 f. L. Aretinus, Isagogicon moralis disciplinae (L. Bruni, Humanistische Transformation des Aristoteles), in: S. Ebbersmeyer/E. Keßler/M. Schmeisser, Ethik des Nützlichen. Texte zur Moralphilosophie im italienischen Humanismus, 2007, S. 112 ff. 34 Siehe dazu auch E. Jüngel, Zur Verankerung der Menschenrechte im christlichen Glauben, in: G. Nooke/G. Lohmann/G. Wahlers (Hrsg.), Gelten Menschenrechte universal?, 2008, S. 166 ff. 35 »(Das Christentum) hat immer alle Menschen, alle Menschen ohne Unterschied, als Geschöpfe Gottes und Bilder Gottes erklärt und damit grundsätzlich – wenn auch in den Grenzen der unüberspringbaren Sozialordnungen – die gleiche Würde aller Menschen proklamiert.« J. Ratzinger (Fn. 15), S. 79.
Christentum und Rechtskultur als Grundlage des Staatskirchenrechts
101
Schrift Pico della Mirandolas »De hominis dignitate« liest, erkennt, wie hier die Quellen des christlichen Menschenbildes geöffnet werden, um den würdigen und wegen seiner Gottesebenbildlichkeit freien Menschen in den Mittelpunkt der Ordnung zu stellen und damit eine Absage an den Vorrang von beherrschenden Kollektiven und unverrückbaren Traditionen zu erteilen36. Mirandolas ursprüngliche scholastische Prägung stammt unter anderem aus dem Studium des kanonischen Rechts an der Rechtsschule von Bologna, bevor er ab 1484 in Florenz auf den Renaissancehumanismus trifft: Dieses biografische Zusammenwirken erhöht die Plausibilität der Thesen von Berman und Prodi.
V.
Das Gewissen als Umwelt zweckrationaler Systeme
Aber wenn wir von diesem Punkt an den sehr weit gespannten Bogen des Verhältnisses von Kirche und Staat wieder zurück verfolgen, wird deutlich, warum das Staatskirchenrecht an eine ganz bestimmte innere Beziehung zwischen Christentum und Rechtskultur gebunden ist: Wenn dieses innere Band sich auflöst, verliert zumindest dieses Rechtsgebiet seine Substanz. Die Geburt der neuzeitlichen Welt wurde von Generationen keineswegs als Zurückdrängung des Christlichen, seine Entzauberung oder als Programm der Säkularisierung verstanden. Schon der jung gestorbene Mirandola wollte in großer Leidenschaft das Christentum erneuern, die Reformation will Frömmigkeit wieder neu und von den Wurzeln her erwecken und mit dem modernen Subjektanspruch des Individuums bereits im konzeptionellen Ansatz versöhnen. Es soll das konkretisiert werden, was der Schrift zugrunde liegt, was mit der Taufe und dem Bürgerrecht ohnehin personal gedacht ist und in der Rechtspersönlichkeit seine Konsequenz findet37. Damit wird das sehr ursprüngliche Verhältnis zwischen weltlicher und göttlicher Ordnung, zwischen Gewissen und Gesetz wieder neu thematisiert, obwohl es in die Fänge einer unerbittlichen Entwicklungslogik hin zur funktional differenzierten Gesellschaft gerät38. Die Möglichkeit individueller Freiheit schafft nicht nur Unsicherheit, woraus denn nun die Gewissheit des gottesfürchtigen Lebens wachsen soll, wenn diese Gewissheit nicht mehr aus der Autorität und Verbindlichkeit der kirchenobrigkeitlichen Anweisungen wächst. Man kann sich auf die Schrift als Fundament zurückziehen und nur noch die Interpretation diskutieren, vielleicht jeder und jede für sich beim Kerzenschein über die Bibel gebeugt, im Ergebnis könnte daraus die von Schleiermacher ge36 Siehe U. Di Fabio, Gewissen, Glaube, Religion. Wandelt sich die Religionsfreiheit?, 22009, S. 52 ff. 37 W. Huber (Fn. 18), S. 13. 38 Zur Ausdifferenzierung von Funktionssystemen: N. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 2. Band, 1997 , S. 707 ff.
102
Udo Di Fabio
fürchtete Privatreligion werden39. Aber was ist dann mit der gesellschaftlichen Ordnung? Wenn die gesellschaftliche Ordnung nicht mehr christlich geprägt ist, kann sie dann nicht im Ganzen (nicht nur im Einzelfall) ungerecht und sündhaft werden? Gelten in einem solchen Fall die weltlichen Gesetze für den Christen? Die auf Verfänglichkeit angelegte Frage von Pharisäern und Herodianern betreffend die Steuerzahlung an die Römer wird von Jesus in scheinbar einfacher, aber doch rätselhaft dialektischer Weise beantwortet: »Was des Kaisers ist, gebt dem Kaiser, und was Gottes ist, Gott. Und sie wunderten sich über ihn.«40 Die das »Wundern« auslösende Dialektik entfaltet sich, wenn man sieht, dass das Reich der Christen nach dem Neuen Testament auf Liebe gründet, nicht auf Macht und Gewalt. Vor der Gewalt politischer Herrschaft entfliehen die Christen nicht in die Wüste, sie rebellieren aber auch nicht, um umzustürzen, sondern sie halten der Macht stand und wirken in dieser Welt mit ihrer transzendenten Botschaft, die durch den Tod des Mensch gewordenen Gottessohnes immer in dieser Welt bleibt und zugleich über sie hinausweist. Der Christ ist mit seinem Gewissen eine eigenwillige Umwelt weltlicher Herrschafts- und wirtschaftlich-technischer Verkehrsformen. Das Christentum wirft von vornherein die Frage auf, ob das Recht gerecht sei, macht weltliches Recht am Maßstab des natürlich-göttlichen Rechts beurteilbar41. Damit kollidiert der absolutistische Anspruch, Recht aus der Sphäre des Staates unbegrenzt setzen zu können und der »aequitas« im Sinne von Billigkeit und Gerechtigkeit nicht recht erlauben will. Aber die Mäßigung 39 F. Schleiermacher, Über die Religion, 1958, S. 97 ff.; A. Hollerbach, Die Kirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts, in: J. Krautscheidt/H. Marr¦ (Hrsg.), Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, 1. Band, 1969, S. 46 ff. (48). 40 NT, Mk 12, 13 – 17. Hierzu bemerkt J. Gnilka, dass die Perikope stilistisch als traditionelles rabbinisches Lehrgespräch ausgeformt ist: Frage, Gegenfrage und Demonstration mit abschließender Antwort haben apophthegmatischen Charakter. Trotz aller Klarheit im Aufbau scheint dieses – vielen als authentisch geltende – Jesuswort eine der durch die Jahrhunderte am heftigsten diskutierte Stelle des NT, ein spannungsreicher Bogen reicht hier von der Interpretation Jesu als revolutionärem Zeloten bis hin zur Deutung Jesu als Proklamator einer gottgewollten Staatsautorität; schon Justin (ca. 165 n. Chr.) begreift das Logion als Einforderung vorbehaltloser Pflichterfüllung gegen staatliche Gewalt, Calvin verstärkt die Sicht zugunsten der staatlichen Autorität, wenn er sagt: »Wer die staatliche Ordnung umstürzen will, ist auch Anführer gegen Gott, […]«, eine Perspektive, die schließlich im Gottesgnadentum fürstlicher Gewalt kulminiert. Nach gegenwärtiger Lesart wird hier von Jesus – in einer spezifisch feindseligen Situation – die Steuer bejaht und die kaiserliche Autorität anerkannt, das Nebeneinander von »Kaiser« und »Gott« ist aber nicht als Balance aufzufassen, vielmehr erfährt das Recht des Kaisers dort seine Grenze, wo die göttliche Autorität beginnt, die Betonung liegt somit auf Gott, dem jeder hörig zu sein hat und Gott hat stets die höheren Ansprüche; wo imperiale Macht und göttlicher Anspruch sich kreuzen, kann in dieser Sicht die Entscheidung nur zugunsten Gottes getroffen werden. J. Gnilka, Das Evangelium nach Markus (Mk 8,27 – 16,20), in: J. Blank u. a. (Hrsg.), Evangelisch-Katholischer Kommentar zum NT, 2. Teilband, Zürich 1979, S. 150 – 157. Siehe dazu auch näher W. Schrage, Die Christen und der Staat nach dem neuen Testament, 1971, S. 29 ff. 41 P. Prodi (Fn. 26), S. 119.
Christentum und Rechtskultur als Grundlage des Staatskirchenrechts
103
und »Verhältnismäßigung« wird dann doch im Prozess der konstitutionellen Bindung und der Menschen- und Grundrechte gleichsam in das staatliche Rechtsprogramm kopiert, wohl auch um staatsgefährdenden Widerständen, wie etwa Gewissensentscheidungen, die Spitze zu nehmen. Der moderne Staat übernimmt sein rechtskulturelles Programm aus jüdisch-christlichen Beständen, leiht sich gewiss auch einiges an Wissenschaftstradition aus der islamischen Welt, sehr vieles aus der griechischen und römischen Antike. Aber die Bibel steht im Mittelpunkt. Die Idee des Volkes als Schicksalsgemeinschaft hat nicht nur antike und germanische Wurzeln, sondern geht zu Beginn der Neuzeit auch sehr stark auf das auserwählte Volk der Israeliten42 und die Kirche als Gemeinschaft und das Volk der Christen zurück43. Dass zu richten sei ohne Ansehen der Person, findet sich natürlich schon in der älteren antiken Rechtstradition, aber im Mittelalter lebendig gehalten wurde dies durch die alt- und neutestamentarischen Quellen44. Hier findet sich die für die Neuzeit wirksam werdende Substanz des großen Satzes »Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich«. Die Suche nach Frieden45 und nach einer gerechten Welt, die auf Nächstenliebe gründet, ist im Nachvollzug des Entwicklungspfades immer auch unverrückbar christlich, wie auch der Leistungsgrundsatz, der Arbeit verlangt und nicht Müßiggang46. Der Staat verdrängt zwar die christliche Religion aus 42 AT, Psalm 105, 43. 43 Siehe auch M. Luther, Die sieben Kennzeichen der Kirche, in: Bezzenberger, Freiheit und Bindung. Vier Schriften Martin Luthers, 1996, S. 113. 44 Ohne Ansehen der Person geht auf AT, Dtn 1, 117 zurück: »Schaut im Gericht nicht auf die Person. Hört den Geringen an wie den Vornehmen! Vor keinem dürft ihr euch scheuen, denn das Gericht ist Gottes. Ist euch aber eine Sache zu schwer, so bringt sie zu mir, dass ich sie höre.« Die Bibelstelle beschreibt das Ereignis in der Geschichte des Volkes Israel, als Moses die just von ihm berufenen Richter ermahnt, die ihn von der schweren Bürde seines Richteramtes etwas entlasten sollen. Moses wendet sich hier dezidiert gegen parteiliche Rechtsprechung oder Begünstigung, und zwar nicht aus einem moralischen Impetus heraus, sondern unter Berufung auf Gott selbst, als Richter in letzter Instanz. H. Lamparter, Der Aufruf zum Gehorsam: Das 5. Buch Mose, 1977, S. 26. Und auf NT 1. Petrus 1, 17: »Und wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht.« Vgl. auch N. Brox, Der erste Petrusbrief, in: ders. (Hrsg.), Evangelisch-Katholischer Kommentar zum NT, 21. Band, 4 1993, S. 79 f. 45 Friedensgebot (Pax tecum! Pax vobiscum!) NT Lk 24, 36. Wird auch als liturgischer Gruß während jeder katholischen Messfeier verwendet, entspricht dem Gruß, den Jesus nach seiner Auferstehung an die Jünger richtete. 46 NT 2. Tessalonischer 3, 10: »Denn auch als wir bei euch waren, haben wir euch dies befohlen, dass einer, der nicht arbeiten will, auch nicht essen soll.« In dieser viel zitierten Bibelstelle wendet sich Paulus autoritativ gegen den Misstand des »faulen Lebenswandels«, gegen Gemeindemitglieder, die nicht von ihrer Hände Arbeit leben, sondern »Unnützes« treiben. Mit diesen Gemeindemitgliedern soll der Verkehr strikt abgebrochen werden. Durch eine gespannte Parusieerwartung kommt es in der Gemeinde zu eschatologisch motivierten Arbeitsniederlegungen, Paulus greift hier keine sittliche Verfehlung oder Irrlehren an, sondern
104
Udo Di Fabio
dem Zentrum der Gesellschaft, weil er ihre Botschaft in verweltlichter Formensprache sich zu eigen macht, aber er kann das Christentum nicht wirklich beerben, weil seine Instrumentalität weder Liebe noch Eros erlaubt – Patriotismus kam dem am nächsten, die Entfesslung von Leidenschaften im Nationalismus aber hätte – jedenfalls in Europa – beinah die ganze rationale Staatsidee zum Einsturz gebracht. Stattdessen setzt man seit der französischen Revolution und dann im 19. Jahrhundert, vor allem nach Feuerbach auf weltliche Varianten des Seelenheils: ewiger Fortschritt statt ewiges Leben, Aufhebung aller Antagonismen im Kommunismus statt Himmel und Paradies, Aufklärung statt Erleuchtung, Revolutionäre oder Sozialplaner statt Priester. Diese heimliche Theologisierung der differenzierten Gesellschaft und des rational begrenzten (sektoralen) Staates durch die antireligiösen Kräfte der Aufklärung ist im Kern antimodern, auch wenn sie sich selbst ganz anders in Szene setzt. Doch die Gegenkräfte aus den christlichen Konfessionen waren zunächst noch enorm groß und verlangten nach Einbindung und Achtung. Schaut man sich die Entstehung der Weimarer Verfassung und ihrer Kirchenartikel an, so sieht man aber auch, dass ein politisches Interesse an der Erhaltung des deutschen Volkes als eines christlichen47 bestand und dass dies der eigentliche Grund für die Beschlicht die Arbeitsscheu bzw. den mangelnden Arbeitsethos. Dies ist eine entscheidende Klarstellung, denn mit dem gr. »thelein« meint Paulus den Willen zur Arbeit, erzwungene Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit sind also keinesfalls mitgedacht. Dieses Pauluswort hat – als verpflichtendes Traditionsgut – seit der Väterzeit über das Mittelalter bis in die neuzeitliche christliche Sozialethik seine Spuren hinterlassen, am augenfälligsten sind hier das katholisch-benediktinische »Ora et labora« oder die protestantisch-calvinistische Prädestinationslehre, Erfolg durch harte Arbeit ist ein Zeichen der persönlichen Erwähltheit. Paulus verlangt hier ein striktes und ausgrenzendes Vorgehen, aber er verlangt dieses Verhalten nicht gegenüber einem Schutzbedürftigen oder Schwachen, dem der Christ zu Solidarität und Unterstützung verpflichtet wäre, sondern er verlangt es gegenüber einem, der aus freiem Willen das »Unnütze« gewählt hat. Freilich geht er nicht so weit, den Arbeitsscheuen aus der Gemeinschaft auszuschließen, also zu exkommunizieren. 47 L. Richter, Kirche und Schule in den Beratungen der Weimarer Nationalversammlung, 1996, S. 248; C. Hillgruber, Staat und Religion, 2007, S. 46; doch auch die Bundesrepublik Deutschland bekennt sich in der in der Verfassungspräambel festgeschriebenen »InvokatioDei-Formel« zu ihrer christlichen Grundlage. Nach einer Untersuchung von B. v. Schewick hat die katholische Kirche während der Arbeiten des Parlamentarischen Rates einen beachtlichen Einfluss auf die Verfassungsgestaltung genommen und mit den Abgeordneten des Zentrums, der CDU/CSU und der DP gegen die FDP, vor allem gegen Kommunisten, aber auch Sozialdemokraten eigene Modelle durchgesetzt. Insbesondere J. Kardinal Frings und sein Beauftragter, der Domkapitular W. Böhler, waren in intensiven Auseinandersetzungen – insbesondere mit dem Präsidenten des Parlamentarischen Rates, K. Adenauer, und dem Mitglied des Parlamentarischen Rates, T. Heuss – darauf bedacht, die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Bundesrepublik auch christlich zu gestalten. Im Pathos der 40er Jahre liest sich ein Hirtenwort der deutschen Bischöfe (Fuldaer Bischofskonferenz vom 26. 8. 1948) so: »Wir wollen dafür Sorge tragen, dass die Grundsteine (der Verfassung) mit der Ehrfurcht vor Gott gesalbt und nicht in den Schatten der Gottesferne gelegt werden« (S. 68). J. Kardinal Frings äußerte sich in einem Schreiben an K. Adenauer vom 25. 10. 1948 noch deutlicher : In
Christentum und Rechtskultur als Grundlage des Staatskirchenrechts
105
wahrung der körperschaftlichen Autonomie als institutionelle Absicherung der Religionsfreiheit und als öffentliche Wirkungsverstärkung gewollt war. Aber wer das Staatskirchenrecht lediglich entweder als pragmatische Wirkungsverstärkung staatlichen Machtanspruchs oder allein als grundrechtliche Flankierung der Religionsfreiheit missversteht48, übersieht womöglich die tiefe kulturelle Verknüpfung von Christentum und Rechtskultur des Verfassungsstaates: »In Deutschland, dem Land der Reformation, des großen Glaubenskrieges, der Säkularisation und des Kulturkampfes ist es ein Wesensmerkmal der geistigen und geistlichen Geschichtserfahrung, dass die verschiedenen im Bogen des Christentums versammelten Konfessionen, Kirchen und Sekten im Genuss dieser Freiheiten sind, auch wenn erst die Aufklärung, die bürgerliche Verfassungsbewegung und die grundsätzliche Trennung von Staat und Kirche nach dem Sturz der Monarchie die volle Ausbildung und Sicherung dieses religionsrechtlichen und kirchenpolitischen Systems bewirkt haben« (Peter Badura)49.
VI.
Die Zeichen einer neuen, reflexiven Aufklärung
Aber was soll eigentlich noch diese Bekräftigung einer langen, dem Grunde nach unbestrittenen Ko-Evolution von Kirche und Staat? Steht nicht heute die christliche Religion mitten im Zerfallsprozess der bürgerlich-modernen Industriegesellschaft50 ? Müsste nicht die De-Institutionalisierung auch der Rechtskultur und des Staates zu einer Bewegung »los vom Staat« führen, damit die Kirchen jenseits eines positiven Rechts, das sein Maß und seine Konsistenz im System der vielen bürokratischen Ebenen zu verlieren droht, wieder größere Bewegungsfreiheit für die Verbreitung ihres Glaubens finden? Eine solche Enteiner Verfassung seien Grundsätze zu verankern, die einerseits die Stellung des Menschen im Staat regeln, wie das Recht der Eltern auf eine Bekenntnisschule, die Sicherung des Religionsunterrichts, den Schutz der Privatschule und Regelungen über die Unverletzlichkeit von geborenem und ungeborenem Leben und andererseits das Kirche-Staat Verhältnis nicht ungeregelt ließe (S. 80). All dieses fehlte in einem ersten Verfassungsentwurf des Grundrechtsausschusses, der von einer stärkeren Regelungskompetenz durch die Länder ausging und nur Kernpunkte (»Mindestnormen«) regeln wollte. Der Kirche ging es dabei nach dem totalitären Trauma um eine grundlegende Reform des gesellschaftlichen Lebens (S. 128). B. v. Schewick, Die Katholische Kirche und die Entstehung der Verfassung in Westdeutschland 1945 – 1950, 1980. 48 Zu den Gefahren einer parallel laufenden Gleichgültigkeit: H. Meier, Kirche – Staat – Gesellschaft, in: J. Krautscheidt/H. Marr¦ (Hrsg.), Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, 1. Band, 1969, S. 17. 49 P. Badura (Fn. 5), S. 41. 50 K. Gabriel, Christentum zwischen Tradition und Postmoderne, 1992, S. 141; F.-X. Kauffmann, Kirchenkrise, 2011, S. 82 ff.
106
Udo Di Fabio
kopplung wäre für beide Seiten jedenfalls riskant und womöglich sogar fatal. Die erst in den letzten Jahrzehnten zur herrschenden Einstellung, ja zur Massenkultur gewordene eindimensionale Aufklärung, die sich noch nicht selbst kritisch beobachten will, hat eine Lagerbildung des Denkens befördert, das sich blind macht für strukturelle und evolutionäre Kopplungen. Diese Aufklärung erster Ordnung kämpft weiter einen Schattenkampf gegen übermächtige Kollektive, Institutionen und Traditionen, die pauschal die individuelle Freiheit bedrohen sollen, obwohl es diese Zwangskollektive, vielleicht mit Ausnahme der rationalen, mit den Aufklärern verbündeten öffentlichen Gewalt, eigentlich nicht mehr oder jedenfalls noch nicht wieder gibt. Wer die freiwillige Bindung von Menschen in den Kirchen, wer Gläubigkeit für rückständig oder für kleinbürgerliche Schwäche hält, hat nicht verstanden, worauf es ankommt. Das Primat der Kollektive ist in den Staaten des Westens spätestens seit den sechziger Jahren verloschen, seitdem regiert im Westen bislang unangefochten das Primat individueller Entscheidungsfreiheit.51 Diese Entwicklung war nicht zuletzt in der Entfaltungslogik des vernunftgeöffneten Christentums52 deutlich angelegt53. Die Idee der Würde54, diejenige der natürlichen Lebensgrundlagen als Teil des Schöpfungswerks, des sektoralen Staates, also der Trennung von Gesellschaft und Staat, die Idee der Grundrechte und der Menschenrechte, die Vorstellung individueller Freiheit55, von Gewissensfreiheit, von Gleichheit und sozialer Verantwortung, sie alle können – auch wenn sie Kräfte und Resultate in einem universalen Zivilisationsprozess sind – ihre kulturellen Wurzeln aus der Geschichte des Christentums nicht verleugnen, andernfalls würden sie Überzeugungskraft, Konsistenz und einen eigentlichen Grund verlieren56. Aber, so kann man fragen, ist das nicht dennoch nur ein Hinweis auf Geschichte, ohne Belang für die Zukunft? Eine neue, allmählich stärker werdende Aufklärung zweiter Ordnung57, die sich in ihrem Wechselspiel mit religions- und alltagskulturellen 51 Dazu aufschlussreich C.s Taylor, Das Unbehagen an der Moderne, 1995. 52 Deren Ursprünge man in der Apologetik am Ausgang der urchristlichen Phase sehen kann, G. Theißen, Das Neue Testament, 32006, S. 115. 53 W. Huber, Gerechtigkeit und Recht. Grundlinien christlicher Rechtsethik, 32006, S. 205 ff. Nach J. Ratzinger steht der christliche Glaube dafür ein, dass die Welt aus der Vernunft kommt und Vernunft somit ihr Maß und Ziel ist; eine Vernunft, die schöpferisch ist und sich im gekreuzigten Sohn Gottes als Liebe gezeigt hat. J. Ratzinger (Fn. 15), S. 80. 54 C. Hillgruber, Wie viel Christentum braucht, wie viel Christentum verträgt der Staat des Grundgesetzes? in: F. Kirchhof/H.-J. Papier/H. Schäffer (Hrsg.), Rechtsstaat und Grundrechte, Festschrift für D. Merten, 2007, S. 23 (24); ausführlich hierzu ders. (Fn. 47), S. 56 – 65. 55 M. Heckel, Der Einfluss des christlichen Freiheitsverständnisses auf das Staatliche Recht, in: H. Marr¦/D. Schümmelfelder/B. Kämper (Hrsg.), Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, 30. Band, 1996, S. 82 ff. 56 C. Hillgruber, Staat und Religion, DVBl. 1999, S. 1155 ( 1178). 57 Zur Idee einer zweiten Aufklärung vgl. N. Postmann, Building a Bridge to the Eightteenth Century, 1999, der Titel ins Deutsche übersetzt als »Die zweite Aufklärung«, 2001. Dabei
Christentum und Rechtskultur als Grundlage des Staatskirchenrechts
107
Grundlagen der Gesellschaft selbst beobachtet und sinnvoll ausrichtet, also reflexiv angelegt ist, erkennt nicht nur wieder stärker den Wert von gefährdeten Institutionen, sondern auch den Wert von bürgerlicher Lebenskultur und christlichem Gemeindeleben. Unter dem heute herrschenden Vorrang individueller Entscheidungsfreiheit wird die Revitalisierung von im Zugang offenen, im Stil individualisierten Gemeinschaften zu einer Überlebensfrage nicht allein der Gesellschaft, sondern vor allem für die Möglichkeit von Freiheit, gegen die drohende Übermacht neuer Kollektive. Eine freie Gesellschaft kann sich nicht mit Grundrechtsverwaltung oder der weiteren Perfektionierung sozialtechnischer Planung über die Klippen von Orientierungs- und Vitalitätsverlusten retten, ohne mit der immer weiteren Politisierung und Verrechtlichung bis hinein in die Kernbereiche von sozialen Gemeinschaften wie Familien und Religionsgemeinschaften die Freiheit Schritt für Schritt stärker konformistisch zuzurichten und immer weniger Toleranz für die Abweichung von ideologischen Tageseinsichten zuzulassen. Die Aufklärung zweiter Ordnung dagegen, die sich als reflexive Aufklärung in ihren Voraussetzungen und Wirkungen selbst beobachtet58, widersteht den Sirenengesängen sowohl des Antirationalismus wie auch einer – damit nicht nur weitläufig verwandten – zunehmenden Neigung zur Auflösung und Ablehnung gesellschaftlicher Unterscheidungen nach Funktionsbereichen, also einer Neigung zur Entdifferenzierung der Gesellschaft. Aus einem politisch-wirtschaftlichen Verbundsystem heraus werden inzwischen alle sozialen Gemeinschaften und alle Orte institutioneller Freiheit, und so auch die Kirchen, in eine politisch-moralisch hergeleitete und holistisch angelegte Pflicht genommen. Auch die Menschenrechte werden zunehmend ihres überpositiven und ihres überrechtlichen Gehalts entkleidet, politisch und rechtlich argumentativ für (gewiss in den meisten Fällen sehr berechtigte) Interessen zugeschnitten. Das wird in einigen Fällen durchaus eine Wirkungsverstärkung bedeuten und darf als solche begrüßt werden, es kann aber auch jene Metaebene in Vergessenheit geraten lassen, die das christliche Rechtsdenken ausmacht: Damit gemeint ist die Vorstellung, dass das staatliche Recht zwar vom Christen befolgt wird, aber das weltliche Gesetz ihn nicht von der eigenen Gewissensentscheidung und der eigenen Beurteilung der Welt entbinden kann59. Das Christentum ist insofern immer sperrig, seit seinen römischen Anfängen, weil das von Christus gelebte und geoffenbarte Menschenbild nicht zur Disposition gestellt referiert Postman Siegmund Freud mit der »erwachsen gewordenen Menschheit«, a. a. O., S. 138. 58 Siehe U. Di Fabio (Fn. 36), S. 43 ff. 59 Dazu Benedikt XVI., Eine menschlichere Welt für alle. Die Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 18. April 2008, 2008; siehe dazu auch den Beitrag U. Di Fabio, Caput mundi. Die Frage nach der Gerechtigkeit des Rechts vor der Versammlung der Welt, ebenda, S. 59 ff.
108
Udo Di Fabio
werden kann. Christliche Weltsicht und staatliche Herrschaftsansprüche erzwingen jedenfalls eine Pluralität der Perspektiven, die wiederum Voraussetzung für Wahlfreiheit und Toleranz ist. Wenn die Kirchen eine schleichende Politisierung ihrer Glaubenswelt unbesehen mitmachen, dann drohen sie postmoderne Landeskirchen zu werden.60 Wenn sie dagegen allzu schroff auf eigene sittliche Rationalitätszugänge bestehen, werden sie nicht nur unter Druck der politischen öffentlichen Meinung geraten. Sie werden dann auch diejenigen Menschen verstören, die sie gewinnen wollen, die aber noch in der engen Zweidimensionalität von wirtschaftlichem Zweckkalkül und politisiertem Weltzugang gefangen sind. Es geht um den erweiterten, den kritischen Zugang zur Welt und zugleich für die Kirchen um die Wahrung der religiösen Identität. Das Staatskirchenrecht zielte nie auf entdifferenzierte Einheit oder einheitslose Differenz, sondern auf eine Einheit, die aus dem sichtbaren Unterschied von weltlichem Staat und transzendent gerichteten Kirchen ihren Sinn erhält61. Wenn der Staat und seine überstaatlichen Einrichtungen weiter lebendiger Rechtsstaat sein wollen, sollte die Neutralität als wohlwollende verstanden werden, weil es um kulturelle Grundlagen geht, die politischen und rechtlichen Instrumenten nicht ohne weiteres zugänglich sind. Beide Seiten sollten aber jene hypertrophen Auswüchse zurückschneiden, die ihre jeweilige Identität bedrohen. Eine Religionsgemeinschaft schöpft ihre Kraft aus der Verbreitung des Glaubens. Wer meint, dass Glaubensfestigkeit erst heute durch einen angeblichen Megatrend der Säkularisierung erschüttert sei, der wird vielleicht doch Opfer eines unhistorischen linearen Fortschrittsdenkens. Ist die Geschichte des Christentums nicht voll von Etappen des Niedergangs, der Korruption, der Identitätsbedrohungen? Sie ist doch aber auch ebenso voll von höchst überraschenden Erholungen, der Wiederkehr ihrer ursprünglichen Botschaft, der erneuten Verbreitung des Glaubens. Das gleiche gilt für die alte Idee einer weltlich gerechten Ordnung. Die Verirrungen überkomplexen Rechts, die finanzielle Überschuldung und die Hybris einer auch noch spirituellen Allzuständigkeit sind der Geschichte politischer Herrschaft keineswegs fremd. Auch der Staat 60 Vgl. hierzu die Ansprache von Papst Benedikt XVI. am 25. 9. 2011 in Freiburg: »Um so mehr ist es wieder an der Zeit, die wahre Entweltlichung zu finden, die Weltlichkeit der Kirche beherzt abzulegen. Das heißt natürlich nicht, sich aus der Welt zurückzuziehen, sondern das Gegenteil. Eine vom Weltlichen entlastete Kirche vermag gerade auch im sozial-karitativen Bereich den Menschen, den Leidenden wie ihren Helfern, die besondere Lebenskraft des christlichen Glaubens zu vermitteln«. 61 »Anders als in neuerer Zeit behauptet worden ist, bedeutet religiöse und weltanschauliche Neutralität des Staates nicht Indifferentismus von Staat und Recht gegenüber Religion und Kirche oder gar das Gebot des Ignorierens von Religion und Kirche durch Staat und Recht. Wesentliche Rechtswerte – etwa des Familien- oder Strafrechts – (könnten) ohne ihre Fundierung in einem mehr oder weniger religiös oder weltanschaulich entwickelten Kulturhorizont nicht verstanden werden.« P. Badura (Fn. 5), S. 42 f.
Christentum und Rechtskultur als Grundlage des Staatskirchenrechts
109
wurde immer wieder neu entworfen, zurückgeführt auf Menschenmaß, auf seinen begrenzten, aber anspruchsvollen, weil sittlichen Zweck. Beiden Sphären kann aber solche stärkende Entwicklung auf längere Sicht nur gelingen, wenn sich die Alltagskultur der Bürger – und damit eine wesentliche Bedingung der Rechtskultur – wieder selbstbewusster zeigt und nach einem Sinn des Lebens sucht, der eigene Freiheit und selbstgewählte Bindung gleichermaßen schätzt, dabei seine Herkunft auch in Gemeinschaften des Glaubens respektiert und den Horizont des Anderen achtet, denjenigen anderer Religionen und auch den der Agnostiker.
Wolfgang Huber
Kirche und Verfassungsordnung1
I.
Zur Problemstellung
Immer wieder neu wird nach dem Verhältnis von Kirche und Verfassungsordnung gefragt;2 es scheint, diese Frage werde niemals ausgeschöpft. Politische Neuordnungen oder kirchliche Neubesinnungen geben dazu ebenso Anlass wie gesellschaftliche Verschiebungen. Wenn die Frage heute erneut aufgeworfen wird, dann sind es vor allem gesellschaftliche Verschiebungen, die ein neues Nachdenken auslösen. Doch worin bestehen diese Verschiebungen? Auf diese Frage kann man höchst unterschiedliche Auskünfte hören. Drei derartige Auskünfte drängen sich in den Vordergrund; die Stichworte für sie heißen: Säkularisierung, Wiederkehr der Religion, religiöse Pluralität. Die einen sehen unsere Gegenwart nach wie vor im Bann eines epochalen Säkularisierungsprozesses;3 er führt, so meinen sie, unweigerlich zu einer Marginalisierung der Religion; dem müsse man, so folgern sie, auch in der Verhältnisbestimmung von Kirche und Verfassungsordnung Rechnung tragen. Dieser Ansatz verbindet sich häufig mit einer Tendenz dazu, die bestehende 1 Die Erstveröffentlichung dieses Beitrages erfolgte in der Schriftenreihe Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, Band 42, hrsg. von B. Kämper und H.-W. Thönnes, 2008, S. 7 – 30. Ich danke Verlag und Herausgebern herzlich für die Zustimmung zum Wiederabdruck; insbesondere danke ich B. Kämper für alle Unterstützung. 2 Schon in den zurückliegenden Jahren haben sich die »Essener Gespräche« mit im weitesten Sinne hierauf zielenden Themen befasst: H. Marr¦/D. Schümmelfelder/B. Kämper (Hrsg.), Säkularisation und Säkularisierung, Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche (EssGespr.), Band 38 (2004); B. Kämper/H.-W. Thönnes (Hrsg.), Religionen in Deutschland und das Staatskirchenrecht, EssGespr. 39 (2005); dies. (Hrsg.), Die Trennung von Staat und Kirche. Modelle und Wirklichkeit in Europa, EssGespr. 40 (2007). 3 Eine Übersicht zum Begriff der Säkularisierung bei W. Heun und M. Honecker, Art. »Säkularisierung«, in: W. Heun/M. Honecker/M. Morlok/J. Wieland (Hrsg.), Evangelisches Staatslexikon, 42006 (EvStL4), Sp. 2073 – 2080, m. w. N. Aus religionssoziologischer Sicht F.-X. Kaufmann, Gegenwärtige Herausforderungen der Kirchen durch die Säkularisierung, in: EssGespr. 38 (2004), S. 103 ff.
112
Wolfgang Huber
staatskirchenrechtliche Ordnung in einer laizistischen Richtung umzudeuten oder weiterzuentwickeln. Das wird als notwendig angesehen, um den veränderten religionssoziologischen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die anderen sehen unsere Gegenwart unter dem Vorzeichen einer Wiederkehr der Religion.4 Die These, Religion sei Privatsache, hat sich, so stellen sie fest, nicht bewahrheitet. So sehr Menschen nach einem Glauben fragen, der ihnen für ihr Leben Halt gibt, so fragen sie auch nach der öffentlichen Stimme und dem öffentlichen Handeln der Religionsgemeinschaften, insbesondere der Kirchen. Die Verhältnisbestimmung von Kirche und Verfassungsordnung wird also unter dem Gesichtspunkt betrachtet, ob es dieser sich wandelnden Bedeutung von Religion gerecht wird, die Freiheit der persönlichen religiösen Überzeugung schützt und die öffentliche Wirksamkeit der Religionsgemeinschaften achtet. Schließlich wird auf den Wandel aufmerksam gemacht, der sich aus den globalen Wanderungsbewegungen und der weltweiten Kommunikation ergibt. Nur wenige Länder oder Regionen der Erde sind religiös homogen. Aber für Europa gilt auf besondere Weise, dass es in eine Situation verschärfter religiöser Pluralität5 eingetreten ist. In unseren Tagen ist dieses Faktum vor allem durch vier neue Momente geprägt: durch eine gewachsene Bedeutung des Islam (und seit dem 11. September 2001 durch ein gewachsenes Bewusstsein für dessen Präsenz), durch eine erhöhte Aufmerksamkeit für die kleineren christlichen Kirchen und ihre durch Migrationsvorgänge ebenfalls gewachsene Präsenz; durch die Entstehung von neuen religiösen Gemeinschaften (bis hin zu der Frage, ob sie diesen Namen zu Recht tragen) und schließlich durch einen erheblichen Anteil von Gesellschaftsgliedern, die sich zu keiner Religion bekennen. Wer die gegenwärtige Situation vor allem unter dem Gesichtspunkt der verschärften religiösen Pluralität betrachtet, stellt im Blick auf das Verhältnis von Kirche und Verfassungsordnung vor allem die Frage, ob die gegebene verfassungsrechtliche Ordnung dieser Pluralität gerecht wird. Ob die Religionsfreiheit der Religionslosen und der Anhänger kleinerer religiöser Gemeinschaften ausreichend gesichert ist, wird dann ebenso zum Thema wie die Frage, ob das traditionelle Staatskirchenrecht zu einem Religionsverfassungsrecht6 werden muss. Säkularisierung, Wiederkehr der Religion, verschärfte religiöse Pluralität – so heißen die unterschiedlichen Akzente für die Beschreibung der neuen gesellschaftlichen Lage, die ein neues Fragen nach dem Verhältnis von Kirche und 4 Zu diesem Stichwort siehe etwa U. H. J. Körtner, Wiederkehr der Religion?, 2006; G. Küenzlen, Die Wiederkehr der Religion. Lage und Schicksal in der säkularen Moderne, 2003. 5 Hierzu E. Jüngel, Religion, Zivilreligion und christlicher Glaube. Das Christentum in einer pluralistischen Gesellschaft, in: EssGespr. 39 (2005), S. 53 ff. 6 Dokumentation einer Tagung zu dieser Frage bei H.-M. Heinig/C. Walter (Hrsg.), Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht? Ein begriffspolitischer Grundsatzstreit, 2007.
Kirche und Verfassungsordnung
113
Verfassungsordnung auslöst. In jeder dieser drei Akzentsetzungen steckt natürlich ein unleugbarer Wahrheitskern; aber in jeder stecken auch Probleme. So ist nicht zu leugnen, dass die soziale Durchsetzungsmacht und die traditionsbildende Kraft der christlichen Kirchen in Europa seit dem Zeitalter der Aufklärung und der Französischen Revolution zurückgegangen sind. Doch ob dieser gesellschaftliche Wandel mit dem Begriff der Säkularisierung richtig beschrieben wird, ist mehr als fraglich. Die Begriffe der Säkularisierung und der Säkularität werden dann am präzisesten verwendet, wenn sie auf die Frage nach der rechtlichen Stellung von Staat und Religion angewandt werden. Hier muss nach meiner festen Überzeugung die Ausgangsthese heißen, dass der Übergang zu einer aufgeklärten Säkularität der staatlichen Verfassungs- und Rechtsordnung einen Freiheitsgewinn verbürgt, der aus Gründen des Glaubens ebenso zu begrüßen ist wie aus Gründen der verfassungsstaatlichen Überzeugung. Aber aus dem Ja zum säkularen Staat folgt nicht automatisch die Vorstellung von einer säkularisierten Gesellschaft. Der Funktionswandel von Religion in der modernen Gesellschaft, Prozesse der Entkirchlichung eingeschlossen, ist bei sorgfältigerer Betrachtung gerade nicht als Säkularisierung (also als Unsichtbarwerden der Religion), sondern als Differenzierung (also als Auseinandertreten unterschiedlicher Umgangsweisen mit Religion) zu interpretieren. Ähnlich vorsichtig ist mit dem zweiten Ausgangspunkt umzugehen. Die These von der Wiederkehr der Religion wirkt, gerade wenn man sie auf die europäische Lage anwendet, reichlich pauschal. In globalem Maßstab haben wir eine verstärkte Zuwendung zur Religion zu beobachten, teilweise übrigens mit höchst beunruhigenden Folgen. Dabei sind es nicht allein Entwicklungen im Islam, die zur Beunruhigung Anlass geben. Auch innerhalb des Christentums gibt es Tendenzen zu fundamentalistischer Vereinfachung wie zu enthusiastischer Übertreibung, die keineswegs fröhlich stimmen. Der Einsicht, dass wir in einem Zeitalter ökumenischer Verbundenheit und Kooperation leben, treten Tendenzen zur Spaltung oder einer willkürlichen Neubildung von Kirchen gegenüber, die jeden ökumenisch gesonnenen und besonnenen Menschen hochgradig alarmieren müssen. Verglichen mit solchen Tendenzen haben wir es in Europa und insbesondere in Deutschland nicht nur im problematischen, sondern auch im positiven Sinn mit einer »religiös gemäßigten Zone« zu tun, in der uns manche Auswüchse, die andernorts zu beobachten sind, einstweilen jedenfalls noch erspart bleiben. Es ist übrigens ein gemeinsames Interesse von Staat und Kirche – und insofern auch eine gemeinsame Aufgabe –, die Ausbreitung willkürlicher Formen von Religion in Grenzen zu halten. Am wenigsten lässt sich gegen die These einwenden, dass wir unter Bedingungen verschärfter religiöser Pluralität leben. Doch welche Folgerungen ziehen wir daraus? Ist schon genug gesagt, wenn wir zu einer allgemeinen Toleranz aufrufen, von der wir dann vielleicht sogar meinen, sie lasse sich am leichtesten
114
Wolfgang Huber
unter der Voraussetzung praktizieren, dass man von der eigenen religiösen Haltung eine möglichst unpräzise Vorstellung hat? Bedeutet religiöse Pluralität, dass die Vorkehrungen der Verfassungsordnung sich an den Voraussetzungen derjenigen Religionen orientieren müssen, die im geringsten Maß eine eigene institutionelle Ausgestaltung aufweisen? Ist mit der Forderung nach einem Übergang vom Staatskirchenrecht zum Religionsverfassungsrecht gemeint, dass diejenigen Regelungen, die vom staatlichen Respekt für den Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen geprägt sind, deshalb zurücktreten müssen, weil andere Religionen eine vergleichbare institutionelle Vertretung ihres Öffentlichkeitsauftrags gar nicht kennen? Auch hinsichtlich dieses dritten Akzents – der religiösen Pluralität – ist also Differenzierung angezeigt und angebracht. In diesem Beitrag wird das Thema aus theologischer und kirchlicher Sicht, unter Einschluss der Erfahrungen in kirchenleitender Verantwortung behandelt. Da mag eine Aufforderung zur Differenzierung gleich zu Beginn eher überraschen. Denn praktische Leitungsverantwortung, so heißt das gängige Urteil, erfordert die Fähigkeit zur Vereinfachung oder verleitet doch zu ihr. Differenzierung dagegen gilt als unpraktisch. Ich kann dagegen nur geltend machen, dass ein Mangel an Differenzierung in praktischen Leitungsentscheidungen zu höchst problematischen Ergebnissen führen kann. Ich nenne als Beispiel nur die Eingriffe in die Stellung des Religionsunterrichts, die in Brandenburg7 und noch massiver in Berlin8 erfolgt sind. Sie waren im Grunde von einer Säkularisierungsvorstellung gesteuert, deren Unhaltbarkeit ich gerade angedeutet habe. Oder ich nenne als anderes Beispiel die Art und Weise, in welcher über Jahre hin ein undifferenzierter Begriff von multireligiöser Toleranz zur Leitvorstellung für die praktische Bewältigung religiöser Pluralität gemacht wurde. Heute ist offenkundig, dass eine solche Vorstellung nicht zureicht; doch die Anstrengungen dazu, sich eine angemessenere Zugangsweise zu erarbeiten, kommen spät und werden nur sehr zögernd rezipiert. In der evangelischen Kirche erleben wir das gegenwärtig in exemplarischer Form an den Reaktionen auf unsere Handreichung zum Verhältnis zwischen Christen und Muslimen, die wir im Jahr 2006 unter dem Titel »Klarheit und gute Nachbarschaft« veröffentlicht haben.9 Ich halte den darin vertretenen Ansatz einer differenzierten wechselseitigen Wahrnehmung, die schwierigen Themen nicht ausweicht, für notwendig. Deshalb plädiere ich auch in dieser
7 § 11 Brandenburgisches Schulgesetz i. d. F.v. 2. 8. 2002 (GVBl.I/02, [Nr. 08] , S.78), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. 1. 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 01] , S. 2). 8 § 12 Abs. 6 Berliner Schulgesetz i. d. F. vom 26. 1. 2004 (GVBl. S. 26), zul. geänd. durch Artikel V des Gesetzes vom 11. 7. 2006 (GVBl. S. 812). 9 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.), Klarheit und gute Nachbarschaft. Christen und Muslime in Deutschland, EKD-Texte 86, 2006.
Kirche und Verfassungsordnung
115
Hinsicht aus kirchenleitender Erfahrung heraus dafür, sich das notwendige Maß an Differenzierung zuzumuten. Zu dieser Differenzierung gehört selbstverständlich auch, dass ich mir meiner eigenen eingeschränkten Perspektive bewusst bin. Ich betrachte unser Thema in ökumenischer Weite; und ich bin mir bewusst, dass für unsere Verfassungsordnung die gleiche Religionsfreiheit aller und der paritätische Umgang mit den Kirchen von hoher Bedeutung sind. Aber es ist zugleich selbstverständlich, dass meine eigene Wahrnehmungs- und Gestaltungsperspektive durch meine eigene Verwurzelung und meine eigene Funktion in der evangelischen Kirche geprägt ist.
II.
Historische Einordnung
Auch wenn meine Überlegungen von aktuellen Fragestellungen bestimmt sind, so ist eine historische Einordnung doch unentbehrlich. Die Ordnung des Verhältnisses zwischen Staat und Religion, die die heutige Lage in Deutschland prägt, hat Wurzeln, die weit zurückreichen. Der Historiker Heinrich August Winkler hat diese Wurzeln unlängst in einer sehr elementaren Weise auf den Satz Jesu zurückgeführt: »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist« (Matthäus 22, 21).10 In diesem Satz ist eine Unterscheidung angelegt, die sich erst in einem langen historischen Prozess ausgeformt hat; doch in ihm kam – zum Teil gegen erhebliche kirchliche Widerstände – etwas zum Ausdruck, was in einer Grundorientierung des christlichen Glaubens selbst seine Wurzel hat: nämlich die Freiheit des christlichen Glaubens von der Bevormundung durch politische Macht, aber damit auch die Freiheit der politischen Verantwortung von religiöser Bevormundung. Die wechselseitige Unabhängigkeit und die auf ihrer Grundlage mögliche Kooperation prägen im Gang der europäischen Entwicklung in wachsender Deutlichkeit das Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Das heutige Staatskirchenrecht mit seinen Grundprinzipien der Religionsfreiheit, der Trennung von Staat und Kirche, des Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften, der Säkularität und Neutralität des Staates, der Gleichstellung aller Religionen im pluralistischen System bildet das Ergebnis eines langen Prozesses,11 für den das gleiche Recht unterschiedlicher religiöser 10 H. A. Winkler, Was heißt westliche Wertegemeinschaft? (Abschiedsvorlesung am 14. 2. 2007 an der Humboldt-Universität Berlin), in: Internationale Politik (IP), Nr. 4, April 2007, S. 66 ff. (68). 11 M. Heckel, Zur Ordnungsproblematik des Staatskirchenrechts im säkularen Kultur- und Sozialstaat, JZ 1994, 425 ff.; allgemein zu den Veränderungen des religiösen Lebens in
116
Wolfgang Huber
Überzeugungen von großer Bedeutung ist. Doch zugleich ist unverkennbar, dass das Verhältnis von Staat und Religionen im Sinne eines geordneten Gegenübers von weltlichem Gemeinwesen und rechtlich selbständigen Religionsverbänden tief in der christlichen Welt verwurzelt ist; denn das Christentum hat diese Unterscheidung hervorgebracht.12 Eine der großen Fragen, vor denen wir heute stehen, liegt darin, ob wir andere Religionen, aber auch diejenigen, die für sich selbst keine Religion gelten lassen, für diese Unterscheidung gewinnen können. Die heute geltenden staatskirchenrechtlichen Bestimmungen haben sich in Deutschland seit dem 16. Jahrhundert entwickelt. Die Reformation, die ihrer ursprünglichen Intention nach auf die Erneuerung der einen Kirche gerichtet war, ließ in ihrer geschichtlichen Wirkung unterschiedliche christliche Konfessionen nebeneinander treten; sie brachte damit die Notwendigkeit hervor, dass der Staat ein neues Verhältnis zu den Religionsgemeinschaften entwickeln musste. In diesem Zusammenhang finden sich erste Ansätze von individueller und kollektiver Religionsfreiheit in den Festlegungen des »Augsburger Religionsfriedens« von 1555.13 Im Rahmen der Reichsinstitutionen wurden das Corpus Catholicorum und das Corpus Evangelicorum nebeneinander anerkannt. Den Landesherren wuchs das Recht zu, in ihren Territorien die für alle Untertanen einheitlich geltende Konfession zu bestimmen und auch zu wechseln (ius reformandi – umschrieben durch das Schlagwort »cuius regio – eius religio«). Der persönlich abweichenden Entscheidung des einzelnen wurde dadurch Rechnung getragen, dass ein Recht auf Auswanderung aus dem Territorium unter Mitnahme des Eigentums etabliert wurde (ius emigrandi – eine Art staatlich gesicherter religiöser Freizügigkeit). Die Regelungen des Augsburger Religionsfriedens konnten allerdings den Frieden im Reich nicht endgültig sichern.14 Erst nach dem dreißigjährigen Krieg kam es mit dem Westfälischen Frieden von 1648 zu Regelungen, infolge derer bis heute kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Konfessionen in Deutschland nicht wieder auftraten. Der Augsburger Religionsfrieden wurde im Westfälischen Frieden fortentwickelt. Neben Katholiken und Lutheranern wurDeutschland in den letzten Jahrzehnten S. Muckel, Religiöse Freiheit und staatliche Letztentscheidung, 1997, S. 1 ff. 12 A. Frhr. v. Campenhausen/H. de Wall, Staatskirchenrecht. Eine systematische Darstellung des Religionsverfassungsrechts in Deutschland und Europa, 42006, S. 1. 13 Dazu M. Heckel, Zur Entwicklung des deutschen Staatskirchenrechts von der Reformation bis zur Schwelle der Weimarer Verfassung, Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht (ZevKR) 12 (1966/67) S. 10 ff.; A. v. Campenhausen, Religionsfreiheit, in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland (HStR), Band VI, Freiheitsrechte, 11989, S. 375, Rn. 12 f.; ders./H. de Wall, Staatskirchenrecht (Fn. 11), S. 11 ff. 14 Hierzu und zu den weiteren historischen Entwicklungssträngen s. nur A. v. Campenhausen/ H. de Wall Staatskirchenrecht (Fn. 12), S. 13 ff., m. w. N.
Kirche und Verfassungsordnung
117
den die Reformierten als dritte Religionspartei anerkannt. Die räumliche Verbreitung der Konfessionen im Reich wurde auf den Status quo des sogenannten »Normaljahres« 1624 festgeschrieben. Allen drei Bekenntnissen wurde das Recht der öffentlichen Religionsausübung zuerkannt. Die Bedeutung des Westfälischen Friedens liegt nicht zuletzt darin, dass er zwischen den Religionsgemeinschaften auf nachhaltige Weise Frieden stiftete. Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des heutigen Staatskirchenrechts in Deutschland wurde mit den in Preußen ab der Mitte des 18. Jahrhunderts vorgenommenen Regelungen zur Religionsfreiheit gesetzt. Das landesherrliche Kirchenregiment über die evangelische Kirche wurde freilich zugleich fortgesetzt – ein verfassungsrechtlicher Drahtseilakt, der noch bis zum Ende des Ersten Weltkriegs Bestand hatte. Doch die Vorstellung von der Religionsfreiheit als bestimmendem Maßstab für die rechtliche Stellung auch der religiösen Institutionen breitete sich auch in Deutschland während des 19. Jahrhunderts weiter aus. Eine dieser Vorstellung entsprechende institutionelle Regelung des Staatskirchenrechts trat in Deutschland aber erst mit der Weimarer Reichsverfassung in Kraft, deren entsprechende Bestimmungen durch die Übernahme in das Grundgesetz bis heute gelten. Diese staatskirchenrechtliche Grundordnung hat sich sowohl beim Neuaufbau eines demokratischen Gemeinwesens nach dem Zweiten Weltkrieg als auch im Prozess der Vereinigung Deutschlands bewährt. Es ist heute unter anderem auch daraus neu herausgefordert, weil auch die Frage nach der öffentlichen Stellung der Religionsgemeinschaften in einen europäischen Kontext gerückt ist. Die Europäisierung macht auch vor unserer Fragestellung nicht Halt. Das deutsche Modell muss sich in diesem Prozess erneut bewähren. Dieses Modell ist durch die Verbindung zwischen individueller Religionsfreiheit, korporativer Religionsfreiheit und institutionellen Gewährleistungen für die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften geprägt. Fragt man nun nach dem Schlüsselbegriff, der den inneren Zusammenhang dieses Systems verbürgt, so ist es ohne Zweifel der Begriff der Freiheit. Aus einer evangelischen Perspektive liegt es besonders nahe, diesem Schlüsselbegriff genauer nachzugehen.
III.
Freiheit als Schlüsselbegriff für das Verhältnis von Kirche und Verfassungsordnung
Freiheit ist ein Begriff sowohl der christlichen Heilsgewissheit als auch der staatlichen Rechtsordnung. Diese beiden Freiheitsbegriffe sind voneinander zu
118
Wolfgang Huber
unterscheiden. Im Verhältnis von Kirche und Verfassungsordnung des Grundgesetzes treten sie aber zueinander in ein Verhältnis und korrespondieren miteinander.
1.
Freiheit im Glauben
Freiheit ist ein Schlüsselbegriff des biblischen Zeugnisses.15 Diesem Zeugnis gemäß ist Freiheit die große Gabe Gottes an die Menschen. Ihr wohnt die Verheißung des Gelingens ebenso inne wie die Verführung zum Misslingen. Die ihm als Geschenk anvertraute Freiheit zu bewahren und die in der Befreiung aus der Sünde erneuerte Freiheit verantwortlich zu gebrauchen, ist Gottes Auftrag an den Menschen. In allen großen Traditionsströmen des christlichen Glaubens hat diese Freiheitszusage ihren Ort, weitergegeben von Generation zu Generation. Die christliche Theologie hat um das rechte Verständnis der Freiheit gerungen. Sie hat in allen ihren Phasen, Ausgestaltungen, Richtungen und Verästelungen festgehalten, daß das christliche Freiheitsverständnis einen unaufgebbaren Beitrag zum Verständnis und zur Gestaltung der Freiheit leistet. Diese Freiheit erhält ihre Bestimmtheit durch den Namen Jesu Christi. Und sie kommt zu ihrer höchsten Erfüllung, wenn sie sich aufschwingt zum Lob Gottes, der in Jesus Christus uns zu Gute menschliche Gestalt annimmt. Eine in Gottes Menschwerdung begründete Freiheit, die im Lob Gottes ihre Erfüllung findet – das ist eine Freiheit, die der Mensch sich nicht dadurch plausibel machen muss, dass er sie an sich selbst und seinen Taten aufweist. Dies ist keine Freiheit, die dadurch geprägt ist, dass sie alles Mögliche für gleich gültig erklärt. Sondern es ist eine Freiheit, die sich ein Mensch von Gott schenken läßt, um sie im Verhältnis zu sich selbst wie im Eintreten für seinen Nächsten zu bewähren. Sie erhebt sich aus der Gefangenschaft allen Machens und Schaffens. Sie lässt sich nicht durch uns selbst verbürgen, durch unsere Fähigkeiten, Finanzen oder Freunde; sondern sie verdankt sich der Güte Gottes. Welche Auswirkungen hat dieses Verständnis der christlichen Freiheit? Wer sich einer Freiheit verdankt, die unverfügbar ist, weiß sich für die Gestaltung von Räumen verantwortlich, in denen diese Freiheit zur Erfahrung kommt. Deshalb interessiert sich der christliche Glaube für die Bedingungen, Voraussetzungen und Folgen im eigenen Handeln ebenso wie für die Bedingtheiten und Bestimmtheiten des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Er setzt sich leidenschaftlich für Lebensverhältnisse ein, in denen Freiheit erfahrbar wird. Deshalb 15 Zur Entfaltung des Begriffs W. Huber, Evangelisch im 21. Jahrhundert, in: Kirchenamt der Evangelischen Kirche Deutschland (Hrsg.), Kirche der Freiheit im 21. Jahrhundert. Dokumentation des Zukunftskongresses der EKD, 2007, S. 18 ff.
Kirche und Verfassungsordnung
119
ist er als Religion der Freiheit eine Religion der Aufklärung und der Vernunft, des freien Dienstes am Nächsten und der politischen Mitverantwortung. Aus christlichem Verständnis heraus vollzieht sich die Wahrnehmung dieser Verantwortung sowohl im Handeln des Einzelnen wie in dem der christlichen Kirche. Die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden gründet im übereinstimmenden Verständnis des Evangeliums. Sie wird im evangelischen Verständnis konsequent vom Gottesdienst her bestimmt. Denn im gefeierten Gottesdienst vergewissert sich die christliche Gemeinde ihres Grundes: der Erlösung in Jesus Christus. Und im gefeierten Gottesdienst kommt sie ihrer allerersten Pflicht nach: dem Lob Gottes. Eine Kirche, die im Gottesdienst ihres Grundes gewiss wird, ist zugleich in einem präzisen Sinn eine Kirche für andere. Das Geschenk des Glaubens befreit uns von Gott her zu uns selbst; und es richtet unseren Blick von uns weg auf den Nächsten; denn ihm wendet sich der Glaube zu, der durch die Liebe tätig ist. Die Freiheit eines Christenmenschen kommt erst dann zu sich selbst, wenn sie in der Verantwortung für andere konkret wird. Dass der Christenmensch ein freier Herr aller Dinge ist, bewährt sich gerade darin, dass er aus freien Stücken allen ein Diener sein kann. Wenn der christliche Glaube auch darin der Freiheit die Treue hält, dass er aufmerksam ist für die Bedingungen, unter denen diese Freiheit erfahren werden kann, und wachsam ist gegenüber Umständen, die dieser Freiheit den Entfaltungsraum verweigern, dann gilt dies keineswegs nur für die jeweils eigene Freiheit, sondern gerade auch für die Freiheit des andern. Dass die Freiheit eines Christenmenschen den vor Gott stehenden und durch ihn aufgerichteten Menschen meint, relativiert die gesellschaftliche, politische und kirchliche Verantwortung der Christen nicht, sondern präzisiert sie. Bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung, also bei der Religionsausübung im umfassenden Sinne des Wortes sind alle Christen angewiesen auf die Gemeinschaft mit anderen in ihrer Kirche. Das christliche Freiheitsverständnis ist somit zugleich individuell und korporativ.
2.
Glaubensfreiheit
Die so verstandene christliche Freiheit drängt nach gesellschaftlichen Umständen und nach einer Verfassungsordnung, in welchen die Entfaltung dieser Freiheit möglich ist. Die Freiheit der Verfassungsordnung ist eine Freiheit für alle. Sie kennt keinen Vorrang für die Freiheit von Christen. Aber das Verständnis dieser Freiheit ist – neben anderen wichtigen Einflüssen – in erheblichem Maß durch das christliche Freiheitsverständnis geprägt.
120
Wolfgang Huber
In dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Mai 1995 zum Kruzifix in öffentlichen Schulen16 wird dieser Zusammenhang folgendermaßen beschrieben: »Auch ein Staat, der die Glaubensfreiheit umfassend gewährleistet und sich damit zu religiös-weltanschaulicher Neutralität verpflichtet, kann die kulturell vermittelten und historisch verwurzelten Wertüberzeugungen und Einstellungen nicht abstreifen, auf denen der gesellschaftliche Zusammenhalt beruht und von denen die Erfüllung seiner eigenen Aufgaben abhängt. Der christliche Glaube und die christlichen Kirchen sind dabei, wie immer man ihr Erbe heute beurteilen mag, von überragender Prägekraft gewesen. Die darauf zurückgehenden Denktraditionen, Sinnerfahrungen und Verhaltensmuster können dem Staat nicht gleichgültig sein«.17 Diesen vom Bundesverfassungsgericht eingeführten Begriff der Prägekraft des Christentums haben Trutz Rendtorff und Jürgen Schmude in ihrer erhellenden Schrift »Wie versteht die evangelische Kirche die Rede von der ›Prägekraft des Christentums‹« näher beschrieben. Dabei haben sie zurückgegriffen auf die Denkschrift der EKD »Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie. Der Staat des Grundgesetzes als Angebot und Aufgabe« von 198518 sowie auf die Erklärung des Rates der EKD »Christentum und politische Kultur. Über das Verhältnis des demokratischen Rechtsstaates zum Christentum« von 1997.19 Rendtorff und Schmude heben für das Verständnis der Prägekraft des Christentums diejenigen Werte und Normen hervor, die, von Christen und aus christlichen Glaubensgrundsätzen entwickelt, weiterhin wirkungskräftiges Gemeingut im demokratischen Staat und seiner Gesellschaft sind. Im einzelnen nennen sie Menschenwürde und Menschenrechte, die Grundsätze der Gewissensfreiheit und der Toleranz, die Betonung der Eigenverantwortung wie die Verpflichtung zu Solidarität und Gerechtigkeit mitsamt ihren Auswirkungen auf das Konzept der sozialen Marktwirtschaft sowie die Verantwortung der Christen für den Aufbau und die Gestaltung der Demokratie. Daran knüpfen sie die Feststellung an: »Der demokratisch-rechtsstaatlich verfasste Staat muss als Gesetzgeber in seinem Handeln Rücksicht nehmen auf die geschichtlich vermittelten und in der Gesellschaft präsenten Überzeugungen, aus denen er selbst die Überzeugungskraft seiner Gesetz-
16 BVerfGE 93, 1 = KirchE 33, 191 = ZevKR 40 (1995) S. 477. 17 BVerfGE 93, 1 (22). 18 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.), Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie. Der Staat des Grundgesetzes als Angebot und Aufgabe. Eine Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland, 41990. 19 Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.), Christentum und politische Kultur. Über das Verhältnis des demokratischen Rechtsstaates zum Christentum, EKD-Texte 63, 1997.
Kirche und Verfassungsordnung
121
gebung bezieht. Darin unterscheidet sich der demokratische Rechtsstaat von absoluter oder totalitärer Herrschaft.«
Welche Konsequenzen ergeben sich hieraus für das Verständnis der individuellen, korporativen und institutionellen Religionsfreiheit in der freiheitlichdemokratischen Grundordnung des Grundgesetzes? Die Verfassung privilegiert nicht in einer ausschließenden Weise die christlichen Kirchen, sondern behandelt ihrer grundsätzlichen Absicht nach alle religiösen Überzeugungen und alle Religionsgemeinschaften gleich. Artikel 4 des Grundgesetzes garantiert die Glaubens-, Gewissens- und Religionsfreiheit, ein Grundrecht, das nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern auch für die Religionsgemeinschaften gilt; denn Religionsausübung ist auf die Gemeinschaft mit anderen angewiesen, hat also eine individuelle wie eine korporative Seite. Der Artikel 140 des Grundgesetzes konkretisiert die korporative Religionsfreiheit durch institutionelle Festlegungen, indem er die staatskirchenrechtlichen Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung in das Grundgesetz übernimmt. Diese Bestimmungen beginnen mit der klaren Feststellung, dass keine Staatskirche besteht; daraus folgt, dass Staat und Kirche voneinander unabhängig sind. Das Staatskirchentum, in dem insbesondere die evangelischen Kirchen verhaftet waren, ist beendet. Doch die Kirchen sind nach wie vor Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie sind jedoch weder in den Staatsorganismus integriert noch unterliegen sie – wie die anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts – einer Staatsaufsicht. Diese Regelung verbindet die wechselseitige Unabhängigkeit von Staat und Kirche mit der Anerkennung des Öffentlichkeitsauftrags der Kirchen. Religionsfreiheit kann demnach keineswegs nur – wie das französische Modell des Laizismus annimmt – dadurch verwirklicht werden, dass die Religion auf den Bereich des Privaten beschränkt wird. Man kann vielmehr die religiöse Neutralität des Staates akzeptieren und zugleich die öffentliche Dimension von Religion respektieren. Die besondere Bedeutung des deutschen Modells liegt gerade darin, dies beides miteinander zu verbinden. Nur der religiös neutrale Staat20 kann die volle Religionsfreiheit verfassungsrechtlich sichern. Ein religiös gebundener Staat, der sich einer Religion gegenüber in besonderer Weise verpflichtet weiß, läuft dagegen Gefahr, diese 20 Zum Grundsatz der Neutralität A. v. Campenhausen/H. de Wall, Staatskirchenrecht (Fn. 12), S. 371 f.; K. Schlaich, Zur weltanschaulichen und konfessionellen Neutralität des Staates, in: EssGspr. 4 (1970), S. 9 ff.; ders., Neutralität als verfassungsrechtliches Prinzip, vornehmlich im Kulturverfassungsrecht und Staatskirchenrecht, 1972; K. G. Meyer-Teschendorf, Staat und Kirche im pluralistischen Gemeinwesen, 1979, S. 145 ff.; M. Heckel, Religionsfreiheit. Eine säkulare Verfassungsgarantie, in: K. Schlaich (Hrsg.), Martin Heckel. Gesammelte Schriften. Staat – Kirche – Recht – Geschichte, Band IV, 1997, S. 647 (773 ff.); S. Huster, Die ethische Neutralität des Staates, 2002.
122
Wolfgang Huber
gegenüber anderen Religionen in seinem Staatsgebiet zu privilegieren. Die Unterdrückung von Menschen wegen ihrer religiösen Überzeugung gehört auch heute in vielen Ländern zur politischen Realität. Der Staat, der anerkennt, dass der Mensch frei und mit unantastbaren Rechten ausgestattet ist, kann ihn nicht einer vorgegebenen Religion zuweisen oder ihn direkt oder indirekt zwingen, sich für eine Religion zu entscheiden, oder aber seine religiöse Überzeugung ins Private abdrängen. Der moderne, freiheitliche und demokratische Staat legitimiert sich nicht von Gott her, sondern allein von den Menschen, die in diesem Gemeinwesen miteinander verbunden sind, auch wenn diese in Verantwortung vor Gott stehen, wie die Präambel des Grundgesetzes formuliert. Daher fehlt es an einer Rechtfertigung dafür, dass der Staat eine Religion von sich aus zur verbindlichen Grundlage des Zusammenlebens erklärt. Die religiöse Neutralität des Staates liegt im Interesse des Glaubens; und sie setzt eine klare institutionelle Scheidung von Staat und Religionsgemeinschaften voraus. Aber es wäre ein Missverständnis von staatlicher Religionsneutralität, daraus eine Gleichgültigkeit des Staates gegenüber dem Wirken der Religionsgemeinschaften abzuleiten. Vielmehr gibt es eine Pflicht des Staates, die Religion als Bestimmungskraft für das Leben vieler Bürgerinnen und Bürger wahrzunehmen und sie ohne falsche Parteinahme zu fördern. Mit dem Begriff der »fördernden Neutralität« hat das Bundesverfassungsgericht21 dies – wie ich meine – zutreffend charakterisiert. Die wechselseitige Unabhängigkeit von Staat und Kirche bedeutet nach deutschem Verfassungsrecht nicht, dass das Religiöse aus dem öffentlichen Bereich verbannt wird. Vielmehr erkennt der freiheitliche demokratische Staat die große Bedeutung der Religion im Prozess der Werte- und Überzeugungsbildung an. Er braucht bei aller Säkularität und religiösen Neutralität ein sozialethisches Fundament. Er lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann.22 Jede Gesellschaft verfügt nur dann über eine innere Stabilität, wenn sie eine Wertordnung hat, der gegenüber sich die einzelnen Bürgerinnen und Bürger verpflichtet wissen. Es ist nötig, vor diesem Hintergrund ausdrücklich den Überlegungen zu widersprechen, die Bundesjustizministerin Zypries in der 5. Berliner Rede zur Religionspolitik am 12. Dezember 2006 zum Thema »Religion und Recht«23 angestellt hat. Zunächst ist ihrer Behauptung zu widersprechen, dass im säku21 »Kopftuch-Urteil« des BVerfG: BVerfGE 108, 282 ff. 22 Siehe das berühmte Diktum von E.-W. Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in: ders., Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, 1992, S. 112. 23 Die Rede ist im Internet auf der Homepage des Bundesjustizministeriums im Wortlaut veröffentlicht: http://www.bmj.bund.de/enid/0,0/Ministerin/Reden_129.html?druck=1& p mc_id=3758.
Kirche und Verfassungsordnung
123
laren Verfassungsstaat Religion weitgehend zur Privatsache der einzelnen Staatsbürger geworden sei. Zu kritisieren ist auch die Konsequenz, die Brigitte Zypries aus dieser Behauptung zieht: »Der Rückgriff auf die Religion ist eine Modeerscheinung von Autoren, denen alles zu unordentlich geworden ist in Deutschland. Er sagt viel über ihre Sehnsucht nach der Ordnung von gestern, aber er bietet keine Antworten auf die Fragen von heute. Was unsere Gesellschaft in ihrem Innersten zusammenhält – diese Frage stellt sich doch auch deshalb so eindringlich, weil heute eben kaum mehr als 60 Prozent der Bevölkerung den beiden großen christlichen Kirchen angehören – und sich noch weniger dort wirklich zu Hause fühlen.«
Dem ist zunächst die Prägekraft des Christentums für die freiheitlich-demokratische Grundordnung entgegenzuhalten, die unabhängig von der aktuellen Größe von Kirchen zu würdigen und zu achten ist. Davon abgesehen sind »kaum mehr als 60 Prozent« immer noch fast zwei Drittel der Bevölkerung; einen Grund, den christlichen Bevölkerungsanteil zu bagatellisieren, gibt es also nicht. Unter Bezug auf die oft zitierte Aussage von Ernst-Wolfgang Böckenförde, dass der freiheitliche säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann, fragt Brigitte Zypries, »ob wir uns diese Passivität des Staates an diesem Punkte weiterhin leisten können«. »Staatliche Passivität« ist indessen wohl die falsche Kategorie dafür, dass der demokratische Verfassungsstaat eingedenk seiner Wurzeln seiner Pflicht zur Gewährleistung von Religionsfreiheit gerecht zu werden sucht. Gewiss kann es heute angezeigt sein, diese Gewährleistung an bestimmten Stellen zu präzisieren und über die Grenzen der Religionsfreiheit Klarheit zu gewinnen. Doch der Grundsatz der Religionsfreiheit darf nicht angetastet werden. Die Tatsache, dass die umfassende Anerkennung der Religionsfreiheit christliche Wurzeln hat, darf ihr ganz gewiss nicht zum Nachteil ausgelegt werden. Die verschärfte Form religiöser Pluralität kann an bestimmten Stellen eine deutlichere Klarheit im Blick auf die Grenzen der Religionsfreiheit nötig machen. Auch kann der Staat sich der Aufgabe nicht entziehen, klar zu sagen, wo er den Namen der Religion oder auch den Begriff »Kirche« für nicht religiöse Zwecke missbraucht sieht. Insofern sehe ich in dem Votum der Stadt Hannover, dass sie an einer Zentrale der »Scientology Church« kein Interesse hat und sich dafür einsetzt, dass für dieses Vorhaben keine zentrale innerstädtische Immobilie zur Verfügung gestellt wird, ein wichtiges Signal, das ich mir auch in Hamburg oder Berlin hätte vorstellen können. Der Ausgangspunkt für solche Überlegungen ist auch heute das Wort Jesu: »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.« Die klare Unterscheidung zwischen dem geistlichen Auftrag der Kirche und dem weltlichen Auftrag des Staates entspricht dem Selbstverständnis der Kirche ebenso
124
Wolfgang Huber
wie dem Verständnis des demokratischen Rechtsstaats. Diese Unterscheidung ist eine wichtige Voraussetzung für die Achtung der Freiheit der Person, wie sie in der Achtung der Religionsfreiheit und der ihr folgenden Freiheitsrechte zum Ausdruck kommt. Sie ist zugleich die Begründung für die selbständige Verantwortung eines jeden Bürgers in der demokratischen Gesellschaft. So ermöglicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung es den christlichen Kirchen in hohem Maße, mit Wirkung für die Gesellschaft gemäß ihrem christlichen Freiheitsverständnis zu handeln. Der mit der christlichen Freiheit verbundene Auftrag korrespondiert mit den Möglichkeiten, die unsere Verfassungsordnung für die Wahrnehmung der Religionsfreiheit bietet. Die Freiheit im Glauben und die Glaubensfreiheit stehen in einer guten Entsprechung zueinander.
IV.
Das Handeln der christlichen Kirchen in Gesellschaft und Verfassungsordnung
Von hier aus sind die Stellung und das Handeln der Kirchen innerhalb unserer Verfassungsordnung zu beschreiben. Ich hebe drei Gesichtspunkte hervor.
1.
Die öffentliche Stellung der Kirchen
Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist auf den offenen Meinungsaustausch angewiesen. Dazu gehören auch die Stimmen der Kirchen. Die Kirchen sind – und darin unterscheiden sie sich grundlegend von Parteien und anderen gesellschaftlichen Großorganisationen – nicht in den Prozess gesellschaftlicher Produktion, Reproduktion und Erhaltung eingebunden. Die von Sachzwängen geprägte Lebenswirklichkeit braucht Kräfte, die in Freiheit und Unabhängigkeit am gesellschaftlichen Willensbildungsprozess mitwirken und dabei den Sprachlosen eine Stimme verleihen. Wie Richard von Weizsäcker einmal formuliert hat, ist es nicht die Aufgabe der Kirchen, Politik zu machen, wohl aber Politik möglich zu machen.24 Gesellschaft und Staat sind darauf angewiesen, dass an dem Dialog zwischen den gesellschaftlichen Gruppen auch solche beteiligt sind, die nicht nur ihr Eigeninteresse vertreten. Daher ist das Verhältnis des Staates zu den Kirchen nicht durch den Übergang 24 Aus einem Grußwort von Bundespräsident a.D. R. v. Weizsäcker bei der 7. Tagung der 8. Synode der EKD (3.–7.11.1996, Borkum), in: Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.), Borkum 1996, Bericht über die siebte Tagung der achten Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 3. bis 7. November 1996, 1997, S. 152. Ebenso einsehbar unter http://www.ekd.de/synode96/grussworte_weizs.html.
Kirche und Verfassungsordnung
125
zu einem laizistischen System oder durch die Verbannung der Religion aus dem öffentlichen Leben angemessen zu gestalten. Vielmehr gibt die Verfassung den Kirchen und Religionsgemeinschaften den notwendigen Raum, in der Öffentlichkeit zu wirken. Die Grundmarkierungen der deutschen Verhältnisbestimmung zwischen Staat und Religionsgemeinschaften enthalten die Erwartung in sich, dass die Kirchen sich aktiv in die Willensbildung der Gesellschaft einbringen, dass sie ihren Beitrag in Gesellschaft, Bildung, Medien, Wissenschaft, Kultur und Diakonie leisten. Um dem Anspruch seiner Bürger und Bürgerinnen auf positive Religionsfreiheit und aktive Religionsausübung gerecht zu werden, ist der Staat auf ein Zusammenwirken mit den Religionsgemeinschaften angewiesen, so beim Religionsunterricht in der staatlichen Schule, in der Seelsorge in Krankenanstalten, in Haftanstalten oder in der Bundeswehr, in den Landespolizeien und der Bundespolizei, bei theologischen Fakultäten und kommunalen Friedhöfen. Religiöse Neutralität bedeutet nicht, dass der Staat sich von jeder Förderung von Religion oder jedem Zusammenwirken mit ihr fern zu halten hat. Denn er erkennt ihre öffentliche Bedeutung an und drängt sie deshalb gerade nicht ins Private ab. Die These von der Religion als Privatsache gehört in die Gedankenwelt des 19. Jahrhunderts; das sollte man nie vergessen, wenn sie zu Beginn des 21. Jahrhunderts – etwa in der schon erwähnten Rede der Bundesjustizministerin – unversehens wieder auftaucht. Die positive Förderung der Religionsausübung durch den Staat verstößt nicht gegen das Prinzip der religiösen Neutralität des Staates, solange der Grundsatz der Gleichheit gewahrt bleibt.25 Gleichheit bedeutet allerdings bekanntlich, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Religiöse Symbole, religionsbestimmte Handlungen und religiöse Überzeugungen werden deshalb vom Staat legitimerweise unter dem Gesichtspunkt ihrer Nähe zu den Grundüberzeugungen des freiheitlichen demokratischen Staats betrachtet. Zu Recht wird in den Blick genommen, mit welchen politischen oder gesellschaftlichen Haltungen sie sich verbinden. Klare Hinweise hierzu gibt das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum Körperschaftsstatus der Zeugen Jehovas vom 19. Dezember 2000. Darin wird jeder Form eines aggressiven Fundamentalismus eine Absage erteilt. Das Gericht stellt sich ausdrücklich gegen jeden Versuch, der darauf zielt, auf eine theokratische Herrschaftsordnung hinzuwirken.
25 Zu den einzelnen Aspekten der Parität s. insbesondere M. Heckel, Gleichheit oder Privilegien? (=Jus Ecclesiasticum, Bd. 47), 1993.
126 2.
Wolfgang Huber
Kirchlicher Öffentlichkeitsanspruch in christlicher Verantwortung
Der kirchliche Öffentlichkeitsauftrag26 ist allerdings nicht durch die staatliche Ordnung vorgegeben; er folgt vielmehr aus dem Evangelium. Der entscheidende Ansatzpunkt dafür ist der Verkündigungsauftrag der Kirchen, der sich aus dem Missionsauftrag Christi in Matthäus 28, 18 ff. ergibt; er schließt die Aufgabe ein, alle Völker zu lehren. Die Barmer Theologische Erklärung vom 31. Mai 1934 verdeutlicht dies in ihrer 6. These so: »Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, besteht darin, an Christi Statt und also im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes durch Predigt und Sakrament die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk.« Die für die diese Zusammenhänge noch immer maßgebliche Denkschrift der EKD »Aufgaben und Grenzen kirchlicher Äußerungen zu gesellschaftlichen Fragen« aus dem Jahr 197027 formuliert dazu: »Die Legitimation der Kirche, sich zu politischen und gesellschaftlichen Fragen zu äußern, beruht nach ihrem Selbstverständnis auf dem umfassenden Verkündigungs- und Sendungsauftrag ihres Herrn. Recht verstanden, geht es nicht um einen kirchlichen ›Anspruch‹, sondern um ein ›Ansprechen‹ der Welt unter dem Anspruch Gottes und in Solidarität mit den Aufgaben und Nöten der Gesellschaft. Diese Solidarität folgt aus dem Gebot der Christusnachfolge, dem durch persönliche Liebestätigkeit allein nicht Genüge getan wird.«28 Die öffentliche Vertretung des Evangeliums vollzieht sich allerdings nicht nur durch Worte, sondern auch durch Werke, beispielsweise durch diakonische Tätigkeit. Die Verkündigung des Evangeliums findet innerhalb der weltlichen Ordnung und zu ihrem Besten statt. Um ihrer Klarheit willen erfordert sie auch Abgrenzungen gegenüber bestimmten politischen Vorstellungen, Zielen oder Zuständen. Zugleich bleiben die Andersartigkeit der Kirche und das Besondere ihres Auftrags gewahrt. Die Wahrnehmung des Öffentlichkeitsauftrags wird durch den Verkündigungsauftrag der Kirche nicht nur begründet, sondern auch
26 Siehe dazu W. Huber, Kirche und Öffentlichkeit, München 1973; G. Klostermann, Der Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen – Rechtsgrundlagen im kirchlichen und staatlichen Recht (Jus Ecclesiasticum, Bd. 64), 2000; K. Schlaich, Der Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen, in: J. Listl/D. Pirson (Hrsg.), Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band II (HdbStKirchR II2), 21995, S. 131 ff.; C. Thiele, Der Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen – aus evangelischer Sicht –, ZevKR 46 (2001), S. 179 – 190. 27 Die sogenannte »Denkschriften-Denkschrift«: Rat der Evangelischen Kirche (Hrsg.), Aufgaben und Grenzen kirchlicher Äußerungen zu gesellschaftlichen Fragen. Eine Denkschrift der Kammer für soziale Ordnung der EKD, 1970. Ebenfalls abgedruckt in: Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.), Die Denkschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland. Frieden, Versöhnung und Menschenrechte, Bd. 1/1, 1978, S.43 ff. 28 Ebenda, S. 49.
Kirche und Verfassungsordnung
127
beschränkt. Das gesellschaftliche Engagement der Kirche muss stets als kirchliche Lebensäußerung erkennbar bleiben.29
3.
Kooperation von Kirche und Staat
Es ist gerade das Proprium der deutschen Verhältnisbestimmung von Kirche und Verfassungsordnung, dass der Staat in Gewährleistung der Religionsfreiheit und unter Wahrung seiner Säkularität und Neutralität mit den Kirchen und darüber hinaus mit anderen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften kooperiert. Wechselseitige Unabhängigkeit und Kooperation schließen einander nicht aus, sondern gehören zusammen. Die Kooperation ist nicht etwa eine inkonsequente Einschränkung eines ansonsten geltenden Trennungsprinzips, sondern ist Ausdruck der staatlichen Anerkennung der Religion als einer wichtigen, gesellschaftsgestaltenden, die Grundlagen des Staates selbst mitprägenden Kraft.30 Soweit das Grundgesetz selbst Vorgaben für diese Kooperation macht, etwa hinsichtlich des Religionsunterrichts oder der Anstaltsseelsorge, so geschieht dies in voller Übereinstimmung mit der Verfassungsordnung. Nicht nachvollziehbar ist deshalb eine Kritik, die hier von verfassungswidrigem Verfassungsrecht spricht. Eine besonders interessante und wichtige Rechtsquelle sind in diesem Zusammenhang die Staat-Kirche-Verträge.31 Solche Verträge sind zu allen Zeiten unter dem Grundgesetz aktuell gewesen: nach dem Krieg in der alten Bundesrepublik, nach der Wiedervereinigung in den neuen Bundesländern, erst kürzlich in einigen Stadtstaaten.32 Im Zuge der Föderalismusreform könnte es durchaus zu neuen Vereinbarungen für Sachgebiete kommen, in denen sich neue Kompetenzen auf Seiten des Bundes oder der Länder ergeben. Längst werden solche Verträge mit dem Staat nicht mehr nur mit den großen Kirchen abgeschlossen. Der einzige Vertrag auf der evangelischen Seite, der mit der Bundesrepublik abgeschlossen wurde, betrifft die Seelsorge in der Bundeswehr.33 Im Jahr 2007 29 Vgl. C. Thiele, Öffentlichkeitsauftrag (Fn. 26), S. 182. 30 Hierzu mit einer Fülle weiterer Nachweise zuletzt A. v. Campenhausen/H. de Wall, Staatskirchenrecht (Fn. 12), S. 93 ff. 31 Ein ausdrücklicher Hinweis darauf, »dass die Trennung von Staat und Kirche gleichermaßen Distanz und Kooperation gebietet«, findet sich in der Präambel des Vertrages zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und der Pommerschen Evangelischen Kirche vom 20. 1. 1994 (GVOBl. M – V S. 559), sog. »Güstrower Vertrag«. 32 Zuletzt in Hamburg und Berlin. 33 Vertrag der Bundesrepublik Deutschland mit der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge vom 22. 2. 1957 (BGBl. II S. 702). Text bei J. Listl,
128
Wolfgang Huber
war dessen fünfzigjähriges Jubiläum zu feiern; ich habe bei dieser Gelegenheit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses Modell auch auf Bundesebene gegebenenfalls auf andere Regelungsmaterien angewandt werden kann. Der Geist, der solchen Staat-Kirche-Verträgen zugrunde liegt, ist, wie gerade die Präambeln der neueren Verträge exemplarisch deutlich machen, von der gemeinsamen Verpflichtung auf die verfassungsrechtliche Bestimmung der Stellung der Kirchen im freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaat ebenso geprägt wie vom Respekt vor der Religions- und Glaubensfreiheit der einzelnen und der Anerkennung des Selbstbestimmungsrecht der Kirchen. Diese Verträge respektieren den Unterschied zwischen dem geistlichen Auftrag der Kirchen und den weltlichen Aufgaben des Staates; sie würdigen aber auch die Bedeutung, die christlicher Glaube, kirchliches Leben und diakonischer Dienst für das Gemeinwohl und den Gemeinsinn der Bürger haben.
V.
Folgerungen
Abschließend gilt es, aus dem Vorgetragenen drei exemplarische Folgerungen zu ziehen.
1.
Kirchen und religiöse Pluralität
Mit jeder Religion verbindet sich ein umfassender Anspruch. Es gibt keine Religion, die ohne Konsequenzen für die Lebensführung bleibt. Insofern hat jede Religion auch eine politische Dimension. Sie betrifft nicht nur das private, sondern auch das öffentliche Leben.34 Der moderne Staat erwartet, dass dies in einer Form geschieht, die mit der Pluralität in der Gesellschaft vereinbar ist. Die offene Gesellschaft westlicher Prägung birgt eine Vielfalt von Lebensvorstellungen, Weltanschauungen und Religionen in sich, deren Beziehungen zueinander in einem zivilgesellschaftlichen Prozess öffentlicher Verständigung auf der Grundlage gegenseitiger Toleranz gestaltet werden müssen. In einem langen und durchaus schmerzhaften geschichtlichen Lernprozess, zu dem die Konfessionskriege der frühen Neuzeit genauso gehören wie der Übergang zu innerstaatlicher religiöser Pluralität im 18. Jahrhundert, haben die europäischen Gesellschaften gelernt, Toleranz als das Die Konkordate und Kirchenverträge in der Bundesrepublik Deutschland, Band I, 1987, S. 96 ff. 34 Vgl. hierzu insgesamt A. Hollerbach, Religion und Kirche im freiheitlichen Verfassungsstaat, 1998.
Kirche und Verfassungsordnung
129
Komplementärprinzip zur Religionsfreiheit zu begreifen. Auch die Kirchen haben erkannt, daß es dem Kern des christlichen Glaubens entspricht, die Menschenwürde, die Menschenrechte und damit die Religionsfreiheit auch Menschen anderen Glaubens zuzuerkennen. Deshalb respektieren die christlichen Kirchen das Existenzrecht anderer Religionen, einschließlich ihres Anspruchs auf ein Wirken in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Toleranz meint dabei nicht: alles für richtig zu halten und jedem Recht zu geben. Religiöse Toleranz in einem ernsthaften Sinn meint das Aushalten und Austragen von Differenzen in Anerkennung der Verbindlichkeit von religiösen Überzeugungen. Eine freiheitliche Gesellschaft, in der religiöse Überzeugungen ernst genommen werden, braucht eine wache, selbstbewusste Toleranz, die den Dialog einfordert, um gemeinsam Antworten auf die für alle wichtigen Fragen zu suchen. Wechselseitiger Respekt und das Bekenntnis zur klaren Scheidung zwischen Religion und Gewalt bilden entscheidende Voraussetzungen für das friedliche Zusammenleben in einer Pluralen Gesellschaft und für den Frieden zwischen Völkern, Kulturen und Religionen. Diese Voraussetzungen zu erhalten ist Aufgabe aller Religionen. Die Entwicklung religiös begründeter Parallelgesellschaften – wie dies auch in unserem Lande in Bezug auf den Islam mancherorts zu beobachten ist – bildet einen Nährboden des Fundamentalismus. Niemand kann das Recht haben, unter Berufung auf religiöse Regeln oder auf kulturelle Traditionen aus seinem jeweiligen Herkunftsland andere Menschen gewaltsam zu bedrängen, zu verletzen, ja zu töten oder öffentlich und mit dem Anspruch auf Resonanz die These vom »Traditionsmord« zu vertreten. Gesellschaft, Staat und Religionsgemeinschaften sind heute in besonderem Maße gehalten, ihr Verhältnis zu einander im Bewusstsein solcher gemeinsamer Grundüberzeugungen zu bestimmen und die Rahmenbedingungen der Religionsfreiheit in der freiheitlich demokratischen Grundordnung unseres Gemeinwesens so zu entwickeln, dass religiöser Fanatismus darin keinen Platz hat und haben kann. Dieser Gedanke wird in der wichtigen Zeugen-Jehovas-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts35 aufgenommen, wenn das Gericht jedenfalls die Religionsgemeinschaften mit Körperschaftsstatus auf den Schutz der Grundrechte Dritter und darauf verpflichtet, die Grundsätze des freiheitlichen Staatskirchenrechts, zu denen die Einhaltung von Toleranz gehört, nicht zu beeinträchtigen oder zu gefährden. Aus einer christlichen Perspektive gründet das Eintreten für die Religions35 BVerfG, Urteil vom 19. 12. 2000 – 2 BvR 1500/97 -, BVerfGE 102, 370 = KirchE 38, 502 = ZevKR 46 (2001) S. 224. Siehe dazu als Analyse aus Sicht der EKD: C. Thiele, Der Körperschaftsstatus von Religionsgemeinschaften – Zu einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in: H. Barth/W.-D. Hauschild/M. Kramer/H. Schultze (Hrsg.), Kirchliches Jahrbuch 2000, 2002, S. 140 ff.
130
Wolfgang Huber
freiheit als Menschenrecht in der Glaubensgewissheit, um deretwillen der Mitmensch als Nächster geachtet und in seiner abweichenden Glaubensweise respektiert wird. Der christliche Glaube stützt sich – insbesondere in seiner reformatorischen Deutung, aber nicht allein in ihr – auf eine göttlich zugesprochene Anerkennung der menschlichen Person, die unabhängig von ihren Taten und damit auch von ihren Überzeugungen gilt. Daher entspricht es dem Kern des christlichen Glaubens, diese Menschenwürde, die Menschenrechte und damit die Religionsfreiheit auch Menschen anderen Glaubens zuzuerkennen. Deshalb respektieren die christlichen Kirchen das Existenzrecht anderer Religionen, einschließlich ihres Anspruchs auf ein Wirken in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Die Verwirklichung der Religionsfreiheit als Menschenrecht weltweit ist heute eine unaufgebbare Forderung und ein Anliegen der beiden großen Kirchen in Deutschland. Die Bejahung der individuellen wie der kollektiven, der negativen wie der positiven Religionsfreiheit ist ein Ergebnis eines geistesgeschichtlichen Prozesses insbesondere seit der Reformation. Die Menschenrechte bilden inzwischen einen Schwerpunkt der christlichen Ethik.
2.
Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht?
Wer die religiöse Pluralität bejaht und in diesem Sinn einen Monopolanspruch der christlichen Kirchen auf die Repräsentation von Religion in der Öffentlichkeit hinter sich lässt, muss, so scheint es, Schwierigkeiten mit dem hergebrachten Begriff des Staatskirchenrechts haben. Von daher ist es verständlich, dass der, wenn ich recht informiert bin, zuerst von Peter Häberle vorgeschlagene Begriff des Religionsverfassungsrechts spürbar an Resonanz gewinnt. Sogar in einem so traditionsbewußten Lehrbuch wie demjenigen, das Axel von Campenhausen, seit der neuesten Auflage gemeinsam mit Heinrich de Wall, verantwortet, wird der Begriff des Religionsverfassungsrechts demjenigen des Staatskirchenrechts systematisch vorgeordnet,36 wenn auch im Titel das »Staatskirchenrecht« – man möchte hinzufügen: gerade eben noch – den Rang des Haupttitels behält und das Religionsverfassungsrecht in den Untertitel verweist. Der in dieser Hinsicht ausgebrochene »begriffspolitische Grundsatzstreit«37 hat viele Facetten. Das System der Religionsfreiheit in seinen individuellen, korporativen und institutionellen Aspekten ist heute natürlich längst nicht mehr 36 So A. v. Campenhausen/H. de Wall, Staatskirchenrecht (Fn. 12), S. 40. 37 Siehe hierzu H.-M. Heinig/C. Walter (Hrsg.), Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht? (Fn. 6).
Kirche und Verfassungsordnung
131
auf die Freiheit zur Wahrnehmung des christlichen Glaubens und auf das institutionelle Verhältnis zwischen den christlichen Kirchen und dem demokratischen Verfassungsstaat beschränkt. So meint der Begriff des Staatskirchenrechts ebenso wie der des Religionsverfassungsrechts gleichermaßen die heute selbstverständliche pluralistische Rahmenordnung des säkularen Staates, in der »die Institutionen als Instrument gemeinsamer Aktivitäten und Belange der Bürger und ihrer religiösen Gruppierungen verstanden (werden), die zur realen Verwirklichung ihrer Grundrechte dienen«.38 Die grundrechtlich verbürgte, individuelle Religionsfreiheit gehört längst zum anerkannten Kern des Staatskirchenrechts; daß es auch in seinen institutionellen Aspekten von der individuellen Religionsfreiheit aus zu entwerfen und zu normieren sei, ist keineswegs eine neue These. Deshalb erscheint es mir als hochproblematisch, hierzu einen dogmatischen Streit zu führen; unverkennbar verbindet sich dieser Streit bei manchen Akteuren mit der Absicht, die korporative und institutionelle Seite der Religionsfreiheit zurückzudrängen. Soweit dabei ein Leitbild bestimmend ist, das die Religionen in ihrer korporativen und institutionellen Gestalt auf den Bereich des Privaten beschränken wollen, ist dem aus historischen wie aus aktuellen, vor allem aber aus grundsätzlichen Erwägungen zu widersprechen. Die deutlichere Wahrnehmung religiöser Pluralität in unserer Gesellschaft bietet keinen Grund dazu, die in der Religionsfreiheit begründete Verhältnisbestimmung von Religionsgemeinschaften und Verfassungsstaat in Frage zu stellen oder zu modifizieren – ganz im Gegenteil. Allein pragmatische Gründe der Anerkennung der religiösen Pluralität in unserer Gesellschaft können es deshalb nahe legen, dem Begriff des Religionsverfassungsrechts den weiteren Bedeutungsradius zuzuerkennen und den herkömmlichen Begriff des Staatskirchenrechts dem zuzuordnen. Es mag sein, daß eine solche Vorgehensweise es auch erleichtert, die deutschen Erfahrungen und Weichenstellung im europäischen Rahmen zu vermitteln und verständlich zu machen.
3.
Kirche in der europäischen Verfassungsordnung
In den vergangenen Jahren, in denen es um die Formulierung des Verfassungsvertrages der Europäischen Union ging, hat die Diskussion über den Gottesbezug sowie über die Erwähnung der jüdisch-christlichen Tradition in der Präambel in der öffentlichen Debatte besondere Aufmerksamkeit gefunden.39 38 M. Heckel, Religionsfreiheit und Staatskirchenrecht in der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts, in: ders. (u. a.) (Hrsg.), Martin Heckel. Gesammelte Schriften, Band V, Staat – Kirche – Recht – Geschichte (Jus Ecclesiasticum, Bd. 73), 2004, S. 303 ff. (310). 39 Ein Überblick über den Gang der Diskussion bei C. Thiele, Die Kirchen und der Europäische
132
Wolfgang Huber
Evangelische und katholische Kirche in Deutschland haben ihre Position in dieser Debatte einvernehmlich formuliert und in die politische Diskussion eingebracht.40 Auch heute unterstreiche ich gern, dass ein Hinweis auf die Verantwortung vor Gott in der Präambel des europäischen Verfassungsvertrags einen guten Ort hätte und daß mir die Präzisierung der Rede von religiösen und humanistischen Traditionen im Sinn eines Hinweises auf die jüdisch-christliche Tradition unentbehrlich erscheint. In dieser Debatte ist freilich ein anderer Aspekt weithin in den Hintergrund getreten. Im Hinblick auf Kirchen und Religionsgemeinschaften ist der Artikel I52 des Entwurfs Gegenstand eingehender Überlegungen gewesen. Dieser Artikel soll eine bereits in einer Protokollerklärung zum Amsterdamer Vertrag verankerte Bestimmung in das Primärrecht der Europäischen Union übernehmen. Es geht um die Festlegung, daß die nationalen Systeme der Religionsverfassung durch das europäische Recht zu beachten sind und nicht beeinträchtigt werden dürfen. Daneben ist vorgesehen, daß die europäischen Institutionen in den Dialog mit den Religionsgemeinschaften eintreten sollen; dieses Vorhaben wurde bereits unter der österreichischen Präsidentschaft im Jahr 2006 in Gang gebracht wurde und wird im Mai 2007 unter der deutschen Präsidentschaft weitergeführt. Unabhängig von der derzeit offenen Frage nach dem künftigen Schicksal des europäischen Verfassungsvertrags ist beides von großer Bedeutung: sich auf europäischer Ebene über den hohen Rang der Religionsfreiheit zu verständigen und die unterschiedlichen Formen der Ausgestaltung der Religionsfreiheit in den europäischen Ländern zu achten. Gerade in diesem Feld kann es ein System des »kleinsten gemeinsamen Nenners« nicht geben. Die Aufgabe, »Europa eine Seele zu geben«, schließt ganz gewiss die Belange der individuellen, korporativen und institutionellen Religionsfreiheit als zentrales Element ein. Deutlich steht uns als Kirchen die Aufgabe vor Augen, den kirchlichen Auftrag innerhalb der EU wahrzunehmen und für eine freiheitliche Religionsverfassungsordnung auch auf europäischer Ebene einzutreten. Der stetige und transparente Dialog zwischen den europäischen Institutionen und den Religionsgemeinschaften wird von uns in seiner Bedeutung hoch eingeschätzt. Als Kirchen treten wir dafür ein, daß die individuelle wie die korporative und die institutionelle Religionsfreiheit mitsamt der religiösen Neutralität des Staates und der gemeinsamen Verantwortung von Staat und Religion für das Gemeinwesen auch im europäischen Kontext geachtet wird, so wie dies im nationalen deutschen Bereich durch die gewachsene Verhältnisbestimmung von Verfassungsvertrag, in: H. Barth/W.-D. Hauschild/H. Oelke/H. Schultze (Hrsg.), Kirchliches Jahrbuch 2003, 2006, S. 142 ff., insbesondere S. 157 ff. 40 Siehe z. B. »Gemeinsame Stellungnahme« von Präses M. Kock und K. Kardinal Lehmann vom 28. 5. 2002, abgedruckt ebenda, S. 146 f.; gemeinsames Schreiben von Bischof W. Huber und K. Kardinal Lehmann vom 3. 6. 2004 an Bundeskanzler Schröder, abgedruckt ebenda S. 163.
Kirche und Verfassungsordnung
133
Kirche und Verfassungsordnung der Fall ist. Als Kirchen bejahen wir dies, weil wir von der Überzeugung bestimmt sind, dass die Freiheit des Glaubens zum Kernbereich menschlicher Freiheit gehört.

![Die Philosophie der Inder; eine Einführung in ihre Geschichte und ihre Lehren [3d ed.]
9783520195036, 3520195038](https://dokumen.pub/img/200x200/die-philosophie-der-inder-eine-einfhrung-in-ihre-geschichte-und-ihre-lehren-3d-ed-9783520195036-3520195038.jpg)


![Väter und ihre Söhne: Eine besondere Beziehung [2. Aufl.]
9783662603628, 9783662603635](https://dokumen.pub/img/200x200/vter-und-ihre-shne-eine-besondere-beziehung-2-aufl-9783662603628-9783662603635.jpg)