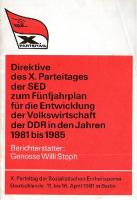Auf dem Weg zum sozialistischen Dorf?: Zum Wandel der dörflichen Lebenswelt in der DDR von 1952 bis 1969 mit vergleichenden Aspekten zur Bundesrepublik Deutschland 352535794X, 9783525357941
Die Umgestaltung der dörflichen Gesellschaft in der DDR: Intention und Wirklichkeit Die Konstruktion einer sozialistisc
154 39 10MB
German Pages 352
Polecaj historie
Citation preview
Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 131
V&R
Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft Herausgegeben von Helmut Berding, Jürgen Kocka Hans-Peter Ullmann, Hans-Ulrich Wehler
Band 131 Antonia Maria H u m m Auf dem Weg zum sozialistischen Dorf?
Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen
Auf dem Weg zum sozialistischen Dorf? Zum Wandel der dörflichen Lebenswelt in der DDR von 1952 bis 1969 mit vergleichenden Aspekten zur Bundesrepublik Deutschland von
Antonia Maria H u m m
Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen
Umschlagbild: Plakat DDR 1954, Design: Erich Melcher. Bildarchiv des Deutschen Historischen Museums Berlin.
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Humm, Antonia Maria: Auf dem Weg zum sozialistischen Dorf? : zum Wandel der dörflichen Lebenswelt in der D D R von 1952 bis 1969 mit vergleichenden Aspekten zur Bundesrepublik Deutschland / von Antonia Maria H u m m . Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1999 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft ; Bd. 131) Zugl.: Dissertation Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät I, Dezember 1996. ISBN 3-525-35794-X
Gedruckt mit Hilfe der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften in Ingelheim am Rhein, des Ministeriums ländlicher Raum Baden-Württemberg, des Zweckverbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke sowie der Axel Springer Stiftung. © 1999, Vandenhoeck Sc Ruprecht, Göttingen. - Printed in Germany. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere fur Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Umschlag: Jürgen Kochinke, Holle. Satz: Text & Form, Pohle. Druck: Guide-Druck G m b H , Tübingen.
Inhalt Vorwort
11
Einleitung Konzeption und methodische Probleme Quellenlage Forschungsstand
14 14 28 34
I. Der ländliche Strukturwandel in Niederzimmern und Bernstadt
43
1. 2. 3. 4.
Die naturräumliche Gliederung der Untersuchungsgemeinden ... Bevölkerungsentwicklung und Wanderungsbewegungen Der Wandel der Erwerbsstruktur Zur Urbanisierung des ländlichen Raums: Die Entwicklung der dörflichen Siedlungs- und Infrastruktur
43 44 54 65
II. Die Landwirtschaft: Agrarpolitik, sozioökonomischer Strukturwandel und bäuerliche Handlungsstrategien 78 1. Die agrarpolitischen Rahmenbedingungen 1.1. Die Vorgeschichte: Agrarpolitik und landwirtschaftlicher Strukturwandel in der SBZ/DDR 1945 bis 1952 1.2. Die Agrarpolitik der D D R im Zeichen der Kollektivierung ... 1.3. Die Agrarpolitik in der Bundesrepublik 2. Der sozioökonomische Strukturwandel in der Landwirtschaft in beiden deutschen Staaten 2.1. Die landwirtschaftlichen Betriebe 2.1.1. Die bäuerlichen Privatbetriebe 2.1.2. Die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften in der D D R 2.2. Die Beschäftigten in der Landwirtschaft 2.3. Die Betriebs- und Arbeitsorganisation in den LPGs 2.4. Die Modernisierung der landwirtschaftlichen Produktionsweise am Beispiel der Mechanisierung und des Düngereinsatzes 2.5. Die Ergebnisse der landwirtschaftlichen Produktion
78 79 88 102 109 110 110 114 117 122
123 127 5
3. Zur Transformation der bäuerlichen Lebenswelt: Reaktionen und Handlungsstrategien 3.1. Bäuerliche Selbständigkeit und die Alternative der LPG in Niederzimmern 1952 bis 1960 3.2. Die Neuformierung der bäuerlichen Lebenswelt durch die LPG: Genossenschaftsbauern in Niederzimmern 1960 bis 1969 3.3. Handlungsstrategien der Landwirte in Bernstadt in vergleichender Perspektive
III. Kommunalpolitik und politische Partizipation 1. Die Kommunalverfassungen: Struktur und Funktionen kommunalpolitischer Organe 1.1. Politisches System und kommunalpolitische Strukturen in der D D R 1.2. Kommunalpolitische Strukturen in der Bundesrepublik in vergleichender Perspektive 2. Staatliche Intervention und kommunale Politik 2.1. Die Durchsetzung zentralstaatlicher Entscheidungen in der Gemeinde Niederzimmern 2.2. Kommunalverwaltung und Bevölkerung 2.2.1. Die Durchsetzung und Rezeption agrarpolitischer Vorgaben in Niederzimmern 2.2.2. Die Wohnraumbewirtschaftung in Niederzimmern in vergleichender Perspektive zu Bernstadt 3. Politische Partizipation und politische Mobilisierung auf kommunaler Ebene 3.1. Politische Partizipation in der Gemeindevertretung 3.1.1. Die Gemeindevertretung und ihre Mitglieder in Niederzimmern 3.1.2. Der Gemeinderat in Bernstadt in vergleichender Perspektive 3.2. Die politische Mobilisierung der Bevölkerung in Niederzimmern 3.2.1. Die Kommissionen 3.2.2. Die Parteien und Massenorganisationen 3.2.3. Die Haus- und Hofgemeinschaften 3.2.4. Das Nationale Aufbauwerk (NAW) 3.2.5. Die Maifeiern
6
133 133
146 167
183 183 183 187 188 189 198 200 203 207 208 208 216 226 226 229 234 235 240
IV Dörfliche Kultur zwischen Transformation und Tradition 1. Das Vereinsleben 1.1. Zur politischen Funktionalisierung von Kultur und Sport in der D D R 1.2. Vereinskultur in Niederzimmern am Beispiel der Sportgemeinschaft und des Volkschors 1.2.1. Die Sektion Turnen der Sportgemeinschaft Niederzimmern 1.2.2. Der Volkschor in Niederzimmern 1.3. Vereinskultur in Bernstadt in vergleichender Perspektive 2. Die Jugendkultur 2.1. Zur Jugendpolitik in der D D R 2.2. Die Jugendkultur in Niederzimmern: FDJ und Kirmesburschenschaft 2.2.1. Die FDJ 2.2.2. Die Kirmesburschenschaft 3. Das kirchliche Leben 3.1. Zum Verhältnis von evangelischen Kirchen und Staat in in der D D R 3.2. Die Rolle der evangelischen Kirchengemeinde in Niederzimmern 3.3. Das kirchliche Leben in Bernstadt in vergleichender Perspektive
244 246 246 248 248 259 268 278 278 280 280 284 292 292 294 302
V Auf dem Weg zum sozialistischen Dorf?
307
Anhang: Umgebungskarte von Niederzimmern Umgebungskarte von Bernstadt Karte Bundesrepublik Deutschland
323 324 325
Abkürzungen
327
Zeitzeugeninterviews
329
Quellen- und Literaturverzeichnis
331
Register
349
7
Verzeichnis der Tabellen im Text Tab. 1: Tab. 2:
Bevölkerungsentwicklung in Niederzimmern und Bernstadt Erwerbsstruktur der Abwanderer in der alteingesessenen Bevölkerung Niederzimmerns Tab. 3: Zielorte der Abwanderer Niederzimmerns Tab. 4: Sozialstruktur der DDR-Flüchtlinge im Landkreis Weimar im Jan., April, Mai j u l i , Aug., Sept. 1960 Tab. 5: Wanderungsbilanz in Niederzimmern 1946-1968 Tab. 6: Erwerbsstruktur und soziale Zugehörigkeit in der D D R und der Bundesrepublik Deutschland Tab. 7: Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit in der D D R und in der Bundesrepublik Deutschland Tab. 8: Erwerbsstruktur nach Sektoren und Stellung im Beruf in Niederzimmern und Bernstadt Tab. 9: Erwerbsstatistik Niederzimmern Tab. 10: Erwerbsstruktur nach Geschlechtern in Niederzimmern und Bernstadt Tab. 11 : Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe in der D D R 1950-1952 ... Tab. 12a: Entwicklung der Zahl der privaten landwirtschaftlichen Betriebe in der D D R nach Größenklassen Tab. 12b: Entwicklung der Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in der Bundesrepublik nach Größenklassen Tab: 13: Betriebsgrößenstruktur landwirtschaftlicher Privatbetriebe in der D D R und der Bundesrepublik Tab. 14: Anteil der genossenschaftlich bewirtschafteten Flächen an der LNF .... Tab. 15: Entwicklung der LPGs nach Typen, Anzahl der Betriebe und Flächenanteile Tab. 16: Entwicklung der Betriebsgrößenstruktur der LPGs Tab. 17a: Beschäftigte in der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft der D D R nach Stellung im Betrieb (ohne Lehrlinge) Tab. 17b: Erwerbstätige in der Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei der Bundesrepublik Deutschland Tab. 18: Rückgang der Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen in der Landwirtschaft der D D R im Vergleich zu den LPG-Beitritten dieser Gruppen Tab. 19: Soziale Herkunft der LPG-Mitglieder in der D D R (einschließlich der Familienangehörigen) Tab. 20: Maschinenbestände der Landwirtschaft a) Traktorenbestand in der D D R und der Bundesrepublik b) Vollerntemaschinen in der D D R und der Bundesrepublik
8
45 47 49 51 52 55 56 63 64 64 87 113 113 114 116 116 117 120 120
121 121 126 126
Tab. 21: Einsatz von Düngemitteln Tab. 22: Produktionsergebnisse der Landwirtschaft in der D D R und der Bundesrepublik Deutschland a) Viehbesatz je 100 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche b) Jahresmilchertrag je Kuh c) Pflanzliche Produktion Tab. 23: Produktionsergebnisse (DDR) in den LPGs und Privatbetrieben im Vergleich
127 131 131 131 131 132
9
Vorwort
Für das Gelingen einer Studie, die sich vor allem auf zwei Gemeinden konzentriert, ist die Hilfe und Vermittlung von lokalen Persönlichkeiten unabdingbar. Ich hatte das Glück, in beiden Orten Menschen zu finden, die sich für mein Projekt interessierten und die mir den Weg ebneten, indem sie mich mit Zeitzeugen bekannt machten oder mich auf zusätzliche Quellen wie beispielsweise Dorf- oder Vereinschroniken hinwiesen und die mir spezifische Problemstellungen in den Gemeinden in manchmal langen Gesprächen näher brachten. Dafür danke ich besonders den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltungen in Niederzimmern und Bernstadt, wobei ich insbesondere Frau Kirnich aus Niederzimmern sowie den Bürgermeister von Bernstadt, Herrn Ott, nennen möchte. Für meine Arbeit waren aber auch die Bereitschaft der Zeitzeugen, in ihren Erinnerungen, in ihren privaten Archiven und Fotoalben zu stöbern, von zentraler Bedeutung. Ihnen gebührt Dank, da sie mir nicht nur ihre Zeit, sondern auch ihre Gastfreundschaft schenkten. Die vorliegende Studie wurde im Dezember 1996 von der Humboldt-Universität zu Berlin als Dissertation angenommen und für die Veröffentlichung überarbeitet. Sie entstand im Rahmen des interdisziplinären Graduiertenkollegs »Gesellschaftsvergleich in historischer, soziologischer und ethnologischer Perspektive«, das von der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität Berlin und dem Centre Marc Bloch getragen wird. Dieser Arbeitszusammenhang bot mir nicht nur die nötigen materiellen Voraussetzungen, sondern auch ein wichtiges Diskussionsforum, das meine Arbeit drei Jahre lang begleitete. Umfassende Unterstützung und kritische Begleitung leisteten die beiden Betreuer und Gutachter meiner Dissertation, Prof. Dr. Hartmut Kaelble von der Humboldt-Universität Berlin und Prof Dr. Etienne François vom Centre Marc Bloch, Berlin. Z u danken habe ich ebenfalls Prof Dr. Ulrich Kluge, Dresden und Dr. Arnd Bauerkämper, Potsdam für weitere wissenschaftliche Betreuung und anregende Diskussionen. Ermunterung, Denkanstöße, Ratschläge und redaktionelle Hilfe bei der Durchsicht des Manuskripts erhielt ich u.a. von Klaudia H u m m , Dr. Gertrud Hüwelmeier, Birgit Kempf, Edith Krannich, Dr. Ciro Krauthausen, Almut Rietschel und Mathias Waltersbacher. Neben wissenschaftlicher Unterstützung bedarf eine Dissertation immer auch erheblicher materieller Mittel. Finanzielle Förderung wurde mir dankenswerterweise drei Jahre lang durch ein Stipendium der DFG zuteil sowie durch die FAZIT-Stiftung, die mir ein Abschlußstipendium gewährte. Für die 11
Drucklegung bewilligten das Ministerium ländlicher Raum Baden-Württemberg, der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke, die Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften sowie die Axel Springer Stiftung großzügige finanzielle Mittel. Unterstützung fand ich zudem durch den Landrat des Alb-Donau-Kreises, Dr. Schürle, sowie das Bildarchiv des Deutschen Historischen Museums Berlin. So möchte ich allen, die zum Gelingen der vorliegenden Studie beigetragen haben, meinen herzlichen Dank aussprechen. Berlin, im Oktober 1998
12
Antonia Maria H u m m
Säer
Du Dorf: noch dumpf in kargen Fluren, noch ohne Wissen, ohne Licht: Wir heben aus zerfahrenen Spuren dich in das Licht der Zuversicht Wir säen herrliche Projekte: Hier wird ein Sportplatz, weit und weich, und dieses grüne, tanggefleckte Sumpfwasser wird zum klaren Teich; hier werden wir ein Klubhaus bauen, dies Land wird ein Mitschurinfeld... Freund, welches Leben! Schon zu schauen des Bauern morgenlichte Welt! Wir sehen das Dorf der Stadt sich nähern und Dorf und Stadt gehn Hand in Hand. Die Erde beugt sich vor den Säem, die Saat geht auf im jungen Land (Franz Fühmann, 1959)1
1 Dieses 1959 in der D D R erschienene Gedicht wurde entnommen aus: Kunst ist Waffe III, Fort mit den Trümmern und was Neues hingebaut! Leipzig 1981, S. 56.
13
Einleitung
Konzeption und methodische Probleme Die Staatsführung der D D R etablierte nach den Vorstellungen und unter der Regie der SED eine sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung, wobei sie weite Bereiche von Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur umgestaltete und bestehende Strukturen zerschlug. Sie veränderte die Besitzverhältnisse durch Enteignungs-, Verstaatlichungs- und Kollektivierungsmaßnahmen und führte die Planwirtschaft sowie ein politisches System ein, das nach dem Prinzip des sog. demokratischen Zentralismus organisiert war. Der Zentralismus, verknüpft mit einem diktatorischen Herrschaftssystem, in dem die SED die »führende Rolle« beanspruchte, legte der Staatsführung nicht nur alle politischen Entscheidungen in die Hände, sondern erlaubte ihr, Wirtschaft und Justiz, Kultur sowie die Massenorganisationen zu kontrollieren und zu lenken. 2 Der totalitäre Herrschafts- und Gestaltungsanspruch der Staatspartei betraf nicht nur institutionelle Bereiche, sondern erstreckte sich auf alle Dimensionen der sozialen Wirklichkeit, selbst auf die individuelle Ebene. Gesellschaftliche Subsysteme wurden ihrer Eigenständigkeit beraubt und ideologisch überlagert.3 Die SED zielte darauf ab, einen neuen Menschentypen heranzubilden, die »sozialistische Persönlichkeit«. Diese sollte sich u.a. durch ein »sozialistisches Bewußtsein«, d.h. eine marxistisch-leninistische Weltanschauung, die aktive Teilnahme am Aufbau des Sozialismus, gesellschaftliche Mitarbeit in Massenorganisationen und eine sozialistische Arbeits- und Lebensweise auszeichnen. Mit der Entwicklung der »sozialistischen Persönlichkeit« wollte man auch den Beweis antreten, daß mit der neuen Gesellschaftsordnung völlig neue soziale Beziehungen entstanden. 4 Der folgenreichste staatliche Eingriff in die ländliche Gesellschaft war die Kollektivierung der Landwirtschaft, die mit dem Beschluß zum planmäßigen »Aufbau des Sozialismus« auf der 2. Parteikonferenz der SED im Juli 1952 verkündet und 1960 endgültig abgeschlossen wurde. Indem die SED die genossenschaftliche Landwirtschaft durchsetzte, verfolgte sie nicht nur das Ziel, die 2 Lepsius, S. 18ff. Zu Errichtung der sozialistischen Ordnung in der D D R im Uberblick siehe auch: H. Weber, DDR; Staritz. 3 Siehe dazu: Meuschel, S. 10. 4 Bergem, S. 115-133; Die SED von A bis Z, S. 40; M.E. Müller, S. 25ff.; Lemke, S. 20ff.
14
landwirtschaftlichen Besitz- und Produktionsverhältnisse gänzlich neu zu ordnen, sondern postulierte auch, daß dies die Voraussetzung zur angestrebten Uberwindung der Rückständigkeit des Landes und zur Aufhebung des StadtLand-Gegensatzes sei.5 Nach der Kollektivierung erfolgte die Landbewirtschaftung gemeinschaftlich, die individuelle Verfügungsgewalt der Bauern über ihren Grund und Boden sowie über ihr Inventar war aufgehoben, und es entstanden große betriebliche Einheiten. Die neuen landwirtschaftlichen Verhältnisse strahlten auf viele Bereiche der sozialen Wirklichkeit und der Lebenswelt des Landes aus. So veränderten sich die Sozialstrukturen und die gesellschaftlichen Beziehungen im Dorf sowie die alltäglichen Arbeitserfahrungen der landwirtschaftlichen Bevölkerung. Daneben wurde die ländliche Gesellschaft und ihre Lebenswelt auch von staatlichen Eingriffen berührt, welche die gesamte Gesellschaft der D D R betrafen. Die Dominanz der SED in den kommunalpolitischen Institutionen und die Zentralisierung der politischen Entscheidungen ordneten die politischen Machtverhältnisse im Dorf neu. Z u gleich entmachtete dies die kommunalpolitischen Entscheidungsträger und degradierte sie zu Handlangern der Staats- und Parteiführung. Auch in die dörfliche Kultur mischte sich der Staat ein. Einerseits veränderte er die institutionelle und organisatorische Verfassung der dörflichen Kulturinstitutionen und definierte andererseits die Funktion und die Inhalte der kulturellen Praxis neu. Kultur erhielt danach ebenso wie der Bereich der Bildung einen erzieherischen und ideologischen Charakter. Ausgehend von diesen umfassenden Gestaltungsansprüchen der Machthaber in der DDR, kann man durchaus von einer »durchherrschten Gesellschaft«6 sprechen, deren Wandel in hohem Maß das Ergebnis politischer Konstruktion war.7 U m die Geschichte der Diktatur in der D D R zu verstehen, ist es unabdingbar, außer der Perspektive der Herrschaftsstrukturen und Herrschaftsausübung auch die Wechselwirkungen zwischen dem Geltungsanspruch der Diktatur und ihrem gesellschaftlichen Kontext zu betrachten. 8 Will man ergründen, inwieweit der sozialistische Staat seine Herrschaftsansprüche durchzusetzen vermochte, ist in erster Linie nach der alltäglichen Herrschaftswirklichkeit zu fragen, d.h. nach der Art und Weise, »wie die in der D D R lebenden Menschen sich die von der SED oktroyierten Herrschaftsverhältnisse aneigne 5 Mit Bezug auf die Marx'sehe Kapitalismuskritik und der darin enthaltenen Stadt-LandTheorie, die den Stadt-Land-Gegensatz als Resultat kapitalistischer Eigentumsverhältnisse interpretierte, sah die SED den Unterschied zwischen Stadt und Land im Zuge der Umwälzung der Eigentumsverhältnisse schwinden. Dementsprechend wurde bereits die Kollektivierung der Landwirtschaft sowie die Angleichung der landwirtschaftlichen an die industrielle Produktion als ein wesentlicher Schritt in diese Richtung gesehen. Dazu: Tömmel, S. 12f. 6 Diesen Begriff benutzte Liidtke, Helden, S. 188. 7 Diese Auffassung vertreten ζ. B. Kocka, Gesellschaft, S. 547f.; Lindenberger, Projektvorstellung, S. 38. 8 Bessel/Jessen, S. 9; Fullbrook, S. 274.
15
ten, sie deuteten und wie sie sich ihnen gegenüber verhielten«.9 Dahinter steht eine Betrachtungsweise, die »Herrschaft als soziale Praxis«, als Interaktion begreift und die wechselseitige Abhängigkeit von Herrschenden und Beherrschten betont. 10 Diese Herangehensweise unterstellt, daß historische Prozesse nicht allein durch äußere Zwänge - sei es durch politische Konstruktion oder durch strukturelle Rahmenbedingungen - bestimmt werden, sondern daß auch Individuen und Gruppen Einfluß darauf gewinnen können. In ihrer spezifischen Verarbeitung von herrschaftlichen Zwängen treten sie als Akteure auf, die extern beschlossene Neuordnungen bis zu einem gewissen Grad bremsen, umdeuten oder auch zulassen können und damit auf ihre Lebenswelt gestaltend einwirken. Es ist anzunehmen, daß in der Realität der sozialistischen Gesellschaft eine Differenz zwischen der beabsichtigten Konstruktion der Gesellschaft nach »marxistisch-leninistischem Bauplan« und dem Eigengewicht sozialer Strukturen und Prozesse bestehen blieb. Selbst einer staatlichen Planung, die den Anspruch einer allumfassenden Steuerung hatte, dürfte es kaum gelungen sein, die Handlungsweisen und Interaktionen der Individuen absolut zu determinieren. 11 Gegenstand dieser Studie ist die ländliche Gesellschaft zwischen 1952 und 1969. Untersucht werden soll, wie weit die politische Konstruktion von sozialem Wandel innerhalb des traditionellen, dörflichen Sozialmilieus reichte und wo ihre Grenzen verliefen.12 Dabei sind zwei Untersuchungsdimensionen zu unterscheiden. In einem ersten Schritt gilt es, die staatlich oktroyierten, institutionellen Neuregelungen zu benennen sowie die unmittelbaren, unausweichlichen Folgen darzustellen, welche die massiven Eingriffe für die sozioökonomischen, politischen und kulturellen Strukturen des Dorfes hatten. Die zweite Untersuchungsdimension betrifft die Frage, aufweiche Weise sich die Landbevölkerung die herrschaftlichen Gestaltungsansprüche aneignete, und wie sie auf die Eingriffe des sozialistischen Staates in bestimmte Bereiche ihrer Lebenswelt wie die Ökonomie, die Kommunalpolitik und die dörfliche Kultur reagierte. Am Beispiel einer Gemeinde untersuche ich, ob und inwieweit die Einwohner bereit waren, die Veränderungen, die ihnen durch den gezielten Umbruch der bisherigen Gesellschaftsordnung zugemutet wurden, zu akzeptieren und mitzutragen, oder ob sie sich widersetzten. Paßten sie sich der scheinbar unvermeidlichen Entwicklung an oder entwickelten sie Handlungsstrategien, die darauf abzielten, bestimmte Entwicklungen abzuwehren? Versuchten sie, Nischen und Freiräume zu erhalten, in denen sie Formen ihrer 9 Lindenberger, Projektvorstellung, S. 39. 10 Liidtke, Herrschaft, S. 12ff.; Lindenberger, Alltagsgeschichte, S. 312ÍF. 11 Siehe dazu: Jessen, S. 99f. 12 Eine Untersuchung der Beharrungskraft traditioneller Milieus in der DDR schlägt Christoph Kleßmann für eine künftige DDR-Geschichtsschreibung vor. Vgl.: Kleßmann, Beharrungskraft, S. 146-154.
16
überkommenen Lebensweise konservieren konnten? In welcher Weise veränderten sich durch die spezifischen gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen die Verhaltensdispositionen, Handlungsmuster und Einstellungen der Akteure? Die Reaktionsweisen der Bevölkerung auf die Durchsetzung der sozialistischen Gesellschaftsordnung sind auf Anpassung und Resistenz zu befragen, um erfassen zu können, inwiefern diese den Herrschaftsanspruch des Staates akzeptierten und stützten oder ihn begrenzten. 13 Der Begriff »Resistenz« fand in der alltagsgeschichtlichen Forschung zum Nationalsozialismus Anwendung und umfaßt ein breites Spektrum von Verhaltensweisen, die von aktivem oppositionellen Handeln bis zu »bloßer«, nicht politisch begründeter Interessenwahrung reichen. Resistenz definiert sich dabei allein durch die objektive Wirkung der Handlungsweisen im Sinne von Herrschaftseinschränkung. Anders als »Widerstand«, der vor allem auf die subjektive Motivation der Akteure abzielt, ermöglicht es der Resistenzbegriff, aus dem Alltagshandeln resultierende Herrschaftsbegrenzungen zu zeigen.14 U m die unterschiedlichen Nuancen der Umgangsweisen mit staatlichen Eingriffen zu erkennen, bedarf es darüber hinaus eines Ansatzes, der nicht nur nach einem Entweder-Oder von Resistenz und Anpassung fragt. U m der Vielschichtigkeit und dem ambivalenten Charakter von Verhaltensweisen auf die Spur zu kommen, ist es sinnvoll, mit dem Konzept von »Eigensinn« zu operieren. 15 »Eigensinn« meint in diesem Zusammenhang die Aneignung und Deutung von Herrschaft durch die gesellschaftlichen Akteure sowie deren Ubersetzung für ihr eigenes Leben. Dabei zielt der Begriff auf die Bedeutung, den Sinn, den die Individuen ihren Handlungen und Verhaltensweisen in der Interaktion mit der Obrigkeit verleihen. Die subjektiven Handlungsmotive und Bedeutungen weichen von dem herrschaftlich intendierten und zumeist ideologisch definierten Sinn ab, d.h. systemkonforme Anpassungsleistungen beruhen auf einer Motivation, die den beabsichtigten Sinn ignoriert oder ihn sogar ins Gegenteil verkehrt. »Eigensinnige« Verhaltensweisen können durchaus widersprüchlich erscheinen, denn das Spektrum der so charakterisierten Praktiken umfaßt Kooperation, die dazu dient, die vom 13 Mit der Frage, inwieweit totalitäre Herrschaftsansprüche im ländlich-bäuerlichen Milieu griffen, beschäftigte sich bereits die alltagsgeschichtliche Forschung zum Nationalsozialismus. Zdenek Zoflta konnte zeigen, daß sich die N S D A P bei der Durchsetzung ihrer Macht in den Dörfern den tradierten und sehr beharrlichen Strukturen und Gewohnheiten anzupassen hatte. Dies wertete er als Resistenzfaktor gegen die totalitären Ansprüche des Regimes. Vgl. dazu auch Broszat, Resistenz; Fröhlich/Broszat, Macht. 14 Z u r Definition des Resistenzbegriffs siehe: Broszat/Fröhlich, Alltag, S. 47ff.; Broszat, Resistenz, S. 693ff. 15 Die Konzeption von Eigensinn wurde in Anlehnung an den Ansatz von Alf Lüdtke entwikkelt, der diesen Begriff in einer sozialgeschichtlichen Forschung zur Industriearbeiterschaft verwendete. Der hier referierte »Eigensinns«-Begriff folgt v.a. Lindenberger (Projektvorstellung), der versucht, die von Lüdtke (Eigen-Sinn; Geschichte) vertretene Definition für die Erforschung der DDR-Geschichte nutzbar zu machen.
17
System gebotenen Möglichkeiten und Vorteile in eigennütziger Weise auszuschöpfen - interessengeleitetes Handeln und »Eigensinn« lassen sich also kaum trennen. Es reicht weiter über eine äußerliche Loyalität bei innerlicher Distanziertheit bis zu passiven Formen des Sich-Verweigerns und offener Gegenwehr. Dennoch liegt im »Eigensinn« kein Widerstand; er ist keineswegs als »Gegenhalten der >kleinen Leutetraditionell< verwende ich in diesem Zusammenhang fur bäuerliche Wertemuster, die sich vor allem im 19. Jahrhundert nach den Agrarreformen und der Befreiung der Bauern von feudalen Lasten herausgebildet hatten. Die Übernahme der vollen Eigentumsrechte an den Höfen, aber auch die Begünstigung von größeren Höfen, vergrößerte den Abstand zwischen den Schichten und hatte eine soziale Differenzierung zur Folge, die die Basis für solche Orientierungen bot. Siehe dazu: Mooser; Harnisch. Z u r traditionellen bäuerlichen Orientierung am Besitz in diesem Sinne siehe z.B. auch:Jeggle/Ilien, Leben, S. 50-61; Rosenbaum, S. 56f.; Golde, S. 97ff. 141 Auch die in Kap. II. 2. vorgestellten Daten über die soziale Herkunft der Genossenschaftsmitglieder, die den lange Zeit geringen »Altbauernanteil« in den LPGs belegen, bestätigen, daß das Verhalten der Bauern der Untersuchungsgemeinde typisch war. Die ablehnende Haltung der Bauern gegenüber den LPG war auch nach bereits erfolgtem LPG-Beitritt noch nicht überwunden.
139
verweisen auf die Beharrungskraft der bäuerlichen Mentalität und auf ein hohes Resistenzpotential gegen staatliche Transformationsbestrebungen. Die Bemühungen der SED, die genossenschaftliche Landwirtschaft durch Agitation und die gezielte Benachteiligung der Privatbetriebe zu popularisieren, konnten die Bauern nicht zu einer Einstellungsänderung veranlassen. Zugleich gilt es zu betonen, daß die vorgefundenen Verhaltensmuster der Bauern auf die Verteidigung ihrer wirtschaftlichen Interessen verweisen. Diese Handlungsmotivation konnte bei den Bauern auch zu einer Revision von traditionellen Orientierungen führen, was darauf hindeutet, daß Mentalitäten sich flexibel neuen Gegebenheiten anpassen können, ohne sich grundlegend zu wandeln. So verfolgte zumindest ein Teil der Landwirte die Strategie, eine betriebswirtschaftliche Optimierung zu erreichen, um ihre selbständigen Betriebe zu erhalten und den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu trotzen. Dabei erwies sich die Einstellung der Bauern, den Landbesitz in seinem vollen Umfang zu erhalten oder sogar zu vermehren nicht länger als sinnvoll, denn mit wachsender Betriebsgröße stiegen die Ablieferungsverpflichtungen überproportional an. Viele Landwirte reduzierten deshalb die von ihnen bewirtschaftete Fläche. Obwohl die Behörden versuchten, diese Praxis zu unterbinden, verkleinerten in Niederzimmern zwischen 1952 und 1956 insgesamt 16 Bauern ihre Nutzfläche im Durchschnitt um zwei bis drei Hektar. Je größer die Betriebe waren, desto eher versuchten ihre Besitzer, Land abzugeben, um so in die nächstniedrigere Größenklasse zu gelangen. Von den sieben »Großbetrieben« verringerten vier Betriebe ihre Nutzfläche, von den 46 Mittelbauern acht und den insgesamt noch 45 erhaltenen Kleinbetrieben unter 5 ha weitere vier. N u r drei Betriebe stockten ihre Fläche geringfügig um 1,5 bis 3 ha auf, ohne allerdings in die nächsthöhere Größenklasse zu gelangen.142 Wie ein Zeitzeuge schilderte, konnten sie ihre Flächen verringern, indem sie die zugepachteten Felder zurückgaben: »Dann haben die ganzen Leute, die Acker gepachtet hatten, alle hingeschmissen, weil die Ablieferung so hoch war. Die Verpächter mußten ihr Land wieder zurücknehmen, Dies zeigen die Auflösungen von LPGs in den fünfziger Jahren. Diese betrafen überwiegend Genossenschaften, in denen sich vorwiegend ehemalige Einzelbauern auf Grund ihrer ökonomischen Bedrängnis zusammengeschlossen hatten (Thür. HStA Weimar, Bezirkstag L 176). Für die Neubauern hingegen, die das ihnen ab 1946 zugewiesene Land erst seit wenigen Jahren besaßen, spielten diese traditionellen Bindungen eine weit geringere Rolle. Für viele, die ihren Betrieb nur unter größten ökonomischen Problemen bewirtschaften konnten, bedeutete die Mitgliedschaft in der LPG eine Verbesserung ihrer Lage. Auch für die Landarbeiter, die zuvor in bäuerlichen Privatbetrieben fur oft geringe Löhne hart gearbeitet hatten, erwies sich die Alternative der LPG-Mitgliedschaft als vorteilhaft. 142 Die Flächenreduktionen wurden errechnet durch den Vergleich der beiden Betriebszählungen von 1952 und 1956, die die LNF eines jeden Besitzers über 1 ha Betriebsfläche auflisten. Für die Jahre zwischen 1956 und 1960 liegen keine Angaben vor. 1952: Gemeindearchiv Niederzimmern Β 77; 1956: KA Weimar, Rat des Kreises 627.
140
nur die Kirche hat es nicht zurückgenommen und die anderen, die dazu nicht in der Lage waren, weil sie in Erfurt oder Weimar wohnten. Alles dies ging dann auch an die OLB und dann in die LPG. Die Leute bekamen jedoch dafür keine Pacht, gar nichts bekamen sie dafür.«143 Eine weitere Möglichkeit, die Fläche zu verkleinern, war die Überschreibung einiger Hektar an den mitarbeitenden Hofnachfolger, so daß offiziell zwei Betriebe geführt wurden. Davon machtenjedoch nur wenige Betriebe Gebrauch, da dies einer behördlichen Genehmigung bedurfte, die nur in Ausnahmefällen erteilt wurde. Die Reduktion von Flächen entsprach während der fünfziger Jahre einem ostdeutschen Trend. Darauf deutet auch die bereits in Tabelle 12a dargestellte Zunahme der Kleinbetriebe von 0,5 bis 5 ha zwischen 1952 und 1956 hin sowie die Verringerung der Zahl der größeren Betriebe. 144 U m unter den ungünstigen Ausgangsvoraussetzungen der fünfziger Jahre einen landwirtschaftlichen Betrieb noch erfolgreich und gewinnbringend bewirtschaften zu können, war die Verfügbarkeit über genügend familieneigene Arbeitskräfte, die die Betriebsausgaben in Grenzen hielten, und ein ausgeprägtes Rentabilitätsdenken notwendig. Die Landwirte, die ein Fingerspitzengefühl dafür besaßen, wo zwischen den fast allumfassenden Reglementierungen noch Platz für Eigeninitiative war, konnten sich bis 1960 mit wirtschaftlichem Erfolg behaupten. Dies zeigt das Beispiel zweier Betriebe der Untersuchungsgemeinde. Beide, jeweils 25 und 15 ha groß, wurden von jüngeren, gut ausgebildeten Landwirten geleitet, denen es gelang, Gewinne zu erwirtschaften. Sie setzten dabei auf Bewirtschaftungsmethoden, die auf Rentabilität ausgerichtet waren, wie die Intensivierung durch systematisches Düngen, die Verbesserung der Futtererzeugung durch Silage und die Spezialisierung auf Produkte, mit denen hohe Einkommen erzielt werden konnten. 145 Obwohl der befragte »Großbauer« hohe Ablieferungsleistungen zu erbringen hatte, gelang es ihm, gewinnbringend zu wirtschaften: »Ich hatte mich gleich auf Schweine eingestellt. Mit Getreide war auch mit freien Spitzen nicht viel zu machen, da mußte man schon veredeln und mußte es in die Schweine reinstecken, alles andere war nicht lohnend. Ich hatte auch noch Zuckerrübenanbau.
143 Zeitzeugeninterview N z 2. Seine Aussage wird durch zahlreiche Dokumente über Verhandlungen über die Rückgabe von Pachtland bestätigt. Gemeindearchiv Niederzimmern Β 81. 144 Vgl. Kapitel II. 2.1.1. 145 Besonders anschaulich zeigt sich das Leitbild des rentablen Wirtschaftens bei einem Zeitzeugen, wenn er noch immer voller Respekt über seinen Berufsschullehrer berichtet: »In der Berufsschule hatten wir einen tüchtigen Lehrer, der war in Erfurt Landwirtschaftsschuldirektor gewesen. Der sagte uns: >Also, Jungs, horcht zu: bei der Milch, da machen wir, wenn wir Rüben füttern 30001, das geht ohne Kraftfutter. U n d wenn ihr dann mehr machen wollt, dann müßt ihr Kraftfutter zugeben. M a n muß aber zuerst ausrechnen, was das Kraftfutter im Z u k a u f kostet, und wenn das sich nicht rentiert, dann müßt ihr die Finger davon lassen.< Wenn ich mehr ausgebe, wie ich einnehme, dann ist das Gefalle noch viel schlimmer« (Zeitzeugeninterview N z 2).
141
Die Blätter der Rüben kamen in die Silos. Das war der Motor für die Milch bei uns. So habe ich mein Soll geschafft. Mir hat das Wasser nicht am Hals gestanden. ... Bis ich aufgehört habe, habe ich einen ganz guten Verdienst gehabt. Jedenfalls habe ich mehr verdient als in der LPG in den ersten Jahren. Wenn man als einzelner hinterher ist, dann kommt immer mehr raus. Ich will jetzt über niemanden Dreck schippen, aber wenn es Betriebe gab, die finanziell schlecht standen, so waren es die, die extensiv gewirtschaftet haben. Die haben dann '58 das Handtuch geschmissen. Die wollten dann nicht genug düngen, weil es Geld kostete und machten dies auch nicht mit System. Die kamen nicht in den Genuß vom freien Aufkauf, weil sie nicht investierten. Man mußte auch wissen, womit man viel Geld machen konnte. Ich habe einem geraten, Grassamen zu vermehren, der wußte nicht, daß das viel Geld brachte. Bei manchen lag ihre schlechte Lage aber auch an der ungünstigen Klassifizierung. Wenn man gerade noch in die höhere Ablieferungsklasse eingruppiert war, dann hatte man natürlich ungünstige Pflichtablieferungen.«146 Der Zeitzeuge besaß eine fundierte landwirtschaftliche Ausbildung. Seine Lehrzeit hatte er in einem nach modernen Methoden wirtschaftenden landwirtschaftlichen Großbetrieb außerhalb der eigenen Gemeinde verbracht und besaß so gute fachliche Voraussetzungen für eine moderne Betriebsführung. Anzumerken ist jedoch, daß Betriebsstrategien wie die Spezialisierung auf bestimmte Produkte immer nur partiell verwirklicht werden konnten, da die Bauern zu einer vielfältigen Produktion, die zahlreiche pflanzliche und tierische Produkte umfaßte, verpflichtet waren. Der befragte Landwirt wies darauf hin, daß die Bauern durch geschickte Tauschgeschäfte untereinander versuchten, eigene Defizite auszugleichen, u m so die Ablieferung für jedes Produkt möglichst erfüllen zu können: »Viele kamen zu mir und wollten ein Schwein oder einen Läufer. Ich sagte: >Aber dann mußt du mir Getreide geben, sonst kriegst du nichts.«< Beide Betriebe verfügten aber auch über eine ausreichende Zahl von Arbeitskräften. Der Mittelbauer bewirtschaftete seinen H o f mit seiner Frau und den bereits erwachsenen Kindern - eine familiäre Situation, die sich als so günstig erwies, daß familienfremde Arbeitskräfte nur zeitweise erforderlich waren: »Wir hatten keine ständigen Arbeitskräfte auf dem Hof, nur Saisonarbeitskräfte. Meist waren es Frauen aus dem Dorf, die bei der Ernte halfen. Die hatten auch noch ein Stück Acker, das wir dann mitgemacht haben. Das gab es auch schon vor dem Krieg. Es waren immer die gleichen Familien, die sich ausgeholfen haben. Es wurden zwischen Nachbarn auch mal Geräte ausgetauscht. Das wurde aber nicht mit allen gemacht. Das hing von der gegenseitigen Sympathie ab, so könnte man sagen.«147
146 Ebd. Aussagen zum relativen Erfolg der Methoden moderner Betriebsfuhrung liegen auch vom Zeitzeugen N z 1 vor. Dieser war vor allem durch die gewinnbringende Saatgutvermehrung erfolgreich. 147 Zeitzeugeninterview N z 1.
142
Diese Aussage zeigt, daß auch in den fünfziger Jahren noch traditionelle reziproke Arbeitsbeziehungen zwischen Betrieben unterschiedlicher Größe verbreitet waren, durch die der Austausch von Dienstleistungen organisiert wurde. Diesen gewachsenen Beziehungen gaben die Bauern den Vorzug vor der administrativ organisierten »gegenseitigen Hilfe« durch Arbeitsgemeinschaften: »Die gegenseitige Hilfe, die die VdgB organisiert hat, war dabei nicht von Bedeutung. Da ist man lieber zum Nachbarn gegangen und hat gefragt: >Hilfst du nicht einmal mit?Sag mir, für was haben wir gearbeitete Wenn man mal ein schlechtes Jahr hatte und nicht genug abgeliefert hatte, so durfte man auch nicht schlachten. Man kriegte dann nur ein Gnadenschwein im Jahr. Das reichte dann meist nicht aus für die Familie.«159
Ihre Erbitterung darüber, durch die Behörden bevormundet zu werden, kommt besonders plastisch in der von allen Befragten geäußerten Empörung zum Ausdruck, daß bei Ablieferungsschwierigkeiten nur ein Schwein pro Jahr, das sogenannte »Gnadenschwein«, geschlachtet werden durfte. In dieser Regelung, die die Ernährungslage einer großen bäuerlichen Familie empfindlich einschränken konnte, schien sich für die Betroffenen die Unerträglichkeit der staatlichen Maßnahmen in besonderem Maße zu bündeln, denn sie sahen sich sogar der Zugriffsmöglichkeit über die von ihnen selbst erzeugten, lebensnotwendigen Produkte beraubt. Die Widerstandskraft gegen die LPG war bei den selbständigen Bauern auch geschwächt worden, als 1958/59 einige große und mittlere Betriebe kapituliert und sich zu einer LPG vom Typ I zusammengeschlossen hatten. Angesichts der sich kontinuierlich verschlechternden Situation in den Vorjahren ist nachvollziehbar, warum es 1960 nur noch einer kurzen Phase des massiven Drucks und der Drohgebärden bedurfte, um die Bauern zur Kollektivierung zu bewegen. Die relativ rasche Kapitulation der 159 Zeitzeugeninterview Nz 2. Auch wenn die genannte Summe ist nicht überprüfbar ist, waren zweifellos besonders die größeren Bauern mit sehr hohen Steuern belastet (vgl. dazu Kap.
II.l.l.). 147
Bauern während der im Frühjahr 1960 durchgeführten Kollektivierungskampagne war eine erzwungene Anpassung. Die Weigerung, einer LPG beizutreten, hätte nicht nur fatale Folgen für die Ökonomie des Privatbetriebs gehabt, sondern wäre offener Opposition gleichgekommen - ein Verhalten, das staatliche Repressionsmaßnahmen nach sich gezogen hätte.160 Wie reagierten die zum Beitritt zu den Genossenschaften genötigten Bauern, und wie schnell waren sie bereit, sich mit der neuen Situation zu arrangieren? Die unmittelbare Reaktion auf den massiven Kollektivierungsdruck im Frühjahr 1960 schilderte ein Zeitzeuge: »Andere Bauern kamen dann abends hierher zu uns. Da haben sich die Leute besprochen und jeder merkte, daß ihm nichts anderes übrig blieb. Wir haben uns dann gesagt: (Komm, besser wir machen zusammen, als daß wir in Typ III gehen.< Dann war da natürlich auch ein bißchen der Bauernstolz bei jedem. Man muß sich ja auch überlegen, daß das alles nicht so einfach war, wenn ich immer selbständig war, und nachher muß ich mich allen anderen fügen. Das mußte man zwar in Typ I auch, aber doch nicht in dem Maße wie dort. Bei uns wurde immer noch ein bißchen gemeinschaftlich abgesprochen. U n d in Typ III war es die reinste Befehlsausgabe. ... Dann 1960 wollte der Staat die »Grammetal« mit in die III haben, und, um dem aus dem Wege zu gehen, sind noch sechs bis acht von den Neuerwerbungen mit in die »Grammetal« gegangen, damit die weiter existieren konnte. Meistens waren es die [Bauern], bei denen sie [die Werber] am härtesten zu kämpfen hatten. Andere wollten wieder auf keinen Fall in die »Grammetal« und haben dann die »Frohe Zukunft« gegründet. Bei über 100 Betrieben in Niederzimmern gab es halt unterschiedliche Meinungen, da konnte nicht jeder mit jedem.« 161
Im Frühjahr 1960 schlossen sich 20 Betriebe den beiden LPGs vom Typ I an. Die LPG »Frohe Zukunft« umfaßte insgesamt 31 Mitglieder und bewirtschaftete 150 ha, die LPG »Grammetal« hatte 28 Mitglieder und eine Fläche von 170 ha. Wenn schon die LPG-Mitgliedschaft als unumgänglich akzeptiert werden mußte, versuchten diese Bauern doch so weit wie möglich, ihre Eigenständigkeit zu erhalten. Sofern sie über die betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen verfügten, bevorzugten die größeren und mittleren Bauern die LPG vom Typ I: »Die stabilsten Betriebe, die gingen in Typ I oder die, die gut mit Arbeitskräften besetzt waren.«162 Das geschilderte Verhalten der Niederzimmerner Bauern war typisch für ihre Standesgenossen. Wie bereits dargestellt, vervierfachte sich die Anzahl der LPG vom Typ I in der D D R zwischen 1958 und 1960, was darauf
160 Während Osmond über vielfältige Symptome des Protests im Zusammenhang mit der zwangsweisen Kollektivierung berichtet - beispielsweise wurden vielerorts Gründungsversammlungen gestört oder boykottiert, Plakate abgerissen oder LPG-Gebäude in Brand gesetzt - , sind für Niederzimmern keine derartigen Vorfälle bekannt. Vgl. dazu: Osmond, Kontinuität, S. 155ff. 161 Zeitzeugeninterview N z 1. 162 Zeitzeugeninterview N z 2.
148
hinweist, daß die gezwungenermaßen kollektivierten Bauern bevorzugt diese Art der Genossenschaft gründeten. 163 Wie schon erwähnt, distanzierten sich in Niederzimmern auf diese Weise die größeren und mittleren Bauern von den ehemaligen Industrie- und Landarbeitern, die während der fünfziger Jahre in der LPG Typ III zwar die wichtigsten Funktionen eingenommen, jedoch auf der sozialen Stufenleiter der traditionellen Dorfgesellschaft weit unten gestanden hatten.164 Die zitierte Interviewpassage dokumentiert ferner, daß für viele Bauern eine Unterordnung unter deren Führung inakzeptabel war. Mit ihrer Entscheidung für die LPG vom Typ I hatten die alteingesessenen Bauern sichergestellt, unter ihresgleichen zu bleiben. Indem sie eine zweite LPG dieses Typs in der Gemeinde gründeten, behielten sie einen Teil ihrer Entscheidungsfreiheit, denn auf diese Weise war es eher möglich, sich auszusuchen, mit wem man genossenschaftlich zusammenarbeiten wollte. Da die Behörden bisher kaum der Gründung mehrerer LPGs an einem Ort zugestimmt hatten, kann diese Neugründung und der Erhalt der beiden anderen LPGs durchaus als eine erfolgreiche Verteidigung der bäuerlichen Interessen bewertet werden. Allerdings war es in der Zeit des Umbruchs, als die Behörden ausschließlich das Ziel verfolgten, die Kollektivierung so schnell wie möglich abzuschließen, einfacher, Zugeständnisse zu erhalten.165 Obwohl die Behörden die Genossenschaften in Niederzimmern verstärkt seit Mitte der sechziger Jahre zum Zusammenschluß drängten, gelang es den Beteiligten, die drei Produktionsgenossenschaften bis 1969 als eigenständige Betriebe zu erhalten.166 In ihrer Beharrung auf den Bestand der eigenen LPG und ihrer Weigerung, sich der LPG Typ III anzuschließen, entzogen sich die Bauern der beiden LPGs vom Typ I noch bis Ende der sechziger Jahre soweit wie möglich dem staatlich initiierten Umbruch ihrer Lebenswelt. Z u m Ausdruck kommt darin auch ihre konservierte Wertschätzung der bäuerlichen Eigenständigkeit. Allerdings war es in den Folgejahren kaum möglich, sich einer schrittweisen Zusammenarbeit zu entziehen, auch wenn beide LPGs
163 Vgl. Tab. 15, Kap II.2.1.2. 164 Die Weigerung der größeren und mittleren Bauern, mit Klein- und Neubauern, Landund Industriearbeitern in einer LPG zusammenzuarbeiten, ist in den Bezirksakten Erfurt auch für andere Gemeinden mehrfach nachgewiesen. Siehe: Thür. HStA. Weimar, Bezirkstag L 562. Die Aufrechterhaltung sozialer Differenzen innerhalb der LPGs bestätigte auch Osmond, Kontinuität, S. 158. 165 Wie Schulz (Kapitalistische Länder, S. 38) zeigte, war es üblich, daß die Werbekommissionen und Instrukteure den Bauern 1960 unrealistische Versprechungen machten, um diese zum Genossenschaftseintritt zu bewegen, wie z.B. die erst spätere Aufnahme genossenschaftlicher Arbeit und die Möglichkeit des späteren Austritts. 166 So kritisierte der Rat der Gemeinde 1965, daß bei den Jahresabschlußversammlungen der beiden LPGs die Frage des Zusammenschlusses nicht einmal erwähnt worden sei. U m eine solche Diskussion in Gang zu bringen, wurden die Räte zu Versammlungen der LPGs geschickt. Gemeindearchiv Niederzimmern Β 27.
149
Typ I ihre Weiterexistenz zunächst noch sichern konnten. Ab 1965/66 wurde zwischen den drei LPGs in Niederzimmern und zwei weiteren aus dem Nachbarort ein Kooperationsvertrag abgeschlossen, der vorsah, die Feldarbeiten gemeinsam zu verrichten. 1969 blieb nach der Darstellung der Zeitzeugen für die Bauern der LPGs vom Typ I keine andere Wahl als der Zusammenschluß. 167 Einerseits drängten die Behörden immer nachdrücklicher darauf, andererseits standen den Bauern durch die Abwanderung ihrer Nachfolger aus der Landwirtschaft kaum mehr genügend Arbeitskräfte zur Verfügung, um die individuelle Viehwirtschaft aufrecht zu erhalten. Mit dem Zusammenschluß wurde zugleich der Aufbau eines spezialisierten, genossenschaftlichen Großbetriebs eingeleitet, indem Kooperationsvereinbarungen mit LPGs aus fünf umliegenden Gemeinden getroffen wurden. Bereits 1971 vereinigten alle beteiligten LPGs ihre Feldwirtschaft zu einem Betrieb und vollzogen damit die Trennung von Tier- und Pflanzenproduktion. Der Ubergang zu dorfübergreifenden Großbetrieben war politisch gewollt und entsprach nicht den Wünschen der Mitglieder.168 1960 hatten sich 41 Betriebe für die LPG »Ernst Goldenbaum« entschieden, die damit auf eine Größe von 640 ha gewachsen war und 154 Mitglieder umfaßte. Der größte Teil der Neueingetretenen zählte zu den Besitzern kleinerer Betriebe; 35 bewirtschafteten weniger als zehn Hektar. Wie bereits erwähnt, brachte die Mitgliedschaft in der LPG vom Typ III für die Kleinbetriebe Vorteile. Aber auch sechs der größeren und mittleren Bauern zogen 1960 diesen Typ vor. Einen Einblick in seine Motive gibt ein Zeitzeuge, der mit seinen 25 Hektar als »Großbauer« galt: » M e i n e F r a u w a r l e i d e n d , sie w a r i m K r a n k e n h a u s , u n d es w u r d e n i c h t b e s s e r . D i e K i n d e r w a r e n n o c h klein. D a h a b e i c h d a m a l s g e s a g t : >Also 2 5 H e k t a r A c k e r l a n d u n d n o c h z w e i H e k t a r W a l d u n d e i n k r a n k e F r a u u n d in d i e T y p I g e h e n , d a s w i r d nichts.( D e n n d i e L e u t e g i n g e n d a n n a u c h w e g , die ich hatte. A l s o in d e m M o m e n t , w e n n e i n e m d i e A r b e i t ü b e r d e n K o p f w ä c h s t u n d m a n n i c h t w e i ß , w o h i n t e n u n d v o r n e ist, d a s f ü h r t z u n i c h t s G u t e m . S o b i n ich in die T y p III g e g a n g e n . « 1 6 9
Auch zwei weitere größere Betriebe schlossen sich 1960 der Genossenschaft vom Typ III an, da sie ebenfalls nicht genügend Arbeitskräfte für eine weiterhin privat betriebene Viehwirtschaft hatten.170
167 Zeitzeugeninterviews N z 1, N z 2. 168 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 27, Β 29, Ortschronik. 169 Zeitzeugeninterview N z 2. Eine solche Motivation wurde auch von anderen Zeitzeugen bestätigt: »Es sind natürlich auch größere und mittlere Bauern in die Typ III gegangen, aber das lag daran, daß die oft nicht mehr die Arbeitskräfte hatten, weil dieja auch mit in die L P G gingen. Wenn dann die Arbeit überhand nimmt und das Geld nicht einmal stimmt und es nachher noch zu Hause Unzufriedenheit in der Familie gab, da haben sich eben viele von den größeren gesagt: >Ehe ich mir jetzt noch einmal die Arbeit aufhalse, da gehe ich eben in Typ III«< (Zeitzeugeninterview N z 1).
150
Viele der neuen Mitglieder der LPG vom Typ III weigerten sich zunächst zu kooperieren. Auf den als erzwungen empfundenen Beitritt 1960 reagierten viele Bauern mit einer Strategie der Verweigerung, indem sie das Inventar, das sie einzubringen hatten, zurückhielten, wie aus einem Bericht über die Vollversammlungen der drei LPGs der Gemeinde hervorgeht: »Es dürfte falsch sein zu glauben, daß mit dem Eintritt der Bauern in eine Genossenschaft auch gleich das genossenschaftliche Denken und Handeln einsetzen würde. In besonders krassem Maße zeigt sich dies bei der Festlegung der Hektarbeiträge, insbesondere der Einbringung des d e m 100-ha-Besatz entsprechendem Viehbesatzes. Es könnte sonst nicht v o r k o m m e n , daß ein Betrieb von 14 ha keine Schweine einbrachte. S o waren es noch viele große und kleine Betriebe, die nur wenige oder gar keine Schweine und Rinder einbrachten, eine Handlung, die dazu beitrug, daß der Wert der Arbeitseinheit im Jahre 1960 weit abgesenkt wurde.« 1 7 1
Besonders ältere Bauern aber waren auch in der Folgezeit kaum mehr bereit, sich umzustellen und arrangierten sich mit ihrer neuen Rolle nur soweit, wie es unbedingt erforderlich war. Das durch einen Zeitzeugen mitgeteilte Beispiel veranschaulicht dies: »Mein Nachbar, der war schon etwas älter, der vertrat damals die Devise: D i e Zeit ist zu kurz, u m sich noch zu streiten mit solchen Leuten. D e r hat morgens Futter gefahren und Stroh und ist dann wieder heimgegangen, der hat sich u m nichts weiter gekümmert. D e r hat gesagt, meine Zeit ist abgelaufen.... Das U m d e n k e n von Ich aufWir ging nicht sehr schnell.« 172
Ein Bericht der Parteiorganisation der S E D in der LPG »Ernst Goldenbaum« von 1963 weist ebenfalls daraufhin, daß die Vorbehalte der Bauern gegen die LPG und die mangelnde Bereitschaft, sich für deren Aufbau einzusetzen, nur langsam abzubauen waren: »Trotzdem gibt es noch Unklarheiten, die sich h e m m e n d auf die weitere politische und ökonomische Entwicklung auswirken. Sie bestehen darin, daß ein Teil der Genossen-
170 In einem 33-Hektar-Betrieb war der Betriebsinhaber gestorben, so daß seine beiden unverheirateten Töchter den Hof alleine hätten bewirtschaften müssen: »Als mein Vater gestorben war, da waren meine Schwester und ich alleine. Wir sind dann in die Typ III, weil mit der ganzen Viehwirtschaft, das war nicht mehr zu schaffen« (Zeitzeugeninterview N z 4). Bei einem 20-Hektar-Betrieb waren außer dem bereits älteren Inhaberehepaar keine anderen Arbeitskräfte vorhanden, da die erwachsenen Kinder in die Bundesrepublik abgewandert waren (Gemeindearchiv Niederzimmern Β 88). 171 Vgl. Gemeindearchiv Niederzimmern Β 87. Die Aussage eines Zeitzeugen bestätigt dies: »Was die Leute als lebendes Inventar einbrachten, damit kamen jedenfalls keine Sauen hinein. Erstmal behielt jeder solches Vieh für sich. Das war ja schon vorprogrammiert, man machte noch Hausschlachtungen und verkaufte, was noch Geld brachte« (Zeitzeugeninterview N z 2). Diese Praxis, den Viehbestand möglichst nicht in die LPG einzubringen, war allgemein verbreitet, wie Berichte der Bezirksbehörden zeigen. Thür. HStA Weimar, Bezirkstag L 181. 172 Zeitzeugeninterview N z 2.
151
schaftsbäuerinnen und -bauern noch nicht von der Gesetzmäßigkeit des Sieges des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik und des Vorteils der sozialistischen Großproduktion in der Landwirtschaft überzeugt sind; ... daß einzelne Genossenschaftsmitglieder die alten überlebten Auffassungen noch nicht vollständig überwunden haben und durch Egoismus und Spekulation ihr Schritt vom Ich zum Wir erschwert wird.... Das drückt sich ... zum Teil in schlechter Arbeitsmoral und Disziplin ... aus.«173 A u c h in d e n L P G s v o m Typ I verlief die D u r c h s e t z u n g der genossenschaftlic h e n Arbeitsweise zunächst n i c h t o h n e P r o b l e m e . So w u r d e in e i n e m Bericht ü b e r eine V o l l v e r s a m m l u n g der G e n o s s e n s c h a f t e n N i e d e r z i m m e r n s kritisiert: »Gleiche Tendenzen zeigten sich bei den neuen Mitgliedern des Typs I, die da glaubten, noch im gleichen Jahr ihre Ernte persönlich einbringen zu sollen und erst mit den Arbeiten für das Jahr 1961 mit der genossenschaftlichen Arbeit beginnen zu können. Erfreulich ist, daß mit dem Beginn der Arbeiten für das neue Wirtschaftsjahr 1961, beginnend mit der Herbstbestellung 1960, die genossenschaftliche Arbeit einsetzte.«174 Infolge der unfreiwilligen Kollektivierung 1960 u n d der f e h l e n d e n U b e r z e u g u n g der B a u e r n w a r e n viele L P G s zunächst instabil, da Mitglieder rasch w i e der austraten u n d Leitungspositionen n u r u n g e n ü g e n d besetzt u n d k a u m arbeitsfähig w a r e n . D a f ü r die G e n o s s e n s c h a f t e n der U n t e r s u c h u n g s g e m e i n d e keine e n t s p r e c h e n d e n I n f o r m a t i o n e n vorliegen, j e d o c h n i c h t ausgeschlossen w i r d , daß sich 1960 a u c h d o r t ähnliche Vorfälle abspielten, w i r d hier stellvertretend ein Bericht ü b e r die Lage i m Bezirk E r f u r t 1960 zitiert: »Ernste Anzeichen einer ungenügenden politischen Klarheit kam in einer Reihe von Austrittserscheinungen und Funktionsniederlegungen zum Ausdruck. In den Kreisen des Bezirks wurden insgesamt 672 Austrittserklärungen abgegeben.... So erklärten ζ. B. 17 Mitglieder der LPG »Salza« in Nagelstädt ihren Austritt mit der Begründung, daß sie eine derartig schlechte Arbeit in der LPG nicht verantworten könnten. Dabei handelte es sich hier um gute erfahrene Bauern mit hoher Arbeitsmoral. ... Die Tendenzen der Funktionsniederlegungen sind in den Kreisen unterschiedlich aufgetreten.... Die Ana173 Gemeindearchiv N i e d e r z i m m e r n Β 25. Eine Studie über die Verhältnisse in der M a g d e burger Börde (Räch, Lebensweise, S. 96) zeigt, daß das Problem des fehlenden Engagements neuer Genossenschaftsbauern allgemein verbreitet war. D i e n o c h in der D D R entstandene Studie betont j e d o c h , daß diese H a l t u n g binnen weniger Jahre durch Aufklärungsarbeit verändert w u r d e und die Bauern rasch ein ausgeprägtes Verantwortungsbewußtsein entwickelten. 174 Gemeindearchiv N i e d e r z i m m e r n Β 87. Das möglichst lange Hinauszögern der g e n o s s e n schaftlichen Arbeit in N i e d e r z i m m e r n 1960/61 war keine A u s n a h m e , w i e zahlreiche Berichte über andere LPGs des Bezirks Erfurt zeigen. Thür. H S t A Weimar, Bezirkstag L 562. Das Problem der D u r c h s e t z u n g der sozialistischen Arbeitsorganisation war bereits seit B e g i n n der Genossenschaftsb e w e g u n g T h e m a der Berichterstattung der staatlichen Aufsichtsbehörden der Kreis- und Bezirksverwaltungen. Es bestand der Anspruch, daß die LPG sich streng an die Prinzipien der Brigadearbeit und des Arbeitsnormensystems zu halten hätten. Thür. H S t A Weimar, Bezirkstag L 555, Vs.St. 314.
152
Iyse dieser Erscheinungen zeigte, daß die ungenügende Unterstützung der Vorstände durch die Mitglieder zu einer Unzufriedenheit der Funktionäre geführt hat. So haben [einige LPG] monatelang überhaupt keine arbeitsfähigen Vorstände gehabt, weil sich kein Mitglied zur Mitarbeit bereit erklärte.«175
In Niederzimmern erwies sich das Verhältnis zwischen den altgedienten Genossenschaftsmitgliedern und den neu eingetretenen in der LPG Typ III nach den Schilderungen eines Zeitzeugen, zumindest nach der Durchsetzung der Vollkollektivierung, als äußerst konfliktträchtig: »1960 war die Stimmung zwischen den Neueingetretenen und denen, die schon länger dabei waren, wie zwischen Ossis und Wessis jetzt. Da gab es welche, die schon länger da waren, die wollten das Kommando haben. Damit sich die Sache ein bißchen entspannte, hatten wir zwei Feldbaubrigaden, eine mit alten und eine mit neuen Mitgliedern.«176
In dieser Konfliktsituation spiegelt sich nicht nur die Erbitterung der neuen Mitglieder über den Verlust ihrer Selbständigkeit, sondern sie zeigt auch, daß sich die alteingesessenen Bauern von den aus der Industrie- oder Landarbeiterschaft stammenden LPG-Mitgliedern sozial distanzierten. Bäuerliches Standesbewußtsein prallte hier auf das gewachsene Selbstbewußtsein der früh eingetretenen Genossenschaftsbauern, die nach der sozialistischen Ideologie die Avantgarde der neuen ländlichen Gesellschaft darstellten. Das bäuerliche Standesbewußtsein konnte in der LPG kaum mehr durch eine ökonomische oder gesellschaftliche Vorrangstellung legitimiert werden. In der Folgezeit entstand für die Bauern daher ein Anpassungsdruck, der ihrem Standesdenken und den damit verbundenen Abgrenzungsmechanismen entgegenwirkte. Verhaltensweisen, die eine soziale Distanzierung allzu deutlich zum Ausdruck brachten, wurden nicht nur politisch sanktioniert, sondern auch durch die gegenseitige Kontrolle unterdrückt. Auch wenn das bäuerliche Standesbewußtsein im alltäglichen Umgang keine wichtige Rolle mehr gespielt haben dürfte, erscheint es dennoch unwahrscheinlich, daß es mit dem Eintritt in die LPG vollkommen verschwand, denn es hatte die Mentalität der Bauern lange geprägt. Ein Vorfall, der sich 1964 in der Gemeinde ereignete, weist daraufhin. Der Sohn eines
175 Thür. HStA Weimar, Bezirkstag L 562. Die Austrittserklärungen wurden von den Behörden jedoch nicht akzeptiert. Vgl. dazu auch Osmond, Kontinuität, S. 161ÍT. 176 Zeitzeugeninterview N z 2. Die anfänglich konfliktgeladene Situation bestätigte auch der damalige Vorsitzende der Genossenschaft. Er äußerte sich zu diesem Thema jedoch nur sehr vorsichtig und stellte die Streitigkeiten als harmlos und schnell behoben dar: »Es gab anfangs schon Probleme, aber die Leute haben sich mit der Zeit schon zusammengelebt. Die haben ihre Arbeit getan, sie wollten ja auch was verdienen. Es wurde schon kritisiert, und durch viele Aussprachen wurden dann die Streitigkeiten beseitigt« (Zeitzeugeninterview N z 3). Die Behauptung, daß das Einvernehmen schnell wiederhergestellt worden sei, spiegelt die Perspektive eines Funktionärs, der damit seine eigene Autorität verteidigte. Die Formulierung »durch viele Aussprachen wurden dann die Streitigkeiten beseitigt« entspricht einer typischen Redewendung im Sprachgebrauch von Parteifunktionären, die unerwünschte Mißstände zu verschleiern suchten.
153
größeren Bauern beschimpfte die Traktoristen der LPG als »Knechte« - eine Anspielung aufderen früheren Status, die sanktioniertwurde.177 Auch bei meiner Feldforschung in Niederzimmern 1993 erfuhr ich, daß sich bis heute Rudimente des alten bäuerlichen Standesbewußtseins erhalten haben. U m einzelne bäuerliche Familien der Gemeinde, von denen im Interview die Rede war, näher zu beschreiben und zu unterscheiden, bezogen sich die Gesprächspartner in der Regel auf deren frühere Besitzgröße und den daran geknüpften Sozialstatus. Dies deutet darauf hin, daß es die sozialistische Landwirtschaft über 30 Jahre lang nicht erreicht hatte, die sozialen Differenzierungen vollständig einzuebnen. Auseinandersetzungen entstanden in den Genossenschaften offenbar auch über die gerechte Verteilung der Arbeit, wie die Ausführung eines Genossenschaftsbauern indirekt andeutet: »Die Verantwortung der Einzelnen für die Genossenschaft war unterschiedlich. Wir hatten gute Leute drunter, die hat es auch schon als Einzelbauern gegeben, und wir haben welche gehabt, die wir ewig im Schlepptau hatten.« 178
Streitigkeiten unter den LPG-Mitgliedern waren ein dauerhaftes Problem. Dafür spricht, daß 1962 in der LPG »Ernst Goldenbaum« eine Schiedskommission eingerichtet wurde, um derartige Konflikte zu lösen.179 Bereits in den fünfziger Jahren war das Verhältnis der LPG-Mitglieder in Niederzimmern spannungsreich, wie eine Aktennotiz der Kreisbehörden von 1957 beweist: »Der Vorstand stellt sich die Aufgabe, das Verhältnis der Mitglieder untereinander zu verbessern«.180 Auch das Verhältnis zwischen der LPG-Leitung und den LPG-Mitgliedern war von Anfang an konfliktträchtig. Davon zeugen nicht nur die zahlreichen Austritte und Ausschlüsse von Mitgliedern in der Aufbauphase der Genossenschaft seit Mitte der fünfziger Jahre, sondern auch ein Diskussionsbeitrag des Vorsitzenden der LPG »Ernst Goldenbaum« auf der MTS-Bezirkskonferenz im Dezember 1956: »durch die N e u a u f n a h m e von Mitgliedern, die aus der Landwirtschaft kamen, sind verschiedene Probleme an uns herangetreten, mit denen wir einen schweren K a m p f zu fuhren hatten. Einige von den werktätigen Bauern, die früher von frühmorgens bis spätabends gewühlt haben, bestanden jetzt auf den 8-Stundentag in der Genossenschaft. Gegen diese Machenschaften greifen wir streng durch.« 1 8 1
177 Beurteilung durch das Wehrkreiskommando Weimar 1964, Gemeindearchiv Niederzimmern Β 89. 178 Zeitzeugeninterview N z 2. 179 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 87. Zu dieser Maßnahme waren ab 1963 alle LPGs verpflichtet. 180 KA Weimar, Rat des Kreises 1212. 181 KA Weimar, Rat des Kreises 792.
154
In dieser Rede, in der das strenge Durchgreifen eingefordert wird, offenbart sich die hierarchische Befehlsstruktur in der LPG vom Typ III. Für Mitspracherechte der einzelnen Mitglieder, die in den Statuten festgelegt waren, blieb nur wenig Raum, zumindest dann, wenn Kritik oder Vorschläge nicht der vorgegebenen Linie entsprachen. Offenbar akzeptierten die LPG-Mitglieder die Befehlsstrukturen in der Genossenschaft nicht immer widerspruchslos. Ein Beteiligter umschrieb seine Erfahrung so: »Anfangs fiel es mir schwer, mich unterzuordnen. Da ist man schon mit denen, die jetzt kommandieren wollten, zusammengeeckt.«182 Auch der damalige Vorsitzende deutete dies an: »Es gab auch mal Kritik von den Mitgliedern. Ich oder die Brigadiere, wir mußten dann die H a r m o n i e wieder herstellen, daß das nicht noch giftiger wurde. U n d wenn einer was gesagt hat und dann vielleicht merkte, daß er nicht ganz Recht hatte, dann hat er das ergänzt oder widerrufen.« 1 8 3
Es ist nicht anzunehmen, daß Konflikte zwischen den LPG-Mitgliedern und den Leitungskadern so reibungslos beigelegt werden konnten, wie der damalige LPG-Vorsitzende behauptete. Seine Formulierung verweist vielmehr auf eine funktionärstypische, euphemistische Umschreibung von Zwangsmaßnahmen. Die hierarchischen Befehlsstrukturen waren in den LPGs vom Typ I der Gemeinde weniger stark ausgeprägt als in der LPG vom Typ III. Durch ihre geringen Mitgliederzahlen und ihre soziale Zusammensetzung-gleichrangige Bauern, die oft auch durch persönliche Beziehungen miteinander verbunden waren - konnte sich kein großes Gefalle zwischen Mitgliedern und der LPGLeitung herausbilden. Der Vorsitzende, der immer wieder neu gewählt wurde, beteiligte sich ebenso wie die übrigen Mitglieder an den anfallenden Arbeiten. Obwohl die Leitungskader versuchten, die Mitglieder auch an den Entscheidungsprozessen zu beteiligen, kam es auch in den LPGs vom Typ I zu Autoritätskonflikten, wie ein ehemaliges Mitglied der LPG »Grammetal« berichtete: »In der L P G Typ I hatten wir nur eine Brigade und einen Brigadier. Der wurde gewählt, genauso wie der Vorsitzende. Der Brigadier war dazu da, die Arbeit einzuteilen und die Abrechnung mit den Leuten zu machen. Anfangs war es bei uns so, da wurde noch vieles miteinander abgesprochen, wann welche Arbeit gemacht wird usw. Es wurde gesagt: >Du und D u n i m m s t die Maschine, und der Rest geht mit der Handhacke raus.< Es passierte schon, daß es darüber auch mal Unstimmigkeiten gab, aber im großen und ganzen wurde das akzeptiert. 184
182 Zeitzeugeninterview N z 2. 183 Zeitzeugeninterview N z 3. 184 Zeitzeugeninterview N z 1. Das tatsächliche Ausmaß der Konflikte in dieser LPG konnte nicht ermittelt werden. Wie das Zitat zeigt, äußerte sich der Befragte dazu nur zurückhaltend. Dies ist möglicherweise darauf zurückzufuhren, daß er selber von 1966 bis 1969 Vorsitzender der LPG »Grammetal« war und daher aus der Herrschaftsperspektive berichtete.
155
Wie bereits dargestellt, war in den Statuten der LPG ein demokratisches Organisationsmodell vorgesehen, in dem jedem Mitglied Mitbestimmungsrechte eingeräumt wurden - ein Modell, das im Idealfall dazu geeignet sein konnte, eine Identifikation mit der LPG zu begründen. Dennoch waren die Mitglieder von betrieblichen Entscheidungen weitgehend ausgeschlossen und zu Befehlsempfángern degradiert. Dieses hierarchische System dürfte eher kontraproduktiv für die Uberzeugung der Genossenschaftsbauern, an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten und damit auch für ihre Identifikation mit der Genossenschaft gewesen sein. Dies um so mehr, als daß der Anspruch auf die Durchsetzung der »innergenossenschaftlichen Demokratie«, die Einbeziehung aller Mitglieder in die Planungs- und Leitungsfragen zwar immer wieder formuliert, jedoch nicht umgesetzt wurde. Relevante Entscheidungen wurden vielfach bereits außerhalb der LPG von übergeordneten Behörden getroffen. So war auch die Leitung der LPG, der Vorsitzende und der Vorstand, in ihren betrieblichen Entscheidungen nicht frei. Im Rechenschaftsbericht des Vorstandes von 1962 heißt es: »Der Vorstand und das gesamte Leitungskollektiv sind in erster Linie verpflichtet, das Statut, die innere Betriebsordnung sowie die Beschlüsse von Partei und Regierung einzuhalten.« 185 Die LPGs standen unter der Aufsicht der Gemeinde- und Kreisbehörden, die überprüften, ob der Plan eingehalten, nach den vorgeschriebenen Methoden gearbeitet und nach den sozialistischen Leistungsprinzipien entlohnt wurde. Der ehemalige Vorsitzende bestätigte, daß Besuche von Instrukteuren des Kreises zumindest in den Anfangsjahren häufig stattfanden: »Vom Rat des Kreises, Abteilung Landwirtschaft, kamen oft welche her. Da wurden dann Anweisungen gegeben, wie es weitergehen soll, und ich mußte das dann durchführen. Es kamen auch Spezialisten, die bestimmte Arbeitsmethoden durchgesetzt haben. Die Instrukteure vom Kreis kamen ungefähr die ersten zehn Jahre, später kamen dann nur noch Verordnungen.« 186
Auch die Kader der LPG, der Vorsitzende, der Vorstand sowie die Brigadiere waren nicht frei wählbar; ihre Ernennung war vielmehr von behördlicher Zustimmung abhängig. Besonders auf die Neueinsetzung der Vorsitzenden der LPG Typ III hatten die Kreisbehörden entscheidenden Einfluß. Sie schlugen einen Kandidaten vor, den die Mitgliederversammlung durch ihre Wahl zu bestätigen hatte. Die entscheidenden Kriterien für einen Vorsitzenden waren seit den sechziger Jahren dessen fachliche Qualifikation und Parteimitglied-
185 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 87. 186 Zeitzeugeninterview N z 3. Auch der Zeitzeuge N z 2 bestätigte die behördliche Einflußnahme auf betriebliche Entscheidungen in der LPG: »Von der SED-Kreisstelle kamen dann Instrukteure zur Überwachung, die haben sich zum Teil auch in die Produktion eingemischt und wollten uns sagen, was zu tun ist.« Über die Eingriffe der Gemeindeverwaltung in die Belange der LPG siehe Kap. III.2.2.1.
156
schaft. W i e ein Z e i t z e u g e berichtete, w u r d e in der L P G »Ernst G o l d e n b a u m « 1964 der Vorsitzende n a c h zehnjähriger Amtszeit als n i c h t g e n ü g e n d qualifiziert abgelöst u n d d u r c h einen v o n a u ß e n k o m m e n d e n Fachkader ersetzt: »Wir hatten dann auch einen Regierungswechsel, Alfred trat ab. Er war eben den ganzen Landwirtschaftsexperten, die beim Landratsamt saßen, nicht gewachsen, weil er kein Fachmann war. Er hat es nicht tragisch genommen, als er aufgehört hat. Dann war ein paarmal Regierungswechsel und dann kriegten wir '67 den G. H. aus Berlstedt. Der war ein Mann vom Fach vom Scheitel bis zur Sohle. ... Die Vorsitzenden wurden anfangs, als Alfred angefangen hat, noch gewählt. Später hat der Kreis dann durch die Qualifizierung viele Reservekader gekriegt, daß keiner mehr eingesetzt wurde, der nicht qualifiziert war. Die waren dann im Angebot.«187 A u c h in die Aufstellung der Kandidaten f ü r d e n Vorstand der L P G m i s c h t e n sich K r e i s b e h ö r d e n sowie die Kreisleitung der S E D massiv ein, w i e aus d e n Bezirksakten hervorgeht: »Aufgrund der guten politischen Unterstützung auf Seiten der Räte der Kreise und der Kreisleitungen unserer Partei bei der Aufstellung von Kandidaten ist erreicht worden, daß bewährte Funktionäre erneut bestätigt wurden bzw. fähige Mitglieder das Vertrauen der Mitglieder erhielten.«188 N e b e n d e n L a n d w i r t s c h a f t s b e h ö r d e n der Kreisverwaltung hatte die S E D - P a r teiorganisation des Betriebs ( B P O ) u m f a n g r e i c h e M i t s p r a c h e r e c h t e in d e r L P G . Sie t r a f V o r e n t s c h e i d u n g e n auf der G r u n d l a g e der Beschlüsse der ü b e r g e o r d n e t e n B e h ö r d e n u n d der S E D , die der gewählte LPG-Vorstand berücksichtigen m u ß t e : »Grundsätzlich war es so: Als erstes tagte der Parteivorstand, und was da beschlossen wurde, das kam nachher in den LPG-Vorstand, der dies dann bestätigen mußte. In der LPG-Parteigruppe wurde erst einmal festgelegt, was gemacht wurde oder was von oben her gemacht werden mußte. So war zu 90 % schon durchgedrückt, was die Partei beschlossen hatte. Der Vorsitzende war ja auch in der Partei, in der Typ III jedenfalls, und auch sonst hatten wir hier in der LPG eine ganze Masse Genossen. In Typ I war das allerdings noch anders.«189 Es k o n n t e n i c h t e i n d e u t i g geklärt w e r d e n , f ü r w e l c h e Kader die Mitgliedschaft in der S E D o d e r in einer der Blockparteien b i n d e n d war. A n z u n e h m e n ist j e -
187 Zeitzeugeninterview N z 2. 188 Thür. HStA Weimar, Bezirkstag L 562. In einigen LPGs des Bezirks Erfurt brachten die Mitglieder 1960 ihre Unzufriedenheit über die vorgeschlagenen Kandidaten dadurch zum Ausdruck, daß sie geheime Wahlen forderten und diese teilweise auch durchführten. Dabei wählten sie andere Kandidaten als die vorgeschlagenen. 189 Zeitzeugeninterview N z 1. Die wichtige Rolle der BPO in der LPG vom Typ III bestätigte auch der frühere Vorsitzende (Zeitzeugeninterview N z 3) sowie ein Zeitungsbericht von 1961 über die LPG »Ernst Goldenbaum« aus »Das Volk«, der mit der Titelzeile überschrieben war: »Genossen geben die Richtung an« (zitiert in der Ortschronik).
157
doch, daß sie zumindest bei der Besetzung der oberen Ränge in der LPG Typ III eine Rolle spielte. So waren alle Vorsitzenden der LPG »Ernst Goldenbaum« in der SED. In den LPGs vom Typ I schien die Parteimitgliedschaft bei Kadern weniger wichtig gewesen zu sein, denn mindestens einer der Vorsitzenden in den LPGs dieses Typs in Niederzimmern war parteilos. Wie der Fachbereichsleiter der Abteilung Tierzucht der LPG Typ III berichtete, hatte die Parteimitgliedschaft der Kader auch Einfluß auf ihre Durchsetzungskraft bei Verhandlungen mit übergeordneten Behörden: »Auf der Tierzucht in Erfurt bei einer Versammlung haben sie mir gesagt: >Mit Dir reden wir nicht, D u bist parteilose Auch bei der Kreisverwaltung konnte ich deswegen meine Worte nicht anbringen. M e i n Kollege F. [der SED-Parteisekretär und ehemaliger »Großbauer«, d . V ] , der schon in der Partei war, sagte dann: >Ich bringe Dir ein Formular mit, dann bist D u eben auch in der Partei.< Ich bin '64 eingetreten. S o bin ich in die Partei g e k o m m e n , habe aber nie darauf Wert gelegt. Aber dann kriegte ich Antworten.« 1 9 0
Auf der unteren Funktionärsebene schien eine Parteimitgliedschaft weniger zwingend gewesen zu sein. So war in der LPG vom Typ III in Niederzimmern bis 1989 mindestens ein parteiloser Brigadier beschäftigt. Wie er sich erinnerte, hatte er jedoch Zugeständnisse in bezug auf die Mitgliedschaft in Massenorganisationen zu machen: »Ich war Mitglied der Deutsch-Sowjetischen-Freundschaft. Als Leiter blieb mir nichts anderes übrig. Wenn man in der L P G sozialistische Brigade werden wollte, dann mußten mindestens 80 % von den Mitgliedern, glaube ich, in der D S F sein. Selbst ich habe da geworben. M i r ging es natürlich auch u m die Extraprämie, mit der eine sozialistische Brigade ausgezeichnet wurde. Es gab auch mal eine Reise oder sonst was.« 191
Wie der aus pragmatischen Gründen erfolgte Parteieintritt, zeugt auch die Verhaltensweise des Brigadiers von der Bereitschaft der Bauern, sich an die >Spielregeln< der Staatsmacht anzupassen. Die Handlungsweisen dieser Bauern waren damit zwar systemkonform; da sie sich jedoch nicht mit den herrschaftlichen Intentionen deckten, sondern von individuellen Eigeninteressen motiviert waren, sind sie als »eigensinnig« zu charakterisieren. Obwohl die größeren Bauern nur zögernd in die LPG Typ III eingetreten waren, konnte ihnen die Mitgliedschaft Vorteile bringen, sofern sie bereit waren zu kooperieren. Durch ihre fachliche Kompetenz, die in der LPG geschätzt wurde, gelang es einigen von ihnen, kurz nach ihrem Beitritt in der Genossen-
190 Zeitzeugeninterview N z 2. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Zeitzeuge seinen Grund für den Beitritt zur SED in der Retrospektive banalisierte, indem er weitere »opportunistische« Motive verschwieg. Es erscheint allerdings unwahrscheinlich, daß er sich binnen weniger Jahre vom »Großbauern« zum ideologisch überzeugten Parteigänger der SED wandelte. 191 Zeitzeugeninterview N z 1.
158
schaft fuhrende Positionen zu besetzen.192 Der oben zitierte »Großbauer«, der als privat wirtschaftender Landwirt ein erfolgreicher Schweinezüchter war, wurde sofort Brigadier und kurze Zeit später Leiter der Abteilung Tierzucht. Er prägte die weitere Entwicklung der LPG entscheidend mit, denn auf seine Initiative ging die ab Mitte der sechziger Jahre begonnene Spezialisierung des Betriebs auf Schweinezucht zurück. Aus der Schilderung seiner ersten Erfahrungen in der LPG wird sein Ehrgeiz deutlich, seine Fachkompetenz auch in der LPG unter Beweis zu stellen: »Sie haben gesagt: >Du mußt dich entscheiden, was Du willst! Wir brauchen Leute für die Viehwirtschaft, auch für die Feldwirtschaft.< Und da ich damals schon Schweinezucht hatte, da ging ich in die Viehwirtschaft und wurde Brigadier.... Ich bin dann mit zwei oder drei Mann von einem Stall zum anderen gezogen und habe mir erst einmal einen Überblick verschafft. Also solche dünnen Sattelschweine hatte ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Die waren derartig abgemagert. Aber es waren ja keine Leute da, die Ahnung hatten, und es war auch kein Futter da.... Zuerst habe ich die Schweine zusammengezählt und mir den Betriebsplan und was zu liefern war, angesehen. Da habe ich zum Vorsitzenden gesagt: >Da müßte ja jedes Schwein dreihundert Kilo wiegen, um den Plan zu erfüllend Außerdem hingen ja auch die Löhne dran, die so kaum auszuzahlen waren. Da bin ich zu F. gegangen, der ein profilierter Bauer war, auch ein Betrieb mit 20 Hektar, der war schon eher eingetreten, wegen Familiendifferenzen. Er hat gesagt: >Es nützt alles nichts, wir müssen den Karren aus dem Dreck ziehen.< Ich sagte: >Wenn wir das Schiff an Land ziehen wollen, müssen wir tragende Sauen kaufen, ihr habt ja keine da.< Weil wir kein Geld hatten, sind wir zur Bauernbank gefahren, dort kannte ich einen, der gab uns dann ein Scheckheft für 50.000 Mark. Damit konnten wir dann Sauen kaufen, und so haben wir den Startschuß gekriegt. Das Futter war dann auch noch ein Problem, hinter dem mußte ich auch erst herlaufen, bis ich welches gekriegt habe. Ich habe mir dann auch Leute an Land gezogen, die, wollen wir mal so sagen, die Schweineverstand hatten, die mit Schweinen umgehen konnten. Das waren Sudentenländer, die haben ihre Arbeit mit Sinn und Verstand gemacht. Darum haben wir dann auch gute Ergebnisse gehabt.«193 Zugleich dokumentiert diese Äußerung aber auch das Selbstbewußtsein eines erfahrenen Bauern, der sich den in der LPG wirtschaftenden Arbeitern und Kleinbauern überlegen fühlte und weiterhin bestrebt war, seine bisherigen Entscheidungsbefugnisse zu behalten. Auch zwei weitere Bauern, die vorher größere Höfe bewirtschaftet hatten, besetzten in der LPG rasch fuhrende Positionen. Der Inhaber eines 22 ha großen Betriebes wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, ein weiterer »Großbauer« Brigadier. Diese Landwirte, die bereit waren, sich für den wirtschaftlichen Aufbau der LPG zu engagieren,
192 Die Übertragung leitender Positionen an größere Bauern, deren fachliche Qualifikationen die LPGs auf diese Weise nutzen konnten, war durchaus üblich, wie eine U n t e r s u c h u n g über die Magdeburger Börde zeigt: Räch, Lebensweise, S. 92. 193 Zeitzeugeninterview N z 2.
159
hatten bereits als privat wirtschaftende Betriebsinhaber versucht, ihren Hof mit modernen Methoden möglichst profitorientiert zu bewirtschafteten. Auch in der LPG strebten sie nach wirtschaftlichem Erfolg, da sie nur darin die Möglichkeit sahen, rasch angemessene Einkommen zu erzielen: »Daran hingen doch die ganzen Löhne. Die Leute wollten doch alle Lohn haben, jeden Monat wollte man Lohn haben. U n d dann zahlen Sie mal was, wenn der Betrieb nicht läuft.«194 Motiviert wurden sie zudem durch die Anerkennung ihrer Kompetenz durch den damaligen Vorsitzenden der LPG, einen ehemaligen Industriearbeiter, der ihnen auf ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet weitgehend freie Hand ließ: »Der Vorsitzende hat mir nicht in meine Arbeit dreingeredet, der hatte ja selber keine Ahnung von Schweinen. Er war kein Mann vom Fach, aber das habe ich ihm immer hoch angerechnet, daß er gesagt hat: >Berate mich, ich habe keine Ahnung davon.< Der war ehrlich.«195
Erscheint diese Verhaltensweise der größeren Bauern auf den ersten Blick als reibungslose Anpassung an die neue Ordnung, so lassen sich dennoch Elemente von »Eigensinn« ausmachen. Da sie den LPG-Beitritt noch kurz davor verweigert hatten, ist nicht davon auszugehen, daß ihre Kooperationsbereitschaft ein Ausdruck für ihre Ubereinstimmung mit der neuen landwirtschaftlichen Verfassung war. Die Übernahme von Verantwortung sicherte ihnen vielmehr den Erhalt ihrer bisherigen sozialen Position und öffnete ihnen einen Weg, wenigstens partiell ihre eigenen Vorstellungen in der LPG verwirklichen zu können. Ihr Wohlverhalten war also eng mit der Wahrung ihrer statusbezogenen und auch materiellen Eigeninteressen verknüpft. Ihre innere Distanz gegenüber der genossenschaftlichen Landwirtschaft deutet sich in einer Bemerkung des Zeitzeugen an, der zunächst den Eindruck einer für sich relativ reibungslosen Adaption vermittelte: »Es war natürlich schwierig, plötzlich nicht mehr selbständig wirtschaften zu können. Man mußte sich mit der LPG abfinden. Man mußte da einen Schlußstrich ziehen, und den habe ich auch gezogen.«196 In den Berichten der Gemeindeverwaltung, die mitverantwortlich für den erfolgreichen Aufbau der Genossenschaften war, findet sich nach der Konsolidierungsphase der LPG keine Kritik mehr über fehlende Kooperationsbereitschaft. Dies spricht dafür, daß die genossenschaftliche Form der Zusammenarbeit nach einiger Zeit akzeptiert wurde. Auch die allmählich einsetzende wirtschaftliche Stabilisierung der LPG »Ernst Goldenbaum« kann als Indiz für die wachsende Bereitwilligkeit der Mitglieder, sich zu engagieren, gewertet werden. Eine Produktivitätserhöhung wäre ohne diese Anpassungsleistung 194 Ebd. 195 Ebd. 196 Ebd.
160
nicht möglich gewesen. So stiegen der Viehbesatz und die Hektarerträge in der Pflanzenproduktion während der sechziger Jahre deutlich an.197 Mit der wachsenden Produktivität erhöhte sich der Wert der Arbeitseinheiten und damit auch die Einkommen der Mitglieder. 198 Auch der 1963 eingeführte innerbetriebliche Wettbewerb und das Leistungsprinzip trugen zu einer Steigerung der Arbeitsproduktivität bei. Nach dem neuen Vergütungsprinzip wurde die Arbeit nicht nur nach quantitativen sondern auch nach qualitativen Maßstäben entlohnt, und gleichzeitig bot ein ausgeklügeltes Prämiensystem zusätzliche finanzielle Anreize. Die Bereitschaft, sich mit der genossenschaftlichen Arbeitsweise abzufinden, beruhte nicht zuletzt auf den Eigeninteressen der Mitglieder. Denn nur ihre Kooperation garantierte ihnen ein befriedigendes Einkommen, da die ausgezahlten Löhne an den erwirtschafteten Gewinn gekoppelt waren. Andererseits spricht die zunehmende Kooperationsbereitschaft auch für die allmähliche Identifikation der Mitglieder mit ihrer Genossenschaft. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der LPG wuchs auch deren Renommee. Wie der damalige Leiter der Abteilung Tierzucht berichtete, wurde die Produktionsgenossenschaft für ihre Schweinezucht ausgezeichnet: »Wir wurden dann Mitglied beim Landesverband junger Schweinezüchter, und ich war als Vertreter in der Zuchtkommission. U m die Züchtungen zu verbessern, bin ich dann in eine Versuchsstation für Besamung bei Jena gefahren und habe sie überredet, mir einige Sauen zu besamen. Die hatten dort das Beste vom Besten. Wir hatten damit Erfolg. Bei der Stammeberschau in Erfurt haben wir dann mit den Besamungsebern den besten Jungeber von Thüringen gestellt. Ich bin dann noch viel rumgefahren, bis in den Berliner Raum, um Zuchteber zu kaufen. So haben wir uns allmählich durchgeboxt.«199
Es ist davon auszugehen, daß dieser Prestigegewinn die Identifikation der Mitglieder mit ihrer Genossenschaft weiter verstärkte. Die Beteiligten gewannen der genossenschaftlichen Arbeitsweise auf Dauer auch positive Seiten ab. Die Ausführungen eines Bauern, Mitglied einer LPG vom Typ I, der seine Selbständigkeit nur sehr widerstrebend aufgegeben hatte,
197 Zwischen 1960 und 1970 stieg der Viehbesatz je 100 ha in der LPG vom Typ III in Niederzimmern_folgendermaßen: der Schweinebesatz von 86 auf234 Tiere, der Schafbesatz von 22 auf 49 Tiere. Die Anzahl der Rinder ging hingegen zurück, da der Betrieb begonnen hatte, sich auf Schweinezucht zu konzentrieren. Auch die pflanzliche Produktion erzielte eindrucksvolle Erfolge. 50 nahm die Getreideproduktion zwischen 1961 und 1967 von 21,4 auf 38,4 dz/ha zu, die Kartoffelproduktion von 82,9 auf 218 dz/ha und die Zuckerrübenproduktion zwischen 1961 und 1969 von 206,4 auf280,1 dz/ha. Insgesamt konnte die LPG damit bessere Ergebnisse vorweisen als der DDR-Durchschnitt. Vgl. Kap. II.2.5. Die Daten wurden der Ortschronik entnommen. 198 Entwicklung des Werts der Arbeitseinheit: 1961: 6,33 DM, 1962: 7,88 DM, 1963 : 7,65 DM, 1964: 8,05 DM, 1965: 9,35 DM, 1966: 7,20 DM, 1967: 10,00 DM, 1968: 10,56 DM, 1969: 12,56 DM. Daten aus der Ortschronik. 199 Zeitzeugeninterview Nz 2.
161
veranschaulichen, daß er die Arbeitserleichterungen durch Gruppenarbeit und die einsetzende Technisierung in der LPG durchaus zu schätzen wußte. »Das Viehfutter für die individuellen Bestände wurde gemeinsam geholt und dann auf die Einzelnen verteilt. Jeder bekam nach seiner Hektarzahl. Es war praktischer, es zusammen zu machen, als wenn jeder Einzelne sein Futter geholt hätte, denn wir hatten in der LPG dann einen Mählader, man konnte mähen und gleichzeitig laden. Vorher mußten wir das mit einem Grasmäher und Pferd machen. Bei uns wurde gleich von Anfang an mechanisiert.... Wir haben, als die MTS aufgelöst wurde, gleich einen Traktor bekommen. Den mußte man allerdings bezahlen. In der LPG hat man viel leichter Maschinen gekriegt als vorher.«200
Es darfjedoch nicht vergessen werden, daß sich die Arbeitsorganisation für die Genossenschaftsbauern in den LPGs vom Typ I nur partiell verändert hatte, da mit der individuellen Viehwirtschaft ein großer Teil des selbstbestimmten Arbeitsalltags erhalten geblieben war. Die genossenschaftlich verrichteten Feldarbeiten beschränkten sich in der Regel auf nur wenige Stunden am Tag, und die Spezialisierung der Mitglieder auf bestimmte Arbeitsbereiche war nur wenig ausgeprägt.201 Diese reichte in der LPG vom Typ III wesentlich weiter, denn dort unterschieden sich die Einsatzbereiche der Mitglieder nicht nur nach Feldbau und Tierproduktion, Verwaltung und technischem Bereich, sondern waren auch noch innerhalb dieser Bereiche auf bestimmte Tätigkeiten eingegrenzt. Die Form der Spezialisierung, aber auch der fremdbestimmte Arbeitstag und -ablauf auf den die Mitglieder keinen Einfluß hatten, wandelten den Arbeitsalltag der ehemaligen Bauern in den Produktionsgenossenschaften vom Typ III grundlegend. Beim Beitritt hatten die neuen Mitglieder noch die Möglichkeit, ihren neuen Arbeitsplatz nach ihren Interessen zu wählen: »Damals gab es ja noch die Möglichkeit, den Arbeitsplatz auszusuchen, für den man auch Interesse hatte. Denn es gab ja Leute, die gingen lieber ins Feld, die wollten vielleicht auch den Sonnabend und Sonntag für sich haben und manche gingen lieber in den Stall, denn dann hatten sie das ganze Jahr über Verdienst. Denn wenn der Herbst rum war, hatten die Leute auf dem Feld ja keine Arbeit mehr.« 202 200 Zeitzeugeninterview Nz 1. Seit der Übernahme des MTS-Maschinenbestands 1959 nahm der Grad der Mechanisierung in den LPGs rasch zu. Eine Bestandsaufnahme vom Jahresende 1965 beziffert den Maschinenbestand der LPG »Goldenbaum« u.a. auf 12 Traktoren, 23 Anhänger, 2 Mähdrescher, 1 Kartoffelvollerntemaschine, 1 Rübenvollerntemaschine, 4 Fördergebläse, 6 Melkmaschinen, 1 mechanische Entmistungsanlage. Gemeindearchiv Niederzimmern Β 90. 201 Ein beteiligter Zeitzeuge schilderte die Arbeitsorganisation so: »Auch in Typ I war die Arbeit schon etwas spezialisiert. Es gab ja immer einen Teil, die keine Fahrerlaubnis hatten, die nahmen dann eben noch die Pferde, die hatte man ja noch zu Anfang. In Typ III war es natürlich viel mehr spezialisiert. Es gab dort mehrere Brigaden. In der LPG Typ I hatten wir nur eine Brigade und einen Brigadier« (Zeitzeugeninterview Nz 1). 202 Zeitzeugeninterview Nz 2. Die Beschäftigten im Bereich Feldbau wurden im Winter, wenn die Feldarbeit verrichtet war, zu Pendlern, die in den industriell-gewerblichen Bereich
162
Die Wahl des Arbeitsplatzes nach individuellen Interessen, die mit der Technisierung einhergehenden Arbeitserleichterungen aber auch die geregelte Freizeit dürften dazu beigetragen haben, daß die ehemaligen Bauern die Genossenschaften allmählich akzeptierten. Im Gegensatz zu den nur teilgenossenschaftlich wirtschaftenden Bauern in der LPG vom Typ I kamen die Mitglieder vom Typ III in den Genuß einer geregelten Arbeitszeit, auch wenn diese in den Anfangsjahren noch nicht auf einen Achtstundentag festgelegt war. Zudem hatten sie Anspruch auf freie Wochenenden und seit den sechziger Jahren auch auf Urlaub. 203 Damit fand eine schrittweise Angleichung an die Arbeitsbedingungen in den nicht-landwirtschaftlichen Sektoren statt. Dennoch weisen einige Indizien daraufhin, daß die Akzeptanz der genossenschaftlichen Landwirtschaft nicht bruchlos war. Einer dieser Bruchstellen zeigte sich in der individuellen Hauswirtschaft, diejedem LPG-Mitglied die Eigenbewirtschaftung einer Fläche von einem halben Hektar und eine kleine Viehhaltung gestattete. Diese Form der individuellen Produktion erwies sich als lukrativ, denn die Erzeugnisse konnten zu relativ hohen Preisen verkauft werden. Da die individuelle Hauswirtschaft zudem selbständiges Wirtschaften erlaubte, investierten die Mitglieder der LPG vom Typ III dafür sehr viel Energie und stellten die Belange ihrer eigenen Kleinwirtschaft vor die der Genossenschaft. Ein Protokoll der Gemeindevertretersitzung dokumentiert dieses Verhalten und kritisiert es als kontraproduktiv für die LPG: » E i n e s e h r w i c h t i g e F o r d e r u n g d e s V I . K o n g r e s s e s 2 0 4 ist es, d a ß d i e g e n o s s e n s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n V o r r a n g hat v o r d e r i n d i v i d u e l l e n H a u s w i r t s c h a f t . ... E s k a n n a l s o k e i n e s falls gebilligt w e r d e n , w e n n d a s w e n i g e P f l a n z g u t , d a s in d e r G e n o s s e n s c h a f t v o r h a n d e n ist, voll z u r B e s t e l l u n g d e r i n d i v i d u e l l e n F l ä c h e n v e r w e n d e t w i r d , in d e r B e s t e l l u n g d e r genossenschaftliche Flächen aber d a d u r c h große Ausfälle entstehen, die nicht einmal die staatliche A u f l a g e s i c h e r n , z u m a n d e r n aber a u c h n i c h t g e w ä h r l e i s t e n , d a ß n o c h F u t t e r f ü r d a s V i e h ü b r i g bleibt.« 2 0 5
delegiert wurden: »Die Traktoristen haben wir im Winter dann als Fahrer in einer Mälzerei untergebracht, die wurden dazu abgestellt. Manche Frauen von der L P G haben im Winter in Weimar in einer Elektrofabrik gearbeitet, auch von der L P G abgestellt« (Zeitzeugeninterview N z 2). 203 Eine befragte Genossenschaftsbäuerin unternahm in den sechziger Jahren ihre erste U r laubsfahrt: »Anfang der sechziger Jahre waren wir an der Ostsee, stolz mit dem Trabbi sind wir hochgefahren. Wir hatten dort in der N ä h e entfernte Verwandte, bei denen waren wir ungefähr 14 Tage. 1968 hatten wir dann einen regulären Urlaubsplatz in Binz. Die Versorgung mit diesen Urlaubsplätzen war j a äußerst dünn« (Zeitzeugeninterview N z 4). 204 Gemeint ist der Bauernkongress, der 1960 in Rostock stattfand. Die Bauernkongresse wurden mit Vorsitzenden und Aktivisten der L P G s veranstaltet und dienten der Legitimierung agrarpolitischer Entscheidungen. 205 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 87. Auch die Aussage einer Zeitzeugin ( N z 4) bestätigte dies: »Alle, die in der L P G gearbeitet haben, hatten Schweine, Schafe und was sonst noch alles privat gehalten wurde. Das brachte gute Nebeneinnahmen. Die Wolle von unseren f ü n f Schafen brachte im Jahr soviel, wie ein Arbeiter im Monat verdiente. Das Futter hat man von der L P G mitgenommen.«
163
In der Sichtweise der Bauern war die individuelle Hauswirtschaft ein Symbol der früheren Selbständigkeit: »Das mit der Hauswirtschaft konnte man auch so ausdrücken: D a hatte jeder eine kleine L P G für sich alleine.«206 In der hohen Wertschätzung dieser bescheidenen Form der Eigenständigkeit offenbart sich nicht nur »Eigensinn« - denn die Beteiligten verbanden mit dieser Form der Bewirtschaftung eine über den staatlich intendierten Sinn hinausgehende Bedeutung-, sondern zugleich die Beharrungskraft von traditionellen Einstellungen. Ein weiteres Indiz für die beibehaltene Distanzierung der Bauern von der genossenschaftlichen Form der Landwirtschaft ist die seit 1960 weitverbreitete Abwanderung ihrer Kinder aus der Landwirtschaft, die von den Eltern unterstützt wurde: »Die Kinder wollten keinen landwirtschaftlichen Beruf lernen, und die Eltern wollten dies auch nicht. Eine L P G war so ziemlich das letzte, auch wenn sich dies im Laufe der Zeit geändert hat, vielleicht in den siebziger Jahren. In den fünfziger Jahren gingen die Bauernsöhne noch nicht in andere Berufe, aber als es mit der L P G losging, haben die meisten eine andere Ausbildung gemacht. Das war j a nachher so, daß nur noch mittleres Alter und ältere in der L P G waren j u n g e Leute waren nicht mehr da. Die Lehrlinge in der LPG, die kamen öfter aus der Stadt, es wurde auch ein bißchen gefördert. Wer, naja, ein bißchen Schwierigkeiten in der Schule hatte, der lernte eben Landwirtschaft.« 207
Aus dieser Darstellung geht auch hervor, daß der landwirtschaftliche Beruf, selbst unter der bäuerlichen Bevölkerung, erheblich an Prestige verloren hatte. Von den Bezirksbehörden Erfurts wurde 1961 das Problem der Abwanderung Jugendlicher im Zusammenhang mit einer Werbekampagne für landwirtschaftliche Lehrlinge analysiert. Als Gründe für die Abwanderungsbereitschaft wurden die schlechten Verdienstmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft angeführt, aber auch das Vorbild der »Großbauernkinder«, die bereits seit Jahren in nicht-landwirtschaftliche Berufe abwanderten. Die Berichte bemerken zudem, daß der Abwanderungswunsch der Jugendlichen von ihren Eltern befürwortet wurde. 208 Beim Phänomen der Abwanderung 206 Zeitzeugeninterview N z 4. 207 Zeitzeugeninterview N z 1. Auch der Zeitzeuge N z 2 bestätigte dies: »Ein Teil von ihnen (der Bauernkinder) ist dageblieben, aber nur in den fünfziger Jahren. Die Sache wurde immer brenzliger, daß die jungen Leute sagten: >Nichts!Lumpenzeug< gehabt, er hat eine Pferdezucht gehabt, also Arbeitspferde, Kaltblüter. Dann haben wir Rindviecher gehabt, Milchvieh. M a n hat Schafe gehabt und Schweine.... U m sich zu spezialisieren, hätten wir einen neuen Stall bauen müssen, also entweder einen Schweinestall oder einen Viehstall. Er hat dann das Wohnhaus aufgestockt und nebenher ein neues Wohnhaus gebaut. D a n n war er finanziell so angespannt, daß er sich im Stall nicht spezialisiert hat. Bei uns war der Stall alt, und d a r u m war das auch viel Handarbeit und Muskelarbeit, das war ein Schlauch. ... Bei m e i n e m Vater w u r d e noch nichts umgestellt. D a s haben einige Betriebe schon getan, aber mein Vater nicht. Der hat so gewurstelt, wie er es ü b e r n o m m e n hat. Ich habe es Ihnen j a schon gesagt, die vielen Betriebszweige die man gehabt hat. D e r hat sich da nie groß Gedanken gemacht. A u f j e d e n Fall haben die Einnahmen darunter gelitten, und rentabel war es nur deshalb oder vielmehr er hat nur überleben können, weil er billige Arbeitskräfte gehabt hat und das sind Familienangehörige gewesen. D i e haben keinen L o h n b e k o m m e n , die hat m a n mit einem Taschengeld abgefunden.« 2 3 6 D e r zitierte H o f e r b e , d e r i m e l t e r l i c h e n B e t r i e b g e a r b e i t e t hatte, b i s er d e n H o f ü b e r n a h m , hatte d u r c h s e i n e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e A u s b i l d u n g a n d e r e V o r s t e l l u n g e n v o n B e t r i e b s f ü h r u n g g e w o n n e n . G e g e n ü b e r s e i n e m Vater k o n n t e er diese j e d o c h nicht durchsetzen: »Ich habe ein halbes Jahr einen Austausch gemacht. D a s war ungefähr 1959. D a ist von einem Fremdbetrieb einer zu uns g e k o m m e n , und ich bin auf seinen Betrieb gegangen. D a s w u r d e von der Landwirtschaftsschule vermittelt. S o hat man mal etwas anderes gesehen und einen anderen Betrieb kennengelernt. D a s war für mich ein sehr prägendes halbes Jahr. Das war ein Schweinebetrieb, sie hatten Schweine und Milchvieh, aber spezialisiert war schon sehr auf Schweineproduktion, Z u c h t und Mast. Für mich war das, wie gesagt, prägend, weil ich dann später a u f Schweine umgestellt habe. Gerade wegen der Spezialisierung war das aktuell damals, entweder Rindviehhaltung oder mehr auf Schweine umsteigen, weil es einfach arbeitsmäßig nicht mehr möglich war, so vielseitig zu sein. Sicher, ich habe darauf gedrängt, daß mein Vater wenigstens die Schafe mal weggetan hat. Ich konnte aber nicht viel Einfluß nehmen a u f meinen Vater, der war sehr eigen.« 237 Sofort nach der Ü b e r n a h m e des H o f e s begann der S o h n mit der betrieblichen U m s t e l l u n g u n d spezialisierte sich a u f S c h w e i n e z u c h t : »Also, ich habe sowieso eine Abneigung gehabt gegen Milchviehwirtschaft. D a s hat mit dazu beigetragen, daß ich a u f Schweine umgestellt habe. N a c h der Ü b e r n a h m e habe ich mir gedacht, was ist für mich finanziell am tragbarsten? D i e Muttersauenhaltung, das war halt ein schnelles Geld. D i e Ferkel, die habe ich v o n der Geburt an höchstens
236 Zeitzeugeninterview Bs 1. 237 Ebd. 177
von 10 Wochen, dann kann ich die verkaufen. Also innerhalb von kurzer Zeit bekomme ich Geld für mein Produkt. Der Preis war ja damals, als ich angefangen habe, gut.«238 Der Zeitzeuge schilderte weiter, daß bei allen älteren Bauern der Gemeinde die Bereitschaft zu betrieblichen Innovationen fehlte. Erst in seiner Altersstufe, der Generation, die seit den fünfziger Jahren die Betriebe übernahm, sei die Spezialisierung angestrebt und verwirklicht worden: »Speziell in Bernstadt haben die alten Bauern nichts getan, keiner. Das war dann mehr meine Generation, die den Schritt gemacht haben. Also beim B. da hinten, das hat auch der Sohn gemacht. Der hat ein paar Bauplätze verkaufen können. Dann hat er in seinen Stall eine Schwemmentmistung hineingemacht und hat Milchvieh und nebenher eine Rindermast und Bullenmast. Beim F., da hat der Alte zwar das Milchvieh noch weggetan. Der hat dann nur noch Muttersauen gehabt und ein bißchen eine Schweinemast. Erst der F. hat das dann intensiviert. In den alten Schafstall hat er einen Maststall hineingebaut. Beim S. war es so, daß erst der Junge, der ist zwei Jahre älter als ich, der hat sich erst auf Schweine spezialisiert. Der Vater hat auch noch eine Rinderhaltung gehabt und ein paar Sauen noch nebenher, wie es halt so war in den Betrieben. Beim oberen Bauer, beim Sch., hat der Junge in den Milchviehstall eine Schwemmentmistung hineingemacht und einen Bullenstall, also einen Boxenmaststall, gebaut.«239 Die Beispiele der befragten Bernstadter Bauern zeigen, daß die kleineren und mittleren Bauern - durch den stärkeren ökonomischen Zwang veranlaßt - betriebswirtschaftlich rationaler als die Großbauern handelten. So praktizierte einer der Zeitzeugen die freiwillige Buchführung in seinem Betrieb, u m eine Ubersicht über seine Gewinne und Verluste zu erhalten: »Ich habe immer ein bißchen Buchführung gemacht. Gelernt haben wir es ja in der Landwirtschaftsschule. Dann habe ich es immer ein bißchen gemacht, denn mich hat es interessiert, was man rausbringt im Jahr.«240 Auch die Einstellung zur beruflichen Zukunft der Kinder erscheint bei diesem Inhaber einer mittelgroßen Landwirtschaft weniger traditionsgebunden. Er drängte seinen Sohn, den Hofnachfolger, nicht in die Landwirtschaft, denn er befürchtete, daß die Weiterexistenz des Betriebs in der Zukunft gefährdet sei: »Mein Sohn hat Landwirt werden wollen, dann habe ich gesagt: >Nein, Hermann, unser Betrieb ist zu klein, jetzt lernst Du vorher etwas. Wenn Du nachher die Landwirtschaft betreiben willst, wenn ich im Alter bin, das kannst Du dann ja.< Aber er ist heute froh, daß man es so gemacht hat. Das habe ich damals schon gesagt, der ist ja 1965 aus der Schule gekommen. Ich habe ihm gesagt: >Das hat keinen Wert, unser Betrieb kann 238 Ebd. 239 Ebd. Auch eine Untersuchung von acht nordbayerischen Gemeinden erbrachte ein vergleichbares Ergebnis. Dort waren es die seit den fünfziger Jahren in den Landwirtschaftsschulen ausgebildeten Hofnachfolger, die die traditionelle Wirtschaftsweise zugunsten einer marktangepaßten, nach ökonomischen Kriterien ausgerichteten Betriebsführung aufgaben. Vgl. Schorr/ Dierks, S. 153ff. 240 Zeitzeugeninterview Bs 2.
178
sich auf die Dauer nicht halten. Da kommt nicht soviel heraus, daß man davon leben kann. Du lernst etwas und gehst nicht als Hilfsarbeiter zu den Maurern. Die Lehre bei der WLZ, die Arbeit in einem Lagerhaus [Verkauf von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln, d.V], war dann in diese Richtung, da kennt man sich im Pflanzenschutz besser aus als ein jeder Landwirt. Also, in dieser Richtung hätte der eine gute Voraussetzung gehabt, wenn er hätte die Landwirtschaft nachher betreiben wollen.«241 Im Gegensatz dazu bestand der Großbauer auf einer landwirtschaftlichen Laufbahn seiner Kinder. Er mußte einerseits weniger um die Zukunft seines Betriebs fürchten, andererseits aber war seine Einstellung noch stärker von bäuerlichem Standesbewußtsein geprägt, denn er bewertete den Beruf des selbständigen Landwirts weit höher als berufliche Alternativen im nicht-landwirtschaftlichen Sektor. Seine Kinder hingegen standen dem landwirtschaftlichen Beruf distanzierter gegenüber: »Für meine Eltern war es klar, daß der Sohn den Hof übernimmt und daß die Schwestern daheim bleiben und dann auf einen Hof heiraten. Ja, so in dem Gedankengut haben sich meine Eltern bewegt. Meine Schwestern sind über das Winterhalbjahr in einen Haushalt gegangen. Also eine ist nach München, nur daß sie auch ein bißchen sehen, wie ein Haushalt geführt wird, eine war in Stuttgart und eine war in Aulendorf. Die haben sich dann doch ein bißchen mehr getraut, etwas gegen die Eltern zu sagen, und nur eine hat einen Bauern geheiratet, die anderen zwei nicht. Die haben bewußt keinen Bauer geheiratet, weil sie ja den ganzen >Rotz< daheim auch miterlebt haben .... Also, es hat eine Zeit gegeben, da hätte ich jeden anderen Beruf lernen mögen, nur nicht Bauer werden. Ich habe eigentlich keine große Freude gehabt an der Landwirtschaft. Aber man hat mich gebraucht, man hat keine Fremdarbeitskräfte mehr gehabt. Wenn der Vater gesagt hat, >Du tust dasbrägla< von der Nachbarschaft. Er ist nur mit dem Schlepper gefahren, mit den Gäulen hat er eigentlich nicht viel getan, man hat j a die Knechte gehabt. Das war eigentlich seine Hauptarbeit, mit dem Bulldog fahren. A m Abend, wenn man im Feld mit dem Heuen fertig war - das war auch etwas, was mich gestört hat, damals schon sind meine Mutter und die Leute, die mit auf dem Feld waren, heim, die haben die Stallarbeit machen müssen, und mein Vater, der hat das Gewehr auf den Buckel genommen, das hat man gleich am Mittag mit hinausgenommen, und ist dann auf die Jagd gegangen. Das hat schon einige Aufwallungen in mir erzeugt, aber wie gesagt, das war halt ein autoritärer Mann. Ich habe müssen lange warten, bis ich mich mal getraut habe, da was zu sagen. ... Dann haben wir keine Schweizer mehr gehabt. D a habe ich dann in den Stall müssen. Dann habe ich funktioniert als Arbeiter und Melkmann. Wofür man früher mehrere Personen gehabt hat, nämlich zum Viehstall machen, das mußte ich jetzt tun, also melken und nebenher misten und füttern. Mein Vater hat im Stall keinen Finger krumm gemacht. Von Stallarbeit hat der überhaupt nichts wissen wollen.... Das ist noch ein bißchen ein Bauer vom alten Schlag gewesen, so wie es die großen Bauern waren.« 244
Als Fazit können wir in den Handlungsmustern der Landwirte in der Bundesrepublik und der D D R Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen. Gemeinsam war ihnen in den fünfziger Jahren das Bestreben, die Weiterexistenz ihrer Betriebe zu sichern. In beiden deutschen Staaten genoß die bäuerliche Selbständigkeit und der Besitz des eigenen Bodens eine hohe Wertschätzung unter den Bauern. Diese Fixierung auf den Grundbesitz und die bäuerliche Betriebsautonomie verweist auf den Fortbestand einer traditionellen bäuerlichen Mentalität. Während diese mentale Prägung der Bauern in der Bundesrepublik nicht in Frage gestellt wurde, ist ihr Erhalt in der D D R , wo ein privatbesitzfeindliches Klima vorherrschte, um so bemerkenswerter. Die Beharrungskraft dieser Einstellungen und Werte trug dazu bei, daß die Bauern der D D R so lange wie möglich den Sozialisierungsbestrebungen trotzten, obwohl damit auch wirtschaftliche Nachteile verbunden sein konnten. 244 Zeitzeugeninterview Bs 1.
180
In anderen Bereichen hingegen sind bäuerliche Handlungsmuster zu beobachten, die von einer Anpassung an geänderte Bedingungen zeugen. Sowohl die ostdeutschen wie die westdeutschen Bauern - besonders die der jüngeren Generation - waren bereit, ihre Betriebsführung nach marktgerechten und ökonomisch rationalen Kriterien auszurichten. Damit reagierten sie auf den wirtschaftlichen Druck und entwickelten Strategien, die das Ziel verfolgten, möglichst gewinnbringend zu wirtschaften. Ost-West-Unterschiede ergaben sich dabei aus den Zwängen und Spielräumen, welche die jeweils vorgegebenen Rahmenbedingungen mit sich brachten. Da in der D D R viele Produktionsmittel für die privaten Landwirte nicht zur Verfügung standen, konnten diese ihre Betriebe, anders als in der Bundesrepublik, nicht mechanisieren. Während die bundesdeutschen Bauern ihre Höfe durch den Ausbau der Wirtschaftsgebäude und die Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzfläche aufstockten und so ihre betriebliche Rentabilität erhöhten, waren diese Maßnahmen für die DDR-Landwirte auf Grund des Ablieferungssystems nicht attraktiv. Auch Spezialisierungsbestrebungen wurden durch die strengen Anbau- und Ablieferungsauflagen in der D D R eingeschränkt. Anstelle der Landaufstockungen entschieden sich die ostdeutschen Bauern für die gezielte Abgabe von Land, soweit dies möglich war. Mit dieser Strategie handelten auch sie betriebswirtschaftlich rational, denn so konnten sie in eine günstigere Ablieferungsklasse gelangen. Die fehlende Mechanisierung und den Rückgang der familienfremden Arbeitskräfte versuchten sie zu kompensieren, indem sie die gewachsenen reziproken Austauschbeziehungen weiterhin aufrechterhielten. Die früheren Arbeitsbeziehungen zwischen den Bauern und der nicht-bäuerlichen Bevölkerung bestanden sogar nach der Kollektivierung fort, wenn auch in der gewandelten Form der Ernteeinsätze für die LPG. In der Bundesrepublik gingen solche Beziehungen mit der Mechanisierung, die die individuelle, von fremder Hilfe unabhängige Produktion ermöglichte, verloren. Die allmählich einsetzende Resignation der Bauern in der D D R , die dazu führte, daß die Beharrung auf betrieblicher Selbständigkeit Ende der fünfziger Jahre zu bröckeln begann, ist auf die restriktive Agrarpolitik zurückzuführen. Diese hatte den Bauern seit Jahren das selbständige Wirtschaften erschwert und schließlich auch die Hoffnungen auf eine Zukunft der privaten Landwirtschaft zerstört. Dennoch bleibt zu betonen, daß es einer zwangsweisen Kollektivierung bedurfte, u m einen großen Teil der DDR-Bauern zur Aufgabe ihrer Selbständigkeit zu bewegen. Doch selbst nachdem die Kollektivierung vollständig durchgesetzt war, versuchten sie, ihre Eigenständigkeit partiell zu erhalten, indem sie den LPGs vom Typ I den Vorzug gaben und ihre individuelle Hauswirtschaft ausbauten. Das Bestreben der westdeutschen Landwirte, ihre selbständige landwirtschaftliche Existenz zu sichern, wurde hingegen durch die fortwährende agrarpolitische Propagierung des bäuerlichen Familienbetriebs ideologisch und materiell unterstützt. Trotzdem war auch in der Bundesrepu181
blik das bäuerliche Ideal der Selbständigkeit nicht mehr ungebrochen, denn besonders die kleinbäuerlichen Hofnachfolger gaben ihre Betriebe zugunsten ihrer nicht-landwirtschaftlichen Berufe auf, die ihnen ein ausreichendes und in der Regel auch höheres Einkommen garantierten.
182
III. Kommunalpolitik und politische Partizipation
Nach einer einführenden Beschreibung kommunalpolitischer Strukturen und Institutionen in der D D R und der Bundesrepublik untersuche ich im folgenden Kapitel, in welcher Weise der Zentralstaat in der D D R auf der kommunalpolitischen Ebene intervenierte und wie sich das Verhältnis zwischen den kommunalen Organen als den »örtlichen Vertretern der Staatsmacht« und der lokalen Bevölkerung entwickelte. Ferner beschäftige ich mich mit der Frage, welche Möglichkeiten der politischen Partizipation die Bürger in beiden deutschen Staaten auf Gemeindeebene hatten und wie der sozialistische Staat versuchte, die Bevölkerung politisch einzubinden und zu mobilisieren.
1. Die Kommunalverfassungen: Struktur und Funktionen kommunalpolitischer Organe 1.1. Politisches System und kommunalpolitische
Strukturen in der
DDR
Der Staatsaufbau und das politische System der D D R war durch das Prinzip der Zentralverwaltung gekennzeichnet. Diese Form des Staatsaufbaus entsprach dem aus der Sowjetunion übernommenen Organisationsprinzip des »demokratischen Zentralismus«. Die Anwendung dieses Prinzips bedeutete, daß grundlegende Entscheidungen über die Staatspolitik und ihre Durchführung auf zentraler Ebene gefällt wurden und für alle nachgeordneten Organe verbindlich waren. Diese Praxis gründete in der marxistisch-leninistischen Staatslehre, nach der der Staat das Instrument der herrschenden Klasse zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele ist. Zugleich war damit ein Instrument geschaffen, die Kommunen in die zentrale Leitung des Staatsapparates einzubinden. Die Verwaltungs- und Gebietsreform von 1952 war ein wesentlicher Schritt, um die Zentralverwaltung zu stärken. Die Neukonstitutierungder Bezirksverwaltungen, die an die Stelle der Landtage traten, sowie die Neuordnung der Kreise, welche die Gebiete der Kreisverwaltungen verkleinerte, waren von dem Ziel geleitet, die Kontroll- und Koordinationsfunktionen der Zentralverwaltung gegenüber den unteren Ebenen effizienter zu gestalten.1 Mit den Verwal1 Siehe dazu: Hauschild, S. 20ff.
183
tungsreformen von 1952 wurde der hierarchisch gegliederte, zentralisierte Einheitsstaat geschaffen. Unterhalb der Zentralregierungsebene bestand ein dreistufig gegliedertes System der örtlichen Organe der Staatsmacht: die Bezirkstage, die Kreistage und die Gemeindevertretungen. Die örtlichen Volksvertretungen waren dem Weisungsrecht der Organe des Kreises unterstellt, ihnen verantwortlich und rechenschaftspflichtig. Ihre Hauptaufgabe war die Durchführung bereits beschlossener Maßnahmen. Ihnen blieb nur ein geringer eigener Entscheidungsspielraum, der sich vor allem auf die Form der Durchführung bezog, weniger auf den Inhalt der Maßnahmen. Das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden war damit faktisch aufgehoben. 2 In der Verfassung der D D R von 1949 findet sich das kommunale Selbstverwaltungsrecht folgendermaßen formuliert: »(1) Gemeinden und Gemeindeverbände haben das Recht der Selbstverwaltung innerhalb der Gesetze der Republik und der Länder. (2) Zu den Selbstverwaltungsaufgaben gehören die Entscheidung und Durchführung aller öffentlichen Angelegenheiten, die das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes betreffen. Jede Aufgabe ist vom untersten dazu geeigneten Verband zu erfüllen.« 3
Das so festgelegte Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden wurde in der D D R von Anfang an zentralstaatlich interpretiert. Die Kommunen waren der zentralen Staatsverwaltung untergeordnet, welche Verwaltungsaufgaben an die Kommunalverwaltungen delegierte. Zunächst wird dies im hierarchischen Prinzip der Verwaltungsstrukturen, das bereits in der Gemeindeordnung von 1946 festgelegt worden war, deutlich. Darin war eine untergeordnete Stellung der Gemeinden gegenüber dem Kreistag vorgesehen. Die übergeordnete Vertretungskörperschaft konnte Maßnahmen, die von den Gemeinden getroffen worden waren, als Folge von Beschwerden aufheben. Bereits kurz nach der Gründung der D D R wurden die Befugnisse der zentralen staatlichen Regierungs- und Verwaltungsorgane ausgebaut und ihre Stellung gegenüber der regionalen und kommunalen Ebene gestärkt. Die Zentralisierung setzte zuerst im Bereich der staatlichen Wirtschaftsleitung und der öffentlichen Haushalts- und Finanzwirtschaft ein. Die schrittweise Beseitigung der wirtschaftlichen und finanziellen Selbständigkeit der Gemeinden höhlte schließlich die Grundlage der kommunalen Selbstverwaltung aus. Seit 1948/49 wurden den Gemeindeverwaltungen kommunale Aufgaben entzogen und in sogenannte Kommunalwirtschaftsunternehmen überführt. 1950 erfolgte mit der Einführung der Staatlichen Plankommission ein wesentlicher Schritt zu einer zentral gelenkten
2 Siehe dazu: Bartsch, S. 109; Städte und Gemeinden, S. 6ff. Zum Staatsapparat und zum demokratischen Zentralismus siehe auch: Neugebauer, S. 129-136; König, S. 28ff. 3 Art. 139 der DDR-Verfassung 1949, zitiert nach: Hauschild, S. 51.
184
Wirtschaftsplanung und -Verwaltung. In demselben Jahr wurde über eine Reform des öffentlichen Haushaltswesens die Grundlage für einen einheitlichen Staatshaushalt der D D R geschaffen, der auch die Einzelhaushalte der Gemeinden einschloß. Die Gemeinden verloren damit ihre Finanzhoheit. 4 Der formale Aufbau der kommunalen Organe entsprach dem in der Bundesrepublik gültigen Prinzip, auch wenn die Bezeichnungen differierten. Die politischen Institutionen setzten sich zusammen aus dem Gemeindeparlament (Gemeindevertretung), der Exekutive (Rat der Gemeinde) sowie dem Chef der Verwaltung (Bürgermeister). Die Arbeit der Gemeindevertretungen wurde nach den klassischen parlamentarischen Regeln organisiert. Der Rat der Gemeinde, der ebenso wie der Bürgermeister von der Gemeindevertretung gewählt wurde, war nach dem Prinzip der doppelten Unterstellung der Volksvertretung und dem übergeordneten Rat des Kreises verantwortlich und spielte eine entscheidende Rolle bei der Durchsetzung der Beschlüsse der SED und der Verwirklichung der zentralistischen Staatspolitik. Die Instanz des Bürgermeisters wurde 1958 als selbständiges Organ abgeschafft. Fortan stand der Vorsitzende des Rates der Kommunalverwaltung vor, trug allerdings weiterhin die Amtsbezeichnung »Bürgermeister«. Fachkommissionen, die sich aus Gemeindevertretern und sachkundigen Bürgern zusammensetzten, sollten die Arbeit der kommunalen Parlamente unterstützen. Sie bereiteten Beschlüsse vor und kontrollierten ihre spätere Durchführung. Grundlage für alle politischen Entscheidungen waren die Parteibeschlüsse der SED. In ihren Händen lag die staatliche Macht, denn sie hatte sich die wesentlichen Führungspositionen gesichert und setzte alle Beschlüsse ihres Politbüros in Gesetzen und Verordnungen durch. Ihren Führungsanspruch begründete sie mit der marxistisch-leninistischen Ideologie, nach der ihr es zukam, als »Avantgarde der Arbeiterklasse« die Geschicke des »Arbeiter- und Bauernstaats« zu leiten.5 Zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele hatten die Kommunisten gleich 1945 mit dem Aufbau von einheitlichen Massenorganisationen begonnen, die ebenso wie die Blockparteien die Führungsrolle der KPD bzw. SED anzuerkennen hatten. Die wichtigsten Organisationen, die auch auf kommunalpolitischer Ebene eine Rolle spielten, waren der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB), die Freie Deutsche Jugend (FDJ), die VdgB, der Demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD) sowie die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF). Alle Parteien und Massenorganisationen waren unter dem Dach der Nationalen Front (NF) zusammengefaßt. Deren Funktion bestand darin, alle politischen und gesellschaftlichen Vereinigungen in die sozialistische Politik einzubinden, die nach ihrer spezifischen 4 Vgl. dazu: Schneider. 5 Z u r Führungsrolle der SED vgl. Henkel, S. 88fi.; Lieser-Triebnigg, S. 18ff.; Herbst u.a., S. 875923
185
Interessenlage keinen Anlaß gehabt hätten, ein dauerhaftes Bündnis mit der SED einzugehen. Auf kommunaler Ebene agierte die N F in Orts- und Wohnbezirksausschüssen, die durch ehrenamtliche Kräfte getragen wurden. Z u gleich gehörten auch die Vorsitzenden der Gemeinderäte den Ausschüssen an. Eine der Hauptaufgaben der N F war es seit 1950, die Wahlen vorzubereiten und durchzuführen, so auch die Wahl der Gemeindevertretung alle vier Jahre. Die Wahlvorschläge der Parteien und Massenorganisationen, die ebenfalls eigene Kandidaten aufstellten, wurden von der N F in einer Einheitsliste zusammengefaßt. Das Wahlsystem nach Einheitslisten bedeutete, daß nicht frei gewählt werden konnte, denn jede Partei und Massenorganisation erhielt ihre Sitze nach einem bereits vorher feststehenden Schlüssel. Da bei der Auswahl der Kandidaten für die Massenorganisationen darauf geachtet wurde, daß sie möglichst zugleich auch der SED angehörten, besaß diese Partei immer die Mehrheit. Die Wahlen dienten nicht einer Entscheidungsfindung, denn nach dem marxistisch-leninistischen Verständnis war die Entscheidung, wer die Regierungsmacht ausüben sollte, bereits endgültig getroffen. Der Sinn der Wahl bestand vielmehr darin, die Inhaber der politischen Macht zu bestätigen. Die Nationale Front veranlaßte seit Anfang der fünfziger Jahre auch die Bildung sogenannter »Haus- und Hofgemeinschaften«, die den Zweck hatten, die »sozialistischen Beziehungen« zwischen den Bürgern zu pflegen. Ferner sollten diese Gemeinschaften aber auch praktische Probleme, die sich aus dem Zusammenleben ergaben, lösen und als Interessengemeinschaften gegenüber den staatlichen Organen fungieren. Seit 1951 war die N F auch Trägerin des Nationalen Aufbauwerks (NAW), einer Bewegung, die innerhalb von Kommunen freiwillige und unbezahlte Arbeitseinsätze organisieren sollte. Ihre Projekte betrafen vor allem Baumaßnahmen in öffentlichen und sozialen Einrichtungen.6 Die Aufforderung des Staates an die Bürger, sich in diesen Institutionen zu betätigen, erwuchs aus der Auffassung, daß sich das »sozialistische Bewußtsein« des einzelnen nur weiterentwickeln würde, wenn er sich am gesellschaftlichen und politischen Leben beteiligte. Zugleich galten diese Vereinigungen auch als Erziehungsinstanzen, in denen die marxistisch-leninistische Weltanschauung sowie ein umfassendes System moralischer Werte und Normen vermittelt wurden und somit die Entwicklung eines »sozialistischen Bewußtseins« förderten und lenkten. 7
6 Zu den Wahlen und zur Nationalen Front siehe: Henkel, S. 97ff.; Die Nationale Front; Völkel, S. 112ff. 7 M.E. Müller, S. 26ff.; Krambach, S. 18ff.
186
1.2. Kommunalpolitische
Strukturen in der Bundesrepublik
in vergleichender Perspektive
Im föderalistischen System der Bundesrepublik untersteht die Kommunalordnung den Ländern. Aus diesem Grund sind in den Bundesländern unterschiedliche Kommunalverfassungen in Kraft. Entsprechend der Auswahl des westdeutschen Untersuchungsgebiets wird im folgenden auf die Besonderheiten der baden-württembergischen Kommunalverfassung verwiesen. Die Gemeindeordnungen, die in der SBZ und in den westlichen Besatzungszonen erlassen wurden, weisen auf den ersten Blick deutliche Ähnlichkeiten auf. Dennoch ergaben sich durch die Rechtsauslegung in der Verwaltungspraxis erhebliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, die sich mit der Modifikation der Gemeindeordnungen künftig noch wesentlich vertieften sollten. Grundprinzip aller kommunalen Ordnungen Westdeutschlands ist die weitgehende Selbstverwaltung der Gemeinden. So heißt es etwa in der Gemeindeordnung Baden-Württembergs: »Die Gemeinden verwalten in ihrem Gebiet alle öffentlichen Aufgaben allein und unter eigener Verantwortung, soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen.« 8 Inhaltlich unterschied sich diese Definition des Selbstverwaltungsrechts kaum von den Ausführungen der DDR-Verfassung von 1949. Erhebliche Differenzen gab es jedoch in der Art und Weise, wie diese in der Verwaltungspraxis ausgelegt und umgesetzt wurde. Die Gemeinden waren und sind ein wesentliches Element im demokratischen System der Bundesrepublik und haben eigenständigen Charakter. Der Staatseinfluß auf die kommunale Verwaltung sollte zurückgedrängt werden. Den Kommunen wird ein weiter Raum zugestanden, in dem sie selber entscheiden können, wie sie ihre Angelegenheiten regeln, welche Schwerpunkte sie für den Einsatz ihrer Mittel legen und in welchem Maß sie ihre Bürger zu Leistungen für das Gemeinwesen heranziehen wollen. In die Zuständigkeit der Gemeinden fallen die Versorgung mit kommunalen Dienstleistungen, bestimmte Aufgaben der Wohlfahrt und des Gesundheitswesens - Bereiche, die auch die DDR-Kommunen zu verwalten hatten. In den Fragen der kommunalen Wohnungswirtschaft hatten die Gemeinden in der Bundesrepublik weit geringere Kompetenzen als die ostdeutschen Kommunalverwaltungen. Seit die Wohnraumbewirtschaftung in der Bundesrepublik Anfang der sechziger Jahre abgeschafft worden war, wird die Wohnungsversorgung zum größten Teil privatwirtschaftlich geregelt, während sie in der D D R auch danach staatlich reglementiert blieb. In eigener Regie führen die Kommunen der Bundesrepublik die Raumplanung in ihrem Z u ständigkeitsbereich durch, sie entscheiden selbständig über Industrieansiedlung, Wirtschaftsförderung und den Ausbau der kommunalen Infrastruktur, 8 G O Baden-Württemberg, § 1, zitiert nach: Hauschild, S. 47.
187
Bereiche, die in der D D R durch die zentrale Planung abgedeckt wurden. Das ungleiche Selbstverwaltungsprinzip wird auch im Haushaltsrecht offenbar. Während in der Bundesrepublik die Gemeinden ihre eigene Finanzhoheit besitzen und sowohl über ihre eigenen Steuereinnahmen als auch über die Schlüsselzuweisungen des Landes frei verfügen können, waren die kommunalen Haushalte in der D D R an zentrale Finanzzuweisungen und Planvorgaben gebunden. Selbst die Eigeneinnahmen der Gemeinden standen dort nicht zur freien Disposition. Die kommunalpolitischen Organe in der Bundesrepublik setzen sich aus dem Gemeinderat (Abstimmungskörperschaft), der Gemeindeverwaltung (Exekutive) und dem Bürgermeister (Chef der Verwaltung) zusammen. In der Bundesrepublik gilt das Prinzip der Allzuständigkeit des Gemeinderats. Er ist Beschlußkörperschaft, und kann zugleich den Verwaltungen Weisungen erteilen, wie bestimmte Aufgaben zu lösen sind. Seine Befugnisse sind daher von der Exekutive nicht genau getrennt. Ebenso wie in der D D R sehen die Kommunalordnungen der Bundesrepublik die Bildung von Ausschüssen vor, die neben Gemeinderäten auch Bürger ohne Mandat einbeziehen sollen. Ihre Aufgabe ist es, Parlamentsbeschlüsse vorzubereiten und ihre spätere Durchführung zu kontrollieren. Der Bürgermeister ist in manchen Bundesländern wie in Baden-Württemberg zugleich stimmberechtigter Vorsitzender des Gemeinderats. Dort erfolgt die Wahl des Bürgermeisters - dessen Amtszeit acht, bei einer Zweitwahl sogar zwölf Jahre dauert - durch eine Direktwahl. In kleineren Gemeinden nimmt der Bürgermeister zugleich die Aufgaben der Gemeindeverwaltung wahr. Damit kommt dem Bürgermeister in Baden-Württemberg eine Schlüsselposition in der Gemeinde zu. Die Länge der Legislaturperioden kommunaler Vertretungen sind in den Ländern der Bundesrepublik uneinheitlich geregelt. In Baden-Württemberg galt bis 1973 das Rollierende System, d.h. daß alle drei Jahre lediglich die Hälfte der Abgeordneten neu gewählt wurde; die andere Hälfte hatte eine überschneidende Legislaturperiode. 9
2. Staatliche Intervention u n d k o m m u n a l e Politik Am Beispiel von Niederzimmern soll die Verknüpfung von Zentralstaat und kommunalen Organen, auch als »örtliche Vertretung der Staatsmacht« bezeichnet, konkretisiert werden. So untersucht die Studie, in welche Verwaltungsbereiche der Gemeinde sich die übergeordneten Behörden einmischten, an wel9 Z u den bundesdeutschen Kommunalstrukturen siehe: Städte und Gemeinden; Gisevius·, Wehling,.
188
che zentralstaatlichen Vorgaben die kommunalen Organe gebunden waren und welche Methoden der Einflußnahme die übergeordneten Behörden anwandten, d.h. aufweiche Weise der vorgegebene politische Kurs durchgesetzt wurde. In einem zweiten Schritt wird danach gefragt, wie die beteiligten Kommunalpolitiker darauf reagierten und wie erfolgreich sie auf den sozialistischen Staat eingeschworen werden konnten. Ein weiterer Abschnitt behandelt das Verhältnis von Kommunalpolitikern und Einwohnerschaft. Es soll geklärt werden, inwieweit die kommunalpolitischen Organe nur als Instrumente der Staatsmacht in ihrer Gemeinde fungierten oder ob sie auch die Interessen der dörflichen Bevölkerung vertraten. Die eingangs gestellte Frage nach der Einflußnahme des Staats auf die kommunale Politik läßt sich auf die westdeutsche Gemeinde wegen der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen in der Bundesrepublik nicht übertragen. Das dort geltende Prinzip der Selbstverwaltung der Gemeinden wird durch die Kommunalaufsicht des Landes im Grundsatz nicht eingeschränkt. Den Aufsichtsbehörden obliegt es lediglich sicherzustellen, daß die Gemeinden ihre Aufgaben im Rahmen der für sie geltenden Gesetze wahrnehmen. 10 Eine vergleichende Analyse kann für diesen Punkt daher nicht durchgeführt werden. Bei der Frage des Verhältnisses zwischen kommunalen Organen und Bevölkerung läßt sich hingegen durch einen Vergleich mit der westdeutschen Untersuchungsgemeinde überprüfen, ob die spezifischen kommunalpolitischen Rahmenbedingungen in der D D R diese Beziehung in besonderer Weise prägten und ob sich Unterschiede in der Bürgernähe der kommunalen Organe zeigen.
2.1. Die Durchsetzung zentralstaatlicher Entscheidungen in der Gemeinde
Niederzimmern
Die Akten der Gemeindeverwaltung belegen eine weitgehende Einmischung des Kreisrates, der kommunalen Aufsichtsbehörde, in die Angelegenheiten der Gemeinde. Die Kommunalpolitiker handelten nach den Anweisungen »von oben« und wurden ständig durch die Kreisbehörden kontrolliert. In der Dorfplanung wird die Bevormundung der Gemeinden besonders deutlich. Die Kommunen waren verpflichtet, jedes Jahr Pläne über die Vorhaben des jeweils
10 Anzumerken ist jedoch, daß sich auch in den westdeutschen Gemeinden allmählich eine tendenzielle Verlagerung der Entscheidungskompetenzen abzeichnet, die aber den hier untersuchten Zeitraum kaum betrifft. Seit Ende der sechziger Jahre werden die Gemeinden durch die Einrichtung von regionalen Planungsbehörden verstärkt in überlokale Systeme integriert. Diese Einbindung in gemeindeübergreifende wirtschaftliche und planerische Zusammenhänge ist jedoch in ihren Auswirkungen auf die Autonomie der Gemeinden keineswegs mit der zentralstaatlichen Einbindung der DDR-Gemeinden zu vergleichen, da in der Bundesrepublik nur ein allgemeiner Rahmen für längerfristige Entwicklungslinien abgestecktwurde. Siehedazu:Jauch/Kromka, S. 83 ff.
189
folgenden Jahres, zum Teil auch längerfristige Pläne - Zwei- oder Fünf jahrpläne - aufzustellen und darin die Vorgaben der Kreisplanung für ihren Verwaltungsbereich umzusetzen.11 Bei der Formulierung der Dorfpläne -wurde regelmäßig- in einem »Prolog« - auf gesamtstaatlichen Pläne und Vorgaben Bezug genommen. Diese obligatorische rhetorische Übung symbolisierte zugleich die Unterordnung der Gemeinden gegenüber der Staatsmacht. So heißt es zum Beispiel 1952: » Z u r E r f ü l l u n g dieses Plans, gegen Remilitarisierung - für Frieden, Einheit u n d A u f bau, zur Steigerung der friedlichen Industrieproduktion u n d der landwirtschaftlichen E r z e u g u n g . . . soll u n s e r D o r f w i r t s c h a f t s p l a n m i t b e i t r a g e n , d i e g e s e t z t e n Z i e l e z u erreichen.«12
Die Wirtschaftspläne der Gemeinde enthielten detaillierte Maßnahmen und Vorschriften zur Leistungssteigerung in der Landwirtschaft, aber auch zum Ausbau der dörflichen Infrastruktur, der sozialen Einrichtungen, Verordnungen zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit sowie Aufgaben zur »Entwicklung des geistigen und kulturellen Lebens«. Daneben wurden separate Haushalts- und Jugendförderpläne aufgestellt. Die Pläne mußten von den Kreisbehörden genehmigt und ihre Durchführung kontrolliert werden. Hinweise darauf, ob die Kreisbehörden auch Pläne zurückwiesen oder konkrete Änderungen verlangten, geben die Akten der Gemeinde Niederzimmern nicht. Die Beanstandung eines noch fehlenden Jugendförderplans durch die Staatsanwaltschaft deutet jedoch daraufhin, daß die übergeordneten Behörden auf der Aufstellung der Pläne streng bestanden. Die Staatsanwaltschaft - von den Kreisbehörden wegen eines vermeintlichen Gesetzesbruches durch den Rat der Gemeinde eingeschaltet - forderte in harschen Worten von der Gemeindeverwaltung Niederzimmerns: » I m Interesse der Wiederherstellung der Gesetzlichkeit u n d der W a h r u n g der Rechte d e r J u g e n d , w e i s e ich S i e g e m ä ß § 13, A b s . 1 d e s G e s e t z e s [ J u g e n d f ö r d e r g e s e t z v o n 1950, d . V ] d a r a u f h i n , d a ß S i e u n v e r z ü g l i c h alle M a ß n a h m e n z u r W i e d e r h e r s t e l l u n g der Gesetzlichkeit einzuleiten haben.«13
11 Die U m s e t z u n g der gesamtstaatlichen Pläne erfolgte schrittweise über die verschiedenen Instanzen der staatlichen Verwaltung. So wurden die zentralen Vorgaben zunächst von den Bezirksverwaltungen auf ihr jeweiliges Territorium übertragen. Diese Pläne auf Bezirksebene bildeten wiederum den Rahmen für die Planung auf Kreisebene . D i e Kreisverwaltungen waren schließlich dafür verantwortlich, daß ihre eigenen Planvorgaben in den Plänen der einzelnen Gemeinden berücksichtigt wurden. In der folgenden Darstellung beschränke ich mich auf die unterste Ebene staatlicher Einflußnahme, der Intervention der Kreisbehörden bei kommunalen Entscheidungen. 12 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 77. 13 Brief der Staatsanwaltschaft Weimar an den Rat der Gemeinde von 1959. Wie sich herausstellen sollte, handelte es sich u m einen Irrtum seitens der Behörde, da die Gemeinde ihren J u gendförderplan bereits eingereicht hatte, dieser jedoch noch nicht an der ansprechenden Stelle angekommen war. Gemeindearchiv Niederzimmern Β 19.
190
Auch die Arbeitsweise der kommunalen Organe wurde vom Rat des Kreises kontrolliert und regelmäßig beaufsichtigt. So mußten nicht nur alle Protokolle der Gemeindevertreter- und Ratssitzungen vorgelegt werden; es waren von Zeit zu Zeit auch Vertreter der Kreisbehörden bei Sitzungen anwesend. In größeren Zeitabständen besuchten Instrukteure des Kreises die Gemeinde, vor allem dann, wenn Mißstände festgestellt wurden, die auf eine unzureichende Arbeit der kommunalen Organe hinwiesen. So erfolgte 1954 eine umfassende Untersuchung, als sich in der Volksbefragung zum EVG-Vertrag14 nicht alle Stimmberechtigten wie erwartet gegen den Vertrag ausgesprochen hatten und zum Teil ungültige Stimmen abgegeben worden waren. Die untersuchenden Behörden vermuteten eine ungenügende Agitationsarbeit der Volksvertreter Niederzimmerns in ihrer Gemeinde und gaben konkrete Anweisungen, wie in Zukunft zu verfahren sei: »eine sofortige Einberufung einer Gemeindevertreter- oder Gemeinderatssitzung, u m eine Auswertung der Volksbefragung vorzunehmen. D i e G e m e i n d e m u ß in Verbind u n g mit der Nationalen Front und d e m Ortsblock der demokratischen Parteien und Massenorganisationen verstärkte Aufklärungsarbeit leisten mit d e m Ziel, die Einwohner über den Charakter der E V G aufzuklären.« 1 5
In weiteren Gemeindeprüfungen wurde vor allem die Arbeit der kommunalen Organe bemängelt. Die Protokolle dokumentieren, daß die Kommunalpolitiker eine derartige Kritik zumindest von den Aufsichtsbehörden widerspruchslos hinnahmen und die Anweisungen offenbar auf eine fast demütig anmutende Art akzeptierten: »Die folgende Aussprache gab viele gute Hinweise, die dazu beitrugen, daß sich die Arbeit des Rats der G e m e i n d e verbessern konnte. D e r Rat der G e m e i n d e wird alles daran setzen, daß die gegebenen Hinweise und Ratschläge weiterhin verfolgt werden und die guten Ansätze auch weiterhin zu guten Taten führen.« 1 6
Der Zentralstaat schränkte die Selbstverwaltung und Eigenverantwortlichkeit der Gemeinden für ihr Territorium nicht nur empfindlich ein, sondern delegierte auch Aufgaben an diese, die weit über die Alltagsgeschäfte der Kommunalpolitik - wie etwa in der Bundesrepublik üblich - hinausgingen. So finden wir im Arbeitsplan der Gemeindevertretung für 1959 folgende Zielsetzungen: »1. D e r verstärkte K a m p f u m einen Friedensvertrag mit Deutschland u m die Einheit Deutschlands und gegen die atomare Aufrüstung Westdeutschlands; 2. D i e E r f ü l -
14 Vertrag der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Gegen die Beteiligung der Bundesrepublik an diesem Vertrag hatte die Regierung der D D R nachdrücklich protestiert und eine umfassende Gegenagitation in der DDR betrieben, die in der genannten Volksbefragung gipfelte. 15 Gemeindearchiv Niederzimmem Β 13. 16 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 26; weitere Gemeindeprüfungen, die ebenfalls die Arbeit der kommunalen Organe betrafen, sind in den Akten nachgewiesen: Β 15, Β 16.
191
lung und Übererfüllung des Volkswirtschaftsplans zu Ehren des 10. Jahrestags der DDR«17 Diese Aufgaben galten als Basisarbeit, um die sozialistische Gesellschaft zu verwirklichen und den Staat zu stärken. Es zeigt sich dabei nicht nur, daß die Gemeindevertretung und der Rat der Gemeinde für gesamtstaatliche Belange instrumentalisiert wurden, sondern auch der Anspruch der S E D , auf allen institutionellen Ebenen die Grundlinien ihrer Politik durchzusetzen. In den Arbeitsplänen der kommunalen Organe wurde regelmäßig Bezug auf die Beschlüsse des jeweils letzten Parteitages der S E D genommen, aus denen dann die unmittelbaren politischen Zielsetzungen der Kommunalorgane abgeleitet wurden. Nach dem Aufgabenkatalog, den sich die Gemeindevertreter stellten, sollten sie beispielsweise Diskussionen über die Außenministerkonferenz 18 in den Haus- und Hofgemeinschaften durchführen, den Briefwechsel mit westdeutschen Gemeinden verstärken 19 oder die Sozialisierung in der Landwirtschaft vorantreiben. Diese politisch-agitatorischen Funktionen wie die politische »Aufklärungsarbeit«, die Mobilisierung der Bevölkerung und der Einsatz für den gesellschaftlichen und ökonomischen U m b a u der D D R ließen sich für Niederzimmern ab Mitte der fünfziger Jahre nachweisen. Von den Personen, die kommunalpolitische Verantwortung trugen, wurde in der D D R unbedingte Loyalität gegenüber dem eigenen Staat und die Uberzeugtheit von der Richtigkeit des politischen Kurses gefordert. Die übergeordneten Behörden vertrauten jedoch nicht darauf, daß die Gemeindevertreter und Räte per se die richtige politische Anschauung und Qualifikation mitbrachten. Es wurden regelmäßig Schulungen angeboten, an denen die Volksvertreter teilnehmen mußten. Bei diesen Veranstaltungen, die gewöhnlich in den Wintermonaten einmal pro Monat stattfanden, wurden die Grundlagen des Marxismus-Leninismus gelehrt und über neue Gesetze und Verordnungen informiert. 20 Politische Vorträge, die von Referenten des Kreises oder von ortsansässigen Lehrern gehalten wurden, leiteten von Zeit zu Zeit die Gemeindevertretersitzungen ein. Diese Referate hatten den Charakter politischer Agitation und unterrichteten die Abgeordneten über den Inhalt von Parteitagsbeschlüssen, über staatliche Pläne sowie außenpolitische Themen, wobei immer wieder die Politik der Bundesrepublik und anderer westlichen Staaten angeprangert wurde. 21 17 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 19, ähnliche Aufgaben und Formulierungen auch in den Arbeitsplänen der übrigen Jahre seit 1956; Β 18, Β 22, Β 23, Β 24, Β 25, Β 26. 18 Gemeint ist die Deutschlandkonferenz der Außenminister der Vier Mächte 1959 in G e n f mit Besucherdelegationen aus der Bundesrepublik und der D D R . 19 Die Gemeinden waren in den fünfziger Jahren aufgefordert worden, mit westdeutschen Gemeinden in Kontakt zu treten, u m fur die Politik der D D R sowie für die deutsche Einheit zu werben. Vgl. Gemeindearchiv Niederzimmern Β 43. 20 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 17, Β 19, Β 22, Β 24, Β 26. 21 Diese Vorträge ziehen sich durch den gesamten Untersuchungszeitraum; Akten Β 9 - B 28.
192
Zunehmend gingen den Rechenschaftsberichten der Gemeindevertretung auch ausufernde Erklärungen und Kommentare voran, die mit der Gemeinde in keinem Zusammenhang standen, sondern die offizielle Meinung der Staatsund Parteiführung wiedergaben. So finden sich beispielsweise in den Eingangspassagen der Rechenschaftsberichte von 1954 und 1955 Abhandlungen über die Schändlichkeit des EVG-Vertrags, über die Bemühungen der D D R und der Sowjetunion um die deutsche Einheit sowie den Imperialismus und die Aggressionsbereitschaft westlicher Staaten. 1961 wurde der Mauerbau gerechtfertigt, behandelt wurde in jenem Jahr ferner der Algerienkrieg, der Parteitag der K P d S U und die sowjetische Überlegenheit in der Weltraumfahrt. Diese propagandistischen Ausführungen nahmen im Laufe der Zeit an U m f a n g zu. U m faßten sie in den fünfziger Jahren noch ein bis zwei Seiten, waren es im folgenden Jahrzehnt bereits drei bis fünf Seiten. 22 Diese Rechenschaftsberichte vermitteln den Eindruck, daß die Gemeindevertreter darin nicht nur die geleistete Arbeit nachzuweisen hatten, sondern auch den Erfolg der politischen Schulungen und ihre staatskonforme Gesinnung. Auf den ersten Blick scheinen sich in den Rechenschaftsberichten Loyalität und Linientreue der Volksvertreter Niederzimmerns gegenüber ihrem Staat widerzuspiegeln sowie deren hohe Bereitschaft, sich für den Aufbau der neuen Gesellschaftsordnung zu engagieren. Anhand von Berichten über politische Einstellungen der Gemeindepolitiker ist zu überprüfen, ob die in den Rechenschaftsberichten bekundete Systemkonformität authentisch war oder ob es sich nur u m rhetorische Übungen handelte, die sich vor allem an den Leserkreis der übergeordneten und kontrollierenden Behörde richteten. Einige Hinweise sprechen dafür, daß systemkonformes politisches Bewußtsein und die Bereitschaft zu politischem Engagement bei vielen Gemeindevertretern nur wenig ausgeprägt waren und sie teilweise zum politischen Kurs der D D R eine distanzierte Haltung bewahrten. Berichte des Bürgermeisters über deren Arbeit, die zum Teil an die Kreisbehörden, zum Teil ermahnend an die Gemeindevertreter selbst gerichtet waren, enthielten häufig Kritik, die die Unzulänglichkeit ihrer politischen Arbeit anprangerte. Daran scheint sich im Laufe der Jahre wenig geändert zu haben, denn Berichte dieses Inhalts sind für den gesamten Untersuchungszeitraum vorhanden. So bemängelte der Bürgermeister 1961 die fehlende Eigeninitiative sowie das Desinteresse der Gemeindevertreter an der Mitarbeit bei der Aufstellung der Pläne: »So kann es auch zur Beurteilung der Arbeit der Gemeindevertreter beitragen, wenn in einem Zeitraum von fast 10 Jahren nur etwa 3 Beschlußvorlagen aus der Reihe der Abgeordneten vorgelegt wurden, während alle übrigen v o m Bürgermeister erarbeitet wurden. Auch die Mitarbeit bei der Aufstellung der Pläne ist trotz mehrfacher AufFor-
22 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 14, Β 24, Β 51.
193
derung zur Einreichung von Vorschlägen auf ganz wenige Ausnahmen beschränkt, wie auch die Diskussion der Pläne vor ihrer Beschlußfassung recht spärlich ist.«23 Ebensowenig waren die Gemeindevertreter geneigt, den »sozialistischen Arbeitsstil« zu verwirklichen. Dieser verlangte von ihnen, die zentralstaatliche Politik, aber auch Gemeindeangelegenheiten in der Bevölkerung zu diskutieren, mit dem Ziel, bestimmte Maßnahmen zu popularisieren: »Der Entwurf zum Dorfplan ist an alle Gemeindevertreter etwa Mitte Februar herausgegeben worden .... Es hätte demnach jeder Gemeindevertreter Zeit genügend gehabt, den Plan in seinem Wirkungsbereich ... zu diskutieren. Es mag auch daran erinnert werden, daß die Sitzungspläne jedem Gemeindevertreter in die Hand gegeben wurden und dies nicht etwa, um sie hinter den Spiegel zu stecken, sondern um zu rechter Zeit mit der Bevölkerung darüber zu sprechen.... Es ist dies ein klarer Beweis dafür, daß sich die Gemeindevertretung noch nicht zu dem sozialistischen Leitungsorgan entwickelt hat, wie es eigentlich sein sollte.... So konzentriert sie sich noch nicht auf die Hauptaufgaben des sozialistischen Aufbaus und entwickelt noch nicht den sozialistischen Arbeitsstil, der die Lösung dieser Aufgaben sichert.«24 Wie in einem Bericht von 1964 kritisiert wurde, beschränkten die Gemeindevertreter ihr politisches Engagement auf die Teilnahme an den Sitzungen. Auch gegenüber dem Aufbau des Sozialismus und der Politik der Staatsführung blieben die Gemeindepolitiker distanziert, wenn nicht sogar ablehnend. So heißt es 1961: »Die Durchsetzung von Beschlüssen von Partei und Regierung hält oft recht schwer. So haben wir z.B. die Erklärung des Staatsrats vom 4.6.60 vor der Volkskammer und die Proklamation der kommunistischen und Arbeiterparteien vom Nov. 1960 in Moskau in einem ausfuhrlichen Referat vor der Gemeindevertretung erläutert. Der Erfolg war ein stummes Anhören ohne jegliche Diskussion. So sind es auch bei allen Problemen, die behandelt werden, nur einige wenige Abgeordnete, die dazu Stellung nehmen und dann auch oft negativ.«25 Besonders in der Kollektivierung der Landwirtschaft wurde die Diskrepanz zwischen den Anforderungen, die an die Volksvertreter gestellt wurden - sie sollten die Genossenschaftsbewegung in der Gemeinde propagieren - , und ihrer persönlichen Meinung offenbar: »Die Stärkung des sozialistischen Sektors... dürfte wohl nicht als ein direktes Verdienst der Gemeindevertretung anzusehen sein, da ein großer Teil der Mitglieder der Gemeindevertretung zu inaktiv ist. In den ersten Jahren des Bestehens der LPG Typ III konnte von einer systematischen Unterstützung seitens der Gemeindevertretung oder des Rates nicht gesprochen werden. Von einer ideologischen Unterstützung durch die 23 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 23. 24 Bericht von 1958, Gemeindearchiv Niederzimmern Β 18, vergleichbare kritische Anmerkungen auch in den Jahren 1960, 1961, 1964; Β 22, Β 23, Β 26. 25 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 23.
194
Gemeindevertretung oder den Rat war noch nicht die Rede.... Eine Aussprache brachte eine gewisse Klärung dahingehend, daß die persönliche Einstellung einiger Mitglieder zur LPG klar und deutlich kritisiert und z.T. vielleicht auch bereinigt wurde. Auch wenn diese Aussprache kein positives Ergebnis in Bezug auf die Stärkung der LPG zeitigte, so schuf sie doch die Voraussetzung für die Maßnahmen, die zur Stärkung der LPG festgelegt werden konnten, so u.a. die persönliche Verantwortlichkeit aller Mitglieder der Gemeindevertretung für die weitere Sozialisierung. Allerdings kann man sich hierbei des Gefühls nicht erwehren, daß dieser Beschluß für einen Teil der Gemeindevertreter doch nur ein rein formaler war, also bisher noch nicht in die Tat umgesetzt wurde.«26 Die Haltung der Gemeindevertreter ist vor dem Hintergrund zu erklären, daß einige selbst von der allgemein unbeliebten Kollektivierung betroffen waren. Von den Bauern unter ihnen wurde verlangt, die Umgestaltung der Landwirtschaft zu fordern, indem sie selbst der L P G beitraten. Sie wurden nicht nur in der Gemeindevertretung, sondern auch öffentlich unter Druck gesetzt. Ein Zeitungsartikel forderte 1958 vier Gemeindevertreter Niederzimmerns namentlich auf sich einer Genossenschaft anzuschließen: »Es kam zum Ausdruck, daß die Gemeindevertreter H., R., R und K. [die Namen sind der V. bekannt], die ja als gewählte Vertreter der Einwohner in erster Linie die sozialistische Entwicklung fördern sollten, sich endlich auch entschließen müßten, den Schritt zur sozialistischen Wirtschaft zu tun. Erst dann handeln sie verantwortlich im Sinne unseres Staats.«27 Bei einer nachhaltig fehlenden Bereitschaft zu staatskonformem Verhalten drohte aber auch die Abberufung aus dem Amt. So wurden 1958 drei Gemeindevertreter - Bauern, die nicht bereit waren, in die L P G einzutreten - mit dem Vorwurf des »Konservatismus« entlassen. Die sich wiederholende Kritik zeugt davon, daß viele Mitglieder der kommunalen Organe nicht dem SED-Ideal typus eines politischen Funktionärs entsprachen. Ihr »sozialistisches Bewußtsein« war wenig ausgeprägt, und sie weigerten sich, den Aufbau des sozialistischen Staats aktiv zu unterstützen. Dennoch fielen in Niederzimmern einzelne Kommunalpolitiker auf, die sich durch ein besonderes Engagement für den sozialistischen Staat profilierten. Sie setzten sich für die Einhaltung der Parteibeschlüsse ein, verteidigten die Regierungspolitik und riefen ihre Kollegen in der Gemeindevertretung zu politischem Engagement auf. Sie mahnten die »Ubererfüllung« der Pläne an, warben für die Kollektivierung sowie für den Beitritt von Jugendlichen zur Volkspolizei. Sie regten wiederholt an, Protestbriefe an die Regierung der 26 Bericht von 1958, Gemeindearchiv Niederzimmern Β 18. Eine vergleichbare Kritik, die ebenfalls die Zurückhaltung der Volksvertreter bei den Werbungen fur die LPG betrifft, ist auch für 1959 (B 19) dokumentiert. 27 Das Volk, 13.7.58.
195
Bundesrepublik zu schreiben und schlugen 1961 vor, mit der Bevölkerung über die Notwendigkeit der Schließung der Grenze zu sprechen. Teilweise nahm ihre Einsatzbereitschaft fast satirische Züge an, wenn sie per Dringlichkeitsantrag forderten, Bilder von Pieck und Grotewohl im Bürgermeisteramt aufzuhängen. 28 Die Durchsicht der Protokolle zeigt, daß es diese Aktivisten waren, die sich in den Sitzungen am häufigsten zu Wort meldeten. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, daß ihre Wortmeldungen überdurchschnittlich häufig dokumentiert wurden, da die Verantwortlichen auf diese Weise die gewünschte Systemkonformität der kommunalen Organe gegenüber der kontrollierenden Behörde beweisen konnten. Diese Abgeordneten, alle langjährige Mitglieder der Gemeindevertretung und des Rats, spielten die Rolle der politischen Scharfmachen in der Kommunalpolitik. Bei ihnen handelte es sich ausnahmslos um SED-Mitglieder, die zum Teil auch beruflich in exponierten Stellungen waren, die Linientreue von ihnen abverlangte. Unter ihnen waren zwei Lehrer, der Leiter der örtlichen Zweigstelle der B H G sowie der Vorsitzende der LPG. Neben diesen Gemeindevertretern war es vor allem der Bürgermeister, der daraufdrängte, die vorgegebenen Spielregeln einzuhalten und die zentral beschlossenen Anordnungen zu verwirklichen. In zunehmendem Maße waren die Bürgermeister vom Kreis eingesetzte Kader, die zuvor eine spezifische Ausbildung erhalten hatten. Bereits seit Beginn der fünfziger Jahre war es Strategie der Kreisbehörden, die oft aus den Gemeinden stammenden Nachkriegsbürgermeister durch entsprechend ausgebildete, systemkonforme Funktionäre zu ersetzen. So heißt es in einem Bericht des Kreisrates über die Arbeit der Bürgermeister 1954: »Unser Bestreben, die Arbeit bei den örtlichen Organen der Staatsmacht in den Gemeinden laufend zu verbessern, führt dazu, daß jene Bürgermeister, die ihren Aufgaben nicht mehr gewachsen sind, durch neue bessere Verwaltungsfunktionäre ersetzt werden. Im Jahre 1953 sind einige der Bürgermeister bereits abgelöst worden.«29
Auch in Niederzimmern war der einheimische Bürgermeister 1952 abgelöst worden; an seine Stelle trat ein Ortsfremder. Wie das Protokoll der Neueinsetzung zeigt, wurden der Gemeindevertretung, die das Recht hatte, den Bürgermeister zu wählen, bei der Kandidatenauswahl nur wenig Mitspracherechte eingeräumt. Die Wahl des eingesetzten Bürgermeisters diente offenbar nur der Bestätigung, wie die Schilderung der Kandidatenvorstellung und des anschließenden Wahlvorganges zeigt:
28 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 9, Β 10, Β 12, Β 13, Β 16, Β 18, Β 19, Β 22, Β 23. 29 ΚΑ Weimar, Rat des Kreises 009.041. Vgl. dazu auch Schier, S. 44, die diese Praxis, nur noch systemloyale Funktionäre einzusetzen, für eine weitere thüringische Gemeinde bestätigte.
196
»Der Vorsitzende verliest zwei Schreiben des Kreisrates Weimar und das dazugehörige Protokoll des Kreis-Gemeindeausschusses betr. die Zurückziehung des bisherigen Bürgermeisters Otto Wagner. Als neuer Bürgermeister ist von der LDP Herr Arthur Schmidtke vorgeschlagen. Anschließend stellt sich Herr Schmidtke der Gem.vertretung vor. Er gibt einen kurzen Lebenslauf bekannt und versichert, daß er seine ganze Kraft fur das Wohl der Gemeinde Niederzimmern einsetzen wird. Die Wahl des Herrn Schmidtke wird von der Gemeindevertretung einstimmig angenommen.«30
Die neu eingesetzten Bürgermeister fühlten sich auf Grund ihrer fehlenden Ortsverbundenheit weitaus stärker ihrer Aufsichtsbehörde verpflichtet als den Einwohnern der Gemeinde. So scheute sich der Bürgermeister Niederzimmerns nicht, in Berichten an die übergeordnete Behörde die Arbeit der kommunalen Organe als unzulänglich anzuprangern oder einzelne Personen namentlich zu denunzieren. In einem Briefwechsel des Bürgermeisters mit dem Kreisrat von 1954, in dem die Kreisbehörde einfordert, die Ablieferungsrückstände der landwirtschaftlichen Produzenten zu beheben, zeugt das Antwortschreiben des Bürgermeisters von dessen Loyalität zu seiner vorgesetzten Behörde. Nachdem er eindrücklich seine bisherigen Bemühungen um die Einhaltung der Ablieferung geschildert hatte, schreibt er: »Ich werde nunmehr nicht zögern, jetzt noch hartnäckige Bauern dem Rat des Kreises zu benennen.«31 Auch die örtliche Parteiorganisation der SED mischte sich in die Arbeit der Gemeindevertretung ein und gab ihr mitunter direkte Handlungsanweisungen. So erarbeitete die SED 1963 einen Plan für die Gemeindevertretung und den Rat zur Entwicklung der politischen Massenarbeit im Dorf Dieser Entwurf wurde von der Gemeindevertretung als Teil ihres Arbeitsplans akzeptiert. Die SED hatte darin die Rolle der örtlichen Parteiorganisation in der Kommunalpolitik formuliert: »Durch die Parteileitung ist eine straffe Kontrolle der systematischen Arbeit der Gemeindevertretung bei der Durchsetzung des Arbeitsplans zu garantieren.«32 Insgesamt zeigen diese Ereignisse, daß es dem Staat in der D D R gelang, seine zentralen Beschlüsse mit Hilfe des Kontrollsystems auch auf kommunaler Ebene umzusetzen. Systemkonformität und Politisierung im sozialistischen Sinne konnten jedoch bei den kommunalpolitischen Kräften nicht durchgängig verankert werden. Diese agierten zwar nicht offen oppositionell gegen das staatliche System, ihre geschilderte passive Haltung deutet aber darauf hin, daß sie sich einer vollen Vereinnahmung verweigerten. Dennoch konnten sie durch den Druck der Kreisbehörden, aber auch durch ihren Bürgermeister sowie die SED in der Gemeinde dazu veranlaßt werden, wenigstens formal den an sie
30 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 10. 31 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 13. 32 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 25, Β 26.
197
gestellten Anforderungen Folge zu leisten. Es scheint so, daß die Gemeindevertreter, die zum größten Teil der alteingesessenen Bevölkerung entstammten, Hemmungen bei der Durchsetzung von möglicherweise unpopulären Entscheidungen hatten und sich von diesen distanzierten, da sie Rücksicht auf ihr persönliches soziales Umfeld zu nehmen hatten. Dies klang 1957 in einer Rede des Bürgermeisters an: »Es dürfte daher wohl unbedingt fehl am Platze sein, wollte man für die Entscheidung denjenigen dafür verantwortlich machen, der als ausführende Person des Kollektivs nunmehr seinen Namen daruntersetzt [gemeint ist der Bürgermeister, d.V]... Bei allen abschlägigen Bescheiden, die ja der Bürgermeister unterschreiben muß, heißt es: der Bürgermeister ist schuld. Ja es hat sich sogar herausgestellt, daß der Rat der Gemeinde hier im Orte vielmehr entgegengekommen ist.«33
2.2. Kommunalverwaltung
und Bevölkerung
Seinem Anspruch gemäß, die Gesellschaft von Grund auf zu verändern, regelte der Staat in der D D R viele Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens in umfassenderWeise. Deswegen waren die kommunalpolitischen Organe in den Gemeinden der D D R für ihre Bürger auch allgegenwärtiger als in den Gemeinden der Bundesrepublik. In der D D R oblag es ihnen - wie bereits gezeigt wurde - , der Bevölkerung Beschlüsse der Regierung und Partei zu vermitteln. Sie kümmerten sich nicht nur um die Einrichtungen der kommunalen Infrastruktur und wachten über die Einhaltung des Volkswirtschaftsplans; sie hatten auch den Auftrag, sich für die Durchsetzung des Sozialismus und für die Erziehung der Bürger zu »sozialistischen Persönlichkeiten« einzusetzen. Zudem sollten sie auf eine angemessene »sozialistische Lebensweise« ihrer Bürger achten und »den Kampf gegen Feindtätigkeit, Fahrlässigkeit, Leichtsinn, Unordnung, Schlamperei und Arbeitsbummelantentum« an der Basis führen, wie im Volkswirtschaftsplan 1966 formuliert worden war.34 Dies führte in Einzelfällen nämlich dann, wenn Einwohner durch nonkonformes Verhalten auffielen - zu empfindlichen Eingriffen in die Privatsphäre des einzelnen. Einen solchen Fall schildert ein Bericht von 1965: »Der Jugendliche L.H. ... wurde wegen schlechter Arbeitsmoral und gröbster Vernachlässigung seiner Wohnverhältnisse vor den Rat der Gemeinde geladen. Ihm wurde letztmalig klargemacht, daß sein Lebenswandel nicht den Forderungen unserer Gesellschaft entspricht. Der Rat der Gemeinde will versuchen, ihm zu helfen und auf eine gerade Bahn zu lenken.«35 33 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 17. 34 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 91. Die hier aufgeführten Aufgaben der Gemeinden sind auch in den anderen Dorfplänen verzeichnet. 35 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 27; in Β 27 und Β 28 weitere Berichte über ähnliche Vorkommnisse.
198
Vergleicht man die Kompetenzen der Gemeindeverwaltungen in Ost und West, wird deutlich, daß diese in der westdeutschen Untersuchungsgemeinde wesentlich eingeschränkter waren. In erster Linie beschäftigten sich die kommunalen Organe der Bundesrepublik mit Maßnahmen des infrastrukturellen Ausbaus, mit der Baugeländeerschließung, den Gemeindesteuern und der Verwaltung des Gemeindebesitzes, d.h. Verpachtungs- und Vermietungsfragen. Dennoch griffen Amtsträger auch dort in manchen Fällen in die persönlichen Belange der Bürger ein. Der Bürgermeister Bernstadts verkörperte nicht nur die Verwaltungsinstanz; seine Rolle in der Gemeinde war vielmehr durch ein quasi-patriarchales Verhältnis zu den Einwohnern geprägt.36 Er übte autoritär anmutende soziale Kontrollfunktionen aus, wenn er in einigen Fällen beim Landratsamt die Verhängung von Wirtshausverboten für sozial auffällige Alkoholiker beantragte oder veranlaßte, daß bestimmte Personen in einer Heilanstalt untergebracht oder vom Amtsgericht entmündigt wurden.37 Andere Aufgaben, die er wahrnahm, entsprechen eher dem fürsorgenden Aspekt einer patriarchalen Beziehung. So vergab er Referenzen, wenn Einwohner diese für Arbeitgeber und Kreditinstitute benötigten. Die Gemeinde übernahm Bürgschaften für Privatkredite oder beschäftigte Einwohner als Gemeindearbeiter, die als soziale Problemfälle galten. Die Motivation hierbei war, Hilfestellung bei der sozialen Eingliederung zu leisten.38 Zu erklären ist die paternalistische Beziehung des Bürgermeisters von Bernstadt zu den Bürgern weniger durch die ihm zugeschriebenen politischen Aufgaben, sondern durch die Autorität, die ein Bürgermeister eines Dorfes als Amtsperson traditionell genoß. Diese Stellung gestattete ihm bzw. verlangte ihm ein Verhalten ab, das paternalistische Züge aufwies. Seine spezifische Rolle ist aber auch in den persönlichen Beziehungen zwischen Bürgermeister und den Bürgern begründet, die in diesem Fall besonders ausgeprägt waren, da der Bürgermeister aus der Gemeinde stammte und 20 Jahre lang, von 1954 bis 1974, der Gemeinde vorstand. Er war nach dem baden-württembergischen Kommunalwahlsystem direkt von der Bevölkerung gewählt worden. Wie seine Wiederwahl mit großer Mehrheit zeigte, erfreute sich sein Arbeitsstil großer Akzeptanz in der Gemeinde. Obwohl der Bürgermeister Niederzimmerns ähnliche Aufgaben der sozialen Kontrolle wahrnahm, ist sein Verhältnis zur Einwohnerschaft kaum als patriarchalisch im traditionellen Sinne zu beschreiben. Als ein von oben eingesetzter Funktionär, der nicht aus der Gemeinde stammte, verkörperte er die Staatsmacht. Auch von der Einwohnerschaft wurde er als Amtsträger ohne eigenes Profil, als Vertreter des übermächtigen Staats wahrgenommen, wie aus einer Äußerung eines Zeitzeugen hervorgeht: 36 Als patriarchalisch soll hier ein Verhältnis gekennzeichnet werden, das zugleich autoritäre und fürsorgliche Elemente enthält. 37 Gemeindearchiv Bernstadt 021.9, 8160-61. 38 Gemeindearchiv Bernstadt 4127, 4676, 4680.
199
»Er mußte durchsetzen. Er mußte das, was von oben angeordnet war, durchsetzen. Zu sagen hatte er ja nicht viel. Als solchen mußte man ihn respektieren. Man konnte ihn praktisch ja nicht rausschmeißen.«39
Vertiefend soll n u n an den Beispielen Landwirtschaft und Wohnungsbewirtschaftung - zwei Bereichen, die zu den zentralen Aufgaben der kommunalen Organe in der D D R gehörten - der Frage nachgegangen werden, wie sich das Verhältnis von Kommunalverwaltung und Bevölkerung gestaltete.
2.2. Í. Die Durchsetzung und Rezeption agrarpolitischer Vorgaben in Niederzimmern Die Landwirtschaft, der wichtigste Wirtschaftszweig Niederzimmerns, stand im Mittelpunkt des dörflichen Wirtschaftsplanes. Dieser legte für die Landwirtschaft die Ablieferungsmengen fest und gab detaillierte Vorschriften für den Anbau, den Viehbesatz und selbst die H ö h e der Ertragssteigerung. Begleitend beschloß die Gemeindevertretung Maßnahmen, die die Planerfüllung fördern sollten, wie etwa Bauernschulungen oder Bodenuntersuchungen. Sie erstellte Pläne zur Düngung, Unkraut- und Tierseuchenbekämpfung, vereinzelt sogar Arbeitspläne, u m die Ernte sowie die Herbstbestellung vorzubereiten und durchzuführen. 4 0 Die damit verbundenen Maßnahmen durchzusetzen, war häufig unpopulär und forderte Konflikte mit den betroffenen Bevölkerungskreisen heraus. Dies war besonders bei den Ablieferungsbestimmungen der Fall, die die Bauern als zu hart empfanden. Die Gemeindeverwaltung spielte dabei eine Mittlerrolle zwischen der übergeordneten Kreisbehörde, die die Gesamthöhe der abzuliefernden Mengen bestimmt hatte, und den Bauern. Sie legte die individuelle Ablieferung fest und hatte die Landwirte zur pünktlichen Abgabe ihrer Produkte im geforderten U m f a n g zu veranlassen, wobei sie auch zu Druckmitteln greifen konnte. Die verantwortlichen Kommunalpolitiker befanden sich mit dieser Aufgabe in einer Zwangslage, da sie einerseits mit den betroffenen Bauern persönlich bekannt und so bis zu einem gewissen Grad zu Entgegenkommen verpflichtet, andererseits ihrer übergeordneten Behörde rechenschaftspflichtig waren. Die Akten zeigen, daß die Gemeindeverwaltung ihre Verfahrensweise in diesem Punkt veränderte. N o c h 1948 entschloß sie sich - von der Kreisbehörde beauftragt, die fahrlässigen Ablieferungsschuldner zu melden - , alle betreffenden Erzeuger vor der Kreisbehörde für unschuldig zu erklären. Sie stellte sich damit schützend vor die Bauern, die sonst von Strafen bedroht gewesen wären. 41 Obwohl die Gemeindeverwaltung in Niederzimmern auch in den folgenden 39 Zeitzeugeninterview N z 9. 40 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 77, Β 18, Β 19. 41 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 8.
200
Jahren, etwa bei Witterungsschäden, mit den Kreisbehörden u m die Herabsetzung von Ablieferungsmengen verhandelte, schien sie ihren Bauern gegenüber wesentlich unnachsichtiger geworden zu sein. So meldete der Bürgermeister nachweislich seit 1952 die Bauern, die mit der Ablieferung im Rückstand waren, der Partei und den Kreisbehörden. 42 Als Zwangsmaßnahme wurde erwogen, den Bauern die Schlachtgenehmigung zu versagen bis sie ihre Ablieferungsschulden ausgeglichen hatten. Ein solches Vorgehen war allerdings nicht auf die Eigeninitiative der Gemeindeverwaltung zurückzuführen; die Kreisbehörden hatten zuvor massiven Druck ausgeübt. Der Bürgermeister als der Hauptverantwortliche gegenüber den Kreisbehörden war eher bereit, unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen. Unter den Gemeindevertretern gab es nicht wenige, die versuchten, damit zusammenhängende Aufgaben zu umgehen, beispielsweise wenn sie die Bauern aufsuchen sollten, um sie persönlich zur Einhaltung der Ablieferung aufzufordern. 43 In der von Repression geprägten Situation distanzierten sich viele Bauern von der kommunalen Politik. Wiederholt wurde in den Sitzungen der Gemeindevertretung berichtet, daß die Bauern über die nicht erfolgte Herabsetzung des »Ablieferungssolls« verärgert seien und viele sich daher weigern würden, am kommunalpolitischen Leben teilzunehmen. So kritisierte der Bürgermeister 1957 in einer Rede: »Denken wir an die Vorstellung der Kandidaten, in der der Saal des Schwarzen Bären noch viele Besucher hätte aufnehmen können. U n d welche Kreise fehlten? Die Bauernschaft. U n d woran liegt es? Es sind die Parolen, die hartnäckig bei uns im Dorfe kursieren.... >Wir brauchen die Abschaffung des Solls und höhere Preisen« 44
N o c h tiefer als in die privat betriebene Landwirtschaft griffen die kommunalen Organe in die genossenschaftliche Landwirtschaft ein. Während der Kollektivierungsphase von 1957 bis 1960 gehörte es zu ihren Aufgaben, für den L P G Beitritt zu werben und zur Stabilisierung der Produktionsgenossenschaften beizutragen. Die Dorfpläne und Arbeitspläne der Gemeindevertretung dieser Jahre legten fest, wieviel Fläche die Genossenschaften in einem Wirtschaftsjahr hinzu gewinnen sollten oder welche Werbe- und Unterstützungsmaßnahmen die Gemeinde für die LPGs durchzuführen hatte.45 Auch die Auflagen, die von den LPGs zu erfüllen waren, fanden sich dort detailliert formuliert, so die Ablieferungsmengen, der Viehbesatz und der U m f a n g der Produktionssteigerung. Zugleich griffen die Behörden weitgehender in die Betriebsautonomie der LPGs ein als in die der Privatbetriebe. Von den Produktionsgenossenschaf-
42 43 44 45
Gemeindearchiv Gemeindearchiv Gemeindearchiv Gemeindearchiv
Niederzimmern Niederzimmern Niederzimmern Niederzimmern
Β Β Β Β
10, Β 13, Β 14, Β 17. 13, Β 17. 17. 17, Β 18, Β 19, Β 22.
201
ten, deren Vorsitzende sich regelmäßig vor der Gemeindevertretung zu verantworten hatten, wurden bei Ablieferungsrückständen exakte Aufholpläne verlangt; auch Termine für den Abschluß der Erntearbeiten wurden vorgegeben. Daneben schränkte die Gemeindevertretung die betriebswirtschaftliche Selbständigkeit der Genossenschaften empfindlich ein, indem sie beispielsweise anwies, die Kartoffelfelder nach der Ernte nachzulesen, den Winterzwischenfruchtanbau zu erweitern oder Stallneubauten zu errichten. 46 Selbst auf die innergenossenschaftliche Organisationsstruktur nahm die Kommunalverwaltung erheblichen Einfluß. So formuliert ein Plan von 1962, daß die Gemeindevertretung bei den LPGs darauf zu drängen habe, die Plandisziplin einzuhalten, die Leitungstätigkeit zu verbessern und die Einzelverantwortung zu erhöhen. Die Genossenschaften wurden gemahnt, nach Leistung zu bezahlen und das das Statut strikt einzuhalten. 47 Selbst in Personalangelegenheiten waren die Landwirtschaftsbetriebe nicht frei in ihren Entscheidungen. Der Bürgermeister kritisierte 1968: »Unverständlich ist, daß vier jungen Traktoristen der Austritt [aus der LPG] gewährt wurde.... Die Volksvertretung als mitverantwortliches Organ stimmt diesen Maßnahmen nicht zu und fordert, daß alle Mitglieder ihre alten Arbeitsplätze wieder einnehmen.«48
In der LPG versuchte man, die von der Gemeindeverwaltung formulierten Vorschriften zu ignorieren, wie einige vom Bürgermeister kritisierte Vorfälle zeigen: »Die Unterstützung der LPG durch die Gemeindevertretung war nicht immer so, wie sie hätte sein sollen. Dem steht aber auch entgegen, daß die LPG »Ernst Goldenbaum« die Beschlüsse und Empfehlungen der Gemeindevertretung nicht immer beachtet hat und in Einzelfällen sogar das Gegenteil tat. Es wurden von der LPG III in den Sitzungen der Gemeindevertretung oft falsche Berichte gegeben, so daß ein falsches Bild entstand, das die Verhältnisse besser aufzeigte, als die Wirklichkeit war.«49
Die LPGs boykottierten z.T. auch die Forderung, Vertreter der kommunalen Organe zu Betriebsversammlungen einzuladen: »Ein sehr ernstes Problem ist immer noch die Durchführung der Beschlüsse. So war es z.B. im Arbeitsplan der Gemeindevertretung verlangt, daß alle LPG'n dem Rat der Gemeinde die Termine der Vollversammlungen melden. Die LPG »Ernst Goldenbaum« hat dies nicht regelmäßig getan, oder aber so kurzfristig, daß eine Teilnahme anderer Funktionäre nicht mehr möglich war.«50 46 47 48 49 Β 24. 50
202
Gemeindearchiv Niederzimmern Β 23, Β 24, Β 28. Gemeindearchiv Niederzimmern Β 24. Gemeindearchiv Niederzimmern Β 29. Zitat von 1965, Gemeindearchiv Niederzimmern Β 53. Vergleichbare Aussagen auch in 1962, Gemeindearchiv Niederzimmern Β 24; vergleichbare Aussage auch in Β 28.
D e n n o c h ist davon auszugehen, daß trotz vorhandener Spannungen, von denen die hier aufgeführten Vorfälle zeugen, das Verhältnis der LPGs zu den kommunalpolitischen Organen besser gewesen sein dürfte als das der privat wirtschaftenden Bauern. Da mit der Produktionsgenossenschaft eine institutionelle Einrichtung betroffen war, hatten die Eingriffe in die Betriebsautonomie der LPG weniger privaten Charakter. Ein weiterer Faktor, der zwischen den LPGs und der Gemeindevertretung vermittelnd gewirkt haben dürfte, waren personelle Überschneidungen, denn LPG-Kader waren z.T. auch Mitglieder der Gemeindevertretung. Zumindest zwei der LPG-Vorsitzenden, einige Brigadiere und der Buchhalter waren kommunalpolitisch engagiert. Die Beschäftigung der Gemeinde mit innergenossenschaftlichen Angelegenheiten hatte für die LPG auch positive Effekte, etwa wenn Arbeitseinsätze organisiert und freiwillige Erntehelfer geworben wurden. Neben diesen Hilfsmaßnahmen dürfte zudem entschärfend gewirkt haben, daß nicht ausschließlich die Kommunalbehörde als Kontroll- und Entscheidungsinstanz präsent war, sondern auch die landwirtschaftliche Fachabteilung der Kreisbehörde, die regelmäßig Instrukteure entsandte. Weiterhin wäre zu überprüfen, ob die LPG als führender Wirtschaftsbetrieb in der Gemeinde ein politischer Machtfaktor darstellte oder sich zu einem solchen entwickelte. Denkbar wäre beispielsweise, daß das Leitungsgremium der LPG durch informelle Absprachen mit den kommunalpolitischen Funktionären Einfluß auf die sie betreffenden Dorfwirtschaftspläne nahm. Für die Gemeinde Niederzimmern sind solche Mechanismen der Einflußnahme in den verfügbaren Quellen zwar nicht nachweisbar, aber auch nicht auszuschließen. 2.2.2. Die Wohnraumbewirtschaftung in Niederzimmern in vergleichender Perspektive zu Bernstadt Die Wohnraumbewirtschaftung oblag in der D D R , anders als in der Bundesrepublik, dauerhaft den Gemeinden. Die Gesetzgebung reglementierte diesen Bereich streng, d.h. die Verfügungsgewalt über Wohnraum war für Privatbesitzer stark eingeschränkt. Die kommunalen Organe regelten die Verteilung von Wohnungen und verfügten, wieviel Wohnraum einzelne Personen beanspruchen konnten, wobei auch Privatbesitzern enge Grenzen gesetzt waren. So konnte der Rat der Gemeinde sogar anordnen, Wohnraum auf Kosten des Besitzers u m - und auszubauen oder wiederherzustellen. Durchgeführt wurde die Wohnungserfassung und Wohnungszuteilung von einer Wohnungskommission, die sich aus Mitgliedern der Gemeindevertretung zusammensetzte. 51 Wie in einem Bericht des Bürgermeisters 1957 über die Wohnraumlenkung doku-
51 Für die Wohnungskommission findet sich in den Akten auch der äquivalente Begriff»Wohnungsausschuß«.
203
mentiert, verfuhren die kommunalen Behörden Niederzimmerns in der Wohnraumbewirtschaftung streng gemäß der entsprechenden Gesetzgebung, nach der die Bedürfnisse der Mieter grundsätzlich Vorrang vor den Ansprüchen der Vermieter hatten: »Die Wohnraumfrage ist ja nicht allein deswegen so schwierig, weil es eben am nötigen Wohnraum mangelt, sondern weil auch die Menschen, die daran beteiligt sind, oft nur ihre eigensüchtigen Interessen vertreten und die Belange der anderen Menschen, die auf Mietwohnungen angewiesen sind, außer Acht lassen. ... Die Vermieter stellen oft Forderungen, die ... keinesfalls bedacht werden können. So ist es gesetzlich nicht vertretbar, daß der Vermieter sich seine Mieter aussuchen will. ... Eine Kündigung von Wohnraum wird nur dann wirksam, wenn der Mieter die Kündigung annimmt und ihm eine andere Wohnung zugewiesen wird.«
Bei der spezifisch ländlichen Wohnungssituation Niederzimmerns, wo der weitaus größte Teil der Wohnhäuser im Privatbesitz der alteingesessenen Bevölkerung war und es kaum abgeschlossene und ausgewiesene Mietwohnungen gab, griff die Gemeindeverwaltung mit ihrer Wohnraumvergabepraxis tief in den privaten Lebensbereich der einzelnen ein. Wohnungsbesitzer hatten meist einen Teil ihrer eigenen Wohnung abzutreten, ohne daß diese Einfluß darauf nehmen konnten, wer ihre neuen Mitbewohner sein würden. Diese Form der Wohnraumbewirtschaftung führte zu unzähligen Konflikten zwischen der Gemeindeverwaltung und den Vermietern. Als typische Beispiele für Konfliktsituationen findet sich in den Akten etwa der Fall eines Hausbesitzers, der sich weigerte, eine Wohnung freizugeben, da er sie für seine verheiratete Tochter brauchte. Dies lehnte die Behörde mit der Begründung ab, daß im elterlichen Haus genügend Wohnraum zur Verfügung stünde und ein vorhandener großer Raum leicht abgeteilt werden könne. In einem anderen Fall wurde eine freie Wohnung, die einem Mieter zugesprochen war, vom Besitzer eigenmächtig an einen anderen Mieter seiner Wahl weitergegeben. Da der Wohnungsinhaber die Räume aufAnordnung der Gemeinde nicht für den vorgesehen Mieter freigab, verhängte die Kommunalbehörde Zwangsgelder. Nachdem auch dieses Mittel erfolglos geblieben war, wurde zwangsgeräumt. 52 Wie der zuletzt geschilderte Fall zeigt, waren die kommunalen Organe auch in Konfliktsituationen nicht bereit einzulenken; sie handelten nach den vom Bürgermeister vertretenen Grundsatz: »Bei hartnäckigem Widerstand muß mit allen Rechtsmitteln vorgegangen werden.«53 Auch wenn die Mehrzahl der geschilderten Konflikte sich zwischen der Gemeindeverwaltung und den Vermietern abspielte, ergaben sich auch mit den Mietern Streitigkeiten, da diese häufig nicht mit den zugewiesenen Wohnungen zufrieden waren. 54 Die 52 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 13; vergleichbare Beispiele auch in Β 14, Β 16, Β 17. 53 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 13. 54 Diese Praxis der Wohnungsvergabe führte auch zu Streitigkeiten zwischen Vermietern und
204
meisten aktenkundigen Konfliktfálle konzentrierten sich auf die fünfziger Jahre. Während der sechziger Jahre entspannte sich die Wohnungssituation in der Gemeinde wenigstens soweit, daß Wohnraumzuweisungen nur noch in wenigen Fällen zwangsweise erfolgten. Die Mitglieder der Wohnungskommission liefen Gefahr, von der Bevölkerung persönlich für ihre unpopulären Entscheidungen verantwortlich gemacht zu werden und sich im Sozialverband der Gemeinde zu diskreditieren. So hieß es 1956 in den Gemeindeakten: »Als schlecht und verwerflich anzusehen ist, wenn einzelne Mitglieder der Kommission oder des Rates der Gemeinde wegen Maßnahmen, die auf gemeinsamen Beschlüssen beruhen, persönlich angegriffen werden.«55 1957 wurde berichtet: »Viele Mitglieder des Ausschusses beklagen sich darüber, daß sie von Einwohnern, deren Wünsche sie nicht erfüllen, d u m m angesprochen wurden.« 56 Der soziale Druck durch die Bevölkerung führte dazu, daß Mitglieder der Wohnungskommission versuchten, sich ihnen unangenehmen Aufgaben zu entziehen. So bemängelte der Bürgermeister, daß die Sitzungen des Wohnungsausschusses oft sehr schlecht besucht seien und sich die Mitglieder des Ausschusses davor scheuten, »irgendwelche Aufgaben zu übernehmen, wie die Besichtigung von Wohnungen, Ausmessungen von Wohnungen«. 57 Mitunter distanzierten sich die Kommissionsmitglieder in der Öffentlichkeit von den getroffenen Entscheidungen: »Es ist vorgekommen, daß Mitglieder der Kommission Vorschläge gemacht haben und die Kommission Vorschläge einstimmig angenommen hat. Den betroffenen Vermietern oder Mietern gegenüber wurde dann aber eine die Tatsachen verdrehende Darstellung gegeben und die Verantwortung für diesen Beschluß dem Bürgermeister zugeschoben. Ja, es ist sogar vorgekommen, daß... dem betroffenen Hausbesitzer gegenüber erklärt wurde, er hätte zwar unterschrieben, aber er sei nicht einverstanden gewesen.«58
Diese Aussagen belegen, daß zumindest bei einigen der beteiligten Gemeindevertreter eine Diskrepanz zwischen der Verfahrensweise in der Wohnungsbewirtschaftung und ihrer persönlichen Haltung bestand. Ihrer Uberzeugung hätte es eher entsprochen, kompromißbereiter zu handeln, um den Interessen aller Bevölkerungskreise gerecht zu werden. Die Funktionäre unter den Kommunalpolitikern wie der Bürgermeister oder einige der SED-Räte forcierten jedoch den durchgeführten kompromißlosen Kurs; sie waren es, die immer wieder zur Einhaltung der vorgeschriebenen Verfahrensweise ermahnten. Damit erwiesen sich sie als loyale Vertreter der Staatsmacht, die bereit waren, die Mietern. Besonders in den ersten Nachkriegsjahren spiegelten sich darin auch die Konflikte zwischen den alteingesessenen Familien und den neu hinzugezogenen Vertriebenen. Eine vergleichbare Situation herrschte auch in Bernstadt. 55 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 16. 56 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 17. 57 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 17, Β 13. 58 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 17.
205
vorgegebene politische Linie auch gegen die Interessen ihrer Einwohnerschaft durchzusetzen. Während die Landwirtschaft in der Bundesrepublik nicht in den Kompetenzbereich der Kommunen fiel, konnten diese die Wohnungswirtschaft dort noch bis Anfang der sechziger Jahre regulieren.59 In den ersten Nachkriegsjahren, als zahlreiche neue Bürger unterzubringen waren, erfolgte die Wohnungsverteilung in ähnlicherWeise wie in der SBZ/DDR. Die Gemeinden der Bundesrepublik waren verpflichtet, die ihnen zugewiesenen Vertriebenen und DDR-Flüchtlinge unterzubringen; sie hatten jedoch weniger rigide Durchführungsbestimmungen zu beachten als die kommunalen Behörden der DDR. Auch in Bernstadt beschlagnahmten die Verantwortlichen während der unmittelbaren Nachkriegsphase Wohnungen von widerständigen Vermietern und führten Zwangseinweisungen durch.60 Doch schon früh scheuten sich die Bernstadter Wohnungsbehörden, mit konsequenter Härte gegen widerständige Vermieter vorzugehen, die ebenso wie in Niederzimmern der alteingesessenen Bevölkerung entstammten. Wie ein Brief des Bürgermeisters an seine Aufsichtsbehörde, das Landratsamt, zeigt, vermied er es, unpopuläre Entscheidungen in eigener Verantwortung zu fällen. Er schrieb 1950 über eine Entscheidung zur Wohnungsvergabe, die in Rücksicht auf den einheimischen Vermieter und nicht nach Dringlichkeit gefällt wurde: »Ich bitte das Landratsamt die Entscheidung der örtlichen Wohnungsbehörde ruhig anzufechten und eine Entscheidung zu treffen ohne uns, dann haben wir, oder wenigsten ich die mich oft bedrückende Last weg.«61 Bereits ab Anfang der fünfziger Jahre, als die starke Anspannung des Wohnungsmarktes nachgelassen hatte, verzichtete die Gemeindeverwaltung auf die Ausübung von Zwangsmaßnahmen, wie aus einem Brief des Bürgermeisters an einen Wohnungssuchenden 1957 hervorgeht: » D u r c h die hier geschaffene Siedlung besteht in Bernstadt keine Wohnungsnot mehr, und so hat der Gemeinderat Bernstadt schon einige Jahre davon abgesehen, freiwerdende Wohnungen durch einen Wohnungssausschuß zu vergeben, da es sich i m m e r wieder herausgestellt hat, daß den Hausbesitzern die zugewiesenen Familien nicht angenehm waren. Wir sind von der U b e r z e u g u n g ausgegangen, daß es besser ist, wenn der Hausbesitzer seinen künftigen Mieter selbst aussucht.« 6 2
Tatsächlich war es in diesem Zusammenhang zu zahlreichen Konfliktsituationen zwischen Vermietern und Mietern gekommen, die die Gemeinde schlichtete, indem sie eine andere Wohnung zuwies. So versuchte man auf dem Wege 59 Die Wohnungszwangswirtschaft wurde in Baden-Württemberg 1962 aufgehoben. KAAlbDonau-Kreis, 647.30. 60 Zur Problematik der Wohnungszuweisungen vgl. auch Erker, Heimatvertriebenen, S. 23fF. 61 Gemeindearchiv Bernstadt, Akte Wohnungsamt. 62 Gemeindearchiv Bernstadt 7500.
206
der gütlichen Einigung, den Wohnungsbesitzern nur solche Mieter zu vermitteln, die diese auch zu akzeptieren bereit waren. Weit weniger entgegenkommend konnte sich die Gemeindeverwaltung Bernstadts verhalten, wenn es um die Frage der Vermietung von freien Wohnungen ging. Die Anweisungen des Landratsamts untersagten es den Gemeinden, den Hausbesitzern zu gestatten, Wohnraum leer stehen zu lassen.63 Insgesamt zeigt der Vergleich beider Gemeinden hinsichtlich der Verfahrensweise in der Wohnungsbewirtschaftung einen unterschiedlichen Umgang mit der Bevölkerung. Die Kommunalpolitiker in Bernstadt sahen sich veranlaßt, die Interessen ihrer Einwohnerschaft zu berücksichtigen und bei Interessenkonflikten einen Ausgleich zu suchen, der möglichst allen gerecht wurde. Den Einsatz von Zwangsmitteln, um ihre Macht durchzusetzen, suchten sie möglichst zu vermeiden - auch in einer Zeit, in der die Wohnungsknappheit noch gravierend war. Begründet werden kann diese andere Verfahrensweise der kommunalen Organe in der Bundesrepublik mit dem größeren Entscheidungsspielraum und dem weit geringeren Druck von übergeordneten Behörden, eine bestimmte Politik durchzusetzen. Dieser Freiraum erlaubte es den kommunalen Behörden, Rücksichten auf die öffentliche Meinung sowie ihre künftigen Wähler zu nehmen. Die kommunalen Organe Niederzimmerns zeigten sich gegenüber ihrer Einwohnerschaft weder in der Wohnraumbewirtschaftung noch bei landwirtschaftlichen Fragen kompromißbereit. Selbst wenn man in Betracht zieht, daß sie weit größeren Handlungszwängen ausgesetzt waren, lassen sich kaum Ansätze erkennen, Spielräume zugunsten einer Konfliktlösung zu finden, welche die Interessen der Einwohnerschaft berücksichtigt hätten. Während sich nicht wenige der Gemeindevertreter von diesem kompromißlosen Vorgehen distanzierten, forcierten es vor allem der Bürgermeister und einige SED-Funktionäre. Unvermeidlich war so eine Distanz der Bevölkerung gegenüber den Vertretern der Kommunalpolitik, von denen man wußte, daß sie vorrangig die Entscheidungen des Staates durchzusetzen hatten und erst nachrangig die Interessen der eigenen Gemeinde vertraten.
3. Politische Partizipation und politische Mobilisierung auf kommunaler Ebene »Plane mit, arbeite mit, regiere mit!«,64 mit dieser Parole wurde die DDR-Bevölkerung seit Ende der fünfziger Jahre aufgefordert, sich politisch zu engagieren und durch gesellschaftliche Mitarbeit zum Aufbau des Staates beizutragen. 63 Gemeindearchiv Bernstadt 021.9. 64 Zitiert nach Dorfplan der Gemeinde Niederzimmern 1960, Gemeindearchiv Β 22.
207
Das Bestreben, das gesellschaftspolitische Engagement zu fördern, breite Bevölkerungsschichten politisch zu mobilisieren und sie aufzufordern, sich am sozialistischen Aufbau zu beteiligen, zieht sich durch die gesamte Geschichte der DDR. Diesen Anspruch des sozialistischen Staates an die Bürger formulierte auch der Bürgermeister von Niederzimmern 1956 in einer Rede an die Einwohner: »Es ist Pflicht eines jeden Staatsbürgers, der sein Vaterland liebt, an der Gestaltung dieses seines Vaterlandes mitzuarbeiten.... Sage keiner, daß dazu ja keine Gelegenheit sei, es gebe ja doch nur 3 Gemeinderäte und 16 Gemeindevertreter. Die Mitarbeit ist nicht nur in diesen beiden Körperschaften möglich, sie kann auch im Rahmen der Haus- und Hofgemeinschaften, in der Nationalen Front oder in öffentlichen Versammlungen vor sich gehen.... Ein weiteres Mittel, den Willen zur Mitarbeit zu beweisen und gleichzeitig einen Beitrag zu leisten im Kampf um den Frieden und die Einheit unseres Vaterlandes, ist die Erfüllung und Übererfüllung der Volkswirtschaftspläne und die Erfüllung des Planes für das Nationale Aufbauwerk.«65
Untersucht man, inwieweit es gelang, diesen Anspruch innerhalb der ländlichen Gesellschaft umzusetzen, sind zwei Bereiche zu unterscheiden: 1. die Mitarbeit in den kommunalpolitischen Organen, die unmittelbar mit politischer Verantwortung verknüpft war, und 2. die Beteiligung möglichst aller Bürger an verschiedenen Formen gesellschaftspolitischer Aktivitäten, die unter dem Begriff der »politischen Massenarbeit« subsumiert wurden. Ziel dieser breiten Mobilisierungsbewegung war es, den Aufbau des Sozialismus zu propagieren, die Bevölkerung an den sozialistischen Staat zu binden und ihre Loyalität und Identifikation mit dem Staat zu stärken.
3.1. Politische Partizipation 3.1.1. Die Gemeindevertretung
in der
Gemeindevertretung
und ihre Mitglieder in
Niederzimmern
Im Mittelpunkt dieses Abschnitts steht die Frage, welchen Einfluß die veränderten kommunalpolitischen Strukturen in der D D R und die Zugangsbedingungen zu politischen Amtern auf lokale Machtstrukturen hatten. In welcher Weise hatte sich die Bereitschaft der verschiedenen sozialen Gruppen, sich für politische Funktionen zur Verfügung zu stellen, gewandelt, und welche Folgen hatte dies für die soziale Zusammensetzung der lokalen politischen Führungsgruppe? Bei den folgenden Ausführungen beschränke ich mich im wesentlichen auf die Gemeindevertretung. Der Rat der Gemeinde wird nicht gesondert berücksichtigt, da dessen Mitglieder in der Regel der Gemeindevertretung angehörten. 65 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 16.
208
In der soziostrukturellen Zusammensetzung der Gemeindevertretung lassen sich im Verlauf des Untersuchungszeitraums Veränderungen feststellen. Waren die Bauern in den fünfziger Jahren noch proportional zu ihrem Anteil in der Bevölkerung vertreten - sie hielten etwa die Hälfte aller Sitze - , nahm ihr Anteil seit 1961 stärker ab als das Gewicht ihrer Berufsgruppe. 1950 zählten 44 % der Gemeindevertreter zu den Bauern, 1957 kamen 53 % aus dieser Berufsgruppe. 1961 hatte die Gemeindevertretung noch 36 % bäuerliche Mitglieder, 1970 waren es nur noch 30 %, während 40 % der Erwerbstätigen in der Gemeinde in der Landwirtschaft arbeiteten. Das traditionell starke politische Gewicht der »Großbauern« im Dorf war 1950 noch nicht gebrochen, denn vier der 16 damaligen Gemeindevertreter bewirtschafteten Höfe mit über 20 ha. Von den übrigen besaß einer einen 17 ha großen Betrieb, zwei weitere Gemeindevertreter bewirtschaften sieben bzw. acht ha. 1957 zählten nur noch zwei der 19 Gemeindevertreter zu den »Großbauern«, vier waren Mittelbauern, einer Kleinbauer und drei Genossenschaftsbauern. Nach der Neuwahl von 1961 zeichnete sich der Rückzug der ehemals selbständigen Bauern aus der Gemeindepolitik ab. Von den neun Gemeindevertretern, die der LPG angehörten, stammten nur fünf aus alteingesessenen Bauernfamilien. 1965 und 1970 kamen jeweils drei der sieben LPG-Bauern in der Gemeindevertretung aus der ehemals selbständigen Bauernschaft. Der größere Teil der bäuerlichen Gemeindevertreter stammte in den sechziger Jahren demnach ursprünglich aus der Arbeiterschaft. 66 Die Angestellten waren im Verhältnis zu ihrem Anteil in der Bevölkerung überdurchschnittlich stark in der Kommunalpolitik vertreten. So stellten sie 1950 25 % der Gemeindevertreter, 1961 waren es 28 % und 1970 sogar 35 %, während sich ihr Anteil unter den Erwerbstätigen in der Gemeinde zwischen 1952 und 1968 von ca. 9 % auf 20 % erhöht hatte. Bei den Angestellten in der Gemeindevertretung handelte es sich häufig um Beschäftigte bei Behörden in gehobenen Positionen oder um Personen, die durch ihren Beruf eine besondere Stellung in der Gemeinde innehatten, wie etwa der Leiter der BHG, die Leiterin der örtlichen Konsumgenossenschaft, die Gemeindekrankenschwester, die Leiterin der Kinderkrippe oder Mitglieder der Volkspolizei. Auch die Lehrer am Ort waren regelmäßig in der Gemeindevertretung präsent. Wenig Interesse an der Mitarbeit in den kommunalpolitischen Organen zeigten die Arbeiter. Obwohl ihr Anteil an den Erwerbstätigen in der Gemeinde zu Beginn der fünfziger Jahre etwa ein Drittel betrug, gehörten 1950 nur 12 % der Gemeindevertreter zur Arbeiterschaft. Zwar erhöhte sich ihr Anteil bis 1970 auf 25 %; dennoch waren sie weiterhin stark unterrepräsentiert, zumal ihr Anteil an den Erwerbstätigen auf etwa 40 % gewachsen war. Gering war zunächst auch der Frauenanteil, doch stieg die Zahl der Gemeindevertreterinnen im Untersuchungszeitraum beträchtlich. Saß 1950 nur eine Frau ( = 6 %) in der
66 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 48, Β 50, Β 51, Β 53, Β 55.
209
Gemeindevertretung, waren es 196128 und 1970 26 %. Seit Mitte der fünfziger Jahre waren neu in die Gemeinde gezogene Bürger überproportional in der Gemeindevertretung repräsentiert. Zu dieser Kategorie zählen hier Personen, die fünf oder weniger Jahre im Dorf wohnten. 1950 lag der Anteil der über 400 Vertriebenen, die sich seit 1945 in der Gemeinde niedergelassen hatten, in der Gemeindevertretung bei 19 %. 1957 und 1961 gehörten 16 bzw. 12 % der Gemeindevertretung den Zugezogenen an, 1965 sogar 20 %. Da ihre Gesamtzahl mit ca. 60 Zuwanderern zwischen 1957 und 1968 vergleichsweise klein war, ist für diese Bevölkerungsgruppe eine sehr hohe Bereitschaft zur Übernahme von politischen Amtern festzustellen. Rekonstruiert man die Ursachen für diesen Wandel in der Zusammensetzung der Gemeindevertretung, sind zunächst die Zugangsbedingungen zu analysieren. Diese legten fest, daß ein Kandidat in der Regel einer Partei oder Massenorganisation angehören sollte.67 Das bedeutete, daß die Mitgliedschaft in der Gemeindevertretung nicht allen Einwohnern einer Gemeinde gleichermaßen offenstand. Bewerber für dieses Amt konnten sich nicht selber zur Wahl stellen, sondern wurden von der Nationalen Front vorgeschlagen. Da jedoch angenommen werden kann, daß ein großer Teil der Einwohnerschaft wenn nicht einer Partei, so doch zumindest einer Massenorganisation angehörte, erfüllte ein relativ großer Personenkreis diese Voraussetzungen. 68 Eingeschränkt war die Auswahl der in Frage kommenden Personen allerdings durch die schon vorab festgelegte Zusammensetzung der Gemeindevertretung. Diese sollte in Niederzimmern zum Beispiel 1957 folgendermaßen aussehen: Von der SED waren fünf Kandidaten zu nominieren, von der DBD einer, von der LDPD vier, vom FDGB zwei, von der FDJ zwei, von der VdgB/BHG drei, von der Konsumgenossenschaft zwei Kandidaten sowie eine Kandidatin vom DFD. 69 Da möglichst auch die Vertreter der Massenorganisationen der SED angehören sollten, waren zwischen 1950 und 1970 in allen berücksichtigten Legislaturperioden mindestens die Hälfte aller örtlichen Volksvertreter Mitglieder dieser Partei, also gut doppelt so viele, wie durch die SED selbst nominiert wurden. Der Anteil der SED-Mitglieder steigerte sich im Laufe des Untersuchungszeitraumes sogar. Gehörten 1950 noch 50 % der Volksvertreter dieser Partei an, so waren 1961 52 % der Gemeindevertreter SED-Mitglieder und 1970 57 %. Die Zahl der Mitglieder, die den übrigen Blockparteien angehörten, blieb trotz der veränderten Größe des kommunalen Parlaments nahezu unverändert. Eine
67 Massenorganisationen waren verbandsähnliche gesellschaftliche Organisationen, die zwar als überparteilich galten, die aber von der SED dominiert wurden. Für ihren jeweiligen Bereich besaßen sie das Organisationsmonopol. Sie hatten die Funktion von »Transmissionsriemen« für die Partei und sollten die Verbindung zu den Massen herstellen. Siehe dazu: Weber, Organisationen, S. 62Iff. 68 Vgl. dazu Kap. III. 3.2.2. 69 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 41.
210
weitere Zugangsvoraussetzung ergab sich daraus, daß sich die Gemeindevertreter nicht nur loyal zum Staat und zum politischem System zu verhalten hatten, sondern auch aktiv dafür eintreten mußten, die Beschlüsse der politischen Führung durchzusetzen. Bürger, die sich entschlossen, die ihnen angetragene Kandidatur fur die kommunalen Organe zu akzeptieren, kamen nicht umhin, diese Bedingungen zu billigen. Durch die genannten Prämissen legte der Staat prinzipiell neue Kriterien für die Zugangsvoraussetzungen zu lokalen Machtpositionen fest und ermöglichte es, die traditionellen Machtstrukturen des Dorfes aufzubrechen. Das politische Machtmonopol lag in der Vergangenheit bei der lokalen Oberschicht, der im wesentlichen die wohlhabenden Bauern angehörten. Ihre politische Vorherrschaft war in ihrer ökonomischen Lage, ihrer sozialen Stellung und ihrem Ansehen begründet. 70 Zugleich symbolisierte die Teilhabe an der politischen Macht im Dorf den sozialen Rang einer Person innerhalb der lokalen Gemeinschaft. Die politische Vorherrschaft der traditionellen Elite war jedoch bereits während der NS-Zeit angetastet worden, da bei der Berufung der Kommunalpolitiker die Mitgliedschaft in der NSDAP die entscheidende Rolle spielte. So gelangten Bevölkerungsgruppen, die zuvor von der politischen Partizipation faktisch ausgeschlossenen waren, auch in öffentliche Ämter.71 In Niederzimmern veränderte sich dadurch allerdings wenig, da dort viele der großen Bauern der NSDAP angehörten und weiterhin die politische Macht innehatten. 72 Der eigentliche Einschnitt erfolgte also erst im Laufe der fünfziger Jahre, als die traditionell führende Schicht immer weniger in den kommunalpolitischen Organen vertreten war. Die Mitgliedschaft in diesen Körperschaften gründete nun nicht mehr auf der ökonomischen Vorrangstellung und dem sozialen Ansehen - Kriterien, die die politische Macht im Dorf vorher legitimiert hatten - , sondern auf Vorgaben, die der sozialistische Staat definierte. Durch die Praxis der Kandidatenauswahl nach politischen Kriterien verloren die lokalen politischen Organe ihre frühere Legitimation. Das seit 1950 gültige 70 Nach der Weberschen Definition läßt sich bäuerliches Honoratiorentum durch »die aus der ökonomischen Lage folgenden Qualifikation zur Wahrnehmung von sozialer Verwaltung und Herrschaft als >Ehrenpflicht«< herleiten. M. Weber, S. 547. Zur traditionell dominierenden Rolle der Bauern in der Gemeindepolitik siehe auch Wagner, S. 248ff.; Kaschuba/Lipp, S. 272; Exner, Ländliche Gesellschaft, S. 217ÍI;Jauch/Kromka, S. 85; Wurzbacher/Pflaum, S. 233fT. 71 Kaschuba/Lipp, S. 281ff. Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt auch Exner für Westfalen, vgl. ders., Ländliche Gesellschaft, S. 217£f. 72 Zofka weist in einer Regionalstudie aus dem Bezirk Günzburg nach, daß Vertreter der alten Gemeindeeliten Parteiämter in der NSDAP übernahmen, um den Einfluß der Partei in der Gemeinde zu kontrollieren. Als Fazit seiner Gemeindestudie stellt er heraus, daß die »Machtergreifung« der NSDAP im dörflichen Bereich dadurch geprägt war, daß die NSDAP Rücksicht auf die Beharrungskraft dörflicher Traditionen zu nehmen hatte und daher nicht bruchlos eine neue Elite und eine neue Ideologie in der ländlichen Gesellschaft installieren konnte. Siehe dazu: Zofka, S. 383-434.
211
Wahlverfahren nach Einheitslisten, das eine freie Auswahl der Kandidaten durch die Wählerschaft nicht mehr ermöglichte, begründete diese im Bewußtsein der Bevölkerung aber auch nicht neu. Die Gemeindevertretung stellte als lokale Vertretung der Staatsmacht zwar noch die faktische Machtinstanz im Dorf dar, hatte jedoch ihre symbolische Bedeutung eingebüßt, die in der Ubereinstimmung von Ansehen und politischer Macht ihrer Mitglieder begründet war. Verloren war das frühere Prestige, das die Gemeindevertretung als Institution und ihre Mitglieder in der dörflichen Gesellschaft genossen. Nach Aussagen von Zeitzeugen, die selber nie Mitglied der Gemeindevertretung waren, unterstellte zumindest ein Teil der Einwohnerschaft den damaligen Mandatsträgern das wenig ehrenvolle Motiv, ihr Amt aus Geltungsbedürfnis übernommen zu haben: »Ich warj a nicht mit der Gemeindevertretung befaßt, aber es gab schon einige, die sich ein bißchen hervortun wollten.« 73 Diese von mehreren Personen geäußerte Unterstellung läßt die Interpretation zu, daß die Gemeindevertreter in der Dorföffentlichkeit als Persönlichkeiten nicht den besten Ruf genossen; sie galten offenbar als Wichtigtuer. Die Übernahme eines politischen Amtes wurde demnach von einem Teil der Einwohnerschaft negativ beurteilt. Der Prestigeverlust dieser Institution resultierte gleichzeitig daraus, daß - wie bereits diskutiert - der Gemeindevertretung durch den Zentralstaat Kompetenzen entzogen worden waren, der sie zum verlängerten Arm der Staatsmacht umfunktioniert hatte und zwang, unpopuläre Entscheidungen auf kommunaler Ebene durchzusetzen. Das daraus resultierende spannungsgeladene Verhältnis zwischen der Einwohnerschaft und der Gemeindevertretung hatte schließlich zur Folge, daß ein großer Teil der Einwohnerschaft kein Interesse hatte, sich durch ein solches Amt zu kompromittieren. Für einzelne Gruppen in der Bevölkerung war es allerdings fast unumgänglich, eine Nominierung zu akzeptieren, da eine Ablehnung zu beruflicher Benachteiligung geführt hätte, wie einer der Interviewpartner betonte: »Es war schwierig, beispielsweise als Lehrer abzulehnen, in die Gemeindevertretung zu gehen. A n g e n o m m e n , man wäre zu mir g e k o m m e n und hätte gesagt: »Wir haben Dich für die Gemeindevertretung vorgesehenWahlvorschlägeden müssen wir wählen, daß wir eine Chance haben, wenn es Abstimmungen gibtArbeite mit, regiere mit< oder so ähnlich, aber das war nur ein Flop, weil es ging ja nicht von unten nach oben, sondern immer andersherum.« 151
Weitere Gründe für das fehlende Interesse an gesellschaftspolitischen Aktivitäten mögen auch in den hohen Ansprüchen, die der Staat an seine Bürger stellte und die zu einer Uberbeanspruchung des einzelnen durch eine Vielzahl von geforderten politischen Betätigungen führte, zu finden sein. In den sechziger Jahren, als der Aufbau des Sozialismus sich in der Kollektivierung auch im Dorf nachhaltig niedergeschlagen hatte, veränderte sich die Situation nicht wesentlich. Die bereits an anderer Stelle152 diskutierte Frage, ob sich bei den Genossenschaftsbauern durch ihre veränderten Arbeits- und Lebenszusammenhänge ein »sozialistisches Bewußtsein« herausbildete, konnte auch hier nicht positiv beantwortet werden, denn sie hielten sich ebenso wie viele andere in ihrem gesellschaftspolitischen Engagement zurück und verrieten im kommunalpolitischen Kontext keine Identifikation mit dem Sozialismus und dem ihn vertretenden Staat. Sie wurden so den Anforderungen, die an die neue »sozialistische Persönlichkeit« gestellt wurden, nicht gerecht.
151 Zeitzeugeninterview N z 9. 152 Siehe Kap. II. 3.2.
243
IV Dörfliche Kultur zwischen Transformation und Tradition
Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen dörfliche Institutionen, die bereits seit langem die wichtigsten Träger des lokalen Kulturlebens in Niederzimmern waren: die Vereine, die Kirmesburschenschaft sowie die Kirchengemeinde. 1 Einerseits waren dies Kulturträger, die auch innerhalb des sozialistischen Staats eine relativ eigenständige Rolle spielten, wie die Kirchengemeinde und die Kirmesburschenschaft. Andererseits handelt es sich dabei um kulturelle Vereinigungen wie die Sportgemeinschaft, der C h o r und die F D J , die dem Zugriff des Staats unterworfen waren, und die er als Vehikel für die gesamtgesellschaftliche Transformation zu nutzen versuchte. Die genannten Institutionen repräsentieren dann die dörfliche Kultur, wenn sie in der Gemeinde etabliert sind und ihre Rolle als Kulturträger allgemein akzeptiert ist.2 Die kulturelle Bedeutung dieser Vereinigungen für die Gemeinde ist zugleich mit ihrer integrativen Funktion für das soziale System des Dorfes verknüpft. Als sozialintegrativ gelten diese Institutionen, wenn die Mitgliedschaft offen für alle Bevölkerungsgruppen ist und wenn sie durch Veranstaltungen für die Allgemeinheit dazu beitragen, die innerdörflichen Kontakte zu fördern.3 Zugleich haben die kulturellen Institutionen eine Symbolfunktion für Gemeinde, die dazu beiträgt, die Ortsidentifikation der Bevölkerung zu stärken.
1 Auf die Bedeutung der Vereine als Kulturträger einer Gemeinde macht z.B. Jauch aufmerksam. Er sieht den kulturellen Gehalt in den jeweiligen Vereinszielen und -aktivitäten sowie in den vermittelten sozialen Kontakten. Diese Konzeption der kulturellen Rolle der Vereine läßt sich m. E. auch auf die Kirmesburschenschaft und die Kirchengemeinde übertragen. Siehe dazu: Jauch, S. 49. 2 Daß dies nicht immer der Fall sein muß, zeigte Dwertmann am Beispiel eines Sportvereins in einer südoldenburgischen Gemeinde. Dieser Verein konnte bis in die sechziger Jahre keine gewichtige Rolle für die dörfliche Kultur entwickeln, da er durch seine schichtenspezifische Zusammensetzung und mangelnde Verwurzelung in den führenden Bevölkerungsgruppen wenig Resonanz in der Einwohnerschaft fand. Vgl. dazu: Dwertmann, S. 94ff. 3 Diese Kriterien für die sozialintegrative Funktion wurden in Anlehnung an Wurzbacher u. Pflaum (S. 151ÍF.) formuliert. Ihre Studie stellt eine der wegweisenden Arbeiten dar, die den Aspekt der sozialintegrativen Funktion der Vereine betonen. Einen Uberblick zur Integrationsfunktion der Vereine bietet Siewert, S. 1968ff. Andere Arbeiten zu Vereinen betonen stärker, daß in ihnen soziale DifFerenzierungsprozesse in den Gemeinden widergespiegelt werden. Beispielsweise: Lehmann, Leben, S. 65ff.; ders., Vereinsstruktur, S. 105-119.
244
Untersucht werden soll, wie die Einwohner auf die Interventionsbestrebungen des Staates reagierten, die darauf ausgerichtet waren, die bestehende kulturelle Praxis neu zu interpretieren und eine neue sozialistische Kultur durchzusetzen. Es ist danach zu fragen, welche Auswirkungen die herrschaftlichen Eingriffe in die dörfliche Kultur auf die Mitgliederstruktur und die kulturellen Aktivitäten der Vereine, der Kirmesburschenschaft und der Kirchengemeinde hatten sowie auf deren sozialintegrative und identitätsstiftende Funktionen. Besonders berücksichtigt wird dabei die von diesen Institutionen gepflegte Feierkultur. Die Dorffeste waren kollektive gesellschaftliche Höhepunkte, die die Chance boten, »gemeinschaftsbildend, integrierend und identitätsstiftend zu wirken«. 4 Neue Formen dörflicher Kultur sozialistischer Ausprägung sollen dann thematisiert werden, wenn sie als expliziter Gegenentwurf, als konkurrierende Institution zur Ausschaltung der herkömmlichen kulturellen Formen etabliert werden sollten. In diesem Sinne wird die FDJ hier als kulturelle Institution behandelt, obwohl diese vor allem als politische Organisation aufzufassen ist. U m die Reaktionsweisen und Handlungsstrategien der dörflichen Gesellschaft auf die staatlichen Ansprüche interpretieren und in ihrer Bedeutung verstehen zu können, soll Kultur als »Diskursfeld« aufgefaßt werden, »als eine Arena, in der Werte, Normen und Deutungsmuster von kulturellen Akteuren ständig neu >verhandelt< werden - >verhandelt< in Anführungszeichen, weil kulturelles Handeln zwar immer zeichenhaft, aber nicht immer sprachlich ist«.5 Kultur ist damit nicht als ein geschlossenes System, sondern als Prozeß definiert. Im Diskurs setzen sich die Träger einer Kultur mit Positionen auseinander, die die eigenen Deutungsmuster in Frage stellen, sind aber bestrebt, die eigenen kulturellen Standards zu verteidigen und zu erhalten. N u r mit der Stabilisierung der eigenen kulturellen Praxis und der Abgrenzung nach außen können die bestehenden Werte und Normen festgeschrieben werden. Die Machtverschiebung in der D D R eröffnete der SED die Möglichkeit, ihr beanspruchtes Interpretationsmonopol auch im kulturellen Bereich durchzusetzen und damit neue Deutungsmuster zu etablieren. Im staatlichen Anspruch, eine sozialistische Kultur zu verankern, entstand ein Gegendiskurs, der durch seine Verknüpfung mit staatlicher Macht wirkungsmächtiger war als die üblichen innergesellschaftlichen Diskurse. 6
4 Sauer, Volksfeste, S. 195. 5 Schiffauer, S. 14f. 6 Auf den Aspekt von Macht- und Widerstandseffekten der diskursiven Praktiken macht auch Schüttler (S. 139) aufmerksam, der sich v.a. auf den Diskursbegriffvon Foucault bezieht.
245
1. Das Vereinsleben 1.1. Zur politischen Funktionalisierung von Kultur und Sport in der DDR Neben dem musisch-künstlerischen Bereich und der Bildung galten auch Körperkultur und Sport als zentrale Elemente des kulturellen Lebens und der sozialistischen Lebensweise. 7 Alle diese Bereiche waren in das politische und gesellschaftliche System eingebettet und hatten beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaft wichtige Funktionen zu erfüllen. Kulturarbeit war Bestandteil der politischen Massenarbeit. Sie sollte zur sozialistischen Erziehung beitragen, d.h. zur »allseitigen Entwicklung der Persönlichkeit, Erziehung zur Solidarität und kollektivem Handeln, Erziehung zu kämpferischer Aktivität, Vermittlung einer hohen theoretischen und musischen Allgemeinbildung, Entfaltung aller geistigen und körperlichen Fähigkeiten«. 8 Auch die sozialistisch geprägte Sportbewegung wurde im Sinne der SED-Politik instrumentalisiert. D e m »Nur-Sportlertum« wurde die Losung »Jeder Sportler ein Aktivist« entgegengesetzt. 9 Der Sport hatte nicht nur das Ziel, zur Verbesserung der Volksgesundheit und zur Reproduktion der Arbeitskraft beizutragen, sondern sollte - ebenso wie die übrigen kulturellen Bereiche - den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft durch ideologisch-politische Einflußnahme unterstützen. Eine besondere Bedeutung wurde dem Sport im Hinblick auf die Herausbildung und Festigung der »sozialistischen Persönlichkeit« beigemessen: »Die sozialistischen Uberzeugungen und die ihnen entsprechenden politisch-ideologischen Einstellungen sowie die dadurch bestimmten moralischen Eigenschaften herauszubilden und festigen zu helfen, gehört zu den Hauptaufgaben der kommunistischen Erziehung und sozialistischen Persönlichkeitsentwicklung auf dem Gebiet der Körperkultur und Sport.«10
Der Staat förderte die Teilnahme der Bürger am kulturellen Leben und Sport und versuchte breite Bevölkerungsschichten dafür zu mobilisieren. Eine besondere Bedeutung wurde der Kulturarbeit und der Entwicklung des Sports auf dem Land zugemessen, denn dort war »der Sieg des Genossenschaftsprinzips mit den Mitteln der Kultur und Kunst zu vollenden und zu befestigen«. 11 Ein wichtiger Aspekt der Kulturarbeit war die künstlerische Selbstbetätigung, die zu den Wesenszügen des sozialistischen Menschen gerechnet wurde. Diese 7 Siehe dazu und zu den folgenden Ausführungen: Rossade·, Kulturpolitisches Wörterbuch, S. 282-285; Stündl, S. 25; Freyer, S. 13. 8 Protokoll der Verhandlungen des V. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, S. 1395, zitiert nach Freyer, S. 28; zu den kulturpolitischen Zielen der SED siehe auch: Petzoldt, S. 70fT. 9 Zitiert nach: Körperkultur und Sport, S. 25. 10 Ebd., S. 448. 11 Freyer, S. 29.
246
sollte in Volkskunstgruppen stattfinden, zu denen beispielsweise die Laienchöre gerechnet wurden. Seit Mitte der fünfziger Jahre erhielt die Volkskultur politische Relevanz, wobei nun auch die bestehenden traditionellen Formen ins Blickfeld rückten, denn die SED verstand sich als Erbin der progessiven deutschen Kulturtraditionen. Zugleich sollte die traditionelle Volkskultur mit der neuen Gesellschaftsordnung verknüpft werden. 12 Die Volkskunstgruppen waren dem Kulturbund, einer Massenorganisation, angegliedert und hatten u.a. politisch-ideologische Aufgaben. Zudem - so wurde betont - bedurften sie einer ständigen kulturpolitischen Anleitung im Sinne der Beschlüsse der SED und der Regierung.13 Dies bedeutete beispielsweise für die Chöre, daß sie nicht mehr frei über ihr Repertoire und ihre Programmgestaltung entscheiden konnten, sondern von Genehmigungen der übergeordneten Institutionen abhängig waren, und sie bei allen gesellschaftlichen Anlässen, insbesondere bei »sozialistischen Feierlichkeiten«, aufzutreten hatten. Neben der herkömmlichen Chorbewegung entwickelte sich in der D D R eine breite Bewegung von sogenannten »Singegruppen«, die für den Sozialismus eintreten sollte. Die lokalen kulturellen und sportlichen Vereinigungen wurden in der D D R nicht als unabhängige Institutionen begriffen; anders als in der Bundesrepublik gab es keine rechtlich eigenständigen Vereine mehr.14 Der Wiederaufbau des Sports in der SBZ stand nach der Zerschlagung der alten Sportorganisationen unter dem Vorzeichen der Abgrenzung von der bürgerlichen und nationalsozialistischen Körperkultur. Ab 1946 wurden nur noch solche örtlichen Sportgemeinschaften zugelassen, die sich auch in der Namengebungvon ihren Vorläufern distanzierten. Diese kommunalen Sportgemeinschaften waren zunächst der FDJ angegliedert. Mit der Gründung des Deutschen Sportausschusses 1948 übernahm dieser die zentralen Organisationsaufgaben. Daneben förderte der FDGB die Bildung von Betriebssportgemeinschaften, als deren Träger er fungierte. Mit der Gründung des Deutschen Turn- und Sportbundes (DTSB) 1957, wie der Kulturbund zu den Massenorganisationen gerechnet, wurden schließlich alle sportlichen Vereinigungen unter einem Dach zusammengefaßt. Die kommunalen Sportgemeinschaften sowie die Betriebssportgemeinschaften gehörten jetzt als Grundeinheiten dem DTSB an. Die Zentralisierung des Sports war damit vollzogen.15
12 Vgl. dazu: Speckels, S. 137ff. 13 Freyer, S. 162ff. 14 Wenn ich im Zusammenhang mit der DDR-Gemeinde dennoch von Vereinen spreche, geschieht dies, um der Perspektive der Beteiligten gerecht zu werden. Diese betrachteten den Chor sowie die Sportgemeinschaft noch immer als Vereine. U m der, in der fejuenden Eigenständigkeit begründeten Andersartigkeit dieser Institutionen im Vergleich zu den westdeutschen Vereinen gerecht zu werden, wird der Begriff »Verein« künftig im Zusammenhang/nit der D D R in Anführungszeichen verwendet. 15 Kühnst, S. 15£f.; Stund!, S. 30f.
247
1.2. Vereinskultur in Niederzimmern am Beispiel der Sportgemeinschaft und des Volkschors
Vereine hatten in Niederzimmern eine reiche und lange Tradition. Bereits 1857 wurde eine Chorgemeinschaft, die »Liedertafel Niederzimmern«, gegründet und wenige Jahre später, 1863, ein Turnverein. Ab 1903 existierte ein Spielmannszug; seit 1920 und 1924 der Radfahrverein und der Fußballverein. Nachdem diese 1945 aufgelöst worden waren, wurde 1947 die Sportgemeinschaft (SG) aufgebaut, die alle vorher bestehenden Sparten umfaßte. Die Turner, Radfahrer und Fußballer wurden jetzt zu Sektionen der Sportgemeinschaft. Der Chor konstituierte sich 1947 ebenfalls neu, indem sich die alte »Liedertafel« zum Volkschor wandelte. Im rechtlichen Sinne handelte es sich bei diesen Vereinigungen nicht mehr um unabhängige Vereine, sondern um Unterorganisationen zentralstaatlicher Einrichtungen. In der Untersuchung beschränke ich mich auf den Volkschor und die Sektion Turnen, denn es würde den Rahmen dieser Untersuchung sprengen, alle örtlichen »Vereine« zu berücksichtigen. Das Kriterium für die Auswahl dieser beiden Vereinigungen war deren lange Vereinsgeschichte, auf die sich die Nachfolgeorganisationen beriefen. Beide spielten bereits in der Vergangenheit für die dörfliche Feierkultur eine tragende Rolle und waren so in der Öffentlichkeit überaus präsent. 1.2.1. Die Sektion Turnen der Sportgemeinschaft Niederzimmern
Die Sektion Turnen in Niederzimmern umfaßte 1957, zur Zeit ihres höchsten Mitgliederstandes in der Nachkriegszeit, 50 aktive Mitglieder, darunter auch eine Frauen- und eine Mädchenriege. Das Geschlechterverhältnis unter den erwachsenen Turnern betrug in den fünfziger Jahren ungefähr zwei Drittel Männer und ein Drittel Frauen. Unter den aktiven Sportlern überwog die jüngere Generation. Das Alter der erwachsenen Aktiven lag zwischen 18 und 30 Jahren, vereinzelt turnten auch noch 30- bis 40jährige mit. Die Eheschließung stellte dabei nicht für alle einen Einschnitt dar, denn viele waren auch nach ihrer Heirat noch aktiv. Die Alteren, die sich aus dem aktiven Sport zurückgezogen hatten, blieben meist passive Mitglieder der Sektion. Sie erschienen als Zuschauer bei Veranstaltungen oder nahmen an Versammlungen teil. Neben den Riegen für erwachsene Turner gab es eine Kinder- und eine Jugendriege. Die soziale Zusammensetzung der Sektion war heterogen, denn ihr gehörten gleichmäßig Bauern, Arbeiter und Handwerker an, unter ihnen auch Zugezogene.16 Während die soziale Durchmischung für die Sektionen Fußball und 16 Genaue Zahlen zur Sozialstruktur der Mitglieder waren nicht zu ermitteln. Die Angaben stützen sich auf ca. 30 Mitglieder, die namentlich mit Hilfe der Zeitzeugen ermittelt werden konnten.
248
Radfahren - beides ursprünglich Arbeitersportvereine - erst nach dem Krieg einsetzte, waren im »Turnverein« bereits seit langem alle gesellschaftlichen Gruppen des Dorfes vertreten. Soziale Gegensätze kamen dort nicht zum Tragen, wie einer der Zeitzeugen betonte: »Bei uns Turnern waren viele Bauern dabei und viele Arbeiter. Aber da wurden die Unterschiede verwischt. Das war nicht so, daß der eine der Herr Gutsbesitzer war und der andere der Knecht.... Auch von den Umsiedlern waren viele beim Sport. Das waren zum Teil gute Sportler. Auch von den Leuten, die später zuzogen, kamen welche dazu. Besonders die jungen Leute, die älteren weniger.«17
Daß diese Aussage kaum beschönigt sein dürfte, beweist ein Blick auf die Liste der Vereinsvorstände, unter denen bereits vor 1945 zahlreiche Arbeiterbauern und Handwerker waren.18 Durch ihre Offenheit für alle Bevölkerungsgruppen und ihre heterogene Zusammensetzung wies sich die Sektion Turnen als Integrationsinstanz im Dorf aus. Als einige der langjährigen Turner nach dem Krieg das frühere Vereinsleben wieder aufnehmen wollten, sahen sie sich mit staatlichen Reglementierungen konfrontiert. Nachdem sie einige Zeit informelle Turnstunden abgehalten hatten, die als illegal galten, traten sie am 1. Advent 1946 anläßlich ihres Stiftungsfestes erstmals wieder in der Öffentlichkeit auf. Wie ihr Protokollbuch vermerkte, hatten sie sich jedoch »damit abfinden müssen«, daß ihnen eine offizielle Wiederaufnahme des Turnbetriebs nur gestattet worden war, nachdem sie sich formell der FDJ unterstellt hatten. Nach der Neuorganisation des Sports 1947 wurden sie schließlich als Sektion in die neu gegründete Sportgemeinschaft integriert. Wie einer der damals Beteiligten schilderte, war man sich bewußt, daß diese Zentralisierung einen weiteren Schritt in die Abhängigkeit bedeutete. Dennoch wurde diese Maßnahme schließlich akzeptiert, denn die Sportler trösteten sich damit, daß jetzt staatliche Mittel in die Töpfe der SG flössen. »Die einzelne Vereinsmeierei war damals nicht gefragt. In der Sportgemeinschaft waren alle unter einem Hut, und so war von oben eine bessere Ubersicht über das, was da getrieben wurde. Hätten wir die Sportgemeinschaft nicht gegründet, dann hätte es eben keine Mittel gegeben. Die Sportgemeinschaft wurde ja unterstützt, teils von Betrieben, teils vom Kreis. Da gab es ganz schöne Gelder manchmal.«19
Der Zusammenschluß der Sparten, Turnen, Fußball und Radfahren blieb weitgehend auf die formale Ebene beschränkt. Die den Sektionsleitungen übergeordnete Leitung der SG verwaltete u.a. den gemeinsamen Finanzhaushalt der Sportgemeinschaft. Ob es über die zentrale Verteilung der Finanzmit17 Zeitzeugeninterview Nz 1. 18 Ortschronik Niederzimmern, verfaßt von Edmund Kühn, unveröffentlichtes Manuskript, Anhang: Bericht zur Feier des 100jährigen Bestehens der Turner. 19 Zeitzeugeninterview Nz 1.
249
tel zu Rivalitäten zwischen den einzelnen Sektionen kam, konnte nicht ermittelt werden. Ein Zeitzeuge wies jedoch daraufhin, daß die Sektionen versuchten, auf informellem Weg in diesem Bereich eine Teilautonomie zu bewahren: »Die Zuschüsse, die wir bekamen, die kamen in eine gemeinsame Kasse, und der Vorstand beschloß, welche Sektion was bekommt. Wenn eine Sektion durch Veranstaltungen Geld einnahm, so kam das auch in die gemeinsame Kasse. Es existierte allerdings auch noch eine schwarze Kasse, aber das durfte niemand wissen.«20
Die einzelnen Sektionen blieben im alltäglichen Sportbetrieb und in ihren übrigen Aktivitäten weitgehend autonom. Diese informelle Selbständigkeit spiegelte sich auch im Selbstverständnis der einzelnen Sektionen und in der Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit wider. Jede Sektion präsentierte sich der Gemeinde in eigenständigen Veranstaltungen und führte ihr eigenes Protokollbuch. Gemeinschaftliche Aktivitäten außerhalb des Sports wie etwa Ausflüge oder Weihnachtsfeiern wurden innerhalb der Sektionen und nicht mit der ganzen SG veranstaltet. Die Mitglieder identifizierten sich daher weniger stark mit der Sportgemeinschaft, sondern fühlten sich weiterhin als Turner, als Fußballer oder als Radfahrer. Daran änderte sich auch nichts, als die SG 1959 auf Drängen des Kreises in eine Betriebssportgemeinschaft (BSG) der LPG »Ernst Goldenbaum« überführt wurde. Wie ein Zeitzeuge berichtete, nahmen dies die Beteiligten, die Sportler wie auch die LPG, als eine Formalität hin. Die Trägerschaft durch die LPG schloß einige gegenseitige Verpflichtungen ein, die jedoch weder die Leitungsinstanzen der Sportgemeinschaft noch die sportlichen Aktivitäten berührten. Die LPG mischte sich nicht ein, und weder Sportler noch Sportfunktionäre mußten Mitglied der LPG sein: »Die BSG Traktor, das war dasselbe wie die Sportgemeinschaft, es wurde nur der Namen Traktor übernommen. Die Umbenennung wurde vom Kreis aus angestrebt und gefördert. Aber dadurch hat sich nichts geändert. Die LPG hatte damit nicht viel zu tun. Sie hatte keine Einwirkung auf uns. Die Entscheidungen trafen allein wir im Vorstand. Die LPG war verpflichtet, den Sport zu unterstützen, die stellte zum Beispiel einen LKW, um die Fußballer zu fahren. Die von der LPG wurden auch mit in die Vorstandssitzung geladen. Die stellten auch mal Forderungen, daß wir bei der Ernte helfen sollen usw. Die LPG war andererseits verpflichtet, der Sportgemeinschaftjedes Jahr Mittel zur Verfügung zu stellen. Das ging vielleicht mit 1000 Mark im Jahr los und hörte später mit 3000 Mark auf.«21
Es scheint in der Gemeinde eine Ubereinkunft über die informelle Autonomie des »Sportvereins« bestanden zu haben, die sowohl von der LPG als auch von der Gemeindeverwaltung akzeptiert worden war. So mischte sich die Gemeindeverwaltung nur wenig in die Belange der Sportgemeinschaft ein. Da das »Ge20 Ebd. 21 Ebd.
250
setz zur Förderung der Jugend und des Sports« die Gemeindevertretung verpflichtete, sich mit diesen Bereichen zu befassen, thematisierte sie in ihren Sitzungen allerdings bestimmte Probleme der Sportgemeinschaft, wie z.B. die zeitweise Verringerung der Mitgliederzahlen oder daß Trainingsstunden unregelmäßig durchgeführt wurden. Sie gab der SG jedoch selten direkte Anordnungen. Bei den Wahlen der Vorstände und der Vorsitzenden, die durch die Mitglieder erfolgten, bestanden hingegen Auflagen hinsichtlich der Parteizugehörigkeit der Kandidaten. Der befragte Zeitzeuge versicherte, daß man diese weitgehend umgehen konnte: »Der Vorstand war zwar schon ein bißchen abhängig von der Partei, aber bei uns in Niederzimmern wurde nicht so direkt danach gefragt. Vom Vorstand sollte eine bestimmte Zahl in den Parteien und in der Gewerkschaft sein. Aber nicht alle. Wenn man Kandidaten aufgestellt hat, mußte man darauf achten, daß man von den Parteien und Massenorganisationen eine bestimmte Zahl aufstellte. Die doppelte Zahl wurde vorgeschlagen, und ein Teil wurde gewählt. Ich war jahrelang Sektionsleiter beim Turnen und war nie in der Partei.«22
Uberprüft man die Parteimitgliedschaft der kommunalen Sportfunktionäre, erscheint diese Aussage glaubwürdig, denn nur etwa die Hälfte aller Vorsitzenden der Sportgemeinschaft und der Sektionen gehörten einer Partei an.23 Für die Sportler war bei der Wahl ihrer Sportfunktionäre das persönliche Ansehen und die Fähigkeit, die Interessen der Sportler nach außen zu vertreten, ausschlaggebend. Die Sektionsleiter stammten größtenteils aus Familien, die bereits seit mehreren Generationen den Turnern angehörten. 24 Es gibt keine Hinweise, daß die SED-Mitgliedschaft eines Sportlers ihn grundsätzlich bei der Mehrheit seiner Sportkameraden diskreditiert hätte, so daß er bei Wahlen schlechtere Chancen gehabt hätte. So äußerten die beiden befragten früheren Vorsitzenden der Sektion Turnen, beide parteilos, keine negativen Urteile über die Leitungstätigkeit von SED-Mitgliedern. 25 Obwohl die übergeordneten Behörden versuchten, die Parteimitgliedschaft als neue Zugangsvoraussetzung für Leitungsfunktionen in der SG zu etablieren, behielten für die Beteiligten die früher gültigen Auswahlkriterien Geltung. Die Turner reagierten auf die Einmischungen der Behörden pragmatisch. W e ein Zeitzeuge berichtete, arrangierten sich die Sportler zumindest formal 22 Ebd. 23 Hier handelt es sich um eine Schätzung, da die Parteimitgliedschaft, wie bereits in Kap. III. 3.2.2. ausgeführt, nicht mit letzter Gewißheit festgestellt werden konnte. Die Namen der Sportfunktionäre in: Kirnich, Streifzug, S. 78fF. 24 Ein Zeitzeuge definierte die Zugangskriterien für Leitungspositionen in der SG so: »Es mußte schon einer sein, der ein bißchen ein Ansehen hatte und der auch vertrauenswürdig war. Sie mußten natürlich auch ein bißchen beschlagen sein und gut reden können« (Zeitzeugeninterview N z 1). 25 Zeitzeugeninterviews N z 1 und N z 5.
251
mit den vorgegebenen Bedingungen, d.h. mit den Auflagen, denen sie sich nicht entziehen konnten, wenn sie Nachteile für die eigene Vereinigung vermeiden wollten: »Der Staat hat sich schon auch in die Belange der Sportgemeinschaft eingemischt. Bei großen Versammlungen, da waren immer einer oder zwei vom Kreis, der Bürgermeister und welche von der SED vom Ort da. Da wurden vorher schon mal Reden gehalten, und die gaben die Richtung an.... Wir sollten uns auch beim Nationalen Aufbauwerk beteiligen und Mitgliederwerbung betreiben. Daran hing auch wieder eine Geldprämie vom Staat. Bei der Mitgliederwerbung wurde natürlich auch viel Schwindel gemacht. Es wurden eben einfach zehn Jugendliche aufgenommen. Dann stand eben die erforderliche Zahl von Namen da, und wenn es nicht paßte, wurden sie einfach wieder abgemeldet. Da wurde aber nicht nachgefragt.«26
Wie im Zusammenhang mit der organisatorischen Umstrukturierung und der Besetzung von Leitungsfunktionen deutlich wurde, distanzierten sich die Beteiligten von den staatlichen Einmischungen nicht durch offen oppositionelles Verhalten oder indem sie sich demonstrativ verweigerten. Vielmehr verfolgten sie die Strategie, nach außen den Anschein zu erwecken, sich anzupassen, aber dennoch wenigstens teilweise ihre Selbstbestimmung zu bewahren. U m die eigenen Wünsche nach Eigenständigkeit mit der Fremdbestimmung in Einklang zu bringen, wurde bestimmten Auflagen die Schärfe des Zwangs genommen, indem die Beteiligten sie als eigene Anliegen umdeuteten. Dies zeigte sich beispielsweise darin, daß ein Zeitzeuge auch die positiven Seiten der Verpflichtungen betonte: »Wir haben für das Nationale Aufbauwerk zum Beispiel vom Turnen aus den Wartturm restauriert. Es wurde ganz gern gemacht, es mußte aber auch gemacht werden, weil das im Plan drinstand.«27 Für die Restaurierung des Wartturms lag eine eigene Sinngebung nahe, denn der aus dem Mittelalter stammende Wehrturm war ein Symbol der Geschichte des Dorfes. Aber auch die Sportwerbeveranstaltungen, die in den fünfziger Jahren zusammen mit der FDJ durchgeführt werden mußten, bewerteten die Beteiligten ähnlich positiv. Sie hoben hervor, daß diese Veranstaltungen Gelegenheit zu Ausflügen in die Umgebung und zu öffentlichen Auftritten boten: »In den ersten Jahren haben wir mit der FDJ zusammen Werbeveranstaltungen für den Sport durchgeführt. Sonst gab es mit der FDJ kaum eine Zusammenarbeit, denn die Turner hatten für die FDJ nicht allzuviel übrig. Die FDJ hatte damals eine Kapelle, die dann auf den Werbeveranstaltungen spielte. Wir und die Radfahrer übernahmen den sportlichen Teil. Aber so schlecht waren diese Werbeveranstaltungen nicht. Da ging es eben mal weg, 10, 20 oder auch mal 50 Kilometer, und dann wurde aufgetreten.«28
26 Zeitzeugeninterview N z 1. 27 Ebd. 28 Ebd. Die Teilnahme der Turner an Sportwerbeveranstaltungen ist in den Gemeindeakten bis 1956 nachgewiesen. Gemeindearchiv Niederzimmern Β 9.
252
In der Abgrenzung von der FDJ distanzierte sich der Zeitzeuge zugleich von der politischen Funktionalisierung und Vereinnahmung des Sports. Indem sich der »Turnverein« explizit auf Traditionen bezog, entwickelte er aber auch eine offensive Gegenstrategie, um der drohenden Vereinnahmung entgegenzusteuern.29 Durch die Berufung auf seine langjährige Geschichte, die Vereinstraditionen sowie die Pflege des Vereinsbrauchtums definierten die Beteiligten die Funktion und die Bedeutung des »Turnvereins« eigenständig. Sie distanzierten sich auf diese Weise von den politisch-ideologischen Funktionen, die die SED vorgab. In der Betonung der Traditionsbezogenheit beharrten die Beteiligten auf eigenen Einstellungen und Deutungsmustern, die sie der Ideologie, die der Staat vertrat, entgegensetzten. Die Verwendung des Begriffs »Tradition« hatte dabei fast propagandistischen Charakter. Obwohl die Sektion Turnen eine Neugründung war, verstand sie sich dennoch als die unmittelbare Fortsetzung des alten Vereins. Dies wurde bereits deutlich, als sie den Termin ihres ersten öffentlichen Auftritts 1946 auf den Gründungstag des alten Turnvereins legte. Auch das Fest zum 100jährigen Jubiläum, das die Sektion 1963 feierte, bezog sich auf den Gründungstag des früheren Turnvereins. Die offensive Betonung von Kontinuität zeigte sich auch darin, daß die Beteiligten die Protokollbücher des früheren Vereins weiterführten und in der Alltagssprache weiterhin vom »Turnverein« die Rede war. Nicht nur die befragten Zeitzeugen sprachen vom »Verein«, wenn sie über die Sektion berichteten, sondern auch der Ortschronist benutzte diesen Begriff in seinen Aufzeichnungen noch während der sechziger Jahre.30 Besonders in der Pflege des dörflichen Festbrauchtums demonstrierten die Turner, daß sie auf den eigenen kulturellen Standards bestanden. Sie richteten zwei der beliebtesten dörflichen Veranstaltungen aus: die Turnerspinnstube zu Fastnacht und das Schauturnen alljährlich am 1. Advent - ein Termin, der wiederum an den Gründungstag des alten Turnvereins erinnerte. Beide Veranstaltungen fanden seit den 1880er Jahren statt und galten im Dorf neben der Kirmes als die traditionsreichsten Dorffeste. Der Ablauf der Veranstaltungen stellte ein immer wiederkehrendes Ritual dar; selbst die alten Symbole wie die Vereinsfahne wurden verwendet:
29 Noch in der Retrospektive umschrieben die befragten Zeitzeugen die Form der Vereinsaktivitäten sehr häufig mit dem Begriff der Tradition. Bei der Verwendung des Begriffs »Tradition« in der vorliegenden Studie beziehe ich mich auf die Bedeutung, die diesem Begriff von den Zeitzeugen zugeschrieben wurde: Gemeint sind überlieferte Formen fìir die Gestaltung von Vereinsaktivitäten. Dabei konnte nicht rekonstruiert werden, ob diese Formen bereits auf die Zeit der Vereinsgründung zurückgehen oder erst im Laufe der Zeit entstanden. Die Beteiligten verwendeten den Begriff für Brauchtum, das seit der Vereinsgründung bis etwa in die Zwischenkriegszeit entstanden war. 30 Ortschronik.
253
»Das Schauturnen am 1. Advent, das war der Stiftungstag. Da ging der Spielmannszug los und holte beim ältesten Mitglied die Fahne ab, und dann war Fahneneinmarsch im Saal. Der Spielmannszug stellte sich oben auf, und es wurde gespielt und eine kleine Ansprache gehalten. Und dann turnten die einzelnen Riegen. Es wurden auch Gastvereine eingeladen, die auch turnten. Zugesehen haben alle, die Interesse hatten, nicht nur Vereinsmitglieder. Da war alles so voll, da konnte kein Kellner mehr durchgehen.«31 Die Bedeutung, die das D o r f dem mit der Turnerspinnstube verbundenen Brauchtum zumaß, wurde dadurch unterstrichen, daß es dem Ortschronisten zu Beginn seiner Aufzeichnungen 1959 einen kleinen Exkurs darüber wert war: »Am Nachmittag kommen die Frauen und auch Männer, viele mit Kindern, auf dem Schenksaal zusammen. Im Lottospiel werden Korbwaren ausgespielt. Die Mitspieler kaufen Lottokarten. Nun werden die Nummern ausgelost. Wer eine Zahlenreihe voll hat, erhält einen Gewinn. So wiederholt sich das Spiel mehrmals. Gegen 6 Uhr abends gehen alle mit oder ohne Körbe nach Hause. Am Abend findet ein Maskenball statt. Dieser Brauch ist sehr alt.«32 Ebenso wie das Schauturnen erfreute sich dieses Fest im D o r f großer Beliebtheit: »Die Turnerspinnstube war Tradition. Es kamen in den fünfziger Jahren immer etwa 200 Leute. ... Abends war dann Faschingstanz, Maskenball. Der war auch immer sehr gut besucht. Es gab Zeiten, da waren 400 bis 500 Menschen im Saal. Da kamen auch viele von außerhalb. Der Maskenball hier war bekannt. Es gingen Leute jeden Alters dorthin von 14 bis 70 Jahren. Wir hatten Zeiten, wo wir 50, 60 Masken auf dem Saal hatten, richtig schöne Masken.«33 Die wichtige Rolle, die die Turner für die dörfliche Feierkultur spielten, trug zu ihrer Popularität in der Gemeinde bei. Durch ihre Veranstaltungen gewann die Sektion Turnen ein großes öffentliches Renommee, und sie legitimierte sich in den Augen der DorföfFentlichkeit als die Institution, die sich u m die Aufrechterhaltung von Traditionen, auf die man stolz war, verdient machte. Indem die Sektion auf das überlieferte Brauchtum und ihr Eigenleben beharrte, ermöglichte sie nicht nur die Identifikation der Mitglieder mit ihrem »Verein«, sondern auch die Identifikation großer Teile der Bevölkerung. In der Bedeutung, die die Bürger Niederzimmerns dem Traditionserhalt zumaßen, bündelte sich stellvertretend für andere Lebensbereiche die allgemeine Ablehnung der gesellschaftlichen Veränderungen. Besonders in der Zeit, als mit dem Aufbau des Sozialismus der gesellschaftliche U m b r u c h in der D D R vorangetrieben wurde, entfaltete das Festhalten an überlieferten Werten eine besondere Wirksamkeit. N o c h heute spricht aus den Äußerungen einiger Zeitzeugen, die z.T. 31 Zeitzeugeninterview Nz 1. 32 Ortschronik.
33 Zeitzeugeninterview Nz 1.
254
ungefragt die Attraktionen des dörflichen Festbrauchtums schilderten, die Genugtuung darüber, daß die Traditionen im Dorf auch während der 40jährigen SED-Herrschaft aufrecht erhalten wurden.34 So gewinnt man den Eindruck, daß das Festhalten an diesen Bräuchen im Selbstverständnis vieler Einwohner Niederzimmerns eine oppositionelle Verhaltensweise gegenüber dem herrschenden System darstellte. Dieses Bewußtsein stand jedoch im Widerspruch zu den tatsächlichen Gegebenheiten, denn die Staatsmacht setzte der Brauchtumspflege in Niederzimmern keine merklichen Einschränkungen entgegen, denn bis zu einem gewissen Grad war der Bezug auf Traditionen sogar erwünscht. Die Pflege des überlieferten Brauchtums in Niederzimmern ist zugleich als Versuch der Bevölkerung zu werten, die dörfliche Identität zu erhalten. Eine identitätsverstärkende Rolle spielte das Bewußtsein einer kollektiven Abwehrhaltung gegenüber der staatlichen Einflußnahme, denn darin wurde zugleich die Abgrenzung nach außen, gegen das Fremde, markiert. Die Sektion Turnen sowie die durch sie transportierten Traditionsbestände symbolisierten dabei in besonderem Maße einen Teil der früheren dörflichen Identität. Der Ortschronist verknüpfte diese in seinen Aufzeichnungen zur 100-Jahr-Feier unmittelbar mit dem Turnverein: »Der Verein war seit seiner Gründung mit dem Dorfe fest verwurzelt, so daß mit Recht von einem Turnerdorf gesprochen werden kann.«35 Diese Sichtweise bestätigte auch einer der Zeitzeugen: »Der Sport war schon ein Aushängeschild für den Ort. Niederzimmern war in der Umgegend als Sportlerdorf bekannt. Und auch die Bevölkerung des Orts wurde dadurch zusammengeschweißt. Wenn Turniere waren, da war die Dorfbevölkerung schon aufgeschlossen, alle, nicht nur die Mitglieder der Sportgemeinschaft. Man war allgemein Stolz darauf, wenn die Sportler gut abgeschnitten haben. Außerdem hatte der Sport ja großen Anteil an den Veranstaltungen.«36
Die Anziehungskraft der Sektion beruhte besonders in den fünfziger Jahren auch auf ihren sportlichen Erfolgen. Sie beteiligte sich an Kreis- und Bezirksturnieren, wobei einige ihrer Mitglieder sehr gute Ergebnisse erzielten. Turner aus Niederzimmern errangen 1955 die Titel der ersten und zweiten Kreismeister der Männer sowie der ersten Kreismeisterin unter den Frauen. Auch die ersten und zweiten Sieger und Siegerinnen in der Altersklasse der A-Jugend kamen aus Niederzimmern. Selbst beim Bezirksturnfest konnten die Niederzimmerner Turner noch den 3. und 8. Platz gewinnen.37 Die Erfolge der Sektion trug zur Ausprägung eines Zusammengehörigkeitsgefühls im Dorf bei, denn auf diese Weise hob man sich von den anderen Gemeinden der Region ab. 34 35 36 37
Beispielsweise in den Zeitzeugeninterviews N z 5, N z 8, N z 9. Ortschronik. Zeitzeugeninterview N z 1. Gemeindearchiv Niederzimmern Β 16.
255
Höhepunkte in der Geschichte der Sektion - zwei Vergleichskämpfe mit dem westdeutschen Turnverein Eschwege 1957 - hatten in Niederzimmern fast legendären Charakter und verstärkten die Identifikation der Bevölkerung mit dem »Turnverein«. Der Kontakt zum Eschweger Verein war auf offiziellem Wege durch den Kreisfachausschuß Turnen hergestellt worden. Dieser lud die Eschweger Turner zu einem Wettkampf nach Thüringen mit dem Kreissieger Niederzimmern ein. Als die eigentliche Sensation im Dorf galt jedoch der einige Monate später erfolgte Rückkampf der Niederzimmerner in Eschwege, denn dieser mußte den zuständigen Behörden abgetrotzt werden. Die lange geplante Fahrt, zunächst von den Bezirksbehörden untersagt, fand schließlich statt, nachdem die Niederzimmerner Sportler nachdrücklich interveniert hatten. So mobilisierten sie zu einem Besuch des Bezirksbeauftragten in dieser Angelegenheit zahlreiche Teilnehmer. Die Argumente, die sie bei den Behörden für die Reise vorbrachten, zeugen davon, daß sie die politische Propaganda für die eigene Sache instrumentalisierten, um ihre Erfolgschancen zu steigern. Wenn es, wie das Protokollbuch vermerkte, hieß: »Wir lassen uns die Ehre nicht nehmen, das gesamtdeutsche Gespräch zu fördern«, wurde auf die staatliche Propaganda Bezug genommen, die seit Jahren die Wiederherstellung der deutschen Einheit forderte. Die Bedeutung, die die Einwohner der Gemeinde dieser deutsch-deutschen Begegnung zumaßen, wurde schließlich in der Rezeption des Ereignisses deutlich. In den Akten der Gemeindevertretung ist vermerkt, daß es sich dabei um den kulturellen Höhepunkt des Jahres gehandelt habe. Der Ortschronist, der 1963 anläßlich des 100jährigen Bestehens der Turner einen Rückblick auf deren Geschichte verfaßte, bezeichnete das Ereignis sogar als »Höhepunkt im Turnerleben unseres Dorfes«.38 Die Bedeutung dieser Sportveranstaltung für die dörfliche Bevölkerung resultierte besonders aus der Tatsache, daß es den Turnern gelungen war, sich gegen behördliche Einwände durchzusetzen, aber auch aus der gewonnenen Bestätigung, sich durch dieses Ereignis gegenüber den anderen Gemeinden hervorzuheben. Die sportlichen Erfolge und der Traditionsbezug der Turner stärkte zugleich das Gruppenbewußtsein innerhalb der Sektion. Zum Zusammenhalt trug die Popularität, die die Turner in der Dorföffentlichkeit genossen, ebenso bei wie die Begeisterung für die von ihnen ausgeübte Sportart. Darüber hinaus spricht eine gemeinsame, >konspirative< Aktion dafür, daß sie ihren Zusammenhalt auch mit der kollektiven Kritik an der politischen Situation in der DDR verstärkten: »Wir waren ja alle nicht linientreu, bei uns waren wenig in der Partei. Als wir den Wartturm reparierten, da hatten wir eine Niederschrift gemacht, einen Zettel, auf dem stand, wie gut uns das ging bei den Russen und wie die Partei ist und was da alles 38 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 17; Ortschronik, Anhang, Bericht des Chronisten zur Feier des 100jährigen Bestehens der Turner.
256
dranhängt. Eben alles, was uns nicht gefallen hat, wurde niedergeschrieben und einer hat das dann verlesen und dann wurde abgestimmt und jeder unterschrieb. Dann haben wir den Zettel in eine Flasche gesteckt und eingemauert. Einen von uns Turnern, den hatten sie dann 1953 eingesperrt. Der war am 17. Juni in Jena und hat das Gefängnis mit aufgemacht. Da haben wir die Flasche wieder rausgeholt und haben das Papier verbrannt. Wir hatten Angst, daß er irgend etwas sagt. Das hätte einen Mordsklamauk gegeben.«39
Die Basis des Zusammengehörigkeitsgefühls der Sektionsmitglieder bestand in der Vermittlung von sozialen Kontakten sowie in der Freizeitgestaltung, die im »Verein« geboten wurde. Zugleich sind darin wichtige Funktionen der Sektion markiert. Die Sportler verbrachten einen nicht unbedeutenden Teil ihrer Zeit miteinander. Neben dem allwöchentlich stattfindendem Training, dem ein gemeinsamer Wirtshausbesuch folgte, arbeitete man gemeinsam an Projekten des NAW, fuhr zu Werbeveranstaltungen und Turnieren und bereitete die Feiern vor. Die Mitgliedschaft in der Sportgemeinschaft bot nicht nur Freizeitunterhaltung in einer Zeit, in der das Leben auf dem Dorf noch wenig Alternativen bot, sondern sie bedeutete auch - besonders für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen - dazuzugehören. Die Möglichkeit, rasch Anschluß zu finden, erhielten dabei auch die Vertriebenen und Zugezogenen: »Bis ich ungefähr 25 oder 26 war, bin ich regelmäßig zum Turnen gegangen, zur Übungsstunde. Alles spielte sich damals im Verein ab. Das Fernsehen gab es ja noch nicht, es gab nur das Vereinsleben. Wer nicht bei einem Verein war, gehörte nicht dazu. ... Die Zugezogenen, die schlossen sich den anderen an und knüpften in den Vereinen Freundschaften. Da hieß es dann: >Gehst du nicht mit zum Turnen oder in einen anderen Sportvereine Niederzimmern hatte ja genügend.«40
Dazugehören bedeutete zudem, daß die Sportkameraden Anteil an biographischen Ereignissen nahmen: »Zur Hochzeit, Silberhochzeit oder Jubiläum, da spielte der Spielmannszug ein Ständchen bei den Mitgliedern der Sportgemeinschaft. Und dann kam vom Verein eine kleine Abordnung und brachte Geschenke und gratulierte. Auch bei Beerdigungen von Sportlern war es üblich, daß Sportler den Sarg getragen haben.«41
Obwohl die Sektion Turnen während der fünfziger Jahre im Mittelpunkt des sportlichen Interesses im Dorf gestanden hatte, geriet sie seit Beginn der sechziger Jahre hinsichtlich ihres Mitgliederbestandes in die Krise. Noch während der fünfziger Jahre hatte sie einen starken Mitgliederzuwachs verzeichnet, auch wenn die Größe des Turnvereins der Vorkriegszeit, als 1937 90 Mitglieder eingeschriebenwaren, nie wieder erreicht werden sollte. Zwischen 1952 und 1957 39 Zeitzeugeninterview N z 5. 40 Ebd. Die integrative Funktion besonders der Sportvereine fur die Vertriebenen betont auch eine Studie zur Flüchtlingsintegration in einer westfälischen Gemeinde. Vgl. dazu: Lüttig, S. 191ff. 41 Zeitzeugeninterview N z 1.
257
war die Zahl der Turner von 38 auf 50 aktive Mitglieder angewachsen, den höchsten Stand der Nachkriegszeit.42 Die Sektion stellte in dieser Zeit die mitgliederstärkste Abteilung der Sportgemeinschaft dar. Seit Beginn der sechziger Jahre wurde wiederholt über Nachwuchsmangel geklagt, aber auch darüber, daß der Besuch der Übungsstunden nachgelassen hatte und keine nennenswerten sportlichen Leistungen bei Wettkämpfen mehr erbracht wurden.43 1964 hatte die Sektion noch 40 aktive Mitglieder. Durch Werbemaßnahmen konnte die Mitgliederzahl bis 1966 auf 44 erhöht werden. Die Sektion bestand nun neben zwölf erwachsenen Turnern überwiegend aus Kindern und Jugendlichen.44 Die Krise im Sport war nicht auf die Sektion Turnen beschränkt. Bereits 1957 hatte sich die Sektion Radfahren aufgelöst, die 1950 und 1951 im Kunstradfahren noch Thüringischer Landesmeister geworden war und 50 Mitglieder zählte. Die Gründe für den Mitgliederschwund bzw. die Auflösung zweier erfolgreicher Sektionen lagen nicht in einem generellen Rückgang des sportlichen Interesses in der Gemeinde, wie die steigenden Mitgliederzahlen der Sportgemeinschaft bewiesen. Nach einem drastischen Einbruch ihrer Mitgliederzahlen von 106 (1951) auf70 (1964) infolge der oben beschriebenen Ereignisse konnte die Sportgemeinschaft die Zahl ihrer Mitglieder durch eine massive Werbekampagne sowie die Neugründung der Sektion Reiten erheblich steigern. Im Laufe des Jahres 1964 wuchs die Mitgliederzahl der B S G von 70 auf 154 und bis 1968 sogar auf 171 Sportler an. Besonders Schulkinder und Jugendliche konnten in großer Zahl geworben werden. Die Neueintritte kamen der neu gegründeten Sektion Reiten und vor allem dem Fußball zugute. Ab Mitte der sechziger Jahre war der Fußball mit 90 Mitgliedern die stärkste Sektion der B S G geworden. Die Fußballspieler konnten nun die sportlichen Erfolge für sich beanspruchen. Die erste Mannschaft wurde 1964 Kreismeister. Für kurze Zeit gelang ihnen sogar der Aufstieg in die Bezirksliga. Die Krise der Sektion Turnen war vorrangig darauf zurückzuführen, daß sich die sportlichen Interessen auf andere Sportarten verlagerten - ein Prozeß der sich mit dem Generationenwechsel vollzogen hatte. Die Turner und Radfahrer, die in den fünfziger Jahren beide Sektionen zur Blüte geführt hatten, gehörten alle der ersten Generation seit der Neugründung an. Aus Altersgründen oder weil sie nach der Heirat in andere Orte verzogen, gaben sie nach und nach ihre sportlichen Aktivitäten auf Die Nachfolgegeneration ließ sich offenbar wenig von den turnerischen Traditionen der Gemeinde beeindrucken und wählte bevorzugt die Sportarten, die gerade in Mode kamen. So ist es denkbar, daß die zunehmende Beliebtheit des Fußballs in den sechziger Jahren mit der Verbreitung des Fernsehens in Zusammenhang stand, denn durch die Übertragung 42 Zahlen nach dem Protokollbuch der Sektion Turnen. 43 Protokollbuch. 44 Ortschronik.
258
von Fußballereignissen gewann diese Sportart an Popularität. Das nachlassende Interesse am Turnen war auch durch das Angebot neuer Sektionen begründet. Sowohl die 1964 gegründete Sektion Reiten als auch die seit 1968 bestehende Sektion Tischtennis, die beide jeweils etwa 20 Mitglieder umfaßten, traten bei der Nachwuchswerbung in Konkurrenz zu den übrigen Sektionen. Die befragten ehemaligen Turner, die noch der ersten Generation angehörten, führten das nachlassende Interesse am Turnen auf die Verbreitung des Fernsehens und die Motorisierung zurück. 45 Das Angebot von alternativen Freizeitbeschäftigungen mag den Ausstieg der erwachsenen Sportler seit Anfang der sechziger Jahre beschleunigt haben; dennoch zeigten die wieder ansteigenden Mitgliederzahlen der gesamten Sportgemeinschaft, daß auf Dauer keine generelle Abkehr vom Sport erfolgte. Die nachlassende Beliebtheit der Sportart Turnen hatte jedoch keine merklichen Folgen für die Feierkultur der Sektion. Die Turnerspinnstube und das alljährliche Schauturnen wurden weiterhin mit großem Erfolg veranstaltet. Die Turner konnten ihre kulturelle Bedeutung als Verwalter des dörflichen Brauchtums behaupten, obwohl ihre Sportart etwas aus der Mode gekommen war. Entscheidenden Anteil an der Kontinuität der kulturellen Praxis des »Vereins« hatte die mittlere und ältere Generation im Dorf, denn sie drängten darauf, diese Bräuche zu pflegen: »Die Leute haben gesagt, wir können das doch nicht untergehen lassen, das muß weitergehen. Die lange Tradition hat dabei viel ausgemacht.«46 i.2.2. Der Volkschor in Niederzimmern
Der Männerchor wurde in Niederzimmern 1947 neu gegründet. Einige Sänger der früheren »Liedertafel«, die bis 1945 existiert hatte, initiierten die Wiederaufnahme des Chorgesangs. Ebenso wie bei den Sportvereinen gestatteten die Behörden nicht, den alten Gesangverein fortzuführen, sondern verlangten die Neugründung des Chors, der sich bereits durch einen anderen Namen vom früheren Chor abzuheben hatte. Die neue Bezeichnung »Volkschor Niederzimmern«, die die Beteiligten wählen mußten, »weil das so gewünscht war«,47 sollte auf eine politisch fortschrittliche Kultur Bezug nehmen und die Distanzierung von den Relikten des bürgerlichen Zeitalters versinnbildlichen, dem der frühere Chor zugerechnet wurde. Mit der Neugründung des Chors waren auch die früheren Zugangsbeschränkungen aufgehoben, die die dörflichen Unterschichten von einer Mitgliedschaft weitgehend ausgeschlossen hatten. Die Aufsichtsbehörden duldeten die frühere soziale Exklusivität nicht länger. Der befragte Zeitzeuge schilderte die frühere Praxis der Mitgliederrekrutierung: 45 Zeitzeugeninterviews N z 1, N z 5. 46 Zeitzeugeninterview N z 1. 47 Zeitzeugeninterview N z 9.
259
»Vor dem Krieg war es so, daß bei Neuanmeldungen von jungen Mitgliedern über deren Aufnahme abgestimmt wurde. Da kam es nicht darauf an, ob einer musikalisch war. Da ist mancher gute Sänger abgelehnt worden durch Vorurteile. Es war vorwiegend so, daß reiche und mittlere Bauern im Chor waren. Arbeiter zu dieser Zeit weniger, die mußten sich erst einmal hocharbeiten, um da reinzukommen. Da sind nicht alle zum Zuge gekommen. Mein Schwiegervater war damals auch schon im Chor, aber der war gehobener Beamter bei der Reichsbahn. Nach dem Krieg mußten sich die konservativ denkenden Menschen fügen. Da ist es dann anders gewesen.«48 D i e staatliche Intervention führte zu einer sozialen Durchmischung. U n t e r den insgesamt 31 Mitgliedern waren 1947 neben 15 Bauern, die zumeist bereits d e m früheren Chor angehört hatten, z w ö l f Arbeiter und jeweils ein Handwerker, Lehrer, Pfarrer und Angestellter. 49 Auch vier Umsiedler schlossen sich d e m Chor an. In den Folgej ahren setzte sich die soziale Heterogenisierung fort. 1957 befanden sich unter den Mitgliedern nur noch zwölf Bauern neben 13 Arbeitern, f ü n f Angestellten und vier Lehrern. Staatliche Eingriffe in die Aktivitäten des Chors betrafen die Verpflichtung, bei offiziellen Feierlichkeiten oder politischen Veranstaltungen in der G e m e i n de aufzutreten und so für den kulturellen Rahmen zu sorgen: »Wir haben die verschiedensten Feierlichkeiten mit unseren Beiträgen umrahmt, ob das jetzt Stalins Geburtstag war oder die anderen staatlichen Feiern. Z u m Beispiel haben wir gesungen zur Einwohnerwahlversammlung, zur Rentnerjahresfeier, Internationaler Frauentag, Maiveranstaltung, Tag des Kindes, Feiertag der Russischen Revolution, Gründung der D D R und so weiter. Wenn Wahl war, auch morgens vor dem Wahllokal. Wir waren immer präsent. Obwohl, wir haben das nicht so gern gemocht. ... Bei solchen Feiern mußten wir in die Gaststätte kommen in den Saal. Der Chor hat eröffnet, dann wurde das Hauptreferat gehalten, dann gab's vielleicht noch eine Darbietung von Laiengruppen aus dem Dorf, und dann ging es zum gemütlichen Teil über. Den Abschluß haben wir dann auch noch mit Liedern gestaltet.«50 Auch über das Repertoire konnte der Chor nicht mehr frei verfügen. Wie der Zeitzeuge berichtete, mußten sogenannte »sozialistische Lieder« politischen Inhalts ins Programm a u f g e n o m m e n und Lieder, die v o n den Aufsichtsbehörden als unzeitgemäß beurteilt wurden, gestrichen werden: »Wir mußten ja eine Genehmigung haben für die Lieder, die wir singen wollten. Es wurden auch Lieder gestrichen. Einmal wollten wir ein ungarisches Kunstlied singen, aber da wurde uns gesagt, das sind Sachen aus der Mottenkiste, das ist nicht mehr ge48 Ebd. 49 Gemeindearchiv Niederzimmern Β 3. 50 Zeitzeugeninterview N z 9. Die Mitwirkung des Volkschors an allen politischen und gesellschaftlichen Veranstaltungen ist auch in den Gemeindeakten dokumentiert. Gemeindearchiv Niederzimmern Β 9, Β 17, Β 28, Β 69. Eine ähnliche Rolle fur das öffentlich politische Leben der Gemeinde nahm der Spielmannszug der Sportgemeinschaft ein. Auch er sorgte für die musikalische Begleitung zahlreicher politischer Veranstaltungen.
260
fragt. Nach ungefähr 15 Jahren haben wir das Lied wieder eingereicht, und da ist es mit Bravour gesungen worden. Das war variabel, man hat nie gewußt, wie man es richtig macht.... Das Repertoire war unterschiedlich, je nachdem, wofür gesungen wurde. Wir haben Volkslieder gesungen, Vagantenlieder, Kunstlieder, aber auch sozialistische Lieder. Mit der Zunahme dieser vielen patriotischen Feiertage, die da ausgerufen worden sind, wurde ein anderer Liedschatz gefordert, und zwar in Bezug auf die politische Umgestaltung der DDR. Es wurde viel Wert drauf gelegt, daß wir auch diese Lieder einüben. Bei staatlichen Feiern wurden zum Anfang meistens sozialistisch geprägte Lieder gesungen, aber dann hat man wegen der Gemütlichkeit der Feiern auch einige nette Volkslieder dazu gesungen.«51
Die Reaktion der Sänger auf die staatliche Bevormundung erschien zwiespältig. Der befragte Zeitzeuge begründete die Abneigung der Chormitglieder gegen »sozialistische Lieder« damit, daß die Sänger deren propagandistischen Gehalt abgelehnt und die alten Volkslieder vorgezogen hätten. Gleichzeitig geht aus seinen Äußerungen hervor, daß die Chormitglieder rasch bereit waren, sich den Anforderungen des Staates zu beugen: »Anfangs, als wir die sozialistischen Lieder singen sollten, gab es Widerstand vom Chorleiter, aber auch vom Vorstand und von den Sangesbrüdern. Wir lehnten diese Lieder ab, weil sie uns nicht viel gaben. Es war nur eine Glorifizierung des Regimes, und nicht jeder ist damit konform gegangen. Der Dirigent und der Vorstand mußten es aber dann doch bei uns durchsetzen, daß wir diese Lieder singen. Man hat an uns appelliert: »Sangesbrüder, ihr wißt doch, wie momentan die Zeiten sind, und wir schaden uns selbst, wenn wir das nicht machen.< Die Zuschüsse, die wir jedes Jahr von der Gemeinde bekamen, um Noten zu kaufen, die wären dann bestimmt weg gewesen.... Auf Grund der Genehmigungen hat man sich schon gemaßregelt gefühlt als Chormitglied. Wir haben uns dann halt gegenseitig getröstet und gesagt: »Entweder singen oder nicht singen. Da müssen wir die Sachen, die für uns nicht schön klingen, eben schlucken und müssen sie singenHoch< gesungen und dann gab's eine ordentliche Gratulation. Dann waren auch ein oder zwei Runden fallig.«55
Ebenso wie die Sektion Turnen begleitete der Chor herausragende biographische Ereignisse seiner Mitglieder:
53 Ebd. 54 Ebd. 55 Ebd.
262
»Wir haben auch bei Sangesbrüdern gesungen, die im Krankenhaus lagen. ... Die Sangesbrüder sind auch gekommen, wenn einer Hochzeit hatte. Sie haben dann einige Lieder gesungen und sind dann öfter noch lange geblieben. Auch zu Geburtstagen, denn man wußte ja, da gab's wieder was zu trinken.«56 Auch die Chormitglieder betrachteten die Traditionspflege als eines ihrer Hauptziele. Sie sahen sich in Kontinuität zum alten Gesangverein und hatten sich die Pflege des überlieferten Brauchtums und der alten Liedtradition zur Aufgabe gemacht. Auf diese Weise definierten sie ihre Funktion in ihrem eigenen Sinn und distanzierten sich so von ihrer politischen Rolle, die ihnen der sozialistische Staat zuschrieb. Das politisch konforme Wohlverhalten des Chors war im Bewußtsein der Mitglieder nur ein Mittel zum Zweck, das es ihnen ermöglichte, die eigenen Interessen weiter zu verfolgen. Die starke Identifikation der Chormitglieder mit der langjährigen Chortradition in der Gemeinde wird daran ersichtlich, daß ihre Festaktivitäten immer wieder auf die Geschichte des Chors verwiesen. In der Feier des 100jährigen Bestehens des Chors 1957 wurde ein unmittelbarer Bezug zur »Liedertafel« hergestellt. Das Stiftungsfest, das an deren Gründungstag gefeiert wurde, war der Höhepunkt im Jahresverlauf Ebenso wie die Turner verwendeten die Sänger dabei mit der Vereinsfahne ein ererbtes Symbol. Nach dem Bericht des Zeitzeugen hatte der Ablauf des Festes rituellen Charakter: »Am liebsten haben wir bei unserem eigenen Stiftungsfest gesungen. Das Stiftungsfest wurde jedes Jahr gemacht. Das ist unser höchster Feiertag gewesen. Wir haben die auswärtigen Chöre dazu eingeladen. Das ging dann schon am Nachmittag los. Die Fahne wurde aufgestellt, und jeder Chor hat da seinen Vortrag gehalten. Der Bürgermeister und die Honoratioren des Ortes waren auch dabei. Wir hatten auch eine Musikkapelle da, die zwischen den Chören spielte. Und abend gab es jedesmal Tanz. Ohne das ging es nicht.«57 Auch mit dem regelmäßig zu Pfingsten stattfindenden Waldfest der Sänger wurde eine Tradition aufrechterhalten und zugleich Unabhängigkeit demonstriert, wie der Zeitzeuge betonte: »Zu Pfingsten sind wir dann bei gutem Wetter rausgezogen in den Wald. Der Fleischermeister war da mit Bratwürsten und der Wirt mit Bier. Das Volk ist rausgezogen und hat sich dort hingelagert. Da war nichts aufgebaut, wir haben uns hingesetzt, wo wir gerade standen. Und abends sind wir dann in die Schenke marschiert, und dann ging der Tanz los. Aber das war eine ganz freie Gestaltung gewesen vom Chor, ohne daß uns da einer was genehmigt hätte. Wir haben das eben gemacht, das war nicht angemeldet, das haben wir auf unsere Kappe genommen. Ist immer gutgegangen. Und die Bevölkerung war dabei.«58 56 Ebd. 57 Ebd. 58 Ebd.
263
Beide Feiern stellten neben der Kirmes und den Veranstaltungen der Turner die wichtigsten Ereignisse der dörflichen Feierkultur dar. Der Chor präsentierte sich der Dorföffentlichkeit durch seine Feste als eine Institution, die sich um die Aufrechterhaltung dörflicher Traditionen verdient machte und verkörperte auf diese Weise ebenso wie der »Turnverein« einen Teil der alten Dorfkultur und der Geschichte der Gemeinde. Die Veranstaltungen des Chors boten der Gemeinde zugleich ein Forum zur Pflege von sozialen Kontakten. Neben den traditionellen Festen waren es auch öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen, die sich großer Beliebtheit in der Bevölkerung erfreuten: »In der Schenke haben wir bunte Abende gemacht, bei denen wir Singspiele aufführten. Z u m Beispiel >Beim Kronenwirt< oder >Ein Abend im Gesangverein zu BummelsdorfLammLamm< gekommen, da hat man gewußt, heute sind die Fußballer da, und das andere mal sind die Turner da. Die, die sich zu den einen hingezogen gefühlt haben, die sind an dem Tag gekommen, an dem sie dort waren.«90
89 Ebd. 90 Ebd.
273
Auch der Vertreter des Chors betonte, wie wichtig die Geselligkeit war, die durch gemeinsame Gasthausbesuche, den alljährlichen Vereinsausflug und die Anteilnahme an biographischen Ereignissen der Mitglieder gepflegt wurde. Bei Hochzeiten und Geburtstagen älterer Mitglieder brachte der Gesangverein ein Ständchen. 91 Selbst der Schriftführer des Protokollbuches sah sich 1965 anläßlich eines gemeinsamen Essens, für das einer der Sänger ein Spanferkel gestiftet hatte, bemüßigt, auf die Bedeutung der Geselligkeit hinzuweisen: »Ich habe dies [das Spanferkelessen] hier nur festgehalten, damit spätere Generationen nachlesen können, daß bei uns nicht nur gesungen wurde, sondern auch hin und wieder mal was getan wurde, das der Geselligkeit diente und die Sänger in kameradschaftlicher Weise miteinander verkettet.«92
Die vereinsinterne Feierkultur war im Gesangverein Bernstadt besonders ausgeprägt. So wurden jedes Jahr mindestens zwei Feiern ausschließlich für die Mitglieder und deren Familienangehörige veranstaltet. Bei diesen Festlichkeiten - es handelte sich um eine sogenannte Familienfeier im Frühjahr und eine Weihnachtsfeier oder alternativ eine Faschingsveranstaltung, meist mit gemeinsamem Gesang und anschließendem Tanzvergnügen - wurde streng darauf geachtet, daß man unter sich blieb. 1958 machte der Vorstand bei der Generalversammlung darauf aufmerksam, daß »jedes Mitglied dafür Sorge tragen soll, daß keine unerwünschten Besucherden Saal betreten«.93 Während sich der Sportverein eher als Freizeitverein verstand, hatte sich der Gesangverein auch der Pflege der Liedtradition verschrieben, was dem Gruppenzusammenhalt einen zusätzlichen Inhalt gab. Das Liedrepertoire war kaum von modernen Strömungen beeinflußt. Jüngere Mitglieder, die in diesem Bereich auf Veränderungen drängten, konnten sich nach den Angaben des Zeitzeugen kaum durchsetzen: »Die Chorleiter mit dem Vorstand zusammen bestimmen das Repertoire und teilen es dann den Sängern mit. Ja, da hat es schon ab und zu ein bißchen was gegeben zwischen den älteren und jüngeren Mitgliedern. Die jüngeren Sänger haben aber auch bei der schwereren Musik mitgemacht und gespürt, daß das gut und schön ist und daß solche Chöre eben bei unserem Publikum besser angekommen sind wie das neuere. Das hat der Dirigent eigentlich immer so ganz gut gemanagt, und so hat man da mehr oder weniger einen Rahmen gefunden, der doch für jeden akzeptabel war.«94
Die Traditionalität des Gesangsvereins kommt auch in der Beibehaltung der reinen Männerbesetzung - trotz der sich allmählich einstellenden Nachwuchssorgen - zum Ausdruck:
91 92 93 94
274
Information durch Zeitzeugeninterview Bs 5; Protokollbuch des Gesangvereins. Protokollbuch des Gesangvereins. Ebd. Zeitzeugeninterview Bs 5.
»Das ist immer noch ein Männergesangverein. Wir haben auch davon gesprochen, Frauen aufzunehmen. Wir haben dann aber gesagt, solange wir einen Kirchenchor haben, brauchen wir ja nicht unbedingt einen gemischten Chor. Die älteren Sänger haben gesagt, >also in dem Moment, in dem es ein gemischter Chor wird, dann ist es für mich ausi.«95
Im Vergleich zu Niederzimmern blieb die Mitgliederzahl des Chors jedoch weitgehend stabil. Ihre Zahl war zwischen 1948 und 1954 von 48 auf 105 Mitglieder angewachsen, darunter 51 aktive Sänger. Gelanges dem Verein, bis 1961 weiter zu expandieren - man zählte damals 121 Mitglieder, darunter 57 aktive Sänger - , sank ihre Zahl bis 1968 auf 109 Mitglieder, davon 46 Aktive. Dieser Rückgang erscheint geringfügig, aber er zeigt dennoch, daß der Verein von der zunehmenden Einwohnerzahl in dieser Zeit nicht profitieren konnte. 96 U m dem drohenden Nachwuchsmangel zu begegnen, wurde schließlich zu Beginn der siebziger Jahre ein Jugendchor gegründet. 97 Der Sportverein konnte sich eines stetigen Mitgliederzuwachses erfreuen. Nach Schätzungen des damaligen Vereinsvorstandes begann man nach dem Krieg mit etwa 50 Sportlern, davon etwa 20 Turnern. 1966 war die Zahl der TSV-Mitglieder auf232 angewachsen, 1972 auf330. 98 1969 erweiterte der Verein sein Sportangebot durch eine Frauenhandballmannschaft, die damals 30 Mitglieder zählte. Seit der Nachkriegszeit dominierte in Bernstadt der Fußballsport. Vom späteren Mitgliederzuwachs profitierte diese Sparte ebenfalls. 1947 existierten drei Mannschaften, davon eine Jugendmannschaft; 1972 waren bereits sieben Mannschaften vorhanden, davon vier Jugendmannschaften und eine »Altherrenmannschaft«. Die Turner konnten ihre Mitgliederzahl zunächst steigern, vor allem durch eine 1949 gegründete Mädchenriege, die sich jedoch nicht - wie die Männer - dem Geräteturnen, sondern der Gymnastik widmete. Seit Mitte der fünfziger Jahre verloren die Turner so viele Mitglieder, daß der Sportbetrieb vollständig zum Erliegen kam. Der Zeitzeuge machte dafür mehrere Ursachen verantwortlich: »Bei den Turnern ist es dann auch so gewesen, daß das Interesse stark abgenommen hat. Dann sind eben die Jahre des Wohlstandes gekommen, und dann hat diese anstrengende Sportart, bei der man soviel üben muß, eben kaum mehr Interessenten gefunden. Die haben halt alle kapituliert und haben gesagt, >dazu bin ich nicht geeignet!. Die alten Turner sind ausgeschieden, und dann war für die Jugend keine Übungsleitung da, die sich dafür eingesetzt hätte, daß man die Jugend richtig mit heranzieht und aufbaut. So 95 Ebd. 96 Mitgliederzahlen wurden dem Protokollbuch des Gesangvereins entnommen. 97 Information von Bs 5. 98 Schätzung der Mitgliederzahlen für 1946: Bs 6. 1966: Gemeindearchiv Bernstadt 360. 1972: Festschrift des 50jährigen Vereinsjubiläums Turn- und Sportverein Bernstadt 1972. Da keine Protokollbücher existieren, läßt sich die Entwicklung der Mitgliederzahlen zwischen 1946 und 1966 nicht nachvollziehen.
275
ist es dann gekommen, daß das Turnen eingeschlafen ist. ... Es ist die Motorisierung aufgekommen, die Zeit hat es einfach mit sich gebracht, daß viele gesagt haben, wofür soll ich mich so abschinden. Der Fußball ist ein Mannschaftssport, das ist einfach etwas ganz anderes, beim Turnen muß halt jeder einzelne sein Talent zeigen. Beim Turnen da muß jemand einfach ein ganzer >Kerl< sein und viel, viel üben. Wenn man dann keinen Vorsitzenden hat, der sagt, >das ist absolut notwendig für unseren Verein, das brauchen wir, sonst fehlt irgend etwas im Verein






![POLIT-KUNST !?: Die bildende Kunst in der DDR und ihre Rezeption in der Bundesrepublik Deutschland bis zum Mauerbau [1 ed.]
9783412525996, 9783412525989, 9783412525972](https://dokumen.pub/img/200x200/polit-kunst-die-bildende-kunst-in-der-ddr-und-ihre-rezeption-in-der-bundesrepublik-deutschland-bis-zum-mauerbau-1nbsped-9783412525996-9783412525989-9783412525972.jpg)
![Der Weg zum Maschinenschreiber: Ausbildung im Maschinenschreiben nach dem Tastsystem bis zum Geschäftsmaschinenschreiber [9. Auflage. Reprint 2019]
9783486769449, 9783486769432](https://dokumen.pub/img/200x200/der-weg-zum-maschinenschreiber-ausbildung-im-maschinenschreiben-nach-dem-tastsystem-bis-zum-geschftsmaschinenschreiber-9-auflage-reprint-2019-9783486769449-9783486769432.jpg)
![Internationales Signalbuch: Amtliche Liste der Seeschiffe der Bundesrepublik Deutschland mit Unterscheidungssignalen als Anhang zum Internationalen Signalbuch. 1969: [Grundwerk] [In Kraft: 1.4.1969. Reprint 2019 ed.]
9783111647609, 9783110009286](https://dokumen.pub/img/200x200/internationales-signalbuch-amtliche-liste-der-seeschiffe-der-bundesrepublik-deutschland-mit-unterscheidungssignalen-als-anhang-zum-internationalen-signalbuch-1969-grundwerk-in-kraft-141969-reprint-2019nbsped-9783111647609-9783110009286.jpg)