Wissenschaftstheorien in der Medizin: Ein Symposium 9783110888119, 9783110128499
172 110 13MB
German Pages 462 [464] Year 1992
Polecaj historie

Table of contents :
Theorienstrukturen in der Medizin - Ein Symposium
Theoriebegriffe in der Medizin
Das Reduktionismusproblem in der Medizin
Fortschritt in der Medizin
Theoriebegriffe in der Medizin
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin: Themen und Probleme
Zur Methodologie der praktischen Wissenschaften
Medizin als Idealexemplar einer allgemeinen Wissenschaftstheorie ein historisches Beispiel
Holismus versus Realismus? Wissenschaftsphilosophische Bemerkungen zum Verhältnis östlicher und westlicher Medizin
Das Reduktionismusproblem in der Medizin
Plädoyer für einen pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus
Das Ganze und seine Teile – Holismus, Emergenz, Erklärung und Reduktion
Chaos und Selbstorganisation als medizinische Paradigmen
Die Philosophie des "Handwerklichen" – Ein Beitrag zur Frage der Beschreibung und Handhabung komplexer Systeme
Das Reduktionismusproblem und seine Überwindung
Fortschritt mit der Wissenschaft: Wissenschaft ist Fortschritt Der Wandel der Fortschrittsidee in der deutschen Medizin im 19. Jahrhundert
Anmerkungen zur Analyse des Fortschrittsbegriffes in den experimentellen bio-medizinischen Wissenschaften – Eine Fallstudie aus der kardiovaskulären Physiologie
Therapeutische Erneuerung in der Medizin – Eine kritische Betrachtung des philosophischen Wissens–Anwendungs–Modells in der Medizin und eine Würdigung der medizinischen Praxis als Quelle neuen Wissens
Anhänge
Anhang I – Zwei beispielhafte Illustrationen zum Reduktionismusproblem in der Medizin
Anhang II – Planung und Strukturierung des Symposiums
Anhang III – Zu den Teilnehmern
Register
Personenregister
Sachregister
Citation preview
Wissenschaftstheorien in der Medizin
Wissenschaftstheorien in der Medizin Ein Symposium Herausgegeben von W. Deppert, H. Kliemt, B. Lohff, J. Schaefer Unter Mitwirkung bzw. mit Beiträgen von W. Deppert, W. Diederich, U. Freund, R. Hegselmann, P. Hucklenbroich, T. Kenner, H. Kliemt, R. K. Lie, Β. Lohff, Κ. Mainzer, Κ. Η. Pralle, R. Rosen, D. Schaefer, J. Schaefer, J. H. Solbakk, M. Stöckler, G. Vollmer, R. Vos
w DE
G
Walter de Gruyter Berlin · New York 1992
Dieses Buch enthält 29 Abbildungen
Die Deutsche Bibliothek — Wissenschaftstheorien in von W. Deppert ... Mit New York : de Gruyter, ISBN 3-11-012849-7 NE: Deppert, Wolfgang
CIP-Einheitsaufnahme der Medizin : ein Symposium / hrsg. Beitr. von W. Deppert ... — Berlin ; 1992 [Hrsg.]
© Copyright 1992 by Walter de Gruyter & Co., Berlin 30. Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag hat für die Wiedergabe aller in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen etc.) mit Autoren bzw. Herausgebern große Mühe darauf verwandt, diese Angaben genau entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abzudrucken. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und dergleichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, daß solche Namen ohne weiteres von jedermann benutzt werden dürfen. Vielmehr handelt es sich häufig um gesetzlich geschützte, eingetragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind. Druck: Gerike GmbH, Berlin. — Bindung: Dieter Mikolai, Berlin. Printed in Germany
Danksagung
Unser Dank gilt insbesondere dem Verlag Walter de Gruyter, daß er sich unter Federführung von Herrn Professor Dr. H. Wenzel und Herrn Priv. Doz. Dr. R. Radke, bereit fand, das mit der Veröffentlichung eines interdisziplinären Sammelbandes unvermeidlich einhergehende verlegerische Sonderwagnis auf sich zu nehmen. Da die Herstellung einer camera-ready Version eines Verhandlungsberichtes trotz moderner PC- und Lasersysteme eine Menge Arbeit bedeutet, sei an dieser Stelle auch all jenen gedankt, die durch ihren Einsatz und ihre Mühe sowie ihren Einfallsreichtum sowohl das Bad Orber Treffen ermöglicht als auch bei der äußeren Gestaltung der Beiträge mitgewirkt haben. Hierzu gehören Brigitte Schaefer, welche maßgeblichen Anteil an der Organisation des Treffens und seines Ablaufes hatte. - Frau Dr. med. Stella Muurling sei herzlich gedankt für die Übersetzung des Beitrages von Rein Vos. Stud. med. Tim Schaefer hat sich sehr dafür engagiert, die Zeichnungen und Graphiken in den verschiedenen Beiträgen computergerecht und optisch ansprechend zu gestalten. Frau Irmgard Prasch half bei der Transkription der auf Band aufgezeichneten Diskussionsbeiträge auf das PC-System. Kirsten Mensch danken wir für die umfassende Nacharbeitung und Vereinheitlichung der gesamten Vorlage. Unserer besonderer Dank gilt der Familie Raimund und Ulrich Freund, Inhabern der Rehabilitationskliniken Küppelsmühle, 6482 Bad Orb, und ihren Mitarbeitern, die durch ihre großzügige Gastfreundschaft und materielle Unterstützung dem Internationalen Institut für Theoretische Cardiologie Heimstatt bieten und zum wiederholten Male Treffen und Begegnungen von Wissenschaftlern und Wissenschaftsphilosophen ermöglicht haben. die Herausgeber
Vorbemerkung der Herausgeber Wolf gang Deppert, Hartmut Kliemt, Brigitte Lohff, Jochen Schaefer
Angesichts der modernen Wissenschaftsdynamik und -Spezialisierung bleibt Wissenschaftlern im allgemeinen gar nichts anderes übrig, als in eng umrissenen Spezialgebieten „nach vorne" zu forschen. Sie kümmern sich nicht oder kaum um das, was hinter und neben ihnen liegt oder geschieht. Die disziplinare Arbeitsteilung beschränkt sie perspektivisch auf das, was von der speziellen Aufgabenstellung ihres Forschungsgebietes her gefordert ist. Wie soll da noch Raum bleiben, um zurückzuschauen oder nach übergreifenden Zusammenhängen zu fragen? Wollen wir nicht orientierungslos werden, müssen wir den Versuch, übergreifende Zusammenhänge zu erkennen, dennoch unternehmen. Die Wissenschaftsphilosophie kann derartige Bestrebungen unterstützen und insoweit eine nützliche Dienstleistung für die Fachdisziplinen übernehmen. Das gilt unserer Meinung nach auch und insbesondere für die biomedizinischen Wissenschaften. Mediziner scheinen in besonderem Maße anfällig für die Illusion zu sein, sie stünden mit der jeweils neuesten Lehrmeinung auf dem Boden unerschütterlich gesicherten Wissens. Sie legen sich selten Rechenschaft ab über Herkunft, Art und Sicherheit ihrer fachspezifischen Kenntnisse. Reflexionen darüber findet man höchstens bei Außenseitern oder in den Memoiren alter Ärzte, die sich darüber wundern, wie sehr sich die von ihnen praktizierte Medizin im Laufe ihres Berufslebens verändert hat. Ein blindes Vertrauen, die Wissenschaft werde schon von selbst ihren geordneten Gang gehen, wird auf Dauer nicht ausreichen. Die Reflexion auf die Grundlagen des eigenen Tuns ist jederzeit angezeigt. Das Symposium diente dazu, in einem interdisziplinären Gespräch den Blick über die Grenzen des eigenen Faches zu öffnen und einen wissenschaftsphilosophischen Dialog in Gang zu setzen, damit Wissenschaftstheoretiker durch Einzelwissenschaftler und umgekehrt Einzelwissenschaftler durch
viii
Vorbemerkungen der Herausgeber
Wissenschaftstheoretiker Anregungen für ihre Arbeit erhalten. Wir haben bewußt die sonst übliche Form von wissenschaftlichen Tagungen, auf denen jeder der Teilnehmer sein vorbereitetes Manuskript verliest, vermieden. Denn die nach der Manuskriptpräsentation stattfindenden Diskussionen sind nach aller Erfahrung fast ausschließlich "Grabenkämpfe" zwischen "Angreifern" und "Verteidigern" der vorgetragenen Thesen und Argumente, so daß sie meistens mit einer verhärteten Position nach Hause fahren; wobei sie allenfalls gelernt haben, diese besser gegen Angriffe zu verteidigen. Bei unserer Tagung sollten derartige Verhaltensmuster vermieden werden. Deshalb war das Symposium ganz und gar der Diskussion gewidmet. Um den Inhalt der Gespräche durch konkrete Fälle medizinischer Forschung zu bestimmen, wurden Texte zur Herz- Kreislaufforschung ausgewählt, da Jochen Schaefer als Hauptveranstalter ein besonderes Interesse an diesem Bereich medizinischer Forschung hat. Hinzukamen wissenschaftsphilosophische Texte (s. Anhang II). Aus Sicht der Teilnehmer hat dieses Symposium seinen Zweck so gut erfüllt, daß sie sich am Schluß der Tagung bereit erklärt haben, die gewonnenen Anregungen und Einsichten in Beiträgen für den vorliegenden Band zu verarbeiten. Wir hoffen, daß die Ergebnisse dieses Nachdenkens ebenso wie die zunächst abgedruckten Symposiums-Diskussionen - an denen außer den verhinderten Herren Mainzer und Rosen alle Autoren von in diesem Band veröffentlichten Beiträgen teilnahmen - auch für ein größeres Publikum anregend sind. Angesichts der umfassenden Vorbereitung und Diskussion wurde auf einen „peer review" der erbetenen Beiträge verzichtet, um dem gedanklichen Gestaltungswillen der von uns angesprochenen Teilnehmer freien Lauf zu lassen. Es ist vorgesehen, aus diesem ersten Buch eine Reihe zu entwickeln, welche für den Diskurs zwischen Wissenschaftsphilosophie und Kardiologie als ein Forum dienen soll.
Inhalt
Theorienstrukturen in der Medizin - Ein Symposium Theoriebegriffe in der Medizin
1
Das Reduktionismusproblem in der Medizin
29
Fortschritt in der Medizin
47
Theoriebegriffe in der Medizin P. Hucklenbroich
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin: Themen und Probleme
65
H. Kliemt
Zur Methodologie der praktischen Wissenschaften J. H. Solbakk
Medizin als Idealexemplar ein historisches Beispiel einer allgemeinen Wissenschaftstheorie;
97 115
W. Diederich
Holismus versus Realismus? Wissenschaftsphilosophische Bemerkungen zum Verhältnis östlicher und westlicher Medizin 137
χ
Inhalt
Das Reduktionismusproblem in der Medizin M. Stöckler Plädoyer für einen pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus
157
G. Vollmer Das Ganze und seine Teile - Holismus, Emergenz, Erklärung und Reduktion
183
K. Mainzer Chaos und Selbstorganisation als medizinische Paradigmen
225
R. Rosen Die Philosophie des "Handwerklichen" - Ein Beitrag zur Frage der Beschreibung und Handhabung komplexer Systeme
259
W. Deppert Das Reduktionismusproblem und seine Überwindung
275
Fortschritt in der Medizin B. Lohff Fortschritt mit der Wissenschaft: Wissenschaft ist Fortschritt Der Wandel der Fortschrittsidee in der deutschen Medizin im 19. Jahrhundert
327
R. K. Lie Anmerkungen zur Analyse des Fortschrittsbegriffes in den experimentellen bio-medizinischen Wissenschaften - Eine Fallstudie aus der kardiovaskulären Physiologie
355
R. Vos Therapeutische Erneuerung in der Medizin - Eine kritische Betrachtung des philosophischen Wissens-Anwendungs-Modells in der Medizin und eine Würdigung der medizinischen Praxis als Quelle neuen Wissens
371
Inhalt
xi
Anhänge R. Κ. Lie und J. Schaefer Anhang I - Zwei beispielhafte Illustrationen zum Reduktionismusproblem in der Medizin
403
Anhang Π - Planung und Strukturierung des Symposiums
421
Anhang LH - Zu den Teilnehmern
425
Register Personenregister
431
Sachregister
435
Theorienstrukturen in der Medizin Ein
Symposium
Theoriebegriffe in der Medizin Hegselmann: Ich möchte eine Frage aufwerfen, die sich an diejenigen unter uns richtet, die mit eher härteren naturwissenschaftlichen Theorien, insbesondere der Physik vertraut sind. Betrachtet man Beispiele für medizinische Theorien, so wie sie von Medizintheoretikern angegeben werden, so fällt sogleich auf, daß in diesen Theorien genaue quantitative Angaben fehlen. Man trifft auf Charakterisierungen wie: Etwas nehme ab, etwas anderes nehme zu und dies möglicherweise in wechselseitiger Abhängigkeit. Tendenziell werden nur qualitative und komparative Feststellungen getroffen, während man auf die Angabe direkter funktionaler Beziehungen verzichtet. Dabei wird von den betreffenden Medizintheoretikern augenscheinlich unterstellt, dies sei typisch für die Medizin. Ich würde nun gern von denjenigen unter uns, die etwas von Physik verstehen, wissen, ob nicht so etwas im Bereich der sogenannten harten Wissenschaften in vielen Fällen ebenfalls üblich ist. Sollte dies nämlich so sein, so könnte man eine Abgrenzung zwischen Medizin und den sogenannten harten Naturwissenschaften nicht allein aufgrund der Tatsache vornehmen, daß derart "weiche" Hypothesen wie die zuvor skizzierten nur in der Medizin auftreten. Stöckler: Eine Antwort auf diese Frage fällt nicht leicht, weil sich die Wissenschaftstheorie der Physik im allgemeinen mit speziellen Problemen beschäftigt, die sich vor allem auf die grundlegenden Gleichungen beziehen. Aber ich nehme an, daß es in den angewandten Bereichen der Physik und insbesondere auch in der Experimentalphysik derartige "weniger quantifizierte" Theorien gibt. Ich würde mir allerdings selbst kein Urteil zutrauen, inwieweit der Bereich der Physik, der bereits wissenschaftstheoretisch erschlossen ist, typisch ist für den Rest der Physik.
2
Theoriestrukturen in der Medizin
Vollmer: Von der Prigogine-Schule wird heute die sogenannte BelousovZhabotinsky-Reaktion viel diskutiert. Grob gesprochen handelt es sich dabei um eine Flüssigkeit, von der man in Unkenntnis ihrer chemischen Zusammensetzung annehmen würde, sie sei homogen. Diese Flüssigkeit färbt sich laufend um. Beispielsweise wird sie zunächst rot, dann farblos, dann wieder rot, wieder farblos, und so weiter, was sich so lange fortsetzt, bis der verfügbare Energievorrat aufgebraucht ist. Man weiß inzwischen ganz genau, welche Substanzen in der Flüssigkeit sind - ich glaube, es sind sechs verschiedene. Man kann die Reaktionsgleichungen aufstellen und den Vorgang quantitativ genau beschreiben. Bevor man jedoch zu dieser quantitativen Beschreibung gelangt war, vermochte man diese Art einer "chemischen Uhr" allenfalls qualitativ zu erfassen. Man konnte nur sagen, daß ein Stoff den anderen, dieser den nächsten anregt usw., und daß daraus ein periodischer Vorgang entsteht. Ich nehme an, daß diese Beschränkung auf eine qualitative Beschreibung der Regelfall war für alle nichtlinearen Systeme. Eine Physik, die auch nichtlineare Verhältnisse beschreibt, gibt es noch gar nicht lange. Denn die über das rein Qualitative hinausgehende Behandlung nichtlinearer Systeme hat in der Physik erst in den letzten 10 bis 20 Jahren wirklich begonnen. Aber sie hat begonnen, und von daher bin ich durchaus optimistisch, daß es irgendwann auch vom Prinzip her dem Mediziner und insbesondere dem Physiologen möglich sein sollte, von qualitativen Charakterisierungen zu quantitativen Beschreibungen überzugehen. Insgesamt meine ich also, daß hier nicht zwischen Medizin und den "harten" Naturwissenschaften ein Unterschied besteht, sondern nur einer zwischen verschiedenen Stadien des Erkenntnis-Fortschritts, und daß es diese verschiedenen Stadien nicht nur in den "harten" Naturwissenschaften gibt, sondern eben auch in der Physiologie. Kliemt: Man kann sich in diesem Zusammenhang unmittelbar an bestimmte Fragen aus der sozialwissenschaftlichen Methodendiskussion erinnert fühlen. Insbesondere hat George Caspar Homans argumentiert, daß in bestimmten frühen Stadien der Theorieentwicklung sogenannte orientierende Feststellungen ausreichen können, den gesamten Gehalt einer Theorie wiederzugeben. Grob gesprochen orientiert eine solche Feststellung darüber, daß in Kontexten, in denen eine Variable A eine Rolle spielt, möglicherweise auch eine Variable Β wichtig sein kann. Über den funktio-
Theoriebegriffe in der Medizin
3
nalen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen wird jedoch nichts gesagt. Homans betont, daß wir gerade die Formulierung eines solchen funktionalen Zusammenhangs anstreben. Solange dies jedoch nicht in allgemeingültiger Form möglich ist, können die orientierenden Feststellungen sehr wohl eine Rolle spielen, indem sie uns helfen, konkrete spezifische Hypothesen zu formulieren. Sie helfen uns dabei, bestimmte nicht-allgemeine Theorien zu formulieren. Eine Brücke zu einem Mediziner, der fallweise jeweils eigene patientenbezogene Theorien bilden muß, ließe sich hier womöglich schlagen. Mit Bezug auf das, was Herr Vollmer gesagt hat, möchte ich allerdings hinzufügen, daß solche Arten von Theorien, die allein auf orientierenden Feststellungen beruhen, nur Durchgangsstadien auf dem Weg zu besseren Theorien sein können. Das scheint mir jedenfalls die These von Herrn Vollmer zu sein, der hier möglicherweise zwar den Theoriebegriff verwenden, zugleich aber darauf bestehen würde, daß man derart schwache qualitative Formulierungen nicht selbst noch zum theoretischen Ideal erheben dürfe. Das Ideal bleibt weiterhin die dahinterliegende quantifizierbare Theorie. Das methodologische Ideal ist für Sie doch die quantitativ formulierte Theorie? Vollmer: Ja, ich würde dies so sehen. Ob das Ideal erreichbar ist, ist eine andere Frage. Ob es sinnvoll ist, sich dauernd darum zu bemühen, ebenfalls. Aber grundsätzlich würde ich dem zustimmen. Diederich: In den "harten" Wissenschaften spielen durchaus nichtquantitative Methoden und Argumente eine prominente Rolle. Aussagen darüber, daß die Entropie in Systemen einer bestimmten Art tendenziell wachse, beruhen offenkundig auf qualitativer und komparativer Begriffsbildung. Im Gegensatz zu dem, was weite Bereiche der klassischen Wissenschaftstheorie annahmen, ist die quantitative Begriffsbildung in der Physik keineswegs völlig vorherrschend. Es geht darum, Exemplare aufzufinden, die Modelle bestimmter theoretisch beschreibbarer Strukturen sind. Die theoretischen Strukturen enthalten dabei keineswegs ausschließlich quantitativ formulierte mathematische Relationen. Die einschlägigen Aussagen sind nicht in dem etwas vordergründigen Sinne quantitativ, der in der älteren wissenschaftsphilosophischen Diskussion oft im Vordergrund stand. Häufig hat man es vielmehr mit Existenzaussagen zu tun, die behaupten, daß es Funktionen bzw. Relationen eines bestimmten Typs
4
Theoriestrukturen in der Medizin
gibt, die eine bestimmte Größe mit der Größe gewisser Randbedingungen verknüpfen. Ich glaube daher, daß wir die These vom Vorherrschen quantitativer Aussagen in der Physik relativieren müssen. Hucklenbroich: Ich möchte gerne einen Aspekt ins Spiel bringen, der sich auf ein bestimmtes Vorverständnis von Wissenschaft bezieht, das in Methodendiskussionen durchaus vorherrschend zu sein scheint. Man fragt nach Theorien und Theorienstrukturen, nicht jedoch danach, wie eine Theorienstruktur mit ihrem Gegenstand oder mit dem System, auf das sie sich bezieht, zusammenhängt. Wenn wir diesen Bezug mit einbeziehen, ändert sich unsere Perspektive. Wie stark man sich auch auf molekulargenetische Fragen spezialisieren mag, letztlich muß man in der Medizin immer im Auge behalten, daß sich die Theorien auf den Menschen anwenden lassen müssen. Die Systeme, die der Physiker typischerweise untersucht, sind häufig weit weniger komplex als der Mensch. Das gilt auch für das hier zuvor diskutierte Beispiel der Belousov-Zhabotinsky-Reaktion. Allerdings gibt es auch in der Chemie oder der Physik Systeme, die so komplex sind, daß sie ähnliche Theorie-Strukturen erzwingen, wie sie in der Medizin üblich sind. Ich bin zwar kein Physiker, aber soweit ich weiß, ist schon das Drei-Körper-Problem nicht exakt lösbar. Deppert: Ich möchte dies unterstützen. Der Objektbegriff in der Physik ist von einer Art, die es erlaubt, Objekte miteinander zu identifizieren bzw. als äquivalent zu betrachten. Als Physiker können wir etwa sagen, alle Objekte haben einen Gravitationsschwerpunkt. Unter dem Aspekt des "Schwerpunktes" können wir die Objekte miteinander identifizieren und können sie alle der gleichen Theorie unterwerfen. In der Medizin ist das aber nicht so. Wir haben keine Möglichkeit, die verschiedenen Untersuchungsobjekte miteinander zu identifizieren und wir müßten deswegen zu einer ganz andersartigen Theorie kommen, zu einer science of particulars. Wir brauchen eine Wissenschaft der Einzelobjekte! Das aber ist natürlich ein völlig neuer Gedanke. Kliemt: Die These von einer science of particulars ist von hohem Interesse. Ich möchte allerdings etwas pointiert fragen, ob man hier nicht möglicherweise Schindluder mit dem Wissenschaftsbegriff treibt, oder etwas
Theoriebegriffe in der Medizin
5
weniger überspitzt, ob man nicht den Wissenschaftsbegriff nur mehr in einer atypischen, sekundären Verwendung benutzt. Wissenschaft ist etwas, das wir grundsätzlich mit Allgemeinheit und Verallgemeinerungsfähigkeit verbinden, und es fragt sich, was uns noch bleibt, wenn wir der Wissenschaft diesen zentralen Aspekt nehmen. Um dies zu erläutern, empfiehlt es sich vielleicht, ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich zu betrachten. Wenn man Studenten an einer Universität in Betriebswirtschaftslehre unterrichten möchte, dann kann man sie keineswegs über die Einzelheiten jener Betriebe informieren, denen sie später angehören werden. Die spezifische oder partikuläre Theorie des Unternehmens Hoesch wird nicht zum Gegenstand des Universitätsunterrichts gemacht. Interessanterweise wird allerdings auch nicht ein Kanon allgemeiner sozialtheoretischer Gesetze gelehrt. Vorgestellt werden vielmehr beispielhafte Fallstudien und Denkmodelle, die typische Fälle der Praxis illustrieren sollen. Es wird angenommen, daß die Kenntnis einer derartigen Kasuistik den Studenten in die Lage versetzt, später in der Praxis selbst zu geeigneten partikulären Theorien bzw. Hypothesen zu gelangen, die ihm eine intelligente Orientierung in der komplexen sozialen Umwelt erlauben. Sieht man, wie hoch der Markt die Fähigkeiten der Absolventen betriebswirtschaftlicher Studiengänge bewertet, so scheinen diese an den Hochschulen durchaus Nützliches für die Praxis zu lernen. Fraglich ist allerdings, ob wir es tatsächlich mit einem Vorgang zu tun haben, der mit dem vergleichbar ist, was wir normalerweise unter der Lehre einer wissenschaftlichen Theorie verstehen. Hat man es nicht eher mit einer Einübung in — im weiteren Sinne wissenschaftliche — Praktiken zu tun? Daß völlig Analoges in der Medizin eine große Rolle spielt, liegt auf der Hand. Neben sogenanntem expliziten Lehrbuchwissen verfügen wir über sogenanntes implizites Wissen im Sinne Michael Polanyis, welches sich nicht - jedenfalls nicht vollständig - in explizites umformen läßt. Die Frage ist dann, welche Bedeutung derartiges implizites Wissen für die sogenannten harten Wissenschaften besitzt und ob sich unter Bezugnahme auf das Konzept des impliziten Wissens die Idee einer Wissenschaft von spezifischen Einzelsystemen retten läßt. Stöckler: In der Wissenschaftstheorie scheint häufig die Auffassung vorzuherrschen, daß spezielle wissenschaftliche Aussagen aus allgemeinen deduktiv folgen, so wie spezielle Theoreme einer axiomatisierten mathe-
6
Theoriestrukturen in der Medizin
matischen Theorie aus deren Axiomen. Dies ist selbst mit Bezug auf die Physik verfehlt. Denkt man etwa an die Grundgleichung der klassischen Mechanik, wonach sich Kraft als Produkt aus Masse und Beschleunigung bestimmt, so folgt aus dieser für den Mond zunächst nichts. Zunächst einmal wird man mit F = m· a konfrontiert, und alles andere muß sich finden. Mit Bezug auf die Masse des Mondes lassen sich die betreffenden spezifischen Probleme noch relativ einfach lösen. Denkt man jedoch an das Problem, einen felderfüllten Hohlraum zu beschreiben, welches am Anfang der Quantenmechanik steht, so ist die Sachlage nicht mehr so einfach. Man kannte bereits die Grundgleichungen der klassischen Mechanik, stand jedoch vor dem Problem, einen Mechanismus für die Vorgänge im Hohlraum zu unterstellen. Von welchen Objekten mußte man ausgehen? Hier nutzten die fundamentalen Theorien der Physik wiederum nichts. Es ging vielmehr darum herauszufinden, wie sich diese Theorien erst einmal anwendbar machen ließen. Welche Deutungen sollte man den Variablen geben und wie sie mit Meßgrößen in Zusammenhang bringen? Es entstand ein langer Streit darüber, was in einem Hohlraum überhaupt vor sich geht, ob man den Raum mit elektrischen Eigenschaften versehen oder alles auf die Wände beziehen sollte etc. Der Streit ging letztlich darum, wie so etwas wie ein Hohlraum überhaupt in eine allgemeine "große" Theorie einzubeziehen ist. Hier lag gerade kein einfaches Deduktionsverhältnis vor. Man konnte den Streit nicht dadurch entscheiden, daß man einfach die richtigen Axiome und allgemeinen Sätze hernahm und logisch deduzierte, wie man einen Hohlraum angemessen zu behandeln hatte. Ganz allgemein kann man wohl sagen, daß bei jeder Anwendung einer physikalischen Theorie fortlaufend neue Annahmen hinzukommen. Hier handelt es sich - und das gilt bereits in der Quanten-Mechanik - um Theorieerweiterungen, die nicht in den Axiomen stehen. Das Vorgehen ist in einen weiteren Zusammenhang eingebettet, aus dem weitere Annahmen hinzutreten. Klassische Elektrodynamik plus soundsoviele Annahmen über die Erde und was ein Hohlraum ist etc. Diese Notwendigkeit der echten Theorieerweiterungen deutet auf eine Möglichkeit hin, das Konzept einer Wissenschaft vom Partikulären zu verstehen. Für die wissenschaftliche Anwendung muß man wissen, wie das System, über das man redet, gebaut ist und wie man es überhaupt in eine allgemeine Theorie einfügen kann. Falls die hier auftretenden Probleme zu speziell werden, so wird man dazu tendieren, den gesamten Fragenbereich aus der Physik auszugliedern. Es gibt keine Physik des Maikäfers. Aber das prinzipielle
Theoriebegriffe in der Medizin
7
Problem, um das es hier geht, ist bereits im Rahmen der Theorie des Hohlraumes erkennbar: Wie kann man spezielle Systeme in der allgemeinen Theorie beschreiben, wie kann man die Variablen interpretieren etc. Die Physik beschränkt sich charakteristischerweise auf Probleme, in denen diese Anwendungsfragen, Spezifikationsprobleme und Theorieerweiterungen relativ einfach sind, d. h. letztlich auf einfache Systeme. Sobald die Systeme sehr komplex werden, verlagert sich das Hauptgewicht der Forschung von der allgemeinen Theorie darauf, welcher Mechanismus es überhaupt möglich macht, die allgemeine Theorie anzuwenden. Mit Bezug auf die Medizin könnte man dies etwa dadurch erläutern, daß das Hauptproblem der Untersuchung der "Nervenleitung" darin besteht, die elektrischen Reaktionen zu benennen, die für dieses spezifische Phänomen relevant zu sein scheinen. Wie diese Reaktionen dann ablaufen, das weiß man bereits aus der allgemeinen Theorie, welche die Physiker liefern. Diese allgemeinen Zusammenhänge muß der Biologie oder Mediziner nicht mehr erforschen. Mit anderen Worten besteht das Hauptproblem von Biologen oder Medizinern darin, Elektrizität mit Nervenleitungen so in Verbindung zu bringen, daß die geordnete Anwendung der allgemeinen Theorie möglich wird. Das Hauptgewicht verschiebt sich zu der Frage der Anwendbarkeit und Theorieerweiterung. Dies sind meine Assoziationen zum Konzept einer Theorie des Partikulären. Hucklenbroich: Jede Wissenschaft, sei es Physik oder Medizin, muß sich in irgendeiner Form von den Universalbegriffen bzw. universalisierten Strukturen auf einzelne Dinge oder partikuläre Systeme beziehen. Der entscheidende Unterschied zwischen beispielsweise Medizin und Physik liegt nicht darin, daß der eine Bereich nur auf das Partikuläre zielt und keine Universalbegriffe verwendet, während der andere nur allgemeine Strukturen unter Verwendung von Universalbegriffen untersucht, sondern es geht darum, daß die Gegenstände, auf die Bezug genommen wird, von unterschiedlicher Komplexität sind. Ein Maikäfer ist in der Tat sehr viel komplexer als eine Billardkugel. Billardkugeln sind im allgemeinen viel homogener. Die Physik befaßt sich typischerweise mit derartig homogenen Systemen. Wenn man demgegenüber auf die größere Komplexität der Gegenstände der Medizin verweist, so darf man das nicht dahingehend fehldeuten, daß die Medizin deshalb eine ganz anders geartete Wissenschaft von den partikulären Dingen sein müßte. Es gibt den Unterschied in
8
Theoriestrukturen in der Medizin
der Komplexität der behandelten Gegenstände, nicht jedoch eine fundamental verschiedene Wissenschaft vom Partikulären. Die letztere Annahme würde meines Erachtens auf einen einfachen logischen Fehler zurückgehen. Vollmer: Bei uns in Deutschland ist die Lehre in den medizinischen Fächern stark an der Forschung orientiert. Allgemeine theoretische Forschungsergebnisse werden vermittelt, seien diese nun quantitativ-metrisch oder auch anders formuliert. In der Praxis soll man dann das, was man in den zu Lehrzwecken getrennten Fächern Physiologie, Zytologie, Histologie usw. gelernt hat, auf Individuen anwenden. In Amerika ist man an mindestens zwei Universitäten - ich glaube, dazu zählt auch Stanford - dazu übergegangen, das Curriculum des Medizinstudenten völlig umzustellen. Die Studenten werden vom ersten Semester an mit Patienten konfrontiert. Man beginnt mit Simulanten, die einfach sagen, was ihnen angeblich wehtut oder was sie am Vortag geträumt haben, um dann zu echten Fällen überzugehen. Durch diese Ausbildung, die sich von vornherein am Patienten vollzieht, wird die Lehre stärker an der zukünftigen Praxis orientiert und nicht an der Theorie oder an der Forschung. Die medizinische Forschung kann zwar weiterhin den Idealen allgemeiner Forschung nacheifern; aber die Lehre, die den Arzt oder die Ärztin ausbilden soll, muß der Tatsache Rechnung tragen, daß es sich in der Behandlungspraxis immer um Individuen handelt und daß die Kunst, allgemeine Sätze auf den Einzelfall anzuwenden, viel mehr geübt werden muß, als es die herkömmliche Ausbildungspraxis zuläßt.1 Deppert: Was die Frage einer science of particulars anbelangt, so läßt sich der Brückenschlag zwischen Medizin und Physik möglicherweise sehr leicht herstellen. Wenn man annimmt, daß eine Theorie zunächst einmal - grob gesprochen - aus einem Objektbereich und Gesetzen, die das Verhalten der Objekte beschreiben, besteht, dann fragt sich, welches denn der Objektbereich ist, mit dem der Physiker umgeht. Mir scheint es nun so zu sein, daß wir Physiker dann, wenn wir von Elementarteilchen oder Masseteilchen etc. sprechen, letztlich nur über Teilobjekte eines größeren einheitlichen Objektes sprechen. Das Objekt, das der Physiker beschreiben will, ist im Grunde die physikalische Welt als ein Ganzes. Dies scheint mir gerade in der Einsteinschen Forderung zum Ausdruck zu kommen, wo-
Theoriebegriffe in der Medizin
9
nach Gesetze so zu formulieren sind, daß sie von jedem Bezugsystem aus in gleicher Weise Geltung besitzen. Die Rechtfertigung dieses Kovarianzprinzips kann sich nur daraus ergeben, daß man unterstellt, es gebe die eine physikalische Welt als ein Ganzes. Wenn die Physiker letztlich versuchen, jene Gesetzmäßigkeiten herauszufinden, die die physikalische Welt als Gesamtheit beschreiben, dann zeigt sich meines Erachtens mit einem Mal, daß der Gedanke einer science of particulars überhaupt nicht im Widerspruch oder im Widerstreit zur Physik steht; denn so, wie sich die physikalische Welt als ein Einzelnes betrachten läßt, so kann man einen einzelnen Organismus als eine eigene Welt mit eigenen Gesetzen verstehen. Diederich: Ich möchte vorschlagen, grundsätzlich zwei Deutungen des Begriffes "partikulär" in der Rede von einer Wissenschaft vom Partikulären zu unterscheiden: Zum einen kann "partikulär" bedeuten, daß man an eine exemplarische Problemlösung denkt, die eine spezielle normalwissenschaftliche Forschungstradition zu begründen vermag. Diese spezifische Lösung ist aufgrund ihres paradigmatischen Charakters durchaus etwas Individuelles, ohne jedoch deshalb nur ein bestimmtes Individuum zu betreffen. Es handelt sich etwa um die Lösung des Drei-KörperProblems oder eine Lösung des Problems der Pendelschwingungen, ohne dabei Bezug zu nehmen auf bestimmte Körper bzw. ein bestimmtes Pendel. Daneben gibt es noch einen anderen Sinn des Partikulären in der Wissenschaft, der nun wirklich einen direkten Bezug auf Individuen herstellt. Hier stellen sich neue und zusätzliche Probleme, die philosophischtraditionell gesprochen mit dem, was Kant "Urteilskraft" genannt hatte, zusammenhängen. Spezifische Einzelindividuen müssen in einen bestimmten Gesetzes- oder Vorstellungszusammenhang eingeordnet werden. In diesem Zusammenhang frage ich mich, ob eigentlich in der Medizin irgend etwas besonderes vor sich geht, das man in den anderen Wissenschaften, insbesondere in der Physik, nicht zu beobachten vermag. Vos: In der Medizin wird natürlich subsumiert und in Kategorien eingeordnet. Man hat eine Kategorie und sucht den partikulären Fall in diese aufzunehmen. In der Medizin will man auf den partikulären Fall allerdings stets unter einem praktischen Erkenntnisinteresse hinaus. Hierin steht die Medizin sicherlich der Technik näher als etwa der Physik.
10
Theoriestrukturen in der Medizin
Lohff: Mir scheint, daß die Medizin stets ein allgemeines Modell des Organismus als Leitlinie verwendet, wenn sie sich der Untersuchung einzelner Prozesse zuwendet. Das Ideal der wissenschaftlichen Praxis der Medizin ist nicht der individuelle Fall oder der einzelne Organismus, sondern ein Verständnis des Einzelorganismus in seinem Verhältnis oder im Vergleich zum allgemeinen Modell des Organismus. Der Arzt lernt den individuellen Organismus oder das Individuum immer nur durch eine schwierige Überwindung als Individuum kennen. Dies geschieht immer nur auf der Folie seines theoretischen Wissens, und mir ist ziemlich unklar, wie wir zu einer partikulären Theorie kommen sollen, die auf ein Vergleichsmodell von der Form eines "abstrakten Organismus", in dem allgemeine Gesetze gelten, verzichtet Kenner: Ich möchte versuchen, mich als Mediziner ganz naiv auszudrükken. Die Mediziner - genauer die Physiologen - wollen gern ähnliche Gesetze aufstellen, wie die Physiker. Sie orientieren sich an so einfachen Beispielen wie 'Kraft gleich Masse mal Beschleunigung', doch liegen die Dinge in der Medizin in der Regel weit komplizierter. Dessen ungeachtet charakterisiert man die Patienten einfach nach allgemeinen Daten, die meßbare Faktoren in einem allgemeinen Erklärungsschema bilden. Dabei vergißt man - und das ist meiner Meinung nach das wesentliche am Partikulären -, daß der Patient eine ganze Lebensgeschichte hat. Würde man nachprüfen, was bei uns heute an den Kliniken an Krankengeschichten geschrieben wird, so würde man vermutlich einen wahren Skandal zutage fördern. Dieser "skandalöse Zustand" der Praxis ist teilweise von der Medizintheorie mit induziert. Von dieser Theorie her kann man nur schwer verstehen, daß zwei Menschen, die gleich alt sind - vielleicht Zwillinge -, aber eine unterschiedliche Geschichte haben, ganz verschiedene Verhaltensweisen und insbesondere auch ganz unterschiedliche Krankheiten aufweisen können. Die konkrete Geschichte eines konkreten Systems zu berücksichtigen, verlangt nach Vorgehensweisen, die in der Praxis vom verallgemeinernden Vorgehen theoretisch orientierter Disziplinen stark abweichen. Es ist vor allem dies, welches der wissenschaftlichen Praxis der Medizin ihren spezifischen, auf das Partikuläre hin orientierten Charakter verleiht. Die häufig anzutreffende Rede vom "Blick des Arztes" und ähnliche Effekte, die regelmäßig mit überlegenen Fähigkeiten zur Gestalterkennung in Verbindung gebracht werden, würde ich demgegen-
Theoriebegriffe in der Medizin
11
über eher unter die Skurrilitäten rechnen. Es handelt sich dabei um Beispiele, die im wesentlichen jenem des bereits im Krankenzimmer an seinem Geruch erkennbaren Diabetikers gleichen, mögen sie auch in Einzelheiten komplexer gelagert sein. Vollmer: Herr Hegselmann hatte uns ja durch die Anfangsfrage herausgefordert zu sagen, ob und worin denn ein fundamentaler Unterschied zwischen der Medizin und anderen, "härteren" Naturwissenschaften besteht. Es wurde in der Diskussion mehrfach betont, daß es das, was es in der Medizin gibt, auch in den anderen Naturwissenschaften gibt, und umgekehrt. Offenbar ist es nicht so, daß die Medizin nur mit Partikulärem zu tun hätte und die Naturwissenschaften sich nur mit allgemeinen Gesetzmäßigkeiten beschäftigten. Herr Deppert hat nachdrücklich darauf hingewiesen, daß man die Physik sogar so interpretieren kann, als befasse sie sich mit einem einzigen Objekt, dem Kosmos als Ganzem. Gegenüber diesen Gemeinsamkeiten müssen wir jedoch auch die großen Unterschiede zur Kenntnis nehmen, die wir herausgearbeitet haben. Ich denke, es ist nützlich, sich nochmals auf diese Unterschiede zu besinnen, und möchte im Anschluß an ein Buch von Martin Harwit mit dem Titel "Die Entdeckung des Kosmos", Piper, München, 1983, versuchen, einige etwas weniger fundanmentale Gründe für derartige Unterschiede zu nennen. Harwit versucht herauszufinden, wieviele Klassen astronomischer Objekte wir kennen. Die Neutronensterne etwa bilden eine derartige Klasse, die Weißen Zwerge, die Hauptreihensterne, die Schwarzen Löcher, die Sternhaufen, die Kugelhaufen, die Galaxien usw. Insgesamt kommt er dabei auf etwa 40 derartige Klassen und fragt, wieviele wohl noch zu entdecken sein mögen. Das ist sehr kühn, doch sicherlich legitim. Harwit rechnet mit insgesamt 130 derartigen Klassen. Wir hätten also bisher etwa ein Drittel der Klassen astronomischer Objekte entdeckt. Gehen wir einmal, ohne uns auch gleich für die Zukunft festzulegen, davon aus, daß diese Schätzung zutrifft. Es erhebt sich dann die Frage, wieviele Klassen von Objekten der Physiker und die Physikerin insgesamt kennen. Ich würde sagen, diese Zahl liegt vielleicht bei 200, vielleicht auch bei 500, höchstens jedoch bei 1000. Das heißt, ein Physiker, ein Student, der sich über alle diese Klassen informieren will, müßte etwa 500 repräsentative Beispiele kennenlernen und wissen, wie man diese behandelt. Die Kenntnis von 500 partikulären Klassen reicht also aus, um die
12
Theoriestrukturen in der Medizin
Physik zu überblicken. Fragt man nun den Biologen, wieviele Klassen grundsätzlich verschiedener Objekte den Gegenstandsbereich der Biologie ausmachen, dann kommt man bei Beschränkung auf die jetzt lebenden Arten auf ungefähr 2 bis 3 Millionen. Nimmt man auch noch die ausgestorbenen Arten hinzu, dann wächst die Anzahl grundsätzlich verschiedener Objekte nach einer Schätzung von Ernst Mayr noch einmal um den Faktor 100. Fragt man schließlich nach der Situation in der Humanmedizin, so gibt es zwar hier nur eine biologische Klasse, nämlich die der Menschen, aber gerade in der Humanmedizin spielen ja die Verschiedenheiten zwischen den Angehörigen dieser Klasse eine so große Rolle. Diese Klasse umfaßt zur Zeit immerhin fünf Milliarden. Zwar kommen nicht alle in die gleiche Praxis - was ja wohl auch ganz gut ist -; auf der anderen Seite ist aber der Patient, den der Arzt als Neugeborenen kennenlernt, ein ganz anderer, als der, den er als Einjährigen, Sechsjährigen, Zwanzigjährigen oder Siebzigjährigen behandeln soll. Die Individuen in ihren verschiedenen Lebensphasen konstituieren jeweils neue "Objekte". Zwar handelt es sich immer nur um ein einziges Individuum, aber für den Arzt doch immer wieder um einen neuen Fall. Zwischen zwei verschiedenen Zeitpunkten hat der betreffende Patient Unterschiedliches erlebt; er hat vielleicht geheiratet, ist geschieden worden oder hat einen Selbstmordversuch unternommen. Wenn ich zusammenfassen darf - und auf eine Größenordnung soll es uns dabei nicht ankommen -, so bewegen wir uns in der Physik in der Größenordnung von Tausend, in der Biologie von einer Million und in der Humanmedizin von einer Milliarde. Die Konsequenz daraus ist nicht nur, daß man etwa als Physiker noch die "ganze" Physik beherrschen kann, als Biologe aber nicht mehr die ganze Biologie. Es geht gar nicht nur um diese gleichsam quantitativen Unterschiede, vielmehr handelt es sich hier um qualitative Sprünge. Die Schwierigkeiten, über die wir hier sprechen, lassen sich an diesen Unterschieden festmachen: Es ist unmöglich, alle möglichen Phänomene, die einem in der Praxis begegnen können, schon in der Universitätslehre oder im Studium kennenzulernen. Es stellt sich deshalb die Frage, welche Art von Lehre und welche Art von Praxis dieser spezifischen Problemlage der Medizin gerecht werden kann. Solbakk: Sie, Herr Vollmer, haben gesagt, die "Medizin und andere Naturwissenschaften"; heißt das, daß sie Medizin als eine Naturwissen-
Theoriebegriffe in der Medizin
13
schaft betrachten oder verstehen? Das führt mich zu der Frage, ob die Theoriebegriffe aus der allgemeinen Wissenschaftstheorie anwendbar sind auf die medizinischen Theorien? Daraus ergibt sich für mich eine weitere Folgefrage danach, wie allgemein Theoriebegriffe der allgemeinen Wissenschaftstheorie sind. Vollmer: Die Formulierung "Medizin und die anderen Naturwissenschaften" möchte ich eigentlich gerade vermeiden, habe ich wohl auch nicht benutzt. Herr Hegselmann fragte ja, ob für die harten Naturwissenschaften Ähnliches gilt wie für die Medizin. Ich persönlich sehe Medizin nicht als eine weitere Naturwissenschaft, sondern als etwas Besonderes. Zur Medizin gehört eben mehr als das theoretische Wissen. Wegen der spezifischen Unterschiede zwischen Physik und Biologie und erst recht zwischen Naturwissenschaften und Medizin müssen die Wissenschaftstheorien dieser Disziplinen verschiedene Schwerpunkte setzen. Mit meinen Überlegungen hatte ich gerade nach dem Grund gesucht, warum derart typische Unterschiede bestehen. Kliemt: Dazu habe ich eine weitere direkte Frage. Ich meine, Ihr Verweis auf die Größenordnungen 10 hoch 3, 10 hoch 6, 10 hoch 9 ist zwar sehr suggestiv, legt aber möglicherweise vorschnelle Folgerungen nahe. Es stimmt zwar, daß sich die Medizin mit Einzelobjekten in der Größenordnung von 10 hoch 9 beschäftigen muß, aber die eigentliche Frage ist doch die, ob wir nicht innerhalb dieser Klasse theoretischer Gegenstände Unterklassen bilden können. Ist es nicht möglich, daß die Medizin Theorien von mittlerem Allgemeinheitsgrad, wie etwa die allgemeine Lösung von Problemen der Pendelbewegung, aufstellt? Ist dies nicht das eigentliche Ziel der theoretischen Medizin oder Medizintheorie, und könnte dies nicht zu einer entscheidenden Reduktion der Größenordnungen führen? Vollmer: Wir sind darüber einig, daß alle Pendelphänomene zusammen eine der Klassen für den Physiker bilden. Nun betonen Sie zu Recht, daß es auch die Möglichkeit gibt, Klassen von Patienten zu bilden. Aber da liegt eben das Problem. Da man mit 10 hoch 9 niemals einig werden kann, muß man Klassen bilden. Die Frage ist, inwieweit diese Klassenbildung eine Vergröberung bedeutet. Kann man alle Diabetiker, die natürlich in der
14
Theoriestrukturen in der Medizin
Hinsicht gleich sind und eine Klasse bilden, daß sie Diabetiker sind, sämtlich gleich behandeln? Da uns diese Gleichbehandlung nicht als angemessen erscheint, müssen wir sehen, inwieweit die unvermeidliche Klassenbildung in unschädlicher Weise vorgenommen werden kann. Kliemt: Damit stellt sich aber meines Erachtens das Fundamentalproblem, ein Ideal für die Medizintheorie zu formulieren. Kann es überhaupt ein sinnvolles Ideal sein, Theorien in der Größenordnung von 10 hoch 9 zu bilden? Da dies sicherlich nicht der Fall ist, meine ich, daß unserem Anliegen, eine angemessene Medizintheorie zu formulieren, tatsächlich Genüge getan ist, wenn wir für bestimmte Klassen "anständige Theorien" bilden. Wenn in dieser Weise dem theoretischen Anliegen Genüge getan ist, stellt sich als ein weiteres Problem, wie ein einzelner Patient, der nicht richtig in eine Klasse hineinfällt, zu behandeln ist. Dieser Patient müßte gleichsam "contra legem" behandelt werden - abweichend von der theoretisch formulierten Regel der ärztlichen Kunst. Die damit aufgeworfenen Fragen scheinen mir aber vor allem Fragen der Anwendung der Medizintheorie zu sein. Sie betreffen weniger die Methodologie der Theoriebildung als die der Anwendung von Theorien in der Praxis. Aus dieser Sicht der Dinge ist es keine ideale Zielsetzung der Medizintheorie, Einzelfalltheorien zu bilden, sondern die allgemeine "Klassentheorie" ist alles, was wir tatsächlich verlangen können. Hucklenbroich: Herr Hegselmann hat ursprünglich gefragt, ob sich mit Bezug auf die Medizin irgendwelche Bedingungen angeben lassen, die eine grundsätzliche oder prinzipielle Grenze für die Erkennbarkeit, Beschreibbarkeit oder Theoretisierbarkeit ergeben. Hier verstehe ich das von Herrn Vollmer vorgebrachte Argument als einen Hinweis auf wachsende Komplexität der betrachteten Systeme. Ich möchte diesen Hinweis als das Komplexitätsargument bezeichnen. Obschon ich diesem Komplexitätsargument im Grundsatz zustimme, frage ich mich, ob es tatsächlich auf eine prinzipielle Schranke verweist. Man könnte ja daran denken, daß sich in der Zukunft mit sehr komplexen Computern diese komplexen Systeme simulieren lassen. Im Gedankenexperiment könnte man sich etwa im Extrem vorstellen, daß ein Arzt soviel über den menschlichen Organismus im allgemeinen und über die Randbedingungen eines spezifischen Patienten weiß, daß er praktisch alles über ihn weiß. Dieser Arzt würde
Theoriebegriffe in der Medizin
15
gegenüber dem Patienten eine gleichsam gottähnliche beherrschende Stellung einnehmen. Aus Komplexitätsgründen erscheint uns dieses Gedankenexperiment als extrem; doch es scheint, daß man in ihm keine prinzipielle Schranke überwinden muß. Demgegenüber würde ich betonen, daß die Interaktion zwischen Arzt und Patient eine andere Grundstruktur aufweist. Der Arzt steht dem Patienten nicht als externer Beobachter gegenüber, der gleichsam von außen in das vom Patienten gebildete "System" eingreifen könnte. Diese Modellvorstellung übersieht, daß der Arzt den Patienten nicht in einer derartigen Weise beherrschen kann, sondern mit ihm in einer Wechselwirkung steht. Das System, das wir hier betrachten müssen, ist das "Arzt-Patient-System" als ganzes. Nehmen wir diesen interaktiven Standpunkt ein, so wird das Problem der Selbstreferenz sichtbar. Der Arzt muß die Wirkungen seiner eigenen Handlungen auf den Patienten reflexiv mit einbeziehen. Dadurch scheint mir ein prinzipieller Regreß zu entstehen, wie er in selbstreferentiellen Strukturen typischerweise auftreten kann. Man könnte hier an Analogien etwa zum GödelArgument in der Logik oder zum Heisenberg-Argument in der Meßtheorie denken. Hier scheint tatsächlich eine prinzipielle Schranke sichtbar zu werden. Wenn man nämlich Patient und Arzt zusammennimmt als ein System, dann kann man sagen, daß der Prozeß, der zwischen den beiden erkenntnis- wie handlungsmäßig abläuft, den Selbstreferenzpunkt oder auch den Selbsterkenntnispunkt des Gesamtsystems bestimmt. Hier ergeben sich prinzipielle Erkenntnisgrenzen. Lohff: Ich möchte in Erinnerung bringen, daß wir das Problem anschneiden sollten, was eigentlich eine "anständige" Theorie innerhalb der Medizin ist oder sein könnte. Es wird immer als selbstverständlich vorausgesetzt, daß man wisse, was denn das Ideal der Forschung sei. Also, Herr Kliemt, was ist eine anständige medizinische Theorie? Kliemt: Fragen Sie mich nicht. Ich bin Laie, möchte allerdings betonen, daß diese Frage tatsächlich zum Kern unserer augenblicklichen Diskussion zu gehören scheint. Wenn wir über Theoriebegriffe in der Medizin sprechen, so sollten wir uns darüber verständigen, was wir als Ideal einer medizinischen Theorie ansehen wollen. Zwar muß eine anständige Theorie möglicherweise nicht auch eine ideale sein. Es sollte jedoch sichtbar sein, in welche Richtung wir bei der Entwicklung anständigerer) Theorien fort-
16
Theoriestrukturen in der Medizin
schreiten möchten. An der Beantwortung dieser Frage entscheidet sich auch, ob nicht vielleicht die Medizin eine ganz normale Wissenschaft sein könnte. Trennen wir einmal die beiden Punkte kluge Theoriebildung und kluge Praxis und entscheiden wir uns für den Augenblick, das Problem der klugen Praxis und der Subsumption spezieller Einzelfälle unter allgemeine Theorien außer Betracht zu lassen. Dann möchte ich fragen, ob mir jemand widersprechen würde, wenn ich feststelle, daß es ein Ideal der medizinischen Theoriebildung darstellt, Lösungen für Problemklassen anzugeben, genauso, wie es etwa die Theorie der Pendelbewegungen tut. Nach einer in diesem Sinne allgemeinen Theorie würde dann eine ganze Klasse von Phänomenen, eine ganze Klasse von Patienten behandelt. Die Theorie der Diabetes-Behandlung etwa würde es als anständige Theorie erlauben, mit der Klasse der Diabetiker so umzugehen, wie es uns die Theorie der Pendelbewegungen ermöglicht, alle spezifischen Pendelphänomene unter Anleitung eines allgemeinen theoretischen Konzeptes zu behandeln. Erhebt sich also Widerspruch, wenn jemand sagen würde, die Medizintheorie strebt an, anständige Theorien in diesem Sinne zu bilden? Wenn sich hiergegen kein Widerspruch erhebt, dann gehen wir alle davon aus, daß es in der Medizin Theorien gibt und geben sollte, die in Übereinstimmung mit dem übrigen wissenschaftlichen Vorgehen stehen. Vos: Ich glaube, daß es solche Theorien gibt. Von der Erkenntnisstruktur her gibt es möglicherweise keinen Unterschied zur physikalischen Theorie. Ich glaube aber auch, daß wir in der Regel mit weit weniger zufriedenstellenden Theorien umgehen müssen. Das gilt meines Erachtens selbst für naturwissenschaftliche Theorien. Wenn man z.B. an die Meteorologie denkt, so zeigt sich, daß unsere Möglichkeiten, Änderungen des Wetters zu erklären bzw. etwa Unwetter vorauszusagen, doch sehr beschränkt sind. Eine ähnliche Unzufriedenheit wie mit den Theorien der Meteorologie stellt sich im Falle der Medizin ebenfalls ein. Die Lösungsmöglichkeiten, die von diesen Theorien aus für die Praxis angegeben werden können, erscheinen uns als unzureichend. Unter diesem Aspekt kann man, glaube ich, nicht von der Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis absehen.
Theoriebegriffe in der Medizin
17
Kliemt: Aber kann man sich nicht wenigstens darauf verständigen, daß jedenfalls eine Theorie wie die der Pendelbewegungen eine anständige Theorie ist? Vos: Ja, das ist eine anständige Theorie. Dennoch glaube ich, daß wir in der Medizin häufig Situationen antreffen, in denen wir zwar über "anständige Theorien" zu verfügen scheinen, zugleich jedoch unzufrieden sind mit den Handlungsmöglichkeiten, die uns diese Theorien bieten. Sie reichen einfach nicht aus für unsere praktischen Bedürfnisse und führen deshalb nicht zu einer zufriedenstellenden Verknüpfung von Theorie und Praxis. Stöckler: Eine anständige Theorie ist eine Theorie, die bestimmte Ziele erreicht. Das Ziel der Theoriebildung ist u.a. die Vereinheitlichung unseres Wissens. Theoriebildung beginnt erst dann, wenn man nicht einfach tausend Einzelerfahrungen in ein großes Buch schreibt, sondern beginnt, diese zu vereinheitlichen. Hierzu gibt es verschiedene Methoden. Eine Methode besteht darin, komplexe Gegenstände zu zerlegen und das Verhalten der Einzelteile zu betrachten. Durch Anwendung dieser Methode hat sich beispielsweise in der Physik herausgestellt, daß man, wenn man etwa über Atome redet, mit ganz wenigen Exemplaren auskommt. Im Idealfall bedarf es nur einer Sorte von Feld. Wenn es mehr als zwanzig Elementarteilchen gibt, werden die Physiker unruhig und beginnen nach noch elementareren Teilchen zu suchen. Die Elementarteilchen kann man wiederum in Klassen einteilen, die ganz homogen sind. Elektronen unterscheiden sich nicht mehr voneinander. Sie haben beispielsweise keine unterschiedliche Geschichte, sondern ausschließlich einen unterschiedlichen Bewegungszustand, sind im übrigen aber gleich. Für solche Elemente gibt es saubere quantitative Gesetze. Eine anständige Theorie liegt vor, wenn man diese Gesetze aufschreibt. Auf fundamentaler Ebene gibt es also anständige Theorien. Betrachtet man nun komplexe Dinge, so kann man zunächst - und ich würde mich dem anschließen - feststellen, daß diese sich aus den elementaren Gegenständen zusammensetzen und in ihrem Verhalten im Prinzip aus dem Verhalten der elementaren Gegenstände erklärt werden können. Daraus folgt jedoch überhaupt nicht, daß es für Maikäfer die gleiche Sorte von Gesetzen gibt wie für Elektronen. Hier zeigen sich gewisse Vorteile eines konsequenten Reduktionismus, weil man
18
Theoriestrukturen in der Medizin
zwar zum einen behauptet, daß im Prinzip alles unter Bezug auf Elementarteilchen und Elektronen, die ihrerseits schönen quantitativen Gesetzen gehorchen, erklärbar ist, zum anderen aber nicht fordern muß, daß Maikäfer und Gänseblümchen ebenfalls durch vergleichbare theoretische Differentialgleichungen beschrieben werden können. Diese Differentialgleichungen gibt es nur für Elektronen und das reicht im Prinzip aus. Aber nur im Prinzip und damit nur für den lieben Gott und nicht für den Menschen. Einheit des Wissens bedeutet, daß man im Prinzip zeigt, wie komplexe Vorgänge höherer Ebene durch Vorgänge auf der nächst tieferen Stufe zu verstehen sind. Gerade für den reduktionistischen Standpunkt ist es eine verkehrte Forderung, auf allen Komplexitätsebenen quantitative Formulierungen zu erwarten, wie sie für die fundamentale Ebene gelten. Die Theorie des Maikäfers in der Biologie läßt keine quantitativen Gesetzmäßigkeiten mehr zu. Das ist gerade für den Reduktionisten evident. Sein Ziel ist stets Erklären und Verstehen, Vereinheitlichen; aber das heißt nicht notwendig, mit wenigen homogenen Klassen und quantitativen Beziehungen auszukommen, sondern erfordert vielmehr nur zu zeigen, wie im Prinzip mit einem Satz von relativ ähnlichen Mechanismen die Vielfalt der Phänomene zu verstehen ist. Diederich: Ich möchte nochmal Bezug nehmen auf das, was Herr Vollmer vorhin sagte, und die sich daraus ergebende Problematik der Klassenbildung in der Medizin. Könnte es nicht sein, daß wir, wenn die medizinische Wissenschaft fortschreitet, sehr bald zu dem Punkt kommen, wo nur ein-elementige Klassen übrig bleiben ? Nehmen wir an, daß wir bei einem konkreten Patienten Diabetes, Bluthochdruck und noch einiges anderes diagnostizieren. Dann gibt es möglicherweise nur noch einen Patienten, der genau dies alles in genau dieser Kombination hat. Nun könnte man den Patienten gemäß all dieser Diagnosen behandeln wollen. Jede dieser Diagnosen könnte jeweils mit einer allgemeinen Handlungsvorschrift bzw. Behandlungsvorschrift verknüpft sein. Ich vermute jedoch, daß es hier sehr schnell Konsistenzprobleme gibt. Die nach der einen Diagnose angezeigte Behandlung kann mit einer nach einer anderen Diagnose indizierten in Konflikt geraten. Ich denke, daß man hier in eine Situation geraten könnte, in der man handeln muß, ohne daß dies theoretisch gedeckt ist. Gerade dann, wenn man in Analogie zur Physik im Gesetzes- und Subsumptionsdenken fortzuschreiten sucht, stößt man
Theoriebegriffe in der Medizin
19
gleichsam von selbst auf derartige Probleme der Medizin. Diese Probleme sind wohlunterschieden von jenen, die sich aus der Rückführung von Komplexität auf Einfaches ergeben. Pralle: Es sind gerade die sogenannten sauberen Theorien, die Teilsysteme des Menschen betreffen, die uns überhaupt in die Lage versetzen, den Menschen behandeln zu können. Dennoch gibt es das von Herrn Diederich genannte Konsistenzproblem. Ich muß wissen, was ich mit meiner Therapie bei einem speziellen Patienten in der Praxis anrichten kann und zwar unabhängig davon, ob ich den ganzen Menschen und sein Umfeld in die Therapie einbeziehe oder nicht. Es gibt bestimmte Theorien und bestimmte allgemeine Lehrsätze, die ich beherrschen muß, um den Menschen angemessen behandeln zu können. Ich kann nicht einen AsthmaPatienten, der gleichzeitig einen Hochdruck hat, mit einem Beta-Blocker behandeln, weil ich dann das Risiko eingehe, daß er schwere asthmatische Zustände dadurch bekommt. Deppert: Ich möchte nochmals auf die Analogie zwischen der Beschreibung der physikalischen Welt und der Beschreibung einzelner Patienten zurückkommen. Wenn wir empirische Theorien bilden, dann benötigen wir von vornherein zwei Typen von Theorien. Zum einen eine Theorie, die ich als Metatheorie bezeichnen möchte, weil sie uns den Möglichkeitsraum dessen angibt, was wir in der Empirie vorfinden können, und eine Theorie, die die Beschreibung empirischer Objekte leistet. In der Kosmologie etwa liefert die Metatheorie eine Fülle möglicher Welten. Eine Metatheorie der Medizin müßte entsprechend einen "möglichen Organismus" beschreiben mit allem, was sich überhaupt denken läßt. Ausgehend von diesem Konzept eines allgemeinsten Organismus, ist dann der spezielle Organismus durch Parameter zu bestimmen. Unter diesen Voraussetzungen ließen sich prinzipiell die Schwierigkeiten, die Herr Vollmer aufgezählt hat, vollkommen eliminieren. Es handelt sich jedenfalls nicht um spezifische Schwierigkeiten der Medizin. Denn bezogen auf die Metatheorie ist die Anzahl der möglichen Objekte ohnehin immer potentiell unendlich handele es sich nun um den Bereich der Kosmologie oder der Medizin. Von daher könnte man sich theoretisch sehr wohl eine saubere bzw. anständige Theorie der Medizin denken. Dies gilt jedenfalls von einem konzeptuellen Standpunkt her, mögen sich in der Praxis auch erhebliche
20
Theoriestrukturen in der Medizin
Schwierigkeiten einstellen. Die eigentliche Besonderheit der Medizin scheint mir auf einer anderen Ebene angesiedelt zu sein. Die Physiker verfolgen immer noch die Idee einer "Baukastenwelt". Nach ihrem reduktionistischen Programm gehen sie davon aus, daß es letztlich möglich sein muß, alle Abläufe des Kosmos aus Gesetzmäßigkeiten zu erklären, die sich auf elementare Teilchen beziehen. Jedenfalls im Prinzip geht man davon aus, daß sich alle komplexen Vorgänge gleichsam baukastenmäßig aus Einfacherem zusammensetzen lassen. Dies ist ein Denken in linearen Strukturen, so als ob das Gesamtobjekt linear aufgebaut sein müßte. In der Medizin ist es demgegenüber so, daß ich Untersysteme innerhalb eines Organismus nur verstehen kann, wenn ich ihre gegenseitige Abhängigkeit einbeziehe. Es hat keinen Sinn, Untersysteme herauszulösen und das komplexere Gesamtsystem aus den zunächst isoliert betrachteten Untersystemen schrittweise zusammenzusetzen. Nach meiner Auffassung wird diese Betrachtungsweise auch einmal auf die Physik anzuwenden sein, obschon die Physiker bislang nicht dieser Auffassung sind. Insoweit könnte es, nebenbei bemerkt, eines Tages auch möglich sein, daß von Theorien der Medizin bzw. von der Wissenschaftstheorie der Medizin her Anregungen für Theorien der Physik bzw. der Wissenschaftstheorie der Physik ausgehen. Lie: Mir scheint, daß wir besser als bisher zwischen wissenschaftstheoretischer und wissenschaftlicher Seite unterscheiden müssen. Die Frage, wie man einen speziellen Patient behandeln sollte, möchte ich für den Augenblick einmal ausklammern. Diese Frage ist selbstverständlich wichtig, doch nicht für den von mir momentan zu diskutierenden wissenschaftstheoretischen Kontext. Für mich stellt sich vielmehr die Frage, ob es überhaupt eine Theorie etwa der Diabetes-Behandlung gibt. Läßt sich eine solche allgemeine Theorie für verschiedene Klassen von Patienten überhaupt formulieren? Das führt zu der viel weitergehenden Frage, was es überhaupt heißen kann, in den Biowissenschaften beispielsweise in der Biochemie von allgemeinen Theorien zu sprechen. Ohne Zweifel gehört die Biochemie zu den erfolgreichsten Fächern in der Medizin. Dennoch bereitet es große Schwierigkeiten, diese Art der Theoriebildung mit dem Schema Allgemeingültigkeit beanspruchender All-Sätze in Übereinstimmung zu bringen, welches uns die allgemeine Wissenschaftstheorie nahelegt. Das, was wir wissen, läßt sich ganz offenkundig nicht in Form von
Theoriebegriffe in der Medizin
21
All-Sätzen repräsentieren. Man hat beispielsweise für Escherichia coli die Protein-Synthese detailliert untersucht. Es gelang, einen Abschnitt der DNA, der strukturell einem Operator-Gen entspricht und für eine Mehrproteinsynthese verantwortlich ist, darzustellen und ebenso Suppressoren anzugeben. Man versteht also die Funktion dieses Systems ganz genau und man kann dieses Verständnis durchaus auch verallgemeinern. Dennoch gelten die beschriebenen Abläufe nur für diese Organismen, diese Bakterien. Das Problem ist, daß die über das System getroffenen Feststellungen eben nicht für alle Organismen gelten. Die All-Sätze gelten für alle Escherichia coli aber nicht für alle Organismen. Will man hier Aussagen übertragen, so muß man Ähnlichkeitsbetrachtungen anstellen. In anderen Organismen beobachtet man ungefähr dasselbe, aber eben nicht genau dasselbe. Im Prinzip gleichen sich die Abläufe, aber sie sind eben nicht ganz gleich in allen Organismen und man hat daher bestimmte Ausnahmen vorzusehen. Hier erhebt sich die Frage, was man mit solchem Wissen anfängt. Die klassische Logik läßt sich nicht gradlinig anwenden, weil hier nichts deduzierbar ist. Wir müssen die Frage aufwerfen, was für eine Struktur ein Wissen besitzt, das nur über Verknüpfungen per Analogie vernetzt ist. Die Bedeutung derartiger Probleme der Wissensrepräsentation scheint mittlerweile bis in die Politik hinein anerkannt zu werden. Jedenfalls gibt es in den USA mittlerweile Bemühungen, auch von staatlicher Seite aus, Projekte zu fördern, die versuchen, das Problem der Wissensrepräsentation unter Einsatz von Computern zu lösen. Obwohl man bislang keine theoretische Biologie besitzt, die allgemeine Sätze aufstellt, die für alle Organismen Geltung beanspruchen, kann es vielleicht gelingen, eine theoretische Superstruktur zu bilden, die alle Verknüpfungen zwischen verschiedenen Organismen systematisch darstellt. Diese Superstruktur ist dann die theoretische Biologie. Von der Superstruktur wird die gleiche Funktion wahrgenommen wie von der allgemeinen Theorie in der Physik. Dies vollzieht sich weitgehend losgelöst von den Experimentalwissenschaften. Es handelt sich um ein theoretisches Supersystem, in welches zwar alle experimentellen Resultate hineinpassen, das jedoch nicht zu einer Vereinheitlichung führt, wie sie etwa die Theorie aller Pendelbewegungen zu leisten vermag. Man besitzt keine Theorie der Proteinsynthese, die ausnahmslos für alle Organismen gilt, sondern die Theorie der Proteinsynthese, über die man verfügt, bildet eher ein Netzwerk mit Ausnahmen und Analogieschlüssen usw.
22
Theoriestrukturen in der Medizin
Stöckler: Es ist überhaupt nicht zu erwarten, daß sich in der Medizin und der Biologie eine allgemeine Theorie entwickelt, die in der gleichen Weise allgemein ist, wie wir es von der Physik her gewohnt sind. Die Allgemeinheit der Physik bezieht sich auf die Einfachheit der Objekte und auf die homogene Klassenbildung. Die Allgemeinheit der Physik liegt nicht in der Methode, sondern in der Einfachheit der Gegenstände begründet. Im Gegensatz zur Biologie spielen Randbedingungen nur eine untergeordnete Rolle. In der Biologie hingegen ist von entscheidender Bedeutung, welchen Pfad die Evolution eingeschlagen hat und welcher Code als Ergebnis der Evolution vorhanden ist etc. Daher ist es überhaupt nicht zu erwarten, daß einmal ein "Newton des Grashalms" zu uns kommt. Auf den muß man gar nicht erst warten. Hucklenbroich: Unsere momentane Diskussion zeigt meines Erachtens erneut, daß die wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzungen der 40er - bis ungefähr 70er Jahre - eigentlich Phantomdiskussionen gewesen sind. Als man sich die Wissenschaften, so wie sie tatsächlich sind, näher anschaute, ist man auf ganz andere Fragestellungen gestoßen. Es hat vermutlich keinen Sinn, auf den Newton der klassischen Wissenschaftstheorie zu warten. Es gibt auch noch niemanden, der irgendeines der wissenschaftstheoretischen Modelle und sei es auch nur mit Bezug auf die Physik durchgeführt hat. Niemand hat je im einzelnen dargelegt, wie die Physik aussähe, wenn man etwa von Popper oder von Stegmüller oder Sneed ausginge. Meines Erachtens ist dies kein Zufall. Kliemt: Aber Herr Hucklenbroich, sagen Sie nicht, daß der Theoriebegriff, der in der herkömmlichen Wissenschaftstheorie angewandt wurde, von vornherein inadäquat gewesen ist. Sie behaupten, daß jene Art von Theorie oder jene Art von wissenschaftstheoretischer Konzeption von Theorie, die Herr Lie für die Medizinwissenschaften vorgeschlagen hat, auch für die Physik von jeher angemessen ist? Hucklenbroich: So wäre das vielleicht ein Kurzschluß, da die Gegenstandsbereiche zu verschieden sind.
Theoriebegriffe in der Medizin
23
Stöckler: Die theoretische Physik kommt mit 3 oder 5 großen Theorien aus und man arbeitet daran, selbst diese noch zu vereinheitlichen. Für die Biologie ist ähnliches nicht zu erwarten. Ein Physiker kann in einem Buch vier Gleichungen hinschreiben und sagen, eigentlich sei das schon alles. Der Rest sind nur Anwendungen. Man rechnet zwar im Lehrbuch noch für verschiedene Anwendungsfälle die Felder aus, aber was den Physiker eigentlich theoretisch daran interessiert, ist die allgemeine Struktur, die beispielsweise in vier Grundgleichungen zusammengefaßt werden kann. Der Biologe hingegen verschiebt das Interesse von den Strukturen der allgemeinen Gesetze zu den speziellen, wirklich realisierten Anwendungen. Ein Biologe, der sich wie die Physiker verhielte, müßte ja sozusagen den punktförmigen Affen analysieren. Das entspräche den Beispielen, die in Physik-Lehrbüchern gerechnet werden. Diese haben mit der Welt überhaupt nichts zu tun. Je mehr man sich wirklich komplexen Systemen zuwendet, desto mehr verschiebt sich das Interesse. In der Biologie nimmt man die Gesetze hin und guckt, wie die Gesetze der Physik auf spezielle Systeme angewandt werden. Während der Physiker sagt, mich interessieren nur die Gesetze: Wie man diese in komplexen Systemen anwenden kann, das interessiert mich nicht, davon verstehe ich zu wenig, und das ist mir zu kompliziert. Schaefer: Vielleicht zu allem direkt. Ich will versuchen, die Fragen, die ich an Herrn Hucklenbroich und Herrn Stöckler habe, einigermaßen konkret zu formulieren. Es wurde darüber gesprochen, daß wir eine anständige Theorie des Pendels haben. Worauf beruht es, daß alle sich darüber einig sind, daß dies eine anständige Theorie ist? Wie kommt es, daß für andere Theorien dieses Anständigkeitskriterium nicht angeführt wird? Das ist die eine Frage. - Die zweite Frage stellt sich in Verlängerung der ersten mit Bezug auf die Medizin. Wir haben natürlich nicht nur eine Theorie des Diabetes, sondern wir haben -zig Theorien des Diabetes. Und es ist so, daß wir nicht nur eine Handlungsanweisung haben, sondern wir haben zig Handlungsanweisungen, die sich auf diese Theorien stützen. Was ist der Grund, daß wir die Eindeutigkeit, die in Bezug auf das Pendelbeispiel zu existieren scheint, in der Beurteilung der Anständigkeit einer medizinischen Theorie nicht haben?
24
Theoriestrukturen in der Medizin
Stöckler: Konkurrierende Theorien sind typischerweise in der Physik nicht so häufig. Das liegt daran, daß die Physik sich mit so einfachen Gegenständen beschäftigt, würde ich vermuten. Was nun speziell das Pendel als einen makroskopischen Körper anbelangt, so scheint es ausschlaggebend zu sein, daß die spezielle Zusammensetzung des Pendels irrelevant ist für die Schwingungszeit. Wir können alle anderen Aspekte außer der Fadenlänge ausblenden und deshalb eine anständige allgemeine Theorie bilden. Man kann deshalb auf einer Ebene oberhalb der Teilchen Gesetze finden. Wenn die Details zu kompliziert und die Feinstruktur zu wichtig werden, dann muß man so vorgehen wie die Systemtheoretiker oder Elektrotechniker. Die sagen, das ist ein Verstärker und ich will jetzt gar nicht wissen, was die Elektronen und die Ströme dadrin machen. Ich will nur wissen, wie das funktioniert. Deppert: Ich meine, auch die sogenannten anständigen Theorien sind alle ziemlich unanständig, weil sie einfach nicht stimmen. Jemanden, der glaubt, es gäbe eine wirklich zutreffende Theorie des Pendels, möchte ich kennenlernen. Die Beschreibung des Pendels, wie wir sie aus der Physik kennen, stimmt immer nur unter zwei Annahmen: erstens keine Reibung und zweitens ganz kleine Ausschläge. Sobald die Ausschläge größer werden, wird es eine nichtlineare Differentialgleichung mit allen damit verbundenen Schwierigkeiten allgemeiner Lösbarkeit. Man könnte hier die Argumentation auch einfach herumdrehen und sagen, die allgemeinsten Theorien sind die Theorien komplexer Systeme und die speziellen Theorien seien jene, die die Physiker bilden. Denn diese gelten nur unter ganz bestimmten Annahmen. In Wirklichkeit gelten sie eigentlich gar nicht, weil die Annahmen immer so speziell sind, daß sie höchstens im platonischen Ideenhimmel gelten. Lohff: Begriffe, wie der der "anständigen", der sauberen, der reinen Theorie sind Metaphern, hinter denen eine Motivation und eine Vorstellung, wohin sich nun bitteschön die Medizin oder jede Wissenschaft zu entwickeln hat, steht. Als Nichtphysiker und Nichtmediziner habe ich aus der Diskussion den Eindruck gewonnen, daß im Grunde genommen doch eine Idee da ist, wie die anständige medizinische Theorie auszusehen hätte. Diese Fixierung auf die Idee der anständigen Theorie, die von den Wissenschaftstheoretikern noch unterstützt wird, hindert im Grund genommen
Theoriebegriffe in der Medizin
25
daran, sich mit der medizinischen Theorie und ihren Möglichkeiten und ihrem Anwendungsbereich wirklich auseinanderzusetzen. Hucklenbroich: Würde man den praktizierenden Arzt, sei er nun auf einer Station oder niedergelassen in einer Praxis oder sonst wo tätig fragen, wonach er handelt, dann würde er nicht auf Theorien verweisen. Er würde vermutlich sagen: "Es ist so etwas wie ein Organisationsplan, ein Schema, das ich befolge. Ich habe eine Menge von Regeln, von Handlungsmöglichkeiten, von Zwängen, unter denen ich stehe. Unter anderem habe ich auch mein medizinisches Wissen, das ich gelernt habe und das durch meine Erfahrung erweitert worden ist. Dieses Wissen bezieht sich zwar auf den gesamten menschlichen Organismus, also den Patienten-Organismus, ist aber in sich selbst sehr heterogen. Es ist dabei allerdings gar nicht zu erwarten und auch nicht notwendig, daß ich ein Total-Modell des PatientenOrganismus habe, aus dem ich alles ableiten könnte. Sondern es kommt vielmehr darauf an, daß meine Praxis irgendwie "stimmt" und für den Patienten sinnvoll bleibt." Wenn man diese Denkstruktur analysieren würde, dann käme man eher darauf, was der Mediziner eigentlich unter Theorie versteht. Das ist eben nicht die Art von biomedizinischer Theorie, wie sie in der humanbiologischen oder auch psychologischen Forschung über einzelne Systeme des Organismus gebildet wird. Vollmer: Wie beurteilt man Theorien? Einen absoluten Maßstab gibt es natürlich nicht. Dann verbleiben zwei Wege. Einer von ihnen beginnt intuitiv. Hätten wir etwa zwanzig Theorien aus der Medizin vor uns liegen, so könnten wir zunächst intuitiv entscheiden, welche davon wir für "anständig" halten und welche nicht. Aus dieser intuitiven Unterscheidung ließen sich dann Qualitätsmerkmale herausarbeiten. Sicher wäre es dabei wenig sinnvoll, davon auszugehen, daß es überhaupt noch keine anständige Theorie gibt, also Anforderungen zu stellen, die keine Theorie erfüllen könnte. Wir kämen so zu medizin-internen, aber eben intuitiven Kriterien. Wir könnten aber auch externe Maßstäbe anwenden. Es gibt ja eine theoretische Physik. Dagegen gibt es so etwas wie theoretische Biologie fast überhaupt nicht. Woher kommt das? Herr Stöckler sagt, der Physiker interessiere sich nur für die einfachen Systeme und Gesetze. Ich meine, daß Physiker sich durchaus für komplexe Zusammenhänge interessieren; aber
26
Theoriestrukturen in der Medizin
man kann in der Physik eben auch dann bestehen, wenn man sich nur für einfache Systeme mit einfachen Gesetzen interessiert. Die gibt es nämlich wirklich, und es sind gerade die Dinge, die der theoretische Physiker behandelt. Wenn man dazu in der Biologie eine Analogie ziehen und theoretische Biologie machen möchte, dann bleibt nichts übrig, wenn wir uns auf einfache biologische Systeme und einfache Gesetze konzentrieren. Das heißt, theoretische Biologie in strenger Analogie zur theoretischen Physik existiert deshalb nicht, weil der Wunsch, sich erst einmal mit einfachen Systemen und einfachen Gesetzen zu begnügen, von der Biologie zu wenig übrigläßt. Kliemt: Wenn ich aufgefordert würde, eine, das Wort "eine" muß man unterstreichen, Definition von anständiger Theorie zu geben, dann würde ich vorschlagen, jedenfalls folgende Charakterisierung eines Aspektes von Anständigkeit mit einzubeziehen: Eine Theorie ist umso anständiger, umso weniger Beurteilungskunst nötig ist, um sie auf Einzelfälle anzuwenden. Eine Theorie ist anständiger als eine andere, wenn man sie schematischer anwenden kann, wenn es weniger situationsbezogener spezifischer Beurteilungskunst der einzelnen Person, die diese Theorie anwenden muß, bedarf als bei der Anwendung der anderen Theorie. Vieles, über das wir hier reden, die Komplexität der Anwendungen medizinischer Theorien etc., hat unmittelbar etwas damit zu tun, daß es den Medizinern eben gerade nicht gelungen ist, außer mit bestimmten harten Partikulartheorien, diese Schematisierung herbeizuführen. Überzogen formuliert: In der ärztlichen Kunst gibt es zu viel Kunst und zu wenig Schematik, um von anständiger Theorie zu sprechen. Stöckler: Wenn es darum geht, daß Ärzte heilen sollen, dann tendiere ich dazu, gar nicht so sehr zu fragen, wie sie das machen. Wobei ich schon eher Leuten vertraue, die, wenn sie mir den Bauch aufschneiden, auch im Großen und Ganzen wissen, was sie da erwartet. Da muß man einfach schon bestimmte Dinge wissen und damit über insoweit anständige Theorien verfügen. Wenn man etwas erklären kann, dann ist die Chance im allgemeinen recht gut, es in erwünschter Weise zu verändern. Aber nicht immer ist das Voraussetzung. Oft kann und muß man auch Dinge ändern, ohne die Wirkungen des eigenen Handelns wirklich abschätzen zu
Theoriebegriffe in der Medizin
27
können. Wenn man beispielsweise Kinder erzieht, kennt man die Mechanismen auch nicht. Solbakk: Nur eine Frage an Herrn Stöckler. Meinen Sie, daß es in den Basiswissenschaften um einen Theoriebegriff der Beschreibbarkeit geht, und in der Medizin um einen Theoriebegriff der Anwendbarkeit? Stöckler: Das gibt es in beidem. Auch in der Physik gibt es die Anwendung. Dieses Verhältnis von Erklärung und Anwendung ist, glaube ich, für die Physik im Verhältnis zur Technik und für die Biowissenschaften im Verhältnis zur praktischen Medizin das Gleiche. Man erklärt nicht, um etwas zu verändern in der Welt, sondern Erklärungen sind teilweise Voraussetzungen für Veränderungsfahigkeiten. Also weder notwendig noch hinreichend. Solbakk: Das heißt, Sie meinen es ist ähnlich. Stöckler: Es ist ähnlich, ja. Hucklenbroich: Wenn Sie es mir nicht übelnehmen, dann würde ich sagen, daß Sie, Herr Stöckler, die Verhältnisse in einer stilisierten Weise dargestellt haben, die typisch für die Allgemeine Wissenschaftstheorie ist, die sich am Paradigma der Physik oder überhaupt der forschenden Naturwissenschaften orientiert. Ich komme ja auch aus diesem Bereich und kenne also diese Herangehensweise sehr genau. Für mich war das ein längerer Lernprozeß zu sehen, wie man eigentlich in der Medizin denkt und wie man von daher zu einer Theorie der Medizin kommen würde. Da würde andersherum argumentiert werden. Da ist zunächst der Arzt mit dem Kranken, dem er helfen muß, egal, was er nun und wieviel er weiß. Das ist das Vorrangige. Diese Praxis muß zunächst in ihrer Struktur theoretisch aufgeklärt werden. In dieser Praxis bildet das Wissen, auch das biomedizinische Wissen, ein wichtiges, aber nicht das einzige Element. Man kann nicht einfach sagen, da gibt es einmal die Wissenschaft und dann gibt es die Anwendung. Das ist in der Medizin nicht möglich, weil die Praxis und das Helfen-müssen immer da sind, denn egal, wieviel Sie wissen und auch
28
Theoriestrukturen in der Medizin
wenn Sie gar nichts wissen, sind Sie aufgefordert etwas zu tun. Etwas zu tun, ist für den Arzt das ganz Entscheidende, das Wichtigste überhaupt. Wenn man im Sinne der Allgemeinen Wissenschaftstheorie alles andere nachher auf die Anwendungen verlegt, kommt man deshalb nicht dazu, wirklich Theorie der Medizin zu treiben. Stöckler: Die Trennung zwischen erklärendem Wissen und Anwendungswissen, die kann man begrifflich immer machen. Aber ich stimme Ihnen ganz zu, daß das für die jeweilige Arbeit und für die jeweiligen Ziele ganz unterschiedlich ist. Für die Lebenssituation des Arztes haben Sie sicher Recht, aber ich will trotzdem an der möglichen begrifflichen Unterscheidung festhalten. Hucklenbroich: Man sollte die "elitäre" Abgesondertheit der theoretischen und experimentellen Physiker etwas durchbrechen und sehen, daß diese Forschung doch in einem Kontext steht, in dem die Technik und die industrielle Anwendung von Technik wichtig sind. Die Frage der Perspektive, von der man auf Wissenschaft und Forschung und schließlich auch auf wissenschaftstheoretische Probleme blickt, ist wichtig. Die Medizin ist sehr eng an der von der Praxis ausgehenden Perspektive orientiert. Solbakk: Ganz sicher ist der Techne-Begriff der Medizin historisch bedingt und nicht nur ein pragmatischer oder ein Begriff der Anwendbarkeit, sondern ein epistemologischer Begriff. Zum Beispiel im Corpus Hippocraticum sind beide, Episteme und Techne, vereint und beide sind erkenntnistheoretische Begriffe. Weil Medizin als Technologie nicht nur Medizin als Anwendbarkeit von medizinischem Wissen beinhaltet, ist medizinische Technologie teilweise selbst medizinisches Wissen und zwar in theoretischem Sinne. Schaefer: Wir sind beispielsweise darauf angewiesen, jedenfalls in der Inneren Medizin, Medikamente zu verwenden. Was immer man dagegen sagen mag. Wir glauben daran, daß Medikamente für uns angemessene Handwerkszeuge geworden sind, mit denen wir bestimmte Dinge in einer bestimmten von uns erwarteten Richtung lenken können. Das Fatale an der Sache ist, daß - und darüber könnte Herr Vos noch sehr viel mehr sagen
Theoriebegriffe in der Medizin
29
als ich - in der Theorie der Pharmaka-Anwendung unser Wissen schlecht ist. Das heißt, sobald wir mehr als zwei bis drei Pharmaka gleichzeitig geben, wissen wir überhaupt nicht mehr, was eigentlich passiert. Die Partikulartheorien, mit denen wir zu tun haben, die helfen uns häufig nicht weiter. Wir haben immer nur die Partikulartheorien für einen Aspekt und wenn schon das zweite oder dritte Medikament gegeben wird, dann bricht alles zusammen. Das heißt also, ich würde dafür plädieren, daß wir wirklich einen ganz anderen Theorie-Begriff in der Medizin brauchen, der uns in die Lage versetzt, vom Gesamtsystem, mit dem wir es zu tun haben, auszugehen.
Das Reduktionismusproblem in der Medizin Die nachfolgend wiedergegebenen Diskussionen gingen von zwei konkreten medizinischen Beispielen aus, die als Anhang zu diesem Buch abgedruckt sind. Die Diskussionen sind auch ohne Kenntnis der Beispiele nachvollziehbar; aber es ist natürlich hilfreich und nützlich, den Anhang zu konsultieren, um sich von den Ausgangspunkten der Diskussionen einen Eindruck zu verschaffen. Kliemt: Ich meine, daß es nützlich ist, zwischen zwei fundamental unterschiedlichen Arten des Reduktionismus zu unterscheiden. Zum einen stellt sich ein theoretisches Reduktionismusproblem, worunter ich sowohl Probleme des sogenannten epistemischen wie auch des ontologischen Reduktionismus fassen möchte. Hier hat man vor allem zu untersuchen, ob sich möglicherweise alle Naturphänomene auf die Gesetze der Physik zurückführen lassen. Zum anderen gibt es neben diesem theoretischen Reduktionismusproblem ein forschungsstrategisches oder praktisches Reduktionismusproblem: Unter welchen Bedingungen und Zielsetzungen ist es eine vernünftige Vorgehensweise, an Erklärungsprobleme mit Reduktionsstrategien heranzugehen und unter welchen Bedingungen und Zielsetzungen ist dies unvernünftig?
30
Theoriestrukturen in der Medizin
Stöckler: Innerhalb der Wissenschaftstheorie gab es die Idee, eine physikalische Theorie oder überhaupt eine wissenschaftliche Theorie sei so etwas wie eine mathematische Theorie, deren Sätze in einem Deduktionszusammenhang stehen. Man hat Axiome, aus denen man etwas ableiten kann. Das stimmt so einfach in der Physik nicht: Physik ist nicht nur Mathematik mit Größen, die eine empirische Bedeutung haben. Ähnlich hat die Biologie methodische Aspekte, die in der Physik nicht zu finden sind. Das, was als große Leistung innerhalb der Biologie angesehen wird, ist eben etwas anderes als das, wofür es in der Physik zum Beispiel Nobelpreise gibt. Die biologische Erklärungsleistung besteht nicht aus einer Deduktion in der Art einer mathematischen Theorie. Es handelt sich, wie Herr Hegselmann gesagt hat, um Teilerklärungsweisen, die wieder auf eine tiefere Ebene gehen. Im Zentrum der biologischen Forschung steht nicht eine Gesamttheorie eines Organismus. Ein typisches Forschungsproblem ist etwa, die Vererbung sichtbarer Merkmale auf biochemische Reaktionen zurückzuführen. In der Biologie sucht man in der Regel nicht nach Gebilden, die Physiker eine Theorie nennen würden, sondern man versucht, spezielle Theorien der Basiswissenschaften auf spezielle Probleme anzuwenden (etwa Elektrizitätslehre auf Signalleitung in Nerven). Damit ist man dann schon zufrieden. Im Erfolgsfalle nennt man das Ergebnis verwirrenderweise oft Theorie, aber solche Anwendungsmodelle haben andere Eigenschaften als die "strengen" Theorien der Physik. In der Biologie gibt es Nobelpreise für Teilerklärungen, die sich durch Zurückführung auf eine tiefere Ebene ergeben. Es ist Aufgabe der Biologie, Beziehungen zwischen Komplexitätsebenen herzustellen. Und das hat auch im Sinne einer Erklärungstheorie eine Funktion, man zeigt nämlich, daß Organismen nicht alle eine Eigengesetzlichkeit haben, sondern im Prinzip von gleichen Grundkräften bestimmt werden. Das heißt, es gibt neben der elektrischen Kraft und der Schwerkraft nicht noch spezielle Kräfte im Organismus, die einer eigenen Gleichung folgen. Aber dieser Reduktionismus führt gerade nicht dazu, daß ein Biologe arbeiten soll wie ein Physiker. Es kommt allerdings darauf an, so gut es geht, Beziehungen zwischen den Ebenen herzustellen. Lie: In der Medizin gibt es nur sehr wenige Fälle, in denen man aus einem molekular-biologischen Verständnis die phänotypischen Prozesse ableiten und verstehen kann. Ein Beispiel dafür bildet die Erklärung der Sichel-
Das Reduktionismusproblem in der Medizin
31
zellenanämie. Hier handelt es sich um eine Krankheit, die man deshalb ganz genau erklären kann, weil man sie auf einen genau lokalisierbaren Fehler in der Proteinsynthese zurückzuführen vermag. Über eine veränderte Struktur eines bestimmten Proteins führt dies zu einer Veränderung der roten Blutkörperchen. Unter bestimmten klinischen Bedingungen resultieren daraus die für das Krankheitsbild der Sichelzellenanämie charakteristischen phänotypischen Erscheinungen. Insgesamt liegt damit ein Beispiel für eine molekular-biologische Erklärung eines phänotypischen Krankheitsbildes vor. Derartige Beispiele sind allerdings sehr selten in der Medizin. Dennoch verfügt man über wichtige und gut gestützte medizinische Theorien, die nicht bis auf die molekular-biologische Erklärung der Phänomene zurückgehen. Demgegenüber wird heutzutage sehr viel Geld für molekular-biologische Forschungen ausgegeben mit der Begründung, daß dies die einzige Forschungsrichtung sei, von der handfeste Resultate zu erwarten sind. Der Schlüssel zum Verständnis von Krankheiten liege, so wird argumentiert, auf molekular-biologischer Ebene. Nur in dieser Rückführung erkennt man einen zu erstrebenden Fortschritt und gewährt deshalb vor allem auf diesen Gebieten Forschungsunterstützungen. Demgegenüber wird wenig und immer weniger Geld z.B. für die traditionelle physiologische Forschung ausgegeben. Damit werden für Forschungsprojekte, die sich mit Organzusammenhängen beschäftigen, erheblich weniger Mittel zur Verfügung gestellt. In dieser Tendenz liegt eine Gefahr begründet, die aus forschungspolitischen Gründen dem Reduktionismusproblem großes Gewicht verleiht. Hucklenbroich: Neben der Sichelzellenanämie gibt es eine ganze Reihe von anderen Krankheiten, die man bis auf einen Gen-Defekt bzw. einen Molekular-Defekt zurückführen kann. Die These, daß man es hier gleichsam mit dem Paradigma von Krankheit zu tun habe, muß man jedoch entschieden zurückweisen. Es handelt sich nur um eine bestimmte Form von Krankheit. Vor diesem Hintergrund ist die Frage erneut aufzuwerfen, ob es eine sinnvolle Forschungsstrategie sein kann, Krankheiten jeweils soweit aufzuklären bzw. aufklären zu wollen, daß sie in ihrem Mechanismus ganz durchsichtig geworden sind. Wollte man stets bis auf einen GenDefekt zurückgehen, so wäre dies sicherlich verfehlt. Es kann häufig ausreichen, Krankheiten bis zu einem bestimmten Level zu verstehen. Zwar weiß man, daß man den Mechanismus noch weiter aufklären bzw. spezi-
32
Theoriestrukturen in der Medizin
fizieren könnte, man nimmt jedoch aus verschiedenen Gründen davon Abstand. Lie: Natürlich gibt es andere durch Gen-Defekte bewirkte Erkrankungen. Die genaue Konstruktion der Kausalketten ist allerdings stets mit Schwierigkeiten behaftet. Selbst bei der Sichelzellenanämie ist es unsicher, welche genauen phänotypischen Erscheinungen sich aus der genetischen Anlage ergeben. Darüber hinaus ist zu fragen, ob man den Mechanismus von Krankheiten auf einem ganz grundlegenden Level verstehen muß. Muß man, um einen Krankheitsmechanismus zu verstehen, wirklich die genetischen Bedingungen oder die Abweichungen der DNA-Synthese verstehen oder kann man nicht vorher bereits auf einem weniger grundlegenden Level stehen bleiben. Das ist das Problem. Soll man zu einem früheren Zeitpunkt aufhören und welche Kriterien bestimmen diesen Punkt? Deppert: Ich glaube nicht, daß man das theoretische oder ontologische Reduktionismusproblem von forschungsstrategischen Problemen des Reduktionismus tatsächlich trennen kann. Würde wirklich jedermann glauben, daß sich die Wirklichkeit ohne qualitative Sprünge jeweils durch Rückgriff auf elementarere Stufen erklären ließe, so wäre auch die Vergabe von Forschungsgeldern im Sinne eines reduktionistischen Programms vorentschieden. Dem kann man nur begegnen, indem man anderweitige Denkmöglichkeiten aufzeigt. Die Wirklichkeit könnte etwa so konstituiert sein, daß nicht alles nur auf die Grundbestandteile der physikalisch letzten, materiellen auffindbaren Teilchen zurückzuführen wäre. Solange eine solche Denkmöglichkeit nicht aufgezeigt ist, wird es nur Geld geben für reduktionistische Forschungsvorhaben und jedermann wird versuchen müssen, Reduktionsstufen zu überspringen. Demgegenüber möchte ich allerdings festhalten, daß es bereits in der Physik eine Fülle von qualitativen Sprüngen gibt, die sich nicht reduktionistisch auflösen lassen. Wenn Sie etwa versuchen, von der Quark-Theorie her die ElementarteilchenPhysik aufzubauen, dann können Sie kein wirklich sauberes Massenspektrum der Elementarteilchen angeben. Wenn Sie versuchen, von den Elementarteilchen überzugehen auf die Ebene der atomaren Beschreibung, sind Sie nicht in der Lage, wirklich die Elementarteilchentheorie zu benutzen, um die Struktur der Atome zu bestimmen. Von der Ebene der Atome können Sie nicht übersteigen auf die Ebene der Moleküle und es
Das Reduktionismusproblem in der Medizin
33
gibt zwischengelagerte weitere Sprünge. Die Quantenmechanik läßt sich sauber auf das Wasserstoffatom anwenden, aber schon nicht mehr sauber auf das Lithiumatom und schon gar nicht auf das Uranatom. - Wohin wir auch schauen, wir erblicken qualitative Sprünge. Es könnte sein, daß dasjenige, was wir Wirklichkeit nennen, tatsächlich eine derartige Grundstruktur aufweist. Es könnte verschiedene Qualitäten geben, die sich grundsätzlich nicht auf etwas jeweils Darunterliegendes reduzieren lassen. Dies ist ja nicht von vornherein ausgeschlossen und es sollte deshalb auch in unsere Diskussionen einbezogen werden. Stöckler: Ich möchte für den Reduktionismus nicht beanspruchen, er könne beweisen, daß nicht auch andere Theorien denkmöglich sind. Ich meine nur, daß es gute Gründe gibt, eine bestimmte Variante des Reduktionismus zu verteidigen. Es ist richtig, daß man das Verhalten des Helium-Atoms nicht aus Protonen und Elektronen exakt berechnen kann. Doch selbst wenn dies keine reduktionistische Theorie zu leisten vermag, so muß man feststellen, daß dies auch keine holistische Theorie vermag. Sollte es eine holistische Theorie geben, die neben dem Wasserstoffatom auch die anderen zufriedenstellend zu behandeln erlaubt, prima, dann werde ich Holist. Bislang können allerdings nur die Reduktionisten wenigstens das Wasserstoffatom erklären. Deswegen bin ich Reduktionist. Deppert: Aber die Chemiker, die können doch trotzdem schön arbeiten. Stöckler: Das ist zwar richtig, doch sollten wir genau zwischen verschiedenen Fragen unterscheiden. Zum einen stellt sich die philosophische Frage, ob die Wechselwirkungen, die man aus der Physik kennt, im Prinzip ausreichen, um sich vorstellen zu können, daß alle Vorgänge in der Natur nach den entsprechenden Gesetzen ablaufen. Die Behandlung dieser Frage ist eine weitgehend spekulative Angelegenheit. Die philosophische Reduktionismusthese läßt sich nicht dadurch nachweisen, daß man alles im einzelnen ausrechnet. Der philosophische oder ontologische Reduktionismus behauptet auch nicht, daß man dies tun könne. Deshalb kann man den ontologischen bzw. philosophischen Reduktionismus auch nicht dazu verwenden, etwa systemtheoretische Ansätze abzublocken. Das würde auf einem Mißverständnis beruhen. Aufgrund der Einsicht in epistemische Be-
34
Theoriestrukturen in der Medizin
schränkungen muß man es zulassen, daß man etwa über Transistoren spricht, ohne genau zu wissen, was in den Halbleitern passiert. Damit sind wir bei der zweiten, der forschungsstrategischen Frage angelangt. Was diese anbelangt, so würde ich auch vorsichtig sein, wenn die Geldgeber den Unterschied zwischen einem ontologischen Reduktionismus und dem forschungsstrategischen Reduktionismus nicht verstehen. In einem solchen Falle würde ich mich verpflichten, über den philosophischen Reduktionismus nur in abgeschlossenen Räumen zu sprechen, da ich die damit verbundenen Gefahren ernst nehme. Für den forschungspolitischen Reduktionismus spricht möglicherweise wenig, während meines Erachtens zugunsten des philosophischen oder ontologischen Reduktionismus einiges gesagt werden kann. Wenigstens ab und an hat es einmal geholfen, komplexe Systeme in Bestandteile zu zerlegen, um über die Analyse der Bestandteile zu einem besseren Verständnis des Systems zu gelangen. Mir sind für den umgekehrten Weg keine Beispiele bekannt. Dabei sehe ich durchaus das Problem, daß es einfach viele Dinge gibt, die man nicht weiß, und daß man trotzdem handeln muß. Mein Reduktionismus bezieht sich nur auf das philosophische Problem, wie die Welt aufgebaut ist. Daß ich in der Welt handeln muß, ist auch ein philosophisches Problem, aber ein anderes, das nicht in Konkurrenz zum ontologischen Reduktionismus steht. Aus dem Reduktionismus, den ich hier vertreten möchte, folgt überhaupt nichts für die Forschungspolitik. Man kann zugleich Systemwissenschaftler und ontologischer Reduktionist sein. Vollmer: Ich möchte zunächst eine Lanze für den methodischen Reduktionismus brechen. Normalerweise ist doch jeder Wissenschaftler methodischer Reduktionist. Ich kann mir gar keine Wissenschaft vorstellen, die auf dieses Programm verzichten könnte. In meinen Augen ist der Witz der, daß man bei diesem Programm sowohl hoffen kann, daß es funktioniert, als auch hoffen kann, daß es scheitert. In beiden Fällen ist es zweckmäßig, Programmreduktionist zu sein. Glaubt man, daß sich etwas im Sinne des reduktionistischen Programms auf eine tiefere Erklärungsebene zurückführen läßt, dann muß man eben dies zu leisten versuchen.Wenn man es gar nicht erst versucht, dann kann es auch nicht gelingen. Sollte andererseits jemand der Meinung sein, daß sich etwas von einer tieferen Ebene aus nicht erklären läßt, dann wird sich auch dies nur dadurch
Das Reduktionismusproblem in der Medizin
35
zeigen lassen, daß man es ernsthaft versucht. Nur durch diesen Versuch wird man herausfinden, wo und warum das Programm scheitert. Ein Beispiel: Um zu zeigen, daß man in der Philosophie des Geistes Dualist sein muß, oder um zu zeigen, daß der Vitalist recht hat, muß man hartnäckig eine Reduktion versuchen. Nur dann kann man hoffen, den Ort und die Gründe des Scheitems zu benennen. Ich glaube deshalb, daß Wissenschaft, wie wir sie kennen, ohne diesen methodischen oder ProgrammReduktionismus überhaupt nicht möglich wäre. Daneben scheinen mir nun aber auch einige grundsätzliche Erwägungen für den epistemologischen Reduktionismus zu sprechen. Das erste Argument ist das Syntheseargument. Es ist in vielen Fällen möglich, aus einfachen Bausteinen ein kompliziertes System herzustellen, zu synthetisieren. Aus diesem Grunde liegt es nahe anzunehmen, daß es auch möglich ist, in der Theorie aus der Kenntnis der Eigenschaften der Teilsysteme die Eigenschaften des Gesamtsystems zu gewinnen. Das Argument ist deshalb nicht sehr triftig, weil bei der Synthese natürlich ein Willensagent eingreift, der gewisse Absichten hat. Der Erfolg der Synthese könnte davon abhängen, daß der Agent bewußt hinzufügt, was für die Reduktion noch fehlt. Das zweite, etwas bessere Argument ist das Ontogeneseargument. In der Ontogenese von Organismen werden aus kleinen, einfachen Bausteinen größere und kompliziertere Systeme. Sieht man von theistischen Deutungen ab, so gibt es hier keinen Agenten, der das komplexere aus dem einfacheren synthetisch herstellt. Hiergegen kann man allerdings immer noch einwenden, daß dabei ja ein genetisches Programm eingreift, nach dem die gesamte Ontogenese abläuft. Das dritte Argument zugunsten des Reduktionismus scheint mir deshalb das schlagkräftigste zu sein. Es ist das Evolutionsargument. Wir glauben zu wissen, daß im Laufe der universellen Evolution - nicht nur der biologischen, sondern auch der kosmischen - aus einfachen Bausteinen kompliziertere entstanden sind. Deshalb liegt es nahe anzunehmen, daß es auch möglich ist, in der Theorie die Eigenschaften solcher Gesamtsysteme aus den Eigenschaften der Teilsysteme zu erklären. Zwingend ist dieser Schluß nicht, doch scheint es mir hochgradig plausibel, daß das, was in der Evolution möglich war - und zwar ohne Agenten und ohne Programm - , auch in der Theorie nachvollziehbar sein sollte. Aus der Tatsache der universellen Evolution vom Einfachen zum Komplexen ergibt sich damit ein Argument dafür, daß wir auch in der
36
Theoriestrukturen in der Medizin
Theorie vom Einfachen zum Komplexen erfolgreich fortschreiten können sollten.2 Diederich: Ich akzeptiere, daß der Reduktionismus als Strategie möglich ist. Ich glaube allerdings, daß einige Gesichtspunkte dagegen sprechen, einen Alleinvertretungsanspruch reduktionistischer Strategien zu akzeptieren. Zunächst einmal ist darauf zu verweisen, daß uns reduktionistische Detailuntersuchungen blind machen können für komplexe Zusammenhänge. Insbesondere können Erfolge in der Detailarbeit darüber hinwegtäuschen, daß man mit Bezug auf die komplexeren übergeordneten Zusammenhänge dennoch scheitert. Zum zweiten möchte ich Zweifel gegenüber dem von Herrn Vollmer vorgebrachten Evolutionsargument anmelden. Die Erkenntnisordnung muß nicht notwendig der Seinsordnung und dem durch diese vorgegebenen evolutionären Gang folgen. Es wäre immerhin möglich, obschon ich nicht behaupten möchte, daß dies notwendig so sein muß, daß es dem Verständnis komplexer Phänomene förderlicher wäre, nicht die Evolution gleichsam "nachzudenken", sondern anders anzusetzen. Drittens meine ich, daß es durchaus problematisch ist, einen Gegensatz aufzubauen zwischen einem Reduktionismus, den man letztlich als Physikalismus interpretiert, und dem Holismus. Holismus kann nicht heißen, daß man beim Ganzen anfängt und beim Ganzen stehen bleibt. Holismus hat nur Sinn, wenn man das Ganze als ein strukturiertes Ganzes begreift. Man muß auf eine andere Analyseebene zurückgreifen können, auf Teile oder Komponenten oder Momente des Ganzen, soll der Holismus nicht ein unbegriffener Holismus bleiben. Was nun den Zugriff auf eine weitere Analyseebene anbelangt, so gibt es möglicherweise für bestimmte Phänomenbereiche Alternativen zu einem Physikalismus, der im wesentlichen räumlich denkt und damit den Rückgriff auf weitere Analyseebenen mit einem Rückgriff auf das immer Kleinere verbindet. Vor diesem Hintergrund könnte man etwa das Vorgehen der chinesischen Medizin als ein Abweichen vom räumlichen Modell verstehen. Einen Schmerz im Knie etwa wird man innerhalb der chinesischen Medizin möglicherweise über einen Defekt im Wasser-Energie-Haushalt und damit aus einem globalen Prinzip heraus zu begreifen versuchen. Auch ein derartiges System kann zu unserem Verständnis beitragen, ohne daß seine Leistungen auf dem Rückgriff auf räumlich kleinere Bestandteile beruhen würden. Ich möchte hier keineswegs dafür plädieren, ausschließlich derartige nicht-
Das Reduktionismusproblem in der Medizin
37
reduktionistische Strategien zu verfolgen. Der Hinweis auf die Existenz von Argumenten für Alternativen zu reduktionistischen Zugangsweisen scheint mir jedoch wichtig zu sein. Hucklenbroich: Ich meine, daß wir in unseren Diskussionen immer noch nicht hinreichend berücksichtigen, daß es viele Bereiche gibt, in denen man funktionale und andersartige Zusammenhänge erkennt und auf dieser Basis Erklärungen geben kann, die sich selbst völlig genügen. In diesen Kontexten wäre ein Rückgriff auf eine niedrigere Erklärungsebene gar nicht sinnvoll und auch nicht erforderlich. Mir scheint, daß man diesen Aspekt in den Diskussionen des Reduktionismusproblems meist nicht hinreichend berücksichtigt. Hegselmann: Wer ein Radio besitzt und es lauter stellen möchte, der muß am Lautstärkenregler drehen. Man kann dies wissen, ohne mit der inneren Struktur des Radios vertraut zu sein. Man kann seine Funktionsweise insoweit verstehen, ohne seine internen Wirkmechanismen zu kennen. Für die meisten praktischen Zwecke ist dies vollkommen hinreichend und befriedigend. Mediziner scheinen demgegenüber häufig in Situationen zu geraten, in denen es gleichsam Empfangsstörungen gibt. Wenn sie, um im Bilde zu bleiben, den Bauplan des Gerätes nicht kennen, dann bleibt ihnen nichts übrig, als blind herumzuexperimentieren. Mal etwas Wasser hineinschütten, eine Salzlösung zugeben, doch mit den merkwürdigsten Effekten rechnen müssen, wenn gleichzeitig ein wenig Essig oder irgendeine andere Chemikalie verabreicht wird. Solange man es mit einer Blackbox zu tun hat, tappt man insoweit buchstäblich im Dunklen. Von daher scheint es mir keineswegs unvernünftig zu sein, nicht nur den Versuch zu unternehmen, funktionale Zusammenhänge zu erfassen, sondern darüber hinaus den inneren Bauplan im Detail aufzuhellen. Damit unterstreiche ich die Bemerkung von Herrn Stöckler, daß man ein reduktionistisches Programm auf gar keinen Fall in einen Gegensatz zum Verstehen komplexer Zusammenhänge bringen darf. Wenn ich unter holistischem Denken den Versuch verstehe, komplexe Zusammenhänge zu begreifen, dann kann eine reduktionistische Strategie das Mittel der Wahl für den Holisten sein. Es kann komplexe Zusammenhänge geben, bei denen in der Tat die einzige Verständnischance darin besteht, sie im einzelnen aufzubröseln. Über lange Phasen der Forschung können die Detail-Fortschritte dabei mögli-
38
Theoriestrukturen in der Medizin
cherweise nicht zu einem erweiterten Verständnis der komplexen Zusammenhänge führen. Die erforderlichen Vorleistungen können sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Es mag auch sein, daß deijenige, der mit Faustregeln arbeitet, zunächst im Vorteil ist. Ich möchte in diesem Zusammenhang jedoch an das schöne Bild von Dreyfus erinnern, wonach diejenigen, die auf dem Weg zum Mond direkt auf die Bäume steigen, natürlich zunächst dem Mond näher gekommen sind als jene, die vorerst am Boden bleiben, um sich zu überlegen, wie man tatsächlich den Mond erreichen kann. Die eiligen Kletterer werden bestimmt nicht ankommen. Freund: Meines Erachtens vernachlässigen Sie zu sehr, daß man Erfahrungen macht, wenn man Essig und Wasser "in die Black-box hineinschüttet". Man beobachtet, was daraufhin passiert, und wird daraus klüger. Ich meine allerdings, daß man generell die Gegensätze zwischen Holismus und Reduktionismus nicht überbetonen sollte. Wenn ich etwa an das Feld der Persönlichkeitstheorien denke, so findet man in diesem Bereich organismische und faktorenanalytische Ansätze. Der Streit um die richtige Vorgehensweise begegnet uns hier in immer neuen Auflagen. Ich denke jedoch, daß man eigentlich überhaupt keinen Gegensatz konstruieren sollte, weil die eine Zugangsweise so notwendig und nützlich wie die andere ist. Welche man wählt, hängt weitgehend von der Fragestellung ab und davon, was man eigentlich erreichen möchte. Jede Betrachtung, die sich nur auf den einen Zugang beschränkt, ist einseitig. Es gibt hier ein Spannungsfeld, das es auszuhalten gilt. Schaefer: Was die Grundsatzfrage des Verhältnisses von Reduktionismus und Holismus anbelangt, so scheint mir unklar zu sein, welche Rolle das Streben um die Einheit des Wissens in einem solchen Kontext noch spielen kann. Der Arzt stellt sich möglicherweise zwangsläufig von seinem Heilungsinteresse her außerhalb dieses Strebens. Stöckler: Das philosophische Motiv für den Reduktionismus bzw. für jene Form von Reduktionismus, die ich bevorzuge, scheint mir mit dem zusammenzuhängen, was ich als die Aufgabe der Wissenschaft begreife. Vielleicht bin ich insofern etwas verbildet, als ich mich mit Fragen der Kosmologie und der Elementarteilchen beschäftigt und damit relativ weit
Das Reduktionismuspioblem in der Medizin
39
von praktischen Verwertungsinteressen entfernt habe. Wer eine Theorie des Neutronensterns formuliert, der will keine Neutronensteme bauen und keine verkaufen. In dem Spektrum, welches von reiner Grundlagentheorie zu anwendungsbezogener Wissenschaft reicht, steht die Medizin sicherlich den zuvor erwähnten Fragestellungen fern. Deshalb mache ich mir möglicherweise ein falsches Bild von den Aufgaben der Wissenschaft, würde mich aber dennoch dagegen wehren, daß Wissenschaft immer nur problemlösend sei. Ich gebe zu, daß 99 % der Wissenschaftler nicht in den heiligen Hallen der erklärenden Wissenschaft leben. Es ist auch wahr, daß 99 % der Wissenschaftstheoretiker sich mit nur 1 % der Wissenschaft, der reinen bzw. theoretisch erklärenden Wissenschaft, beschäftigen. Aber dieses 1 % gibt es und mit Bezug auf diesen Bereich stellt sich die Frage des Reduktionismus. Eines der wesentlichen Motive für den Reduktionismus ist die These von und das Bemühen um die Einheit der Wissenschaft. Es geht um eine rein theoretische Frage nach dem Zusammenhang des Wissens. Diese Frage ist auch dann sinnvoll, wenn man nicht in der Lage ist, etwa die Eigenschaften komplexer Atome wirklich auszurechnen. Ein Reduktionist begnügt sich nicht damit, daß man ein Thermometer anwenden kann, um Temperaturen bzw. Fieber zu messen. Er wird über die technische Anwendung hinaus danach fragen, warum sich Körper unter Wärmeeinfluß ausdehnen. Es ist nun die Erfahrung der Physik, daß man ausgehend von Atomen viele Dinge, etwa bestimmte Effekte bei der Elektrolyse erklären kann. Das Ziel des Reduktionismus bzw. sein Hauptmotiv ist es, das Wissen zu vereinheitlichen. Diese Vereinheitlichung des Wissens kann von Theorien höherer Ebene und Gesetzmäßigkeiten höherer Ebene ausgehen, fragt aber im nächsten Schritt, wie man die betreffenden Phänomene gleichsam von "unten" erklären kann. Ein so verstandener Reduktionismus muß nicht behaupten, daß ein Haufen von Backsteinen das gleiche sei wie ein Haus. Er wird nicht, um im Bilde zu bleiben, behaupten, daß man Architekten zu Lehmfachleuten umschulen müsse. Systeme verhalten sich nach Auffassung eines recht verstandenen Reduktionismus unterschiedlich, wenn man dieselben Bestandteile anders zusammensetzt. Demgegenüber waren die Reduktionisten des 19. Jahrhunderts einfach zu unbescheiden. Sie haben nicht gesehen, daß derjenige, der allein auf der Ebene der Atome beginnt, überhaupt nicht zum Komplexen kommen kann.
40
Theoriestrukturen in der Medizin
Sie haben nicht verstanden, daß man, bildlich gesprochen, den Tunnel mindestens von zwei Seiten anbohren muß und daß es viel vernünftiger ist, zunächst eine qualitative Theorie des Komplexen zu formulieren, um erst im nächsten Schritt nach einer Vereinheitlichung zu suchen. Konsequente Reduktionisten dieses Typs könnten beispielsweise keinen Fachbereich Chemie zulassen. Chemie wäre aus ihrer Sicht höchstens angewandte Physik. Würde ein Chemiker beginnen, von Wertigkeit zu sprechen, dann müßte verlangt werden, diesen Begriff physikalisch zu definieren. Würde man herausfinden, daß dies nicht geht, so müßte man dem Chemiker sagen, er solle die Universität verlassen. Das ist natürlich Unsinn. Ich selbst habe in meinem Chemiepraktikum erfahren, daß die Chemiker Dinge können, die man als Physiker einfach nicht kann. Die Chemiker haben irgendwo geschüttelt und wußten, was in der geschüttelten Substanz enthalten ist, während ich drei Tage mit dem Trennungsgang verbracht habe und dann immer noch eine falsche Analyse hatte. Wenn ich also behaupte, die Physik sei eine fundamentale Theorie, so behaupte ich nicht, daß man kein eigenständiges chemisches Wissen besitzen kann. Meine Behauptung bezieht sich vielmehr auf das philosophische Interesse an einer allgemeinen und einheitlichen Theorie der Welt. Geldgeber und Forschungsförderungsinstanzen müssen lernen, diesen Unterschied zwischen einem allgemeinen und einem methodologischen Reduktionismus zu machen. Sollte man allerdings keine Chance sehen, den Geldgebern derartige Sachverhalte klarzumachen, so würde ich zugestehen, daß auch eine theoretisch richtige Position dadurch, daß sie in der Öffentlichkeit vertreten und falsch verstanden wird, schlimme Folgen haben kann. Freund: Ein Haufen Backsteine ist kein Haus. Aber es ist natürlich ebenso richtig, daß ein Haus ohne Backsteine nicht zu bauen ist. Der Glaubenskrieg beginnt, wenn eine Position leugnet, daß das Haus aus Backsteinen gebaut ist und die andere sagt, es sei in Wirklichkeit nur ein Haufen Backsteine. Es ist einfach destruktiv, wenn man nicht aushalten kann, daß ein Haus aus Backsteinen besteht, aber zugleich Backsteine allein kein Haus ergeben. Diederich: Vielleicht sollte man bei Heidegger nachgucken, ob das Haus des Seins aus Backsteinen besteht.
Das Reduktionismusproblem in der Medizin
41
Vollmer: Was würde der Holist anders machen als der Reduktionist? Das würde mich sehr interessieren. Daß sich etwa eine Faser in Gemeinschaft mit anderen Fasern anders als isoliert verhält (man vergleiche für ein konkretes Beispiel für jene Phänomene auch den Anhang zu diesem Buch; die Hrsg.), ist schließlich nicht überraschend. Derartige Phänomene begegnen uns allenthalben. So gibt es ja auch Menschen, die sind allein ganz vernünftig, und zu zweit machen sie Unsinn. Oder es gibt Massenpsychosen. Aus der Kenntnis des Einzelsystems oder des isolierten Systems weiß man häufig nicht, wie sich das Gesamtsystem, wie sich das Teilsystem im Verbund oder Verband verhalten wird. Die Frage nach der Forschungsstrategie ist damit jedoch noch nicht zugunsten des Holismus beantwortet. Ich persönlich bin wahrscheinlich ein so eingefleischter Reduktionist, daß ich gar keinen anderen Weg sehe, als sich zu überlegen, wie könnte es sein, daß eine Muskelzelle oder -faser der nächsten bzw. allen anderen mitteilt: Wir sind zusammen, benehmt euch im Takt! Mich würde interessieren, ob jemand einen anderen Weg sieht. Wie würde man das holistisch und damit anders als aus dem Zusammenwirken der Teilsysteme erklären? Nach meiner Erwartung wird das angeführte Beispiel nicht zur Entwicklung holistischer Theorien führen. In der Rückschau wird sich die Sachlage nicht so darstellen, daß wir 1989 die Wende zum Holismus erlebten, sondern in einigen Jahren werden wir sagen: 1989 wußten wir über das Verhalten der einzelnen isolierten Muskelzelle noch nicht so viel, daß wir hätten voraussagen und erklären können, wie sie sich im Verband verhält. Wir konnten das aber nach weiteren Forschungen an den Verbänden sehen. Inzwischen haben wir gelernt, daß sich Fasern noch diese oder jene Signale übermitteln, und auf diese Weise einander synchronisieren. Derartiges hat sich in der Wissenschaftsgeschichte immer wieder in ähnlicher Weise ereignet. Newton hat beispielsweise die Gravitationskraft als Fernkraft eingeführt. Das war zu seiner Zeit eigentlich ein Sakrileg. Denn diese Fernkraft war so etwas wie eine okkulte Fähigkeit, mit der etwas von hier nach dort ohne Verzögerung und ohne vermittelnde Instanz wirken sollte. Descartes' Druck- und Stoßtheorie war insoweit viel plausibler. Da die Gravitationstheorie von Newton jedoch funktionierte, hat er gegen seinen Willen und haben seine Zeitgenossen und Nachfolger gegen ihre Überzeugung akzeptiert, daß es anscheinend doch Fernkräfte geben muß. Die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein hat dieses Problem schließ-
42
Theoriestrukturen in der Medizin
lieh gelöst. Danach verändert die Masse die Raumstruktur und andere Massen bewegen sich in dieser veränderten Raumstruktur auf geodätischen Bahnen. Auf diese Weise kann man ohne Annahme okkulter Kräfte erklären, warum ein Planet um die Sonne kreist. Es gibt keine Fernkraft von der Sonne zum Planeten; die Nahwirkung wurde letztlich doch gefunden. In analoger Form werden sich meiner Erwartung nach nicht-reduktionistische Erklärungsmuster mit dem Fortschreiten der Wissenschaft als überflüssig erweisen. Deppert: Mit der Einsteinschen Allgemeinen Relativitätstheorie begegnen wir interessanterweise einem Fall von holistischer Theorie in der Physik. Denn es ist tatsächlich so, daß durch die Feldgleichungen eine gegenseitige Abhängigkeit von Raumstruktur auf der einen und Masseverteilung auf der anderen Seite beschrieben wird. Masseverteilung und Raumstruktur bedingen sich gegenseitig und deswegen ist das notwendigerweise auch eine nichtlineare Differentialgleichung. Die Auffassung, daß ich durch die Wechselwirkung, die gegenseitige Abhängigkeit von verschiedenen Elementen, offenbar neue Phänome hereinbekomme, die ich nicht aus dem Einzelnen selber erklären kann, ist die Position des Holisten, die deswegen völlig konträr im Gegensatz zu der der Reduktionisten steht. Bezogen auf biologische Beispiele ist vollkommen klar, daß die Zellen aus Molekülen bestehen, die Moleküle wieder aus Atomen und weiß der Teufel was. Alles, was damit erklärbar ist, soll auch dadurch erklärt werden und kann auch wahrscheinlich durch nichts anderes erklärt werden. Aber wenn man darüber übersieht, daß durch die gegenseitige Abhängigkeit tatsächlich eine neue Qualität entsteht, ist das ein Verlust. Sie kennen es alle aus den ersten Chemiestunden, das Beispiel vom Kochsalz: Chlor ist ein giftiges Gas und Natrium auch nicht sehr gesund. Wenn Sie beides zu einem Molekül verbinden, dann ergibt sich ein sehr wohlschmeckender Stoff, mit dem Sie Ihre Speisen würzen können. Es kommt also durch die Verbindung von Chlor-Ion und Natrium-Ion zu einer neuen Qualität, die ich offenbar nicht bestimmen kann aus den einzelnen Eigenschaften vom Natriumatom und Chloratom. Vollmer: Ich will nicht erneut auf die Relativitätstheorie eingehen, aber das Beispiel vom Kochsalz ist in meinen Augen nichts Holistisches. Der Physiker oder der Quantenchemiker kann sagen, das Chlor ist einwertig,
Das Reduktionismuspioblem in der Medizin
43
dem fehlt ein Elektron in der Außenschale; das Natrium hat dagegen ein Elektron zuviel. Beide können sich verbinden, dann gibt es Ionenbindung; damit hat man zwar noch nicht den Geschmack des Salzes ~ das liegt wieder mehr an der Kristallstruktur, nicht am Einzelmolekül —, aber ich kann doch in diesem Falle aus der Kenntnis der Teilsysteme die Eigenschaften des Gesamtsystems erklären. Gewiß, diese sind neu. Aber ich kenne keinen Reduktionisten, der bestreitet, daß durch Zusammenfügen von Teilsystemen neue Eigenschaften entstehen. Ich sehe nicht, wo da der Holismus liegt.3 Hegselmann: Als Gegensatz zum Holismus wird von den Holisten häufig ein Isolationismus konstruiert, dem der Reduktionist keineswegs anhängen muß. Isolationismus ist eine Position, die glaubt, die Wirkungsweise komplexer Zusammenhänge oder komplexer Systeme allein schon dann richtig beschreiben zu können, wenn man die Elemente völlig isoliert voneinander ohne Rücksicht auf die möglichen Wechselwirkungen hin untersucht. Ein isolationistischer Forschungsansatz, der glaubt, wenn er außerhalb des Körpers bestimmte Muskelfasern des Herzens genau untersucht, hätte er hinterher eine vernünftige Theorie des Herzens, ohne auf die Wechselwirkungen eingehen zu müssen, ist ziemlich aussichtslos. Reduktionismus verpflichtet natürlich in keiner Weise auf diese Form von Isolationismus. Als Reduktionist muß ich doch nur der Meinung sein, daß ich Gesamtzusammenhänge aus dem Zusammenwirken der verschiedensten Elemente erklären kann. Deppert: Herr Hegselmann, ich verstehe Ihre Unterscheidung nicht zwischen Isolationismus und Reduktionismus. Für mich ist der Reduktionist ja genau einer, der der Meinung ist, daß das Ganze sich aus dem Studium der Teile vollständig erklären, beschreiben und darstellen läßt. Wenn ein Reduktionist nicht zugleich Isolationist wäre, dann müßte er ja noch etwas annehmen, was plötzlich hinzukommt Hegselmann: Die Wechselwirkung, wenn man die Teile zusammennimmt
44
Theoriestrukturen in der Medizin
Deppert: Ja, aber die Wechselwirkungs-Möglichkeit muß für den Reduktionisten in dem Einzelnen angelegt sein. Das heißt, diese Wechselwirkungs-Möglichkeit müßte ich sozusagen am Einzelnen studieren können; denn das ist ja nun mal der Ansatz des Reduktionisten, daß er nicht sagt: "Durch die Wechselwirkung kommt prinzipiell etwas Neues hinzu, was nicht im Einzelnen schon vorhanden wäre". Das ist vielmehr die Position des Holisten, der sagt: "Durch die Wechselbeziehung entsteht etwas Ganzes, das mehr ist als die Summe seiner Teile, und dieses Mehr kommt durch die Wechselwirkung hinein. Solbakk: Ich verstehe nicht, warum Sie diese gegenseitige Wechselwirkung Holismus nennen. Also dem Holismus geht es nach Ihrer Sicht offenkundig nur um relationales Denken. Das macht man auch in der Systemtheorie. Aber man kann ja systemtheoretisches nicht einfach als holistisches Denken bezeichnen. Wir haben in der Medizin etwa die feedback Systeme. Das sind Systeme, die man zu erklären versucht durch ein relationistisches Denken. Das ist nicht Holismus. Ich finde es ist eine Sprachverwirrung in dieser Diskussion. Kliemt: Ich möchte auch davor warnen, Glaubenskriege um Begriffe zu führen. Wenn das Harmlose, was Herr Deppert im Auge hat, von Herrn Deppert gern Holismus genannt wird, würde ich vorschlagen, daß wir es meinetwegen Holismus 1 nennen. Die Reduktionisten sind dann möglicherweise auch Holisten dieser ersten Art. Dann haben wir aber noch einen Holismus 2, den sie nicht akzeptieren. Die Philosophiegeschichte ist wirklich voll mit Beispielen dafür, daß ein bestimmter Begriff nach und nach so ausgedehnt wird in seinem Sinngehalt, daß er eigentlich dem Gegenbegriff gleicht oder umgekehrt. Stöckler: Für einen Reduktionisten ist klar, daß die Umgebung eines Systems die Eigenschaften des Systems abruft. H2O wird bei tiefen Temperaturen Eis, dann eine Flüssigkeit und dann Dampf. Insofern bestimmt die Umgebung Eigenschaften des Systems. Der Reduktionist fordert zusätzlich nur, daß man das aus der Molekül struktur von H2O und den gegenseitigen elektrischen Wechselwirkungen, also aus so einem kosmischen Gesetz — die Elektrodynamik gilt universell — verständlich
Das Reduktionismusproblem in der Medizin
45
machen soll. Es gibt natürlich spezielle Gesetze des Pendels oder des Schwingkreises. Der Reduktionist fordert, daß die Gesetzlichkeiten, die in speziellen Systemen gelten, plausibel gemacht werden oder im Idealfall abgeleitet werden sollen aus den generellen Gesetzen. Man muß also zeigen können, warum Wasser bei bestimmten Temperaturen flüssig ist. Das kann man glaube ich nur in Ansätzen. Solange muß der Reduktionist sagen, die theoretischen Wasserchemiker sind noch nicht gut genug, nicht jedoch die Natur selbst verantwortlich machen. Diese Zielvorstellung ist wegen der Einheit der Wissenschaft von Bedeutung. Andernfalls hat jeder Spezialist sein eigenes Gesetz und man weiß nicht, wie diese Gesetze überhaupt zusammenhängen könnten. Vorsichtige Reduktionisten können widerspruchslos versuchen, das Ganze aus dem Wissen über die Einzelteile und deren Wechselwirkungen zu verstehen und dennoch von neuen Eigenschaften auf höheren Ebenen reden. Das Wissen, das notwendig ist, um ein Einzelteil in der einigermaßen isolierten Normalumgebung zu verstehen, ist viel geringer als das, was man überhaupt über das Einzelne wissen kann. Vielleicht ein Beispiel: Man kann furchtbar lange eine Schneeflocke angucken, und weiß noch nicht, wie sich ein Gletscher bewegt. Wenn viele Schneeflocken zusammenkommen, dann gibt es einen Gletscher. Dieser hat eine Flußgeschwindigkeit, bricht an einer bestimmten Stelle ab usw. Das kann man aus dem Verhalten der einzelnen Schneeflocke nicht direkt bestimmen, da man diese normalerweise immer nur bei normalem Luftdruck analysiert. Wasser unter hohem Druck und bei bestimmten Temperaturen verhält sich einfach anders. Das Wissen, das ausreicht, um ein isoliertes System unter Normalbedingungen zu verstehen, das reicht nicht aus, um das Verhalten des Einzelsystems in komplexen Zusammenhängen zu erklären. Deshalb muß der Reduktionist in der Regel fordern, auch von der höheren Ebene aus zu arbeiten. Das läßt sich auch auf medizinische Beispiel wie das des Zusammenwirkens der Muskelzellen des Herzens übertragen. Man weiß gar nicht, was die genaue Umgebung ist für die einzelne Muskelzelle. Welcher Aspekt der Umgebung ist entscheidend? Ist das irgendein Stoff? Oder ist das ein elektrisches Signal? Man kennt die Umgebung gar nicht. Wenn man die Umgebung kennen würde, müßte ein guter Molekularbiologe auch sagen können, wie die Muskelzelle sich verhält. Aber man kennt die Umgebung eben nicht. Und deswegen ist es gar nicht sinnvoll, die Aufgabe
46
Theoriestrukturen in der Medizin
der Verhaltenserklärung der Muskelzellen den Molekularbiologen zu übergeben. Wenn man weiß, wie die Umgebung beschaffen ist, kann man diese Umgebung allerdings künstlich herstellen, eine Muskelzelle in diese versetzen und dann müßte diese sich so verhalten wie im funktionierenden Gesamtorganismus. Schaefer: Ich finde, daß Sie eine sehr plausible und gute gedankliche Hilfe geben. Wenn ich beispielsweise an die Erforschung von Herzrhythmusstörungen denke, so legen wir diesen Unregelmäßigkeiten nämlich eine bestimmte Ursache an der Zelle zugrunde. Alle Forschungen, soweit ich sie kenne, konzentrieren sich überwiegend auf die Einzelzelle. Daraus wird zwar ein Wissen gezogen, das manchmal sogar zu einem Heilmittel, einem Pharmakon führt. Tatsächlich wäre es aber, wenn es so ist, wie Sie sagen - und ich kann dem folgen -, wichtig, diese Zusammenhänge zwischen Zellen zu untersuchen und eben nicht nur einzelne Zellen. Die Untersuchung komplexer Systeme, ist jedoch eine ganz andere Forschungsstrategie, die genau nicht verfolgt wird. Stöckler: Ja, das wäre so, als wenn die Gletscherforscher nur noch Schneeflocken angucken und nicht mehr in die Berge gehen. Schaefer: Was wir eigentlich für uns als Ärzte fordern müßten, ist, daß wir uns jeweils systemadäquat verhalten. Wenn ich einen Gletscher untersuche, muß ich diesen Gletscher untersuchen, und wenn ich eine Schneeflocke untersuche, eine Schneeflocke. Außerdem muß ich wissen, wann ich einen Gletscher und wann ich eine Schneeflocke vor mir habe und das kann unter Umständen manchmal nicht ganz einfach sein. Denn ich habe große Schwierigkeiten, aus dem Einzelwissen, welches ich aus den unter anderen Untersuchungskonstellationen gewonnenen Ergebnissen ableite, auf diese Gesamtheit zu schließen. Das Wissen, das einzelwissensmäßig aus bestimmten Konstellationen resultiert, wird dann so behandelt, als habe es auch für komplexere Zusammenhänge zu gelten, obwohl ein für diese Zusammenhänge geeignetes und unter komplexen Bedingungen erhobenes Wissen gar nicht vorhanden ist.
Das Reduktionismuspioblem in der Medizin
47
Lohff: Es ist auffällig, daß die reduktionistisch denkenden Wissenschaftstheoretiker einen ganz anderen Reduktionismus vertreten, als er etwa von Otto Frank4 befürchtet wurde. Wenn man genau zuhört, und in Ihrer Sprache mitdenkt, dann kommt in unserer Diskussion gar nicht das Problem auf, das real in der Forschung interessiert. Biologen oder Physiologen, die etwas scheinbar geeignetes in die Finger bekommen, werden in der Regel zu sehr strikten und brutalen Reduktionisten. Wir klammern damit jedoch wissenschaftstheoretisch eine Tatsache des realen Wissenschaftsprozesses aus. Im wissenschaftlichen Prozeß entwickelt sich eine Eigendynamik, die den Reduktionismus ohne Umschweife als Maxime in konkrete Forschungspolitik umsetzt, ohne noch nach Grenzen und Leistungsfähigkeit dieses Vorgehens zu fragen. Es ist nicht der ontologische Reduktionismus oder eine Weltbetrachtung allgemeiner Art, die die Forschungsstrategie bestimmt, sondern ein Reduktionismus als konkrete praktische Handlungsnorm. Man kommt dadurch schnell in den Reduktionismus hinein, aber verdammt schwer wieder heraus, wenn man ihn eben nicht als Ideologie erkennt.
Fortschritt in der Medizin Kenner: Ein großer Teil der jüngeren wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzung wird von der Frage bestimmt, ob sich der Wissenschaftsfortschritt kontinuierlich in kleinen Schritten vollzieht, bei denen man jeden neuen Wissensstand jeweils mit seinen Vorzuständen vergleichen kann, oder ob wir es eher mit einem sprunghaften revolutionären Wandel zu tun haben, in dem Theorien einander in einer Weise ablösen, die es nicht erlaubt, Vergleiche anzustellen, die einen Fortschritt im Sinne der Wissenserweiterung oder Kumulation von Wissen anzeigen. In der Medizin gibt es nun Fragestellungen, die man schon im 17. Jahrhundert oder gar früher fast so gut wie heute durchschaut hat, sie jedoch nicht in der heutigen Weise beschreiben konnte, weil dazu die Methoden fehlten. So gab es etwa bereits zur Zeit von Galilei Modelle, die Blutdruck und Blutströme in einer Weise in Verbindung bringen, die unglaublich modern aussieht. Von
48
Theoriestrukturen in der Medizin
daher könnte man sagen, der Fortschritt in der Medizin sei kontinuierlich. Man könnte sogar weiter gehen und behaupten, daß überhaupt kein Fortschritt stattfindet, weil man das Wesentliche schon vor mehreren hundert Jahren gewußt hat. Es gibt keinen grundsätzlichen Fortschritt, sondern nur ein tieferes Eindringen in Details der Physiologie oder Kardiologie. Es gibt allerdings andere Gebiete, in die man prinzipiell in früheren Zeiten nicht eindringen konnte. In diesen Bereichen - man denke etwa an das konkrete Beispiel der Untersuchung der Zellmembran - wurden sprunghafte Entwicklungen durch technische Fortschritte möglich. Lohff: Was als Fortschritt in der Medizin gilt, wird jeweils von einem ganz bestimmten Paradigma her definiert. Wenn wir heute von Fortschritt sprechen, dann legen wir einfach unseren Leisten an und werten konsequenterweise alles ab, was vorher unter einem anderen Paradigma gemacht worden ist. Die Ergebnisse, die man jetzt innerhalb der Kardiologie als ein fortschrittliches Wissen interpretiert — das, was seit Mitte oder Ende des letzten Jahrhunderts erforscht wurde — sind alle unter dem physikalistischen Ansatz hervorgebracht worden. So wird aus der Rückschau gesagt, daß diejenigen, die sich früher mit dem kardiovaskulären System beschäftigt haben, auch schon bestimmte Dinge erkannten. Wir bewerten dabei Forschungsergebnisse aus dem 18. oder 17. Jahrhundert entsprechend unserer jetzigen Idee, was Wissenschaft zu sein habe. Wir tun so, als wenn diese früheren Erkenntnisse wie die heutigen interpretiert werden könnten und klammern einfach alles aus, was die damaligen Forscher beschäftigt haben mag. Wir fragen nicht, was Harveys Idee war, das HerzKreislauf-System in einer bestimmten Weise zu betrachten. Feyerabend5 hat in einer Bemerkung, die mir persönlich sehr gut gefallen hat, über die heutigen Ansichten über Newton gesagt, daß alles zu Newton hinzugepackt wurde, was man heute eben für unsere Vorstellungen von der Welt gut gebrauchen kann, während alles, was Newton damals für seine Theorieentwicklung auch dazu genommen hat, seine ganzen alchemistischen Kenntnisse, sein unitarischer Ansatz einfach ausgelassen wird. Wir interpretieren Fortschritt auf der jetzigen Erkenntnisfolie. Wir benutzen nur unsere gegenwärtige Auffassung, was wir als Wissenschaft interpretieren, um zu sagen, hier ist Fortschritt vollzogen worden.
Fortschritt in der Medizin
49
Stöckler: Das Fortschrittsproblem in der Medizin hat verschiedene Aspekte. Zum einen stellt sich die Frage, was Fortschritt in der Medizin überhaupt heißen kann. Besteht der Fortschritt darin, daß bessere Heilungserfolge - wie immer man die Güte der Heilungserfolge messen mag erzielt werden, oder darin, daß man bestimmte Prozesse, die im Körper ablaufen, besser beschreiben und erklären kann? (Natürlich können diese beiden Aspekte, der praktische und der theoretische, miteinander verknüpft sein, weil etwa eine bessere Beschreibung und Erklärung zugleich zu besseren Interventionsmöglichkeiten auf dem Felde der medizinischen Behandlung beitragen können.) Ein weiterer Fragenkomplex wird berührt, wenn man den Zusammenhang zwischen erkenntnistheoretischen Kriterien für bessere und schlechtere Theorien (oder auch für die Qualität von Heilerfolgen) auf der einen und den Einfluß von sozialen Abläufen in der Wissenschaft auf der anderen Seite betrachtet. Innerhalb dieses zweiten Fragenkomplexes stellen sich Unterfragen. Wir müssen uns eine Meinung darüber bilden, ob es objektive Kriterien für gute und schlechte Wissenschaft gibt, so daß man sinnvoller Weise die normative Forderung erheben kann, jene, die Macht in der Wissenschaft besitzen, sollten diese Kriterien in Anwendung bringen, wenn sie darüber zu entscheiden haben, ob sie gewisse Arbeiten akzeptieren oder nicht akzeptieren wollen, ob sie Nachwuchswissenschaftler promovieren bzw. nicht promovieren wollen usw. Gibt es solche Kriterien, von denen wir jedenfalls idealtypisch erwarten würden, daß sie rationalerweise angewandt werden sollen oder handelt es sich bei der Entscheidung der erwähnten Fragen von vornherein um Machtfragen, die kriterienlos aufgrund der Macht allein entschieden werden müssen. Wenn wir uns diesen Fragen nähern wollen, so benötigen wir zunächst einmal viele Fallbeispiele. Mit Bezug auf das Fortschrittsproblem in der Medizin ist dies nicht anders. Wir benötigen Fallbeispiele für Theorienauseinandersetzungen in der Medizin. Dann können wir klären, ob Fortschritt in der Medizin etwa stets beinhaltet, daß eine Theorie eine andere aus dem Felde schlägt, oder ob es auch möglich ist, daß mehrere Theorien koexistieren können. In der Folge davon könnte man dann etwa fragen, ob in der Medizin als praktischer Wissenschaft Kriterien für den Beschreibungs- bzw. Erklärungsfortschritt von Kriterien für Behandlungserfolge getrennt werden können und wie diese beiden Bereiche miteinander zusammenhängen.
50
Theoriestrukturen in der Medizin
Diederich: Fortschritt kann revolutionär, aber auch ganz unspektakulär sein. Beides ist möglich. Wir sollten uns hier frei machen von vorgefaßten wissenschaftstheoretischen Auffassungen darüber, wie Fortschritt in den Wissenschaften zu verlaufen habe. Wir sollten uns auch von der Vormeinung lösen, daß es ein Charakteristikum guter Forschung sei, daß ein gemeinsames grundlegendes Paradigma existiert. Dies ist, meine ich, nicht notwendig und offenbar auch nicht üblich in der Medizin. Was die Unvergleichbarkeit unterschiedlicher Paradigmen anbelangt, so meine ich, daß man häufig durchaus von partiellen Vergleichbarkeiten ausgehen kann. Denkt man beispielsweise an die Akupunktur und gewisse neuere elektrophysiologische Untersuchungen über die von der Akupunktur behaupteten Zusammenhänge, die diese teilweise erhärten könnten, so zeigt sich meines Erachtens, daß alternative Konzepte in bestimmten Bereichen aufeinander bezogen werden können. Hier ist der Fortschritt mittlerweile der, daß innerhalb der einen Tradition versucht wird, etwas aus einer anderen zu assimilieren und sich verständlich zu machen. Dadurch wird eine Integrationsleistung vollbracht, die es erlaubt, die Leistungen der anderen Tradition jedenfalls partiell mit aufnehmen zu können. Dies führt überdies zu neuen Formen der Konkurrenz, in denen es darum geht, welche Tradition es in höherem Maße schafft, eine andere zu assimilieren. Ich glaube, daß man sich von den wissenschaftstheoretischen Modellen eines revolutionären bzw. nicht-revolutionären Fortschrittes frei machen sollte, um einfach die befruchtende Rolle von Alternativen und gerade auch von sehr stark abweichenden Alternativen anerkennen zu können. Radikale Alternativen zu besitzen, ist überaus wichtig für den Wissenschaftsfortschritt. Das kann man meines Erachtens auch an der Rolle der Astrologie bei Kepler illustrieren. Die Astrologie hat bei Kepler eine wichtige Rolle für seinen Beitrag zur kopernikanischen Revolution gespielt, obgleich sie in späteren Zeiten aus dem Wissenschaftskanon ausgeschlossen worden ist. In diesem Sinne kann meines Erachtens die Beschäftigung mit Alternativen bis hin zu anscheinend obskuren Ansätzen eine wichtige fortschrittsfördernde Funktion besitzen. Das gilt selbst dann, wenn ein Großteil dieser alternativen Ansätze im nachhinein als irrelevant entlarvt wird. Stöckler: Man muß sehr tolerant in Bezug auf Alternativen sein, selbst wenn man sie für falsch hält. Man muß allerdings gewisse Bremsen und Kontrollen in diese Toleranz einbringen. Angemessene Kontrollen dürfen
Fortschritt in der Medizin
51
natürlich nicht fortschrittshemmend wirken. Die Angemessenheit muß man nach wissenschaftsgeschichtlichen Erfahrungen beurteilen. Kriterien, die beispielsweise verhindert hätten, daß ein Kepler toleriert worden wäre, sind sicher nicht angemessen. Von Kontrollmechanismen, wie sie mir vorschweben, wäre Kepler nicht betroffen worden. Das gilt sogar für seine astrologischen Ideen. Denn bei Kepler kam stets etwas Konkretes und Kontrollierbares heraus. Toleranz gegenüber solchen Theorien ist geboten, kaum jedoch für Theorien, die überhaupt sonst keine Konsequenzen haben. Solche Theorien unterscheiden sich zwar von anderen Theorien, sind aber keine ernst zu nehmenden Alternativen. Überdies verdienen auch solche Ansätze nicht den gleichen Respekt nach dem Toleranzgebot, die einfach auf fundamentalen Unkenntnissen bzw. Mißverständnissen beruhen. Wenn etwa jemand eine alternative Relativitätstheorie vertritt, es sich jedoch herausstellt, daß er die Vektorrechnung nicht beherrscht und deshalb fortlaufend bei Einstein Fehler zu finden glaubt, dann muß man seine Theorien allein schon aus Gründen der Arbeitsökonomie ausscheiden. Man kann sich nicht wochenlang mit solchen Leuten beschäftigen und die sonstigen Forschungen deshalb aufhören lassen. Von solchen Fällen abgesehen, ist jedoch Toleranz gegenüber alternativen Theorien wichtig und geboten. Vollmer: Selbstverständlich gibt es verschiedene Fortschrittsbegriffe und diesen Begriffen entsprechende Fortschritte in der Medizin. Zum einen kann man an praktischen Fortschritt in der Heilung von Krankheiten denken, zum anderen an theoretische Fortschritte in der Erklärung physiologischer Abläufe, und natürlich kann es noch mehr Ziele geben. Ich habe gar keine Probleme, mehrere Fortschrittsbegriffe zugleich zu benutzen. Dabei muß ich mich nicht entscheiden, ob etwas deshalb ein Fortschritt in der Medizin ist, weil ich mehr Leute heilen kann, oder deshalb, weil ich daraus mehr theoretische Einsichten gewinne. Es gibt einfach verschiedene Ziele und deshalb auch verschiedene Arten von Fortschritt. Nun scheint es mir aber so zu sein, daß in der Medizin eigentlich alle Arten von Fortschritt, die ich mir überhaupt ausdenken kann, Hand in Hand gehen. Trat ein Fortschritt in der Medizin ein, so konnte man mehr Leute heilen, man konnte Krankheiten heilen, die man vorher nicht heilen konnte, man konnte es schmerzloser tun, und man gewann zugleich tiefere Einsichten in die Zusammenhänge. Das Zusammenspiel von theoretischen Einsichten und
52
Theoriestrukturen in der Medizin
dem, was man mit diesen anfangen kann, ist ein wirkliches Wechselspiel. Wenn Einstein sagt, nichts sei so praktisch wie eine gute Theorie, so scheint mir dies voll und ganz zuzutreffen. Wer mehr weiß, kann mehr machen, und wer mehr machen kann, lernt daraus auch mehr und weiß dann mehr. Sieht man einmal von der Frage ab, ob die medizinischen Fortschritte angesichts der Bevölkerungszunahme tatsächlich in einem übergeordneten Sinne Fortschritte für die Menschheit als Ganzes darstellen, so scheinen mir alle engeren Fortschrittskriterien in der Medizin stets in die gleiche Richtung zu weisen. Auch das würde das Fortschrittsproblem in der Medizin entschärfen. Deshalb würde es mich interessieren, ob jemand Beispiele nennen kann, bei denen Fortschritt in einer Richtung mit Rückschritt in einer anderen einherging. Gibt es solche Beispiele nicht, so wird damit auch das Problem der Forschungsforderung entschärft. Das führt mich zu einer zweiten grundsätzlichen Bemerkung. Toleranz gegenüber alternativen Forschungsansätzen kann ja grundsätzlich zweierlei bedeuten: Zum einen geht es darum, alternative Theoriebildungen nicht zu diskriminieren, sondern zuzulassen. Zum anderen erhebt sich die Frage, an wen Forschungsmitte/ vergeben werden sollen. Man kann es grundsätzlich begrüßen, wenn Alternativ-Strategien in der Forschung eingeschlagen werden, und doch der Vergabe von Mitteln für diese Arten von Forschung ablehnend gegenüberstehen. Ich selbst finde es zum Beispiel nicht besonders gut, daß öffentliche Mittel, nämlich die des Bundesministeriums für Forschung und Technologie, für das Erdstrahlenprojekt vergeben werden. Wenn aber irgendwelche Leute die Handhabung von Wünschelruten in der Praxis untersuchen, dann finde ich dies durchaus begrüßenswert. Es gibt vieles, was wir nicht wissen, und wir werden immer irgendwo etwas finden können, das wir bisher nicht wußten. Lohff: Wenn Herr Vollmer schlankweg behauptet, daß es Wissensfortschritt gibt in der Medizin, dann muß man die Frage aufwerfen, was für ein Fortschritt und welche Art von Wissen das ist. Wir wissen sicher heute mehr über die Physiologie des Nervensystems. In diesem Bereich sind unsere Kenntnisse größer als die Harveys oder Galvanis. Kliemt: Mir scheint, Herr Vollmer hat nicht einfach offengelassen, was Wissenschaftsfortschritt heißt, sondern hat etwas mehr gesagt. Er hat einem möglichen Gegner vorgeschlagen, eine Reihe von Fortschrittskriterien
Fortschritt in der Medizin
53
anzugeben und im Anschluß daran die provozierende Frage aufgeworfen, ob es unter Anwendung halbwegs plausibler Kriterien überhaupt Beispiele gibt, bei denen Fortschritt nach einem Kriterium nicht zugleich Fortschritt nach den anderen nach sich zieht Deppert: Für mein Dafürhalten ist das Fortschrittsproblem in der Medizin deshalb mit zusätzlichen Schwierigkeiten behaftet, weil in der Beurteilung dessen, was Fortschritt heißen soll, nicht nur der Mediziner selbst gefragt ist, sondern auch der Patient. Wenn heute etwa ein Gerät entwickelt wird, das man sich implantieren lassen kann und das dann zuverlässig gegen den plötzlichen Herztod schützt, so hat diese Art von Fortschritt durchaus fragwürdige Seiten. Der schönste Tod, den man haben kann, nämlich der plötzliche Herztod, ist dem Patienten nicht mehr vergönnt. Die Vor- und Nachteile derartiger Maßnahmen für ihn selbst kann letztlich nur der Patient beurteilen. Hucklenbroich: Ein Verfahren zur Verhinderung des plötzlichen Herztodes zu haben, bedeutet ja nicht, daß man es allen Leuten aufzwingt. Insofern könnte man sagen, es sei auf jeden Fall ein Fortschritt, diese zusätzliche Option zu haben. Schaefer: Ganz so einfach liegen die Dinge nicht. Neulich nahm ich an einer Veranstaltung von etwa 40 meiner Kollegen teil, auf der sich alle einig darin waren, daß jeder Patient ein Gerät zur Verhinderung des plötzlichen Herztodes haben muß, sofern er bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Es war überhaupt nicht die Frage, ob man nicht möglicherweise das Anrecht auf einen plötzlichen Herztod habe. Hätte ich diese Frage gestellt, wäre das indiskutabel gewesen, weil diese jüngeren Kollegen gleichsam im Rausch der technischen Möglichkeiten, die sie der Menschheit anbieten können, derartige Zweifel weit von sich gewiesen hätten. Kliemt: Es muß offenkundig unterschieden werden zwischen theoretischem Fortschritt einerseits und der Frage praktischen Fortschrittes andererseits. Zum praktischen Fortschritt gehört auch das Konzept technologischer BeheiTschung, also interventionistischen Erfolges. Herr Freund hat nun argumentiert, daß man auch dann, wenn man beispielsweise den
54
Theoriestrukturen in der Medizin
Organismus als Black-box behandelt, Wirkungen nach der Zugabe gewisser Substanzen beobachten kann. Man bekommt etwas heraus über regelmäßige Zusammenhänge zwischen zugefügten Substanzen und eintretenden Wirkungen. Man könnte dem entgegenhalten, daß wir in der Regel nicht nur wissen wollen, welche Korrelationen bestehen, sondern auch, warum sie bestehen und wie sie Zustandekommen. Eine einfache Beobachtungsregelmäßigkeit wie etwa das Boylesche Gasgesetz konnte nicht befriedigen, solange man keine Vorstellung darüber besaß, auf welchem Mechanismus diese Regelmäßigkeit beruhte. In einer Disziplin wie der Medizin, die in hohem Maße von technischen Verwertungsinteressen beeinflußt wird, könnte man versucht sein, wissenschaftstheoretische Auseinandersetzungen wie etwa den Streit zwischen Reduktionismus und Holismus als Glaubenskriege beiseitezuschieben. Jedenfalls die prinzipiellen philosophischen Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, könnte man offenlassen und fragen, ob es nicht ausreicht, sich darüber zu verständigen, welche Wirkungen relevante Testinstanzen darstellen sollen. Man kann dies etwa mit Bezug auf die Auseinandersetzung zwischen sogenannter Alternativmedizin und Schulmedizin leicht konkretisieren. In dieser Auseinandersetzung schwingen Untertöne mit, die in starkem Maße mit dem Glaubenskrieg zwischen holistischen und reduktionistischen Ansätzen zusammenzuhängen scheinen. Auf einen endgültigen Schiedsrichter in diesen Glaubensfragen wird man nicht hoffen dürfen. Könnten sich allerdings beide Kontrahenten darauf verständigen, den Voraussagegehalt der Theorien unter dem Aspekt erwünschter Wirkungen zum Kriterium zu erheben, so könnte man hinsichtlich der grundlegenden Glaubensüberzeugungen eine völlig liberale Haltung einnehmen. Das Kernproblem ist dann, intersubjektiv zugängliche, allgemein akzeptierte Tests zu konstituieren. Diese Tests bilden eine unabhängige Instanz, auf die sich jeder der Kontrahenten berufen kann, da eine Konvention, die Instanz zu akzeptieren existiert. Die Tests sind nicht geeignet, die Grundlagenfragen des wissenschaftstheoretischen Vorgehens zu klären. Sie geben uns keine Hinweise darauf, ob wir nicht möglicherweise auf dem Wege zum Mond nur irgendwelche Bäume ersteigen, die uns letztlich nicht weiterführen werden. Sie sollten deshalb auch keineswegs zum alleinigen Kriterium für wissenschaftliche Förderung und wissenschaftlichen Erfolg gemacht werden. Dennoch können sie wesentliche Hinweise und Hilfen für eine mittel-
Fortschritt in der Medizin
55
fristige bzw. kurzfristige Forschungspolitik und -Strategie bieten. Der Erfolg im Hinblick auf technische Verwertbarkeit ist jedenfalls ein wichtiges Kriterium. LohfT: Wenn man eine derartige liberale Einstellung vertritt, nach der die Konkurrenz um die bessere Voraussage bzw. die bessere technische Verwertbarkeit über Theorien entscheidet, dann geht man meines Erachtens völlig daran vorbei, daß die Wahrnehmung und das Sehen dessen, was man für gut und wissenschaftlich wertvoll erachtet, überhaupt nicht wertfrei definiert werden kann. Wenn man meint, Wissenschaftler untereinander wären in der Lage, fair zu entscheiden, welche Theorie oder welche Weltsicht von Wissenschaftlichkeit die wirklich zukunftsträchtige ist, dann entspricht das einer weltfremden, optimistischen Idealisierung von Wissenschaft, die einfach der Realität nicht entspricht. Kliemt: Mein Vorschlag ist tatsächlich ein partiell normativer. Ich erhebe nicht den Anspruch, die Welt, so wie sie ist, zu beschreiben, sondern möchte einen Vorschlag machen, wie man möglicherweise den Glaubenskrieg um Holismus und Reduktionismus in der Medizin umgehen bzw. entschärfen kann. Es scheint mir eine historisch gut belegbare Tatsache zu sein, daß die Wissenschaftsdynamik wesentlich davon abhängt, daß es gelungen ist, intersubjektiv zugängliche Entscheidungsinstanzen zu installieren, auf die sich einzelne Individuen gegenüber anderen berufen konnten und an denen sie ihre Kritik festmachen konnten. Ich betrachte im Augenblick nicht die Frage der Wahrheit, sondern ein institutionelles Phänomen im Bereich der Wissenschaftsorganisation. Welche Konvention es auch immer sein mag, die wir als Maßstab der Qualitätsbeurteilung von Theorien vereinbaren mögen, ihre bloße Existenz (als Konvention) verleiht der Konkurrenz unter Theorien, die sich nun alle an einem gemeinsamen Maßstab orientieren können, einen neuen Charakter. Jedes Individuum, jede einzelne wissenschaftliche Richtung kann sich auf diese Konvention, solange sie denn allgemein akzeptiert wird, individuell berufen. In der Konkurrenz unterschiedlicher Richtungen gibt es eine neutrale "Schiedsrichterinstanz" und damit ein Wissenschaftsdynamik ermöglichendes Selektionskriterium. Ob der nach diesem Kriterium beschrittene Evolutionspfad sub specie aeternitatis tatsächlich zielführend ist, läßt sich nicht sagen. Man kann jedoch feststellen, daß jedenfalls relativ zu der akzeptierten Kon-
56
Theoriestrukturen in der Medizin
vention ein geordneter Fortschritt aufgrund eines der Auseinandersetzung vorläufig durch Vereinbarung entzogenen Kriteriums möglich wird. Diederich: Zu derartigen Vorschlägen hat es Vorläufer gegeben. Paracelsus etwa hat seinen galenischen Gegnern vorgeschlagen, daß sie ebenso wie er - jeweils 50 Todkranke behandeln sollten, um zu sehen, wessen Sterbeziffern nach der Behandlung höher sind. Mir scheint, daß derartige Tests nur auf eine sehr oberflächliche Weise möglich sind. Vor allem zwei Aspekte dürften derartige Vergleiche und Tests grundsätzlich erschweren. Zum einen sind die Ansprüche konkurrierender Theorien häufig grundsätzlich verschieden. In der westlichen Tradition trennt man ziemlich deutlich zwischen Forschung und Praxis. Man hält Erklärungsansprüche und das Ziel der Heilung relativ genau auseinander. In anderen medizinischen Traditionen mag dies enger beieinander liegen. Diese würden gar nicht den Anspruch erheben, generelle Erklärung zu liefern, sondern zielen nur auf Heilung ab. Zum zweiten wird es häufig praktisch unmöglich sein, zu einer intersubjektiven Einmütigkeit über das anzulegende Kriterium zu gelangen. Ich habe eine Freundin, die psychosomatische Medizinerin und zugleich Internistin ist. Diese freut sich über jeden "klaren" internistischen Fall. Sie sagt, in solchen Fällen wisse sie, was sie zu tun habe, und dann gehe alles seinen Gang. Im allgemeinen ist die Sachlage jedoch weit komplexer. Betrachtet man etwa Fälle von Magengeschwüren, so muß man selbst dann, wenn man auf Heilen als Ziel abstellt, die Frage nach dem Erfolgskriterium immer noch beantworten. Worin besteht der Erfolg? Darin, daß das Magengeschwür verschwunden ist, oder darin, daß die betreffende Person ruhiger geworden ist? Ich denke, ein Akupunkteur würde das Behandlungsziel ganz anders beschreiben als etwa ein traditioneller Internist, und ich sehe wenig Chancen, hier zu einem intersubjektiv akzeptierten harten Kriterium zu kommen. Letztlich trifft man wiederum auf das grundsätzliche philosophische Problem des Vergleichs konzeptuell sehr verschiedener Systeme. Schaefer: Als Ärzte geben wir Zielsetzungen vor, die in einem bestimmten Referenzsystem erfüllt sein müssen. Die Einigung über diese Zielsetzungen bereitet Schwierigkeiten. Ist es die Beseitigung einer Verengung in einer Herzkranzschlagader oder ist es die Beseitigung des Brustschmerzes, oder ist es das Verlängern des Lebens, oder was sonst ist es? Jeder,
Fortschritt in der Medizin
57
der im medizinischen Beruf tätig ist, kann sein eigenes Wirken, sei es theoriegelenkt oder nicht, letztlich an das Referenzsystem seiner Wahl binden. Daraus ergeben sich meines Erachtens große prinzipielle Schwierigkeiten. Stöckler: Ein Beispiel dafür, daß zumindest gewisse Fähigkeiten zur Heilung verlorengehen können, mag eine Geschichte bilden, die meine Mutter mir erzählt hat. In ihrer Kindheit hat ein Onkel Warzen dadurch beseitigt, daß sie an einem bestimmten Tag bei Mondschein an einen bestimmten Baum in den Odenwald gegangen sind. Ich fürchte, meine Vorstellungen über kausale Auswirkungen von Mondlicht würden verhindern, daß Warzen weggehen. Ich muß zum Hautarzt. Dies ist zumindest teurer als das Verfahren, das da im Odenwald funktioniert hat. Fortschritte in der Erkenntnis und die Frage nach den Wirkmechanismen können hier dazu führen, daß bestimmte Heileffekte in der Medizin nicht mehr eintreten. Lohff: Tatsächlich ist mit der Erweiterung unseres Wissens auch ein Verlust eingetreten, weil die integrative Sicht, wie sie mit Herrn Stöcklers Warzen-Beispiel angesprochen wird, einfach in dieser Form des Erkenntnisfortschritts verlorengegangen ist. Ich halte es für ein grundsätzliches Problem anzugeben, was Wissensfortschritt eigentlich ist. Wenn ich mehr Funktionen, mehr Zusammenhänge beschreiben kann, ist das wirklich schon ein Fortschritt? Schaefer: Ich denke, daß es viele weniger exotische Beispiele gibt, die zeigen, daß Fortschritt Rückschritt gebracht hat. Man denke etwa an die Einführung der Antibiotika und deren Wirkung auf die Verbreitung von Pilzinfektionen. Es ist gar keine Frage, daß die Gefährdung durch Pilzinfektionen, die über die Haut, den Darm oder andere innere bzw. äußere Körperflächen Zustandekommen, aufgrund des weiten Gebrauches von Antibiotika in einem Ausmaß angestiegen ist, das man vorher nicht für möglich gehalten hat und nicht kannte. Hinzu kommen enorme Resistenzprobleme, die in der Behandlung von Infektionen und Infektionskrankheiten entstanden sind. Das führte und führt zur Entwicklung immer modernerer Antibiotika, die dann aber immer kürzer wirken, weil man
58
Theoriestrukturen in der Medizin
wiederum mit neuen Resistenzproblemen konfrontiert wird. Neben diesen eher praktischen Problemen, bei denen Fortschritt mit bestimmten Formen des Rückschritts verbunden zu sein scheint, gibt es auch Beispiele für Wissensverluste theoretischer Art. Wenn wir heute einen Studenten oder Jungassistenten der Medizin nehmen, der in der Kardiologie tätig ist, kann dieser das Herz nicht mehr so untersuchen, wie er es vor 30 oder 40 Jahren gekonnt hätte. Er lernt andere Dinge, die das damalige Wissen für ihn nicht parat machen. Auch seine Lehrer sind gar nicht mehr in der Lage, ihm das beizubringen, was früher gewußt wurde. Fortschritt kann hier dazu führen, daß neue Techniken, die invasiver und gefährlicher sind, benutzt werden, weil ein Wissen, das verfügbar war, nicht mehr genutzt wird. Diese Tatsache mag auf einem Wissensverlust oder nur auf einer Wissensvernachlässigung beruhen. Daß der sogenannte Fortschritt hier jedenfalls für die Behandlung bestimmter Arten von Fällen eher Rückschritt gebracht hat, scheint mir unabweisbar zu sein. Daniel Schaefer: Man darf hierbei auch die juristische Komponente, die im Alltagsleben der Mediziner eine zunehmende Rolle spielt, nicht vernachlässigen. Eigentlich kann es sich niemand mehr leisten, eine alte, gut funktionierende, aber letzten Endes auch nur etwas unterlegene Technik heute noch schulmedizinisch zu verbreiten und anzuwenden. Denkt man etwa an die Geburtsmedizin und an die Situation in den USA, so wird das Problem ganz offenkundig. Geht bei der Entbindung nur die kleinste Kleinigkeit schief, so steht sofort ein Dutzend Anwälte bereit, um Schadensersatzansprüche in Millionenhöhe geltend zu machen. Schließlich möchte niemand mehr wegen der hohen Versicherungssummen Geburtshelfer werden. Dabei ist andererseits klar, daß etwa der Geburtsmediziner vor 50 Jahren große Erfahrungen und Fähigkeiten gehabt hat, die der heutige Perinatalmediziner kaum noch besitzt. Bei einem Stromausfall in der Klinik würde sich das plastisch zeigen. Kliemt: Es stellt sich die Grundsatzfrage, ob die theoretischen Fortschrittskriterien von den praktischen getrennt werden können oder nicht. Ist es möglich, genau zu trennen zwischen einem rein nach wissenschaftstheoretischen oder wissenschaftsinternen Kriterien zu bewertenden Fortschritt und einem Fortschritt, der sich nach wissenschaftsexternen Kriterien bestimmt?
Fortschritt in der Medizin
59
Solbakk: Es scheint mir fragwürdig zu sein, Fortschritt in der Heilung und Fortschritt in der Beschreibung und der Erklärung zu differenzieren, um im Anschluß daran die erste Form des Fortschritts als gleichsam technische und die zweite als theoretische auszuweisen. Eine derartige Unterscheidung scheint zwar vielen unserer Diskussionen zugrundezuliegen. Es dürfte jedoch durchaus fragwürdig sein, einen Fortschritt im Heilen als atheoretisch anzusehen. Vos: So logisch der Unterschied zwischen Beschreibung und Heilung auch zu sein scheint, in der Medizin liegen die Dinge vielleicht etwas komplizierter. In der Medizin hat man es mit abweichenden Systemen zu tun, in denen die Abläufe nicht normal, sondern pathologisch sind. Es sind stets drei Faktoren im Spiel: Zum einen eine Beschreibung des normalen physiologischen Prozesses, zum zweiten eine Beschreibung des pathologischen Prozesses, schließlich der Versuch, die pathologischen Mechanismen zum Normalen zurückzuführen. Die Beschreibung von pathologischen Prozessen ebenso wie die Beschreibung der normalen Prozesse führt zu Einsichten, die das Eingreifen in das pathologische System ermöglichen. In diesem Sinne ist Fortschritt an den Heilungsaspekt geknüpft ebenso wie an den Fortschritt in der Beschreibung von Prozessen. Der analytische Unterschied zwischen den verschiedenen Faktoren kann zwar gemacht werden, dennoch besteht eine grundsätzliche Verknüpfung zwischen ihnen. Solbakk: Ich bin nicht ganz zufrieden mit dieser Unterscheidung zwischen Fortschritt im Heilen und Fortschritt in der Beschreibung bzw. technisch-praktischem und kognitivem Fortschritt. Man kann auch sagen, Fortschritte im Heilen seien auch kognitive Fortschritte. Vos: Ich meine, daß man einen Unterschied zwischen Beschreibung und, sagen wir mal, so etwas wie technischer Beherrschung machen kann. Was mich daran dennoch stört, ist zweierlei. Mit dem Konzept der Beschreibung kommt erstens zuviel von einer theorie-dominierten Wissenschaftstheorie ins Spiel. Man sollte vielleicht Fortschritt - und das nicht nur in der Medizin sondern auch Fortschritt in der Wissenschaft - nach verschiedenen Kompetenzen ausweisen. Darunter verstehe ich nicht nur eine Zustands-
60
Theoriestrukturen in der Medizin
Beschreibung, sondern auch die Kompetenz, Apparate und Meßmethoden zu entwickeln. Wenn das alles dem Konzept der technologischen Beherrschung zugeordnet wird, habe ich keine Einwände. Das Zweite ist, daß man dann, wenn man sagt, die heutige Medizin sei fortgeschritten, vielleicht einen historischen Fehler begeht, da man verschiedene, letztlich unvergleichbare Perioden in der Medizin miteinander vergleicht. Solbakk: Die Trennung zwischen praktischem Wissen und theoretischem Wissen im Bereich der allgemeinen Wissenschaftstheorie ist innerhalb der Medizin nicht notwendigerweise gerechtfertigt. In der Medizin hat man ein theoretisches Wissen, das teilweise Erkenntniswissen ist, teilweise operatives Wissen. Es ist, um es zu wiederholen, ein Faktum, daß Medizin als Wissenschaft gleichzeitig Episteme und Techne ist. Und das heißt, daß medizinische Techne oder Technologie nicht Praxis in der traditionellen Weise, sondern Theorie ist. Gleichzeitig Episteme und Techne zu sein, heißt, systematisch gesprochen, daß Medizin als Wissenschaft eigentlich der kleinere Teil ist. Strikt gesprochen könnte man deshalb also fragen, ist Anatomie eigentlich Medizin? Ist Normal-Physiologie eigentlich Medizin? Das, was Medizin als Wissenschaft charakterisiert, ist Medizin als klinische Forschung. Dieses Wissen in der klinischen Forschung besteht nicht nur aus Erkenntnis, um diagnostizieren zu können, Prognostik und Therapie durchzuführen, Prophylaktik zu etablieren, sondern es ist auch das Wissen über das, was passiert, wenn man eine therapeutische Intervention durchführt. Die Medizin als Wissenschaft besteht in einem beschränkten Teil in klinischer Forschung. Das medizinische Wissen ist gleichzeitig Episteme und Techne, also Erkenntniswissen und operatives Wissen und deswegen ist diese Trennung zwischen praktischem Wissen und theoretischem Wissen in der Medizin nicht notwendigerweise fruchtbar. Vollmer: Wenn man einmal versuchsweise die theoretischen medizinischen Fächer wie Anatomie, Physiologie, Biochemie des Menschen, Zytologie usw. in die Biologie hineinschöbe, was würde dann in der medizinischen Ausbildung und auch in der medizinischen Fakultät übrigbleiben? Ich glaube, darauf weisen Herr Vos und Herr Solbakk hin. Natürlich würden immer noch theoretische Fächer übrigbleiben, insbesondere die ganze Pathologie, denn über Krankheit lernt man in der Biologie ja nichts. Ich erkenne an, daß das in der Wissenschaftsheorie gar nicht be-
Fortschritt in der Medizin
61
rücksichtigt wird. Pathologien und die Disziplinen, die Pathologien behandeln, kommen in der üblichen Wissenschaftstheorie nicht vor, weil es Vergleichbares in der Physik nicht gibt. Da gibt es vielleicht so etwas wie eine Bruchlast, aber das ist auch schon alles. Und in der Biologie kommt derartiges eben auch nicht vor. Deppert: Herr Solbakk, Ihr Anliegen ist sehr hoch zu ehren, finde ich. Aber es gibt die Notwendigkeiten der Arbeitsteilung. In der Physik haben wir längst die theoretischen Physiker und die Experimentalphysiker, die Technik zählt man nicht direkt zur Physik, d. h., den Anwendungsbereich, der bei den Medizinern doch direkt zur Medizin hinzugerechnet wird. Das Problem, daß die Spezialisten, die aufgrund der Arbeitsteilung in Bezug auf das Gesamtobjekt der Erkenntnis nicht wieder zusammenfinden, daß das Ganze aus den Einzelerkenntnissen nicht wieder zusammengefügt werden kann, stellt sich überall. Sie scheinen zu fordern, daß der Arzt weniger spezialisiert vorgeht. Und ich glaube, das ist auch für den Patienten wahrscheinlich eine gute Sache. Dennoch aber wird es sicherlich in den Wissenschaften ohne Spezialisierung nicht abgehen. Solbakk: Meine Position war nur, wenn man versucht, die Medizin als Wissenschaft vom wissenschaftstheoretischen Bereich her zu analysieren, dann muß man, glaube ich, viel mehr berücksichtigen, daß Pathologie, Pathophysiologie usw. in charakteristischer Weise die fachspezifischen Domänen der Medizin sind. Das theoretische Wissen der Medizin ist zuerst und vor allem in diesen Fächern zu lokalisieren und dort wissenschaftstheoretisch zu analysieren. Kliemt: Die Frage ist natürlich, ob es sich hier um theoretisches Wissen eigener Art handelt. Lie: Wenn ein Arzt vor einem Patienten steht, dann braucht er das Wissen aus den biologischen Fächern, er braucht das Wissen von den pathologischen Fächern, er braucht das Wissen von den klinischen Studien, und er braucht auch die Erfahrungen, die er gemacht hat als praktischer Arzt. Alles das kommt irgendwie zusammen, wenn eine Entscheidung zu treffen ist, was in diesem Fall gemacht werden soll. Das ist ein praktisches Wis-
62
Theoriestrukturen in der Medizin
sen. Wir müssen verstehen, wie dieses Wissen in einer Art Synthese zusammenhängt. Nur dann wissen wir auch, was ein adäquates Wissen, was ein guter Arzt, was ein schlechter Arzt ist. Das sind sehr interessante Fragen, die wenig untersucht wurden. Es ist eine sehr wichtige Aufgabe, dieses praktische Können oder Wissen systematisch philosophisch zu untersuchen. Kliemt: Ich stimme Herrn Lie darin zu, daß hier eine überaus wichtige philosophische Aufgabe gestellt ist. Ich möchte jedoch auch betonen, daß Wissenschaftsfortschritt wesentlich darauf beruht, daß wir Wissen nicht nur durch den Mechanismus der Praxis oder durch Einübung in Praktiken tradieren, sondern durch Kodifizierungen in Büchern und ähnlichem. Der Wissenschaftsfortschritt, wie wir ihn beobachtet haben, beruht wesentlich darauf, daß wir die Traditionen des Wissens partiell entbunden haben von der Tradierung von bloßen Praktiken und Künsten. Nun scheint sich in der Medizin aber die SpezialSituation zu ergeben, daß sie sich als eine Wissenschaft versteht, die wesentlich immer auch Kunst im antiken philosophischen Sinn ist. Das kommt auch mit der von Herrn Solbakk betonten Verbindung von Techne und Episteme zum Ausdruck. Ich frage mich nur, ob es nicht möglicherweise doch so ist, daß der eigentliche Fortschritt in der Medizin als Wissenschaft darauf beruht, daß es uns gelungen ist, auch in der Medizin die "Kunsttradition" immer stärker von der Tradierung expliziten Wissens zu trennen. Es scheint zwar so zu sein, daß viele Mediziner tatsächlich sagen würden, es ist gar kein erstrebenswertes Ideal, das zu erlangen, was den Wissenschaftsfortschritt offenkundig in vielen anderen Disziplinen ermöglicht hat, nämlich die Trennung oder Entbindung von der Tradition durch bloße Weitergabe von Praktiken und impliziten Kenntnissen. Aber ist es wirklich sinnvoll, in der Medizin nicht nach diesem Ideal vorzugehen? Hucklenbroich: Ich denke, daß wir uns immer mehr der Frage nähern, was vielleicht die Wissenschaftstheoretiker und Mediziner voneinander lernen sollten und wie sie miteinander kooperieren könnten. Ich sehe die Notwendigkeit, den Zusammenhang von verschiedenen Wissensarten und Entscheidungsweisen, sowohl die medizinische Krankheitstheorie wie auch die medizinische Logik und Entscheidungstheorie erst einmal zu analysieren. Das ist ja noch gar nicht genügend gemacht worden und ich
Fortschritt in der Medizin
63
denke, das ist das, was die Theorie der Medizin und was die Wissenschaftstheorie und Praxistheorie der Medizin erst einmal zu tun hätte. Hier wäre ein Beitrag zu leisten. Vollmer: "Haustiere" einer Disziplin nenne ich jene Systeme, die man beherrschen muß, um die jeweilige Disziplin zu lernen. Etwas vornehmer könnte man auch von Prototypen sprechen. Natürlich gibt es auch Prototypen für die Wissenschaftstheorie. Der Prototyp der traditionellen Wissenschaftstheorie war und ist immer noch die Physik. Das merkt man ja auch an uns. Wenn nun aber die Konzentration auf die Physik nicht ausreicht, um auch die Fragen der praktischen Anwendung von Wissenschaft umfassend zu analysieren, dann könnte man einmal nach einem geeigneteren Prototyp für eine Wissenschaftstheorie des nächsten Jahrhunderts fragen. Vielleicht wäre die Medizin als ein solcher Prototyp besser geeignet. Zwar bliebe auch bei dieser Wahl die Trennung zwischen theoretischem Wissen und praktischem Handeln und Anwenden. Begriffliche Trennungen bleiben immer erhalten. Aber in der Medizin ist beides viel stärker miteinander verwoben als in anderen Bereichen. Auch das Problem des Handlungsdrucks oder des Entscheidens unter Unwissenheit, unter Risiko, stellt sich jeden Tag bei jedem Patienten. Ebenso stellt sich die ganze ethische Problematik. Was darf man, was darf man nicht? Das konnte man in der Physik so wunderbar abtrennen. Ja, ein Wissenschaftler konnte früher mit Stolz sagen: Ich kümmere mich gar nicht um die Anwendungen. Bis zur Atombombe oder jedenfalls bis zum Giftgas des ersten Weltkrieges war das eine respektable Position. Medizin dagegen ist immer schon angewandt. Angesichts der heutigen Probleme und der Forderungen, die wir heute an jeden Wissenschaftler stellen, sich nämlich über die Folgen seines Tuns ~ nicht nur seiner Ergebnisse, sondern auch seines Forschens ~ Gedanken zu machen, ist daher vielleicht die Medizin ein besonders geeigneter Prototyp für wissenschaftstheoretische und wissenschaftsethische Überlegungen.
64
Theoriestrukturen in der Medizin
Anmerkungen 1 Dazu: Stein, R., Der verständnisvolle Arzt als Ziel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. September 1989. 2 Zu diesen Argumenten vgl. Oppenheim, Ρ./ Putnam, Η., Einheit der Wissenschaft als Arbeitshypothese (engl. 1958), in: Krüger, L„ Erkenntnisprobleme der Naturwissenschaften. Kiepenheuer&Witsch, Köln 1970, S. 339-371, Abschnitt 6. Zum Evolutionsargument vgl. Vollmer, G., Was können wir wissen? Band 2: Die Erkenntnis der Natur. Hirzel, Stuttgart 1986, S. 185-9,225-8. 3 Hierzu vgl. meinen Beitrag "Das Ganze und seine Teile" zu diesem Band (S. 113152). 4 Frank, O., Thermodynamik des Muskels. Ergebnisse der Physiologie, (1904) 3, 2: S. 349-544, hierbei die Seiten 255-260. 5 Feyerabend, P., Wider den Methodenzwang. Skizze zu einer anarchistischen Erkenntnistheorie. Suhrkamp, Frankfurt a. Main, hier S.72.
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin: Themen und Probleme Peter Hucklenbroich
"Im allgemeinen ist das Interesse für theoretisch-philosophische Fragen unter den Medizinern nicht sehr groß; Philosophie wird nicht selten als unnütz und schädlich bezeichnet [...]; die eigenen philosophischtheoretischen Entwürfe stehen keineswegs immer auf der Höhe philosophischer Reflexionen der Zeit. Andererseits werden genuine Überlegungen in der Medizin vorgetragen, die in der Philosophie keine Aufnahme finden. Wissenschaftstheorie ist ein höchst heterogener Begriff; ganz unangemessen wird nicht selten unter Wissenschaftstheorie Physiktheorie verstanden. In der Forschung, Praxis und im Unterricht hat Medizintheorie in der Gegenwart kein großes Gewicht." von Engelhardt/Schipperges 19801
1. Vorbemerkung: Eine Rolle für die Medizintheorie Obwohl den eingangs zitierten skeptischen Einschätzungen auch heute noch weitgehend zugestimmt werden muß, sollte dennoch nicht übersehen werden, daß es eine Tradition medizintheoretischen Denkens gibt, die bis zur hippokratischen Medizin zurückreicht. Überwiegend sind es Ärzte häufig philosophisch oder historisch gebildete - , die über die Grundlagen ihrer Tätigkeit reflektieren und sie in ein System zu bringen suchen. Fach-
66
Peter Hucklenbroich
philosophen haben sich dagegen selten, Fach-Wissenschaftstheoretiker nur ganz ausnahmsweise mit wissenschaftstheoretischen Aspekten der Medizin befaßt. Bemühungen dieser Art werden selten als "Wissenschaftstheorie" (der Medizin), sondern eher als "Logik der Medizin", als "medizinische Erkenntnistheorie", "Theorie der Medizin", "Medizintheorie" oder "Theoretische Medizin" bezeichnet; auch Bezeichnungen wie "Iatrologie" und "Praxiologie der Medizin" finden sich. Für das 20. Jahrhundert seien stellvertretend nur die Namen W. Bieganski, A. Bier, Richard Koch, E. Liek, L. Fleck, K. E. Rothschuh, A. Feinstein, R. Gross, E. D. Pellegrino, Κ. Sadegh-zadeh als die von medizintheoretisch hervorgetretenen Ärzten genannt2; als Wissenschaftstheoretiker haben in neuerer Zeit u. a. A. Diemer, H. Westmeyer, W. Wieland und K. F. Schaffner substantielle Beiträge zur Medizintheorie vorgelegt.3 Trotz dieser vorliegenden Arbeiten und trotz des in den letzten 10 bis 15 Jahren deutlich zunehmenden Interesses an medizintheoretischen Fragen, das sich ζ. B. in der Etablierung von Fachzeitschriften und Buchreihen und in der Gründung von Abteilungen und Gesellschaften zeigt4, existiert bislang keine umfassende systematische und aktuelle Darstellung der Medizintheorie. Die philosophische Wissenschaftstheorie hat sich, von den oben genannten Ausnahmen abgesehen, noch nicht näher mit der Medizin befaßt; umgekehrt fehlt den aus der Medizin stammenden Beiträgen meist der Bezug auf die Diskussionslage der philosophischen Wissenschaftstheorie. Im angloamerikanischen Bereich werden medizintheoretische Forschungen dominiert durch die Perspektive der Bioethik, die dort inzwischen institutionell fest verankert ist; daraus ergibt sich ein Interesse, das primär auf Anwendungsfragen von Ethik ("applied ethics"), weniger auf Wissenschaftstheorie und die Diskussion von Grundkonzepten gerichtet ist5. Ich will im folgenden skizzieren, welche Probleme im Rahmen einer Wissenschaftstheorie der Medizin gegenwärtig zu diskutieren wären und mit welchen methodischen Ansätzen sie angegangen werden können; darüber hinaus werde ich in exemplarischer Weise einige Forschungshypothesen in diesem Bereich diskutieren. Vollständigkeit oder abschließende Resultate können zum gegenwärtigen Zeitpunkt und im Rahmen dieses Artikels allerdings nicht erwartet werden6. Die philosophische Wissenschaftstheorie zeigt heute das Bild einer autonomen, weitgehend durch interne Probleme und Theorien in ihrer
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin
67
Entwicklung gesteuerten Disziplin. Diskussionen entzünden sich an den Differenzen zwischen verschiedenen theoretischen Ansätzen und an den offenen Problemen innerhalb der Ansätze. Beispiele für ersteres sind die Diskussion um die Adäquatheit logisch rekonstruierender Ansätze angesichts wissenschaftshistorischer und wissenschaftssoziologischer Befunde 7 , um die Korrektheit und Möglichkeit der apriorischen meßtheoretischen Fundierung physikalischer Disziplinen durch "Proto-Physiken"8 oder um die Möglichkeit, alternative theoretische Begrifflichkeiten miteinander zu vergleichen9. Beispiele für letzteres sind die nach wie vor nicht befriedigend gelösten Probleme des Kriteriums für die "Gesetzesartigkeit" von Aussagen in der analytischen Wissenschaftstheorie10, der Begründung für normative Folgerungen aus wissenschaftstheoretischen Bewertungen im Kritischen Rationalismus11 oder der adäquaten Fassung des Theoretizitätsbegriffs im (Neo-) Strukturalismus12. Entsprechend dieser theorieund problemgesteuerten Diskussionsweise, werden Theorien und Wissensbestände konkreter Einzeldisziplinen primär als Belege oder Widerlegungen diskutierter wissenschaftstheoretischer Auffassungen rekonstruiert, kaum dagegen im Interesse einer vollständigen systematischen Rekonstruktion eines Gebiets oder im Interesse der Aufklärung von fachintern wahrgenommenen Problemen. Diese Vorgehensweise, die den unbestreitbaren Vorteil der Fruchtbarkeit für die interne Entwicklung der philosophischen Wissenschaftstheorie gehabt hat, führt andererseits zu Nachteilen beim Versuch der Anwendung des so Erarbeiteten außerhalb der verwendeten Beispiele. Es zeigt sich nämlich typischerweise, daß die Anwendungsbereiche eine Eigenstruktur mitbringen, die über die allgemeinen wissenschaftstheoretischen Schemata hinausgeht, ohne vernachlässigbar zu sein, und daß sich viele für das jeweilige Gebiet interessanten Fragen erst unter Berücksichtigung dieser Eigenstruktur überhaupt stellen lassen. Wenn dies so ist - und ich werde für den Bereich der Medizin im folgenden Belege dafür bringen -, dann spricht es dafür, die allgemeine Wissenschaftstheorie um spezielle Wissenschaftstheorien einzelner Disziplinen zu ergänzen, die die jeweilige fachspezifische Eigenstruktur berücksichtigen, ja überhaupt erst einmal aufklären. Im Fall der Medizin ließe sich dann zwanglos die oben angeführte Tradition einer "Logik bzw. Theorie der Medizin" mit dieser speziellen Wissenschaftstheorie der Medizin identifizieren. Dies ergäbe zugleich eine Perspektive, unter der die bislang unverbundenen Traditionsstränge (der philosophischen Wissenschafts-
68
Peter Hucklenbroich
theorie und der Medizintheorie) vereinigt und füreinander fruchtbar gemacht werden könnten. Die folgenden Überlegungen sollten als Versuch, in diese Richtung zu gehen, verstanden werden.
2. Probleme der Medizintheorie Man kann die Medizin einigermaßen zutreffend als Wissenschaft vom menschlichen Organismus als einer bio-psycho-sozialen Einheit, seinen Krankheiten und deren Erkennung und Behandlung kennzeichnen. Aus dieser Kennzeichnung ergibt sich, welches die Grundkonzepte der Medizin sind, nämlich die des Organismus, des somatischen, psycho-somatischen und sozio-(psycho-)somatischen Zusammenhangs, der Krankheit, der Diagnose und Diagnostik, Prognose und Prognostik und der Behandlung und Therapeutik im weitesten Sinne (Diätetik, Therapie, Prävention, Rehabilitation). Alle genannten Grundbegriffe beinhalten zugleich typische medizintheoretische Probleme, die ihre genaue Bedeutung und Abgrenzung, ihre theoretischen und praktischen Implikationen und ihre korrekte Formulierung und Rekonstruktion betreffen. Eine Klärung dieser medizintheoretischen Problematik ist gleichbedeutend mit der Klarlegung der spezifischen Wissenschaftsstruktur der Medizin, ihrer oben sogenannten "Eigenstruktur". Damit ergeben sich die Hauptgebiete der Medizintheorie. Ich werde im folgenden exemplarisch einige Probleme der Organismustheorie und der Theorie des ärztlichen Procedere (Diagnostik, Therapeutik) skizzieren. 2.1. Die Theorie des Organismus Bereits die Verwendung des Terminus "Organismus" für den medizinisch untersuchten Menschen - wie auch überhaupt für biowissenschaftlich betrachtete Lebewesen - impliziert eine bestimmte Sichtweise oder "Theorie", nämlich dadurch, daß der zu erforschende Gegenstand überhaupt als eine "Einheit" oder ein "Ganzes" angesehen wird, unabhängig von seiner Zerlegbarkeit in Teile, Komponenten oder Subsysteme, und daß diese Einheit als eine organische13 aufgefaßt wird. Die genauere Fassung dessen, was unter einer "organischen" Einheit zu verstehen ist, ist dagegen bereits ein Problem, das durchaus unterschiedlich beantwortet wird 4. Es bestehen Beziehungen zu anderen philosophischen Problematiken wie der
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin
69
des Lebensbegriffs, des Evolutionsbegriffs, der Teleologie, des Identitätsbegriffs und des Systembegriffs15. Ein relativ konstant anzutreffendes Merkmal in Definitionen des "organischen" bzw. "organismischen" Charakters ist die "selbstorganisierende", "selbsterhaltende" und/oder "selbstproduzierende" Struktur bzw. Organisation von Organismen, die als ein wechselseitiges Hervorbringen der Teile (Organe) des Organismus durcheinander gefaßt wird. So heißt es bei Kant in der "Kritik der Urteilskraft" von 1790: "In einem solchen Produkte der Natur wird ein jeder Teil, so, wie er nur durch alle übrigen da ist, auch als um der andern und des Ganzen willen existierend, d.i. als Werkzeug (Organ) gedacht [...] als ein die andern Teile (folglich jeder den andern wechselseitig) hervorbringendes Organ [...]"(Kant, 1790 [1969], S.485). Schelling schreibt im "System des transzendentalen Idealismus" von 1800, diesem seinem wohl bedeutendsten Werk: "Der Grundcharakter der Organisation ist, daß sie aus dem Mechanismus gleichsam hinweggenommen, nicht nur als Ursache, oder Wirkung, sondern, weil sie beides zugleich von sich selbst ist, durch sich selbst besteht. [...] Der Grundcharakter der Organisation ist also, daß sie mit sich selbst in Wechselwirkung, Produzierendes und Produkt zugleich sei, welcher Begriff Prinzip aller organischen Naturlehre ist ..."(Schelling, 1800 [1979], S. 151f.). In Hegels eigentümlicher Konzeption und Diktion schließlich, wie sie in der "Wissenschaft der Logik" von 1816 vorliegt, läßt sich immer noch derselbe Grundgedanke wiederfinden: "[...] Diese Objektivität des Lebendigen ist Organismus; sie ist das Mittel und Werkzeug des Zwecks, vollkommen zweckmäßig, da der Begriff ihre Substanz ausmacht; aber eben deswegen ist dies Mittel und Werkzeug selbst der ausgeführte Zweck, in welchem der subjektive Zweck insofern unmittelbar mit sich selbst zusammengeschlossen ist. Nach der Äußerlichkeit des Organismus ist er ein Vielfaches nicht von Teilen, sondern von Gliedern...; indem dieser Unterschied unmittelbar ist, ist er Trieb jedes einzelnen, spezifischen Moments, sich zu produzieren und ebenso seine Besonderheit zur
70
Peter Hucklenbroich
Allgemeinheit zu erheben, die anderen ihm äußerlichen aufzuheben, sich auf ihre Kosten hervorzubringen, aber ebensosehr sich selbst aufzuheben und sich zum Mittel für die anderen zu machen. [...] Der Begriff produziert also durch seinen Trieb sich so, daß das Produkt, indem er dessen Wesen ist, selbst das Produzierende ist, daß es nämlich Produkt nur als die sich ebenso negativ setzende Äußerlichkeit oder als der Prozeß des Produzierens ist."(Hegel, 1816 [1969] S.476). Die hier gegebenen Zitate sollten trotz der Verwandtschaft der in ihnen ausgedrückten Grundvorstellung natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, daß letztere in erheblich unterschiedliche philosophische Gesamtkonzeptionen eingebettet ist. Aber offenbar läßt sich die Vorstellung weitgehend unabhängig vom spezifischen philosophischen Kontext aufrechterhalten und in eine erfahrungswissenschaftlich aufgefaßte Biologie übernehmen; man vergleiche dazu eine moderne Formulierung^ die sich bei Maturana, in seiner Theorie "autopoietischer" Systeme, findet : "Diese zirkuläre Organisation stellt ein homöostatisches System dar, dessen Funktion darin besteht, eben diese zirkuläre Organisation selbst zu erzeugen und zu erhalten. Dies geschieht dadurch, daß das System genau jene Bestandteile determiniert, die die zirkuläre Organisation spezifizieren und die ihrerseits wiederum durch die zirkuläre Organisation synthetisiert oder erhalten werden."(Maturana, 1982, S.35). Während also dieser Grundgedanke zur Charakterisierung von Organismen als weitgehend geläufig betrachtet werden kann, ergeben sich wissenschaftstheoretische Probleme bei den Details einer solchen Auffassung und beim Versuch ihrer Konkretisierung. Einige davon seien im folgenden exemplarisch skizziert Wir betrachten dazu zunächst nur die Anwendung der genannten Auffassung auf einzellige Lebewesen, da sich bereits in diesem einfachsten Falle die typischen Probleme zeigen lassen. Nach heutigem Wissensstand bestehen einzellige Lebewesen in chemischer Hinsicht aus einer großen Anzahl von Molekülen und Ionen verschiedener Sorten. Unter ihnen sind insbesondere bestimmte Kat- und Anionen wie Natrium-, Kalium-, Calcium- und Magnesiumionen, Chlorid-, Hydrogencarbonat- und Sulfationen; bestimmte kleinere organische Moleküle wie
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin
71
Aminosäuren, Zucker, Lipide, Carbonsäuren usw.; und schließlich organische Makromoleküle wie Polysaccharide, Proteine und Nucleinsäuren. Diese Moleküle sind in einer Zelle in unterschiedlichen Konzentrationen miteinander und mit einer wässrigen Phase vermischt und räumlich verteilt; sie bilden dabei sol- und gelartige Dispersionszustände, aber auch hochstrukturierte Formen wie Membranen, Häute, Filamente und Mikrokristalle aus. In chemisch-thermodynamischer Hinsicht befindet sich dieses Gemisch nicht im Zustand des Gleichgewichts, sondern ist ziemlich weit davon entfernt, da die Moleküle im Vergleich zur Umgebung eine teilweise recht hohe Bindungsenergie beinhalten und hohe Konzentrationsgradienten sowohl innerhalb der Zelle als auch zwischen Zelle und Umgebung bestehen. Es finden dementsprechend in der Tat permanent Prozesse der Molekülund Ionenwanderung sowie chemische Reaktionen statt. Während jedoch im "Normalfall" ein Gemisch dieser Art in einer typischen Umgebung, z.B. in Meerwasser, Nährböden oder an feuchten Grenzflächen, in kürzester Zeit durch Zerfalls- und Verdünnungsprozesse in den thermodynamischen Gleichgewichtszustand übergeht, ist das besondere an lebenden Zellen bzw. Einzellern, daß sie in solchen Umgebungen über recht lange Zeit oder sogar unbegrenzt "überleben", d.h. die Konzentrationsunterschiede innerhalb und zur Umgebung und den durchschnittlichen Energieinhalt ihrer Moleküle und insofern ihren Abstand vom Gleichgewicht aufrechterhalten. Diese Fähigkeit von Zellen wird nach der zur Diskussion stehenden Auffassung auf ihre spezifische "organismische" Eigenschaft, ihre Organisation, zurückgeführt: Die Komponenten einer Zelle - letztlich also die Moleküle und Ionen - seien in so spezifischer Weise räumlich angeordnet und in ihren chemischen Reaktionen miteinander verkettet, daß ein zyklisches oder zirkuläres Produktionsmuster resultiere. Das bedeutet in dieser Auffassung, daß zwar einerseits ständig Zerfall, Zerlegungen oder Umwandlungen von Molekülen geschehen, diese abbauenden (katabolen) Prozesse aber durch inverse aufbauende (anabole) Prozesse der Synthese und Umwandlung ständig kompensiert werden. Zirkulär ist dieser Zusammenhang insofern, als man von einem beliebigen Molekül ausgehen kann und bei Verfolgung der Stoffwechselwege, in die es einbezogen ist und die von ihm ausgehen, irgendwann immer an eine Stelle kommt, an der ein Molekül derselben Art im Prozeß produziert, synthetisiert wird17.
72
Peter Hucklenbroich
Versucht man diese Vorstellung präzise zu fassen, so lassen sich verschiedene Stufen der Explikation angeben. Die Anfangsstufe bestünde darin, daß man die Gesamtheit der Moleküle einer Zelle (Menge Z) aufteilt in die Menge der Anfangs- und Endprodukte (Menge A) und die Menge der intermediären Produkte des Stoffwechsels (Menge I) und für letztere die Bedingung formuliert, daß jedes ihrer Elemente (1) nur aus anderen Elementen der Zelle - also der Menge Z=A+I18 - hervorgeht, (2) nur in Elemente von Ζ umgewandelt wird. Für die Anfangs- und Endprodukte wird dies nicht gefordert, da sie aus der Umgebung stammen bzw. in sie abgegeben werden. Dies ist als Explikation insofern noch zu schwach, als die gegebene Bedingung auch einen einfachen kettenförmigen Zerfallsoder Umwandlungsprozeß (Al —» II —»12—»13—»El) abdecken würde, bei dem keinerlei Zyklizität auftritt. Man könnte daher als zweite Bedingung explizit die Zyklizität fordern, indem man ζ. B. die Bedingung formuliert, daß zu je zwei Elementóle« von I, also zu jedem Paar von Molekül- oder Komponentensorre« Ia und Ib, zwei Stoffwechselwege existieren, so daß auf dem ersten Weg Instanzen von Ia (Moleküle) an der Hervorbringung von Instanzen von Ib beteiligt sind, auf dem zweiten Weg das Umgekehrte gilt. Ein "Stoffwechselweg" ist dabei aufgefaßt als ein in der Zelle möglicher Prozeß aus verketteten "direkten Hervorbringungsrelationen", also aus chemischen Reaktionen und eventuell Transportprozessen19. Diese Forderung impliziert insbesondere, daß Moleküle jeder Komponentensorte an der Hervorbringung von Instanzen ihrer eigenen Sorte beteiligt sind, also eine selbstreferentielle Struktur besteht. Diese zweite angeführte Bedingung, die man nach dem Gesagten als Zyklizitäts- oder Selbstreferenzbedingung bezeichnen kann, stellt eine recht starke strukturelle Annahme über die Prozesse in einer Zelle dar. Dennoch muß man nach dem gegenwärtigen Wissensstand annehmen, daß diese Bedingung tatsächlich erfüllt ist. Dies gilt sogar für das Material der Erbsubstanz, also für die Moleküle der DNS in einer Zelle, wenn man bereit ist, die chemischen Prozesse zur Stabilisierung und Reparatur dieses genetischen Materials als Beitrag zu seiner "Hervorbringung" zu betrachten; andernfalls würden diese Moleküle allerdings eine Ausnahmestellung einnehmen, da ihre "Hervorbringung" dann im wesentlichen mit der Zellentstehung (durch Teilung o. ä.) als abgeschlossen zu betrachten wäre. Dies setzt das betrachtete Modell aber nicht außer Kraft, da man die DNS dann als Teil der "Anfangsprodukte", analog zu aus der Umgebung aufgenommenem Material, betrachten könnte20.
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin
73
Was leistet eine solchermaßen explizierte Organismusvorstellung? Wir untersuchen exemplarisch folgende Fragen: (1) Kann das am Beispiel der Zelle formulierte Explikat auch auf "höhere" Organismen übertragen werden? (2) Stellt die Organismusvorstellung ein Identitätskriterium oder ein Individuierungsprinzip für lebende Wesen zur Verfügung? (3) In welchem Sinne kann von einer Autonomie des Organismus gegenüber der Umwelt gesprochen werden? 2.1.1. Höhere Organismen Bei der Betrachtung der Einzeller im vorigen Abschnitt haben wir stillschweigend unterstellt, daß mit der Berücksichtigung von Molekülen und deren physikalischen und chemischen Interaktionen alle relevanten Typen von Komponenten und Prozessen dieses Organismustyps erfaßt seien. Dies erweist sich bei näherer Betrachtung aber schon hier als Übervereinfachung: Vorgänge wie die Bildung eines Proteins über die Prozesse der Transkription und Translation oder die Atmungskette in den Mitochondrien21, an denen viele Makromoleküle mit hochspezifischer Form und in hochspezifischen räumlichen Anordnungen beteiligt sein müssen, setzen sich zwar nach wie vor aus physikalischen und chemischen Elementarprozessen zusammen, realisieren aber zugleich "höhere", d.h. komplexere Struktur- und Prozeßformen, die als Ultrastrukturen oder Organelle und als ultrastrukturelle Prozesse der Zelle bezeichnet werden. In der Beschreibung des Zellmetabolismus können daher neben den physikalischchemischen Elementarprozessen auch diese höheren Einheiten als Komponenten und Prozesse verwendet werden, was aus Gründen der Beschreibungsökonomie übrigens ohnehin kaum umgangen werden kann. Eine geeignete ultrastrukturelle Beschreibung der Zelle vorausgesetzt, muß sich die zyklische organismische Struktur auch unter Einschluß dieser Beschreibungsebene formulieren lassen. (Aus diesem Grunde war im vorigen Abschnitt schon verschiedentlich von Komponenten statt von Molekülen gesprochen worden.) So ist ein Ribosom beispielsweise, das aus bestimmten Proteinkomponenten besteht, ebenso ein Produkt des Stoffwechsels, wie es selbst an der Produktion von Proteinen maßgeblich beteiligt ist. Als komplexeste Form ergibt sich bei dieser Betrachtungsweise der Einzellerorganismus selbst, als das Korrelat des gesamten stattfindenden (physikalisch-chemischen und ultrastrukturellen) Prozesses; er ist buchstäblich dieses dynamische, "organismische" Prozessieren, auf-
74
Peter Hucklenbroich
gefaßt als eine Einheit, ein Prozessor. Da er neben der Nahrungsaufnahme und Abfallabgabe nur seine eigenen Komponenten "verarbeitet", prozessiert, kann man ein solches System oder Wesen als einen umweltvermittelten Selbstprozessor bezeichnen22. Um diese Explikation des Organismusbegriffs auf "höhere", vielzellige Lebewesen anwenden zu können, wird vorausgesetzt, daß sich die Zellen des Vielzellers wiederum als Komponenten eines höher integrierten organismischen Systems verstehen lassen. Dies ist kein prinzipiell anderer Schritt als der, neben Molekülen auch Ultrastrukturen als Zellkomponenten zuzulassen, und bietet daher keine grundsätzlichen Schwierigkeiten. Es stellt sich aber bei höheren Lebewesen die interessante Frage, ob die makroskopisch-anatomisch unterscheidbaren Organe, wie Herz, Leber, Niere, Darm, aber auch Funktionssysteme wie Kreislaufapparat, Atmungsapparat, Bewegungsapparat usw. im Sinne unserer Explikation des Organismusbegriffs wirklich "Organe"23, nämlich Komponenten des organismischen Prozesses sind. Dazu müßte gezeigt werden, daß bzw. in welchem Sinne sie sich "wechselseitig hervorbringen". Um dies zu zeigen, müßte eine Beschreibung des gesamten vielzelligen Organismus gegeben werden, die alle am Prozeß beteiligten Komponenten und unter ihnen insbesondere diese Organe und Funktionssysteme identifiziert und das gesamte Netzwerk der Hervorbringungs-, Erhaltungs-, Bewegungs- und Verwandlungsprozesse zwischen ihnen darstellt. Wenn man nun berücksichtigt, daß zu solchen Interaktionen im Falle der makroskopischen Organe und Systeme nicht nur makroskopische Prozesse gehören, sondern daß die Interaktion über die tieferen Ebenen des Gesamtsystems bis hinunter zur Molekülebene indirekt vermittelt sein kann, so steht schon nach heutigem Wissen nichts einer Einbeziehung der makroskopischen Organe und Systeme in die skizzierte Organismusauffassung entgegen. Beispielsweise ist die Funktion des Magen-Darm-Traktes dann so zu beschreiben, daß er durch mechanische und chemische Aufbereitung der aufgenommenen Nahrungsstoffe Moleküle verfügbar macht, die von den Zellen aller Organe - einschließlich seiner eigenen - als "Anfangsprodukte" (der intrazellulären Stoffwechselstrecke) benötigt werden, um die eigene Substanz aufbauen und erhalten zu können. Kann auch die psychische Funktion in diese Organismuskonzeption einbezogen werden? Diese Frage führt unweigerlich auf das Leib-Seele-Problem bzw. die Grundlagenproblematik der Psychosomatik. Mit ziemlicher Sicherheit läßt sich sagen, daß nur monistische Auffassungen in dieser
Wissenschafttheorie als Theorie der Medizin
75
Frage mit dem Organismuskonzept des Selbstprozessors voll vereinbar sind, da jeder (ontologische, nicht methodische) Dualismus als solcher die Einheit des Organismusprozesses in irgendeiner Weise bestreiten muß. In einer monistischen Konzeption wäre dagegen zu zeigen, (1) daß die Psyche ohne theoretischen Bruch als Teil bzw. Komponente des Organismus aufgefaßt werden kann, die mit den anderen Komponenten in Wechselwirkung steht; (2) in welcher Weise sie in den zyklischen Organismusprozeß einbezogen ist, produziert wird und selber zur Produktion beiträgt. Einer der plausibelsten Ansätze zur zweiten Frage stammt aus der Umweltlehre des Biologen Jakob v. Uexküll, die von seinem Sohn Thure v. Uexküll in die Grundlage einer psychosomatischen Medizin weitergebildet wurde24. Die Psyche von Tieren und Menschen ist danach als ihr "Umweltorgan" aufzufassen, insofern sie eine subjektive Umwelt eines Individuums darstellt; als Rahmen für Wahrnehmung und Selbstbewegung erschließt sie sowohl die Umgebung des Organismus als auch sein eigenes "Inneres" zu einem bestimmten Teil für ihn selbst, macht ihn zu einem empfindungs- und reaktionsfähigen Wesen. Man kann hier von einer Anpassung oder besser Einpassung von Organismen in ihre (äußere und innere) Umgebung durch ihre subjektive Umwelt, ihr Psychoorgan, sprechen 25 . Insofern dadurch praktisch der gesamte Produktions- und Reproduktionsprozeß des Organismus tangiert ist, ist die Zyklizitätsbedingung mit Sicherheit erfüllt. Die erstgenannte Frage, nämlich wie die Einbeziehung der Psyche als Komponente des Organismus begrifflich und theoretisch zu fassen ist, stellt das philosophisch-wissenschaftstheoretische Leib-Seele-Problem im engeren Sinne dar. Als solches findet es gegenwärtig starke Beachtung und Diskussion, insbesondere auch unter dem Eindruck der Forschungen zur Künstlichen Intelligenz und Kognitionswissenschaft. Da eine kurze Abhandlung dieser komplexen Problematik nicht sinnvoll erscheint, sei hier nur global auf diesen Diskussionsbereich hingewiesen26. 2.1.2. Identität und Individuierung Als weiteres Beispiel für wissenschafts- und medizintheoretische Probleme im Zusammenhang mit dem Organismusbegriff sei die Frage nach Kriterien für Identität und Individualität eines Organismus angeführt. Bietet eine Definition des Organismus im Sinne des vorhergehenden Abschnitts zugleich ein Kriterium zur eindeutigen Abgrenzung von
76
Peter Hucklenbroich
Organismen voneinander und von der Umwelt? H. R. Maturana, dessen Version der Organismusdefinition als "autopoietisches" System oben bereits zitiert wurde, unterstellt beispielsweise, daß dies der Fall sei. Nach seiner Formulierung produziert ein autopoietisches System, also ein Organismus, im Zuge seines Prozessierens zugleich seine räumliche Begrenzung und konstituiert sich erst dadurch endgültig als Einheit. Aus den von Maturana gegebenen Formulierungen und Beispielen27 geht hervor, daß er dabei im wesentlichen an die Produktion der Zellmembran denkt, die natürlich eine notwendige Komponente zellulärer Organismen ein Organeil - ist. Als identitäts- oder individualitätskonstituierendes Merkmal taugt die Membranbildung jedoch nicht, da erstens bei Ein- und Mehrzellern auch intrazellulär reichlich Membranen und membranartige Strukturen existieren - sowohl offene als auch geschlossene, wie Kernoder Lysosomenmembranen - , zweitens in mehrzelligen Organismen ohnehin zusätzliche Kriterien erforderlich wären, um sie z. B. von einer Zellkolonie zu unterscheiden. Ebenso taugt das von Maturana erwogene Kriterium der Ununterbrochenheit des autopoietischen Prozesses nicht als Identitätskriterium. Das einfachste Gegenbeispiel dazu ist die Fortpflanzung durch Zellteilung, bei der auch nach Maturanas Auffassung zwei neue, nicht mit der Stammzelle identische Individuen entstehen. Aber ein viel schlagenderes Gegenbeispiel stellt die Transplantation von Organen dar: Um beispielsweise eine Niere transplantieren zu können, muß diese ununterbrochen am Leben gehalten werden. Sie müßte demnach ihre Identität auch nach erfolgreicher Implantation behalten, wodurch ein Identitätskonflikt im transplantierten Patienten entstünde. Nun stellt zwar die immunologische Transplantatabstoßung, die im Regelfall medikamentös unterdrückt werden muß, in der Tat eine Art Konflikt im Organismus dar, bei der so etwas wie die "immunologische Identität" eine Rolle spielt; aber erstens ist die immunologische Identität zu unterscheiden von der Identität, wie sie Maturana definieren würde, und zweitens erschiene es uns als absurd, die Identität eines Menschen primär von der Herkunft oder immunologischen Beschaffenheit seiner Organe abhängig zu machen. Diese Widersprüche könnten vielleicht zu einer erneuten Untersuchung der Konzepte von Identität und Individualität und ihrer Beziehung zur Organismustheorie führen. Die Definition von Organismen als Selbstprozessoren scheint für sich allein noch nicht ausreichend zu dieser Klärung zu sein.
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin
77
2.1.3. Autonomie und S erniose
Ein weiteres Problem der Organismustheorie ergibt sich aus der Frage, inwieweit man Organismen als autonom gegenüber ihrer Umgebung betrachten kann, insbesondere ob sie hinsichtlich kausaler Relationen irgendeinen Sonderstatus einnehmen. Sowohl Maturana als auch v. Uexküll gehen von einem solchen Sonderstatus aus, wenn auch in verschiedener Weise. Maturana legt besonderen Wert auf die Feststellung, daß Organismen (autopoietische Systeme) von ihrer Umgebung nicht "determiniert" werden könnten und daß es keinerlei "instruktive" Wechselwirkung zwischen Umgebung und System geben könne, sondern daß sie durch die Umgebung lediglich in ihrer Eigendetermination "moduliert" oder "perturbiert" werden könnten; er nennt sie aus diesem Grunde auch "zustandsdeterminiert" oder "strukturdeterminiert". Es ist daher nach Maturana nicht möglich, einen Organismus von außen zielgerichtet zu beeinflussen oder zu steuern. Er geht so weit zu behaupten, daß schon die Vorstellung, ein autopoietisches System habe einen In- und Output, unzutreffend sei: "Lebende Systeme haben in bezug auf ihre funktionale Organisation weder Input noch Output, obwohl sie bei Störungen ihre eingestellten Zustände konstant halten. [...] Wenn wir für unsere Analyse der Organisation des Lebendigen einen solchen deskriptiven Standpunkt einnehmen, passen wir unser Verständnis dieser Organisation unwillkürlich Vorstellungen an, die nur flir vom Menschen erzeugte (fremdreferentielle) Systeme Gültigkeit haben."(Maturana, 1982, S.74f.). 28 Mit dieser Auffassung weicht Maturana aber von einer erfahrungswissenschaftlich nachvollziehbaren Analyse der Funktion von Organismen ab. In chemischer und biologischer Betrachtung existieren erstens sowohl "Randkomponenten" des organismischen Netzwerks, die als Input- und Outputelemente aufzufassen sind, z. B. die aufgenommenen und ausgeschiedenen Moleküle, und es ist zweitens möglich, den Organismus von "außen" zielgerichtet zu beeinflussen, wenn man dabei seine innere Strukturdynamik berücksichtigt. Letzteres setzt zwar eine genaue Kenntnis der Mechanismen innerhalb des Organismus voraus, ist aber offensichtlich möglich29. In diesem Zusammenhang ist es weiterhin gerade sinnvoll, Organismen als Input-Output-Systeme zu konzeptualisieren, die global durch eine zweistellige Funktion (oder vierstellige Relation) f(i,z, )=(z 9 ,o)
78
Peter Hucklenbroich
charakterisiert werden können, die also Paare aus Input- und Zustandselementen in Paare aus Zustands- und Outputelementen abbildet. In kausalanalytischer Betrachtung stellen dabei sowohl Input als auch jeweiliger Systemzustand (z^) Ursachen für Output und Folgezustand (z~) dar. Dies läßt sich präzisieren unter Rückgriff auf die analytische Explikation des Kausalbegriffs als INUS-Bedingung, wonach als Ursache bezeichnet werden kann, was eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Teilbedingung im Rahmen einer hinreichenden, wenn auch nicht 30
notwendigen Gesamtbedingung darstellt . In diesem Sinne sind Organismen kausal durch Umgebungsbedingungen beeinflußbare und steuerbare Systeme31. Maturana würde vermutlich diese gesamte Analyse als inadäquat, als verfälscht durch Kategorien des "Beobachters", zurückweisen. Es ist jedoch an ihm, eine alternative Analyse der "funktionalen Organisation" von Organismen anzugeben, die als erfahrungswissenschaftliche Beschreibung verwendet werden könnte. Betrachtet man das Modell, mit dem er seine 32
Darstellung zu konkretisieren versucht , so läßt sich jedenfalls kein Unterschied zu der von uns gegebenen Beschreibung rechtfertigen. Eine andere Version der kausalen Sonderstellung von Organismen wird von Thure v. Uexküll vertreten. Nach v. Uexküll ist eine kausale Betrachtung von Organismen deswegen inadäquat, weil sie sich auf die Betrachtung zweistelliger Relationen (Ursache-Wirkung) beschränkt, während für Organismusprozesse dreistellige Relationen (Zeichen-ObjektBedeutung) konstitutiv seien. Daher müsse die kausale durch eine semiotische oder ökologische Analyse ersetzt werden: "An analysis of the cause-effect-relations does not consider interrelations between meanings and concentrates on relations between mass and energy, whereas an analysis of relations between signs shows interrelations in which something has a meaning for something else. [...] Systems are ecological structures in which the state and the behavior of one element (subsystem) has a meaning for the state and behavior of all others."(v. Uexküll, 1986, S.214f.). Gegen diese Argumentation muß aus wissenschaftstheoretischer Sicht zweierlei eingewandt werden. Zum ersten ist v. Uexkülls Restriktion der Kausalanalyse auf mechanische Parameter und zweistellige Relationen weder dem tatsächlichen Gebrauch des Kausalitätsbegriffs in den Erfahrungs-
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin
79
Wissenschaften noch seiner analytischen Explikation angemessen, wie oben bereits angedeutet wurde. Die analytische Fassung des Begriffs erlaubt alle Formen von multifaktorieller, nichtlinearer und sogar selbstreferentieller Verursachung, läßt sich also auch auf die oben (Abschnitt 2.1.) skizzierte Auffassung der Organismusprozesse anwenden. Zum anderen ist aber v. Uexkülls eigene Auffassung, daß schon elementare biologische Prozesse, etwa die Aufnahme eines Moleküls aus der Umgebung durch eine Zelle via die selektiven Rezeptoren der Zellmembran, als Zeichenprozeß zu beschreiben seien, äußerst problematisch. Es reicht ja für solche Vorgänge das Modell eines einfachen Input-Output-ZustandSystems völlig aus, das die Selektivität eines Rezeptors innerhalb der Funktion f als spezifische Input-Zustands-Relation berücksichtigt. Wenn dies bereits einen Zeichenprozeß involvieren würde, dann müßte man auch jeden Getränkeautomaten als ein nur semiotisch analysierbares System betrachten. Hier empfiehlt sich eine feinere Differenzierung zwischen Systemmodellen, wobei die zweigliedrigen "kausalen" Systeme, die informationellen Systeme (Automaten) und die semiotischen oder zeichenverarbeitenden Systeme jeweils eine höhere Komplexitätsstufe realer Systeme darstellen können. Von Zeichenverarbeitung sollte man erst dort sprechen, wo sich nicht nur eine selektive Beziehung von Input und innerem Zustand, sondern auch eine selektive Beziehung zwischen Inputelementen findet, die im Sinne einer (subjektiven, systemrelativen) Bezeichnungsrelation gedeutet werden kann. Eine weitergehende Auseinandersetzung mit v. Uexkülls psychosomatischer Konzeption, die insbesondere sein Konzept des "Selbst" berücksichtigen müßte, soll hier nicht versucht werden. Es sollte lediglich exemplarisch gezeigt werden, welche wissenschaftstheoretischen Probleme in der Organismustheorie zu erwarten sind. Insbesondere sehe ich von einer Darstellung all der Probleme ab, die im Zusammenhang mit dem Krankheitsbegriff in der Organismustheorie zu diskutieren sind und die einen Großteil der medizintheoretischen Literatur ausmachen33. 2 2. Ein Modell des ärztlichen Procedere Als zweites Beispiel für Probleme, die in der traditionellen Medizintheorie diskutiert werden, soll die Aufgabe der Rekonstruktion des ärztlichen Vorgehens in Diagnostik und Therapie (Procedere) dargestellt werden. Dazu werde ich ein bereits relativ weit entwickeltes Modell vorstellen, von
80
Peter Hucklenbroich
dem wissenschaftstheoretische Detailuntersuchungen ausgehen könnten. Die folgende Darstellung versteht sich demgemäß als eine Rekonstruktion der kognitiven Aspekte des ärztlichen Handelns in der Arzt-PatientBeziehung, also eine Darstellung, bei der von den psychosozialen und affektiven Aspekten bewußt abstrahiert wird. Deren Bedeutung in der konkreten Situation wird dadurch nicht etwa bestritten; es geht lediglich darum, den kognitiven Aspekt in seinem eigenen Zusammenhang zu isolieren und separat darzustellen, wie es für wissenschaftstheoretische Analysen ein weitgehend akzeptiertes Vorgehen ist. Auch die Einteilung in verschiedene "Abschnitte" und Phasen wird um der Übersichtlichkeit willen in vereinfachter Form vorgenommen, ohne zu übersehen, daß das konkrete Vorgehen oft eine weitergehende Anpassung und spezifische Ausgestaltung im Hinblick auf die Erfordernisse der Praxis nötig macht. Unter dieser Voraussetzung soll versucht werden, die wesentlichen kognitiven Elemente des ärztlichen Wissens, Denkens, Erkennens und Entscheidens in ihrem Zusammenwirken aufzuzeigen. 2.2.1. Phase I: Die initiale Irrformation Eine ärztliche Handlungssequenz in Beziehung zu einem (potentiellen) Patienten kommt überhaupt nur dann in Gang, wenn für diesen Patienten ein (medizinischer) Behandlungsbedarf und/oder ein (medizinisch-diagnostischer) Abklärungsbedarf besteht. Wenn beides nicht besteht, ist ärztliches Handeln nicht indiziert. Allerdings sind die Begriffe "Behandlungsbedarf' und "Abklärungsbedarf' hier weit zu fassen: Zur Behandlung gehören gegebenfalls auch einfaches Zuhören, Vorsorge, Beratung, Begleitung, mitmenschliche Zuwendung und Trost; zur Abklärung gehört auch die Feststellung, ob überhaupt ein behandlungsbedürftiger oder behandlungsfähiger Krankheitszustand vorliegt, falls daran noch Zweifel bestehen. In diesem Sinne ist das ärztliche Handeln als durch zwei MetaIndikationen gesteuert aufzufassen, eben die Metaindikationen der Behandlungs- und der Abklärungsbedürftigkeit. Es sollte hier deswegen von Me/a-Indikationen gesprochen werden, um diese globalen Kriterien abzugrenzen von den Indikationen und Kontraindikationen für einzelne medizinische Verfahren diagnostischer oder therapeutischer Art, die innerhalb einer einmal in Gang gekommenen Handlungssequenz zum Zuge kommen. Die Meta-Indikationen legen sowohl den Beginn (die Aufnahme) als auch das Ende (den regulären Abschluß) einer Handlungssequenz fest.
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin
81
Um eine Metaindikation stellen oder ihr Bestehen verneinen zu können, muß eine minimale Information über einen Patienten vorliegen (ist garnichts über ihn bekannt, kann auch keine medizinische Beurteilung erfolgen). Relativ zu einer vorliegenden Information, kann jedoch entschieden werden, ob Behandlungs- und/oder Abklärungsbedarf besteht. Diese minimale, für den Start einer besonderen Handlungssequenz notwendige Information sei im gegenwärtigen Zusammenhang als initiale Information bezeichnet. Sie kann in der Praxis in verschiedener Form auftreten. Der klassische Fall ist der, daß ein Patient mit bestimmten Beschwerden oder Problemen in die ärztliche Sprechstunde kommt; dann bilden der Inhalt seiner Beschwerdenschilderung sowie einige in der Regel unmittelbar durch den Arzt wahrgenommene Merkmale (Patientengeschlecht, ungefähres Alter, Größe, Allgemeinzustand etc.) die initiale Information. Andere Fälle liegen vor, wenn der Arzt zu einem Patienten gerufen wird, wenn der Patient in die Praxis, Ambulanz oder Station gebracht wird, wenn der Arzt telefonisch oder en passant konsultiert wird oder wenn ein Arzt zufällig Zeuge eines Notfalls oder einer plötzlichen Erkrankung wird. In all diesen Fällen gibt es eine initiale Information, die sich insgesamt aus den mitgeteilten Informationen, den wahrgenommenen oder beobachteten Informationen und eventuellem Vorwissen des Arztes über diesen spezifischen Patienten zusammensetzen kann. Die initiale Information steht in zweierlei Beziehung zum allgemeinen medizinischen Wissen: Erstens stellt sie selbst eine Übersetzung bzw. medizinische Deutung von Sachverhalten dar, insofern der Arzt sowohl die mitgeteilten als auch die wahrgenommenen Informationen in sein spezielles medizinisches "Begriffsraster" einordnet, wobei er die Mitteilungen des Patienten höchst selektiv bewerten muß und bei der Wahrnehmung sein spezifisches medizinisches Training und seine Erfahrung in Anwendung bringt. Vorausgesetzt ist dabei insbesondere eine umfassende Kenntnis medizinischer Symptome und der Art und Weise, wie diese subjektiv wahrgenommen und beschrieben werden können. Zweitens muß der Arzt auf spezifisches medizinisches Wissen zurückgreifen, um aus der initialen Information die Frage des Bestehens von Metaindikationen beantworten zu können. Dieses Wissen besteht im wesentlichen in der Kenntnis derjenigen Symptome, die einen sicheren oder fraglichen Krankheitswert haben, sowie derjenigen "Symptome", die keinen Krankheitswert haben, aber möglicherweise als solche verkannt wer-
82
Peter Hucklenbroich
den (ζ. Β. auffällige, aber harmlose Verfärbungen des Urins). Dabei wird die Lage dadurch verkompliziert, daß Krankheitswerte von spezifischen Konstellationen abhängen können, also ζ. B. von der Kombination mehrerer Symptome oder von der Kombination von Symptomen mit weiteren Merkmalen des Patienten, die selbst keine Symptome sind (ζ. B. Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen, Medikationen). Beide Wissenselemente hängen natürlich eng zusammen; im Prinzip ließe sich dieses Wissen als eine Liste aller medizinisch relevanter Symptome vorstellen, bei der zu jedem Symptom angegeben ist, welchen Krankheitswert es für sich allein besitzt (keiner - fraglicher - sicherer Krankheitswert), in welchen Konstellationen welche anderen Krankheitswerte vorliegen, und welche Umschreibungen typischerweise von medizinischen Laien gegeben werden. De facto taucht dieses Wissen jedoch nicht so isoliert auf, sondern ist Teil komplexerer Systematisierungen (vgl. Abschnitt 2.2.3.). Auf der Basis der initialen Information können zwei Arten von Aktionen ausgelöst werden: Erstens Sofortbehandlungen, falls eine unmittelbare Behandlungsindikation besteht - dies ist typischerweise in Notfällen gegeben; zweitens Diagnostik, wenn ein Abklärungsbedarf besteht. Auch das abwartende Beobachten, wie sich der Zustand des Patienten weiterentwickelt, ist unter die diagnostischen Maßnahmen im weiteren Sinne zu rechnen. Diagnostik im engeren Sinne ist dagegen ein komplex strukturiertes Vorgehen, das im folgenden weiter analysiert wird. 2.22. Die diagnostisch-therapeutische Schleife Wenn ein Beschwerdezustand oder Krankheitsfall nicht "auf Anhieb", d.h. aufgrund der initialen Information, diagnostiziert wird und auch nicht durch abwartendes Offenlassen angegangen werden kann, setzt das eigentliche medizinische Procedere ein: Es wird, in einem iterativen Prozeß, über die Durchführung diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen entschieden, die zu neuen Informationen führen, aufgrund deren weitere Maßnahmen angesetzt werden können, bis ein diagnostischer und therapeutischer Endpunkt erreicht ist. Dies entspricht prozeßstrukturell einer Schleife mit Abbruchkriterium, also einem Prozeß, der so lange wiederholt wird, bis das Abbruchkriterium erfüllt ist. Darstellungen dieser ganz allgemeinen zyklischen Struktur sind in der medizinischen Literatur weit verbreitet34. Sie läßt sich schematisch durch folgende 4 Schritte wiedergeben:
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin
83
1 - Gewinnung von Information über den Patienten 2 - Entscheidung über indizierte diagnostische und therapeutische Maßnahmen 2.1 Bildung der aktuellen differentialdiagnostischen Alternative 2.2 Auswahl der geeignetsten diagnostischen und/oder therapeutischen Maßnahme 3 - Ausführung der Maßnahme(n) 4 - falls Abbruchkriterien erfüllt, Ende - sonst weiter mit 1. Jeder dieser Schritte greift in spezifischer Weise auf medizinisches Wissen zurück und verwendet spezifische Informationsstrukturen und Verarbeitungsweisen (Schlußformen, Entscheidungsverfahren), die im einzelnen zu betrachten sind. 22.2.1. Die Strukturierung der Patienteninformation Die im Laufe des diagnostisch-therapeutischen Prozesses erhobenen Informationen über den Patienten, beginnend mit der initialen Information, bedürfen einer Strukturierung und Vorverarbeitung in mehreren Hinsichten, um weiterverwendet werden zu können: Die Notwendigkeit, anamnestische Angaben umzuformulieren bzw. zu übersetzen, um sie in Bezug zum kodifizierten medizinischen Wissen setzen zu können, wurde bereits erwähnt. Eine weitere wichtige Vorverarbeitung besteht darin, quantitativ erhobene Daten, wie sie typischerweise bei physiologischen und chemischen Tests und Analyseverfahren erhalten werden, einer Grobklassifikation zuzuordnen. Solche Grobklassifikationen stehen selbst in unterschiedlicher Weise zur Verfügung, von der bloßen Unterscheidung "normal - nicht normal" bis hin zu Reihen wie "extrem erniedrigt - stark erniedrigt - erniedrigt - grenzwertig erniedrigt - normal - grenzwertig erhöht - erhöht - stark erhöht - extrem erhöht". Welche Grobklassifikation verwendet wird, kann sowohl von der in Frage stehenden physiologischen oder chemischen Größe als auch von der augenblicklichen Fragestellung abhängen. Die Fragestellung ist ζ. B. unterschiedlich danach, ob es sich um eine bloße Orientierungsuntersuchung oder um die Feinkalibrierung einer Therapie handelt. Für spezifische Phänomenbereiche werden darüber hinaus eigene Klassifikationsschemata entwickelt und standardisiert. So wird ζ. B. in der Onkologie für jede Tumorspezies ein eigenes Schema der Klassifikation hinsichtlich Ausdehnung, Stadium (staging) und Ent-
84
Peter Hucklenbroich
artungsgrad (grading) verwendet (TNM-Schema). Für diese Formen der Grobklassifikation quantitativer bzw. kontinuierlich variabler Daten hat sich insbesondere im Bereich der medizinischen Informatik die Bezeichnung Datenabstraktion eingeführt. Eine dritte Art der Vorverarbeitung ergibt sich daraus, daß Kombinationen von Symptomen und Befunden zusammengefaßt werden können, wenn sie eine typischerweise zusammengehörige Konstellation bilden ("Syndrome") oder wenn sie einen ätiologisch-pathogenetischen, also ursächlichen Zusammenhang aufweisen ("Pathozustände", "Pathomechanismen"). So wird z.B. das gemeinsame Auftreten von Pupillenverengung, hängendem Oberlid und eingefallenem Augapfel als "Horner-Syndrom" oder "Hornersche Trias", die Kombination von Hypoproteinämie, Dysproteinämie, Ödemen und Hyperlipoproteinämie als "nephrotisches Syndrom" bezeichnet. Diese Zusammenfassung unter einem eigenen Begriffsnamen dient dabei der Ökonomisierung der Informationsdarstellung, darüber hinaus aber auch der Systematisierung des medizinischen Wissens. 35 Syndrome, Pathozustände und Pathomechanismen sind wesentliche Bausteine des medizinischen Krankheitswissens, die gleichberechtigt neben Krankheitseinheiten, Krankheitsursachen, (Einzel-) Symptomen und (Einzel-) Befunden stehen. Ein großer Teil der diagnostischen Arbeit besteht jedoch darin, zunächst die Befunde zusammenzutragen, aus denen auf das Vorliegen bestimmter Pathozustände und -mechanismen geschlossen werden kann; dies geschieht in den folgenden Schritten der diagnostisch-therapeutischen Schleife. 2.2.2.2. Der medizinische Entscheidungsprozeß Solange die vorliegenden Informationen über einen Patienten keine eindeutige und abschließende Beurteilung seines Krankheitszustandes zulassen, müssen alternative Hypothesen darüber gebildet und unterhalten werden. Es ist insbesondere notwendig, alle möglichen Alternativen so lange in der Diskussion zu halten, wie sie nicht direkt widerlegt sind oder, aufgrund des definitiven Nachweises einer der anderen Hypothesen, als erledigt betrachtet werden können. Die Gesamtheit der zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Diskussion zu stellenden Hypothesen über einen Patienten kann in erster Näherung als eine (endliche) Disjunktion aufgefaßt werden, deren Glieder durch das ausschließende "oder" ("entweder-oder") ver-
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin
85
knüpft sind. Diese Informationsstruktur sei als (vollständiges) diagnostisches Differential bezeichnet. Es ist sinnvoll, dieses Differential als die zweite für das ärztliche Procedere maßgebliche Informationsstruktur zu betrachten, neben der die bereits gesicherte Information (Symptome, Befunde, Pathozustände, Diagnosen) enthaltenden Informationsstruktur, die man häufig als den Befund bezeichnet. Die Disjunktionsglieder des diagnostischen Differentials, also die einzelnen Hypothesen, können selbst wiederum zusammengesetzt und zwar konjunktiv zusammengesetzt sein. Dies muß schon deshalb der Fall sein, weil ein Patient gleichzeitig mehrere Krankheiten haben kann, also im Endeffekt auch mehrere Diagnosen bekommen muß. Erst recht muß aber während des diagnostischen Prozesses die Möglichkeit bestehen, mehrere Teilaspekte des gesamten Krankheitsbildes parallel und (vorläufig) unverbunden als Teil-Hypothesen weiterverfolgen zu können, auch wenn manche oder alle dieser Hypothesen zum Schluß unter einer einzigen Diagnose zusammenfaßbar sein sollten. Diese Teilhypothesen beziehen sich also auf vermutete bzw. verdächtigte Zustände und Prozesse, die als koexistent im Patienten unterstellt werden. Das vollständige diagnostische Differential stellt dementsprechend in zweiter Näherung eine (ausschließende) Disjunktion von Konjunktionen (konjunktiv verknüpften Hypothesen) dar. Die Hypothesen innerhalb eines diagnostischen Differentials können, insbesondere bei umfangreichen Differentialen, unterschiedlich gewichtet werden, d.h. es wird eine (grobe) Klassifikation in wichtige und weniger wichtige Hypothesen vorgenommen. Diese Gewichtung ist notwendig, um Prioritäten für die weitere Abklärung setzen zu können. In diese Gewichtung gehen heterogene Kriterien ein: Die A-priori-Wahrscheinlichkeit von Krankheiten, die sich aus ihrer Häufigkeit ergibt, ihre A-posterioriWahrscheinlichkeit bezogen auf die bereits vorliegende Information, weiterhin ihre Bedrohlichkeit und ihr Zeitverlaufstyp: Fulminant verlaufende Krankheiten z. B. erfordern, wenn sie vermutet werden, eine rasche Diagnostik, bekommen also eine hohe Priorität, selbst wenn sie a priori weniger wahrscheinlich sind als andere, langsamer verlaufende. Auch die Anzahl der Teilhypothesen in einem Disjunktionsglied spielt insofern eine Rolle, als "einfachere" Erklärungen, d. h. Erklärungen, die weniger (Teil-) Hypothesen benötigen, ceteris paribus die höhere Priorität besitzen. Die Rekonstruktion der Prinzipien dieser Prioritierung ist eine recht diffizile Aufgabe, da unterschiedliche Arten von Abhängigkeiten zwischen nosologischen Entitäten zu berücksichtigen sind; eine rein
86
Peter Hucklenbroich
wahrscheinlichkeitstheoretische Rekonstruktion, wie sie häufig versucht wird - z. B. mit Hilfe des BAYES sehen Theorems - , dürfte kaum erfolgversprechend sein36. Auf jeden Fall gehören alle genannten Attribute und Relationen nosologischer Entitäten - Wahrscheinlichkeiten, Bedrohlichkeitsgrade, Zeitverlaufstypen - zum diagnostisch relevanten medizinischen Wissen. In dritter Näherung besteht das diagnostische Differential also aus einer nach Prioritäten geordneten Disjunktion von Konjunktionen. Die Konjunktionsglieder einer Hypothese - unter Umständen nur ein einziges Glied - werden formuliert mit Prädikaten, die sich auf nosologische Entitäten beziehen, also auf alle die Gegenstände (Sachverhalte, Patientenmerkmale) 37 , die Gegenstand der Nosologie als systematischer Krankheitslehre sind und Inhalt einer Vermutung sein können. Dies sind keineswegs nur die Krankheitseinheiten, die in der Formulierung von Enddiagnosen gebraucht werden können, sondern auch alle allgemeineren Krankheitskategorien und Bezeichnungen zur Formulierung intermediärer Befunde. Beispielsweise ist im Bereich der urologisch-nephrologischen Diagnostik nicht nur das Prädikat "Hypernephrom" zur Formulierung einer Hypothese zulässig, sondern auch "Nierentumor", "Malignom" oder "renale Ursache(n) einer Hämaturie". Welche Hypothese adäquat ist, ergibt sich in Abhängigkeit von der bereits vorliegenden Information, also von "dem" Befund. Ist lediglich eine Hämaturie bisher bekannt, so wird man zunächst nur ein Differential mit drei Hypothesen aufstellen, nämlich die drei intermediären Möglichkeiten "prärenale Ursachen", "renale Ursachen" und "postrenale Ursachen" ("der Hämaturie", ist jeweils zu ergänzen). Erst aufgrund weiterer Informationen, z. B. dem Ausgang der Zwei- oder Drei-Gläser-Probe, wird man in Richtung auf eine abschließende Diagnose weiterkommen. Das nosologische Begriffssystem, das dem medizinischen Laien geradezu unsystematisch erscheinen kann, verdankt seine Struktur weitgehend der Notwendigkeit, die begrifflichen Hilfsmittel für ein schrittweises Diagnostizieren von verschiedenen denkbaren Ausgangspunkten aus zur Verfügung zu stellen. Es ist unter diesem Aspekt auch keineswegs unsystematisch, sondern hochgeordnet, wobei sich die Ordnung aber nur dem er38 schließt, der das ärztliche Procedere beherrscht . Die Bildung und Modifikation des diagnostischen Differentials beruht auf folgenden Prinzipien: Jede neu hinzugewonnene Information über einen Patienten - d.h. jedes neue Element des Befundes - wird, evtl. nach
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin
87
Vorverarbeitung, daraufhin ausgewertet, a) ob sich aus ihm, zusammen mit der bereits vorliegenden Information, weitere, bisher nicht in Betracht gezogene Hypothesen ergeben oder Teilhypothesen verändert (verfeinert, zusammengefaßt) werden können, b) ob bereits aufgestellte Hypothesen gesichert (bewiesen) werden können, c) ob aufgestellte Hypothesen ausgeschlossen (widerlegt) werden, d) ob sich Veränderungen in der Prioritierung der Hypothesen ergeben. Für diese Auswertung wird auf spezifisches Wissen über die diagnostischen Relevanzen von Befunden und anderen medizinischen Informationen zurückgegriffen, das Teil des explizit formulierten medizinischen Wissens ist39. Im Zuge des diagnostischtherapeutischen Prozesses wird so das Differential so lange umgeformt, bis eine der Hypothesen (Disjunktionsglieder) als Enddiagnose gesichert werden konnte oder bis die diagnostischen Möglichkeiten erschöpft sind. In jeder Phase dieses Prozesses dient das aktuelle Differential als Grundlage für die Entscheidung, welche diagnostischen Maßnahmen als nächste angezeigt, indiziert, sind. Diese Indikationsstellung ist ein ähnlich komplexes, diffizil zu rekonstruierendes Problem wie die Prioritierung der Hypothesen. Es muß dazu auf spezifisches Wissen über die Leistungsfähigkeit diagnostischer Methoden zurückgegriffen werden, das teilweise in Form expliziter Indikationen und Kontraindikationen kodifiziert ist. In vielen Fällen kann jedoch nicht schematisch aus Indikationsregeln deduziert werden, sondern es müssen Kriterien verwendet und miteinander verrechnet werden, die u. a. die Güte (Spezifität, Sensitivität, Selektivität) der Methode, ihre Invasivität und Risiken (Belastung und Gefährdung des Patienten) und ihre Kosten ebenso wie die subjektive Präferenz des Patienten und des Arztes einbeziehen. Andererseits kann die Entscheidung dadurch vereinfacht werden, daß für viele diagnostische Standardprobleme Leitprogramme ausgearbeitet worden sind, die das kunstgerechte Procedere beschreiben und insofern einen Teil des ärztlichen Wissens ausmachen40. Das Gesagte gilt ebenso für die therapeutische Entscheidungsfindung, die parallel zur diagnostischen abläuft, wobei therapeutische Maßnahmen natürlich nur im Hinblick auf bereits diagnostisch gesicherte Befunde indiziert sein können. Insgesamt ist die Entscheidungsproblematik, sowohl in diagnostischer wie in therapeutischer Hinsicht, in der Regel so komplex, daß gegenwärtig mit großem Aufwand versucht wird, Methoden der Künstlichen Intelligenz zur Unterstützung des Arztes einzusetzen41.
88
Peter Hucklenbroich
Die diagnostisch-therapeutische Schleife terminiert in diagnostischer Hinsicht erfolgreich, wenn eine für die ärztlichen Zwecke genügend genaue diagnostische Hypothese gesichert werden konnte; in therapeutischer Hinsicht terminiert sie, wenn auf der Basis der bestehenden Informationen und Kriterien die optimale Behandlungsmethode - sofern eine existiert gefunden worden ist. Was den Heil erfolg betrifft, so gilt: Medic us curat, natura sanat. 2.23.
Explikationsprobleme
Die Darstellung des ärztlichen Procedere im vorigen Abschnitt ist deswegen relativ ausführlich und detailliert gehalten, um zeigen zu können, an welchen verschiedenen Stellen jeweils Rückgriffe auf das medizinische Wissen erfolgen. Es wird daraus bereits deutlich, daß dieses Wissen ziemlich heterogene Elemente enthalten muß. Für den Wissenschaftstheoretiker oder Medizintheoretiker stellt sich die schwierige Frage, wie dieses Wissen in sich strukturiert ist bzw. wie es rekonstruiert werden könnte. Von einer Antwort auf diese Frage sind wir gegenwärtig noch weit entfernt. Ich will im folgenden nur zwei Feststellungen machen, die bei der Lösung dieses Explikationsproblems eine Rolle spielen könnten. 1. Es ist sinnvoll, mindestens folgende zwei Ebenen des medizinischen Wissens zu unterscheiden: (i) die klinisch-nosologische Ebene, als die Ebene, auf der Konzepte von Krankheiten, Krankheitsgruppen, Symptomen, Befunden und medizinischen Maßnahmen miteinander und untereinander so verbunden und systematisiert sind, wie sie unmittelbar zur Anleitung des praktischen Procedere benötigt werden; dies ist die Ebene, die - wie erwähnt - dem Außenstehenden am wenigsten zugänglich ist, dem Arzt aber am nächsten liegt; (ii) die systemisch-pathologische Ebene, auf der der menschliche Organismus und seine Krankheiten als soziopsycho-somatischer Lebensprozeß mit mannigfachen, teilweise hierarchisch gegliederten Subsystemen und Subprozessen konzeptualisiert wird. Diese Unterscheidung ist nicht so zu verstehen, daß es sich um zwei getrennte Elemente des medizinischen Wissens handelt, sondern um dasselbe Wissen gewissermaßen auf zwei verschiedenen Stufen der begrifflichen "Auflösung". Die klinisch-nosologische Beschreibung zerlegt den Gegenstand nur so weit analytisch, wie es jeweils klinisch-praktisch von Nutzen ist, und ignoriert alle weitergehenden Feinstrukturebenen der systemisch-pathologischen Beschreibung; letztere führt die Analyse so weit,
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin
89
wie es mit den jeweils verfügbaren wissenschaftlichen Mitteln überhaupt möglich ist, und geht daher unmittelbar in die Forschung in den medizinischen Grundlagenfächem über. 2. Insbesondere auf der klinisch-nosologischen Ebene spielen Begriffsbildungen eine Rolle, die zugleich einen Bezug zum (Patienten-) Organismus wie zur (ärztlichen) Handlung ausdrücken. Dazu gehören Konzepte wie "Symptomwert", "diagnostische Relevanz", "Gefahrdungspotential", "Malignität", "Invasivität", "therapeutische Potenz" ebenso wie "Indikation" und "Kontraindikation". Bemerkenswert daran ist, daß es sich dabei um konstitutive Elemente des ärztlichen Wissens handelt, die einerseits eindeutig eine beschreibende Komponente beinhalten, andererseits aber wegen ihres klaren Handlungsbezugs kaum als rein deskriptiv aufgefaßt werden dürften. Eine Wissenschaftstheorie der Medizin hätte dieser besonderen Begriffsform, die in anderen Wissenschaftsbereichen wohl kein Analogon besitzt, besonders Rechnung zu tragen. Dasselbe gilt für den oben bereits erwähnten Zusammenhang zwischen der klinisch-nosologischen Systematisierung und den Notwendigkeiten des ärztlichen Procedere.
3. Schlußbemerkung Die in den beiden Hauptabschnitten skizzierten Themen und Probleme der Medizintheorie bilden nur einen geringfügigen Ausschnitt aus dem gesamten Bereich. Ich hoffe, deutlich gemacht zu haben, daß eine tiefergehende wissenschaftstheoretische Beschäftigung mit diesen Fragen sowohl wünschenswert als auch erfolgversprechend ist. Wenn die in diesem Band zusammengestellten Arbeiten ein Indiz dafür sein sollten, daß eine solche Arbeit nun auf breiterer Basis einsetzen wird, so darf gehofft werden, daß es tatsächlich zu einer Fusion zwischen der existierenden medizintheoretischen Forschungstradition und einer aus der philosophischen Wissenschaftstheorie heraus entwickelten Wissenschaftstheorie der Medizin kommen wird.
90
Peter Hucklenbroich
Anmerkungen 1 Vgl. v.Engelhardt/Schipperges 1980, S. 91 f. 2 Die Geschichte dieser Tradition ist noch nicht geschrieben worden. Materialien dazu finden sich z. B. in Rothschuh 1975,1978a, 1978b; Caplan/Engelhardt/McCartney 1981; Schipperges/Seidler/Unschuld 1978. Für das 20. Jahrhundert findet sich eine Übersicht in v.Engelhardt/Schipperges 1980. Für die Zeit nach 1945 versucht Neumann 1988 einen Abriß zu geben, der jedoch auf teilweise zweifelhaften wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen basiert 3 Vgl. die im Literaturverzeichnis aufgeführten Werke dieser Autoren. 4 Vgl. die Fachzeitschriften "The Journal of Medicine and Philosophy", 1977 begründet durch Edmund D. Pellegrino, und "Theoretical Medicine", unter dem Namen "Metamed" 1978 begründet durch Kazem Sadegh-zadeh; die Buchreihe "Philosophy & Medicine", seit 1975 herausgegeben durch Tristram Engelhardt, jr., und Stuart F. Spicker (bisher 36 Bände); die Gründung der "European Society for Philosophy of Medicine and Health Care" 1987; die 1976 erfolgte Erweiterung des Münsteraner Instituts für Geschichte der Medizin zum jetzigen "Institut für Theorie und Geschichte der Medizin" und die entsprechenden Abteilungsgründungen in Holland in den letzten Jahren. 5 Vgl. die thematischen Schwerpunkte der oben erwähnten amerikanischen Buchreihe "Philosophy & Medicine". Zur Bioethik in den USA vgl. Sass 1988. 6 Eine umfassendere systematische Studie zur Medizintheorie befindet sich z. Zt. in Vorbereitung (Hucklenbroich 1991). 7 Vgl. die Diskussion um die Ansätze von Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Toulmin und nahestehenden Autoren, z. B. in Lakatos/Musgrave 1974, Diederich 1974, Stegmüller 1973, Hucklenbroich 1978, Andersson 1988. 8 Exemplarisch: Böhme 1976; Hucklenbroich 1978, Kap. 7 u. 11. 9 Vgl. die ausgedehnte wissenschaftstheoretische Diskussion um das Inkommensurabilitätsproblem und den Reduktionsbegriff. 10 Vgl. Stegmüller 1969 und 1983. 11 Besonders im Zusammenhang mit der Kuhn-Lakatos-Feyerabend-Kontroverse. 12 Sneed 1971, Stegmüller 1973, 1986, Hucklenbroich 1978, 1982, Diederich 1981, Balzer 1982. 13 Natürlich heute nicht mehr im Sinne der "organischen Chemie". 14 Vgl. z. B. zur Begriffsgeschichte Löw 1980, zur neueren Diskussion auch Rothschuh 1963, Hucklenbroich 1981 und 1986. 15 Solche Interdependenzen sind aufgezeigt in Hucklenbroich 1986, Kap. 2. 16 Maturana 1982, S. 35. Zur Theorie autopoietischer Systeme vgl. auch Varela 1979, Zeleny 1981, Hucklenbroich 1986, Schmidt 1987 und Riegas/Vetter 1990. 17 Dies gilt natürlich nur für die "intermediären" Moleküle des Stoffwechsels, nicht für die Anfangs- und Endprodukte; s. unten. 18 Man lese "+" als Vereinigungszeichen für Mengen.
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin
91
19 Eine ausführlichere Fassung dieses Definitionsgedankens würde es erforderlich machen, ein Konzept für den "Möglichkeitsraum" eines Organismus zu formulieren, d.h. gewissermaßen den "Organismus als Programm" zu konzipieren. Vgl. dazu vorläufig Hucklenbioich 1986. 20 Dies hätte die interessante Konsequenz, daß die Unterscheidung zwischen exogenen und endogenen (= genetischen) Krankheitsursachen hinfällig würde, da das Genom dann formal den aus der Umwelt stammenden Faktoren gleichgestellt wäre. Auch wäre die Fortpflanzung der Einzeller, ζ. B. durch DNS-Duplikation und Zellteilung, als umweltbezogener und nicht organismus-immanenter Prozeß zu verstehen. 21 Für Einzelheiten muß auf die einschlägigen Lehrbücher der Biochemie, Zytologie etc. verwiesen werden. 22 Dieser Begriff wird detaillierter entwickelt in Hucklenbroich 1986, 1987 und Hucklenbioich/Chuaqui 1987. 23 Im Sinne der Kantischen Formulierung. 24 Vgl. Th. v. Uexküll 1963, 1988, 1990, sowie z. B. J. v. Uexküll 1909, 1928, 1931. 25 Der Passungsgedanke wurde besonders auch von K.E. Rothschuh in seiner "Theorie des Organismus" herausgearbeitet (Rothschuh 1963). 26 Zwei neuere deutschsprachige Untersuchungen zum Leib-Seele-Problem sind Hastedt 1988 und Carrier/Mittelstraß 1989. Wissenschafts- und medizintheoretische Aspekte der Künstlichen Intelligenz werden diskutiert in Hucklenbroich 1989. 27 Vgl. dazu die in Maturana 1982 gesammelten Arbeiten, besonders das Modell S. 157-169, sowie das Interview mit Maturana in Riegas/Vetter 1990. 28 Hervorhebung von mir, P.H. 29 So argumentiert auch Gerhard Roth in Roth 1987, bes. S. 271-273. 30 Die analytische Kausalitätstheorie ist dargestellt in Stegmüller 1983, bes. S. 583600. Sie geht zurück auf J.L.Mackie, vgl. Mackie 1974. 31 Vgl. auch meine Kritik an Maturana in Hucklenbroich 1990. 32 Maturana 1982, S. 157-169. 33 Vgl. Hucklenbroich 1984 und die in Anm. 2 genannte Literatur. 34 Vgl. beispielsweise Anschütz 1982, Gross 1985, Schölmerich 1985. 35 Strenggenommen ist hier zu unterscheiden zwischen begrifflichen Zusammenfassungen, die auf Nominaldefinitionen beruhen und daher nicht hypothetisch sind, und "erklärenden" Zusammenfassungen, die eine Erklärungshypothese beinhalten, insofern keine begrifflichen Wahrheiten sind und nicht zur Vorverarbeitung, sondern zur Differentialdiagnostik im engeren Sinne gehören. Der zur Zusammenfassung komplementäre Vorgang der Verfeinerung oder Differenzierung, bei dem ein Befund oder Zwischenergebnis aufgesplittert wird in mehrere mögliche Feinbeschreibungen, gehört dagegen immer zur Differentialdiagnostik im engeren Sinne, da er immer Hypothesen beinhaltet. 36 Zeitweise ist versucht worden, die gesamte diagnostische Entscheidungsfindung wahrscheinlichkeitstheoretisch zu begründen. Es existiert in diesem Bereich eine umfangreiche Literatur; zum BAYES-Theorem vgl. etwa die Bibliographie bei
92
37 38
39
40
41
Peter Hucklenbroich Sadegh-zadeh 1980. Auch in verschiedenen diagnoseunterstützenden Computerprogrammen wird stark auf derartige Ansätze zurückgegriffen. Zur Kritik aus medizintheoretischer Sicht vgl. Hucklenbroich 1989, Kap. 4. Zum Präzisierungsproblem vgl. unten 2.2.3. Wenn Wieland z.B. kritisiert, daß das in der Praxis verwendete nosologische System ganz unterschiedliche Einteilungsgesichtspunkte aufweist und daß Syndrome, Faktoren, Gradeinteilungen, therapeutisch motivierte Klassifikationen, "berufstheoretische Begriffe" (R.N.Braun) etc. zu den "substantiellen" Krankheitsentitäten hinzugefügt würden (Wieland 1975, S. 121-141), so übersieht er diese aus der diagnostisch-therapeutischen Praxis resultierende Systematik. Dieses Übersehen ist im Rahmen der Zielsetzung seiner ansonsten vorzüglichen Analyse besonders gravierend; denn gerade sein Versuch, den Charakter von Medizin als "praktischer Wissenschaft" bzw. "Handlungswissenschaft" herauszuarbeiten, könnte durch den Aufweis dieser engen Verflochtenheit von Begriffssystem und praktischem Procedere wesentlich substantiiert werden (vgl. Kliemt 1986, S. 113-130, der Wielands Argumentation für die "Handlungswissenschaft" Medizin nicht überzeugend findet). Dieses Wissen ist weitgehend in einigen Lehrbüchern und Nachschlagewerken erfaßt, die üblicherweise die Bezeichnungen "Diagnostik" oder "Differentialdiagnose" im Titel führen. Vgl. die Bücher von Marx 1980, Kaufmann 1986, Eiseman/Wotkyns 1982, Don 1988, McNeil/Abrams 1986, sowie das Computerprogramm MISS ("Medizinisches Informations Service System"), das auf Flußdiagrammen basiert. Auf die Inhalte und die Problematik der wissensbasierten Programmierung und der Expertensysteme in der Medizin kann ich im gegenwärtigen Rahmen nicht näher eingehen. Vgl. Shortliffe 1976, Szolovits 1982, Clancey/Shortliffe 1984, Schaffner 1985, Puppe 1983 sowie Hucklenbroich 1989 und die dort verarbeitete Literatur. Ein Plädoyer für den Einsatz dieser Methoden gibt Puppe 1986 im Deutschen Ärzteblatt; zurückhaltender Gross 1989 im selben Organ.
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin
93
Literatur [1] Andersson, G. (1988), Kritik und Wissenschaftsgeschichte, Tübingen. [2] Anschiitz, F. (1982), Indikation zum ärztlichen Handeln, Berlin. [3] Balzer, W. (1982), Empirische Theorien: Modelle-Strukturen-Beispiele, Braunschweig/Wiesbaden. [4] Böhme, G. (Hrsg.) (1976), Protophysik. Für und wider eine konstruktive Wissenschaftstheorie der Physik, Frankfurt/M. [5] Caplan, A.L./Engelhardt, H.T./McCartney, J.J. (Hrsg.) (1981), Concepts of Health and Disease. Interdisciplinary Perspectives, Reading, Mass. [6] Carrier, M./Mittelstraß, J. (1989), Geist, Gehim, Verhalten, Berlin/New York. [7] Clancey, WJ./Shortliffe, E.H. (Hrsg.)(1984), Readings in Medical Artificial Intelligence, Reading, Mass. [8] Diederich, W. (1974), Theorien der Wissenschaftsgeschichte, Frankfurt/M. [9] Diederich, W. (1981), Strukturalistische Rekonstruktionen, Braunschweig/Wiesbaden. [10] Diemer, A. (1966), Zur Grundlegung einer Philosophie der Medizin, Regensburg. [11] Don, H. (Hrsg.) (1988), Intensivmedizinische Entscheidungen, Stuttgart [12] Eiseman, B./Wotkyns, R.S. (Hrsg.) (1982), Chirurgische Entscheidungsprozesse, Stuttgart/New York. [13] Gross, R. (1985a), Geistige Grundlagen der Erkenntnisfindung in der Medizin, in: Gross, 1985b, S.73-89. [14] Gross, R. (Hrsg.) (1985b), Geistige Grundlagen der Medizin, Berlin. [15] Gross, R. (1989), Künstliche Intelligenz und ärztliches Handeln, Deutsches Ärzteblau 86,675-677. [16] Hastedt, H. (1988), Das Leib-Seele-Problem, Frankfurt/M. [17] Hegel, G.W.F. (1816), Werke, Bd. 6: Wissenschaft der Logik II, Frankfurt/M. 1969. [18] Hucklenbroich, P. (1978), Theorie des Erkenntnisfortschritts, Meisenheim. [19] Hucklenbroich, P. (1981), Wissenschaftstheorie und Pathologie. Analytische Untersuchungen zum Funktionsbegriff, Path. Res. Pract. 171, 33-49. [20] Hucklenbroich, P. (1982), Epistemological Reflections on the Structuralist Philosophy of Science, Metamedicine 3,279-296. [21] Hucklenbroich, P. (1984), System and Disease, Theoretical Medicine 5, 307-323. [22] Hucklenbroich, P. (1986), Organismus und Programm, Münster. [23] Hucklenbroich, P. (1987), Das Konzept der Selbstprogrammierung in natürlichen und künstlichen Gehirnen, in: E.H. Graul/S. Pütter/D. Loew (Hrsg.), Das Gehirn und seine Erkrankungen (I), Iserlohn, 115-136. [24] Hucklenbroich, P. (1989), Künstliche Intelligenz und medizinisches Wissen, Habilitationsschrift, Münster. [25] Hucklenbroich, P. (1990), Selbstheilung und Selbstprogrammierung. Selbstreferenz in medizinischer Wissenschaftstheorie und künstlicher Intelligenz, in: Riegas/Vetter 1990,116-132. [26] Hucklenbroich, P. (1991), Theorie der Medizin (in Vort).).
94
Peter Hucklenbroich
[27] Hucklenbroich, P./Chuaqui, B. (1987), Thesen und Probleme zu den Begriffen von Ordnung, Information und Emergenz, in: W. Doerr/H. Schipperges (Hrsg.), Modelle der Pathologischen Physiologie, Berlin, 57-70. [28] Kant, I. (1790), Weike, Bd. 10: Kritik der Urteilskraft, Frankfurt/M. 1969. [29] Kaufmann, W. (Hrsg.) (1986), Diagnostische Entscheidungsprozesse in der Inneren Medizin, Stuttgart/New York. [30] Kliemt, H. (1986), Grundzüge der Wissenschaftstheorie, Stuttgart/New York. [31] Lakatos, I./Musgrave, A. (Hrsg.) (1974), Kritik und Erkenntnisfortschritt, Braunschweig. [32] Löw, R. (1980), Philosophie des Lebendigen, Frankfurt. [33] Mackie, J.L. (1974), The Cement of the Universe. A Study of Causation, Oxford. [34] Maturana, H.L. (1982), Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit, Braunschweig/Wiesbaden. [35] Marx, H. (1980), Differentialdiagnostische Leitprogramme in der Inneren Medizin, Berlin. [36] McNeil, B./Abrams, H.L. (Hrsg.) (1986), Brigham and Women's Hospital Handbook of Diagnostic Imaging, Boston/Toronto. [37] Neumann, J.N. (1988), Hauptströmungen medizinischer Wissenschaftstheorie in Deutschland nach 1945, Sudhoffs Archiv 72,133-153. [38] Puppe, B. (1983), Die Entwicklung des Computereinsatzes in der medizinischen Diagnostik und MEDI: Ein Expertensystem zur Brustschmerz-Diagnostik, Diss, med., Freiburg. [39] Puppe, B. (1986), Mit künstlicher Intelligenz gegen das Wissensdilemma, Deutsches Ärzteblatt 83,1367-1376. [40] Riegas, V./Vetter, C. (Hrsg.) (1990), Zur Biologie der Kognition. Ein Gespräch mit Humberto Maturana. Beiträge zur Diskussion seines Werkes, Frankfurt/M. [41] Roth, G. (1987), Autopoiese und Kognition: Die Theorie H.R. Maturanas und die Notwendigkeit ihrer Weiterentwicklung, in: Schmidt 1987,256-286. [42] Rothschuh, K.E. (1963), Theorie des Organismus, München. [43] Rothschuh, K.E. (1978a), Iatrologie. Zum Stand der klinisch-theoretischen Grundlagendiskussion. Eine Übersicht, Hippokrates 49,3-21. [44] Rothschuh, K.E. (1978b), Konzepte der Medizin in Vergangenheit und Gegenwart, Stuttgart. [45] Rothschuh, K.E. (Hrsg.) (1975), Was ist Krankheit?, Darmstadt. [46] Sadegh-zadeh, K. (1980), Bayesian Diagnostics: A Bibliography, Part 1, Metamedicine 1,107-124. [47] Sass, H.-M. (1988), Bioethik in den USA, Berlin. [48] Schaffner, K.F. (1980), Theory Structure in the Biomedical Sciences, Journal of Medicine and Philosophy 5, 57-97. [49] Schaffner, K.F. (1986), Exemplar Reasoning about Biological Models and Diseases: A Relation between Philosophy of Medicine and Philosophy of Science, Journal of Medicine and Philosophy 11,63-80. [50] Schaffner, K.F. (Hrsg.) (1985), Logic of Discovery and Diagnosis in Medicine, Berkeley.
Wissenschaftstheorie als Theorie der Medizin
95
[51] Schelling, F.WJ. (1800), System des transzendentalen Idealismus, Leipzig 1979. [52] Schipperges, H./Seidler, E./Unschuld, P.U. (Hrsg.) (1978), Krankheit, Heilkunst, Heilung, Freiburg. [53] Schmidt, S.J. (Hrsg.) (1987), Der Diskurs des radikalen Konstruktivismus, Frankfurt/M. [54] Schölmerich, P. (1985), Grundlagen ärztlicher Entscheidungsprozesse, Steiner. [55] Shortliffe, E.H. (1976), Computer-Based Medical Consultations: MYCIN, New York. [56] Sneed, J.D. (1971), The Logical Structure of Mathematical Physics, Dordrecht [57] Stegmüller, W. (1969), Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Bd. I: Wissenschaftliche Erklärung und Begründung, Berlin. [58] Stegmüller, W. (1973), Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Bd. II: Theorie und Erfahrung, Zweiter Halbband: Theorienstrukturen und Theoriendynamik, Berlin. [59] Stegmüller, W. (1983), Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Bd. I: Erklärung Begründung Kausalität, 2. Aufl., Berlin. [60] Stegmüller, W. (1986), Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Bd. II: Theorie und Erfahrung, Dritter Teilband, Berlin. [61] Szolovits, P. (Hrsg.) (1982), Artificial Intelligence in Medicine, Boulder, Colo. [62] Varela, F.J. (1979), Principles of Biological Autonomy, New York. [63] V.Engelhardt, D./Schipperges, H. (1980), Die inneren Verbindungen zwischen Philosophie und Medizin im 20. Jahrhundert, Darmstadt [64] v.Uexküll, J. (1909), Umwelt und Innenwelt der Tiere, Berlin. [65] v.Uexküll, J. (1928), Theoretische Biologie, Berlin (Neudruck Frankfurt 1973). [66] v.Uexküll, J. (1931), Der Organismus und die Umwelt, in: Driesch, H. (Hrsg.), Das Lebensproblem im Lichte der modernen Forschung, Leipzig, 189-224. [67] v.Uexküll, Th. (1963), Grundfragen der psychosomatischen Medizin, Reinbek. [68] v.Uexküll, Th. (1986), Medicine and Semiotics, Semiotica 60,201-217. [69] v.Uexküll, Th. (Hrsg.) (1990), Psychosomatische Medizin, 4. Aufl., München. [70] v.Uexküll, Th./Wesiack, W. (1988), Theorie der Humanmedizin, München. [71] Westmeyer, H. (1972), Logik der Diagnostik, Stuttgart. [72] Wieland, W. (1975), Diagnose. Überlegungen zur Medizintheorie, Berlin. [73] Wieland, W. (1986), Strukturwandel der Medizin und ärztliche Ethik, Heidelberg. [74] Zeleny, M. (Hrsg.) (1981), Autopoiesis. A Theory of Living Organization, New York.
Zur Methodologie der praktischen Wissenschaften Hartmut Kliemt
0. Allgemeines Die Auffassung, daß es neben der theoretischen nicht nur eine angewandte, sondern daneben auch eine spezifisch praktische Wissenschaft gebe, ist weit verbreitet. Sie wird mit dem Verweis auf die speziellen Anforderungen der "Urteilsbildung am Einzelfall" belegt, welchen sich jeder "Praktiker" zu stellen habe. Diese praktische Urteilsbildung sei selbst wissenschaftlich. Denn sie gehe über eine bloße Anwendung allgemeiner Resultate der Einzelwissenschaften hinaus. Dennoch fehle ihr der allgemeine Charakter einer theoretischen Urteilsbildung, die auf eine über den Einzelfall hinausgreifende Geltung abstellt. Sie sei konstitutiv für einen Typus von Wissenschaft sui generis, eben den der praktischen Wissenschaft. Damit verweist die These von der spezifisch praktischen Wissenschaft auf eine weit zurückreichende philosophische Tradition. Ihre Wurzeln kann man zumindest bis auf den antiken Begriff der "techne" und der "kunstgerechten Praxis" zurückverfolgen; wobei Bezüge zu Kants Konzept der Urteilskraft ebenfalls offenkundig sind. Ungeachtet dieser langen Tradition fehlt bislang jedoch eine wirklich befriedigende Explikation des Konzeptes einer spezifisch praktischen Wissenschaft, die neben theoretischer und angewandter Wissenschaft eine eigenständige Rolle beanspruchen kann. Das könnte allerdings auf Schwierigkeiten zurückzuführen sein, die die angemessene Explikation des Wissenschaftsbegriffes im allgemeinen aufwirft. Diese Frage werde ich im folgenden jedoch nicht behandeln, sondern davon ausgehen, daß es jedenfalls klare Fälle von Wissenschaft gibt.
98
Hartmut Kliemt
Es seien hier stellvertretend theoretische Physik, theoretische Ökonomik und theoretische Biologie genannt. Das zu untersuchende Problem läuft dann auf die Frage hinaus, ob Disziplinen oder Teile solcher Disziplinen wie Rechtswissenschaft, Ingenieurwissenschaft, Betriebswirtschaftslehre oder Medizin spezifisch praktisch und dennoch mit paradigmatischen Fällen von Wissenschaft im herkömmlichen Sinne so ähnlich sein können, daß man das zusammengesetzte Prädikat der praktischen Wissenschaft ohne Irreführung verwenden darf. Dabei ist zu Gunsten der Anhänger der These von einer spezifisch praktischen Wissenschaft davon auszugehen, daß sich die Frage auf die Wissenschaftlichkeit einer Tätigkeit richtet. Strittig kann nur sein, ob die Tätigkeit in den sogenannten theoretischen Diziplinen der in den praktischen soweit gleicht, daß man in beiden Fällen das gleiche Prädikat der Wissenschaftlichkeit verwenden kann. Diese Frage besitzt insbesondere mit Bezug auf die Medizin und deren Wissenschaftsverständnis hohes Interesse.
1. Die These von der Unmöglichkeit einer spezifisch praktischen Wissenschaft Geht man vom herkömmlichen Bild der theoretischen Wissenschaften aus, so ist festzustellen, daß die Tätigkeit eines theoretischen Wissenschaftlers so nachgezeichnet wird, als sei sie wesentlich von Hypothesenbildung und Deduktionen aus diesen Hypothesen innerhalb eines allgemeinen theoretischen Rahmens gekennzeichnet. Akzeptiert man dieses wissenschaftstheoretisch einflußreiche Bild für den Augenblick, so ist zu fragen, ob praktische Disziplinen ähnliche "deduktive" Merkmale oder die nämlichen Merkmale in ähnlicher Ausprägung aufweisen wie theoretische. Das führt zu zwei grundsätzlichen Alternativen: 1. Der Tätigkeit in einer praktischen Wissenschaft wird zumindest in einem Kernbereich eine Gemeinsamkeit mit wissenschaftlicher Tätigkeit nicht abgesprochen. Dann erscheint die Frage nach weiteren oder zusätzlichen Spezifika der in diesem "deduktiven" Sinne wissenschaftlichen praktischen Disziplinen weit weniger aufregend. Es mag zwar solche Spezifika geben, doch diese sind gleichsam außerhalb des von praktischer und theoretischer Wissenschaftlichkeit geteilten Kernbereiches deduktiven Vorgehens angesiedelt.
Zur Methodologie der praktischen Wissenschaften
99
2. Eine Übereinstimmung hinsichtlich des deduktionsorientierten, schlußfolgernden Charakters der Tätigkeiten in theoretischen bzw. praktischen Disziplinen ist nicht festzustellen. Dann würde das Prädikat "praktische Wissenschaft" vollkommen heterogene Bestimmungen verbinden und seine Erfüllungsmenge deshalb leer sein. Dies würde zwingend folgen, falls man das Spezifische an der Tätigkeit in den praktischen Disziplinen gerade im Sinne einer Abweichung von dem Vorgehen in den theoretischen Disziplinen charakterisieren wollte. Damit scheint sich folgendes Resultat zu ergeben: Entweder ist die Konzeption einer spezifisch praktischen Wissenschaft von vornherein irreführend, oder sie ist weitgehend konsequenzenlos und trivial. Wenn die betreffende Tätigkeit wirklich "spezifisch" ist, dann ist sie nicht "wissenschaftlich", und ist sie "wissenschaftlich", dann eben nicht "spezifisch". Dies scheint eine elegante A priori-Lösung eines komplexen Problems zu sein. Gegenüber jenen, die an der Wissenschaft so ziemlich alles ablehnen außer deren gutem Ruf, den sie gern auch für ihre spezifische "wissenschaftliche" Praxis in Anspruch nehmen würden, ist das Argument auch durchaus schlagend. Spezifizität wird von diesen ja gerade im Gegensatz zur Wissenschaftlichkeit im herkömmlichen Sinne begriffen und darf deshalb nicht ohne Irreführung unter der gleichen Flagge segeln. Angesichts einer so lange wirkenden und unter so vielen seriösen Wissenschaftlern verbreiteten Überzeugung wie der von einer spezifisch praktischen Wissenschaft sollte man sich allerdings erst nach reiflicher Überlegung auf eine derartige "apriorische" Altemativ-Argumentation verlassen. Man sollte sicher sein dürfen, daß man mit der Entgegensetzung von Spezifizität und Wissenschaftlichkeit nicht eine Scheinalternative eröffnet hat, die keineswegs erschöpfend ist, sondern weitere Möglichkeiten der Argumentation verschleiert Diese Sicherheit besteht jedoch nicht. Spätestens seit Wittgenstein das Konzept der Familienähnlichkeit einführte und die damit verbundenen Sachverhalte untersuchte, wissen wir, daß nicht alle rechtmäßig unter einen Begriff fallenden Gegenstände notwendig eine gemeinsame Eigenschaft aufweisen müssen. So gesehen, könnte es irreführend sein, von einer oder mehreren Kerneigenschaften auszugehen, die allen wissenschaftlichen Tätigkeiten gemeinsam sind. Damit ist klar, daß die Anhänger der These von einer spezifisch praktischen Wissenschaft jedenfalls nicht ohne weitere Analyse aus dem Felde geschlagen werden können. Es ist
100
Hartmut Kliemt
durchaus möglich, daß legitim als wissenschaftlich bezeichnete Tätigkeit heterogene, "spezifische" Phänomene umfaßt. Die Prämisse der obigen Alternative, daß Heterogenität und einheitliche Bezeichnung nicht ohne Irreführung zusammengehen können, ist nicht a priori gültig. Die Alternativargumentation, entweder sei die Tätigkeit in den praktischen Disziplinen nicht spezifisch oder nicht wissenschaftlich, sticht insoweit nur gegen einige grobschlächtige Varianten der These von der spezifisch praktischen Wissenschaft. Man kommt nicht darum herum, zu untersuchen, wie groß die Heterogenität der Tätigkeit in praktischen und theoretischen Disziplinen tatsächlich ist.
2. Kennzeichen wissenschaftlicher Tätigkeit im herkömmlichen Verstände Die nach herkömmlicher Auffassung hervorragendste Eigenschaft wissenschaftlicher Tätigkeit ist die "Objektivität" und "Verbindlichkeit" wissenschaftlicher Äußerungen. Objektivität wissenschaftlicher Äußerungen beruht darauf, daß sie sich in intersubjektiv nachvollziehbarer Weise prüfen lassen. Die Herstellung von intersubjektiver Prüfbarkeit wiederum setzt ein normierendes Regelsystem voraus, an dem sich jedes prüfende Subjekt orientieren kann. Bei Existenz eines solchen Regelsystems wird die Schlüssigkeitsprüfung von Argumenten zu einem nicht privaten, sondern öffentlichen Prozeß, der in Sonderheit eine wechselseitige Konkurrenz und Kontrolle und damit jenes Maß oder jene Art von Objektivität und Verbindlichkeit erzeugt, das wir mit Wissenschaftlichkeit allgemein verbinden. Deduktives Rechtfertigen aus explizit angegebenen allgemeinen oder speziellen Prämissen besitzt, so nimmt man allgemein an, für diese Intersubjektivitätserzeugung in den theoretischen Wissenschaften eine zentrale Funktion. Dadurch wird zumindest ein Teil wissenschaftlicher Überlegungen in einer definitiven, intersubjektiv unstrittigen Weise prüfbar. Denn als Wissenschaftler kann nach allgemeinem Verstände jedenfalls der nicht gelten, der logische Fehlschlüsse akzeptiert. Andernfalls würde er sich selbst als nicht zugehörig zur Wissenschaftlergemeinschaft qualifizieren. Es mag zwar manchmal schwierig sein, logische Fehlschlüssigkeit zu prüfen. Strenggenommen muß überdies niemand "logik-gemäß handeln" und die Regeln der Logik anerkennen. Wie bei allen Regeln existiert auch bei
Zur Methodologie der praktischen Wissenschaften
101
den sogenannten Denkgesetzen der Logik im Gegensatz etwa zu Naturgesetzen die Möglichkeit des Verstoßes. Es besteht allerdings Einigkeit darüber, daß man nicht gegen Gesetze der Logik verstoßen soll. Die Einmütigkeit in diesem Punkt besagt jedoch keineswegs, daß nicht neben den rein logischen Regeln noch andere Regeln rationalen Vorgehens von Bedeutung sind. Hierzu gehören vor allem zwei Typen von Regeln: 1. Regeln, die theoretische Sätze mit Erfahrungssätzen in Verbindung bringen; 2. Regeln, die die Erfahrungssätze mit unmittelbarer Erfahrung verknüpfen. Regeln der ersten Art sind die typischen methodischen Grundsatzregeln, wie sie etwa als "induktive Logik", als "Regeln des statistischen Schließens", als "Bestätigungs- bzw. Falsifikationsregeln" vorgeschlagen und diskutiert werden. Diese Regeln setzen, soweit sie dem Rechtfertigungszusammenhang unserer Erkenntnisse zugehören, sämtlich deduktive Zusammenhänge voraus. Sie mögen untereinander partiell inkompatibel sein, doch die mit ihnen verbundenen Probleme beziehen sich mindestens in ebensolcher Weise auf die theoretischen wie die praktischen Disziplinen. Deshalb können sie nicht ausschlaggebend für eine spezifisch praktische Wissenschaftlichkeit sein. Die Regeln der zweiten Art suchen Erfahrungssätze mit Erfahrungen zu verknüpfen. Sie verbinden wissenschaftsöffentlich Zugängliches mit "privaten" Akten. Wenn sie etwa verlangen, daß Beobachtungen allgemein nachvollziehbar und dazu wiederholbar sein müssen, zeigt sich darin, daß die Erfahrungen jedenfalls nur von Individuen und damit in gewisser Weise nur "privat" oder nur "nicht-öffentlich" gemacht werden können. Objektivität im Sinne der Intersubjektivität findet hier in letzten Schlickschen Konstatierungen von intersubjektiv zugänglichen bzw. "öffentlichen Protokollsätzen" eine natürliche Grenze. Die ältere empiristische Lehre stellte sich unter den fundamentalen Konstatierungen immer einfache Feststellungen von der Art "hier jetzt rot" etc. vor. Diese Einfachheit sollte ungeachtet der Privatheit der Erfahrung intersubjektivierend wirken. Die betreffende Grenze der Intersubjektivierung ist dann zwar nicht überwindbar, doch liegen jenseits dieser Grenze nur ganz triviale, extrem einfache Evidenzerlebnisse, hinsichtlich deren Individuen je für sich weitgehend übereinstimmen. Damit schien Objektivität durch intersubjektive Kontrolle vernünftig nicht bestreitbarer Evidenzen gesichert.
102
Hartmut Kliemt
3. Einwände und Gegenbeispiele gegen die traditionelle empiristische Objektivitätskonzeption Schon früh wurde gegen die skizzierte Konzeption eingewandt, daß nicht notwendig einfache, in klassisch protokollsatzmäßiger Form erfaßbare Sachverhalte konstatiert werden müssen. Sehr komplexe gleichsam ganzheitlich oder als Gestalt erfahrbare Sachverhalte können ebenfalls unmittelbar zugängliche Basiserfahrungen bilden. Es ist eine zusätzliche - denkt man an das Problem der dualen Sprachkonzeption und der theoretischen Terme -, nicht gerade sinnvolle methodische Regel, zu verlangen, daß die Prüfinstanzen einer Theorie in einfachste Einzelevidenzen auflösbar sein müssen. Hier sei nur die lange unbeachtet gebliebene Schrift Ludwik Flecks über die Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache genannt (vgl. 1980 - erstmals 1935). Fleck sucht dort die Denkstilgebundenheit unserer Sehweisen und Erfahrungen hervorzuheben, die zu einer Art Gestaltsehen führt, das sich einer Auflösung in Einzelerfahrungen weitgehend entzieht. Jeder Wissenschaftler übt sich in den Denkstil ein. Das geschieht unter Anleitung bereits erfahrener Angehöriger jenes Denkkollektivs, das über den Denkstil verfügt. Intersubjektive Übereinstimmung wird in den stilgebundenen Bereichen nicht nach Regeln, sondern nur indirekt über den von praktischen Übungen vermittelten Initiationsritus des Denkkollektivs erreicht. Praktische Erfahrung (oder "Ablichtung" im Sinne Wittgensteins) ist ausschlaggebend und nicht das Erlernen und Anwenden eines allgemeinen Theorien- und Regelkanons auf ein gegebenes Material. Dies kann man radikalisieren, indem man zu einer strikt situationsgebundenen Sichtweise übergeht. Danach ist es allein möglich, sich in Urteilssituationen zu versetzen und alle verfügbaren Informationen je individuell kunstgerecht miteinander zu verknüpfen. Intersubjektive Überprüfung kann nur von einem "Experten" durch kunstvolle Einsicht und nicht durch Anwendung von Regeln zur Verknüpfung des Erfahrungsmaterials mit der Theorie vollzogen werden. Der Experte agiert aufgrund seiner "Erfahrung" kunstgerecht, doch nicht nach "den Regeln der Kunst". Denn es gibt keine derartigen allgemeinen Regeln, nach denen er sein Handeln ausrichten könnte. Das sind starke Thesen. Sie lassen sich jedoch augenscheinlich durch einige allgemeine Beobachtungen über intelligentes menschliches Verhalten
Zur Methodologie der praktischen Wissenschaften
103
in- und außerhalb der Wissenschaften stützen. Daraus ergeben sich anscheinend auch Belege für die These von der spezifisch praktischen Wissenschaft, in jedem Falle aber Hinweise auf tiefere Gründe, die zu der Popularität der These geführt haben könnten. Drei einschlägige Beobachtungen mögen hier genügen: 1. Schachspielen: Der Schachspieler zeigt ein Verhalten, das man als Paradigma strategisch zielbewußter menschlicher Zielverfolgung ansehen kann. Ein Schachspieler der Spitzenklasse kennt eine Vielzahl von schachtheoretischen Überlegungen und von diesen vorgeschlagenen generellen Regeln. Dennoch spielt der Schachspieler nicht - jedenfalls nicht durchgängig - nach diesen Regeln. Wäre dies so, dann könnte man Computer mit diesen Regeln programmieren und sie würden sich schon heute als jedem Menschen überlegen erweisen. Tatsache ist jedoch, daß der menschliche Experte dem Computer - jedenfalls bislang - überlegen bleibt, weil er etwa das, was die Schachspieler Positionsgefühl nennen, entwickelt. Was als guter Zug zu gelten hat, ergibt sich im Einzelfall einer konkreten Stellung auf dem Brett nicht aus den allgemeinen Regeln der Lehrbücher. Diese können als Anhaltspunkte oder Heuristiken dienen. Letztlich ist man jedoch auf das Expertenurteil angewiesen, wenn man die Qualität eines Zuges aus der je spezifischen Spielsituation heraus beurteilen möchte. 2. Medizin: Die in jüngerer Zeit in den Bereich der praktischen Anwendbarkeit vorstoßenden medizinischen Diagnoseprogramme versuchen, sogenanntes Expertenwissen in allgemeine Regeln umzusetzen. Sie gehen von der Arbeitshypothese aus, daß es solche Regeln gibt und daß ihre Anwendung ausschlaggebend für kunstgerechtes Verhalten ist. Ein führender Forscher auf diesem Gebiet stellt zwar fest: "Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß ein Großteil dieses Wissens vom Experten fast als etwas Privates gehütet wird, nicht weil er sich weigern würde, öffentlich zu machen, wie er vorgeht, sondern weil er dazu gar nicht im Stande ist. (Warum sonst sind die Jahre der Doktorandenzeit oder der klinischen Praktika der Ärzte eine zunftähnliche Lehre für einen späteren 'Meister des Handwerks'? Was die Meister wirklich wissen, steht in den Lehrbüchern der Meister nicht drin.)" (Feigenbaum zitiert nach Dreyfuss 1985,292). Der soeben zitierte Fachmann Feigenbaum glaubt aber, daß man das Expertenwissen dennoch freilegen und in Regeln fassen kann. Aufgrund sei-
104
Hartmut Kliemt
ner Arbeitshypothese geht er von dem handlungsleitenden "All-and-someSatz" aus, daß sich letztlich alles Wissen in Regeln fassen und systematisieren läßt. Obschon er anerkennt, daß die Erforschung der Repräsentation von Expertenwissen einen sehr schwierigen und mühsamen Weg vor sich hat, glaubt er, daß das betreffende Forschungsprogramm der Regelrepräsentation letztlich Erfolg haben wird. Demgegenüber hält ein führender Kritiker der Künstlichen-Intelligenz-Forschung (kurz: KI-Forschung) das zugrundegelegte Forschungsprogramm für ein degeneratives. Hubert Dreyfuss bemerkt in seinem auch in deutscher Übersetzung erschienenen Werk über die Grenzen der künstlichen Intelligenz: "Wenn die wesentlichen Bedingungen für das Urteilsvermögen von Experten in einem ausgedehnten Praktikum und dem Anwenden von Beispielen bestehen, wenn es also für das, was mit Hilfe von Regeln verstanden wird, eine Grenze gibt, dann wird Feigenbaum sie nicht zu Gesicht bekommen - am wenigsten in Bereichen wie der Medizin" (Dreyfuss 1985, 292f.). Wolfgang Wieland als ein Philosoph, der sich der Medizin zugewandt hat, scheint ganz ähnliche Gedanken zu hegen, wenn er in seinem Buch "Diagnose" (1975) den praktischen Charakter der Medizin betont. Er sucht diesen Gedanken zu stützen, indem er auf den "Handlungscharakter" von Diagnosen verweist. Darüber hinaus hebt er ihre Bezogenheit auf den Einzelfall und damit ihre Singularität hervor. Dieser Singularität der kunstgerechten medizinischen Beurteilung stellt er die allgemeine Ausrichtung des im theoretischen Sinne wissenschaftlichen Urteiles entgegen. Mit dem Beurteilungskonzept eng verwoben ist für den Aristoteles-Kenner Wieland die Vorstellung eines "topischen Vorgehens". Wieland, der, nebenbei bemerkt, große Hoffnungen auf den Einsatz des Computers in der medizinischen Diagnostik setzt, greift nicht auf die KI-Forschung, sondern auf das viel ältere Denkmuster der Topik zurück. In diesem Zusammenhang nimmt er zustimmend auf Theodor Viehwegs Überlegungen zum Verhältnis von "Topik und Jurisprudenz" (1975) Bezug. Er sieht eine starke Parallelität zwischen der Einzelfall- oder Problembezogenheit, die seiner Meinung nach für Beurteilungen in der Medizin wie in der Jurisprudenz ausschlaggebend ist. Was Wieland mit seinem Verweis auf Topik meint, mag deshalb der Kürze halber sogleich am Beispiel der Jurisprudenz skizziert werden. 3. Jurisprudenz: Theodor Vieh weg hat in seinem Buch (1974) zur Topik versucht, das antike Konzept einer Kunst, die in einem spezifischen Sinne
Zur Methodologie der praktischen Wissenschaften
105
zugleich nicht-verallgemeinerbare Praxis und Wissenschaft ist, zum Verständnis der neuzeitlichen Jurisprudenz heranzuziehen. Der Kerngedanke Viehwegs beruht auf einer an historischen Berichten herausgearbeiteten Unterscheidung zwischen verschiedenen Typen von "scientiarum instrumenta". Er unterscheidet die alten wissenschaftlichen Methoden als topische von den neuzeitlichen, die er als kritische und axiomatisch-deduktive begreift (vgl. Viehweg 1975, S. 16). Was genauer unter dieser Unterscheidung zu verstehen ist, dafür argumentiert Viehweg jedoch nur versteckt. Hinter einem ganzen Arsenal häufig recht heterogener, überdies in historische Berichte gekleideter Bemerkungen scheint sich jedoch eine Grundintuition zu verbergen, die man vor dem Hintergrund der zuvor skizzierten Überlegungen zum Expertenwissen wie folgt rekonstruieren könnte: Es gibt Kenntnisse, die sich nicht in allgemeine Regeln fassen lassen. Die aus solchen Kenntnissen heraus über konkrete Problemsituationen gefällten Urteile können nicht durch eine Subsumption unter ein System allgemeiner Regeln gerechtfertigt und auch nicht nach allgemeinen Regeln in einfache Basisurteile "aufgelöst" werden. Die alte topische Methode versuchte dem Rechnung zu tragen, indem sie für solche Situationen gewisse Kunstregeln angab, die es Urteilenden erlauben sollten, selbst die richtige "ganzheitliche" Beurteilung zu finden. Intersubjektive Bestätigung kann in solchen Fragenbereichen nur daraus resultieren, daß ein anderes Subjekt selbst zum gleichen Urteil kommt, ohne daß ihm dazu eine Regel den Grund liefern oder es sein Urteil gegenüber anderen durch Verweis auf Regeln rechtfertigen könnte. Nach dieser Auffassung wird die richtige Beurteilung durch Subsumption unter Regeln weder gefunden noch gerechtfertigt. Sie wird vom erfahrenen Experten "privat" konstatiert. Die Richtigkeit einer Urteilsbildung ergibt sich nicht aus von Expertenurteilen unabhängigen Kriterien, sondern allein daraus, daß die Experten untereinander übereinstimmen bzw. sich wechselseitig "korrigieren", indem sie überwiegend einem anderslautenden Urteil widersprechen. (Man könnte hier in Analogie zu Kripkes (1987) skeptischer Lösung des sogenannten skeptischen Paradoxes des Bedeutungsverstehens von einer skeptischen Lösung des Objektivitätsproblems sprechen.) Die Kunstregeln, Gesichtspunkte oder Topen werden als Hilfen für die Urteilsbildung ausschließlich von dem urteilenden Subjekt benutzt Sie erlauben also als solche keine Rechtfertigung von Urteilen. Sie richten vielmehr die Aufmerksamkeit auf bestimmte "Orte", ohne im voraus allgemein
106
Hartmut Kliemt
zu bestimmen, was sich dort finden wird. Das erklärt den Bezug auf Cicero und die häufige Rede von der "ars inveniendi" bei Viehweg. Darüber vernachlässigt Viehweg zweifelsohne zu sehr den rechtfertigenden Aspekt, den die aristotelische Topik ebenfalls besitzt und den er selbst notwendig in Anspruch nehmen muß, um seiner These wirkliches Interesse zu sichern (vgl. dazu Hegselmann, 1985). Zutreffend ist allerdings in jedem Falle, daß es dem topischen Denken nicht darum geht, zu zeigen, wie man aus vorgegebenen generellen Prämissen von der Form des klassischen "Alle Menschen sind sterblich" zu der Folgerung gelangt, daß auch Sokrates sterblich ist. Die Topoi sind keine allgemeinen Regeln, unter die man ein singulares Urteil in deduktiver Rechtfertigung subsumieren könnte. Mit ihnen könnte man in der Deutung als Erfindungsregeln allenfalls ein bestimmtes, dem eigenen Urteil vorgelagertes Verhalten rechtfertigen, indem sie einen Grund etwa dafür bilden, daß man die Aufmerksamkeit gerade auf den Faktor χ anstatt auf den Faktor y gerichtet hat (vgl. auch die Ähnlichkeit zu Homans' "orientierenden Feststellungen", 1972). Topoi sind zunächst weitgehend heuristische Faustregeln oder Gesichtspunkte, die ein generelles Problemlösungsverfahren nur vorstrukturieren wollen. Hierin gleichen sie fast aufs Haar bestimmten Strebungen der frühen KI-Forschung, die einen "General Problem Solver" (GPS) aus ganz wenigen und einfachen heuristischen Regeln bilden wollte. Daß Topiker wie KI-Forscher bislang ihr Ziel nicht erreichten, einen generellen Problemlösungsmechanismus für unklare, nur meinungsmäßig strukturierte Wissenssituationen anzugeben, sollte im gegenwärtigen Zusammenhang nur am Rande interessieren. Es verweist uns allerdings erneut auf die Frage, woran dies liegen mag. Die Antwort könnte möglicherweise sein, daß man sich von der Wiederbelebung der Topik ebenso wenig wie vom Fortschritt der Computer-Programmierung eine generelle Problemlösungsheuristik erhoffen sollte. Daß jedoch jene Intuition, die Theoretiker wie Viehweg und Wieland zur Rückbesinnung auf Topik führte, Ausdruck eines universellen Sachverhaltes intelligenten menschlichen Verhaltens ist: Der Tatsache nämlich, daß wir uns wesentlich an Einzelfallerfahrungen orientieren und von diesen durch eine nicht mehr durch explizite Regeln zu steuernde Analogiebildung zu anderen Fällen übergehen. - Ich denke, jedenfalls die weit überwiegende Mehrzahl praxiserfahrener Mediziner wird zustimmen, daß hiermit ein wesentlicher Aspekt medizinischer Praxis benannt wird. Es stellt sich allerdings die Frage, ob dies nicht letztlich
Zur Methodologie der praktischen Wissenschaften
107
doch die medizinische Praxis - so rational und intelligent sie auch sein mag - als verschieden von wissenschaftlicher Praxis im allgemeinen qualifiziert und damit der These von der Medizin als einer spezifisch praktischen Wissenschaft entgegensteht.
4. "Praktische" Aspekte auch der theoretischen Wissenschaft Wenn die Orientierung an Analogien, die an paradigmatische Erfahrungen oder Fälle anknüpfen, eine universelle Eigenschaft menschlichen Rationalverhaltens bildet, dann muß dies für die theoretischen Disziplinen ebenso wie für die praktischen gelten. In der Tat passen nicht nur die bereits erwähnten Ausführungen von Fleck - oder etwa Michael Polanyis These von der Rolle impliziten Wissens (vgl. u. a. 1985) - zu diesen Überlegungen. Neuere Entwicklungen der Wissenschaftstheorie, wie sie sich im Gefolge von Kuhn ergaben, vor allem aber auch die sogenannte strukturalistische Wissenschaftsauffassung mit ihrem von Wolfgang Stegmüller (vgl. etwa 1969, Bd. 2, zweiter Halbband) betonten Konzept der bewußt unscharf durch paradigmatische Fälle bestimmten und insoweit offengehaltenen Menge intendierter Anwendungen fügen sich nahtlos ins Bild. Möglicherweise sind demnach die tieferen Gründe dafür, daß sich der Gedanke an eine spezifisch praktische Wissenschaft so lange halten konnte, besser fundiert, als es zunächst den Anschein haben mag. Nach einer allgemeinen Erfahrung gibt es eine nicht unter allgemeine Sätze und Regeln zu bringende Beurteilungskunst, die eine charakteristische Rolle in jeder wissenschaftlichen Tätigkeit spielt. Die Beherrschung dieser Kunst erwächst aus je individueller Erfahrung und Einübung und nicht aus kognitiv auf direktem Lehrwege vermittelbaren allgemeinen Kenntnissen. Man erkennt damit die für die praktische Wissenschaft reklamierten Charakteristika partiell an. Man gesteht zu, daß die Anhänger der These von der spezifisch praktischen Wissenschaft insoweit möglicherweise weitsichtiger waren als die Anhänger klassischer wissenschaftstheoretischer Auffassungen. Darüber darf man allerdings nicht vergessen, daß die getroffenen Feststellungen dann für Wissenschaft im allgemeinen gelten und die These von der Spezifizität damit gerade hinfällig wird. Es hat sich vielmehr und gleichsam "umgekehrt" nur gezeigt, daß die Tätigkeit in der
108
Hartmut Kliemt
theoretischen Wissenschaft ein starkes Element "kluger Praxis" oder eingeübter "Kunst" aufweist Dennoch darf man im Gegensatz zum Vorgehen vieler Anhänger der These von einer spezifisch praktischen Wissenschaft das theoretischer wie praktischer Wissenschaft zugehörige Element der Kunst nicht überbewerten. Der Erfolg der modernen Wissenschaften wäre gar nicht erklärlich, wenn nicht neben das individuelle oder private Expertentum eine öffentliche Rechtfertigung und Diskussion getreten wäre, in der die Angabe allgemeiner Sätze und Regeln und die Subsumption von Fällen unter diese eine entscheidende Rolle gespielt hätten. Wissenschaftliche Arbeitsteilung und wechselseitige Prüfung ist eben nur deshalb möglich, weil die Einzelforscher sich über die reine Kasuistik hinauswagen. Selbst wenn denn beispielsweise ein jedes Individuum ein eigener "Kosmos" wäre, der idealerweise die Bildung einer je spezifischen Theorie erforderte, um eine medizinische Behandlung vorzubereiten, so würde dies nichts an der Tatsache ändern, daß wissenschaftliche Praxis als soziale Institution, wie wir sie kennen, gerade das Absehen vom Einzelfall erfordern würde. Selbst wenn man den kluger Beurteilung entspringenden kasuistischen Analogieschluß des Experten nicht in allgemeine Regeln auflösen kann, so beruhen doch der Fortschritt der Wissenschaft und ihre soziale Kontrollstruktur wesentlich auf der allmählichen Ablösung dieser Art von Schlüssen durch deduktive Anwendung allgemeiner Schlüsse und Regeln. Dennoch: Einen bestimmten Anteil wissenschaftlicher Rechtfertigung wird man niemals dem reinen Expertenurteil entziehen können. Das ist insofern, als es einer Konstatierung prüfender Erfahrungen in dem früher erwähnten Schlickschen Sinne bedarf, um die Testinstanzen in den intersubjektiv zugänglichen Bereich des wissenschaftlichen Interaktionssystems zu bringen, trivial und niemals bestritten worden. Weniger trivial ist es, daß diese Grundurteile von Experten - wie ebenfalls bereits festgestellt - möglicherweise recht komplexe denkstilgebundene Erfahrungen zum Ausdruck bringen und nicht nur Feststellungen von der Form "hier jetzt rot". Schließlich scheint es klar zu sein, daß wissenschaftliche Tätigkeit, soweit sie sich nur auf den Entdeckungszusammenhang der Erkenntnis bezieht, selbstverständlich von der Erfahrung und Kreativität des Experten getragen wird. Alles dies sind praktische Aspekte wissenschaftlicher Tätigkeit, die den Anhängern der These von der praktischen Wissenschaft wiederum vermutlich besser bewußt waren als ihren Gegnern. Wenn sie den "prak-
Zur Methodologie der praktischen Wissenschaften
109
tischen" Charakter wissenschaftlicher Tätigkeit betonen, so haben sie insoweit weitgehend Recht. Die unter Praktikern in Sonderheit der Medizin und Jurisprudenz anzutreffende Auffassung, von der Tätigkeit in den theoretischen Wissenschaften, die sich an einem bestimmten Bild von Mathematik und Logik als eines mechanisch subsumptiven Vorgehens orientiert, ist demgegenüber ein aus Unkenntnis geborenes Vorurteil. Abgesehen von der formalen Unentscheidbarkeit aller wirklich interessierenden Theorien wird die Tatsache verkannt, daß man vermutlich in keiner Disziplin ein solches Maß an oft überraschender Kreativität findet wie gerade in der Mathematik. Kaum irgendwo sonst wird deshalb in einem solchen Maße auf die Einübung von Expertenfähigkeiten durch selbständige Aufgabenlösung Wert gelegt wie in dieser deduktiven Disziplin. Deduktivität bezieht sich in den formalwissenschaftlichen Disziplinen eben primär auf den Rechtfertigungszusammenhang der Erkenntnis. Man erfindet einen neuen Beweis und zeigt damit, daß sich ein bestimmtes Theorem aus einer Menge von Axiomen folgern läßt. Dieses Folgern aus einem fixen System von Axiomen findet man in den nicht-formalen Einzelwissenschaften zwar nur für beschränkte, axiomatisierte Bereiche - wie etwa die klassische Newtonsche Mechanik - oder axiomatisierte Teile der wirtschaftswissenschaftlichen Analyse - wie etwa die sogenannte Aktivitätsanalyse und die allgemeine Gleichgewichtstheorie. Doch das Fehlen entsprechender Axiomatisierungen kann für den Anhänger der These von einer spezifisch praktischen Wissenschaft nicht den Ausschlag geben. Er muß vielmehr betonen, daß in den praktischen Disziplinen überhaupt nicht aus vorgegebenen allgemeinen Sätzen oder Regeln gefolgert wird - seien diese nun axiomatisiert oder nicht. (Deshalb bezeichnet ein Theoretiker wie Wieland es nachdrücklich und insoweit folgerichtig als verfehlt, Medizin als angewandte Naturwissenschaft zu begreifen. Es gehe nicht um die Anwendung vorgegebener Regeln. Entsprechend betont Viehweg, daß in der Jurisprudenz nicht aus dem vorgegebenen Gesetz und Recht "mechanisch" gefolgert werde.)
110
Hartmut Kliemt
5. Folgerungen für das Verhältnis von theoretischer und praktischer Wissenschaft und unsere wissenschaftlichen Ideale Nach den bisherigen Überlegungen scheint letztlich die Unmöglichkeit, auf eine fixe Menge allgemeiner Sätze oder Regeln Bezug zu nehmen, von den Anhängern der These einer spezifisch praktischen Wissenschaft zum entscheidenden Charakteristikum einer solchen Wissenschaft erhoben zu werden. Entsprechend betont Wieland, daß die Anwendung von Regeln nicht selbst bis ins letzte von Regeln bestimmt sein könne (vgl. 1975, S. 95 ff.). Doch selbst dann, wenn man ihm und Viehweg insgesamt konzedieren würde, daß der nicht nach allgemeinen Sätzen und Regeln bestimmbare Bereich in den praktischen Disziplinen aufgrund der Situationsgebundenheit der Praxis von besonderer, von herkömmlicher Wissenschaftstheorie nicht hinreichend gewürdigter Bedeutung sein mag, sind zwei zusätzliche Feststellungen zu treffen. Zum ersten muß auch hier wiederum besonderes Gewicht auf die Forderung gelegt werden, zwischen Rechtfertigungs- und Entdeckungszusammenhang zu unterscheiden. Jede wissenschaftliche Tätigkeit und damit auch die in einer praktischen Disziplin muß diese beiden Rollen genau trennen. Der Erfolg der neuzeitlichen Wissenschaft beruht ganz offenkundig wesentlich darauf, daß für den Rechtfertigungszusammenhang gerade die Berufung auf nicht-mitteilbare Expertenerfahrung in zunehmendem Maße nicht mehr als kunstgerecht gilt. Die einzige anerkannte Autorität ist die Deduktion aus Sätzen - einschließlich bestimmter Beobachtungssätze und induktiv-statistischer Prüfungs- bzw. Falsifikationsverfahren etc. - die in einem Denkkollektiv intersubjektiv anerkannt werden oder doch in dieser Weise prüfbar sind. Zweitens muß man grundsätzlich festhalten, daß rationales Vorgehen generell nur gewährleistet ist, wenn man weiß, welche Prämissen man dem allgemeinen Kodex einer Disziplin entnehmen kann und welche nicht. Der befähigte Experte gibt sich gerade dadurch zu erkennen, daß er sich dem allgemeinen Wissensfundus seiner Disziplin gemäß verhält. Nur innerhalb des so gezogenen Rahmens wird er sein "Fingerspitzengefühl" und damit seine private Erfahrung zum Tragen bringen. Nur so kann man wissen, was dem intersubjektiv bereits geprüften oder vereinbarten Fundus angehört und was nicht. Nur wenn man eine deduktive Rechtfertigung ver-
Zur Methodologie der praktischen Wissenschaften
111
sucht, kann man sich über die in einer Situation S notwendigen eigenen Zusatzprämissen klar werden. Allerdings ist klar, daß diese an deduktiver Rechtfertigung orientierte Vorgehensweise nur bis zu einer gewissen Grenze durchgehalten werden kann. Diese Grenze wird in bestimmten von geringen theoretischen Invarianzen gekennzeichneten Bereichen relativ früh erreicht werden. Dieser Hinweis ist wichtig gegenüber insoweit zu optimistischen Annahmen traditioneller Wissenschaftsbilder. Dennoch spricht nichts dafür, diese Grenze nicht so weit wie möglich hinauszuschieben und vor allem spricht nichts dagegen, sie zumindest nicht zu verwischen, sondern alles dafür, daß man anstrebt, sie so genau wie möglich zu erkennen bzw. sichtbar zu machen. So kann der Jurist - wie vor allem in jüngerer Zeit Hans-Joachim Koch und Helmut Rüssmann (vgl. 1982, S.5 und passim) betonten - deduktive Entscheidungsbegründung zum Rechtfertigungsideal erheben, ohne annehmen zu müssen, daß er sein Urteil aus dem Gesetz ableiten könnte. Er fügt dem Gesetz zwar eigene Prämissen hinzu. Durch das Festhalten an der Deduktivitätsforderung ist es ihm aber überhaupt erst möglich, diese Prämissen festzustellen und damit zu erkennen, an welchen Stellen er besondere Begründungslasten eingeht und möglicherweise auch hätte anders wählen und damit im Ergebnis anders entscheiden können. Ebenso mag der Mediziner, wie ihm in Methodenlehren der Diagnostik (vgl. etwa Groß 1969) empfohlen wird, zunächst eine Untersuchung ohne alle Hilfsmittel vornehmen und intuitiv eine möglicherweise von ihm zunächst gar nicht explizit begründbare Diagnose finden. Diese Entdeckung ist dann aber so weit wie möglich durch objektive Befunde zu belegen. Letztlich wird man ihm eine deduktive Begründung seiner Diagnose aus der jeweiligen intersubjektivierbaren Wissenssituation gerade dann abverlangen müssen, wenn man an rationaler Praxis interessiert ist. Dieser Zwang wirkt nach allgemeiner Erfahrung rationalisierend auf die Praxis. Die Anhänger einer spezifisch praktischen Medizinwissenschaft hätten hier zu zeigen, daß dieser Zwang zu einer - so weit wie möglich - im Rahmen allgemeiner Standards intersubjektiv nachvollziehbaren Rechtfertigung Zielen widerstreitet, die wir vernünftigerweise mit unserer Praxis in den sogenannten praktischen Disziplinen anstreben. Eine entsprechende Evidenz ist bislang jedoch nicht präsentiert worden. Was gezeigt wurde, ist allein, daß wir de facto häufig darauf angewiesen sind, uns auf das Expertenurteil zu verlassen, ohne eine detaillierte Regelkontrolle vornehmen zu können.
112
Hartmut Kliemt
Doch gerade in den Fällen, in denen die Experten zu unterschiedlichen Auffassungen kommen, zeigt sich, daß die deduktive Explizitmachung von Begründungen unser Ideal sein muß. Wenn wir uns hier nämlich nicht auf Abstimmungen (bzw. Aggregationsverfahren wie etwa die von Lehrer und Wagner (1981) vorgeschlagenen) zurückziehen wollen, dann ist das die einzige Möglichkeit, argumentativ einem Konsens doch noch näherzurücken. Man kann natürlich auch hier gleichsam über das Ziel hinausschießen. Man mag etwa in der Medizin versuchen, das Diagnoseverfahren selbst - ähnlich wie ein Gerichtsverfahren - nach bestimmten Regeln zu strukturieren. Dennoch wird man auf den Experten bei der Hypothesenbildung nicht zugunsten eines Diagnosealgorithmus, wie ihn etwa Hans Westmeyer (1972) in seiner "Logik der Diagnostik" vorgeschlagen hat, verzichten können. Zwar ist dieses Verfahren möglicherweise geeignet, sämtliches allgemein vorgebbares Wissen zu repräsentieren und insoweit den Diagnostiker nur zur empirischen Konstatierung von programmierten Fragealternativen heranzuziehen. Der wunde Punkt ist jedoch, daß sich das Wissen des Experten eben nicht gänzlich in allgemeiner Form repräsentieren läßt und daß damit ein Gutteil "stilbestimmter" Einzelerfahrung verbleibt. In den sogenannten praktischen Disziplinen ist dieser Anteil besonders hoch. Hier haben die Anhänger einer spezifisch praktischen Wissenschaft vermutlich auf einen wesentlichen Gesichtspunkt verwiesen, der allgemein in der wissenschaftlichen Methodologie zu wenig beachtet worden ist. Insofern scheint die zuvor aufgemachte Alternative zur Spezifizität der praktischen Wissenschaft in der Tat bedeutsame Gewichtungsmöglichkeiten zu verschleiern. Andererseits hat sich nach den voranstehenden Überlegungen auch herausgestellt, daß es eine einheitliche, auf das Deduktivitätsideal gegründete Form wissenschaftlicher Tätigkeit für den Rechtfertigungszusammenhang gibt und daß insoweit die praktischen Disziplinen den theoretischen gleichen. Rechtfertigung bringt stets die Bedingung der Öffentlichkeit und damit das Verlangen nach öffentlicher Nachvollziehbarkeit mit sich. Damit bleiben die traditionellen wissenschaftlichen Ideale untangiert. Nur unsere Einsicht darein, in wie beschränktem Maße wir diese Ideale erreichen können, ist gewachsen. Die Feststellungen über die Rolle von individualisiertem Expertenwissen können nicht begründen, vom Ideal der deduktiven Rechtfertigung für den intersubjektiven Kontext abzugehen. Nur durch logisch strukturiertes und
Zur Methodologie der praktischen Wissenschaften
113
damit deduktives Vorgehen erreicht man das mögliche Maß an Intersubjektivität von Rechtfertigungen. (Dabei heißt deduktives Vorgehen, wie ausgeführt, keineswegs "Deduktion aus vorgegebenen Axiomen", sondern das Bemühen um logisch stringente Begründung aus explizit gemachten Prämissen!). Dieses ist für die Wissenschaften insgesamt von zentraler Bedeutung, weil es allein Intersubjektivität der Begründungen und damit das erreichbare Maß an arbeitsteiliger Zusammenarbeit und objektiver Kontrolle ermöglicht. Für die Jurisprudenz kommt hinzu, daß die Forderung nach deduktiver Entscheidungsbegründung im richterlichen Kontext geradezu eine moralische ist. Das gilt jedoch möglicherweise für den Mediziner in ähnlicher Weise. Das blinde Vertrauen in die eigene Intuition scheint jedenfalls kein Wert zu sein, der vermittelt und gestützt werden sollte, wenn wir an einer möglichst rationalen medizinischen Praxis interessiert sind. Wer selbstkritisch die ärztliche Kunst ausüben will, wird gerade darauf angewiesen sein, vor sich selbst auszuweisen, was an seinen spezifischen eigenen Praktiken durch die anerkannten allgemeinen Praktiken und den diesen zugrundeliegenden theoretischen Vorstellungen gedeckt ist und was nicht. Wenn der erfahrene Praktiker dann letztlich doch gegen allgemein anerkannte Regeln bzw. Theorien verstößt, so sollte er dies offen aussprechen und auch rechtlich - im Gegensatz zur heutigen Übung - dazu ermuntert werden, diese Abweichung vom allgemein anerkannten Verfahren offen und nachvollziehbar mit Billigung des Patienten durchzufuhren. Nur dann wird es auch möglich sein, aus abweichenden Praktiken tatsächlich etwas zur Verbesserung der allgemeinen Praxis zu lernen. Diese m. E. von einer vernünftigen institutionellen oder Praxismoral der Medizin zu verleihende Autorisierung, die "allgemein anerkannten Regeln der ärztlichen Kunst" u. U. zu ignorieren, darf allerdings nicht dahingehend mißverstanden werden, daß sie zur allgemeinen Ignoranz der Regeln legitimiere. So, wie nur das Bemühen um Allgemeinheit und Bindung an gegebene Regeln von der Kadijustiz zur Rechtsstaatlichkeit führt, so kann nur das Bemühen um explizit regelgeleitete Praxis von der Voodoo-Medizin zur wissenschaftlichen Medizin führen.
114
Hartmut Kliemt
Literatur [1] Dreyfuss, H.L.(1985): Die Grenzen künstlicher Intelligenz. Königstein/Ts. [2] Heck, L. (1980): Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Frankfurt. [3] Groß, R. (1969): Medizinische Diagnostik - Grundlagen und Praxis. Berlin. [4] Hegselmann, R. (1985): Formale Dialektik. Hamburg. [5] Homans, G. C. (1972): Was ist Sozialwissenschaft. Opladen. [6] Koch, H.-J. und Rüssmann, H. (1982): Juristische Methodenlehre. München. [7] Lehrer, K. und Wagner, C. (1981): Rational Consensus in Science and Society. Dordrecht. [8] Kripke, S. (1987): Wittgenstein über Regeln und Privatsprache. Frankfurt. [9] Polanyi, M. (1985): Implizites Wissen. Frankfurt. [10] Schlick, M. (1938/1969): Gesammelte Aufsätze. Hildesheim. [11] Stegmüller, W. (1969): Ergebnisse und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Berlin. [12] Viehweg, Th. (1974): Topik und Jurisprudenz. München. [13] Westmeyer, H. (1972): Logik der Diagnostik. Stuttgart. [14] Wieland, W. (1975): Diagnose. Berlin und New York.
Medizin als Idealexemplar einer allgemeinen Wissenschaftstheorie: Ein historisches Beispiel Jan Helge Solbakk
1. Einleitung Der Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die wenig untersuchte Auffassung, daß nur "puristische" Formen der Wissenschaften in einer allgemeinen Wissenschaftstheorie annehmbar seien (Caplan 1986, S. 99).1 Dieser Glaube scheint in der modernen Wissenschaftstheorie eine dominierende Rolle zu spielen. Dies führt dazu, daß praktische Domänen der wissenschaftlichen Nachforschung, wie zum Beispiel die Baukunst oder die Landwirtschaft, ignoriert oder beiseite geschoben werden, weil sie als theoretisch uninteressant betrachtet werden (Caplan, ebd.). Ein Einfluss dieses wissenschaftstheoretischen Purismus läßt sich auch in Beiträgen der heutigen Medizin-Philosophie ("Philosophy of Medicine") deutlich spüren, und zwar hinter Aussagen wie, "Why Medicine cannot be a Science" (Munson 1981, S. 183) und "Medicine as a Form of practical Understanding" (Widdershoven-Heerding, 1987, S. 179). In diesem Artikel werden wir durch ein historisches Gegenbeispiel diese puristische Herrschaft in Frage stellen. Maßgebend für die Interpretation ist ein Gespräch sowie zwei medizinhistorische Arbeiten: Das PhilebosGespräch Piatons, P.Laing-Entralgos Arbeit über "Die ärztliche Hilfe im Werk Piatons" und Ernst Hoffmanns Arbeit über "Piaton und die Medizin".
116
Jan Helge Solbakk
2. Die Purismus-Dominanz als kontingentes Faktum. Ein historisches Gegenbeispiel Die Tatsache, daß die meisten Beispiele, oder "core cases of sciences" (Munson 1981, S. 189) den Gebieten der theoretischen Physik, Chemie oder Biologie entnommen sind, ist eine Tatsache von kontingenter Natur: Das heißt, der wissenschaftstheoretische Purismus stellt keine notwendige Tatsächlichkeit dar, sondern drückt nur eine historische Möglichkeit aus; denn in der Wissenschaftsgeschichte gibt es zumindest eine Alternative zum heutigen Purismus. Auf diese Alternative, die dem Corpus Platonicum entnommen ist, werden wir uns jetzt konzentrieren. Wir behaupten nicht, daß Piaton notwendigerweise die endgültige wissenschaftstheoretische Wahrheit besitzt, finden es aber richtig, seinen wissenschaftstheoretischen Beitrag ernsthaft auf die Frage hin zu überprüfen, ob hier ein gangbarer Weg aufgezeigt wird. Ein durchgehendes Merkmal der allgemeinen wissenschaftstheoretischen Reflexionen im Corpus Platonicum sind die zahlreichen Hinweise auf die Medizin. Diese Tendenz kommt nicht nur in den frühen sokratischen Dialogen (Kriton, Laches, Lysis, Charmides, Protagoras und Gorgias), sondern auch in den Arbeiten des späten Piatons (Nomon, Philebos, Timaios, Epistolai) deutlich zum Ausdruck. Diese Hinweise lassen sich in drei Kategorien oder drei Arten von Beziehungen Piatons zur Medizin einteilen: Erstens eine berufliche, zweitens eine begriffliche und drittens eine paradigmatische Beziehung. "Das erste Mal handelt es sich um Piatons eigene heilkundliche Ansichten; er tritt als theoretischmedizinischer Fachmann auf; das zweite Mal handelt es sich um den Philosophen der sich in ethischen, psychologischen, logischen Untersuchungen medizinischer Termini bedient" (Hoffmann 1922, S. 1074). Die paradigmatische Qualität, die der Heilkunst zugewiesen wird, läßt sich daran aufzeigen, daß auf die Medizin - im Gegensatz zur Steuermannskunst und Baukunst - nicht nur jedesmal verwiesen wird, "... wenn das Wesen einer wirklichen techne bezeichnet werden soll, sondern sie wird im Politikos 293b geradezu zur Wesensbestimmung der 'Königliche Wissenschaft', der 'Herrschaft' verwendet, und zwar sie allein unter allen Berufsarten" (Hoffmann, ebd). Die Rolle der Medizin als wissenschaftstheoretisches Idealexemplar kommt vielleicht am deutlichsten zum Aus-
Medizin als Idealexemplar
117
druck in Piatons Bestrebungen, eine wissenschaftliche Ethik zu entwickeln. Bevor wir uns weiter mit der idealexemplarischen Funktion der Medizin bei Piaton beschäftigen, müssen wir seine theoretische Begründung bzw. Legitimierung eines nicht-puristischen Wissenschaftsideals erst genauer untersuchen. Das bringt uns zum Spätwerk Piatons, und zwar zum Philebos-Gespräch. Das Hauptthema dieses Gesprächs ist die Frage "... welchem nemlich von beiden der Preis gebühre an menschlichen Leben, der Lust oder der Erkenntnis" (Schleiermacher 1826, S. 128). Beim ersten Anblick scheint die Auseinandersetzung zwischen Protarchos und Sokrates das Gespräch in drei Denkstufen zu strukturieren (Dies 1941, S. IX) : 1. Das höchste Gute des Lebens ist weder die Lust an sich (Protarchos), noch die reine Erkenntnis (Sokrates), sondern eine Mischung von beiden (lla-23b, 509 Zeilen). 2. In dieser Mischung kommt der Erkenntnis die Vorherrschaft zu (23c 31b, 395 Zeilen). 3. Alle Wissenschaften bzw. Künste sind in der Mischung "willkommen geheissen", von den Lüsten aber nur Wahrheit, Schönheit und Maß, d.h. Lüste, die auf die eine oder andere Art für die Charakterbeschaffenheit der Erkenntnis und der Weisheit konstitutiv sind. In dieser Weise ergibt die Auseinandersetzung eine fünfstufige Wertskala des Lebens: 1. Maß, 2. Schönheit, 3. Erkenntnis und Weisheit, 4. Wissenschaften und Künste, 5. reine Lüste (59e-67b , 330 Zeilen). Insgesamt macht dieses Hauptthema des Gesprächs 1164 Zeilen aus. Philebos umfaßt aber im Ganzen 2369 Zeilen, d.h., daß etwa 1200 Zeilen des Gesprächs (31b-59d) von der obengenannten Auseinandersetzung unberührt bleiben. In unserem Zusammenhang ist hervorzuheben, daß etwa 180 von diesen 1200 Zeilen (55c-59c) unserem Thema gewidmet sind, nämlich einer Analyse der Wissenschaften und Künste als gemischte Erkenntnisformen bzw. der Darstellung eines nichtpuristischen Wissenschaftsideals. Hinzu kommt, daß der letzte Teil des Gesprächs (59e-67b), ebenfalls grundlegend zu diesem Thema beiträgt.
118
Jan Helge Solbakk
Versuchen wir jetzt, die dialogische Argumentation Piatons zum Thema durch das Gespräch zu verfolgen. Piatons Ausgangspunkt ist zweifacher Art: Erstens eine Einteilung aller Erkenntnisformen in ausübende und ausbildende bzw. erzieherische Wissenschaften; und zweitens die Etablierung eines Trennungs-Kriteriums von Reinheit und Wahrheit (55c-d). Dieses Kriterium soll dazu dienen, um möglicherweise reinere und unreinere bzw. wahrere und unwahrere Erkenntnisteile aus den einzelnen Wissenschaften und Künsten ausscheiden zu können. Wenn jemand zum Beispiel aus allen Künsten die Rechenkunst und die Messkunst und die Waagekunst ausscheidet, was bleibt dann eigentlich übrig? Antwort: Nur etwas Geringfügiges, "... nichts übrig als Abschätzen nach Gutdünken und Einübung der Sinne durch Erfahrung (εμπειρία) und Gewöhnung, in dem man dazu nimmt was nur die glückliche Mutmassung vermag, welche viele auch eine Kunst nennen, die durch Anstrengung und Sorgfalt ihre Stärke erreicht" (55e). Die Tonkunst scheint sich in einer solchen Lage der Abschätzung nach Gutdünken und Mutmaßung zu befinden. Und, sagt Sokrates weiter, es scheint sich eben so mit der Heilkunst und dem Ackerbau und der Kunst des Seefahrers und des Heerführers zu verhalten (56b). Als ein exemplarisches Beispiel einer reineren Kunst schlägt Sokrates die Baukunst vor, weil ja diese Kunst sich der meisten Masse und Werkzeuge bedient, und deswegen genauer und "kunstreicher" als die meisten anderen ist (56b). Damit scheint die Einteilungsfrage auf festen Boden zu stehen (56c): "Teilen wir also die genannten Künste zwiefach: in solche, welche, der Tonkunst folgend, in ihren Werken nur geringerer Genauigkeit fähig sind, und in solche, die, der Baukunst folgend, größerer". Bei dieser Zweiteilung bzw. diesem Einordnungsverfahren stehen zu bleiben, würde bedeuten, die Rechenkunst, die Meßkunst und die Waagekunst als die genauesten unter den genaueren Künsten einzustufen. Hier folgt aber die erste dialektische Umwertung Piatons, wodurch er jetzt die obengenannte Einordnung der drei genaueren Künste in Frage stellt (56d):
Medizin als Idealexemplar
119
"Allerdings; aber, o Protarchos, müssen wir nicht sagen, daß auch diese wiederum zwiefach sind, oder wie?" Wenn man zum Beispiel die Rechenkunst genauer in Augenschein nimmt, muß man dann nicht zugestehen, daß das Bild keineswegs eindeutig ist? Allein schon deshalb, weil es erstens eine "gemeine" Rechenkunst gibt, und zweitens auch eine ganz andere, nämlich die der wissenschaftlichen? Die gemeine Rechenkunst rechnet immer der Zahl einander ungleiche Einheiten hinzu, "...wie zwei Läger oder zwei Ochsen und zwei Allerkleinste oder auch zwei Allergrößte" (56e). Die wissenschaftliche Rechenkunst spielt aber nicht mit ungleichen Einheiten herum, sondern setzt eine Einheit, welche von jeder Einheit der Teile durchaus nicht verschieden ist. Eine zweite Umwertung des vorangenannte Genauigkeitsanspruch der Baukunst wird von Piaton deshalb vorgenommen, weil die Berechnungen und das Messen der Baukünstler, sowieso nicht auf eine wissenschaftliche bzw. philosophische Weise betrieben wird. Diese zweite Umwertung bereitet den Boden einer folgenreichen Stellungnahme Piatons vor (57d): "Daß es eine zwiefache Rechenkunst gibt und eine zwiefache Meßkunst; und daß dieser ebenso mehrere andere solche folgen und dieselbe Zwiefältigkeit enthalten, wiewohl nur Eines Namens teilhaftig". Versuchen wir, was Piaton bis jetzt gesagt hat, kurz zusammenzufassen: 1. Es gibt ausübende und ausbildende bzw. erzieherische Wissenschaften und Künste. 2. Alle Wissenschaften und Künste lassen sich in reinere oder unreinere Erkenntnisformen einteilen. Dem Reinheitskriterium nach ist eine solche "Inter"-Scheidung zu grob. 3. Von jeder Wissenschaft oder Kunst lassen sich reinere und unreinere Erkenntnisteile ausscheiden. Dem Reinheitskriterium nach scheint deswegen eine "Intra"-Scheidung notwendig zu sein. 4. Es sei hier nicht gefragt, "...welche Kunst (τέχνη) oder Wissenschaft (επιστημη) vor allen anderen den Vorzug verdiene deshalb, weil sie
120
Jan Helge Solbakk
die größte und stärkste und uns am meisten Nutzen bringende ist; sondern welche das Gewisse und Genaue und das Wahrste im Auge hat..." (58c). Mit dem letzten Punkt hat Piaton nicht nur seine vorangehende Argumentation zusammengefaßt, sondern er hat auch eine neue dialektische Karte ins Spiel gebracht, wodurch implizit eine Umwertung des Reinheits- und Wahrheits-Kriteriums als ideal-wissenschaftliche Forderung erfolgt ist. Das heißt nicht, daß er das Kriterium als solches in Frage stellt, sondern nur, daß es ihm auf der weiteren Suche nach seinem Wissenschaftsideal nicht helfen kann. Anders ausgedrückt: Das Kriterium der Wahrheit und Reinheit hat gezeigt, daß es keine absolute reine bzw. wahre Wissenschaft oder Kunst gibt, oder geben kann, sondern nur gemischte Erkenntnisformen: "Also gibt es auch keinen Verstand davon noch eine Wissenschaft, die wirklich das Wahreste enthielte" (59b). In dem früheren Teil des Gesprächs, wo Piaton über das höchste Gute des Lebens sprach (19a-23b), haben wir gesehen, wie er gerade die Mischung als ideales Kriterium etabliert hat. Jetzt, wenn es um das Wissenschaftsideal geht, wendet er sich wieder dieser Erkenntnisform zu (61b): "So hat nun auch uns jetzt die Rede angedeutet wie auch schon im Anfang, das Gute nicht in dem ungemischten Leben zu suchen, sondern in dem gemischten (εν τ03 μεικτΦ)". Versuchen wir jetzt, die Ideal-Mischung auf der wissenschaftlichen Ebene bzw. das Wissenschaftsideal Piatons anzugeben. Es ist schon durch die Umwertung des Wahrheits- bzw. ReinheitsKriteriums klar geworden, daß die ideale Mischung nicht in der Kombination der wahrsten Abschnitte einer Erkenntnis von partikularen Dingen (d.h. eine Erkenntnis, "die auf das Werdende und Vergehende sehend"(61e)) mit den entsprechenden Abschnitten einer Erkenntnis, die auf das Allgemeine bzw. auf das "auf gleiche Weise immer Seiende" gerichtet ist (61e), liegen kann. Piaton sucht im Gegenteil die Lösung in der anderen Richtung, nämlich in einer Mischung die "das wünchenswürdigste Leben zu bereiten" fähig ist (61 e).
Medizin als Idealexemplar
121
Um verständlich zu machen, was er damit meint, führt er folgendes Beispiel an: Es gibt einen Menschen, der die Gerechtigkeit als solche kennt, und auch bezüglich alles anderem, was existiert, hat er eben solche Einsicht. Er weiß von der göttlichen Kugel und dem Kreis selbst, hat aber keinen Begriff von der menschlichen Kugel und dem menschlichen Kreis. "Wird der nun wohl Erkenntnis genug haben" (62a), fragt Piaton (Sokrates), um sich sein Haus bauen zu können? Es wäre ein lächerlicher Zustand, antwortet Protarchos, "...wenn wir nur die göttlichen Erkenntnisse allein innehätten" (62b). Aus diesem Beispiel lassen sich die folgende Schlußfolgerungen zu unserem Thema ziehen: 1. Hieraus folgt seine endgültige Bestätigung eines nicht-puristischen Wissenschaftsideals und zwar in bezug auf die göttliche Erkenntnis! Von der philologischen Seite her betrachtet, spiegelt sich dieses Wissenschaftsideal auch darin wider, daß "techne" und "episteme" bei Piaton nicht, wie bei Aristoteles, prinzipiell getrennt gedacht werden, sondern sehr häufig zusammen genannt und als Synonyme benutzt werden: "Wie sehr aber noch der alte Piaton die Charakteristik der Techne als επιστημη, als Einsicht, Wissen, wie sie Sokrates in den Jugenddialogen vertritt, festhält, ergibt sich auch aus dem Altersdialog Philebos (55d-56e)" (Moser 1973, S. 47) . 2. Die Etablierung eines Kriteriums der Konstruktivität bzw. des Nutzens als mischungsnormierendes Kriterium. Das heißt: Die ideale Wissenschaft ist diejenige, wo allgemeines Wissen über das "...auf gleiche Weise immer Seiende" (6le) mit dem partikularen Wissen des Werdenden und Werdensollenden und Gewordenen (59a) in solcher Weise gemischt ist, daß hierdurch das Bauen des guten Lebens ermöglicht wird . Schon zu Anfang des Philebos-Gesprächs, gibt Piaton uns einen Einblick, was er unter allgemeinem Wissen versteht, und zwar in mythischer Sprache (16c-d): "Als eine wahre Gabe von den Göttern an die Menschen, wofür ich es wenigstens erkenne, ist einmal von den Göttern herabgeworfen worden durch irgendeinen Prometheus, zugleich mit einem glanzvollsten Feuer, und die Alten, Besseren als wir und den Göttern Näherwohnenden haben uns diese Sage übergeben, aus Einem und
122
Jan Helge Solbakk
Vielem sei alles, wovon jedesmal gesagt wird, daß es ist, und habe Bestimmung und Unbestimmtheit in sich verbunden. Deshalb nun müßten wir, da dieses so geordnet ist, immer einen Begriff von allem jedesmal annehmen und suchen; denn finden würden wir ihn gewiß darin. Wenn wir ihn nun ergriffen haben, dann nächst dem einen, ob etwa zwei darin sind zu sehn, wo aber nicht, ob drei oder irgendeine andere Zahl, und mit jedem einzelnen von diesen darin Befindlichen ebenso, bis man von dem Ursprünglichen einen, nicht nur, daß es Eins und Vieles und Unendliches ist, sieht, sondern auch wievieles; des Unendlichen Begriff aber an die Menge nicht eher anlegen, bis einer die Zahl derselben ganz übersehen hat, die zwischen dem Unendlichen und dem Einen liegt, und dann erst jede Einheit von allem in die Unendlichkeit freilassen und verabschieden. So nun haben, wie ich sagte, die Götter uns überliefert, zu untersuchen und zu lernen und einander zu lehren".
3. Zur idealexemplarischen Funktion der Medizin bei Piaton Nachdem wir jetzt die Begründung Piatons eines nicht-puristischen Wissenschaftsideals untersucht haben und ein Bild von der formalen Struktur seiner idealen Wissenschaft besitzen, werden wir uns jetzt der Konkretisierung dieses Ideals zuwenden. Warum Piaton die Medizin als Form der Konkretisierung gewählt hat, wird hoffentlich in Laufe der Analyse deutlich werden. Im ersten Abschnitt dieses Teils der Abhandlung werden wir Piatons doppeltes bzw. zweifaches Bild der Medizin betrachten, um so die Konkretisierung der dreifachen Hypothese der Zweiteilung im Philebos-Gespräch auf der medizinischen Ebene zu verfolgen. Dadurch werden wir auch zum Bild der idealen Medizin bzw. zum platonischen Wissenschaftsideal gelangen. Die idealexemplarische Funktion der Medizin im Aufbau einer ethischen Wissenschaft kommt dann als zweiter Schritt hinzu, und zwar als eine indikative Analyse.
Medizin als Idealexemplar
123
In einem dritten Abschnitt dieses Teils werden wir eine indikative Analyse derselben Funktion der Medizin auf der Ebene der politischen Wissenschaft entwickeln. 3.1 Das doppelte Bild der Medizin bei Piaton
Wegen der dreifachen Hypothese der Zweiteilung im Philebos-Gespräch, wäre es überraschend gewesen, wenn diese Hypothese auf der Ebene der Medizin sich nicht niedergeschlagen hätte. Das geschieht freilich nicht in jenem Gespräch, sondern in Piatons Alterswerk, in den Gesetzen (Nomon). In Nomon 720a-e zum Beispiel unterscheidet Piaton zwischen zwei verschiedenen Klassen von Ärzten, und zwar die freien Ärzte und die unfreien bzw. Ärzte-Sklaven, deren Praxis auf zwei verschiedenen Erkenntnisformen aufgebaut sind: "Es gibt doch gewisse Ärzte, sagen wir, und Gehilfen der Ärzte, und auch diese nennen wir doch Ärzte... Und zwar ganz gleich, ob sie Freie sind oder Sklaven und nach Anweisung ihrer Herren und durch Zusehen und bloße Erfahrung ihre Kunst erwerben und nicht aus dem Wesen der Sache (κατα φνδιν) heraus, wie sie die Freien selbst erlernt haben und so auch ihre Schüler lehren... Nun kannst du doch auch folgendes beobachten: da die Kranken in den Städten teils Sklaven, teils Freie sind, so werden die Sklaven in der Regel zumeist von Sklaven behandelt, die ihre Rundgänge machen oder sie in den Arztstuben erwarten; und kein einziger von solchen Ärzten pflegt auch nur irgendeine Begründung für die jeweilige Krankheit eines Sklaven zu geben oder sich geben zu lassen, sondern er verordnet ihm das, was ihm aufgrund seiner Erfahrung gut scheint, als wüßte er genau Bescheid, eigenmächtig wie ein Tyrann; dann springt er auf und begibt sich zu einem andern erkrankten Sklaven und erleichtert so seinem Herrn die Sorge für die Kranken" (Nomon 720a-e). Schon von der Ironie in der Beschreibung her wird es klar, daß diese tyrannische Medizin, die auf reine "empeiria" bzw. "äußere Routine" (Entralgo 1962, S. 195) fundiert ist, nicht zum Ideal Piatons einer Medizin oder Wissenschaft paßt. Im Politikos beschreibt Piaton sogar die tyrannische Art des Verfahrens als das eines stolzen und unwissenden Men-
124
Jan Helge Solbakk
schens, "...der nichts will anders als nach seiner eigenen Anordnung tun und auch niemanden weiter anfragen lassen, auch nicht, wenn jemandem etwas Neues, Besseres gekommen ist, außer der Ordnung, die er selbst festgestellt hat" (Politikos 294c). Das heißt: Piaton kritisiert nicht nur den Mangel an theoretischem Wissen in der Sklaven-Medizin, sondern auch die "schematische Rücksichtslosigkeit" (Wehrli 1951, S. 179) und geringe Individualisierung bzw. "Massenbetrieb" (Kudlien 1968, S. 29) in der Behandlung. Die ideale Mischung von allgemeinem Wissen und Wissen von partikulären Dingen finden wir in Piatons Beschreibung der wissenschaftlichen Medizin, die durch àie freien Ärzte ausgeübt wird (Nomon 720d-e): "Der freie Arzt dagegen behandelt meistens die Krankheiten der Freien und beobachtet sie; und indem er sie von ihrem Entstehen an und ihrem Wesen nach erforscht, wobei er sich mit dem Kranken selbst und mit dessen Freunden bespricht, lernt er teils selbst manches von den Kranken...". Was Piaton unter "ihrem Wesen nach" (κατα φνσιν) versteht, finden wir an anderer Stelle desselben Dialogs weiter herausgearbeitet, und zwar in einer ironischen Äußerung gegen die Sklaven-Ärzte ( Nomon 857c-d) : "...wenn einmal einer der Ärzte, welche die Heilkunst rein empirisch ohne theoretische Grundlage betreiben, auf einen freien Arzt träfe, der sich mit einem freien Kranken unterhält und sich dabei beinahe philosophischer Argumente bedient und die Krankheit bei der Wurzel packt, indem er auf die allgemeine Natur des Körpers zurückgeht, so würde jener gleich in lautes Gelächter ausbrechen und keine andere Reden vorbringen als die, welche in diesem Fall die meisten der sogenannten Ärzte schnell bei der Hand haben; er würde nämlich sagen: 'Du Tor, du behandelst ja nicht den Kranken, sondern belehrst ihn geradezu, als müßte er ein Arzt, nicht aber gesund werden!"·. Das Piaton mit der Aussage, die "allgemeine bzw. gesamte Natur des Körpers" nicht nur "das Ganze der Natur" oder "das Ganze der leidenden Natur" meint, sondern auch auf die individuelle Natur des Patienten anspielt, wird durch den Leib-Seele-Vergleich im Phaidros (270b-e) klar :
Medizin als Idealexemplar
125
"Es hat dieselbe Bewandtnis mit der Redekunst wie mit der Heilkunst. Wieso? In beiden mußt du die Natur einteilen, die des Leibes in der einen, die der Seele in der anderen, wenn du nicht nur hergebrachterweise und erfahrungsmäßig (ει μελλεισ μη τριβή μονον και εμπειρία), sondern nach der Kunst jenem durch Anwendung von Arznei und Nahrung Gesundheit und Stärke verschaffen, dieser durch angeordnete Belehrungen und Sitten, welche Überzeugung und Tugend du willst, mitzuteilen begehrst...Und glaubst du die Natur der Seele richtig begreifen zu können ohne des Ganzen Natur (του ολου φύσεως)? Wenn man dem Asklepiaden Hippokrates glauben soll, auch nicht einmal die des Körpers ohne ein solches Verfahren...So sieh nun, was über die Natur (περι φύσεως) Hippokrates sagt und die richtige Vernunft. Muß man nicht so nachdenken über eines jeden Dinges Natur (περι οτουον φύσεως): zuerst, ob das einerlei ist oder vielgestaltig, was wir selbst als Künstler behandeln und wozu wir auch andere geschickt machen wollen; dann, daß man, wenn es einerlei ist, seine Kraft untersuche, was für eine es hat von Natur, um auf was für Dinge zu wirken, und was für welchen aufzunehmen; wenn es aber mehrere Gestalten hat, diese erst aufzähle und so von jeder wie vorher von dem einen sehe, was sie ihrer Natur nach ausrichten und was sie von welchem andern erleiden kann...Jedes Verfahren ohne dieses wäre nur wie eines Blinden Wanderung. Aber keineswegs muß, wer irgendeiner Sache kunstmäßig nachstrebt, einem Blinden oder Tauben verglichen werden können, sondern offenbar ist, daß, wenn jemand kunstmäßig Reden mitteilt, er auch das Wesen der Natur dessen genau muß zeigen können, dem er seine Reden anbringen will." Fritz Wehrli behauptet (Wehrli 1951, S. 181), daß Piaton mit diesem LeibSeele-Vergleich eigentlich ausführen will, daß die ärztliche Kunst erst mit der Kenntnis, wie der (einzelne) Körper auf Nahrung und Arznei reagiert, beginnt. Uns scheint diese Interpretation so gewaltig, weil es ja hier nicht um Chronologie geht, d.h. um welches Wissen - das allgemeine oder das partikuläre - zuerst entsteht, sondern um die Charakter-Beschaffenheit des medizinischen bzw. wissenschaftlichen Wissens, und zwar als eine Mischung von beiden Arten des Wissens .
126
Jan Helge Solbakk
Versuchen wir jetzt das Problem des Wissens über partikuläre Dinge genauer zu analysieren. Das Problem wird im Politikos als ein gemeinsames Problem aller Künste charakterisiert (294b): "Denn die Unähnlichkeit der Menschen und der Handlungen, und daß niemals nichts sozusagen Ruhe hält in den menschlichen Dingen, die gestattet nicht, daß irgendeine Kunst in irgend etwas für alle und zu aller Zeit einfach darstelle". Im Falle der Medizin sucht man, Piaton folgend, das Problem des Wissens durch die Natur des individuellen Patienten bzw. das Problem der Individualisierung der Diagnostik und Behandlung durch persönliches Lernen, Aufklärung, Überzeugung und biographische Anpassung zu erreichen . Wir haben die Technik des persönlichen Lernens schon mehrfach berührt; wie der freie Arzt nicht nur allgemeines Wissen von der gesamten Natur oder von der leidenden Natur im Ganzen, sondern auch partikuläres Wissen von der Natur des Körpers des individuellen Patienten in seine Betrachtung einbezieht, und wie er durch die "fast philosophische" Unterhaltung mit dem Kranken, seinen Freunden und seiner Familie etwas von dem Kranken selbst lernt. Durch das persönliche Lernen von dem Kranken wird es dem Arzt auch möglich, "...nach dem Maß des Möglichen den Kranken selbst" (Nomoi 720d) zu belehren. Das heißt: Den Patienten über seine Krankheit aufzuklärenι, und ihn von der Wirksamkeit der Behandlung zu überzeugen und zu beruhigen. Ohne "gewisse Besprechungen" verschreibt der gute Arzt dem Patienten nichts (Charmides 157a-b): "Jenes also müsse man zuerst und am sorgfätligsten behandeln, wenn es um den Kopf und auch um den ganzen Leib gut solle stehen. Die Seele...werde behandelt durch gewisse Besprechungen, und diese Besprechungen wären die schönen Reden. Denn durch solche Reden entstehe in der Seele Besonnenheit, und wenn diese entstanden und da wäre, wurde es leicht, Gesundheit auch dem Kopf und dem übrigen Körper zu verschaffen. Als er mich daher das Mittel und die Besprechungen lehrte, sprach er: Daß dich ja nicht jemand überrede, mit dieser Arznei seinen Kopf zu behandeln, der
Medizin als Idealexemplar
127
dir nicht zuvor auch seine Seele darbietet, um sie mit den Besprechungen von dir behandeln zu lassen". Das heißt, daß die Besprechungen bzw. "die Überzeugung durch das Wort" bewirkt, "...daß der Kranke die Verordnung des Behandelnden mit der objektiven und subjektiven Gewißheit annimmt, daß diese Verordnung wirklich "für ihn" ist, und was vorher nur rein körperliche Anpassung der Vorschrift war, verwandelt sich jetzt in eine Anpassung, die gleichzeitig körperlich und seelisch ist. Das Wort des Arztes macht eine qualitative und seelisch orientierte Individualisierung der Behandlung aus einer, die sonst nur quantitativ und körperlich orientiert wäre" (Entralgo 1962, S. 199). In Nomon (722e-723a) finden wir die kontrastierende Vorschrift des tyrannischen Sklaven-Arztes als eine, die das "reinen Gesetzes" charakterisiert; das heißt, eine Vorschrift, wo die Partikularität des einzelnen Krankens außer Betracht bleibt, und jeder Kranke "über derselben Kamm geschoren wird" (ebd., S.195). Die biographische Anpassung macht das letzte Element der Individualisierung in der Medizin aus, und soll hier nur kurz berührt werden. Die Notwendigkeit dieser Anpassung ist nach Piaton durch zweierlei Tatsachen gegeben: Erstens, kann ein Heilmittel für den einen Körper heilsam sein, während dasselbe Mittel für den anderen schädlich ist (Nomon 636a-b). Zweitens, weil eine medizinische Vorschrift, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben heilsam ist, zu einem anderen Zeitpunkt, wenn andere Bedingungen eingetreten sind, aber nicht länger günstig für den Kranken zu sein braucht (Politikos 295c). Fassen wir jetzt unsere Analyse der idealen Medizin als exemplarische Wissenschaft zusammen: 1. Ziel der Wissenschaften ist es, zum Entwurf eines guten Lebens beizutragen, d.h., sich dabei als "nützlich, lebensfordernd oder lebenserhaltend" zu erweisen (Heinimann 1961, S. 117). Die Medizin ist die lebenserhaltende Wissenschaft par excellence, weil sie die Gesundheit bzw. die Voraussetzung für die Verwirklichung dieses Entwurfes bietet. 2. Die Norm der Wissenschaften ist die allgemeine Norm der Natur - d.h. das innewohnende Gute (εμφντον αγαθόν) der Natur. Das innewohnende Gute der menschlichen Natur bzw. die Norm der Medizin ist die
128
Jan Helge Solbakk
Gesundheit. (In Abschnitt 3.2 werden wir die Theorie Piatons vom innewohnenden Guten und Bösen (εμφντον αγαθόν και κακόν) der Natur genauer betrachten ). 3. Der Gegenstand der Wissenschaften ist die gesamte Natur, inklusive der partikulären Natur bzw. das innenwohnende Gute und Böse der Natur der einzelnen Dinge. Gegenstand der Medizin ist die menschliche Natur. 4. Die Methode der Wissenschaften ist die konstruktive Mischung allgemeinen Wissens über die Natur und des Wissens über die partikuläre Natur der einzelnen Dinge. Der ideale Arzt muß erstens die vielgestaltige Natur des Körpes kennen, zweitens wissen, wie und worauf jeder einzelne Teil wirkt, wie und woran er leidet, drittens verstehen, die Arten der Teile und Heilmittel zusammenzuhalten und beurteilen zu können, wodurch und warum bestimmte Körperteile gerade dadurch Nutzen oder Schaden zugefügt wird. Hierbei muß die Natur des Ganzen stets im Auge behalten werden (Hoffmann 1922, S. 1083). 5. Die Grenze der Wissenschaften ist die Grenze der gesamten Natur, d.h. das innewohnende Gute (αγαθόν) und Böse (κακόν) der Natur . 6. Die Einteilung der Wissenschaften erfolgt durch die Unterscheidung nach ausübenden und erzieherischen Wissenschaften. Die Medizin ist die exemplarische Wissenschaft der Ausübung, weil sie die Voraussetzung der Ausübung - die Gesundheit - ermöglicht. Durch Aufklärung, Überzeugung und biographische Anpassung erhält die Medizin nicht nur die Gesundheit, sondern wirkt auch erzieherisch. Dadurch zeigt die Medizin sich als eine erzieherische Wissenschaft. Als ausübende und erzieherische Wissenschaft schlägt die Medizin eine Brücke über die Zweiteilung der Wissenschaften. Deswegen zeigt die Medizin sich nicht nur als exemplarisch der ausübenden Wissenschaften gegenüber, sondern auch in bezug auf erzieherische Wissenschaften. 3.2 Die idealexemplarische Funktion der Medizin im Airfbau einer ethischen Wissenschaft. Eine indikative Analyse Um die idealexemplarische oder "maieutische" Funktion der Medizin auf der Ebene der Ethik zu verfolgen, nehmen wir als Ausgangspunkt Piatons
Medizin als Idealexemplar
129
Definition der Seele und seine Lehre des innewohnenden Guten und Bösen aller Dinge. Die Seele wird im Corpus Platonicum definiert als das, was durch Gerechtigkeit und Wissen gefordert, aber durch Ungerechtigkeit und Ignoranz geschädigt wird (Kriton 47d-e). Das, was schadet und zerstört, ist böse, das, was nützt und fördert, ist gut (Politeia 608d-e). In jedem Ding gibt es eine Mischung von beiden - vom innewohnenden Bösen und Guten (Politeia 609a). Piaton gibt mehrere Beispiele des innewohnenden Bösen der Dinge: Das Eisen wird durch den Rost verdorben, das Holz durch die Fäulnis und das Korn durch den Brand (Politeia, ebd.). Beim Körper heißt das innewohnende Böse, "Krankheit" (νοσον), weil das natürliche Gute des Körpers "Gesundheit" (νγιεια) heißt (Gorgias 499d-e, 504c, Politeia 609c-d). Auf der Basis dieser Lehre vom innewohnenden Bösen und Guten aller Dinge versucht Piaton seine Ethik zu entwickeln. Erwartungsgemäß geschieht dies durch das innewohnende Böse und Gute des Körpers als normative Analogie und der Medizin als wissenschaftliches "Paradeigma" (Politeia 444c-e): "Also ist nun auch, sprach ich, das Ungerechthandeln und Unrechttun und ebenso das Rechttun, alles dieses wohl schon ganz deutlich bestimmt, wenn ja auch Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit es sind...Weil sie, sprach ich, gar nicht unterschieden von dem Gesunden und Ungesunden, was dieses für den Leib ist, für die Seele sind...Das Gesunde bewirkt doch Gesundheit und das Ungesunde Krankheit? Ja. Bewirkt nicht auch das Rechttun Gerechtigkeit und das Unrechttun Ungerechtigkeit? Notwendig. Gesundheit bewirken heißt aber, das Leibliche in ein naturgemäßes Verhältnis des Beherrschens und voneinander Beherrschtwerdens zu bringen, und Krankheit, in ein naturwidrig Herrschen und Beherrschtwerden eins vom anderen. Das heißt es. Nicht auch wiederum, sprach ich, Gerechtigkeit bewirken, das in der Seele in ein naturgemäßes Verhältnis zu bringen, des Herrschens und voneinander Beherrschtwerdens, Ungerechtigkeit aber, in ein naturwidriges Herrschen und Beherrschtwerden eines vom anderen...So wäre denn die Tugend, wie es scheint, eine Gesundheit und Schönheit und Wohlbefinden der
130
Jan Helge Solbakk
Seele, die Schlechtigkeit aber Krankheit und Hässlichkeit und Schwäche". Von der Perspektive der Parallelität zwischen dem innewohnenden Bösen und Guten des Körpers und der Seele wird es noch klarer, warum die Medizin "Paradeigma" für die ethische Wissenschaft ist. Denn wo sonst gab es eine Wissenschaft, die erstens auf das Gute abzielte, die zweitens ihr Objekt nach diesem Guten - dem εμφντον αγαθόν - definierte, die drittens Ursachen untersuchte, durch die das Objekt besser und schlechter wird, wie Piaton es für seine Gütertafel brauchte, und die viertens aus der Theorie Praxis machte, wie er es für die Ethik forderte? Antwort: Nirgendwo. Nur die Medizin war als Wissenschaft fähig, diese idealexemplarische Funktion zu füllen. 3.3 Die idealexemplarische Funktion der Medizin auf der Ebene der politischen Wissenschaft. Eine indikative Analyse "InT Gorgias', in dem der konstruktive Grundriß der neuen politischen Techne zum erstenmal enthüllt wird, hatte Piaton ihre methodische Form und ihr Ziel am Vorbild der ärztlichen Kunst deutlich gemacht" (Jaeger 1973, S. 924-925/ΙΠ 48-49). In dieser Analyse der idealexemplarischen Funktion der Medizin auf der politischen Ebene werden wir uns auf zwei Aspekte des Aufbaus der politischen Wissenschaft konzentrieren. Erstens geht es um die KompetenzFrage. Wer besitzt die Kompetenz, und wie kann man die Kompetenz des Herrschers messen? Dabei soll es sich hier um ein Messen drehen, das von der Form der politischen Konstitution, vom Willen des Volkes und von der ökonomischen Lage des Herrschers unabhängig ist? Piaton antwortet mit Bezugnahme auf dieselbe Frage in der Medizin (Politikos 293b-c): "Von diesen aber, mögen sie nun mit dem guten Willen der Beherrschten regieren oder wider ihren Willen und nach geschriebenen Satzungen oder ohne solche und dabei reich sein oder arm, müssen wir glauben, wie wir jetzt meinen, daß die jegliche Regierung, welche es auch sei, nach der Kunst verwalten werden; so wie wir die Ärzte nicht weniger dafür halten, sie mögen uns nun mit oder
Medizin als Idealexemplar
131
wider unseren Willen heilen und dabei schneiden, brennen oder welchen Schmerz sonst uns zufügen, und mögen es nach geschriebenen Vorschriften tun oder ohne solche und arm oder reich sein, in allen Fällen werden wir ihnen nichtsdestoweniger zugestehen, daß sie Ärzte sind, solange sie nur kunstgerecht dem Leibe vorstehn und ihn reinigen oder sonst irgendwie magerer machen oder fleischiger, wenn es nur zum Besten des Leibes (επ αγαθω τω των σοματων) geschieht, um ihn besser zu machen aus einem schlechteren, und sie ihn, wie jeder, der etwas pflegt, sein zu Pflegendes erhalten. So werden wir sagen, denke ich, und nicht anders ergebe sich die richtige Bestimmung der ärztlichen und jeder anderen Aufsicht und Regierung". Wie die Medizin hat auch die Politik die menschliche Natur zu ihrem Gegenstande. Es ist deswegen sachlich angebracht, wenn Piaton in seiner Bearbeitung dieser Antwort auf der politischen Ebene dieselbe Struktur und Begriffe wie in der Medizin benutzt (Politikos 293d-e): "Und wenn sie auch einige töten oder verjagen und so zu seinem Besten den Staat (επ αγαθω την πολιν) reinigen oder auch Kolonien wie die Schwärme der Bienen anderwärts hinsenden und ihn kleiner machen oder andere von außen her unter die Bürger aufnehmen und ihn größer machen: solange sie nur Erkenntnis und Recht anwendend ihn erhalten und aus einem schlechten möglichst besser machen, werden wir immer nach diesen Bestimmungen diese Staatsverfassung für die einzig richtige erklären müssen. Die wir aber sonst so nennen, dürfen wir gar nicht für echte und wahrhafte angeben sondern für Nachahmerinnen jener, von denen die wohlgeordneten sie besser, die anderen schlechter nachahmen". Von der Kompetenzfrage geht Piaton zweitens zur Problemlage der Gesetzgebung über und zwar zum Problem der Autorität von allgemeinen Gesetzen im Verhältnis zu individuellen Entscheidungen des Herrschers. Das heißt: Sollte es für den Herrscher verboten sein, alte Gesetzgebung durch neue bzw. geänderte Gesetze zu ersetzen? In der Problemlösung bewegt sich Piaton von einer internen Äußerung über die königliche Wissenschaft (Politikos 294a), über das Problem der Beziehung zwischen allgemeinem und partikulärem Wissen in den
132
Jan Helge Solbakk
Wissenschaften (Politikos 294b-c) bis hin zur medizinischen Ebene. Die zwei ersten Stufen der Problemlösung bereiten den Weg zur Analogie der Medizin vor: Ein Arzt kehrt vom Ausland früher als geplant zurück. Die Krankheit seines Patienten hat sich wegen einer Klima-Änderung rasch verbessert, schneller als der Arzt auf der Grundlage der gegebenen Verordnungen erwartet hat. Das Problem ist nun, was er dann als Arzt tun sollte? Sollte er zögern seine alte Verordnungen durch neue zu ersetzen? Sollte er es als eine Pflicht betrachten, bei den alten Verordnungen zu bleiben, als ob diese die wahren Kanons der Medizin und der Gesundheit wären, und als ob, wenn er"...davon abwiche, (dies) schädlich sein müßte und nicht kunstmäßig?" (Politikos, 295d). Die Antwort Piatons lautet (295d-e): "... würde nicht in jeder Wissenschaft und wahren Kunst, welche es auch sei, auf alle Weise das größte Gelächter entstehen über solche Gesetzgebungen?" Die Antwort Piatons angewandt auf die politische Ebene lautet (296a): "...müßte nicht auch dies Verbot um nichts minder als jenes in Wahrheit lächerlich erscheinen?". Eine ausführliche Analyse der idealexemplarischen Funktion der Medizin würde uns zur Politela bringen, denn in der Politela findet die Gestaltung seiner idealen Staats-Lehre statt, und zwar ausgehend von der Idee, daß das Ziel aller Gemeinschaft die höchste Entfaltung der Seele des Individuums ist. Das heißt: Der ideale Staat ist der gerechte Staat, und deswegen der gesunde Staat, weil alle realen Staatsformen "Krankheits- und Degenerationsphänomene" enthalten.
4. Rückblick und Ausblick Unsere Analyse der idealexemplarischen Funktion der Medizin auf der Ebene der Wissenschaftstheorie hat uns bis zum Corpus Platonicum gebracht. Es erschien notwendig, so weit zurück in die Geistesgeschichte zu dringen, um jenseits des Einflusses eines aristotelischen Wissenschaftsideals zu gelangen. Das heißt: jenseits eines Ideals, in dem der Gegenstand des wissenschaftlichen Wissens auf Universalien begrenzt ist, jenseits eines Ideals, wo partikuläres Wissen auf der Ebene des wissenschaftlichen
Medizin als Idealexemplar
133
Wissens nichts bedeutet. "An inability to give a plausible account of our knowledge of particulars", sagt Gorovitz and Maclntyre "(is) an inability for which Aristotelianism is notorius" (Gorovitz & Maclntyre 1976, p. 56). Der Purismus in der heutigen Wissenschaftstheorie zeigt uns, daß wir immer noch in der Wirkungsgeschichte eines Aristoteles' leben. Piatons Beitrag bringt uns in vierfacher Weise jenseits des aristotelischen Wissenschaftsideals: 1. Weil er uns die Grenzen des wissenschaftstheoretischen Purismus gezeigt hat, und zwar, daß weder reine "Empeiria" noch reine "Theoria" als Basis für eine Wissenschaft ausreichend ist. 2. Weil er eine nichtpuristische Wissenschaftstheorie bzw. eine Theorie der Mischung als Alternative vorschlagen hat. Das heißt: Eine Wissenschaftstheorie, die partikuläres Wissen als Element des wissenschaftlichen Wissens versteht, und die die Beziehung zwischen allgemeinem und partikulärem Wissen abzuklären versucht. 3. Weil er mit seiner nichtpuristischen Wissenschaftstheorie auf die Beziehung zwischen "epistemisches" Wissen und Ethik aufmerksam gemacht hat. Das heißt: Er hat versucht, eine Wissenschaftstheorie zu entwickeln, die Ethik als ein Element des wissenschaftlichen Wissens versteht, und die die Beziehung zwischen "epistemischem" und ethischem Wissen zu erhellen sucht. Diese Theorie einer "Interdependenz" zwischen "epistemischem" und ethischem Wissen, scheint uns nicht nur auf der Ebene der Wissenschaftsi/ieor/e konsequenzreich zu sein, sondern auch auf der Ebene der WissenschaftserA/fc: Denn das heißt nicht nur: um Wissenschaftstheorie treiben zu können, muß man die wissenschafts-ethische Reflexion in die Theorienbildung einbringen, sondern es heißt auch: um Wissenschaftsethik treiben zu können, muß man die wissenschaftstheoretische Reflexion in die Theorienbildung einbringen. Das heißt: Auch auf der Ebene der wissenschafts-eiA/sc/zen Theorienbildung scheint die Lösung in der Mischung zwischen ethischem und epistemischem Wissen und nicht in einem ethischen Purismus zu liegen. 4. Viertens, hat er uns die idealexemplarische Kraft der Medizin auf der Ebene der allgemeinen Wissenschaftstheorie gezeigt.
134
Jan Helge Solbakk
Anmerkungen 1
Unter "puristischen Formen der Wissenschaften" werden in dieser Arbeit die sogenannten "pure sciences" verstanden, das heißt theoretische Wissenschaften, in welchen der Gegenstand des wissenschaftlichen Wissens nicht die Frage der Anwendung miteinbezieht, sondern auf das Nachfragen nach allgemeinen Gesetzen begrenzt ist. "Wissenschaftstheoretischer Purismus" heißt, die Tendenz sich nicht außerhalb solcher Formen der Wissenschaften zu bewegen, wenn es um Einsicht in Naturgesetze, wissenschaftliche Erklärungen und wissenschaftliche Theorien geht Das wörtliche Zitat aus Caplan (1986) S.99 lautet: "Historically, philosophers of science have not been inclined to look outside the realm of the natural sciences for insights into the nature of laws, explanations, and theories of science or in order to ascertain the processes of theoretical evolution. Indeed, not only has the philosophy of science rarely looked outside the natural sciences to understand science, it has almost never looked outside the realm of "pure' science for the purposes of either description or prescription. The focus on the natural sciences derives from a little-examined belief that the philosophy of science ought restrict itself to the purist forms of science. As a result, practical areas of scientific inquiry such as engineering, agriculture, and medicine, have been either ignored or slighted in favor of what are seen as the more important or basic aspects or components of scientific inquiry".
Medizin als Idealexemplar
135
Literatur [1] Aristoteles, Metaphysik I-XIV, griechisch und deutsch, hrsg von H. Seidl, Hamburg 1978-1980. [2] Caplan, A. (1986), Exemplary Reasoning? A Comment on Theory Structure in Biomedicine, The Journal of Medicine and Philosophy, 11,93-105. [3] Dies, A. (1941), Notice, Platon, Oeuvres complètes, Tome IX - 2e Partie, Paris. [4] Entralgo, P.-L. (1962), Die ärztliche Hilfe im Werk Piatons, Sudhoffs Archiv, 46, 193-210. [5] Gorovitz, S. & Maclntyre, A. (1976), Toward a Theory of Medical Fallibility, The Journal of Medicine and Philosophy, 1,51-71. [6] Heinimann, F. (1961), Eine vorplatonische Theorie der τ έ χ ν η , Museum Helveticum 18,105-130. [7] Hoffmann, E. (1922), Piaton und die Medizin. In: Zeller, E., Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Zweiter Teil, Erste Abteilung, Leipzig, S. 1070-86. [8] Jaeger, W. (1973), Paideia, Bd. I - ΠΙ ( ungekürzter photomechanischer Nachdruck der Ausgabe 1936 -1947 in einem Band) Berlin. [9] Kudlien, F. (1968), Die Sklaven in der griechischen Medizin der klassischen und hellenistischen Zeit Forschungen zur antiken Sklaverei, Wiesbaden. [10] Lenk, H. (1980), Technik und Wissenschaft. In: Speck, J. (Hrsg.), Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe, Band 3 (R-Z), Göttingen. [11] Moser, S. (1973), Kritik der traditionellen Technik-Philosophie. In: Lenk, H.; Moser, S. (Hrsg.), Techne-Technik- Technologie, München, S. 11-81. [12] Munson R. (1981), Why Medicine cannot be a Science, The Journal of Medicine and Philosophy, 6, 183-208. [13] Piaton, Werke in acht Bänden, griechisch und deutsch, hrsg. von G. Eigler, Darmstadt 1977. [14] Schleiermacher, F. (1826), In: Piaton, Werke hrsg von F. Schleichermacher. Dritter Band, Zweiter Theil, Berlin S.I ff. [15] Wehrli, F. (1951), Arztvergleich bei Piaton, Museum Helveticum, 177-184. [16] Widdershoven-Heerding, I. (1987), Medicine as a Form of practical Understanding, Theoretical Medicine, 8,179-185.
Holismus versus Realismus? Wissenschaftsphilosophische Bemerkungen zum Verhältnis östlicher und westlicher Medizin Werner Diederich
Im ersten Teil dieses Papers (Abschnitte 1-4) zeige ich, nach einem einleitenden 1. Abschnitt, einige Probleme des Vergleichs östlicher und westlicher Medizin auf (Abschnitte 2 und 3) und formuliere in Abschnitt 4, in welcher Hinsicht ich deren Vergleichbarkeit eingeschränkt sehe. Der zweite Teil (Abschnitte 5-8) behandelt als Beispiel chinesischer Theoriebildung die Lehre von den Fünf Elementen (Abschnitt 5), die RealismusFrage (Abschnitt 6), die Einbeziehung psychischer Faktoren (Abschnitt 7) sowie Möglichkeiten und Grenzen einer ganzheitlichen Sichtweise (Abschnitt 8). 1. Akupunktur ist in der westlichen Welt inzwischen mehr als nur chic geworden. Wenn auch von den meisten Ärztinnen noch höchstens zurückhaltend, so wird sie doch zunehmend von Heilprakterlnnen betrieben, und es dauert vielleicht nicht mehr lange, bis sie, mit einer kassenärztlichen Anerkennung, auch bei uns einen breiteren Durchbruch erhält. Analog, hört man, wird in China westliche Medizin adaptiert, und hier wie dort bemühen sich Wissenschaftlerinnen um physiologische Erklärungen der Wirksamkeit von Akupunktur1. Damit wären wir beim Thema: Ist es denkbar, daß die östliche Medizin die westliche, oder umgekehrt, inkorporiert? Gibt es, oder kann es ein integriertes öst-westliches medizinisches Konzept geben? So nahtlos sich eines Tages die Praxis von östlicher und westlicher Medizin zusammenfügen lassen mag, so schwierig, ja aussichtslos, scheint, wie wir sehen werden, eine theoretische Integration der beiden Systeme. Schließen also beide einander theoretisch aus? Und wenn ja: weil sie einander widersprechen oder
138
Werner Diederich
weil sie inkommensurabel, in ihren Vorstellungswelten einfach nicht aufeinander zu beziehen sind? (Inkommensurabilität wäre natürlich kein logischer Ausschluß.) Möchte man die Verdienste der beiden Systeme gegeneinander abwägen, so bietet sich zunächst ein Leistungsvergleich an. Schon Paracelsus, zu seiner Zeit das, was wir heute einen 'Alternativmediziner' nennen würden, hatte seinen ('etablierten') galenischen Gegnern als Vergleichstest vorgeschlagen, jeweils die gleiche Anzahl von Kranken seiner neuen Behandlungsweise zu unterziehen, bzw. der traditionellen galenischen, und dann die Sterbeziffern zu vergleichen. (Seine Gegner haben sich auf einen Test dieser Art - dessen Ausgang aus heutiger Sicht wohl durchaus offen und in jedem Fall verheerend gewesen wäre - nicht eingelassen.) Wie könnte ein Leistungsvergleich zwischen westlicher und östlicher Medizin aussehen? Was wäre der Vergleichsmaßstab? Im folgenden beziehe ich mich, da es mir nur auf sehr grundsätzliche Fragen ankommt, umstandslos auf "die" westliche bzw. östliche Medizin, ungeachtet aller nötigen Differenzierungen, und verstehe die westliche Medizin überdies nach ihrem verbreiteten naturwissenschaftlichen Selbstverständnis, nehme also dieses für die Sache selbst, und als östliche Medizin paradigmatisch die Akupunktur bzw. das als deren Variante ausgebildete Shiatsu.2 2. Die westliche biomedizinische Forschung bietet ein detailliertes anatomisches und physiologisches Bild des Menschen, das grundsätzlich das gesunde wie auch das kranke Verhalten des menschlichen Organismus zu erklären sich anheischig macht. Zugleich sollen diese Art Erklärungen dazu dienen, den Erfolg gewisser Eingriffe zu verstehen bzw. vorherzusagen und zu planen. Wir haben zu diesem Zweck eine leidlich genaue Erfahrungssprache ausgebildet, mit deren Hilfe wir den gesunden Zustand und Krankheitsbilder ebenso zu formulieren und klassifizieren vermögen, wie eingreifende Maßnahmen und deren Erfolge. Auf der erklärenden Ebene verfügen wir über ein reiches Arsenal physiologischer Gesetzmäßigkeiten und Modelle zur diagnostischen Deutung von Krankheitsbildern. Idealerweise sähe ein ärztliches Vorgehen dann so aus: Es werden (beobachtbare, meßbare) Symptome am einzelnen Menschen diagnostisch gedeutet, so
Holismus versus Realismus?
139
daß der gegenwärtige Zustand der untersuchten Person zufolge der Diagnose unter einschlägige Gesetze subsumiert und dadurch erklärt, sowie der Erfolg gewisser Behandlungsmethoden mehr oder weniger genau vorhergesagt werden kann. Ich nenne dieses Verfahren - in Anlehnung an das Subsumptionsmodell der wissenschaftlichen Erklärung in der Wissenschaftstheorie - das Subsumptionsmodell von Diagnose und Therapie. Auf der Grundlage dieses - stark vereinfachten - Selbstbildes westlicher naturwissenschaftlicher Medizin, das wir hier um der Argumentation willen als zutreffend unterstellen, läge nun für einen Vergleich mit östlicher Medizin nichts näher, als deren Vertreterinnen aufzufordern, ihre theoretischen Erklärungen von Befunden an Patientinnen vorzulegen, sowie ihre Behandlungsmethoden nebst theoretisch gestützten Erfolgsaussichten. Doch würde oder könnte sich die östliche Medizin auf einen solchen Vergleich einlassen? Nehmen wir als Beispiel eine Patientin mit anhaltendem Bluthochdruck. Ein westlicher Arzt würde, wenn der Blutdruck dauerhaft gewisse Werte nicht unterschreitet, wahrscheinlich Betablocker verabreichen (nachdem er Kontraindikationen ausschließen konnte). Die Grundlage dafür bietet beispielsweise eine aus den Symptomen erschlossene Dysfunktion der Blutgefäße und ein Wissen darüber, daß - vielleicht sogar wie - eine solche Dysfunktion durch Betablocker kompensiert werden kann. Ein östlicher Kollege unseres Arztes würde derselben Patientin wahrscheinlich erst einmal Shiatsu geben und dabei etwa feststellen, daß ihre "Feuerenergie" überaktiv ist und daß der Grund dafür vermutlich in einer Unausgewogenheit ihres Holzelements, der "Mutter" des Elements Feuer, zu suchen ist. Deshalb könnte dieser ihren Gallenblasenmeridian, den YangMeridian des Holzelements, sedieren. Nach der bisherigen, vereinfachten Schilderung scheint ein Leistungsvergleich von östlicher und westlicher Medizin noch durchaus möglich zu sein. Wir haben, im Beispiel, ein und dieselbe Beschreibung eines Zustands der Patientin: Bluthochdruck, und lediglich verschiedene Interpretationen und Behandlungsmethoden. Es kann dann verglichen werden, mit welcher Methode das (angenommenermaßen) selbe Ziel: einen normalen Blutdruck wiederherzustellen, schneller oder verläßlicher erreicht wird. In Wirklichkeit liegen die Dinge natürlich wesentlich komplizierter. Da ist einmal, wenn wir zunächst bei derselben Zustandsbeschreibung und
140
Werner Diederich
Zielsetzung bleiben, die Frage der Nebenwirkungen. Der Sache nach könnte man vermuten, daß eine Akupunktur- oder Shiatsubehandlung geringere Risiken mit sich bringt als eine Verabreichung von Betablockern. Erstere Methode erscheint sanfter und hat eine viele Hunderte von Jahren alte Geschichte. Doch will ich hier für diesen Punkt nicht argumentieren, da es mir im gegenwärtigen Zusammenhang nur auf die erkenntnistheoretischen und methodologischen Fragen ankommt. Sodann war unsere bisherige Fallbeschreibung insofern künstlich, als (jedenfalls) der Akupunkteur sich nicht mit der Beschreibung "Bluthochdruck" zufrieden geben würde. Nehmen wir an, die Patientin sei nach westlichen Maßstäben ansonsten "gesund", d.h., sie zeige keine weiteren pathologischen Symptome: Alle irgendwie relevanten Tests verlaufen negativ. Kommt dieselbe Patientin zum Akupunkteur, so würde der ein ganz anderes Diagnoseverfahren einschlagen. Er würde wohl nicht den Blutdruck messen, sondern, sofern sich die Patientin nicht schon spezifisch über irgendwelche Beschwerden äußert, sich über Körperhaltung, Gesichtsfarbe, Muskeltonus etc. und etwa über Reaktionen der Patientin auf das Geben von "allgemeinem Shiatsu" ein Bild von deren "energetischem Zustand" verschaffen, das in den Vorschlag einer spezifischen Therapie münden kann, wenn dieser Zustand unbefriedigend ist (vgl. unten, Abschn. 3, zu "Disharmoniemustern"). Wir haben so eine andere Beschreibung desselben Falles und damit verbunden auch eine andere Zielsetzung für die Therapie. Wir könnten also nur noch "vergleichen", ob es eher oder besser gelingt, den Zustand A in den Zustand Β zu überführen oder A' in B'. 3. Eine solche Schematisierung der Vergleichssituation legt den Verdacht nahe, die beiden Vorgehensweisen seien "praktisch inkommensurabel", als ginge es so wenig um Alternativen wie bei dem "Vergleich", draußen sei es kälter als abends. Doch geben wir bei unserer Suche nach einem Vergleichsmaßstab so schnell nicht auf! Die Situation ist offenbar nur theoretisch unbefriedigend. Praktisch bleibt es der Patientin unbenommen, sich wahlweise von dem westlichen oder dem östlichen Arzt behandeln zu lassen oder von beiden. Ihre Entscheidung wird vermutlich davon abhängen, wie sie sich selbst
Holismus versus Realismus?
141
und ihr Anliegen versteht, ob sie sich im westlichen Sinne krank fühlt und wieder "gesund" werden, oder ob sie einen Zustand energetischen Gleichgewichts mit sich und ihrer Umwelt wiederherstellen möchte. Wie sie sich versteht und was sie deswegen möchte, wird von ihrem soziokulturellen background abhängen. Nicht einfach zwischen verschiedenen Praktiken wird sie wählen, sondern zwischen verschiedenen Selbstverständnissen oder Lebensformen oder, wenn wir so wollen, theoretischmedizinischen Entwürfen. Das Scheitern eines direkten Praxisvergleichs scheint uns auf diese Weise nun doch einen Theorienvergleich nahezulegen. Bevor ich allerdings später (in den Abschnitten 6-8) dazu übergehe, möchte ich erst ein Stück Kategorienanalyse betreiben. Das wird uns helfen, uns etwaige Befangenheiten in unserer westlichen Vorstellungswelt, mit denen wir ja rechnen müssen, bewußter zu machen. Die Praktiken östlicher und westlicher Medizin sperren sich nämlich noch in weiteren Hinsichten gegen einen Vergleich. Wir haben gesehen, daß eine Person, bei der "etwas nicht stimmt", dieses Etwas ganz verschieden beschreiben und deshalb auch ganz verschiedene Wege, Abhilfe zu schaffen, einschlagen kann. Was "nicht stimmt", ist nicht neutral beschreibbar; jeweils verschiedene Sets von Symptomen werden für relevant gehalten. Es gibt keine gemeinsame Kategorie zur Subsumption von "Fällen". Aber können wir nicht einfach die Kategoriensysteme selbst einander gegenüberstellen und vergleichen? Auf welche Symptome achtet der westliche, auf welche der östliche Mediziner? Was heißt in einem Fall, "gesund" zu sein, was im anderen? Welche Krankheiten kennen die beiden Systeme respektive, welche Art von Diagnose, welche Therapieformen? Die grundlegende Schwierigkeit mit solchen Fragen scheint mir zu sein, daß wir nicht einmal gemeinsame Metakategorien zur Verfügung haben. Z.B. heißt nicht einfach "gesund" in einem System dies, im anderen das, sondern diese Art (Meta-)Kategorie kennt die östliche Medizin kaum. Es gibt dort nicht so etwas wie einen überindividuell gekennzeichneten Normalzustand; jedenfalls kann der Zielzustand nicht eigentlich beschrieben werden, weil "das Tao (- der ausgeglichene und harmonische Weg), das ausgesagt oder beschrieben werden kann, nicht das wahre Tao ist".3 Es lohnt sich vielleicht, bei dem Beispiel des Gesundheitsbegñffs einen Moment zu verweilen. Was Gesundheit ist, kann im Osten entweder ganz einfach angegeben werden ("Ausgeglichenheit", "Harmonie") oder eben
142
Werner Diederich
gar nicht: nämlich nicht positiv als ein bestimmter organischer und physiologischer Zustand. Das hängt m.E. damit zusammen, daß das Gleichgewicht, das die Chinesen anstreben, ein dynamisches, individuell ganz verschieden realisierbares ist. Man kann auf viele verschiedene Weisen im Gleichgewicht sein. Das Ziel kann also immer nur jemandes Gleichgewicht sein, sogar nur ein jeweiliges. Nicht die Abweichung von einem Normzustand ist der Ausgangspunkt, sondern ein individuell besonderes Ungleichgewicht, eine spezifische Form von Unausgewogenheit der verschiedenen Energieformen etc., ein "Disharmoniemuster". Die chinesische Medizin setzt gleichsam bei der Pathologie an und "definiert" Gesundheit als nicht-pathologischen Zustand; sie geht also gerade umgekehrt vor wie die westliche Medizin. Das mag auch ihr zunächst verblüffendes Desinteresse an einer naturwissenschaftlichen Anatomie und Physiologie verständlich machen: die Funktionsweise des "gesunden" Körpers verdient gar kein eigenes systematisches Interesse4. Nicht viel anders verhält es sich beim komplementären Begriff der Krankheit. Es gibt in der chinesischen Medizin nicht so etwas wie überindividuelle Krankheitsbilder, sondern nur individuell geprägte "Disharmoniemuster". Das hängt zusammen mit einem fast gänzlichen Fehlen kausalen Denkens in der östlichen Medizin und dem entsprechend verschiedenen Diagnoseverfahren. Während im Westen Diagnose im wesentlichen darin besteht, bestimmte Symptome auf ihre "Ursachen" zurückzuführen, bleibt die chinesische Medizin viel stärker auf der Ebene der Symptome, freilich anderer Symptome und vor allem des Zusammenhangs vieler Symptome in bestimmten Mustern. Zwar kennt auch die chinesische Medizin "krankheitsauslösende Faktoren", doch sieht man schnell, daß diese Faktoren kaum als Ursachen im westlichen Sinne bezeichnet werden können: Diese Faktoren fallen in die Kategorien der Umgebung, der emotionalen Einstellung und der Lebensweise, wobei nur die Faktoren der erstgenannten Kategorie als externe verstanden werden, und das auch nur in einem recht eingeschränkten Sinne: als Umweltfaktoren werden Wind, Kälte, Feuer/Hitze, Feuchtigkeit, Trockenheit und Sommerhitze genannt, scheinbar klimatische Faktoren also, in Wirklichkeit aber Momente der jeweiligen Disharmoniemuster des Menschen, die "kausal" höchstens im Sinne von Wechselwirkungen mit externen Bedingungen zu verstehen sind. Die sechs genannten Faktoren kennzeichnen nämlich zugleich Tendenzen oder Dispositionen von Personen und sind so Züge, die Mikround Makrokosmos miteinander verbinden. Jede Person wird also von der
Holismus versus Realismus?
143
chinesischen Medizin zugleich als wesentlich individuell (nicht als "Fall") und als Teil oder Abbild ihrer Umgebung wahrgenommen. Harmonie, als erstrebenswerter Zustand, ist immer mehr als nur ein In-sich-ruhen, nämlich ein Einklang letztlich mit dem gesamten Kosmos. 4. Wir haben gesehen, daß sich westliche und östliche Medizin gegen einen direkten Vergleich sperren: (1) Es wird auf unterschiedliche Symptome geachtet. (2) Die Behandlungsmethoden sind nicht nur verschieden, sondern dienen auch verschiedenen Zielen. (3) Die theoretischen Systeme, in denen die Symptome gedeutet werden, sind grundverschieden. (4) Sie spielen verschiedene Rollen für die medizinische Praxis. Wegen (1) ist es kaum möglich, "Fälle" neutral zu formulieren, in bezug auf welche Behandlungserfolge verglichen werden könnten. Die westliche Medizin benutzt zur Diagnose hauptsächlich quantitative Parameter wie Blutdruck, Pulsfrequenz, Blutzuckergehalt, Leberwerte etc., die östliche dagegen qualitative Charakteristika wie schleichender/klopfender Puls, Färbung der Zunge, Leere/Fülle von Leitbahnen (Meridianen) etc. Dementsprechend wird auch der wünschbare Zustand nach einer Behandlung verschieden beschrieben und ist oft verschieden: ein nach östlichen Maßstäben geheilter Patient kann nach westlichen Kriterien weiter behandlungsbedürftig sein und umgekehrt. Diese Verschiedenheit der Zielsetzungen (2) hängt zusammen mit den Unterschieden der deutenden theoretischen Systeme (3). Während im Westen nach Ursachen der Symptome gesucht wird, die in fest umrissene Krankheitsbilder einzuordnen sind, die prinzipiell eine Klassifikation, Erklärung und Prognose im Stile naturwissenschaftlicher Methodologie erlauben ("Subsumptionsmodell von Diagnose und Therapie"), bleibt die östliche medizinische Theorie wesentlich auf der Ebene der Erscheinungen selbst. Sie versucht, innerhalb der Symptommannigfaltigkeit der untersuchten Person "Disharmoniemuster" auszumachen - ohne ein sonderliches Interesse an einer kausalen Erklärung dieser Muster zu nehmen. Dieses Desinteresse erklärt
144
Werner Diederich
sich u.a. damit, daß in der östlichen Medizin die untersuchte und behandelte Person viel mehr als ein besonderes Ganzes, ein Individuum, behandelt wird, das als solches keinen Naturgesetzen zu subsumieren ist: es gibt keine hinlänglich umfassenden Gesetze, die auf diesen spezifischen Menschen zugeschnitten sind, und die chinesische Medizin sucht auch gar nicht nach solchen. Dementsprechend spielen die theoretischen Systeme in Ost und West auch ganz verschiedene Rollen für die medizinische Praxis (4). Im Westen bedeutet ein "Fall" immer das "Fallen unter" (letztlich) Naturgesetze, deren Geltung mehr oder weniger zwingend bestimmte Behandlungen vorschreibt. In der östlichen Medizin ist der Zusammenhang von Theorie und Praxis viel lockerer. Die "Theorie", wenn man sie denn überhaupt so nennen darf, spielt eher nur eine heuristische Rolle. Primär kommt es auf die Erfahrung und erworbene Feinfühligkeit der diagnostizierenden und behandelnden Person an. Die Theorie kann dabei nur dazu dienen, die akkumulierten Erfahrungen vergangener Generationen begleitend bis leitend einfließen zu lassen.
5. Daß dies in der östlichen Medizin auch nicht viel anders sein kann, erhellt schon daraus, daß deren theoretisches System anscheinend recht heterogene Elemente enthält, die oft nur dürftig miteinander verbunden und systematisiert sind. Würde eine dem westlichen Subsumptionsmodell vergleichbare enge Anbindung der Praxis an die Theorie bestehen, so würde die Diversität der Theorieteile offenkundiger in der Praxis und von daher auf theoretische Entscheidungen drängen. Ich betrachte als Beispiel zwei der ältesten theoretischen Traditionen der chinesischen Medizin, die Yin-Yan^-Theorie und die Lehre von den Fünf Elementen oder "Wandlungsphasen. Es handelt sich hier offenbar tatsächlich um zwei unabhängig voneinander entstandene, wenn auch schon sehr früh miteinander verschmolzene Traditionen 6 Während die Yin-YangTheorie dadurch, daß sie über nur zwei in ihrer Bedeutung sehr offene Grundbegriffe, Yin und Yang, verfügt und scheinbar fast beliebige Differenzierungen gestattet: Yin im Yang, Yang im Yang, etc., sich einer sich entwickelnden Praxis recht plastisch angleichen läßt, neigt die FünfPhasen-Theorie zu einem starreren Begriffsgerüst, das leichter Risiken
145
Holismus versus Realismus?
läuft, mit anderen Systemteilen und mit Empirie und Praxis in Konflikt zu geraten. Ich will das etwas verdeutlichen. Als die fünf Phasen werden Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser angegeben. Diese üblich gewordenen westlichen Übersetzungen haben dazu ge- oder verführt, von "fünf Elementen" zu sprechen und diese in Analogie zu den abendländischen vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde zu verstehen. Dabei gelingt es, aus bestimmten inhaltlichen Gründen, noch relativ leicht, Metall und Luft einander zuzuordnen. Bliebe Holz, das "rausfällt" aus unserem System. Spätestens seit Aristoteles fanden die vier empedokleischen Elemente ihre "Begründung" in den Qualitätspaaren feucht/trocken und warm/kalt, nämlich nach dem Schema: feucht
trocken
warm
Luft
Feuer
kalt
Wasser
Erde
Abb. 1
Diese Anordnung legt eine rudimentäre Theorie chemischer Umwandlungen nahe: benachbarte Elemente, also solche, die eine der vier Qualitäten miteinander teilen, gehen leichter ineinander über. Im Unterschied dazu sind die fünf Wandlungsphasen von vornherein auf Übergänge ineinander, bzw. überhaupt als Phasen von Prozessen konzipiert, denen eben deswegen nicht der substantielle Charakter von Elementen zugesprochen werden kann. Die wichtigsten der möglichen Übergänge können in dem folgenden Kreisschema wiedergegeben werden (s.folgende Seite). Die Übergänge in Pfeilrichtung können dabei in mehrererlei Hinsicht verstanden werden. Einmal gibt es tatsächlich eine "elementische" Bedeutung: das Holz nährt das Feuer, Feuer wird zu Asche (Erde), Erde läßt in sich Metall wachsen (eine auch westliche Vorstellung), Metall "zieht Wasser an", Wasser läßt Holz wachsen. Sodann gibt es die im Diagramm schon eingezeichnete Zuordnung zu den Jahreszeiten. (Die Zuordnung ErdeSpätsommer ist cum grano salis zu verstehen. Erde entspricht eher allen Übergangszeiten.7) Schließlich wird die dargestellte Anordnung auch als "Mutter-Kind"-Beziehung verstanden und insofern nicht nur als "chemische", sondern auch als biologische Erzeugung. (Die ebenfalls beachtete "Großmutter-Kind"-Beziehung, also von Holz zu Erde, von Erde
146
Werner Diederich
zu Wasser, usw., wird auch als Kontrollfunktion gedeutet, z.T. mit naheliegenden Interpretationen im Alltag. )
Holz (Frühjahr) «I
/c.Feuer
(
\
Wasser (Winter)
ν
4
(Sommer)
Erde (Spätsommer)
(Herbst) Metall
y
Abb. 2
Neben den genannten Zuordnungen der Phasen zu Stoffen, Jahreszeiten und Generationen, die sich in obigen Kreislauf fügen, wurden im Laufe der Zeit eine Fülle weiterer Verbindungen geknüpft, die zu anderen oder auch gar keinen Kreisdiagrammen führen, so zu Tageszeiten, Gerüchen, Himmelsrichtungen (mit "Mitte" für Erde), Farben, Emotionen und vielen anderen mehr, last not least, für die Medizin von besonderer Bedeutung, zu "Organen" oder Leitbahnen (Meridianen), nämlich jeweils einem Yinund einem Yang-Organ/-Meridian:
Yin Yang
Holz
Feuer
Erde
Metall Wasser
Leber
Herz
Milz
Lunge Nieren
Magen
Dickdarm
Gallen- Dünnblase darm
Blase
Abb. 3
Wie jedoch die Fünfzahl der Zuordnung bei den Jahreszeiten (und Himmelsrichtungen) Schwierigkeiten macht, so - in umgekehrter Richtung - die Entsprechung zu den Leitbahnen: nach klassischer Lehre gibt es näm-
Holismus versus Realismus?
147
lieh mindestens zwei weitere Leitbahnen, "Herzkreislauf' (HK) und "Dreifacher Erwärmer" (DE) 9 , die zwar noch weniger "Organen" im westlichen Sinne (sondern eher "Funktionen") entsprechen als die zuvor genannten zehn Leitbahnen, die aber dank ihrer Lokalisierung auf der Körperoberfläche einen eindeutigen Platz in der Systematik der Leitbahnen beanspruchen können: sie verlaufen im wesentlichen mittig auf der Innenbzw. Außenseite der Arme und komplettieren so das Bild zu je sechs Meridianen an den Extremitäten. HK und DE werden auch dem Feuer zugeordnet, genauer dem "ergänzenden Feuer", im Unterschied zum "absoluten Feuer" von Herz und Dünndarm. (Durch die Zwölfzahl der Meridiane lassen sich diese dann auch "zwanglos" je zwei Stunden der Tages- oder Nachtzeit zuordnen.10) Ich habe die Fünf-Phasen-Theorie auch deshalb hier relativ ausführlich geschildert, um einen Eindruck zu geben von der Komplexität und Spannweite der mit der medizinischen Praxis verbundenen theoretischen Vorstellungswelt. Diese verbindet, wie wir gesehen haben, eine Art "Anatomie" des menschlichen Körpers mit einer Fülle anderer Aspekte, u.a. mit den emotionalen Strukturen und der Umwelt des Menschen, bis hin zum gesamten Kosmos. Man mag den Verdacht haben, daß hier, jedenfalls für medizinische Zwecke, viel unnötiger Ballast mitgeschleppt wird. Ich denke, daß dem auch so ist; doch widerstrebte es dem (leider zum Synkretismus neigenden) Geist chinesischer Medizin, hier scharfe Grenzen zu ziehen. Die Fünf-Phasen-Theorie in ihrer Gesamtheit ist sicherlich ein bis in absurde Details verfolgter und teilweise numerischen Pseudo-Sachzwängen geschuldeter Versuch einer umfassenden Kosmologie. Zu Recht mag ein Autor wie Ted J. Kaptchuk die ältere Yin-Yang-Theorie mit ihren spezifischer medizinischen Differenzierungen vorziehen. 11 Es scheint mir aber doch so zu sein, daß gerade die Fünf-Phasen-Theorie ein unentbehrliches Hilfsmittel medizinischer Praxis darstellt, und nicht nur als gelegentliches Hilfsmittel angesehen werden kann. Jedenfalls kann das vom Shiatsu gesagt werden, vielleicht mehr als von der Akupunktur. Und zwar spielen die "Elemente" oder Phasen sowohl diagnostisch als auch therapeutisch eine Rolle, insbesondere z.B. die oben erwähnte "MuttérKind"-Beziehung: um etwa eine Schwäche im Metallelement (u.a. Bereich der Atmung und der Haut) auszugleichen, lohnt es sich oft, nach "Ursachen" im Mutterelement von Metall, Erde (u.a. Magen, Bauchspeicheldrüse etc.) Ausschau zu halten und hier vielleicht auch therapeutisch anzusetzen, anders ausgedrückt: die betreffende Person von der
148
Werner Diederich
"Mitte" her zu stärken, um Schwächen der Peripherie zu behandeln. Auch tragen die emotionale Befindlichkeit der untersuchten Person, ihre Vorlieben und Abneigungen für bzw. gegen bestimmte Speisen, Farben, Gerüche etc. zum Gesamtbild und damit der Diagnose der Person bei. Sicherlich ist in jedem Einzelfall ein Großteil des von der Fünf-PhasenTheorie angebotenen Vorstellungsmaterials entbehrlich - und was herangezogen wird, hängt wohl auch von den Besonderheiten der behandelnden Person ab -, doch ein Verzicht auf diesen theoretischen background scheint in praxi kaum möglich.
6. Ich wende mich jetzt dem erkenntnistheoretischen und ontologischen Status medizinischer Theoriebildung zu, besonders der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer realistischen Interpretation solcher Theorien: Gibt es Gründe für die Annahme, daß die von einer medizinischen Theorie postulierten Entitäten wirklich existieren? Ich möchte diese Frage zunächst für die östliche Medizin diskutieren und sodann für die westliche im Vergleich mit der östlichen. Zwei Momente östlicher medizinischer Theorienbildung sprechen gegen eine realistische Interpretation. Zum einen haben wir gesehen, daß die östlichen theoretischen Systeme sehr heterogen und teilweise wohl geradezu inkonsistent zusammengesetzt sind; insbesondere scheint dies für die YinYang-Theorie und die Fünf-Phasen-Theorie der Fall zu sein 12 , beide für die Praxis unentbehrliche theoretische Leitvorstellungen. Allerdings dürfte es mißlich sein, hier von logischen Widersprüchen im westlichen Sinne zu reden, da die Vagheit vieler Begriffe einen solchen Widerspruch mindestens nicht abzuleiten gestattet. Auch ist diese Vagheit, in chinesischen Augen, nicht einfach ein Defizit, sondern entspricht einer taoistischen Grundhaltung, die allen begrifflichen Fixierungen bewußt ausweicht und gern zu paradoxen Formulierungen greift. Zum andern haben wir gesehen, daß die theoretischen Systeme der chinesischen Medizin nur sehr locker mit der Praxis verbunden sind. Jedenfalls gilt das im Detail, wenn auch nicht in toto. Wir können oft eine verblüffende Kohärenz der einzelnen Interpretamente konstatieren, etwas daß Puls, Zungenbelag, Gesichtsfarbe, Tonus der Leitbahnen etc. im Sinne der Theorie in dieselbe Richtung weisen und so ein stimmiges Gesamtbild
Holismus versus Realismus?
149
oder "Disharmoniemuster" der untersuchten Person vermitteln. Daraus folgt aber nun nicht, daß die betreffende Diagnose, etwa "kalter Wind im Nieren-Qi" oder ähnliches auf wirklich existierende Entitäten verweist. Wir haben es hier mit einer anderen Art von Zusammenhang zu tun als dem, im westlichen wissenschaftsphilosophischen Diskurs anvisierten, von theoretischen Entitäten und empirischem Material. Von daher wäre es auch unangemessen zu sagen, das Verhältnis von Theorie und Praxis in der chinesischen Medizin lege einen Anti-Realismus nahe. Vermutlich würde ein philosophisch bewußter chinesischer Mediziner schon die Fragestellung "Gibt es das Qi, gibt es seine besonderen Formen wie Nieren-Qi, Herz-Qi, usw. wirklich?" zurückweisen; der 'realism issue' ist für die Chinesen vermutlich keiner. Aber bilden wir uns nicht ein, so einfach über unsere Fragestellungen hinweggehen zu können! Wir wollen wissen, was wirklich ist, oder -vielleicht neutraler - was real ist (um nicht an die im deutschen "wirklich" anklingende Vorstellung von Wirken anzuknüpfen). Und da können wir nur feststellen: wir haben aus den angeführten Gründen keinen Anlaß, an die reale Existenz der im theoretischen Arsenal der chinesischen Medizin versammelten Entitäten zu glauben.
7. Ist es um eine realistische Interpretation westlich-medizinischer Theorien besser gestellt? Tatsächlich sind unsere Mediziner, jedenfalls außerhalb der Sprechstunden sozusagen, schnell bereit zuzugeben, daß es mit der Verwirklichung des naturwissenschaftlichen Anspruchs ihrer Disziplin nicht so weit her ist. Aber mag dem sein, wie es wolle, es geht mir hier auch und gerade um diesen Anspruch, der jedenfalls teilweise erfüllt wird und als Tendenz in der medizinischen Forschung allemal wirksam ist. Diesem tendenziell erfüllten Selbstbild westlicher Medizin entsprechend werden auf der Grundlage enorm verfeinerter anatomischer und physiologischer Kenntnisse eine Unmenge detaillierter Kausalketten nachgezeichnet, die insbesondere bestimmte (zunächst) nicht wahrnehmbare (Mikro-)Zustände mit wahrnehmbaren Symptomen ursächlich verbinden. An der Realität der postulierten Ursachen kann oft kein begründeter Zweifel bestehen, etwa wenn ich bei einem chirurgischen Eingriff diese schlicht finde. In anderen Fällen mögen die Ursachen nur vage umrissen und ihre Existenz nicht
150
Werner Diederich
unabhängig von ihrer behaupteten symptomatischen Wirkung nachvollziehbar sein. Aber es scheint so, das sei nur eine Frage der Zeit; vergrößerte Forschungsanstrengungen führten grundsätzlich eines Tages zu einer vollständigen ursächlichen Aufklärung der Krankheitserscheinungen. Oder ist dem nicht so? Geht uns auch bei noch so intensiver biomedizinischer Forschung prinzipiell "etwas durch die Lappen"? Es ist schwer zu sehen, wie oder ob überhaupt diese Frage befriedigend beantwortet oder auch nur sinnvoll - unmetaphorisch - gestellt werden kann. Oft werden der naturwissenschaftlichen Medizin scheinbar bündig Grenzen gezogen mit dem Diktum, das Ganze sei mehr als die Summe seiner Teile. Doch möchte ich einem solchen unqualifizierten Holismus nicht das Wort reden. Statt dessen möchte ich jedenfalls an einer Stelle -wie ich hoffe, paradigmatisch - aufzeigen, daß uns tatsächlich "etwas durch die Lappen" zu gehen scheint. Unter westlichen Medizinern, nicht nur Psychosomatikern, wächst die Einsicht in die Wirksamkeit psychischer Faktoren beim Krankwerden wie beim Heilen. Warum zeigen zwei Personen mit, somatisch betrachtet, dem gleichen klinischen Befund mitunter ganz verschiedene Krankheitsverläufe? Nun, bei genauerer Hinsicht wird man vielleicht doch die Befunde in relevanter Hinsicht differenzieren können. Es scheint aber -jedenfalls machen Mediziner mich das glauben - einen prinzipiell unaufklärbaren "Rest" zu geben, der oft in psychischen Faktoren gesucht wird. Nehmen wir einmal für das Argument an - wovon wir offenbar weit entfernt sind -, es gelänge, auch diese seelischen Aspekte gemäß dem naturwissenschaftlichen Subsumptionsmodell in den Griff zu bekommen. Jeder einzelne Fall wäre dann neben den biomedizinischen auch psychologischen Gesetzmäßigkeiten zu unterwerfen. Könnten wir dann das Krankheitsgeschehen ganzheitlich, umfassend erklären und durch Eingriffe verläßlich beeinflussen? Mir scheint, daß hier tatsächlich, auch im optimalen Fall, etwas fehlt - nämlich etwas, was man im echten Sinne Psychosomatik nennen könnte. Das naturwissenschaftliche Erkenntnismodell verlangte strenge Korrelationen psychischer und somatischer Faktoren, nicht nur - um den Preis schizoider Doppelung - parallele psychische und physische Behandlung. Nun ist es sicherlich nicht ausgeschlossen, daß eine in diesem Sinne echte Psychosomatik möglich ist, doch scheint mir das nicht sehr wahrscheinlich zu sein. Diese Einschätzung beruht, zugegebenermaßen, vorläufig nicht auf einer genauen Analyse psychosomatischer Theoriebildung, sondern
Holismus versus Realismus?
151
auf einem Vergleich mit relevanten Aspekten östlicher Medizin. Einer der für uns verblüffendsten Züge östlicher Medizin ist nämlich, daß der uns nur zu geläufige psychophysische Dualismus in ihr offenbar nicht vorkommt, obwohl emotionale Qualitäten auf fast allen Ebenen eine bedeutende Rolle spielen. Dieser Zug der chinesischen Medizin ist nun aber nicht etwa das Resultat einer in dieser Hinsicht geschickten Kategorienwahl, sondern etwas theoretisch wie praktisch Selbstverständliches! Die Zugangsweise der chinesischen Medizin ist von vornherein psychophysisch "integriert" - "integriert" in Anführungszeichen, weil es da gar nichts zu integrieren gibt, was zunächst getrennt wäre. Zum Erscheinungsbild einer Patientin gehört selbstverständlich und untrennbar von ihrem somatischen Zustand ihre emotionale Befindlichkeit. Und ebenso selbstverständlich wird ihre Person von dem behandelnden Arzt in ihrer Ganzheit wahrgenommen. Letzteres wiederum ist wohl nur möglich, wenn dieser selbst sich als psychophysische Einheit versteht und als solche in den Prozeß von Diagnose und Therapie einbringt. Natürlich bleibt das Geschehen zwischen den beiden Personen gerichtet; eine "therapeutische Situation" ist in der östlichen medizinischen Praxis ebenso erforderlich wie bei uns. Nur werden diese Strukturen bei uns praktisch nur in der Psychotherapie reflektiert - in Kategorien der Übertragung, Gegenübertragung, etc. - und auch da in der Regel nur einseitig als psychische. In der klassischen Psychoanalyse gibt es sogar so etwas wie ein Berührungsverbot zwischen Arzt und Patienten (was für die Technik der Projektion seinen guten Sinn haben mag). Umgekehrt wird der Körperkontakt in der somatischen Praxis entpersönlicht, sogar durch Benutzung von Apparaten weitgehend vermieden (wiederum teilweise mit guten Gründen der Hygiene oder der Effektivität, wenn beispielsweise ein weniger gründlich als seine östlichen Kollegen ausgebildeter Akupunkteur die Tsubos, das sind die zu nadelnden Reizpunkte, nicht ertastet, sondern durch Hautwiderstandsmessungen aufspürt). Bei der Akupunktur und, mehr noch, beim Shiatsu kann die praktische Ausübung letztlich nur als Interaktion, als Begegnung zweier Personen, verstanden werden. Jede Shiatsu-Behandlung beginnt mit einer meditativen Selbstvergewisserung der behandelnden Person, schreitet fort über das "bo-shin", ein ungefähres, absichtsloses Schauen auf die zu behandelnde Person, das diese nicht-analytisch und noch durchaus subjektiv als ganze wahrzunehmen sucht, und eröffnet die eigentliche Diagnose und
152
Werner Diederich
Behandlung mit einer vorsichtigen, spürenden, ersten körperlichen Berührung, vorzugsweise am Hara, der "Mitte", anatomisch: am Unterbauch. Was dann weiter geschieht, bleibt zwar von der einen auf die andere Person gerichtet, ist aber tatsächlich ein Austausch, nicht nur ein Geben von Shiatsu, sondern immer wieder auch Spüren, körperliche Rückmeldung über Wärme, Tonus etc., Übertragen von Atemrhythmus und anderem mehr, das alles eingebettet in - bei der behandelnden Person theoriegeleitete Intuition. Einigen westlichen Psychotherapien, besonders sogenannten Körpertherapien, sind diese Dinge nicht ganz fremd, so z.B. der von A. Löwen entwickelten, auf den Freud-Schüler W. Reich zurückgehenden Bioenergetik. 13 Typischerweise wird dort mit Begriffen wie "Charakterpanzer" gearbeitet, d.h. mit der Vorstellung, daß wir unsere persönliche emotionale Entwicklung in einer spezifischen Ausprägung unseres Muskelsystems gleichsam speichern und - für den geübten Blick des Bioenergetikers - "ausdrücken". Durch Arbeit mit und an dem Muskelpanzer - vornehmlich durch Übungen der Patientin, weniger durch therapeutische Berührung - werden "Energien" wieder zum "Fließen" gebracht, Konflikte reaktiviert und so der - in der Regel verbalen - Psychotherapie zugänglich gemacht. Es ist indes nicht zu übersehen, daß die Begrifflichkeit, auch die der Bioenergetik, weitgehend dem psychophysischen Dualismus verhaftet bleibt, wie in der Wortkrücke "Charakterpanzer", und als neutral gemeinte Begriffe nur so vage wie den der "Energie" kennt.14 8. Am Beispiel der Einbeziehung psychischer Komponenten in das medizinische Menschenbild habe ich zu zeigen versucht, wie schwer sich die westliche Medizin tut, Aspekte des Menschseins einzubeziehen, die das Krankheitsgeschehen tangieren, vielleicht sogar wesentlich mitbestimmen, sich aber nur schwer, wenn überhaupt, dem naturwissenschaftlich geprägten Methodenideal fügen. Die östliche Medizin, mit ihrem lockereren Methodenverständnis und ihrer ganzheitlichen Sichtweise, scheint diese Aspekte leichter und von vornherein, nicht erst durch Überwindung konzeptueller Grenzen, berücksichtigen zu können. Sicherlich hat die traditionelle chinesische Medizin auch ihre blinden Flecken, sie kennt z.b. kein Nervensystem und hat kein Konzept von Infektionskrankheiten, doch auch
Holismus versus Realismus?
153
ohne spezielle Kenntnisse der Anatomie und miskropischer Erreger versteht sie es, durch ihr System der Meridiane und einer vertieften Phänomenologie des Ablaufs fiebriger Erkrankungen, mit den entsprechenden Störungen hilfreich umzugehen. Sie darf deshalb getrost als holistischer, wenn auch freilich in einigen Bereichen als weniger effektiv als die westliche Medizin angesehen werden. Entsprechend bildet sich dort, wo beide Traditionen einander in der Praxis berühren - in einigen Zentren Chinas, in Japan und in einigen westlichen Ländern -, eine Art Arbeitsteilung heraus, die vereinfacht oft darauf hinausläuft, daß z.B. Fälle für die Chirurgie (Unfallmedizin) und akute gefährliche Infektionen "westlich" behandelt, aber Rehabilitation und Behandlung chronischer Leiden, die mehr den ganzen Menschen betreffen, eher östlicher Heilkunst anvertraut werden. 15 Es ist wohl auch das holistische Menschenbild, das viele im Westen an der chinesischen Medizin anzieht und das sie in der westlichen Tradition weitgehend vermissen; auch die zunehmende Beliebtheit heterodoxer Strömungen im Westen selbst, wie Homöopathie und anthroposophische Medizin, weisen in diese Richtung. Daß sich jedoch im Westen jemand nur auf die östliche (oder "Alternativ"-) Medizin verläßt, ist nicht nur aus praktischen Gründen sehr selten. Ein weiterer Grund scheint mir zu sein, daß für den Holismus östlicher Medizin ein Preis zu zahlen ist, den wir - in Kenntnis unserer Tradition - nicht so ohne weiteres zu zahlen bereit sind. Wir können nämlich, wie ich hoffe gezeigt zu haben, die medizinische Theorie des Ostens kaum beim Wort nehmen, soll heißen: nicht realistisch interpretieren; und zwar nicht nur deshalb nicht, weil sie sich mit unserem medizinischen Menschenbild nicht vertrüge - das ist nicht einmal ausgemacht -, sondern weil sie in sich zu wenig kohärent ist und wegen ihres nur lockeren und vage gehaltenen Zusammenhangs mit medizinischer Erfahrung ihr Realitätsgehalt sich schwerlich bestimmen läßt. In diesem Sinne können wir, wie es die Titelfrage schon suggerieren sollte, nur (höchstens) eines haben: Holismus oder Realismus. Die Einschränkung "höchstens" habe ich soeben insofern gemacht, als die Möglichkeit einer realistischen Interpretation westlicher medizinischer Theorie auch nicht so ohne weiteres gegeben ist. Sie scheint mir nur, überschlägig gesprochen, weniger skeptisch zu beurteilen zu sein als die der östlichen Theorien. Ich möchte dazu nicht ins Detail gehen, sondern nur verweisen auf die ausgedehnten allgemeinen Debatten der letzten Jahre zum Thema "wissenschaftlicher Realismus", die m.E. gezeigt haben, daß,
154
Werna- Diederich
wenn auch kaum ein Theorien-, so doch ein Entitäten-Realismus sich sehr wohl plausibel vertreten läßt; soll heißen: selbst wenn wir zu der Einsicht gedrängt werden, daß "the laws of physics lie" (fast immer jedenfalls) 16 , es uns doch oft gelingt, über Ursachenketten die Existenz der Entitäten, von denen unsere Theorien handeln, über vernünftige Zweifel hinaus sicherzustellen.17 Insofern also die westliche Medizin Ursachenforschung betreibt und ursächliche Therapien begründet - eine Voraussetzung, die zwar sicher nicht durchgängig erfüllt ist, die ich hier aber idealtypischerweise schon eingangs gemacht habe - ist sie nach gegenwärtigen wissenschaftsphilosophischen Standards jedenfalls realistischer als die östliche. In der beschriebenen Weise haben wir also zwischen Realismus und Holismus zu wählen. Ist das mehr als eine faire Beschreibung des status quo? In praxi scheinen viele "Konsumenten", und nicht wenige Mediziner, beides verbinden zu wollen, indem sie westliche und östliche Heilkunst parallel anwenden. Deutet diese Praxis auf einen "Meta-Holismus" hin, eine Verbindung von im Detail effektiverer, wenn auch partikularisierender, ursächlich eingreifender westlicher Medizin mit sanfterer, risikoärmerer, phänomenologischer östlicher Ganzheitsmedizin? Sind die chinesischen Mediziner die "Spezialisten für's Allgemeine" (wie Ernst Bloch die Philosophen genannt hat), zuständig für die Restkategorie all dessen, was durch das scharfe, aber eben doch löchrige Raster unserer naturwissenschaftlichen Sichtweise fällt? Können wir Holismus als Ergänzung haben, von der wir insgeheim hoffen, sie eines Tages, wenn unser Raster fein genug ist, nicht mehr zu benötigen? Ich denke, eine wirkliche Verbindung von Holismus und Realismus, eine Befriedigung unseres Bedürfnisses, als ganze Personen wahrgenommen und behandelt zu werden, bei gleichzeitigem Festhalten an der Effektivität westlicher Apparatemedizin, ist nicht leicht zu haben. Zu sehr sind die entsprechenden Praxen in den respektiven Lebensformen mit all ihren divergenten, oft unverträglichen Erwartungen verwurzelt. Darüber hinwegzusehen und -zugehen führt nur zu modischen Trends, nicht zur Integration. Hilfreicher scheint mir, die beiden Medizin- und die sie hervorbringenden Lebensformen als komplementär zu begreifen und damit ihre tiefgreifende Differenz erst einmal zu respektieren. Wir können von der anderen Kultur nicht wirklich durch Vereinnahmung (des uns brauchbar Scheinenden) lernen, sondern nur durch wiederholte Versuche, in die andere Vorstellungs- und Lebenswelt auch praktisch einzutauchen. Vielleicht lernen wir dabei, nämlich wenn wir "zu uns" zurückkehren, mehr über uns selbst als
Holismus versus Realismus?
155
über die anderen und können so die Defizite unserer Kultur anders als durch kolonialisierenden Zugriff überwinden.
Anmerkungen 1 Für die chinesische Medizin beziehe ich mich im folgenden vor allem auf Ted J. Kaptchuk (1983), zitiert nach der deutschen Ausgabe (1988). 2 Shiatsu (wörtlich "Fingerdruck") ist vordergründig eine Massagetechnik nach Akupunkturprinzipien, die bald nach der Jahrhundertwende in Japan aus älteren Vorformen entstand. Sie ist inzwischen eine auch im Westen verbreitete Heilkunst, die auch meditative, yoga-ähnliche Körperübungen einschließt. Vgl. Shitsuto Masunaga/Wataru Ohashi (1977), zitiert nach der deutschen Ausgabe (1989). 3 Kaptchuk (1988), S. 62; vgl. S. 158. 4 Kaptchuk (1988), S. 62f., vgl. auch die Anmerkung zum "kulturellen Gesundheitsbegriff". 5 Zur Yin-Yang-Theorie vgl. Kaptchuk (1988), S. 19ff. sowie für deren Anwendungen auf "Disharmoniemuster" Kap. 7, S. 197ff„ für die Lehre von den Wandlungsphasen Anhang H, S. 390ff., ferner Dianne M. Connelly ( 3 1987). 6
Die etwa im vierten vorchristlichen Jahrhundert entstandene Fünf-Phasen-Theorie verschmolz während der Han-Dynastie (ca. 200 vor bis 200 n.Chr.) mit der sehr viel älteren Yin-Yang-Theorie. Vgl. Kaptchuk (1988), S. 392f„ zur Übersetzungsproblematik ("ElementeY'Wandlungsphasen") S. 390f.; beim Shiatsu werden die Phasen gelegentlich auch "Energie-Formen" genannt
7
Vgl. Kaptchuk (1988), S. 391 sowie Connelly ( 3 1987), S. 53, auch für die Zuordnung zum nordamerikanischen "Indian Summer". 8 Vgl. Kaptchuk (1988), S. 398f. 9
Statt "Herzkreislauf" (Ohashi (1977), S. 38) wird auch "Herzkonstriktor" (Masunaga/Ohashi (1989), S. 41) oder "Herzbeutel" (Kaptchuk (1988), S. 114) übersetzt, im Englischen auch "Circulaüon Sex" (Connelly ( 3 1987), S. 36).
10 Connelly ( 3 1987), S. 72, fast manisch bei J.R. Worsley (1986), S. 68 u. 80ff. 11 Kaptchuk (1988), S. 401ff. 12 Kaptchuk (1988), S. 399ff. 13 Alexander Löwen (1979) 14 Löwen (1979), Kap. 2, S. 33ff. Allerdings ist der Energiebegriff bei Löwen noch nicht zum Modeartikel verkommen wie im zeitgenössischen esoterischen Schrifttum. Für Lowens Bezug auf Reichs Orgon-Theorie vgl. Löwen (1979), S. 23ff. 15 Vgl. Kaptchuk (1988), bes. S. 33, Anm. 26; femer Worsley (1986), z.B. S. 119. 16 Nancy Cartwright (1983); vgl. von derselben Autorin (1989).
156
Werner Diederich
17 Vgl. Ian Hacking (1983), jedoch auch (1988). 18 Vgl. Ian Hackings 'Anarcho-Rationalism' in (1982), S. 48-66: "Anarcho-rationalism is tolerance for other people combined with the discipline of one's own standards of truth and reason." (S. 66).
Literatur [ 1 ] Cartwright, N. (1983), How the Laws of Physics Lie, Oxford. [2] Cartwright, N. (1989), Nature's Capacities and their Measurement, Oxford. [3] Connelly, D.M. (1975), Traditional Acupuncture: The Law of The Five Elements, Columbia, Maryland, rev. ed. 1979, 3 1987. [4] Hacking, I. (1983), Representing and intervening, Cambridge. [5] Hacking, I. (1988), The Participant Irrealist At Large in the Laboratory, Brit. J. PhU. Sci. 39, 277-294. [6] Hacking, I. (1982), Language, Truth and Reason, in: Hollis, M./Lukes, St. (eds.), Rationality and Relativism, Cambridge, Mass. [7] Kaptchuk, T.J. (1983), The Web That Has No Weaver. Understanding Chinese Medicine. Deutsch (1988): Das große Buch der chinesischen Medizin, Bern. [8] Löwen, A. (1979), Bioenergetik. Therapie der Seele durch Arbeit mit dem Körper, Reinbek. (Amerikan. Orig. 1975). [9] Masunaga, S./Ohashi, W. (1977), Zen Shiatsu. Deutsch (1989): Shiatsu. Theorie und Praxis der japanischen Heilmassage, Reinbek. [10] Ohashi, W. (1977), Shiatsu. Die japanische Fingerdrucktherapie, Freiburg. [11] Worsley, J.R. (1986), Was ist Akupunktur?, Berlin. (Engl. Orig. 1982).
Plädoyer für einen pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus Manfred Stöckler
1. Reduktionismus: Ein Konzept mit einem schlechten Ruf Viele philosophische Reizworte eignen sich deshalb für einen ungehemmten dogmatischen Schlagabtausch, weil ihre Bedeutung so vielfältig ist, daß jeder Kontrahent ungestraft eine eigene Vorstellung damit verbinden kann. Dies gilt sicherlich auch für den Begriff "Reduktionismus". Für die einen ist er ein Schimpfwort, das die unzulässige Übertragung physikalischer Methoden in die Biologie und die Sozialwissenschaften kennzeichnet, wobei gerade die entscheidenden Eigenschaften von Organismen und sozialen Systemen übersehen werden. Die Anhänger der Gegenpartei tragen zuweilen die Bezeichnung "Reduktionist" wie eine heldenhaft erworbene Auszeichnung und vermuten in jedem Angriff auf den Reduktionismus einen verborgenen Vitalismus, eine Berufung auf unkontrollierbare Agentien, magische Lebenskräfte und geheimnisvolle Wirksubstanzen, die jeder wissenschaftlichen Methode widersprechen. Der Streit um den Reduktionismus ist nicht nur theoretisch. Der modernen Medizin wird vorgeworfen, daß der naturwissenschaftliche Zugang, etwa in der Betonung der physiologischen Grundlagen der Lebensprozesse, die Heilung eines Patienten auf die Ebene der Reparatur eines defekten Automobils herabziehe. Man befürchtet, daß das falsche Bild vom Zusammenhang von Materie, Leben und Geist auch zu falschen Handlungen mit schlimmen Folgen führt. Viele unterschiedliche Assoziationen verbinden sich mit dem Wort Reduktionismus: Szientismus und Irrationalismus, Physikalismus und Vitalismus, die Metapher vom Mensch als Maschine, aber auch subtile
158
Manfred Stöckler
Fragen der logischen Beziehungen zwischen verschiedenen Theorien. Mehrere Problemstränge überkreuzen sich im Streit um den Reduktionismus und hinterlassen als Spur vielfältige Assoziationen. Ich möchte im folgenden die verschiedenen Problemfelder aus wissenschaftsphilosophischer Perspektive analysieren. Dabei wird sich zeigen, daß die beiden Parteien sich gar nicht so unversöhnlich gegenüberstehen müssen, da es ihnen um verschiedene Fragestellungen geht. Damit möchte ich der Aufgabe des Philosophen gerecht werden, Kommunikationshindernisse zu beseitigen und einen stabilen Rahmen für die Diskussion auch der praktischen Fragen zu schaffen.
2. Reduktionismus und Emergenz: Eine kurze Problemgeschichte Wenn auch das Wort "Reduktionismus" erst in den 40er Jahren unseres Jahrhunderts in Gebrauch gekommen ist, das damit verbundene Problem ist älter.1 Sieht man einmal davon ab, daß alle wichtigen philosophischen Probleme schon einmal bei den alten Griechen vorkommen (in unserem Zusammenhang müßte man bei den Atomisten nachschauen), dann ist unsere heutige Debatte eine Nachfolgediskussion der Frage, ob das Leben mechanisch zu verstehen ist. Diese Frage begleitet den Geburtsprozeß der Biologie als eigene Disziplin im 19. Jahrhundert. Wir wollen die Entwicklung am Beispiel eines ihrer Schlüsselbegriffe, nämlich der "Emergenz" verfolgen. Beginnen wir 1843 mit John Stuart Mill. Im 6. Kap. des ΠΙ. Buchs seines "System of Logic" befaßt sich Mill mit der Zusammensetzung von Ursachen. Bei der Untersuchung der Frage, wie man von den Wirkungen der Einzelursachen zum Ergebnis des Zusammenwirkens verschiedener Ursachen kommt, werden zwei Fälle unterschieden. Das erste Kompositionsschema ist charakteristisch für die Mechanik: Die Kenntnis der Einzelwirkungen erlaubt es, ohne Zusatzinformationen das Ergebnis des Zusammenwirkens abzuleiten. Mills suggestives Beispiel ist die Zusammensetzung mechanischer Kräfte, die einfache vektorielle Überlagerung, also die lineare Superposition (vgl. Mill 1843, S.370). In anderen Bereichen der Natur, die etwa von der Chemie untersucht werden, hat die Zusammensetzung neue, besondere Wirkungen. Eine chemische Verbindung hat andere Eigenschaften als die Ele-
Für einen pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus
159
mente, aus denen sie besteht. Aufgrund der Eigenschaften des Wasserstoffs und des Sauerstoffs kann man die Eigenschaften des Wassers nicht vorhersagen. Auch der Zucker, um ein weiteres Beispiel von Mill zu erwähnen, hat einen anderen Geschmack als die Summe des Geschmacks seiner Bestandteile (Mill 1843, S. 371). Dieser Fall, den George Henry Lewes 2 dann später (im Gegensatz zur "resultanten" Zusammensetzung in der Mechanik) "emergent" nannte, umfaßt vor allem lebende Organismen: "... the phenomena of life ... bear no analogy to any of the effects which would be produced by the action of the component substances considered as mere physical agents" (Mill 1843, S. 371). In Mills Ausführungen sind fast schon alle Elemente enthalten, die in der späteren Diskussion für Mißverständnisse gesorgt haben. Es ist nicht klar, ob Mill den logischen Aspekt der prinzipiellen Ableitbarkeit oder den epistemischen Aspekt einer echten Vorhersage im Sinn hat.3 Außerdem eröffnet er durch das Beispiel der Nichtreduzierbarkeit des Geschmacks (also einer sekundären Qualität) eine weitere Diskussionslinie, die zusätzliche Probleme ins Spiel bringt, die nicht spezifisch die Reduktion von Biologie auf Physik betreffen, sondern u. a. die Vereinbarkeit des Alltagswissens mit dem wissenschaftlichen Wissen.4 Die Schwäche der Argumente von Mill und Lewes besteht darin, daß sie sich zu sehr an Beispielen orientieren, in denen die zusammengesetzte Größe einfach die Summe der Einzelgrößen ist. Es scheint aber nicht sinnvoll, nur bei linearen Kompositionsgesetzen von Ableitbarkeit zu reden. Der lineare Fall, die einfache Summe (etwa in der Vektoraddition mechanischer Kräfte) sind nur dadurch ausgezeichnet, daß man hier das Ergebnis der Zusammensetzung aus den Einzelelementen besonders leicht ausrechnen und vorhersagen kann. Der nächste große Schritt in der Diskussion um die Emergenz ist zugleich eine wichtige Etappe im Reduktionismusstreit. In Reaktion auf die Darwinsche Evolutionstheorie bildete sich die Bewegung des "emergenten Evolutionismus". Der Begriff "Emergenz" wurde jetzt populär, insbesondere durch das Buch "Emergent Evolution" des Biologen und Philosophen C. Lloyd Morgan, das im Jahre 1923 erschien. Die reduktionistische Strategie kann bei entsprechender Auslegung in Konflikt mit der Entstehung neuer Strukturen und neuer Eigenschaften kommen. Der emergente Evolutionismus nimmt dabei eine bemerkenswerte Zwischenstellung
160
Manfred Stöckler
ein: Einmal wird der metaphysische Vitalismus zurückgewiesen, die Entstehung des Neuen soll nicht auf eine "von außen" wirkende Kraft zurückgeführt werden. Aber ebenso wird der Mechanismus abgelehnt, also das Programm, die neuen, hoch organisierten Strukturen auf der Basis der Erkenntnis der tieferen Schicht zu erklären. Die Frage ist allerdings, ob zwischen den beiden Polen überhaupt noch ein Platz ist. Der "emergente Evolutionismus" hat eine starke Tendenz, die Entstehung des Neuen als etwas Gegebenes hinzunehmen, das sich jeder Erklärung entzieht. S. Alexander und C. L. Morgan sprechen von "natural piety", mit der das zu geschehen habe. Mit einem gewissen Recht wurde diese Einstellung als kryptovitalistisch bezeichnet (Kochanski 1979, S. 82). Morgan ist überzeugt, daß die neuen, auf der tieferen Ebene nicht vorkommenden Eigenschaften und Beziehungen es unmöglich machen, die emergenten Eigenschaften vorherzusagen (Morgan 1923, S. 5). Der naheliegende Ausweg, die alten fundamentalen Gesetze, die die tiefere Ebene beherrschen, unter den neuen Randbedingungen komplexer Systeme anzuwenden, wird jedoch nicht beschritten. Möglicherweise wird so der Weg offengelassen, daß die erfahrungswissenschaftliche Erklärungslücke durch die Berufung auf Gott geschlossen werden kann (so deutlich in Morgan 1923, S. 9). C. D. Broad hat in seinem 1925 erschienenen einflußreichen Buch "The Mind and its Place in Nature" herausgearbeitet, daß neben der Kenntnis der Eigenschaften der isolierten Konstituenten und der Art ihrer Zusammensetzung auch schon in der Mechanik die Kenntnis eines allgemeinen Gesetzes der Zusammensetzung nötig ist. Diese Kompositionsgesetze sind in der Mechanik leicht zu finden. Broad glaubt, daß sie schon im Falle der Chemie überhaupt nicht existieren. Er lehnt also aus empirischen Gründen die Möglichkeit ab, Chemie auf Physik zu reduzieren (vor allem wegen offenbarer Aussichtslosigkeit, vgl. Broad 1925, S. 59f., S.66f.). Broad gibt aber zu, daß diese Auffassung sich im Laufe der Zeit ändern könnte. Sein Explikationsvorschlag für Emergenz hat epistemische Untertöne: "... the characteristic behaviour of the whole could not, even in theory, be deduced from the most complete knowledge of the behaviour of its components, taken separately or in other combinations, and of their proportions and arrangements in this whole. This alternative ... is what I understand by the 'Theory of Emergence'" (Broad 1925, S. 59).
Für einen pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus
161
Auch diese Formulierung enthält noch Zweideutigkeiten. Hilfreich war hier der dritte große Schritt in der Debatte um Reduktion und Emergenz. Die Werkzeuge, die die moderne Logik zu Verfügung gestellt hatte, konnten für die Analyse wissenschaftlicher Theorien fruchtbar gemacht werden. Im Rahmen und im Umkreis des logischen Empirismus wurde die Reduktionsbeziehung in Analogie zur wissenschaftlichen Erklärung präzisiert. Nach der berühmten Analyse von Hempel und Oppenheim ist eine wissenschaftliche Erklärung die logische Deduktion der Beschreibung des zu erklärenden Sachverhalts aus Prämissen, die Gesetzesformeln und Beschreibungen der Anfangs- und Randbedingungen enthalten. Die Reduktion von Biologie auf Physik konnte jetzt als Ableitung der Theorien der Biologie aus den Theorien der Physik angesehen werden. Nach der klassischen Analyse von E. Nagel heißt das, daß die Begriffe der Biologie durch Begriffe der Physik definiert und die Gesetze der Biologie aus den Gesetzen der Physik deduziert werden können, fallweise unter Zuhilfenahme von Brückenprinzipien, über deren Status später viel gestritten wurde. Wir können festhalten, daß die ontologische Frage der Beziehung von lebenden Organismen zu ihren anorganischen Bestandteilen erst einmal durch ein logisches Problem ersetzt wurde: Ist eine bestimmte vorliegende biologische Theorie aus den zu diesem Zeitpunkt zu Verfügung stehenden physikalischen und chemischen Theorien ableitbar oder nicht? Das Reduktionsproblem war damit auf die Metaebene gehoben worden. Zudem war die Reduzierbarkeit an das Vorliegen bestimmter Theorien gebunden und damit zeitlich relativiert. Die Diskussion um das ontologische Problem des Zusammenhangs von Organismen und physikalischen Systemen erschöpft sich aber nicht in der Frage nach den logischen und semantischen Beziehungen zwischen den zu einem bestimmten Zeitpunkt existierenden und hinreichend präzisierten Theorien. Ein klassisches Programm des neueren Reduktionismus haben Paul Oppenheimer und Hilary Putnam 1958 formuliert. Beflügelt von den Fortschritten der Molekularbiologie verbinden sie in ihrem berühmten Aufsatz "Einheit der Wissenschaft als Arbeitshypothese" die logische Explikation der Theoriereduktion mit einer Teil-Ganzes-Relation (Mikroreduktion). Wie schon der Titel anzeigt, verfolgen sie die Idee einer Einheitswissenschaft, die sich im logischen Empirismus entwickelt hatte. Bemerkenswert ist die Unterscheidung von "Einheit der Wissenschaft" als
162
Manfred Stöckler
Kennzeichnung ihres idealen Zustandes und als "einen überall vorhandenen Zug innerhalb der Wissenschaft..., der auf Erreichung dieses Ideals abzielt" (Oppenheim/Putnam 1958, S. 340). Ein Hinweis auf eine beginnende Wendung zur Ontologie ist die zentrale Rolle einer Hierarchie von verschiedenen Stufen (Elementarteilchen, Atome, Moleküle, Zellen, Organismen, soziale Gruppen), wobei die Elemente der höheren Stufe aus den Elementen der tieferen Stufe zusammengesetzt sind. Hier kommen alte Vorstellungen über einen Schichtenaufbau der Natur wieder zu Geltung. Mit diesen Voraussetzungen können wir die grundlegende metaphysische Intuition des Reduktionismus formulieren: Es ist die Vorstellung, daß in der tieferen Schicht schon alle kausalen Faktoren vorhanden sind und deshalb die Erklärungsrichtung dem Aufbau der Stufen folgen soll. Die tiefere Schicht legt im Zusammenwirken der Bestandteile das Verhalten der komplexen Zusammensetzungen fest,5 es gibt keine davon unabhängigen, nur in den höheren Schichten auftretenden Kräfte. Die Prozesse in den höheren Stufen werden von den gleichen Gesetzen bestimmt wie das Verhalten der Elementarteilchen. Auf die Theorieebene projiziert: Alles, was in der Natur beschrieben werden kann, kann im Idealfall und im Prinzip durch die Physik beschrieben werden. Es ist ein naheliegender Gedanke, diese ontologische These dadurch überprüfbar zu machen, daß wirklich durchgeführte Reduktionen zwischen auf verschiedenen Stufen angesiedelten Teiltheorien vorgeführt werden. Die Reduktionismusthese kann so durch Untersuchung der Entwicklung der Wissenschaftsdisziplinen gestützt werden. Zuweilen wurde die metaphysische Reduktionsbehauptung sogar als metatheoretische Reduktionsbeziehung (Ableitbarkeit der Theorien) expliziert, der ontologische Reduktionismus also ausdrücklich mit dem sog. epistemologischen Reduktionismus identifiziert. Diese Strategie stößt jedoch auf Schwierigkeiten (vgl. dazu Hoyningen-Huene 1989). Im Gegensatz dazu möchte ich in den folgenden Abschnitten stärker die metaphysische Behauptung des Reduktionismus von seiner methodischen Seite trennen. Ich werde zeigen, daß auch die tatsächliche Undurchführbarkeit von Reduktionen mit der prinzipiellen These des Reduktionismus vereinbar ist, wenn in jedem Einzelfall die Grenzen des Reduzierens als Folgen der beschränkten praktischen und theoretischen Fähigkeiten der Menschen erwiesen werden können, also pragmatischer Natur sind.
Für einen pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus
163
Doch zunächst zurück zu dem Aufsatz von Oppenheim und Putnam. Zur Stützung ihrer Hypothese verweisen sie einmal auf erfolgreiche Reduktionsversuche, zum anderen erwähnen sie methodologische Gesichtspunkte (1958, S. 350). Der Reduktionismus ist fruchtbar, weil er Anlaß zu konkreten Forschungen gibt, während der Glaube an die prinzipielle Irreduzierbarkeit noch zu keiner einzigen akzeptierten wissenschaftlichen Theorie geführt habe. Der Reduktionismus entspreche außerdem der "demokritischen Tendenz", zu versuchen, "soweit als möglich scheinbar verschiedenartige Phänomene mit Hilfe qualitativ identischer Teile und ihrer raumzeitlichen Beziehungen zu erklären" (ebd.). Als wichtiges Motiv wird die universelle Evolution genannt, in der die komplexen Stukturen zeitlich nach ihren Elementen entstanden sind. Was im Verlaufe der Ontogenese aus der anorganischen Welt entstanden ist, sollte auch durch die Gesetze der anorganischen Welt erklärbar sein. Dabei greifen die Autoren vielfach Reduktionsbeziehungen aus anderen Bereichen der Wissenschaften auf, insbesondere die Diskussion um Individualismus und Kollektivismus in den Sozialwissenschaften. Die Parallelität der Fragestellungen in Sozial- und Naturwissenschaften war in den 50er Jahren offenbar präsenter als in der gegenwärtigen Diskussion. Ernest Nagel bemühte sich, dieses Programm mit der Methodologie der Biologie in Einklang zu bringen und führt in seiner Analyse auch den Emergenzbegriff aus seinem antireduktionistischen Hintergrund heraus. Neue emergente Gesetze kommen zustande, wenn in der Natur neue Kombinationen und Wechselwirkungen von Komponenten auftreten (Nagel 1961, S. 380). Emergenz bezieht sich vor allem auf die Neuheit des Verhaltens spezieller Strukturen, das in den Komponenten noch nicht zu finden ist. Daraus folgt aber noch nicht, daß das physikalische Wissen prinzipiell nicht ausreicht, um das Neue und Komplexe zu erklären. Aus heutiger Sicht ist diese Formulierung des reduktionistischen Programms zu optimistisch gewesen. Die Annahme, daß die Einheit der Wissenschaft im Sinne einer durchgeführten Theorienreduktion tatsächlich erreichbar ist, erscheint utopisch. Ein wichtiger Faktor für diese Erkenntnis waren detailliert durchgeführte Analysen von echten Fallbeispielen aus den Naturwissenschaften, z. B. der Beziehungen der Keplergesetze zur Newtonschen Mechanik oder des Verhältnisses von Mendelscher Genetik zur Molekularbiologie.6 Schon im Falle der Planetentheorie gab es große Schwierigkeiten, die allen Phy-
164
Manfred Stöckler
sikern bekannte Grenzfallbeziehung als approximative Erklärung präzise zu rekonstruieren. In der Biologie geht die Schere zwischen exakten Erklärungsmodellen und Praxis der Wissenschaftler noch weiter auseinander. Legt man entsprechend strenge Maßstäbe an, gibt es fast keine Beispiele für gelungene Reduktionen. Auch die weitaus liberaleren Vorstellungen von Grenzfallbeziehungen, die unter Wissenschaftlern verbreitet sind, schließen in vielen Fällen den Erfolg einer Reduktion aus. Was soll dann der ganze Streit um den Reduktionismus? Jagt man hier nicht einer Illusion nach? In den folgenden Abschnitten möchte ich zeigen, warum es vernünftig ist, dennoch Reduktionist zu sein. Ich werde diese Position verteidigen, indem ich nachweise, daß die berechtigen Einwände gegen den Reduktionismus nur diejenigen Formulierungen betreffen, die übersehen, daß die Fähigkeiten von uns Menschen begrenzt sind. Ein pragmatisch eingeschränkter Reduktionismus impliziert ζ. B. nur dann noch einen methodischen Reduktionismus, wenn nicht praktische Gründe eine Reduktion unmöglich machen. So lassen sich die philosophischen Vorteile eines ontologischen Reduktionismus genießen, ohne die von seinen Gegnern beschriebenen Gefahren fürchten zu müssen.
3. Zwei Argumente für den Reduktionismus Meine These ist, daß der Reduktionismus keine Position ist, die man in erster Linie aufgrund des Fortschritts der Molekularbiologie oder einer anderen fundierenden Wissenschaft einnimmt. Der Reduktionismus ist eine ontologische Hypothese, eine Annahme über die Natur. Für ein solches metaphysisches Programm spricht der Erfolg "atomistischer", d. h. reduzierender Forschungsstrategien, und aus ihm folgen mit noch zu spezifizierenden Einschränkungen reduktionistische methodische Empfehlungen. Naturgemäß sind Argumente für eine solche Position nicht zwingend. Ich skizziere zwei Gründe für den Reduktionismus, die allerdings nicht ganz unabhängig voneinander sind. Die folgenden Überlegungen folgen im wesentlichen einer Darstellung von Gerhard Vollmer (1986, S. 163 - 233). 1. Das erste Argument für den Reduktionismus ist ein naturphilosophisches und geht von der Evolution des Kosmos aus ("Evolutionsargument", vgl. Vollmer 1986, S. 225f.). Das Leben hat sich aus der anorga-
Für einen pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus
165
nischen Welt entwickelt, oder allgemeiner: Komplexe Systeme bestehen aus einfacheren Komponenten und sind aus ihnen entstanden. 7 Die Forderung liegt nahe, daß sich die Einheit der Natur in der Einheit der Wissenschaft widerspiegeln sollte. Dieses Argument beruht auf einzelwissenschaftlichem Wissen, etwa aus Astrophysik und Evolutionstheorie. Wesentlich für den Reduktionismus ist das Bestehen einer Teil-Ganzes-Relation, die die Richtung der Reduktion bestimmt (Mikroreduktion). Das Verhalten eines strukturierten Ganzen wird mit Hilfe der Gesetze erklärt, die für das Verhalten der Teile gelten. Der Kern dieses Arguments ist die Annahme, das die Physik vollständig ist, daß die Gesetze der Physik keine Lücken lassen, in die dann "auf höhere Ebene" neue Prinzipien eingreifen können. Naturgesetze gelten ohne Ausnahmen. Eine solche Position schließt insbesondere alle Formen von Vitalismus aus. Für alle Positionen, die eine echte Grenze der Reichweite physikalischer Theorien annehmen, ist es eine große Schwierigkeit, auf willkürfreie Weise die Stelle anzugeben, an der die Physik durch außerphysikalische Agenden ergänzt werden muß. Ein ähnliches Problem haben dualistische Lösungen des Leib-Seele-Problems, wenn es darum geht, die Stelle zu finden, an der der Geist auf den Körper einwirkt. Die Mikroreduktion ist eine Nachfolgerin des atomistischen Erklärungsprogramms. Die metaphysische Annahme einer Einheit der Natur kann den Erfolg reduktionistischer Strategien verständlich machen. Eine Detailanalyse des "Mechanismus" des Zusammenwirkens der Teile ist außerdem oft besonders effektiv bei der Beseitigung von Störungen im normalen Systemablauf. Die Denkfigur, daß die Erklärung der Richtung der kausalen Abhängigkeit folgen soll, findet sich auch in der Methodologie der Sozialwissenschaften. Dort wird von Reduktionisten etwa gegen Begriffe wie "Volksgeist" argumentiert und im Sinne eines methodischen Individualismus betont, daß das Verhalten von Kollektiven aus dem Verhalten der Mitglieder erklärt werden muß. 2. Das zweite Argument für den Reduktionismus ist ein erkenntnistheoretisches, bezieht die Beschreibungsebene ein und folgt aus Zielen, für die wir Wissenschaft treiben. Reduktion beseitigt Redundanz (Vollmer 1986, S. 214), durch Reduzieren wird unsere Darstellung der Natur einfacher und geschlossener. Betrachten wir ein Beispiel für eine gelungene
166
Manfred Stöckler
Reduktion innerhalb der Physik: Durch Maxwells Theorie konnten die Gesetze der Elektrizität, des Magnetismus und der Optik vereinigt werden. Durch Reduktion gelingt es oft, verschiedene Objektbereiche mit Hilfe gleicher Basiselemente zu erklären (Licht und Radiowellen sind beides elektromagnetische Wellen). In unserem Beispiel kann man nach der Reduktion die Bezugssystemabhängigkeit elektromagnetischer Phänomene (je nach Bezugssystem liegt ein elektrisches oder ein magnetisches Feld vor) verstehen und ihre Umsetzung in Sinneseindrücke besser durchschauen (Magnetfelder und Licht werden durch die gleiche Theorie beschrieben, obwohl wir nur Licht direkt wahrnehmen können). Reduktion erlaubt eine "ontologische Sparsamkeit", man muß nicht unnötig neue Basisobjekte einführen. Dies führt zu gehaltvollen, möglichst willkürfreien Theorien. Es ist nicht hilfreich, für jeden Effekt eine eigene Teilchensorte oder ein neues Feld zur Erklärung einzuführen. In der Wissenschaftspraxis haben wir meist Beschreibungen auf verschiedenen Komplexitätsebenen vorliegen. Eine gelungene Reduktion zeigt, wie die verschiedenen Beschreibungsebenen miteinander zusammenhängen. (In der Medizin etwa das sichtbare Symptom, eine zelluläre Veränderung, und beteiligte molekularbiologische Prozesse). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die moderne Theorie der wissenschaftlichen Erklärung, in der die Vereinheitlichung eine zentrale Rolle spielt (vgl. dazu die näheren Ausführungen in Schurz (1988)). Vereinheitlichung des Wissens ist das theoretische Hauptziel der Wissenschaft, eine gute Erklärung kann im wesentlichen durch ihre vereinheitlichende Kraft charakterisiert werden. Dies gilt auch für Theoriereduktionen, die ja Sonderfalle von Erklärungen sind. Reduktion schafft Einheit. Das gilt zunächst für Teiltheorien innerhalb eines Objektbereichs, etwa für die Elementarteilchenphysik, wo die Vereinheitlichung der Gesetze nicht nur die Zahl willkürlicher Annahmen verringerte, sondern auch neue Vorhersagen erlaubte. Eine bunte Vielfalt unzusammenhängender Theoriebruchstücke ist nicht der Idealzustand einer wissenschaftlichen Theorie. Allzu leicht können sich hier ad hoc - Lösungen einschleichen, die willkürliche Anpassungen der Beschreibung an die Natur erlauben, aber keine befriedigenden Erklärungen. Der Reduktionismus fordert die Einheitlichkeit nicht nur für Theorien innerhalb eines Anwendungsfelds, sondern auch für Bereiche, die durch Teil-Ganzes-Beziehungen verbunden sind.
Für einen pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus
167
Der Reduktionismus folgt aus den Zielen der Wissenschaft Aber auch erstrebenswerte Ziele können unter bestimmten Umständen aus praktischen Gründen unerreichbar sein. Dann wäre es unvernünftig, sie um jeden Preis zu verfolgen. Damit kommen wir zu den Einwänden gegen den Reduktionismus und zu den notwendigen pragmatischen Einschränkungen.
4. Fünf Schwierigkeiten mit dem Reduktionismus und ein Rezept zu ihrer Überwindung Die Argumente für den Reduktionismus sind nicht zwingend, es sind bestenfalls plausible Überlegungen. In einer solchen Situation muß man Einwände und Hinweise auf Gefahren des Reduktionismus besonders ernst nehmen. Es gibt eine Reihe von Vorwürfen, mit denen sich der Reduktionismus auseinanderzusetzen hat: Der physikalistische Ansatz werde den Besonderheiten der Lebensphänomene nicht gerecht. Die Leugnung wesentlicher Unterschiede zwischen den Schichten verhindere die notwendige Pluralität der Forschungsmethoden. Erklären sei immer Eliminieren: in einem gewissen Sinn verdränge der Reduktionismus die Existenz komplexer Systeme. Den eher ontologischen Argumenten für den Reduktionismus (Einheit der Natur, Abgeschlossenheit der Physik, ontologische Sparsamkeit) stehen so die eher methodologischen Argumente der Antireduktionisten gegenüber (Pluralismus der Forschungsmethoden, Autonomie der Biologie und der Sozialwissenschaften). Wir werden uns im folgenden vor allem mit zwei miteinander zusammenhängenden Sachverhalten beschäftigen, die in beiden Parteien unumstritten sind: Die Schwierigkeiten bei der Berechnung komplexer Systeme und die Grenzen der praktischen Durchführbarkeit emsthafter Theoriereduktionen. Dabei werden Wertgesichtspunkte und Kosten-Nutzen-Analysen ins Spiel kommen, insbesondere, wenn Wissenschaft nicht nur zur Beschreibung der Welt dient, sondern gleichzeitig andere Ziele verfolgt. Um eine defekte Telefonleitung zu reparieren, muß man nicht bei den grundlegenden Gleichungen der vereinheitlichten Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung anfangen. Es ist klar, daß in der Medizin, die als praktische
168
Manfred Stöckler
Wissenschaft wesentlich auf das Heilen ausgerichtet ist, solche Gesichtspunkte eine wichtigere Rolle spielen als etwa in der theoretischen Elementarteilchenphysik. In Auseinandersetzung mit verschiedenen Einwänden gegen den Reduktionismus werde ich zeigen, daß die Gefahren des Reduktionimus gerade dadurch vermieden werden, daß man die gegebenen Einschränkungen der technischen und theoretischen Fähigkeiten der Menschen angemessen berücksichtigt. Ich werde hier nicht auf Probleme des Reduktionismus eingehen, die auf speziellen Inhalten der naturwissenschaftlichen Theorien beruhen. Damit sind solche Fragen gemeint, ob etwa das Leben dem Entropiesatz widerspricht oder der "nichtboolesche" und nichtlokale Charakter der γQuantenmechanik eine Reduktion der Biologie auf die Physik verhindert. Die Elementarteilchenphysik hat Probleme mit dem Begriff eines isolierten Objekts und mit der Existenz einer letzten fundamentalen Stufe. Ich bin der Auffassung, daß man auch diese Bedenken ausräumen kann, aber um das zu begründen, müßten wir uns hier zu sehr mit einzelwissenschaftlichen Details beschäftigen. 8 Bemerkenswert ist jedenfalls, daß es Konstellationen in den Theorien der Einzelwissenschaften geben kann, die es nahelegen, den Reduktionismus zu verwerfen. Das beste Argument für den Reduktionismus wäre die Tat, d.h. die Reduktion möglichst vieler Teiltheorien auf allgemeinere Fundamentaltheorien. Die Paradepferde geglückter Reduktion sind nun nicht sehr zahlreich und stammen meist aus der Mathematik oder aus der Physik und betreffen so gerade nicht die heiklen Fälle der Reduktion von Theorien, die verschiedene Stufen oder Schichten der Natur beschreiben. Das führt zu unserem ersten Einwand. 1. Einwand: Der Reduktionismus in seiner Operationalisierung als Theorie-Reduktionismus ist bestenfalls ein utopisches Programm, er ist ein ungedeckter Wechsel auf die Zukunft. Die Behauptung einer "Im-PrinzipReduktion" ist eine unüberprüßare Immunisierungsstrategie. "The problem is, for the philosopher as for the fat man, to try to reduce now" (Scheffler 1965, S. 80). Die reduktionistische Antwort auf diesen Vorwurf wird zunächst feststellen, daß der Zusammenhang der verschiedenen Bereiche der Natur und die
Für einen pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus
169
logischen Konsequenzen unserer Theorien wohl nicht davon abhängen, welche Kenntnisse wir zu einem bestimmten Zeitpunkt haben und wie entwickelt unsere Fähigkeiten sind, die Konsequenzen einer Theorie wirklich abzuleiten und hinzuschreiben. Wer allerdings diese Trennung von epistemischen und ontologischen Fragen nicht mitmacht, wird auch von dieser Verteidigungsstrategie wenig halten. Für den Reduktionisten spricht hier eine gewisse Bescheidenheit, daß er die intellektuellen Fähigkeiten der Menschen nicht zum Maß aller Dinge macht. In jedem Fall muß der Reduktionist verständlich machen, was die Behauptung einer Reduktionsbeziehung bedeuten soll, die sicher auf lange Frist und vermutlich auch in der fernsten Zukunft nicht konstruktiv herstellbar ist. Im ersten Schritt ist hier zu zeigen, aus welchen Gründen die Reduktion nicht durchführbar ist. Man kann hierzu ζ. B. darauf verweisen, daß es im Kopf, auf dem Papier und auch in den zur Verfügung stehenden Computern unmöglich ist, ein System von 10 14 gekoppelten nichtlinearen Differentialgleichungen zu lösen, wie es ζ. B. für eine exakte Lösung der Lasergleichungen nötig wäre. Zusätzlich muß man plausibel machen, daß es sich um eine praktische Grenze handelt, die an der menschlichen Natur oder am Entwicklungsstand der Technik liegt, daß also insbesondere keine anderen theoretischen Gründe gegen eine Reduktion sprechen (etwa mathematische Sätze, die bei der betrachteten Gleichung die Existenz von Lösungen ausschließen9). Aufgrund des sonstigen Hintergrundwissens muß also die Undurchführbarkeit der Reduktion auf praktische Gründe zurückführbar sein, mathematisch begabten Engeln etwa müßte man die Reduktion zutrauen können. Das ist kein sehr hartes Kriterium, aber bei ontologischen Fragen sind wir oft auf solche weichen Argumente angewiesen. Als wirklich sicherer Ausweg bleibt nur, als positivistischer Skeptiker ganz auf empirisch nicht entscheidbare Aussagen zu verzichten. Um dem Reduktionismus die Glaubwürdigkeit zu erhalten, muß in den Fällen, in denen eine Detailanalyse der Mikrostruktur möglich ist oder in denen ein Gleichungssystem aus Symmetriegründen oder nach einigen Vereinfachungen doch lösbar ist, die Reduktion wirklich erfolgreich sein: Dort, wo der Erfolg nicht durch die Begrenzung der menschlichen Fähigkeiten verhindert wird, muß er sich dann auch einstellen. Neue theoretische Ansätze, die etwa Hermann Haken bei der Untersuchung des Lasers entwickelt hat (Schlagwort: Synergetik), widersprechen
170
Manfred Stöckler
damit nicht der reduktionistischen Position, obwohl die neue Lasertheorie keine vollständig atomistische Beschreibung des Lasers erreicht, also keine explizite Lösung für die 10 14 Gleichungen angibt.10 Die Details der "makroskopischen" Lösung beruhen aber auf mikroskopischen Eigenschaften des Systems. Im Mittelpunkt der Diskussion um die Grenzen der menschlichen Fähigkeiten steht der Umgang mit komplexen Systemen. Das führt uns zu einem zweiten wichtigen Einwand gegen den Reduktionismus. 2. Einwand: Der Reduktionismus hilft in der Forschungspraxis insbesondere nicht bei der Analyse komplexer Systeme. Betrachtet man die heuristische Fruchtbarkeit, so gibt es einerseits Beispiele (etwa in der Molekularbiologie), in denen das atomistische Vorgehen große Fortschritte gebracht hat. Andererseits beruht der Erfolg vieler anderer Theorieansätze gerade darauf, daß sie ihr Untersuchungsobjekt nicht in allen Details analysieren. Wie sollte etwa die physikalische Übersetzung der folgenden Aussage lauten: "Der Adler ist ein Raubvogel, der durch natürliche Auslese zur solitären Jagd aus der Luft besonders gut adaptiert worden ist" (Kochanski 1979, S. 118)? Kein Biologe käme auf die Idee, das Funktionieren der Zelle quantenfeldtheoretisch auf der Ebene der Quarks und Leptonen zu erklären. Die entscheidende Leistung bei der Analyse komplexer Systeme scheint gerade darin zu liegen, geeignet gewählte Gesamtheiten als Basis von Erklärungen zu finden, die ganz in der höheren Stufe angesiedelt sind (in der Chemie z. B. Moleküle, in der Biologie Zellen). Welche Gesamtheiten dazu geeignet sind, kann nicht allein aufgrund der Kenntnis des Verhaltens der Bestandteile auf der Mikroebene entschieden werden, da es auf die Einbettung dieser Bestandteile in ihre spezielle Umgebung ankommt. Die Auswahlgesichtspunkte liefert dabei die höhere Ebene. Der kluge Reduktionist wird in dieser Lage eine doppelte Verteidigungsstrategie wählen: er wird fast allen diesen Bemerkungen zustimmen, dabei aber darauf beharren, daß dies nicht an den Gegenständen, sondern nur an den eingeschränkten Fähigkeiten des Menschen liegt. Im Prinzip wäre immer eine vollständige mikroskopische Analyse möglich. Da aber die konkrete Durchführung zu viele Kosten und zu viel Zeit erfordert oder wegen ihres Umfangs und ihres Schwierigkeitsgrads die mathematischen
Für einen pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus
171
und logischen Fähigkeiten von uns Menschen ganz übersteigt, muß man auf Detailinformationen verzichten, gröbere Muster bilden und neue Gesamtheiten auszeichnen. Es gibt also gewisse Techniken, wie man von einer zu reichhaltigen mikroskopischen Beschreibung auf eine makroskopische Charakterisierung eines Systems übergeht, die sich auf die wesentlichen Eigenschaften und Einflußgrößen beschränkt. Solche Mechanismen zur Reduktion der Komplexität sind ζ. T. schon biologisch vorgeformt, da zum Überleben eine schnelle Reaktion (etwa auf das Auftauchen eines Raubvogels am Himmel) wichtiger ist als eine vollständige Analyse der Situation. Der Reduktionist kann darauf verweisen, daß seine Position im wesentlichen eine ontologische Hypothese ist und nicht dafür ausgedacht wurde, das Überleben zu erleichtern. Er läuft glücklicherweise nicht Gefahr, seine Lebenschancen zu verringern, wenn er aus pragmatischen Gründen Holist und aus theoretischen Gründen Reduktionist ist. Die Redundanz, die nach reduktionistischer Sicht den auf höheren Ebenen angesiedelten Beschreibungen anhaftet, ist eine theoretische, keine praktische. Auf die Theorien der höheren Ebenen kann man im Prinzip verzichten, aber nicht angesichts unserer beschränkten theoretischen Kapazitäten. Natürlich wird der Reduktionist empfehlen, in allen Fällen, in denen eine reduktionistische Strategie erfolgreich ist, die Kenntnisse des Mechanismus eines Systems auch dazu auszunützen, das System wirkungsvoll zu beeinflussen. Die Kunst der Chemiker und Biologen beginnt gerade da, wo die Probleme für die halbwegs exakten und mit vielen atomistischen Details versehenen Methoden der Physiker zu kompliziert werden. Mit dem Reduktionismus fast gar nichts zu tun hat übrigens die ökologische Frage, ob es vielleicht besser wäre, die komplexen Systeme unserer natürlichen Umwelt überhaupt nicht zu beeinflussen. Psychologische Experimente, etwa mit Computersimulationen der Wirtschaftskreisläufe eines Entwicklungslandes (vgl. Dörner 1975), haben gezeigt, daß schon die Kombination weniger Elemente, die mit präzise angebbaren Rückkopplungsschleifen verbunden sind, die menschliche Intuition vor fast unlösbare Aufgaben stellt, selbst wenn das System noch relativ leicht zu berechnen ist und ganz durch seine Elemente und ihre gegenseitigen (allerdings nichtlinearen) Wechselwirkungen bestimmt sind. Für einen Reduktionisten zeigt dies, daß die reduktionistische Strategie bei entsprechenden Hilfsmitteln (Computern) erfolgreich sein kann, ohne diese Hilfs-
172
Manfred Stöckler
mittel (wenn nur die menschliche Intuition zu Verfügung steht) aber versagt. Auch er wird also vor leichtfertigen Eingriffen in natürliche Abläufe (etwa beim Klima) warnen. Es ist sicherlich richtig, daß der Kontext des Gesamtsystems die Auswahl der relevanten atomi stischen Parameter und den Grad der Idealisierung beeinflußt. Die tiefere Ebene legt nicht fest, auf welche Informationen man zur ökonomischen Beschreibung des Systems verzichten muß. Hier spielt der Zweck der Beschreibung und die Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Details eine Rolle. Der dadurch ins Spiel kommende holistische Zug hat also praktische Gründe, der Reduktionismus muß pragmatisch, nicht ontologisch eingeschränkt werden. Dies führt uns zu einem weiteren Einwand. 3. Einwand: Der Reduktionismus gefährdet die notwendige Vielfalt der Beschreibungsperspektiven. Eine adäquate Erfassung komplexer Systeme erfordert nämlich eine Pluralität von Beschreibungsperspektiven. Die reduktionistische Auffassung, daß "eigentlich" nur die Elemente existieren, das Ganze höchstens eine abgeleitete Existenz hat, gefährdet die Vielfalt der Arbeitsmodelle mit verschiedenem Auflösungsgrad. Ein Orthopäde arbeitet mit einem anderen Bild eines Oberschenkelknochens als ein Experte für Knochenmarkskrebs. Die Vielfalt der Perspektiven könnte tatsächlich gegen den Reduktionisten sprechen. Wenn man aber nach ihrer Ursache und ihrem Zusammenhang fragt, so zeigt sich, daß die Perspektiven nicht auf einer Unvollständigkeit der tieferen Stufen sondern auf den verschiedenen Zwecken in der näherungsweisen Modellierung der höheren Stufen beruhen. So kann auch dieser Angriff auf den Reduktionismus durch pragmatische Einschränkung abgewehrt werden. Bei seiner Replik kann sich der Reduktionist auf eine Arbeit von Moritz Schlick aus den dreißiger Jahren stützen. Schlick betont als Reduktionist: "Prinzipiell bleibt es auch bei jedem Organismus möglich, alles, was überhaupt über ihn gesagt werden kann, in der Weise zu sagen, daß man allein von den Teilchen spricht, die ihn aufbauen, und von deren Beziehungen untereinander" (Schlick 1971, S. 221). Schlick gesteht aber zu, daß aus praktischen Gründen es oft nützlich ist, Elemente zu Ganzheiten zusammenzufassen, nicht mehr alle Details zu erwähnen und in einer
Für einen pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus
173
"ganzheitlichen" Beschreibungsweise sich je nach Beschreibungszweck auf die wesentlichen Merkmale zu konzentrieren. "Bei diesem Gebilde ist eine summenhafte, bei jenem eine ganzheitliche Begriffsbildung zum Zwecke der Erkenntnis vorteilhafter" (Schlick 1971, S. 222). Bestritten wird nur, daß auf der höheren Ebene etwas erfaßt werden kann, was auf der tieferen Ebene prinzipiell verborgen bleibt: "Eine 'ganzheitliche' Beschreibungsweise wird nirgends die einzig mögliche, aber immer dort am Platze, ja oft praktisch allein durchführbar sein, wo gewisse 'Invarianten' auftreten, gewisse Anordnungen oder Kombinationen, die im Wechsel des Geschehens erhalten bleiben, indem sie bestimmte sinnlich auffällige Eigenschaften, wie besonders Raumform und die Art des räumlichen Zusammenhangs der Teile bewahren" (Schlick 1971, S. 220). Eine Beschreibungsperspektive, so könnte man diese Überlegungen weiterentwickeln, besteht aus mehreren Teilen. Einmal sind es Vereinfachungen, ein Verzicht auf Detailinformationen (was das praktische Rechnen erleichtert, aber nicht heißt, daß die entsprechenden Sachverhalte verschwunden sind), die durch den Forscher im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel vorgenommen werden. Ein Astronom kann einen Planeten meist als Massenpunkt ansehen, ein Geologe auf Erdölsuche wird mit diesem Modell nicht viel Erfolg haben. Zum anderen wird eine solche Strategie zur Reduktion der Komplexität nur erfolgreich sein, wenn die hervorgehobenen Strukturen in der Natur einigermaßen stabil sind und das Geschehen stärker beeinflussen als die vernachlässigten Charakteristika. Die Bildung von Ganzheiten geschieht dabei nach ähnlichen Kriterien wie allgemein die Konstitution von Gegenständen wie Planeten, Bäumen oder Städten. Moritz Schlick bringt das Beispiel der meteorologischen Erfassung der Erdatmosphäre. Es ist unmöglich, die Bewegung jedes Sauerstoffmoleküls und jedes Wassertröpfchens einzeln zu verfolgen, in der Meteorologie verwendet man stattdessen Entitäten wie Tiefdruckgebiete, Gewitter oder Zyklone. Der Reduktionist ist sich mit seinen Widersachern also im praktischen Umgang mit Theorien verschiedenen Auflösungsgrades und verschiedener Schichten ziemlich einig. Er gibt nur einen anderen Grund für die antireduküonistischen Strategien an. Ursache ist nicht eine prinzipielle Unvollständigkeit jeder mikroskopischen Beschreibung, sondern pragmatische Vereinfachungen unserer Beschreibung. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile: Das gilt nicht in dem Sinne, daß die Summe der
174
Manfred Stöckler
Aussagen über die Teile und ihre Wechselwirkungen schlecht oder unvollkommen wäre, im Gegenteil ist sie für unser menschliches Erfassungsvermögen zu gut, d. h. hier: zu umfangreich. Black-Box-Methoden und systemtheoretische Ansätze sind in der Wissenschaft komplexer Gegenstände also unverzichtbar. Neuere Entwicklungen in der Analyse nichtlinearer Prozesse und komplexer Systeme (Synergetik, Chaostheorie) zeigen, welche Hilfsmittel man entwickeln kann, um auch solche Systeme zu erfassen, die nicht im Detail analytisch aus ihren Bausteinen hergeleitet werden können. Diese neuen Forschungsansätze widersprechen aber nicht einem pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus. Der Reduktionist wird allerdings nicht bei einem bunten Nebeneinander verschiedener Beschreibungen des gleichen Gegenstands stehenbleiben, sondern nach ihrem Verhältnis zueinander fragen. Tatsächlich sind weite Teilgebiete der Biologie und auch viele Bereiche der medizinischen Forschung gerade dadurch gekennzeichnet, daß in eher systemtheoretischen Modellen punktweise der Zusammenhang zu den Prozessen in der molekularbiologischen Basis hergestellt wird. So charakterisiert Kenneth Schaffner (1986, S. 69) Theorien in den Biowissenschaften vor allem als "series of overlapping interlevel temporal models". Der Reduktionist gibt dabei eine spezielle Antwort auf die Frage, wie die vielfältigen Ansätze und Modelle zusammengehören: Es gibt nur eine Welt, aber aus praktischen Gründen verschiedene Weltsichten. M. Schlick betont in der schon erwähnten Arbeit, daß Fragen der passenden Beschreibung nicht mit Tatsachenfragen verwechselt werden dürfen. Der Unterschied von Summe und Ganzheit ist nicht eine Frage der Verschiedenheit von Dingen, sondern ein Gegensatz von Darstellungsweisen. "Probleme der passenden Beschreibung, der zweckmäßigen Definitionen werden mit Tatsachenfragen verwechselt, und so entstehen scheinbar ontologische Probleme, metaphysische Streitfragen. Die 'Ganzheit', ein vortreffliches Beschreibungsmittel, verwandelt sich in ein metaphysisches Wesen, wird zur 'Entelechie' und ähnlichen Ausgeburten philosophischer Unklarheit" (Schlick 1971, S. 222). Damit sind wir bei einem vierten Einwand gegen den Reduktionismus angelangt. 4. Einwand: Der Reduktionismus nimmt die Schichtenstruktur der Realität nicht ernst und verneint die Existenz emergenter Eigenschaften.
Für einen pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus
175
Im Laufe der Geschichte des Reduktionismus, besonders im Mechanismus und oft auch in den frühen Zeiten der Molekularbiologie sind manche Forscher offenbar der Gefahr erlegen, nur diejenigen Objekte als "wirklich existierend" zu betrachten, die zum Gegenstandsbereich der Theorie der tiefsten Schicht gehören. Aber zusammengesetzte Gegenstände, deren Existenz und Eigenschaften man erklären kann, sind nicht weniger wirklich als die Elementarteilchen. Es gibt Stühle, nicht nur Beine, Lehnen und Sitzflächen. Beschreibungsperspektiven müssen im Hinblick auf ihre Ziele bewertet werden, es darf keine generelle Bevorzugung der tiefsten Ebene als einzig existierender geben. Die Erklärung komplexer Systeme bringt diese nicht zum Verschwinden. Ein Prozeß kann gleichzeitig ein chemischer und ein biologischer sein. Ähnliche Probleme werden etwa in der Handlungstheorie unter dem Verhältnis kausaler und intentionaler Beschreibungsperspektiven diskutiert. Die Bevorzugung der tiefsten Ebene besteht nur darin, daß sie in ontologischer Sicht als vollständig betrachtet wird. Die höheren Schichten der Natur sind von ihr abhängig und werden aus pragmatischen Gründen begrifflich abgegrenzt. So betonte S. Pepper in den 20er Jahren: "... I maintain that the same natural regularities can be described by a whole hierarchy of different laws and that this ladder of laws has been mistaken by the emergent evolutionists for a ladder of cosmic regularities" (Pepper 1926, S. 242). Da die Gründe für die Notwendigkeit neuer Beschreibungsmethoden aber in der Komplexität und der reichen inneren Stuktur der untersuchten Systeme liegen, hat die Hierarchie der Schichten auch ein Gegenstück in der Natur. Es handelt sich dabei aber nicht um neue irreduzible Prozeßmuster oder Gesetze (etwa im Sinne einer Lebenskraft), sondern um einen neuen Grad an Komplexität, der besondere Beschreibungsmethoden nötig macht. Daraus folgt nicht, daß man die höheren Stufen nicht ernst nehmen sollte, und schon gar nicht, daß die Gegenstände, die in der Hierarchie höher angesiedelt sind, nicht existierten. Die Frage, ob ein Reduktionist emergente Eigenschaften akzeptieren soll oder nicht, kann erst beantwortet werden, wenn klar ist, welche Eigenschaften (oder auch Gesetze) emergent heißen sollen. Niemand kann sinnvollerweise bestreiten, daß ein Ganzes Eigenschaften hat, die seine Teile nicht haben. Andererseits wird ein Reduktionist nicht zulassen können, daß es auf höheren Stufen Eigenschaften gibt, die mit den Teilen und der
176
Manfred Stöckler
Art ihrer Zusammensetzung überhaupt nicht zusammenhängen. Ich selbst finde folgenden Explikationsvorschlag sinnvoll (ohne dafür hier argumentieren zu können): Emergent sind diejenigen Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten komplexer Systeme, die nicht aus den eingeschränkten Theorieteilen abgeleitet werden können, die ausreichen, um das Verhalten der isolierten Komponenten zu verstehen. Dieser Vorschlag setzt voraus, daß die Theorie der tiefsten Stufe (etwa die Elementarteilchenphysik) nicht identisch ist mit der Theorie der isolierten Elemente. Ein gutes Beispiel für diese Unterscheidung ist der elektrische Schwingkreis, den Gerhard Vollmer in seinem Beitrag in diesem Band diskutiert: Die Theorie der tiefsten Stufe sind die Maxwell-Gleichungen, die Theorien der isolierten Elemente (des Kondensators etwa) sind Teilausschnitte davon (sie ergeben sich als meist einfache Spezialfälle). Diese Emergenzdefinition hat eine pragmatische Komponente, sie ist aber damit verträglich, daß emergente Eigenschaften mit Hilfe der vollständigen Theorie der fundamentalen Stufe (in unserem Beispiel: mit Hilfe der Maxwell-Gleichungen) erklärbar sind. So kann also auch ein Reduktionist emergente Eigenschaften akzeptieren. Mit der Position des Reduktionismus ist übrigens nicht die Forderung verbunden, daß die Zusammensetzung von Komponenten durch eine einfache mathematische Theorie beschrieben werden kann. Der Zusammenhang zwischen Teilen und Ganzem kann nichtlinear und in hohem Grad vernetzt sein. Die Schwierigkeit der Berechnung ist kein ontologisches Argument. Wir kommen abschließend zu einem letzten Einwand, der ebenfalls ontologische Fragen mit anderen, hier normativen verwechselt. 5. Einwand: Der Reduktionismus führt zu einer falschen Forschungspolitik, da er isolationistische Forschungsprojekte favorisiert. Die Debatte, ob Biologie auf Physik reduzierbar ist, wurde oft vor dem Hintergrund der bedrohten Autonomie der Biologie geführt. So scheinen die Gegner, gegen die etwa der Biologe Ernst Mayr (z. B. in 1984, S. 49f.) ins Feld zieht, weniger ontologische Reduktionisten zu sein als allzu forsche Vertreter der Molekularbiologie, die für ihr Fach möglichst viele Lehrstühle der Botanik und Zoologie erbeuten wollen. Dieser Vorwurf ist ernstzunehmen, wenn auch prinzipiell eine These nicht schon allein des-
Für einen pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus
177
halb falsch wird, weil jemand sie zur Rechtfertigung übler Taten mißbraucht. Das Mißverständnis beruht vielleicht auch darauf, daß der Physikalismus im philosophischen Sinn nicht den gleichen Physikbegriff wie die Disziplineneinteilung der Universitäten hat. In den physikalischen Instituten werden ja tatsächlich gerade die einfachen materiellen Systeme untersucht, die sich untereinander gleichen und gut von ihrer Umgebung isolieren lassen. Die Untersuchung komplexer, innerlich strukturierter Systeme haben die Physiker ihren Kollegen von der Chemie und Biologie überlassen. Die ontologisch tiefste Ebene ist strenggenommen nicht mit dem üblichen Objektbereich der Physik identisch. Aus dem Studium der isolierten Elemente das Verhalten komplexer System erschließen zu wollen, wäre ähnlich verfehlt, wie ein Geldstück nicht da zu suchen, wo man es verloren hat, sondern dort, wo eine Laterne die Straße erleuchtet. Es sind pragmatische Gründe, die die Autonomie der Wissenschaften der höheren Stufe garantieren, weil zur Analyse komplexer Systeme mit den beschränkten menschlichen Möglichkeiten spezielle Methoden nötig sind. Selbst wenn der epistemologische Reduktionismus erfolgreicher wäre als er in Wirklichkeit ist, wäre die Selbständigkeit der Biologie nicht bedroht, wie der Biologe Francisco Ayala befürchtet hat.11 Auch bei gelungener Theoriereduktion ist Biologie mehr als angewandte Physik, da zu einer Wissenschaftsdisziplin mehr gehört als das Theoriengerüst. Reduzieren heißt nicht eliminieren oder herabstufen, hier sollte man sich weder von dem falschen Vorbild rein mathematischer Theorien noch von dem (sowieso ungerechtfertigten) Ruf der Physik als besonders seriöser Wissenschaft verführen lassen.
5. Pragmatisch eingeschränkter Reduktionismus: Einheit ohne schlechtes Gewissen Zur Ergänzung der vorhergehenden Überlegung sei noch angefügt, daß eine Konsequenz des pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus schon einen ehrwürdigen Namen bekommen hat, nämlich Thales-Problem.12 Damit ist gemeint, daß der ganz überwiegende Teil der gegenwärtigen
178
Manfred Stöckler
Elementarteilchenphysik keinen Einfluß auf die Physik des Alltags hat. Die in der praktischen Anwendung wichtigsten Theorien sind heute von der Entdeckung neuer Quarks oder von den neuesten Spekulationen über Superstrings nicht mehr betroffen, sie haben einen gewissen Abschluß gefunden. Viele Aspekte zusammengesetzter Objekte sind unabhängig von Details der mikroskopischen Zusammensetzung hinreichend verstehbar, ihre theoretische Beschreibung bleibt stabil, auch wenn sich neue Erkenntnisse über die tiefere Ebene ergeben. Ein Ganzes behält oft Gestalt und Identität, obwohl seine Teile ausgewechselt werden und ζ. B. Moleküle den Organismus verlassen. Unser vorwiegendes Interesse gilt zusammenhängenden Strukturen und komplexen Mustern, die dauerhafte Züge zeigen (Hayek 1972, S.14/15). Hier begegnet uns eine Situation, in der eine Tieferlegung der Erklärung keine praktischen Vorteile mehr bringt. So wird deutlich, daß verschiedene Ziele des Erklärens in Konflikt geraten können. Eine Vereinheitlichung des theoretischen Hintergrunds etwa durch einen sparsamen Einsatz von postulierten Entitäten kann mit der Forderung nach einem überschaubaren Argument mit relevanten Parametern in Konflikt geraten. Hilary Putnam hat daraus im Zusammenhang mit dem Leib-Seele-Problem ein Argument gegen den Reduktionismus gemacht (vgl. Putnam 1966). Es scheint, daß die Probleme der Theorie der Erklärung, ein geeignetes Maß für die Qualität einer Erklärung zu finden, verwandt sind mit der Frage, wann ein Rückgang auf die tiefere Ebene und wann eine einfache "phänomenologische" Erklärung angebracht ist. In beiden Fällen kann wohl das Ziel und der Kontext einer bestimmten Erklärung nicht unberücksichtigt bleiben. So ist es plausibel, daß die pragmatische Relativierung von Erklärungserfolg auch auf die Reduktionismusfrage Auswirkungen hat (s. die Einleitung von Schurz 1988). Was bleibt also vom Reduktionismus, wenn man die pragmatischen Einschränkungen und die "im Prinzip"-Formulierungen abzieht? Ich meine, es bleibt genug von einer kosmologischen Idee der Einheit der Welt, ihrer Verstehbarkeit durch eine einheitliche Theorie und von dem atomistischen Ideal der Erklärung. Der ontologische Reduktionismus ist mehr als die bloße Behauptung, daß Organismen aus Atomen und Molekülen zusammengesetzt sind (konstitutiver Reduktionismus). Pragmatische Überlegungen zeigen, warum der epistemologische Reduktionismus (d. h. die Theorienreduktion) nicht als letztes Kriterium für ontologische Fragen
Für einen pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus
179
dienen kann. Die Trennung zwischen ontologischen und methodologischen Aspekten macht plausibel, wie man zugleich methodologischer Holist und prinzipieller Reduktionist sein kann. Für die Medizin scheint die Berücksichtigung pragmatischer Aspekte besonders wichtig. Sie beschäftigt sich mit einem hochkomplexen System und hat dabei eine spezielle Zielsetzung, die nicht in erster Linie in der Analyse unserer Körperfunktionen, sondern in der Heilung von Krankheiten besteht. In der Medizin sind deshalb Relativierungen auf Beschreibungsperspektiven und der unterschiedliche Bedarf an Auflösungsvermögen offenkundig. Die klassische Wissenschaftstheorie kann sich anregen lassen, ähnliches auch schon im Bereich von Physik, Chemie und Biologie zu finden. Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Spielarten des Reduktionismus deutet an, wie vermeintlich entgegengesetzte Positionen doch vereinbar sein können, weil sie die gleichen Sachverhalte nur unter verschiedenen Begriffen suchen. Vielleicht wird jetzt auch mancher Leser meinen, eine soweit eingeschränkte Variante wie die hier vorgestellte sollte besser nicht mehr Reduktionismus heißen. In diesem Fall werde ich mich über die Zustimmung in der Sache freuen und nicht darüber einen Streit anfangen, was man reduktionistisch nennen soll und was nicht.
180
Manfred Stöckler
Anmerkungen 1 Älter sind auch die Begriffe "Reduzieren" und "Reduktion". 2 Lewes verwendet als erster das Wort "emergent" (1874/75, Vol. I, S. 98, Vol. II S. 412). 3 Zuweilen können im Nachhinein Erklärungen (Ableitungen) gegeben werden, ohne daß eine Vorhersage möglich gewesen wäre. 4 Wie hängt, um ein Beispiel von Eddington zu benutzen, der stabile braune Schreibtisch in der Sicht des Büromöbelhändlers mit dem Schreibtisch im Weltbild des Atomphysikers zusammen, der zunächst nur aus elektromagnetischen Feldern und einem Schwärm herumfliegender Elektronen und Nukleonen besteht, wobei diesen eine Farbe gar nicht sinnvoll zugesprochen werden kann. Vgl. zu diesm Reduktionsproblem die klassischen Überlegungen von Wilfrid Seilars (1963). 5 In diesem Sinne ist Reduktionismus die Auffassung, daß alle Systemeigenschaften auf Eigenschaften der Teilsysteme zurückführbar sind, vgl. hierzu den Aufsatz "Das Ganze und seine Teile" von Gerhard Vollmer in diesem Band. 6 Vgl. als Beispiel Schaffner (1969), für einen Überblick Wimsatt (1979) und den Abschnitt "Reduction and Genetics" in Hull (1982). 7 Vgl. dazu die antireduktionistischen Argumente von Primas (1983) und Hedrich (1990), die sehr tief in gegenwärtige Entwicklungen von Physik und Chemie einsteigen. In der Quantenmechanik der Vielteilchensysteme entsteht das Problem der Separierbarkeit in Einzelobjekte (vgl. Hedrich Kap. 4.1 und 5.2). Da die Grundlagendiskussion der Quantenmechanik (insbes. über die Interpretation des Meßprozesses) noch lange nicht zu Ende ist, kann man allerdings noch Wege zur Rettung des ontologischen Reduktionismus finden. 8 Vollmer (1986) S. 202 hat einige dieser Bedenken entkräftet 9 Interessante Problemfälle sind Systeme mit sog. strukturaler Irreduzibilität, die durch Dynamik und Anfangsbedingungen der tieferen Schicht festgelegt sind, wobei aber kein Algorithmus zur Vorhersage der Systemprozesse existiert, der kürzer ist als der im System selbst verwirklichte. Vgl. hierzu Hedrich (1990), S. 205. 10 Vgl. Haken (1982), S. 235 f. 11 Ayala (1983), S. 526. F. Ayala hat übrigens in der Einleitung zu Ayala/Dobzhansky (1974, S. viii) die klassische Einteilung in ontologischen, epistemologischen und methodologischen Reduktionismus eingeführt 12 Vgl. Feinberg (1966).
Für einen pragmatisch eingeschränkten Reduktionismus
181
Literatur [1] Ayala, F. (1983), Biology and Physics: Reflections on Reductionism, in: A. van der Merwe (ed.), Old and New Questions in Physics, Cosmology, Philosophy, and Theoretical Biology, New York, S.525-534. [2] Ayala, F./ Dobzhansky, T.(eds.) (1974), Studies in the Philosophy of Biology, Berkeley. [3] Broad, C. D. (1925), The Mind and Its Place in Nature, London. [4] Dörner, D. (1975), Wie Menschen eine Welt verbessern wollten und sie dabeizerstörten, Bild der Wissenschaft 12/2,48-53. [5] Feinberg, G. (1966), Physics and the Thaies Problem, Journal of Philosophy 63, 5-17. [6] Haken, H. (1982), Synergetik, Berlin. [7] Hayek, F. A. (1972), Die Theorie komplexer Phänomene, Tübingen. [8] Hedrich, R. (1990), Komplexe und fundamentale Strukturen: Grenzen des Reduktionismus, Mannheim. [9] Hoyningen-Huene, P. (1989), Epistemological Reductionism in Biology: Intuitions, Explications, and Objections, in: P. Hoyningen-Huene/ F. M. Wuketits (eds.), Reductionism and Systems Theory in the Life Sciences, Dordrecht, S. 29-44. [10] Hull, D. (1982), Philosophy and Biology, in G. Floistad (ed.), Contemporary Philosophy, Vol. 2, The Hague, S. 281-316. [11] Kanitscheider, B. (1979), Hrsg., Materie-Leben-Geist, Berlin. [12] Kochanski, Z. (1979), Kann Biologie zur Physiko-Chemie reduziert werden? In: Kanitscheider, B. (1979), S. 67-120. [13] Lewes, G. H. (1874/75), Problems of Life and Mind, London. [14] Mayr, E. (1984), Die Entwicklung der biologischen Gedankenwelt, Berlin. [15] Mill, J. S. (1843), A System of Logic, Toronto. [16] Morgan, C. Lloyd (1923), Emergent Evolution, London. [17] Nagel, E. (1961), The Structure of Science, New York. [18] Oppenheim, Ρ./ Putnam, Η. (1958), Unity of Science as a Working Hypothesis, in: H. Feigl/ M. Scriven/ G. Maxwell (eds.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. II, Minneapolis; dtsch. in: L. Krüger (Hrsg.), Erkenntnisprobleme der Naturwissenschaften, Köln 1970, S. 339-371. [19] Pepper, S. (1926), Emergence, Journal of Philosophy 23,241-245. [20] Primas, H. (1983), Chemistry, Quantum Mechanics and Reductionism, Berlin. [21] Putnam, H. (1973), Reductionism and the Nature of Psychology, Cognition 2, 131-145. [22] Schaffner, Κ. (1969), The Watson-Crick Model and Reductionism, The British Journal for the Philosophy of Science 20,325-348. [23] Schaffner, Κ. (1986), Exemplar Reasoning about Biological Models and Diseases: A Relation Between the Philosopy of Medicine and Philosophy of Science, The Journal of Medicine and Philosophy 11,81-92.
182
Manfred Stöckler
[24] Scheffler, I. (1965), Comments, in: R. S. Cohen/ M. W. Wartofsky (eds.), Boston Studies in the Philosophy of Science, Vol. II, New York, S. 77 - 80. [25] Schlick, M., Über den Begriff der Ganzheit (1935), wiederabgedruckt in: E. Topitsch (Hrsg.), Logik der Sozialwissenschaften, Köln 1971, S. 213-224. [26] Schurz, G. (1988), (Hrsg.), Erklären und Verstehen in der Wissenschaft, München. [27] Seilars, W. (1963), Philosophy and the Scientific Image of Man, in: Ders., Science, Perception and Reality, London, S. 1 - 40. [28] Vollmer, G. (1986), Was können wir wissen, Bd. 2: Die Erkenntnis der Natur, Stuttgart. [29] Wimsatt, W. C. (1979), Reduction and Reductionism, in: P. D. Asquith/ H. E. Kyburg (eds.), Current Research in Philosophy of Science, East Lansing (Mich.), S. 352-377.
Das Ganze und seine Teile Holismus, Emergenz, Erklärung und Reduktion Gerhard Vollmer
1. Forderungen nach ganzheitlicher Betrachtung Ganzheit ist in aller Munde. Vielfach wird behauptet, das Denken in Teilen sei lange, gar zu lange vorherrschend gewesen, es sei gescheitert und habe auch scheitern müssen, ganzheitliches, synthetisches Denken sei nun - und eigentlich schon längst - angesagt und es habe auch schon glänzende Erfolge gezeitigt. Von Holismus ist da die Rede, von einem neuen, vom holographischen Weltbild gar, von Emergenz, Fulguration, Systemdenken, von einer anderen Wissenschaft, von einem Paradigmenwechsel und von einer wissenschaftlichen Revolution, die natürlich auch gleich eine neue Ethik erforderlich und glücklicherweise auch möglich mache.1 Aus einem reichen Angebot greifen wir ein Beispiel heraus: "Ein wesentlicher Zug dieses mechanistischen Denkens ist der Reduktionismus, der aus dem komplexen Naturgeschehen einzelne Vorgänge herauslöst und diese dann mit den Methoden der Mathematik genau untersucht. Erst in der neuesten Zeit sind wir sehr deutlich an die Grenzen dieser mechanistisch-reduktionistischen Naturbetrachtung gestoßen und haben uns wieder darauf besonnen, daß die Natur und ihre Organismen komplexe Systeme sind, denen man mit einer reduktionistischen Betrachtungsweise nicht gerecht wird. Wir haben uns daher einer systematischen Betrachtungsweise zugewandt, die wieder den ganzheitlichen Aspekt betont und versucht, das Gesamtverhalten von Systemen zu erklären. Obwohl dieses systematische Denken erst in den Anfängen ist, hat es bereits eine
184
Gerhard Vollmer
Fülle von Erkenntnissen gebracht und sich vor allem als wertvolles heuristisches Prinzip erwiesen."2 Hier kommen auch schon fast alle Begriffe vor, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen: Mechanismus, Reduktionismus, Analyse ("herauslösen") auf der einen Seite, Ganzheit, Komplexität, systematisches Denken auf der anderen. Zu ergänzen wären allenfalls die Begriffe Physikalismus hier, Holismus, Emergenz und Fulguration dort. Nun ist die These, daß es eine besondere ganzheitliche Betrachtungsweise gebe und daß sie für bestimmte Zwecke die einzig angemessene sei, nicht gerade neu. Wir dürften etwa schon Platon (Sophistes), aber auch Pascal, Goethe, Hegel, den südafrikanischen Staatsmann Jan C. Smuts (18701950), den Biologen J.S. Haidane (1860-1936), Alfred North Whitehead (1861-1947), Teilhard de Chardin (1881-1955), den Naturphilosophen Adolf Meyer-Abich (1893-1971) und sicher noch viele andere als Ganzheitsdenker bezeichnen. Holisten in diesem Sinne hat es jedenfalls zu allen Zeiten gegeben. Schon deshalb wäre es sicher verfehlt, den Holismus als Modeerscheinung abzutun. Eher handelt es um eine Art Pendelbewegung, bei der holistische Strömungen immer wieder an Aufmerksamkeit und an Einfluß gewinnen.3 Holismus ließe sich dann als eine Art Reaktion auf allzu mechanistische, reduktionistische, physikalistische Tendenzen deuten. Ob eine solche Beschreibung (im Sinne einer Pendelbewegung) und eine solche Deutung (im Sinne einer Reaktion) historisch angemessen sind, soll hier nicht untersucht werden. Aber auch dazu bedürfte es klärender Vorarbeiten im Hinblick auf das, was der Holist eigentlich will, was er behauptet und was er bestreiteL Andererseits sollte man bei einer historischen Darstellung auch gar nicht stehenbleiben. Schließlich wollen wir auch wissen, ob Holisten mit ihren Thesen recht haben. Ist die traditionelle Wissenschaft wirklich in eine geistige Sackgasse geraten, gibt es eine holistische Alternative, und kann sie tatsächlich Erfolge vorweisen? Auch hierfür muß man natürlich wissen, was Holismus ist. Um eine solche Klärung kommen wir also nicht herum. Im folgenden soll beides versucht werden: eine Charakterisierung und eine Beurteilung des Holismus. Was also beansprucht der Holismus, und ist dieser Anspruch berechtigt?
Das Ganze und seine Teile
185
2. Natürlich ist der Teil nicht das Ganze Den Holismus verstehen wir hier als eine naturphilosophische und wissenschaftstheoretische Position. Ganzheiten spielen natürlich auch in anderen Zusammenhängen eine Rolle. So gibt es eine Ganzheitsmedizin, eine Ganzheitspsychologie, eine Ganzheitspädagogik. Die Ganzheitsmedizin fordert unter anderem, in der ärztlichen Praxis müßten psychosomatische, aber auch psychosoziale Zusammenhänge mehr berücksichtigt werden. Nicht Krankheiten solle der Arzt behandeln, sondern kranke Menschen, nicht die Technik, sondern die Person - von Arzt und Patient - müsse wieder mehr im Vordergrund stehen; entscheidend sei das Individuum mit seiner Krankheit hier und jetzt; die Medizin insgesamt benötige ein ganzheitliches Menschenbild, letztlich sogar eine eigenständige medizinische Anthropologie.4 All dem kann man nur begeistert zustimmen. Die schwierigen Fragen schließen sich aber erst an: Was ist überhaupt erreichbar? Welcher Arzt hat das Wissen, den Willen, die Zeit, das Wünschenswerte auch zu verwirklichen? Welcher Nutzen wiegt welche Kosten auf? Kann man sich auf das Wünschbare einigen? Diese Probleme können nicht Gegenstand unserer Betrachtung sein. Die Ganzheitspsychologie spielt vornehmlich zwischen den beiden Weltkriegen eine wichtige Rolle. Gegenüber der "Elementenpsychologie" Wilhelm Wundts betont sie den "Systemcharakter" des psychischen Geschehens. Nicht nur sei das Ganze mehr als die Summe seiner Teile (Übersummativität), vielmehr bestimme das Ganze, bestimmten die "Systemeigenschaften" auch rückwirkend die Eigenschaften der einzelnen Teile. Insbesondere trage die Gestaltwahrnehmung diesen ganzheitlichen Charakter.5 Ganzheitspsychologie und Gestalttheorie haben der modernen Psychologie viele wertvolle Anregungen vermittelt, inhaltlich-faktische wie methodisch-heuristische. Hier bestehen noch die engsten Beziehungen zu unserer Holismus-Problematik. Allerdings spielt dabei immer auch das Leib-Seele-Problem mit hinein. Und auf dieses schwierige Problem werden wir uns hier nicht einlassen. Die Ganzheitspädagogik schließlich trägt Ideen der Ganzheitspsychologie, aber auch die allgemeinere Idee vom "ganzen" Menschen, in den Unterricht. Sie geht davon aus, daß sich dem Schüler die Unterrichtsgegenstände, insbesondere die Schrift, zunächst als ganze darbieten und erst allmählich gegliedert, aufgeschlüsselt, zerlegt werden (sollten). Sie ist
186
Gerhard Vollmer
insofern angewandte Psychologie, insbesondere Entwicklungspsychologie. Auch sie kümmert uns nur insoweit, als eine erfolgreiche Lehrmethode die ihr zugrundeliegende Theorie zu stützen vermag. Die Erfolge der Ganzheitsmethoden sind jedoch umstritten. (Es ist wohl so, daß für verschiedene Schüler auch verschiedene Lehrmethoden angemessen sind.) Wir werden auch diese Zusammenhänge unberücksichtigt lassen müssen. Es gibt viele weitere Gebiete, in denen ganzheitliche Fragen, Antworten, Methoden gefordert werden. Vor allem in der Ökologie wird auf den ganzheitlichen Charakter eben von Ökosystemen hingewiesen: Jeder Organismus stehe in Wechselwirkung, im Stoff-, Energie- und Informationsaustausch mit seiner Umwelt, und das gelte natürlich auch für den Menschen. Die Teile eines Ökosystems bildeten eine Einheit und dürften nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Das gelte auch für das größte bekannte Ökosystem, die gesamte Biosphäre. Die Erde als Ganzes könne und müsse man als Raumschiff betrachten; sie stelle eine Art Superorganismus dar und könne als solcher besser verstanden und bewahrt werden (Gaia-Hypothese). Ähnliches läßt sich dann auch für andere Systeme feststellen, für wirtschaftliche, politische, soziale. Diese Hinweise sind immer berechtigt. Überall gibt es Einflüsse, Wechselwirkungen, Rückkopplungen, Regelkreise, Nebenfolgen, Spätfolgen. Kein System im Universum ist völlig isoliert, von allen anderen unabhängig - nicht der einzelne Mensch, nicht die Menschheit, nicht die Erde, nicht das Planetensystem, nicht die Milchstraße, nicht einmal ein Schwarzes Loch. Einen sprechenden Beleg bietet das folgende Zitat: "Es ist nicht wahr, daß wir in einen Kosmos ausgesetzt sind, dessen fremde Schönheit mit uns nichts zu tun hat. Es ist nicht wahr, daß unsere Existenz sich in einem Weltall abspielt, dessen unermeßliche Leere wir mit unserer Erde beziehungslos durchqueren, gleichsam nur unserer Bedeutungslosigkeit wegen geduldet, aber ohne jeden Zusammenhang mit der Entwicklung des Ganzen. ...der Kosmos selbst ist der Ursprung und die Grundlage unserer Existenz ... Er ist unser Weltraum. Er hat uns hervorgebracht und er erhält uns am Leben. Wir sind seine Geschöpfe. Das kann uns Vertrauen geben, auch wenn wir zugestehen müssen, daß es niemanden gibt, der uns sagen könnte, wohin die Reise geht."6
Das Ganze und seine Teile
187
In dem hier zitierten Buch "Kinder des Weltalls" macht Hoimar von Ditfurth auf bestechende Weise klar, wie sehr wir mit unserer Existenz von Alter, Größe und weiteren Besonderheiten des uns umgebenden Kosmos abhängen. Daraus darf man allerdings nicht schließen, daß uns dieser Kosmos nun eine Art Überlebensgarantie böte, wie das die letzten Sätze zumindest nahelegen. In dieser Welt sind wir nur möglich, nicht auch noch notwendig. Daß wir dem Kosmos in viel stärkerem Maße verbunden, auf ihn viel dringender angewiesen sind, als wir gedacht haben mögen, gerade das verdeutlicht ja die besondere Anfälligkeit und Zerbrechlichkeit unserer Existenz. Wie auch immer - die Einbeziehung unserer kosmischen Umgebung, ja des gesamten Universums, ist auf jeden Fall lehrreich. Wie hier ist es immer möglich, zum eigentlichen Gegenstand einer Betrachtung weitere Objekte, insbesondere solche aus seiner Umgebung, hinzuzunehmen, ihn in einen größeren Zusammenhang einzubetten und das größere System als neue Einheit in den Blick zu nehmen. Die Betrachtung des fraglichen Systems wird dadurch jedoch komplizierter, schwieriger. Die Frage ist deshalb auch hier, ob der Erfolg den Aufwand lohnt. Und es ist ja gerade die Aufgabe und die Kunst des Wissenschaftlers herauszufinden, welche äußeren Einflüsse (die es faktisch immer in Hülle und Fülle gibt) für das Verhalten des jeweils betrachteten Systems wesentlich sind. Nur diese Bezüge wird man dann auch berücksichtigen. Es liegt also noch kein Verdienst darin, darauf hinzuweisen, daß ein bestimmtes, als abgeschlossen betrachtetes System in Wahrheit gar nicht abgeschlossen sei. Entscheidend ist nicht der Nachweis, daß eine bestimmte Wechselwirkung mit der Umgebung existiert, sondern daß diese berücksichtigt werden muß, wenn man das System verstehen will. Das läßt sich nicht von vornherein entscheiden; es muß eingehend untersucht werden. Nur wenn in Vergessenheit geraten sollte, daß jedes System und somit natürlich auch das jeweils betrachtete mit seiner Umgebung in Wechselwirkung steht, dann mag ein solcher Hinweis angebracht und vielleicht auch hilfreich sein. All dies ist aber noch kein Holismus, nicht in dem hier ins Auge gefaßten Sinne. Daß der Teil noch nicht das Ganze ist, das ist schließlich trivial; es folgt schon aus der Definition von Teil und Ganzem, wie immer diese schwierige - Definition auch aussehen mag.7 Deshalb gehört es auch zu den Axiomen der Euklidischen Geometrie. Und selbst die nichteuklidi-
188
Gerhard Vollmer
sehen Geometrien machen daran keine Abstriche, auch wenn sie andere Axiome (wie das Parallelen-Axiom) weglassen oder durch ihr Gegenteil ersetzen. Der Holismus behauptet mehr.
3. Resultierende und emergente Eigenschaften Die kürzeste, wenn auch nicht unbedingt die klarste Formulierung der holistischen Position liegt in der These, das Ganze sei mehr als die Summe seiner Teile. "Was ist mit diesem Rätselwort gemeint?" (Goethes Faust) Es ist ein Rätselwort, solange nicht bekannt ist, was hier 'Summe' und was hier 'mehr' bedeuten sollen. Ist aber die Bedeutung der These noch offen, so ist es ihre Wahrheit erst recht. Wir wollen einige Deutungsmöglichkeiten diskutieren und dabei annehmen, daß der Holist nicht eine Interpretation im Auge haben kann, bei der seine These trivialerweise wahr oder trivialerweise falsch wird. Eine durchaus ernstzunehmende Fassung geht darin, daß ein System Eigenschaften aufweisen kann, die seine Teilsysteme einzeln nicht besitzen. Man spricht dann gerne von Systemeigenschaften oder, noch deutlicher, von neuen Systemeigenschaften. Die Betonung liegt dabei auf der Tatsache, daß es sich um eine neue Eigenschaft, um eine neue Qualität handeln muß. Nicht gemeint sind also bloße quantitative Veränderungen. Natürlich hat ein volles Glas Wasser ein anderes Gewicht als das Glas allein und als das Wasser allein. Aber die Teile haben eben auch schon für sich ein Gewicht. Das Gesamtgewicht ergibt sich dann als einfache Summe der beiden Teilgewichte: G = Gì + G2. Dasselbe gilt auch für die jeweiligen Massen und für die Energieinhalte.8 Die Zustandsgrößen Gewicht, Masse, Energie können sich zwar ihrem Betrage nach ändern, aber doch nicht insgesamt auftauchen oder verschwinden. Von neuen Eigenschaften ist dabei also nicht die Rede. Dies gilt auch dann noch, wenn sich eine Zustandsgröße des Gesamtsystems nicht durch einfache Addition aus den Teilgrößen ergibt. Ohmsche Widerstände Ri, R2 kann man zusammenschalten. Schaltet man sie hintereinander, so ist der Widerstand R des Gesamtsystems einfach die Summe: R = Ri + R2. Schaltet man sie jedoch parallel, so ist der Widerstand des
189
Das Ganze und seine Teile
Gesamtsystems nicht die Summe, auch nicht die Differenz; vielmehr addieren sich jetzt die reziproken Werte: I R
=
J_ + J_ R, R 2
bdzz w w
·
Rk =
R R 1 ? R1+R2
Ähnliches gilt für die "Addition" gleichgerichteter Geschwindigkeiten vi und V2 nach der speziellen Relativitätstheorie. Als Gesamtgeschwindigkeit ergibt sich nicht wie in der klassischen Physik ν = v j + V2 , sondern ν=
v i + V2 V v 1 + 1 2
Auch wissen wir, daß Geschwindigkeiten, Kräfte und viele andere Größen, die nicht gleichgerichtet sind, sich vektoriell addieren: Die resultierende Größe braucht dann weder dem Betrage noch der Richtung nach mit einer der Ausgangsgrößen oder mit deren einfacher Summe übereinzustimmen. Offenbar ergeben sich die Eigenschaften der Gesamtsysteme in diesen Fällen durchaus nicht durch einfache Addition aus den Eigenschaften der Teilsysteme; insofern ist auch hier das Ganze mehr - gelegentlich auch weniger - als die Summe seiner Teile. Trotzdem sind das noch keine Belege für die holistische These: Tatsächlich sind ja auch keine neuen Eigenschaften aufgetreten. Viele Autoren (zuerst wohl Lewes 1875) sprechen in solchen Fällen - in sinnfälliger Analogie zur Addition von Kräften - von Resultanten oder Resultierenden.9 Resultierende Eigenschaften sind also noch nicht das, worauf der Holist eigentlich hinaus will. Ihm geht es um die neuen Qualitäten. Sie heißen (in diesem Sinne wohl ebenfalls zuerst bei Lewes) emergente Eigenschaften, und das Auftreten neuer Systemeigenschaften heißt Emergenz. Daß es Emergenz in diesem Sinne gebe, ist also die erste und wichtigste These des Holismus.
190
Gerhard Vollmer
4. Die erste holistische These: Emergenz Unser heutiges Weltbild ist durchweg evolutionär. Alle realen Systeme unterliegen der Evolution; alles hat sich aus kleineren, einfacheren Bausteinen entwickelt. In dieser Perspektive ist das faktische Auftreten neuer Systeme mit neuen Eigenschaften selbstverständlich, evident; zu dieser Sicht gibt es überhaupt keine ernsthafte Alternative. Der Aufbau komplexer Systeme aus einfachen Teilsystemen findet laufend statt. Dabei entstehen auch heute noch durchaus neue Systeme, also solche, die es vorher noch nie gegeben hat. So ist - auch ohne Berufung auf die universelle Evolution - das Auftreten neuer Systemeigenschaften von niemandem zu übersehen oder zu bestreiten. Eine Position also, die sich etwa in die Worte kleiden ließe "nichts Neues unter der Sonne" (Ecclesiastes = Prediger Salomo 1,9) oder "alles schon dagewesen" (Rabbi Ben Akiba in Gutzkows "Uriel Acosta"), ist völlig unhaltbar. Natürlich ist nicht alles schon einmal dagewesen. Die konträre Behauptung "nichts ist schon dagewesen", zu der Konrad Lorenz sich hinreißen läßt , ist freilich ebenso übertrieben. Natürlich gibt es nicht immer nur Neues. Was Lorenz sagen will, ist auch nur, daß immer wieder Neues entsteht (und daß deshalb nicht alles vorhersehbar ist). Die folgenden Beispiele dienen deshalb weniger dazu, das Auftreten neuer Systemeigenschaften zu belegen, als dem Versuch, deutlich zu machen, in welchem Sinne Systemeigenschaften neu sein können. Elementarteilchen wie Protonen, Neutronen und Elektronen bilden Atome und sind damit die Urbausteine der Materie, die uns umgibt und aus der auch wir selbst bestehen. Atome aber haben Eigenschaften, die ihre Teile nicht haben: Sie absorbieren und emittieren Lichtquanten verschiedener Energien und zeigen dabei diskrete Spektren·, sie lassen sich polarisieren (wobei - bildlich gesprochen - Atomkern und Elektronenhülle gegeneinander verschoben werden); sie können ionisiert werden und sind dann elektrisch geladen, manche senden auch Kernteilchen aus, zeigen also Radioaktivität·, vor allem aber können sie chemische Bindungen eingehen und sich dabei zu größeren Verbänden zusammenschließen. All das können Elementarteilchen nicht. Die Systeme nun, zu denen Atome sich zusammensetzen, - Moleküle, Makromoleküle, Gase, Flüssigkeiten, feste Körper, Kristalle - zeigen wieder ganz neue Eigenschaften: Sie bilden Stoffe, haben ein spezifisches
Das Ganze und seine Teile
191
Gewicht, leiten Wärme, zeigen Reibung, sind weich oder hart, manche sind löslich in Wasser oder in anderen Flüssigkeiten, leiten Elektrizität, sind magnetisierbar, giftig, zäh, spröde, zerbrechlich und zeigen für uns Farbe, Geschmack, Geruch. Supraleitung und Supraflüssigkeit sind dann zwei besonders auffällige Systemeigenschaften, die sich zudem - obwohl durchaus makroskopischer Natur - nur quantenphysikalisch verstehen lassen. Für lehrreiche Fallstudien eignet sich aber auch schon der einfache Stoff Wasser. Seine Bestandteile, Wasserstoff und Sauerstoff, bilden bei Normalbedingungen Gase, als chemische Verbindung dagegen eine Flüssigkeit. Und was hat diese Flüssigkeit nicht alles für Eigenschaften! Man denke an die überraschende Tatsache, daß Wasser bei 4° C seine größte Dichte hat. So wird die tiefste Schicht eines Sees normalerweise nicht kälter als 4° C; der See gefriert zuerst oben und nur selten bis unten durch. Wasser hat eine ungewöhnlich hohe Wärmekapazität und ist damit verantwortlich für den Unterschied zwischen Land- und Seeklima. Für uns ist es farblos, geschmack- und geruchlos; es ist durchsichtig und doch so schwer zu durchschauen! Aber auch Wasser ist natürlich nur ein Beispiel von vielen, von Tausenden, von Millionen. Physik, Chemie, Biologie finden neue Systemeigenschaften auf Schritt und Tritt. In einem eigenen Aufsatz hat John Platt die Eigenschaften zusammengestellt, in denen große Moleküle sich von ihren chemischen Bausteinen unterscheiden.11 Dabei trennt er zwei- und dreiatomige Moleküle von solchen mit 5 bis 50 Atomen und diese noch einmal von solchen mit 50 bis 500 Atomen. Er betont dabei Eigenschaften, die für Bau und Funktion von Muskeln bedeutsam sind, etwa die Kontraktionsfähigkeit. Häufig erwähnt werden auch die Saite (G.T. Fechner), der Thermostat (B. Hassenstein), die Geige (E.v.Holst, Hassenstein), der Schwingkreis (hierzu vgl. Abschnitt 8). Und als die bedeutendsten Emergenzen im Laufe der gesamten Evolution gelten allgemein das Leben und das Bewußtsein. Ein letztes hübsches Beispiel entnehmen wir - in Anlehnung an Herbert Schriefers - dem "Anti-Diihring" von Friedrich Engels: "Zwei Mameluken waren drei Franzosen unbedingt überlegen; 100 Mameluken standen 100 Franzosen gleich; 300 Franzosen waren
192
Gerhard Vollmer
300 Mameluken gewöhnlich überlegen; 1000 Franzosen warfen jedesmal 1500 Mameluken."12 Wie ist das möglich? Die Mamelucken (bei Engels ohne 'c') sind bessere Reiter; die Franzosen haben mehr Disziplin. Die Disziplin aber kann sich erst auswirken, wo es Vorgesetzte und Befehle gibt, also im größeren Verband; sie ist - jedenfalls hinsichtlich ihrer Auswirkung - eine Systemeigenschaft. Zwischen resultierenden und emergenten Systemeigenschaften gibt es allerdings auch Grenzfälle. Das Proton, das den Wasserstoffkern bildet, ist positiv geladen; das Elektron, das die zugehörige Hülle bildet, ist negativ geladen; das Wasserstoffatom als Gesamtsystem ist dagegen elektrisch neutral. Ist die Systemeigenschaft Neutralität nun eine neue, eine emergente Eigenschaft? Oder resultiert sie einfach aus der Addition der beiden Teilladungen L = Li + L2 = + 1 + (-1) = 0? Sind Mischfarben - Grün aus Blau und Gelb, Braun aus Gelb und Schwarz - emergent oder bloß resultierend? Und doch stellen Grenzfälle eine Unterscheidung noch nicht grundsätzlich in Frage. Sie machen nur darauf aufmerksam, daß es kontinuierliche Übergänge geben kann, wo man einfache Ja-Nein-Entscheidungen erwartet hätte, daß es nötig sein kann, die Begrifflichkeit zu verschärfen, und daß bei dieser Verschärfung pragmatische Elemente, insbesondere Zweckmäßigkeitsüberlegungen, eine "entscheidende" Rolle spielen können. Das Wort 'Emergenz' hat nicht alle zufriedengestellt, die von neuen Systemeigenschaften reden möchten. Konrad Lorenz etwa stößt sich daran, daß es etymologisch 'Auftauchen' bedeutet, daß es also "die Vorstellung erweckt, etwas Präformiertes tauche plötzlich auf, wie ein luftholender Wal an der Oberfläche des Meeres, das eben noch, bei buchstäblich oberflächlicher Betrachtung, leer zu sein schien."13 Da auch die Wörter 'Entwicklung' und 'Evolution' in dieser Hinsicht nicht besser abschneiden, hat Lorenz versucht, den scholastischen Ausdruck 'Fulguration' wiederzubeleben. Mit seiner Herkunft vom lateinischen 'fulgur' ('Blitz') bringe er das absolut Neue besser zum Ausdruck. Einige Autoren sind dem Vorschlag gefolgt, andere haben ihn heftig kritisiert; wirklich durchgesetzt hat er sich nicht; und auch Lorenz selbst soll seinem eigenen Vorschlag zuletzt sehr skeptisch gegenübergestanden haben.
Das Ganze und seine Teile
193
Herbert Schriefers spricht statt dessen lieber von 'Transzendenz'.14 Übernatürliche Einflüsse schließt er dabei ausdrücklich aus. Alternativ und völlig bedeutungsgleich benützt er aber auch 'Emergenz', und es ist überhaupt nicht einzusehen, wofür dann ein so vielfach vergebener und belasteter Begriff wie Transzendenz' noch dienlich sein sollte. Letztlich bedeuten Wörter nicht das, was sie - etymologisch - in ihrer Herkunftssprache oder früher einmal bedeutet haben, sondern das, was wir sie bedeuten lassen. Und wenn wir uns entschließen können, neue Systemeigenschaften im Sinne unserer Beispiele 'emergent' zu nennen, dann brauchen wir weder neue Wörter zu erfinden noch alte wiederzubeleben oder umzudeuten. Dann lautet die erste These des Holismus, daß es emergente Eigenschaften gibt, und dieser These können wir ohne weiteres zustimmen. Sie wird heute allgemein anerkannt.
5. Nichts Neues unter der Sonne? Das war allerdings nicht immer selbstverständlich. Vielfach war man der Überzeugung, daß es in dieser Welt nichts wirklich Neues geben könne. Dafür mögen verschiedene Motive wirksam gewesen sein. Mancher mag der Meinung sein, Gott dürfe seiner Welt nicht einen so mühsamen und langwierigen Werdeprozeß zumuten, wie ihn die Evolution darstellt, und müsse sie deshalb von Anfang an vollkommen geschaffen haben. Ein drastisches Beispiel bietet die antievolutionistische Auffassung von Philipp Henry Gosse, nach der Gott die Welt mit all ihren Teilen gleich so geschaffen habe, wie wir sie kennen: mit geologischen Schichten, Fossilien, Ruinen, Dokumenten, Narben, Erinnerungen. Aus den Funden sei deshalb der wahre Schöpfungszeitpunkt überhaupt nicht zu ermitteln, nicht einmal einzugrenzen. Tatsächlich könnte die Erschaffung der Welt im Prinzip auch um nur wenige Jahrhunderte, Jahre, Stunden, ja selbst Sekunden, zurückliegen.15 Andere meinen, daß wenigstens "Geistiges nur aus Geistigem hervorgehen und deshalb nicht (in gewöhnlichem Sinne) entstehen kann".1 Die Motivation ist hier meist religiöser Natur, aber auch nichtreligiöse Gründe können eine solche Haltung nahelegen. In einem statischen, in einem
194
Gerhard Vollmer
stationären, insbesondere in einem zyklischen Weltbild kann es eben nichts wirklich Neues geben. Allerdings fällt es einem solchen statischen Weltbild dann besonders schwer, evolutive Befunde zu verarbeiten. Wenn im Laufe der Evolution neue Systeme mit neuen Eigenschaften aufzutauchen scheinen, dann muß dies als Täuschung entlarvt werden. Vermeintlich neue Eigenschaften dürfen gar nicht wirklich neu sein; irgendwie müssen sie schon vorher - wenigstens latent - vorhanden gewesen sein. Ein typisches Beispiel ist die Präformationstheorie des 17. und 18. Jahrhunderts. Danach sollte eine Keimzelle bereits den fertigen Organismus enthalten, allerdings unbeobachtbar klein, etwa nach Art eines Homunculus. Das Werden eines Lebewesens im Laufe seiner Ontogenese wäre dann wirklich nur ein Ent-Falten, ein Ent-Wickeln, eine E-volution. Und wie in einer russischen Puppe sollten auch alle zukünftigen Generationen in der Zelle schon fertig angelegt sein. Diese Theorie wurde zwar schon im 18. Jahrhundert widerlegt (und durch die Epigenesistheorie verdrängt); sie war aber im 19. Jahrhundert noch unter dem Namen 'Evolutionstheorie' bekannt, und deshalb konnte Darwin seine Theorie damals nicht 'Evolutionstheorie' nennen, wie wir das heute tun. Das Wort 'Evolution' verwendet Darwin überhaupt erst 1872 in der 6. Auflage seines Hauptwerkes "Der Ursprung der Arten". Es hat also durchaus eine Zeit gegeben, in der das Auftreten neuer Systemeigenschaften ernsthaft bezweifelt wurde und deshalb ausdrücklich betont werden mußte. Das haben etwa John Stuart Mill, Georg Henry Lewes, Wilhelm Wundt, Samuel Alexander, Conwy Lloyd Morgan getan, aber auch in neuerer Zeit legt Karl Popper großen Wert auf die Einsicht, daß die Evolution wirklich Neues hervorbringt.17 Eine andere Konstruktion, die in einer bestimmten Hinsicht ohne neue Systemeigenschaften auszukommen sucht, ist der Panpsychismus, nach dem alle Systeme, auch unbelebte, ja sogar schon Moleküle, Atome und Elementarteilchen, psychische Eigenschaften haben sollen.18 Diese psychischen - bei Bernhard Rensch dann deutlicher 'protopsychischen' Eigenschaften kommen zwar bei unbelebten und auch bei vielen belebten Systemen noch nicht zur Ausprägung, werden nicht manifest; gleichwohl sind sie irgendwie vorhanden. Diese Annahmen sollen die Schwierigkeiten des Leib-Seele-Problems umgehen. Sie sind jedoch nicht nur nicht prüfbar, sondern völlig überflüssig:
Das Ganze und seine Teile
195
In einem evolutionären Universum sind neue Systemeigenschaften nichts Ungewöhnliches, sondern die Regel; und auch Bewußtseinserscheinungen als spezielle Funktionen des Gehirns können in der Evolution ohne weiteres und sogar mehrfach neu entstanden sein. Wir sollten also - bewährten Prinzipien der Erfahrungswissenschaft folgend - Systemen nur Eigenschaften zuschreiben, die wir an ihnen auch finden. Andernfalls gibt es nämlich kein Hindernis mehr, Systemen beliebige Eigenschaften, insbesondere Teilsystemen schon alle höheren Systemeigenschaften anzudichten. In diesem Sinne ist auch Manfred Eigens Warnung zu verstehen: "Es gibt keinerlei Berechtigung, Eigenschaften generell in die Materie hineinzuinterpretieren, die als solche erst auf höherem Organisationsniveau und nur unter sehr spezifischen Bedingungen erworben werden können."20 Im Grunde haben wir es also heute einfacher: In der Einsicht, daß wir in einem evolutionären Universum leben, können wir Eigenschaften, die uns neu erscheinen, auch als neu anerkennen. Alle die erwähnten Hilfskonstruktionen zur Erklärung des scheinbar Neuen, in Wahrheit aber längst Bestehenden, sind damit entbehrlich. Noch nicht beantwortet ist allerdings die weitere Frage, ob wir nun das wirklich Neue in unserer Welt auch er klären können.
6. Sind emergente Eigenschaften aus denen der Systemteile erklärbar? Diese Frage hat mehrere Aspekte. Zunächst einmal kann man die Begriffe 'emergent' und 'erklärbar' natürlich so definieren, daß die Antwort auf jeden Fall "Nein" lauten muß, ganz gleich, was in der Natur der Fall ist oder was wir darüber wissen. Die Antwort gilt dann, wie es so schön heißt, per definitionem; sie informiert uns dann aber auch nur über die Bedeutung unserer Begriffe, über die von uns gewählte Terminologie, über den üblichen, vorgeschlagenen oder verabredeten Sprachgebrauch. Viel interessanter ist jedoch die Frage, ob es solche unerklärbaren neuen Systemeigenschaften tatsächlich gibt. Setzt man ihre Existenz voraus, so
196
Gerhard Vollmer
ist es auch sinnvoll, ihnen einen Namen zu geben, und die Bezeichnung 'emergent' ist dann durchaus ein möglicher Kandidat. Geht man dagegen davon aus, daß es sie nicht gibt, dann ist es weniger zweckmäßig, sie 'emergent' zu nennen, einfach deshalb, weil ja dann die Klasse der so definierten emergenten Eigenschaften von vornherein leer wäre. Zwar ist es weder moralisch verwerflich noch logisch widersprüchlich, ja nicht einmal sprachlogisch sinnlos, nichtexistenten (aber definierbaren) Dingen, Eigenschaften oder Strukturen einen Namen zu geben, - schließlich reden wir ja auch von Nessie, von Einhörnern, von Punktmassen, von idealen Gasen usw. -; aber beim Problem der neuen Systemeigenschaften wäre es natürlich ungeschickt, den wichtigen Begriff 'emergent' von vornherein so zu definieren, daß es Emergenz gar nicht erst gibt. Wir dürfen deshalb davon ausgehen, daß Autoren, die 'emergent' als '(neu und) unerklärbar' definieren, solche Eigenschaften in der Regel auch als tatsächlich existent unterstellen.21 Zwei Beispiele sollen genügen. "Entwickelt sich aus vorgegebenen Elementen und Beziehungen ein neues System, ... so nimmt dieses System Eigenarten an, die aus dem Verhalten der zum Aufbau verwendeten Elemente nicht erklärt werden können ... Man spricht, dieses Phänomen zu charak22 terisieren, von Emergenz." "Allgemein gesagt, wurde der Begriff Emergenz benutzt, um gewisse Erscheinungen als "neu" zu charakterisieren, und das nicht nur in dem psychologischen Sinne des Unerwartetseins, sondern in dem theoretischen Sinne, daß Informationen über die räumlichen oder anderweitigen Bestandteile der betreffenden Systeme nicht ausreichen, um diese Erscheinungen zu erklären oder vorauszusagen."23 Hier ist allerdings nicht nur von Erklärungen, sondern im gleichen Atemzug auch von Voraussagen (bzw. von der Unmöglichkeit beider) die Rede. Im Augenblick kümmern wir uns jedoch nur um den Erklärungsaspekt; ob neue Systemeigenschaften vorausgesagt werden können, werden wir in Abschnitt 10 diskutieren. Andere Autoren definieren und gebrauchen den Ausdruck 'Emergenz', ohne sich dabei auf die Erklärbarkeit oder Nichterklärbarkeit neuer Systemeigenschaften festzulegen.24 Dieses Verfahren erscheint uns zweckmäßiger, und wir werden ihm von nun an folgen. Die These, daß (mindestens einige) Systemeigenschaften nicht aus den Teilsystemen erklärt
Das Ganze und seine Teile
197
werden können, ist allen holistischen Positionen gemeinsam, und wir werden sie deshalb die zweite holistische These nennen. Nach der ersten holistischen These, die wir - nach einigen klärenden Überlegungen - vorbehaltlos zugestanden haben, gibt es neue Systemeigenschaften, gibt es Emergenz. Nach der zweiten holistischen These sind diese neuen Eigenschaften (mindestens einige von ihnen) nicht aus den Eigenschaften der Teilsysteme erklärbar.
7. Die zweite holistische These: Unerklärbarkeit Hat der Holismus auch hierin recht? Ist es also wahr, daß neue Systemeigenschaften nicht aus den Eigenschaften der Teilsysteme erklärt werden können? Diese Frage ist die eigentlich entscheidende. Bei ihrer Diskussion werden wir den üblichen erfahrungswissenschaftlichen Erklärungsbegriff zugrundelegen. Danach ist ein Ereignis erklärt, wenn es als Spezialfall und damit als Folge einer tieferliegenden allgemeinen Gesetzlichkeit erkannt ist (die ihrerseits unabhängig von dem fraglichen Ereignis prüfbar, vorzugsweise auch wirklich geprüft und bestätigt ist). Es handelt sich also um ein Subsumtionsmodell (covering law model) wissenschaftlichen Erklärens.25 Ist ein Ereignis erklärbar in diesem Sinne, so sagt man auch, es sei ableitbar oder deduzierbar. Kann insbesondere eine Systemeigenschaft aus unserem Wissen über die Teilsysteme erklärt werden, so sagen wir, sie sei darauf zurückfährbar oder reduzierbar, im Vollzugsfalle, sie sei zurückgeführt oder reduziert. Reduktionismus ist dann also die Auffassung, alle Systemeigenschaften seien auf die Eigenschaften der Teilsysteme reduzierbar. Der Reduktionismus steht damit im Gegensatz zum Holismus (ganz gleich, wie man 'Emergenz' oder 'Emergentismus' definiert). In unserer Terminologie können Holist und Reduktionist nicht beide recht haben, wohl aber einer von ihnen. Wer hat recht? Nun sollten wir uns wieder hüten, das Problem so zu vereinfachen, daß die Lösung trivial wird. Die Denker vieler Jahrhunderte hätten sich über dieses Problem sicher nicht den Kopf zerbrochen, wenn es eine triviale Lösung hätte. Erscheint uns die Lösung trivial, dann sicher nicht deshalb, weil wir so viel schlauer wären, sondern vermutlich deshalb, weil wir am Kern des Problems vorbeidefiniert haben.
198
Gerhard Vollmer
Den Eigenschafts- oder den Erklärbarkeitsbegriff sollten wir zum Beispiel nicht so wählen, daß alle Systemeigenschaften automatisch erklärbar werden: nicht so etwa, daß alle Systemeigenschaften auch schon Eigenschaften der Teilsysteme werden, so daß es neue Systemeigenschaften letztlich gar nicht geben kann (wofür wir schon die Präformationstheorie und den Panpsychismus kritisiert haben), aber auch nicht so, daß wir die Rückführung des Wirklichen auf das Mögliche schon als Erklärung ausgeben (dann haben wir für alles eine triviale Erklärung). Natürlich gehört es zu den Eigenschaften des Wasserstoffatoms, unter geeigneten Umständen Wasser bilden und als solches unter weiteren einschränkenden Bedingungen Durst löschen zu können; trotzdem ist Wasserstoff noch kein Wasser und löscht deshalb auch nicht den Durst. Natürlich ist alles, was wirklich ist, mit Sicherheit auch möglich (die Umkehrung gilt allerdings nicht). Wenn also Wasser wirklich Durst löscht, dann ist es dem Wasserstoff offenbar möglich, Stoffe zu bilden, die Durst löschen; aber erklärt ist damit noch gar nichts. Auch Molières virtus dormitiva erklärt nicht die einschläfernde Wirkung des Opiums, die vis Vitalis nicht die Lebenserscheinungen, ein élan locomotif nicht das Funktionieren der Dampfmaschine. Andererseits sollten wir gegenüber Erklärungsversuchen nicht derart anspruchsvoll sein, daß Neues - wieder ganz zwangsläufig - grundsätzlich unerklärbar wird. Insbesondere müssen wir zulassen, daß die neuen Systemeigenschaften in Begriffen der Teilsysteme und ihrer wechselseitigen Beziehungen definiert werden. So muß es erlaubt sein, Licht als elektromagnetische Welle, den (makroskopischen) Druck eines Gases über die Impulsänderung der beteiligten Gasmoleküle, die Temperatur eines Stoffes über die mittlere kinetische Energie seiner molekularen Bestandteile zu definieren. Ohne solche identifizierenden Definitionen (Brückenprinzipien) kann es auch keine Erklärungen geben; denn aus Prämissen allein, die einen Term nicht enthalten, kann keine Konklusion gewonnen werden, die ihn wesentlich enthält. Um neue Systemeigenschaften erklären zu können, brauchen wir Brückenprinzipien, und deren Einführung muß wenigstens erlaubt sein. Schließlich ist der Reduktionismus nicht schon dann widerlegt, wenn die Erklärung neuer Systemeigenschaften noch nicht überall gelungen ist. Tatsächlich kann es sinnvoll sein, auf eine Erklärung aus Bestandteilen zu verzichten, also sich entweder auf bloße Beschreibungen oder auf Erklä-
Das Ganze und seine Teile
199
rungen auf der Ebene des Gesamtsystems zu beschränken. Dafür können pragmatische Motive, insbesondere Kosten-Nutzen-Erwägungen, ausschlaggebend sein. Es mag auch - trotz hartnäckiger Bemühungen - bisher einfach nicht gelungen sein, Systemeigenschaften auf die Bestandteile zurückzuführen. Die Unmöglichkeit der Reduktion folgt daraus natürlich noch nicht. Der Reduktionismus ist Programm.·, er hat recht, wenn Reduktionen in allen einschlägigen Fällen möglich sind, nicht erst dann, wenn sie wirklich vorliegen. Da es sehr viele Systemeigenschaften gibt und da immer wieder neue auftauchen, ist es unmöglich, daß jemals alle wünschbaren Erklärungen tatsächlich auch geliefert werden können. Der Reduktionismus als universelles Programm läßt sich also niemals beweisen. Läßt er sich vielleicht widerlegen? Dazu genügt ja im Prinzip ein einziges Gegenbeispiel, ein einziger überzeugender Nachweis, daß eine bestimmte Systemeigenschaft nicht aus den Eigenschaften der Teilsysteme erklärt werden kann. Liegt somit die Beweislast eher beim Holisten als beim Reduktionisten? Es ist allerdings nicht leicht, verbindlich festzulegen, wann denn ein holistisches Beispiel (oder Gegenbeispiel) den Reduktionismus überzeugend widerlegt. Immer nämlich kann sich der Reduktionist damit herausreden, daß die behauptete Reduzierbarkeit nur vorläufig noch nicht durch eine gelungene Reduktion belegt werden konnte, daß jedoch letztere wenigstens im Prinzip möglich sei und nur aus technischen Gründen - solchen der Komplexität, des Rechenaufwandes, der Ungenauigkeit der Meßdaten, des unvollständigen Wissens usw. - nicht gelungen sei, vielleicht sogar auf Dauer nicht gelingen werde. Damit würde der Reduktionismus also unwiderlegbar. So könnte man geneigt sein, dem Reduktionisten - da er unendlich viele Reduktionen natürlich nicht liefern kann - wenigstens für alle wichtigen Fälle erfolgreiche Reduktionen abzuverlangen, die Beweislast also im wesentlichen doch wieder an ihn zurückzuverweisen. Aber was heißt schon 'wichtig'? Sind nicht gerade die schwersten Reduktionen die wichtigsten? Werden sie nicht gerade dadurch wichtig, daß sie so schwierig und bisher nicht gelungen sind? Und kann der Holist nicht ganz gezielt gerade jene Fälle als wichtig herausgreifen, die ihm oder allen besonders schwierig erscheinen? Wäre diese Art der Pflichtenzuteilung nicht auch wieder unfair? Wem kann und soll man dann aber wieviel zu-
200
Gerhard Vollmer
muten? Handelt es sich vielleicht um ein unlösbares, vielleicht auch um ein Scheinproblem? Insgesamt müssen wir uns klarmachen, daß sowohl der Holismus als auch sein Gegenspieler, der Reduktionismus, weder beweisbar noch widerlegbar sind. Beide verbinden nämlich - logisch gesehen - All- mit Existenzbehauptungen: Nach dem Holismus gibt es Systemeigenschaften, an denen alle Reduktionsversuche scheitern; nach dem Reduktionismus dagegen sollte es für alle Systemeigenschaften befriedigende Erklärungen geben. In jeder dieser Positionen gibt es für den All-Anspruch keinen Beweis, für den Es-gibt-Anspruch keine Widerlegung. Eine endgültige Entscheidung zwischen Holismus und Reduktionismus wird es deshalb niemals geben. Stellt man sich trotzdem die Aufgabe, hier zu einem unanfechtbaren Urteil zu kommen, so handelt man sich ein unlösbares Problem ein. Glaubt man, die richtige Lösung bereits zu kennen und nur noch als richtig nachweisen zu müssen, verschreibt man sich ebenfalls einer unlösbaren Aufgabe; denn gerade einen solchen Nachweis kann es ja nicht geben. Handelt es sich also um eine nutzlose Auseinandersetzung, um eine Frage, bei der alle Antworten erlaubt, aber keine der anderen vorzuziehen ist, um ein Problem, bei dem nicht Argumente, sondern nur noch Bekenntnisse eine Rolle spielen? Ganz so ist es nun doch nicht. Auch wo zwingende Beweise fehlen, kann es doch immerhin noch gute, überzeugende, einleuchtende, wirksame Argumente geben. Das gilt auch im Hinblick auf die Auseinandersetzungen zwischen Holismus und Reduktionismus. Was also spricht dafür, daß neue Systemeigenschaften erklärbar sind, was dagegen?
8. Ein Beispiel: der Schwingkreis Sind im Hinblick auf Holismus und Reduktionismus allgemeine Beweise nicht zur Verfügung und auch gar nicht zu erwarten, so gewinnen konkrete Beispiele an Gewicht. Im folgenden befassen wir uns mit dem Schwingkreis; er ist ein besonders beliebtes Beispiel für das Auftreten neuer Systemeigenschaften, für Emergenze Spule, Kondensator und Widerstand ergeben, richtig verdrahtet, ein System, in dem elektrische Schwingungen
Das Ganze und seine Teile
201
auftreten. In keinem der Teilsysteme allein ist das möglich; und auch andere Verschaltungen derselben Elemente liefern nicht notwendig einen solchen Schwingkreis. Der Schwingkreis ist deshalb ein so einleuchtendes Beispiel, weil er ein vergleichsweise einfaches System ist, das wir vollkommen durchschauen. Hier ist uns klar, daß und warum die Systemkomponenten allein noch kein Schwingungsverhalten zeigen können, in welchem Sinne also es sich beim "Schwingen" tatsächlich um ein neues Merkmal handelt. In einiger Ausführlichkeit und mit einer instruktiven Abbildung, die drei verschiedene Schaltkreise und die zugehörigen Spannungsverläufe wiedergibt, findet sich das Beispiel zuerst bei Hassenstein.26 Von ihm übernimmt Konrad Lorenz Text und Zeichnung27. Andere beschränken sich meistens unter Berufung auf Lorenz - auf eine kurze Schilderung des Sachverhalts.28 Ist das Schwingen als Systemeigenschaft erklärbar ? Hassenstein äußert sich zu dieser Frage nicht, scheint ihr sogar ganz bewußt aus dem Wege zu gehen.29 Lorenz betont zwar das absolut Neue des Schwingens, meint aber im gleichen Zusammenhang: "Dies besagt keineswegs, daß die höheren Systeme einer Analyse und natürlichen Erklärung nicht zugänglich seien. Nur darf der Forscher bei seinen analytischen Bestrebungen nie vergessen, daß die Eigenschaften und Gesetzlichkeiten des ganzen Systems ... jeweils aus den Eigenschaften und Gesetzlichkeiten jener Untersysteme erklärt werden müssen, die auf der nächst niedrigeren Integrationsebene liegen. Auch dies ist nur möglich, wenn man die Struktur kennt, in der sich die Untersysteme dieser Ebene zur höheren Einheit zusammenfügen. Unter Voraussetzungen einer restlosen Kenntnis dieser Struktur kann prinzipiell jedes lebende System, auch das höchststehende, in allen seinen Leistungen auf natürliche Weise ... erklärt werden."30 Tatsächlich gibt es für das Verhalten eines Schwingkreises nicht nur eine Beschreibung und eine Erklärung auf der Ebene des Gesamtsystems, etwa die Schwingungsgleichung mit ihren Lösungen für den Spulenstrom (bzw. für Spannung und Ladung des Kondensators), sondern auch eine Erklärung aus unserem Wissen über die Teilsysteme und die Art ihrer Verschaltung. Dazu muß man wissen, wie sich die Spannungen an den
202
Gerhard Vollmer
Bauteilen des Schwingkreises aus deren Kenngrößen (Widerstand R, Kapazität C, Selbstinduktion L) ermitteln lassen: Ohmscher Widerstand:
U\y = RI
(OhmschesGesetz)
Kondensator:
Uk = ç
(Definition der Kapazität C)
Spule
Us = L
(Definition der Selbstinduktion L).
Und an Systemwissen brauchen wir die zweite Kirchhoffsche Regel ("Maschenregel"), nach der in einem geschlossenen Stromkreis die Summe der Spannungen verschwindet: Us + Uw + Uk =0. (Diese Regel läßt sich ihrerseits natürlich auch aus den Maxwell-Gleichungen, den Grundgleichungen der Elektrodynamik, ableiten; aber wir wollen ja hier mit der geringstmöglichen Vorinformation auskommen.) Gliedweises Einsetzen ergibt dann
L§
+
RI+g = 0.
Differenzieren wir nun nach der Zeit t und berücksichtigen dabei, daß nach Definition die Stromstärke gerade die Ladungsänderung ist, I:= -j-jf, so erhalten wir T L
d 2 I _ dl 1 T „ Ht2 + R d F + C I = 0 '
und das ist gerade die Schwingungsgleichung. Sie zu lösen, bedarf es nun nur noch mathematischer Kenntnisse. Ihre Lösungen
in
V¿
R2 R I(t) = I ( t 0 ) e x p ( - s : ) s i n ^ L c ^
Das Ganze und seine Teile
203
beschreiben das Verhalten des Gesamtsystems vollständig: Es handelt sich um freie, aber gedämpfte elektrische Schwingungen. Auf Wunsch können wir noch eine äußere Spannungsquelle hinzufügen; wir bekommen dann erzwungene Schwingungen. Auch können wir statt mit der Kirchhoffschen Regel mit dem Energiesatz arbeiten und kommen auf dieselbe Gleichung.31 Dazu muß man nur wissen, welche Arten von Energie die einzelnen Systemteile enthalten (elektrische und magnetische Energie), daß sie untereinander Energie austauschen und daß dem Gesamtsystem (über die Joulesche Wärme) Energie verlorengeht. Gerade beim Schwingkreis, dem Paradebeispiel für Emergenz, ist es also durchaus möglich, das Auftreten elektrischer Schwingungen als einer neuen Systemeigenschaft aus dem Wissen über die Teilsysteme und ihre Verschaltung zu erklären. Natürlich reicht dazu das Wissen über die isolierten Teilsysteme noch nicht aus; es muß auch bekannt sein, wie diese miteinander verbunden sind. Insbesondere setzt die Anwendung der Kirchhoffschen Regel voraus, daß die Teile hintereinander geschaltet sind (so daß die Teilspannungen addiert werden dürfen) und daß es sich um einen geschlossenen Schaltkreis handelt (so daß sie sich zu Null addieren). Ganz ähnliche Voraussetzungen gelten auch für die Anwendbarkeit des Energiesatzes. Es ist also völlig richtig, daß das Ohmsche Gesetz für den Ohmschen Widerstand und seine Analoga für Spule und Kondensator allein noch nicht die Systemeigenschaft "Schwingen" liefern. Weiß man nicht, wie die Elemente miteinander verschaltet sind, so weiß man auch nicht, wie jene Einzelterme zusammengefügt werden müssen. In unserem Falle werden sie addiert; wählt man eine andere Schaltung - etwa Parallelschaltung - so müssen dieselben Einzelterme zu einer anderen Gleichung kombiniert werden. Für jede konkrete Wahl kann man dann aber auch das Verhalten des Gesamtsystems ermitteln bzw. erklären. Insbesondere ergeben sich, wenn man Spule und Kondensator parallel schaltet, andere Arten von Schwingkreisen, die in der Rundfunktechnik als Sperrkreise oder als Filter eine besondere Rolle spielen. Selbstverständlich hat ein einziges Beispiel, hat auch eine endliche Kette von Beispielen keine Beweiskraft. Was für den Schwingkreis nachweislich gilt, braucht schon für das nächste Beispiel nicht zu gelten. Es sollte uns jedoch zu denken geben, daß gerade der vielzitierte Prototyp für Emergenz eine vollständige Erklärung aus dem Wissen über die System-
204
Gerhard Vollmer
teile und ihre Verschaltung, also "von unten", durchaus zuläßt. In diesem Sinne wäre es auch lehrreich, weitere Beispiele wie den Thermostaten, die Saite oder die Geige zu studieren. Aus Platzgründen müssen wir darauf verzichten. Wir behalten jedoch im Auge, daß neue Systemeigenschaften mindestens manchmal von unten erklärt werden können. Die naheliegende Vermutung, die Neuheit einer Eigenschaft müsse auch schon ihre Unerklärbarkeit bedeuten, ist somit falsch. Sollte also jemand so weit gehen, die grundsätzliche Unerklärbarkeit emergenter Eigenschaften zu behaupten, so können wir ihn oder sie leicht widerlegen. Deshalb ist der Schwingkreis - ursprünglich ja nur ein Beispiel von vielen - argumentativ durchaus von Bedeutung. Außerdem haben wir gesehen, wie wichtig es ist, über die einzelnen Teilsysteme hinaus auch die Vernetzung der Bauteile zu kennen und zu berücksichtigen. Diese Einsicht ist natürlich nicht auf unser Beispiel beschränkt: Diamant, Graphit und Ruß haben ganz verschiedene Eigenschaften. Sie unterscheiden sich jedoch nicht durch ihre Bausteine (ausschließlich Kohlenstoff-A tome), sondern allein durch ihre Struktur, durch die Anordnung dieser Bausteine, durch die Vernetzung. Gerade solche Vernetzungen sind auch Gegenstand einiger jüngerer Disziplinen von hohem Allgemeinheitsgrad: Kybernetik, Systemtheorie, Komplexitätstheorie, Synergetik, Theorien der Selbstorganisation. Sie spielen für die Versuche, Systeme aus ihren Bausteinen zu verstehen, eine besondere Rolle; von ihrem Entwicklungsstand wird es deshalb abhängen, ob solche Versuche auch in Zukunft erfolgreich sein werden.
9. Ist Erklärbares immer auch schon voraussagbar? Zunächst könnte man vermuten, daß hier gar nichts wirklich Neues gefragt sei. Sind Erklärungen und Voraussagen logisch nicht völlig äquivalent? Wird nicht in beiden Fällen von Gesetzen, Rand- und Anfangsbedingungen auf Einzelereignisse geschlossen? Ist es dabei nicht unerheblich, ob das Ereignis in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegt? Nein, Erklärungen und Voraussagen sind nicht gleichwertig. Obwohl sie rein logisch dieselbe Struktur haben, sind sie doch forschungslogisch und
205
Das Ganze und seine Teile
damit auch wissenschaftstheoretisch durchaus verschieden. Betrachten wir zunächst ihre - übereinstimmende - logische Struktur: Gesetz(e) Rand- und Anfangsbedingungen ι
Prämissen
Explanandum / Prognoscendum
Konklusion
also
Gesetz(e), Rand- und Anfangsbedingungen bilden die Voraussetzungen, das zu erklärende oder vorauszusagende Ereignis (bzw. seine sprachliche Beschreibung) bildet die Konklusion eines (je nach Schlußart mehr oder weniger zwingenden) Schlusses. Bei der Erklärung ist die Konklusion jedoch bekannt, und nach geeigneten Prämissen wird gesucht; bei der Voraussage sind dagegen die Prämissen bekannt, gesucht wird nach einer (nach Möglichkeit empirisch prüfbaren) Konklusion. Bei der Suche nach Erklärungen müssen also ganz andere Strategien angewandt werden als bei Voraussagen. Zwischen Erklärung und Voraussage gibt es noch einen weiteren Unterschied: Für Voraussagen genügen oft schon einfache phänomenologische Regelmäßigkeiten, für Erklärungen nicht. So konnte Thaies von Milet für das Jahr 585 v. Chr. eine Sonnenfinsternis zwar durchaus richtig voraussagen; erklären aber konnte er sie nicht. Ähnlich ließ sich aus dem Periodensystem der chemischen Elemente das zunächst unbekannte Element Germanium mit seinen Eigenschaften voraussagen; damit waren jedoch seine Eigenschaften ebensowenig erklärt wie die der bereits bekannten Elemente. Für das Emergenzproblem spielt dieser Unterschied allerdings keine große Rolle, da phänomenologische Gesetze weder zur Erklärung noch zur Voraussage neuer Systemeigenschaften taugen. Uns geht es ja immer um die ontologisch "tiefere" Schicht der Systemteile, und darum genügen hier phänomenologische Gesetze auf der Ebene des Gesamtsystems gerade nicht. Voraussagen ist also in manchen Fällen leichter als Erklären; für das Auftreten neuer Systemeigenschaften gilt das jedoch nicht Insbesondere können in einer Erklärung alle Teile für sich bereits bekannt sein; gesucht ist dann eigentlich nur der kausale Zusammenhang zwischen den Tatsachen bzw. der logische Zusammenhang zwischen ihren sprachli-
206
Gerhard Vollmer
chen Beschreibungen. Tatsächlich versuchen wir ja oft, bekannte Tatsachen (etwa den Fall eines Apfels) auf bekannte Gesetze (etwa das Gravitationsgesetz) zurückzuführen. Das hat gelegentlich zu der falschen Meinung geführt, Erklärungen seien überhaupt immer Rückführungen auf Bekanntes. Das ist jedoch eine unzulässige Verallgemeinerung: Häufig genug gelingen Erklärungen erst und gerade dadurch, daß neue, bisher unbekannte Gesetze eingeführt werden. (So erklärt Newton den Fall des Apfels durch ein bis dahin unbekanntes, eben das Gravitationsgesetz.) Im allgemeinen ist es natürlich einfacher, zwischen bekannten Tatsachen einen Zusammenhang herzustellen, als (geeignete) neue Naturgesetze zu finden oder (geeignete) neue Rand- und Anfangsbedingungen zu formulieren. Deshalb gilt unsere Bewunderung ja in der Regel auch mehr denen, die Naturgesetze entdecken, als denen, die sie erfolgreich anwenden. Aus ähnlichen Gründen ist es im allgemeinen einfacher, eine Systemeigenschaft zu erklären, als sie vorauszusagen. Wer etwas erklärt, der weiß ja schon, worauf er hinaus will; er weiß, wie die Konklusion seiner Schlüsse auszusehen hat. Wer dagegen voraussagen will, der weiß das zunächst noch nicht. Und selbst die strengste formale Logik sagt einem nur, was man schließen darf, nicht, was man schließen muß. (Die Schlußregeln bilden einen Kalkül, keinen Algorithmus.) Hat man aber einmal eingesehen, daß zwischen Erklärung und Voraussage forschungslogisch (und deshalb auch methodisch-heuristisch) wichtige Unterschiede bestehen, dann wird man auch die Frage nach der Erklärbarkeit einer Systemeigenschaft nicht mehr mit ihrer Voraussagbarkeit gleichsetzen oder sie nach Belieben gegeneinander austauschen, wie das häufig geschieht. Ob sich eine Systemeigenschaft aus dem Wissen über die Teilsysteme voraussagen läßt, ist jedenfalls eine andere Frage als die Frage, ob sie sich, einmal entdeckt, daraus erklären läßt. Insbesondere könnte eine solche Eigenschaft erklärbar und doch nicht voraussagbar sein. Daß eine Systemeigenschaft nicht voraussagbar sei, ist also auch eine andere These als die ihrer Unerklärbarkeit. Als eine Variante des Holismus können wir deshalb auch die Behauptung ansehen, neue Systemeigenschaften seien nicht voraussagbar. Wir werden sie die dritte These des Holismus nennen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, daß diese These schwächer ist als die zweite holistische These: Voraussagbare Systemeigenschaften sind im allgemeinen auch erklärbar, aber nicht umgekehrt. Dagegen ist die zweite ho-
Das Ganze und seine Teile
207
listische These stärker als die erste. Unter diesem Aspekt wäre also auch eine andere Reihenfolge und Numerierung möglich. Die dritte holistische These besagt natürlich nicht, daß das Auftreten neuer Systemeigenschaften überhaupt unvoraussagbar sei. Im Gegenteil: Daß immer wieder neue Systemeigenschaften auftreten, das war ja - einschließlich seines Zukunftsaspektes - schon Inhalt der ersten holistischen These, die wir auch vollkommen akzeptiert haben. Hier geht es vielmehr um bestimmte Systemeigenschaften an bestimmten Systemen, die nicht voraussagbar sein sollen. Manchen Autoren dient die Nicht-Voraussagbarkeit sogar zur Definition oder zur partiellen Charakterisierung des Begriffs 'Emergenz'.32 Aber viel wichtiger als die Wahl der Terminologie ist natürlich auch hier die Frage nach der Richtigkeit der dritten holistischen These. Ihr wollen wir uns nun zuwenden.
10. Die dritte holistische These: Unvoraussagbarkeit Sind neue Systemeigenschaften wenigstens in einigen Fällen voraussagbar? Beginnen wir mit unserem Standardbeispiel, dem Schwingkreis. Die Herleitung in Abschnitt 8 hat gezeigt, daß das Schwingen nicht nur nachträglich erklärt, sondern auch vorausgesagt werden kann, wenn man die Verschaltung der Teilsysteme kennt. So sagt auch Konrad Lorenz ganz deutlich: "Ein sehr gescheiter Physiker hätte das voraussagen können, was da passiert."33 Ähnliches gilt für andere Beispiele wie den Thermostaten oder die schwingende Saite. (Von der Motivationsfrage, ob man sich, bevor man die Eigenschaften solcher Systeme kennt, überhaupt für sie interessiert, wird hier natürlich abgesehen.) Aber kann man auch voraussagen, ob sich die Teile jemals zu dem ins Auge gefaßten Gesamtsystem zusammenfinden werden? Einiges - etwa technische Systeme, zu denen der Schwingkreis gehört - kann man natürlich planen und gezielt herstellen. Andere Systeme und Ereignisse - etwa Sonnenfinsternisse - sind wenigstens determiniert und voraussagbar. In vielen weiteren Fällen, insbesondere bei indeterministischen und chaotischen Systemen, kann man dagegen nur abwarten, was wohl passieren
208
Gerhard Vollmer
wird. In diese Gruppe gehören viele Ereignisse der biologischen Evolution, vor allem die langfristigen. Es ist deshalb schwierig oder sogar ganz unmöglich vorauszusagen, welche neuen Systeme und Systemeigenschaften die Evolution hervorbringen wird. Der Grund dafür ist jedoch gar nicht, daß die Systemeigenschaften nicht aus dem Wissen über die Teilsysteme und über ihre Verschaltung ermittelt werden könnten. Der Grund ist vielmehr, daß wir nicht wissen, welche Teile zu welchen Gesamtsystemen zusammentreten werden! Zwar wissen wir, daß schrecklich viel passieren kann und daß davon einiges auch passieren wird. Welche der ungeheuer vielen Kombinationsmöglichkeiten jedoch verwirklicht werden, das wissen wir gerade nicht. In solchen Fällen können wir also allenfalls sagen: Falls die im einzelnen bekannten Teile sich zu diesem bestimmten Gesamtsystem zusammenfinden sollten, dann werden jene bestimmten Eigenschaften auftreten; sollten sie aber zu einem anderen System zusammentreten, dann werden sich ganz andere Eigenschaften ergeben; und sollten überhaupt nicht diese, sondern ganz andere Teilsysteme zusammenkommen, dann wird es noch einmal andere Eigenschaften geben; und so weiter. Selbst wenn wir also - unter stark idealisierenden Annahmen - für alle möglichen Kombinationen bekannter Teile die neuen Systemeigenschaften voraussagen könnten, wüßten wir doch immer noch nicht, welche dieser Kombinationen tatsächlich auftreten werden. Und deshalb wüßten wir eben auch dann noch nicht, welche der vielen möglichen neuen Systemeigenschaften wirklich entstehen werden. Daß wir den Gang der Evolution nicht voraussagen können, ist also kein tragfähiges Argument für die dritte holistische These: Unvoraussagbar sind gar nicht erst die neuen Systemeigenschaften, sondern schon die neuen Systeme selbst. Sind die Systeme jedoch einmal vorhanden, so kann man sie wenigstens nachträglich zu erklären versuchen. Tatsächlich - und eben deshalb - kann die Evolutionsbiologie viel mehr erklären als voraussagen. Soweit allerdings Zufallselemente für das Entstehen eines Systems maßgebend waren, werden auch die Erklärungen unvollständig bleiben: Zufällige Ereignisse haben keine Ursache, und wo es keine Ursache gibt, da gibt es auch keine kausale Erklärung. Aber auch dieses Erklärungs-Defizit beruht - wie das Voraussage-Defizit - nicht auf dem Auftreten neuer Systemeigenschaften, sondern auf dem zufallsbedingten Auftreten neuer Systeme.
Das Ganze und seine Teile
209
Erstaunlicherweise hat Konrad Lorenz diesen Zusammenhang nicht gesehen. Er betont zwar, am Gang der Evolution müsse vieles unerklärt bleiben (und spricht dabei im Anschluß an Max Hartmann von einem "nicht rationalisierbaren Rest"), sieht den Grund jedoch allein in der überwältigend großen Zahl der organismischen Merkmale und der zugehörigen Ursachenketten, die wir niemals vollständig verfolgen oder rekonstruieren könnten und deshalb aus Resignation Zufall nennten.34 Lorenz bleibt also letztlich Determinist, und hinter dem Begriff 'Zufall' verbirgt sich für ihn nichts weiter als Unkenntnis. In Wahrheit ist aber schon der hier zugrundegelegte Determinismus unhaltbar. Betrachten wir noch einmal unseren Scbwingkreis. Stellen wir gerade ihn ganz gezielt her, so können wir seine neuen Systemeigenschaften auch voraussagen. Nehmen wir aber einmal an, wir hätten eine größere Anzahl elektrischer Bauteile zur Verfügung, die völlig zufällig und in wechselnden Anzahlen miteinander kombiniert werden; dann können wir natürlich nicht mehr voraussagen, welche Systeme und welche neuen Systemeigenschaften entstehen werden. Immer noch möglich wären zwar hypothetische Aussagen der Art: Falls im Laufe unserer Versuche eine Spule, ein Kondensator und ein Ohmscher Widerstand zu einem geschlossenen Stromkreis zusammengeschaltet werden sollten, dann wird ein Schwingkreis mit der neuen Systemeigenschaft "Schwingen" entstehen. Aber ob diese Systemeigenschaft entstehen wird, gerade das wissen wir nicht. Und außerdem könnte es passieren, daß wir aus Mangel an Zeit oder an Phantasie gar nicht dazu kommen, diese spezielle Kombination auch auszuprobieren. Dieser Gesichtspunkt spielt eine um so größere Rolle, je größer die Zahl der möglichen Bauteile oder der möglichen Kombinationen wird. Jedoch scheitern wir offenbar gerade dann nicht an prinzipiellen Schranken, wie sie der Holist vermutet, sondern an praktischen Problemen. Fassen wir diese Überlegungen zusammen: Unserem Bemühen, neue Systemeigenschaften vorherzusagen, können sich verschiedene Hindernisse in den Weg stellen: a) mangelnde Kenntnis der Systemteile, b) mangelnde Kenntnis ihrer wechselseitigen Beziehungen, c) mangelnde Ableitungs-, insbesondere mangelnde logische und mathematische Fähigkeiten, d) mangelnde Voraussagbarkeit trotz deterministischen Verhaltens (deterministisches Chaos),
210
Gerhard Vollmer
e) konstitutive Rolle von Zufallsfaktoren, f) Mangel an Zeit, prinzipiell mögliche Ableitungen auch durchzuführen, g) Mangel an Einfallen für weitere mögliche Kombinationen. Keines dieser Kündernisse kann die dritte holistische These wirklich stützen: Die beiden ersten (a und b) widersprechen der Voraussetzung, daß die Teilsysteme mit ihrer Verschaltung vollständig bekannt sein sollen. Unsere Ableitungsfahigkeiten (c) könnten sich verbessern. Chaos (d) und Zufall (e) stellen zwar echte Hindernisse für Voraussagen dar. Das Spektrum der Eigenschaften eines chaotischen Systems ist aber durchaus bekannt; nur welche dieser Eigenschaften im Einzelfall angenommen wird, ist nicht voraussagbar. Zufällig und deshalb unvoraussagbar (nach e) sind schon die neuen Systeme und nicht erst ihre neuen Eigenschaften. Und schließlich gilt: Trotz Mangel an Zeit (f) oder Phantasie (g) könnten wir doch auch Glück haben und zufällig gerade die richtigen Kombinationen untersuchen und deren Eigenschaften korrekt voraussagen. Vieles ist uns unmöglich; aber nicht deshalb, weil der Holist recht hat.
11. Die vierte holistische These: Makro-Determination Unsere bisherigen Überlegungen bezogen sich hauptsächlich auf die holistische These, das Ganze sei mehr als die Summe seiner Teile, und auf ihre Deutungen. Während wir die erste Deutung (es gibt - immer wieder neue Systemeigenschaften) vorbehaltlos akzeptieren konnten, fanden sich für die weitergehenden Deutungen (neue Systemeigenschaften sind nicht erklärbar bzw. nicht voraussagbar) keine guten Argumente. Im Gegenteil: Versieht man diese Deutungen mit Allanspruch, so werden sie schon durch das Beispiel 'Schwingkreis' widerlegt. Nun kann man den Holismus aber auch noch anders charakterisieren. Ging es bisher darum, ob ein System aus seinen Teilen verstanden (erklärt, vorausgesagt) werden kann, so läßt sich darüber hinaus auch fragen, ob sogar ein Teil vielleicht nur aus dem Ganzen verstanden werden kann. Auch eine solche These wäre typisch holistisch, und wir wollen sie die vierte holistische These nennen. Zusätzlich zu der allgemein anerkannten Wirkmöglichkeit des Teils auf das Ganze, die Klee2 'Mikro-Determina-
Das Ganze und seine Teile
211
tion' nennt, gibt es nach dieser These auch noch Makro-Determination, eine Rückwirkung des Ganzen auf seine Teile. Ein typisches Beispiel diskutiert der Soziologe Emile Durkheim (18581917). Er unterscheidet und klassifiziert Kulturen danach, wie stark sie ihre Mitglieder normieren und integrieren. Und nun findet er, daß die Selbstmordrate zwar in verschiedenen Kulturen verschieden hoch, innerhalb eines bestimmten Kulturlos aber erstaunlich einheitlich ist. Er schließt daraus, daß die Kultur (das Ganze) einen starken Einfluß auf das Individuum (den Teil) ausübe. Handelte es sich dabei nur um eine abkürzende Redeweise, so wäre dagegen gar nichts einzuwenden. Gemeint ist aber offenbar mehr: ein kausaler Einfluß der Gesellschaft auf das Individuum. Und hier müssen wir eben doch Bedenken anmelden. Denn auch die Gesellschaft setzt sich aus Individuen zusammen, und diese Individuen begegnen immer nur anderen Individuen, niemals der Gesellschaft als Ganzer. Zwar ist es sinnvoll, für das Gesamtsystem (die "Kultur") einen Durchschnittswert (die Selbstmordrate) zu ermitteln. Aber der einzelne Freitod wird doch niemals durch "die Gesellschaft" bewirkt, sondern durch viele individuelle Ereignisse, Begegnungen, Erlebnisse, Personen.35 Es mag schwierig, unmöglich oder einfach nicht der Mühe wert sein, diese individuellen Ereignisse ausfindig zu machen. Sie aber sind die eigentlichen Ursachen, nicht die übergeordnete Einheit "Gesellschaft" oder das Gesamtsystem "Kultur". Durch eine bequeme Redeweise sollte man sich nicht dazu verführen lassen, neue kausale Zusammenhänge oder gar neue Arten von Kausalität zu postulieren. Gelegentlich spricht man in diesem Zusammenhang von Abwärts-Kausalität (downward causation). Eingeführt hat diesen Ausdruck Donald Campbell. 36 Sogar er selbst findet ihn eher 'ungeschickt' ('awkward'). Vor allem aber beschränkt er ihn ausdrücklich auf die Biologie und dort auf den Fall, daß wir mehrere Generationen zeitrafferartig übereinander projizieren. Es sieht dann nur so aus, als ob etwa das Verhalten des Individuums seinen Körperbau oder sogar seine eigenen Gene beeinflussen könne (die doch selbst das Verhalten erst ermöglichen oder bedingen). In Wahrheit ist es natürlich nur so, daß das Verhalten von Individuen einer früheren Generation über evolutive, insbesondere über selektive Prozesse körperliche Merkmale späterer Generationen beeinflußt.
212
Gerhard Vollmer
Campbells einschränkende Klarstellung hat jedoch seine Nachfolger nicht davor bewahrt, ihn gründlich mißzuverstehen und ganz allgemein von 'Abwärts-Kausalität' im Sinne der vierten holistischen These zu sprechen. Das tut etwa schon Popper17, wenn er diesen Begriff auf Beugungsgitter, Laser, Maser, Hologramme, Regelkreise, ja auf alle Werkzeuge und Maschinen ausdehnt. Verboten ist das nicht; aber es ist natürlich sehr irreführend, daß Popper sich dabei ausdrücklich auf Campbell beruft, ohne auf die entscheidenden Bedeutungsunterschiede auch nur hinzuweisen. Und viele andere machen es ihm nach. Festzuhalten bleibt, daß ein Systemteil, der mit vielen oder sogar mit allen anderen Teilen wechselwirkt, nicht außerdem noch mit dem Gesamtsystem wechselwirken kann. In diesem Sinne ist die vierte holistische These falsch.37 Gleichwohl kann es - wie bereits zugestanden - bequem sein, eine solche Redeweise zu benützen.
12. Die fünfte holistische These: All-Einheit Die These, ein Systemteil könne vom Gesamtsystem beeinflußt werden, läßt sich erweitern zu einer noch anspruchsvolleren Behauptung: Da letztlich alles mit allem zusammenhänge, müsse man, um das Einzelne verstehen zu können, auch das Ganze kennen. Diese Position geht mindestens auf Pascal zurück, vielleicht sogar bis auf Parmenides. "Das Wahre ist das 38
Ganze", sagt Hegel genau in diesem Sinne; Capra meint, die Welt müsse "als ein System untrennbarer, einander beeinflussender und sich ständig bewegender Komponenten" gesehen und könne auch nur so verstanden werden; und Moser39 charakterisiert das holistische Weltmodell ausdrücklich durch die These, alles sei "irgendwie" miteinander verbunden (und auch der Beobachter gehöre immer schon zum beobachteten System). Wir können diese Behauptung deshalb als eine weitere, als die fünfte holistische These ansehen (auch wenn nicht jeder Holist sie vertritt). Wäre diese These richtig, dann könnten wir letztlich überhaupt nichts wirklich erkennen. Denn das Ganze, "die Totalität", ist uns nicht zugänglich, und seine Teile könnten ja nur verstanden werden, wenn wir das Ganze bereits kennten. Denker wie Russell und Popper haben diese Form des Holismus scharfer Kritik unterworfen.40 Sie zeigen, daß ein Gesamtwissen im Sinne des Holismus nicht nur unerreichbar, sondern auch gar nicht nötig ist.
Das Ganze und seine Teile
213
Richtig bleibt natürlich, daß reale Systeme miteinander wechselwirken und daß kein System von allen anderen völlig isoliert ist oder isoliert werden kann. (Insbesondere zeigt die Quantenphysik, daß auf der Mikroebene unaufhebbare Verschränkungen existieren. Sie stützen - für einen gewissen Objektbereich - sogar eine gewisse Form des Holismus, wenn auch nicht die Totalitäts-Variante, um die es hier geht.) Und doch lassen sich Objekte wenigstens teilweise voneinander trennen und deshalb auch unterscheiden: Sie sind näherungsweise trennbar, quasi-separabel. Das genügt, um sie erkennbar zu machen (auch wenn es darüber kein sicheres Wissen geben kann). Wir könnten auch sagen: Alles hat unscharfe Grenzen, aber eben doch Grenzen in dem Sinne, daß Dichteverteilungen exponentiell abnehmen und natürliche Grenzen definiert werden können. So gibt es keine bestimmte Stelle, an der die Sonne, die Erdatmosphäre, ein Kontinent, ein Baum, ein Tisch, ein Atom zu Ende wäre. Und doch können wir die Sonne von ihrer Umgebung unterscheiden. Deshalb können wir sie auch wiedererkennen und als Gesamtsystem auffassen und untersuchen. Es gibt keinen Punkt und keine Linie im Regenbogen oder im Farbenkreis, wo die Farbe Rot zu Ende wäre oder die Farbe Grün begänne. Trotzdem können wir Rot und Grün sehr wohl unterscheiden und bei Bedarf auch jederzeit eine Grenze zwischen beiden festlegen, die allen pragmatischen Ansprüchen genügt. Voraussetzung für die Erkennbarkeit der Welt ist, wie wir gesehen haben, die Quasi-Separabilität der realen Systeme, und verantwortlich für diese Zerlegbarkeit der Welt ist die Tatsache, daß die verschiedenen Wechselwirkungen (Grundkräfte) in der Natur unterschiedliche Reichweiten und Stärken haben. Nur dadurch ist es möglich, daß einige Teile fester zusammenhalten als andere, daß es also so etwas wie Objektstabilität, Identität, Objektränder, Erkennen und Wiedererkennen gibt. Warum die Welt allerdings gerade so strukturiert ist, daß Stabilität und Erkennbarkeit möglich sind, soll hier nicht weiter diskutiert werden.41 Wir begnügen uns damit, gezeigt zu haben, daß und warum die All-Einheits-These des Holismus falsch ist.
214
Gerhard Vollmer
13. Die sechste holistische These: Reduktion aufs Komplexe In Abschnitt 7 hatten wir betont, daß Holismus und Reduktionismus unvereinbar, zum Teil sogar Antipoden seien. Gelegentlich findet sich bei Holisten aber auch eine Position, nach der Reduktionen durchaus möglich und erwünscht sind. Allerdings geht es dabei nicht um die sonst immer ins Auge gefaßte Reduktion auf Bestandteile, auf Einfaches, auf Unbelebtes, auf Physik, sondern um eine Reduktion auf das Ganze, auf Komplexes, auf Belebtes, Beseeltes oder gar Soziales.42 Auch hiernach ist es also weder möglich noch wünschenswert, Systeme aus ihren Bestandteilen zu erklären (bzw. vorauszusagen), was der Reduktionist ja gerade versucht. Trotzdem gibt es zwischen den verschiedenen Ebenen einen Ableitungszusammenhang, freilich nur in umgekehrter Richtung. Wir wollen diese wiederum nicht von allen Holisten vertretene - Behauptung die sechste holistische These nennen. Im Anschluß an Haidane hat etwa Adolf Meyer-Abich (damals noch A. Meyer) diese These ausführlich behandelt und verteidigt. Nicht nur den Mechanismus mit seiner reduktionistischen Haltung lehnt er ab, sondern auch den Vitalismus, für den physikalische und biologische Gesetzlichkeiten unabhängig und beziehungslos nebeneinander stehen. "Im Gegensatz zum Vitalismus glauben wir an einen bestehenden Ableitungszusammenhang zwischen biologischen und physikalischen Gesetzen und Prinzipien, und im Gegensatz zum Mechanismus sind wir überzeugt, daß wir die biologischen Gesetze und Prinzipien als die komplexeren keinesfalls aus den einfacheren physikalischen ableiten können. Dann bleibt uns als dritte Möglichkeit aber noch die Hoffnung, daß wir vielleicht umgekehrt die physikalischen Prinzipien und Gesetze aus den biologischen ableiten können."43 Danach könnte es also durchaus zu einer Vereinigung von Physik und Biologie kommen; jedoch würde die Biologie nicht zu einem besonders komplizierten Teilgebiet der Physik, sondern umgekehrt die Physik zu einem Teil der Biologie: Die Physik ginge dann aus der Biologie durch Projektion, durch Vereinfachung, durch "Simplifikation" hervor. Wie ein Farbbild über ein Schwarz-Weiß-Bild hinausgehe, so gehe auch die Biologie
Das Ganze und seine Teile
215
über die Physik hinaus, wobei sie die gesamte Physik enthalte, aber eben noch weitere Merkmale, Bestimmungsstücke, Gesetze berücksichtige. Es liegt nahe, diesen Ansatz auf andere Bereiche und damit auch auf weitere wissenschaftliche Disziplinen auszudehnen: Noch umfassender als die "Biosphäre" wären die "Psychosphäre" und erst recht die "Soziosphäre", so daß letztlich alles auf Soziologie zurückgeführt werden könnte oder sollte. Diese Thesen sind in einem trivialen Sinne wahr, in dem eigentlich gemeinten substantiellen Sinne aber unhaltbar. Richtig ist, daß die Gesetze einer "tieferen" Schicht - etwa der Physik - auf jeder "höheren" Schicht etwa für die Biologie - ihre Gültigkeit behalten. Im Anschluß an Nicolai Hartmann (1882-1950) spricht man in diesem Zusammenhang gern von der Permanenz der Naturgesetze. Deshalb finden sich einige Gesetze der Physik auch in der Biologie. Aber von der Geltung eines Naturgesetzes kann man natürlich nur dort sinnvoll reden, wo es anwendbar ist. Das Gravitationsgesetz sagt nur etwas über die Kraft zwischen zwei Massen, nicht jedoch über Ladungen. Auf Ladungen ist es nicht anwendbar, und deshalb wäre es sinnlos, nach seiner Geltung für Ladungen zu fragen. Da Tiere - neben vielen anderen Eigenschaften - auch Masse haben, ist das Gravitationsgesetz auch auf sie anwendbar, und die Permanenz der Naturgesetze verlangt dann, daß es für sie auch gilt. (Andernfalls wäre das Gravitationsgesetz in seiner üblichen universellen - Form nämlich falsch.) Dagegen sind Tiere weder elektrisch geladen noch magnetisch; deshalb ist weder das Coulomb- noch das Induktionsgesetz auf Tiere anwendbar, und die Frage, ob diese Gesetze auch für Tiere gelten, ist sinnlos. Daran scheitert dann aber auch die sechste holistische These. Physikalische Gesetze, die auf Lebewesen nicht einmal anwendbar sind, kommen gerade deshalb in der Biologie nicht vor und können deshalb auch nicht aus ihr gewonnen werden. Insbesondere spielen die starke und die schwache Wechselwirkung zwar für Atomkerne eine wichtige Rolle; doch schon für Moleküle und erst recht für Lebewesen sind sie völlig unerheblich. Deshalb tauchen sie in der Biologie gar nicht erst auf, und so können Kernphysik, Elementarteilchenphysik, Astrophysik oder gar Kosmologie in keiner Weise auf Biologie zurückgeführt werden.
216
Gerhard Vollmer
Für die "höheren" Ebenen der Psychologie und der Soziologie gilt dieser Einwand ebenfalls und erst recht. Die sechste holistische These ist also nicht haltbar. An ähnlichen Schwierigkeiten scheitern übrigens auch die - nicht-holistischen - Versuche, die Physik auf die Psychologie (über die Rolle der Beobachtung etwa auf Sinnesempfindungen) oder auf die Soziologie (etwa auf gesellschaftliche Verhältnisse oder auf Klasseninteressen) zurückzuführen.
14. Die siebte holistische These: heuristischer Wert Im Hinblick auf ihren Wahrheitsanspruch konnten wir den holistischen Thesen nicht viel abgewinnen. Haben sie vielleicht heuristischen Wert? Führen sie uns - ganz unabhängig von der Wahrheitsfrage - zu neuen Problemen, zu neuen Ideen, zu neuen Methoden, zu neuen Befunden? Diese Frage kann nicht abschließend beantwortet werden. Es gibt schließlich viele Wege zu guten Einfallen, und auch holistische Ansprüche könnten solche Wege weisen. Wie unsere Denker auf gute Ideen gekommen sind bzw. heute und in Zukunft noch kommen, das ist eine Frage der Wissenschaftsgeschichte (häufig von Anekdoten) bzw. der Wissenschaftspsychologie. Wir wünschen uns aber auch brauchbare Rezepte, heuristische Ratschläge, kreative Techniken. Kann der Holismus sie liefern? Hat er vielleicht schon welche vorgelegt oder entwickelt? Im Hinblick auf die Vergangenheit gewinnt man jedenfalls nicht den Eindruck, daß gerade holistische Ansätze irgendwo zu einer akzeptierten wissenschaftlichen Theorie geführt hätten. Auch die Befunde, die wenigstens in einem gewissen Sinne als Bestätigung holistischen Denkens interpretiert werden dürfen, wie die EPR-Korrelationen der Quantenphysik, sind Ergebnisse streng reduktionistischen Vorgehens. Der Reduktionismus hat nämlich diesen heuristischen Wert, nach dem wir beim Holismus suchen: Ausgehend von der Einheit der Natur, von ihrem evolutiven Gewordensein und vom Aufbau aller Systeme aus kleineren, führt er auf die methodologische Maxime, daß man unermüdlich versuchen sollte, Systeme aus ihren Teilen zu erklären. Dieser methodologische Reduktionismus ist unverzichtbar, ganz gleich, wie oft er zum Erfolg führt.
Das Ganze und seine Teile
217
Denn wenn Systeme aus ihren Teilen erklärt (auf ihre Bestandteile reduziert) werden können, dann werden wir das nur herausfinden, wenn wir es versuchen. Sind sie aber nicht reduzierbar, dann werden wir auch das nur in Erfahrung bringen, indem wir es hartnäckig probieren. Denn nur dann können wir feststellen, wo und warum diese Versuche scheitern. Der methodologische Reduktionismus als Forschungsmaxime ist also unentbehrlich. Sogar ein Holist muß ihm - zumindest zeitweise und immer wieder - folgen. Die Frage ist demnach nur, ob es gelegentlich sinnvoll sein kann, holistischen Erwartungen nachzugehen. Das wollen und können wir nicht prinzipiell ausschließen. Insbesondere mag es nützlich sein, gelegentlich über folgende Fragen nachzudenken: - Zeigt das fragliche System Eigenschaften, die seine Teile nicht zeigen? - Haben wir überhaupt genug Information über die Teilsysteme und über ihre Vernetzung, um eine Erklärung "von unten" angehen zu können? - Haben wir genügend logische und mathematische Hilfsmittel (Schlußwerkzeuge)? - Lohnt sich der Aufwand eines Erklärungsversuchs? - Spielen Zufallsfaktoren eine wesenüiche Rolle? (Das könnte Erklärungen erschweren.) - Handelt es sich um ein chaotisches System? (Dann könnte trotz ver meintlich zufälligen Verhaltens eine Erklärung doch noch gelingen.) - Haben wir vielleicht eine Wechselwirkung des Systems mit seiner Umgebung übersehen? - Haben wir eine bekannte Wechselwirkung des Systems mit seiner Umgebung irrtümlich für unwesentlich gehalten? - Gehört zu den beteiligten Systemen der Umgebung vielleicht der Beobachter selbst? Um diese Fragen sinnvoll zu finden, bedarf es allerdings keines holistischen Programms. Auch widersprechen sie dem Reduktionismus nicht. Aber vielleicht richten sie die Aufmerksamkeit auf Aspekte, die wir sonst leicht übersehen hätten. Und gute Ratschläge sind gut, woher sie auch kommen.
218
Gerhard Vollmer
15. Die achte holistische These: moralischer Wert Nicht unerwähnt bleiben soll schließlich der Anspruch des Holismus, eine moralisch bessere Position zu vertreten oder nahezulegen. Diesen Anspruch wollen wir die achte holistische These nennen. Hier ist zunächst einmal einzuräumen, daß der Holist aufgrund seiner "holistischen" Einstellung geneigt sein könnte, den Lebewesen einen höheren Rang zuzubilligen als den unbelebten Systemen bzw. ganz allgemein komplexere Systeme als wertvoller anzusehen. Deshalb könnte er sich dann auch leichter auf Naturschutz, auf Artenschutz, auf Umweltschutz, allgemein auf ökologisches Denken einlassen. Das macht ihn sympathisch für jemanden, der seinerseits an der Erhaltung der Menschheit in einer lebenswerten Zukunft interessiert ist und hofft, daß auch andere sich dafür einsetzen. So ist es kein Wunder, daß etwa Klaus Michael Meyer-Abich allein dem Holismus zutraut, die Ganzheit der Natur zu sehen und zu achten.44 Nur im Holismus werde bedacht, daß die Nichtachtung, die Gefährdung und die Zerstörung der Welt schon im herkömmlichen wissenschaftlichen Denken beginne. Dieses Denken sei darauf aus, die Dinge der Welt einschließlich der Lebewesen und des Menschen zu "entlarven": zu zeigen, daß Lebendiges nichts anderes sei als tote Materie, Kompliziertes nur eine Anhäufung von Einfachem, Höheres letztlich nur Niedriges und Primitives, Liebe nichts als Chemie. Dieser Zerstörung der Werte entspreche und folge die Zerstörung der Natur, wie wir sie heute erlebten. Deshalb gelte es heute mehr denn je, dem Belebten, dem Beseelten, dem Ganzen gerecht zu werden. Deshalb bedürfe nicht nur unser Forschen eines neuen (ganzheitlichen) Erkenntnisideals, sondern auch unser Handeln einer neuen (ganzheitlichen) Wertorientierung. Nun ließe sich über das Verhältnis von Erkennen und Handeln, von Wissen und Werten, von Sein und Sollen, von Fakten und Normen vieles sagen. Man müßte prüfen, ob das Erkenntnisideal neuzeitlicher Naturwissenschaft wirklich das "Entlarven", ob Erklären wirklich Wegerklären ist, ob Reduktion wirklich eine Herabstufung beabsichtigt oder bewirkt. Man müßte prüfen, ob mit der Analyse wirklich schon eine Entwertung verbunden ist und ob diese wirklich Mißachtung, Mißhandlung und Zerstörung nach sich zieht. Man müßte prüfen, ob die Schwierigkeiten, vor denen wir zweifellos stehen, wirklich durch das reduktionistische Denken
Das Ganze und seine Teile
219
hervorgerufen sind. Man müßte prüfen, ob der Holismus - wenigstens finden Umgang mit Natur und Mensch - eine mögliche, ob er gar die einzig mögliche Alternative bietet. Man müßte prüfen, ob diese Alternative wirklich so segensreich wäre, wie sie sich gibt, ob insbesondere in ihr nicht noch ganz andere, vielleicht sogar größere Gefahren lauern. All dies soll hier gar nicht erst versucht werden. Nur eines sei betont: So einfach sind die Zusammenhänge zwischen Erkennen und Werten nicht. Da aus dem Erkennen kein Werten, aus dem Sein kein Sollen folgt, darf man auch dem erfolgreichsten und hartnäckigsten Reduktionisten nicht unterstellen, er betreibe eine Entlarvung, eine Abwertung, eine Zerstörung seiner Erkenntnisgegenstände. Umgekehrt ist der Holist keineswegs dagegen gefeit, die Objekte seiner Forschung geringzuachten, zu gefährden oder zu vernichten. Es wäre deshalb unfair, die Übervölkerung der Erde, die ökologische Krise oder die nuklearen Risiken einfach dem analytischen Denken anzulasten. Die strenge Trennung von Fakten und Normen, auf der wir hier bestehen, hat eine weitere wichtige Konsequenz. Selbst wenn der Holismus tatsächlich in moralischer Hinsicht allen anderen Positionen überlegen wäre, würde daraus über die Wahrheit seiner ontologischen, erkenntnistheoretischen, methodologischen Thesen doch noch überhaupt nichts folgen. Eine moralische Bewertung kann eben nicht über die Wahrheit irgendeiner faktischen Behauptung entscheiden. Die achte holistische These, über deren Berechtigung wir hier nicht urteilen wollen, hat also keinen Einfluß auf die Wahrheit der übrigen Thesen. Sehr wohl gilt allerdings die Umkehrung. Soweit sich die Thesen 2 bis 7 als verfehlt erweisen, hat das auch Einfluß auf die These 8: Der vermeintlichen Sonderstellung der Ganzheiten wird dadurch der Boden entzogen. Man mag das - aus moralischen oder aus anderen Gründen - bedauern. Es gibt jedoch noch andere Wege, an das Verantwortungsgefühl unserer Mitmenschen zu appellieren. Wenn sich Reduktionisten und Holisten in diesem Bemühen treffen - um so besser.
220
Gerhard Vollmer
Anmerkungen 1 Genannt, aber nicht durchweg empfohlen, seien hier einige Bücher, zum Teil mit bezeichnenden Untertiteln: D. Böhm: Wholeness and the implicate order. Routledge & Kegan Paul, London 1980 (dt. Die implizite Ordnung. Grundlagen eines dynamischen Holismus. Dianus-Trikont, München 1985). - F. Capra: The Tao of physics. Berkeley 1975. (dt. Das Tao der Physik. Scherz, Bern 1977, auch unter dem Titel: Der kosmische Reigen. Barth, Bern 1980) und andere Bücher von Capra. - F. Moser: Bewußtsein in Raum und Zeit. Die Grundlagen einer holistischen Weltauffassung auf wissenschaftlicher Basis. Leykam, Graz 1989. Dieses Buch hat den Vorzug, daß es die Aspekte aus Physik, Biologie und Psychologie, die - nach Meinung des Autors - für ein ganzheitliches Weltbild sprechen, übersichtlich zusammenstellt. - K. Wilber (Hrsg.): Das holographische Weltbild. Wissenschaft und Forschung auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Weltverständnis Erkenntnisse der Avantgarde der Naturwissenschaftler. Scherz, Bern 1986 (engl. 1982). - In Wien gibt es sogar eine Gesellschaft für Ganzheitsforschung, seit 1957 mit einer eigenen "Zeitschrift für Ganzheitsforschung" 2 Nach J. Schurz: Das Gehirn als System. Naturwiss. Rundschau 42 (Sept. 1989) 345-353, dort S. 345. - Dieser Aufsatz ist lesenswert: Er enthält Details, die man sonst nicht leicht findet. Worin jedoch die systemtheoretischen Aspekte der Betrachtung bestehen sollen, bleibt unerfindlich. Von "Ganzheit" ist - nach dem einleitenden Zitat - nie wieder die Rede; sie spielt überhaupt keine Rolle. Systeme, selbst Organismen und ganze menschliche Gehirne, sind auch hier nichts weiter als komplizierte Maschinen. Der ganze Ansatz liefert ein glänzendes Beispiel für erfolgreichen Reduktionismus und damit Argumente zu dessen Verteidigung. 3 So sieht es zum Beispiel Konrad Lorenz in seinem Aufsatz "Ganzheit und Teil in der tierischen und menschlichen Gemeinschaft" (1950), abgedruckt in: Ders., Über tierisches und menschliches Verhalten. Band II, Piper, München 1965, S. 114-200, dortS. 114. 4 Zu diesen und weiteren Forderungen etwa H. Schaefer/E. Sturm (Hrsg.): Der kranke Mensch. Springer, Berlin 1986, mit zahlreichen Beiträgen in ganzheitlicher Richtung. 5 Mehr Information bieten W. Witte: Zur Geschichte des psychologischen Ganzheitsund Gestaltbegriffes. Studium Generale 5 (1952) 455-4W. - Th. Herrmann: Problem und Begriff der Ganzheit in der Psychologie. Rohrer, Wien 1957. 6 H. v. Ditfurth: Kinder des Weltalls. Der Roman unserer Existenz. Hoffmann und Campe, Hamburg 1970 (auch dtv), S. 296. 7 So bietet etwa Leibniz in seinen "Metaphysischen Anfangsgründen der Mathematik" Definitionen für Teil' und 'Ganzes'; daraus beweist er dann leicht, daß das Ganze größer ist als der Teil. Vgl. G. W. Leibniz: Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie. Band I, Meiner, Hamburg 1904 , 3. Auflage 1966, S. 56f. 8 Von der Problematik der speziell-relativistischen Energie-Masse-Äquivalenz, aufgrund deren ein gebundenes System - etwa ein Atomkern - dann doch nicht genau die Masse hat, die sich aus der Addition der Massen seiner Teile ergibt, wollen wir hier aus Einfachheitsgründen absehen.
Das Ganze und seine Teile
221
9 G. H. Lewes: Problems of life and mind. London. Vol.II, 1875, p. 412. - C. L. Morgan: Emergent evolution. Williams and Norgate, London 1923, p.2ff. - Bunge nennt resultierende Eigenschaften auch 'hereditary', also 'erblich', in: M. Bunge: Emergence and the mind. Neuroscience 2 (1977) 501-9, dort p.502. 10 K. Lorenz: Nichts ist schon dagewesen. In: R. Riedl/F. Kreuzer (Hrsg.): Evolution und Menschenbild. Hoffmann und Campe, Hamburg 1983, S. 138. - K. R. Popper/ K. Lorenz: Die Zukunft ist offen. Piper, München 1985, S. 43. 11 J. R. Platt: Properties of large molecules that go beyond the properties of their chemical sub-groups. J. Theor. Biology 1 (1961) 342-358. 12 F. Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft ("Anti-Dühring", 1878). Marx - Engels - Werke, Band 20, Dietz, Berlin 1978, S. 120. Zitiert nach H. Schriefers: Glanz und Elend des Reduktionismus. Die medizinische Welt 34 (1983) 2-8, dort S. 6. 13 K. Lorenz: Die Rückseite des Spiegels. Piper, München 1973, S. 47. 14 H. Schriefers: Was ist Leben? Schattauer, Stuttgart 1982, S.131,137. 15 So zum Beispiel P. H. Gosse: Omphalos. John van Voorst, London 1857,S. 123-5, 345-353. Nach Seite 352 könnte die Schöpfung im Prinzip sogar 1857, also im Erscheinungsjahr des Buches, stattgefunden haben. 16 A. Locker, in: Paderborner Studien, Heft 3/4 (1981) S. 102. 17 Etwa in K. R. Popper/J. C. Eccles: Das Ich und sein Gehirn. Piper, München 1982 (engl. 1977), Kap. PI, Abschnitte 7 und 8. 18 Eine Übersicht über den Panpsychismus und seine Vertreter geben L. u. H. Sprung und H. Hildebrandt, in: J. Ritter/K. Gründer (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 7. Schwabe, Basel 1989, Sp. 50-53. - Panpsychist in einem etwas anderen Sinne ist auch J. Charon: Der Geist der Materie. Zsolnay, Wien 1979 (frz. 1977). 19 Etwa in B. Rensch: Biophilosophie auf erkenntnistheoretischer Grundlage. G. Fischer, Stuttgart 1968, S. 238f. 20 M. Eigen in: Schicksal? Grenzen der Machbarkeit. Ein Symposium [der Carl Friedrich von Siemens Stiftung], Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1977, S. 189. 21 Auch zu dieser "Regel" gibt es die bestätigende Ausnahme: J. J. C. Smart: Philosophy and scientific realism. Routledge & Kegan Paul, London 1963, S. 50: "Unter einem emergenten Gesetz verstehe ich eines, das sich auf einen komplexen Gegenstand bezieht, das aber aus dessen einfachen Teilen prinzipiell nicht erklärt werden kann. Für mich ist es wichtig, die Existenz solcher emergenter Gesetze zu bestreiten, da es eine zentrale These dieses Buches ist, daß Tiere und Menschen sehr komplizierte Mechanismen sind." 22 H. Schriefers, vgl.Anm.14, S. 136-7. 23 C. G. Hempel: Aspects of scientific explanation. Free Press, New York 1965, p. 259. 24 So etwa M. Bunge, vgl. Anm.9, p. 502. - R.L. Klee: Micro-determinism and concepts of emergence. Philosophy of Science 51 (1984) 44-63, unterscheidet vier
222
Gerhard Vollmer
verschiedene Emergenzbegriffe und nennt dabei als Vertreter der "NeuheitsEmergenz" Causey, Kekes, Schievella, Platt und Lloyd Morgan. - In diesem Zusammenhang mag es interessant sein festzustellen, daß Ernst Mayr einen ganzen Aufsatz "The emergence of evolutionary novelties" schreibt (in: S. Tax (ed.): Evolution after Darwin. Vol.1. University of Chicago Press, Chicago 1960, S. 349380), ohne Tìmergenz' auch nur andeutungsweise zu definieren. Das holt er dann allerdings nach in E. Mayr: Die Entwicklung der biologischen Gedankenwelt. Springer, Berlin 1984, S. 52. 25 Andere Erklärungsbegriffe sind denkbar, und es könnte sein, daß man mit ihnen zu anderen Lösungen des Emergenzproblems kommt. Solche Altemativmodelle werden hier nicht diskutiert. 26 B. Hassenstein: Kybernetik und biologische Forschung. In: F. Gessner (Hrsg.): Handbuch der Biologie. Band I, Akad. Verlagsgesellschaft Athenaion, Frankfurt 1966, S. 629-719; dort Seite 635-6. - Ders. (ohne Abbildung): Element und System - geschlossene und offene Systeme. In: R. Kurzrock (Hrsg.): Systemtheorie. Colloquium-Verlag, Berlin 1972, S. 29-38, dort S. 36. 27 K. Lorenz, vgl. Anm.13, S. 48-50. - Ders.: Vergleichende Verhaltensforschung. Grundlagen der Ethologie. Springer, Wien 1978, S. 18; dtv, München 1982, S. 35. - K. Lorenz/F. Kreuzer: Leben ist Lernen. Piper, München 1981, S. 34-36. 28 Etwa G. Vollmer: Evolutionäre Erkenntnistheorie. Hirzel, Stuttgart 1975/1990, S. 82. - P. Hoyningen-Huene: Zu Problemen des Reduktionismus der Biologie, Philosophia Naturalis 22 (1985) 271-286, dort S. 283. - B.-O. Küppers, in: Ders. (Hrsg.): Leben = Physik + Chemie? Piper, München 1987, S. 24. 29 An anderer Stelle und im Hinblick auf andere Beispiele sagt Hassenstein jedoch ausdrücklich: "Die Systemerscheinungen lassen sich aus den Eigenschaften der Elemente und aus den Besonderheiten ihres Zusammenwirkens restlos ableiten." In: D. Todt (Hrsg.): Funk-Kolleg Biologie. Fischer-Taschenbuch, Frankfurt 1976, Band 1, S. 53. 30 Lorenz, vgl. Anm.13, S. 53f. 31 Beide Ableitungen der Schwingungsgleichung finden sich etwa in: H. Franke (Hrsg.): Lexikon der Physik. Franckh, Stuttgart 1969 (zeitweise auch dtv, München 1971) unter 'Schwingungen'. 32 Typische Vertreter einer solchen "Unvoraussagbarkeits-Emergenz" sind Gestaltpsychologen, etwa Wolfgang Köhler, und Philosophen wie Lewes (1875, vgl. Anm.9), C.D. Broad, Morgan (1923, vgl. Anm.9, p.5f.), E. Nagel, (The structure of science. Routledge & Kegan Paul, London 1961, p. 367), Popper (vgl. Anm.17). 33 In Lorenz/Kreuzer, vgl. Anm.27, S. 35. 34 Lorenz, vgl. Anm.13, S. 54f. 35 In den Sozialwissenschaften nennt man diese Position, nach der auch gesellschaftliche Phänomene durch das Zusammenwirken von Individuen Zustandekommen und daraus erklärt werden sollten, methodologischen Individualismus. Sie wendet sich gegen den methodologischen Kollektivismus und damit offenbar gegen jede Form von Sozial-Holismus. Vgl. K.R. Popper: Das Elend des Historizismus. Mohr, Tübingen 1971, S.106f. (engl. 1957).
Das Ganze und seine Teile
223
36 D.T. Campbell: 'Downward causation' in hierarchically organized biological systems. In: F.J. Ayala/T. Dobzhansky (eds.): Studies in the philosophy of biology. Reduction and related problems. Macmillan, London 1974, S. 179-186. 37 Klee, vgl. Anm.24, meint deshalb, alle vermeintliche Makro-Determination müsse sich letztlich auf Mikro-Determination zurückführen lassen. 38 Capra, vgl. Anm.l, S. 22. 39 Moser, vgl. Anm.l, S. 27, 104. 40 Kritik an Hegels Ganzheitsphilosophie übt B. Russell: Philosophie des Abendlandes. Europa, Zürich 1950, Wien 1975, S. 752-4 (engl. 1946). - Den Holismus vieler Sozialwissenschaftler kritisiert Popper, vgl. Anm.17, S. 61-66. Eine jüngere Kritik bietet E. Scheibe: Ganzheitsaspekte in Philosophie und Wissenschaft. Jahrbuch der Akad. d. Wiss. in Göttingen, 1987. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1988, S.39-54, dort S. 42f. 41 F. Hund: Die Begreifbarkeit der Natur. Naturwissenschaften 44 (1957) 460-3, dort S.461. - G. Vollmer: Die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung. In: G. Pasternack (Hrsg.): Philosophie und Wissenschaft: Das Problem des Apriorismus. Lang, Frankfurt 1987, S. 219-243, dort S. 239f. 42 Eine umsichtige und eher neutrale Darstellung dieser Position gibt K.M. MeyerAbich: Holismus - Philosophie der ökologischen Erneuerung. Scheidewege 17 (1987) 81-105, dort S. 92-95. 43 A. Meyer(-Abich): Ideen und Ideale der biologischen Erkenntnis - Beiträge zur Theorie und Geschichte der biologischen Ideologien. Leipzig 1934, S. 35. 44 So steht denn auch der zweite Abschnitt von Meyer-Abich, vgl.Anm.42, unter dem Titel "Die Ganzheit der Natur und die Achtung vor der Welt". - Ganz ähnlich meint Günter Altner, wer natürliche Systeme als offene Systeme anerkenne, werde sie weniger leicht zerstören. G. Altner: Wie göttlich ist die Natur? In G. Fuchs (Hrsg.): Mensch und Natur. Auf der Suche nach der verlorenen Einheit. Knecht, Frankfurt 1989, 81-102, dort S.95.
Chaos und Selbstorganisation als medizinische Paradigmen* Klaus Mainzer
Vorwort Die Medizin bezieht sich auf ein komplexes Wissen vieler Disziplinen, die sich mit dem menschlichen Leben beschäftigen. Sie ist daher e int fachübergreifende und interdisziplinäre Wissenschaft, die von den Naturwissenschaften (z.B. Physik, Chemie, Biologie) über klinische Spezialgebiete einzelner menschlicher Organe (z.B. Kardiologie, Neurologie) bis zu den Geisteswissenschaften (z.B. Psychosomatische Medizin) und Sozialwissenschaften (z.B. Sozialmedizin) reicht. In ihrer Geschichte waren verschiedene Paradigmen vorherrschend, auf die man die komplexen Aspekte des menschlichen Lebens von Gesundheit und Krankheit zurückführen wollte. Häufig standen sich dabei organisch-ganzheitliche und mechanistisch-atomistische Vorstellungen unversöhnlich gegenüber. Noch heute brechen diese Gegensätze auf, wenn angeblich die Schulmedizin mit ihrem naturwissenschaftlichen Spezialwissen bei komplexen Krankheitsbildern versagt. Man therapiere, so lautet dann der Vorwurf, nur an einzelnen Teilen des Körpers und verliere die leib-seelische Ganzheit aus den Augen: C. P. Snow's "Two Cultures" also auch in der Medizin!1 Im folgenden soll gezeigt werden, daß ganzheitlich-funktionale Vorstellungen für die modernen Naturwissenschaften keine Gegensätze sind. Die Theorie komplexer dynamischer Systeme, deren Anwendungsgebiet heute von der Laser-Physik über Chemie, Biologie und Ökologie bis zur Soziologie und Ökonomie reicht, tritt überall dort auf, wo komplexe Vernetzungen und Wechselwirkungen das Verhalten eines Gesamtsystems bestimmen - von den komplexen Wechselwirkungen der Himmelskörper
226
Klaus Mainzer
und Elementarteilchen bis zu ökologischen Populationen und menschlichen Gesellschaftssystemen. Für die komplexen Wechselwirkungen des menschlichen Organismus bietet sich diese Theorie also geradezu an. Insbesondere werden die Selbstorganisationsprozesse, die in der Evolution ebenso wie im menschlichen Organismus ständig ablaufen, nun analysierbar und bilden keine Gegensätze zu naturwissenschaftlichen Erklärungsansätzen, wie in der Wissenschafts- und Philosophiegeschichte lange geglaubt wurde. Von besonderem Interesse sind dabei die Phasenübergänge, die zu chaotischen Systemzuständen führen. Mathematisch werden komplexe Wechselwirkungen durch nicht-lineare Gleichungssysteme beschrieben, die Selbstorganisationsprozesse von Systemen als Phasenübergänge unter bestimmten Nebenbedingungen erfassen. Mit der modernen Computertechnik eröffnen sich neue Möglichkeiten der Lösungsabschätzung solcher Gleichungen zur Simulation von Selbstorganisation. Der "Newton des Grashalms", von dem Kant noch sprach, ist also für die Biowissenschaften gefunden. Dennoch wird sich ein einseitiger Reduktionismus als Illusion erweisen. Am Beispiel der Kardiologie und Neurologie sollen zwei erfolgreiche medizinische Anwendungen der Theorie komplexer dynamischer Systeme besprochen werden. Computersimulationen analysieren komplexe physiologische und molekulare Abläufe, liefern Erklärungen für alte und neue Krankheitsbilder, entwerfen komplexe Makromoleküle für die pharmakologische Therapie und das technische Design erforderlicher medizinischer Geräte. Gleichwohl zeichnen sich Grenzen dieses neuen Paradigmas ab. Im wissenschaftstheoretischen Ausblick geht es um die Frage, in welchem Maß der alte Gegensatz von Reduktionismus und Holismus des Lebens durch die Theorie komplexer dynamischer System eingelöst wird. Daher soll zunächst an die historischen Vorstellungen erinnert werden, die in der Philosophie des Lebens mit Selbstorganisationsprozessen verbunden wurden.
1.
Chaos und Selbstorganisation in der Philosophie des Lebens2
Das alte vorwissenschaftliche Natur- und Lebensverständnis weist viele Aspekte auf, die in heutigen organisch- bzw. ökologisch-ganzheitlichen
Chaos und Selbstorganisation
227
Überlegungen zum Lebensbegriff herausgestellt werden. So wird in frühen mythischen Deutungen betont, daß Leben sich in zyklischen Kreisläufen des Wachsens und Vergehens, von Geburt und Tod vollzieht und daß nur deijenige überlebt, der sich im Einklang mit den großen Naturzyklen befindet. Harmonie bedeutet danach Leben, Chaos Tod. Die vertrauten physiologischen Abläufe gelten als nicht weiter reduzierbar und erklärungsbedürftig. Aristoteles lehnte daher den Demokritschen Atomismus und die pythagoreische Mathematisierung für Lebensvorgänge als spekulativ ab. Leben zeichnet sich nach Aristoteles vielmehr durch die Tätigkeit zur Selbstbewegung aus, ohne von außen (wie bei mechanischen Vorgängen) angestoßen zu werden. Leben bedeutet in diesem Sinn "eine Seele besitzen", die wiederum als organisierende Kraft (Entelechie) der Materie verstanden wird. Die Selbstorganisation des Lebens, so könnte man modem sagen, wird nach Aristoteles durch Ziele und Zwecke funktional gesteuert (Teleologie). So wachsen Tiere und Pflanzen aus Föten und Samen zu dem Zweck, um ihre endgültige Gestalt und Funktion ("Form") entfalten zu können. Eine solche organische Einstellung zum Leben hat praktische Folgen in der Medizin. So lehrt später Galenus, der Leibarzt des Kaisers Marc Aurel, im Sinne aristotelischer Teleologie, daß Körperorgane vollkommen ihren Funktionen angepaßt seien. Als Beispiel wird das Verdauungssystem angeführt, das den "nützlichen" Teil der Nahrung verdaue, in das Blut absorbiere und die Abfallprodukte zurücklasse. Das Leben erfordert daher gesunde Ernährung, d. h. aristotelisch, im Einklang und im Maß mit den Funktionen des Organismus. Im Mittelalter verbindet Albertus Magnus die aristotelische Lebensauffassung mit dem Christentum. Im Mittelpunkt seines biologischen und medizinischen Denkens steht der Mensch als leib-seelische Ganzheit. Alberts therapeutische Empfehlungen für ein harmonisches Wohlbefinden des Menschen reichen von einer geregelten Ernährung bis zu einer gesunden Umwelt. Im Zeitalter Decartes' und Newtons werden Geometrie und Mechanik zum Vorbild der Naturwissenschaften. In der Wissenschaftsgeschichte spricht man deshalb auch im 17. und 18. Jh. von einer Mechanisierung des Weltbildes. Auch die Physiologie der Lebensvorgänge sollte nun mechanisch erklärt werden. So verändert Descartes die Hypothese von Harveys
228
Klaus Mainzer
Blutkreislauf, um das Herz als Pumpmaschine einsetzen zu können. Allgemein stellte Descartes vom tierischen und menschlichen Körper fest, daß sich sein Mechanismus allein aus der Einrichtung der Organe ergibt und zwar "mit der gleichen Notwendigkeit wie der Mechanismus einer Uhr aus der Kraftlage und Gestalt ihrer Gewichte und Räder folgt."3 Ende des 18.Jahrhunderts trägt Kant seine Kritik des mechanistischen Rationalismus vor, indem er die beschränkte Anwendbarkeit des Maschinenbegriffs in der Biologie nachweist. Der Maschinenbegriff ist nämlich im 18. Jahrhundert nur im Sinne der Mechanik präzisiert und kennt nach Kant "lediglich bewegende Kraft" und keine "bildende" und "organisierende Kraft".4 Andererseits lehnt Kant auch die aristotelische Teleologie ab und läßt die Rede von "Zwecken" im Organismus nur als Analogie und anthropomorphe Redeweise zu. Entscheidend sei vielmehr, daß ein Organismus als ein Produkt der Natur als ein "sich selbst organisierendes Wesen" zu verstehen sei. Auf dem Hintergrund von Kants Kritik am mechanistischen Weltbild entsteht Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland eine romantische Naturphilosophie, in der wieder von "beseelten Organismen" gesprochen wird. F. W. J. Schelling entwirft eine "Wissenschaft vom Lebendigen", in der er Organisation und Reproduktion als Kennzeichen des Lebendigen herausstellt 5 So modern uns heute die Grundbegriffe der Selbstorganisation und Selbstreproduktion anmuten, so bleiben sie damals Spekulation, bestenfalls geniale Intuition, da eine entsprechende experimentell-naturwissenschaftliche Basis fehlt. Darwins Lehre von der Entwicklung der biologischen Arten durch natürliche Zuchtauswahl schien die Annahme von zielgerichteten (teleologischen) Kräften der belebten Natur überflüssig zu machen. Eine Ausweitung der Evolution des Lebens vom Einzeller bis zum Menschen trägt in der zweiten Hälfte des 19. Jh. E. Haeckel vor. Dampfmaschine und Elektromotor, Photosynthèse und chemische Energieumwandlung bilden die neuen naturwissenschaftlichen Paradigmen, um Lebensprozesse im menschlichen Organismus zu begreifen. Um die Jahrhundertwende entwarf L. Boltzmann ein reduktionistisches Gesamtbild des Lebens, das auf der Evolutionstheorie, der Thermodynamik und dem übrigen physikalischen und chemischen Wissen des 19. Jahrhunderts gründet und in vielem bereits unser heutiges naturwissenschaftliches Bild des Lebens vorwegnimmt. Wie ist es möglich, daß in
Chaos und Selbstorganisation
229
einer Natur, die nach dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik auf Unordnung, Tod und Zerfall programmiert scheint, die Evolution des Lebens zu immer komplexeren Ordnungs- und Lebenssystemen stürmt? Boltzmann gibt Erklärungen, die bereits moderne biochemische Grundbegriffe der molekularen Selbstvermehrung (Autokatalyse) und des Energie- und Stoffwechsels (Metabolismus) vorwegnehmen. Er verlängert die Evolutionstheorie bis zur komplexen stammesgeschichtlichen Entwicklung des Nervensystems und der damit verbundenen Entstehung von Gedächtnis und Bewußtsein. Das Gehirn sei ein "Apparat" bzw. "Organ zur Herstellung der Weltbilder, welches sich wegen der großen Nützlichkeit dieser Weltbilder für die Erhaltung der Art entsprechend der Darwinschen Theorie beim Menschen geradeso zur besonderen Vollkommenheit ausbildete, wie bei der Giraffe der Hals, beim Storch der Schnabel zu ungewöhnlicher Länge."6 Der menschliche Organismus zeichnet sich als System physikalischer und biochemischer Umwandlungs- und Entwicklungsprozesse ab. Ein reduktionistisches Erklärungsmodell für die Entstehung und Entwicklung von Leben liefert Boltzmann allerdings nicht. Er ist also noch nicht der "Newton des Grashalms", geschweige denn der "Newton des menschlichen Organismus" oder der "Newton des menschlichen Bewußtseins". Aber er deutet naturwissenschaftliche Bedingungen an, unter denen die Selbstorganisationsprozesse des Lebens erklärbar werden.
2. Chaos und Selbstorganisation in Physik, Chemie und Biologie Die Thermodynamik des 19.Jahrhunderts zeichnet zwar nach dem 2. Hauptsatz irreversible Prozesse aus, wonach abgeschlossene Systeme einen Zustand maximaler Entropie bzw. Unordnung, also des Zerfalls anstreben. Wie ist aber dann die Entstehung und Entwicklung von komplexen Ordnungssystemen lebender Organismen zu verstehen? Im Sinne der statistischen Interpretation Boltzmanns kann es sich nur um ein unwahrscheinliches Ereignis handeln - eine kosmische Fluktuation, die lokal, "am Rande des Universums" (wie später noch J. Monod sagen wird) ausgelöst wurde und für den globalen Zustand des Kosmos keine Rolle spielt.
230
Klaus Mainzer
Streng genommen ist der 2. Hauptsatz der Thermodynamik jedoch auf Lebensprozesse nicht anwendbar. Lebende Systeme sind nämlich Beispiele für offene Systeme, die sich durch ständigen Stoff- und Energieaustausch mit ihrer Umgebung (Metabolismus) vom thermischen Gleichgewicht und dem damit verbundenen Zerfall möglichst fernhalten. Die Thermodynamik nach Boltzmann ist auf solche Gleichgewichtssituationen fixiert. Leben vollzieht sich aber offenbar fern des thermischen Gleichgewichts. Eine mathematische und physikalische Thermodynamik des NichtGleichgewichts liegt erst seit einigen Jahren vor (I. Prigogine, H. Haken u.a.). 7 Danach sind viele Phänomene, wie z.B. Selbstorganisation, Metabolismus, Spontaneität, Emergenz neuer Eigenschaften, Gestalt usw., die historisch als irreduzible Eigenschaften lebender Organismen angeführt wurden, bereits auf physikalischer und chemischer Ebene nachweisbar und erklärbar. Fern des thermischen Gleichgewichts entstehen neue Qrdnungszustände dadurch, daß bestimmte äußere Systemparameter (Temperatur, Energiezufuhr) verändert werden, bis der alte Zustand instabil wird und in einen neuen Zustand umschlägt (Phasenübergang). Bei kritischen Werten entstehen spontan makroskopische Ordnungsstrukturen, die sich durch kollektive (synergetische) Kooperation mikroskopischer Systemteilchen durchsetzen. Die Entstehung von Ordnung ist also keineswegs unwahrscheinlich und zufällig, sondern findet unter bestimmten Nebenbedingungen gesetzmäßig statt. Ein berühmtes physikalisches Beispiel für einen solchen Phasenübergang ist das Laserlicht, das spontan durch Koordinierung zunächst ungeordneter Photonen entsteht, wenn die äußere Energiezufuhr des Lasersystems einen bestimmten hohen kritischen Wert erreicht hat. In der Meteorologie läßt sich das spontane Entstehen von Wolkenmustern als Phasenübergang beschreiben, der bei bestimmten kritischen Temperaturwerten und Umweltbedingungen eintritt. Aus der Chemie sind Musterbildungen von Flüssigkeiten (dissipative Strukturen) bekannt, die durch Zufuhr energiereicher Substanzen zu dem jeweiligen Gemisch entstehen und als periodische Pulsationen (chemische Uhr) aufrechterhalten werden können. In diesen Fällen sind Kooperationseffekte von unzähligen Molekülen für den Phasenübergang neuer Ordnungszustände verantwortlich. Auch die Entstehung von Organismen durch Zelldifferenzierungen (z.B. Schleimpilz) versucht man mittlerweile durch Phasenübergänge komplexer
Chaos und Selbstorganisation
231
Systeme zu beschreiben, für die bereits computergestützte Simulationsmodelle vorliegen. Ebenso gibt es ökologische Entwicklungsmodelle von Populationen (z.B. Raubfisch-Beutefisch-Population), die als Phasenübergänge verstanden werden können. Mathematisch werden diese physikalischen, chemischen und biologischen Beispiele von Phasenübergängen komplexer Systeme durch nicht-lineare Evolutions- bzw. Populationsgleichungen beschrieben. Auch M. Eigens Evolutionsmodell, wonach biologische Makromoleküle nach Gesetzen von Physik und Chemie spontan aus ihren Grundbausteinen entstehen und sich selbst zu belebten Systemen organisieren, benutzt solche Gleichungen. Die Nicht-Linearität dieser Modelle bringt mathematisch die komplexen Zusammenhänge dieser Systeme zum Ausdruck, bei deren Berechnung man sehr schnell an die Berechenbarkeitsgrenzen heutiger Computer stößt. Gleichzeitig werden damit auch mathematische Modellbildungen eröffnet, die über die klassischen Grenzen der Naturwissenschaft hinausgehen. Grundlage ist eine allgemeine Theorie komplexer Systeme, deren Strukturbildungen durch nicht-lineare Phasenübergänge beschrieben werden und charakteristische synergetische Effekte aufweisen.9 So wird in der Wahrnehmungspsychologie mittlerweile versucht, das spontane Erkennen von ganzheitlichen Mustern und Gestalten analog zur Muster- und Gestaltentstehung in den naturwissenschaftlichen Beispielen zu beschreiben. Selbst in Soziologie und Ökologie versucht man mittlerweile Wachstumsmodelle (z.B. Bevölkerung, Städtewachstum, Konjunktur) mit nicht-linearen Entwicklungsmodellen zu erfassen. In einer allgemeinen Systemtheorie komplexer dynamischer Systeme werden die klassischen Grenzen zwischen belebter und unbelebter Natur relativiert und in analogen Modellen untersucht. Die klassischen Kriterien für Leben wie Metabolismus, Selbstreproduktion und Mutabilität sind nur notwendige Bedingungen, die in diesem Rahmen erklärbar sind. Dazu gehören auch sog. ganzheitliche Phänomene komplexer Systeme wie ein Organismus, eine Population, Gesellschaftssysteme und ihre Umwelt, die nicht in ihre Teile zerlegt werden können, ohne das System nachhaltig zu stören und zu verändern. In diesem Sinne bilden sie eine Ganzheit, deren Teile durch Kooperation synergetische Effekte hervorrufen, die für das Gesamtsystem konstitutiv sind. Viele historische Gegensätze wie Vitalismus und Mechanismus, Ganzheit und Atomismus und damit einige historische Gegensätze von Geistes- und Naturwissenschaften wurden durch zu
232
Klaus Mainzer
enge physikalische Theorieansätze wie klassische Mechanik, Thermodynamik u.ä. provoziert. Die Eigendynamik komplexer dynamischer Systeme wird erst durch Computersimulationen deutlich, die neue und nicht vorhergesehene Entwicklungen in mathematischen Rechenexperimenten entdecken. Als einfaches Beispiel betrachte man eine Wachstumsfunktion, mit der die Ausbreitung einer ansteckenden Krankheit (z.B. Masern) in einer Population erfaßt wird. Wenn ρ die Prozentzahl der bereits erkrankten Personen der Population und ζ den Ansteckungszuwachs bezeichnen, dann ist die Funktion f(p) = p+z zu bestimmen. Der Ansteckungszuwachs ζ hängt sowohl von der Prozentzahl der bereits angesteckten Personen (p) als auch der noch nicht angesteckten Personen (1-p) ab, d.h. ζ ist proportional sowohl mit ρ als 1-p, d.h. z ~ p ( l - p ) . Wird eine Proportionalitätskonstante k eingeführt, um eine Gleichung ζ = k-p-(l-p) zu erhalten, so läßt sie sich als Koppelungskonstante interpretieren, in der die Intensität der epidemischen Wechselwirkung in der Population zum Ausdruck kommt. Insgesamt gilt also die nicht-lineare Funktion f(p) = p+k-p-(l-p). Um die Werte für aufeinanderfolgende Zeitabschnitte (z.B. Tage) zu berechnen, wird die Prozentzahl ρ mit einem Zeitindex η versehen und f(p) als die Prozentzahl im nachfolgenden Zeitabschnitt n+1 aufgefaßt, d.h. wir erhalten die Rekursionsgleichung f(Pn)=Pn+k-pn(l-pn) = pn+1. Rekursionsformeln besagen nichts anderes, als daß die neuen Werte nach der angegebenen Vorschrift aus den vorher berechneten Werten erneut be-
Abb. 1
rechnet werden. Sie stellen also die Räckkoppelung Systems dar (s. Abb.l).
des dynamischen
233
Chaos und Selbstorganisation
Für einen festen k-Wert kann der Verlauf der Epidemie von einem Startwert p0 aus berechnet werden. Entsprechende Berechnungen10 zeigen, daß sich diese Funktionswerte mehr oder weniger schnell dem Grenzwert 1 nähern, d.h. alle Personen der Population werden krank (z.B. p0 = 0,3 und k = 0,5) (s. Abb.2). Pn 0,300 0,405 0,525 0,650 0,764 0,854
k 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
1 - Pn 0,700 0,595 0,475 0,350 0,236 0,146
k-pn (1-Pn) Pn+1 0,105 0,405 0,120 0,525 0,125 0,650 0,114 0,764 0,854 0,090 0,062 0,916
Abb. 2
Der Ansteckungsverlauf geht um so schneller je größer der Faktor k ist.
Attraktor
Abb. 3
1
Verzweigung
Chaos
(k> 2,570)
234
Klaus Mainzer
Die Rekursionsformel läßt sich auch als Differenzengleichung auffassen. Werden die Zeitintervalle infinitesimal klein, so erhalten wir ein Beispiel für eine nicht-lineare Differentialgleichung, mit der die Zustandsentwicklungen komplexer dynamischer Systeme beschrieben werden. In einem Koordinatensystem läßt sich die Dynamik des Systems geometrisch darstellen, indem auf der x-Achse die k-Werte und auf der y-Achse die f(p)-Werte eingetragen werden (Abb.3). Bei k-Werten größer als 1 tritt ein unerwartetes Ereignis ein, denn ρ wird nach wenigen Schritten größer als 1 (Abb.4). Damit verliert die Gleichung ihre Deutung als Epidemieformel, denn mehr als 100% der Population können nicht krank werden. Pn 0,300 0,930 1,125 0,702 1,330 0,015
k 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
1 - Pn 0,700 0,070 - 0,125 0,298 - 0,330 0,985
k-Pn(l-Pn) 0,630 0,195 - 0,432 0,627 - 1,314 0,045
Pn+1 0,930 1,125 0,702 1,330 0,015 0,060
Abb.4
Historisch wurde die Formel bereits 1845 von Verhulst formuliert, um das Wachstum einer Tierpopulation für bestimmte Umweltbedingungen zu untersuchen. Die Variable ρ steht jetzt für die Population, ρ = 100% bedeutet, daß jedem Tier der optimale Lebensraum zur Verfügung steht. Bei mehr als 100% liegt Überbevölkerung vor. Bei k = 2,3 erkennt man nach einer Einschwingungsphase ein Hin- und Herschwanken zwischen zwei Werten (Abb.3). Bei entsprechender Raffung der Entwicklungsschritte zeigt sich, daß sich die Entwicklungskurve zunächst in 2 Äste, dann in 4, 8, 16 usw. spaltet. Man spricht von einer periodenverdoppelnden Kaskadenverzweigung. Bei k > 2,570 wird das Verhalten chaotisch. Die ökologische Überbevölkerungskatastrophe ist nicht mehr steuerbar (Abb.3). Obwohl die Funktionswerte mathematisch eindeutig bestimmt sind, können bei höheren k-Werten als k = 2 kaum noch Voraussagen für ein Rechenergebnis gemacht werden. Eine Zahlenfolge, die mit einem Start-
Chaos und Selbstorganisation
235
wert 0,1 und eine Folge, die mit 0,11 beginnt, kann nach wenigen Iterationsschritten zu unvorhersagbaren und unterschiedlichen Endergebnissen führen. Eine kleine Änderung der Anfangssituation kann also erhebliche Auswirkungen haben. Demgegenüber geht die klassische Physik Newtons (und Einsteins) davon aus, daß Ursachen und Wirkungen nicht nur eindeutig miteinander verknüpft, sondern prinzipiell mit bliebiger Genauigkeit berechenbar seien. Der Glaube des deterministischen Weltbildes bestand darin, daß mit Hilfe der Newtonschen Bewegungsgleichungen einerseits und hinreichender Informationen über das betreffende System andererseits die Zukunft beliebig lange und exakt vorhersehbar sei. Als Paradebeispiel galt das Keplersche Planetengesetz, nach dem die Erde "auf ewig" dieselbe Ellipsenbahn um die Sonne beschreibt. Die Situation hat sich mit der Theorie komplexer dynamischer Systeme insofern geändert, als die Eindeutigkeit mathematischer Naturgesetze nicht gleichbedeutend mit universeller Vorausberechenbarkeit ist. Ein einfaches Wechselwirkungsschema, in dem mehr als zwei Himmelskörper aufeinander einwirken, kann eine starke Abhängigkeit der Bahnen von den Anfangsbedingungen erzeugen. Der Volksmund wußte schon immer: Dreiecksverhältnisse neigen zu Streit und Instabilität. Eine winzige Abweichung z.B. beim Stoß einer Billiardkugel, eine sehr kleine Störung von Planetenbahnen, von der man vermutete, sie sei zunächst völlig vernachlässigbar, kann sich chaotisch aufschaukeln und Imponderabilien ins Spiel bringen, die nicht mehr berechenbar sind. Und wieder der Volksmund: Ein unbedachtes Wort in einer instabilen Situation kann eine Katastrophe auslösen. Ein wissenschaftliches Beispiel liefern die nicht-linearen Differentialgleichungen der Meteorologen, nach denen geringste lokale Veränderungen, ein kleiner nicht beachteter Wirbel auf der Wetterkarte, ein trudelndes Blatt, der Flügelschlag eines Schmetterlings, globale chaotische Veränderungen der Großwetterlage auslösen können. Jedermann weiß um die Verläßlichkeit des Wetterberichts. In der mathematischen Chaostheorie spricht man deshalb auch vom "Schmetterlingseffekt". n Das altehrwürdige Kausalitätsgesetz des Rationalismus "gleiche Ursachen - gleiche Wirkungen" gilt nicht universell. Als der Mathematiker und Philosoph Henri Poincaré um die Jahrhundertwende erstmals auf das chaotische Verhalten deterministischer Gesetze
236
Klaus Mainzer
stieß, schrieb er: "Die Dinge sind so bizarr, daß ich es nicht aushalte, weiter darüber nachzudenken." Zweifel über die prinzipielle Berechenbarkeit von bisher als deterministisch vorausbestimmbar betrachtetem Systemverhalten traten auf. Aber erst die Rechenkapazitäten moderner Großcomputer haben diese Grenzen massiv verdeutlicht. Das deterministische Weltbild mit seiner totalen Berechenbarkeit und Machbarkeit erweist sich als Illusion. Die Wirklichkeit scheinen vielmehr komplexe Strukturen zu prägen, die durch Synergieeffekte und Selbstorganisationsprozesse bestimmt sind, um sich entweder zu stabilisieren oder plötzlich zu zerfließen. Solche sich stabilisierende Strukturen sind die sog. "Attraktoren", denen die Zustände eines komplexen Systems unter bestimmten Nebenbedingungen zustreben. In der Verhulst-Formel der biologischen Population ist zunächst der Zustand 1 der Attraktor, in dem sich das System stabilisiert, schließlich bei größerem k sind es mehrere Zustände, zwischen denen das System periodisch oszilliert, schließlich ist es ein chaotischer Zustandsraum, den alle Werte anstreben, d.h. graphisch (Abb.3) ist die gesamte Graufläche für k > 2,570 der Attraktor des Systems. Dieses Chaos erweist sich bei näherer Analyse als hochgradig strukturiert. Vergrößert man nämlich die Graphik geschickt und berechnet Teilausschnitte, so entstehen Bilder, die sich vom vollständigen Diagramm kaum unterscheiden. Ein kleiner Teil der Figur enthält bereits die Form der Gesamtfigur, und zwar (wegen der unbegrenzten Rekursion) in beliebiger Tiefe. Mathematisch ist die Figur "selbstähnlich". Diese Symmetrie im Chaos der Formenvielfalt ist typisch für die Geometrie nicht-linearer dynamischer Systeme.12 Man denkt sofort an die genetische Organisation höherer Organismen, bei denen jede Zelle bereits das invariante Erbgut und das komplette Möglichkeitsspektrum ihrer Entwicklung in sich trägt, aber nur ein kleiner Ausschnitt tatsächlich realisiert wird. Sicher handelt es sich bei der erwähnten Chaosfigur nur um ein mathematisches Modell. Der Mikrokosmos eines wirklichen Organismus läßt sich schließlich nicht bis in beliebige Tiefen aufschlüsseln. Aber am mathematischen Modell lassen sich bereits die entscheidenden Eigenschaften nicht-linearer dynamischer Systeme studieren, nämlich Symmetrie, Chaos und Evolution. Die Geometrie der Fraktale eröffnet eine Formenvielfalt, die uns an die komplexen Gestalten der Natur erinnert. Dort finden wir ja in der Regel keine idealen Kugeln, Drei- oder Rechtecke, sondern - plötzlich fällt es uns
Chaos und Selbstorganisation
237
wie Schuppen von den Augen - überall Fraktale: Wolken, Horizonte, Dunst, eine sich brechende Welle am Strand, komplexe Grasfasern, rauhe Hautoberfläche usw. An die Stelle der euklidischen Geometrie mit ihren rechten Winkeln und glatten Kreisen tritt mit dem Studium dynamischer Systeme ein neues geometrisches Paradigma. Dabei scheint alles mit allem zusammenzuhängen. Es ist nur eine Frage des Standortes, welche Formen aus der Totalität des Ganzen klar heraustreten und welche unklar zu verschwimmen scheinen. Das Studium der nicht-linearen dynamischen Systeme erlaubt daher eine neue Sicht "von oben" auf die Totalität der Wirklichkeit, wie wir sie in der ungeheuer komplexen Vernetzung ihrer Teile auch tatsächlich tagtäglich erleben. Man wird nun die Wirklichkeit nicht als eine Ansammlung isolierter Bausteine aus Organismen, Zellen, Molekülen, Atomen und Elementarteilchen betrachten, sondern eher als eine hierarchisch geordnete Struktur.
3. Chaos und Selbstorganisation im Herz-Kreislaufsystem Vernetzte Interaktionen sind Kennzeichen eines hohen Grades der Komplexität und bestehen im Organismus auf der Ebene der Organe, Zellen und im subzellulären Bereich. Die biochemischen Reaktionen, die in einem Organ wie z.B. der Leber ablaufen, bilden eine nahezu unübersehbare Zahl von Reaktionsfolgen. Sie münden in einen komplexen Stoffwechselweg oder zweigen von ihm ab, wobei diese Reaktionsfolgen wiederum untereinander vernetzt sind. Komplexe Stoffwechselprozesse mit überraschenden und früher nicht verstandenen Reaktionen lassen sich heute dank der Theorie komplexer dynamischer Systeme und der modernen Computertechnik analysieren. Erinnert sei an die Variation der Glykolyse (d.i. ein Stoffwechselprozeß, dessen Enzyme in fast allen Zellen vorhanden sind), die je nach äußerer Zufuhr streng periodisch oszillieren, quasi-periodische Schwingungen besitzen oder in chaotische Schwingungen mit ungeordneter Frequenz und Amplitude übergehen.13 Stabile Zustände, periodische und quasi-periodische Oszillationen, aber auch chaotische Reaktionen lassen sich an vielen Beispielen auf molekularer und zellulärer Ebene im menschlichen Organismus nachweisen.
238
Klaus Mainzer
Dabei sind chaotische Zustände nicht unbedingt mit Krankheit und stabile Zustände mit Gesundheit zu identifizieren.14 Es gibt begrenzte chaotische Schwankungen, die den Organismus vor schädlicher Erstarrung bewahren. Organe müssen nach Art nicht-linearer Systeme flexibel auf Umstände reagieren, die sich schnell und unerwartet verändern. So darf der Herzschlag oder Atemrhythmus nicht auf strenges periodisches Verhalten eines mechanischen Modells wie z.B. eine Pendeluhr fixiert sein. Der Gesamtorganismus des menschlichen Körpers selber ist ein komplexes System, in dem lokal ein ständiger Auf- und Abbau von Substanzen, also Sterben und Vergehen stattfindet. Chaos und Selbstorganisation gehören zusammen, und erst im Zustand ihrer "prästabilierten Harmonie" herrscht Leben und Gesundheit. Auch klassische medizinische Disziplinen wie Physiologie und Anatomie können von der Theorie komplexer dynamischer Systeme Anregungen erfahren. Die komplexen Verzweigungen eines Gefäßnetzes sind ein Beispiel für eine fraktale Struktur, deren nicht-lineare Mathematik funktionale Simulationen und damit die Prognose möglicher Krankheitsbilder erlaubt. Das fraktale Netz z.B. der Herzkranzgefäße erinnert an ein komplex verästeltes Baum- und Wurzelwerk, das nahezu unüberschaubare Versorgungsaufgaben zu leisten hat.15 Denselben ästhetischen Reiz, den fraktale Strukturen in der Natur oder in Computersimulationen auszulösen vermögen, finden wir also auch im menschlichen Körper. Dem Mediziner, der hinreichende Kenntnisse der nicht-linearen Mathematik besitzt, eröffnen sie eine neuartige Phänomenologie, die auf bisher unbekannte Tiefenstrukturen schließen läßt. Als Beispiel sei im folgenden die Kardiologie16 näher behandelt. Seit Ende der 70er Jahre begannen Herzspezialisten, Mathematiker und Informatiker das Herz als komplexes dynamisches System zu begreifen. Seit Jahrhunderten wird die normale Herztätigkeit als periodisch angenommen. Aperiodisch pathologische Abweichungen wie z.B. das Kammerflimmern münden in einen chaotischen Endzustand, der den Tod bedeutet. Herzrhythmusstörungen werden in Elektrokardiogrammen schon seit langem isoliert und klassifiziert. Man spricht von ektopischen Schlägen, Alternane, Torsades-de-Points, Blocks höheren Grades, ventrikulären Rhythmen, Parasystoles Wenckebach-Rhythmen, Tachykardie usw., obwohl die Möglichkeiten der Herzdynamik viel größer sind als sich in diesen Namen andeutet. Wer je den plötzlichen Herztod eines Menschen erlebt hat, kann sich der bestürzenden Frage nicht entziehen, warum ein
Chaos und Selbstorganisation
239
Rhythmus, der viele Jahre reglmäßig über 2 Milliarden Zyklen von Wechsel und Entspannung hinter sich brachte, plötzlich in chaotische Hektik ausbricht (Abb.5).17
Obere Kurve: Regelmäßiger Herzschlag
Untere Kurve: Herzflimmern
Abb.5
Kammerflimmern kann viele Ursachen haben: Arterienverschluß, der zum Absterben des Herzmuskels führt, aber auch Streß, Hypothermie oder auch die Einnahme von Pharmaka. Schließlich kann es vorkommen, daß das Muskelgewebe bei der Autopsie keine Beschädigung aufweist. Damit deutet sich eine neue Perspektive im Sinne komplexer dynamischer Systeme an. Die einzelnen Teile eines flimmernden Herzens scheinen normal zu funktionieren, während das Ganze eine Störung mit tödlicher Folge hat. Herzflimmern wäre dann eine dynamische Entwicklung eines komplexen Systems, das dem Attraktor "Chaos" zustrebt. Nur eine massive Einwirkung von außen (z.B. der elektrische Schlag eines Gerätes zur Defibrillation) vermöchte diese Entwicklung aufzuhalten.18 Welcher Typ eines komplexen dynamischen Systems kommt für das Kammerflimmern mathematisch in Frage? Dazu eine detailliertere Betrachtung: Regelmäßiges Schlagen des Herzens setzt ein aufeinander abgestimmtes Einzelverhalten von Millionen von Herzmuskelzellen voraus. Stetig durchläuft diese Herzzellen ein elektrophysiologischer Zyklus von ca. 750 msec Dauer. Dabei werden Natrium-, Kalium- und Chloridionen innerhalb und außerhalb der Zellwände so verteilt, daß jede einzelne Zelle
240
Klaus Mainzer
durch den Aufbau eines chemischen Gefälles in einen zunehmend elektrophysiologisch gespannten Zustand kommen. Schließlich wird die Potentialdifferenz in einer plötzlichen Entladung abgebaut, mit der die muskuläre Arbeit des Herzens ausgelöst wird. Dabei wird der Impuls durch ein nervenähnliches Leitungssystem an die Herzmuskulatur übermittelt. In Form einer Kettenreaktion findet die Ausbreitung durch Weitergabe von Zelle zu Nachbarzelle statt. Nach ca. 60-100 msec hat diese Wellenfront das Herz durchlaufen und löst eine Kontraktion des Muskels aus. Danach durchläuft die Muskelzelle für 200300 msec einen passiven Zustand ("Refraktärphase"), der zur Synchronisation des nächsten Kontraktionsvorgangs notwendig ist, um erneut die koordinierte Zusammenarbeit der Millionen Muskelzellen zu garantieren. Wird jedoch vorzeitig ein Impuls in der Muskulatur ausgelöst, kommt es früher zur Ausbreitung. Dieser irreguläre Vorgang ist zunächst keine Katastrophe und kann auch bei gesunden Patienten beobachtet werden. Eine gefährliche Situation entsteht dann, wenn Teile der Herzzellen im unerregbaren Zustand der Refraktärphase, andere Teile aber schon wieder zur Aufnahme bzw. Wiederausbreitung eines Kontraktionsimpulses bereit sind. Die einzelnen Herzzonen arbeiten nicht mehr koordiniert. Lokal treten in einzelnen Zonen noch refraktärer Muskulatur zyklische Erregungsverläufe auf, die schließlich global in chaotisches Herzflimmern übergehen. Der Aufbau des für die Kontraktionsarbeit erforderlichen elektrophysiologischen Potentials kommt trotz maximalen Energieverbrauchs nicht mehr zustande. Die Pumparbeit des Herzen kann nicht geleistet werden. Kreislaufstillstand tritt ein. Der Kardiologe und Physiker R. J. Cohen (MIT) konnte in Experimenten mit Tieren und im Computermodell ein chaotisches Scenario nachweisen, in dem sich eine ausbreitende Erregungswelle an einzelnen Gewebeinseln bricht. Die Entwicklung von der Ordnung des Herzschlags zum Chaos des Herzflimmerns läßt sich als Phasenübergang eines komplexen dynamischen Systems beschreiben, wie er bereits im vorherigen Kapitel bei der Populationsdynamik ökologischer Systeme oder bei der Ausbreitung einer epidemischen Krankheit analysiert wurde. Es kommt zu einer periodenverdoppelnden Kaskadenverzweigung. Das komplexe System scheint zunächst zwischen 2, 4, 8, 16 usw. Zuständen zu oszillieren, bis schließlich keine Regelmäßigkeit mehr zu erkennen ist.
Chaos und Selbstorganisation
241
Das Phänomen ist schon aus dem Alltag bekannt. Ein Wasserhahn tropft bei wenig Wasser regelmäßig, bei mehr Wasserzufluß steigert sich das Tropfen periodisch im Sinne der Kaskadenverzweigung, bis die Tropfen schließlich im unregelmäßigen Wasserfluß ununterscheidbar werden (Chaos). Die Computersimulationen pathologischer Herzrhythmen könnten eine gezielte Früherkennung ermöglichen, wenn Mediziner ausgebildet sind, ihre fraktalen Diagramme zu lesen. Unter dem Gesichtspunkt der komplexen dynamischen Systeme bewahrheitet sich nun auch für lebende Organismen der berühmte Ausspruch Galileis, daß das "Buch der Natur" in der Sprache der Mathematik geschrieben sei und nur derjenige in diesem Buch zu lesen vermöchte, der diese Sprache beherrsche.
4. Chaos und Selbstorganisation im Zentralnervensystem Die Theorie komplexer dynamischer Systeme betrachtet Organe als Populationen komplex vernetzter Zellen, deren Zustände sich gemäß nichtlinearer Evolutionsgleichungen verändern und dabei verschiedenen Attraktoren, also Grenzzuständen zustreben. Diese Phasenübergänge mit ihren spontan auftretenden neuen Organisationsmustern werden als Selbstorganisation bezeichnet. Chaos ist dabei ein komplexer Attraktor. So läßt sich auch das Gehirn als eine komplexe Population von 70-80 Milliarden gleichartigen Nervenzellen (Neuronen) auffassen, die sich in Phasenübergängen vernetzen und neue Muster erzeugen. Jede Zelle kann mit 110000 Nachbarn verbunden sein und im Prinzip zur gleichen Zeit autonom arbeiten. Verständnis und Analyse des Gehirns war in der Medizingeschichte von jeweils herrschenden technisch-naturwissenschaftlichen Paradigmen abhängig - von Descartes Vorstellung einer Nervenmechanik, die im Gehirn vom "Geist" (res cogitans) gesteuert wird, über die Vorstellung einer elektrophysiologischen Schaltzentrale für "Nervenströme" bis zum "Informationen-"verarbeitenden Digitalcomputer. Ein neues spektakuläres Anwendungsbeispiel bietet die moderne Neuroinformatik, die Selbstorganisationsprozesse im komplexen neuronalen Netzwerk des menschlichen Gehirns als Grundlage nimmt, um neuronale Biocomputer mit enormer technischer Leistungssteigerung zu bauen. Lernprozesse (z.B. Gestaltund Mustererkennung, Bewegungsabläufe des Armes und der Hand)
242
Klaus Mainzer
werden als Selbstorganisationsprozesse komplexer neuronaler Netzwerke verstanden, deren Systemelemente (Neuronen bzw. Nervenzellen) mit autonomer Fähigkeit der Verknüpfung untereinander ausgestattet sind ("Konnektionismus").19 Die Neuronen arbeiten gleichzeitig ("parallel") und ohne Zentrallenkung und erweisen sich daher als sehr flexibel und fehlertolerant im Unterschied zu den traditionellen programmgesteuerten und seriell arbeitenden Digitalcomputern, in denen jeder Schritt geplant und nacheinander ausgeführt werden muß. Der "Konnektionismus" auf der Grundlage sich selbst organisierender neuronaler Netze leitet einen Paradigmenwechsel in der Gehirnforschung, Informatik und Informationstechnologie ein. Zudem deutet sich an, daß die kognitiven Leistungen des Gehirns wie Erkennen, Denken und Fühlen als integrative Funktionen neuronaler Netze begriffen werden könnten.20 Die Selbstorganisation von Zellpopulationen wurde in den 50er Jahren durch sog. "zelluläre Automaten" (John von Neumann) erstmals simu21
liert. Zelluläre Automaten bestehen aus einem Netz einzelner Zellen, die durch die Geometrie der Zellanordnung, die Nachbarschaft jeder Einzelzelle, ihre möglichen Zustände und die davon abhängenden Transformationsregeln für künftige Zustände charakterisiert sind. Zur Analyse der Evolutionsmodelle genügen 1-dimensionale (lineare) zelluläre Automaten, die aus einer Zeile von Zellen in einem 2-dimensionalen Parkett bestehen. In einem einfachen Fall hat jede Zelle zwei Zustände 0 und 1, die graphisch z.B. durch ein weißes bzw. schwarzes Quadrat dargestellt werden können. Der Zustand jeder Zelle ändert sich in einer Folge von diskreten Zeitschritten nach einer Transformationsregel, in der die vorherigen Zustände der jeweiligen Zelle und ihrer Nachbarzellen berücksichtigt sind. Bezeichnet man eine Zelle x^*) mit Zellennummer i und Zeitparameter t, dann hat die Evolutionsgleichung die Form x .(t)
= f ( X i . r ( e - l ) , x . „ , ( . - ! ) , ... > x . + r ( t ·!)).
Allgemein hängt der Zustandswert einer Zelle von den Zustandswerten der 2r Nachbarzellen und der Zelle selbst auf der vorherigen Entwicklungsstufe ab. Zelluläre Automaten im Sinne solcher Transformationsregeln lassen sich als diskrete dynamische Systeme auffassen, deren Eigenschaften mit den Methoden der komplexen System- und Chaostheorie
243
Chaos und Selbstorganisation
analysiert werden können. Ihre linearen Konfigurationen ergeben mit der Zeit komplexe Muster, die sich als typische Evolutionsmodelle der jeweiligen Automaten auffassen lassen. Man unterscheidet die Evolutionsmodelle nach den Attraktoren, d.h. den Endzuständen, denen komplexe dynamische Systeme zustreben. Die Evolutionsmuster entstehen aus "ungeordneten" Anfangszuständen, in denen jede Zelle unabhängig und mit gleicher Wahrscheinlichkeit für jeden möglichen Zustand gewählt ist. Empirische Untersuchungen (im Sinne von Computerexperimenten) legen eine Klassifikation in vier Automatentypen nahe: Klasse 1
K l o sse
Klasse
Klasse 4
3
Abb. 6
Ein Automat der Klasse 1 strebt nach wenigen Schritten einem homogenen Gleichgewichtszustand unabhängig vom Anfangszustand zu. Ein Automat der Klasse 2 strebt einem konstanten oder periodischen Endzustand (z.B. Oszillation oder Pulsation chemischer Systeme) zu und ist dabei in gewissen Toleranzen unabhängig vom Anfangszustand. Ein
244
Klaus Mainzer
Automat der Klasse 3 strebt einem chaotischen Endzustand mit fraktaler Dimension zu. Die Evolutionsmuster reagieren empfindlich auf geringste Änderungen des Anfangszustandes ("Schmetterlingseffekt"). Bekannt sind solche fragilen Systeme von Gasturbulenzen und Wetterlagen in der Meteorologie. Ein Automat der Klasse 4 strebt komplexen Evolutionsmustern als Attraktor zu, die empfindlich auf Veränderungen des Anfangszustandes reagieren ("Schmetterlingseffekt"). Solche Strukturen erinnern an Gestalten und Organismen der biologischen Evolution. Langfristige Prognosen für Evolutionsmuster sind in der Klasse 3-4 nicht möglich. Geringste Abweichungen der Anfangszustände lassen die Entwicklungstrajektorien der Evolutionsmuster exponentiell auseinanderstreben ("Nicht-Linearität"). Selbstorganisation ist also langfristig im allgemeinen nicht prognostizierbar, obwohl im Beispiel zellulärer Automaten jeder einzelne Phasenübergang determiniert ist. Der Rechenaufwand zur Simulation von Evolutionsmustern der Klasse 4 ist mindestens so groß wie der Evolutionsprozeß selber. Zelluläre Automaten sind eine vereinfachte Vorstufe neuronaler Netzwerke. Analog zur spontanen Musterbildung in der physikalischen und biologischen Evolution soll nun die Mustererkenntnis simuliert werden. Mit diesen Systemen wird ein technologischer Paradigmenwechsel eingeleitet, der am neurophysiologischen Modell des menschlichen Gehirns orientiert ist.22 Im Unterschied zu traditionellen Digitalrechnern ('von-NeumannMaschinen'), die komplexe Aufgaben nur Schritt für Schritt in Angriff nehmen können, besteht das menschliche Gehirn aus einer Population von Neuronen, von denen jede mit Tausenden von Nachbarn verbunden ist und im Prinzip zur gleichen Zeit arbeiten kann. Analog besteht die Parallelstruktur eines Neurocomputers aus einer großen Zahl sog. Transputer, die jeweils einen Prozessor und einen kleinen Speicher besitzen. Der Prozessor ist dabei für die Verarbeitung der Stromimpulse und die Verständigung mit anderen Transputern zuständig. Die Transputer arbeiten gleichzeitig und entsprechen in ihrer Funktion den Neuronen (Konnektionismus).
245
Chaos und Selbstorganisation
So können z.B. Transputer der physikalischen Realität der Außenwelt schneller und präziser gerecht werden als traditionelle Computer, die nur über einen Prozessor verfügen. Jeder Transputer verarbeitet gewissermaßen einen Lichtstrahl der Außenwelt, dessen Eigenschaften wie Brechung, Reflexion und Farbwirkung in Zusammenarbeit mit anderen Transputern berechnet werden. Neuronale Rechennetze erweisen sich analog dem menschlichen Gehirn als robust und fehlertolerant, so daß bei Ausfall eines Netzteils dieselben Aufgaben von einem beliebigen anderen Teil übernommen werden können. Beispiel eines neuronalen Netzwerks ist das sog. Hopfleld-System.23 Es besteht aus einer Population von Neuronen XjW mit jeweils zwei Zuständen 0 und 1. Synapsen Wy beschreiben die Zellenvernetzung, wonach der Zustand des j-ten Neurons zum Zustand des i-ten Neurons transportiert wird. Jede Zelle i ist durch eine Reizschwelle S· charakterisiert, bei der sich der Zustand ändert. Der Zustand einer Zelle ist durch eine Evolutionsgleichung beschrieben, die von der Summe der Zellenvernetzungen EiWijXi im vorherigen Zustand und ihrer Reizschwelle S- abhängt: x|+1=f(IiWijXi-Si),
wobei x f + 1
=
*
1
falls Σ WjjXj > S¿
®
falls Σ W^Xj < Sj falls Σ Wj.x. = Sj
Das Erlernen von Mustern geschieht nicht durch ein Programm wie bei zentralgesteuerten Digitalcomputern, indem jeder Schritt durch Regeln festgelegt ist. Vielmehr wird der Lernprozeß durch Beispiele von Mustern A1..., A M auf der Grundlage von Vernetzungsregeln trainiert, nach denen das menschliche Gehirn arbeitet ("Hebbsche Regel"). Danach werden Konnektionen W - zwischen Neuronen eines Musters im selben Zustand verstärkt, solche im verschiedenen Zustand vermindert:
246
Klaus Mainzer
W i - (l-ôy ) Σ ^ = 1 (2A™1) (2AjI1-l)) Dabei wird ein Muster als n-dimensionaler Vektor A m = (A™) aufgefaßt und eine Selbstkoppelung ausgeschlossen, d.h. W - = 0. Wie üblich ist das Kroneckersymbol mit = 1 für i=j und 5jj = 0 sonst. Gestörte Muster von z.B. Buchstaben können so in Phasenübergängen vom neuronalen Netzwerk erkannt werden, nachdem ein Standardmuster durch Beispiele und nicht durch ein Programm eingeübt worden ist:
·• · · ·· ·· •• ·· · •
·· · ·· ·· · ·· ·· · · ·· ·· · ··· · · · · · · ·· ·· · ···· ·
···· f · •
··
· ·· • ·• • · · ·
Abb. 7
Die Erklärung liefert wieder die Physik komplexer dynamischer Systeme: Ein komplexes dynamisches System (das Hopfield-System bzw. das menschliche Gehirn) strebt durch Phasenübergänge einem Gleichgewichtszustand ("Fixpunkt") als Attraktor zu. Praktische Anwendungsbeispiele sind heute neuronale Netzwerke, die automatisch gestörte bzw. unterschiedliche Schriftzüge von Handschriften erkennen oder gestörte oder verschiedene Paßfotos derselben Person erkennen. Systeme mit Netzwerkhierarchie können darüber hinaus nicht nur eintrainierte Muster wiedererkennen, sondern klassifizieren sie spontan nach Merkmalen ohne äußere Überwachung des Lernvorgangs durch einen "Lehrer". Begriffsbildung, Kategorisierung und Abstraktion wird so durch spontane Selbstorganisation erzeugt. Auf der ersten Neuronenschicht (Layer 1 = input layer) werden Zeichen, Worte, Laute etc. registriert. Auf weiteren Neuronenschichten werden Neuronen in "Cluster" zusammengefaßt. Innerhalb der Cluster treten
247
Chaos und Selbstorganisation
Neuronen in Wettbewerb. Eine Einheit lernt, indem sie den Wettbewerb in einem Cluster gewinnt (Abb.8). Lernen geschieht durch Zunahme in den Konnektionen mit aktiven Elementen · und Abnahme in den inaktiven Konnektionen o: Layer 3 : Inhibitoren Cluster Aktivatoren Konnektionen Layer 2 : Inhibitoren Cluster Aktivatoren Konnektionen
Input Einheiten
Abb.8
Input Muster
Die Einheiten werden nicht auf bestimmte Merkmale programmiert, sondern entdecken die Merkmale zur Klassifizierung bei der Input-Analyse selbstständig. Als Beispiel wurden Klassifikationen von Worten AA, AB, BA, BB spontan nach verschiedenen Merkmalen entwickelt: {AA}, {AB}, {BA}, {BB} oder {ΑΑ,ΑΒ}, {ΒΑ,ΒΒ} oder {ΑΑ,ΒΑ}, {ΑΒ,ΒΒ}.
248
Klaus Mainzer
Die entsprechenden Bilder des Input- bzw. Ouputmusters waren:
·· · · · · • · •• mm® m m Φ ·. • · • m •
• · ·
•• ·· ·· • ·
·
· • ·
•
· · · · mmm ·· •
. ·
· • · ·
» #
· ·
β
•
•
.
·
·
•• β· m
•
·
• β
* •· m e. . .• · · · · i.
i
ft 9 « · t • ·
·
Abb. 9
Bisher wurden zur neuronalen Simulation nur solche dynamische Systeme herangezogen, die durch Selbstorganisation einen Fixpunkt als Attraktor anstreben. Im Sinne der Klassifikation komplexer Systeme in Abschnitt 2 handelt es sich um Automaten der Klasse 1. Bemerkenswert sind Überlegungen, auch komplexe Systeme mit chaotischen Eigenschaften (Klasse 3) oder der Klasse 4 zu verwenden. Sie sind nämlich hoch sensibel gegen geringste Unterschiede des Anfangsinputs, deren Entwicklung im System exponentiell auseinanderläuft ("Schmetterlingseffekt"). Für den Wahrnehmungsprozeß und seine neuronale Verarbeitung bietet sich folgende Anwendung an: Da jede Beobachtung nur endliche Präzision hat, könnten zwei tatsächlich unterschiedliche Objekte, deren Wahrnehmungsunterschied unterhalb unseres organischen oder technischen Differenzierungsvermögens ist, zunächst für uns ununterscheidbar sein. Bei einem trainierten Wahrnehmungssystem kommt es im Laufe der Phasenübergänge auf Grund der geringen Anfangsunterschiede zu Verzweigungskaskaden, die schließlich eine Bilddifferenzierung ermöglichen. Das System hätte spontan gelernt, genauer zu erkennen. Neben deterministischen Systemen sind auch stochastische Netzwerkarchitekturen mit nicht-deterministischen Prozessoren und verteilter
Chaos und Selbstorganisation
249
Wissensrepräsentation in Gebrauch ("Βoltzmann-Maschinen")· In solchen Maschinen arbeiten Lernalgorithmen durch Selbstorganisation mit dem Ziel, den informationstheoretischen Unterschied zwischen den internen Modellen des Systems und der externen Außenwelt zu minimieren.24 Zunächst sei die Palette von kommerziellen bis technisch-industriellen Einsatzbereichen von neuronalen Netzwerken erläutert: Wichtig im Zahlungsverkehr von Banken ist z.B. das Überprüfen von Belegen oder Schecks auf die Richtigkeit oder Plausibilität. Das Verifizieren von Unterschriften, wenn auch oft nur sporadisch und stichprobenartig, geschieht heute durch direkten Vergleich mit einer in der Kundenkartei abgelegten Unterschrift. Die Euro-Scheckkarte zum Abheben von Geldbeträgen an Automaten hat auch nur eine begrenzte Sicherheit, die in einer 4-stelligen PIN-Kodierung besteht und vom Besitzer der Karte in den Automaten getippt werden muß. Neuronale Netze können Fingerabdruck, Stimme oder Unterschrift vergleichen und eine erhebliche höhere Sicherheit bieten. Aber auch das automatische Lesen von Zahlen auf Bankbelegen oder Briefen zur Weiterverarbeitung mit dem Computer ist durch neuronale Netze Wirklichkeit geworden. Der Erfolg der Mustererkennung liegt im Training des neuronalen Netzes mit genügend relevanten Daten. Wie aussichtslos wäre doch der Versuch, Schriftzeichen oder Ziffern durch Programmregeln zu beschreiben. Neuronale Netze helfen im Krankenhaus oder in der Arztpraxis das Wissen eines Fachmanns, z.B. eines Kardiologen oder Gehirnstromspezialisten, zum direkten Vergleich mit Patientendaten heranzuziehen. Solange die vom Patienten abgenommenen Daten dem Normalfall entsprechen, das neuronale Netz an genügenden Beispielen erlernt hat, wird kein Alarm gegeben. Erst das Auftreten von abnormalen EKG-, EEG- oder Analyseverläufen sollte die Aufmerksamkeit des Arztes auslösen. Gerade im Zeitalter der steigenden Pflege- und Gesundheitskosten ist es wichtig, daß der Arzt sich auf seine wichtigen Aufgaben, nämlich bei kritischen Situationen anwesend zu sein, konzentriert und Routinetätigkeiten vom Computer abgenommen werden. Die klassischen Robotersysteme von heute sind noch recht "dumm". Wenn ein Roboter versehentlich ein Werkstück fallen läßt, und das Werkstück unkontrolliert liegen bleibt, ist ein Eingriff durch den Menschen erforderlich. Wünschenswert wäre ein Roboter, der sehen kann, der Objekte erkennen und unterscheiden kann, der sich auf Objekte zubewegt oder nach
250
Klaus Mainzer
Gegenständen greifen kann. Ein alter Wunschtraum der Roboterkonstrukteure rückt näher: Zwei Roboter, die sich gegenseitig einen Ball zuspielen oder auch auffangen können. Solche Anwendungen sind denkbar. Es gibt bereits Anwendungen, wo neuronale Netze ähnliche Aufgaben übernehmen. Zwar hat die konventionelle Computertechnik heute schon in fast allen Bereichen unserer Gesellschaft Einzug gehalten. Aber an der Schnittstelle Mensch-Computer sind noch erhebliche Mängel vorhanden. Kommunikationsmittel sind im wesentlichen nach wie vor Bildschirm und Tastatur, wenn man von den neueren Eingabemedien wie Maus und Digitalisiertablett absieht. Neuronale Netze können Sprachsignale aufnehmen, Handschriften oder fremde Schriftzeichen erkennen, z.B. japanische oder chinesische Zeichen. Dabei gibt es heute noch Datenerfassung per Beleg und Dateneingabe nach Beleg. Neuronale Netze werden das MenschMaschine-Interface auf den Menschen anpassen können und nicht umgekehrt, daß der Mensch lernen muß, sich an den Computer anzupassen. Die Unterschiede von neuronalen Netzen und von-Neumann-Maschinen sind jetzt offensichtlich: Während neuronale Netze auf der Grundlage von Selbstorganisation und paralleler Informationsverarbeitung funktionieren, werden von-Neumann-Maschinen durch zentrale Programmsteuerung und serielle Informationsverarbeitung gelenkt. Neuronale Netze bestehen aus einem homogenen System autonomer und gleichartiger Komponenten ("Neuronen"). Demgegenüber ist eine von-Neumann-Maschine ein heterogenes System mit einer zentralen Rechen- und Speicherwerkeinheit. Neuronale Netze sind wie das menschliche Gehirnfehlertolerant: Aus der Unfallchirurgie ist bekannt, daß die Funktionen von Verletzten bzw. ausgefallenen Neuronen an anderen Teilsystemen des Gehirns übernommen werden. Nach diesem Prinzip funktioniert in Toleranzgrenzen auch ein neuronales Netz. Demgegenüber bricht das Programm einer seriellen von-NeumannMaschine bei geringsten Inkompatibilitäten zusammen. Während neuronale Netzwerke auf der Grundlage von Selbstorganisation intuitives und Common-Sense-Wissen verarbeiten, bleibt ein Expertensystem auf regelbasiertes und spezialisiertes Expertenwissen fixiert. Ein Beispiel ist das MYCIN-Programm, das Ärzte bei der Diagnose von Infektionskrankheiten unterstützt. MYCINs Wissenspool über bakterielle Infektionen besteht aus etwa 300 Produktionsregeln, nach denen für vorgelegte Laborergebnisse mehr oder weniger wahrscheinliche Diagnosen abgeleitet werden können.
Chaos und Selbstorganisation
251
Während ein neuronales Netz ein Muster durch Beispiele exemplarisch erlernt, muß einem Expertensystem jede Art von Wissen durch ein mehr oder weniger aufwendiges Programm vermittelt werden. Während der Benutzer einen unmittelbaren Systemzugang zum neuronalen Netz hat, steht zwischen Expertensystem und Benutzer der Wissensingenieur und die jeweilige Programmiersprache. Gleichwohl zielen neuronale Netzwerke und Expertensysteme auf unterschiedliche intellektuelle Fähigkeiten ab. In einer Wissenshierarchie könnte man das "low-level-knowledge" mit z.B. Analyse und Erkenntnis von Signalen, Bildern, Sprache, Wahrnehmungskoordination, Common-SenseWissen und Intuition vom "high-level-knowledge" mit z.B. logischer und grammatikalischer Ableitung, Rechnen, Erklärungen, Expertenwissen unterscheiden. Offenbar entsprechen neuronale Netzwerke der Informationsverarbeitung im "low-level-knowledge", während Expertensysteme dem "high-level-knowledge" entgegenkommen. Die Zukunft liegt daher möglicherweise bei integrierten Systemen von neuronalen Netzen und Expertensystemen: Man denke etwa an die Medizin, in der ein schnelles Erkennen von Datenmustern durch neuronale Netzwerke geleistet werden könnte, während Diagnose und Erklärung Expertensystemen vorbehalten bliebe und zur endgültigen Entscheidung einem Arzt vorgelegt würden. Computertechnologie und Hirnforschung entwickeln sich also in einer wissenschaftlichen Symbiose, um das Gehirn als ein komplexes dynamisches System verstehen zu lernen. Chaos und Selbstorganisation sind dabei Schlüsselbegriffe, obwohl viele Untersuchungen erst am Anfang stehen. Mit diesen neuen wissenschaftstheoretischen Rahmenbedingungen wird sicher auch ein Umdenken in der klinisch-medizinischen Behandlung neurologischer und psychischer Krankheiten erforderlich werden. Chaos ist schlechterdings kein Krankheitsszustand, sondern ein komplexer Attraktor. So finden sich bei der Messung von Gehirnströmen im Elektro-Enzephalogramm (EEG) bei gesunden Menschen chaotisch gezackte Kurven, während bei Epileptikern auffallend gleichmäßige und geordnete EEGKurven vorliegen. Schließlich kann bei der medikamentösen Behandlung ein neues Verständnis des zu behandelnden Organs als komplexes dynamisches System grundlegend sein. A. J. Mandell kritisiert in dem Zusammenhang die heutige Psychopharmakologie, die von Angstgefühlen und Schlaflosigkeit bis zur Schizophrenie
252
Klaus Mainzer
alles zu heilen glaubt. Als Beispiel werden Antidepressiva erwähnt, die eine Abfolge manischer und depressiver Phasen beschleunigen und langfristig zu einem Anwachsen der Zahl der Rückfalle in einen psychopathologischen Zustand führen - ein Vorgang der von den Phasenübergängen mit periodenverdoppelnden Kaskadenverzweigungen wohl bekannt ist. Die herkömmlichen Therapien gehen häufig noch von einer linearen Kausalität aus, ohne das Gehirn als labiles, komplex vernetztes und dynamisches System zu begreifen. Es gibt tausende verschiedener Zellarten und komplexe elektrophysiologische Erscheinungen in einem hierarchisch strukturierten System, in dem auf allen Ebenen von den Molekülen bis zum EEG, vom Mikrokosmos bis zum Makrokosmos des Gehirns fortgesetzt auf Instabilität beruhende autonome Aktivitäten ablaufen. Ein besseres Verständnis der Phasenübergänge zwischen den verschiedenen lokalen Zuständen könnte von erheblichem Nutzen sein. Insbesondere bei einer medikamentösen Behandlung könnte die Kontrolle entsprechender Parameter, die Aufschluß über den Grad des Ordnungs- und Chaoszustandes geben, ein nützliches Instrument sein, um Medikamente gezielt zum geeigneten Zeitpunkt unter Kenntnis möglicher Nebenwirkungen zu verabreichen.
5. Wissenschaftstheoretischer Ausblick: Reduktionismus, Holismus und komplexe dynamische Systeme25 Die alten Naturphilosophen der Antike wußten schon: Organismus und Natur bilden ein sensibles System sich gegenseitig bedingender Rhythmen und Muster, die letztlich nicht steuerbar sind. Nur derjenige überlebt, der sie versteht, und zur rechten Zeit flexibel reagiert. Wenn Aristoteles meint, daß die "Selbstorganisationsprozesse" des Lebens nicht mathematisierbar sind, so ist zu beachten, daß er die euklidische Mathematik seiner Zeit mit ihren idealen Kreisen und Kugeln vor Augen hat und nicht die fraktalen Stukturen nicht-linearer Mathematik. Daher finden wir in den antiken-mittelalterlichen Texten der Naturphilosophie mehr Verständnis für die ganzheitliche Sicht des Lebens als bei den Naturwissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts, die unter dem Eindruck Newtonscher Physik arbeiten. Es scheint, als hätte die Wissenschaftsgeschichte den Umweg über diese Epoche atomistisch-linearer Naturbetrachtung nehmen müssen, um heute
Chaos und Selbstorganisation
253
mit den Möglichkeiten moderner Computertechnik auch die komplexen nicht-linearen Probleme des Lebens in Angriff nehmen zu können. Damit wird natürlich nicht behauptet, daß die antiken Vorstellungen der Selbstorganisation ("Autopoiesis") im modernen Paradigma nicht-linearer Mathematik aufgehen. Jedenfalls ist aber eine holistische Betrachtungsweise einer nicht-linearen mathematischen Naturwissenschaft nicht nur nicht fremd, sondern wird geradezu gefordert. Atomismus und Vitalismus, Reduktionismus und Holismus erweisen sich als überholte wissenschaftshistorische Gegensätze, die durch zu enge naturwissenschaftliche Forschungsansätze mit gleichwohl allgemeinem Erklärungsanspruch der Natur (z.B. mechanistisches Weltbild) provoziert wurden. Aus heutiger Sicht ergibt sich zwar eine reduktionistische Hierarchie naturwissenschaftlicher Disziplinen, die jedoch eine ganzheitliche Sicht nicht ausschließt: Man startet mit Prinzipien der Quantenmechanik und Elementarteilchenphysik. Auf dieser physikalischen Basis erhält man die hierarchisch höher liegende Stufe der Moleküle, chemischen Bindungen, Kristalle usw. durch verschiedene Stufen der Abstraktion, die wissenschaftstheoretisch eine (approximative bzw. "schwache") Reduktion der Chemie auf die Quantenmechanik leistet. In der Biochemie erhält man die hierarchisch höher liegende Stufe der Makromoleküle, die als mögliche Bausteine lebender Systeme auftreten. Auch die Entwicklung makroskopischer Systeme kann partiell reduziert werden. In der Thermodynamik werden offene Systeme fern des thermischen Gleichgewichts untersucht, die im Metabolismus mit ihrer Umwelt stehen und dissipative Strukturen durch Phasenübergänge erzeugen. Die Morphogenese funktionaler Formen von Organen und Organismen in Biologie und Medizin ist ein Beispiel für neue Muster und Strukturen, die durch Phasenübergänge entstehen. Auch auf der hierarchisch höher liegenden Stufe der Populationen von Organismen in der Ökologie lassen sich Entwicklungen in diesem Theorierahmen verstehen. Mathematisch werden dazu komplexe dynamische Systeme durch Phasenübergänge beschrieben. Zusammenfassend erweist sich also die mathematische Sicht hierarchischer Strukturen und Funktionen als geeignet, um die komplexen Facetten von Organen, Organismen und Ökosystemen zu erfassen. Ein so modifiziertes und präzisiertes Reduktionismusprogramm zielt auf eine hierarchische Sicht von Physik, Chemie und Biologie.26 Allerdings muß an dieser Stelle davor gewarnt werden, die Wirklichkeit mit den Bildern
254
Klaus Mainzer
der Wirklichkeit zu verwechseln. Der hier vorgestellte Theorierahmen ist hierarchisch. Ontologische Annahmen über eine metaphysische Hierarchie der Natur sind nicht beabsichtigt, obgleich die naturphilosophischen Diskussionen darüber von Aristoteles über Leibniz bis Whitehead heuristisch anregend sind. Streng genommen kann aber die wissenschaftstheoretische Sicht über solche Fragen nicht entscheiden. Gleichwohl bietet diese Sicht viele Vorteile. So kann der Übergang von der Quantenwelt zur makroskopischen Welt in einem gemeinsamen Theorierahmen mit verschiedenen Stufen erfaßt werden. Eine hierarchisch höher liegende Stufe hat einen eingeschränkteren Gültigkeitsbereich und ist (aufgrund von Approximationen) weniger genau als eine fundamentalere Stufe. In diesem Theorierahmen läßt sich zwar ein Gegenstand einer hierarchischen Stufe mit einer Sprache beschreiben, die zu einer fundamentaleren Stufe gehört. Eine solche Beschreibung kann aber sehr komplex und nahezu unverständlich sein. Konkret: Die Kardiologie auf die Sprache der Quantenmechanik übersetzen zu wollen, erscheint unnötig und überflüssig, obwohl prinzipiell die für die Kardiologie entscheidenden biochemischen Prozesse der Herzzellen nach quantenmechanischen Gesetzmäßigkeiten ablaufen. In diesem Sinne beanspruchen die Gegenstände und Sachverhalte einer höheren Stufe gegenüber einer fundamentaleren Stufe ein eigenes Recht. Jede Beschreibung einer höheren Stufe benötigt eine eigene Sprache, da eine vollständige Übersetzung der Sprache einer höheren Stufe in die Terminologie einer fundamentaleren Theorie weder möglich noch wünschenswert ist. Alternative nicht-reduktionistische Gesichtspunkte sind nicht nur möglich, sondern auch wünschenswert, um die Defizite des reduktionistischen Programms auszugleichen. Damit wird keinem wissenschaftstheoretischen Relativismus das Wort geredet. Die Geschichte menschlicher Erfahrung hat uns vielmehr bis heute eine komplexe Wirklichkeit gezeigt, so daß wir einzelne Kontexte und Perspektiven auswählen, um in ihnen erst erkennen und forschen zu können. So ist Physik nicht vollständig durch das reduktionistische Programm erfaßt, wonach alle physikalischen Kräfte und Teilchen auf eine einheitliche Urkraft zurückzuführen sind. Kennzeichnend für Vielfalt in der Physik ist, daß man sich z.B. ebenso interessiert für die Oberflächen von Stoffen ("Was passiert wirklich am Rand eines Eiswürfels, der im Wasser schwimmt?"), für turbulente Luft- und Wasserströmungen ("Was passiert
Chaos und Selbstorganisation
255
wirklich mit unserem Wetter?") usw. Neben die "Sicht von unten" (d.h. von den Elementarbausteinen her) tritt die komplementäre "Sicht von oben" der Phänomenologie fraktaler Oberflächen und makroskopischer Körper, die durch eine nicht-atomare Sicht der Dinge wie in der Theorie komplexer dynamischer Systeme, Katastrophentheorie usw. beschrieben werden. Noch stärker ist heute die Diskussion um den biologischen Reduktionismus entbrannt, der alle Lebensphänomene auf makromolekulare Strukturen zurückführen will, die biochemisch und biophysikalisch erklärbar sind. Die Biologie interessiert sich nicht nur für die molekularen Bausteine der Organismen und Populationen, sondern untersucht z.B. ökologische Zusammenhänge von Populationen in ihren natürlichen Umgebungen. Neben die "Sicht von unten" tritt die komplementäre "Sicht von oben" auf komplexe ökologische Ganzheiten, die gleichwohl durch neue Paradigmen (z.B. Theorie komplexer nicht-linearer Systeme) mathematisch beschreibbar sind. Für die Medizin eröffnet dieser Theorierahmen neue Einsichten und Möglichkeiten der Therapie. Einerseits werden komplexe, ganzheitliche Betrachtungsweisen mit nicht-linearer Kausalität betont, andererseits werden mathematische Methoden für den Mediziner eine größere Rolle spielen als ehedem. Man spricht geradzu yon"dynamischen" Krankheitsbildern, denen komplexe nicht-lineare Störungen von Rhythmen und Mustern des menschlichen Organismus zugrunde liegen. Psychosomatische Schwankungen gehören ebenso dazu wie Störungen in EEG- und EKG-Diagrammen, Veränderungen in den komplexen Vernetzungen des Immunoder Hormonsystems. Gleichwohl sollten wir uns davor hüten, in der Theorie komplexer dynamischer Systeme ein letztes apodiktisches Kategoriensystem zu sehen. Abgesehen davon, daß viele Perspektiven dieses Forschungsprogramms mathematisch, experimentell und klinisch noch erst einzulösen sind, ist für die Medizin die besondere Art ihrer Aufgabenbestimmung zu berücksichtigen. Die Medizin hat es nämlich seit alters her nicht nur mit Erkenntnis und Forschung zu tun, sondern mit Praxis. Praxis meint dabei nicht nur technisch-praktische Wissensanwendung (wie z.B. beim Ingenieur), sondern Heilen und Helfen, damit der Kranke wieder gesund wird oder seine Beschwerden wenigstens gelindert werden. Wissen und Erkenntnis ist also nur ein Mittel für diesen letzten Zweck der Medizin seit Hippokrates.
256
Klaus Mainzer
Diese schlichte und dennoch fundamentale Rückbesinnung relativiert auch die Deutung von Forschungsparadigmen für den praktischen Mediziner. Für seine Aufgabe des Heilens und Helfens muß er auf ein vielschichtiges Erfahrungswissen zurückgreifen, daß häufig Stückwerk bleibt und keineswegs ein konsistentes und lupenreines reduktionistisches Forschungsprogramm ist. Intuition ist daher unerläßlich, die den erfahrenen Mediziner eher in die Nähe eines Künstlers als in die Nähe eines Mechanikers und Technikers rückt. Dieses Selbstverständnis der Medizin als Kunst hat sich ja auch seit ihren antiken Ursprüngen bis in die Moderne gehalten. Es bewahrt uns davor, in den jeweiligen historischen Forschungsparadigmen aufzugehen, obgleich sie neue und umfassende Einsichten eröffnen können.
Anmerkungen * Die Arbeit entstand im Rahmen des DFG-Projekts 'Computer, Chaos und Selbstorganisation'(Az.: Ma 842/4-1) des DFG-Schwerpunktes 'Wissenschaftsforschung' und des Augsburger Graduiertenkollegs 'Analysen, Optimierung und Steuerung komplexer Systeme'. 1 K. Mainzer (Hrsg.), Natur- und Geisteswissenschaften. Perspektiven und Erfahrungen mit fachübergreifenden Ausbildungsinhalten. Ladenburger Diskurs Bd. 3 (Gottlieb-Daimler- und Karl-Benz-Stiftung), Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo 1990. 2 Vgl. auch Ε. P. Fischer/K. Mainzer (Hrsg.), Die Frage nach dem Leben, München 1990. 3 R. Descartes, Discours de la méthode, dt. A. Buchenan, Leipzig 1919/20, 5. Teil, S. 39 ff. 4 I. Kant, Kritik der Urteilskraft, Hrsg. G. Lehmann, Stuttgart 1971, S. 340 f. 5 F. W. J. Schelling, Sämtliche Werke Bd. II, hrsg.von M. Schröter, München 1927, S. 206 f. 6 L. Boltzmann, Über die Frage nach der objektiven Existenz der Vorgänge in der unbelebten Natur, in: L. Boltzmann, Populäre Schriften, Leipzig 1905, S. 94-119. 7 H. Haken, Synergetics. Nonequilibrium Phase Transitions und Self-Organization in Physics, Chemistry and Biology, Berlin/Heidelberg/New York 1978. 8 Κ. Mainzer, Symmetrien der Natur. Ein Handbuch zur Natur- und Wissenschaftsphilosophie, Berlin/New York 1988, S. 573 ff.
Chaos und Selbstorganisation
257
9 Vgl. auch H.G. Schuster, Deterministisches Chaos. An Introduction, Weinheim 1984; R. L. Devaney, Introduction to Chaotic Dynamical Systems, Menlo Park 1986; J. Gleick, Chaos - Making a New Science, New York 1987. 10 Abb.2-4 entstammen K.-H. Becker/M. Dörfler, Computergrafische Experimente mit Pascal, Braunschweig/Wiesbaden 1986, S.7,8,12. 11 Ε. Ν. Lorenz, The Problem of Deducing the Climate from the Governing Equations, Tellus XVI, 1964, 1-11. 12 Vgl. auch Κ. Mainzer, Symmetrien der Natur (s. Anm. 8), S. 596 ff. 13 B. Hess/M. Markus, Chemische Uhren, in: A. Dress/H. Hendrichs/ G. Küppers (Hrsg.), Selbstorganisation. Die Entstehung von Ordnung in Natur und Gesellschaft, München 1986, S. 61-79. 14 W. Gerok, Ordnung und Chaos als Elemente von Gesundheit und Krankheit, in: W. Gerok u.a. (Hrsg.), Ordnung und Chaos in der unbelebten und belebten Natur. Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 115. Versammlung 1988, Stuttgart 1989, S. 19-41. 15 J.B. Bassingthwaighte/J. H. G. M. van Beek, Lightning and the Heart: Fractal Behavior in Cardiac Function, in: Proceedings of the IEEE 76 1988, S. 693-699. 16 Vgl. auch A.L. Goldberger/V. Bhargava/B.J. West, Nonlinear Dynamics of the Heartbeat, Physica 17D 1985, 207-214; ders. u.a., Nonlinear Dynamics in Heart Failure: Implications of Long-Wavelength Cardiopulmonary Oscillations, American Heart Journal 107, 1984, 612-615; T. Ree Chay/J. Rinzel, Bursting, Beating, and Chaos in an Excitable Membrane Model, Biophysical Journal 47, 1985, 357-366. 17 A. T. Winfree, Sekundenherztod: Hilfe von der Topologie? Spektrum der Wissenschaft, Juli 1983,98-111; ders., When Time Breaks Down: The Three-Dimensional Dynamics of Electrochemical Waves and Cardiac Arrhythmias, Princeton 1987. 18 M. R. Guevara/L. Glass/A. Schrier, Phase Locking, Period-Doubling Bifurcations, and Irregular Dynamics in Periodically Stimulated Cardiac Cells, Science 214, 1981, 1350. 19 K. Mainzer, Die Evolution intelligenter Systeme,("Zeichen im Gehirn? Semiotik und künstliche Intelligenz"), Zeitschrift für Semiotik XII/1 1990 , 83-106. 20 K. Mainzer, Philosophical Concepts of Computational Neuroscience, in: R. Eckmiller (Hrsg.), Proceedings of the International Conference on Parallel Processing in Neural Systems and Computers, Düsseldorf, F.R.G., 19-21 March 1990, S. 9-12. 21 J. Demongeot/E. Golès/M. Tchuente (Hrsg.), Dynamical Systems and Cellular Automata, London/New York/Tokyo 1985. 22 J.-P. Changeux, Der neuronale Mensch, Reinbeck 1984; R J . Baron, The Cerebral Computer. An Introduction to the Computational Structure of the Human Brain, London 1987. 23 J. J. Hopfield, Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities, Proceedings of the National Academy of Sciences 79,
258
Klaus Mainzer
1982, 2554-2558. Abb. 7-9 entstammen R. Serra/G. Zanarini, Complex Systems and Cognitive Processes, Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo 1990. 24 D.H. Ackley/GJE. Hinton/T.J. Sejnowski, A Learning Algorithm for Boltzmann Machines, Cognitive Science 9,1985,147-169. 25 Vgl. Κ. Mainzer, Symmetrien der Natur (s. Anm. 8), Kap. 5; ders., Symmetrie und Symmetriebrechung. Zur Einheit und Vielheit in den modernen Naturwissenschaften, Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie XIX/2,1988, 290-307. 26 K. Mainzer, Symmetries in Nature, Chimia 42,1988, 161-171.
Die Philosophie des "Handwerklichen" Ein Beitrag zur Frage der Beschreibung und Handhabung komplexer Systeme Robert Rosen
1. Einleitung Medizin wird sowohl als eine Kunst als auch als eine Wissenschaft verstanden. Und in der Tat, sie sollte Elemente von beidem in sich vereinen. Aber zu allererst ist sie in ihrer praktischen Ausübung ein Handwerk und außerdem strebt sie an, auch eine Technologie zu besitzen. Sie ist eine angewandte Wissenschaft, insbesondere ist sie aber angewandte Biologie. In mancher Hinsicht ist sie aber eher angewandte Technologie als angewandte Wissenschaft. Wissenschaft hatte immer die Philosophie zur Seite; in der Tat wurde Naturwissenschaft über lange Zeit hin Naturphilosophie genannt. Die griechischen Philosophen waren zutiefst daran interessiert herauszufinden, was und wie die Welt zusammenhält, und sie haben schon vor mehr als zweitausend Jahren dafür die wichtigsten Grundlagen gelegt, wie zum Beispiel das atomistische Konzept oder das der unendlichen Teilbarkeit, ferner das der Evolution oder das der besonderen Schöpfungsakte. Aber sie haben weder eine Philosophie des Handwerklichen noch des Technischen entwickelt, vielleicht weil sie dazu neigten das Handwerkliche zu verachten und alles, was technische Dinge betraf dem TätigkeitsBereich der Sklaven zuzuordnen. Sicher würde es überraschen, Bücher mit folgenden Titeln zu finden: "Die Philosophie des Flugzeugs" oder "Die Philosophie des Automobils", und mehr noch ein Buch über "Die Philosophie der Auto-Reparatur und Pflege". Während die ersteren sich mit den technologischen Aspekten be-
260
Robert Rosen
schäftigen würde das letztere vor allem das Handwerkliche betreffen. Obwohl es ein Arzt sicherlich übelnehmen würde, mit einem Handwerker verglichen zu werden, gibt es sehr überzeugende Gründe dafür, genau dies zu tun. Denn die zeitgenössische biomedizinische Wissenschaft ist unausweichlich in die Cartesianische Tradition eingebunden, die ja behauptet, daß ein Organismus eine Maschine ist, wiewohl man heute "molekulare Maschine" sagen würde, aber eine Maschine ist es trotzdem. Wenn wir diese "Maschinen-Metapher" zulassen, welche zweifellos zu einer der wichtigen Grundlagen des gegenwärtigen Reduktionismus in der Biologie gehört, dann wird ein Organismus auch zum Gegenstand der Ingenieurstätigkeit (allerdings ohne den dafür zuständigen Ingenieur), und der Arzt ist jemand, der für die Aufrechterhaltung und das einwandfreie Funktionieren dieser Maschine verantwortlich ist. In diesem Sinne wird dann die Medizin selbst zu einer Ingenieurs-Kunst (Maschinenbau-Kunst), heute vielleicht eher im Sinne der Regelungstechnik. Wenn eine solche Maschine ihren Dienst versagt (zum Beispiel ein pathologisches Verhalten an den Tag legt) oder von dem ihr zugeschriebenen Verhalten abweicht, dann muß man nach den Ursachen für diese Abweichungen vom Normalen fahnden (zum Beispiel dadurch, daß man bestimmte Krisen beseitigt oder diagnostische Maßnahmen einleitet), um die notwendigen Reparaturen oder Anpassungen vorzunehmen (zum Beispiel therapeutische Schritte einzuleiten und/oder eine "Ersatz-teil"Medizin durchzuführen). Selbst wenn eine solche pathologische Abweichung nicht vorliegt, muß für das problemlose Funktionieren dieser Maschine Sorge getragen werden, um das erwartete Verhalten zu gewährleisten (zum Beispiel durch vorbeugende Maßnahmen, wie etwa durch Hygiene). Der einzige Unterschied zwischen der Medizin und anderen Formen der Regelungstechnik besteht darin, daß wir diese Maschine, genannt Organismus, weder gebaut haben (das heißt auch nicht für die Art und Weise ihres Seins verantwortlich sind) noch darüber wissen, wie sie wirklich funktioniert (das heißt, wir haben auch keine Kenntnis vom Wesen ihrer Funktion). Daher tappt der Arzt viel mehr im dunkeln als sein Gegenüber im technologischen Bereich. Statt sich auf festgelegte Leistungskriterien beziehen zu können, muß er sich mit einem Begriff von "Gesundheit" herumschlagen, der nachgewiesenermaßen schwierig oder
Die Philosophie des "Handwerklichen"
261
gar nicht quantitativ zu erfassen ist. Statt einer ausdrücklich bestehenden Fehleranzeige, welche auf dem Konstruktionsplan beruht, muß er sich mit einer begrenzten Anzahl diagnostischer Verfahren begnügen, die sich letztlich allein auf Erfahrung stützen. Das gleiche gilt für therapeutische Maßnahmen, von denen die meisten weitere Probleme erzeugen (nämlich in Form sogenannter Nebenwirkungen), die ihrerseits wiederum entsprechende Behandlungen erforderlich machen (das sind also iatrogen hervorgerufene Erscheinungen). Den einzigen Vorteil, den der Arzt besitzt, ist der, daß seine "Maschine" sich häufig selbst heilen kann und daß sie ihm sagen kann, wo es weh tut. Wegen dieser in der Sache selbst hegenden Unsicherheiten, ist Philosophie wieder gefragt, selbst wenn man die bisher behandelte MaschinenMetapher bejaht (die ihrerseits bereits eine Philosophie des Organismus darstellt). Wir müssen nämlich durchaus Fragen stellen wie: "Was ist Gesundheit?" "Worin besteht die Abweichung vom Normalen?" "Was ist Krankheit?" "Was sind Symptome oder Syndrome?" "Was ist eine Behandlung?" "Wie können wir therapeutische Nebenwirkungen minimieren oder ganz vermeiden?". Man kann natürlich solche Fragen formulieren, unabhängig davon, ob man die Maschinen-Metapher bejaht oder nicht. Aber die Art der Antworten, die man geben kann oder die man zu finden hofft, wird sich grundsätzlich unterscheiden, je nach dem, ob die Maschinen-Metapher zutrifft oder nicht. Aus vielen Gründen bin ich zu der Auffassung gelangt, daß das letztere der Fall ist. Im Folgenden werde ich versuchen, einige dieser Gründe in einer allerdings eher globalen Form zu beschreiben und auf die Schlußfolgerungen einzugehen, die sich für unsere Thematik ergeben.
262
Robert Rosen
2. Frei-Kugeln1 (magische Geschosse) und Nebenwirkungen Wir werden uns jetzt mit dem Begriff der Nebenwirkung beschäftigen, um damit auch einige der grundlegenden Ideen verständlich zu machen, die wir bisher behandelt haben. Unter Nebenwirkung verstehen wir, grob gesprochen, eine unvorhergesehene Folge einer Behandlungsmaßnahme, die zu einem ganz anderen Zwecke unternommen wurde. Eine Therapie, welche ohne jegliche Nebenwirkungen ist, kann man als eine immer erfolgreiche Handlung verstehen, durch die auf eine geheimnisvolle Weise immer das Ziel erreicht wird. In Analogie zu den Freikugeln, die zum Beispiel in Carl-Maria von Webers Freischütz ihr Ziel nie verfehlen, sei hier auch von Freikugeln gesprochen, allerdings ist dies im übertragenen Sinne zu sehen, da im medizinischen Sinne das "Ein Ziel-treffen" hier mit der Beseitigung der Krankheit gleichgesetzt wird. Die Freikugel erreicht den erwarteten Zweck, zum Beispiel die Heilung einer Krankheit, ohne irgend eine andere Wirkung auf das Gesamtsystem. Wenn man nun mit mechanischen oder elektrischen Apparaturen zu tun hat, sind alle effektiven Maßnahmen, die man bei deren Nicht-Funktionieren ergreift, sogenannte Freikugeln. Und wenn die Maschinen-Metapher auch für den Organismus zutrifft, dann müßte es idealerweise, zumindestens im Prinzip, immer medizinische Freikugeln geben. Aber unsere Erfahrung zeigt uns, daß es ganz anders ist. Warum ist das so? Es könnte natürlich sein, daß wir ganz einfach zu wenig Einzelheiten des Organismus kennen und zu wenig über die Wirkungen unserer Maßnahmen wissen, um die erhofften Freikugeln zu finden. Andrerseits könnte es aber durchaus sein, daß die immer vorhandenen Nebenwirkungen uns etwas Neues über den Organismus mitteilen, nämlich etwas, das mit der Maschinen-Metapher völlig unvereinbar ist. Wir werden nun kurz eine Position für die letztere Möglichkeit skizzieren. Nehmen wir einmal an, wir säßen in einem großen Raum, der eine große Menge Luft enthält. Da es sich um eine große Menge Luft handelt, wird die Raumtemperatur gegenüber äußeren Einflüßen relativ unempfindlich sein. In Bezug auf unsere Kurzzeiterfahrung wird es daher so sein, daß sich die Raumtemperatur nicht ändert und wir schließen daraus, daß die Temperatur konstant bleibt. Und außerdem nehmen wir an, daß wir die Temperatur so mögen, wie sie ist.
Die Philosophie des "Handwerklichen"
263
Eventuell wird sich natürlich die Raumtemperatur wegen der Einflüsse der Umgebung, denen gegenüber der Raum offen ist und die wir nicht direkt wahrnehmen, ändern. Das heißt, die tatsächliche Raumtemperatur wird von der erwarteten und erwünschten abweichen. Natürlich denken wir dann: Das können nur Stör-Einflüße sein. Wir können diese Situation in einem Diagramm darstellen, wie es uns aus jedem Lehrbuch der Regeltechnik vertraut ist:
Störung (Umgebung)
1 Zimmer
Zimmerwärme
(Temperatur) Abb. 1 Graphische Darstellung der Änderung der Zimmertemperatur durch Abfluß von Wärme aufgrund von Umgebungseinflüssen (Störungen)
Der Störeinfluß, der von außen kommt, ist nicht vorhersagbar. Wir haben davon kein klares Bild. Wir wollen seine Effekte aber trotzdem ausschalten, das heißt, wir wollen die Konstanz der Raumtemperatur wieder herstellen und auf dem gewünschten Wert halten. Was für eine Maßnahme also sollen wir einleiten? Nun, glücklicherweise sind wir sehr tüchtig und wir bauen uns einen Thermostaten, einen rückkoppelnden Regler, der die Raumtemperatur fühlt, sie mit der gewünschten Temperatur vergleicht und einen entsprechenden Eingriff vornimmt. Das heißt, wir werden unser ursprüngliches System in ein größeres, wie es in Abbildung 2 dargestellt ist, einbetten. Auf diese Art und Weise haben wir unseren Raum "geheilt"; wir haben eine Art eines dynamischen Isoliersystems entwickelt, welches unseren Raum von den Auswirkungen der Umgebungstemperatur abschließt. Und formal gesehen haben wir durch das sich anpassende System unseres rückkoppelnden Reglers eine Vorstellung von den Störeinflüßen erreicht, die ursprünglich gefehlt hat. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Der Thermostat selbst hat eine neue Material-Struktur, welche wir in das System einführen mußten, um die Auswirkungen der unvorhersagbaren Temperatur-Schwankungen zu be-
264
Robert Rosen
herrschen. Der Thermostat schließt zwar den Raum gegenüber der Umgebungs-Temperatur ab, ist selbst nun aber offen gegenüber anderen Einwirkungen, das heißt neuen Störquellen. Zum Beispiel können seine Bestandteile wegen der Luftfeuchtigkeit und des in der Luft unseres Raumes enthaltenen Sauerstoffs korrodieren. Diese neuen Störquellen können auch auf seine Funktion als Thermostat einwirken und damit letztlich auch die Regelung der Raumtemperatur beeinflussen.
Abb. 2 Schema eines Regelkreises zur Aufrechterhaltung einer vorgegebenen Zimmertemperatur
Das heißt, wir müssen dafür, daß wir das Original-System gegenüber der Umgebungstemperatur abgeschlossen haben, damit bezahlen, daß wir das System neuen Störeinflüßen öffnen. Das ist ein typischer Fall von Nebenwirkung, der schon hier in einer nur konstruierten Situation auftritt. Stellt man diesen Sachverhalt in einem Diagramm dar, so wird man statt des geschlossenen Regelkreises in Abbildung 2 jetzt die offene Situation, wie sie in Abbildung 3 zu sehen ist, vor sich haben, wo wir nun tatsächlich "mehr Störeinflüssen" ausgesetzt sind als vorher.
Die Philosophie des "Handwerklichen"
265
Störung
Abb. 3 Darstellung der Störung des Temperaturreglers
Was ist also zu tun? Wir brauchen offensichtlich mehr "Therapie", um die Nebenwirkungen beherrschen zu können, die wir durch die Einleitung der ursprünglichen Maßnahmen erzeugt haben. Wir könnten daran denken das zu wiederholen, was wir taten, als wir von Abbildung 1 zur Abbildung 2 fortschritten; das heißt, wir könnten noch mehr rückkoppelnde Schleifen einbauen, um die neuen Störquellen zu beseitigen. Wir würden dann zu etwas gelangen, wie es in Abbildung 4 dargestellt ist. (s. folgende Seite) Es sollte klar sein, was hier jetzt passiert. Bei jeder Stufe des Spieles setzen wir Regler ("Behandlungsmaßnahmen") ein, um die Nebenwirkungen des vorangehenden Stadiums zu handhaben, dadurch, daß wir das aber tun, öffnen wir das System immer weiter. Schon an diesem so einfachen Beispiel können wir erkennen, wie sich ein drohender tödlich unendlicher Regress gähnend vor uns auftut Tatsächlich kann man an diesem so kleinen Beispiel einen Sachverhalt verdeutlichen, der durchaus in sehr allgemeiner Art formuliert werden kann. Die wirkliche Frage, die sich hier nämlich stellt, ist die, ob und wenn ja, wann dieser potentiell unendliche Regress unterbrochen werden kann. Wir werden nun im folgenden kurz zeigen, daß diese Frage eine Infragestellung der Maschinen-Metapher selbst bedeutet
266
Robert Rosen
Störung
Abb. 4 Darstellung der Aufhebung des Störungseinflusses auf den Temperaturregler mit Hilfe eines 2. Regelkreises
3. Wie kommt man mit unendlichen Regelungs-Regressen zurecht? Lassen Sie uns noch einmal zum ersten Stadium unseres drohenden unendlichen Regresses zurückkehren, das heißt zu dem kleinen mutmaßlichen Thermostaten, der in Abbildung 2 dargestellt ist. Wie wir schon ausgeführt haben, ist das Regelsystem eigens dafür entwickelt worden, mit der von ihm erzeugten regelnden Stellgröße auch ein genaues Bild oder eine genaue Vorstellung von der Störquelle (das heißt in diesem Falle von der Umgebung) zu vermitteln, welches das Verhalten unseres Systems beeinflußt. Die Stellgröße ist in das System selbst mit einem negativen Vorzeichen zurückgekoppelt, sodaß es folgende Gleichung ergibt Stellgröße + Störgröße = 0.
(1)
Wenn diese Bedingung erfüllt ist, wird der festgesetzte Wert des Kontrollsystems zu einem Abbild des Systems selbst; das heißt
Die Philosophie des "Handwerklichen"
267
Temperatur = Soll-Wert = konstant. (2) Aber, wie wir weiter oben ausgeführt haben, ist das Regelsystem selber Störeinflüssen unterworfen. Das Resultat kann nur sein, daß (1) und daher auch (2) nicht erfüllt werden können. Mit anderen Worten: Die Stellgröße, die wir in der Abbildung 2 dargestellt haben, entspricht nicht mehr einem Modell des ursprünglichen Störeinflusses, den wir eigentlich regeln bzw. ausschalten wollten. Daher haben wir die zweite rückkoppelnde Regler-Schleife in Abbildung 4 eingeführt. Die kombinierten rückkoppelnden Signale dieser beiden Regelschleifen in der genannten Abbildung vermitteln eine bessere Darstellung des ursprünglichen Störeinflusses, der unser System durcheinanderbringt, als der erste Regelkreis allein. Aber es ist, wie gesagt, immer noch nicht ausreichend und gut genug. Daher müssen wir diesen Regelkreis immer weiter verbessern, wieder und wieder, unbeschränkt. Man kann sich nun aber durchaus vorstellen, daß so ein potentiell unendlicher Regress tatsächlich irgendwann abbricht. Das wird aber dann und nur dann der Fall sein, wenn wir den Sachverhalt so einrichten, daß der Störeinfluß, der bei der n-ten Stufe dieser Folge auftritt, wiederum zu Folgen führt, die einer Regelung, welche zu einem früheren Zeitpunkt eingeführt wurde, unterliegen. In einem solchen Falle würde die Folge nach der n-ten Stufe abbrechen. Tatsächlich würde eine solche endliche Folge von Regelkreisen der Länge η unserer "Freikugel" entsprechen. Um es mit anderen Worten zu sagen: Die Stellgrößen der η Regelkreise zusammen stellen eine komplette Abbildung des ursprünglichen Störeinflußes dar (das heißt, sie sind eine Abbildung der ursprünglichen Umgebung des Systems), und der Sollwert in unserem ersten Regelkreis ist, letzten Endes, ein vollständiges Modell unseres ursprünglichen Systems. In unserem kleinen Beispiel konnte das System, das wir zu regeln wünschten, durch eine einzige Zustandsvariable, nämlich die Temperatur, gekennzeichnet werden. Außerdem gab es in unserem Beispiel keine autonome Dynamik; es gab nur ein Reagieren auf Störeinflüße. Es ist nicht schwierig, unsere Analyse auf wesentlich allgemeinere Situationen auszudehnen, in denen das System, welches wir regeln wollen, durch eine endliche Anzahl von Zustandsvariablen (oder explizite Funktionen dieser Variablen, das heißt entsprechender Beobachtungsgrößen) gekennzeichnet werden muß, in dem jede unter dem Einfluß der anderen steht (bei auto-
268
Robert Rosen
nomer Dynamik) und unter der Einwirkung äußerer Störgrößen (die erzwungene Dynamik). In solch einem Fall würde jede Zustandsvariable und jeder Parameter der autonomen Dynamik, wie in unserem kleinen Beispiel, für sich behandelt werden. Die Berechnung wird natürlich zunehmend komplizierter werden, aber letzten Endes bekommen wir nur eine größere Familie von kaskadenartigen Regelkreisen, von denen jede das Potential dieses unendlichen Regresses in sich birgt. Eine Situation, in der jede Kaskade nach einer endlichen Zahl von Schritten abbricht erweist sich als gleichbedeutend zu der, deren Merkmal ich anderen Ortes (vgl. R. Rosen 1984, 1985, in press) als Einfachheit bezeichnet habe. Grob gesagt, ich definierte ein System als einfach, wenn alle seine Modelle berechenbar sind oder simuliert werden können. In einem solchen Fall und nur in einem solchen Fall enthält die Gesamtheit (oder Kategorie) aller Modelle ein eindeutig bestimmtes maximales Element, ein größtes Modell, von dem alle anderen Modelle durch rein formale Mittel hergeleitet werden können. Eine andere Bezeichnung für solche einfachen Systeme ist die eines Mechanismus. In einem solchen Falle, muß also tatsächlich ein Spektrum von minimalen Modellen ("Atomen") existieren, aus denen das größte Modell nach kanonischen Regeln konstruiert werden kann. Diese Klasse von einfachen Systemen ist das Paradies des Reduktionisten: Die grundlegende Behauptung des Reduktionismus ist die, daß jedes materielle System einfach ist. Wie ich an anderer Stelle argumentiert habe (vgl. Rosen 1988), ist dies gerade die materiale Fassung des Theorems von Church. Nun, wie wir schon dargelegt haben, stellen kaskadenartig angeordnete Regelkreise der betrachteten Art selbst wiederum Modelle von den zu regelnden Systemen und ihrer Umgebung dar. Demgemäß müssen sowohl das System wie auch seine Umgebung beide einfach sein, wenn (1) die Regelkreise selbst einfach sind und wenn (2) jede solcher Kaskaden nach einer endlichen Anzahl von Schritten abbricht. Umgekehrt, wenn ein System (und/oder seine Umgebung) nicht einfach ist, dann muß mindestens eine Kaskade von einfachen Reglern existieren, die nicht abbricht. Oder: Wenn eine solche Kaskade, die nicht abbricht, existiert, dann kann die Situation, die wir regeln wollen, nicht einfach sein. Ein System, das in diesem Sinne nicht einfach ist, das heißt, das kein Mechanismus ist, nenne ich komplex. Es sei darauf hingewiesen, daß die-
Die Philosophie des "Handwerklichen"
269
ser Gebrauch des Terminus "komplex" sich grundlegend von der Art und Weise unterscheidet, in der ihn andere Autoren definieren. Insbesondere sind Einfachheit und Komplexität keine in Zahlen zu messenden Größen. Nicht einmal würde die bloße Addition numerischer Parameter bei kleinen Werten "Einfachheit" und bei großen Werten "Komplexität" ergeben. Die Maschine-Metapher behauptet aber gerade, daß alle Organismen in dem oben genannten Sinne einfach sind. Offensichtlich hat aber nun die Wahrheit oder Falschheit dieser Metapher tiefgreifende Folgen für das Verständnis von Medizin als Handwerk, und mehr noch für Handwerk und Technologie überhaupt.
4. Eine Nebenbemerkung zu komplexen Systemen In diesem Abschnitt möchte ich behaupten, daß das, was ich Komplexität genannt habe, tatsächlich die normale und allgemeine Situation darstellt. Dementsprechend ist die mutwillige Hypothese der Einfachheit (das heißt, der Berechenbarkeit oder Simulierbarkeit von allen Modellen) ziemlich starker Tobak, durch den wir uns selbst in ein Universum ganz besonderer Art einsperren. Ich werde dies darlegen, in dem ich einen kurzen Vergleich mit einer sinnverwandten Situation vornehme, die in der Mathematik entstanden ist. Danach werde ich die Beziehung zu dem Gegenstand unserer Betrachtung skizzieren. Die Mathematik selbst wurde während des größten Teils der letzten hundert Jahre von einer "Grundlagen-Krise" erschüttert, die durch das herbeigeführt wurde, was mit der euklidischen Geometrie geschah und zum Teil durch die Entdeckung der mengentheoretischen Paradoxien. Die besondere Natur dieser Krise braucht uns hier nicht zu interessieren, wenngleich bemerkt sei, daß die damit verbundene Beschäftigung mit der Konsistenz formaler logischer Systeme zu tun hat und daß diese Sache noch völlig offen ist. Ein Lösungsversuch dieser Krise, den man Formalismus nennt, wurde von David Hilbert in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts vorgeschlagen. In aller Kürze: Hilbert schlug vor, die gesamte Mathematik als bloßes Spiel mit einer endlichen Familie von bedeutungslosen Symbolen zu betrachten, mit denen man mit einem Satz festgelegter Regeln Opera-
270
Robert Rosen
donen vornimmt. Das bedeutet, ein mathematisches System wird zu einem Spiel der Mustererzeugung; einer Symbol- oder Wort-Verarbeitung und könnte als solches ganz und gar durch eine Maschine ausgeführt werden. Tatsächlich wurden später von dem Mathematiker Alan Turing Maschinen dieser Art charakterisiert. Diese Turing-Maschinen wurden dann später mit Digitalcomputern gleichgesetzt. Die Begriffe berechenbar und simulierbar, die wir oben benutzten, beziehen sich genau auf das, was solche Maschinen leisten. Grob gesprochen, etwas ist simulierbar oder berechenbar, wenn es entsprechend der hardware einer solchen Maschine als software (zum Beispiel als Programm) ausgedrückt oder dargestellt werden kann. Hilberts Programm des Formalismus behauptet genau das, nämlich daß jedes mathematische System ohne irgendeinen inhaltlichen Verlust so ausgedrückt werden kann. Es stellt somit eine formale Fassung der reduktionistischen Hypothese dar, daß jedes (in diesem Falle mathematische) System einfach ist. Das Hilbert'sehe Programm scheiterte 1931 mit der Veröffentlichung des berühmten Gödel'schen Unvollständigkeitstheorems. Tatsächlich zeigte Gödel, daß die Zahlentheorie, die vielleicht als Herzstück aller Mathematik anzusehen ist, nicht in diesem Sinne formalisierbar sein kann, es sei denn, sie war schon vorher inkonsistent. Gödel zeigte ausdrücklich, daß jeder Versuch die Zahlentheorie zu formalisieren, notwendigerweise zum Verlust der Beweisbarkeit der meisten ihrer Aussagen führt. Das heißt, er zeigte, daß die Zahlentheorie in unserem Sinne komplex ist. Nun gibt es offensichtlich eine tiefgehende Parallele zwischen der formalistischen Sicht der Mathematik (zum Beispiel von bedeutungslosen Symbolen, mit denen man nach formalen Regeln herumspielen kann) und der reduktionistischen Sicht der materiellen Welt, die aus Gebilden strukturloser (bedeutungsloser) Teilchen besteht, mit denen auf sie einwirkende Kräfte herumspielen. Und geradeso wie Hilbert alle Arten mathematischer Schlüsse durch Symboloperationen zu ersetzen suchte, so strebt die reduktionistische Anschauung danach, die gesamte Kausalität in "Gesetzen" zu fassen, dies setzt stillschweigend die Berechenbarkeit aller Modelle voraus. Wie wir schon dargelegt hatten, ist die Berechenbarkeit in der Mathematik eine außerordentlich starke Festsetzung, die eine verschwindend kleine Klasse von ungewöhnlichen (und sehr schwachen) Systemen kennzeichnet. Was wir aber vorschlagen ist, daß das gleiche auch in der materiellen Welt gilt. Grob gesprochen würde dies bedeuten, daß Kausalität (das ma-
Die Philosophie des "Handwerklichen"
271
terielle Analogon zu mathematischen Konsequenzen oder Schlüssen) mehr beinhaltet als das, was in einfachen Systemen vor sich geht. Mathematiker hören deswegen nicht auf, sich mit Zahlentheorie zu beschäftigen, weil sie nicht formalisierbar ist. Sie sehen Formalisierbarkeit einfach als irrelevantes Hindernis an. In gleicher Weise muß man deswegen auch nicht aufhören, Wissenschaft zu betreiben, weil man sich mit Komplexität konfrontiert sieht. Aber es ändert die Art und Weise, wie man Wissenschaft betrachtet und folgerichtig auch wie man Handwerk und Technologien, die damit verbunden sind, einschätzt.
5. Einige vorläufige Schlußfolgerungen In den vorangehenden Abschnitten haben wir versucht ein Konzept von Komplexität einzuführen und zu begründen. Ein System nennen wir, wie schon angedeutet, komplex, wenn es kein simulierbares Modell darstellt. Die Wissenschaft solcher komplexen Systeme unterscheidet sich grundlegend von der Wissenschaft, mit der wir es in den letzten drei Jahrhunderten zu tun hatten. Darüber hinaus können komplexe Systeme nicht in dem Begriffssystem irgend eines reduktionistischen Schemas beschrieben werden, welches auf einfachen Systemen basiert. Da die Wissenschaft sich somit unterscheidet, unterscheiden sich auch die Technologien, welche sich auf solch eine Wissenschaft gründen, und dasselbe gilt für das Handwerk, das dem System zugehört, mit dem sich diese Wissenschaft beschäftigt. Insbesondere müssen wir zu einer gänzlich anderen Sicht der Medizin kommen, wenn wir uns die Anschauung zu eigen machen, daß die Organismen, welche die Medizin behandelt, selber eher komplexe als einfache Systeme (wie zum Beispiel Maschinen oder Mechanismen) darstellen. Ein wesentlicher Gesichtspunkt, auf den wir die Aufmerksamkeit gelenkt haben, ist der, daß komplexe Systeme in einem viel größeren Umfang mit Hilfe von Verallgemeinerungen beschreibbar (oder alternativ: "Verallgemeinerungen enthalten" oder "nach Verallgemeinerungen geordnet" (generic)) sind als einfache Systeme, vergleichbar etwa den transzendentalen Zahlen, die wesentlich mehr generic sind als die rationalen Zahlen.
272
Robert Rosen
Insbesondere ist die Forderung nach der Berechenbarkeit von SystemModellen, allein für sich gesehen, schon eine eigenwillige Übertreibung. Die zeitgenössische Physik ist, in der Tat, voll von solchen Ordnungsunfähigkeiten (nongenericities). Erhaltungsgesetze, Abschluß (closure), Symmetrie-Bedingungen, die Exaktheit von Differential-Formen und eine ganze Anzahl von anderen sehr vertrauten Dingen ähnlichen Charakters bringen Ordnungsunfähigkeiten (non-genericity) hervor, und sie wurzeln letzten Endes in den Folgerungen aus der ursprünglichen Annahme der Einfachheit Allgemein gesagt, ziehen Ordnungsunfähigkeiten Ungereimtheiten (nongenericities degeneracy) nach sich. Nämlich das Erzwingen der Koinzidenz von zwei anfänglich deutlich unterschiedenen und voneinander unabhängigen Dingen oder aber das Auf-Oktroyieren von Beziehungen zwischen Dingen, die anfänglich keinen Bezug zueinander haben. So ist es auch hier: Einfachheit erzeugt viele solcher Ungereimtheiten (degeneracies). Zum Beispiel könnte man eine der Folgerungen aus der Einfachheit wie folgt beschreiben (obwohl wir dies hier nicht näher ausführen und belegen können): Die Seinsanalyse (Ontology) eines einfachen Systems kann vollständig unter seine Entstehungsgeschichte (Epistemology) subsummiert werden. Zum Beispiel wird in der zeitgenössischen Biologie angenommen bzw. vorausgesetzt, daß genau dergleiche Umfang analytischer Größen, die angenommenerweise für die Tätigkeit und das Funktionieren eines Organismus verantwortlich sind, auf irgendeine Weise auch, gleichzeitig, sein Zustandekommen oder seinen Ursprung bestimmen. Das ist eine direkte Hinterlassenschaft der Maschinen-Metapher; danach würde zum Beispiel der gleiche Satz von Teilen, der uns in die Lage versetzt, die Tätigkeit einer Uhr zu verstehen, uns auch, sagen wir, in den Stand bringen, die Uhr auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen, und, noch mehr, Fehlfunktionieren während ihrer Tätigkeit zu erkennen und zu reparieren. In komplexen Systemen ist dies jedoch nicht länger der Fall. In komplexen Systemen ist die Seinsanalyse (Ontology) und die Entstehungsgeschichte (Epistemology) eines solchen Systems im allgemeinen sehr unterschiedlich. In unser gegenwärtigen Wissenschaft, welche sich fast ausschließlich auf entstehungsgeschichtliche (epistemological) Fragen konzentriert hat, wird dementsprechend nur relativ wenig Wert auf die seinsanalystischen
Die Philosophie des "Handwerklichen"
273
(ontologischen) Aspekte gelegt, wenn die beiden sich sehr unterscheiden. Das ist genau auch der Grund dafür, warum das Problem des "Ursprungs des Lebens" (oder auch, was diese Sache angeht, jedes Problem, das sich mit dem "Ursprung-von-irgendetwas" beschäftigt) so schwierig ist. Da die Medizin in ihrem diagnostischen Bereich vorwiegend die Entstehungsgeschichte (Epistemologi') miteinbezieht, während ihr therapeutischer Bereich vorallem Seinsanalyse (Ontology) beansprucht, gewinnt die Trennung der beiden für komplexe Systeme eine zentrale Bedeutung. Tatsächlich ändert sich das ganze Konzept des Handwerklichen vollständig, wenn man es mit komplexen Systemen zu tun hat. Denn wir können uns ganz allgemein diesen komplexen Systemen nicht ausschließlich mit einfachen Mitteln nähern. In einem gewissen Sinne nämlich sind komplexe Systeme "unendlich offen"; genauso wie es mit jedem unendlichen Ding ist, können wir auch ihre Kapazitäten, die sie für ihr Wechsel wirken miteinander benutzen, nicht dadurch erschöpfen, daß wir versuchen, ihre Parameter nacheinander zu regeln. Insbesondere würden solche kaskadenartigen Regelkreise, wie wir sie in Abschnitt 2 beschrieben haben, im allgemeinen nicht abbrechen; daraus folgt, daß "Freikugeln" in der geschilderten Art im allgemeinen nicht existieren werden. Andrerseits können wir uns jetzt durchaus Strategien der Regelung vorstellen, die Stellgrößen miteinbeziehen, die ihrerseits wiederum komplex sind. Es könnte sich herausstellen und wäre auch durch nichts zu verhindern, daß derartige Stellgrößen die erwünschten "Freikugeln" selbst darstellen. In der Tat könnten ganz allgemein für komplexe Systeme auch komplexe Stellgrößen die einzig vernünftige Hoffnung sein. Es ist zur Zeit noch zu früh, um zu sagen, wie sich derartige Ideen in der Zukunft weiter entwickeln werden. Mein Hauptanliegen ist es jedoch gewesen, etwas von der Würze (dem Aroma) des Konzeptes der Komplexität miteinzubringen und zu zeigen, in welcher Form ein solches Konzept auch grundlegende biologische Fragen betreffen und wie es eine Neu-Einschätzung nicht nur unserer Wissenschaft sondern auch unseres Konzeptes von Kunst und Handwerklichem erzwingen könnte. So könnte es sich tatsächlich herausstellen, daß sich, wie schon früher, die Handwerksarbeit als der beste Wegweiser erweisen könnte, um die Wissenschaft selbst zu leiten.
274
Robert Rosen
Anmerkungen 1 Freikugeln sind nach der Sage Kugeln, die durch teuflische Mithilfe gegossen wurden und die ihr Ziel nie verfehlen. In der Oper "Der Freischütz" von Carl-Maria von Weber spielen die Freikugeln eine entscheidende Rolle.
Literatur [1] Rosen, R. (1984), The Physics of Complexity. Second W. Ross Ashby Memorial Lecture. 7th. European Meeting on Cybernetics & Systems Research, Vienna, Austria, April, 1984. Systems Research 2, 1985, 171- 175. Ebenso in: R. Trappl (ed.), Power, Autonomy, Utopia. Plenum Press, New York 1985 [2] Rosen, R. (1985), Anticipatory Systems. Monograph. Pergamon Press, Oxford (Appendix also appearing in Collaborative Paper for IIASA, Laxenburg, Austria, CP-85-19). [3] Rosen, R. (1988), Effective Processes and Natural Law. In: R. Herken (ed.), The Universal Turing Machine. A. Half Century Survey, Kammerer & Unverzagt, Hamburg, Berlin, S. 523-537. [4] Rosen, R.(in press), Life Itself. (Monograph).
Das Reduktionismusproblem und seine Überwindung Wolf gang Deppert
1. Das Reduktionismusproblem 1.1 Was heißt Reduktion? Wenn wir als Kinder bei unseren kleinen Wanderungen auf einen Bach stießen, dann war es für uns äußerst spannend, den Bach in die Richtung zu verfolgen, aus der das Wasser strömte. Obwohl es uns damals nie gelungen ist, bis an eine Quelle vorzustoßen, waren wir dennoch davon überzeugt, daß es die Quelle geben muß. Als ich viel später im Gebirge Quellen gesehen habe, wurde ich dabei immer von einem tiefen Staunen und einem seltsamen Gefühl erfaßt, das ich ein heiliges Gefühl nennen möchte. Was treibt uns dazu, Quellen aufzusuchen, woher wissen wir, daß es sie geben muß und warum wird unser Gefühl so stark ergriffen, wenn wir eine Quelle gefunden haben? Vielleicht lassen sich diese Fragen aus unserer Erziehung, unserer Geschichte oder gar aus der biologischen Evolution des Menschen beantworten. Aber indem wir so fragen, suchen wir dabei nicht schon wieder nach einer Quelle, nach der Quelle für den Antrieb, Quellen von Bächen zu suchen? Auf diese zweite Quelle, nach der hier gefragt ist, läßt sich gewiß nicht mehr in dem Sinne zeigen, wie wir auf die Quelle eines Baches hinweisen können. Ich möchte sie eine gedankliche Quelle nennen, weil wir sie nur in unseren Gedanken vorfinden können. Gedankliche Quellen aber werden sich kaum durch biologische Evolution erklären lassen, denn sie stammen vielmehr aus der menschlichen Geistesgeschichte, die viel zu
276
Wolfgang Deppert
kurz ist, als daß sie biologisch bedingte Veränderungen unseres Denkvermögens erzeugen könnte. Aber auch der Versuch, geistesgeschichtliche Ursprünge für dieses Streben nach gedanklichen Quellen aufzufinden, läßt nach einer dritten Art von Quelle fragen, die wiederum erklärt, warum wir auch diesen Versuch noch unternehmen, und man erkennt leicht, daß auf diese Weise das Fragen zu keinem Ende kommt. Der hier unvermeidlich auftretende unendliche Regreß des Fragens bedeutet, daß es aus prinzipiellen Gründen keine Antwort auf die Frage geben kann, warum wir immer wieder bestrebt sind, nach Quellen oder Ursprüngen zu suchen. Wir können nur feststellen, daß es auf geheimnisvolle Weise so ist. Das Verfahren, etwas Existierendes, wie z.B. einen Bach, aus etwas anderem Existierenden, wie z.B. aus einer Quelle, abzuleiten oder einen Begriff auf andere Begriffe zurückzuführen, nennt man Reduktion. Im ersten Fall der existierenden Dinge möchte ich von existentieller Reduktion und im zweiten Fall der gedanklichen Ableitungen von begrifflicher Reduktion sprechen. Gewiß können wir die existentielle Reduktion nur mit Begriffen beschreiben und die Begriffe haben auch stets eine bestimmte Existenzform der Gedanken. Aber in einer Reduktion sollte unterschieden werden, ob auf die existentielle Frage geantwortet werden soll: Wodurch und in welcher Existenzform1 existiert das, was wir begrifflich beschreiben? oder auf die begriffliche Frage: Wie ist der Begriff bestimmt, mit dem wir etwas beschreiben wollen? In jeder Reduktion, einerlei ob sie existentieller oder begrifflicher Art ist, werden gewisse einzelne Größen benötigt, durch die die verschiedenen Stationen der Reduktion charakterisiert werden, und Gesetze oder Regeln und gewisse Randbedingungen, durch die festgelegt wird, wie man von einer Station zu einer nächsten kommt. Im Bachbeispiel sind die einzelnen Größen durch die Wassermenge gegeben, die an einer Stelle durch den Bach fließt. Die Ableitungsgesetze, die bestimmen, wie das Wasser von einer Stelle des Bachbetts zur nächsten kommt, ist das Gravitationsgesetz und das Gesetz der Inkompressibilität des Wassers, während als Randbedingungen die Stabilität und Wasserundurchdringlichkeit des Bachbettes anzusehen sind. In einer begrifflichen Reduktion sind die einzelnen Größen einzelne Begriffe und Aussagen über Begriffe, und die Ableitungsgesetze sind Definitionsregeln und Regeln des logischen Schließens.
Das Reduktionismusproblem und seine Überwindung
277
Formal stellt der Begriff der Reduktion eine mehr-stellige Relation mit mindestens drei Stellen dar, d.h., eine Reduktion bedeutet, daß eine Sache Ρ durch Gesetze § auf eine Sache Q reduziert oder zurückgeführt wird. Dieser relationale Zusammenhang sei abgekürzt mit R(P,§,Q). Spielen noch Anfangs- und Randbedingungen $ eine Rolle, dann wird die Reduktion zu der vierstelligen Relation R(P,§,$,Q). Will man die logische Form der Reduktionsrelation bestimmen, so ist zu fragen, in welcher Weise Ρ und Q verknüpft sein können und sein sollen. Für eine Ableitungsbeziehung zwischen zwei Aussagen ρ und q gibt es drei Möglichkeiten: 1. q ist notwendig für p, d.h., es gilt die logische Beziehung: 'wenn ρ dann q' oder in logischen Zeichen ausgedrückt: ( ρ -> q ), 2. q ist hinreichend für p, d.h., es gilt die logische Beziehung: 'p weil q' oder in logischen Zeichen ausgedrückt: ( ρ
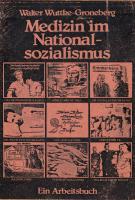



![›Gender-Medizin‹: Krankheit und Geschlecht in Zeiten der individualisierten Medizin [1. Aufl.]
9783839421314](https://dokumen.pub/img/200x200/gender-medizin-krankheit-und-geschlecht-in-zeiten-der-individualisierten-medizin-1-aufl-9783839421314.jpg)
![Botulinumtoxin in der ästhetischen Medizin [2. Aufl.]
9783662589526, 9783662589533](https://dokumen.pub/img/200x200/botulinumtoxin-in-der-sthetischen-medizin-2-aufl-9783662589526-9783662589533.jpg)
![Chemie in der Medizin [9 ed.]
9783110211306](https://dokumen.pub/img/200x200/chemie-in-der-medizin-9nbsped-9783110211306.jpg)
![Antike Medizin: Die naturphilosophischen Grundlagen der Medizin in der griechischen Antike [2. verb. Aufl. Reprint 2015]
9783110821499, 9783110013382](https://dokumen.pub/img/200x200/antike-medizin-die-naturphilosophischen-grundlagen-der-medizin-in-der-griechischen-antike-2-verb-aufl-reprint-2015-9783110821499-9783110013382.jpg)

