Vom Zeichen zur Szene: Der Diskurs der Bedeutungsproduktion in Präsenzgesellschaften 9783839438367
Since Saussure, the connection of an idea to a phonic pattern has been known as a 'sign'. In order to make the
156 37 970KB
German Pages 204 Year 2016
Polecaj historie
Table of contents :
INHALT
EINFÜHRUNG
1. VORLESUNG
2. VORLESUNG
3. VORLESUNG
4. VORLESUNG
5. VORLESUNG
6. VORLESUNG
7. VORLESUNG
8. VORLESUNG
9. VORLESUNG
10. VORLESUNG
11. VORLESUNG
12. VORLESUNG
13. VORLESUNG
14. VORLESUNG
15. VORLESUNG
16. VORLESUNG
17. VORLESUNG
LITERATUR
Citation preview
1
Ralf Bohn Vom Zeichen zur Szene. Der Diskurs der Bedeutungsproduktion in Präsenzgesellschaften
Szenografie & Szenologie
Band 15
2
EDITORIAL Die Reihe „Szenografie & Szenologie“ versammelt Aufsätze und Monografien zur praktischen und theoretischen Szenografie, zur Inszenierung und Inszenierungskritik im Kontext neuer Medien und Medientechniken. Die Reihe wird herausgegeben von Prof. Dr. Ralf Bohn und Prof. Dr. Heiner Wilharm.
3
Ralf Bohn VOM ZEICHEN ZUR SZENE Der Diskurs der Bedeutungsproduktion in Präsenzgesellschaften
4
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2017 transcript Verlag Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung der Copyright-Inhaber urheberwidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen. Umschlaggestaltung: Ralf Bohn Umschlagabbildung: Ralf Bohn Korrektorat: Bernadette Fülscher Satz: Ralf Bohn Printed in Germany Print-ISBN 978-3-8376-3836-3 PDF-ISBN 978-3-8394-3836-7 Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Besuchen Sie und im Internet unter: http://www.transcript-verlag.de Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis und andere Broschüren an unter: [email protected]
5
INHALT
EINFÜHRUNG 9 1. VORLESUNG 15 Textproduktion und Dingproduktion – Zwei Formen der Ökonomie: die Warenökonomie des Tauschs durch Arbeit und die Zeichenökonomie des Spiels – „Szene“ bezeichnet die Produktionsweise der Wiederholbarkeit – Semiotik als Effekt der Lesbarkeit von Medien – Das System des Zeichens ist nicht der orthogonale Raum, sondern die soziale Zeit – Das reine Zeichen dient der Reproduktion von Bedeutung – Szene sei die minimale Einheit der Semiologie, das Zeichen die temporale Einheit einer Produktion 2. VORLESUNG 29 Sprache ist Effekt ohne Ursache – Die Szene hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Sie stellt ihre Zeitdauer dar – In der Praxis der Schrift ist jeder für sich der Andere – In der Sprachhandlung sind die Subjekte präsent, als transzendierte Anwesende: Sie beobachten sich nicht, wie sie handeln – Der Unmöglichkeit der Identität entspricht die Tabuisierung des Inzests – Warum sollte die Theorie lügen? Und warum sollte die Praxis gelingen? 3. VORLESUNG 41 Wissensproduktion als Stabilisierungspraktik von Wert – Vier Vorschläge zur szenischen Wende der Semiotik: 1. Die Szene als Einheit des Zeichens; 2. Szenen sind vom Anderen veranlasst; 3. Situativität ist Selbstreferenz; 4. Das Innen/Außen-Verhältnis der Szene ist homolog und inversiv, d.h. struktural 4. VORLESUNG 51 Konsum ist eine Sprache – Die Tauschfrequenz bestimmt den Wert. Der Zeichentausch ersetzt die Zeichenverweisung – Szenografie ist Rückführung in leibliche Fühlbarkeit – Den Menschen als Nullpunkt neu vermessen – Inszenierung ist eine ephemere Ware – Was ist das Element der Zeit? – Saussures Graphophobie – Jedes Wort ist die ganze Sprache 5. VORLESUNG 67 Warentausch als Zeichentausch – Das Paradox, die technische Überschreitung der Sinne in einen für die Sinne zugänglichen Sinn zu übersetzen – Die Frage nach dem Menschen, dem Humanismus und der Anthropogenität der natürlichen Sinnesleistungen – Phantasie und Traumproduktion – Kurzfassung der Semiologie – Die Szene ist sowohl wiederholbar als auch revidierbar; sie lässt eine Wahl/ein Zögern bedeutsam werden – Die Szene befreit vom Präsenzopfer – Warum ist Verständigung trotz aller Unterschiede möglich? – Mandelbrot: Bedeutung als approximative Funktion zwischen Maßstab und Wert
6
6. VORLESUNG 81 Darstellung ist einzigartige Wiederholung – Urszene als existentielle Differenz – Brechts Medientechnikgeschichte – Wiederaufnahme allegorischer Tradition – Kritik als deinszenatorische Wirkung der Reinszenierung situativer Handlungen – Der Code als Vermittlung individueller Allgemeinheit 7. VORLESUNG 91 Eine Medientechnikgeschichte – Das Subjekt als Membran der Feldebenen – Sprechen, Schreiben, Lesen sind technische Vorgänge – Saussures Demokratisierung der Zeichen – Semiologie ist Politik der Werte und Intensitäten – Praxis ist der Fond des seriellen Funktionierens der Gesellschaft 8. VORLESUNG 99 Zeichenverhältnisse als Tauschverhältnisse – Agon der Dissoziation einer Serie – Geld und Zeichen – Die theoretische und die praktische Perspektive – Eine Unterscheidung als Anfang setzen – Eliminierung des Anderen – Eigentumsform – Die Synthesen enden in der leiblichen Situiertheit – Stimme ist Experimentierraum politischer Vergemeinschaftung 9. VORLESUNG 109 Die natürlichen Sprachen und ihr Verhältnis zu Medienmaschinen – Die Differenz aus Opfer und Gabe geht der Synthese voraus – Den Tod der Geschichte und das Ende der Kommunikation aufschieben – Die protowissenschaftliche Epoche der Semiotik – Inszenierung ist konstitutive Simulation von Vergesellschaftung als zeitlicher Periode – Inszenierung ist der Ereignisträger, der die Dauer der Aufmerksamkeit in einer Disposition ohne Transposition stabilisiert – Ersetzung des Relationsbegriffs durch den Begriff der Funktion – Wie ist zwischen Konsenstheorie und Konflikttheorie zu vermitteln? – Das Zeichen ist die mit sich selbst streitende Zeitlichkeit der Subjektivität 10. VORLESUNG 125 Das Verhältnis von Wirklichkeit und Möglichkeit bezeichnet Peirce als Signifikation – Inversion ist Signifikation – Zeit ist angeschautes Werden – Überschreitung im Hinblick auf Bedeutung, realisiert Möglichkeit innerhalb von Wirklichkeit – Verzeitlichung des Zeichens – Aufhebung des Strukturalismus als Verhältnis „Teil/Ganzes“ – Präsenz ist positives Merkmal situativer Unabschließbarkeit der Interpretation – Ist der Entwurf als Überschreitung einer Konvention unterworfen? 11. VORLESUNG 133 Programm der Geltungssicherung – Zerbrechen des anthropologischen Konsenses in einen informationslogischen und einen sozialwissenschaftlichen Zeichengebrauch – Verdichtung der Zeit – Stimme ist kometenhafte Spur eines Erscheinens der Präsenz – Der Schein opferloser Gabe im Sprechen – Reduktion des Wertes auf eine ökonomische Wahl des Gleichen (Reproduktion) 12. VORLESUNG 141 Sartres Politik der regressiv-progressiven Hermeneutik – Die Grenzen der analytischen und der dialektischen Vernunft als mediale Einheiten des Zeichens – Das Medium der
Situation ist die Praxis – Praxis ist der widerspruchslose und widerstandslose serielle Umgang des Menschen mit den Dingen – Situationsbewusstsein und Entwurfsbewusstsein – Aufgabe des Reflexionsparadigmas – Die dritte Negation: Produktion von Möglichkeit – Strukturdenken ist Herrschaftsdenken über Zeit 13. VORLESUNG 151 Gadamers philosophiehistorische Ableitungen – Hermeneutik ist Methodik, nicht Theorie – Das Symptom ist Produktion eines sich selbst aufhebenden Produkts, Dings, das kein Ding sein will – Kunst ist Unding, sich selbst aufhebendes Spiel – Der Künstler erschafft Möglichkeiten, nicht Dinge – Das Spiel der Kunst ist von ephemerer und transzendierter Dauer – Erst ein Möglichkeitshorizont macht Auslegung notwendig 14. VORLESUNG 161 Sartre versteht unter „Existenz“ einen Prozess der progressiv-regressiven und der analytisch-synthetischen Perioden – Verstehen ist Arbeit – Sartre überschreitet die Dialektik ökonomisch, indem er den Austausch, nicht den Besitz zur gesellschaftlich weiterführenden Form erhebt – Sartres Mittelstellung zwischen einer klassischen Hermeneutik und einer strukturalen Informationstheorie – Die Verzeitlichung erlaubt, die Synthese der Widersprüche als Widerspruch zu erkennen – Die Antinomien zeigen sich in der szenischen Form der Geschichte – Das Erlebnis dominiert Besitz – Die Bedeutung des Menschen für den Menschen ist dialektisch als Widerspruch gegeben 15. VORLESUNG 171 Das Symptom zeigt, dass es etwas gibt, was sich nicht zeigen lässt – Symptom ist positive Negation von Präsenz – Angst ist keine Sache des Individuums; alle Kultur zeigt die Verschiebung von Angst in Sorge – Das Symptom steht in Beziehung zum Zeichen der Praxis, es ist aufgehobene Präsenz für eine andere Präsenz: Inszenierung – Das Symptom ist Widerstand gegenüber den Normen der Praxis – Das Symptom zeigt eine Krise der Motivation in der physikalischen Welt kausaler Technik 16. VORLESUNG 179 Urszene als Reflexion meint: Distanzierung, Spiegelung und Erkennen des Spiegels – Inversion und Involution als Gegenbegriffe zu Reflexion – Zeichen/Bedeutung und System/Bewusstsein sind eine Zweiseitenform – Die Inszenierung produziert Beobachtungen und Beobachter – Mache eine Unterscheidung! – Die Unterscheidung „Selbstreferenz/ Fremdreferenz“ und die Unterscheidung „Bezeichnung/Unterscheidung“ – Beobachtung der eigenen Beobachtung ist eine Wertform, die zur Objektform nicht symmetrisch ist 17. VORLESUNG 187 Spiel ist motiviert, Praxis zielgerichtet – Vom Ding zur Freiheit des Zeichens – Applikationen des Designs: Funktionalität renaturieren und humanisieren – Zukunft als Folge von Unterscheidungshandlungen – Vom Zeichen der Freiheit zur Freiheit der Zeichen – Periode der Beobachtung ist nicht mehr die Historie, sondern die Szene; die zur Abschließung drängende Eröffnung als System – Gebrauch ersetzt Herkunft – Sinn als Katharsis der Verzeitlichung LITERATUR 197
EINFÜHRUNG Die Geschichte der modernen Semiologie seit Charles Sanders Peirce und Ferdinand de Saussure, die als ihre Gründerväter gelten, umfasst etwa hundert Jahre. In dieser Zeitspanne haben es unterschiedliche semiotische Theorien weder geschafft, eine einheitliche Taxonomie oder ein einheitliches Modell der Sprachen, Zeichen, Medien aufzustellen, noch den Sprechenden, Schreibenden, Hörenden, Lesenden, Denkenden in seiner Individualität, Abhängigkeit und Produziertheit als gesellschaftliches Wesen zu erkennen. Die Frage nach dem Menschen schien im besten Fall eine des Verstehens im dialektischen und ökonomischen Bezug zur Gesellschaft gewesen zu sein. Der universalistische Entwurf einer Theorie der Semiologie, den insbesondere der französisch dominierte Strukturalismus bis Ende der 1960er Jahre zu vollenden versprach, scheiterte an der Inklusion von Geschichte, Subjekt und Ereignis. Die anschließenden Korrekturen aus Spezialdisziplinen heraus deckten nach und nach kleinmütig, mit empirischen, statistischen und kybernetischen Verfahren ausgestattet, die philosophischen Rückzüge einer universalistischen „Wissenschaft vom Menschen“ und entdeckten neue, sensualistische und systemorientierte Grundlagen. Diese systemorientierten Positionen arbeiten nicht mehr nur unter Hinweis auf die Analyse der Macht von Ordnungssystemen, wie sie Foucault seziert hat; die Systemtheorien haben einen gleitenden Faktor der Beobachtungsdimension, der Selbst-(Organisation) und der Tiefen- und Detailschärfe der Erkenntnisposition in die Paradigmatik der Sozialwissenschaften eingeführt. Man könnte sagen, die fotografische Detailgenauigkeit der Strukturalisten hat sich im kinematografischen Format erneuert und wird sich bald in das Format von Netzwerken übertragen. Damit stellt sich die Frage nach der Metaphorlogie der Bedeutungsbildung im Verhältnis zu den jeweils avanciertesten Medientechniken, d.h. der Auflösung der Semiotiken in Medienwissenschaften. Ins Visier kommt dabei auch die Frage der Elementarität, der Dialektik, der Ökonomie des Zeichens und seiner Repräsentation – eingedenk eines von der Relativitäts- und Quantenphysik angeregten Modelldenkens: Was, wenn Raum und Zeit, aber auch „Verwandtschaft“ keine die Struktur a priori prägenden Momente sind, wie es Lévi-Strauss in seiner Topologie seit den 1930er Jahren verkündet hat? Und was, wenn das Zeichen in ähnlicher Weise strukturiert ist wie die Energie: als generative Welle und als lokalisierbares Teilchen? Sind also die Ordnungen, die Lévi-Strauss herausarbeiten konnte, eher in der Relation Körper/Ding als in der von Intellekt und Sache anzusiedeln? Muss man also zwischen einer Schärfenbetrachtung gegenwärtiger Situation und einer funktionalen Betrachtung eines szenischen, wiederholbaren Ablaufs unterscheiden? Und was heißt das für eine Gemeinschaft, die sich als Präsenzgesellschaft – technisch geleitet – auf situative Affektivität in ihren Handlungen verlässt? Wenn die strukturale Semiotik zunächst die Topologie des Raumes metaphorisierte, indem sie die Glieder horizontal und vertikal ordnete und damit gegen die Ontologie von Anwesenheit und Abwesenheit die Funktion der Repräsenta-
10
VOM ZEICHEN ZUR SZENE
tion stärkte, so ist die heutige Gesellschaft auf dem Weg, die durch Echtzeitmanipulation synchronisierten Phänomene in einen Wirklichkeitsbereich und einen Möglichkeitsbereich zu unterteilen. Die Verweisung des Zeichens läuft nicht mehr über Re-Präsentation, sondern über affektive Präsenzen. Formulieren wir folgende Grundposition: Will das Individuum die technisch normierte und automatisierte serielle Wirklichkeit als Möglichkeitsbereich von Wert- und Bedeutungsdispositionen offen halten, führt es in die Serie die ironisierend-kritische Form der szenischen Disposition ein: Die Szene ist, weil sie eine Eigenpräsenz gegenüber konventionalisierten Situativitäten konstituiert, wiederholbar (darstellbar) und revozierbar, d.h. die Produkte ihrer Handlungen basieren auf der Funktion von Zeichenwerten, die zurückgenommen oder auch anders betrachtet werden können, und zwar gerade weil die Szene eine wiederholbare Einheit darstellt. Vom Standpunkt des historischen Beobachters aus fokussiert die Semiotik nur auf einen von zwei möglichen Zuständen der Organisation des Partikularen und des Universellen, der in der strukturalistischen Orthodoxie die Mythen, Riten und Symbole als Techniken festgelegt betrachtet wird, in der die Variationen in der Zeit lediglich Störfälle, Enttabuisierungen bzw. Inzestphänomene abbilden. Dem anderen Standpunkt, dem des Opfers der Ereignisse, der vom Chaos, einer unableitbaren Geschichte der Kritik und Krise ausgeht, wird kurz nach dem Höhepunkt der semiologischen Öffnung, nach den historischen Ereignissen des Mai 1968 im Zuge der post- oder neostrukturalistischen Dynamisierung verstärkt Beachtung geschenkt. Es kommt zu einer Re-Inszenierung der geschichtlichen Ereignisse unter und in dynamischen Medien. Das „Ende des geschichtlichen Menschen“ kann nach der Konsolidierung und technisch-zivilen Aufrüstung der bürgerlichen Gesellschaft in den 1950er und 1960er Jahren – angeregt eben durch die Ereignisse vom Mai 1968 (oder später die vom November 1989 oder September 2011) – noch nicht gefeiert werden. Gleichzeitig kann aber auch die Geschichtsschreibung nicht mehr in ihren alten Ordnungen der Herrschaftsgeschichte weiterarbeiten: Mindestens bedarf es einer Ergänzung der Medien-, der Technik- und der Gesellschaftsgeschichte. Während für die letztere von Adam Smith bis Karl Marx Arbeiten vorlagen, gab es weder eine Technik- noch eine Mediengeschichte. Das auf kein statisches Modell zu reduzierende Ereignis paradigmatischer Wechsel wird mit der Kinetik seiner Darstellung mehr und mehr auch ein zeitliches, periodisches, das, wie die Sprache, in jedem Akt sich ständig gänzlich restrukturiert. Die Medien und die Historie, nicht mehr die Literatur bilden das Paradigma performativer Untersuchungen von Metamorphosen in Echtzeit, deren Bedeutungsbild sich nie in der Synchronizität erschöpft, sondern allenfalls die Periode einer szenischen Simulation als Bedeutungsrahmen strategisch ausprobiert, um sie als Serialisierung zu testen. Bedeutungen müssen, so die dynamisierende These der Systemtheorien, aktuell mimetisch produziert oder, wie ein alter hermeneutischer Begriff weiß, diviniert, also erfunden oder verworfen werden. Werden sie nicht verworfen, heben sie sich als serielle Funktion des Gesellschaftlichen auf, d.h., sie werden als Funktion eines Unbewussten der Gesellschaft zugleich konventionalisierte Bedeutung. Die Dialektik des semiotischen Prozesse bekommt
EINFÜHRUNG
durch die strenge Anwendung von Szenen, Modellen, Experimenten und Simulakren eine andere Wahrheitsdimension: die der Wiederholbarkeit unabhängig von einer konkreten Situation. Gefragt wird nun nicht mehr nach den lokalen, sondern den sozialen und ökonomischen Abweichungen von einer industriell auf Wiederholung, Identität und Äquivalenz fixierten technischen Kultur. Die Topologien des Zeichens verschieben sich zu Strategien ihrer Chronologien. Da alles in Echtzeit gesagt und beobachtet werden kann, ist es wichtig, den richtigen Einsatz in die Serie zu bekommen. Einen solchen Einsatz verschaffen dirigierende Inszenierungen. Sich, jemanden oder etwas in Szene zu setzen, heißt, Bedeutsamkeit zu generieren, sie abspielen zu lassen und eben nicht einer seriellen Norm sich zu fügen. Doch jede Szene wirkt, sobald sie seriell reproduzierbar wird, also medialisiert ist, normierend. Nur das wiederholbare, aber nicht reproduzierbare Spiel wirklicher Subjekte, also defizitäre Subjektivität kann Bedeutungen gründen, die weder reine Affekte noch reine informationelle Signale sind. Man überzeugt heute nicht mehr mit Argumenten, wie in der an Diskussionen so reichen Zeit der philosophischen Episteme; man lädt zur Teilnahme an Simulationen ein. Der „Workshop“ ersetzt die Diskussion, das „Projekt“ verhindert die theoretischen Ableitungen. Dabei, und das sei unsere These, ist die Inszenierung doch die großzügigere Variante der Praxis auf Probe: großzügig in Gabe und Opfer, geizig in effektiver Ökonomie. Denn Argumente lassen sich negieren, Handlungen nicht. Gerade aber weil letztere opfervoll sind, bedürfen sie eines „ironisierten Zeitraums“, der sie absichert und bei Bedarf wieder in die Praxis regelgeleiteter, technisch normierter Handlungen zurückführt. Die Einheit einer jeden Szene wird also durch die Dialektik von Gabe und Opfer gebildet. Es gilt nun diese Dialektik für ein systemisches Moment von Einheit gegen die Einheit des Zeichens in Schutz zu nehmen, also das in der strukturalen Semiologie von Marcel Mauss und Claude Lévi-Strauss verborgene Argument für eine Präsenzgesellschaft, die sich nicht über Verwandtschaften, sondern Teilnahmen an Präsenzereignissen konstituiert, neu zu denken. Die widerstreitenden Semiotiker haben ihr produktives Moment in den Widersprüchlichkeiten, Antinomien und Paradoxien von Sprachen vereinheitlichen wollen. Diese reichhaltigen Problemdarstellungen, Abwehrmaßnahmen und publikatorischen Initiativen der „Linguistik“ und den „Semiotiken“, die sich im Verlauf der letzen hundert Jahre in Auseinandersetzungen mit einer historischen Philosophie und einer allzu phantasievollen Hermeneutik konkretisiert haben, nenne ich hier „Semiologie“. Schon der simple Umstand, dass die Sprache – wie jedes Darstellungssystem – Prozess und Produkt zugleich ist, wirft konkrete Fragen nach der Verzeitlichung auf: Wie sind die gesellschaftliche und die sprachliche Produktion miteinander verknüpft? Sind Tausch und Austausch homologe Praktiken? Welches Zeitbild liegt dem „Zugleich“ zugrunde? Ließe sich das „Zugleich“ in zwei simultane Phasen übersetzen oder ist das Verhältnis dieser Phasen eher eines der Repräsentation? Gibt es einen Konsum von Sprache, wenn es einen Konsum von Zeichen und Dingen gibt – und wo wäre die Opfersphäre der Produktivität der sprachlichen Elemente? Wenn wir nicht von der Göttlichkeit der Struktur ausgehen, sondern von der Menschlichkeit des Dialogs, könnten wir als Opfer die symmetrische Parität, die
11
12
VOM ZEICHEN ZUR SZENE
zur Entscheidung und zum Werturteil zwingt, bestimmen: Autor und Leser, Sprecher und Zuhörer, Akteur und Beobachter müssen nacheinander in das Opfer der Zeit eintreten, die sie jedoch medienkompatibel allererst kreditieren müssen. Könnte man auf diese Weise die semiotischen Opponenten in ihrem Auftrag nach opferloser Kommunikation (Identität des Verstehens) besser verstehen (paradoxerweise!) als durch den Imperativ einer normativen Bedeutung, der Informationstechniken? Diese Fragen zeigen an, dass es in den folgenden Vorlesungen nicht um die Nacherzählung der Dynamik der Semiologie oder um die Berichterstattung der Geschichte des Strukturalismus geht. Beides ist in den letzen fünfundzwanzig Jahren umfänglich geschehen. Es geht umgekehrt auch nicht um den Versuch, den Prozess ihrer Geschichte zu strukturieren oder zu systematisieren. Vielmehr will dieser essayistische Entwurf eine dezentrale und nichtlineare Darstellung der Lesarten der Probleme der Semiologie wagen, die sich von den Widersprüchen der Semiotiken aus der Perspektive der „Präsenzgesellschaften“ her ergibt: jenen, teils hypothetisch, teils empirisch zu beobachtenden Zeichenpraktiken, die nicht mehr an Ableitungen, Sinnketten oder gar Kausalitäten orientiert sind, sondern in Analogie zu den Gebrauchsvorgaben der Objekte eine affektive und effektive Kommunikationshandlung präferieren, die die Vielfalt der Bedeutungsentwicklungen umgeht und im Zweifel auf Gewalt oder Missachtung setzt – als das hier und jetzt zu Entscheidende. Das heißt nicht, dass es keine Individuen mehr gäbe, die sich der zeitraubenden Tiefenlektüre von Zukunft und Vergangenheit und der Umdeutung der Archive widmete und somit Glauben machten, dass keine Zeit je in paradigmatischer Präsenz alles konsumieren könnte. Es ist paradox, aber genau in dem historischen Moment, in dem der semiotische Strukturalismus seine abgewehrte Selbstansicht im Produktionsmoment gewahrt, vermitteln die weltweit vernetzten Medien das Bild eines universal gegenwärtigen Wissens, in dem die Produktion an die Peripherie des Kreativen ausgelagert wird und das Subjekt sich nur noch als Protagonist seines eigenen Romans versteht. Die digitale Welt hat eine nicht mehr überbietbare Befehlsprogrammierung geschaffen, ein göttliches, universalistisches Zeichen gesetzt. Hier haben wir tatsächlich eine globalisierte Struktur, die wir nun im gleichen strukturalen Geist betrachten können, wie Lévi-Strauss die Verwandtschaftsbeziehungen indigener Völker im Amazonasgebiet oder Freud, den sexuellen Umgang im bigotten Wiener Milieu. Ein erneuter Blick auf die Problemlagen der Semiotiken erscheint also dringlich – gerade auch in Bezug auf das von ihnen Verfemte: nämlich die Szenen nicht als Szenenzu betrachten, sondern als Zeichen, die man verlustlos verschriften kann. In Rücksicht auf meine Darstellungsabsicht ist deswegen die fragmentarische Essayistik Benjamins und Adornos als gesellschafts- und medienkritische Praxis der Inversion leitend. Essayistik ist stets dezentral und nichthierarchisch. Sie erstellt wuchernd ein Gesamtbild mit Lücken, in denen das Medium durchscheint; wie ein Gemälde von Cezanne. Die Vorlesungen führen den Begriff „Szene“ im Sinne einer Möglichkeit der Wiederholbarkeit von Zeit durch Verdichtung und Verschiebung ein. Die Szene wird als negative, gleichsam transzendierte Zeit verstanden. Aus diesem Grund,
EINFÜHRUNG
weil sie wiederholt und inszeniert werden kann und das Gesetz der Vergänglichkeit im Negativen überbietet, ist die Szene Präsenz und Vorstelung zugleich. Ob sie als Kristall oder als Mobile, als „Lichtung“ (Heidegger) oder als „Anderer Schauplatz“ (Freud) metaphorisiert wird, sei dem Leser überlassen. Formuliert und zusammengefasst wurden die Vorlesungen nach mehreren Seminaren und Vorträgen in Düsseldorf, Dortmund und Zürich 2016. Biel, Herbst 2016
13
1. VORLESUNG Textproduktion und Dingproduktion – Zwei Formen der Ökonomie: die Warenökonomie des Tauschs durch Arbeit und die Zeichenökonomie des Spiels – „Szene“ bezeichnet die Produktionsweise der Wiederholbarkeit – Semiotik als Effekt der Lesbarkeit von Medien – Das System des Zeichens ist nicht der orthogonale Raum, sondern die soziale Zeit – Das reine Zeichen dient der Reproduktion von Bedeutung – Szene sei die minimale Einheit der Semiologie, das Zeichen die temporale Einheit einer Produktion
Was gibt es heute über den Begriff des Zeichens und seine Geschichte zu schreiben, was nicht schon gedacht oder geschrieben worden ist? Seine Geschichtlichkeit! Die mehrere tausend Spalten starken Bände Semiotik/semiotics1 versprachen, die disparaten Argumente und Taxonomien zur prophezeiten Universaltheorie in nicht weniger als drei Lehrsätzen zu vereinigen: Unter „Zeichen“ ist ein dreigliedriger „Ausdruck“ zu „verstehen“, der in einem „Prozess“ des „Verweisens“ eine „Bedeutung“ „korreliert“. Über alle in Anführungszeichen gesetzten Begriffe ließen sich beliebig lange, teilweise entgegengesetzte Diskurspositionen zitieren. So überfällt einen die Ahnung, dass die Semiotiker über die Phase des Jagens und Sammelns in ihrer Wissenschaft nicht hinausgekommen sind. Sie verbleiben im Streitmilieu, das der Semiotik keine Wissenschaftlichkeit, sondern eine ideologiekritische Kompetenz bescheinigt, indem man sie – gemäß der Tradition von Kant über Peirce bis Wittgenstein – in einer philosophischen Logik diszipliniert. Wenig Streit herrscht darüber, dass die Semiotik als Methode verstanden werden kann, deren heute avancierteste Form in den Systemwissenschaften (oder -theorien) relevant geworden ist. Den eigentlichen Problemhintergrund der Geschichte der Semiotiken formulierte eine lose Diskursgemeinschaft, die das Ende der Geschichte, des imperialen Subjekts und der kontingenten Ereignisse durch theoretische Vorannahmen zu bannen trachtete. Diese sehr heterogene Gemeinschaft bekam das Etikett „Strukturalismus“. Als die gesellschaftlichen und institutionellen Probleme überbordeten und sich diesem Etikett niemand mehr anschließen wollte, wurde die französisch dominierte gemeinschaft von den hermeneutischen Auguren als „Poststrukturalisten“ bezeichnet, die zumindest die Probleme neu zu dynamisieren wussten. Die Geschichte der Entwicklung des Strukturalismus ist geschrieben worden.2 Die Geschichte der Zeit danach die Wiederaufnahme und teilweise Inversion der Problemlagen dagegen noch nicht. Die präzisesten Formulierungen zum Selbstverständnis der bis heute nicht entschiedenen Frage, ob es denn „Semiotik“ (Theorie der Zeichenopponenten) oder „Semiologie“ (Systematik und Selbstreflexion der Zeichenrelationen) heißen soll, hat zur Zeit der Hochkonjunktur der Semiotik Julia Kristeva gewählt. Sie war eine der 1 Roland Posner, Klaus Robering, Thomas A. Seboek (Hg.): Semiotik. Semiotics. Einhandbuch zu den Zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur. 3 Bände, Berlin 1997-2003. Eine kürzere Darstellung bietet Winfried Nöth: Handbuch der Semiotik. Stuttgart/Weimar, 2000. 2 François Dosse: Geschichte des Strukturalismus Bd.1. Das Feld des Zeichens, 1945-1966; Bd.2. Das Zeichen der Zeit, 1967-1991. Hamburg 1997 (frz. 1991).
16
1. VORLESUNG
ersten, die dem orthodoxen Strukturalismus (falls es so etwas je gegeben hat), vorgedacht hat, dass jede Theorie, so abstrakt sie auch sein mag, in ihrer Darstellung von zeitgenössischen, das heißt historischen Paradigmen auszugehen hat; dass sie ideologisch sei und im gleichen Sinne wie die Psychoanalyse eine Methode, aber nicht eine Wissenschaft sein könne. Mit Kristeva wollen wir auf die Selbstkritik der Semiotik als Semiologie zu sprechen kommen. Julia Kristeva versteht unter „Semiologie ein[en] Typus der Selbstreflexion der Wissenschaft“3, der sich in der Verifikation des Entwurfs einer Setzung des Gegenstandes „Zeichen“ selbst ständig kritisch hinterfragt. „Wir wollen damit sagen, daß die Semiologie sich nur als Kritik der Semiologie realisieren kann, als Kritik, die über sie hinaustrifft – nämlich in die Ideologie.“4 Die Aufhebung der Zirkelhaftigkeit von thetischer Setzung und praktischer Verifikation (die Zeichentriade „Ausdruck – Verweisung – Bedeutung“) verhält sich tatsächlich so tautologisch, wie sie theoretisch beschrieben wird. Der theoretische Status der Semiologie ist der des Entwurfs. Kristeva definiert die „Semiologie als Herstellung von Modellen.“5 Ihre Kernaussage, die in das Zentrum der Frage nach der Bedeutung der Semiologie (nicht der Semiotik!) vordringt, ist demnach die der Verhältnisbestimmung von Realitätsproduktion und Modellproduktion. Sie nutzt die damals geläufigen Termini, die von „geistiger und körperlicher Arbeit“6, von „Produktivität“7 und Ideologie sprachen – und nicht von Performativität, Darstellung und Beobachterstandpunkt. Die Besonderheit der philosophischen Öffnung der (Text-)Semiotik Kristevas hin zu einer allgemeinen Semiologie besteht darin, dass sie einen konkreten Unterschied zwischen der Zeichen- bzw. Textproduktion8 und der Dingproduktion macht. Die Produktionsweise des Zeichens ist Produktion und Produzierendes zugleich, also, gemäß der marxschen Terminologie, gesellschaftliche Produktion und Produktion von Gesellschaft. Der Unterschied zur Dingproduktion ist evident: Letztere ist zur Entwurfsproduktion sekundär und zudem an ein reales Wert- und Tauschsystem gebunden, dass der Zeichenproduktion aufgrund ihres Modellcharakters (d.h. der Zeichentechnologien im Ingenieurs-, Kunst-, und Wissenschaftsbereich) fehlt.Textproduktion ist Sinnproduktion, Dingproduktion dagegen ist bedeutsam – als Gebrauch. Wir bemerken sofort, dass man mit einer leichten Verschiebung, die vom Text zu den Medien führt, in einer Gesellschaft, die mit Zeichen statt mit Dingen handelt, die Dingproduktion als Marginalie betrachten kann. Denn selbst die Dinge verkörpern in einer Konsumgesellschaft nur noch Zeichen eines gesellschaftlichen Wer3 Julia Kristeva: Semiologie – kritische Wissenschaft und/oder Wissenschaftskritik. In: Peter V. Zima (Hg.): Textsemiotik als Ideologiekritik. Frankfurt am Main 1977, S.34-53, hier S.38. 4 Ebd., S.39. 5 Ebd., S.37. 6 Ebd., S.42ff. 7 Julia Kristeva: Der geschlossene Text. In: Textsemiotik, a.a.O., S.194-229, hier S.194. 8 Ebd., S.194: „In diesem Zusammenhang definieren wir den Text als translinguistischen Mechanismus, der die Anordnungen der Sprache umgestaltet, indem er eine kommunikative ‚Parole‘, deren Zweck die unmittelbare Information ist, zu vergangenen oder gleichzeitig wirkenden Aussagen in Beziehung setzt. Folglich ist der Text eine Produktivität (productivité).“
1. VORLESUNG
tes, einer Marke, einer Gruppenzugehörigkeit und nicht mehr die Erfüllung eines Bedürfnisses. Kristeva bemüht eine Ableitung aus der freudschen Traumdeutung, um den Charakter der Kommunität des Zeichens (respektive der Produktion von Verweisung statt realisierender Verdinglichung) zu kennzeichnen. In dem Die Traumarbeit überschriebenen Kapitel der Traumdeutung lüftet Freud den Vorhang vor dem Schauplatz der Produktion: Was er danach bemerkt, ist weniger reglementiertes Tauschverfahren (oder Gebrauchsverfahren) als vielmehr ein Spiel von Permutationen, in welchem sich die Produktion selbst modelliert. Somit bringt er die Aufgabe in den Blick, Arbeit als besonderes semiotisches System zu begreifen, das klar unterschieden ist vom Tauschsystem.9
In diesem Zitat wird prägnant, dass Kristeva zwei Formen der Ökonomie betrachtet: die Warenökonomie des Tauschs durch Arbeit und die Zeichenökonomie des Spiels durch nichtäquivalente d.h. nichtreproduzierbare Permutationen. Nun ist ein Wesen des Spiels gerade darin zu sehen, dass es als Auf- und Vorführung zwar wiederholt werden kann, nicht aber im Sinne einer Reproduktion. Arbeit muss sich deswegen als Inszenierungsform auf der Ebene des Nichtidentischen begreifen. Jeder arbeitet arbeitsteilig – ohne Kenntnis des Gesamtzusammenhangs und des Produkts, das er erzeugt. Der Schauplatz der Reproduktion ist effektiv der einer unbewussten Praxis, oder, sagen wir deutlicher, einer Praxis, deren situatives Funktionieren gewährleistet ist, indem sie affektiv und automatisch festgelegten Bedeutungshandlungen und nicht spielerischen Permutationen gehorcht. Was uns an Kristevas Argumentation interessiert, ist nicht die Frage der Dynamisierung des Zeichenbegriffs und auch nicht die der psychoanalytischen Hintergründe, die bei Kristeva allzu schnell auf die Triebfunktionen10 reduziert werden, sondern die Unterscheidung der Produktionsweisen, von denen die eine spielerisch transponierend erfolgt und im Bereich des Symbolischen des Analogen und Homologen verbleibt, die andere strategisch im Hinblick auf die Dauer: Die Funktion, sich in seinen Genen zu reproduzieren, d.h. die Ermächtigung der Vaterschaft, zeigt sich hier als Konkurrenz zur weiblichen Produktion. Die Unbeweisbarkeit der Vaterschaft ruft sofort die Intrige des Ödipus auf den Plan, d.h. das Bastardwesen der „unwissenschaftlichen“ Analogie. Das gleiche Verhältnis der Produktionsweisen lässt sich als Simulation in den Semiotiken beobachten: Es gibt eine semiotische Taxonomie, die auf wissenschaftliche Objektivität abzielt und ihre Strukturen als Sachen behandelt – und es gibt ein Spiel mit Zeichen, das jede Semiose auf der Ebene einer Entwurfsarbeit (Theorie, Modell) betrachtet, die durch einen kontinuierlichen Prozess der Selbsthervorbringung und der Selbstüberarbeitung („Dekonstruktion“, wie Derrida sagt) unterwandert ist. Auf dieser Ebene ist das Spiel der Zeichen also eine Simulation der Realisierung, die sich wieder zurücknehmen kann, die im ephemeren Bereich eines 9
Kristeva, Semiologie – Kritische Wissenschaft, a.a.O., S.47 Julia Kristeva: Die Revolution der poetischen Sprache. Frankfurt am Main 1978, S.35. „Die semiotische ‚chora‘ als Triebauflage“.
10
17
18
1. VORLESUNG
szenischen Vollzugs verbleibt. Der Reproduktionsprozess dagegen kennzeichnet die serielle Funktion der Ware als Ding: Sie erneuert sich als identische Serie, ohne jemals die Originalität des einzigen Moments anzunehmen. Folglich ist der einzige Moment das „Ereignis der Präsenz“ – der höchste Wert der Reproduktionskultur. Was uns an Kristeva konkret motiviert, ist die Frage der Selbstdarstellung dieser Wander- und Unterwanderungsbewegung, das Spiel der Permutationen, und zwar in Bezug auf eine Geschichte der Semiotiken, die sich in ihrem szientistischen Flügel an artifiziellen, mathematischen Sprachen orientiert, heute aber den Schein dieser Objektivität durchweg als soziologischen Prozess begreift, der nicht naturwissenschaftlich, sondern vorzugsweise im Modus des Textes, des Diskurses oder der „Bedeutungskerne“11 im Modus des Fingierens – einer antizipierten Zukunft – dargestellt wird. Die Naturwissenschaften, ausgehend von der Biologie, haben verstanden, dass der nietzscheanische „Wille zum Wissen“ letztlich eine Frage der Befriedigung der Sehnsüchte, des Endes der Zufälligkeit der Zukunft und der Umgehung des Inzesttabus darstellt – also Voraussetzungen, die zu sezieren selbst nicht in das Feld der Naturwissenschaften passen. Wenn die Naturwissenschaften ihre Experimente vollständig reproduzierbar gestalten müssen, markieren sie damit die serielle Funktion des Wissens. Gleichwohl sind deren Erfolge unermesslich attraktiv und verlässlich. Von der Relevanz der institutionellen Stellen möchte ich dabei gar nicht einmal reden.12 Eine andere Art von „Traumdeutung“13 – was ist damit gemeint? Bezeichnenderweise dient das Spiel der Permutationen, das in die gesellschaftliche Dingproduktion als Praxis eingelagert ist, nicht dazu, die Zukunft in die Gegenwart heimzuholen und „Ideen zu realisieren“, sondern das Verhältnis von Gegenwart und Zukunft als ein Linearverhältnis aufzulösen und damit die Ökonomie des Tausches als Kreditierung von Zukunft14 zu unterwandern. Permutationen regulieren Übergänge zwischen disparaten Codes oder Sprachen, zwischen imaginären und realen Produktionen, zwischen Bedeutungen und Sinn. Kommt nämlich die Bedeutung 11 Kristeva, Semiologie – kritische Wissenschaft, a.a.O., S.68: „Die Semiologie sollte ihren Formeln
nicht das ‚Zeichen‘ als Einheit zugrunde legen, sondern eine Vielzahl von Bedeutungskernen (noyaux signifiants), von grundsätzlichen Merkmalen, die verschiedenen Typen von Bedeutungssystemen entsprechen. Statt eines einzigen Zeichenmodells gebe es verschiedene Bedeutungsmodelle, die noch definiert werden müßten.“ 12 Über die politische Geschichte der strukturalistischen „Bewegung“ im Verhältnis zu den Schulen der Philosophie und Historik verweise ich auf Dosse, Geschichte des Strukturalismus, a.a.O. 13 Es war Freuds Anliegen, mit der Traumdeutung gegen eine projektive Traumdeutung nach Art der Astrologie Front zu machen und ein hermeneutisch fundiertes Konzept vorzulegen. Siehe Sigmund Freud: Die Traumdeutung. Frankfurt am Main 1984, S.504: „Und der Wert des Traums für die Kenntnis der Zukunft? Daran ist natürlich nicht zu denken. Man möchte dafür einsetzen: für die Vergangenheit.“ Das semiotisch-hermeneutische Universum Freuds konstatiert also 1900 im Wunsch schon die Erfüllung, nicht in seiner Externalisation als reales Produkt. So bestimmt Lacan das „Reale“ als unerfüllbaren Wunsch, als instabiles Verhältnis zwischen dem Symbolischen und dem Imaginären. 14 Das ist eine Erkenntnis von Marcel Mauss, die von den Semiotikern aufgenommen wird. In sozialer Hinsicht ist „Zukunft“ etwas, was durch die Reziprozität der Gabe eröffnet wird und was die Eröffnung einer jeden Kommunikationssituation einschließt. Zukunft wird als interpretativer Möglichkeitshorizont verstanden, der sich niemals vollständig realisieren lässt. Vgl. Marcel Mauss: Die Gabe. (1925). In: Ders.: Soziologie und Anthropologie Bd.2. Frankfurt am Main 1989, S.9-144.
1. VORLESUNG
uns aus der Vergangenheit entgegen – das Signifikat ist das, was die Verweisung des Signifikanten erfüllt –, so kann der Sinn sich nur im Rückgang auf die situativen Bedeutungseinheiten erfüllen. Er kann sich zum Beispiel als Synthese der Bedeutungseinheiten eines Satzes fügen. Da die Synthese aber unter dem Eindruck der Situativität erfolgt, ist sie eine individuelle Ganzheit. Diese Ganzheit, die eine symbolische Einheit bilden kann, versucht der strukturale Ansatz der Semiotik als ein Effekt feststehender Strukturen zu erklären, etwa jenem eines grammatikalischen Satzes. Da der spielerische, poetische Satz an keine Regeln gebunden ist, erregt er das besondere Interesse der Semiotik: Sie will nachweisen, dass gleich der Traumproduktion das Subjekt hier nicht über die rationale Wahl verfügt, sondern nur über einen Korpus von Mythen und anderen anthropologischen Formen. Das Produkt der in die Gegenwart als Möglichkeit eingegliederten Verzeitlichung wollen wir nicht, wie Kristeva, als „Text“ („Literatur“), sondern, erweitert im Hinblick auf Permutation und Performativität, als „Szene“ verstehen. Der Begriff „Szene“ bezeichnet eine Produktionsweise, die der Wiederholbarkeit der Zeit einen experimentellen „Schauplatz“15 verschafft, der ihre gesellschaftliche Selbstreflexion bedeutet. D.h., sie ist das Produkt, genauer das Negat einer Inszenierung, in der die Präsenz dauert, gleichsam transzendiert wird. Den sekundären Wert- und Tauschprozess auf Basis der Verdinglichung (auch der von Handlungen) wollen wir dagegen eine serielle Praxis der Situation nennen, die unter der Verpflichtung des Tauschs der kreditierten und nicht wiederholbaren, aber seriell reproduzierbaren Zeit fällt. Wir müssen sogleich zwischen der Reproduktion und der Produktion in der Szene und der Sprache unterscheiden, wie ein paradigmatischer Vergleich aufklärt: Die kalendarische Zeit wird als verfließende, nicht rückholbare Zeit aufgefasst, die sich summiert, jedoch in der Gestalt (Code) unverändert bleibt. Sie fußt aber auf der älteren Vorstellung der astronomischen Zeit mit ihren sich regelmäßig wiederholenden Rhythmen. Werden die astronomischen Zyklen durch Kometen, epizyklische Bahnbewegungen der Planeten, Sonnenfinsternisse gestört, kommt es zu einer dionysischen Extension der Zeit: Krisen und Katastrophen werden angemahnt. Deren Bannungsdarstellung erfolgt im Rausch oder Karneval, als einer Inszenierung der Zeit/Tage, in denen gewisse gesellschaftliche Regeln außer Kraft gesetzt werden, da die beiden Zeitsysteme als ideologische Systeme und Kulturorientierungen miteinander kollidieren. Die Dramatisierung erfolgt jedoch negativ, durch den Agon der Inszenierung – durch die Disziplinierung dessen, was nicht zu disziplinieren ist. Auf der Ebene der menschlichen Phantasmatik sind dies die Träume, die Vorstellungen, der Rausch und das Fest. Mithin auch die Produkte, die sie positiv produzieren: neurotische, rauschhafte, theatrale Darstellungen, die den Konflikt in eine Eigenzeit der Szene verwandeln und so beherrschbar, d.h. wiederholbar machen, obwohl die Krise selbst nicht reproduziert wird respektive werden kann. Wir wollen die Produktionsprozesse also nicht im Hinblick auf die Materialität des Produkts, die „Szenerie“, sondern im Hinblick auf die Modalitäten der Zeit, der Zeitigung und der Verzeitlichung betrachten und somit die topologische Betrachtungsweise unterordnen, die sowohl das Zeichen wie auch den theaterlo15
Kristeva, Semiologie – kritische Wissenschaft, a.a.O., S.47.
19
20
1. VORLESUNG
gisch konnotierten Begriff der Szene (Bühne) beherrschen. Diese Szene verstehen wir exemplarisch als „Inszenierung“ im Sinne einer Transzendierung der (abstrakten) Zeit. Das, was über das Bedürfnis hinaus erzeugt wird, bezieht sich auf den sozialen Status nicht auf den Körper, der sich nicht der Reproduktion, sondern der Verdopplung widersetzt. Eine solche (westliche) Konsumgesellschaft, die immer stärker seinerseits dem Spiel des Zeichens unterliegt und nicht mehr dem Wertgesetz der Einmaligkeit, der zyklischen Zukunft als Möglichkeit und dem Fortschrittsdenken, kann man Präsenzgesellschaft nennen. In gewisser Weise simuliert diese Gesellschaft das symbolische Handeln der theologischen Gesellschaft des Mittelalters, ersetzt „Gott“ aber durch die gesellschaftliche Wirkmacht normierender Techniken, um die diversen Kalibrierungs-, Schärfe- und Differenzebenen übersetzbar zu halten. Ohne den Einschnitt des Todes (der Ware) hat die Zeit paradoxerweise nur noch die Eigenschaft, da zu sein: Sie ist Dasein in Abwesenheit. „Unter diesem Gesichtspunkt greift das binäre Modell, die strukturale Dualität nicht mehr. An seine Stelle tritt das Denken in Paradoxien, das der zunehmenden Komplexität besser gerecht werden will.“16 Was François Dosse in seiner Geschichte des Strukturalismus Anfang der 1990er Jahre diagnostiziert, ist den erhöhten Mess- und Rechenkapazitäten zu verdanken, die den Blick kristallin facettieren und dem Beobachter, der der Semiotik als passives Subjekt ausgesetzt war, eine eigendynamische Rolle zuweist. Die Rollenverteilung wird damit abhängig vom Auflösungsvermögen der Darstellung. Der universalistische Blick relativiert sich in der Funktionseinheit eines Systems. Der systemische Ansatz bringt sogar ein neues Konzept in Anschlag: Nach dem Mikroskop für das unendlich Kleine und dem Teleskop für das unendlich Große muß man sich des Makroskops als Werkzeug für das unendlich Komplexe bedienen. Mit seiner Hilfe lassen sich die Einzelheiten herausfiltern und das vergrößern, was die verschiedenen Instanzen der Realität verbindet.17
Doch greifen wir nicht auf die Schlussbetrachtung vor. Welche Rolle, so muss gefragt werden, spielt die historische Permutativität von Texten, Techniken und Praktiken in einer Gesellschaft, die sich im simultanen Vorhandensein aller möglichen Transpositionen nicht mehr als linear ableitbar oder abgeleitet erfährt? Was verhindert, diese Gesellschaft als eine von „Schlafwandler“ zu kennzeichnen? Welche Rolle, dies die dritte Frage, spielt in der Semiose das Subjekt, das nicht nur ein Produkt der gesellschaftlichen Zeichen und Konventionen ist, sondern diese auch eigenmächtig „pathologisch“, „kriminell“ oder „künstlerisch“ überschreitet, ohne dass wir sagen könnten, es verhielte sich doch nur gemäß einer Theorie, die jede mögliche Praxis immer schon vorhergesehen und in den symbolischen Tausch integriert hat? Algirdas Greimas hat neben Kristeva Mitte der 1970er Jahre versucht ein Übersetzungsmodell zwischen den semiotischen und den handlungstheoretischen Aspekten diskursiver Vollzüge aufzuzeigen, indem er die kommunikativen Vorgänge unter agonistischen Gesichtspunkten als oszillierende, dialogische Auseinanderset16 17
Dosse, Geschichte des Strukturalismus Bd.2, a.a.O., S.494. Ebd., S.518.
1. VORLESUNG
zung zwischen „Aktanten“ bezeichnet hat. Ein Aktant veranlasst die Bedingungen wechselseitiger Produktion von syntagmatischen Einheiten, die synchrone, paradigmatische Konflikte entzerren. Parallelprozesse (Streit um Land, Geld, Frauen etc.) werden nach der Schematik der Abenteuerliteratur linearisiert und können so jene Probleme erträglich, aber nicht lösbar machen, die auf Paradoxien und Antinomien aufbauen. Solche Antinomien können Opponenten einer Zeichenbestimmung sein, die in der paradoxen Einheit des Zeichens selbst nicht abgearbeitet werden können. Die strukturale Betrachtungsweise, die als Nachbarschaften in Nähe und Ferne ihr dialektisches Spiel entfaltet, bedarf einer Form der Verzeitlichung. Es genügt nicht mehr, diese als „Text“ zu präjudizieren. Peter V. Zima hat in einem Vorwort zu einem Band, der einige ideologiekritische Stimmen der Selbstreflexion der Semiotik der 1960er und 1970er Jahre versammelt, mit Rücksicht auf Greimas auf den Aspekt der Inszenierung als einer solchen Desynchronisierung hingewiesen. „Wichtig ist hier der Übergang von der begrifflichen, darstellbaren Struktur des semantischen Gegensatzes zu dessen anthropomorpher ‚Inszenierung‘ auf der Ebene der ‚Aktanten‘.“18 Mit dem Begriff des Aktanten oder Szenografen ist früh die performative Hinwendung der Kommunikationswissenschaften als Methode der Betrachtung der Produktionsbedingungen gesellschaftlicher Bindungen angesprochen: Kommunikation muss aktiviert und veranlasst werden und ist vom Aktivierten als motiviert zu verstehen – und zwar nicht hinsichtlich seines Informationsgehalts, sondern hinsichtlich der Form der Entzerrung von paradigmatischen Einheiten in syntagmatische. Subjekte können zwar gleichzeitig und Hand in Hand handeln, nicht aber zugleich sprechen/schreiben. Aber setzen wir die Idee der Dialogizität vor die der Sprache, so muss die „Natur der Zeicheneinheit“ noch einmal künstlich reinszeniert werden. Das Zeichen erweist sich in seiner Differentialität nur dadurch ableitbar, als man es den Praktiken entzieht und zu einem Ding der Medientechniken, zu einem Element des Codes macht, in der die Reinheit des Signals die Vielfalt der Bedeutungen erst sekundär zur Geltung kommen lässt. Jetzt, in diesem historischen Moment, entsteht die Semiotik als Effekt der Lesbarkeit von Medien und ihrer Serialisierungsfunktion. Die revolutionären Gesten der Gewalt der 1968er haben ihr Ziel erreicht: Man kann Revolutionen, Kriege, Krisen in Nachrichten verwandeln, so wie man das Wetter berechnen kann. Die Konfliktpositionen, die von Greimas und Kristeva, aber auch von Campbell als „Reise des Helden“19 systematisiert worden sind und die gesamte Literaturund Filmepik durchziehen, zeigen sich in anthropomorphe und soziale Beziehungen übersetz- und analysierbar, also bedeutungsvoll. Diese völlig andere Funktion der Diskursivität als jene, die von der Logik des Satzes und von der Informatorik ausgeht, erweist sich erst später für die Darstellung der soziologischen Systemtheorien 18
Peter V. Zima: Diskurs als Ideologie. In: Ders. (Hg.): Textsemiotik als Ideologiekritik. Frankfurt am Main 1977, S.7-32, hier S.16. 19 Vgl. Joseph Campbell: Der Heros in tausend Gestalten. Frankfurt am Main 1999. Campell untersucht Anfang der 1950er Jahre die in allen Mythologien durchgängigen Phasen der Abenteuerfahrt eines Helden auf symbolisch-semantischer Ebene unter den Positionen „Ruf, Überquerung, Prüfung, Flucht, Rückkehr“. Die Romanuntersuchungen vor allem von Greimas und Kristeva kommen zu ähnlichen, aber detaillierteren Ergebnissen, was die Funktionalität der Romanstruktur angeht.
21
22
1. VORLESUNG
als fruchtbare Domäne: Sie widmet sich den Mehrdeutigkeiten, den Antinomien und Paradoxien und entfaltet diese szenisch gemäß den Handlungen der Protagonisten in einem organischen System. Inszenierungen oder Szenifikationen haben mithin eine spezifische kommunikative Funktion: die der temporalen Vermittlung, die die Opponenten und Paradoxien nicht löst, sondern sie in eine Spirale der Verweisung schickt, von der aus der Held wieder an den Anfang zurückkommt – nun aber ist er ein ganz anderer geworden. In der Regel ist der nachgeschobene Anfang als Heiratsbeziehung situiert. Wo Hollywoodproduktionen20 enden und das Interesse der Anthropologen beginnt, endet die Auftragsbeziehung des Aktanten in eine in sich ruhende Situativität rationalen Handelns und der Verschmelzung weiblicher Produktion mit der männlicher. Das, was wir neben „Inszenierung“ die „Situation der Praxis“ nennen, ist also das, nach dessen Bedeutung niemand mehr eine Kamera richtet. Greimas vermerkt, dass in dieser Hinsicht das logische Konfliktpotential des Zeichens (nicht das transzendente des Symbols) durch „Temporalität ersetzt“21 wird. Unter dem Gesichtspunkt der diskursiven Linguistik ist die dem historischen Diskurs innewohnende Temporalisierung eine häufige Erscheinung und erklärt sich durch den Mechanismus der zeitlichen Auskupplung [...], der darin besteht, die gegenwärtigen Aussagen als in der Vergangenheit verankert zu bestimmen und auf diese Weise eine zeitliche Illusion zu schaffen.22
Die Illusion besteht darin, im pragmatischen Akt sich des Umstands zu versichern, dass das Signifikat schon am Anfang der Verweisungsveranlassung des Zeichens als seine Bedeutungsfunktion stand. Das, worauf das Zeichen/die Handlungsveranlassung verweist, ist ein futur antérieur, eine zukünftige Vergangenheit, die den Diskurs des Fortschritts durch den der Historisierung durchkreuzt. Paradox und auf den Rückgang der Logik bedacht könnte man sagen: Man versteht nur, was man weiß – allerdings sind die beiden Orte des Wissens voneinander durch den Übergang von der Wahrnehmung zum Erkennen (nach Sartreschen Termini) getrennt: als inszenierte und produzierte Zeit, die niemals wieder den Ort erreicht, von dem sie ausgegangen ist, da das Subjekt der Zeit sich stets verfehlt. Ich unterscheide hier zwischen Verstehen und Erkennen: erkennen kann man ein praktisches Verhalten, aber verstehen kann man nur eine Leidenschaft. Was ich „le vécu“ [die 20 Slavoj Žižek hat auf den Befund der Zeichen- und Szenenordnung bei Alfred Hitchcock hingewiesen. Hitchcock hat in mehreren Filmen das Finale als Rückkehr in die patriarchale Ordnung der bürgerlichen Ehe ironisiert, die eine Art Zähmung der matriarchalen Rolle darstellt. Vgl. Slavoj Žižek u.a.: Ein Triumph des Blicks über das Auge. Psychoanalyse bei Hitchcock. Wien 1998. Žižek geht im Vorwort (S.10) auf die Metamorphose des Helden durch die Begegnung mit der weiblichen Produktivität ein: „In ihm [dem veränderten Ich des Helden; R.B.] wird nämlich die ganze Problematik des Sexismus veranschaulicht: der traumatische Preis, den eine Frau zu bezahlen hat, um eine ‚normale Ehefrau‘ zu werden, und die Bedrohung, die selbstbewußte Weiblichkeit für die männliche Identität darstellt.“ Aber auch das Gegenbild hat Hollywood aufgenommen. In Und täglich grüßt das Murmeltier (USA 1993, Regie: Harold Ramis) erlebt der Held ein- und denselben Tag immer wieder und entrinnt der seriellen Zirkulation erst, als er ein Anderer wird, indem er die Liebe zur Frau entdeckt. 21 Algirdas J. Greimas: Der wissenschaftliche Diskurs in den Sozialwissenschaften. In: Peter V. Zima (Hg.): Textsemiotik als Ideologiekritik. Frankfurt am Main 1977, S.77-144, S.99. 22 Ebd.
1. VORLESUNG
gelebte Erfahrung] nenne, ist nun aber gerade das ganze des dialektischen Prozesses des psychischen Lebens, ein Prozeß, der sich selbst notwendig weitgehend verborgen bleibt, weil er eine ständige Totalisierung ist, und zwar eine Totalisierung, die sich ihrer nicht bewußt sein kann. [...] Einen Traum versteht, wer ihn in einer Sprache erzählen kann, die selbst geträumt ist. Jacques Lacan sagt, das Unbewußte ist wie eine Sprache strukturiert: ich würde eher sagen, die Sprache, die das Unbewußte wiedergibt, hat die Struktur eines Traumes.23
Darauf hat auch Kristeva hingewiesen. Ihr Ansatz geht von der Ablösung des Symbolbegriffs und seiner vertikalen Ausrichtung (dem theologischen Verweis oder der anagogischen Funktion) durch die syntagmatische-horizontale (ab dem 15. Jh.) aus, die schließlich eine gleichwertig horizontal/vertikale Gliederung der Struktur nach Saussure wird. Vereinfacht gesagt, wird dadurch eine diskursive Ordnung der Theologie, der Literatur und des Dialogs als Bildfläche (horizontal/vertikal) voneinander ableitbar. Das semiologische Problem aber bleibt das gleiche, denn zunächst interessieren sich die Linguisten nicht für die Performanz der Dialogizität. Es ist der Anthropologe Lévi-Strauss, der sie auf diese Spur führt. Die Symbolfunktion hat daher auf Grund ihrer vertikalen Dimension [...] einen restriktiven Charakter [...]. Der horizontalen Dimension der Symbolfunktion (der wechselseitigen Bestimmung der signifikanten Einheiten) fällt die Aufgabe zu, das Paradox zu vermeiden. Man kann sagen, daß das Symbol auf horizontaler Ebene antiparadoxal ist. In seiner „Logik“ schließen zwei entgegengesetzte Einheiten einander aus. Das Gute und das Böse sind unvereinbar in gleicher Weise wie das Rohe und das Gekochte, der Honig und die Asche usw. – Sobald der Gegensatz auftritt, erfordert er eine Lösung; auf diese Weise wird er verdeckt, „aufgelöst“, das heißt beseitigt. Den Schlüssel zur semiotischen Praxis des Symbols liefert uns bereits der Anfang des symbolischen Diskurses: Der Verlauf der semiotischen Entwicklung bildet einen Nexus, dessen Abschluß vorprogrammiert ist und in nuce im Anfang enthalten ist (dessen Ende der Anfang ist), da ja die Funktion des Symbols (dessen Ideologem) der symbolischen Aussage als solcher vorangeht.24
Das Spiel der Verarbeitung der Paradoxie der statischen Objekte, also der diskursiven Taxonomik der immer schon verabredeten sprachlichen Bedeutungen und topoi kehrt also stets von der inszenatorischen auf die situative Ebene zurück, scheitert aber zugleich im Erkenntnisvorgang des Prozesses selbst an der Unmöglichkeit der Wiederholung. Das nun das Zeichen als Synthese und als Relation von Opponenten (Signifikant|Signifikat) aufzufassen ist – einmal als Element, einmal als Prozess – ermöglicht es, zwischen beiden Auffassungen ein Spiel zu entfalten. Man muss also historisch erst einmal den Unterschied zwischen Symbol und Zeichen auf eine Gegenwartsebene setzen, um dieses Spiel zwischen der Struktur und der Generativität betreiben zu können. Das geschieht genau mit der Darstellung des strukturalen Zeichens durch Saussure – wobei die Interpretation sich zunächst und zu Recht der Statik der Elementbeziehungen versichert, um nach und nach über die 23 „Sartre über Sartre“. Interview aus dem Jahre 1969. Abgedruckt in: Jean-Paul Sartre: Das Imaginäre.
Phänomenologische Psychologie der Einbildungskraft. Reinbek 1971, S.20. Sartre bezieht sich hier auf seine Darstellung des „Verstehens“ bei Flaubert. Seine Ausführungen münden in der Ablehnung des Unbewußten Freuds: „Dagegen glaube ich nicht an das Unbewußte in der Form, in der die Psychoanalyse es darstellt.“ (S.18) 24 Kristeva, Der geschlossene Text, a.a.O., S.197f.
23
24
1. VORLESUNG
Episode des Poststrukturalismus hinaus die Dynamiken der Produktion zu verstehen. Das Problem der Nichtwiederholbarkeit der Veranlassung des Spiels lässt in der rationalen Logik sofort das Gespenst der Metaphysik der Zeitlichkeit aufkommen: jene Zeit der Situativität von Gesellschaft und Produktion, die in der Aussagenlogik niemals zu Wort kommen darf. Was nämlich, wenn die Bedeutungen nicht struktural vorgegeben sind, sondern – so das Konkurrenzunternehmen der Hermeneutik – situativ erfunden (diviniert) werden müssen, damit man der Herrschaft der bloßen Reproduktion, der Codes und der Riten entgeht?
Schema Signifikant|Signifikat aus Ferdinand de Saussure: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. 2. Auflage. Berlin 1967. Verlag Walter de Gruyter & Co., S.78.
Das Zeichen, das im orthogonalen Gleichgewicht einer cartesianischen Ruhe angelegt ist, von diesem Zeichen sagt Kristeva, dass seine heutige Funktion darin aufgeht, das „unmittelbar Sichtbare“ als „Objektivität“25 zu kennzeichnen und dem drohenden Kältetod26 darin zu entgehen, dass Verschiebungen und Verdichtungen jeweils im Sog eines „Wunsches“ die Erfüllung verfehlen. Die Veranlassung der Verweisung, die Inszenierung, erfolgt hier also durch einen simulierten Mangel an sinnlichen Vollzügen, durch die Verdeckung der Ableitungen der Produktion und ihrer Opfer. Literarisch erfüllt der Kriminalroman die Öffnung dieser Verdeckung auf syntagmatischer Ebene: Die Opfersubstanz steht am Anfang eines Verweisungspro25
Ebd., S.199. Bezeichnenderweise enthüllt sich Descartes der Cartesianismus im Traum.
26 Dosse, Geschichte des Strukturalismus Bd.1, a.a.O., S.239: „Dieser Formalisierungstraum steht unter
dem Wahrzeichen des Strukturalismus, dem Kristall, dessen niedrige Temperatur die Dispersion der Moleküle verhindert, worauf die Hoffnung gründet, durch Einfrieren der Menschheit den Nullpunkt an den transzendenten Schlüssel ihrer Möglichkeitsbedingungen zu gelangen: ‚der Wunschtraum der Strukturalisten wäre der Kältetod.‘“ Zitation: Manfred Frank: Was ist Neostrukturalismus? Frankfurt am Main 1983, S.65. Frank bezieht sich auf eine Aussage von Lévi-Strauss, der die Struktur als „Kristall“ bezeichnet. Jean Baudrillard hat das Motiv des Kältetodes mehrfach thematisiert. Am Nachdrücklichsten in Bezug auf das Todestriebmodell von Freud. Vgl. Jean Baudrillard: Der symbolische Tausch und der Tod. München 1991. Er nimmt dort auch Bezug auf einen asignifikativen Zeichengestus, dem urbanen Graffiti: „Irreduzibel auf Grund ihrer Armut selbst, widerstehen sie jeder Interpretation, jeder Konnotation und sie denotieren nichts und niemanden mehr: weder Denotation noch Konnotation, so entgehen sie dem Prinzip der Bezeichnung und brechen als leere Signifikanten in die Sphäre der städtischen, erfüllten Zeichen ein, die sie durch ihre bloße Präsenz auflösen.“ (S.123) Die Auseinandersetzung mit der Vorgabe Freuds erfüllt durchaus eine Lücke in der Frage nach dem „Menschen“, die zwischen „Auslöschung“ als Erfüllung und „Auslöschung“ als Leere in einem Maß oszilliert, das „den Menschen“ keine anthropologische, sondern eine durch die Zeichen- und Medientechniken je situativ zugestandene Rolle zuweist.
1. VORLESUNG
zesses von Zeichen und Indizien, an deren Ende das Opfer durch Schuldabtragung im anthropogenen Täter bedeutsam geworden ist. Der Bedeutsamkeit des Opfers entspricht die Suche nach der Bedeutsamkeit des Täters. Aber diese syntagmatische Lösung erfordert wiederum das Opfer der Zeit, und der Inzest der Identifizierung des Täters ist ein magischer, denn die Schuld ist nicht aus der Welt – gut, für diesmal war der Autor nur der symbolische Täter.27 Die Faszination des Kriminalromans lebt davon, dass der Täter/die Bedeutung schon fest steht/Tod ist und dass diese Bedeutung eindeutig abgeleitet werden kann – dass der Autor uns aber glauben lässt, dass der Sinn sich erst durch die Lesung ergibt, dass am Anfang alle Möglichkeiten als offen inszeniert werden, obwohl sie es nicht sind. Kehren wir zur nichtprozessualen Betrachtungsweise zurück, so besticht die Semiotik in erster Linie als Ordnungswissenschaft von differenziellen, und nicht von paradoxalen Bezügen. Nicht die Dinge, sondern deren Elementarität und Kombinatorik werden zum Ziel der Gebrauchsorientierung in den Fokus gerückt. Die beiden natürlichen Bereiche, auf die sich die Semiotik bezieht, sind das Design, also die Zurichtung der Dinge als Zeichen und opferlose Gebrauchsgaben, und die Zurichtung von Information als transpositionslose Konnektivität von Kommunikation durch Medien. Das reine Zeichen dient der Reproduktion der Bedeutung. Es vermittelt zwischen Dingen und Medien – wobei die Subjekte nach alter Rechnung jeweils auf Seiten des Dings (Körpersinne) oder auf Seiten des Mediums (Geist und Sinn) angesiedelt sind, zuweilen aber bloß den repräsentativen Status eines Zeichens (Person) annehmen oder eben den des Mediums selbst. Der Handel dieser Ordnungswissenschaft geschieht im positiven Bereich konsumativer Gaben, nicht in jenem der Opfer. Wozu sollte man produzieren, außer zur Konsumation? Die Hortung der Produktionswerte kumuliert deren gewalthafte Befreiung, sprich: der Kriegsform der Konsumation. Die Positivität hat zudem den Vorteil nahezu verlustfreier Transposition. Erlaubt sind in dieser Topologie des Zeichens nur zwei Variationen: Bei Freud laufen sie unter dem Schema der „Verdichtung“ und der „Verschiebung“, im Verhältnis zur Wirklichkeit der sprachtechnischen Norm.28 Wir erwähnen das nicht nur, weil die Begriffe „Metapher“ und „Metonymie“ insbesondere bei Lacan29 strapaziert werden, sondern, weil Kristeva damit den Begriff der „Intertextualität“, der später durch den der „Transponierbarkeit“30 ersetzt wird, einführt. Unter „Transposition“ versteht sie nämlich noch einen „dritte[n] ‚Vorgang‘ “ der Traumproduktion, den „Übergang von einem Zeichensystem zu einem anderen“ 31, den Freud mit „Rücksicht 27 Man erinnere sich der Cameo-Auftritte Hitchcocks in vielen seiner Filme, die sowohl als Markenzeichen als auch als Hinweis auf die Wahrnehmbarkeit der Inszenierungsmethode verstanden werden sollen. 28 Freud, Die Traumdeutung, a.a.O., S.234: „VI. Die Traumarbeit.“ 29 Siehe insbesondere Jacques Lacan: Das Drängen des Buchstabens im Unbewussten oder die Vernunft seit Freud. Schriften II. Olten 1975. Hier geht Lacan dezidiert auf die Semiotik Saussures ein. Ebenso Roland Barthes: Elemente der Semiologie. Frankfurt am Main 1981, S.49ff. 30 Kristeva, Die Revolution der poetischen Sprache, a.a.O., S.69: „Der Terminus Intertextualität bezeichnet eine solche Transposition eines Zeichensystems (oder mehrerer) in ein anderes; doch wurde der Terminus häufig in dem banalen Sinne von ‚Quellenkritik‘ verstanden, weswegen wir ihm den der Transposition vorziehen; er hat den Vorteil, daß er die Dringlichkeit einer Neuartikulation des Thetischen beim Übergang von einem Zeichensystem zu einem anderen unterstreicht.“ 31 Ebd.
25
26
1. VORLESUNG
auf Darstellbarkeit“ 32 übertitelt hat. Die „Darstellbarkeit“ 33 – und darauf soll es uns hier ankommen – ist „die spezifische Weise, in der sich Semiotisches und Thetisches innerhalb eines Zeichensystems artikulieren.“34 Die Darstellbarkeit erlaubt, prospektiv und retrospektiv in Handlungsorientierung zu denken, d.h., die Zeitmodalitäten Vergangenheit (Erfahrung, Gedächtnis, Bedeutung) Gegenwart (Präsenz, Situiertheit, Dasein) und Zukunft (Theorie, Modell, Entwurf ) differenzieren sich aus und können in Tauschbeziehung (Motivierungen) gesetzt werden. Was nicht getauscht werden kann in dieser Positivität der Transposition, ist die Negativität der Zeit. Nun ist das Formgesetz der „Szene“ zunächst nichts anderes als eine sich aus den positiven Differenzen abgrenzende Synthese, die fortwährend ihre Negation (den Kontext, den Außenbereich, das Andere, den Beobachter etc.) erzeugt und substituiert, so wie das Signifikat sich dem Signifikanten substituiert und ihn retroaktiv motiviert. Zur Kennzeichnung der Synthesen genügen drei grundlegende Begriffe, die man der Rhetorik entlehnt hat, jener „Kunstform“, die die sprachlichen Elemente und später die Formelemente im Allgemeinen zu übergeordneten Elementmengen zu kombinieren und begrifflich zu synthetisieren verstand: Die Syntaktik untersucht die Beziehung zwischen den Zeichen; die Semantik fragt nach der Verweisungserfüllung, der Bedeutung eines Wortes, dem Sinn eines Satzes als logischer Einheit oder einer sonstigen Synthese; die Pragmatik differenziert nach Handlung, Funktion und Gebrauch der Verweisung vor allem im Sozialzusammenhang. Die Semiotik könnte demnach auch die Nachfolgerin einer ars combinatorica sein. Statt einer strengen vertikalen und horizontalen Verknüpfung könnte sie eine virale haben. Doch die Idee der Struktur wird zuerst an die horizontalen Ableitungen nach Art der Kausalität oder nach vertikalen Gesichtspunkten, der Verwandtschaft oder der Machtverhältnisse organisiert. Der Streit um die Substanz des Zeichens geht, Sie ahnen es vielleicht, um die Frage, was das differenzielle Urelement ist, also was die Raum oder Zeit überbrückende Verweisung/Transposition veranlasst und warum diese Veranlassung einmal bewirkt, dass man fremdreferentiell nach der Bedeutung, und einmal selbstreferentiell nach dem Sein des Zeichens, dem Signifikanten selbst fragt. Könnte es dagegen nicht sein, so überlegt Lévi-Strauss, dass es die Zeit und den Raum nur im Zusammenhang mit den Kreuzungspunkten der Struktur gibt – dass es nur eine strukturale Topologie gibt, die einzig den sozialen Raum ausmacht? Solange aber nicht jede mögliche Position der Struktur bestimmt ist, sorgt ein gewisser Mangel oder eine Lücke in der Differenzialordnung dafür, die Erfüllung in einem anderen Kontext zu suchen, also die Transposition oder Verweisung auf der Grundlage einer Negation zu vollziehen, um so die Individualität hinten wieder einzuführen, die man vorne ausgefüllt hat. Dem Schatten des Erfüllungswunsches ist also vorerst nicht zu entkommen. Z. B. kann man im Wort selbst nicht das Ziel einer Handlung finden und verdächtigt deshalb den Bereich der Dinge „gemeint“ zu sein, insbesondere dann, wenn 32
Ebd. „Rücksicht auf Darstellbarkeit“ ist ein Terminus Freuds. In: Freud, Die Traumdeutung, a.a.O., Kapitel VI. D. 33 Kristeva, Die Revolution der poetischen Sprache, a.a.O., S.70. 34 Ebd.
1. VORLESUNG
diese Dinge jetzt und hier nicht da sind bzw. in Form einer Vorstellung beschworen werden. Auf diese Weise konstituiert und produziert der Tausch den Raum und die Zeit als Realität; er setzt sie nicht mehr voraus und entlarvt sowohl Descartes als auch Kant eines Irrtums. Umgekehrt kann in der Poetik das Wort in Beziehung zu anderen Worten thematisiert werden, ohne auf Dinge verweisen zu müssen. Der Klang kann hier entscheiden. Wichtig ist allemal die Funktion der permanenten Überschreitung. Sie kann beliebig sein oder von der Codierung abhängig. In der Regel genügt sie einer Körper- oder Sinnenpraktik, die situativ selbst keine Überschreitung ist. Entscheidend für uns ist die Überschreitung zur Selbstreflexion, d.h. das Konzept einer möglichen Praxis, die voraussetzt, dass wir ihre Handlung einem Realisierungsaufschub unterwerfen, was wiederum voraussetzt, dass wir innerhalb der Handlung ein Dispositiv der Zeit schaffen, das wir als Zeichen deuten können. Der biologistische Begriff dafür ist „Triebaufschub“, seine Basis der krude Kraftbegriff des Triebs, dem die Idee des gesellschaftlichen Fortschritts entspricht. Ich habe aber angedeutet, dass es in der Semiologie um genau diese Strategie der Aufhebung des linearen Zeitbegriffs als grundsätzlicher ideologischer Setzung von Raum und Zeit geht. Die Struktur verwaltet die Idee, dass das Begehren sich selbst begehrt – dass es, wie Greimas in seinem semiotischen Viereck35 andenkt, darum geht, die Strategie des Todestriebes als eine objektive Oszillation zwischen dem Begehren und seiner Aufhebung im Zeichen, respektive Wort zu erkennen. Die Sublimierungen und Fluchten sind dann gleichbedeutend mit der Bahnung der der Struktur, für die alle Arten des Raumes zur Vorstellung gelangen: der riemannsche, der euklidische, der einsteinsche, der mandelbrotsche, der systemische etc. Anders gefragt: Ist es die fehlende Macht des Körpers über abwesende Dinge, die den Aufschub dieser Macht in der Gegenwart eines Zeichens aktualisiert? Dann wäre aber das Ziel der Verweisung des Zeichens ein ganz anders, nämlich die Sublimierung eines Mangels an Gegenwart durch die Vorstellung, die über sie hinausreicht: die Erfüllung des Begehrens als Vorstellung, deren Simulation Text ist. In der Fiktion ist dann die Erfüllung nicht realisiert, sondern ironisiert oder invertiert. Hier haben wir also das reale Produkt der Event- und Präsenzgesellschaft: eine simulative „Inszenierungsgesellschaft“, die vor dem Kältetod der Rationalität in den dionysischen Taumel einer rituellen Praktik flüchtet. Gerade das, was sich nach Kristeva dem Tausch entziehen soll, wird auf der Ebene der Simulation des Zeichens noch einmal zum Konsum angeboten. Da das Individuum als Subjekt zugleich Produziertes und Produzierendes ist, in dem Maße, wie es Konsumiertes und Konsumierendes ist, erscheint jede Tendenz nur als Vereinseitigung eines Vorgangs, der selbst abwechselnd rhythmisiert und periodisiert. Wir werden das später an dem „Hin und Her“ 35
Vgl. Nöth, Handbuch der Semiotik, a.a.O., S.117. Allerdings macht Greimas es sich zu einfach, wenn er die Opponenten „Anwesenheit – Abwesenheit“ gegen die von „Leben – Nicht-Leben“ bzw. „Tod – Nicht-Tod“ kreuzweise gegenüberstellt. Das Freud’sche Modell des Todestriebes wird erstens aus dem Gegensatz „organisch-anorganisch“ gespeist, zweitens öffnet sich gerade der auf Dinge und Sachen hin stabilisierte Inszenierungs-, d.h. Darstellungsbereich an der Anziehung/Abstoßungsgrenze, da das „Lustprinzip [...] sich aus dem Konstanzprinzip ableitet.“ Vgl. Sigmund Freud: Jenseits des Lustprinzips. In: Das Ich und das Es und andere metapsychologische Schriften. Frankfurt am Main 1982, S.121-170, hier S.122.
27
28
1. VORLESUNG
der hermeneutischen Methode Sartres zeigen. Die beiden Produktionsweisen, die Kristeva veranschlagt sind im Zeichen, – gleich den Quanteneigenschaften – als zwei Zustände der Struktur immer nur um den Preis der Stillstellung ihres Prozessierens beobachtbar, also quasi als Text. Um dem strategischen Spiel der Vergegenwärtigung oder Temporalisation entgehen zu können, muss man die Versammlung des Gegenwärtigen von dieser aufund vorschiebenden Verweisung ausnehmen. Es gilt, eine thetische Setzung36, einen Anfang, ein Datum in dem Zirkel dieser Ökonomie zu wählen. Wir wählen aus dem Medium der Gegenwart. Diesen Modus der ständigen Gegenwart ohne reflexive Vergegenwärtigung (der Wahrnehmung ohne Erkenntnis, wie es bei Sartre heißt) wollen wir Situation nennen. Die Situation meint also den schon gelungenen Aufschub der Zeichenfunktion als Funktion der Praxis der Repräsentation. Wenn allerdings von „reiner“ Gegenwart die Rede ist, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass diese Gegenwart selbst von den Differenten der Vergangenheit und Zukunft „verunreinigt“, infiziert ist – und zwar auf eine Weise, die der Art des Zeichens entspricht, die man Symptom nennt. Das Symptom als Zeichen, das nicht täuscht, vergegenwärtigt also die Unmöglichkeit einer reinen Präsenz oder Identität. Das Symptom ist das (Körper-)Zeichen des nie gelingenden Gelingens, der unproduktiven Produktion – einer Situation, die sofort, wenn man sie strategisch überblickt und in Epochen der Handlung und der interpersonalen Beziehungen selektiert, als Szene erscheint, als eine Art der hysterisierten Aufklärung, die sich im Wiederholungszwang als Nichtabschliessbarkeit darstellt. Die Szene sei die Einheit der Semiologie und das Zeichen die temporale Einheit einer Produktion (Handlung), die die Serialität (Wiederholung Aufführbarkeit, Inszeniertheit) zu Zwecken ihrer Unmöglichkeit anzeigt. Wie kann man eine Theorie oder „Strategie“ über dieses „relativ Nichtseiende“ der Gegenwart aufstellen, das die funktionierende Praxis ist, deren Gesamtzusammenhang niemand überblickt und die also keine Rücksicht auf Darstellbarkeit hat? Dieses „néant“ (das „relativ Nichtseiende“; Sartre) verweist auf die Aufhebung der „für die Philosophie grundlegenden Opposition zwischen dem Sensiblen und dem Intelligiblen“, oder zwischen Körper und Geist – also auf die medial scheinbar gelöste Frage der Transponierbarkeit durch Codes.37 Das, was diese „metaphysische“ Differenz erzeugt – was also die Spur der Nachbarschaften, der Ähnlichkeiten und der Struktur und Geschichte der Sprache weitertreibt –, wird durch die Temporalisation, oder, wie Heidegger sagt, die Verzeitlichung strukturiert: d.h., sie erhält durch die technische Ordnung der Dinge eine bedeutsame Dauer. Zeitlichkeit und Bedeutung sind daher die Äquivalente, die die reine Gegenwart, ihre Repräsentation in der reinen Wiederholung verhindern und so die Geschichte als Faktizität beglaubigen. Diese Geschichtlichkeit gilt es nun in der Struktur der Semiotik zu erkennen.
36
„Das Thetische ist die Voraussetzung für das Aussagen ebenso wie für die Denotation.“ Kristeva, Die Revolution der poetischen Sprache, a.a.O., S.62. 37 Jacques Derrida: Die différance. In: Ders.: Randgänge der Philosophie. Frankfurt am Main 1976, S.6-37, hier S.9.
2. VORLESUNG Sprache ist Effekt ohne Ursache – Die Szene hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Sie stellt ihre Zeitdauer dar – In der Praxis der Schrift ist jeder für sich der Andere – In der Sprachhandlung sind die Subjekte präsent, als transzendierte Anwesende: Sie beobachten sich nicht, wie sie handeln – Der Unmöglichkeit der Identität entspricht die Tabuisierung des Inzests – Warum sollte die Theorie lügen? Und warum sollte die Praxis gelingen?
Die Problematisierung einer entgegenkommenden Zeit für die Zeichentheorien hat am originellsten wohl Jacques Derrida zu Anfang der 1960er Jahre ausgeführt und damit der strukturalistischen Verfestigung einerseits und der von Sartre und von Kristeva weiterentwickelten Politisierung andererseits neue Impulse abgewonnen. Derridas frühe Schriften entstanden Anfang der 1960er Jahre. Sie leiten den Umbruch zu einer Verzeitlichung der strukturalen Oppositionen ein; es geht um das Ursprungsdilemma der linguistischen Theorien. Zwischen individualisierendem Akt und vergesellschafteter Struktur (Grammatik) gilt es, eine Ebene der Übertragung zu finden, also die in der Koexistenz der Zeichenopponenten latente Synchronie mit der Diachronie der historisch-dynamischen, unwiederholbaren Akte zu koordinieren. Dieses Hauptproblem der Wiederholbarkeit ohne Ursprung, das uns in der Verweisung einer Szene begegnet, kennzeichnet nicht nur das Problem der Arbeiten von Saussure, der in Konvention und Ritual eine Form produktiver Wiederholung sieht. Verweisungen auf Szenisches als Bedeutungshandlung finden sich schon in den Sprachtheorien Humboldts und Schleiermachers, so ein Hinweis von Christian Stetter von 1980: Wie soll sich aus der Idee eines Systems koexistierender Zeichen der Begriff des Zeitverlaufs logisch ableiten lassen?38 – „Unverkennbar zeichnet sich – insbesondere in der sprachtheoretischen Analysen Schleiermachers – die Einsicht ab, daß der vermeintliche Widerspruch zwischen Synchronie und Diachronie auf das Konto eines Grammatik-Begriffs zu buchen ist, der seine Prägung der Vernachlässigung der zeitlichen Dimension der Rede verdankt.39
Die Aufgabe wird sein, diese „Vernachlässigung“ dem Raumbegriff zukommen zu lassen, und zu zeigen, dass es nicht um die abstrahierende Tauschfunktion von Raum und Zeit geht (also um die Theoretisierung einer Linguistik respektive Semiotik), sondern um die Produktivität von Gesellschaft und deren Gegenfunktion als Verzeitlichung, d.h. deren konsumativ-ökonomische Dingsynthesen. Wir schlagen, wie schon hergeleitet, vor, als paradigmatische Verschiebung die Begriffe „Situation“ und „Szenifikation" (Szene) einzusetzen, müssen diese Begriffe aber aus ihrer theaterwissenschaftlichen Konnotation lösen und in das Praxisfeld integrieren.40 38
Christian Stetter: Zum Verhältnis von Sprachsystem und Sprachgeschichte. In: Fugen: deutsch-französisches Jahrbuch für Text-Analytik 1980. Olten 1980, S.233-247, hier S.239. Die grimmsche Kleinschreibung von Stetter wird nicht beibehalten. 39 Ebd., S.240. 40 Dazu dienten auch Untersuchungen, die in der Reihe Szenografie & Szenologie sich auf Darstellung und Analyse von aktuellen Inszenierungs- und Szenografie Aktionen und Produktionen beziehen.
30
2. VORLESUNG
Dass der Zeitbegriff nicht als abstrakter, astronomischer Begriff anzusetzen ist, betont auch Stetter: Das Zeichen muss, um seine Referenzfunktion leisten zu können, sinnlich gegeben sein, wenigstens in jenem Teil, der signifikant ist und durch den die Bedeutungsvorstellung repräsentiert wird. Das geschieht astronomisch wie astrologisch aus den stellaren Beziehungen und Perioden der Natur, aber auch ihren Irregularitäten41 und aus den anthropologischen Ritualen und Konventionen, die zueinander in Beziehung gesetzt werden und mehr oder weniger einem Analogieverhältnis beider Zeitvorstellungen entspringen: Wenn die Sterne in dieser Konstellation stehen, bedeutet das für die Gruppe diese oder jene zukünftig eintretenden Ereignisse. Wenn der Code in diesem Algorithmus übertragen wird, wird er die folgenden Ergebnisse zeitigen usw. Vereinfacht gesagt haben wir es bei der Raum-Zeit-Abstraktion mit einer Aufhebung, einem Aufschub der Semiotisierung zu tun: mit einem Entwurf, einer Szene, die vom Körper respektive von dessen Leibfunktionen ausgeht und nicht von Tauschbeziehungen, also reversiblen, wiederholbaren Gebrauchsfunktionen auf der Ebene des Codes „Geld/Zahl“. Nun ist das, was sinnlich gegeben ist, seit Heidegger als Idee der Verzeitlichung selbst das Ereignis der „Zeit“. Die Figuren der Zeit entstammen also einer Sphäre der Produktion, die vor der Zeit als Gabe sich selbst produziert – um mit dem Gabenbegriff die Initiation zum Tauschvorgang als Grundkonstellation der Vergesellschaftung zu benennen.42 Wir lassen offen, ob darunter eine Art opferlose Natur verstanden werden kann, und ob es überhaupt ein „natürliches Zeichen“ als Äquivalent einer „natürlichen Gesellschaft“ geben kann. Hier soll dieser protosemiotische Zustand im nicht historischen und nicht anthropologischen Sinne mit Situation/Gegenwart übersetzt werden: als das, was zu jeder Zeit das Gegebene ist. Der korrelative und – wenigstens vor Einstein – nicht zu überwindende Gegensatz von Raum und Zeit entfällt somit und macht auch eine mechanistisch-topologische Sprachuntersuchung, so sinnvoll sie in linguistischer oder medialer Hinsicht anfänglich ist, obsolet. Es gilt also in den entsprechenden Begriffsrepertoiren des Körpers – szenisch-leibliche Präsenz und situative „Geworfenheit“ einer „automatisierten“ Praxis – den kommunikativen und den informativen Anteil des performativen Umgangs mit Zeichen als Beziehung des Individuums innerhalb des Produktionskörpers der Gesellschaft zu begreifen, nicht aber sich in Ursprungsmeditationen zu verwickeln, die letztlich das Resultat einer Schuld-/ Opfer-Verschiebung darstellen. Aus diesem phänomenologischen Ansatz, der von den Semiologen wegen seiner subjektiven Sättigung abgewiesen wird43, ergibt sich, 41 Die bekanntesten sind wohl die Saturnalien, die je mit Rausch und Traum, also mit der primären
Produktion von „Spiel“ respektive Unvorhersehbarkeit in Zusammenhang gebracht wurden. Vgl. Florens Christian Rang: Historische Psychologie des Karnevals. Berlin 1983. Rang weist nach, dass die hysterisierten Riten des Karnevals Inszenierungen der Rekursivität der Planetenbewegung, insbesondere des Saturns und seiner Epizykel darstellen. Wir haben hier den Paradefall der Inszenierung als Verzeitlichung, d.h. der Regression von abstrakter, unwiederbringlicher Zeit auf die Zeit des Rituals. 42 Initiiert hat Marcel Mauss die Gaben-Problematik bei Lévi-Strauss. Derrida hat sie 1991 wieder aufgenommen. Siehe Jacques Derrida: Falschgeld. Zeit Geben 1. München 1993. 43 Vgl. Dosse, Geschichte des Strukturalismus Bd.1, a.a.O., S.69. Da die Rezeption der Phänomenologie in Frankreich sowohl durch die vor dem Krieg in Paris gehaltenen Vorträge Husserls, stärker aber noch von Sartre aus erfolgte, richteten sich die Angriffe der Strukturalisten sowohl gegen einen
2. VORLESUNG
so Stetter, „ein strikt pragmatischer Bedeutungsbegriff, da er ja die Verknüpfung der Ausdifferenzierung sprachlicher Terme mit dem je individuellen körperlichen Erleben als unabdingbares Fundament jedes Spracherwerbs ausweist.“44 Daraus können wir zwei Leitfragen formulieren: 1. Kann es sein, dass gerade das dominante mediale Modell der Schrift mit seinen linear-arbiträren Zeichencodierungen – statt performative Synthesen – darstellbar zu machen – eine bivalente Struktur protegiert? 2. Kann es sein, dass in einer auf Echtzeitpräsenz tendierende Gesellschaft, die stärker als frühere Gesellschaften durch symbolische, designatorische Elemente kommuniziert und die informatorischen Einheiten (Semiosen) Maschinenprozessen unterwirft, das Modell der arbiträren Schriften kontaminiert ist und deswegen theoretisch (wieder) auf pragmatische und performative, d.h. inszenierte Kommunikationseinheiten umschaltet? Aus der Signifikantenkette der Codes lassen sich Texturen lesbar machen, die wie ein gewebter Stoff ikonische Muster hervorzaubern und die Lesarten pluralisieren. Kristeva fordert die Betrachtung dieses Wechselverhältnisses von Textur/Struktur einerseits und Prozess/Produktion andererseits: „Es käme folglich auf eine Auseinandersetzung der Semiologie mit mathematischen Systemen an, mit skripturalen Systemen, die mit Merkmalen (marques) arbeiten, die als räumlich-szenische Gestaltungen aufzufassen sind (configurations spatio-scéniques).“45 Gegen die topologischen Modelle von Lacan und Foucault46 sind solche von temporal-szenischer Art zu setzen, deren Transposition in Schrift jedoch prekär ist. An ihre Stelle treten in den wissenschaftlichen Entwurfsprozessen Simulationen, Modelle, Experimente, die performativen, d.h. inszenierten Charakter mit synchroner Prozessualität aufweisen. Zeichnen wir im Folgenden die Situation der Semiologie zur Zeit des poststrukturalistischen Umbruchs, der hermeneutischen Einsprüche und der ideologiekritischen Debatten in den späten 1960er Jahren nach, weil sie die wesentlichen Probleme einer auf Ähnlichkeit oder Gleichheit polarisierenden Kommunikationsund Informationstheorie diskutieren.47 Wir schwenken deshalb von der Darstellung Kristevas auf die Derridas um. Subjektivismus der Phänomenologie wie auf eine bewusstseinsfundierte historische Dialektik, wie sie Sartre entwickelte. 44 Stetter, Zum Verhältnis von Sprachsystem und Sprachgeschichte, a.a.O., S.243. 45 Julia Kristeva: Semiologie als Ideologiewissenschaft. In: Peter V. Zima (Hg.): Textsemiotik als Ideologiekritik: Frankfurt am Main 1977, S.65-76, hier S.71. 46 Lacan beschäftigt sich mit einer Theorie der Knoten, Foucault mit Heterotopien. Vgl. Dosse, Geschichte des Strukturalismus Bd.2, a.a.O., S.535ff. 47 Vor allem darf man sich auf zwei eher praktisch orientierte Analysen Baudrillards beziehen. Die eine widmet sich dem Zeichen als Ding, dem Design, die andere dem Konsum des Zeichens. Baudrillard übersetzt also die abstrakte Kommunikationsproblematik der Übertragung von Raum unter dem Opfer der Zeit in Kommunikations-, also Zeichengesellschaften. Er distanziert sich von dem marxschen Modell der Gesellschaft, die die körperliche und geistige Arbeit an erster Stelle setzt. Vgl. Jean Baudrillard: Das System der Dinge. Über unser Verhältnis zu den alltäglichen Gegenständen. Frankfurt am Main 1991 (frz. 1968) und Ders: Die Konsumgesellschaft. Ihre Mythen, ihre Strukturen. Heidelberg 2015 (frz. 1970).
31
32
2. VORLESUNG
Derrida hat darauf aufmerksam gemacht, dass das, „was die Gegenwärtigung des gegenwärtig Seienden ermöglicht, [...] sich nie als solches [gegenwärtigt].“48 Wir haben es hier mit dem Hinweis auf die Unmöglichkeit der Darstellung präsemiotischer „traumanaloger“ Produktion zu tun. Das hört sich tiefgründiger an, als es ist. Man stelle sich vor, mit Bewusstsein die europäischen Normtreppen der Architektur herabzugehen; man gerät unweigerlich ins Stolpern. So lange man aber den Erfahrungen der Beine vertraut, ist das Herabsteigen einer Treppe, so artifiziell es im Bewegungsablauf auch sein mag49, ein automatischer, praktischer Vorgang ohne Signifikationsmerkmale. Die Signifikation tritt dann mit einem Schild „Achtung Stufe!“ ein, wenn es sich gerade nicht um einen serialisierten, wiederholbaren, motorisch eingeübten Vorgang handelt. Auf diese Weise, weil die Dinge schon einmal durch den Entwurfsprozess hindurch gegangen sind, ist das Signifikat in der Praxis der Wahrnehmung redundant. Derridas Begrifflichkeit weist auf eine neue Deutung des strukturalen Problems der Selbsthervorbringung des Zeichens als einer Produktion hin, von der man nicht weiss, wer sie veranlasst, wer die Repräsentation präsentiert. Da die Sprache ein „Effekt ohne Ursache“50, ein sich selbst durch Produktion aufschiebendes Gebilde ist, das sich im Akt des Sprechens konstituiert und aufhebt und zugleich im Akt des Schweigens konsolidiert und „archiviert“, eignet der Sprache kein Ursprung. Sie ist ein Werden, dessen Produkt am Ende des Zyklus die Dauer der Dinge manifestiert, die das Subjekt als sein eigenes Bewusstsein beherrschen. Das Subjekt ist dann ein kontinuierliches Ereignis, das sich selbst überschreitet. Und was überschreitet es? Das Gegenwärtige, Präsente, Anwesende. Das ist aber das Situative, wie wir eben sagten. Für das Subjekt gilt: Es ist, was es nicht ist; es ist nicht, was es ist. Diese Definition ist aber seit Augustinus die Definition von Zeit, genauer: der menschlichen Zeitlichkeit, und noch genauer: des Intervalls oder der Periode des Bewusstwerdens einer Situation als einer Szene (und nicht notwendigerweise eines Dings). Die Szene muss, um als solche kenntlich zu sein, einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben, d.h., sie muss die Anschauung ihrer eigenen Zeitdauer darstellen. Oder, mit einer Bestimmung Derridas, die die Problematisierung des Subjekt bezüglich der Stellung zur Semiose erneuern will: „Dieses dynamisch sich konstituierende, sich teilende Intervall ist es, was man Verräumlichung nennen kann, Raum-Werden der Zeit oder Zeit-Werden des Raumes (Temporisation).“51 Darin ist nun aber die Aufführung als Darstellungsperiode, also die simulative Wiederholbarkeit der Szene verzeitlicht. Nur dann, wenn die Szene wiederholbar ist, ist sie produzierte Zeit. Nur was als künstliche Zeit produziert wird – was inszeniert wird (und noch nicht im Ding ruht) –, lässt sich wiederholen. Wiederholen meint den Brauch, den Ritus, die Konvention – das Zeichen als Produkt eines sich in ständig gleichen Perioden ähnlich Wiederholendes und Verfestigendes. Erst unter dieser Strukturähnlichkeit der Wiederholung und 48
Derrida, Die différance, a.a.O., S.9. Siehe den Versuch Duchamps, diesen Prozess in Malerei zu bannen. Marcel Duchamp, Akt, eine Treppe herabsteigend, 1912. 50 Derrida, Die différance, a.a.O., S.17. 51 Ebd., S.19. 49
2. VORLESUNG
der Aufführung52 wird die Verschiedenheit der Verschiebung – oder die „Spur“, wie Derrida sagt, der Verschiebung – sichtbar, reell und manifest – und zwar im Negat fortschreitend konsumierter Zeit: in der Geschichtlichkeit. Die Wiederholung hat die Bedeutung einer transzendierten sozialen Zeit. Wir können deswegen davon ausgehen, dass die Inszenierung eine bestimmende, sinnliche Tätigkeit der Konstitution von Bedeutung und Sinn ist, gerade weil diese sich nicht aus einem Ursprung, einer Genealogie oder einer Kausalität ableiten lassen. Die „Wiederholbarkeit“, die Szene, ist also selbst die Spur einer „Eigenschaft“ des Systems der Sprachen – der Referent selbstreferenzieller Hervorbringungen, der Aufschub des Aufschubs. Derrida nennt sie im Gegensatz zu Kristeva nicht Text, sondern, gleichfalls universalisierend: Schrift/ Spur. Allerdings ist im Unterschied zur Schrift, die auch jenseits eines Kontextes ihrer authentischen Sender und Empfänger funktioniert, die Geschichtlichkeit in ganz dezidierter Weise nicht kommunikativ und nicht performativ. Das „schriftliche Zeichen [enthält] die Kraft eines Bruches mit seinem Kontext, das heißt, mit der Gesamtheit von Anwesenheiten, die das Moment seiner Einschreibung organisieren.“53 Die Szene, die Szenenfolge, die Inszenierung und die Szenografie funktionieren als wiederholbare und rückholbare Zeit nur durch die unmittelbare Präsenz der authentischen Subjekte, also derjenigen Subjekte, die ihre Verschriftung zu Gunsten einer wirklichen Praxis aufgeben, mit der sie ironisch/spielerisch brechen. Die Praxis ist das Diesseits der Schrift. In dieser Praxis der Schrift ist jeder für sich der Andere. Während die Schrift das Jenseits eines Diesseits simuliert, simuliert die Inszenierung das Diesseits eines Jenseits. Entscheidend ist die Stellung zur Präsenz: Die Präsenz ist demnach die Grenze, von der aus das Zukünftige und das Vergangene als Tauschformen entspringen und in Tausch geraten. Ein Tausch, der jedoch sowohl in der Schrift als auch in der Szene nur als bestimmte Einheit/Bruch gelingt, von der die Einheit des Zeichens aber keine Spur (so Derridas Begriff ) enthält. Man behilft sich mit Begriffen wie: Provisorium, Simulation, Szenifikation, Aufführung, Modell etc., die natürlich ganz konkrete gesellschaftliche Produktionen sind, die nicht zu den materiellen Einheiten der Dinge gezählt werden sollten. Die Schriftspur ist somit die Durchstreichung der Dinge. Die Problematisierung des Subjekts, des Bewusstseins und der Geschichte ergibt sich also unweigerlich aus der einfachen Vorgabe, die Saussure in das Spiel der Verweisungen des Zeichens einbringt und dessen Konsequenzen erst weit nach Saussure sichtbar werden. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Semiologien als solche zu fixie52 Vgl. Sören Kierkegaard: Die Wiederholung. Die Krise und eine Krise im Leben der Schauspielerin.
Frankfurt am Main 1984. Kierkegaard geht differenziert auf das Problem der Wiederholbarkeit einer Aufführung als einem einmaligen Ereignis ein. Insbesondere verwendet dann Derrida auch den Begriff des „Code“ um eine Frequenz der Wiederholung anzuzeigen, wobei Codes die Wiederholung auf der Ebene der Transponierbarkeit darstellen, natürlicherweise basierend auf dem Code der Zahl. Es ist eine Auszeichnung elektronischer Codes, dass es gerade die Amplitude der analogen Welle ist, die sie von der Gleichheit trennt und so Übertragung erst ermöglicht. „Wobei Code hier zugleich die Möglichkeit und die Unmöglichkeit der Schrift, ihrer wesentlichen Iterierbarkeit (Wiederholung, Andersheit) ist.“ Jacques Derrida: Signatur Ereignis Kontext. In: Ders.: Randgänge der Philosophie. Frankfurt am Main, S.124-155, hier S.136. 53 Ebd., vgl. auch S.152: „Dieser allgemeine Raum [der Möglichkeiten; R.B.] ist zunächst die Verräumlichung als Unterbrechung der Anwesenheit im Zeichen (marque), was ich hier Schrift nenne.“
33
34
2. VORLESUNG
ren, sondern zu analysieren, auf welche Weise die Semiologie selbst als „strategische“ Theorie54 von einer Zukunft modifiziert wird, die nicht mehr theoretisch, sondern informationell, diagnostisch und statistisch vergegenwärtigt wird. Kann man überhaupt noch von einer Zukunft sprechen, wenn, so meine thetische Frage, eine Tendenz der Medienpräsenz in Echtzeit darin besteht, alle Ableitungen der Geschichte und der Konventionen, auch gerade die der Zeichen, durch eine Indifferenz von Raum und Zeit zu „präsentifizieren“?55 Was lässt sich in einer solchen Gesellschaft, die erst durch den Tausch entsteht, noch und wohin aufschieben? Anders gefragt: Ist eine Gesellschaft, die sich selbst durch die Universalität des Zeichens (und seiner Semiologien) repräsentiert, dazu verdammt, als Affektgesellschaft zu leben? Muss das 54
Wir werden auf den Begriff „Strategie“ als „Vorgriff auf Zukunft“ insbesondere bei Saussure eingehen. Hier genügt es, eine Überlegung Derridas zu zitieren: „Alles in der Zeichnung der différance ist strategisch und kühn. Strategisch, weil keine transzendente und außerhalb des Feldes der Schrift gegenwärtige Wahrheit die Totalität des Feldes theologisch beherrschen kann. Kühn, weil diese Strategie keine einfache Strategie in jenem Sinne ist, in dem man sagt, die Strategie lenke die Taktik nach einem Endzweck, einem Telos oder einem Motiv einer Beherrschung, einer Herrschaft und einer endgültigen Wiederaneignung der Bewegung oder des Feldes. Eine Strategie schließlich ohne Finalität; man könnte dies blinde Taktik nennen, wenn der Wert des Empirismus selbst nicht seinen ganzen Sinn aus der Opposition zur philosophischen Verantwortlichkeit bezöge. [...] Der Begriff von Spiel siedelt sich jenseits dieser Opposition an, er kündigt in der Nachtwache vor der Philosophie und jenseits von ihr die Einheit des Zufalls und der Notwendigkeit an in einem Kalkül ohne Ende.“ Derrida, Die différance, a.a.O., S.10f. 55 Den Begriff übernehme ich von Hans Ulrich Gumbrecht, der von einem „Spannungsverhältnis zwischen ‚Präsenz‘ und ‚Sinn‘“ ausgeht. Hans Ulrich Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik. Eine Produktion von Präsenz. Frankfurt am Main 2004, S.98. Entsprechend unterscheidet er „Präsenzkultur“ (das, was ich hier unter „Situiertheit“ verstehe) und „Sinnkultur“. Allerdings verortet er die Präsenzkultur im Mittelalter, während ich darunter die gegenwärtige Kultur im Umgang mit Automaten und Medien verstehe, und zwar in Opposition zu einer gegenwärtigen Sinnkultur. „In einer Sinnkultur muß ein Zeichen genau die metaphysische Struktur haben, die nach der These von Ferdinand de Saussure ganz allgemein für das Zeichen gilt: Es sei die Verknüpfung eines rein materiellen Signifikanten mit einem rein geistigen Signifikat (‚Sinn‘ oder ‚Bedeutung‘).“ (S.102) Als Verbindung der beiden Kulturen stellt Gumbrecht dann den Handlungsmodus dar: „Was dem Handlungsbegriff der Sinnkultur in einer Präsenzkultur am nächsten käme, wäre der Begriff ‚Magie‘, d.h. die Praxis des Präsentmachens abwesender Dinge und der Entfernung präsenter Dinge.“ (S.103) Allerdings gibt es von der Sinnkultur aus die Möglichkeit, eine Handlung zu reflektieren und als Synthese zu szenifizieren und strategisch abzuleiten. Präsenzkultur kann das nicht, weil sie über keinen reflexiven Zeitmodus verfügt. „Da Handlungen im Sinne des durch bewußte Motivation definierten menschlichen Verhaltens in Präsenzkulturen keinen Ort haben, ist es hier ausgeschlossen, ein Äquivalent der Begriffe des Spielerischen/Fiktiven und dem Ernst [Situiertheit; R.B.] der Alltagsinteraktion zu bilden. Während die Sinnkultur über den internen Gegensatz zwischen dem Ernst der Alltagsinteraktion [Praktiken; R.B.] und dem Spielerischen oder Fiktiven verfügt, müssen Präsenzkulturen sich – im Rahmen genau festgelegter Zeitgrenzen [Inzenierungen; R.B.] – selbst außer Kraft setzen, wenn sie eine Ausnahme von den kosmologisch fundierten Lebensrhythmen zulassen wollen. Das ist die Struktur, die von Wissenschaftlern, die durch Michael Bachtin angeregt wurden in metonymischer Form als ‚Karneval‘ bezeichnet wird.“ (S.104f.) Gumbrechts Darstellung kommt hier meinen Versuchen, eine gesellschaftliche Form für den Umgang mit Zeit und Zeichen zu finden, recht nahe, ist aber eher an der Frage der Bestimmung der Grenzen der Hermeneutik angesichts der poststrukturalistischen Herausforderung ausgegerichtet. Grundsätzlich lässt sich der Begriff auch genau gegenteilig verwenden: Präsenzgesellschaften sind solche, die direkt über Sprache und anwesende Gegenstände kommunizieren, also in körperlicher Präsenz. Kommunikation über Echtzeitmedien interpretiert den Begriff „Präsenz“ jedoch nicht als „Anwesenheit“ oder „Reflexivität/Bewusstsein“ sondern als Simultaneität: Die Zeichenökonomie ist sofort und unvermittelt als Ganze in sinnliche Nähe gerückt, „so fern sie auch sein mag“ (Benjamin).
2. VORLESUNG
ein Mangel sein? Die Frage ist die nach dem Verlust der Herrschaft durch Verwandtschaft und Geschichte und nach der Konstitution einer Gesellschaft durch mediale Präsenz. Nach der Frage der Ordnung, die Foucault aufgeworfen hat, wäre die der Orientierung zu stellen. Sowohl Saussure als auch Heidegger, Peirce und in dessen Umfeld Wittgenstein betonen, dass es neben der Theorie eine weitere Eröffnung oder Differentiation gibt, die strategisch die Zukunft vergegenwärtigt, ohne sie in der Gegenwart aufzuheben – ohne sie also vollständig zu realisieren. Diese Vergegenwärtigung betrifft das Spiel, das Spiel der Vergegenwärtigungen und seine Magie und Zauberei, die wir tatsächlich als eine Aufhebung der Realität durch das Zeichen ansehen können. Damit haben wir alle Begriffe, die wir für die Untersuchung nach der Geschichtlichkeit der Semiologie (wenigstens einiger ihrer Aspekte) anstellen wollten, versammelt: a. Anwesenheit, Bewusstsein, Präsenz; b. Situation, Szenifikation, Inszenierung; c. Verzeitlichung, Subjektivierung, Vergesellschaftung. Wir werden uns auf das Spiel der Zeit konzentrieren, das immer ein Spiel mit den Geschwindigkeiten und dem synthetischen Vermögen der Sinne ist, ein Vexierspiel als Bedeutung zwischen den Sinneinheiten und den Sinnen – kurzum, moderne Zauberei. Wir fragen nicht nach dem, was erscheint, sondern dem, was die Verdeckung der Erscheinung und die Erscheinung der Verdeckung als Spiel der Zeichen (différance) verschiebt. Man kann diese Verschiebung, diesen Aufschub, „Differentiation“56 nennen und nun eine komplizierte Darstellung der diachronen und synchronen Verhältnisse der Glieder, Elemente und Relationen der Sprache mechanisieren. Wir können uns dabei aber ein Beispiel an Saussure und Derrida nehmen. Sie leiten das Problem aus einer allgemeinen Situativität ab, die wir mit Sartre und Kristeva Praxis nennen. Ich zitiere die Version, die Derrida rezipiert: Gehen wir, da wir uns darin schon eingerichtet haben, von der Problematik des Zeichens und der Schrift aus. Das Zeichen, so sagt man gewöhnlich, setzt sich an die Stelle der Sache selbst, der gegenwärtigen Sache, wobei „Sache“ hier sowohl für die Bedeutung als auch für den Referenten gilt. Das Zeichen stellt das Gegenwärtige in seiner Abwesenheit dar. Es nimmt dessen Stelle ein. Wenn wir die Sache, sagen wir das Gegenwärtige, das gegenwärtig Seiende, nicht fassen oder zeigen können, wenn das Gegenwärtige nicht anwesend ist, bezeichnen wir, gehen wir über den Umweg des Zeichens. Wir empfangen oder senden Zeichen. Wir geben Zeichen. Das Zeichen wäre also die aufgeschobene (différée) Gegenwart.57
Wie wir lesen, lässt sich der produktive Effekt der Sprache ganz einfach auf eine Topologie der Gegenwart abbilden, auf eine sprachliche Situation, in der der Referent – hier bezeichnen wir ihn als Autor, Regisseur (Dramaturg), Szenograf – derjenige oder die Sache ist, die die „Produktion“ (Aufführung, Darstellung, Szene) veranlasst. Der Referent kann also ein einzelnes Subjekt oder aber eine „Maschinerie“, ein Ritual, ein Verfahren sein. Dieser Hinweis klärt noch nicht die Frage der Dynamik, der Produktivität und der Geschichtlichkeit des sprachlichen bzw. verweisenden Systems, d.h. die Sprech- oder Verweisungsakte, die performative Sprach56 Derrida kommt auf einen Wortgebrauch bei Hegel zu sprechen. Vgl. Ders.: Die différance, a.a.O., S.20. 57
Ebd., S.13f.
35
36
2. VORLESUNG
handlungen sind, die also unmittelbare Handlungen nicht aufschieben, sondern sie ironisch oder als Spiel durchführen. Wir haben es also in der Inszenierung nicht mit einer Verschiebung, sondern mit einer Verdichtung respektive der suspendierenden und rekursivierenden Wirkung von Wiederholung zu tun. Die eigentliche Sache wird zu Gunsten einer in die Gegenwart verlagerten Zukunft als Möglichkeit präsentiert. Wiederum ist die Strategie die, den Zeitpfeil von Vergangenheit und Zukunft disponibel zu halten. „Zukunft“ wohl verstanden nicht als Erfüllung der Gegenwart, sondern als in Präsenz angesiedelte Möglichkeit. Wir sehen, dass wir es mit zwei homologen Systemen zu tun haben: jenemr der Sprache und jenem der (dinglichen) Produktion. Derrida geht davon aus, dass im Wesen der Schrift die Abwesenheit des Schreibenden zu denken ist. In der Sprachhandlung dagegen sind die Subjekte präsent, aber als transzendierte Anwesende: Sie beobachten sich nicht wie sie handeln. Wir fragen nicht nach den Beziehungen der Elemente der Sprache und den taxonomischen Spezifikationen analoger Ersetzungen, sondern wir fragen nach der Homologie der Prozesse, der Akte oder Verfahren: nach der Produktivität der Sprachen und der Produktivität der Dinge. Das heißt, wir lassen die ästhetische Ebene der Zeichen – die von Ähnlichkeit, Ungleichheit und Gleichheit – außer Acht. Das bringt die Schwierigkeit mit sich, in anschaulicher Weise in einem Text Zeitvorgänge zu schildern, die uns nicht unentwegt auf eine Verräumlichung zurückwerfen – also auf das was die Bühnenkultur absolut nicht ist. Das szenografische Objekt, der inszenierende Autor und die Repräsentationsmaschinerie zielen stets auf die dramaturgischen und die narrativen Einheiten, und nicht – oder nur am Rande – die „Symbole“. Auch hierzu eine Referenz Derridas an Saussure: Nun ist es aber Saussure, der die Beliebigkeit des Zeichens und seinen differentiellen Charakter zum Prinzip der allgemeinen Semiologie, besonders der Linguistik erhoben hat. [...] Beliebigkeit kann es nur geben, weil das System der Zeichen durch Differenzen konstituiert wird, nicht durch die Fülle von Termini. Die Elemente des Bedeutens funktionieren nicht durch die kompakte Kraft von Kernpunkten[,] sondern durch das Netz von Oppositionen, die sie voneinander unterscheiden und aufeinander beziehen. [...] Dieses Prinzip der Differenz berührt, als Bedingung der Signifikation, die Totalität des Zeichens, das heißt, die Seite des Signifié und die des Signifiant zugleich. Die Seite des Signifié ist die Vorstellung, die ideale Bedeutung; und das Signifiant, das, was Saussure „Bild“, „physischer Abdruck“ eines materiellen, physikalischen, zum Beispiel lautlichen Phänomens nennt.58
Der Referent wird an dieser Stelle von Derrida unterschlagen. Wir haben jedoch bei Kristeva schon bemerkt, dass die Funktion des Referenten, desjenigen, der die Verweisung veranlasst, nicht das Subjekt ist, sondern die Transposition, der Erfüllungsaufschub, also eine minimale subjektive Freiheit/Marge/Spur/Lichtung/Szene z.B. von die von „Bild“ und realem „Ding“. Und wir haben bemerkt, dass die Transpositionen kein Original kennen, weil sie Produziertes und Produzierendes zugleich 58 Ebd., S.15. Derrida bezieht sich direkt auf Klärungen Saussures im Cours. Wir werden später sehen,
dass d „Saussures“ Cours, der eigentlich ein Werk seiner Herausgeber ist, und nicht den Intentionen eines „anderen“ Saussure entspricht, der sich aber nur in später entdeckten Schriften, die für Derrida damals noch nicht voll zugänglich waren, verifizieren lässt. Wir wollen der Kürze wegen den Cours weiterhin Saussure zuschreiben, wie es insgesamt auch die strukturalistischen Semiotiker tun.
2. VORLESUNG
sind. Unsere Geschichte der „Geschichte der Semiotiken“ (seit Saussure und Peirce) wird sich auf eine vexierhafte Form oder Bewegung beziehen, nämlich auf das Veranlassen (Intendanz/Motiviertheit) von Bedeutung und Sinn und auf seine produktive ironische, inszenierte Suspendierung der Erfüllung, die man als eine negative Verzeitlichung in der Zeitigung verstehen kann. Möglicherweise greift alle Fragestellung nach der Natur und Kultur des Zeichens deshalb zu kurz, weil man, vulgär gesagt, zwischen dem Zeichen und seiner Bedeutung ein Innen-Außen-Verhältnis begreift, statt dieses Innen-Außen nur im Außen, nämlich in den sozialen und den dinglichen Beziehungen und Oppositionen zu einer vorgeblich einheitlichen, irreversiblen Zeit abspielen zu lassen. In dieser Hinsicht hat nicht erst die Systemtheorie mit ihrer Definition des Zeichens als einer „Zweiseitenform“ der strukturalen Semiotik den Rang abgelaufen; sie hat zudem den Begriff des Mediums und der Codierung für die „Übertragung“ als „Verweisung“ modifiziert. Was ihr nicht gelungen ist, ist zu erklären, wie Vorstellungsform, Gedächtnisform und Dingform jeweils in ein und der selben Sphäre („Draußen“) angesiedelt sein können. Für diese Sphäre ist nun selbst keine substanzielle Form mehr verantwortlich, sondern eine spezifische Eigenschaft: intentionales Bewusstsein. Seit Heidegger und Sartre ist „Bewusstsein“ kein Medium mehr, sondern eine Modifikation der Zeitstasen: Dasein des Augenblicks – dessen was Sartre néant (relativ Nichtseiendes) oder Praxis nennt – und Dauer, die sowohl die Memorialität des Augenblicks wie die Szenifikation oder Rhetorik von „Augenblickssätzen“ (Narrationen oder Inszenierungen) meint. Aus dieser Perspektive wird verständlich, woran es der strukturalen Semiotik mangelt: einen Ausdruck und eine Darstellung dafür zu finden, dass die Struktur der Zeichen, so systematisch sie sich auch ergründen lässt, durch den pragmatischen Akt (performativ) jeweils um eine Nuance insgesamt modifiziert wird – so wie jeder Akt des Geldtausches den Wert des Geldes verändert, so klein er auch sein mag. Vom Geld kann man nicht anders sprechen als vom Zeichen. Jeder definitorische Akt – und die Semiotiker streiten gerne über ihre Definitionen –, muss zugleich als ein Versuch gewertet werden, die Zeit zu vergegenwärtigen und die Zeit (memorial) zu verändern. Die Semiotiker sprechen von Strukturierung59 durch die Opponenten der semiotischen Elemente. Aber erst durch die Progression von Praktiken (Akten) ergibt sich die Stabilisierung und Kontinuierung einer Praxis, in der Bedeutungen bedeutsam, d.h. konsumierbar werden. D.h., die (technisch/analytische) Bedeutung geht der Praxis voraus. So intoniert Roland Barthes bezüglich der strukturalen Theorie von Lévi-Strauss den Faktor der Wiederholbarkeit (der/als Zeit): Es ist wahrscheinlich, daß für Lévi-Strauss alle menschlichen „Produktionen“, Objekte, Riten, Künste, Institutionen, Rollen und Verwendungen erst dann konsumiert werden, nachdem sie von der Gesellschaft selbst der Vermittlung durch den Intellekt unterzogen wurden; es gibt keine Praxis, die nicht vom menschlichen Geist erfaßt wird, die er nicht zerlegt und in Gestalt eines Systems von Praktiken rekonstruiert.60
59
Zum Begriff der Struktur vgl. Nöth, Handbuch der Semiotik, a.a.O., S.204-207.
60 Roland Barthes: Claude Lévi-Strauss. In: Ders.: Das semiologische Abenteuer. Frankfurt am Main
1988, S.168-180, hier S.169.
37
38
2. VORLESUNG
Wenn Lévi-Strauss zwischen „Struktur“ und „System“ der Praktiken unterscheidet, so verwendet er zwei schwer zu differenzierende Momente der Differenz zwischen der metaphorischen Verdichtung und der metonymischen Verschiebung. Sagen wir einfach, das Lesen der Zeichen erfolgt nach der Struktur einer metonymischen Reihe der Elemente (Phoneme/Buchstaben), die Systematisierung des Sinns jedoch erfolgt nach den zeitlich gegenwärtigen Synthesen (Worte, Buchstaben), die quasi im Rückblick (retroaktiv) als Einheiten die Bedeutung jenseits der Elemente tragen: nämlich metaphorisch. Was in der einen Reihe die Abwesenheit ist, wird in der anderen Reihe durch die Nichtgleichzeitigkeit dargestellt. Der Unmöglichkeit der Identität entspricht die Tabuisierung des Inzests. Warum sollte der Zeichentausch, da er sich theoretisch auf die Praxis bezieht, nicht mit dem Frauentausch beispielsweise homolog sein? Warum sollte die Theorie lügen? Und warum sollte die Praxis gelingen? Offenbar liegt hier ein Spiel gegenseitiger Verpflichtung vor, denn die magischen Gesellschaften sind ebenso theoretisch und strategisch wie die unseren. Wir haben es also mit zwei unterschiedlichen Praktiken der Suspendierung der Realität und des Opfers zu tun. Die Struktur muss sich demnach zugleich erhalten wie auch modifizieren. Sie konstituiert sich in einer Praxis des Konsums (des Bedeutens in Bezug auf Zeichen), indem sie sich als Theorie deduktiv verfestigt (in Bezug auf eine Semiotik). Der Theorie entgeht der wesentliche Aspekt ihrer Praxis. Die Praxis der Semiotiken steht hier zur Analyse an. Es gibt also nur eine Verschiebung und Verdichtung, aber keinen originären oder ursprünglichen Sinn, keine Auflösung des Opfers. Es ist wiederum Derrida, der in einer poststrukturalistischen61 Volte auf die doppelte Produktivität in den Differenzen der Struktur aufmerksam gemacht hat. Erst diese Doppelung erlaubt es, die Begriffe Struktur und System zu unterscheiden. Während die Struktur im Wesentlichen der Raumorientierung verpflichtet ist, denkt, wer im System prozessiert, die Ökonomie und Logik der Zeit. Doch keineswegs ist auch diese Unterscheidung einheitlich. Derrida also unterscheidet: Die zwei anscheinend verschiedenen Bedeutungen von différance verbinden sich in der Freudschen Theorie: das différer als Unterscheidbarkeit, Unterscheidung, Abweichung, Diasthema, Verräumlichung, und das différer als Umweg, Aufschub, Reserve, Temporisation.62
Das eine geht nicht ohne das andere, was voraussetzt, dass es keine originale Bedeutung oder Identität des Sinns geben kann, da alles im Stadium des Entwurfs oder des Spiels lebendig gehalten werden muss, sofern es nicht die eine oder andere Seite extremistisch, tödlich zerreißt. Das heißt, das Zeichen ist Sinn nur für einen Anderen, der ich aber qua Bewusstwerdung im Zeichen (inversiv) selbst sein kann. Das Eine und das Andere zu denken – den Einen und den Anderen zu denken –, wird im Zuge der poststrukturalistischen Neueröffnung der Pragmatik produktiver Handlungen – solche der Verknüpfung der Verpflichtung (Tausch und Reziprozität) – als Systemtheorie neu orientiert. Darüber wird später noch zu berichten sein. 61 Zum Unterschied von Post- und Neostrukturalismus vgl. Frank, Was ist Neostrukturalismus?, a.a.O. 62
Derrida, Die différance, a.a.O., S.25f.
2. VORLESUNG
Der stabilisierende Akt der Strukturierung verstrickt sich in ein Paradox, indem er sich sich selbst setzend aufhebt. Dieses Paradox hatte Johann Gottlieb Fichte schon um 1800 als paradoxe Beziehung des Ichs erkannt. Wir können sagen, das Zeichen, das Bewusstsein oder das Ich sind nicht Materialisationen oder Substanzen – sie sind Negationen, deren Positionen sich als Negationen in den „Produktionen“ kund tun, die wir als Zeichen definibel oder bedeutsam halten wollen –wenigstens so lange, wie unser Gedächtnis, unsere Diskursaufmerksamkeit oder ein Inszenierungsvorgang es für widerständig halten. Eine Substituierung des Inhalts zu Gunsten der Form ist denn auch der Ausweis soziologischer und medienlogischer Zeichenbetrachtung unter den Opponenten Produktion|Konsumation und deren bedeutsamen Besitzverhältnissen als Wissen. Denn es handelt sich dabei um einen ableitbaren, konstruierten Besitz, der in der Präsenzgesellschaft idealerweise jedem zu jeder Zeit offen steht. Wissen wird nicht mehr über den Umweg der Suche erworben, das Signifikat schickt seine Botschaft nicht mehr aus dem Jenseits der Gabe. Ebendies erweckt den Eindruck einer strukturalen Gleichzeitigkeit. Roland Barthes macht diesen Unterschied – wiederum mit Hinweis auf eine soziale Opposition von Lévi-Strauss – deutlich: Das Zeichen ist im Gegensatz zum Symbol nicht durch eine analogische und gewissermaßen natürliche Beziehung zu einem Inhalt definiert, sondern wesentlich durch seine Stellung innerhalb eines Systems von Unterschieden (von Oppositionen auf paradigmatischer und Assoziationen auf syntagmatischer Ebene). Dieses Zeichensystem ist das Merkmal, das eine Gesellschaft dem Wirklichen, ihrem Wirklichen, aufprägt; anders gesagt, die Vermittlung des Wahrnehmbaren verläuft nicht über das parzellierte Bild (Symbol), sondern über ein allgemeines System von Formen (Zeichen).63
63
Barthes, Claude Lévi-Strauss, a.a.O., S.175.
39
3. VORLESUNG Wissensproduktion als Stabilisierungspraktik von Wert – Vier Vorschläge zur szenischen Wende der Semiotik: 1. Die Szene als Einheit des Zeichens; 2. Szenen sind vom Anderen veranlasst; 3. Situativität ist Selbstreferenz; 4. Das Innen/Außen-Verhältnis der Szene ist homolog und inversiv, d.h. struktural
Barthes hebt – im Gegensatz zu Saussure, der die analogische Beziehung der Zeichen präferiert und die etymologische substituiert – im Moment der Strukturiertheit die Präferenz einer technischen Praxis, die methodischen und funktionellen Gebrauchsweisen hervor. Das Funktionieren der Übertragung rückt an die Stelle der Divination von Bedeutung, da die Funktion die Bedeutungshandlung abbildet. Aus dieser Umwertung prägt sich die Unterscheidung zwischen einer hermeneutischen und einer strukturalen Interpretation: Es handelt sich aber lediglich um zwei unterschiedliche Fokussierungen.64 Nun fußt dieser Gegensatz im Prinzip nur auf einer binären Unterscheidung, einer Zweiseitenform – jener von Form (Handlung als Kinesis) und Inhalt (als Bedeutung)65 –, die als symbolische und als funktionale Unterscheidung in den späteren Ausgaben der Traumdeutung von Freud akzeptiert worden ist, und die zweierlei Negationen miteinander tauschbar hält: die von Bewusstsein (Wissen) und Unbewusstem und die von Ich und Anderem. Was nämlich in unserer Gesellschaft produziert ist, ist uns in der Praxis des Konsums, also unserer rituellen Handlungen, durchaus jederzeit unbewusst. Technisch gesagt: Das Medium ist jeweils das Unbewusste des Inhalts. Die Wahl der Opponenten ist demnach für die Theoriekonzeption entscheidend, nicht die Prädisposition einer Methodik. Es ist daher nicht von der Hand zu weisen, die strukturale und die hermeneutische Methode als zwei Herangehensweisen an ein und dieselbe Sache zu formulieren: nämlich der Frage, wie sich Bedeutsamkeit in einer Präsenzgesellschaft als Wissen stabilisiert – und zwar so, dass es eine Theorie gibt, die prognostisch über die Wertbeziehungen und Geltungen einer Praxis mehr als nur taxonomisch orientiert. Es ist folglich die soziologische Frage nach der Ordnung der Ordnungen zu stellen, und nicht die nach der Individualität situativen Handels. Denn Wissen artikuliert sich als stabiler Wert unabhängig von den Situativitäten. Seine Relevanz ist die von Präsenz oder Nicht-Präsenz. Eine These sei vorweggenommen: Jede Theorie erweist sich als Szenifikation der Praxis. Sie spielt die Veränderung der Struktur situativen Handels funktional nach. Es handelt sich jeweils um selektierende Praktiken, deren Vorläufigkeit man im doppelten zeitlichen Sinne (ephemer und vorauseilend) als magisch bezeichnen kann. Entscheidend im Operieren oder Strukturieren ist der Bezug zu dem, was tatsächlich im Zeichen „künstlich“ ist – um hier der Natur des Symbols, der „natür64
Vgl. Ralf Bohn: Szenische Hermeneutik. Verstehen, was sich nicht erklären lässt. Szenografie & Szenologie Bd.12. Bielefeld 2015. 65 Barthes, Claude Lévi-Strauss, a.a.O., S.175.
42
3. VORLESUNG
lichen Wahrnehmung“ einen Opponenten entgegenzusetzen: die Verzeitlichung, die wirklichen Skalierungen polarer Wertverschiebungen auf der Grundlage einer neutralisierten Zeit. Die Theorie und die Wissenschaft sind demnach Stabilisierungspraktiken (Wissensproduzenten), die noch nicht den Entwurfscharakter zur Verdinglichung hin überschritten haben, die die Produktion also aufschieben (différer). „Die Genese des wirklichen Gegenstandes in der Praxis ist also zu unterscheiden vom wissenschaftlichen Erkennen dieses Gegenstandes, das zur wissenschaftlichen Wahrheit und von da zu einer neuen Praxis führt“66 – so Kristeva. Im Wissen steht folglich der Möglichkeitsbereich nicht mehr unter dem Horizont der Bedeutungen, sondern unter dem der Verwirklichung. Auf der Grundlage dieser These kommen wir auf die Frage zurück, warum man sich heute noch mit den Grundlagen „der“ Semiotik auseinandersetzen sollte, um sich nicht den Vorwurf, „postmodern“ und somit unmodern, strukturalistisch und somit dogmatisch zu sein, einzuhandeln. Will Theorie keinen Einfluss mehr auf Praxis nehmen, indem sie nur noch beobachtet, was geschieht – so der Vorwurf an die Systemtheorie?67 Genau dann müsste sie sich als bloße Fiktion, als Inszenierung betrachten, von der gerade nicht verlangt wird, dass sie sich „verdinglicht“ oder Handlungen präjudiziert. Wir schlagen hier eine Verschiebung der Semiologie von einem topologischen auf ein temporallogisches Paradigma vor, denn die Zeit ist das Produkt der Handlung. Wie die Semiotiker beginnen wir ein solches Vorhaben mit dem Entwurf von vier Vorschlägen, deren Gewicht in den nachfolgenden Vorlesungen abzuwägen ist. Erster Vorschlag: Die rhetorischen Differenzierungen des Zeichens sind als Szene (Handlungs- bzw. Deutungseinheit) zu synthetisieren. Als Szene wollen wir die Einheit der Dauer einer Präsenz markieren, eine „Aufmerksamkeitsspanne“ und jene Verzeitlichung, die jemand oder etwas durch Inszenierung oder Ereignishaftigkeit memorialisierbar hält.68 Die starke Form dieser Spanne kann ein Kausalzusammenhang eine natürliche 66
Kristeva, Die Revolution der poetischen Sprache, a.a.O., S.200.
67 Niklas Luhmann: Handlungstheorie und Systemtheorie. In: Ders.: Soziologische Aufklärung 3. Soziale
Systeme, Gesellschaft, Organisation. Wiesbaden 2005, S.58-91, hier S.59. „Die Kontrastierung von Handlung und System ersetzt, wissenschaftsgeschichtlich gesehen, die Kontrastierung von Individuum und Kollektiv. Sie reagiert auf Versuche der Systemtheorie, sowohl Individuen und Kollektive als (personale bzw. soziale) Systeme zu begreifen und zueinander in Beziehung zu setzen. Stattdessen wird alle Systemstruktur (wenn konsequent: auch diejenigen der handelnden Personen selbst) als bloßer ‚Kontext‘ des Handelns begriffen, der zwar mehr oder weniger zwingend vorgegeben ist, aber doch auch in der Situation mehr oder weniger zur Disposition stehen kann.“ 68 Siehe die Beschreibung einer Ereignissynthese, die Christians als Szene bestimmt. Die Szene ist die primäre Form der Entwurfssynthese einer Deutungseinheit. D.h., sie ist eine kulturelle Form, die sich in jedem Medium bildet: „Szenen sind ein wenig provisorisch oder vorläufig – und damit dem schnellen Verständnis zugänglicher, solange sich ein ebenso vorläufiger Kontext herstellen lässt. Szenen modellieren Informationen zu überschaubaren, anschlussfähigen Gefügen und helfen so, Kommunikation und Verstehen zu organisieren. Szenen – und das ist das zentrale Paradox aller Ausführungen zum Thema – weisen keine einheitliche Form auf, ja es ist noch nicht einmal von der relativen Konstanz einiger Elemente dieser Form auszugehen. [...] Das Szenische hat unbenommen sehr viel mit den Techniken und Bedingungen des menschlichen Verstehens zu tun, aber es ist deshalb
3. VORLESUNG
die einer biografischen Narration sein. Stets ist die Form eine zeitliche Periode, keine räumlich-bildliche. „Verzeitlichung“ meint, dass die Übersetzung zur Bedeutsamkeit die Geste (Verweisung) eines Anderen enthalten muss. Die Inszenierung durch den Anderen (als Hinweis auf das Andere) rhythmisiert die Relation „aktiv-passiv“ als Zeitigung. Die Manipulation oder, wie es in der Psychoanalyse heißt, die Verführung ist das Moment des Verweises auf einen Vollzug in der Zeit. Verweisung respektive Übersetzung/Übertragung stellt aus der Vergangenheit für die situative Gegenwart eine Zukunft in Aussicht: Das ist die Verführung. Man kann der Verführung folgen oder sie missachten – was einschließt, dass man in seiner Situation verharrt (dauert), also das Zeichenhafte des Verweises gar nicht bemerkt. Bezüglich der Periodizität (Wiederholbarkeit) einer Szene unterscheiden wir mit Laplanche69 zwischen: a. kosmologischer Zeit b. Periode der Aufmerksamkeit als Zeitlichkeit c. Verzeitlichung als dem Moment der Inszenierung von Perioden und Rhythmen der Dauer und des Augenblicks d. Geschichtlichkeit als das Realisieren der szenischen Entwürfe, also der kulturellen Ausprägungen, in denen der Andere die Mittel der Verführung (passiv-aktiv; produktiv-konsumativ) für mich organisiert. Wir fassen Zeichen als Relationen der Realisierung von Entwürfen sowohl zum Ding hin als auch zur Bedeutung hin auf, insofern Dinge die gegenwärtigen Bedeutungen repräsentieren: Sie sind die Komplexion ihrer realisierten „Zeichenwerte“, die die Zeitstasen primär durchlaufen haben. Zugleich sind sie Entwürfe (Gebrauchsvorschriften) für eine Praxis. Zweiter Vorschlag: Dialektisch entspricht der Periode (oder Szene) – der „Dauer einer Präsenz“ – die „Präsenz der Dauer“. Unter „Präsenz“ wollen wir den kürzest möglichen Moment eines Bewusstseinsereignisses (Zeitigung/Transposition) verstehen, so lange er auch dauern mag. Bewusstsein ist „lebendige Gegenwart“, die verzweifelt mit ihrer Dauer kämpft, also mit der Endlichkeit der Zeit.70 In der Langeweile eines Regentages kein Existenzial.“ Heiko Christians: Crux Scenica. Eine Kulturgeschichte der Szene von Aischylos bis YouTube. Bielefeld 2016, S.35f. Demnach wäre eine semiotische Szene (hinsichtlich der Schrift) ein Satz, eine semantische Szene eine Ereignis-, Aussage- oder Sinneinheit, die vom Sinn und den Sinnen her ihre Bestimmung erfährt, nicht von den semiotischen Einheiten. 69 Jean Laplanche: Die unvollendete kopernikanische Revolution in der Psychoanalyse. Frankfurt am Main 1996, S.85. 70 Derrida, Die différance, a.a.O. Derrida bezieht sich auf Husserl. Unter „Bewusstsein“ kann keine Instanz, sondern nur eine Relation verstanden werden, die den Aufschub, also die Unmöglichkeit der strukturalen Stillstandes, aufhebt. Sie registriert im Kierkegaard’schen Sinne die Verzweiflung, wie sie Nietzsche von dort abgeleitet hat: Um der Lebendigkeit Willen produziert sie unentwegt tote Dinge, die realisiert und also zu Bewusstsein kommen. Sören Kierkegaard: Die Krankheit zum Tode. Frankfurt am Main 1984, S.40: „Der Grad des Bewußtseins ist im Steigen oder im Verhältnis dazu, wie es steigt, die ständig steigende Potenzierung in der Verzweiflung; je mehr Bewußtsein, desto intensivere Verzweiflung.“ Wenn Kierkegaard Verzweiflung als „Existenzial des Lebendigen“ kennzeichnet, so deutet er ihr pathologische Moment in einer Beziehung des Bewusstseins auf sich selbst (das Selbst), deren Erkaltung oder Wahn vom Anderen her aufgelöst werden muss, was natürlich wiederum dem Autonomiezug des Bewusstseins zuwider läuft, wie Sartre erkannt hat. Sartres „These, nach der das
43
44
3. VORLESUNG
kann ein solcher Augenblick Stunden dauern, in der Hektik eines Sportereignisses Millisekunden. Weil der Präsenz ein Maßbegriff fehlt, wollen wir ihn durch den der „Wahrnehmung“ ersetzen: „Situativität“ schließt synchrone Reflexion aus. Wir sind täglich in Situationen, in denen wir die Bedeutungen von Zeichen gleichsam „automatisch“ kontinuieren oder, psychoanalytisch formuliert, sublimieren/medialisieren. Das führt uns zu der These, dass wir mehr und mehr in eine Präsenzgesellschaft konvertieren, in der die Tiefensemantik der Bedeutungen und die Breitensemantik des Sinns, also die kontextuelle Durchdringung und Übersetzung/Transposition des semantischen Feldes zu Gunsten autosemantischer Prozesse abgelöst werden. Zeichen verweisen dann nicht mehr auf Bedeutungen (und auf den Aufschub, den sie prozedieren), sondern nur noch auf den Tausch in ein anderes Zeichen, auf Techniken. Handlungsgesellschaft wandelt sich über Präsenzgesellschaft in Informationsgesellschaft. Alles ist im Wortsinne „gegen-wärtig“, und zwar als Zeichen ohne Autor, aber mit einer normativen Autorität der Realität der Algorithmen ausgestattet. Über den Verlust des Anderen71 hinweg konstituiert sich eine Herrschaft von Aussagen und Objektivitäten, das Phantasma eines opferlosen Äquivalenztauschs. Geradezu als konträrer Effekt wird der Andere als Autor stilisiert, der im Besitz einer Botschaft sein Werk aufführt: Die Inszenierung, die immer ein Phänomen der zwischenmenschlichen Kommunikation war, wird zu einem Arbeitsprozess. Der Signifikant gibt sich als rätselhafter Imperativ, im Zwang der Geschichte eingespannt. Die Gabe wird zu einem Ort der öffentlichen Vorführung statt der subkutanen Verführung. Es genügt einige Sätze von Jean Laplanche zu zitieren, um zu bemerken, dass die Anrede, Zuwendung72, Sorge73 als Verweisung den fehlenden Sinn kompensiert. Bewußtsein nicht ist, was es ist, und ist, was es nicht ist“ schlägt das Thema sozialphilosophisch an, indem er in Das Sein und das Nichts und vor allem in der Kritik der dialektischen Vernunft auf eine Moderierung von Individuum und Kollektiv dringt, die wegweisend auch für die Systemtheorien hätte sein können. Vgl. Dieter Theunissen: Der Begriff der Verzweiflung. Korrekturen an Kierkegaard, Frankfurt am Main 1993, S.52. 71 Vgl. Jean Baudrillard: Der Andere selbst. Habilitation. Wien 1987. Baudrillards Visionen beziehen sich auf eine Welt narzisstischer Kommunikationsformen: „Diese Formen sind keine szenischen Spiele mehr, das heißt keine Spiele des Spiegels, der Herausforderung oder der Andersheit, vielmehr sind es ekstatische, einsame und narzißtische Spiele. Dabei wird nicht mehr die Lust an der szenischen oder ästhetischen Veranstaltung erlebt (seductio), sondern die an der reinen, zufälligen und psychotropischen Faszination (subductio). [...] Wenn wir darauf unsere alten Kriterien und Empfindungen gegenüber einer ‚szenischen‘ Sinnlichkeit anwenden, dann laufen wir Gefahr, das Eindringen dieser neuen ekstatischen und obszönen Form in das Reich der Sinneswahrnehmungen zu verkennen.“ S.21f. Baudrillards Utopien neigen zuweilen zur Einseitigkeit. Wenn in einer nachpostmodernen Gleichzeitigkeit alle Phasen der Geschichte präsent sind, muss man zu einem Modell kommen, in der die Dialektik und die Ökonomie zwischen dem Szenischen und den Situativen (in welcher Ökonomie auch immer) übersetzbar, d.h. austauschbar sind. 72 Baudrillard, Die Konsumgesellschaft, a.a.O., S.233f.: „Nichts wird heute einfach nur konsumiert, das heißt gekauft, in Besitz genommen und für bestimmte Zwecke genutzt. Die Objekte dienen nicht so sehr zu etwas, sie dienen vor allem Ihnen. Ohne dieses direkte Objekt, ohne das personalisierte ‚Ihnen‘, ohne diese totale Ideologie des persönlichen Dienstes am Kunden wäre der Konsum nicht, was er ist.“ 73 Kristeva, Die Revolution der poetischen Sprache, a.a.O., S.135: „Die ‚Sorge‘ ist die Verdrängung der gesellschaftlichen Praxis als objektiver Praxis; an ihre Stelle tritt resigniertes Warten auf einen –
3. VORLESUNG
In einer Gesellschaft ohne den Anderen gibt es jemand, der sich um mich kümmert, der mir den Stoff zur weiteren Kritik/Produktion/Übersetzung/Dekonstruktion liefert: das Zeichen. Was im eigentlichen Sinne des Wortes übersetzt wird, ist kein natürliches, nicht einmal ein historisches Zeichen. Es ist eine Botschaft, ein Signifikant oder eine Kette von Signifikanten. Damit es eine Übersetzung geben kann, ist vorausgesetzt, daß jemand etwas sagen wollte. Man sieht, ich greife wieder auf die Kategorie der Botschaft oder des rätselhaften Signifikanten zurück, wobei der Terminus Botschaft im Begriff des Signifikanten darauf insistiert, daß dieser jemande [...] einen Anderen vertritt; man kann das auch den „AnredeAspekt“ des Signifikanten nennen, die Tatsache, daß er immer jemanden anredet.74
Die Frage nach der Geltung eines néant, einer Lücke oder eines Rätsels als reversibler Zeichenkonstituierung stellt sich im alltäglichen Handeln nicht: Die Bedeutung des Handelnden muss nicht erfüllt werden. Erfüllt werden muss die Weitergabe der Botschaft. Im urbanen Zeichenfeld ist es von großem Vorteil, nur von Zeichen zu Zeichen, nicht aber von Bedeutung zu Bedeutung zu verweisen. Ausreichend ist die serialisierende Verweisung, die auf den Konsumenten des Zeichens selbst übergeht, der dann ein anderes Zeichen von sich abstößt. Die Handlungen werden durch technische Normierung der Zeichen und Dinge vorherbestimmt. Dritter Vorschlag: Im Übergang von Situativität zu Szenifikation finden wir selbst eine Zweiseitenform der Zeit. Wir könnten sie mit der Relation „bewusst/unbewusst“ charakterisieren. Wenn wir aber vom Bewusstsein als unvollständiger Synthese ausgehen, hätten wir nur die Begriffsebene getauscht. Im Falle der Semiotik der Psychoanalyse, wie sie durch Freud und Lacan angestoßen wurden macht das durchaus Sinn. Wir wollen aber auf etwas anderes hinaus: nämlich auf die systemtheoretische Variante einer ursprungslosen Gesellschaft. Saussure hat mit seinem Arbitraritätstheorem75 zeigen wollen, dass kein Zeichen eine Bedeutung durch sich selbst erhält, sondern nur in der „Sozialisation“ mit anderen Zeichen bedeutsam werden kann. Wenn wir nun behaupten, dass es nur ein „Draußen“ der Zeichen in den Stasen der Zeit gibt, ist die Situativität keine Form mit zwei Seiten, sondern eine der Selbstreferenz. Die Situation ist nur die Situation des Individuums als passives Element der Sozialisation. Das Subjekt ist das Draußen und es ist diesem Draußen (diesen Agenten der Zeichenproduktion und des Tauschs) unterworfen. Wenn aber der Andere kein Subjekt ist, sondern eine arbiträre Maschine, die Verweisungen auswirft, kann man auf den Begriff des Subjekts verzichten.76 Die gesellschaftlichen oder transzendentalen – Sinn, der immer unterwegs und nie greifbar ist, dessen Voraussetzung das existentielle (thetische) Subjekt ist – ein Sklave seiner Beherrschung.“ 74 Laplanche, Die unvollendete kopernikanische Revolution, a.a.O., S.164. 75 Ferdinand de Saussure: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft [Cours de linguistique générale; *1916]. Hg. von Charles Bally/Albert Sechehaye. Berlin 1967, S.79: „Das Band, welches das Bezeichnete mit der Bezeichnung verknüpft, ist beliebig; und da wir unter Zeichen das durch die assoziative Verbindung einer Bezeichnung mit einem Bezeichneten erzeugte Ganze verstehen, so können wir dafür auch einfacher sagen: das sprachliche Zeichen ist beliebig.“ 76 Gilles Deleuze: Was ist Strukturalismus? Berlin 1992, S.54f.: „Wenn nun dieser leere Platz auch nicht
45
46
3. VORLESUNG
Szenifikation hingegen bezieht immer eine Fremdreferenz mit ein: Sie ist ein Drinnen im Draußen. D.h., sie ist die Beobachtung einer Form mit zwei Seiten. Denn unter „Inszenierung“ wird ein Produkt verstanden, dass vom Anderen für mich als Anderem gemacht ist.77 Bezüglich der Zweiseitenform der Zeit ist sie zugleich Akt (Augenblick) wie Dauer (Produkt) – und insofern nicht ein singulärer Akt, sondern stets nur ein periodisches Ereignis, das im Kontext memorialisiert werden kann. Sonst würden die Akte für sich als kontingente, zufällige Ereignisse zerfallen und nicht durch „Bewusstsein“, „Ich“ und „Geschichtlichkeit/Bedeutsamkeit“ verbunden werden. Die Einheiten wären als Bedeutungs- oder Wissensform gar nicht aktualisierbar. Sie sind verbunden durch ihre Trennung, d.h. in Bezug auf die normative Totalität der Situativität, in der sie – traumaanalog – sich selbst hervorbringen.78 Die Szene ist die inverse Seite der Innerlichkeit, die als solche aber niemals von der Äußerlichkeit abgelöst gedacht werden darf. Innen/Außen sind hier nichttopografische Begriffe einer Zweiseitenform. Vierter Vorschlag: Das Reflexionsparadigma von Aufmerksamkeit (Erkennen) soll durch das der Inversion ersetzt werden. Unter „Inversion“ wollen wir, wie bei der Umstülpung eines Handschuhs, eine Form mit zwei Seiten verstehen, deren Äußeres (Offenliegendes) dem Inneren (Verdecktem) so entspricht, dass jede Äußerung (Produktion, Darstellung) ein Inneres (Vorstellung, Erinnerung) nicht reflektiert, sondern dass es ein Innen nur als Ausdruck des Äußeren gibt. Anders gesagt, wir reagieren auf unsere Umwelt nicht durch Verinnerlichung und Veräußerlichung, sondern wir invertieren Äußerliches als je das Gleiche, das durch zwei Beobachterpositionen eines Beobachters unterschieden wird. Dadurch vermeiden wir eine Festlegung von Original und Reflektiertem und betonen die Möglichkeit der Selbst-Inszenierung. Die Zweiseitenform wird zur Selbstansicht involutiert, eingewendet, in eine Höhlung des AnderenIch eingebettet, das auch nicht das hat, was fehlt. Sonst müssten wir eine durch und durch gespaltene Welt annehmen, deren jeweiligen Systeme monadisch geschlossen von einem Glied ausgefüllt ist, so ist er nichtsdestoweniger von einer außerordentlich symbolischen Instanz begleitet, die all seinen Verschiebungen folgt: begleitet, ohne besetzt oder ausgefüllt zu sein. Und die beiden, die Instanz und der Platz, verfehlen sich unaufhörlich gegenseitig und begleiten sich auf diese Weise. Das Subjekt ist genau die Instanz, die dem leeren Platz folgt: wie Lacan sagt, ist es weniger Subjekt als unterworfen.“ 77 Insofern ist die Verführung nach Baudrillard tatsächlich der Versuch, jemand anderen sich selbst fremd zu machen. Vgl. Jean Baudrillard: Von der Verführung. München 1992. 78 Heiner Wilharm: Die Ordnung der Inszenierung. Szenografie & Szenologie Bd.8. Bielefeld 2015, S.29: „An den Grenzen der Szene wird ihr situatives Dasein oder ihr Dasein in situ zu erörtern sein. Die Frage, der wir nachgehen, lautet, ob ‚Situation‘ tatsächlich so etwas wie szenifikations- und inszenierungslose Bedeutungsverhältnisse beinhalten könnte. Die Intuition könnte sein, dass die Szene in der Situation ruht, somit alle Zeichen, die sie ausmachen, ebenfalls. Der Prozess der Semiose wäre vorübergehend stillgestellt. Situativ zeigte das ‚Bild‘ der Szene deshalb keine indikativ repräsentativen Eigenschaften, von denen ein Appell ausgehen könnte. [...] Passender wäre vielleicht, die Situation für sich als szenisch neutral hinsichtlich der auszutragenden Schlachten zu kennzeichnen.“ Ein gewisser Automatismus einer jeden Wiederholungsform ruht gerade deswegen in situ, weil die Agone normativ technisch oder konventionell gesellschaftlich entschieden sind – was ja gerade die praktische Seite des Zeichens ist.
3. VORLESUNG
wären und die mithin auch keinen Grund hätten, Kommunikation zu entwickeln. Schon Leibniz hat das als paradox beurteilt. Deleuze hat diese Paradoxie mit dem Begriff der inversiven Falte79 auflösen können. Der Standpunkt entscheidet, ob man sich Drinnen oder Draußen wähnt, und nicht die Reflexion, die an und für sich durchsichtig ist. Denn um das Reflektierte zu erkennen, muss man es schon vorher erkannt haben. Im Spiegel wird also das Verhältnis Ding und Mensch als getrennt vorausgesetzt. Wenn wir die Trennung nicht akzeptieren – der Mensch in seiner Selbstansicht sich als Ding unter Dingen sieht –, bemerken wir, dass es sich bloß um zwei Beobachtungsrichtungen ein und derselben Sache handelt, insofern der Spiegel/ das Ding nur der entäußerte Wunsch nach Selbstansicht ist. Wie sollten wir durch ihn von einem „Innen“ erfahren, das sich nur als Außen zeigt? Der Spiegel ist ein Ansich, dass jedoch im Unterschied zum Menschen kein Fürsich kennt. Der Spiegel sieht sich nicht selbst. Trotzdem können wir inversionslogisch ein ganz äußerliches Signal von einem vorgeblich innerlichen Symptom unterschieden, das wir aber nur ganz äußerlich wahrnehmen, z.B. als Kopfschmerz (nicht aber als Tumor im Kopf oder als Geschwür im Magen etc.). Die Denkfigur der Inversion zeigt uns also, dass wir in einer Art Möbiusband – einer einheitlichen Zweiseitenform, der des Zeichens als Szene – gefangen sind.80 Es gilt also, dass jedes System nur insofern abgeschlossen (innerlich) ist, als man die Beobachterperspektive als ein Außen nicht simultan in die Beobachtung selbst hinein verlegen kann – es sei denn durch den Entwurf einer szenischen Zeit. Eine einfache Illustration für den gleichwahrscheinlichen Standpunkt bezüglich der Gestalt (Szene) bietet das Vexierbild. Hier werden die beiden Bedeutungen nicht durch Reflexion, sondern durch Inversion erzeugt. Reflexiv ist allein dann der Akt der erinnernden (erkannten) Benennung der jeweils beobachteten (wahrgenommenen) Form. Diese vier Vorschläge zur paradigmatischen Neuorientierung sollen keinesfalls genügen, eine „andere Semiologie“ zu begründen. Das ist nicht unsere Absicht. Wir wollen vielmehr an einigen Beispielen und Merkmalen zeigen, wie im Konzept der Semiotiker historisch die Überschreitung schon vorgedacht war, zumindest, wenn wir uns auf die durch Saussure und Peirce vorgegebenen Thesen stützen, die im Übrigen mit dem strukturalistischen Denken gerade dann nicht übereinstimmen, wenn man auf sie den Vorwurf eines geschichts- und subjektlosen Denkens aussetzt. Hier wäre klar zu unterscheiden zwischen den exakten Anforderungen eines informationellen, Heidegger sagt noch „kybernetischen“ Zeichens, das einer operativen Vermittlung dient, und das topografisch und chronometrisch invariant ist, und dem 79 Gilles Deleuze: Die Falte. Leibniz und der Barock. Frankfurt am Main 2000, S.16: „Die Einheit der Materie, das kleinste labyrinthische Element, ist die Falte, nicht der Punkt, der nie ein Teil, sondern immer nur das einfache Ende einer Linie ist.“ 80 So stellt sich für Paul Klee die Frage, was die andere Seite der Zeichnung ist: Die opferlose Reinheit? Wie soll man ein Zeichen setzen, ohne die Differenz einzuführen? – Man darf die Linie selbst nicht absetzen. Nur die unendliche Linie vollendet nicht die Separation der Differenz. Vgl. Ralf Bohn: Inszenierung des Widerstands. Bildkörper und Körperbild bei Paul Klee. Szenografie & Szenologie Bd.2. Bielefeld 2009, S.45ff.
47
48
3. VORLESUNG
kommunikativen Zeichen, das hochgradig variant, d.h. semantisierte Szenifikation ist – so invariant es auch von Menschen in bestimmten Situationen affektiert wird. Aber wir ahnen es, die Effekte und Affekte, die durch die maschinellen Signalkörper ausgelöst sind, haben zwar eine normierende Funktion, aber auch sie variieren im Kontext der Geschichtlichkeit. Denn auch wenn wir die Sprache Goethes mit der heutigen vergleichen, werden wir schnell auf die unterschiedlichen Tempi des Satzbaus und auf andere Phänomene des Stils aufmerksam. Nun, Goethe überdauert in unserem kulturellen Gedächtnis, denn er ist „da draußen“: verfügbar in unzähligen Bibliotheken und Sprachen, als ein invertiertes Draußen, eine invertierte universelle Weltsicht. Wir haben nun den Diskursbereich des Zeichenbegriffs und seiner Theoriebehauptungen und -unterstellungen abgesteckt und beginnen, auf die Darstellung dieser Theorieprobleme und Methodenansätze einzugehen und die Aspekte der Selbstkritik der Semiotiker ernst zu nehmen, und geben folgende Aspekte vor: Wir auf das Verhältnis von Zeit und Gedächtnis ein, also den Begründungen zur Konvention und Arbitrarität des Zeichens und seiner Ordnung. Das schließt die Auseinandersetzung mit den Begriffen „Text“ und „Kontext“ im nicht nur linguistischen Sinne mit ein. Wir fragen, warum die Linguisten in ihrer Frühphase unter dem Begriff „Sprache“ keinen Begriff des Mediums entwickeln konnten, um die Differentialität zum allgemeinen System zu erweitern. Offensichtlich gab es kein Fundament auf dem sich eine Reflexion der Negationen als Differentialität sozialer Beziehung aufbauen ließ, wie es schon Hegel avisiert hatte? Erst die Systemtheorie liefert diese Bausteine, sodass man behaupten darf, die Systemtheorie generalisiert das Erbe der Linguistik, indem sie alle sozialen Beziehungen (Produktionen als Unterscheidungen) zu Erscheinungen erklärt, die durch eine Zweiseitenform und durch einen Beobachter als „Schalter“ ausgedrückt werden können. Ein weiterer Aspekt der Vorlesungen widmet sich in Textuntersuchungen den Anfängen der modernen Semiotik bei Saussure und Peirce, ihrer Verortung sowie ihrer von 1900 bis etwa 1960 lokalisierte Zwischenstellung zwischen strukturaler und hermeneutischer Bedeutungsauffassung. Dies wird anhand eines Aufsatzes von Samuel Weber und des Strategiebegriffs diskutiert. Verweisung als Strategie der Einflussnahme auf Zukunft (Kreditierung) macht einen wesentlichen Aspekt der Bedeutungsinszenierung des Zeichens bei Saussure aus. Hat Ikonizität etwas mit Realität und insofern mit situativer Präsenz zu tun? Diese Fragen stellt sich Ludwig Jäger in Bezug auf den Linearitätsaspekt in der Semiotik von Peirce. Peirce formuliert erstmalig ein Theorem der Negation und der Autopoiesis, die den Systemgedanken der Zeichenordnung herausarbeiten. Zudem gehen wir auf das Verweisungsziel, die Bedeutung oder den Sinn eines Zeichens oder einer Szene (Satz, Episode, Aufführung etc.) ein. Wir stellen die avancierte hermeneutische Methode Sartres vor, die Sinnkonstitution als Produktion von Differenz versteht, und kontrastieren wir uns der Gadamer’schen Hermeneutik zu, die eher identitätsfixiert argumentiert. Sartre wie Gadamer gehen von einer unendlichen Bewegung aus, die zwischen Überschreitung und Einholung des
3. VORLESUNG
Differenten oszilliert. Die Oszillation ist im informationellen System serielle Reproduktion, im Kierkegaard’schen Sinne einmalige Wiederholung. Zurückkehrend zu Sartre werden wir die Bewegung der Oszillation auf die von Produktion und Konsumation übertragen können, sodass im Zeichen selbst die Frage des individuellen oder allgemeinen Symptomcharakters von Körper und Welt nicht mehr unterschieden werden kann. Das Symptom ist die Verdinglichung auf der „falschen“ Seite der Form, eine Art der Selbstnormierung und Selbstbestrafung wider den technischen Gebrauch der Dinge, gerazu deren Überbietungsform. Schließlich wollen wir die Ergebnisse unserer Untersuchung auf die Begriffe der soziologischen Systemtheorie übertragen und werden den Negationen und Freiheiten des Zeichenbegriffs unsere Aufmerksamkeit schenken.
49
4. VORLESUNG Konsum ist eine Sprache – Die Tauschfrequenz bestimmt den Wert. Der Zeichentausch ersetzt die Zeichenverweisung – Szenografie ist Rückführung in leibliche Fühlbarkeit – Den Menschen als Nullpunkt neu vermessen – Inszenierung ist eine ephemere Ware – Was ist das Element der Zeit? – Saussures Graphophobie – Jedes Wort ist die ganze Sprache
Beginnen wir mit einer Auseinandersetzung der Semiotiken in Bezug auf die Zeitstasen „Augenblick“ und „Dauer“. Es geht also in aktualisierter Form um das Verhältnis von Geist und Materie. Nicht mehr nur die thetische Setzung von Zeichen, sondern deren Choreo- und Chronografie ist Thema. Insbesondere Kristeva und Barthes haben das in der poststrukturalistischen Erneuerung herauszuarbeiten versucht. Es ist angebracht, sich zunächst mit der Selbstreflexion szenografischer Arbeit zu beschäftigen. Die Gewerke, vom antiken Theaterkult über das Disegnio der barocken Festkultur bis zum Design des kapitalistischen Warenverkehrs und den begleitenden Kommunikations- und Tauschformen von Ereignissen und Ereignisproduktionen, sowie die Selbstkonstitution von Gemeinschaften zwischen den Polen des Individuums und dem Anderen sind zu sammeln und zu befragen, wenn man nach der Semantik von Semiotik Ausschau hält. Schon die Nennung der Traditionslinien Theater, Fest und Warentausch zeigt, wie umfänglich die Konnotation des Begriffs „Szenografie“ ist und wie die Werte zwischen Ich und dem Anderen, zwischen dem Individuum und der Gesellschaft zu differenzieren sind. Vielleicht gilt es nicht nur eine Struktur, sondern eine Vielzahl von Codes und Formen der Gemeinschaft zu beachten. Hinzu kommen szenografische und performative Dingkonstellationen in Museen, Ausstellungen, Events, Film: alles Ereignisse, die nicht für die Ewigkeit, sondern für eine spezifische Dauer einer Aufführung, einer Saison, einer Mode platziert werden, und deren oppositionelle Einheiten die Szene und der Sinnenkörper, der Leib sind. Die Kollektive bilden hier keine Serie, sondern Gruppen, die nach ihrer intendierten Dauer zerfallen und in der Indifferenz der gleitenden Praktiken untergehen. In einer Gesellschaft, die auf Präsenz verpflichtet ist, scheint es umso mehr angebracht, professionell mit Zeit und Aufmerksamkeit umzugehen, ja, gestaltete Zeit als Ware zu akzeptieren oder genauer: wieder zu akzeptieren – als eine Ware, die sich von den Situativitäten magisch abhebt. Vielleicht dürfen wir behaupten, dass wir in ein Zeitalter der Gegenwart eintreten, in der die alphabetische Schrift nicht mehr den dominierenden Charakter hat, den innerhalb von vierhundert Jahren sich erobert hatte. Die Schrift und das Ereignis – das war vor ihrer allgemeinen Kultivierung das Gleiche, das, was in der Dauer bestand haben sollte. Gehen wir nämlich davon aus, dass grundsätzlich jede Vergesellschaftung sich auf der Grundlage einer spielerischen, interpretativen Ordnung aufbaut, die eine Überschreitungen auf experimentelles Gelände zulässt, so scheint gerade die Sphären der Arbeit und der Auseinandersetzung mit den Maschinen, technischen Normen und der Handlungs- und
52
4. VORLESUNG
Gebrauchsvorschriften dies vergessen zu machen. Zwischen den normierten und nichtnormierten Handlungen klafft zusehends eine Lücke, die einen idealen Ort für sekundäre szenische Tauschhandlungen eröffnet, die sich als magische Ereignisse präsentieren und Traum und Wunsch ineinander transformierbar machen, jedoch von der gleichen merkantilen Ökonomie hervorgebracht sind. Von dieser Überlegung aus ist der profanisierte Gegensatz zwischen Arbeit und Spiel ein falscher: Es geht tatsächlich um zwei Weisen der Produktion, die sich in jedem Augenblick transformieren. Es gibt Spiel in der Arbeit (Kreativität) und Widerstände im Spiel (Regeln). Nicht die Zeitorganisation der Gemeinschaften, sondern die Überschreitung des Gesellschaftlichen, die Bildung anderer Gruppen und Gemeinschaften auf Zeit (jenseits der Verwandtschaften und der Ethnien) ist das Entscheidende. Auf der Mikroebene ist das semiotische Problem von Entwurf und Realisierung als Spiel der Produktion von Bedeutung zu lokalisieren. Eine Bedeutung einem Signifikanten zuzuordnen heißt, Schlüsse zu ziehen und Urteile über den Wert eines Signifikanten in seinem Kontext, in seinem Handlungszusammenhang zu erkennen, ihn zur Erfahrung werden zu lassen, ihn durch Wiederholung zu situieren, ihn zur Körpertechnik zu erheben. Szenografien sind die öffentlich sichtbaren Repräsentanzen dieser Technik divinatorischer (probierender) Aneignung von etwas Anderem, Fremden, Überraschenden in die Integration einer ephemeren Ordnung. Wenn wir die Frage nach der Bedeutung der Inszenierungen auf der Ebene dieser Mikrostruktur (und nicht auf der der theatralen Großinstitutionen) – dieses Vorgangs der progressiven Überschreitung (Entwurf ) und der regressiven Eingliederung des Fremden in den sozialen Bestand der Zeichen und Handlungen – feststellen wollen, müssen wir auf die chronologische Unterscheidung von topologischer Ordnung und temporalem System zurückgreifen und deren dialektische Synthese verstehen. Es genügt dabei nicht, die Topoi als synchrone und die Zeit als diachrone Form zu betrachten. Es geht um eine Logik der Chronosphäre. Es ist offensichtlich, dass der Faktor „Zeit“ im Sinne von Aufmerksamkeitsund Ereigniszeit heute eine dominierende Rolle spielt. Wie aber sind Zeichen und Zeit zueinander zu denken? Nach dem eben Gesagten doch so, dass wir die „falsche“ Entgegensetzung von ökonomisierter und „freier“ Zeit von der Normzeit eines (kulturspezifischen) Acht-Stunden-Arbeitstags entkoppeln und die Mikrostruktur betrachten: Haben wir es wirklich mit einer Tendenz zur Präsenzgesellschaft zu tun? Warum hat die Semiologie nicht an die Forderungen nach einer Universaltheorie anknüpfen können, sondern sich früh in informationellem und kommunikativen Gebrauch von Zeichen, Sprachen, Codes und Medien differenziert? War es nicht genau dieser Unterschied zwischen normativem, situiertem und nichtnormativen, spielerischen Gebrauch, der Kristevas Rede von der Traumproduktion und Derrida von der Anmaßung der Spur sprechen ließ? Wovon und wofür gibt es an dieser Stelle keinen Begriff, sondern nur die dunkle Sprache vom „anderen Schauplatz“ der Produktion: „Im theatralischen Unlesbaren, in der Nacht, die dem Buch vorausgeht, ist das Zeichen noch nicht von der Kraft geschieden.“81 Es ist also vom Tausch und 81
Jacques Derrida: Freud und der Schauplatz der Schrift. In: Ders.: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt am Main 1976, S.302-352, hier S.292.
4. VORLESUNG
von der Zeit zu sprechen, die dem Buch vorausgeht, einer allegorischen und einer analogischen, einer magischen Zeit; es ist vor allem von der Zeit zu sprechen, die in der Praxis den symbolischen und den funktionalen Wert der Handlungen synchronisiert, indem die Hand weiß, was sie tut – indem also der Körper das Zeichen ist und die Kopfarbeit sich in eine „Geste“ verwandelt, die beinahe in einem „Instinkt“82 regrediert. Wenn nach Freud der Traum tatsächlich die Wunscherfüllung ist – die einzig mögliche – gilt es, die andere Erfüllung, die des Dings, in einer Selbstaufhebung auf Zeit aufzuheben. Denn die Dinge erfüllen den Wunsch nur unter der Kontamination einer tödlichen Dauer, in der der Traum der Ware sich durch Inszenierung rettet. Die Ware ist in ihrer Vergänglichkeit lebendiger als das Ding. Warum durchdringt der informationelle Code niemals die inszenierten Spieloberflächen der Mediengadgets als Design, sondern bleibt in den Abgründen der elektronischen und mathematischen Sprachen verbannt? Offensichtlich ist der Aufmerksamkeits- und Ereignishaushalt des Menschen von der Dimension der Körpersinne abhängig. Die Frage dieses Humanismus83 aber ist keine normative, nicht einmal eine ethische. Die Frage nach der Aufmerksamkeit, dem Verhältnis von Wahrnehmung und Erkenntnis einer Bedeutungszuweisung ist von den Semiotikern nie gestellt worden, da sie die Konstitution eines Sinns-für-mich beinhaltet und das semantische Problem einer Hermeneutik berührt, die den Menschen, wenn auch in idealisierter Gestalt, ins Zentrum des Verstehens stellt. Das Verhältnis von Signifikant/Signifikat wird entgegen seiner psychologischen Deutung, die ihm von Lacan beispielsweise verliehen worden ist, immer noch als Identitätsverhältnis im Sinne des „Verstehens“ angesehen: Aufgabe der Verweisung eines Zeichens ist es, die Identität zwischen dem Bedeutenden und dem Bedeuteten herzustellen, derart, dass der Signifikant das Signifikat evoziert und zugleich substituiert. So hat es 82 André Leroi-Gourhan: Hand und Wort. Die Evolution von Technik, Sprache und Kunst. Frankfurt am Main 1988, S.302. Allerdings untersucht Leroi-Gourhan den Zusammenhang nur in der einen Richtung, nämlich der Übernahme der Körper- und Geistfunktionen (das Sensible und das Intelligible) in Maschinen und Systemen, nicht aber das Zurückfallen, d.h. die Konsumation automatisierter, instinkthafter, affektiver Handlungen in den Körpertechniken. 83 Zur Darstellung der Thematik des „Humanismusstreits“ siehe Martin Heideggers Brief über den Humanismus (1946) als Kritik an Lévi-Strauss und die Anthropologie. Parallel dazu eröffnet Sartres Darstellung in Das Sein und das Nichts (1945), „dem Menschen“ eine neue Freiheit. Diesen Freiheitsbegriff des Menschen aktualisiert er in Marxismus und Existentialismus methodisch. Derridas Resümee und Kritik auf den „Humanismusstreit“ in Finis hominis; Ders: Randgänge der Philosophie, a.a.O., S.88-123, S.99 greift diese Diskussion 1968 wieder auf, indem er die Frage nach dem „eigentlichen Menschen“ in ein „wir Menschen“ (S.107) umformuliert und in spezifischer Weise die Explikation des Menschen mit der Implikation seiner Kulturtechniken konfrontiert (S.110). Von wo aus und in welcher Zeit kann nach „dem Menschen“ gefragt werden? Derrida fügt eine Skala der Kalibrierung ein. Die strukturelle Schärfe des Begriffs ist abhängig von ihrer differentiellen Dichte („Nähe“), also von der Präsenz des gegenwärtigen Menschen: „Der Wert der Nähe, das heißt der Präsenz im allgemeinen, entscheidet also die wesentliche Richtung der Daseinsanalytik. Das Motiv der Nähe ist in einer Opposition vereinnahmt, die fortan Heideggers Diskurs regeln wird.“ (S.111) Wir dürfen nicht vergessen, dass Heidegger aber zur allernächsten Nähe die Seinsvergessenheit rechnet, also die Praxis unseres Daseins. Zwischen diesen beiden Positionen, dem Übernahen und dem Nächsten, geht es um die Frage dessen, was man „Ökonomie“ und „Korrespondenz“ nennt oder, mit anderen Worten, „die oszillierende Freiheit des Zeichens“. Vgl. auch Vincent Descombes: Das Selbe und das Andere. Fünfundvierzig Jahre Philosophie in Frankreich 1933-1978. Frankfurt am Main 1981, S.123.
53
54
4. VORLESUNG
Saussure in seinem Cours vorgeblich in einer dualen Schreibweise (S|s) festgelegt. Die konsumtiven Synthesen werden zu Gunsten der produktiven Differenzierungen logisch verfeinert, ohne die Differentialität der Rechenoperatoren erreichen zu können, die die Sinnesleistungen nach Belieben überfordern. Die Überforderungen sinnlich zu rehumanisieren ist Aufgabe eines Handwerks oder einer Technik auch namens Szenografie. Ihre Funktion können wir wie folgt aus der Analyse der Konsumarbeit ableiten: Baudrillard hat Mitte der 1960er Jahre festgestellt, dass in unserer westlichen Konsumgesellschaft84 nicht mehr die Beziehung auf ein Signifikat, sondern die Beziehung der Signifikanten untereinander entscheidend für die Wertgeltung und Differenzierung der Gesellschaft ist. Nicht dieser strukturale Relativismus, sondern die Tatsache, dass der Konsum eine Sprache ist, ist neu. Der autonome Bezug auf die Bedeutung oder die funktionelle Handlung einer Ware, die mit dem Zeichentausch pragmatisch verbunden ist, entfällt zunehmend. Die Tauschfrequenz bestimmt den Wert. Der Zeichentausch ersetzt die Zeichenverweisung. Wir verwerten/inkorporieren in einer Konsumgesellschaft nicht mehr Dinge, sondern prädisponierte, inszenierte Zeichenverhältnisse. Nicht die Erfüllung des Begehrens, sondern die Kontinuität des Unerfüllbaren im Wunsch steht im Zentrum der Fürsorge.85 Bedeutungsverschiebungen lassen sich per Inszenierung, also kontextueller Dislozierung erreichen. Folglich muss man der Ware den gesamten Zeichenzyklus und Kontext, den konnotativen Bezug mitliefern: Das Zeichen ist Form und Struktur einer Sprache, die Roland Barthes „mythisch“ nennt, weil sie einerseits Anteil an göttlicher Gabe hat, andererseits aber die verführerische Sprache des Humanen spricht.86 Die In-Szene-Setzung der Ware setzt den produktiven Wert des Konsums fest. Die Gebrauchsvorschrift wird zum anderen Schauplatz des Konsums, so, als 84 Baudrillard, Die Konsumgesellschaft, a.a.O., S.65: „Eins der grundlegenden Probleme des Konsums liegt, anders ausgedrückt, in der Frage, ob die Menschen sich organisieren, um zu überleben, oder aber um des – individuellen oder kollektiven – Sinnes willen, den sie ihrem Leben verleihen. Dieser Seinswert, dieser strukturelle Wert kann implizieren, dass man wirtschaftliche Werte aufgibt.“ Baudrillard greift die These von Mauss auf, nach der der Tausch/die Gabe die Grundlage der Sozialisation darstellt. In der Konsumgesellschaft, die Baudrillard für die Zeit ab den späten 1950er Jahren ansetzt (was ihre globale Strategie angeht), hat der Tausch jedoch primär die Funktion der Differenzierung der sozialen Hierarchisierungen, die nicht mehr über den Besitz und die Macht erfolgen. Diese Differenzierung bringt die endlose Differenzierung der Zeichen, Waren und Inszenierungen als deren (des Geldes und der Macht) Simulation hervor. Der Umsatz und die „Verschwendung“ sind maßgebend für die gesellschaftliche Bindung, nicht der Gebrauch und der Besitz. Es geht im Zeichengebrauch letztlich um die Simulation des Lebendigen und der Existenz (S.64). Vgl. auch F.D.E. Schleiermacher: Hermeneutik und Kritik. Frankfurt am Main 1977, S.367: „Die Sprache ist mit dem Wissen zugleich gegeben als eine notwendige Funktion des Menschen und ist nichts anderes als die heraustretende Gemeinschaftlichkeit desselben.“ 85 Die Wunscherfüllung ist letztlich die Aufhebung der semiotischen Differenz in einer Realität des Gebrauchs, d.h. Produktion-Konsumation. Baudrillard sagt: „Das Wesentliche ist also die Abschaffung des Signifikanten in der Zeit, d.h. in seiner Sukzessivität.“ Ders., Der symbolische Tausch und der Tod, a.a.O., S.349. Denn wenn das Signifikat im Signifikanten anwesend ist, versiegt die Verweisung. Folglich kommt es immer nur zur Verschiebung des Wunsches im Realen. 86 Roland Barthes: Mythen des Alltags. Frankfurt am Main 2015. Da der Mythos Form und Sprache ist, also Synthese und Differenz, ist er im engeren Sinne ein Stilzug der Zeit (Ausdrucksform), er ist ein Bedeutung verleihender oder inszenatorischer Akt, aber ein sekundärer, der sich den Formen aufpfropft: „Er ist ein sekundäres semiologisches System.“ (S.258)
4. VORLESUNG
sei Konsum nur dann ein Gewinn, wenn darin jeglicher memorierbarer Arbeitsanspruch vorweggenommen wird. Man muss uns beibringen, dass der Konsum ein leichtes Spiel ist. Man spricht nicht mehr nur von inszenierten Objekten, sondern von inszenierten Welten, deren Simulation verdeckt, dass jegliche Traumarbeit eben auch eine Durcharbeitung87 ist, in der das Opfer verschoben wird. Der inverse Bezug von Signifikant|Signifikat meint nun, dasjenige identitätslogisch ersetzen zu können, was man vorher durch Tradition und Gewöhnung, durch Wiederholung und Irrtum sich hat aneignen und differenzieren können. Der zerbrochene semiotische Zyklus gehört zum Geschäft. Die Präsenzgesellschaft ist nämlich immer auch eine Wissensgesellschaft, die sich ihre Ableitungen und Sinntraditionen nicht mehr auf spielerischem Wege, sondern mittels Lerntechniken aneignet, wie auch immer diese Techniken sich spielerisch geben. Bildung wird zum Imperativ der Teilhabe auch am Arbeitsfeld des Konsums. Der Konjunkturumbruch der Semiotik zu Gunsten einerseits der Informatik und andererseits der systemtheoretischen, autopoietischen Kommunikations- und Gesellschaftstheorien ist nicht zu verleugnen. Das heißt nun nicht, man könnte sich von der Idee des Zeichens verabschieden, sondern es gilt, ihre primär dialektische und sekundär ökonomische Arbeit zu vervollständigen. Schon die Vielfalt der Nomenklaturen und Termini, die dem inflationär verwendeten Universalbegriff „Zeichen“ (und „Design“) zukommt, lässt er ahnen, dass der Begriff lediglich eine Relationsbeziehung bezeichnet, die auf ganz unterschiedliche Weise, in unterschiedlichen Codierungs- oder Diskurszusammenhängen vorkommen kann: als Signifikant|Signifikat, Form|Medium, Inhalt|Ausdruck – in loser und in fester Kopplung, durch jeweils ein polares oder dialektisches Relat bestimmt, als Werte-, funktioneller oder funktionaler Bezug. Als Universalverhältnis wird das Zeichen sich von den Leitmedien gesprochene Sprache und Schrift emanzipieren und in alle möglichen Relationsformen, d.h. Codierungen transferieren lassen: in differentielle Produktion und in Synthesen der Konsumation. Es ist nun ein Motiv szenografischer Arbeit, zunehmend komplexe, unsinnliche Vorgänge, also Medialisierungen, Serialisierungen und Algorithmisierungen, gleichsam essayistisch88 in die Nähe sinnlicher, allgemein verständlicher Anschauung und leiblicher Fühlbarkeit zu überführen, also zu reszenifizieren, und umgekehrt allzu profane Praktiken notwendiger Signalisierungen neu mit Aufmerksamkeit und Emotionalität aufzuladen. Es geht um das Erlernen durch Erleben, um den spieleri87
Freud, Die Traumdeutung, a.a.O. Bei Freud ist augenfällig, dass die von Lacan herausgearbeitete linguistische Komponente der Traumarbeit, wie sie im gleichnamigen Abschnitt der Traumdeutung dargestellt wird, mit dem Saussur’schen Ansatz der „Assoziation“ (Saussure, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, a.a.O., S.77) identisch ist. Denn die Bedeutung muss erarbeitet/diviniert werden, sie ist im Zeichen nicht materialisiert. Allerdings ist die „Verdichtungsarbeit“ (Freud, Die Traumdeutung, a.a.O., S.235) im Traum so geleistet, nämlich unbewusst, wie die Arbeit der Konventionalisierung oder Kollektivierung (Saussure, S.80) der Sprache. 88 Die szenografische Arbeit wird deswegen immer essayistisch sein, da die Struktur immer nur im metaphorischen Sinne totalisiert werden kann. „Auf dieser Ebene findet man den strukturalen Kernpunkt des Verfahrens: ‚Die Definition eines Codes ist es, in einem anderen Code übersetzbar zu sein: diese ihn definierende Eigenschaft nennt man ›Struktur‹‘“. Dosse, Geschichte des Strukturalismus Bd.1, a.a.O., S.58. Siehe auch Descombes, Das Selbe und das Andere, a.a.O., S.121.
55
56
4. VORLESUNG
schen Umgang mit der Bildung von Synthesen. Nicht mehr Dinge im „zuhandenen“ Gebrauch, sondern Techniken sind zu erlernen, die uns alle zu Designern, Akteuren, Regisseuren im Spiel der sozialen und technischen Tauschmobilität machen. Sind die Techniken schwer erlernbar und kaum sinnlich nachvollziehbar, befindet man sich im Bereich von Zauberei und Magie. Die Unterscheidung zwischen regulativer Technik und magischer Erscheinung einerseits und individueller, situativer Ver-Wendung andererseits kann nicht nur im Hinblick auf magische Unerklärbarkeit, die sich nur per Initiation fortpflanzt, gesehen werden, sondern auch in Bezug auf Rationalität: Hier heißt es, die situativen individuellen Fehler, Missverständnisse, Übertretungen der strukturellen Regeln selbst zu strukturieren. Von Willkür kann hier ebenso wenig die Rede sein wie im Traum. Der Rahmen solcher Spielplätze der opferenthobenen Verständigung muss wiederum erkämpft und inszeniert und – mit Rücksicht auf Narrative, Geltung, Kausalität und Tradition verteidigt werden. Über den Warencharakter von Ereignissen braucht man spätestens seit Adornos und Horkheimers einseitiger Kritik an den Mythen des Kapitalismus89 und der von Guy Debord wahrgenommenen Gesellschaft des Spektakels90 nicht mehr zweifeln. Seit den populären Mythen des Alltags von Roland Barthes wird die Frage dringlich, ob der „kreative“, sich vom technischen Imperativ ablösende, subversive, travestierende, ironische Gebrauch von Zeichenrelationen sich auf formale Weise beschreiben ließe. Gehört nicht zu jeder kommunikativen Bedeutungsverweisung die Möglichkeit der Missdeutung, die unendliche Anschlussoptionen offen lässt? Die Modernität des Essays wie sie der Strukturalismus intensiv kultiviert, versteht sich als facettierende Form der Negation von opferloser Identität und ableitungsfähiger Wahrheit. Die Konjunktur der postmodernen Apokalyptiker, Baudrillard, Virilio, Barthes, Foucault stehen in dieser Tradition, in der die Behauptung der Ganzheit nur als Unwahrheit aufzufassen ist91 und die Instrumente der Semiotiken, sofern sie nicht auf philosophische Semiologie reüssieren, diskursiver Negativität anheimfallen. Der Essay als Form der Semanalyse (Kristeva) zeigt sich als historisch bedingte 89 Max Horkheimer/Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Frankfurt am Main 1979, S.54.
Horkheimer/Adorno machen den Mythos am Wiederholungszwang fest, begründen ihn also als Ritualisierung und Konventionalisierung von etwas, was schon seine Form gefunden hat, sodass der Mythos dialektisch das Fortschrittsgeschäft der Aufklärung festschreibt, ohne sich über den immanenten Zwang aufklären zu können. 90 Für diese Umorientierung der Inszenierungsgesellschaft steht Guy Debords Die Gesellschaft des Spektakels (Berlin 1996) selbst als „Kultbuch“ ein. Auch er spricht, wie Horkheimer/Adorno, von einem „falschen Bewusstsein der Zeit“ (ebd., S.139) und meint „Zeit“ im doppelten Sinne, als historischer Moment und als Qualität der Verzeitlichung. Das „wahre Bewusstsein“ ist also zu jener Zeit (1967) dialektisch, aber nicht ökonomisch immer noch in der Herrschaftsideologie des „Wahren“ erfasst. 91 Von einer semiologischen Auffassung her kann es eindeutige Wahrheit gar nicht geben. Siehe zu diesem Aspekt paradoxer Gnosis auch Jochen Hörisch: Es gibt (k)ein richtiges Leben im falschen. Frankfurt am Main 2003, S.54. D.h., die paradoxe Mitteilung über das Wahre im Satz Adornos reflektiert die unreflektierte Mitteilung schlechthin als falsch, die paradoxe, die auf Widerspruch aus ist, aber als mehrdeutig und insofern richtig oder „wahr“. „Integration läuft in modernen und postmodernen Gesellschaften erstens nicht über sprachliche, sondern über monetäre Kommunikation; und nicht Konsens, sondern Dissens ist zweitens die regulative Idee von Kommunikation. Inklusion hat in Waren- und Geldgeschäften nur in so paradoxer wie produktiver Form statt.“ (Ebd.)
4. VORLESUNG
Darstellungsform. Das Aktuelle zeigt sich im restituierten Mantel des Alten – und das ist wirklich neu: Zum ersten Mal wird die Geschichte selbst wiederholbar, inszenierbar, wiedererlebbar in Film, Aufführung und Performanz. Das Zeitgenössische und das Authentische werden als Gleichzeitigkeiten erlebbar. Die Postmoderne propagiert sich nicht so sehr durch die Beliebigkeit ihrer Selbstdarstellung, sondern durch die Kompetenz der Synchronisierung und Serialisierung aller Formen und Sprachen, d.h. aller Stile: Aufzeichnung, Speicherung, Wiedergabe. Obwohl in den Designlehren je nach Fall, also situativ, mal das Eine (Grundlehre der Medientechniken), mal das Andere („kreative“ Anwendungsprojekte) zur Ausführung oder Simulation kommt, gibt es doch keine Disziplin, die die Frage nach der objektiven Dialektik der Utopie des Entwurfsprozesses, also der Inszenierung, der Wiederholbarkeit stellt – und zwar nicht praktisch, sondern dem Alltag und dem situativen Hier und Jetzt abgerungen, strategisch. Gerade fehlende Einmaligkeit des geschichtlichen Ereignisses verlangt nach strategischer Kompetenz. Woher kommt denn der Wunsch nach einem Formmythos in einer Gesellschaft, die einerseits dem Historismus abschwört, sich andererseits aber mit der postmodernen Vielfalt in der Formensprache schwer tut und immer noch nicht weiß, in welcher Epoche sie lebt oder über welche Schwelle sie tritt? Es fehlt an sinnlicher Selbstidentifikation. Offensichtlich – wir haben es anfangs schon betont – ist hier immer noch ein Denken linearer Zeit am Werk, das den Kraft- und Triebbegriff nicht vom Gegenwärtigen her denken kann. Das heißt nicht, jede kausale Ableitung, jede Identität als eine Ausblendung von Differenzen in der Zeit zu markieren und den Verlust an historischer Erfahrung zu betrauern; Walter Benjamin hat solchen Erfahrungsverlust gegenüber dem Bauhaus pauschalisiert. Weißen Wänden und rechten Winkeln mangelt es an Geschichten erzählender Differenzierung. Unter der Fahne des „sozialen Bauens“ beginnt ein geschichtsloses Hausen.92 Benjamin hat aber vergessen, was in den Archiven sich nur schwer lagern lässt: die Feste und Veranstaltungen – der Pool der Idee, der letztlich die strenge Idee von Gropius für ein funktionales und soziales Bauen gegen das Nomadentum der Theatralik stellte und das Bauhaus schon vor seiner nazionalsozialistischen Schließung in kaum zu überbrückende Krisen stürzte. Die Unbehaglichkeit, die beispielsweise Paul Klee in seinen späten Lehrjahren artikulierte, zeugt davon. Es dauerte dann nur zwei Jahrzehnte, bis der geschichtslose Ausblick auf die weiße Wand durch die Dauerpräsenz des Fernsehbildes erlöst wurde. War diese atmosphärische Raumgestaltung in den zwanziger Jahren schon in Radio und Schallplatte vorgedacht? Imaginierte das Bauhaus seine Wände durch den Sound von JazzPlatten? Bedeutet „in einer Sprache wohnen“ nicht eine zunehmende Trennung von dinglicher und innerer Äußerlichkeit – gerät mit der Medientechnisierung nicht nur eine Veränderung der Gedächtnisarchive, sondern auch der Zweiseitenform 92 Walter Benjamin: Metaphysisch-geschichtsphilosophische Studien. Erfahrung und Armut. In: Ders.: Gesammelte Schriften Bd.II. Frankfurt am Main 1980, S.218: „Das haben nun Scheerbart mit seinem Glas und das Bauhaus mit seinem Stahl zuwege gebracht: Sie haben Räume geschaffen, in denen es schwer ist, Spuren zu hinterlassen.“ Benjamin ahnt noch nicht, dass die Erfahrungsarmut dieser Räume ihre Geschichten in den Medien finden werden, die elektrisch ins Haus kommen und die Leere der Ornamentik einer geborgten Erfahrung verzieren.
57
58
4. VORLESUNG
von Vorstellung und Darstellung, von Imagination und Wahrnehmung in Schieflage, sich deren Relation verändert? Und was hat das für Folgen in der traditionellen Zeichenökonomie, die sich im Tausch organisiert und repräsentiert? Damit solche Fragen nicht nur der Geschichte und ihrem Trieb nach Veränderung unterworfen werden93, gilt es, die einfachste Stufe der dialektischen Opponenten zu befragen: das Zeichen als Synthese. Der Leser/Hörer dieser Vorlesungen ahnt, dass die Fragestellung nach strategischer Vorwegnahme und Einmaligkeit der Ereignisse in den 1960er bis 1980er Jahren die Besinnung nach struktureller bzw. dynamischer Anwendung der Sprachregeln als Zeichenregeln und -relationen motivierte. Es herrschte ein kybernetischer Entscheidungszwang, zwischen Spur/Buchstabe/Phonem und Zahl/logischer Operation wählen zu müssen. Es ist die Entkopplung beider Entwurfsbereiche – der von „Genauigkeit und Seele“94, wie Musil zu Beginn des 20. Jahrhunderts sie nannte – der die Semiotik dem Designer und die Rechenkunst dem Ingenieur zuschlug. Dabei profitierte die Rechenkunst ebenso vom Verlust des Wahrheitsbegriffs wie die Ästhetik: Es ging nicht mehr um Wahrheit, sondern um Genauigkeit mit Rücksicht auf sinnliche Fassbarkeit und Darstellungsvermögen. Unter dem Stichwort „nach menschlichem Ermessen“ und unter der Kritik des Humanismus, die die Interpreten von „Genauigkeit und Seele“ in zwei Lager teilte, wurde „der Mensch“ als Nullpunkt neu vermessen. Es gibt somit zwei Interpretationen der Interpretation, der Struktur, des Zeichens und des Spiels. Die eine träumt davon, eine Wahrheit und einen Ursprung zu entziffern, die dem Spiel und der Ordnung des Zeichens entzogen sind, und erlebt die Notwendigkeit der Interpretation gleich einem Exil. Die andere, die dem Ursprung nicht länger zugewandt bleibt, bejaht das Spiel und will über den Menschen und den Humanismus hinausgelangen.95
Schafft der Blick auf die Elementardifferenzen der Semiotik Ordnung? Es lohnt nicht nur ein Blick auf die Geschichte der Diskursauseinandersetzungen, sondern gerade auf die Dialektik von Analyse und synthetischer Anwendung, bevor wir von der Dialektik zur Ökonomie übergehen und von dort aus die Probleme der Systemlogik avisieren. Die Dialektik, von der wir noch nicht wissen, welche Synthesen sie hervorbringt, möchte ich durch die Begriffe „Situativität“ (Situationsanalyse) und „Szenifikation“ (Formsynthese) präzisieren, um die Effekte der Strukturalismusdebatten, die um die Elementstruktur, d.h. Kalibrierung der Semiotik kreisen, für ein 93 In dieser Hinsicht ist die Kritik von Horkheimer/Adorno durch den historischen Kontext des Krieges kontaminiert. 94 Robert Musil, Psychotechniker, Ingenieur und Schriftsteller, macht diese Opposition zur Grundlegung in der Auseinandersetzung mit dem Imperialismus des 19. Jahrhunderts. „Denn so weit die menschliche Geschichte zurückreicht, lassen sich diese beiden Grundverhaltensweisen des Gleichnisses und der Eindeutigkeit unterscheiden.“ Ders.: Der Mann ohne Eigenschaften, Gesammelte Schriften Bd.2. Reinbek 1978, S.595. „Die logische Evidenz rührt dh. weil die Logik ihre Wurzeln im Gefühle hat und die Evidenz das Charakteristikum des Gefühls ist“ – so merkt Musil 1904 in seinen Tagebuchnotizen an, die an Husserls Logischen Untersuchungen orientiert sind. Robert Musil: Tagebücher. Reinbek 1976, S.118. 95 Jacques Derrida, Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen. In: Ders.: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt am Main 1976, S.422-443, hier S.441.
4. VORLESUNG
Zeitalter der elektronischen Sprachen – und ihrer aus systemischen Gründen völlig unsinnlichen Operationen – zu befragen. Was ist unter welchen Blickwinkeln und Sinneninstrumenten zu beobachten? Es geht mir, wie schon betont, um eine von der Präsenz ausgehende Periodisierung eben dieser Zeitgrenze – um ihre Inszenierung: Durchaus, wenn man will, ist da ein hysterisches Moment der Sperrung/Lichtung des nur als Grenze formalisierten Gegenwärtigen. Doch genau diese Grenze (Präsenz) verschwindet im Konzept der Szene, die aus der Zeit kein Ding macht, sondern sein eigenes Verschwinden von vornherein als Aushalten-Können einer spezifischen Dauer voraussetzt. Die Inszenierung ist also die ephemere Ware: Der Begriff „Zeichen“ war ursprünglich als Denkhilfe gedacht, um das Abwesende vom Anwesenden außerhalb der Zeit seiner Präsenz („hier“ und „jetzt“) zu denken. Das Zeichen, so kann man sagen, ist, was sich inszeniert, was in seiner Dauer nicht zur Ruhe kommt, was nicht eindeutig ist. Denn wenn die Bedeutung sich einem divinatorischen Akt verdankt, erscheint sie nur unter der Voraussetzung situativer Einmaligkeit. Als Einmaligkeit evoziert sie die Mimetik des Gedächtnisses. Die Semiotik hat sich von der Linguistik gerade zu dem Zeitpunkt emanzipiert, als die technisch-medialen Sprachen – vom Morsetelegrafen angefangen, über die Tricktechnik bei Méliès bis zur ersten schüchternen Kybernetik der 1930er Jahre – die Sinnesleistungen und die Gedächtnisleistungen zu überbieten begannen. Der Fokus richtete sich nicht mehr nur auf die gesprochene Sprache, die zwar als universelle, aber nicht mehr als universale akzeptiert wurde. Wichtiger als der Sprachbegriff wurde der des Code. Mit der Differenzierung der Codes wurde nun von „Codierung“ und „Decodierung“ von „Lesbarkeit“ und „Fragmentierung“, also von „Verschlüsselung“96 gesprochen – auch der des „Menschen“ in seiner Gestalt und seiner Genetik. Während man die menschliche Sprache noch im spielerischen Gebrauch der konkreten Anwendung lernt, muss die Verschlüsselung, wie jede Schrift, systematisch erlernt werden. Während die Synthesen der Schrift (Wort, Satz) als natürliche Synthesen verstanden werden, erfordert das Verschlüsselungsproblem von Anfang die Konstruktion künstlicher Synthesen und Gedächtnisse. Ihr historisch relevanter Ort war Bletchley Park, ihr Protagonist Alain Turing, und das Objekt der Identifizierung, also der Lesbarmachung der Codes, die Verschlüsselungsmaschine Enigma. Turing ging es bei ihrer Konstruktion einzig und allein um die Erhöhung des Durchlaufs der Codierungsmöglichkeiten, erst in zweiter Linie um die Präzisierung eines Sinns. Das, was tausende Mitarbeiter in Wochen erledigten, konnte die Rechen-, Programmier- und Speichermaschine COLOSSUS in Stunden abarbeiten. Die Idee von Turing war, die zeitlichen Szenen von den natürlichen Synthesen der Arbeit des Menschen zu befreien. Die Sinnlichkeit von Lesen und Schreiben war in diesem Moment beendet. Dabei wurde immer vorausgesetzt, dass die Funksprüche der Deutschen im militärischem Sinne eindeutig waren; die Entschlüsselung von surrealistischen Gedichten wäre mit Sicherheit nicht gelungen. Auf diese 96
Vor allem Friedrich A. Kittler hat diese Medientechnikgeschichte bekannt gemacht. Vgl. Ders.: Die künstliche Intelligenz des Weltkriegs: Alan Turing. In: Ders: Die Wahrheit der technischen Welt. Essays zur Genealogie der Gegenwart. Frankfurt am Main 2013, S.232-252, hier S.242: „Jede von einem Algorithmus gesteuerte Maschine kann geschlagen, ja überboten werden, vorausgesetzt, daß die Feindmaschine über eine Obermenge von Algorithmen verfügt.“
59
60
4. VORLESUNG
Weise konnte sich die militärische Maschine mit der Rechenmaschine kurzschließen. Allgemein wird damit der Krieg zu einer Form der Ökonomie der Vorteile, er wird eine Wirtschaftsform. Der dritte Akt der Maschine (Abspielen, Aufzeichnen, Wiedergeben) – das Auswerfen der Protokolle – war die Retransposition des ersten Akts, das Kalkül der Gegenoffensiven etc. Etwas verschlüsseln heißt, es den Sinnen zu entziehen; etwas dechiffrieren heißt, es den Sinnen bedeutungsvoll, d.h. aufmerksamkeitsrelevant zugänglich zu machen. Dazwischen muss prozessiert werden, d.h. alle möglichen Konventionalisierungen durchgearbeitet werden, bis sich sprachlicher Sinn ergibt. Die Frage ist: Geschieht das nicht schon beim Lesen eines alphabetischen Textes? Haben wir es hier nicht dezidiert mit einer In-Szene-Setzung zu tun? Offensichtlich soll „Lernen“ a priori den Möglichkeitsbereich auf Eindeutigkeit hin einschränken. Lernen heißt memorieren und memorieren heißt inkorporieren. Seit Foucault wissen wir, dass diese Ideologie eine politische Kampftechnik97 ist. Wenn Humboldt noch auf einen anderen Bildungsbestand, nämlich den der Übertragbarkeit Rücksicht nahm, dann, weil er die Doppelseitigkeit jeder Bedeutungsermittlung kannte: Die technische Analyse, also die Grammatologie einer Sprache, muss mit der Freiheit ihrer situativen Anwendung korrelieren. Einen Eindeutigkeitsbezug muss man schon deswegen ablehnen, weil – à la Hegel – der geschichtliche Ereignisrahmen als fortschreitend, als „werdend“ vorausgesetzt wurde. Ein „Ende der Geschichte“98 könnte auch das Ende dieser Freiheit bedeuten, zumindest dann, wenn man, wie Hegel, die Vollendung des Geistes im absoluten Wissen propagiert. Nun ist unter „Divination“ nicht „Identifikation“, sondern ein vorausgreifender Entwurf zu verstehen, der nicht der Geschichte vorgreift, sondern überhaupt erst Möglichkeitsraum eröffnet und Gegenwart systematisch verfehlt. Es ergibt sich sowohl für eine Deutungstheorie wie für eine Zeichentheorie der Missstand, dass die progredierende Zeit jeweils die Geltungsdauer einer Theorie, eines Entwurfs zunichte macht, und zwar nicht nur im historischen Maßstab, sondern in jedem der Akte der Wissens- und Bedeutungskonsolidierung. Das Zeichen verfehlt sich in seiner Verweisung systematisch, und nicht aufgrund einer Nachlässigkeit des menschlichen Geistes. Zeichen und Freiheit, das ist jeweils das gleiche Spiel in zwei unterschiedlichen Manifestationen: „Das Spiel ist Zerreißen der Präsenz,“99 ein Zeitgeben der Präsenz. Das Zeichen – das hat insbesondere Peirce verstanden, der seine Logik den Einsichten Kants zuschreibt – kann nur unter den Bedingungen der Freiheit für und gegenüber anderen Zeichen in ein Spiel eintreten. Für die Linguistik bis Saussure und Peirce, die es gewohnt war, mit Jahrhunderten zu rechnen, wenn es um signifikante Sprachveränderung ging, war es kein Problem, solche Veränderungen quasi als Aufsummierungen darwinistisch/ anthropologischer Selektionen und Kombinationen100 zu erklären. Für Semiotiker 97 Vgl. Michel Foucault: Technologien des Selbst. In: Ders.: Ästhetik der Existenz. Schriften zur Lebenskunst. Frankfurt am Main 2007, S.287-318, hier S.287ff. 98 Vgl. Descombes, Das Selbe und das Andere, a.a.O., S.217: „Das Ende der Geschichte bedeutet jetzt, daß die Menschheit im Begriff ist, die historische Zeit zu verlassen, um von neuem in die ‚Zeit des Mythos‘ einzutreten.“ Descombes bezieht sich auf eine Aufnahme Nietzsches durch Pierre Klossowski. 99 Derrida, Die Schrift und die Differenz, a.a.O., S.440. 100 Dass die Kontakte der Vorfahren Saussures sowohl zu den deutschen Idealisten (A. v. Humboldt)
4. VORLESUNG
und Medienanalytiker, die seit dem 19. Jahrhundert allenfalls in Jahrzehnten rechnen, schon. Irgendwie muss das Zeichen der Freiheit in die Freiheit des Zeichens implementiert werden. Wir werden später auf die Antwort, die Luhmann diesbezüglich formuliert, eingehen. Offensichtlich sind aber auch die Einheiten/Elemente/ Ereignisse als Synthesen der Geschichte ebenso wie ihre Kalibrierung nicht mehr am diachronen Zeitstrahl orientiert. Denn die Struktur kennt auch vertikale Gliederungen. Was heißt denn, dass es den Signifikanten (Singular) nicht gibt? Welche Nähe und Ferne, welche Dichte haben die Zeichen – und welche Auflösung muss man zu ihrer Differenzierung wählen? Hier bleibt zu sagen, dass man mit einer Relation Augenblick/Dauer, Nähe/Ferne im Sinne von Situativität/Szenifikation wenigstens vorläufig Begriffe in der Hand hat, um Identität und Differenz der Verweisungsfreiheit in ihrer sinnlichen Evidenz zu kalibrieren. Die binären Programmiersprachen sind nicht mehr Gegenstand einer Semiotik, sie sind Gegenstand einer Informatik, die nicht auf die Qualität der Differenzen und der Verzeitlichungen, sondern einzig auf Quantität der Rechenoperationen setzen. Als Leitfiguren der Frage nach der Technik und ihrer Freiheit können je nach Niveau und Interesse Schleiermacher, Humboldt, Husserl, Sartre, Foucault, Lacan, Freud oder Luhmann zu Rate gezogen werden – je nachdem, ob man sich mehr auf die Form oder die Funktion der Versinnlichung von Produktion kapriziert oder auch beides in funktionaler Einheit denkt. In Bezug auf den Gründungsakt der Semiotik werden jedoch ohne Zweifel Peirce und Saussure zu nennen sein. Es ist nicht Aufgabe unserer Darstellung, die Ableitungen, die hinlänglich protokolliert sind und in Eco und Barthes ihre beiden publizitätswirksamen Protagonisten gefunden haben, noch einmal zu wiederholen. Das ist eine Arbeit von Fußnoten. Wir wollen die Gründungsakte nur soweit in ihren elementaren Problemstellungen rekonstruieren, wie sie für das eigentliche Unterfangen, eine Semiose zwischen Situation und Szenifikation abzuleiten, notwendig ist. Die Semiose sei hier der kleinste Akt der Präsenz der geschichtlichen Freiheit: des Schicksals, des Zufalls, des Dramas der Bedingtheit des Lebens. Das Veranlassen von Sinn- und Sinnlichkeitstausch durch professionelle Autoren und Inszenatoren wird in dem Moment beobachtbar, wie die Aufforderung an die Subjekte der Gesellschaft ergeht, sich selbst ihren individuellen Sinn zu schaffen – und zwar in Tauschbarkeit mit dem Sinn aller anderen im System der Politik und in der Vielzahl politischer Systeme. In eben diesem Moment verlassen wir die vertikale Ordnung der Gesellschaft, wie sie durch Verwandtschaft, Familie, patriarchale Repräsentationen stabilisiert wird. An Stelle dieser alten Ordnung erscheint im 20. Jahrhundert die Freiheit als Form selbstrepräsentativer Kontrolle durch Handlung und Experiment. Ihre stabilisierenden Faktoren sind Besitz und Wissen, als Eindeutigkeit von Bedeutung/Wert in fluider Organisation. Wenn die eindeutigen Zeichen und Wunder heute technischer Natur sind, müssen wir uns die Frage nach dem Aufklärungswert dessen, was als Theatermedium konventionalisiert worden ist, neu in Bezug auf die neuen Medien stellen. als auch zu Darwin durch seinen Vater durchaus engster Natur war, stellt Ludwig Jäger dar. Ders.: Ferdinand de Saussure zur Einführung. Hamburg 2010, S.27ff.
61
62
4. VORLESUNG
Hier sind die absperrende Wirkung zwischen Technik und Körper, ihr gegenseitiger Überbietungszwang an Identität und Identifizierung sowie ihre gesellschaftliche und individuelle Symptomatik nach rückstandsfreier Produktion entscheidend. Ein spezifisches Merkmal der neuen, der Echtzeitmedien ist nicht nur, dass sie in ihrer elektronischen Substanz und in ihrem elektromagnetischen Prozessieren nicht nur jedem Kaliber menschlicher Sinneserfassung entglitten sind und einer Ästhetik des Effekts und Affekts Vorschub leisten, sondern, dass sie sich unabhängig machen vom diachronen Prozedieren und der Idee einer linearen Narrativität und Zeitvorstellung. Was weder linear, kausal, noch durch Autorität oder Konvention abgeleitet werden kann und mit Hilfe unklarer Begriffe von „Vergesellschaftung“ ge- und erläutert wird, verstrickt sich in Zirkeln oder Schleifen oder rettet sich in Strukturen metaphysischer Seinshaftigkeit. Je enger diese Zirkel sind, desto notwendiger ist es, von tendenziösen Präsenzgesellschaften zu sprechen, die weder Raum noch Zeit haben, um ihre Handlungen zu bedenken, weil sie die Präsenz als Grenze der Ökonomie und nicht als szenische Freiheit verstehen, die dauern kann – die sich, ganz unmetaphorisch gesprochen, die Zeit nimmt, die sich ihr gibt. Die ökonomische Gesellschaft aber ist einem Mythos der absoluten Grenze aufgesessen, die keine Zweiseitenform, sondern ein Nullpunkt ist. Und just in dieser Gesellschaft kommt die Frage auf, ob wir denn tatsächlich anders können, als magisch zu handeln – und wenn ja, welcher Produktion denn etwa eine „Reflexionsgesellschaft“ verpflichtet ist? Sartres ambivalenter Begriff der Freiheit, den Luhmann problematisiert, ist dieser Frage nachgegangen, um den Prozess des (Miss-)Verstehens für eine anfängliche Situierung von Raum und Zeit zu klären, die keinesfalls Kategorien a priori sind, wie uns Kant zu glauben empfohlen hat, sondern Normvorstellungen, die aus den sinnlichen Dauern abgeleitet sind. Wir schlagen vor, auf der Grundlage einer Konzeption von historischem Sinnverstehen – mittels einer Methode, die Sartre „regressiv-progressiv“ genannt hat – von der Topologie der Zeichen (wieder) auf eine Chronologie von (Re-)Szenifikationen zu wechseln. Was macht eine Szene zur Szene, was setzt einen Zeitdauer von einer anderen ab, was ist das „Element“ der Zeit? Diese Fragen führen zu der Hypothese, dass jedes Zeichen ein Negat seiner sinnlichen Erscheinung als Zeit darstellt, nämlich die Form seiner Präsenz. Von Heidegger wollen wir dabei eine Grundmetapher einführen, die dieser an Kants Zeittheorie herausgearbeitet hat: Dass Zeit und Einbildungkraft, d.h Vorstellung und Szenifikation äquivalent seien101 – äquivalent im Sinne ihrer sinnlichen Negation. Beide lassen sich nämlich nur willkürlich in Elemente zerlegen, sind folglich „natürliche“ Medien oder Aggregate. Um Vorstellungen zu „verstehen“, müssen sie (wie Träume) in Sprache übersetzt, also segmentiert werden. Als individuelle Sequenzen können sie relativ zu einer konventionalisierten Form in einer vor- und zurücklaufenden Annäherung, in der Gegenwart als Bedeutung festgehalten werden. Aus flüchtigen Vorstellungen werden beständige Bedeutungen und dauernde Dinge – so Sartres Transposition von primärer in sekundäre und tertiäre 101 Martin Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik. Frankfurt am Main 1973, S.181: „Die transzendentale Einbildungskraft ist die ursprüngliche Zeit.“
4. VORLESUNG
Produktion. Die Bedeutung ist zunächst als Präsenzform flüchtig, so wie Sprechen flüchtig ist. Um zu dauern, muss sie sich realisieren. Als verdinglichtes Produkt kann sie dauern, als Dauer repräsentiert sie das Subjekt selbst, dass das Produkt der Repräsentation seiner Dauern, d.h. seiner Präsenzen oder „Bewusstseinsakte“ ist, d.h. der Verinnerlichung (Faltung) der veräußerlichten Äußerung. Bewusstsein und Präsenz sind Modifikationen von Negationen. Ein radikale Trennung von Vorstellung und Verdinglichung muss ebensowenig angenommen werden, wie die Existenz eines völlig vom Signifikat unabhängigen Signifikanten. Für diese zweiseitige Identität von Ding- und Selbstbewusstsein braucht Sartre den Begriff der Existenz. Wir existieren, solange wir produzieren, etwas auf wahrnehmbare Weise in die Welt setzen: „Was ist die Signifikanz? Der Sinn, insofern er sinnlich hervorgebracht wird.“102 Ein auffälliges Detail in der Biografie von Saussure, das erst nach den als Cours de linguistique générale erschienenen Texten bekannt wurde, war seine „Graphophobie“103, die ihn nach der Rückkehr aus Paris, wo er große Erfolge und Anerkennung genoss, schon in jungen Jahren in seiner relativen Isolation in Genf überfiel. Sie scheint mir den Kern der Idee von Sprache als System und Sprechen als individuellem Akt zu kennzeichnen. Saussure begann als Komparatist indogermanischer Sprachen und kam dort früh zu Ruhm. Seine kritischen Einlassungen gegenüber den Philologen seiner Zeit betrafen den Umstand, dass sie sich wenig mit der Sprache unter philosophischem Gesichtspunkt beschäftigten. Saussure wollte erst den ganzen Gegenstand erfassen, um dann an ihm die Details seiner Anwendung zu messen: vom System zum Zeichen, vom Allgemeinen zum Individuellen. Er sah aber ein, dass das Phänomen Sprache gleichzeitig prozessiert: Jedes Wort ist zugleich die ganze Sprache, so wie jeder Transaktionsakt an der Börse den Wert des ganzen Geldes verändert. Saussures Schreibphobie war wohl dem Umstand geschuldet, dass sich Schrift diachron produziert und Simultaneität blockiert. Schreiben schreibt sich selbst nicht auf. Hätte er erkannt, dass gerade die Gleichzeitigkeit der Modifikation von Sprechen (Schreiben) und Sprache die Präsenz eines Begehrens zur Bedeutsamkeit hervorruft, nämlich den Ursprung zur Entfaltung und Erhaltung und Wiederholung einer Dauer (Aufzeichnen, Wiedergeben, Speichern) als Aufschub erfüllt, wäre er vielleicht eher graphophil geworden. Denn Erfüllung als Aufschub, das ist genau die Wiederholung als Paradoxon, wie sie die Szene (und die Graphophobie) artikuliert. Aber wie will man die Sprache wissenschaftlich verstehen, wenn sie unter der Hand nur in situative Anwendungen zerfällt? Szenisches Schreiben hieß in der Selbstblockade Saussures, in der Anekdote und in Tagebuchnotizen stecken zu bleiben. Seltsamerweise kam er damit dem linkischen Schreibprinzip von Peirce nahe, wie wir noch lesen werden. Das Stottern beider sind Erklärung dessen, was im Zeichenhaushalt vor sich geht, wenn man nicht dem Druck unterliegt, die Simultaneität des Prozessierens einer mathematischen Logik zu überantworten, die Schreiben, Lesen, Rechnen in 102
Roland Barthes: Die Lust am Text. Frankfurt am Main 1982, S.90.
103 Jäger, Ferdinand de Saussure, a.a.O., S.65. Vgl. auch Samuel Weber: Das linke Zeichen. Zur Semio-
logie Saussures und Peirces. In: Fugen: deutsch-französisches Jahrbuch für Text-Analytik 1980. Olten 1980, S.43-63, hier S.43 ff. Weber geht insbesondere auf die „linkische“ Schreibweise von Peirce ein.
63
64
4. VORLESUNG
so hoher Geschwindigkeit bewältigt, dass es nicht auffällt, wenn sie sich linear-horizontal in die Taktfrequenz einschreibt. Auch hier also die Überlistung des menschlichen Sinnes – oder die Neukalibrierung des Menschlichen. Die Sprache: das ist eine phantasmatische Synthese die vorausgesetzt werden muss, damit der Sinn nicht zerfällt. Ihre Analyse, das zeigt die Schreibphobie symptomatisch, eliminiert den Gegenstand, den sie zur Behandlung sich vorlegt. Peirce wie Saussure hätten vielleicht von dem ersten Versuch des universalisierenden Schreibens in Europa, von Cervantes Don Quichotte lernen können, dass man ein Leben in seiner Ganzheit nur in Episoden beschreiben kann. Mit den Paradoxien dieser Unmöglichkeit kann der Roman sich dann allerdings unendlich auseinandersetzen. Unter dieser paradoxen Einsicht hat die Semiotik nach Saussure versucht, jedem singulären Sprechakt einen eigenen Begriff zuzuordnen. Schon die Arten der Zeichen werden durch eine undurchschaubare Taxonomie der Terminologisierung, Tabellen und Übersetzungen differenziert, die eine Karte 1:1 vom Land der Sprache nachzeichnen will. Wo aber ist der Standpunkt, von dem man auf dieses Land blickt? Dass man weder auf Gottesperspektiven noch auf die Lösungen von Paradoxa setzen soll, hat die Mythologie und die Pragmatik der Systemtheorie gezeigt. In Bezug auf die Produktivität von Sprache hat man sich vom differentiellen Identitätsausweis naturwissenschaftlicher Forschung zu lösen. Schon Dilthey hat zwischen Erklären und Verstehen prinzipielle Unterschiede ausgemacht. Sprachen sind situative Wertsysteme, Wissenschaften normative mit situativer Invarianz. In der Tat bleibt das mediale Manko bestehen, mit der Sprache Sprache beschreiben zu wollen. Das geht nicht mittels Schweigen. Sartre hat im Gefolge der Romantiker, sowie Husserls und Heideggers parallel und in Anfeindung zu den strukturalistischen Initiativen, die verschollene Idee aufgegriffen, die Zeit selbst als Negation, als Bruch einer Modifikation zu unterziehen, durch die die vorgeblich synchrone Linearität des Lesens durch ein Vor- und Zurück der Modalitäten „Zukunft“ (totalisierender Entwurf des Ganzen) und „Vergangenheit“ (Synthese der elementaren Erinnerungen) Sinn und somit Sinn für ein Subjekt entbindet; Sinn als Bewusstheit seiner Zeitlichkeit und des Entkommens aus der physikalischen Unerbittlichkeit der Jetztzeit. Dies geschieht als Existenz. Hierzu braucht es weder das Reservoir eines Wunsches, noch das eines Begehrens. Die Not des Bedeutens ist gekoppelt an die Relativität der Dauer. Über Sprache nachzudenken heißt immer, über die menschliche Gesellschaft und die menschliche Individualität nachzudenken. In der unvermittelten Dramatik dessen, was an Möglichkeiten, d.h. Strategemen Wirklichkeit werden – also kreiert werden kann und soll – zwischen Leib und Ding, steht die Präsenz als eine Negation – Aufhebung, wie Hegel sagt, die Zeit, in der Dinge gleichzeitig dauern. Um Präsenz selbst eine Dauer zu verleihen, – den Konflikt zwischen situativer Affektivität einer Präsenzgesellschaft und einer sich die Gleichzeitigkeit der Vorgänge reflexiv abarbeitenden szenischen Gesellschaft zu veranschaulichen – ist der Mythos, das Theater und schließlich das gegenwärtige Medienspiel und das Spiel der Simulationen da. Hier soll der Normativitätszwang von Evidenzen und Überschlagshandlungen auf die Probe gestellt und nachvollzogen werden, und zwar für eine begrenzte Dauer einer Aufführung, eines Spiels.
4. VORLESUNG
Wenn wir uns in der Analyse auf eine szenische Entfaltung von Präsenz einlassen, dann können wir das nur vor dem Hintergrund einer idealisierten Trennung der beiden Handlungsmuster und ihrer jeweiligen historischen und situativen Produktivität, der Trennung von informationeller Identität und kommunikativer Differenz. Wenn Echtzeitmedien rund um die Uhr präsent sind, ist es eine Binsenweisheit zu sagen, dass Reflexion ihrem Gegenstand stets hinterherläuft. Aber zuweilen, etwa im Genre des Science Fiktion, ja in Literatur überhaupt, nimmt sie sich die Freiheit, über die Produktionen der Technik hinweg Welten zu entwerfen, die als mögliche Zukunft erscheinen. Solche Entwürfe bleiben durch das Individuum autorisierte Einzelfälle. Doch die Münze des Wortes kann auch den Wert des Geldes insgesamt beeinflussen. Das weiß die Börse nur zu gut, die im eigentlichen Sinne von den Worten der Hoffnung lebt. Schon Napoleon wusste den Chappé-Telegrafen zu Börsenspekulationen wie zu strategischen Operationen einzusetzen. Dumas Roman Der Graf von Monte Christo zeigt dies in einer seiner eindrücklichsten Episoden. Der Graf, dem die Zeit durch seine unschuldige Haft im Château d‘If abhanden gekommen ist, versucht sich mittels des Telegrafen an der Zukunft seiner Widersacher zu vergreifen, indem er deren kreditierte Börsenspekulation zu seinem Vorteil nutzt. Mit Rache lässt sich Zeit nicht zurückkaufen. Man kann sie aber überlisten: dazu ist das Spiel gedacht. Die Frage nach dem Subjekt als Akteur ist unzweifelhaft an die Frage nach der Repräsentanz von Bewusstsein und Selbstbewusstsein geknüpft, also an die der Gedächtniskonvention. Wenn das Individuum in eine Welt tritt, die immer schon da und geordnet ist, muss es sich als Effekt der Anderen begreifen, die vor ihm sind. Wenn es aber begreift, dass auch der Andere nicht im Besitz der Kompetenz der Weltdeutung ist – wenn es, wie Lacan das formuliert, beim Anderen sucht, was dieser selbst nicht hat – sind Streitfiguren der Herrschaft und auch die der Zeichen nicht universell, sondern situativ, immerhin aber auch strategisch zu entscheiden.
65
5. VORLESUNG Warentausch als Zeichentausch – Das Paradox, die technische Überschreitung der Sinne in einen für die Sinne zugänglichen Sinn zu übersetzen – Die Frage nach dem Menschen, dem Humanismus und der Anthropogenität der natürlichen Sinnesleistungen – Phantasie und Traumproduktion – Kurzfassung der Semiologie – Die Szene ist sowohl wiederholbar als auch revidierbar; sie lässt eine Wahl/ein Zögern bedeutsam werden – Die Szene befreit vom Präsenzopfer – Warum ist Verständigung trotz aller Unterschiede möglich? – Mandelbrot: Bedeutung als approximative Funktion zwischen Maßstab und Wert
In dieser Situation, die die Frage nach der Situierung eines Präsenzfeldes als Ereignisfeld philosophisch thematisiert, die also die Szene an Stelle des Ereignisses setzt und so das Ereignis in einer Szene sichert und verwahrt, es wiederholbar macht, gilt es, sich von einem Idealismus des Verstehens abzuwenden und Bewusstsein als Präsenz zu verstehen. Was meinen wir, wenn wir versuchen, aus dem konventionellen Korpus der Theorien statt der Ordnung der Zeichen ein simultanes Praxisfeld zu beschreiben, in dem die Selbsteinholung dessen, was vorausgeht – was vom Anderen uns angeboten wird – als „inszeniert“ zu begreifen ist? Jemand konstruiert eine Geschichte für einen Anderen: er inszeniert, er kommt aus der Zukunft eines Anspruchs. In diesem Sinne besetzt die Szene, nimmt vorweg und realisiert Zukunft als Möglichkeit. Unter der Prämisse der Eröffnung von Freiheit ist das Zeichen ein Effekt seiner Verschiebung auf potentielle Erfüllung (Äquivalenz von Zukunft und Vergangenheit). Die Verschiebung konstituiert das freie, leere Feld der Gegenwart unter wechselnden Situationen als bedeutbar und relativ stabil. Dass die Gegenwart nach beiden Seiten stabilisierend wirkt, ist die paradoxe Erkenntnis des poststrukturalistischen Geschichtsbegriff. Die die Gabe der Zeit bewahrt so die kulturelle und anthropologische Konstanz der Veränderung. Von den elementaren Relationen der Gabe, des Austausch und der Verpflichtung (Identität und Differenz, Reziprozität) sind die Geistes-, Kultur- oder Humanwissenschaften jetzt insgesamt durchdrungen. Vom Zeichen in dieser Weise zu sprechen heißt – und hieß aber auch – seine politische und ideologische Komponente zu betonen, wie wir mit Kristeva erkannt haben. Es gibt keine Neutralität des Zeichens. Gerade Peirce’ Ansatzpunkt war der, nach einer Überschreitung der kantischen Positionen zu suchen, wonach die Mathematik und die Physik Raum und Zeit als Apriori setzen. Bezüglich des Raumes machte zuerst der Feldbegriff, bezüglich der Zeit der Heidegger’sche Gedanke der Zeitlichkeit und der Verzeitlichung abgeleitet aus dem Vorstellungsbegriff (Entwurf ) Kants Karriere. Heidegger hat vom gleichen Paradigmenwechsel der Relationalität profitiert wie Einstein. Wenn man die (Licht-) Geschwindigkeit als Signifikat setzt, lassen sich Raum und Zeit als Anschauungsmodi relativieren. Wählt man als Medium den kontinuierlichen Modus der Hervorbringung von Vorstellung, transzendentale Einbildungskraft im kantischen Sinne, werden Bewusstsein und Anschauung relativiert: als Gegenwart und als Praxis des
68
5. VORLESUNG
Daseins, als Existenz – als lebendige, von der Kosmologie unabhängige Zeit, die sich in Szenen rhythmisiert. Diese paradigmatische Verschiebung genügt, um sich von den klassischen Dichotymien der Reflexion, die an sich zeitlos sein soll, zu befreien und die einfache Repräsentanz des Signifikanten und des Signifikat als kindliche Illusion abzulehnen. Das war der Ausgangspunkt Saussures. Wie man seit einiger Zeit weiß, ging es Saussure – entgegen der konventionellen Lesart der Cours – gerade nicht darum, die Strukturen im idealistischen Sinne zu verdichten und zu stabilisieren, sondern, an Humboldt und Schleiermacher geschult, die Möglichkeit der Variabilität des Sprachmodells aufzuzeigen. Dabei muss sprachliche Kommunikation, um realisiert, also produziert zu werden, in dezidierten Situationen von Individuen nicht auf ihre Äquivalenzleistung, sondern auf ihre Freiheit zur Individualität hin befragt werden. Was erlaubt es, in jeder beliebigen Situation durch jedes beliebige Individuum hindurch gesprochen und verstanden zu werden? Das ist natürlich die Ansprache des Sprechenden selbst, die ein Hören oder ein Zuhören104 verlangt. Eine Ansprache trägt sich weiter, von „Verstehen“ ist zunächst gar nicht die Rede, sondern von einem strukturellen Mangel. Mit dem romantischen Theorem der Divination105 war es möglich, das Produktionssystem „Sprache“ als Moment prozessierender Arbeit, vom freien Parlieren bis zum konkreten Verstehen, als einen Prozess erfindungsreicher Pragmatik zu begreifen, ganz in dem Sinne, in dem Kinder Sprachen lernen: Sie plappern drauflos. Die Bedeutung der Zeichen ist durch die Pragmatik der Reziprozität (der Geltung des jeweils Anderen) konventionalisiert, aber sie bedarf auch der spontanen Entwurfsanpassung einer Relation von Differenz, sprich von Vergangenheit und Zukunft (Herstellen gesicherter Ordnung und Archivierung/Gedächtnis, d.h. Erfüllung des Anderen), gerade weil das Sprechen nur eine Sprache hat, es aber eben auch die Sprache der Dinge und der normierten Formen (Regeln, Gesetze, Normen, Tabus, Techniken) gibt. Das Zeichen wird dabei als universale Form des Prozesses der Weitergabe, nicht der Vermittlung verstanden. Es wird vom Wunsch nach Verständigung aus gedacht, also vom Ideologem der Vernunft. Wir haben es nicht nur mit einem Gebrauch oder einer Identifizierung, sondern mit der ständigen Bildung von Zeichen in unterschiedlichen triadischen Relationen zu tun. Zeichen sind Manifestationen der Gesellschaft und sie sind dies nicht auf die Weise der Formierung von wissenschaftlich exakten Systemen, sondern in der Praxis ihres „unbewussten“ – d.h. nicht auf Selbstkonstitution hin befragten Gebrauchs. Die Technisierung dieser Gebrauchse104 Barthes Auffassung ist dialogisch. Er unterscheidet z.B. drei Phasen des Zuhörens: den „Alarm“, das „Entziffern“ und die Erschließung eines „intersubjektiven Raum[s], [...] in dem ‚Ich höre zu‘ auch heißt ‚höre mir zu‘; was es erfaßt, um es zu verwandeln und endlos in das Spiel der Übertragung einzubringen, ist eine allgemeine ‚Signifikanz‘, die ohne die Bestimmmung des Unbewußten nicht mehr denkbar ist.“ Roland Barthes: Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn. Kritische Essays Bd.III. Frankfurt am Main 1990, S.249. 105 Wenn unter „Divination“ die „Sehergabe“ der „Weissagung“ und „Zukunftsdeutung“ gemeint war, wie sie Freud für die Interpretation des Traum ablehnt, so meint der Begriff heute „Erfindung“, im produktiven Sinne eines sich in die Zukunft vorgreifenden Entwurfs, also das, was Sartre unter dem „Entwurfsakt“ seiner hermeneutischen Methode versteht. Im Kern geht es in der Bedeutungsfindung also immer um einen nicht an die Materialität des Zeichens gebundene Aufforderung nach Kontinuierung der Zeit als realisierte (oder zu realisierende) Gegenwart aus dem Möglichkeitshorizont.
5. VORLESUNG
bene nennt man Medialisierung. Medien unterscheiden sich wie Nationalsprachen durch Codierungen. Sie sind zunächst Anweisungen des Gebrauchs – nicht Dinge zum Gebrauch, auch wenn sie sich heute als Ware, über die zu handeln ist, anbieten. Aufgrund des Vorrangs der Praxis, also der technischen Gebrauchsvorgaben der Dinge, der Medien, deren Codierung wir fast nur noch über Displays, also Szenifikationen entschlüsseln können, habe ich mir vorgenommen, die übliche wissenschaftshistorische Darstellung der Zeichen, wie sie in einer ganzen Reihe von Publikationen auch für den Umgang des Gestalters produziert wird, anders anzuordnen, auch wenn das den sowieso schon heterogenen Zustand der Begriffsbildung in Bereichen der Linguistik, der Anthropologie, der Philosophie, der Literatur- und Theaterwissenschaften, der Semiotik und Medienwissenschaften etc. nicht entspricht. Ich versuche nicht, eine Geschichte zu reproduzieren, sondern an wenigen Merkmalen zu verstehen, wie sich die Geschichte der Semiotik zunächst auf die Struktur und Identität verengt hat, um dann in Folge der Differenzierung der technischen Sprachen der Medien sich auf den situativen Wechsel von Medien (Codes) zu erweitern. Als Sprache wird man heute alle relationalen Produktionssysteme begreifen, die die Tendenz zur abschließenden Aufschließung als Selbststeuerung simultan vollziehen. Da wir diese Darstellung unter dem dominanten System des Warentauschs als Zeichentausch machen, besteht kein Grund, eine solche allgemeine Relationalität einer bestimmten Wissenschaft zuzuordnen. Die historische Verschiebung der Semiologie ist ein offener Verweis: Von der Zeichensetzung – einem Akt der Herrschaft, der Körpertechniken und Wissen verbindet und konserviert – bis zur Bildung einer Szene, dem dialogischen Tauschangebot der Interpretation oder möglichen Anwendung, muss ein Prozess greifen, der die immer abstraktere, komplexere technologische Pragmatik (Ausdifferenzierung der Technik) mit den menschlichen Sinnen verbindet, die es gewohnt sind, im Rhythmus einer Zeitlichkeit zu leben, zu handeln und ganz einfach Sinn als den Narzissmus ihrer Selbst zu involutieren. Sie sind sich selbst die Anderen. Wir stehen vor dem Paradox, dass die technische Überschreitung der Sinne in einen für die Sinne zugänglichen Sinn übersetzt werden muss, ohne dass die Übersetzungsopfer identifizierbar werden. Es stellt sich die Frage nach der Synthese oder Identitätsbildung von Sinn und Sinnlichkeit, die Frage nach der Selektion. Wenn diese Synthesen nicht mehr in der Gesellschaft ausgebildet werden können, bilden sie sich am Körper als Symptome, die auf die Diagnose einer zunehmenden Präsenzwelt mit der Totalisierung im Körper antworten und damit als Designüberbietungen zu verstehen sind: Hautaffektionen, Allergien, Zwänge und Ängste sind Zeichen, die das, was sie bezeichnen, zugleich verschließen wollen, und die der Übersetzung und Übertragung dessen was keinen Ursprung, aber eine Urszene hat, hat ihre eigene Verschließung/Gebrauchssperre als Pathologiemoment entgegensetzen. Die inzestuöse, zugleich dementierende Verweisung auf sich selbst steht unter der Strafe des Symptoms. Nun steht der Leser dieses Buches (eher noch als der Hörer der performativ affirmierenden Vorlesungen) vor dem Dilemma, erstens eine historische Entwicklung „objektiv“ dargestellt zu bekommen, sie aber gleichzeitig „subjektiv“ unter der Prämisse der „notwendigen“, aber beschränkten (Re-)Szenifikation komplexer Situationen dechiffrieren zu müssen. Handelt es sich bei der Nacherzählung einer The-
69
70
5. VORLESUNG
oriebildung um einen fiktionalen oder um einen nicht-fiktionalen Vorgang? D.h., muss man die „Geschichte der Semiotik“ als unwägbaren Moment ihrer Freiheit im Akt nicht inszenieren, um der symptomatische Rede zu entgehen? Wir könnten uns beispielsweise mit dem Theater der Situation Sartres beschäftigen. Das Problem der Selbstinszenierung hatten die Semiotiker im Blick, als sie die Frage stellten, wie mit Zeichen über Zeichen zu handeln sei, wenn diese selbst nur in Verwandtschaft von raumzeitlichen Ereignissen (Geschichte, Politik, Wissenschaft, Kunst etc.) zur Bedeutung kommen. Es ging Anfang der 1960er Jahre also um die Besetzung akademischer Positionen, um das Recht, im „Namen von“ zu sprechen, und eben dieses Recht zu kritisieren, wie es die Gruppe Tel Quel etwa szenisch tat. Wenn es keine Autonomie des Zeichenprozesses innerhalb des Gesellschaftsprozesses gibt (nicht einmal den desemantisierten der Mathematik106), kann man das Unternehmen der Reinszenierung auf Probe nur als eine Art metaphorisch-poetischer Begleitung durchführen. Entgegen dem Wunsch nach Reszenifikation muss eine Resituierung versucht werden. Auch der „Mai 68“ hat spät begriffen, dass es nicht um die Übernahme der Macht, sondern um die Ersetzung der Macht durch die Phantasie ging – nicht überall und durchweg, sondern an strategischen Orten: auf der Straße und nicht im Theater. Die weit ausholende These ist die folgende: Im historischen Augenblick der Diversifizierung der Sprachen der Kultur und der Natur, der insbesondere von den Humboldts exemplarisch beansprucht wird, beginnt man sich für die Sprachlichkeit im Allgemeinen, für eine Universalsprache zu interessieren, deren Element nicht das Wort, sondern das Zeichen – nicht der Satz, sondern die Struktur, die Logik, die Vernunft ist. Eben jetzt bemerkt man auch, dass man die Sprachen künstlich (elektrisch, etwa im Morseapparat) erzeugen kann, und fragt retrospektiv nach dem Ursprung der „natürlichen Sprache“.107 Man ist gezwungen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Wenn die Sprachen aus Verweisungen bestehen, in der das eine Glied durch das andere substituiert wird (durch die Buchstaben hindurch erscheinen die Vorstellungsbilder etc.), sind dann nicht alle Sprachen mehr oder weniger magische und verführerische Überschreitungen der Sinnesleistungen – was dann am deutlichsten in der Synthese der Einzelbilder durch den Film und dessen frühe Vorformen zum Ausdruck kommt? Muss man nun – mehrere Schritte zurück – ebenfalls die Frage nach der historischen Substanz des Zeichens als Zeichen stellen, d.h. nach der Situation, in der ein Zeichen über seine Verzeitlichung als „Konvention“ Auskunft geben kann? Genau das aber wäre die Ausgangssituation der Frage nach der Historizität der Semiose. Und es ist der Ausgangspunkt der Frage nach dem Menschen, dem Humanismus und der Anthropogenität der „natürlichen Sinnesleistungen“, die der Existenzialismus der Objektivität des Zeichens gegenüberstellt. Zwei dieser Punkte wollen wir später sprechen lassen: die der Sartre’schen Existentialhermeneutik und die der Luhmann’schen 106 Vgl. Ralf Bohn: Zahl, Zeichen, Zeit ... Die Geburt des Designs aus dem Geist der Mathematik. In:
Christoph Weismüller (Hg.): Fragen nach der Mathematik. Düsseldorf 2007, S.26-67. Das wichtigste Zeugnis dieser Preisfragen nach dem Ursprung der Sprache stammt von Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache (Stuttgart 1981) aus dem Jahre 1772. Herder bezeichnet die menschliche Sprache gegenüber der Sprache der Tiere schon als „künstlich“, leitet sie auch von diesen, und nicht nach biblischer Auslegung von Gott ab. 107
5. VORLESUNG
Systemtheorie. Einen dritten Punkt, die Frage des Humanismus betreffend, werden wir nur streifen. Es ist ein Zeichen der Konjunktur von „Inszenierungen“ aller Orten, dass die elementare Sprache von Medien, Informatik und Elektronik jedem Laien versperrt ist und ihm durch Inszenierung „Rückversinnlichung“ übersetzt/bedeutet werden muss. Sollen die Codes der technischen Sprachen in das Feld der allgemeinen Praxis Einzug finden, sind nicht nur Übertragungen in Zeichen und Formen, sondern Szenifikationen auf der Ebene sinnlicher Unmittelbarkeit notwendig. Die Dinge dürfen nicht nur bedeuten, sie müssen zugleich auch ihren instrumentellen Nutzen demonstrieren und erzählen, d.h. ihre semantische Referenz als Gebrauchsanweisung mitliefern. Nicht mehr der Bedeutungsbezug, sondern der Anwendungsbezug von Zeichen steht im Vordergrund. Dass die Zeichen nicht nur kombiniert, sondern auch produziert werden, ist im instrumentellen Bezug zu den Zeichenmaschinen selbst nicht mehr erfahrbar. Nur so ist zu erklären, warum die Pragmatik der Performanz/Performativität erst relativ spät Einzug in die Überlegungen der Semiotiken gehalten hat, gleichwohl ihr funktionaler Wert (die Zeitlichkeit als prozessierendes Zeichen) schon beispielsweise von Freud erkannt worden war. Erst im Handel mit vornehmlich ikonischen Zeichen lassen sich Gleichzeitigkeiten ökonomisch tauschen. Bedeutung wird nicht mehr referiert, sie wird funktional demonstriert. Nicht mehr die Elemente der Relationsbeziehungen, sondern die Funktionswerte müssen in Beispielhandlungen dargestellt werden. Damit wird aber die konsumistische Variante des Zeichenverkehrs deutlich: Ein Zeichen zu setzen heißt, eine Gebrauchsanweisung vorzuschreiben. Eine Inszenierung darzubieten heißt, jemand Anderen glauben zu machen, er sei selbst derjenige, der das Zeichen herbeigerufen hat. In beiden Fällen handelt es sich um eine Verführung, also um den Tausch von Ich und Anderem. Nicht die Verführung ist das Kernthema der Konsumgesellschaft, denn die Verführung findet immer schon zwischen der Mutter und dem Kleinkind statt, sondern ihre Involution im Zeichen, das sich als objektiver Sachverhalt gibt. Siehe, hier ist das Angebot: konsumiere! – das ist etwas völlig anderes, als der Initialsatz der Systemtheorie vorgibt: „Mache [produziere] eine Unterscheidung!“ Wir werden darauf zurückkommen. Die didaktische Arbeit wird dadurch erschwert, dass die Designlehren heute nicht einmal ein basales Wissen von den Zeichenrelationen und den Bedeutungsanweisungen lehren – wie vielleicht vor fünfzig Jahren noch, etwa in der Ulmer Schule, als die Semiotik ideologiekritischen Charakter hatte. Inzwischen sind einige teils aufbauende und konkurrierende Methoden und Theorien der Erstellung von Erzählungszuweisungen und Bedeutungsanweisungen auf dem Markt, die sich nicht mehr als ideologiekritisch, sondern als dezidiert ideologisch verstehen, den Begriff „Ideologie“ aber im Sinne eines diskursiven „Paradigmas“ verwenden: die Linguistik, der Strukturalismus, die Kritische Theorie, die Semiologie, die Diskursanalyse, der Poststrukturalismus, die Systemtheorie, die Actor-Network-Theory von Pierre Bourdieu, Bruno Latour usw. – und nicht zuletzt unser eher ironischer Anspruch, eine Ordnung der Inszenierung als „Szenologie“ zu fundieren. Allen diesen historisch und analytisch nie klar zu trennenden Diskursfeldern, die zwischen philosophischer Darstellung und wissenschaftlicher Exaktheit schwanken, ist eigen, dass sie eine
71
72
5. VORLESUNG
funktionelle Unterscheidung an den Anfang ihrer Bemühungen setzen: eine Differenz zur Allgegenwart von Anwesenheit, der vorgeblich die „ursprüngliche Identität“ abhanden gekommen ist und die nun wieder mit medientechnischen Gadgets vermittelt werden muss. Solche Heimat- und Naturphantasien der Versöhnung protegieren den Wunsch nach Beständigkeit und Dauer. Aber selbstverständlich wird man das Problem nicht durch Identitätsbildung lösen, sondern nur durch weitere Differenzierung umgehen, d.h. in Unendlichkeit und Militanz verschieben und aufschieben können. Aber der Effekt der Identität stellt sich als programmatischer Entwurf einer Arbeit Gleichgesinnter am gleichen Problem ein: Gesellschaft oder Vergemeinschaftung ist das Kultivierungsergebnis einer durch Phantasmatik begründeten Forschertätigkeit – wie auch immer dieser Forscher sich im „Elfenbeintum“108 zu isolieren wünscht. Das Ergebnis der Forschung kann nur wieder durch eine allgemein anerkannte Form akzeptiert werden. Und hier wäre tatsächlich einmal nach der Funktion des romantischen Begriffs „Phantasie“ zu fragen: Was heißt, sich eine nicht hier und jetzt anwesende Sache sinnlich vorstellen zu können – ein Signifikat produzieren zu können? Wir werden auf das Problem der Traumproduktion und die Labilität des Begehrens verweisen, auf das uns Kristeva aufmerksam gemacht hat. Zunächst sind die Verweisungsmöglichkeiten des Zeichens einfach. Zeichnen wir eine Kurzfassung einer Semiologie: Nicht der Referenzbezug, sondern der Aufschub der Identität sind die Voraussetzungen, dass sich differentielle Systeme stabilisieren, die mit den Merkmalen „anwesend (Problem)/nicht-anwesend (Lösung)“ spielen können. Dabei ist die Ersetzung, Substitution oder Verdrängung des „Ursprünglichen“ durch das performativ Folgende durch drei Wesensunterschiede gekennzeichnet: Entweder das Eine ist dem Anderen ähnlich (z.B. eine Umrisszeichnung eines abwesenden Gegenstandes); das Eine ersetzt das Ganze nur zum Teil (die Hörner bedeuten das signifikanten Merkmal des Widders); oder der Gegenstand, der auf den anderen verweist, ist gänzlich unähnlich (z.B. ein Kreuz bedeutet die Stelle, wo das Wild zu finden ist). Die erste Ersetzung heißt „Metapher“, die zweite „Metonymie“; die Gegenstände, auf die gedeutet wird, können mehr oder weniger erraten werden. Im dritten Fall genügt das Erraten nicht, man muss wissen. Die Arbitrarität des Wissensvollzugs sichert die Abwehr des phantasmatischen Ursprungs und des finalen Telos. Wissen muss durch Konvention festgelegt werden. Ob eine Jagdstelle durch ein Kreuz oder einen Kreis bezeichnet wird, muss in der Gemeinschaft verabredet werden: entweder durch Herrschaftsspruch oder durch Abstimmung. Die Art der Konventionen können dabei natürlich nicht wieder durch Konvention festgelegt sein: Hier ist sinnliche Präsenz (Ritualisierung, Szenifizierung) notwendig. An den Konventionen hat in der Regel nur Anteil, wer der entsprechenden Gemeinschaft angehört: Nur die Wissenden wissen. Gesprochene Sprache ist in diesem Sinn von Saussure als arbiträr bestimmt worden: d.h., die Laute haben keinerlei Ähnlichkeit mit den Objekten, die sie bezeichnen. Mit ihnen braucht auch nicht gesagt werden, 108 Jochen Hörisch: Die Wut des Verstehens. Frankfurt am Main 1998, S.45. Die Metapher „Elfenbeinturm“ bezieht sich auf den anagogischen Sinn der weißen Halskrause der mittelalterlichen Doktoren. Hörisch nimmt die Wirrungen dieser Metapher als Beispiel für die Unberechenbarkeit hermeneutischer Analogien.
5. VORLESUNG
dass sie etwas anderes meinen, als sich selbst. Gerade aber weil die Selbstreferenz hier ausgeschlossen wird, kann es zu einer Ausdifferenzierung zwischen dem Gesprochenen und dem Sprecher kommen, womit der Sprecher zum Medium der Sprache wird, für das man den Begriff „Subjekt“ nutzt. Das Subjekt (das der Alphabetisierung unterliegende/substituierte) ist das, was durch die Sprache hindurch erscheint, es ist sozusagen der Anwendungseffekt. So kann man sich vorzüglich darüber streiten, ob die Sprachfähigkeit die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft garantiert oder die Vergemeinschaftung die Sprache hervorbringt. Jedenfalls steht die Anerkennung des Anderen, die reziproke Verführung, vor der Autarkisierung und Autonomisierung. Die Individualität ist kein Gegensatz zur Allgemeinheit, sondern sie ist in ihr produktiv eingefaltet. Zwischen den Elementen, die bedeuten, und denen, auf die gedeutet werden soll, gibt es kombinatorische Beziehungen jeder Art: Ein Zeichen, also eine Bedeutungsrelation oder Semiose, kann auf sich selbst, auf andere Zeichen, auf Ähnlichkeiten oder auf ähnliche Kombinationen oder Codierungen verweisen. Der Grad der Codierung (Nähe-Ferne; Ähnlichkeit/Unähnlichkeit etc.) ist abhängig davon, ob statt der Ähnlichkeiten einzelne Elemente oder Funktionen oder komplexe Beziehungen gewählt werden, ob also ein Teil für eine Ganzheit oder ob eine Praxis für einen andere steht. Dann ist entscheidend, ob man das zu Wissende enträtseln muss, – ob man es schon erlernt hat und einen körperlichen Automatismus (z.B. das Lesen von Buchstaben) gebildet hat –, kurzum, ob überhaupt noch ein Unterschied zwischen sinnlicher, naturgemäßer Vorgabe, Ähnlichkeiten oder Unähnlichkeiten gemacht wird. Im Zuge dieser früher magischen, rituellen Affekte und Praktiken gehen die ursprünglicheren Beziehungen weitgehend verloren, während andere als natürlich erscheinen, z.B. Kausalitäten, die den Impetus ersetzen. Neben dem Vorgang des Lesens ist in der Entschlüsselung der Codierung der Zeichen vor allem wichtig, die Ableitungen zu kennen, also die sozialen Strategien dessen, was sinnvollerweise in einer ökonomisierten Tauschgesellschaft ohne Umwege praktiziert und kommuniziert werden kann. Man muss die Redundanzen, die Reproduktionen und Serialitäten von den Innovationen des Gebrauchs unterscheiden lernen: Ich muss also situativ entscheiden, ob ein Ausdruck satirisch gemeint ist, ob er ein strikter Befehl ist oder ob er eine spielerische Inszenierung darstellt. Inszeniert heißt in diesem Fall: Alle Bedeutungen sind bekannt, aber sie konstituieren sich wechselseitig in einer relativen Verschiebung zu einem Autor oder zu einem transzendentalen Subjekt. Jedes Zeichen bekommt dadurch einen kleinen Vektor, der wegen seiner konnotativen Unsicherheit auf die Bedeutung als Sicherung verweist, somit auf die Beziehungen dieser Elemente als umfänglichere tatsächliche oder provisorische Sinneinheiten untereinander: Dieser Stuhl auf der Bühne ist weiterhin ein Stuhl, aber in dem Kontext von König Lear nimmt er den Sinn eines Thrones an und ist das Zeichen von Macht etc. Aber solche Sinnverweisungen gibt es auch beim Sessel eines Vorstandsvorsitzenden. Semiotisch oder szenografisch kann zwischen der Inszenierung eines Theaterstücks und der Inszenierung eines Büros kein Unterschied gemacht werden, medienspezifisch und institutionell hingegen schon. Um hier Neutralität walten zu lassen und der Analyse der Zeichen für alle Bereiche Geltung zu verschaffen, hat sich die Systemtheorie der elementaren
73
74
5. VORLESUNG
Zeichenrelation auf eine soziologische Weise genähert, die die psychoanalytische Vorgabe ein wenig hat ins Hintertreffen fallen lassen. Die Elementarfrage heißt nicht mehr „was bedeutet das?“, sondern „wie verwende ich das (diese Vorschrift), wie verweise ich weiter?“ Denn es darf nicht ausgeschlossen sein, dass ich die Bedeutung gegen die Intention seiner Vorschrift verwende: dass ich die Autorität des Autors (sogar, wenn er die ganze Gemeinschaft ist oder aber nur ein singuläres Mandat hat) missachte oder missverstehe, gemäß der Freiheit, die sich mir als meine Sicherheit unterlegt. Der Begriff „Kommunikation“ (Mit-Teilung/Reziprozität) als Bezeichnung der Verwendung von Zeichenrelationen zeichnet sich, im Gegensatz zu dem der „Information“, durch die Freiheit und somit innovative Möglichkeit der Veränderung von Zeichenverwendungen aus. Jedenfalls macht es Sinn, diese Unterscheidung gelten zu lassen: Wenn nämlich Zeichen durch Konvention entstehen, kann diese Konvention nur in Ausnahmefällen die ganze Weltgemeinschaft umfassen: Solche Ausnahmen kann man „wissenschaftlich exakt“ im naturwissenschaftlichen Sinne nennen. Die anderen Fälle sind in der Regel interpretativ: D.h. ihre Ähnlichkeit und Unähnlichkeitsbeziehung, die Nähe und Ferne des Signifikats zum Signifikanten, sind Wertebeziehungen, die ihren Tageskurs haben und ihre Unterschiede behaupten. Mit diesen wenigen Strichen haben wir ein Beziehungsgeflecht skizziert, in dem die formale Unterscheidung Anwesenheit/Nicht-Anwesenheit bzw. Realität und Vorstellung als Ausgangspunkt für soziale Handlungen genommen werden kann, deren Grundrelation der involutive Einschluss ist: „Ich und die Anderen“ oder „Bedeutung für alle – Sinn für mich“. Diese Unterscheidung ist eingebettet in die Vorgabe einer jeweils konkreten Situation, d.h einem umweltlichen Kontext, der einer je eigenen Handlungsstrategie zur Transposition (Kristeva) bedarf oder eben eines eingeübten Schematismus, einer Rhythmik, Choreografie oder Inszenierung, die als eine Art Superzeichen (Theorie, Methode, Strategie, Modell, Simulation) abgearbeitet werden kann. Seitdem Zeichen in Echtzeit vermitteln und in Lichtgeschwindigkeit codiert und decodiert werden können, muss dieses Prinzip der individuellen Situativität als Präsenzgesellschaft neu überdacht und justiert werden. Das Entwurfsgeschäft solcher Justierungen wird, wie schon im antiken Theater oder auf den Festwiesen der olympischen und anderer Spiele, auf Probebühnen aufgeführt: als in die Zeit gefaltete Äußerungen. Nur der reichhaltige Stoff wirft Falten. Die Akzeptanz oder Annahme eines Zeichens als einer einfachen Unterscheidung, die ein Anderer für mich trifft, wird sofort komplex, wenn man bemerkt, dass das, was am wenigsten „jetzt“ anwesend sein kann, die Präsenz selbst ist – also das „unvermittelte“ Ereignen von Bewusstheit, das reflektorisch verspätet in einem „Das war es also!“ entgegen kommt. Die Szene setzt dieser nie anwesenden Präsenz eine simulative Dauer entgegen, eine Freiheit, ein Zögern eines „Aushaltenkönnens der fehlenden Bedeutung“. Die Verspätung erscheint als simultane Teilhabe mit Widerrufsrecht. Denn die Szene ist sowohl wiederholbar als auch revidierbar. Die Szene lässt als solche eine Wahl/ein Zögern bedeutsam werden. Eine Wahl, die üblicherweise mit dem Begriff des Spiels/der Kalkulation tituliert wird. Eine Wahl,
5. VORLESUNG
die die progredierende physikalische Zeit als reversibel auf die Memorialität und deren Konventionalität denkt, die das Subjekt von seiner Präsenzopferung befreit. „Präsenzgesellschaft“: Dieser Begriff kann erst aufkommen, wenn sich insbesondere durch die Echtzeitmedien Gegenwärtigkeiten gleichzeitig, simultan abspielen. Der Mythos und die Narration kennen diese „Zweiseitenzeit“ der Simultaneität nicht. Sie unterscheiden nicht zwischen funktionaler und symbolischer Bedeutung, weil sie sie synchronisieren. In Bezug auf den Mythos der Sprache und auf die Sprache des Mythos hat Sartre die Dinge auf den Punkt gebracht: „Jedes Wort ist die ganze Sprache.“109 Er weist dabei auf ein methodologisches Dilemma der Sprachwissenschaft seit der Humboldtschen Wende hin. Humboldt hatte verschiedentlich darauf gedrungen, nicht die Einzelfälle einer Sprache zu vergleichen und induktiv daraus eine Theorie der Sprache und seiner zeichenhaften Struktur abzuleiten, sondern synchron die Totalisierung der je kulturell divergierenden Sprachsysteme zur Analyse der Einzelfälle zu gebrauchen. Der Zirkel der Bewegung vom Einzelnen auf das Allgemeine und vom Allgemeinen auf das Einzelne (ein Problem, das in der Schreibhemmung Saussures symptomatisch wird) lässt sich nur durch eine technische und eine divinatorische Methode lösen, so wie Schleiermacher sie verstand und wie Saussure sie übernahm. Dabei muss gesehen werden – und das war die eigentliche Leistung, die Heiddegger an Sartre vermittelte –, dass die Zeitlichkeit als Existenz nur in der szenifizierenden Sprache, in der Verzeitlichung – also sinnlich-imaginäre Vorstellung – vorausgesetzt werden kann. Denn nicht die physikalisch-chemischen Prozesse sind an der Sprachbildung wesentlich, sondern die psychologischen: das Ich gegenüber der Allgemeinheit (oder gegenüber einer Vielheit oder unterschiedlichen Gruppen oder Serien) als Integral der Hin- und Herbewegungen von Entwurf (Verweisung des Signifikanten) und Realisierung/Erfüllung dieser Verweisung im Bedeuteten bzw. in der Produktion/Divination des Bedeuteten. Sprache ist nicht länger ein Instrument, sondern Ausdruck gesellschaftlicher Vorgänge. Genau hier werden Echtzeitmedien vorteilhaft und problematisch, da sie die Produziertheit im Affekt des Gebrauchs vergessen machen und es erlauben, sich auf das je Sinnvolle zu reduzieren. Dabei hatte Humboldt darauf hingewiesen, dass der kulturelle Gehalt sich nicht als nationaler (medienspezifischer), sondern als individueller kenntlich macht. Man verkennt den Sprachprozess, „wenn man das Menschengeschlecht als zahllose zu derselben Gattung gehörende Naturen, und nicht vielmehr als eine in zahllose Individuen zerspaltene betrachtet.“110 Kultur ist eine Einheit (keine Totalisierung) von Gebrauchsunterschieden. Hier identifizierte Saussure die Ideologie einer Universalsprache und einer Universalverständigung zu voreilig als einen „‚strukturalistischen‘ Sprachbegriff [...], aus dem alle Momente der soziokulturellen Situiertheit von Sprache gelöscht sind, während er für Humboldt und für de Saussure gerade programmatisch für eine ‚philosophisch-induktive‘ Sprachidee stand.“111 Nicht die Gattung Mensch, sondern die menschliche Individualität galt es in einer poststruk109 Jean-Paul Sartre: Marxismus und Existentialismus. Versuch einer Methodik. Reinbek 1971, S.136. 110 111
Jäger, Ferdinand de Saussure, a.a.O., S.106. Zitat: Wilhelm von Humboldt. Ebd., S.107.
75
76
5. VORLESUNG
turalistischen Wende zu betonen: Warum ist Verständigung trotz aller Unterschiede möglich? Philosophisch betrachtet muss in der Divination, also der gleichsam kriminologischen „Entdeckung/Produktion/Realisierung“ eines Sinns als der „Wahrheit der Wirklichkeit“, die Inversion die Reflexion ersetzen: Die Reflexion muss das, was sich reflektiert, immer schon als Reflektiertes erkennen, die Inversion hingegen spielt mit dem Zeichen als einer Form mit zwei Seiten, die weder gleich noch ähnlich sein müssen, kein Ursprung und keine Folge sind, vexierhaft, nicht dialektisch, sondern involutiv aufeinander verweisen, ohne dass eine positive Synthese erscheint. Das Spiel der Zeichen ist also alles andere als willkürlich. Vielleicht ist es sogar mehr von der Situation beherrscht als das Zeichen, das einem Imperativ der Eindeutigkeit folgt. Die Bewegung der Verzeitlichung ist von der Logik der Inversion geprägt, d.h. von der/dem gelungenen Abwehr/Aufschub eines Identitätszwangs. Die philosophische Debatte um die epistemische Gründung von Selbstbewusstsein (und der Kenntnis von sich als „Selbst“) steht hier nicht im Zentrum der Darstellung. Doch ohne eine wenigstens rudimentäre Kenntnis ihrer Problematik lässt sich das gescheiterte Anliegen strategischer Wissenskonzeptionen – wie die des Strukturalismus (und seiner geglückten Einlösung in Informationstechnologie), seiner hermeneutischen Gegenbewegung und der System- und Spieltheorien – nicht verstehen. Den die Systemtheorien setzen das sozialisierte Individuum in seinen Handlungen/Beobachtungen an die Stelle des Zeichens. Im Falle der Antinomien der Selbstreflexivität versagt der Vermittlungscharakter des Zeichens, denn dass „Selbstbewusstsein“ muss gleichsam Bewusstsein davon haben, dass es das, was es nicht zum Objekt haben kann (sich selbst), auch nicht vom Anderen bekommt. Denn der Andere/dieses Andere ist auch auf einer Suche nach seinem Selbst. Das ist nicht nichts, sondern die gegenwärtige Realität. So kann Kommunikation als eine Annäherung von Negationen versanden werden, die gerade nicht auf sich selbst festgelegt sind, sondern die Zeit produzieren, die sie durchschreiten. Die Psychoanalyse sagt, das Subjekt verfehlt sich im Anderen, aber indem es sich verfehlt, findet es im Anderen ein Identisches als Differenz. Das Verfehlen im positiven Sinn kann man „Kommunikation“ nennen. Wir sprechen in zweifacher Weise von „Schauspiel“. Erstens: Theoretisieren ist ein Schauspiel, das dazu dient, „Versinnlichung“ oder „Bewusstsein“ nicht als einen Akt narrativer, sondern logischer Funktion zu bestimmen. In dieser Weise haben die Herausgeber der Cours die Tiefendimension der Linguistik durch die horizontalen Ordnungen der Verwandtschaft und Nachbarschaft – und der Wechselwirkung der Zeichen, also der räumlichen Nähe, Ferne und Dichte, kurzum: der „Werte“ – szenifiziert. Der Akt der Selbstaufklärung der „Natur des Theoretisierens“ muss sich selbst mit einem Cordon aus komparatistisch relevanten Merkmalen umgeben, deren Einheit darin besteht, die logische Funktion wieder in eine sinnliche zu überführen und damit die Darstellbarkeit ihrer Aussage als übertragbar zu beglaubigen, so wie jedes mathematische Kalkül erst durch den sinnlich messbaren Vollzug in der Physik erst als nachgewiesen gilt. Roland Barthes hat die Hin- und Her-Bewegung so beschrieben: „Die Funktion bringt das Zeichen hervor, aber dieses Zeichen wird in das
5. VORLESUNG
Schauspiel einer Funktion zurückverwandelt. Ich glaube, gerade diese Umkehrung der Kultur in Pseudonatur kann die Ideologie unserer Gesellschaft definieren.“112 Je nach dem Ort, an dem das Schauspiel sich eröffnet, kann man die Bedeutung eingrenzen, sie verwenden oder subvertieren. Illustrativ kann man sich auf die Mandelbrot’schen Dimensionen des Geltungsbereichs eines Theorems beziehen – der Synthesen, die man in den Beziehungen der Signifikanten untereinander betrachten will. Denn auch der Entwurf springt nicht regelmäßig von Stufe zu Stufe. Die Schrittlänge der Überschreitung hat kein Widerlager in der Zeit: Sie trägt oder sie trägt nicht. Beachte ich nur den unmittelbar benachbarten Signifikanten, eine Periode oder eine szenische Dauer? Der Grad der Differentiation bestimmt den Grad der Bedeutung. Mandelbrot beruft sich auf ein praktisches Beispiel. Er wird aufgefordert, die Küstenlinie Britanniens zu messen. Je feiner der Maßstab der Karte, die er verwendet, umso länger ist die Küstenlinie; zum Schluss wäre um jedes Sandkorn ein Bogen zu schlagen – mit dem Ergebnis, dass die Länge der Küstenlinie gegen unendlich geht. Der Maßstab bestimmt also die Synthese, die wiederum die Wahl des Maßstabs bestimmt. Jedes Mal soll nun – nach Mandelbrot das Ergebnis regressiv in die Formel mit dem progressiv bestimmten Maßstab korrliert werden, bis sich das System der Relationen stabilisiert: Die Küstenlinie ist keine bestimmte Zahl, der eine Länge entspricht, sondern eine Funktion zwischen Maßstab und Wert. Die Ansicht dieser selbstinversiven Funktionen, das verdeutlicht Mandelbrot an den ersten computerisierten Rechendurchgängen, erscheinen in sinnlicher Form als Naturlandschaften, d.h. als selbstähnliche Reflexivität oder Generativität.113 Das meint in der Systemtheorie die autopoiesis, die sich von dem Modell getrennter Außen/ Innenbereiche verabschiedet. Der Andere und ich, das sind zwei Seiten ein- und derselben Medaille, denen in der Dichte und Verbindlichkeit in den Beziehungen und der Beziehungen zu Anderen qualitativ verschiedene Werte entsprechen, die die Soziologie beschreiben kann: die Gruppe, die Klasse, die Partei, die Gemeinschaft.114 112 Roland Barthes: Semantik des Objekts. In: Ders.: Das semiologische Abenteuer. Frankfurt am main 1988, S.187-198, hier S.197. 113 Es ist bezeichnend, dass in der strukturalen Semiotik nicht eigentlich eine Tiefendynamik existiert, die vom Beobachter abhängig ist, sondern dass diese Funktion als Semantik abgespalten wird und eher das Interesse der Hermeneutiker reizt. Die fraktale Geometrie beharrt aber auf die Funktion, Produkt und Produziertes in einer Simultaneität durch Reintegration zu erfassen, also den „praktischen Wert“ des Studiums „irregulärer Kontinua“ zu beweisen. Benoît B. Mandelbrot: Die fraktale Geometrie der Natur. Basel 1991, S.21. Nun zeigt Mandelbrot nicht nur, dass jede natürliche Struktur auch eine Tiefendimension hat, er zeigt gleichzeitig, dass die drei cartesianischen Dimensionen willkürliche, künstliche Setzungen sind, da zwischen diesen Dimensionen beliebig viele Strukturen bestehen: Wolken, Schwämme, Sand, Staub, Bäume etc. „Mit anderen Worten, die effektive Dimension hat unvermeidlich eine subjektive Grundlage. Sie ist eine Sache der Approximation und deshalb des Auflösungsgrades.“ (S.29) 114 Sartre versucht die Polarität zwischen dem Individuum und dem Anderen in Qualitäten zu unterscheiden, die im mathematischen Sinne Dimensionen, d.h. Irregularitäten mit Invarianz sind. Er geht einfacherweise von der „Serie“ und der „Entfremdung“ als anti-dialektischer Zusammenhänge und von der „Gruppe“ als einfachster Form intelligibler, wechselseitiger, dialektischer Vielheit aus und bezieht sie auf ihre jeweilige Praxis: „Darunter verstehen wir, daß die Verbindungen der sich ihrer selbst bewußten Praxis mit all den komplexen Vielheiten verstanden werden müssen, die sich durch sie organisieren und in denen sie sich als Praxis verliert, um Praxis-als-Prozeß zu werden“. Jean-Paul Sartre: Kritik der dialektischen Vernunft. Theorie der gesellschaftlichen Praxis. Reinbek 1980, S.67. Nun
77
78
5. VORLESUNG
Die Synthesen sind immer schon vorhanden. Es kommt, wie Freud sagt, auf die Tiefenanalyse an. Die Semiotiken verstehen sich als analytische Theorien, die Interpretationen oder Semantiken als synthetische. Roland Barthes hat bemerkt, dass man von der Analyse auf die Synthese überwechseln muss, wenn man den Gegenstandsbereich der Theorien als Ganzheit erfassen will. Die wesentliche Form dieser Ganzheit aus funktionalen und symbolischen Bezügen zwischen den Teilen und dem Ganzen nennt der frühe Barthes den „Mythos“. „Der Mythos ist ein System der Kommunikation, eine Botschaft. Man ersieht daraus, daß der Mythos kein Objekt, kein Begriff und keine Idee sein kann; er ist eine Weise des Bedeutens, eine Form.“115 Botschaft, das haben wir bei Laplanche gesehen, meint als Form die Geste des Verweises, das Angebot zu Kommunikation. Dieses Angebot wird im Mythos nur dann angenommen, wenn seine Form nicht abschließbar ist, wenn die Bedeutungserfüllung die Erkenntnis des Scheiterns in sich trägt. Deswegen spricht der Mythos in Rätseln und in Spuren. Sein Maßstab ist ein epischer: gerade so differenziert, dass der Zuhörer/ Beobachter unentwegt Lücken, Rätsel, Aufgaben und Paradoxien findet, die er mit Freuden erfüllt; dies sind die Taten des Odysseus, der nicht heimkehrt; dies sind die Taten des Don Quichotte, der seine Liebe nicht erfüllt; dies sind die Zeichen der Ware, die die Wahrheit der Unerfüllbarkeit dissimulieren. Ich möchte mich im Sinne der von Mandelbrot avisierten gebrochenen Beobachterperspektiven – oder besser: -kalibrierungen (Fraktale) – auf eine essayistische Position zurückziehen. Es geht mir nicht darum, das Gesicht einer schon etwas in die Jahre gekommenen Theorie, der Semiotik, zu liften und zu vermitteln, sondern ihre unterschiedlichen Darstellungsoptionen, die sie anbietet, zu demonstrieren. Der Essay und die disparaten, provisorischen Vorlesungsentwürfe korrespondieren mit einer literarischen Figur, die einen Gegenstand durch einen geschliffenen Edelstein betrachtet: in Facetten. Die Logik des Edelsteins ist die des Sprungs und der Brechungen, gemäß dem induktiven Ansatz, den Humboldt für die Sprachdifferenzen und für die Sprache als solche vorschlägt. Der Essay handelt über die Art und den Wert der Elemente, die man „Zeichen“ nennt und deren lebendige Ausprägung Erfahrungen und Szenen sind – und nicht ursprüngliche Ereignisse. Er erlaubt eine negative Haltung: denn der Essay behauptet nicht die positive Wahrheit einer Sache unter Sublimierung ihrer Form, er nimmt die Form für die adäquate Darstellung der Sache. Weder das Ganze noch die Teile haben einen Vorrang. Sie positionieren sich wie Signifikant und Signifikat in einer differentiellen Vexierbewegung. Immer kommt es auf die Fokussierung oder Totalisierung – oder auf den Raum und Dauer der Szene an, die in den Blick genommen wird. Der Reichtum und die Diversifität einer Sprache wächst mit dem Umsatz ihrer Diskursivität. Jedes System der Sprache hat dem dreifachen Aspekt der Semiose zu gehorchen, wie sie Saussure im Sinn hatte: der Ganzheit des Zeichens, der synthetischen Einheit von Form und Medium ist die Praxis als Prozeß eben keine theoretische Reflexion, sondern eine Darstellung der Handelnden (Individuen) für sich selbst, also eine Inszenierung, in der die Anderen die Rolle von Bedeutungen annehmen. Anders wäre sie gar keine Praxis. Die lediglich serielle Praxis ist die, in der die Gruppe für sich selbst nicht transzendiert zu werden braucht. Entsprechend hat die Systemtheorie die Unterscheidung „Individuum-Andere“ in die von „Handlung-Bedeutung“ transferiert. 115 Barthes, Mythen des Alltags, a.a.O., S.251.
5. VORLESUNG
und der Generativität einer situativen gesellschaftlichen Referenz. Ob man die Semiose an der gesprochenen Sprache oder an den Attributen der Dinge festmacht – die Dinge existieren für Saussure nicht außerhalb ihrer Eigenschaften und Merkmale, also Wertzuschreibungen – stets kommt dieses dreigliedrige Schema in allen zweiwertigen Relationen zum Vorschein, die gewählt werden: „Wir setzen keinen ernsthaften Unterschied [différence] zwischen den Termini Wert, Sinn, Bedeutung, Funktion oder Gebrauchsweise einer Form, nicht einmal zwischen diesen und dem ‚Begriff‘ als Inhalt einer Form; diese Termini sind synonym.“116 Bevor also das Zeichenproblem inventarisiert werden kann, gilt es, den Glauben zu zerstören, es gäbe eine Darstellung von Semiotik. Es gibt Konventionen, gerade in dieser Taxonomie. D.h. nicht, dass sie weniger exakt seien, sondern dass man sich auf ein mediales, technisches oder auf ein anderes normatives oder diskursives Bezugssystem beziehen können muss. Die Einigung fällt schwer, auf welches – und in welcher historischen Konstellation. Schließlich beansprucht die Semiologie Universalität unter Einbeziehung ihrer Geschichtlichkeit. Es geht in der Wertsetzung um Interpretation, d.h. um Wahl oder Wiederholung, um Diskontinuität oder Kontinuität des Gebrauchs. Das Szenische bedingt sich durch die Dauer, in der ein Medium uns zur Treue verführt. Ob man Philosophie auf der Agora polemisiert oder, wie Platon in der Abwendung vom sokratischen Vorbild, sich dazu des Mediums Buch bedient, bestimmt – das hat Friedrich Kittler gezeigt – auch den Inhalt einer Philosophie oder Ideologie. Der ideologische Charakter ist dem Zeichen nichts Äußerliches, er ist die notwendige szenische Reduktion auf seine negative Synthese. Das unumgängliche Verfehlen des Anderen ist Kommunikation als Prozess. Statt Identität, äußerst sich in ihr ein lebendig auszutragender Widerstand: die Zeichen, d.h. eine Identität der Differenz. Der Mangel verwandelt sich so in einen fruchtbaren Agon. Ihre Periode ist die Szene. Das Objektivitätsresiduum dieser Ansicht der Selbsteinsicht in der Begierde nach und in der Abwehr von Identität hat die Systemtheorie in Welt, Umwelt und Beobachter zerlegt und damit die Funktion des Zeichens für eine szenische Darstellung eröffnet. Diesem Übergang vom Zeichen zur Szene wollen wir uns im Folgenden auf einigen Stationen widmen.
116
Jäger, Ferdinand de Saussure, a.a.O., S.159.
79
6. VORLESUNG Darstellung ist einzigartige Wiederholung – Urszene als existentielle Differenz – Brechts Medientechnikgeschichte – Wiederaufnahme allegorischer Tradition – Kritik als deinszenatorische Wirkung der Reinszenierung situativer Handlungen – Der Code als Vermittlung individueller Allgemeinheit
Anders als beim Lesen und Schreiben eines Buches ist die Wiederholungsfunktion der elektrischen Medien ursprungslos auf Identität (Reproduktion und Serialität) ausgerichtet. Im Vergleich zu mittelalterlichen Schreibstuben ist die Abschrift keine Kopie, sondern in Gestaltung und Typografie eigenständig und mit gutem Auge als individuell zu erkennen. Gerade mit dem Buchdruck ändert sich nicht nur die Aufschreibetechnik; der Buchdruck kann vielmehr als der erste industrielle Produktionsprozess überhaupt angesehen werden.117 Um die Wiederholung nicht in Unendlichkeit auslaufen zu lassen, bekommt die Szene eine Art negativer Kapselung. Sie offenbart den Versuchscharakter, eine Einmaligkeit in der Wiederholung als einmaliges Ereignis darzustellen, denn jede Darstellung ist eigentlich eine einzigartige Wiederholung. Für die medienwissenschaftliche Konnotation des Begriffs „Szene“ markiert Heiko Christians beim frühen Brecht den Unterschied zwischen filmischer und theatraler Technik und setzt von vornherein die Arbeit der Diskretion des Diskreten für den Moment der Technisierung, insbesondere den der „apparathaften“ Wiederholbarkeit ein. Über Brecht, der seine Ideen zum Theater über den Umweg des Films entwickelt, heißt es: Die Stärke von Brechts Überlegungen liegt ganz einfach darin, dass er überraschenderweise den Apparat – und damit die gesamte Medientechnik – gerade nicht mit einer angeblich der großen Kunst abträglichen Kulturindustrie identifiziert. Hier sieht man, dass die sich später noch etablierende Kulturindustrie-Schelte einen nicht-technischen Kunst-Begriff zur Voraussetzung hat. Der technikfeindliche Kulturindustrie-Diskurs kann überhaupt nur mittels eines philosophisch-ästhetischen Ereignis-Begriffs in Stellung gebracht werden. Brecht stellt sein Konzept der szenischen Demonstration stattdessen von Anfang an in den Rahmen einer positiv aufgefassten technischen Reproduzierbarkeit.118
Von der Intention des technikbegeisterten Brecht aus macht es keinen Sinn, die Bedeutungstiefe einer künstlerischen Geste als Zeichen zu deklamieren, dessen Bedeutung man kennen muss – die also nicht aus der alltäglichen Situation abgeleitet werden kann, wie das der Film in seiner realistischen Medialität leistet. 117 Siehe dazu die eindrucksvolle und detailreiche Studie von Michael Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Frankfurt am Main 2006. Es ist erstaunlich, mit welcher Geschwindigkeit sich der Buchdruck im 15. Jahrhundert nicht nur als Technik, sondern auch als industriell-ökonomisches Modell entwickelt – in einem Ausmaß, das wohl erst wieder in der Kohle-Chemie- und Energieindustrie im England des 18. Jahrhunderts überboten wird. 118 Christians, Crux Scenica, a.a.O., S.123.
82
6. VORLESUNG
Aus diesem Grund kann Brecht sich radikale Schnitte erlauben, die der Betrachter mittels Bedeutungsproduktion individuell kontinuieren kann. Brecht ist also nicht auf Wiederholung und Wiedergabe einer szenischen Intention, sondern auf Produktion aus. Durch die Konstitution des Schnitts als leerer Stelle gelingt es szenisch, die identische Reproduktion (Kopie) für eine Konsumsynthese produktiv zu machen. Das Verhältnis von situativer Konvention (Serialität) und szenischer Geschlossenheit oder Abstraktion bestimmt sich demnach durch die „Urszene“ einer abschließenden Aufschließung oder durch das, was man ein offenes System nennen kann – offen hin zu einer kontingenten Historizität. Unter „Urszene“ ist nicht der Freud’sche Begriff einer anfänglich ersten, infantilen oder traumatischen Szene gemeint ist, sondern das Prinzip systematisierter Kommunikation, das als Reflexion stets mit dem Fehlen des Urbildes/Originals die Bewusstwerdung begleitet: Das Ich, das sich selbst schon haben muss, um sich als sich zu versichern. Gedacht ist also eine ursprüngliche, d.h. existenzielle Differenz. Kommunikation als Frage nach dem ursprünglichen Ich, der Identität von Selbstbedeutung, schiebt sich also glücklich unendlich auf. Dieser Aufschub also wird durch die Dauer, Periode, Sequenz der Szene als Negat wiederholt. Alfred Lorenzer hat auf diesen systematischen oder strukturalen Aspekt verwiesen, indem er den Aktualitätsstatus gegenüber dem biographischen in der nach Rekonstruktion angelegten Analyse Freuds hervorkehrt. Er vereinfacht ihn stark, um die situative Bezogenheit der ursprünglichen Szene deutlich werden zu lassen: Die Einführung von Sprache erfolgt in konkreten Situationen, die dadurch ihren „Namen“ erhalten. Andersherum gesehen: Die „Bedeutung“ der Sprachfiguren ist die aktuell konkrete Szene. Die Bedeutung des Wortes ist in ihrem Kern szenisch. Ihr Bezug ist kein abgegrenzter Gegenstand, sondern ein szenisches Gefüge. Der Name bezieht sich auf die Szene.119
Was Lorenzer hier andeutet, ist, dass es die diskrete Bedeutung in einer Wort-für-Wort-Übersetzung nicht gibt. Die Identität des menschlichen Verstehens gründet auf der Verschiebung/Verdichtung/Verfehlung der Wiederholung. Die Krise der Hermeneutik des Verstehens motiviert das Unternehmen der linguistischen Konzeption Saussures.120 Bedeutung kann es also nur in einem System geben, dass sein eigenes Prozessieren in einer Szene (nicht im Namen, nicht im Bild, nicht im Symbol) konkretisiert. Die Frage ist nun, wie sich „Ereignis“ und „Erlebnis“ korrelieren, d.h. welche Szene man sich von der Szene macht. Freuds Problem der Rücksicht auf Darstellbarkeit wird hier relevant, d.h. die Frage nach der Trennung/ Prüfung121 von Imagination und Realität. In dieser Hinsicht ist es relevant, dass 119 Zitation Alfred Lorenzer: Sprache, Lebenspraxis und szenisches Verstehen in der psychoanalytischen Therapie. In: Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen 37, 1983, S.19f. Zitiert nach Christians, Crux Scenica, a.a.O., S.219. 120 Der Cours wendet sich von Anfang an gegen ein Modell der Nomenklatur, in dem der Name einer Sache zu entsprechen habe. Vgl. Saussure, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, a.a.O., S.67f. 121 Es ist der gleiche Modus von Einheit und Dualität, der auch den Begriff des Zeichens prägt: Erst die Unterscheidungsfähigkeit von Vorstellung und symbolischer Realität stellt die Realität für ein Subjekt her. Die Realität ist die Einheit, die in der Praxis nicht zu Zweideutigkeit Anlass gibt. Entsprechend kann nun die Realität als Dimension der Praxis angesehen werden, die entweder verschoben oder
6. VORLESUNG
die Semiologie als Ideologie eben nur die theoretische Szene (Formtheorie) einer Szene praktiziert, die je vor dem Hintergrund einer singulären historischen Situation sich ereignen kann, d.h. sie ist grundsätzlich programmatisch und selten pragmatisch orientiert. Es macht wenig Sinn, die Nomenklatur der Semiotik auf die konkreten Situationen anzuwenden. Dort, wo dies versucht wird, liest es sich wie ein Übersetzungsprogramm.122 Als Programmvorschrift wird die Semiotik erfolgreich in der Informationstheorie, nicht aber dort, wo die Verfehlung einen konstitutiven Aufschub der Erfüllungssynthese bewirkt – in der menschlichen Kommunikation. Die Untersuchung muss hier also fragen, in welcher (historischen) Situation jeweils welche Bedeutung bedeutsam wird: die gleiche oder die ähnliche. Heiko Christians‘ Darstellung einer Kulturgeschichte der Szene spezifiziert den Begriff im Unterschied zum Zeichen nicht als abhängig von einer politischen, sondern von einer Medientechnikgeschichte. Wir sollten uns vergegenwärtigen, dass der aktuelle Medienbegriff erst in den 1960er Jahren zum enzyklopädischen Terminus kondensiert – also in dem Moment, in dem die Semiotik einerseits durch Barthes123 ein essayistisches Spiel, andererseits durch Eco124 formalisiert wird –, insgesamt aber die Konjunktur der Semiotik als formalisierter Wissensbestand in der Kybernetik eigenständige Wege bahnt. In dieser Situation wird die strukturale Semiotik durch eine pragmatisch orientierte Systemtheorie einerseits und eine Informatik andererseits herausgefordert. Unschwer lassen sich die Umbrüche der Medientechniken, d.h. des Prozessierens mit visuellem und arbiträren „Material“, als Voraussetzung für die wissenschaftspolitische Umwertung vom Zeichen zur Szene in einer Präsenzgesellschaft realisieren, in der die pauschale Kritik an der „Kulturindustrie“ sich als Verlust tradierbarer Zeichenordnung diskreditiert, die ihre Gebrauchsanweisungen und Decodierungsschlüssel über dem Umweg eines anders gearteten Bildungsarrangements prädisponiert und kanonisiert. Von einzigartiger Durchschlagskraft in der Neubewertung des Zeichens durch die Szene war das nicht verdichtet werden kann. „Neurose wie Psychose sind also beide Ausdruck der Rebellion des Es gegen die Außenwelt, seiner Unlust oder, wenn man will, seiner Unfähigkeit, sich der realen Not, der Ananke anzupassen.“ Sigmund Freud: Der Realitätsverlust bei Neurose und Psychose. In: Ders.: Schriften zur Krankheitslehre der Psychoanalyse. Frankfurt am Main 1991, S.217-280, hier S.274f. Den familialen, moralischen Normen müssen heute natürlich die technischen Normen beigestellt werden. 122 Umberto Eco: Einführung in die Semiotik. München 1972, S.295: „Wenn die Semiotik nicht nur die Wissenschaft von den Zeichensystemen ist, die also solche erkannt werden, sondern die Wissenschaft, welche alle Kulturphänomene so untersucht, als ob sie Zeichensysteme wären – wobei sie von der Hypothese ausgeht, daß in Wirklichkeit alle Kulturphänomene Zeichensysteme sind, d.h. daß Kultur im wesentlichen Kommunikation ist –, so ist die Architektur einer der Bereiche, in dem die Semiotik in besonderem Maße auf die Herausforderung durch die Realität trifft, welche sie in den Griff bekommen will.“ 123 Roland Barthes: Das semiologische Abenteuer. Frankfurt am Main 1988, S.11. Barthes bezeichnet 1974 sein Interesse an der Semiologie – nach einer Phase der Faszination für deren Wissenschaftlichkeit – jetzt als Motiv der „Arbeit und des Spiels“ am Text. 124 Umberto Eco: Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen. München 1987, S.21: „Ziel dieses Buches ist eine Untersuchung der theoretischen Möglichkeit und der sozialen Funktion einer einheitlichen Behandlung aller Signifikations- und/oder Kommunikationsphänomene. Eine solche Behandlung sollte die Form einer allgemeinen semiotischen Theorie annehmen, die fähig ist, jeden Fall von Zeichen-Funktion in Kategorien zugrundeliegender Systeme zu erklären, deren Elemente durch einen oder mehrere Codes wechselseitig aufeinander bezogen sind.“
83
84
6. VORLESUNG
nur am Film geschulte kinematische Denken in Transformationsprozessen der Sinne – eine Art physiologisch kontrollierte Zauberei. Kittler etwa setzt dieses kinematische Denken schon mit den Geistererzählungen der Romantiker an. Insbesondere bei E.T.A. Hoffmann125 amalgamieren sich literarische, traumhafte und technische Produktion, die mit der Perfektion serialisierter Zeitrückholung konkurrieren und nichts anderes beabsichtigen, als das Verhältnis von Imagination und Realisation zu affizieren, also ein Geschäft mit der Aufmerksamkeit zu machen. Die Funktionalität der Echtzeitmedien gestattet es auf synchrone Weise, die symbolische und die funktionale, also szenische Verweisungsfunktion parallel laufen zu lassen. The medium is the message heißt auch, message is the medium. Die szenische Frequenz des Ein- und Ausschaltens, von Transposition/Tausch wird zur eigentlich bedeutsamen Handlung, da man nur noch von Medium zu Medium springen kann. Folglich wacht man nicht mehr in der Realität auf, sondern in der Medienpräsenz, die nicht mehr eine Bedeutungstiefe, sondern eine Fluchtbewegung aktiviert. Wer mit Zeichen handelt, muss sich auf eine Zeitreise unendlicher Verweisungen einlassen, nicht nur insofern die Zeichen heute alle augenblicklich abrufbar sind, sondern insofern sie in ihrer Relevanz mit jeder Aktualisierung schwanken. Solches Schwanken geschieht als geschichtliches Bedeuten. So kreuzen sich im Zeichen zwei zu unterscheidende Vorstellungen: die Welt der konventionalisierten Bedeutungen, die schon da sind und sich in ihrer dienenden Funktion als Dinge (Andere) behaupten, und solche Zeichen, deren historische oder fiktive Abwesenheit aus Spuren von mir selbst gelesen werden müssen; einerseits also Zeichen, die man verstehen kann, weil ihre Codierung durch das Medium präformiert ist und andererseits Zeichen, die ein Wissen voraussetzen. Es geht um Bedeutungsbildung, die als Präsenz in der Evidenz leiblicher Situiertheit eingegangen ist, die also durch ständige Wiederholung inkorporiert und „unbedeutend“ geworden ist. Sie schafft eine Welt, die sich auf affektive und ökonomisierte Präsenz einstellt, auf eine Dauerpräsenz, die durch kein Ereignis gestört werden kann, weil auch die größte Katastrophe und der tiefste Einschnitt medial vermittelbar sind, da der Schock (so Benjamin und Brecht) als Reproduktionsinstanz ihr inhärent ist. In dieser Situation werden Zeichen nicht gelesen (zeitlich organisiert), sondern erfasst (wahrgenommen), und sie erzeugen eine unmittelbare affektive Reaktion. Unsere (westliche) Präsenzgesellschaft reagiert im Wesentlichen auf Identitätsvollzüge, deren Verweisungswert dem eines Signals entspricht, in welchem der Körper die physiologische/biologische Dimension eines Mediums ist und die Organe die Membrane exkludierender Inklusionen (Involutionen) bilden. Sie sind also tatsächliche Medien oder Systeme, deren autopoietische Abschließung sich durch ständiges Prozessieren mit der Umwelt verhindert. Es macht aber immer noch einen Unterschied, ob man Bedeutungen konsumiert oder ob es veranlasst wird, sie zu produzieren, zu divinieren, wie Brecht das im Sinn hatte. Die Frage ist, ob Freiheit, Möglichkeit und Vieldeutigkeit in der Inszenierung selbst angelegt sind. 125 Siehe die insbesondere auch von Freud in seinem Essay Das Unheimliche gewürdigte Erzählung Der Sandmann. Vgl. dazu Friedrich A. Kittler: Optische Medien. Berliner Vorlesungen 1999. Berlin 2002, S.142ff.
6. VORLESUNG
Es gab im Barock Zeichen, die nur mit der nötigen Vorsicht und dem Zugang zum Wissen zu entschlüsseln waren – die einen Entwurf auf mögliche Kombinatorik boten und einen Rückgang auf Erfahrung oder Wissen erforderten. Im semiotischen Kontext nennt man solche Zeichen nach rhetorischer Tradition allegorisch. Sie tragen ihr Bedeutungsgedächtnis selbst vor: Dass ein Stuhl zum Sitzen einlädt, ist für unsere Kultur evident, in der japanischen Tradition aber nicht. Dass in einer katholischen Messe die Transformation von Brot und Wein tatsächlich geschieht, ist für einen Katholiken eine evidente Glaubenstatsache, für einen Protestanten aber eines Sache des Wissens, die er mit einem antiken Abendmahl in Erinnerung bringt, an das er qua Schrifttradition glaubt.126 Glaubt man also der Überlieferung oder dem, was man sieht? Einerseits geschieht das Heilige wirklich in jeder katholischen Messe, andererseits geschieht die Erinnerung an das Ereignis in jedem Lesevollzug des biblischen Wortes tatsächlich. Lesen und Handeln werden hier schon zu tauschbaren Formen. Das magische Moment ist, im Kierkegaard’schen Sinne, dass es die Wiederholung überhaupt gibt. Wenn es sie aber gibt – wenn man zweimal als Derselbe in denselben Fluss steigen kann – bedarf es einer Manipulation der Zeit. Der situative Zeitfluss muss durch einen szenische ausgetauscht oder maskiert werden. In diesem Sinne interessiert uns hier die szenischen Ordnung als Zeitform des Zeichens, die ja erst als Resultat ihrer unbedingten Strenge und Äquivalenz den Raum und die Zeit als bestimmte Dimensionen abstrahiert. Mit Recht kann jedes Zeichenverhalten ambivalent als rückständig oder grundlegend, magisch oder produktiv angesehen werden. Das heißt nun gerade nicht, dass dieser Magie der Realität nicht mit logischen Mitteln auf den Grund gegangen werden kann, z.B. mit den zeitgemäßen Fragen an eine Semiologie: Welche Arten der Ordnung des Zeichens sind für alle Zeichen grundlegend? Welche Funktion hat eine Semiologie in der tendenziellen Verschiebung von einer Wissensgesellschaft in eine Präsenzgesellschaft, in der die Reszenifikationen unsinnlicher Technikvollzüge durch Design und Inszenierung jederzeit und überall präsentiert werden können müssen? Vor der Diskussion dieser Fragen ist es angebracht, die recht unterschiedlichen Definitionsversuche der Semiotiken zu sichten und die These der Verschiebung zu einer Präsenzgesellschaft selbst als Prozess einer Dialektik von Identität und Differenz auszumachen, indem der dem Subjekt konsumtiv zugesprochene Teil identitätsfördernd ist, während der produktive, differenzierende Anteil als Opfer marginalisiert und abgeschirmt wird. Vom historischen Standpunkt aus müssten wir uns in die Epoche des höfischen Barocks (und der Allegorie) zurückversetzen, in dem zum ersten Mal die Inszenierungstechniken nicht mit Magie, sondern mit Herrschaft und technischer Beherrschung assoziiert wurden und in der Verklärung und Aufklärung dialektisch aufeinander verwiesen. Das, was vor der Szene unbemerkt zum Verschwinden gebracht wurde, konnte nachher auch zum Erscheinen gebracht 126 Jörg Lauster: Die Verzauberung der Welt. Eine Kulturgeschichte des Christentums. München 2015, S.371ff. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die katholische Symbolik im Protestantismus zur bewussten Bedeutung umschlägt und der Glaube, dass die Zeichen etwas bedeuten, einerseits durch Glauben, andererseits durch Prüfung ihre gemeinschaftliche Akzeptanz erfahren. Hierzu gehört auch die relative Trennung zwischen selbstreferenziellem Bild und fremdrefentieller Sprache/Schrift.
85
86
6. VORLESUNG
werden.127 Die Zauberwelt des Barocks bildet den gesellschaftlichen Hintergrund für eine dialektische Korrespondenz von Bild (Sichtbarkeit, Pictura) und Text (Interpretatio) unter dem Blickwinkel eines Schlüssels (Motto). Die Dreigliedrigkeit der barocken Emblematik und ihrer allegorischen Form korrespondiert direkt mit der Dreigliedrigkeit des Zeichens. Allerdings ist das Zeichen die Ganzheit der Form, die in der Allegorie mit bildlich diskreten Szenen im Status ihres Prozessierens gezeigt wird. Die barocke Allegorie ist im Ideal eine Wissen produzierende Simulationsmaschine. Dem griechischen Wort „allegorein“ liegt ja die Bedeutung „etwas anderes sagen“ zu Grunde, nämlich, es im szenischen Sinne „auf Probe“ zu sagen – mit dem Recht, dass in der gesagten Darstellung die Wiederholung das Opfer der Zeit dispensiert. Im klassizistischen Streit um Allegorie und Symbol wird dann erst über den Ähnlichkeitsbezug der Allegorie das Verdikt der Unwissenschaftlichkeit und der Magie gefällt, und zwar unter dem Imperativ der Reproduzierbarkeit. Denn die Allegorie kann nur szenisch erscheinen – auf der Bühne der diskreten Versammlung ihrer Elemente –, während das Symbol sich anmaßt, als Ganzheit der Form ihrem jeweiligen Kontext enthoben zu sein. Aus dem Symbol gerinnt so die Beschäftigung mit dem artifiziellen Zeichen, von dem erst die Semiotik eines Peirce und die Linguistik eines Saussure zeigt, dass es ohne Kontextualität nicht geht – dass es keinen reinen Signifikanten gibt.128 Nur, wenn das wissenschaftliche Zeichen, das Zeichen der Informatik und der Mathematik, seinen Kontext in der Neutralität einer desituierten Raumzeit zu stiften vermag, die Sprache und das kulturelle Zeichen aber den sozialen und kulturellen Zeitraum als Szene benötigen, dann deeskaliert der Streit um allegorische, symbolische, arbiträre oder konventionalisierte Zeichen in einem Agon wechselseitiger Dissimulation, d.h. der Kalibrierbarkeit der Differentialität. In dieser Situation wird der Umweltbezug, d.h. der pragmatische Bezug des jeweiligen Differentials, relevant und theoretisierbar: als Feld, Struktur, System, Welt – d.h. der Bedeutungspraktiken. Auf der anderen Seite erfordert die Kalibrierung der Szene das Wissen um die vermeintliche Stellung und Prädisposition des Beobachters. Eine Semiotik ist demnach vor allem in Hinblick auf eine Phänomenologie der Zeitvorstellung und der Verzeitigungen, d.h. Realisierungen zu untersuchen, insofern die Schemata der Zeit das Präsente vom Apräsenten trennen und so eine Analyse der astronomischen Zeit, der Vorstellungszeit und der Zeitprodukte ermöglichen. Denn die Szenifikation ist nicht so sehr die Involution eines Raumes in einem 127
Heiner Wilharm: Magische Effekte oder Vom Verschwinden der Endlichkeit. Zur Ökonomie und Logik von Inszenierung und Szenifikation. In: Ralf Bohn/Heiner Wilharm (Hg.): Inszenierung und Effekte. Die Magie der Szenografie. Szenografie & Szenologie Bd.7. Bielefeld 2013. Wilharm widmet sich unter anderem dem Prestigio, also der Art und Weise in der Zauberei, einen Gegenstand verschwinden und erscheinen zu lassen – wenn man will, jener szenischen Form der Selbstszenifikation der Zeichenreferenz schlechthin. 128 Bei Kristeva ist die Nomenklatur umgekehrt: Sie verwendet den Begriff „Symbol“ für die kontinuierliche, primäre, traumartige Produktion, jenen des Zeichens für die konventionalisierte gesellschaftliche Produktion. Die Frage der Ähnlichkeit des Symbols mit der bezeichneten Sache ist höchst zweifelhaft. Zwar ist das Kreuz jeder Kreuzung ähnlich. Aber die Trikolore ist nur mit sich selbst ähnlich und ist doch das Symbol der französischen Nation, sie bedeutet diese nicht, sondern repräsentiert sie. Roland Barthes zeigt 1964 eine kleine Liste der unterschiedlichen Nomenklaturen der einfachen Arten des Zeichens. In: Ders.: Elemente der Semiologie, a.a.O., S.32.
6. VORLESUNG
anderen, sondern die einer Zeit in einer anderen Zeit – wobei grundsätzlich die szenische Zeit immer in die situativ normierte zurückfällt, sobald sie sich als solche konventionalisiert, also tatsächlich als reproduzierbar (semiotisierbar/konventionalisiert) erweist. Die normierte Zeit muß nicht die astronomische Zeit sein, es kann auch die des kapitalorientierten Warenverkehrs oder eines ganz anderen Mediums sein. Weil das unmittelbar affektiv Gegenwärtige nur als eine Negation gegeben ist – denn die unmittelbare Gegenwart ist nur die Grenze, die die Vergangenheit von der Zukunft trennt –, muss sich die Semiologie mit der Frage der Gegenwärtigkeit als Evidenz beschäftigen, das heißt mit der Verschmelzung von Bedeutendem und Bedeutetem – mit dem, was verweist, und dem, auf den die Verweisung trifft. Die Bedeutungserfüllung sei deshalb diejenige Relation, die die Grenze zwischen dem Anwesenden und dem Abwesenden als Gedächtnis vergegenwärtigt/differiert. Neu ist für die Tendenz zur Präsenzgesellschaft nicht die Medialisierung oder das Medium, sondern die Disparation des technischen Apparats gegenüber seinen Ableitungen. Alle Ableitungen, die durch Produktion negiert sind, müssen im Gebrauch neu erfunden oder als sinnliche Korrespondenzen erzeugt werden. Da der Sinn niemals stattgefunden hat (oder in den Mikrostrukturen der Elektronik eingewandert ist), kann er auch nicht finalisiert werden. Was dem Apparat als Schnittstelle bleibt, ist die Verweisung von Tastaturen und revueartig angeordneten Zeichenfunktionen. Einen solchen Apparat, der sich selbst dispensiert und mensuriert, hat Brecht zur Aufklärung seinem Publikum im situativen Theater zugemutet und Sartre als Theater der Situation bezeichnet: Es ging darum, das Publikum an der Entstehung der Szene aus der Praxis teilnehmen zu lassen, also eine de-inszenatorische Wirkung als Inszenierung banaler, und eben nicht als inszeniert empfundener serieller Handlungen zu kritisieren. Das Publikum soll selbst in die Rolle des Produzenten/Intendanten treten, statt passiv zu genießen. Brecht entwickelt eine Theorie der Imitation oder Nachahmung, die sich zunächst an der Struktur der Filmkomik orientiert, bei der diejenigen Züge einer Person hervorgetrieben werden, die sich zu einem scharfen Bild fügen. Die Szene wird als ein selektives Konstrukt begründet – und nicht als möglichst vollständiger Ausschnitt. [...] Die paradoxe Einsicht, dass gelungene Imitationen gerade keinen vollständigen, sondern selektive Darbietungen sind, ist aber noch keine Lösung für den Übergang der Straßenszene von der Straße auf die Bühne. Hier ist ja nicht Komik, sondern Kritik der Verhältnisse das Ziel.129
Brecht steht vor der Situation, in einer theatral zubereiteten Konsumsituation die Szene als Entwurfseinheit dem Publikum zur Realisierung vorzustellen, und aus dem Theater wirkliche Handlungen folgen zu lassen. Das Gelingen dieser Agitation entgegen den äußeren Situierungen eines theatralen Rituals (ein Stück wird gespielt, Eintritt wird verlangt, man versammelt sich in einem zur Bühne ausgerichteten Blickraum) sei dahingestellt – Pirandello hat ein solche Desituierung schon wirkungsvoller inszeniert130 und der Film setzt nach wie vor auf eine konsumative Haltung. Brecht hat die Problematik der Desituierung durch den theatralen Ritus, 129
Christians, Crux Scenica, a.a.O., S.121.
130 So in Luigi Pirandellos Stück Sechs Personen suchen einen Autor. Insbesondere legt Pirandello Wert
auf die Geschlechterbeziehung der Personenkörper.
87
88
6. VORLESUNG
die spätere Performances durch Aufführungen auf öffentlichen Plätzen (Interventionen) scheinbar spontan aufzuheben versuchen, wohl erkannt. Aber auch das bedeutet nur eine Rückkehr zur Commedia dell’Arte des Barocks, in der zwar die Charaktere scharf sind, die Handlung aber höchst spontan und an den aktuellen Ereignissen orientiert erfolgt – ein Aktualitätsbezug, der dem bürgerlichen Theater des ausgehenden 19. Jahrhunderts allmählich abhanden kam.131 Die Straßenszene, die größere Ausschnitte geben muß, kommt hier in Schwierigkeiten, die nicht unterschätzt werden dürfen. Sie hat ebenso tüchtig Kritik zu ermöglichen, aber sie muß das besorgen für viel komplexere Vorgänge. Sie muß positive und negative Kritik ermöglichen.132
Auch wenn hier unter „positiver“ und „negativer Kritik“ ein Werturteil über die Qualität der Aufführung gefällt wird, hat die Unterscheidung zwischen „gutem“ Stück und „schlechter“ Inszenierung Priorität. Sonst würde die theoretische Propädeutik des Engagements Brechts für ein „natürliches Straßentheater“, das sich technischer Mittel im Inszenierungsraum „Theater“ zu bedienen hat, um dessen szenische Wirklichkeit markieren zu können, zusammenbrechen. Brecht sieht also sehr genau, dass der „Realismus“ der Naturraums „Bühne“ (also deren Situiertheit, deren Konventionalität) schon durch die Technik seiner einschließenden Ausschließung (Architektur, Institution, Bühne etc.) bestimmt ist – und zwar genau so, wie die angebliche Alltäglichkeit der Straße. Auch sie ist durch die Techniken des Kapitals, der Industrialisierung, des Wissens, der Zeichen disponiert. Im Folgenden wäre den Spuren nachzugehen, die neue Bühnenarrangements hervorbringen und eben wieder die Straße (Fussgängerzone) entdecken. Doch die Geschichte dieses Begriffs der Szene interessiert uns hier nicht.133 Die Spuren der Verweisung einer Ableitung der Zeichen bestimmen sich durch den Umgang mit Dingen, von denen die technischen Medien am direktesten von der Schärfe und Dimension der Zeichen – also von ihrer Differentialität – profitieren. Man soll – so Brecht – aus der positiven Struktur der Merkmale der bekannten Signifikationen auf das in ihnen Mögliche, Andere schließen. Diesem Schluss auf ein fehlendes oder falsch platziertes Element in der Reihe der gewohnte Merkmale, also der Szenifikation von Situationen, hat sich die semiotische Analyse gewidmet. Sowohl die Hermeneutik, die nach dem Sinn des Ganzen fragt, als auch der Strukturalismus, der der Ganzheit die Präferenz vor dem Element gibt, ist davon geleitet, zwischen dem Verstehen und dem Erklären einen Abschluss zu finden, eine Identität. Das heißt aber nichts anderes, als dass zwischen dem Allgemeinen (der Straße) und dem Besonderen (dem Ereignis und seiner szenischen Entzerrung und Deplatzierung) ein Agon um die Verzeitlichung geführt wird – und keinesfalls nur 131 Von Hugo bis Zola rekrutierte sich der Roman vor allem aus den Tagesaktualitäten des Schauspiels
und der Tageszeitungen. Siehe u.a. die Biografie von F. W. Hemmings: Emile Zola. Chronist und Ankläger seiner Zeit. München 1979. Balzac hat diesem stets nach Aktualität gierenden Treiben in seinem Roman Die verlorene Illusion ein einfühlsames Gesicht gegeben. 132 Christians, Crux Scenica, a.a.O., S.121. 133 Zu moderneren Bühnenformen vgl. Nebojša Tabaˇcki: Kinetische Bühnen. Sean Kennedy und Josef Svoboda – Szenografen als Wiedererfinder des Theaters. Szenografie & Szenologie Bd.10. Bielefeld 2014.
6. VORLESUNG
um die Zeit der Gegenwart, sondern auch um die Bedeutung der Zukunft für eine Modifikation der Vergangenheit. Fiktionale Entwürfe und Archive sind also gleichermaßen von der Umdeutung der Agitatoren bedroht und entwickeln aus dieser Bedrohung heraus ritualisierte Inszenierungen/Instituationalisierungen ihrer Bedeutungslegitimation, gegen die es Agitatoren selbst vom Schlage eines Brecht schwer haben. Wir greifen jetzt schon sehr weit vor auf die komplexe Funktion und Ordnung der Zeichen und ihre Abhängigkeit von einem universellen Kontext. Den für unsere Sichtweise relevanten Kontext der Situativität haben wir nicht „Umwelt“134, sondern „Praxis“ genannt. Die Praxis ist die Dimension der in Evidenz aufgegangenen Realisierungen/Serialisierungen – dessen, was nicht in Frage steht, was dauert. Das Produkt der Wiederholungen hier ist im Gedächtnis des Gebrauchs der Dinge verwahrt. Die Dinge sind Zeichenkörper ihres Gebrauchs. Das Zeichen setzt eine Produktion von Wirklichkeit als elementare Norm der Gesellschaft voraus, die sich in ihm als das Anwesende zu erkennen gibt. Wenn also ursprünglich die Semiotik als eine Theorie der Ordnungen verstanden wurde, können wir sie in einer „Szenologie“ als eine „Ordnung der Unordnung“, genauer: als eine „Ordnung der Präsenzen“ auffassen. Seit ihren Anfängen neigen die Theorien des Zeichens dazu, prospektiv und retrospektiv Zeit in Sinn umzusetzen, also Ordnung in den Verlauf der Geschichte zu übersetzen. „Bedeuten“ heißt ja immer, auf eine vergangene Ordnung mit einer zukünftigen (vom Anderen, Referenten zu vollziehenden) Zuordnung zu verweisen. Theorien sind, wie alle Artikulationen von Wissenschaft, auf Eindeutigkeit geeicht. So war auch das Kernproblem der Zeichentheorien ein Paradox: Man wollte festlegen, welcher Ordnung Zeichenrelationen angehören sollen, musste aber zugleich die Regeln der Veränderung dieser Ordnung erklären. Arbeitsteilig kann im Groben festgestellt werden, dass die strukturalistisch orientierte Semiotik sich mehr an den anthropologischen Ordnungen der Kultivierung von Zeichen als Repräsentationen orientiert, während eine deutungsorientierte, hermeneutisch orientierte Semiotik mehr den irregulären, individuellen und situativen Ausdeutungen der Zeichen den Vorzug gab. Beide Interpretationen, so haben wir bei Derrida gehört, zielen auf Erfüllung respektive Identitätsfindung dessen ab, was als Mangel der Produktionsanlass von Bedeutung ist. Sie verfehlen also systematisch das Wesen des Zeichens. Oder vielmehr, sie invertieren es systematisch, indem sie nicht auf die Frage, sondern auf die Antwort zielen. Seit der poststrukturalistischen Umorientierung der Semiologie als einer Theorie der Produktion von Bedeutungen (Kristeva, Baudrillard) oder Ordnungen, wie Foucault sagt, wird der Blick auf die systemimmanente Unabschließbarkeit und auf die Gewalt der Bedeutungsdisziplinierung als Wissen gelegt. Das Zeichen selbst ist eine Relation aus beiden Ordnungsorientierungen: Es ist individuell in jeder Situation verwendbar und muss zugleich die Singularität jeder Situation in ein allgemeines, kommunizierbares Netz an Bedeutungen für Andere repräsentieren. Jedes Ereignis, so einmalig es auch sei, muss, um kommuniziert wer134 Zumal der Begriff „Umwelt“ eigentlich dem biologischen Diskurs entstammt, jener der „Praxis“ dem kulturellen Diskurs.
89
90
6. VORLESUNG
den zu können – das schließt die eigene Bewusstwerdung über das Ereignis mit ein –, in diese Relation von individueller Allgemeinheit eintreten. Es muss codiert sein, also einer gesellschaftlichen Konvention oder Regel sich unterwerfen. Dass geschieht sogar mit den Träumen: An ihnen ist nur mitteilbar, was dem szenischen Modus der Umarbeitung in Darstellbarkeit unterworfen ist – was einschließt, dass man Träume natürlich auch anders medialisieren kann als in der gesprochenen Sprache, nämlich etwa im Film.135 Individuation und Allgemeinheit sind nicht dialektisch aufeinander bezogen, sondern sie sind es gesellschaftlich und ökonomisch.
135
Zur Übersicht siehe Hans Ulrich Reck: Traum. Enzyklopädie. München 2010, S.231ff.
7. VORLESUNG Eine Medientechnikgeschichte – Das Subjekt als Membran der Feldebenen – Sprechen, Schreiben, Lesen sind technische Vorgänge – Saussures Demokratisierung der Zeichen – Semiologie ist Politik der Werte und Intensitäten – Praxis ist der Fond des seriellen Funktionierens der Gesellschaft
Gehen wir ein wenig auf die Medientechnikgeschichte ein, die eine bestimmte Ansicht des Codes der gesprochenen und geschriebenen Sprache beeinflusst hat. Es war eine der Auszeichnungen struktural orientierter Semiologie, auf die topologische Dimension und die topographische Beschreibung von Zeichen und ihrer Differentialität untereinander Wert gelegt zu haben. Historisch lässt sich diese topographische Metaphorisierung sowohl mit einer technisch-medialen Lösung der Dauer simultaner Ereignissen als auch mit der Beschreibung negativer, tabuisierter Wirklichkeiten durch die Anthropologen und deren Paradigma des Feldes136 rechtfertigen – eines Feldes, das die Szenografen heute gerne in Atmosphären auflösen möchten. Jedes Ereignis, das einmalig war und zur Eindeutigkeit drängte, hatte innerhalb des Feldes – ein zuerst militärischer Begriff – seine „dunkle“ Seite, sein „Negativ“ gesellschaftlicher Bedeutungsverleihung. Auf dieser ersten Ebene der nachbarschaftlichen Beziehungen baute sich eine zweite der hierarchischen Beziehungen auf. Die Fotografie lieferte vor der szenischen Kinematik das Paradigma des Positivs, indem sie Realität konstruiert, die Psychoanalyse des Unbewussten, die nicht erst bei Freud beginnt137, liefert das Paradigma des vertikalen Negativs. Vor allem Lacan hatte diesen linguistischen Aufbau des Feldes bearbeitet. Das Leben des Subjekts war nun nicht mehr als Weg der narrativen Progression, sondern als Membran zwischen diesen Feldebenen zu beschreiben: Es wurde zum topologischen Nomaden, dessen Bezugnahme eine Topologie der Zeit, also der Verwandtschaft und Nachbarschaft von Ereignissen korrespondierte. Die Begriffe „Welt“ und „Umwelt“138 reüssieren als Daseinsbegriffe der ersten Ebene und substituieren Zeitweise die Begriffe von „Ich“ und „Anderem“. Auch der Fokus der Zeit veränderte sich. Mit der Entwicklung fotografischer Techniken konnte in einem situativen Augenblick eine Szene als 136
Den Feldbegriff hat vor allem Kurt Lewin in die psychologische Forschung gegen den Assoziationsbegriff eingeführt, der eine Markierung der Wiederholung meint, also das, was Saussure „Konventionalisierung“ und „Ritualisierung“ nennt. Lewin war der Meinung, dass die Person in einem Spannungsfeld handelt, sodass zunächst die Sequentierung der Zeit und dann die Selbst- oder Fremdinitiation (Wunsch oder Reiz) der Handlung dieses Spannungsfeld bestimmt. Das lässt sich durchaus mit dem Begriff des „szenischen Handelns“ beschreiben, da hier das Moment der situativen Übertragbarkeit dominiert. 137 Vgl. Henry F. Ellenberger: Die Entdeckung des Unbewußten. Geschichte und Entwicklung der dynamischen Psychiatrie von den Anfängen bis zu Janet, Freud, Adler und Jung. Bern 1996. 138 Siehe Martin Heidegger: Anmerkungen zu Karl Jaspers „Psychologie der Weltanschauungen“ (1919/21). In: Ders.: Wegmarken. Frankfurt am Main 1976, S.1-45. Heidegger entwickelt diesen Begriff entgegen dessen biologistischem Gebrauch.
92
7. VORLESUNG
reproduzierbare Gegenwart dispariert werden. Trotz aller magischen Evokationen139 war die Fotografie die Begründerin einer realistischen, positiven Weltsicht. Sie zeigt das Anwesende als Bedeutsames. Die Präsenz eines Augenblicks war nicht mehr nur durch eine Zeit verbrauchende Kette von Beschreibungen (oder Bemalungen), sondern durch den simultanen Akt einer Szenifizierung darstellbar. Das Foto verlagerte die Szene, die „einen Anfang, eine Mitte und ein Ende“140 hat, in ein strategisches Zeichenfeld. Genau genommen handelt es sich bei der Fotografie nicht um eine Szenifizierung141, sondern um eine Situierung, in der der Ausschnitt der Zeit keine Handlungsbewegung zeigt. Diese Situierung war maßgebend für die Normierung des Sehens durch optische Apparate schlechthin; es war ein topografisches Zeigen, kein typografisches Lesen. Nicht mehr Anwesenheit und Abwesenheit waren der Tauschnutzen des Zeichenensembles, sondern Gleichzeitigkeiten: Dieses und Jenes waren parallel und simultan zur Ansicht gestellt, d.h. die Zeichen konnten vergleichend zur Schau gestellt werden. Die Parallelprojektion der Kunstwissenschaft verfeinerten diese Verfahren mit Hilfe der Diaprojektion. Das Foto stand nicht im Rang der Kunst, es war Handwerk. Doch waren die innovativen optischen Veränderungen der Weltbildgebung nach wie vor durch ein diachrones, narratives Sprach- und Textmonopol – etwa auch im Medium der Postkarte, in der die allegorischen Momente, von Pictura, Motto, Subscritio wieder auftauchen – dominiert. Die Elektrifizierung der Zeichengebung und die Synchronisierung der Uhren in der vereinheitlichten Eisenbahnzeit gegen Ende des 19. Jahrhundert142 können als Indizien benannt werden, in der die Gleichzeitigkeit des Zeichens überhaupt erst theoretisch zu denken war. Re-Produktion gleichartiger Serien, wie sie die Industrialisierung auch des Sehens schafft, heißt aber stets auch Verdrängung der Präsenz zugunsten einer „dahinterliegenden“ apparativen Bedeutung. Die Zeichentheorien sahen nun ihre analytische Aufgabe gerade darin, die Gleichzeitigkeiten zu entzerren – sie in einer Szene in räumlicher Ausbreitung erfahrbar machen zu können, deren Opponenten die Form und die Apparatur waren, also der Geist des Sinns und die Materie der Sinnlichkeit. Die Chronofotografie und Mareys Experimente sowie eine Unzahl von Vorformen kinematografischer Systeme dienten letztlich dazu, diese Opponenten zweier fotografischer Ereignisse zu kontinuieren. Der Film ist in Vertauschung der Reihenfolge des historischen Erscheinens die natürlichere Variante die Fotografie eine Abstraktionsform. Die Deutungsverweisung geht hier endgültig zu Gunsten der Inszenierung verloren. Der Film bildet nicht ab, er erschafft neu: Er ist die höchste der divinatorischen Techniken. 139
Zum Beispiel Max Dauthendey: Des Teufels Künste (Leipziger Stadtanzeiger). In: Wolfgang Kemp (Hg.): Theorie der Fotografie Bd.I 1839-1912. München 1999, S.68-70, hier S.68: „Flüchtige Spiegelbilder festhalten zu wollen, dies ist nicht bloß ein Ding der Unmöglichkeit, wie es sich nach gründlicher deutscher Untersuchung herausgestellt hat, sondern schon der Wunsch dies zu wollen, ist eine Gotteslästerung.“ 140 Christians, Crux Scenica, a.a.O., S.22ff. 141 Daneben gibt es eine inszenierende Fotografie, die darauf aus ist, die Geschichte lesbar zu machen in dem, was an Brüchen, an Arrangements angeordnet wird. Diese Fotografie ist allegorisch, weil sie unterschiedlichste Zeitgestalten (Moden, Historien, Stile) versammelt oder aktualisiert. Die Szene ist hier also ein negatives (synchrones) Moment der Lesebewegung des Beobachters, nicht des Objekts selbst. 142 Die Mitteleuropäische Eisenbahnzeit (MEZ) wurde erst im Juni 1891 verbindlich eingeführt.
7. VORLESUNG
Unter philosophischen Aspekten war sicher die Gleichzeitigkeit von Wahrnehmen und Erkennen die ästhetisch relevanteste, die im Simultanverhältnis von Sache und Begriff seit je den Wahrheitsgehalt einer Aussage, also ihre Äquivalenzoder Tauschbeziehung auszeichnen sollte. Wobei die fotografischen Verfahren eben jenen Wahrnehmungsgegenstand normierten, dem das Erkennen als seine Bedeutungszuweisung hinterherhinkte. Wir werden sehen, dass Sartre diese Differenz später umkehrt: Gerade die logische Trennung ist verantwortlich für die Verzeitlichung der Unterscheidung von Wahrnehmen und Bedeuten. Sartre baut auf dieser Umkehrung und Einführung einer präreflexiven Produktion (ähnlich wie Freud und Kristeva) seine Hermeneutik auf. Die Verspätung ist demnach das Resultat einer Zeichendifferenz, deren Bedeutung die Zeit ist. Wir sehen, auch hier steht der Wunsch nach Eindeutigkeit und Ordnung im Vordergrund: nicht aus Gründen der Statuierung einer normativen Macht, sondern im Gegenteil aus Gründen der allgemeinen kapitalorganisierten Tauschbarkeit auch der ikonischen Medienprodukte, letztlich also des Tauschereignisses selbst als Basis von Vergesellschaftung, die sich nicht magisch konstituiert. Eine strukturale Linguistik, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts ausgearbeitet, löste auf ebenso elegante wie unzureichende Weise das Problem der Relationalität der Zeichen untereinander, indem sie die Bedeutung als Effekt dieser wie auch immer umfänglichen differentiellen Gleichzeitigkeit beschrieb und benannte. Die Analyse der simultanen Zeichen präferiert nicht eigentlich den Text, sondern die Karte als Feldinstrument. Das wird augenfällig an der Diagrammatik der Wiener Schule um Otto Neurath und den Inszenierungskult der Ware.143 Die Semiotik folgte damit einem der relativistischen Physik nicht unähnlichen Weg, den Einstein in der Formulierung seiner allgemeinen Relativitätstheorie 1915 jedoch schon wieder verlassen hatte. Basis strukturaler, sich von der Linguistik emanzipierender Semiotik war nämlich der konkrete, an einen realen Raum und an eine physikalische Zeit gebundene naturwissenschaftliche Wissensbegriff. Aber diesen Raum und diese Zeit hatten erst die Übertragungsmedien geschaffen. Am Anfang der Sprachen stand niemals eine vorbabylonische, ideale Ordnung der Sprache, sondern die Praxis einer je individuellen Situation. D.h. hier musste erst einmal reflektiert werden, dass unter den analysierbaren Veränderungen des Sehens durch die Fotografie – des Sprechens durch Morse und Bell – auch die Sprache als gesprochener und geschriebener Diskurs medial im Sinne eines technischen Mediums aufgefasst werden konnte; kurzum, dass Sprechen, Schreiben und Lesen eminent technisch-logische Vorgänge sind. Den Rahmen der Linguistik zu verlassen, bedeutete, die operativen Funktionen des Zeichens in Abhängigkeit von den medialen und technischen Codes der Medien aufzugreifen. Nun wurden die Massenmedien die 143 Otto Neurath kann als Szenograf der ersten Stunde angesehen werden, der sein theoretisches Wissen ganz in den Dienst der praktischen Umsetzung einbrachte. Unvergleichlich sind immer noch seine Landkarten und Bildstatistiken, die den ideologischen Charakter jedes Zeichens offenbaren. Vgl. Hadwig Kraeutler: „Es war nicht üblich, Daten und ‚Botschaften‘ in Erlebnisräumen umzusetzen ...“. Zur Aktualität von Otto Neuraths Museums- und Ausstellungsarbeit. In: Tabellen, Kurven, Piktogramme. Techniken der Visualisierung in den Sozialwissenschaften. Mitteilungen des Instituts für Wissenschaft und Kunst 1-2/2009. Wien 2009, S.43-61.
93
94
7. VORLESUNG
metaphorische Basis, um Sprache zu beschreiben. Wie Sprache und Literatur sich unter technischen Verhältnissen wandeln, kann man sich an Hemingways Schreibstil verdeutlichen, der im Paris nach dem Ersten Weltkrieg seine Artikel an kanadische Zeitungen per teurer Telegrafie durchgeben musste und so jedes Wort vermied, das der Redakteur jenseits des Atlantiks nicht auch „divinieren“ konnte. Das bedeutete einen Verlust an konnotativen Redundanzen und prägte einen lakonischen Realismus. Wie Einstein also an der Konstanz von Raum und Zeit zu zweifeln begann und sie von der Verteilung der Energie und Masse abhängig machte, so zweifelten Saussure und Peirce unabhängig voneinander an einer Gleichverteilung von Dingen und Begriffen im Raum der Sprache. Sie besannen sich auf qualitative Unterscheidungen, auf Intensitäten/Werte der Zeichen, d.h. auf die Nähe und Ferne eines Signifikanten als simultane, aber virtuelle Glieder im Raum sprachlichen Prozessierens, d.h. sprachpragmatischer Übertragung, in der übrigens Redundanzen gerade nicht überflüssig sind. Wie ein Zeichen diskret und intensiv zugleich sein kann, das war eine ganz andere Frage, die jene der aisthetischen Ähnlichkeit, der Mimesis an den Rand drängte. Nachbarschaften, Verwandtschaften, Exotismen und Machtspiele waren plötzlich nicht nur in der Sprachtheorie, sondern vor allem in den Ethnologien im Gefolge der Kolonialisierungen in Mode. Lévi-Strauss, Übervater der strukturalen Anthropologie, zielte darauf ab, den Menschen als Zeichen unter Zeichen zu denotieren. Als Resultat dieser wechselseitigen Tauschoptionen von Raum, Zeit und Identität konnten weder der historische noch der topologische Raum objektiv gegeben sein – das war auch keine Frage der Tiefenschärfe des Blicks mehr –, sondern die Koordination des „Menschen in der Welt“ sich nach der „Macht“ ihrer Bedeutung in einem sozialen Kontext der „Massen“ richtete. Mit „Schwere“ ist dabei die Dauer einer Regel, Konvention, Ordnung, eines Verhaltens oder Gesetzes gemeint – mit „Masse“, die Konformität der in den normierten Gesten der Zeichendisziplinierung konventionalisierten Formen. Der geografische Sprachraum war zu einem sozialen Sprachraum hin geöffnet. Seine Ähnlichkeit mit dem Raum der Allgemeinen Relativitätstheorie war frappierend. Muss man in der Relativität des Zeichens nicht ein allgemeines Gesetz erkennen?144 Es dürfte in dieser kurzen historischen Unterwanderung der Zeichentheorien durch Medienpraktiken einsichtig geworden sein, wohin unsere Argumentation führen soll: Der „Sprachraum“ muss in der Gesellschaft, die mit synchronisierten Echtzeitmedien hantiert, als relative „Sprachzeit“ transformiert gedacht werden. Die Topologie linear/simultan soll nicht nur diachron/synchron aufgefasst werden; Sprache/ 144
Insbesondere die Welle/Teilchen-Dualität der Quantenphysiker reizt zur Parallelität mit dem Zeichenbegriff, etwa bei Gaston Bachelard: Der neue wissenschaftliche Geist. Frankfurt am Main 1988, S.93: „Wellen- und Partikelbild lassen sich also nicht vereinigen. Klar sind sie nur, wenn man sie trennt. Letztlich sind beide nur Bilder und können nicht den Anspruch erheben, eine tiefere Realität darzustellen.“ – „Warum sollte man nach einer kausalen Verbindung zwischen Welle und Teilchen suchen, wenn es sich nur um Bilder handelt, um zwei verschiedene Sichtweisen ein und desselben komplexen Phänomens?“ (S.97)
7. VORLESUNG
Zeichen und Zeit/Bewusstsein müssen als zwei Manifestationen eines Prozesses begriffen werden. Sprache und Zeit sind im Zeichengedächtnis als zwei Seiten der Verzeitlichung zu verstehen. Damit wird weder die generativ argumentierende Linguistik noch die historisch argumentierende Medienwissenschaft diskreditiert. Im Gegenteil: Ihr Darstellungsrecht haben diese Methoden aufgrund der Möglichkeit, dass Verweisungen soziologisch betrachtet immer Verweisungen/Differentiationen/ Auf- und Verschübe der Verzeitlichung sind, die durch die Art der Verweisung heute von einer synchronen Weltzeit aus gedacht und praktiziert werden. Wir haben es also mit einem durch und durch dynamischen System zu tun, dessen analytische Ausweispflicht darin besteht, jeweils den Verweis mitzuliefern, auf welche Zeitlichkeit und auf welchen diskursiven Raum sie sich beziehen. Der Ideologieverdacht einer jeden Semiotik ist in dieser Hinsicht kein Nachteil gegenüber sogenannten objektiven Wissenschaften, sondern ein offensichtlicher Vorteil. So kann Roland Barthes etwa die spezifische Vorgehensweise von Saussure mit dessen „Aufwertung der Analogie“ und „Abneigung gegen den Genetismus“145 begründen. Wenn der etymologische Prozess zugunsten nachbarschaftlicher Konfigurationen substituiert wird und die Topologie den Vorzug vor der Zeit gewinnt, kann Barthes die entsprechende Ideologie „demokratisch“ nennen. D.h. aber, das eigentliche Bezugssystem der Zeichen ist weder der Raum noch die Zeit im Modell der Übertragung, sondern das der politischen Gesellschaftsform, d.h. der Geltung der Zeichen in diesem „Milieu“, dieser Vergemeinschaftung, dieser Umwelt. Barthes annonciert damit auch, dass Geltungen und Bedeutungen keine objektive, sondern situative, d.h. ideologische Merkmale sind, die Saussure in eine Szene des theoretischen Entwurfs für eine strategische Zukunft in der Zeit ausrichtet. Dieses Strategem ist aber das der Politiken insgesamt: Sie stellen eine bestimmte mögliche Zukunft in Aussicht, deren Repräsentanten die Referenten der Verwirklichung, d.h. der Bedeutungsfestlegung dieser Zukunft sind – egal ob diese Zukunft sich realisiert oder nicht. Diese Überlegungen lassen in Saussure den Genfer Demokraten erkennen. Die Formulierung dieser Politiken der Werte und Intensitäten der Zeichen ist der eigentliche Sinn der Selbstkritik der Semiologie – nicht die Errichtung einer Nomenklatur, wie Barthes unzweifelhaft vor Foucault erkannt hat: Der Raum des Wortes ist nicht mehr der einer Abkommenschaft oder Nachkommenschaft, sondern der einer Seitenverwandtschaft: die Elemente der Sprache – ihre Individuen – stehen einander nicht mehr als Söhne, sondern als Mitbürger gegenüber: Die Sprache, das sprachliche Werden, ist keine Lehensherrschaft mehr, sondern eine Demokratie: die Rechte und Pflichten der Wörter (die im Grunde ihren Sinn ergeben) sind durch die Koexistenz, das Miteinander gleichberechtigter Individuen eingeschränkt.146
Nun wird man das, was Barthes hier als ideologischen Sinn der (post-)strukturalen Semiologie anführt, von der strukturellen Logik der Korrespondenz zweier Hervorbringungen, der Dingproduktion als Produktion von Disparationen, und der 145 Roland Barthes: Saussure, das Zeichen und die Demokratie. In: Ders., Das semiologische Abenteuer, a.a.O., S.159-164, hier S.159. 146 Ebd., S.160.
95
96
7. VORLESUNG
Zeichenproduktion als Transposition unterscheiden müssen. Der Sinn enthüllt sich nämlich erst mit der Positionierung des Blicks auf die Kritik von Raum- und Zeitposition, also dem, was die Systemtheorie soziologisch „Unterscheidung der Beobachtungen“ nennt und was eine konsumatorische, synthetisierende Aufgabe sein soll. Die Beobachtung, die Referens, muss in der Theorie ebenso mit genannt werden wie die Messeinheit im Experiment, wie die Kalibrierung und der Fokus bei Mandelbrot. Als „Gemeinschaft“ soll dasjenige „System“ begriffen werden, dass dieser Sprachszene eine relative Dauer einschreibt. Wenn wir nun die Gesellschaftsformen und die Systeme weiter differenzieren, erfüllt sich Sartres Satz, dass jedes gesprochene Wort die ganze Sprache ist, ebenso wie die analytische Feststellung, dass die Interpretation auch nur eines einzigen Satzes die Semiologie als Ganze erfassen muss. Wir haben an der Schreibblockade Saussures und am linkischen Schreiben bei Peirce gesehen, dass dieser monadisch/fraktalen Idee eine andere Lösung folgen muss, als die der Übertragbarkeit von Situationen. „Schreiben“ heißt „Prozess und Produkt synchronisieren“. Synchronisation ist Aufgabe der Choreografie, der Regie und der Inszenierung. Die Synchronisation totalisiert eine Synthese, deren Sinn sich produziert und unter dem Einbruch einer situativen Simultaneität leicht wieder zerfällt. Denn wir denken die Szene ja nicht mehr in einer astronomischen Zeit, sondern in vielen Verzeitlichungen von parallelen, gleichzeitigen Ereignissen. Z.B. hat sich für den Spielfilm in Analogie zum Theater eine narrative Spanne von ca. 90 Minuten herausgebildet, die wiederum in fünf oder sechs dramatische Einheiten unterteilt werden, die ihrerseits – je nach Genre – auf 120 bis 300 Szenen und noch mehr Schnitten festgelegt sind.147 Während dieser 90 Minuten kann der soziale Sprachraum unter hinreichendem Inszenierungsdruck nicht nur zusammengehalten werden, er kann sich auch in Industrie, Architektur und Kunstform als Kino körperaffin institutionalisieren.148 Wir bemerken, dass in dem Moment, in dem man über zeitliche Codierungen und Kontinuitäten spricht, die Zeit temporalisieren, choreographieren und sie einer einheitlichen Frequenz unterwerfen muss, die Maßsysteme den Sinnen angepasst werden müssen, innerhalb derer sich Differenzen abspielen. So kann jeder Spielfilm mit der Zeiteinheit von 24 Bildern pro Sekunde alle Bedeutungsinhalte kommunizieren, da das Auge die Einzelbilder nicht mehr wahrnimmt, während die CPU eines Computer, dazu im Gigaherzbereich synchronisiert ist. Der Takt und die Synchronisation der Ereignisabfolgen, also die Codierung wird wesentlich für den Begriff des technischen Mediums. George Spencer Brown formuliert 1969 in Laws of Form den berühmten Imperativ, mit dem eine jede Synchronisation als eingeschlossenen Ausschluss beginnt: „Mache eine Unterscheidung!“ Mit 147 Vorlage dieser mythischen Form ist der von Campell beschriebene Kreislauf des Helden (In: Der Heros in tausend Gestalten. Frankfurt am Main 1999, S.237). Vgl. Syd Field: Das Handbuch zum Drehbuch. Übungen und Anleitungen zu einem guten Drehbuch. Frankfurt am Main 1998. Die sogenannten Plot Points sind in der Regel über den 90-minütigen Spannungsbogen nach Maßgabe der mythischen Konflikte verteilt. Selbstverständlich spielen auch physiologische und ökonomische Gründe für die Länge eines Kinofilms eine Rolle. 148 Dass man diese Sequenz von 90 Minuten beliebig ausweiten kann, zeigt sich nicht nur im Kino, sondern auch etwa an der akustikbedingten harten Bestuhlung des Bayreuther Festspielhauses und der dort im Wagnerrhythmus angeordneten Toilettenpausen. Man kann ohne Umschweife behaupten, letztlich sind es die Sinne und die Körper, die die Szene beherrschen und zuweilen den Sinn dominieren.
7. VORLESUNG
diesem Imperativ, der die Frage nach Autorschaft, Herrschaft und Akzeptanz des Referenten und Referierten gerade nicht stellt, sondern sich selbst als ein freies Angebot inszeniert, ist mehr gemeint, als eine freundliche Aufforderung zur Wahl. Jede Wahl zeitigt Folgen, indem sie andere Wahlen wahrscheinlicher macht und somit den Grad der Selektivität zunehmend individualisiert. Wer oder was hat wann und unter welchen Bedingungen die Unterscheidung anzuordnen? Zuerst meint Brown lediglich, dass man in gesellschaftlichen Systemen praktischerweise nicht alle theoretischen Wahlmöglichkeiten und Bedeutungstiefen ermessen kann, wenn man nicht einfach einmal irgendwo beginnt. Dieses Beginnen (thesis) hebt sich jeweils von einer situativen Praxis ab, die als gesellschaftliche Konventionen sich von selbst verstehen. Der zeichentheoretische Pragmatismus der Systemtheorie geht von Ordnungen oder Strukturen aus, die nicht zuerst stabil sind und dann verändert werden können, sondern sie sind stabil nur in ihrer Veränderung. Dabei unterliegt die Stabilität ihrer Veränderung selbst einer Dynamik. Die Zweiseitenform der systemtheoretischen Unterscheidung geht von der Logik der Semiose wie folgt aus: Jede Entscheidung ist ein Akt der Bedeutungsbildung – derart, dass die Signifikationsbewegung immer vor einem dynamischen Fond (Situation) stattfinden muss, der als Umwelt des Systems synchron erscheint. Dieser dynamische Fond ist schlicht die Praxis des seriellen Funktionierens der Gesellschaft nach Maßgabe der medientechnischen Normierungen. Obwohl diese Zusammenhänge als Theorieentwicklung von der Linguistik über die Anthropologie, den Strukturalismus, den Neostrukturalismus bis zur Medien- und Systemtheorie geradlinig als Dynamisierung einer artifiziellen Statik zu verfolgen ist, hat man sich, soweit ich weiß, noch nicht die Mühe gemacht aufzuzeigen, wie man denn kohärent von der Saussure’schen Semiose zur Luhmann’schen Systemik gelangen kann – um nur diese beiden Protagonisten des Theoriefeldes zu nennen. Man darf nicht vergessen: Der theoretische Gesichtspunkt, nicht der interpretative wird von einer Konjunktur der Fortschrittsidee beherrscht, die eine Vorhersehbarkeit der Zukunft, d.h. ihre Einholung in Gegenwärtigkeit zu leisten verspricht. Die Wahl der Strategie der Theorie als Zeichenwert ist durch die Semiotiker, insbesondere Kristeva, immer wieder als ideologisch positiv gewendet worden. Der Imperativ „draw a distinction“ betraf im wirkungsmächtigen Ansatz von Saussure zunächst die Differenz von Signifikat und Signifikant, aber eben nicht das, was jede Unterscheidung als Anschlussoption unterscheidbar machte. Man hat sich bis auf den exilierten Bereich der Informatik mit seinen eindeutigen Zeichenbeziehungen stets davor gescheut, die Semiotik in eine vergleichende Wissenschaft, eine Semiologie aller Sprachen, also aller Techniken zu überführen. Erst eine solche Semiologie könnte eine kulturwissenschaftliche Begründung des spezifischen Deutungsspielraums menschlicher Sprache angeben. „Ähnlichkeiten“, wie sie Saussure verfolgt, garantieren keine wissenschaftliche Methodik im Sinne mathematischer Äquivalenz. Hier bleibt, was Roland Barthes früh geahnt hat, die Semiologie eine interpretierende Wissenschaft, deren Beobachtungstechnik durch die Montage und Kristallform des experimentierenden Essays charakterisiert wird.149 149 Der Essay bestimmt seinen Gegenstand durch Gebrauch, nicht durch Methode. Vgl. Theodor W. Adorno: Der Essay als Form. In: Ders.: Noten zur Literatur I. Frankfurt am Main 1969, S.9-49,
97
98
7. VORLESUNG
Politisch ging es den Semiotikern der 1960er Jahre um eine objektive Beschreibung der Zeichenverhältnisse insbesondere der Waren- und Wertegesellschaft. So blieb es bis Anfang der 1960er Jahre bei dem Ansatz einer Semiotik ohne semiologische Perspektive: Theorie als strategisches, simulatives, modellhaftes Entwurfsgeschehen ist nur in der Antizipation oder der Retrospektion einer Praxis verifizierbar. Wenn aber in jeder Phase der technischen Kommunikationsentwicklung auch die semiotische Betrachtung sich wandelt oder die Opponenten der Semiose sich ändern – muss man dann nicht die Frage nach der Bedeutung der Geschichte, also den Kontingenzen als zentral ansehen? Zumindest die virtualisierte Echtzeitkommunikation über elektrische Medien ist ein Codierungsumbruch, der in der Menschheitsgeschichte seinesgleichen sucht und den kopernikanischen Umbruch hinter sich lässt. Das heißt, dass die Kategorisierung von Zeichen in aufgehobenen Raum- und Zeitbezügen (Struktur und Genese betreffend) nicht nur den Menschen, sondern auch die Welten verändert.
hier S.29: „Wie der Essay die Begriffe sich zueignet, wäre am ehesten vergleichbar dem Verhalten von einem, der in fremdem Land gezwungen ist, dessen Sprache zu sprechen, anstatt schulgerecht aus Elementen sie zusammenzustümpern.“
8. VORLESUNG Zeichenverhältnisse als Tauschverhältnisse – Agon der Dissoziation einer Serie – Geld und Zeichen – Die theoretische und die praktische Perspektive – Eine Unterscheidung als Anfang setzen – Eliminierung des Anderen – Eigentumsform – Die Synthesen enden in der leiblichen Situiertheit – Stimme ist Experimentierraum politischer Vergemeinschaftung
Wir fragen in dieser Vorlesung, warum die Semiotiken (in ihren diversen Taxonomien der Opponenten) durch Diskursanalyse und Medienanalyse und systemische Modelle abgelöst werden konnten. Wenn vom Ende der Theorien überhaupt die Rede ist, muss dann nicht auch vom Ende der Retrospektion und der Prospektion die Rede sein? Theorien sind keine Darstellungen des Bestehenden, sondern Entwürfe einer situativen Vergegenwärtigung zukünftiger Szenifikationen. Theorien verstehe ich zunächst als abstrahierende Szenifikationen mit paradigmatischem oder metaphorologischem Charakter. Entgegen allfälliger Meinung von einer Getrenntheit von Theorie und Praxis behaupte ich, dass eine Theorie nur dann Relevanz hat, wenn das in ihr Intelligible den Sinnen unmittelbar zugänglich gemacht wird. Dem Wortsinn nach meint theoria „schauen“, seinem heute gebräuchlichen Sinn nach „überschauen“. Sie ist eine spezifische Art der Deduktion, um Sachverhalte im Hinblick auf eine realisierbare Praktik zu entwerfen. Schon ein Blick auf die Wettervorhersagen bestätigt die Ausweitung der Dimension der Präsenz, für die früher ein Blick aus dem Fenster genügte. Die Wettervorhersage ist eine theoretische, auf empirische Daten gegründete Prognostik, reszenifiziert in einen Kanon analoger Zeichen. Eine Theorie als dargestellte Erfahrungsleitung (d.h. implizite Statistik) ist heute durch die situative Erfassung der Daten und durch ihre Hochrechnung für viele Tage im Voraus szenisch, also mittels einer Darstellungstechnik zu erfassen. Der immense Zahlenbestand der Daten und ihre rekursiven Algorithmen sind es nicht. Es ist bezeichnend – oder eben gerade nicht mehr „bezeichnend“ –, dass heute nicht mehr die Barometer- und Temperaturangabe, sondern ikonische Sonnen, Wolken, stilisierte Regentropfen und eine Temperaturskala in Farben über das Wetter Auskunft geben. D.h., dass die allegorische Verkörperung oder Simulation des Wetters über die Gegenwart hinaus auf eine zukünftige Präsenz verweist. Die Zukunft wird so immer schon vergegenwärtigt. Semiotische Theoriebildung behauptet nun, statt der historischen oder kausalen Ableitungen solche der Nähe und Ferne, der nachbarschaftlichen Beziehungen der Signifikationsketten oder Strukturen, der Denotationen und Konnotationen des Zeichens analysieren zu können. Aber dem Sinnlichkeitsbereich sind nicht nur Dinge entzogen, die nicht da sind, sondern auch solche Dinge der Zukunft und Vergangenheit, gegen deren Modifikation gerade der Besitz der Dinge immunisieren soll. Die allgegenwärtige Signifikation des Wetters demonstriert, dass nicht der Text, sondern der (atmosphärische) Kontext der Inbezugnahme der Zeitlichkeit einer Technik der Rückversinnlichung bedarf. Als solche Technik dient Theorie, die stets von einer Taxonomisierung des Zeichens und der Bezeichnung begleitet ist.
100 8. VORLESUNG
Die Semiotik und vor ihr die Rhetorik haben für die wissenschafttheoretische und -pragmatische Selbstreflexion Merkmale ausgearbeitet, die den Abstraktionen ihrer zumeist dualer Werteoppositionen entsprechen: analog – arbiträr; konnotativ – denotativ; metaphorisch – metonymisch etc. Sieht man sich diese Definitionen bei unterschiedlichen Autoren an – das beginnt bei der Definition des Zeichenbegriffs –, so ist zu erfahren, dass die Taxonomie schon eine Interpretation ist. Dieses Schwanken der Begriffe ist leicht zu verstehen, wenn man bedenkt, dass „Gegenstand“ und „Sache“ in der Semiotik das gleiche Objekt haben. Mittels Zeichen werden Zeichen geordnet und verglichen. Der Inhalt ist durch sein Medium korrumpiert. Signifikat und Signifikant, daran hat die Schreibweise ↓Signifikant|Signifikat↑ im Cours de linguistique générale eines Saussure150 gemahnt, lassen sich jederzeit austauschen. Signifikanz und Insignifikanz unterliegen im Idealfall einer freien Unterscheidung im Sinne Spencer Browns. Zeichenverhältnisse sind Tauschverhältnisse: Den Zeichen des Wetterberichts soll (sinnlich) das Wetter entsprechen. Wenn gerade in der Linguistik auf die Arbitrarität der Formen hingewiesen wird, die sich aufgrund ihrer Willkürlichkeit gegenseitig stabilisieren müssen, so kann das nur in einem Formrahmen von Zeit oder Logik geschehen, mithin also in Narrationen, in denen diese beiden Rahmungen agonal konkurrieren. Diese Rahmungen haben seit je die Aufmerksamkeit der Semiotiker beflügelt. Denn sie nagen an der Elementaritätsbehauptung des Signifikanten, der nun selbst nicht mehr Herr über seine Verweisungen ist, sondern dies nur in „demokratisierter“ Nachbarschaft aufgrund von Ähnlichkeiten, Assoziationen und Regelungen kann. Die Elementarität des Zeichens weicht gegenüber seinem Kontext auf und erfordert ein Spektrum von rahmenden Begriffen, die zugleich die Situationen der Aufmerksamkeit präformieren: Wort, Satz, Text, Diskurs. Roland Barthes hat darauf aufmerksam gemacht: So wie die Linguistik beim Satz endet, genauso endet die Analyse der Erzählung beim Diskurs: In der Folge muß man zu einer anderen Semiotik übergehen. Die Linguistik kennt solche Grenzen, die sie unter der Bezeichnung Situation bereits postuliert – wenn nicht erforscht – hat. Halliday definiert die „Situation“ (in Bezug auf den Satz) als Gesamtheit der nicht assoziierten sprachlichen Tatsachen.151
„Situation“ bezieht sich also auf eine mediale Einheit der Zeitlichkeit, die als solche eben nicht opponiert werden kann: Sie ist dissoziiert, d.h., sie ist ihr eigener Kontext. Die Situation ist quasi ein temporäres „Für-Sich“ ohne Bedeutungsverweisung. Sie ist, was sie ist, nämlich die Praxis als Negat. Denn wenn auch der Satz mit den Sinnen gelesen wird, so ist es doch sein Sinn, der sinnlich vorgestellt wird. Das Korrelat des Sinn ist die Szene, das der Sinne das Bühnenbild, das folglich in seiner Gegenständlichkeit nur als Kulisse simuliert zu werden braucht. Sobald der Satz als Satz deklamiert wird, erscheint er szenisch. Die Szene ist also von einem Agon der Inversion und einem Zwang der Imagination begleitet. Dadurch erlangt sie ihren 150
Saussure, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, a.a.O., S.78.
151 Roland Barthes: Einführung in die strukturale Analyse von Erzählungen. In: Ders.: Das semiologische
Abenteuer, a.a.O., S.102-143, hier S.130.
8. VORLESUNG 101
narrativen Charakter: „Alles weist darauf hin, daß die treibende Kraft der narrativen Aktivität die Verwechslung von zeitlicher Folge und logischer Folgerung ist, das Nachfolgende in der Erzählung als verursacht von gelesen wird.“152 Die Szene ist folglich die Bezugnahme auf ein zeitliches Negat vor Anfang und Ende. Sie macht aber nur dann eine Situation bedeutsam, wenn die Serie der Praxis unterbrochen wird. Diese Unterbrechung, die Präsenz des Ereignisses, lässt die Inszenierungskraft der Szene dauern. Sie ist also ein Phänomen der Präsentifikation, der Ausdehnung, der Gegenwart als Gedächtnisform. Barthes liefert unter Bezugnahme auf die „Wichtigkeit des neutralen Begriffs oder des Nullpunktes“153 (nach Lévi-Strauss) den Hinweis, dass nicht mehr ein Tabu, sondern logische Serien an Stelle von narrativen Aktivitäten treten, die stets agonal sind: Einer theoretischen Prophetie der zukünftigen Ereignisse als Serie (der maschinellen Produktion) wird so ein temporal-logischer Agon als konsumativer Ort entgegengesetzt. Szenifikation ist sozusagen Konsum der Nullzeit der Gegenwart. Eine Kompensation der unsinnlichen (arbiträren) Zeichenprozesse lässt sich leisten, wenn man die weitgehend „automatische“, d.h. „situative, unbewusste Praxis“ mit der realen „Neutralität“ des Geldes als universellem Tauschmedium anreichert. Einem Geldstück ist der Zeichenwert in Zahlenwerten aufgeprägt. Er steht fest. Der Tauschwert, auf den es aber ankommt, wird durch den Tausch (Konsum und Produktion) festgelegt. Jeder, der am Tausch teilnimmt, verändert diesen Tauschwert, der in der Regel (außer bei sehr hohen Transaktionen an der Börse) nicht sinnlich erfahrbar ist. Auf der Seite der Waren ist uns aber durchaus klar, dass das Geld, das wir für eine Ware bezahlen, bei deren Rücktausch weniger Wert ist, da der Kauf den Gebrauch (Agon der Dissoziation einer Serie)als Besitz einschließt. Diese Wertverschiebung innerhalb der Bewegung (zwischen Tauschwert und Gebrauchswert – so Marx) sorgt dafür, dass Zeit und Raum nicht mehr objektiv, also als unendliche Serie, sondern relativ zur Geltung der Tausch- oder Vermittlungshandlung gesehen werden muss: als Handlungs- und Verhandlungsraum und eben in der Elementarität von Zeichen (Werteinprägungen). Mithin bestimmt das Geld, sofern es nicht einfach als Materie gehortet wird, sondern als Medium Geltung erlangt, seinen Wert, den es inhaltlich als Zahl aufgeprägt hat, durch den transzendierenden Akt des Tauschs. Das Geld ist also nichts anderes als das substantiierte Negat (Unbewusste)154 der agonalen Tauschformen. Der Hinweis auf die Wertbildung des Geldes sagt uns auch, dass der Zeichenwert und der Handlungswert zwei übersetzbare Phänomene darstellen. Zeichenhandlungen sind im Sinne der Performanz tatsächliche Handlungen. Kommunikationstheorien müssen, um Geltung zu erlangen, sich als Handlungstheorien bewähren, oder anders gesagt: Der pragmatische Charakter der Theorie als eigener Praxisform reguliert die Bedrohung einer willkürlichen Herrschaft der Zeichen, deren Implosion, indem sie den kreditierenden Rahmen liefert für eine nar152
Ebd., S.113. Ebd., S.177. 154 Die kühnste Auseinandersetzung mit der Analogie von Logik und Geldtausch vermittelt Alfred Sohn-Rethel: Das Geld, die bare Münze des Apriori. Berlin 1990, S.41. Die These ist, dass „Kopfarbeit“ Aneignungslogik sei und dass nur Produktionslogik die Einheit von Kopf- und Handarbeit (Handlungen und Bedeutungsbildung) leisten könne. 153
102 8. VORLESUNG
rative Logik der Zeit – eines „Es-wird-so-gewesen-sein-werden“. Theorie, die nicht auf eine zukünftige situative Relevanz aus ist, bleibt bloße Fiktion. So verstanden hat Barthes recht, wenn er das Angebot der Semiotik als eine Antwort auf die Bedrohung durch neue Techniken und Medien ansieht, in denen tradierte Bedeutungsriten in der Serialität mediatisierter Operationen unterzugehen drohen: als das Verschwinden eines sinnlich narrativen Nachvollzugs an dessen Stelle schockhaft erscheinende Signale Handlungen dirigieren ohne Synthesen zu kontingentieren. Offenbar ist davon schon bei Saussure einiges zu spüren. Die Semiologie kann als funktionales Phänomen155 eines Prozesses der Beschreibung betrachtet werden, der durch den seriellen Charakter der Produktivkräfte herausgefordert ist und sich im strukturalen Sinne dieser Serialität auch verschrieben hat. Das ist eine Folge der Willkür des Zeichens. [Arbitraritätsannahme Saussures; R.B.] Beschränkte man sich also auf die Bedeutung, so wäre die Sprache ständig von der Zeit, vom Tod bedroht; dieses Risiko ist die Frucht einer Art Ursünde – über die sich Saussure offenbar nie hinwegtröstet: der Willkür des Zeichens. Wie schön wäre diese Zeit, diese Ordnung, diese Welt, diese Sprache, in der ein Signifikant in alle Ewigkeit für sein Signifikat einstünde, in der der Lohn der „gerechte“ Preis der Arbeit wäre, in der die Papierwährung immer ihrem Goldwert entspräche.156
Wie also soll man auf dieses Risiko reagieren, das die Ähnlichkeiten zerstört, die man vornehm für exklusiv und natürlich hielt, obwohl sie es nicht sind? Offenbar reicht eine Strategie des Wissens, des buchstäblichen Wissens der Umsetzung der Laute in der Schrift nicht mehr aus, um all dem Bedeutsamkeit zu verleihen, was an Dialekten in der Industrialisierung explodiert. Die Strategie ist nun eine neue: Man muss eine künstliche Währung der Zeit erschaffen, die in Elemente (Zeichen) organisiert ist, die zugleich das Problem offenbaren, dass man der Entschlüsselung nur noch mit einem theoretischen Wissen beikommt.157 Es wird in dieser komplexen Situation notwendig, die Verzeitlichung aus den unbewussten Situationen zu destillieren, dass heißt, in einem künstlichen Prozess der Bezeichnung (Design) die Gebrauchsanweisung der unsinnlich prozessierenden Produkte gleich szenisch mitzuliefern: Design, Reklame und das inszenatorische Spiel der Massenmedien gehen nicht über den Weg der Bewusstwerdung. Die Opponenten sind jetzt nicht mehr Anwesenheit und Abwesenheit, also die Stellvertreterschaft des Signifikanten für eine Bedeutung, sondern Wahrnehmbarkeit und Wissen, oder Wahrnehmung und Erkennen. Eine solche Bewusstseinsrelation lässt sich allerdings nicht mehr in eine buchstäbliche Elementarität auflösen. Hinter dem Sagbaren steht das Unsagbare der szenischen Einheit, die „Vorstellung von“ im/als „Bewusstsein von“. Auf den Zusammenhang zwischen „Vorstellungsein155 Vgl. die Einführung des funktionalen Phänomens durch Silberer in: Freud, Traumdeutung, a.a.O.,
S.427. Sartre nennt das funktionale Phänomen, ebenfalls in Rücksicht auf Silberer, „auto-symbolische Phänomene“. Sartre, Das Imaginäre, a.a.O., S.181. 156 Barthes, Saussure, das Zeichen und die Demokratie, a.a.O., S.161. 157 Der Rätselgestus der Allegorie ist evident. Vgl. Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Arthur Henkel/Albrecht Schöne (Hg.): Stuttgart 1996. Die Pictura hat in der Emblematik jedoch die dominierende Funktion. An ihr soll die Wahrheit der Inscriptio sich erweisen und sichtbar machen, was im Bild als Sichtbares verrätselt ist.
8. VORLESUNG 103
heit“ und „Verzeitlichung“, auf den Heidegger aufmerksam macht, werden wir noch zu sprechen kommen. Systemtheorien verstehen sich als Handlungstheorien vergesellschafteter Subjekte. Die moderne Linguistik, aus der die Systemtheorien sich unter anderem entwickelt haben, versteht sich als Werttheorie von Zeichen. Nun sind Zeichen im Verweisungsbezug aber Handlungsträger. Eine Unterscheidung machen, heißt handeln. Beachte das eine, nicht das andere. Eine Unterscheidung setzt Entscheidendes (Signifikanz/Insignifikanz respektive Welt/Umwelt; Beobachter/Beobachtetes) voraus. Die unterschiedliche Definition des funktionalen Begriffs „Selbstbeziehung“ und „Selbstverweisung“ ist entscheidend: Das Zeichen verweist in der Regel nicht auf sich selbst (sonst könnte man es mit dem „natürlichen“ Symbol verwechseln), während das System immer zugleich auf sich und auf das verweist, was es invertiert. Das System schließt nicht aus, es stülpt ein, es bildet sozusagen topologisch eine Höhle (Involution) oder ein Organ (Membran), in der das Andere niemals ganz, sondern selektiv ausgeschlossen ist. Statt der Ähnlichkeitsbeziehung gestattet es das System, mimetische Handlungsvollzüge zu vergleichen. Roland Barthes hatte eine solche Beziehung schon für eine herausragende Idee bei Lévi-Strauss abgeleitet: Bestimmte Formen von Gesellschaften bevorzugen nicht ästhetische Ähnlichkeiten, um Vermittlungen zu arrangieren, sondern Homologien, also strukturierte funktionale Prozesse. Nicht die Dinge ähneln sich, sondern die Organisationen158 mit der sie als Zeichen hervorgebracht werden. Die Systemtheorie betont demnach die Äquivalenz, die Semiotik (oder Linguistik) die Substitution eines Differenzfeldes. Das Schnittfeld dieser Prozessualität kann man dann ein theoretisches nennen. Hier wird nicht wirklich produziert, sondern das Produzieren macht sich selbst sichtbar. Das entspricht der szenischen Repräsentation. Barthes empfiehlt an dieser Stelle, nicht mehr von ethnologischen, sondern von soziologischen Gesellschaften zu sprechen. Die Repräsentation, also die Serialisierung von Produktion – nicht ihre singuläre zufällige Hervorbringung –, ist der unterste Abstraktionsgrad einer Theorie. Die zentrale Problematik der soziologischen Gesellschaft lautet heute: Wie weicht der persönliche Lebensentwurf von dem der gesellschaftlichen Strukturiertheit ab? Neben einer Theorie der Soziologie muss es eine der Abweichungen geben, die mehr ist als eine statistische Variation. Lévi-Strauss, so Barthes, schlägt vor, umgekehrt zu denken – vom Primat der Individualität her: Es sind gerade die Abweichungen, das Diskontinuierliche159 der Prozesse, ihre situative Position innerhalb der Struktur, die dem allgemein normierenden Charakter der industrialisierten Warenzeichen, d.h. ihrer Schablone, stabilisieren. Der Reichtum des Sinns entfaltet sich aus der nichttheoretischen Perspektive, die aber wiederum als Theorie einer Semiotik des Einzelfalles zur Darstellung ansteht. Fragen wir also umgekehrt: Leben wir unser Leben nach Regeln, die durch die Strukturganzheit vollständig abgedeckt sind, als Aktanten und Reaktanten einer immer schon bedeutungsvollen Welt – mit der Aberration vielleicht eines persönlichen Sinns, der uns wie ein Krankheitssymptom befällt? Semiologisch gewendet: Ist es vielleicht ein Dreiecksverhältnis zwischen 158 159
Barthes, Claude Lévi-Strauss, a.a.O., S.176. Ebd., S.178.
104 8. VORLESUNG
natürlichem, künstlichem und körperlichen Zeichen (Symptom), das die Dualität zwischen Signifikant und Signifikat aufbricht? Sie könnte dem von Peirce schon zu Anfang des 20. Jahrhundert in die Debatte geworfenen „Referenten“, dem Subjekt oder „Leser/Autor“ der Semiose, neue Aktualität verleihen. Denn was referiert das Symptom anderes, als eine Unmöglichkeit, die Verinnerlichung zu veräußern, ohne sie den Gesetzen des Außen, der Produktion, auszusetzen? Könnte man dem Symptom, dem Sich-zeigen-des-Zeigens eine aktualisierte, positive Konnotation abgewinnen? Halten wir uns diese Türe offen. Man kann durchaus Zeichen gegen ihre Intention lesen; man kann strategisch ein nichtintentionales Lesen als Intention eines Autors inszenieren. Die Zwei-Seiten-Form heißt auch immer: Die Unterscheidung steht auf Messers Schneide. Die Selbstreflexion einer Praxis muss sich eines theoretischen Weges versichern, um einzugestehen, dass das Unkalkulierbare in Wirklichkeit sich als das erweist, was die Bedeutung der Kommunikation ausmacht. Es ist eine didaktische Misshelligkeit, dass Sprache und Kultur immer schon da sind und die Frage nach ihrer Herkunft Zeitlichkeit voraussetzt. Man muss sich mit der Beschreibung von Praxis begnügen, d.h., man muss beobachten und sich als Beobachter eines Interesses und eines Standpunktes beobachten. Das schließt ein, dass man bezüglich der sprachlichen Erscheinungen oder symbolischer Verwendung das Problem des Anfangs, der Mensur der Präsenz neu denkt. Unsere Geschichte kennt bekanntermaßen keinen Ursprung, sie beginnt christtheologisch mit einer Differenz, die als anfänglich zu denken ist. Systemtheorie hat dagegen für soziale Phänomene die Hinwendung nicht zur Identitäts-, sondern zur Differenzbildung gefordert. Die Idee Spencer Browns, eine Unterscheidung als Anfang zu setzen, problematisiert nicht nur das Zeitverhältnis jeder Deutungs- und Bedeutungsreihe, sondern auch das Bewusstsein von Problembewusstsein. Probleme sind immer in Differenz zur möglichen Lösung hin aufgegeben. Die Rückkehr zum Anfang als Identität löst keine Probleme, sie vernichtet sie. In der Semiose wird dieser Sachverhalt darstellbar. Der Vollzug der Bedeutung als Eindeutigkeit, die idealen Beziehung von Signifikant und Signifikat, tötet jede Kommunikation als Begehren nach Verständigung und Identifikation mit dem Anderen in seinen vielfältigen Gruppenbeziehungen. Verstehen von Bedeutung wird nicht nur zurückgeführt auf die Grundfrage nach Identität und Differenz, sondern auch auf die nach der funktionalen Ab- und Aufschließung. Für sie stehen die Begriffe „Information“ und „Kommunikation“ ein. Kommunikation setzt nicht mit der Identitätsbestimmung ein, sondern mit der Differenz. Das Begehren des Austauschs begehrt sich selbst als unendlich. Wenn am Beginn der Kette der Differenzierungen eine Differenz, ein Ungleichgewicht steht, kann man die semiotische Relation auch als ein universelles Prinzip der Asymmetrie des Zeichens, als seine verlorene Zeitfolge verstehen. Die Idee, dass mit „Verstehen“ „Eindeutigkeit“ gemeint sein muss, hat der späte Saussure nicht im Blick. Verstehen von Bedeutung und, in der Fuge der logischen Aussage eines Satzes, Sinn, erweist sich stets nur so weit als produktiv, wie im Verstehen der Modus der Differenzierung zur Identifizierung nicht aufgeht. Derhermeneutischen Idee, den Autor besser zu verstehen als er sich versteht, liegt ein homosexuelles, völlig unfruchtbares Verständnis der Sprache und der symbolischen Kulturerscheinungen zugrunde, nämlich das der Eliminierung des Anderen. Es geht heute in den Sprachwissenschaften und den
8. VORLESUNG 105
Zeichentheorien nicht mehr um Eindeutigkeit, sondern um Produktion, Agon und Konfliktarbeit. Es wird zudem deutlich, dass die Strukturpositionen von gesellschaftlichem Tausch und gesellschaftlicher Identität als Eigentumsformen zwar idealerweise getrennt betrachtet werden können, dass mathematisierte und kontextuelle Sprachen jedoch am gleichen System zerren. Ihre zunehmende Polarisierung zerstört das, was als sprachliche Erscheinung Identität von Gemeinschaft zu bilden hat: Die sinnliche Gewissheit – das Vertrauen in Wahrnehmung – erodiert, wenn Design den Algorithmus nicht mehr in sinnliche Werte verwandelt. In der Tat ist der Widerspruch zwischen einer Hermeneutik des Verstehens und einer Technik des Identifizierens, wie er seit Gadamers Wahrheit und Methode in den 1960er Jahren aufflammte, gekennzeichnet durch die Unkenntnis dessen, was spätestens in den 1980er Jahren als mediatic turn, sagen wir besser als medialer point de vue fokussiert wurde: das Ersetzen von Bedeutungsträgern in ihrer konnotativen Kontextualität durch Medien. Medien sind Negate. Würden wir näher an den Apparat treten, würde uns die Illusion der Linien oder Punkte, aus denen die bedeutungstragenden Zeichenformen zusammengesetzt sind, nicht mehr sinnvoll erscheinen. Vertrauen in Wahrnehmung wird durch Vertrauen in apparative Techniknormen ersetzt. Das beginnt schon bei der Alphabetisierung: Lesen bedeutet eigentlich Schreiben – produzieren von Bedeutungen. „Die Soziologie ist die Analyse einer ‚schreibenden‘ Gesellschaft. [...] Die Massengesellschaft strukturiert also das Wirkliche auf zwei konkomitierende Weisen: durch die Produktion und durch das Schreiben.“160 Wenn man die Geschichte der Sprache nicht beim Lallen des Kleinkindes beginnen lassen will – was man etwa mit Freud oder Winnicott161 machen könnte –, so muss man bei den pädagogischen Anstalten beginnen, die sich nicht als Verwalter von Herrschaftswissens aufspielen, sondern gerne das Sprechen Anderer für sich in Anspruch nehmen. Das Zitat ersetzt den Beweis. Der akademische Betrieb hat sich für eine Geschichte der Inszenierung der Theorie des Bedeutens auf die beiden Namen Ferdinand de Saussure und Charles Sanders Peirce geeinigt, die die Ketten der Herleitung der Sprachwissenschaft, die hermeneutische und die strukturale, „verschalten“ und nicht nur eine Elementtheorie der Bedeutungseinheiten, sondern gar deren Vereinheitlichung in medialen Formen anstoßen. Je feiner nämlich die semiotische Differenzierung der Elemente wird bevor sie schließlich in Bites and Bytes logarithmisch diffundiert, dem szenischen Maß der Sinne entschwinden, um so variabler wird die Möglichkeit, vor dem Hintergrund des Verschwindens eine 160
Ebd., S.171. Das „Übergangsobjekt“ kann als erster Ausdruck der Realität in einem Feld von Singularitäten gedeutet werden, die das Kleinkind organisiert: „Wenn das Kind sich eines Symbols bedient, unterscheidet es bereits deutlich zwischen Phantasie und Tatsache, zwischen inneren Objekten und äußeren Objekten, zwischen primärer Kreativität und Wahrnehmung. Aber der Ausdruck ‚Übergangsobjekt‘, wie ich ihn verstehe, schafft freien Raum für den Prozeß des Erwerbs der Fähigkeit, Unterschiede und Ähnlichkeiten zu akzeptieren. Ich glaube, wir sollten nach einem Ausdruck für die Wurzel der Symbolik in der Zeit suchen, einen Ausdruck, der den Weg des Kindes vom rein Subjektiven zur Objektivität beschreibt.“ D.W. Winnicott: Von der Kinderheilkunde zur Psychoanalyse. Aus den „Collected Papers“. München 1976, S.299. 161
106 8. VORLESUNG
Praxis des Gebrauchs und des Missbrauchs zu formulieren. Aus den elektronischen Schaltzeichen wird die Vermittlung aller anderen sinnlichen Zeichen möglich. Die Synthesen enden also stets in der leiblichen Situiertheit – was nicht heißt, wie Foucault nachweist, dass allerlei Körpertechniken und Pathoplastizitäten auch hier produktiv werden. Beim Analogfilm genügen 24 Bilder pro Sekunde, um das Illusionsmedium Kino zu erzeugen und den Filmstreifen zum Verschwinden zu bringen. Beim Fernsehen sind es zunächst einige hundert Linien, dann Bildpunkte, um die Sinne zu überlisten. Heute sind noch nicht einmal diese Punkte mit unbewaffnetem Auge zu erkennen. Die Fraktalisierung der Täuschung kann nicht mehr enttäuscht werden. Dem unaufhaltsamen Prozess der Produktion als Differenzierung muss eine ganze Industrie synthetisierender Inszenierung nun wieder sinnliche Nähe gestatten. Aber so neu ist der Prozess der neuen Medien nun auch wieder nicht, als dass man an der Komplexität der sozialen Selektion von Positivität und Negation, also dem, was die Griechen Logos nannten, nicht sofort das Vermittlungsmedium der Agora erkennt: Agora, das ist schlicht die Versammlung, die ein Einzelner noch mit unverstärkter Stimme zu erreichen vermag.162 Der andere Raum – jener der Chora, der Vorstadt, des Kontextes – lag schon außerhalb der politischen Mittelbarkeit. Neben der Überdehnung des Raumes gibt es die Überdehnung der Zeit: Der szenische Schnitt, Makro- und Teleaufnahme, fliegende Kameras – all das hat die Bedeutung des Wortes „Beobachter“ zur Phrase für ein sich seiner selbst nicht gewisses Subjekt werden lassen. Das Theater der Griechen, dass sich aus dem Agon der Diskussion um Authentizität entwickelte (die es vielleicht so nie gab), stellt also nichts anderes dar, als den Experimentierraum für die Vergemeinschaftung von Stimmleistungen mit der List, genau diesen Prozess der Vergemeinschaftung (als göttliche Fügung und menschliches Drama) zu problematisieren: das Recht des Einzelnen, der auf seiner Autonomie beharrt, und das Recht des politischen Rhetors, der auf authentische Repräsentation der Gesetze, der Handlungen und des juridischen Bedeutens beharrt. Das Theater trägt also dem transzendenten Prozess der Vergesellschaftung Rechnung, von dem die Politiker glauben lassen wollen, dass sie ihn im Griff haben. Die Griechen haben für die Problematisierung der Körper, die sich „Ich“ nennen, einen Namen: Philosophie. Nicht mehr die Götter korrumpieren den Geist, sondern die Medientechniken, die ihren Raum in Bibliothek und Theater, in der Kaserne und der Münze163 – dieser ausgezeichneten Zweiseitenform – haben. Die Philosophie wird in ihrer Verschriftung durch Platon dem inneren Dialog zugeordnet und verschwindet von der Agora. 162 Siehe hier die schöne Ableitung, die Karl-Heinz Göttert über das Problem der Tragfähigkeit der Stimme in den großen Freitheatern macht. Er beschäftigt sich dabei ausführlich mit antiken Verstärkertechniken. Karl-Heinz Göttert: Geschichte der Stimme. München 1998, S.39ff. 163 Siehe Jochen Hörisch: Kopf oder Zahl. Die Poesie des Geldes. Frankfurt am Main 1996, S.12: „Im Zeichen des (Schein-)Geldes wird das Alphabet überzählig. Das Medium Sprache hat sein Vorherrschaft an Geld abgetreten. Keine noch so hoffnungsfrohe Theorie der kommunikativen Kompetenz wird diese Abtretung rückgängig machen können. Und die Poesie, die dem überzähligen Alphabet anachronistisch die Treue hält, tritt zunehmend irritiert an, den Siegeszug des Geldes und der Zahlen zu beobachten.“
8. VORLESUNG 107
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Wechselwirkung von Sprache und Gesellschaft, von zwei Philosophen – Saussure und Peirce initiiert worden ist, um positive Ordnungssysteme und -regeln zu erstellen. Beide haben sich um die Dimension ihres Blicks, die Endlichkeit ihrer Sinne und des differenzierenden Vermögens, kurz: um die inszenatorische und initiierende Wirkung ihrer Texte nur am Rande Gedanken gemacht haben. Sie haben zwar die Geschichtlichkeit der Sprache, nicht aber die der Wissenschaften vor Augen gehabt. Hätte vor ihnen Mandelbrot schon das Problem der menschlichen Dimension von Sinnlichkeit und ihrer Simulation stellen dürfen, hätte man sich vermutlich eher die Frage nach der Rekursivität, dem re-entry von Elementen gestellt. Wenn nämlich jedes Element durch die Stellung als Strukturmoment seine Bedeutsamkeit gewinnt und nicht durch genealogische, genetische oder ästhetische Ableitung (durch Etymologie, Sprach- oder Herrschaftsgeschichte oder Ähnlichkeit) disponiert ist, dann muss man die Wahl der Elementarität und den „Maßstab“ einer Struktur als ziemlich willkürlich (arbiträr und kontingent) begreifen – gerade weil man nicht die Dimension, also den Geltungsbereich der Szene, des Systems oder der Sprachgemeinschaft definieren kann. Foucault war es, der zuerst seine Aufmerksamkeit auf diesen Punkt richtete, indem er mit dem Begriff des Diskurses den Prozess der Bildung einer kommunikativen Gemeinschaftsform identifiziert hat. Die Elemente, auf die Saussure mehr noch als Peirce sein Augenmerk richtete, schienen zunächst gottgegeben. Die Phoneme, die Buchstaben, allenfalls noch Wörter oder Sätze und somit logische Aussagen in Form von Prädikationen – das sind die sinnlich wahrnehmbaren Einheiten des Mediums Sprache. Wahrnehmung wird damit als einheitsbildender Erkenntnisakt aufgefasst. Dieser lässt sich täuschen und muss sich infolgedessen ständig auf progressiv entwerfen und regressiv versichern. Diese Bewegung, die die Zeit ist, bewahrt Kommunikation davor, in Identitäten zu versiegen. Es sind die Diskontinuitäten, die in ritueller Konvention, in ewiger Wiederholung und damit als Praxis Sprachlichkeit erschaffen, indem sie sie verfehlen müssen.
9. VORLESUNG Die natürlichen Sprachen und ihr Verhältnis zu Medienmaschinen – Die Differenz aus Opfer und Gabe geht der Synthese voraus – Den Tod der Geschichte und das Ende der Kommunikation aufschieben – Die protowissenschaftliche Epoche der Semiotik – Inszenierung ist konstitutive Simulation von Vergesellschaftung als zeitlicher Periode – Inszenierung ist der Ereignisträger, der die Dauer der Aufmerksamkeit in einer Disposition ohne Transposition stabilisiert – Ersetzung des Relationsbegriffs durch den Begriff der Funktion – Wie ist zwischen Konsenstheorie und Konflikttheorie zu vermitteln? – Das Zeichen ist die mit sich selbst streitende Zeitlichkeit der Subjektivität
Wenig ist in der Linguistik schwieriger zu beantworten als die Frage: Was ist ein Satz? – Genügt schon ein poetisches „A!“, gar ein literarisiertes „!“ für eine Satzaussage – oder sind es solche Miniaturromane, die Thomas Mann ohne Punkt über zwei Buchseiten entfalten kann? Buchstaben, Phoneme, Sätze – das scheint noch irgendwie stabil zu sein. Aber wie steht es mit den Wahrnehmungs- und Vorstellungseinheiten? Ein Baum, schön und gut, das ist ein Element. Ein Wald, das sind viele Bäume, eine Synthese. Ein Kubus, das ist eine Einheit, ein Ding! Aber was ist mit den modernen Zeichen-, Waren- und Maschinenkörpern – den Sachen, die gar keine Namen mehr kennen, die irgendein Lexem verzeichnen könnte? Sind das nicht eher Prozesse; Aufmerksamkeitsperioden von Details und Ganzheiten; gleitende Eigenschaften, die, um von der Wahrnehmung identifiziert zu werden, einer Mensur bedürfen, eines Codes? Was ist mit den Düften einer Parfümerie, die zu Hunderten einander verweben? Muss man hier Elementarität zu Gunsten einer gebrochenen Dimension von Atmosphäre aufgeben? Ist es sinnvoller, bei Rückversinnlichungen, Reinszenierungen, Designationen eher von „funktionalen Erlebnissen“ zu sprechen, deren Referenz eine Art Eigensymbolik darstellt? Oder kann man den Vorgang der artifizellen Synthesen als Szenifikationen vielmehr als künstliche Produktion, Renaturierungskultur ansehen, so wie es Baudrillard dem Begriff der Simulation164 zugesteht? Oder sind Synthesen schlicht an der Physiologie der Sinne orientierte Produktion? Sollte man nicht Zeichen, sondern Zeichenhaftes zu untersuchen versuchen? Steht dann der Semiotiker nicht immer auf der Seite des abwägenden, wählenden Konsumenten, der die Klassifikationen nur nachträglich nach der Realität oder deren Simulation ordnet? Hätten Saussure und Peirce sich diesen Fragen heute, durch Echtzeitmedien und digitalem Zeichenverkehr geschult, intensiver gewidmet? Sie hätten vermutlich 164 Unter Simulation versteht Baudrillard schlicht die Umkehrung der Kultur der realen Produktion durch die Inszenierung des Zeichens: „Es geht nicht mehr um die Imitation, um die Verdopplung oder um die Parodie. Es geht um die Substituierung des Realen durch Zeichen des Realen, d.h. um eine dissuasive Operation, um die Dissuasion realer Prozesse durch ihre operative Verdopplung, eine programmatische, fehlerlose Signalmaschinerie, die sämtliche Zeichen des Realen und Peripetien (durch Kurzschließen) erzeugt.“ Jean Baudrillard: Agonie des Realen. Berlin 1978, S.9. Zur szenografischen Implikation der Simulationstheorie von Baudrillard vgl. die genaue Ableitung in Bernadette Fülscher: Gebaute Bilder – künstliche Welten. Szenografie und Inszenierung an der Expo.02. Baden 2009, insbes. S.168-175.
110 9. VORLESUNG
schnell den Weg von der Bestimmung des lautlichen und buchstäblichen Zeichens zu den allgemeinen medialen Anwendungen gefunden. Aber man beginnt eine Wissenschaft in der Regel mit Definitionen und Thesen, mit Identitätsbehauptungen. Aus diesen Anfängen heraus ist zunächst die Nomenklatur provisorisch. Die Bezugssysteme sind nicht geklärt. Die Linguistik dominiert zeitweise noch die Semiotik. Die Definitionen sind tastend. Man widerspricht einander, diskutiert. Je nach Forschungsintention, Problemperspektive, Durchdringungstiefe, Kulturgemeinschaft akzeptiert man schließlich Sachverhalte und Benennungen. Kristeva, Barthes und Baudrillard z.B. sehen rasch ein, dass von der Semiotik als einer Ideologiewissenschaft im genitivus objectivus und subjectivus zu sprechen ist, was wiederum von anderen Forschern, etwa Foucault, zum Anlass genommen wird, über das Verhältnis von Ideologie, Macht und Wissenschaft Analysen aufzunehmen. Diese sind mehr an den gesellschaftlichen Funktionen von Aussagehandlungen orientiert, als an der Bestimmung der Elementaropponenten, die inflationär werden, sich aber der gleichen strukturalen Methode anvertrauen. Redlicherweise sollte jeder Wissenschaftler über seine Elemente (Definitionen) und seine Perspektive (Methode) Auskunft geben, bevor er sie anwendet oder im situativen Anfangen retrospektiv gewinnt. Für die Konstitution der Semiotik war die Retrospektion verständlicherweise nicht möglich, solange sie den Ewigkeitsraum des Sprechens von Sprache nicht zugunsten ihrer je technisch ausdifferenzierten Medialisierung spiegelte. Es sind zunächst die „natürlichen“ Sprachen und ihr Verhältnis zu den neuen Medienmaschinen, die die grundsätzlichere Funktionsweise zu untersuchen verlangen. In Bezug auf die künstlichen, elektrifizierten Sprachen erscheint aber die natürliche Sprache plötzlich defizitär und zugleich technisch. Das Subjekt scheint eher ihr Produkt zu sein, als dass, wie Herder noch meinte, der Mensch die Sprache hervorbringt. Im gleichen Zeitraum wird von philosophischer Seite die Untersuchung nach Eindeutigkeit der Aussagenlogik im Verhältnis zur mathematischen Logik eingeleitet. Das Programm von Russel und Whitehead korreliert mit dem von Hilbert und fragt nach der Universalisierung der Sprache der Mathematik. Der wechselseitige Vorwurf nach der Defizienz der natürlichen und der künstlichen Sprache verschiebt sich allmählich zu Ungunsten der natürlichen. Aber auch das Hilbert-Programm nach „vollständiger Wahrheit“ der mathematischen Axiome schlug fehl. Eindeutigkeit soll kommunikativ (politisch und vernunftgemäß) über Fehldeutungen und -interpretationen, über die produktive Mehrdeutigkeit des Sinns demokratisch obsiegen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass nicht die nationalstaatlichen, sondern die technisch-medialen Normen, Standards und Patente, durch die Entwicklung des Ersten Weltkriegs entscheidenden Einfluss hatten.165 Verständigung und Vernunft dominiert nicht über Sinn und Wert. Wer wann unter welchen Umständen Produktivkräfte als Synthesen herstellen kann, entscheidet über die szenische Kraft individueller Diskontinuitäten und verwandelt so Individuen in Volksund Kriegsgemeinschaften. Entgegen der Meinung Baudrillards erhebt der Körper 165 Friedrich A. Kittler: Rockmusik – ein Missbrauch von Heeresgerät. In: Ders.: Short Cuts Bd.6. Frankfurt am Main 2002, S.7-29. Kittler schildert die Verwendung ursprünglich militärischer Funkelektronik für die spätere Unterhaltungsindustrie.
9. VORLESUNG 111
immer noch zu Gunsten der Materie und nicht zu Gunsten des Zeichens Einspruch. Simulationen sind zwar das Phantasma urban gesättigter Übertragungsverhältnisse, und nicht das der allerorten noch dringlichen Befriedigung sogenannter Grundbedürfnisse. Noch im deutschen Faschismus sind es die technologischen Hochrüstungen, die über die Möglichkeit der Führung von Weltkriegen entscheiden – nicht die Unfähigkeit, diplomatische Noten eindeutig zu verfassen. Saussure weigerte sich zunächst, seiner Linguistik für geschriebene Sprache Geltung zu verleihen: Die parole dominiert die Frage nach der technischen Festlegung der Bedeutung (Schrift und Code) auch für natürliche Sprachen. Erst mit der Analogiebestimmung des Zeichens in der Struktur wird der künstliche und politisch-ideologische Charakter sozialer Zeichenbeziehungen offensichtlich. Saussure, so Barthes, versteht die Struktur – seiner Genfer Heimat gemäß – als demokratisch organisiertes System.166 Sie ist eine individualisierbare Allgemeinheit in wechselseitigem, gleichberechtigtem Austausch. Seine Semiotik, so haben wir bei Barthes gelesen, ist demokratisch. Saussure beginnt mit einer einfachen Relation: Es gibt etwas, dessen sinnliches Erscheinen auf etwas verweist, das sinnlich gerade jetzt oder hier nicht anwesend ist, sondern das als Ding, Sachverhalt oder Vorstellung durch dieses erste Etwas vertreten, repräsentiert und substituiert wird. Dieses Etwas als Relation ist das Zeichen. Das Zeichen ist nicht das Ding, das verweist, sondern eine Relationsvorschrift vom Bezeichnenden und Bezeichneten, das vom Anderen (Referenten/Referens bei Peirce) veranlasst ist. Ein Wald ist in der Regel kein Zeichen ein vereinzelter Baum auf einer Anhöhe kann es hingegen sein. Gleichwohl bleibt nie ausgeschlossen, dass das Bezeichnende qua eigener Materialisation, die im semiotischen Prozess transzendiert werden soll, sich selbst meinen kann, wenn die Ordnung der Zeichen, in der das Element steht, zu diesem Urteil zwingt: Ist der einzelne Baum gepflanzt, um diesen Ort auszuzeichnen, oder zeichnet der Baum selbst diesen Ort aus (und ist der Referent eines abgeholzten Waldes)? Man kann ein Verkehrszeichen dekorativ finden, man kann es zur Kunst erheben, ohne dass man seine Bedeutung beachtet.167 Saussure war angetrieben, zunächst nur linguistische Zeichen, nämlich phonematische, gesprochene Sprache zu analysieren, und überließ es Anderen (z.B. den Herausgebern des Cours), die dabei gewonnenen Erkenntnisse auf andere Sprachsysteme zu übertragen und entsprechende Übertragungsregeln zu entwickeln. Je mehr man sich dabei dem Bild, der Szenifikation und der Simulation von Realität nähert, um so problematischer wird der Zirkel der Metaphorisierung des Sprechens über Sprechen (parole). Beim Film, der geradezu eine Verdopplung der Sprache der Realität darstellt168 – die erste Natur neutralisiert –, wird eine Art Gegenwirklich166 Der Cours spricht entgegen dem Gebrauch der Strukturalisten häufig von „System“, selten von „Struktur“. 167 Die Pop-Art, insbesondere Rauschenberg, haben einerseits diese zweite Kodierung des Zeichens präferiert, um das Warenzeichen zu inszenieren und es damit seiner seriellen Praxis zu entheben. Andererseits haben sie Kritik am Kunstwerk geübt, indem sie die Warenzeichen serialisiert als Kunst produziert haben (Warhol). 168 Hans Ulrich Reck: Pier Paolo Pasolini. München 2010, S.56ff. „Zeichen waren für ihn [Pasolini; R.B.] nichts anderes als der physiognomisches Ausdruck, den eine Natur als Zeichenkraft selbst
112 9. VORLESUNG
keit erzeugt, deren Elemente nicht mehr disparate Zeichen, sondern „unwirkliche“ Bewegungs- und Zeitmuster – szenische Perioden und Schnittperioden sind –, die die Wirklichkeit eines kontinuierlichen Raums und einer linearen Zeit als puren Idealismus entlarven. Der Film spielt die Realität nicht nur nach, er beeinflusst sie auch. Je differenzieller eine Sprache ist, desto konkreter bildet sie den Bereich ab, der durch sie bezeichnet wird. Wird aber die Elementarität zu fein, dispersieren die Elemente zu Medien. Sie verschmelzen wie in der Sprache des Films zur eigenständigen, künstlichen Realität. Die Relation Signifikant/Signifikat wird in der Bedeutungsrelation Form/Medium aufgehoben. Die Elemente der semiotischen Relation müssen also in einer gewissen sinnlichen Diskretion erscheinen, die Maurice Merleau-Ponty „leiblich“169 genannt hat. Der kantisch-euklidische Normalraum der Immanenz erweist sich nicht nur durch Einsteins Entdeckungen schon als hochproblematische Hypothese – kurz: als Inszenierung einer westlichen, technisierten Geopolitik, die Arbeit, Geld, Zeit und Besitz objektiv in ein elementares Tauschverhältnis stellen muss, deren Elementarität durch die Warenstückelung (und diese wiederum durch Transport-, Lagerung- und Konsumgewohnheiten) bestimmt ist. Die Elementarisierung der Ware vom Ziegelstein bis zur Grundstücksgröße sind dingliche Synthesen, deren Wertaspekte als Tauschbarkeiten zu Zeichen gerinnen. Der Zusammenhang von Zeichentheorie und Geldtheorie, von Wissen und Besitz ist von Anfang an evident.170 Die Bestimmung der Macht ist vom gleichen Geist wie die Bestimmung der Sprache über die Abwesenheit und die Vergangenheit. Ein von Samuel Weber verfasster Aufsatz zur Vorgeschichte des noch nicht mit dem Prädikat „Post-“ besetzten Strukturalismus analysiert an Belegstellen der beiden Väter der Semiotik, dass es die Ebenen der räumlichen und zeitlichen Spationierungen von Bedeutungssynthesen sind, die alle Versuche zunichte machen, einen Anfang und ein Ende der Struktur und somit eine Idealsprache als Metasprache in wissenschaftlicher Rücksicht zu begründen. Man kann nämlich jedes Element einer polaren Relation auf zwei Weisen auffassen: So kann man einen Stuhl einerseits als findet. In der fachlichen Semiotik, breit erörtert wiederum bei Eco, wird dies gängigerweise als untere Schwelle der Semiosen bezeichnet.“ Pasolinis Ausdruckskraft in den Filmen verdankt sich einer protosemiotischen Betrachtungsweise: „Es handelt sich um ein signifikantes Erleben, nicht um abwägendes Bezeichnen.“ (S.58) „Es gibt keine prinzipiellen, sondern nur einen aspektualen Unterschied zwischen Wirklichem und Zeichenhaftem, also zwischen Natur und Artefakt. Eben deshalb erscheint ihm die kinematographische Apparatur nicht nur als eine Technik und Mythos beispielhaft verbindende, nicht nur als eine Art generative Alchemie der entfalteten Artefakte, sondern auch als Ausdrucksmöglichkeit des Wirklichen.“ (S.59) 169 Maurice Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin 1966, S.215ff. In phänomenologischer Rücksicht setzt Merleau-Ponty an die Stelle des Zeichens die direkte Form der körperlichen Geste, die sich vom Leibraum nicht in der Weise löst, wie das Zeichen von seinem Produzenten. 170 Dieser Zusammenhang beruht auf die Übernahme der Wertformanalyse von Marx und hält sich bis in die Zeit der Distanzierung der Strukturalisten von Sartre, beginnt aber mit der Stalinistischen Entzauberung zu bröckeln. Die dialektischen Kategorien werden nach und nach durch ökonomische ersetzt, was für die Dynamisierung der Semiotiken nicht unerheblich ist. Vgl. Dosse, Geschichte des Strukturalismus Bd.1, a.a.O., S.248: „Die Ökonomie wird nicht die Rolle einer Pilotwissenschaft übernehmen, die dem Strukturalismus zum Sieg verhilft. Aber sie ist in der Mathematisierung, wie sie die Mehrzahl der Sozialwissenschaften zu diesem Zeitpunkt zwingend ist, am weitesten vorgedrungen.“
9. VORLESUNG 113
positive Gestalteinheit eines Dings aisthetisch definieren – indem der Stuhl in einen beliebigen Kontext gesetzt wird, der ihn immer noch als Stuhl qualifiziert. Man kann ihn aber auch als negative Einheit seiner funktionellen Ansichten, seiner eigenen qualitativen Merkmale auffassen. Bei der ersten Ansicht wird der Stuhl, etwa in Shakespeares König Lear, ein Thron werden, der vielfältige symbolische Konnotationen (Erhöhung, Macht, Alter, Heimat) annehmen kann. Die Setzung der signifikanten Elemente erfolgt also nicht willkürlich und nicht additiv, sondern als synthetischer Akt der Produktion – als Bedeutungssetzung selbst. Bei der zweiten Ansicht klärt der Stuhl andererseits über seine Machart, Materialität, Stilfigur und Sitzhaltung auf, die an ihm selbst sinnlich erfahrbar ist. Es ist nicht zu entscheiden, ob der Stuhl ein Produkt der Macht, oder ob die Macht ein Resultat der Produktion eines Stuhles ist. Die Richtung der Semiose ist stets austauschbar – was Saussure in seiner bekannten Darstellung durch vertikale Pfeile angezeigt hat. Die doppelte Synthese ist ein Effekt der Produziertheit des Zeichens (gemäß des Gebrauchs- und des Tauschwertes); die Verweisung, also die Offenheit der Lesart veranlassenden Referenten gemäß der Zeichenrelation, die man dann als „das Zeichen ‚Stuhl‘“ versteht, macht aus diesem Zeichen das Konsumgut: Der Stuhl gibt sich mir als Stuhl zu erkennen. Ich überlasse es dem Leser, schon an dieser Stelle von „Inszenierung“, d.h. von der Eröffnung einer „schwankenden“ Szene als Gedächtnisform zu sprechen, die ein beobachtendes Werturteil verlangt. Sobald man das Konsumgut auf die beiden Relate hin unterscheidet, fragt man nach der Bedeutung des Dings für mich. Die Benutzung auf die eine oder andere Weise ist konsumative Synthese zwischen Ding und Körper; die Wahl jedoch bleibt produktiv. Erst in der situativen, individuellen Reinszenierung des Stuhls, nicht aber in der Zeichensynthese an sich kann Bedeutsamkeit als differentielle Verweisung aufkommen. Die Differenz aus Opfer und Gabe geht der Synthese voraus. Das chronotopologische Problem von Struktur und Genese, von Differentialität und Synthese wird, so Samuel Weber, gerade in der unterschiedlichen Vorgehensweise von Saussure und Peirce deutlich. „Zeichen“ ist keine ontologische Kategorie, sondern eine der praktischen Anwendung, also der Funktionalisierung – wobei völlig unerheblich ist, welchen Wert wir zunächst dieser Funktion/Relation unterstellen wollen. D.h., der Bedeutungswert erscheint idealerweise situativ und eben nicht als ein imperatives Mandat des Signifikanten an sich. Es ist eine Eigenschaft von sozialen Situationen, dass sie nicht wiederholbar sind, es sei denn, man inszenierte sie als wie auch immer theatralisierte Formen und enthebt sie also der Raumzeit ihrer vorbestimmten Gebrauchspraxis. Nicht Wiederholungen, sondern Serien sind hier relevant. Kurzum: Weber zeigt, dass Saussure eher von einer Topologie des Zeichens ausgeht, während Peirce eher eine Chronologie des autologen Prozessierens ins Auge fasst. Es fügt sich, dass im gleichen Band, in dem der Aufsatz von Weber als Revue (wenn nicht Abgesang) der Semiotik erschienen ist, ein Ansatz von Ludwig Jäger bezüglich der Zeitlichkeit des Zeichens veröffentlicht ist, der davon ausgeht, dass alle Theorien der Bedeutung letztlich auf die Einholung eines prognostischen Wissens aus sind – was nichts anderes darstellt als den Versuch, die Irreversibilität der Identität der Ereignisse als Verzeitlichung einer historischen Praxis wiederholbar zu machen: wiederholbar in jeder Situation durch Konvention und Überschreitung. Die Pointe,
114 9. VORLESUNG
die sich aus der Zeittheorie der Zeichen an einem bestimmten Punkt ihres historischen Erscheinens ergibt, ist nämlich die Aufklärung der Bewusstwerdung über Wissenschaft selbst, jener Urszene des Todestriebs, der die Systeme, so Baudrillard, dazu verdammt, ihre Abschließung, ihre Identität zu wollen und zu verweigern – kurzum: das Erkalten, den Tod der Geschichte und das Ende der Kommunikation aufzuschieben. Das gelingt in einem System, das sich als Sprache pinzipiell nicht finalisieren lässt, sondern das, was es erzeugt, zur Differentialität ihres Systems integriert. Anders gesagt, es gelingt nicht, Kommunikation restlos zu verkonsumieren. Der Rest, der leere Ort, das Tabu trägt sich unentwegt weiter als das Opfer jeden Äquivalenzprinzips. Den Einbruch der Reflexion der Urszene, dass die Zeichen nicht das sind, was sie sind, sondern stets auf das andere Zeichen und das Zeichen des Anderen verweisen, kann man nur mit der Idee des Todesaufschubs fundieren. Das entspricht nicht dem dominierend positiven Wissenschaftsstatus um 1900, der mit Dilthey gerade erst den Unterschied zwischen erklärenden und verstehenden Wissenschaften zu formuliert sucht, und einen nicht mathematisch fundierten Wissenschaftsbegriff legitimieren will. Identität erreicht man nicht durch die Eliminierung des Anderen, sondern durch die Globalisierung der Teilnahme am Markt. Identität und Differenz sind demnach die logischen polaren Opponenten, die sich wechselseitig im Spiel halten müssen, um Gemeinschaft aus Gesellschaft zu etablieren und die Opposition zum Anderen zu validieren. Serialitäts- und Identitätsformen müssen offen sein für Übertragungen. Aufschub des Todes und Faszination seiner Stillstellung im Ding, in der Bedeutung, im Signal sind die todestrieblichen Momente, die im Szenischen zur Verlebendigung bereitstehen. Eine durchorganisierte Gesellschaft hat demgemäß Mangel nur an einem Produkt: Arbeit, sprich: Entertainment, Event, Inszenierungen, Spektakel. Die Hermeneutik, der man nachsagt, sie strebe die Identität der Verständigung an, beweist mit der Wut ihrer Deutungsproduktion, dass sie das, was sie zu konsumieren denkt, produktiv vermehrt und zur Deutung aufgibt. Bücher erzeugen Bücher. Wir wenden uns jetzt dem Text von Weber zu und referieren dessen Überlegungen aus dem Jahre 1980, als die durch Eco, Barthes, Kristeva, Derrida und anderen kritisierte strukturalistische Position vor allem durch politische und philosophische, weniger durch linguistische Überlegungen schon ins Wanken geraten ist, oder als deren Probleme sich in den Informationswissenschaften verselbständigt haben.
Während die 1968 (dt. 1972) erschienene Einführung in die Semiotik Umberto Ecos sichtlich noch um die didaktische Konzeption einer Strukturtheorie der Semiotik ringt und die umfängliche Anwendbarkeit insbesondere in den Feldern populärer Kultur demonstriert, ist der 1980 publizierte Aufsatz von Weber bereits bemüht, die Folgen der Semiotisierung der Theorielandschaft in einer „poststrukturalistisch“ genannten Debatte zu reflektieren – übrigens mit Bezug auf einen nicht durch den Cours überformten Rückgang auf den „authentischen“ Saussure. Der Übergang, der durch die Arbeiten Derridas und Foucaults unter den Begriffen différance und Diskurs erfolgt, erfragt erstmals Momente der Kalibrierung und Fokussierung der Korrela-
9. VORLESUNG 115
tion der Genesis und Geltung des Zeichenbegriffs. Zwischen dem Zeichen und dem Diskurs bilden sich mehrere Einheiten, die immer noch vom Text bzw. der (fotografischen) Bildnorm einer Realität ausgehen. Erst allmählich differenziert sich der Begriff „Medialität“ als Codierungs- und Operationseinheit künstlicher Sprachnormierung heraus. Bei Eco kommt der Begriff „Medium“ etwa noch gar nicht vor.171 Die Semiotik bleibt auf das Feld der rhetorischen Zeichen beschränkt, obwohl sie sich als universelle Elemententheorie der Einheiten/Differenzen aller Medien respektive Sprachen verstehen will. Es deutet sich in dieser Umbruchphase auch eine Hinwendung zu dynamischeren und zugleich immateriellen Komponenten der Semiose an: Begriffe wie „Geschwindigkeit“ (Virilio), „Simulation“ (Baudrillard), „Medialität“ (Kittler) transformieren die ursprüngliche Idee einer in anthropologischer Starre (zu Unrecht) verrufenen Strukturalismus- (Lévi-Strauss) und Humanismusdebatte (Heidegger, Sartre) und brechen sie pragmatisch auf.172 Die Anwendung und die Funktion, und nicht die Substanz und die Theorie der Zeichen stehen nun ab den späten 1970er Jahren in einer performativen Wendung im Vordergrund. In ebendieser Situation fragt Weber, ob die Dynamisierung, die auf eine erste Situierung der Theorie erfolgt, nicht schon in Texten der „Gründer“ angelegt sei, die man, als sie erschienen, sowieso nie sonderlich kohärent lesen konnte. Das gilt insbesondere für den Cours, auf dessen verfälschende Zuschreibung zum Ideenkomplex Saussures wir später noch zu sprechen kommen. Weber geht von der These Isers aus, dass die Strukturkonzeption in sich so angelegt sei, dass sie zunächst „nur“ eine „Inventarisierung“173 leisten könne. Man kann von einer protowissenschaftlichen Epoche der Semiotik reden. Iser fordert, eine jede Strukturdarstellung auf die jeweilige kontextbezogenen Situationen anzuwenden. Dass die Begriffe „Situation“ oder „Präsenz“ im performativen Sinne Gewicht gewinnen – was tatsächlich zunächst mit Hinblick auf Wittgensteins Sprachspielbegriff ausgelotet wird und von Eco schon am Rande behandelt wird174 –, dürfte einsichtig sein. Wir werden diese Linie weiter verfolgen. Wenn die Merkmalseinheit der kontextuellen Vergegenwärtigung, also die Veränderung eines dimensionalen Fokus oder genauer: eines negativen Skopus175 aus einer Elementarposition eine „Situation“ macht (sie als „bedeutend“ produziert), kann man die dynamische Korrespondenz zwischen Kontext und Text nicht mehr als einfache Differenz abbilden. Sie wird vielmehr zum Funktionswert funktionalisiert. Denn jede Elementarität ist schon die Synthese einer untergegangenen Differenz. Die situative Praxis hat sich gleichsam von einer künstlichen in eine natürliche, insignifikante, unbewusste Praxis verwandelt. Diese „Natursynthese“ der Alltagspräsenz 171 Signifikant ist auch Ecos Kritik am Code-Begriff, den er durch den der „Enzyklopädie“ (in der weiterführenden, auf „Sememe“ bezogenen Theorie von Peirce) ersetzen will. Eco, Semiotik, a.a.O., S.76ff. 172 Diese Debatte ist teilweise öffentlich geführt worden. Siehe die Replik von Lévi-Strauss auf Sartres Einwände in der Kritik der dialektischen Vernunft in: Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken. Frankfurt am Main 1973, S.282ff. 173 Weber, Das linke Zeichen, a.a.O., S.43. 174 Eco, Semiotik, a.a.O., S.178. 175 Die Linguisten verstehen unter „Skopus“ u.a. eine positivierende Verneinung im Satzzusammenhang. Hier möchte ich ihn in Bezug auf die Mandelbrot-Dimensionen einsetzen: die Umkehrung einer (als Serialität) negierenden Alltagspraxis.
116 9. VORLESUNG
ist zunächst kein Mangel, sondern, wie Freud gesagt hätte, ein „Reizschutz“, ein Filter, eine Membran, aus der sich nur die wirklich signifikanten Szenen herausheben. Das bedeutet aber noch nicht, dass man über diesen Vorgang selbst Bewusstsein hat. Diese Semiologiedebatte versteht sich deshalb als Metareflexion und Aufklärung der Bedeutung des Bedeutens bzw. der Sublimierung von Bedeutung im praktischen Handlungsvollzug. Nun ist die Szene eine mit sinnlicher Konkretion und in Bewusstsein beobachtet, eine „Situation zweiten Grades“, die „Vernatürlichung“ eines als „ursprünglich“ angenommenen traumartigen, oder sagen wir besser: magisch-symbolischartifiziellen Produzierens, in der sich inversionslogisch Text und Kontext für eine bestimmte Dauer der Präsenz als different halten können. Die Praxis als homologe Basis trägt diese Inversion, die als Verweisung in jeder Situation latent ist – denn anders müsste es zu einer Inflation der Differenzen und zu einer Traumatisierung kommen. Wie also, so lautet die Kernfrage, regelt man Synthesen und Differenzierungen? Unter dieser Frage bekommt die Semiologie ein neues Gesicht: Denn Verzeitlichung und Dauer, d.h. die Verteilung von Aufmerksamkeit, wird relevant, oder anders: die Fähigkeit, Inszenierungen eine von den Situationen abgehobene Dauer zu verleihen, die sie aus der seriellen Praxis heraushebt und zu Erlebnissen stilisiert. Wir müssen nur verstehen, dass die Künstlichkeit des Zeichens in Warenrespektive Konsumgesellschaften eine Natürlichkeit zweiten Grades geworden ist – eine Natürlichkeit, die allerdings Simulation einer ersten Natur ist, die es nur phantasmatisch gegeben hat. Die eigentlich künstliche Welt ist nun die, in der die Szene als Inszenierung eigens als vom Referenten mir zukommend produziert worden ist, und zwar in der Regel über ein reziprokes Gabenverhältnis, das Verbindlichkeiten und Vertrauen als Verzeitlichung produziert. In dieser Phase ist die Inszenierung nicht mehr nur rhetorische Form, sondern konstitutive Simulation von Vergesellschaftung selbst als zeitlicher Periode – jenseits vom Modell der Verwandtschaft oder der ethnischen Ähnlichkeiten. Szenografien entstehen als eigenständige quasinatürliche Ereignisorte – angefangen bei Las Vegas und Disneyland und bis hin zur Eisdiele und zum Museum. Der Kontext wird dabei nicht negiert, sondern er unterläuft die signifikante Artifizialität durch die Naturgemäßheit seiner funktionalen Arrangements, durch Spielhandlungen von mythisch-narrativem Wert. Das Spiel – eine szenische Einheit, die keinerlei Widerstand und Übersetzung verlangt, sondern nur in der Verweisung signifikanter Ketten besteht, die eher von sinnlicher als von sinnhafter Qualität sind, so wie man Kindern Geschichten zum Einschlafen anbietet – eröffnet und begrenzt eine Dauer. Es gewinnt dadurch eine ornamentale Qualität176, die es mit Naturproduktion in Verbindung bringt. 176 Gérard Raulet: Natur und Ornament. Zur Erzeugung von Heimat. Darmstadt 1987. Raulet sieht das Problem in der dialektischen Vermittlung von Technik und Sinnlichkeit, die das Bauhaus und die Moderne rundweg das Ornament ablehnen ließen. „Aus alledem folgt, daß sich die Frage des Ornaments in der Architektur als ‚Bebauung des Hohlraums‘ unserer Selbstbegegnung, also der Heimat, am Ausgang des Rationalisierungsprozesses stellt. [...] Wenn es tatsächlich um Versöhnung geht, dann lautet die entscheidende Frage: kann es ‚Ornamente der Befreiung‘ [Ernst Bloch; R.B.] oder gar ein befreiendes Ornament geben – eines, das nicht nur zur sachlichen ‚großen Erzählung‘ technischer
9. VORLESUNG 117
Inszenierung sei dann der Ereignisträger, der die Dauer des Aufenthalts (der Aufmerksamkeit) in einer Disposition ohne Transposition stabilisiert. Dabei kann das eingedeutschte Wort „Inszenierung“ sowohl die Darstellung als auch die Veranlassung der Darstellung meinen. Die Autorschaft, d.h. die Bedeutungs- und Sinnverweisung, kann von einem menschlichen Autor oder von einem Ding oder einem Ensemble von Dingen, einem Gebäude, einem Weg inszeniert sein. Es gilt also zu sehen, dass die Opponenten dieses Zeichenbegriffs zwischen den Polen „Natürlichkeit“ (Situativität, Serialität)/„Künstlichkeit“ (Szenifikation, Aufmerksamkeit) verbleiben, gerade auch dann, wenn Inszenierungen – insbesondere solche mit artifiziellem Anspruch – auf Interventionen, Diskreditierungen und Vertrauensbrüche setzen. Das enthebt sie nicht der Verantwortung, ihre Inszenierung letztlich als „Aufführung“ und somit als einheitlichen Formprozess zu begreifen, so disparat dieser auch immer sein will. Der Referent ist in gewisser Weise und vom Machtanspruch her der Besitzer der Verweisung/Veranlassung. Die natürliche Synthese dieser Dialektik ist eben die normativ konventionalisierte Praxis unseres Umgangs mit Artefakten und mit Naturstoff als Rohstoff und die Verwandlung des einen in ein homologes anderes. Ein Drittes gibt es nicht – noch nicht: Diese Funktion soll nun die Theorie des Zeichens als Szene einer Relation zur Darstellung bringen. Die eine Ökonomie zwischen Differenzierung und Synthese soll analytisch in der anderen reflektiert werden können. Die Bedingung der Verweisung „für einen Anderen“ ist dabei das für den soziologischen Standpunkt Entscheidende. Dauer von Präsenz zu erwirken – „Umsicht“ sagt Weber177, „Macht“178 sagt Foucault –, ist der Ansatzpunkt der Kritik Isers an einem vorgeblich orthodoxen Strukturalismus. Iser belegt ihn mit dem Begriff „Funktion“. Der Funktionsbegriff soll den der Relation ersetzen. Die Funktion sagt nicht nur, dass die Zeichen auf Bedeutungen verweisen, sondern wie sie das tun.179 Für dieses „wie“ hat Pierce in die Dyade von Signifikant/Signifikat den etwas umständlichen Begriff des Referenten eingeführt. Darunter ist keine Person, sondern eine Eigenschaft der Relation, ihre Funktion, ihre „Produziertheit“, letztlich also der Code zu verstehen. Nun macht Weber sich daran nachzuweisen, dass die Kritik Isers in Bezug auf die Textexegese von Saussure und Peirce nicht greift. Saussure beruft sich deziHerrschaft kompensierend hinzutreten würde?“ (S.72f.) Wir werden in Bezug auf die Freiheit des Zeichens darauf eingehen. Ein anderes Machtverhältnis wäre die informatorische Reduktion des Zeichens auf seine Eindeutigkeit hin: „Seit der Genesis prozediert die Sprache der oberen Führung nur mit Ja und Nein. Um auch nicht das kleinstmögliche Missverständnis zuzulassen.“ Kittler, Die künstliche Intelligenz des Weltkriegs: Alan Turing, a.a.O., S.235. Das Ornament zeigt nun, dass die Sprache der Herrschaft bezüglich der Inszenierung das Ornament, also die Verausgabung bevorzugen kann. Wenn heute die Verausgabung als soziale Unterstützung geleistet wird, erübrigt sich die Funktion des Ornaments, die aber dann in den Behausungen der Individuen massiv auftauchen und deshalb leere Räume als Medien benötigen. 177 Weber, Das linke Zeichen, a.a.O., S.45. 178 Michel Foucault: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit. Frankfurt am Main 1983, S.171. „Eine Macht aber, die das Leben zu sichern hat, bedarf fortlaufender, regulierender und korrigierender Mechanismen. Es geht nicht mehr darum, auf dem Feld der Souveränität den Tod auszuspielen, sondern das Lebende in einem Bereich von Wert und Nutzen zu organisieren.“ 179 Insofern sind die Begriffe „soziologisch“ und „funktional“ auf den Herstellungs- und Ablösungsaspekt, also auf die Synthese des Zeichens bezogen. Es ist ein Vorgang der Ent- und der Reideologisierung.
118 9. VORLESUNG
diert auf „gesellschaftliche und geschichtliche Faktoren“ und insbesondere auf die Dynamik synchronischer und diachronischer Veränderungen einer jeden Strukturkonzeption: „Die Synchronie zielte auf die Herausarbeitung von gesetzmäßigen, konstitutiven Zeichenbeziehungen, während die Diachronie sich im wesentlichen auf die reine Beschreibung ihrer empirischen Veränderungen beschränken müßte.“180 Das Problem der gleichzeitigen, also strukturalen Verfehlung hadert mit dem Darstellungsproblem von Situativität (alle Zeichenbeziehungen sind gleichwertig, „praktikabel“) und Inszenierung (alle Zeichenbeziehungen müssen gemäß einer quasinatürlichen Rhetorik prozessieren). In einem Text/Buch kann im Lesen (das immer auch ein Nachschreiben ist) nicht zugleich die Veränderung einer Bedeutung durch das performative Lesen bedeutsam werden. Das Problem stellt sich im Übrigen nicht, wenn man von der linearen Konzeption der Sprache (ihrer Diachronität) den medialen Übergang zum Film, und allgemeiner: zum Bewegtbild oder zum bewegten Blick (Bühnen, Theatralitäten) wagt. Solches geschieht schon in den 1920er Jahren etwa in der Psychologie durch Kurt Lewin, der zeitliche Einheiten als Strukturen der Verzeitlichung betrachtet, oder in der Diagrammatik durch Otto Neurath in der Wiener Schule, ausgehend im Wesentlichen nicht vom Strukturbegriff, sondern vom – im Laufe der Strukturdebatte verkümmerten, bei Sartre aber noch lebendigen – Gestaltbegriff, der sich mangels begrifflicher Ausdifferenzierung und unter den unseligen Aspekten der Einfühlung und der Ähnlichkeit als zu unwissenschaftlich disqualifizierte.181 Das bewegte Bild ist an sich schon quasinatürliche Selbsthervorbringung, die sich von der natürlichen Wahrnehmung durch die Manipulation der Zeiteinheiten unterscheidet. Neuraths Experimente mit ikonischen Statistiken zeigt, wo das Problem des Zeichens in der Darstellung kultureller Prozesse liegt: Bilder/ Zeichnungen/Ideogramme sind nicht so universell, wie sie sich geben. Sie schleusen insgeheim Referenten ein, die von einer kulturellen Gruppe als Kontextbezug gar nicht mehr wahrgenommen werden können. Sie werden nicht produktiv gelesen, sondern synthetisch konsumiert, auch wenn ihr Abstraktionsgrad etwa in den Piktogrammen nur noch schematische Formähnlichkeiten mit der „natürlichen“ Wahrnehmung ausweisen. Vom Film ist es nun kein Geheimnis, dass seine Rezeption unter quasinatürlichen mythischen Synthesen erfolgt. Ist es also ein Problem, Semiotik aus einer linguistischen Tradition heraus zu entwickeln und somit andere „künstliche“, mediale Sprachen auszusparen? Die gesprochene Sprache hat doch eine Besonderheit, die sonst nur noch von der Musik 180 Weber,
Das linke Zeichen, a.a.O., S.49.
181 Der Gestaltbegriff und die Gestalttheorie verfolgten vor allem zwei Problemfelder: das der Über-
summenhaftigkeit, also das der „Vergemeinschaftung“ oder Synthesen von Elementen, und das der „Transponierbarkeit“ also der Dekontextualisierung (Strukturierung) dieser Synthesen. Vgl. Edmund Husserl: Logische Untersuchungen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis II/1. Tübingen 1980, S.277ff. Husserl ersetzt den Gestaltbegriff durch den der Ganzheit und sieht im Einheitsmoment bezüglich der Elemente der Ganzheit ein Verhältnis der „Fundierung“ (S.277). Interessant wird diese Darstellung, wenn Husserl auf das Problem der Elementarität von Zeit abhebt. Die entsprechende Totalisierung (Ganzheit) ist die der Vorstellung. Von der Vorstellung kommt er zum Zeichen: „Darnach heißt nämlich Vorstellung soviel wie Repräsentation in dem doppelten Sinne der Vorstellungsanregung und der Stellvertretung. [...] Überhaupt heißt das Zeichen, gleichgültig ob es Bildzeichen oder Nennzeichen ist, ‚Vorstellung‘ des Bezeichneten.“ (S.503)
9. VORLESUNG 119
repräsentiert wird: Sie ist flüchtig, d.h., Produktion und Konsumation erfolgen gleichsam militant (oder „dekonstruktiv“) im simultanen Prozess. Der Dingausweis entfällt. Hinzu kommt, dass die technische Reproduktion der gesprochenen Sprache erst außerordentlich spät erfolgt, sodass das Theater im akustischen Bereich – weniger im Bühnenbild – von der Präsenz der gesprochenen Sprache lebt, die allerdings stilistisch und deklamatorisch ornamentiert wird.182 Aber auch hier ist die bestimmung dadurch geprägt, ob man die Arbeit oder die Ware als Produkt der Produktion ansieht. Roland Barthes hat schon ab Anfang der 1960er Jahre die Gefahr gesehen, dass ein ausschließlicher Bezug auf die gesprochene Sprache schließlich jeder rhetorischen Wendung einen spezifischen Zeichenterminus zuordnen müsse. D.h., wenn Sprachspiele universell und diskret sind: Von welchem Standpunkt aus will man dann das Spiel als Spiel erkennen, wenn die konkrete und die terminologische Sprache homolog sind? Man könnte in der semiotischen Taxonomie die Sprache metaphorologisch verdoppeln und eine unendliche Liste von Unterscheidungen des Zeichens in seiner Anwendung aufstellen.183 Aufgrund dieser Überlegung sah Barthes sich gezwungen auf eine essayistische Form auszuweichen, die es erlaubt, einzelne Szenen, Dinge und Praktiken semiotisch zu untersuchen, und die nicht an der Sprache, sondern am Objekt und der Erfahrung orientiert war und ihre Synthese fragmentarisch hielt. Eine solche induktive Methode der Differenzierung der Zeichen entsprach nicht dem linguistischen Ansatz der Konzeption einer Universalsprache zur Vermeidung von Widersprüchen und Bedeutungsschwankungen, an der schon das Konkurrenzunternehmen der Hermeneutik gescheitert war – jedenfalls soweit hermeneutische Konzeptionen von den Strukturalisten zur Kenntnis genommen wurden. Hier taucht erneut das Problem der künstlichen, kybernetischen, logikbasierten Sprachen auf, deren Entwicklung unter Führung mathematischer Rechenmethoden deduktiv erfolgt. Der facettierende, kinematografische Blick von Barthes erprobte sich an den klassischen narrativen Einheiten. Der Mythos als die substituierte Praxis einer ethnologischen Natur konnte auf einfache Weise in seine Differenzen zerlegt werden, indem er als funktional-sinnhaft erklärt wurde: Alle Dinge werden produziert, dauern und vergehen. Doch man muss zwischen der epigenetisch matriarchalen und der patriarchalen Genese unterscheiden. Alle diese grundsätzlichen Probleme einer Metaphorologie184 oder Taxonomie wurden damals von verschiedenen Autoren grundlegend gestellt und unter dem Sammelbegriff „Poststrukturalismus“ oder „Neostrukturalismus“185 diskutiert 182 Vgl.
Göttert, Geschichte der Stimme, a.a.O., S.373ff. Einige Tabellen dazu finden sich bei Barthes, Elemente der Semiologie, a.a.O. und bei Eco, Semiotik, a.a.O. 184 Hans Blumenberg: Theorie der Unbegrifflichkeit. Frankfurt am Main 2007, S.99: „Was wir über die Welt metaphorisch aussagen, bezieht sich gar nicht auf den Unterschied von Gegenstand und Horizont, von Einzelheit und Ganzheit, sondern auf die Eigenschaften, die sich überhaupt einer theoretischen Erörterung entziehen, aber auch nicht in der Weise der Wertung oder Emotion aus Einzelerfahrungen aufbauen und integrieren lassen.“ 185 Dosse, Geschichte des Strukturalismus Bd.2, a.a.O., S.135. Wobei Dosse den Umschlagspunkt 183
120 9. VORLESUNG
und als eine Art Universalismusstreit ausgefochten, der insbesondere den Status des Referenten, d.h. die Produktion und Macht des Subjekts betraf, das die letzte Stellung des synthetischen Ortes der Dialektik einnimmt – das also selbst dialektisch, individuell und allgemein sein muss (so schon die Reflexionsbestimmung bei Schelling und Schleiermacher). Es ist demnach zwischen der historischen und der sozialen Bestimmung des Subjekts zu unterscheiden: Ist das Subjekt ein Produkt seiner Umund Mitwelt (seiner Zeichenstruktur), erübrigt sich die Bestimmung seiner Freiheit; die Freiheit ist eine des Zeichens, nicht des Subjekts. Ist es aber ein durch keine Allgemeinheit zu begreifendes Faktum der kommunikativen Irregularität, muss es letztlich als autonom und frei bestimmt werden. Beide Ansichten kreuzen sich an einer strukturalen und einer hermeneutischen Methode der Deutung. Das Problem bleibt also der unbestimmbare, notwendig unbewusste dritte Faktor im Produkt des Zeichens: der Referent, als situativer Kontext, der trotz aller Serialisierungen und Formalisierungen in Raum und Zeit individuell sein muss. Den Ausweg, den Weber bei Saussure sich anbahnen sieht, ist durch den Begriff „Spiel“ (im Sinne von „Freiheit“/„Beweglichkeit“, „etwas hat Spiel“) annonciert. Spielzug und Struktur etwa des Schachspiels, auf das sich Saussure verschiedentlich bezieht, lassen eine digitale, d.h in Parenthesen der Situation darstellbare Beschreibung zu. Denn die Stellung der Figuren (ihre szenische Beziehung) ändert sich nicht kontinuierlich, sondern nur ruckweise, also dem Filmtransport – 24 Bilder pro Sekunde – nicht unähnlich, aber wesentlich langsamer, d.h. mit geringerer Frequenz und längerer stabiler Dauer. Das Schachspiel hat eine dialogische Chronografie; es ist agonal, als Widerstreit aufgebaut. Dagegen ist die gesprochene Sprache, so Saussure, eindeutig konsensgeleitet was die Bedeutung angeht, nicht aber was die Funktion angeht: Man spricht, um niemals das letzte Wort zu haben. Kommunikation soll nicht finalisierbar sein – was nicht hindert, dass sie sich zuweilen totläuft oder peinliche Pausen entstehen. Unter diesen Bedingungen gibt es ein einheitliches, an der Defizität der Sprache sich abarbeitendes Subjekt. „Die Bewußtseinsart des Schachspiels dagegen deutet auf ein gespaltenes, konfliktbedingtes Subjekt.“186 Hier stellt sich Saussure die Frage nach der Relation Individualität|Allgemeinheit und nach der möglichen Bedeutung der Verfehlung einer Bedeutungsintention aufgrund der Arbitrarität der Zeichen. Wie also ist zwischen Konsenstheorie und Konflikttheorie zu vermitteln? Die Argumentation Saussures, so Weber, läuft mehr oder weniger tastend darauf hinaus, die Semiose nicht starr, sondern im hermeneutischen Sinne konfliktmoderierend zu halten. Im Sprechen zeigt sich die Bedeutungsentwicklung – und noch mehr die Sinngenese – nicht als eine opferlose Übertragung, sondern als kommunikative Diskursivität, die um ein situatives Negat streitet, das unerreichbar ist: das sogenannte „leere Feld“, das volle Subjekt (der Tod); die volle oder eindeutige auf das Jahr 1966, also den Moment des größten publikatorischen und politischen Erfolgs setzt. Manfred Frank zielt in Was ist Neostrukturalismus? eher auf die Neubewertung der Probleme unter den Begriffen: „Subjekt“, „Geschichte“ und „Sinn“. 186 Weber, Das linke Zeichen, a.a.O., S.50. Es ist nicht so sehr das dialogische Spiel, sondern die strategische Funktion des fiktionalen Entwurfs, das Weber beim Schach interessiert, weil es die Geschlossenheit der Sprache beständig überschreitet, wie sie Saussure zu bewahren sucht.
9. VORLESUNG 121
Gewissheit und das Verstehen werden nur im Negat des Sprechens selbst erreicht. Sprache erfüllt sich im Sprechen. Ihre Taxonomie ist nicht das Ergebnis konzeptueller Überlegungen, sondern einer Praxis. Eben diesen Streit zu vermitteln, der sich zwischen strukturalistischer Theorie und hermeneutischer Interpretation ausbildet und den Kern der Angriffe gegen einen orthodoxen Strukturalismus und das Ende des Autorensubjekts bildet, treten der Poststrukturalismus einerseits und die – insbesondere von Lacan und Sartre innovativ befruchtete und sich von Gadamer absetzende – Interpretationstheorie an. Dabei betont Lacan die homosexuelle, inzestuöse Dimension des Wunsches nach Identität (Finalisierung des Begehrens), die letztlich unproduktiv sei, und, um dauern zu können, eben jenes „leere Feld“ besetzt/besitzt, das vom Ideal oder Gottesphantasma aus den spielerischen Rahmen der Struktur immobil werden lasse.187 Das Zeichen ist die mit sich selbst streitende Zeitlichkeit der Subjektivität – die kontinuierliche Produktivitätsarbeit der Kontinuitätsfiktion des Ichs, so Lacan, das nichts weiter begehrt als das endlose Begehren selbst. Zu fragen ist nach der Chronografie dieses Ichs, nicht nach der Identität des Verstehens des Anderen. „Inszenieren“ meint ja gerade, dem Anderen den eigenen Mangel als eine Funktionsganzheit zur Kontingentierung offerieren. Wie sagt Lacan so schön: Liebe ist, dem Anderen zu geben, was man selbst nicht hat.188 An dieser Stelle des Streits zwischen statischer Struktur und dynamischer Funktion (um stark zu polarisieren), setzt Weber einen Begriff ein, der ein wesentliches Merkmal des Spiels ist. Es sind nicht die Regeln, die ein Spiel bestimmen, sondern es ist die Strategie der Erfüllung, d.h das Verhältnis von Vorsicht und Nachsicht, von Protention und Retention, von Entwurf und Erfahrung oder, linguistisch gesprochen, von Konvention und Innovation. Das Ich spielt also in einem zeitlich vorgreifenden, strategischen Entwurf immer schon seine interpretative Freiheit für den situativen Moment durch und verinnerlicht die Veräußerlichungen (die Gaben des Anderen) durch Konzeption einer eigenen Andersheit (das „Es“ oder das „Gewissen“ oder die „Vernunft“). Vorausgesetzt [ist], daß man „Interpretation“ nicht einfach als die Auslegung eines Sinnes versteht, der wie ein Kern im Auszulegenden schon enthalten wäre, sondern vielmehr als konfliktträchtiges Spiel, durch das sich zwar Sinn ergibt, doch unter Bedingungen, die „strategisch“ zu nennen sind, weil sie auf die Notwendigkeit der Organisation und Bewältigung von Konflikten verweisen.189
Dass zur Vermeidung von (inneren) Konflikten gerade der technisch-formale Charakter infinitesimaler Kalküle als Universalsprache der Techniken (Rechenoperatoren) eingesetzt wird, deren Fokussierung hinreichend genau ist, um die Mandelbrot’schen Unschärfen oder Kontextfokussierungen nicht als konfliktträchtig aufkommen zu lassen, bedarf keines Hinweises. Nur, gerade im Rahmen eindeuti187 Deleuze, Was ist Strukturalismus?, a.a.O., S.41. Das „leere Feld“ ist derjenige Ort, „blinde Fleck“,
an dem die Struktur ihre eigene Unabschließbarkeit erzeugt. Lacan, Das Drängen des Buchstabens im Unbewußten, a.a.O., S.15ff. In diesem Text von 1957 geht Lacan dezidiert auf die Semiotik Saussures ein. 189 Weber, Das linke Zeichen, a.a.O., S.51. 188
122 9. VORLESUNG
ger Rechenoperationen kann man sich mehrdeutige „Inhalte“ erlauben. Wobei die Eindeutigkeit nicht nur logisch ist, sondern auch unterhalb der Schwelle der Wahrnehmbarkeit. Man muss schlicht die Pixel übersehen, die das Bild ausmachen, um die Bedeutung zu erfassen und als Sinn zu transponieren. Eine unserer Grundannahmen war die, dass zwischen dem Innen und dem Außen eine homologe Beziehung besteht, die übrigens ja auch Lévi-Strauss schon als strukturalen Modus von sozialen Gemeinschaften annoncierte. Ihre Übertragungen sind nicht mehr magisch, auf aisthetische Ähnlichkeit ausgerichtet,, sondern strukturaffin, auf „Mimesis“ ausgerichtet, insofern mit Mimesis die nichtvermittelte Funktionsanalogie gemeint ist. Ohne sinnliche Rückkontrolle sind interpretatorische Akte in der Semiose nicht möglich. Das öffnet neben der Idee der Freiheit auch einer Strategie der Manipulation Tür und Tor. Um sie zu kontrollieren, werden rhetorische und inszenatorische Mechanismen der Entzauberung entwickelt. Und mittlerweile hat sich auch gerade unter Informatikern durchgesetzt, dass menschliche Kommunikation im Überbietungsgehorsam eines regelgerechten Gebrauchs agonal stratifiziert ist: Sie wird neurotisch, symptomatisch, referiert also nicht auf die Bedeutung, sondern auf den Prozess der Bedeutsamkeit selbst. Es sind dann nicht die Ingenieure oder die Designer, die sich für die Pixelstruktur interessieren, sondern die Neurotiker, die auf die objektiv psychotische Professionalisierung des Blicks mit ihren Symptomen hinweisen. Lacan konnte leicht nachweisen, dass jeder für den Anderen eine andere Andersheit darstellt, die in der Frage nach der Erfüllung des fehlenden Signifikanten kursiert und zu allerlei Zwangs-, Wahn- und Kontrollmechanismen greift, deren theatralischste –die „Hysterie“ – sprichwörtlich eine Szenifikation von Maschinisierungs- und Medienkunst ist. Wenn Saussure sich auf die gesprochene Sprache als linguistischen Gegenstand beschränkt, so ist es heute einer medienwissenschaftlichen Öffnung der Semiotik gerade darum zu tun, die Dynamik, die Saussure zu bannen suchte, voll zu entfalten. Und dafür steht, so Weber, Peirce’ „linke“, weil „linkshändisch“ begründete Strategie ein, die sich der philosophischen Konformität auf ähnliche Weise entzieht (so Peirce), wie es Nietzsches Aphoristik in der deutschen Philosophie tat: indem sie sich der systematischen Geschlossenheit verweigerte. Die Arbeiten von Peirce verweigert sich einem geschlossenen Werkcharakter. Man muss Peirce, so Weber, ganz anders lesen als Saussure. Peirce’ Ansatz verpflichtet sich der Abwehr einer möglichen „intuitivunmittelbare(n) Erkenntnis“.190 Die Antwort nach einer positiv zu bestimmenden Form von „Intuition“ soll ermöglicht werden. Dabei ist das Negat erstens niemals vollständig negativ, zweitens aber auch kein sich seiner selbst bewusstes Subjekt (Schöpfer, Autor), sondern ein „Referent“, der der Dyade von Signifikant/Signifikat von „vornherein als Bewegung der Andersheit und der Äußerlichkeit“191 zustößt und als drittes Element hinzugefügt wird. Das Zeichen erweist sich also nicht durch sich selbst, sondern durch die Abhebung einer Kontextualität bzw. durch deren Substitution formiert oder inszeniert, d.h mit dem Mandat einer Anwendung auf sinnvolle 190 191
Ebd., S.55. Ebd., S.56.
9. VORLESUNG 123
Integration hin für einen Anderen ausgerichtet. Es gilt dabei, das „leere Feld“ der mangelnden Totalisierung ständig kommunikativ weiterzutragen, und nicht, es durch ein Pseudos zu erfüllen. Die einzig gelingende Erfüllung ist der Tod. „Integration“ ist angesichts der rechenoperativen Anschlussfähigkeit von Decodierung das passende Wort für den mediierenden Prozess. Nur durch infinitesimale Integration und Differentiation lässt sich eine Homologie zwischen formalen und natürlichen Sprachen und Zeichen invertieren. Strukturalismus und Hermeneutik sind nicht antinomisch, sondern relativ polarisierende Opponenten ihrer Referenz. In der gesprochenen Sprache wie in der Praxis des Umgangs mit Dingen kursiert Sinn als Diskurs, der nur als Gewalt- und Machtform einseitig festgeschrieben werden kann. Wenn er sich festigt, so geht er in medialen Praktiken oder Gebrauchsanweisungen der Dinge ein – im glücklichen Fall. Folglich sind alle Dinge gewaltförmig. Der Rest bleibt infinitive, todesphobische Praxis: verhandelbar, tauschbar.
10. VORLESUNG Das Verhältnis von Wirklichkeit und Möglichkeit bezeichnet Peirce als Signifikation – Inversion ist Signifikation – Zeit ist angeschautes Werden – Überschreitung im Hinblick auf Bedeutung, realisiert Möglichkeit innerhalb von Wirklichkeit – Verzeitlichung des Zeichens – Aufhebung des Strukturalismus als Verhältnis „Teil/Ganzes“ – Präsenz ist positives Merkmal situativer Unabschließbarkeit der Interpretation – Ist der Entwurf als Überschreitung einer Konvention unterworfen?
Das Problem, das sich Peirce zu Beginn seiner Überlegungen zur Logik des Zeichens stellt, betrifft nicht die Dynamisierung und Umbesetzung einer Ordnung, sondern die Funktion der Verweisung. Von Kant ableitend fragt er danach, wie sich vorstellendes Denken durch Vernunft moderieren lassen kann, ohne in eine unendliche Reflexion von Ich und Ich-Anderem eintreten zu müssen. Wirklichkeit (Präsenz des Signifikanten) und Vorstellungssinn (Idealisierung des Signifikats) unterscheiden sich für Peirce nicht ontologisch, sondern in dem Maße, wie Wirkliches und Vorgestelltes auf den vermittelnden Denkakt reagiert, wenn das logisch Vermittelte wirklich sein muss. Was ist dieses dritte Element, dieses abgeleitete Wirkliche? Ob das unmittelbar vor dem Geist stehende Objekt das Wirkliche Objekt ist oder nicht, scheint eine Frage zu sein, der man nur schwer irgendeine klare Bedeutung zuschreiben kann. Doch ist gewiß, daß kein Nachdenken über es das wirkliche Objekt verändern wird, denn genau dies ist gemeint, wenn man es „wirklich“ nennt.192
Am Anfang steht für Peirce eine Art Nullverweisung der Form „Zeichen“, die funktional auf sich selbst weist. Die Überlegungen von Peirce haben die gegenteilige Prämisse wie jene von Saussure. Sie gehen nicht von einer prästabilisierten Ordnung der Sprache aus und untersuchen von dort aus die Abweichungen und Modifikationen, sondern von einer Prozessualität (Funktionalität): Denken und Bezeichnen sind nämlich (qua Kontingentierung und Codierung) in ihrem Verweisungsbezug a priori wechselseitig verantwortlich dafür, dass die Gegenwart (die „Nullverweisung“ einer alltäglichen lebendigen Indifferenz) sich in Vergangenheit und Zukunft aufspaltet. Ort dieser Nullverweisung ist das Individuum. Wählt man also die Prozessualität als Ausgangspunkt, muss man die Zeitform dynamisch betrachten, während Saussure im ihm zugesprochenen Cours sie nur als etymologischen oder historischen Fall betrachtet, nicht aber als Instabilität der durch und durch künstlichen, medientechnisch ausgerichteten Praxis der Individuen. Peirce denkt das Zeichen als Modus der Überschreitung von Individualität, das sich in der Wirklichkeit vermittelt und aufhebt. Wir akzeptieren zu Demonstrationszwecken die pauschale Polarisierung: Saussure steht für Raumordnung, Peirce für Handlungsordnung. Den Vätern der Linguistik fehlen die Mütter: die Medien, in denen gedacht und gehandelt wird, 192 Charles Sanders Peirce: Semiotische Schriften 3 (1906-1913). Essays über Bedeutung 1909-1910. Frankfurt am Main 1993, S.351.
126 10. VORLESUNG
in denen Wirklichkeit als Mangel auf Möglichkeit verweist. „Zeitordnung“ steht dagegen bei Peirce in erster Linie für Handlungspraxis, nicht für linguistische Fälle. Nun ist ein Gedanke, wie beispielsweise die Bedeutung eines Wortes, offensichtlich von der Natur einer Gewohnheit. Tatsächlich können wir eine Bedeutung (meaning) als eine mögliche Gewohnheit definieren, die bestimmt, wie ein allgemeines Zeichen zu verwenden ist. Die Bedeutung eines allgemeinen Zeichens weist zwei Elemente auf. Denn jede Gewohnheit hat drei Elemente, von denen die Bedeutung eines verliert. Die drei Elemente jeder Gewohnheit sind: erstens dasjenige, was festlegt, welche Handlung durch sie angeregt wird, zweitens dasjenige, was festlegt, aufgrund welchen Anlasses es diese Handlung anregt, und drittens dasjenige, was festlegt, in welchem Sein die Gewohnheit lebendig wird. Da eine Bedeutung keine lebendige Gewohnheit, sondern nur eine mögliche Gewohnheit ist, ist sie in keinem Geist mehr als in einem anderen lebendig. Dies ist die Definition des Wortes „möglich“, so wie es in der Definition von Bedeutung verwendet wird.193
Wenn die Übermittlung der Bedeutung des Zeichens in der Möglichkeit latent ist, bezieht Bedeutung sich auf eine Präsenz, d.h. eine Gegenwart, ein Seiendes, das hier oder jetzt da sein kann oder nicht – das auf jeden Fall aber als Vorstellung, also in Möglichkeit, Bedeutung gewinnt. Dieses Verhältnis von Möglichkeiten (wobei Möglichkeit als Vorstellung ungeschieden Vergangenheit und Zukunft umfasst) ist es, was Peirce als „Signifikation“ bezeichnet, Freud als „das Unbewusste“ und Marx als „Produktionsmittel“. Dasjenige, wozu die Bedeutung anregt, ist das Erscheinen eines Vorstellungsbildes. Ein Vorstellungsbild kann als ein Zeichen aufgefaßt werden, doch besitzt es keine Bedeutung. Es zeigt einfach sich selbst, und indem es dies tut, stellt es alles dar, dem es ähnlich ist, insoweit es irgendeinem Vorstellungsbild ähnelt. (Denn es kann nichts anderes als einem Vorstellungsbild ähneln.) Dies Element der Bedeutung wird Signifikation (signification) genannt.194
In den Ausführungen von Peirce an zitierter Stelle wird prägnant, dass der Präsenzbegriff des Zeichens eine ausgezeichnete Stellung hat, weil er klar gegen die Vorstellungsbilder abgegrenzt ist. Für Peirce sind also die funktionalen Momente das, was Freud „Rücksicht auf Darstellbarkeit“ nennt relevant. „Präsenz“ ist der nie eintretende Grenzfall eines Zusammenfalls von Wahrnehmung und Vorstellung – der Magie, durch Vorstellung auf Wirkliches einzuwirken. Die Wirkung kann immer nur dann eine Veranlassung sein, wenn die Vorstellung in Denken übergeht, d.h., wenn sie Bedeutung (Signifikanz) veranlasst. Die Veranlassung ist eine Verschiebung, die, so gering ihre Zeitdauer auch sein mag, Wirklichkeit (Gegenwärtigkeit bzw. Bewusstsein von bzw. Denken) immer verspätet erscheinen lässt. Das leere Feld des Strukturalismus wird so zur Wirkung/Produktivkraft vektorieller Präsenzen. Bedeutung ist für Peirce, weniger noch als für Saussure, kein Reservoir der Konventionen oder Gewohnheiten, sondern der Akt der Inversion, der die Vorstellung in Bezug auf Wirklichkeiten/Veränderbares mit Möglichkeit auflädt. Solches heißt in der hermeneutischen Tradition „Interpretation“. Wir haben weiter oben schon betont, dass nicht die Zeit, sondern die Zeitformen (Perioden, Szenen, 193 194
Charles Sanders Peirce: Semiotische Schriften 2 (1903-1906). Frankfurt am Main 1990, S.178. Ebd.
10. VORLESUNG 127
Dauern) Sinnkonstituenten sind, während der Fokus von Bedeutungsgegenstand näher bei der Ansicht Saussures steht, signifikante Elemente zu betrachten. Diese Unterscheidung beruht wohl zum großen Teil darauf, dass Saussure empirischer Linguistik mit philosophischem Anspruch ist, Peirce aber von vornherein die objektive Bewegung des Denkens, d.h. den Code der Vernunft mit der Handlung verknüpft. Die Sich-Selbstgleichheit von Natur oder Wirklichkeit als kantisch ideal gedachte Erkenntnis (die Natur hat keine „Möglichkeit“) ist jedoch eine Denknachlässigkeit interpretatorischer Rückschau, die Hegel aufgehoben hat, indem er die Vermittlung als ein Werden erkannte.195 Anstelle der niemals „wahrnehmbaren“ Präsenz, die ein ideales Gebilde ist (die Sprache), setzt Peirce eine Auseinandersetzung mit der Kontinuität des (kantischen) „Ich“ entgegen. Das Zeichen (der Signifikant) verweist auf eine analoge Reaktivierung der Vorstellung im Durchgang durch ein Ordnungs- und Regelsystem, eine Membran der Sprache. Peirce kann jedoch nicht zwischen Reflexion und Inversion unterscheiden; denn die Idee der Membran setzt keine absolute Trennung zwischen dem Menschen und den Dingen voraus. Die Vermittlung kommt dem Ich als seine eigene Verspätung zu. Die Präsenz ist immer Identität und somit ein Negat. Denn in Wirklichkeit unterschlägt die Unterscheidung zwischen „Ich“ und „Ding“ die Verdinglichung beider Momente, solange man nicht den den beiden Begriffen inhärenten homologen Wertcharakter erfasst. Philosophisch stellt sich damit die Frage, wie das „Ich“ von sich (und seinen Bedeutungsproduktionen) Kenntnis nehmen kann. Wenn nicht in Identität, dann in Differenz über den Anderen oder, das ist die nichtsoziologische Variante, über den Aufschub der Zeit. Da aber alle Anderen zueinander Andere sind, bleibt die Analyse der zeitlichen Verspätung die Nachträglichkeit als Differenzmoment. Das Ich muss als Verzeitlichung bestimmt werden. In dieser Hinsicht greift Peirce in Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Philosophie sehr viel tiefergehend die Frage auf, welches Organ das Ich in dieser Oszillation von Genesis und Geltung spielt, er greift damit sehr früh in eine Debatte ein, die im französisch dominierten Poststrukturalismus mit seiner Fixierung auf Saussure kaum rezipiert wurde, aber mit Heidegger dann vehement die Debatte lenkt. Verzeitlichung ist ein progressives Produzieren – hermeneutisch gesagt: ein divinatorischer Prozess – keine Findung, sondern Schaffung von Sinn. Die Strategie der Philosophie kann jetzt von zwei Seiten aus die Dynamiken entwickeln – gesetzt, dass Menschen und Dinge nicht absolut geschieden sind, sondern aneinander vermittelt. Erstens lässt sich das Ich-Andere-Verhältnis aufspalten inform soziologischer Beziehungen. Personen, Gruppen, Klassen, Parteien – also systemische Einheiten. Diesen Weg, der von den Strukturalisten, insbesondere Lévi-Strauss, aufgrund seiner Politisierung heftig als „unwissenschaftlich“ kritisiert wird, zeigt Sartre in der Kritik der dialektischen Vernunft auf. Zweitens kann eine Analyse der Zeit unter dem Einfluss des Denkens Heideggers, welches das Moment des „Werdens“ bei Hegel differenziert, den 195 G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes. Frankfurt am Main 1980, S.25. „Denn die Vermittlung
ist nichts anderes als die sich selbst bewegende Sichselbstgleichheit, oder sie ist die Reflexion in sich selbst, das Moment des fürsichseienden Ich, die reine Negativität oder auf ihre reine Abstraktion herabgesetzt, das einfache Werden.“
128 10. VORLESUNG
Progress der Vermittlung von Vorstellung und „Präsenz“ genauer fassen – und zwar in Beziehung zur Gegenwärtigkeit (Situativität) der „Umwelt“; als geschichtliche Produktivkraft des Menschen, der Verwandlung von Sein in Zeit. Die Objektivität ruht somit in der subjektiven Vermittlung oder in der Vermittlung der Subjekte. Wenn das „Subjekt“ ontologisch als existierendes Dasein begriffen wird, dessen Sein in der Zeitlichkeit gründet, dann muß gesagt werden: Welt ist „subjektiv“. Diese „subjektive“ Welt aber ist dann als zeitlich-transzendent „objektiver“ als jedes mögliches „Objekt.“196
Genau diese Idee macht sich die Systemtheorie der Soziologie zunutze. Sie sieht nämlich das Verhältnis der Individuen untereinander in gleicher Weise wie das der Subjekte zu sich selbst, womit sie den Begriff der Subjektivität durch den der Beobachtung substituiert und die Beziehungen als Zeit, wie Hegel sagt: als „angeschautes Werden“ betrachtet.197 Das Denken der Verspätung/Realisierung des Signifikats gegenüber dem Signifikanten hat unabsehbare Folgen für eine serialisierte Form des Zeichens. Das serielle Zeichen wird zu einer Form, die die Verspätung durch die Reproduktion aufhebt. Die Warenform der industriell gefertigten Dinge ist zirkulare Dauerpräsenz. An ihr ist der Prozess der Verspätung (die Natur der Produktion) nicht mehr ablesbar. Die seriellen Zeichen (Design) fundieren Präsenzgesellschaften, die sich, wie Baudrillard früh gezeigt hat, dem Konsum aus Gründen ihrer Logik unterwerfen, nicht aus Gründen einer Begierde oder eines Mangels. Nun ringen die professionalisierten Bezeichner – die Designer, Kreativen, Ingenieure, Künstler – darum, den Zeichenformationen mittels Inszenierung die Vor- und Nachgeschichte wieder anzudichten, die sie in der Produktionsvergessenheit verloren haben. Die Zeitmessung richtet sich nach dem Verhältnis von Erlebnis und Aufmerksamkeit. Die Strategie der Reszenifikation wird nicht an ein Subjekt gerichtet, sondern es unterstellt dem Subjekt selbst die Konstitution seiner selbst als seiner Geschichtlichkeit – oder allgemeiner – seiner Physiologie. Baudrillard nennt diese Hintergehung der Sinne Verführung. Peirce nimmt mit seinem chronologischen Ansatz der Vor- und Zurückverweisung der Semiose (Möglichkeit/Wirklichkeit) Thesen vorweg, die Sartre später in seiner existentialistischen Hermeneutik unter dem Begriff „Entwurf“ entfalten wird. Der Entwurf ist, wie die Szene, eine Möglichkeit innerhalb der Wirklichkeit. Er ist nicht serialisierbar, weil er eine Überschreitung enthält. Die Überschreitung geht ebenfalls auf eine nachkantische Problemstellung zurück und umgeht den Unendlichkeitsbezug idealistischer Identitätskonzeptionen. In gleicher Weise hat der Interpretant bei Peirce eine „intellektuelle Funktion“ – nämlich die der „Interpretation“.198 „Interpretation“ meint nicht „unendliche Ausdifferenzierung“, sondern „Rückgang auf eine Präsenz“, die sich als Negat von Vergangenheit und Zukunft gibt und die ich qua Bewusstsein meiner selbst werden kann. Erst die Überschreitung auf Bedeutung 196
Martin Heidegger: Sein und Zeit. Tübingen 1979, S.366. Ebd., S.431. Heidegger kommt in den Schlussparagraphen von Sein und Zeit auf das Problem der Geschichtlichkeit bei Hegel zu sprechen. Hegel denkt in der Enzyklopädie die „Zeit“ als „angeschautes Werden“. 198 Weber, Das linke Zeichen, a.a.O., S.59. 197
10. VORLESUNG 129
hin realisiert die Möglichkeit innerhalb der Wirklichkeit. Das Zeichen schafft demnach eine Äquivalenzbeziehung zur Präsenz als dessen Negat.199 „Bewusstsein von etwas haben“ und „Bewusstsein der Lesbarkeit der Welt“ sind bei Peirce im Wesentlichen identisch: als Bedeutsamkeit(sproduktion). Peirce schließt, wie Husserl und nach ihm Sartre, ein „reines Bewusstsein“ aus. Als Interpretant verfehlt Bewusstsein sich permanent selbst und kann somit nur eine quasidialektische Translucidität haben, die niemals in Synthesis aufzuheben ist, sondern sich nur in den Signifikaten, d.h. den Dingen, Sachen und Funktionen selbst ritualisiert, kondensiert und konventionalisiert – oder schließlich als Serialität konsumiert. Die Tendenz zur Verwirklichung ist immer mit einem Mangel an Möglichkeiten des Gebrauchs erkauft. Das schließt nicht aus, dass man die Konvention jederzeit überschreiten könnte, auch wenn die Dinge einen massiven Widerstand entfalten. Wir haben schon angedeutet, dass Sartre aufgrund dieses Primats der Dinge eine Psychoanalyse der Sachen einfordert – also dieser Widerständigkeit, und nicht etwa eine Psychoanalyse des „Unbewussten“. Das Unbewusste ist für Sartre – das Da-draußen-Gegebene, dessen Präsenz in der Dauer der Sachen ruht. Denn in den Sachen ist der Prozess der scheiternden/gelingenden Ichbildung zur Ruhe gebracht; „aufgehoben“, wie es bei Hegel in vierfachem Sinn heißt. Peirce, so Weber, äußert sich bezüglich dieser Selbstblockade/-stabilisierung ähnlich: Die Äquivalenzbeziehung der Zeitform seien „Qualität und Rücksicht. Beide aber bedeuten, daß der durch den Interpreten gestiftete Bezug der Äquivalenz immer nur partiell sein kann. Anders gesagt: die Äquivalenzbeziehung von Zeichen und Gegenwart ist nie absolut, sondern immer bedingt.“200 Was also der Interpret (nicht das Interpretans) leistet, ist die verbindende Hinzufügung einer kontinuierlichen Präsenz (Bewusstsein oder Ich) gegenüber dem uneinholbar vorlaufenden Abwesenden – der vom Anderen konstituierten Praxis, in die ich als Anderer meiner selbst „unbedeutend“ eintrete. Bedeutung ist Präsenz von Möglichkeit, was subjektiv der evozierten Vorstellung der Zeichenverweisung entspricht: Ich bin Bewusstsein der Zeichenrelation, ich inter-pretiere (trete dazwischen), d.h., das Ich tritt als Osmose der Semiose auf und produziert sich als eine Sache: als Wert der Dinge für mich und, weitergedacht: als Besitz, Ökonomie und Logik der Verdinglichung und seiner Transzendierung in Geldwert. Die grundlegende Erkenntnis, die Weber bei Peirce herausarbeitet, ist die der Verzeitlichung des Zeichens: „Aber ebenso deutlich wird die Tatsache, daß dieser Interpretant nur unter bestimmten Bedingungen, in einer gewissen Rücksicht – und zwar im wörtlichen Sinne, also rückgängig – funktionieren kann.“201 Das Negat des Zeichens darf mithin kein Element sein, sondern es muss die gleitende Bedingung der Anbindung an alle früher (und vorher) getätigten Verweisungen evozieren, wie sie in einem Medium operativ und codificiert konventionalisiert sind. Zugleich verweist das Zeichen in einem Entwurf über sich hinaus auf den Möglichkeitsraum 199 Hans Ulrich Gumbrecht: Präsenz. Frankfurt am Main 2012, S.130. Erst die Verwandlung in Geschichten erlaubt es, mit den dynamisierten Repräsentationen präsentisch umzugehen. 200 Weber, Das Linke Zeichen, a.a.O., S.59. 201 Ebd.
130 10. VORLESUNG
seiner Unbestimmtheit, die ihm vom vorstellenden Individuum – das ja für sich sub-jektiert ist – nach der Vergangenheit assimiliert wird. Medien sind konventionalisierte, mit Codierungsregeln stabilisierte Gedächtnisse; sie sind institutionalisierte Möglichkeiten, indem sie aufzeichnen, abspielen und speichern können. Man wird das „Ich“ im Peirce’schen Sinne als Medium und nicht als Instanz auffassen. Die Argumentation von Peirce, wie sie Weber nahelegt202, konfrontiert uns mit zwei Schwierigkeiten: Erstens ist die Autonomie und Positivität des Ichs im Prozess der Protention und der Retention (Husserl) respektive der progressiven und regressiven Synthesen (Sartre) genauso wenig zu halten wie die „Subjektivität“ des Poststrukturalismus. Zweitens wird die Zeit der Präsenz immer noch linear nach dem Modell der Sprache und des Textes verstanden, und nicht als ein autopoietisches Prozedieren. Denn Verspätung insinuiert, dass es eine Gleichzeitigkeit gibt, die verschüttet wurde; eine Konvention/Wiederholung, die sich also nie ereignet hat; ein „Traum“, dessen Originalität nie rekonstruiert werden kann. Für die Topologie des Bildes, dass ja per se eine Synthese darstellt, braucht die Ordnung der Differenzen nicht linear gedacht sein – sie kann auch chaotisch oder spontan erfolgen, ungeachtet des Umstandes, dass etwa die Ikonologie203 uns gelehrt hat, dass Bilder wie Texte zu lesen seien. Allerdings schließen wir aus, dass es sich bei Imaginationen um Bilder handelt: Es sind Szenifikationen, also Handlungen. Es handelt sich nach Sartre um dynamische Gestalten, deren Bedeutungsmorphologie erst nachträglich konstituiert wird, auch wenn man die Metapher des „Kinos im Kopf“ bemüht. Die erste Schwierigkeit bezieht sich auf das Ich und seine Äquivalenzeinheiten. Hier hatten wir schon vorsichtig physiologisch argumentiert: Die Sinnlichkeit des Zeichens bedarf erst einer bestimmten Kalibrierung, um bedeutsam zu werden; die Differenz wird nicht als Differenz wahrgenommen, sondern als ein Gleiten. „Der Mensch“ ist wie seine Sprache eine kulturelle und historische Erscheinung. In erster Linie sind für die Linguistiker (zu denen Peirce nicht zu zählen ist) die Einheiten des phonematischen Bedeutens relevant. Bilder, Metaphern, Allegorien sind nicht die primären Einheiten der Linguistik. Die zweite Schwierigkeit betriff die Aufgabe, die Synthesis als Bild zu verifizieren. An dieser Stelle würden wir gerade den Begriff „Szene“204 setzen, um den bei Peirce gewonnenen und später über Heidegger von Derrida explizierten Begriff der Zeit- und Bewegungsdifferenz (Auftritt, Handlung, Abgang) nicht wieder sta202
Es ist für unseren Zusammenhang nicht von Bedeutung nach dem „tatsächlichen Peirce“ zu fragen, da Weber gerade von der Disparatheit seiner Publikationen, vom „Linkischen“ seines Schreiben und von der gebrochenen exegetischen Tradition seiner Schriften ausgeht, die auf deutsch erst spät zugänglich und in Frankreich kaum, allenfalls durch Eco vermittelt rezipiert wurden. Erst 1969, auf Émile Benvenistes Initiative hin, erscheint in der Zeitschrift Semiotica eine Auseinandersetzung mit Peirce. Vgl. Dosse, Geschichte des Strukturalismus Bd.2., a.a.O., S.237. 203 Erwin Panofsky: Ikonographie und Ikonologie. In: Ekkehard Kaemmerling (Hg.): Ikonographie und Ikonologie. Theorien, Entwicklung, Probleme. Bildende Kunst als Zeichensystem Bd.1. Köln 1979, S.207-225. 204 Christians, Crux Scenica, a.a.O., S.40. Es geht natürlich um den „Einbruch der Zeit“ der Deutung im Bild sowie um die Verzeitlichung des Bildes selbst als realisierter und zu realisierender Entwurf.
10. VORLESUNG 131
tisch werden zu lassen. Damit sind auch die von Saussure, Peirce und später von Lacan und Barthes annoncierten Begriffe „Metonymie“ (Verschiebung/Textualisierung) und „Metapher“ (Verdichtung/Szenifizierung) als dynamisch eingeführt – und es wird vermieden, nach den gestaltästhetischen Kriterien des Strukturalismus von einem Verhältnis „Teil-Ganzes“ auszugehen, mit dem Vorrang der Ganzheit. Eine weitere Pointe der Darstellung von Peirce – nach der Einführung eines Primats der Dynamik in Analogie zu den Imaginationen – besteht in der Überwindung der Vorwürfe einer anthropologischen Starre des Zeichenbegriffs, die im Grunde bei Peirce eine philosophische Ausrichtung der Semiologie, keine wissenschaftliche bestätigt. Peirce vermittelt damit die Differenz zu jener schlecht-romantischen Hermeneutik einer subjektgewissen Interpretation – der inzestuösen Identität von Sprecher und Zuhörer, Autor und Leser –, indem er die Präsenz als positives Merkmal der situativen Unabschließbarkeit der Interpretation einführt. In performativer, handlungsorientierter und systemsoziologischer Hinsicht bedeutet dies heute eine Selbstverständlichkeit. Dass Peirce’ Argumentationsform, die wir hier auf unseren Bedarf kompiliert und polarisiert haben, linkisch und unbeholfen wirkt, ist weniger ihm, als dem Medium zuzuweisen, dass er für seine Darstellung benutzt und das den Sprung vorwärts und rückwärts in die Zeit nicht abbildet: Lesen respektive sprechen scheint stets unaufhaltsam progressiv zu arbeiten. Doch jeder, der einen Satz hört oder liest, muss entlang der Wörter regressiv und aktiv die Bedeutungen und progressiv den Sinn in rückwärtiger, retroaktiver Erinnerung der Satzeinheiten oder des Satzganzen synthetisieren. Analyse und Synthese aber geschehen als Vergegenwärtigung, als Bewusstwerdung, oder als Verzeitlichung. Dies macht den ganzen reziproken Gabencharakter des Sinns aus: In der Gabe ist die Sphäre der Produktion und der Arbeit zwischen Autor und Leser invertiert. Es scheint so, dass der Sinn sich mir gibt, obwohl ich ihn produziere. Da der Vorgang der Synthese von (auf Zukunft/Möglichkeit gerichtetem) Entwurf und (auf Vergangenheit bzw. Gedächtnis gerichteter) Konvention aber in einer Simultaneität als Präsenz geschieht, kann Präsenz eine normative, integrale Zeitform annehmen: die der mathematischen Zeit, die eine Abstraktion der Tatsache ist, dass es arbeitet – dass alles erfüllt ist von einer Bewegung der Beziehungen, des Tauschs und der Gaben. In Wirklichkeit aber springen die Synthesen diskontinuierlich von den kleineren Einheiten auf die größeren und machen deswegen den Übersprung der Präsenz möglich: Bedeutung eines Buchstabens, eines Wortes, einer Phrase, eines Satzteils, eines Satzes, eines Abschnitts, eines Textes in einer physiologischen/ phonetischen Sinnlichkeitsbeziehung. Weil Präsenz nicht das Nu eines Augenblicks (rien), sondern eine inversible Zweiseitenform von Verinnerlichung und Veräußerlichung (Produktion/Konsumation) ist (also „Bewusstsein“), gibt sie sich nur als Relation kund, nicht aber als Einheit des Zeichens. „Zeichen“ ist ein synthetisierender Begriff. Eine ökonomisierte, serialisierte Praxis muss immer so gestaltet sein, dass sie eben nicht auf diese Ableitungen angewiesen ist, sondern dass das Nachfolgende durch das Vorhergehende unmittelbar bestimmt und im notwendigen vorbereitet ist. Ob der vorauseilende Entwurf eingeholt oder verfehlt wird, bemisst sich an der Kalibrierung des Systems „Text|Kontext“ bzw. „System|Umwelt„. Es gilt:
132 10. VORLESUNG
Die für das Zeichen konstitutive Herstellung von Äquivalenz durch den Interpretanten ist also „historisch“ im einfachen Sinne von rück-blickend, retrospektiv, durch seine Angewiesenheit auf frühere Interpretationen (Zeichen). Aber der Interpretant ist nicht minder prospektiv, vorausgerichtet; denn die Setzung einer bestimmten Äquivalenzbeziehung schafft damit zugleich ein Zeichen, das wiederum vorausblickt, d.h. auf seinen Interpretanten gleichsam wartet.205
Auf dieses Spiel (im Sinne eines Spielraums/Dauer der Präsenz) entwirft Peirce eine Dynamik, die – eingespannt zwischen „Situation“ und „Variabilität“206 – sich eine Präsenz in reflektorischer Dauer zu geben vermag, in der der Zeichenprozess für sich selbst transparent, szenisch bzw. konstruktiv wird; denn wenn ich meine Handlungen auf das hin befrage, warum und wozu ich sie tue, synthetisiere ich das Handeln als Ganzheit, Szene. Dann ist es Voraussetzung, dass wir das Zeichen vom Ich als Referenten der Beobachtung (Inversion) überschreiten und nicht gleichsam signalisierenden Effekten und Affekten unterliegen. Wir können festhalten: Die Konstitution des Zeichens ist eine Konstitution jener Zeit, in der ein Subjekt sich verzeitlicht. Eine weitere Frage lautet: Ist die Überschreitung nicht selbst einer Konvention unterworfen? In dieser Frage reflektiert der Strukturalismus seinen Umbruch und seine Auflösung unter den historischen Ereignisse des Mai ‘68.
205 Weber, 206
Das linke Zeichen, a.a.O., S.60. Ebd., S.62.
11. VORLESUNG Programm der Geltungssicherung – Zerbrechen des anthropologischen Konsenses in einen informationslogischen und einen sozialwissenschaftlichen Zeichengebrauch – Verdichtung der Zeit – Stimme ist kometenhafte Spur eines Erscheinens der Präsenz – Der Schein opferloser Gabe im Sprechen – Reduktion des Wertes auf eine ökonomische Wahl des Gleichen (Reproduktion)
Die Probleme des Strukturalismus, die man glaubte aus dem Cours abgeleitet zu haben, entsprechen nicht der Lektüre, die Weber 1980 an zentralen Positionen Saussures und Peirce’ durchführt. Eine poststrukturalistische Revision ist damit zu entschuldigen, dass die statische Relation der Semiose auf der Grundlage von Analogien von Ganzen und Teilen zunächst dazu dient, einfache Grundregeln für eine Beziehung von Sprache und Zeichenfunktion aufzustellen, die den nominalistischen Dualismus und seinen Wahrheitsbegriff destruieren. Der Poststrukturalismus erweitert den Begriff des Zeichens sowohl auf psychologischer Ebene, indem er die psychoanalytischen Ansätze der Ich-Bildung und -destruktion mit aufnimmt (mit Lacan), und er erweitert den Begriff der Sprache, indem er die Frage nach den Sprachgemeinschaften (Foucault) und der Diskurse und ihrer Machtverweisungen und -repräsentationen (Ideologiekritik) in den Fokus rückt und die Konfrontation zwischen Ich und Anderem zu vermitteln beginnt. Ergebnisse dieser Aufweichung der Polaritäten sind in den 1960er Jahren, eine Abschwächung orthodoxer Positionen zwischen strukturalistischer und subjektivistischer Sinngenese, eine Dynamisierung der Relationen und Opponenten sowie eine Abkopplung der Semiotik von der Linguistik durch Ausweitung der Analysen von Sprachen auf Medien, das heißt der die Kommunikation beherrschenden Techniken. Hinzu kommt eine neues Verständnis von Medientechnikgeschichte und „physiologischem Humanismus“ unter einem flexiblen Leib- und Systembegriff, dessen Separation von mechanistischen Metaphern hin zu relativistischen, energetischen und handlungstheoretischen Metaphern geführt hat. Insbesondere die erst spät rezipierte philosophische Tragweite des Ansatzes von Peirce, die wir mit Weber konstruiert haben, hat Ludwig Jäger in einem Aufsatz beispielhaft historisch aufarbeitet. Er bezieht sich zunächst auf das „Synchronie-Diachronie-Theorem“207 bei Saussure. Wenn es nämlich eine Eigenschaft von Strukturdenken ist, sich methodisch und wissenschaftlich auszudrücken, so bedeutet eine funktionale Sichtweise auch, dass die Theorie philosophisch als prognostischen Auftrag fungiert, das Denksystem konvertierbar für eine gesellschaftliche Praxis zu halten, die sich als „Macht“ der „Konvention“ aus einer Vergangenheit begründet und legitimiert; die es versteht, ein Repräsentationsprogramm von „Dauer“ zu systematisieren; die also Geltung zuerst nicht in Wechselbeziehung mit Genesis bringt. Dieses 207
Ludwig Jäger: Linearität und Zeichensynthesis. In: Fugen: deutsch-französisches Jahrbuch für Textanalytik 1980. Olten 1980. S.187-212, hier S.188.
134 11. VORLESUNG
Programm der Geltungssicherung (auch einer jeden Wissenschaft) schafft Bedingungen, die für das Hier und Jetzt Stabilität bedeuten, ohne dass die Legitimationen ständig angezweifelt oder aktualisiert werden müssen – auch wenn sie in Riten, Beschwörungen und Festen für eine Zukunft wiederholt werden, die der Vergangenheit gleichen soll. Ein solches Repräsentationsprogramm wird im abstrakten, geldvermittelten Warentausch schon immer mitgedacht, aber es fehlt die Transzendierung auf eine Produktionstheorie geld- und zeichenvermittelter Vergesellschaftung. Kann eine genetische Theorie als Werttheorie wissenschaftlich begründet werden, ohne auf den empirischen und statistischen Algorithmus – als die Medialisierung der großen Zahl – auskommen zu müssen? Dagegen soll das „transzendentale Motiv“ der Zeichenstrukturierung ein „Interesse“ „an einer Erzeugung prognostischen Wissens“208 erfüllen, und zwar für die Form individueller, und nicht für jene statistisch „vergesellschafteter“ Ereignisse. Das Tauschverhältnis von Zahl (Geld) und Zeichen als Bedeutung produzierende Ökonomie rückt dadurch in den Fokus.209 Damit ist nicht nur eine Ideologisierung, sondern auch eine Historisierung des Zeichenbegriffs relevant geworden, die im Konsum „den Zwang zur modischen Erneuerung beinhaltet und damit die exklusive Praxis der Kultur als eines symbolischen Systems von Sinn durch die spielerische und kombinatorische Praxis der Kultur als System von Zeichen ersetzt.“210 Von nun an müssen die Semiotiker erkenntnislogisch entweder die Sprache „von allen jenen Momenten einer historisch gesellschaftlich vermittelten Subjektivität [...] reinigen“211 – erste Bedingung von wissenschaftlicher Erkenntnis (Reinheit der Zeichen) – oder die Bedingungen der Verunreinigung, nämlich die verfehlte Identität von Präsenz und Zeichen in der Wertfügung des Marktes klären, d.h., den Ort der Verunreinigung von einem angeblich reinen Denken, einer reinen Vernunft und reinem, opferlosem Tausch säubern. Unter diesen beiden Prämissen, der wissenschaftlichen Desituierung einerseits und der soziologischen und historischen Bezugnahme andererseits, zerbricht der anthropologische Konsens des Strukturalismus in einen informationslogischen-kybernetischen und einen sozialwissenschaftlich-historischen Zeichengebrauch.212 Bedeutsamkeit und Gebrauch schließen sich jedoch in Konsumgesellschaften kurz, d.h. ihr Kurzschluss, der opferlose Tausch, ist eine Simulation durch Zeichen, die die Wirklichkeit der Opferproduktion verdeckt, per Design (Be-Zeichnung) substituiert. An die Unreinheit (den Rest) kommt man nur heran, wenn man erstens die Zeichenlogik durch eine Kritik der historischen Produktionslogik ersetzt, und zweitens den Appell an die Reinheit, die Identität des Verstehens als eine bloß symbolische Geste hermeneutischen Verstehens 208
Ebd. Jean-Paul Sartre: Kritik der dialektischen Vernunft. Theorie der gesellschaftlichen Praxis. Reinbek 1980, S.103: „Man könnte daher zweifellos die Sprache in derselben Weise wie das Geld untersuchen: nämlich als zirkulierende, inerte, Zerstreuungen vereinende Materialität.“ 210 Baudrillard, Die Konsumgesellschaft, a.a.O., S.158. 211 Jäger, Linearität und Zeichensystem, a.a.O., S.189. 212 Biografisch beispielhaft ist das den Schriften von Umberto Eco zu entnehmen, der ab den 1970er Jahren mehr oder weniger die Durchgestaltung der Semiotik aufgibt und sich den narrativen und szenischen Einheiten zuwendet, wie zehn Jahre früher schon Roland Barthes, der sich einer flexibleren Essayistik zugewendet hat. 209
11. VORLESUNG 135
diskreditiert, die in Anlehnung an technisch-mechanistische Metaphorik so tut, als würde Bedeutung von einem Sender A störungsfrei zu einem Empfänger B übertragen werden und als wären Subjekte daran also nur jenseits der Designoberflächen und Interfaces beteiligt. Mit einer unglaublichen Ignoranz wird dieses Modell von Shannon und Weaver213 durch alle Medienwelten hindurch gefeiert und der Unterschied von Information und Kommunikation zu Gunsten eines romantisch-hermeneutischen Ideals eines eindeutigen und abschließbaren Verständigungsfriedens proliferiert, den die Medientechniken angeblich garantieren können. Kein Wunder, wenn eine Ableitung der Medienwissenschaft sich aus der Logik des Krieges als eine Art globalem Siegfrieden speist. Wenn diese Ignoranz die herrschende Praxis digitaler Sinnverführung beschreibt – die ja reibungsarm funktioniert –, wie kann man dann das Zeichen noch anders in die Objektivation des Tauschs bringen als durch das reine Zeichen schlechthin, die Zahl oder durch den selbstreflexiven, poetischen Signifikanten? Mit diesem letzteren Fall wollen wir uns hier nicht weiter beschäftigen.214 Die Informatik hat rechenpraktisch – nicht mathematisch-theoretisch – dafür gesorgt, dass Informationsquellen digital (und eben nicht auf Basis analoger Ähnlichkeitsbeziehungen) möglichst rein und störungsfrei laufen, indem sie sich im Wesentlichen an ihrer eigenen normativen Zeit – z.B. der CPU eines Rechners – orientieren und kontrollieren.215 Die Rechenmaschinen sind aus der Zeit, weil sie ihre Eigenzeit, ihre Frequenztaktung selbst erzeugen d.h., System und Umwelt arbeiten geschlossen, referieren aber nur im Programmbezug aufeinander. Was Science-Fiction, also Literatur gerne prophezeit, nämlich dass Maschinen sich selbst klüger machen können als sie sind, geht nur mit gestaffelten Metaebenen gemäß der Mandelbrot’schen 213 Eco greift es in seiner Semiotik (a.a.O., S.73) nur noch als Modell eines physischen Kommunikationsaktes auf, an dem nicht die Zeichen, sondern nur die Codes Anteil haben. Es handelt sich aber um eine Metapher der elektrischen Übertragung, des Telegrafen, die immer noch in den Köpfen der Informationstheoretiker als Modell herumspukt – vielleicht sogar noch bei Kittler, der die Medientechniken letztlich auf diesen militärischen Posten reduziert. Dass es auch eine semantische Wechselwirkung zwischen Inhalt und Einschaltquoten gibt, berührt aber grundsätzlich die technische Normierung auch und verändert sie beständig. Wenn es z.B. tatsächlich nur um Sprachübertragung ginge, hätte man auf dem Stand des Phonographen stehen bleiben können. Vgl. auch Eco, Einführung in die Semiotik, a.a.O., S.54: „Es muß hier eine Tatsache unterstrichen werden, die man wegen des analogischen Gebrauchs der mathematischen Begriffe oft zu vernachlässigen neigt [...], daß nämlich der Wert ‚Information‘ nicht mit dem Inhalt, der mitgeteilt wird, gleichgesetzt werden darf. In der Informationstheorie zählt die mitgeteilte Bedeutung nicht. [...] Für die Informationstheorie zählt die Zahl der Alternativen, die für eine eindeutige Definition des Ereignisses erforderlich ist, und es zählen die Alternativen, die sich an der Quelle als mitmöglich darstellen. Die Information ist nicht so sehr das, was gesagt wird, sondern das, was gesagt werden kann. Die Information ist das Maß einer Wahlmöglichkeit bei der Selektion einer Botschaft.“ 214 Letztlich sind es die Phänomene der Fiktionalität und der Ironie, die im Informationsbegriff schwierig werden, sodass Literatur sich als Zufluchtsort des nicht Eindeutigen ausgeben kann. 215 Die Digitalität bedarf also – um Sinn für eine Gesellschaft zu machen, also Kommunikation zu modulieren – immer eines interpretierenden Analogons. In Wirklichkeit sind die elektromagnetischen Frequenzen, denen das Signal digital aufmoduliert wird, natürlich analog, nämlich elektromagnetische Wellen, die als Rechtecksignale moduliert sind. Zur Entwicklung dieser technischen Normierung als Zähmung primärer Produktion vgl. Ralf Bohn: Technikträume und Traumtechniken. Die Kultur der Übertragung und die Konjunktur des elektrischen Mediums. Würzburg 2004.
136 11. VORLESUNG
Rekursion. Das Opfer dieser Maschinen ist eine bis ins Unermessliche verdichtete Rechenzeit – und hier handelt es sich tatsächlich um eine Verdichtung der Zeit, die die Sinne täuscht: Gerechnet wird nicht mit exakten Zahlen, sondern mit logarithmischen Werten. Wie in der Logik Wahrheit durch Pragmatik ersetzt wird, wird in der Technik Mathematik durch Rechenoperationen ersetzt, denn es ist nicht schwer, die Leistungen der Sinne zu überbieten. Erst mit der Hinwendung zur Ungenauigkeit und der Verdichtung von Rechenzeit, gebrochenen Dimensionen und Rekursivitäten werden die Operationen beliebig genau.216 Aufzeichnung, Berechnung und Wiedergabe sind streng geschieden, es sei denn, man bringt die Ergebnisse rekursiv in die Rechnung wieder ein. Mandelbrotmengen sind solche rekursive, autopoietische Mengen, die zu selbstähnlichen Zeichenformationen führen, welche auf ideale Naturformen verweisen. Jede Rekursion entspricht einer der Synthesen (Perioden) auf dem Weg der Progression-Regression, wie wir sie gleich genauer beschreiben werden. In den elektronischen Maschinen, deren Kraft-Wärmeumsatz gigantisch ist, kann also wirklich nicht von verlustloser Übertragung die Rede sein. Die Verluste entziehen sich nur vollständig unseren Sinnen, während die Gewinne sich als Gotteswunder in Erscheinung bringen: in all den schwerelos präsenten Zeichen. Der einzelne Fall, der der „historisch gesellschaftlich vermittelten Subjektivität“, muss historisch-systematisch abgeleitet werden, um das Wechselnde vom Dauernden zu trennen. Lévi-Strauss war auf diesem Weg, indem er die überzeitlichen, anthropologischen und kulturspezifischen Riten der Stammesgemeinschaften untersuchte, um „moderne“ Gesellschaften zu befragen, die sich im Wesentlichen nicht durch die Dynamik der Narration, die Zirkularität des Jahres, der Feste und der Verwandtschaften, sondern über den abstrakten Tausch und das Moment der darin enthaltenen Reziprozität bestimmen. Zur historischen Analyse unserer gegenwärtigen Präsenzkultur, der Geschichtslosigkeit unterstellt wird217, bieten sich zwei Wege an: Der eine führt über Husserl und Sartre und behandelt die regressiv-progressive Interpretationsmethode, also die zirkuläre Spirale, die nicht zum Anfang zurückkehrt, sondern diesen verschiebt, differiert, aufschiebt und das Ideal der Identität und der Stellung des Zeichens auf seinem Platz verhindert. Der andere Weg, den Jäger nachzeichnet, geht vom Formnegat Saussures zurück zu Humboldt und dessen Konzeption einer weiter nicht reduzirbaren Linearität der Sprache als absolutem Präsenzmedium (das Negat der phone), dem gleichwohl die linguistisch verifizierbare Geschichte als Spur seiner Verschiebung eingeschrieben ist. Wir müssen ähnlich wie Derrida ein Primat der Schrift vor der Stimme einräumen. Wir fragen nach der Spur dieser Schrift – 216 Mandelbrots fraktale Geometrie ist dafür ein anschauliches Beispiel. Ohne solche Algorithmen ließe sich heute kein Bildgenerator betreiben und keine „künstliche, digitale Welt“ darstellen. 217 Baudrillards Analyse der Konsumgesellschaft beweist das Gegenteil. Einerseits propagiert er unentwegt das Ende der Zukunft, weil er glaubt, dass aus der Globalisierung dieses Phänomens kein Weg herausführt, dass also die Herrschaft des Zeichens nicht mehr durch die Emanzipation der Sinne durchbrochen werden kann, sodass es zu einem „Streik der Ereignisse“ kommt. Andererseits aber gilt: Mit der Übermittlung des Zeichens in Lichtgeschwindigkeit kommt der historische Fortschritt an seine physikalische Grenze. Er zerfällt in seine Bestandteile. Ein „katastrophische[r] Prozeß der Rekurrenz und der Turbulenz folgt.“ Vgl. Jean Baudrillard: Die Illusion des Endes oder Der Streik der Ereignisse. Berlin 1994, S.24.
11. VORLESUNG 137
ganz gleich, ob daraus nicht der Zirkelschluss folgt, dass es eben auch keine „reine“ Geschichtlichkeit, keine reine Kontingenz gäbe. Erst wenn der Zufall nicht rein ist, kann die Geschichte selbst eine „Schrift“ sein, die Spuren, Verunreinigungen, Krisen mit sich führt. Ist die Historie der Schrift in ihren Anfängen nicht weniger Kriegsund Herrschaftsgeschichte als Aufzeichnung des Handels und der Festlegung der Vergleichbarkeit der Besitzwerte? Jedenfalls widmen wir uns hier nicht dem Problem der Identität, sondern dem der Art und Weise der Verfehlungen des Verstehens, von denen Freud annimmt, dass sie strategischer Natur seien und, wie das Symptom, eine Form der Rede artikuliert – auch wenn Freud nicht die Schlüsse zieht, die wir daraus folgern können, nämlich dass es zwischen dem positiven Sinn des Verstehens und seiner ihn begleitenden negativen Form selbst eine semiotische Differenz gibt, die nach einer bestimmten Art und Weise – bei Freud dem Unbewussten, bei Sartre dem Möglichen des Gebrauchs (Gebrauchsverfehlung oder Politik des Handel(n)s) – betrifft. Bevor wir zur positiven Bestimmung der Zeicheninterpretation bei Sartre kommen, sei das Referat der Analyse von Jäger wiedergegeben, das als Vorgeschichte der Lösungen verstanden werden kann, die Derrida einzureichen versucht hat, die wir aber auch nicht weiter aufgreifen wollen, da sie auf Aspekte von „Schriftlichkeit“ führen, die wir allgemein systemtheoretisch betrachten wollen. In der geprochenen Sprache ist evident, dass der Laut eine relative Präsenzform hat. Er erklingt und verklingt ohne zu dauern, er ist gleichsam nur die kometenhafte Spur eines Erscheinens. Das „heißt nichts anderes, als daß jeder ertönende Laut den ihm Vorausliegenden negiert, um seinerseits durch den ihm folgenden negiert zu werden. Insofern impliziert das ‚Prinzip der zeitlichen Sukzession‘ nicht nur die Negation der räumlichen Simultaneität, sondern auch die Negation des in der Sukzession Erscheinenden selbst.“218 Wir haben es hier mit einer Art doppelter Aggregation zu tun, wie sie dem Welle-Teilchen-Dualismus eigen ist. Die Struktur- oder Systemähnlichkeit liegt nicht im topologisch-chronologischen Bereich, sondern, so führt Jäger mit Saussure weiter aus, im Bereich der Unterscheidung von akustischen und visuellen Zeichen, wobei erstere den letzteren „überlegen sind“219, da visuelle Zeichen ihre Materialität nie ganz aufheben können; sie sind gleichsam schon (stärker) mit Wirklichkeit infiziert. Akustische Zeichen sind reiner als visuelle. Erst der Film, der die Flüchtigkeit des visuellen Eindrucks auf eine Lichterscheinung, also ein technisches Medium zurückführt, verschiebt diesen Eindruck von der Substanzlosigkeit der Sprache, von der Unmerkbarkeit einer Dauer des Schalls. Nun hat sowohl die Sprache wie die Musik im Gegenzug intensiver mit der Inszenierung ihrer Perioden, die im Wesentlichen zeitliche Modifikationen sind, zu tun. Der Charakter des Negats leitet denn auch seit Humboldt, Herder und Hegel sprachwissenschaftlich den Substitutionsanspruch technischer Medialität in der Opposition Form/Medium ein. Medium ist ein „relativ Nichtseiendes“. Die Substitution wird bei Saussure durch die Darstellung der beiden Pfeile angedeutet, die jede mögliche Inversion zwi218 219
Jäger, Linearität und Zeichensynthesis, a.a.O., S.194. Ebd., S.195.
138 11. VORLESUNG
schen Signifikant und Signifikat an den Beginn der Handlung einer Unterscheidung, d.h. deren Möglichkeitsschema setzt. Die Denkfigur der Inversion, also des Tauschs signifikanter und substituierter signifikativer Differenten bezüglich des sinnlichen Erscheinens (Materialität) wird hier und insbesondere bei Humboldt zum Kriterium einer Unterscheidung, die nur noch formbestimmt ist – ein sinnfälliges Beispiel bieten die Kippfiguren oder Inversionsbilder, bei denen eine gewisse Gleichwahrscheinlichkeit der Substitution zwischen Signifikat|Signifikant (Kontur|Fläche, Form|Medium) möglich ist, die sonst in Homonymen vergegenwärtigt werden können (Ball:|:Ball; Läufer:|:Läufer; Bank:|:Bank). Für Humboldt schon ist die zeitliche, nicht mehr die räumliche Differenzierung ausschlaggebend für die Konstitution von Sinn. Man kann nämlich physiologisch immer nur eine Seite der Vexierform als Signifikat bestimmen. Zeitlichkeit und Bedeutungsvorstellung sind ein und dasselbe.220 In einem Argument des Kriterienkatalogs, den Jäger anhand von Unterscheidungen Humboldts auflistet, erfährt man: „Die Umrisse nebeneinander liegender Dinge vermischen sich leicht vor der Einbildungskraft, wie vor dem Auge. In der Zeitfolge hingegen schneidet der gegenwärtige Augenblick eine bestimmte Gränze (sic!) zwischen dem vergangenen und zukünftigen ab. Zwischen Seyn und Nicht mehr seyn ist keine Verwechslung möglich.“221 Allerdings wird auch hier die Phonematik, obwohl gleitend, als schärfste Grenze des Vergangenen und Zukünftigen erfasst. Dass mit der Verzeitlichung der phone als reinem Zeitverlauf der Präsenzen auch die Schärfe des Begriffs ausgezeichnet wird, ist ein Nebeneffekt, der alle idealistische Philosophie zu schriftfixierenden Begriffstheorien verwandelt, da die Stimme sich nicht in einem Bild festhalten lässt. Idealistisch ist diese Humboldt’sche Sprachtheorie weniger im Gedanken der Totalität, als in jenem einer systemischen Universalität, der Ableitung der Welt aus dem Begriff. Humboldts Sprachtheorie widersetzt sich vehement der Aufhebungslogik der Hegel’schen Geschichtsdialektik, weil sie die Geschichte nicht als zielfixierten Verlauf, sondern als disparate Folge von empirisch festlegbaren Einheiten begreift, die differieren und synthetisieren. Der Sprache im Humboldt’schen Sinne fehlt – anders als der Geschichte bei Hegel schlicht ein Telos. Ihr Ziel kann nicht die absolute Verständigung sein. Sie ist praktisch, nicht theoretisch organisiert. In der Tat zeigt gerade eine Analyse der differentiellen Struktur der phonischen Substanz den engen Zusammenhang, den der Akt der Zeichenkonstitution mit dem der Systembildung hat: Wenn nämlich jeder Akt der Artikulation, indem er die Identität eines sprachlichen Zeichens hervorbringt, zugleich ein Akt der Abgrenzung ist, der sich dem distinguierenden Medium der phonischen Substanz verdankt, wenn also jeder Akt der Zeichen-Konstitution notwendig ein Akt der Negation ist, so heißt das nichts anderes, als daß bereits jede einzelne 220 Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen. Frankfurt am Main 1980, S.309. Wittgenstein
orientiert sich an den doppelt semantisch belegten Formen der Vexierfiguren: Die Zuordnung der jeweiligen Bedeutung gelingt nicht simultan, man muss sie nacheinander in den Blick nehmen und erblickt dabei die Zeitlichkeit des eigenen Blickvorgangs (Semantisierung) „Wir deuten sie also, und sehen sie, wie wir sie deuten.“ Allerdings hütet sich Wittgenstein davor, die Vorstellungsaktualisierung unter dem abstrakten Blick des Zeitäquivalenz zu betrachten. Er bleibt konsequent auf der Seite der Bedeutungsbildung und vollzieht damit nicht den Schritt, den Heidegger mit Kant unternimmt. 221 Jäger, Linearität und Zeichensynthesis, a.a.O., S.197. Jäger zitiert W. v. Humboldts Fragment Über Denken und Sprechen (1795/96).
11. VORLESUNG 139
Handlung der Hervorbringung eines sprachlichen Zeichens, also seiner Identitätskonstitution, zugleich notwendig eine systembildende Handlung ist.222
Über den Umweg einer historischen Ableitung (Humboldt) des Begriffs der Struktur lässt sich erfahren, was in der „Artikulation“ bei Saussure, die die Begriffe „Medium“ und „Codierung“ bzw. Kodierungskonvention auf technische Garanten einer systematisierten Normierung reproduzierbarer Vollzüge aufbaut, verloren gegangen ist, was aber Humboldt noch als systembildenden, natürlichen Vollzug einer Gabe der Sprache gepriesen hat – auch wenn sich durch die Normierung nicht immer das technisch reinste, sondern der ökonomisch und logistisch unproblematischste Mediengebrauch politisch durchzusetzen vermag: derjenige unbefragter, irreflexibler Machtpraxis. Die technischen Medientäuschungen bilden die „natürlichen“ durch Überschreitung des Sinnenleibes nach. Dessen Rekonstruktion und Simulation soll nachträglich im szenografischen Erlebnisparcours wieder eingeführt werden. Hier kreuzt das technisch Machbare die sinnlichen Kapazitäten. Ihre psychologisch-physiologische Beachtung taktet die Differentiallogik der Informatik mit der unterlegenen (substituierten) menschlichen Sinnenauffassung: Was abstrahiert worden war, muss sinnlich wieder in Szene gesetzt werden. So erscheint gerade der Wunsch nach Stabilisierung einer umfassenden Strukturbeschreibung der Kultur (à la Hegel), wie ihn Eco und Barthes schon Ende der 1960er Jahre als nicht realisierbar festgestellt haben, als Herrschaftsform vorgeblich reiner technischer Vollzüge. Das mengentheoretische Problem allumfassender Kontrolle der Sinne, das durch beliebige Erhöhung der Rechen- und Rekursionskapazitäten seit Turings und Mandelbrots ersten Studien am COLOSSUS und an IBM-Rechnern möglich geworden ist, stabilisiert sich am ausgeschlossenen Einschluss des sich selbst im Konsum produzierenden Subjekts, nämlich als notwendiger Ausschluss des Kältetodes der Identitäten. Nur war das immer schon im Vorgang des Lesens bekannt: Lesen als magische Produktion muss man über den rituellen Vorgang der Alphabetisierung erlernen, um schließlich durch das Negat der Buchstaben hindurch den Sinn zu visionieren, zu divinieren. Das setzt voraus, das jeder Leser lernt, seinen eigenen Sinnen (dem Sehen) nicht zu trauen und das stumm Gesehene (die Buchstabenfolge) in Gehörtes und das arbiträre Zeichen wieder in kinematische Visionen zu verwandeln. Wenn es so ist, dass alles Verstehen immer schon artifiziell ist, dass uns also Natur nur in Form eines Negats bewusst werden muss, kann man diese Techniken auch entschlüsseln. Gerade auf Basis einer simulativen Exaktheit zeigen sich die Verfehlungen, Brüche und Zufälligkeiten als äußerst konstante, wenn auch negative Einheiten, in der das Symbolische und das Funktionale eine Form mit zwei Seiten bilden, deren fiktionale Synthese das Zeichen sich jeder sinnlichen Bestimmung so entzieht wie der Wert substanzlosen Geldes. Denn mit Techniken der Körperaufhebung haben wir es hier zu tun, mit Medien. Sie dienen in erster Linie der Konsumation, indem sie den Wert des Wertes auf eine ökonomische Wahl reduzieren. 222
Ebd., S.201.
140 11. VORLESUNG
Wir wollen jetzt zeigen, dass es zwei verwandte Modelle der Technik der Verzeitlichung des Verstehens der Individuation gibt, die die Wertsetzung in Korrelation zur befreiten Subjektivität stellen. Das eine lässt sich anhand von Sartre als „existenziale Hermeneutik“, das andere als kunstfertige Auslegung, als „rhetorische Hermeneutik“ bezeichnen. Dieses letztere werden wir mit Gadamer präzisieren. Bleibt noch zu erwähnen, dass beide Modelle ein wenig aus der Mode gekommen sind; sich eher als Handlungsmodelle verstehen, denn als Semiotiken, und schließlich durch komplexere und universellere Optionen der Systemtheorien an den Rand der Aufmerksamkeit gedrängt wurden. Dabei präferiert Sartre den ideologischen, Gadamer den ästhetischen Wertbezug.
12. VORLESUNG Sartres Politik der regressiv-progressiven Hermeneutik – Die Grenzen der analytischen und der dialektischen Vernunft als mediale Einheiten des Zeichens – Das Medium der Situation ist die Praxis – Praxis ist der widerspruchslose und widerstandslose serielle Umgang des Menschen mit den Dingen – Situationsbewusstsein und Entwurfsbewusstsein – Aufgabe des Reflexionsparadigmas – Die dritte Negation: Produktion von Möglichkeit – Strukturdenken ist Herrschaftsdenken über Zeit
Wird das Lesen eines Textes als mechanischer Vorgang betrachtet, so ist zu erfassen, dass ein konstantes Präsenzereignis gleichsam wie ein Filmprojektor die sich differierenden Einheiten der Signifikanten und die Sequenzen des Sinns linear und zeitlich fortschreitend abzuarbeiten scheint. Der Augenschein trügt. Die vertikale Komponente der Bedeutung scheint in der Mechanik des Lesens den Sinnen selbst zu entgehen. Die Buchstabenfolge (der Code) suggeriert Bedeutung in einer diachronen Bewegung: Buchstaben, Worte, Sätze sind aber Synthesen. Operativ ist die Codierung der Einheiten selbst für die Synthesen verantwortlich und orientiert sich an der Stellung der Synthesen (grammatisch) untereinander. Die Produktion selbst ist das Produkt: Als solche ist sie Arbeit, die ihren Widerstand umgeht. Die Synthesen erscheinen dadurch als Übersprungshandlungen. Man greift dem Sinn voraus, man hängt ihm hinterher und überspringt Irrelevantes. Der Rhythmus des Lesevorgangs ist nicht beliebig, sondern durch einen Autor intendiert. Sartre hat die Bewegung der Analyse und der Synthese in einem Prozess geordnet, den er „progressiv-regressiv“ nennt. So entsteht in einer dialektisch-spiralförmigen Bewegung der Wert kontinuierlicher Präsenz als ein Bewusstsein als Abstand von vorlaufender (codierter) und einholender (decodierender) Bewegung. Ob ich gelesen werde oder lese ist also nicht entscheidbar. Die Synthesen hängen nicht nur von den sinnlichen Leistungen ab, sie sind Techniken. Präsenz ist in zwei Aggregaten vorhanden: als Ereignis und als Prozeß in wechselseitiger Negation (Zweiseitenform). So ist es möglich, aus der unechten Dialektik eine Synthese zu erzeugen, deren Einheit ein Subjekt für sich illusioniert. Ohne die positive Verifikation der Illusion ist die Aussage „A inszeniert für B Ereignis C“ nicht als Inszenierung erlebbar. Wie ist nun diese Dialektik des Abstandes zwischen der technischen und der divinatorischen Interpretation beschaffen? Sartre arbeitet sie in Die Kritik der dialektischen Vernunft als Deutungstheorie analog seiner eigentümlich unorthodoxen materialistisch-dialektischen Synthesen von Gemeinschaften aus. Ihre Vorgeschichte ist weniger durch die Vorarbeiten der deutschen Romantik (Schleiermacher, Humboldt) geprägt als durch die in den 1930er Jahren erfolgte Rezeption Husserls. Sartre gelingt es, mit seiner Darstellung die Elementarität des Zeichens grundsätzlich in Frage zu stellen und Bedeutsamkeit als Ergebnis der Individualität des Subjekts zu konstatieren. Er setzt also zunächst ein Interesse und ein Engagement, d.h. eine Aufmerksamkeit voraus, deren Ereignis Sinn-für-mich ist. In dieser Entgegensetzung von (allgemeiner) Bedeutung und
142 12. VORLESUNG
individuellem Sinn hebt sich das politische Interesse Sartres als eine existenzielle Hermeneutik mit politisierender Absicht wohltuend heraus. Denn Verstehen betrifft hier nicht mehr die Klausur eines Textes, sondern den Umgang der Menschen miteinander. Die Gesellschaft der Zeichen ist homolog zu der Gesellschaft der Subjekte.223 Damit greift er einem wesentlichen Konzept der Systemtheorien vor. Er stellt den Semantisierungsprozess als ein kontinuierliches Zusammenspiel von Vorstellung (Fiktion/Imagination), Produktion (Funktionalität) und Verdinglichung (Inszenierung/Gruppenbildung) dar, in dessen Mitte sich der dialektische Begriff der Präsenz hält: als Welt und als Subjekt. Diese existenziale Wende ist außerordentlich wichtig für die Stellung des Subjekts: Weder prägt jetzt die Welt das Subjekt, noch das Subjekt die Welt. Beide zusammen sind Zerfallsprodukte und Synthesen einer sich im Widerstand der Mitte haltenden lebendigen Vitalität, die schon bei Peirce angeklungen war: der Vergangenheit, die vom Verlust des Gedächtnisses bedroht ist, und der Zukunft, die von der Festschreibung der Bewegung der Realisierung bedroht ist. Sartre nennt diese gesellschaftliche Mitte „Praxis“, und die des Subjekts „Hexis“. Tatsächlich ist das Verstehen nichts anderes als die Durchsichtigkeit der Praxis für sie selbst, sei es, daß sie durch ihre Konstituierung ihre eigene Aufklärung hervorbringt, sei es, daß sie sich in der Praxis des anderen wiederfindet. Jedenfalls geschieht das Verstehen der Handlung durch die (produzierte oder reproduzierte) Handlung; die teleologische Struktur der Aktivität kann nur in einem Pro-jekt erfaßt werden, das sich selbst durch sein Ziel, das heißt seine Zukunft, bestimmt und das von dieser Zukunft her zur Gegenwart zurückkommt, um sie als Negation der überschrittenen Vergangenheit zu offenbaren.224
Der komplexe und sehr allgemeine Begriff der Praxis bei Sartre präzisiert die Funktion der Situiertheit als eine dialektische „Normalität“, deren Überschreitung, also Bedeutsamkeit, sich durch eine zirkulare Aktion der Verzeitlichung, also durch eine echte Szenifikation, auf die Situation selbst wieder zurückwerfen muss. Denn die Praxis ist ein Rätsel, das beständig wie das Lesen der Buchstaben der Enträtselung bedarf. Eben dies passiert bei der Aufforderung eines Satzes. Der Satz verweist, und seine Bedeutung, das Verstehen, antwortet darauf. Allerdings ist Sartre, wie zu betonen ist, auf ein Primat der praktischen Handlungen und nicht irgendwelcher sprachlicher oder schriftlicher Vermittlung aus – gerade umgekehrt wie Derrida, der die Praxis als eine Form der Schrift auffasst.225 Im Folgenden ist zu Recht zu fragen, ob 223 Sartre, Kritik der dialektischen Vernunft, a.a.O., S.509f.: „Aber wenn es wirklich eine Möglichkeit
gibt, die Theorie der wechselseitigen Vielheiten in einer organisierten Gruppe aufzustellen (diese Theorie ist übrigens in der Kybernetik skizziert), unabhängig von jedem konkreten und historischen Zweck und jedem besonderen Umstand, befinden wir uns dann nicht plötzlich einem inerten Gerüst der Organisation gegenüber? Und verlassen wir damit nicht den Bereich der befreienden Praxis und der Dialektik, um zu irgendeiner anorganischen Notwendigkeit zurückzukommen?“ – In den folgenden Ausführungen kommt Sartre dann auf die Probleme des anthropologischen Strukturbegriffs bei Lévi-Strauss zu sprechen. 224 Ebd., S.77 . 225 Zu dieser Auseinandersetzung vgl. Christoph Weismüller: Zwischen analytischer und dialektischer Vernunft. Eine Metakritik zu Jean-Paul Sartres Kritik der dialektischen Vernunft. Würzburg 2004. S.365ff. Weismüller geht insbesondere auf die Kritik Derridas im Aufsatz Finis homines und den Vorwurf eines „Humanismus“ bei Sartre ein. „Derridas mit Heidegger formulierter Vorwurf, daß es sich bei Sartres Werk, durchgehend mithin, um einen Humanismus handele, der notwendig metaphysisch
12. VORLESUNG 143
die von Lévi-Strauss vorgebrachte Kritik an der dialektischen (und nicht nur analytischen) Vernunft nicht auf die sozial-, sondern auf die medienwissenschaftliche und medienphilosophische Spur führen müsse. Handelt es sich um eine anthropologische oder um eine kulturelle Praxis?226 Eine Produktivität der wechselseitigen Kritik ließe sich nur durch die gemeinsame Grenze der analytischen und der dialektischen Vernunft als mediale Einheit des Zeichens im Durchgang durch die Entfremdung des je Anderen vermitteln. Dazu bietet die Einheit der Praxis und ihre Unterscheidung in serielle Situativität überschreitende Szenifikation nur einen Hinweis.227 Sartre jedenfalls ersetzt die pseudophysikalischen, analytischen Begriffe „Zukunft“ und „Vergangenheit“ durch die von „Entwurf“ und „Verstehen“. Das, was die Systemtheorie den „Imperativ der Entscheidung in einer Form mit zwei Seiten“ nennt, nennt Sartre im Rückgriff auf Marx und im Vorgriff auf Kristeva „Produktion“: „Geprägt von seiner Arbeit und den gesellschaftlichen Produktionsbedingungen, existiert der Mensch als Produkt seines Produkts zugleich inmitten seiner Produkte und bildet die Substanz der ihn selbst zersetzenden ‚Kollektive‘“.228 Diese Aussage zeigt, wie problematisch der anthropologische Ansatz ist, der in der kulturellen Situation etwa der westlichen Konsumgesellschaft (oder der Gesellschaft Frankreichs im 19. Jahrhundert, wie Sartre sie untersucht) von dem Menschen ausgeht. Gehen wir dieser Wende in der Ideologiekritik der Genese der Semiologie, der Struktur der Sprache und ihres Verstehens weiter nach. Sartre beginnt seine methodische Darstellung des Zeichens als Agenten von Bedeutung mit der Bewegung der Produktion, die aus einem Entwurf die Produkte schaffen und sie zugleich zu kollektiven Trägern von Vergangenheit und Bedeutung konsumierbar/zersetzbar halte. Eine positive Auslegung des Zeitbegriffs negiert er. Am Marxismus kritisiert er, dass dieser „die Totalisierung der menschlichen Tätigkeiten im Medium eines homogenen und unendlich-teilbaren Kontinuums, der Zeit des Cartesianischen Rationalismus“ auffasste.229 Die Zeit ist aber keineswegs wertneutral oder leer, wie das Geld. Sie frisst an der Substanz der Arbeitenden. bleiben müsse und so der Entwicklung der Humanwissenschaften sowie – um es mit Sartre zu sagen – der analytischen Vernunft und der Technifizierungsausrichtungen derselben zuarbeitet, ist sicherlich nicht rundweg abzuschmettern. Doch gerade von der Unabwendbarkeit solcher Zuarbeitung der Dialektik auf die analytischen Verschließungsinstanzen gibt die Kritik der dialektischen Vernunft philosophisch entbergenden Bericht, so daß man meines Erachtens zumal davon sprechen kann, daß solche Selbstentbergung auch eine methodologisierende Aufbrechung unkritischer Technologieprogression darstellt.“(S.375) Eine tatsächliche Produktivität dieser wechselseitigen Kritik ließe sich nach meiner Meinung und der Weismüllers nur durch die gemeinsame Grenze der analytischen und der dialektischen Vernunft als mediale Einheit des Zeichens im Durchgang durch die Entfremdung des je anderen vermitteln. Dazu ist die Einheit der Praxis und ihre Unterscheidung in serielle Situativität und überschreitende und einholende Szenifikation nur ein bescheidener Hinweis auf der Ebene der kleinsten Aktion. 226 Davon weiß die strukturale Semiotik der damaligen Zeit kaum zu berichten, zumal die deutschsprachige Initiative von Kittler mit Aufschreibesysteme 1800,1900 erst ab 1987 wirkungsmächtig erfolgt. 227 Vgl. Weismüller, Zwischen analytischer und dialektischer Vernunft, a.a.O., S.386. 228 Sartre, Marxismus und Existentialismus, a.a.O., S.66. Sartre erklärt methodisch seine eher historisch orientierten Ausführungen in der Kritik der dialektischen Vernunft. 229 Ebd., S.75.
144 12. VORLESUNG
Wir müssen zur Einordnung der Begriffe Sartres einige Aufklärung liefern. Der Aufsatz, auf den ich mich beziehe, ist unter dem Titel Marxismus und Existentialismus 1960 erschienen, unmittelbar nach der umfassenden Studie Die Kritik der dialektischen Urteilskraft, in der Sartre minutiös das Verhältnis des Einzelnen zur Allgemeinheit, d.h. die soziale Dialektik untersucht. Als eine solche individuelle Allgemeinheit hat sich für die Frühromantiker das Zeichen manifestiert. Die Zeichenrelation verbindet den konventionalisierten Teil des Signifikanten mit der je individuellen, aber auch ideellen Vorstellung des (abwesenden) Gegenstandes – mit seiner Bedeutungssynthese, auf die der Signifikant durch seine Stellung zwischen anderen Signifikanten verweist, wobei das Bedeutete oft kein Ding, sondern eine Idee, Sache oder ein weiteres Zeichen-/Medienverhältnis sein kann. Es ist nämlich nicht die partikulare Konfrontation des Signifikanten mit dem Signifikat, sondern die jeweilige Kette der Synthesen oder Codierungen, die der Bedeutung einen Wert zuweist – so wie die beiden Leisten eines Rechenschiebers durch Verschiebung den Rechenwert ermitteln. Auch Sartre nimmt an, dass die Produktion ein kontinuierlicher Prozess ist, der sich aus jeder gegebenen Situation vollzieht, und dass sein Produkt sich als Bewusstsein manifestiert. Situation ist sozusagen der Anfang oder die Nullstelle des Eintritts in die soziale Relation mit einem Korrespondenten, einer Abstoßung, einem Produkt gleich welcher Art: die Bedeutung, das Ding, das Ereignis. Das „Medium“ dieser Situation als „Umwelt“ ist die Praxis. „Die Praxis ist nämlich ein Übergang des Objektiven zum Objektiven durch Verinnerlichung.“230 Da in diesem Übergang kein Heraustreten, also kein Wechsel/Reflex der Objektebene erfolgt, sondern der Übergang auf homologer Ebene (Inversion) bleibt – als menschlicher Gebrauch der Dinge, Bedeutungen und Ereignisse, in der die Sachen und Menschen einander gleichwertig (ohne Gebrauchsstörungen) begegnen –, kommt eine Individuierung nicht vor. Das Subjekt ist das den von den Praktiken vorgegebenen gesellschaftlichen Bedingungen, Unterliegende/Substituierte. Es ist hier, anders als in der französischen Tradition, streng zwischen Individualität und Subjektivität zu unterscheiden. Man kann auch sagen, „Praxis“ sei der widerspruchslose und widerstandslose serielle Umgang des Menschen mit den Dingen. Sartre vermeidet es, von „bewusstlos“ oder „unbewusst“ zu sprechen.231 In diesem Sinne hat Sartre die gesellschaftliche Norm bei Freud neu zu interpretieren gewagt.232 Praxis ist das, was Robert Musil „seines230
Ebd., S.79. Siehe Weismüller, Zwischen analytischer und dialektischer Vernunft, a.a.O., S.402. So erweist sich die Praxis, gerade weil sie an der Schnittstelle der Bewusstwerdung stehen kann, als das eigentlich Unbewusste der Sartre’schen Dialektik. Das Moment des Heraustretens aus der seriellen Praxis bedingt, dass die Wahrnehmung dieser Praxis als „Sprachspiel“ unbewusst erfolgt. D.h., man kann die Dinge ohne explizite Erkenntnis ihres Gesamtzusammenhangs gebrauchen. Zerfällt diese Wahrnehmung im analytischen Moment, tritt zugleich die Opfererkenntnis der Selbstspaltung auf und verschließt das analytische Moment wieder in eine Synthese der Praxis. 232 Und in diesem Sinne verfehlt die Anamnese der Genese Adornos und die Kritik an einer Mediengesellschaft natürlich den notwendigen Aspekt der Verunbewusstung als Verinnerlichung. Bei Freud, so kann man sagen, ist es der Wiedereintritt in die Praxis des Unbewussten, eine gelungene Verdrängung, die die Arbeitsfähigkeit wiederherstellt, nicht aber der Aufklärung der Kritik der Gesellschaft dient, die erst der späte Freud in Angriff nimmt. Lacan vollzieht diesen Schritt Sartres in der gleiche Weise, wie 231
12. VORLESUNG 145
gleichen geschieht“233 nennt, nämlich der vollständig konventionalisierte Umgang mit Zeichen als bloßen Sachen. Diese Position des Subjekts innerhalb der Praxis ist situativ. Ohne sie würde aber die Struktur der sozialen Beziehungen nicht funktionieren. Dennoch arrangieren sich soziale Beziehungen und sprachliche Bedeutungen unentwegt zwischen Differenzierung und Indifferenzierung, Verdichtung und Verschiebung. Die Situativität der Praxis ist nur der eine Part der dialektischen Bewegung, die sich als gesellschaftliche vollzieht. Denn freilich wird die Praxis unentwegt gestört durch die Tatsache, dass sich die Verinnerlichung in der Veräußerlichung als Realität unentwegt verfehlt: Es gibt keine reinen, opferlosen Dinge. Ihr Sein wird durch den vorstellenden Entwurf unentwegt überboten werden. Wie geht dieser Entwurf nun in die Praxis ein, wie realisiert er sich? Ein vorgestellter Gegenstand konstituiert immer den Mangel des realen Gegenstandes und empfängt den Entwurf als seine zukünftige Erfüllung. Die Zeit stört ruckweise in der Verzeitlichung die Progression und die Regression, sie ist selbst nur die Praxis dieses Hin- und Hers der Entwurfsperioden. Die Veräußerlichung der Produktion versucht diese Differenz zu kontinuieren und in Quasiverdinglichungen (Wiederholungen, Riten, Konventionen) – also in einem Programm der Dauer und Wiederholungen – festzuschreiben. Aber zunächst vermittelt ein Entwurf in der Vorstellung eine erste Synthese. Die Vorstellung, die über die bloße Einbildung hinaus auf den Mangel der Wirklichkeit hin sich entwirft, nennt Sartre „Erkenntnis“. Sartre zeigt, dass die dialektische Bewegung zwischen der Wahrnehmung, die situativ erfolgt, und der Erkenntnis, die die Differenz von Vorstellung und Realität symbolisiert, oszilliert – dass sie als Bewegung nie zum Stillstand kommt und dass einmal die subjektive, einmal die objektive Synthese die Oberhand behält. „Das Subjektive erscheint mithin als notwendiges Moment des objektiven Geschehens.“234 Reflexion ist nicht Erkenntnis von sich im Anderen, sondern Erkenntnis der Unterscheidung meiner Realität von der meiner Vorstellung: Im Spiegelbild wird die Vorstellung, die ich von mir habe, mit der Wahrnehmung, die ich von mir bekomme, getauscht/ reflektiert. Hier schafft Sartre einen Übergang zwischen „Situationsbewußtsein und Entwurfsbewußtsein“235 als Übergang zur Handlung und umgeht damit das problematische Reflexionsparadigma der Ichbildung. Ist aber Erkenntnis schon eine Handlung? Lesen wir etwas ausführlicher: Damit kommen wir zur Bestimmung einer simultanen Doppelrelation; mit bezug auf das gegebene ist die Praxis Negativität: aber es handelt sich immer um die Negation einer Derrida ihn vollzieht. Die Schrift/Sprache bleibt das Paradigma der gesellschaftlichen Beziehungen. Sartre beweist aber, dass es sich bei der Schrift nur um eine, wenn auch um eine elementare Form der gesellschaftlichen Produktion handelt. 233 Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, a.a.O., S.360. „Weil Weltgeschichte zweifellos ebenso entsteht wie alle anderen Geschichten. Es fällt den Autoren nichts Neues ein, und sie schreiben einer vom anderen ab. [...] Größtenteils entsteht Geschichte aber ohne Autoren.“ Musil ist sich bewusst, dass die Geschichte ein Effekt der Vermittlungsopfer ist. Wie bei der „Stillen Post“: „Befiehlt man nun vorne: ‚Der Wachtmeister soll vorreiten‘, so kommt hinten heraus: ‚Acht Reiter sollen sofort erschossen werden‘ oder so ähnlich. Auf die gleiche Weise entsteht auch Weltgeschichte.“ (S.361) 234 Sartre, Marxismus und Existentialismus, a.a.O., S.79. 235 Ebd., S.76.
146 12. VORLESUNG
Negation; mit Bezug auf das intendierte Objekt ist sie Positivität; aber diese Positivität führt geradewegs zum „Nichtseienden“, zu dem, was noch nicht ist. Als Flucht und Sprung nach vorn, als Verweigerung und Realisierung zugleich, hält der Entwurf die überschrittene und von der sie überschreitenden Bewegung zurückgewiesene Realität fest und enthüllt sie: demzufolge ist Erkenntnis ein Moment selbst der rudimentärsten Praxis: aber diese Erkenntnis hat nichts mit einem „absoluten Wissen“ gemein; denn auf Grund dessen, daß sie durch die Negation der im Namen der allererst erzeugenden Realität zurückgewiesenen Realität bestimmt ist, bliebt sie der Aktion, die sie erhellt, verhaftet und versinkt mit ihr. Es ist mithin völlig richtig, daß der Mensch das Produkt seines Produktes ist, denn die durch die menschliche Arbeit geschaffenen Strukturen einer Gesellschaft bilden für einen jeden eine objektive Ausgangssituation.236
Dieser Abschnitt zeigt sehr klar, dass das Feld der Produktion übersprungen, aber sofort wieder restrukturiert werden muss. Man könnte hier auch sagen, zwischen Verinnerlichung und Veräußerlichung findet ein Prozess permanenter Dekonstruktion statt, der das „Feld des Möglichen“, „wie reduziert es auch immer sein mag“, realisieren muss – realisieren „als einen streng strukturierten Bereich [...], der von der gesamten Geschichte abhängt und seine eigenen Widersprüche einschließt.“237 Da die Praxis eine doppelte Negation darstellt, in der die in den Dingen (2. Negation) untergegangene Produziertheit (1. Negation) als Zeichen aufscheint, sobald die Erkenntnis sie positiviert, muss die Darstellung dieser Erkenntnis, d.h. des „Hinund-Her“238 der Produktion selbst in einer dritten Negation latent sein. Diese dritte Negation ist das Bedeutenlassen dessen, was in der Praxis bedeutsam, aber nicht bedeutungsvoll geschieht. Diese dritte Negation ist durch den Möglichkeitscharakter der Erkenntnis geprägt, die ihre eigene Negation zurücknehmen kann: Sie kann sich als Schein der Produktion produzieren – sozusagen als Bewegung der Ironisierung, so wie das Spiel und das Theater Produktionen der Aufhebung ihrer selbst sind. Erst hier ist die Produktion vollständige Inszenierung als ein einzelnes Schauspiel oder als Weltgeschichte. Produktion simuliert sich darin als Entwurf (da es ja Nichtproduktion nicht geben kann): Hier tritt die Szenifikation als Inszeniertheit in Erscheinung. Zugleich verweist Sartre erstens auf den Entwurfscharakter des Zeichens als eine Art kulissenhaftes Simulakrum, zweitens auf die „Dialektik als Ergebnis der Entwurfskollisionen“239 der Individuen, die sich als Subjekte objektivieren. Drittens, mit Hinblick auf die Permanenz der Produktion (vs. den Tod des Individuums), untersucht er das Ziel der Produktionsbewegung. Er ist dabei nicht auf eine Synthese nach Art der Vereinigung der Klassengegensätze oder der Vollendung der Geschichte aus. Insofern beweist seine Anstrengung die Gegenführung eines Existentialismus unter marxistischen Annahmen. Existentialismus heißt hier lediglich: in Bezug auf das, was als Präsenz einer jeden Existenz sich abspielt. Dieser Begriff ist sicher fünfzehn Jahre vorher in Das Sein und das Nichts von Sartre noch anders interpretiert worden. Es handelt sich um eine Konzeption, die darauf aus ist zu zeigen, dass alle Materialisierung der menschlichen Kultur nichts anderes als Vergegenwärtigungen 236
Ebd. Ebd., S.76f. 238 Ebd., S.108 und S.114. 239 Ebd., S.81. 237
12. VORLESUNG 147
einer synthetischen Vermittlung von Innerlichkeit (Individuum) und Äußerlichkeit (Allgemeinheit) als Dauer, als Akte (Zeichen) permanenter Aktualisierung und als Produktion sind, die voneinander völlig abhängig, homolog sind. Und wo sind die Produkte letztlich entmaterialisierter, fluider und strategischer als im Entwurf der Phoneme gesprochener Sprache? Nur der Entwurf als Vermittlung zwischen zwei Momenten der Objektivität kann Zeugnis ablegen von der Geschichte, d.h. von der menschlichen Schöpferkraft. Man muß wählen. Denn: man führt entweder alles auf Identität zurück (was einen mechanistischen Materialismus an die Stelle des dialektischen setzen hieße) – oder man macht aus der Dialektik ein göttliches Gesetz, das dem Universum auferlegt wird, eine metaphysische Macht, die selbst den historischen Prozeß erzeugt (was ein Rückfall in den HEGELschen Idealismus wäre) – oder man erkennt dem Einzelmenschen die Fähigkeit der Selbstüberschreitung durch Arbeit und Aktion zu. Allein diese Lösung ermöglicht es, die Totalisierungsbewegung auf das Wirkliche zu gründen.240
So erläutert Sartre den Prozeß des Entwurfs, der Produktion und deren Vorbehalt. Die Überschreitung ist einerseits eingebunden in eine dialektische (Re-) Strukturierung als Wirklichkeit und Praxis. Andererseits ist die Unruhe (Freiheit) das Ergebnis einer Überschreitung/Kollision mit dem Anderen. Der dritte Punkt bedarf einer ausführlichen Erläuterung. Er betrifft das Ziel oder Ergebnis der Produktion. Wenn die Struktur selbst die Dialektik hervorbringt, kann das Ergebnis nicht die Erschaffung einer perfekten objektiven Welt sein, zumal nicht eine der Dinge. Gemäß der Entwurfskonzeption als Überschreitung genau dieser dinglichen Praxis kann das Ergebnis selbst nur in der dritten Negation der Erkenntnis verankert sein, als Denken oder als „Aufhebung der Verdinglichung“ oder „Öffnung der Möglichkeit“. Das Ergebnis kann nicht die Befreiung des Menschen von der Produktion sein. Eben hier kommt Sartre auf einen „Sonderbereich des Instrumentalfeldes“241 zu sprechen, auf die Sprache, die die inneren Widersprüche der menschlichen Dialektik (dem individuell-allgemeinen)242 transparent macht. „Zwischen dem einfachen Enthüllen und der öffentlichen Manifestation liegt das eingeschränkte und begrenzte Feld der Kulturinstrumente und der Sprache.“243 In der Sprache ist, wie in den Dingen, die Produktionsgeschichte und die Entwurfsgeschichte zur Durchsichtigkeit der Praxis geworden. Die Sprache ist nicht Ding, weil sie „zu sinnreich“ ist; sie ist aber auch nicht Wirklichkeit, da ihre Elemente „zu wenig zahlreich sind“.244 Sie ist eine Entwurfsvermittlung, die ihre Überschreitung invertiert. Für die Sprache gilt, dass sie sich überschreitet und zu ihrer Substanz zurückkehrt, die sie ermöglicht. Dadurch erkennen wir als Verstehen die „Spuren der dialektischen Bewegung“245, auf die die Zeichenrelation als Schrift verweist. Das Referens der Peirce’schen Semiose wird bei 240
Ebd. Ebd., S.92 242 Manfred Frank: Das individuelle Allgemeine. Textstrukturierung und -interpretation nach Schleiermacher. Frankfurt am Main 1977, S.247ff. Frank widmet sich vor allem auch der vermittelnden Funktion der Hermeneutik Sartres. 243 Sartre, Marxismus und Existentialismus, a.a.O., S.91. 244 Ebd., S.92. 245 Ebd., S.117. 241
148 12. VORLESUNG
Sartre zur dialektischen Bewegung, einem dissymmetrischen „Hin-und-Her“, einer sich vollziehenden Totalisierung, die im Zeichen als Möglichkeit realisiert worden war. Aber das Zeichen ist zwischen der Wahrnehmung und dem Erkennen steckengeblieben, es hat sich verweigert, Ding zu sein. Verstehen als Interpretieren bedeutet einerseits also progressiv den Spuren dieser Konvention zu folgen, derzufolge das Zeichen eine bestimmte Bedeutung ermöglicht, die sich einer situativen, sich selbst nicht transparenten Praxis verdankt und in der die Bewegung zur Ruhe gekommen oder wiederholbar arrangiert war. Andererseits muss regressiv die bestimmte Bedeutung in einer idealen Vorstellung mit den Facetten eines individuellen Sinns kollidieren. Diese Kollision kann nur in der Totalisierung einer Szene zum Ausdruck kommen, – als diese Bedeutung in dieser Situation, also als aktualisierte Praxis der Möglichkeit selbst. Sartre fasst zusammen: Wir haben eine Reihe vor uns: die materiellen und sozialen Bedingungsverhältnisse bis zum Werk; es handelt sich darum, die Spannung zu finden, die zwischen Objektivität und Objektivität waltet, das Aufbaugesetz zu entdecken, demgemäß eine Bedeutung durch die folgende überschritten wird und das diese in jener fortleben läßt. Es handelt sich nämlich darum, eine Bewegung zu erfinden, sie wieder zu erschaffen; doch die Hypothese ist unmittelbar verifizierbar; denn nur diejenige kann gültig sein, die in einer schöpferischen Bewegung die transversale Einheit aller heterogener Strukturen verwirklicht.246
Was Sartre als Erfordernis „aller heterogener Strukturen“ meint, bringt die Semiotik in Bedrängnis, nach der Szenifikation, der Möglichkeit der Struktur zu fragen. Muss man denn nicht das entfernteste Zeichen verstehen, um ein singuläres Zeichen bedeuten zu können? Oder heißt es nicht, den Entwurf strategisch und projektiv so weit voraus zu denken, dass er sich in einem theoretischen Entwurf provisorisch versinnlicht? Die Geschichte der Analysen der Semiotik hat gezeigt, dass es auf den Akt des sinnlichen Vollzugs, und nicht auf die universale Totalisierung aller Konnotationen und Kalibrierungen ankommt. Der sinnlich, leibliche Bereich konstituiert den Wirkungsbereich seines Hier und Jetzt seiner Praxis, wenn ihm nicht die Vermittlungsdinge, die magischen Medien suggerierten, er hätte auch noch Wirkmacht über die letzten Dinge im entferntesten Winkel der Welt und er bräuchte nur einen der „neun Milliarden Namen Gottes“247 zu rufen, und mit dem einen Wort veränderte sich die ganze Welt. Dieser projektive Realisierungsdruck beendet als Kybernetik den Universalitätsanspruch der strukturalen Semiotik. Das Produktionsmoment dieser sinnlich einfachsten Synthese nennen die Hermeneutiker „Divination“. Im Zeichen nach Sinn zu suchen heißt also, aus der Praxis den Funken der Vergegenwärtigung zu erschaffen. Diese Präsenzauffassung war sowohl von Saussure als auch von Peirce immer in den zwei Komponenten des diachronen und des synchronen Ereignisse, der vertikalen und der horizontalen Gliederung des Zeichens vorgestellt, nicht aber als universelle Produktion erkannt worden, weil zwischen der Produktivität der Sprache und der Produktivität der Kultur stets 246
Ebd., S.118. Baudrillard, Der symbolische Tausch und der Tod, a.a.O., S.321ff. Baudrillard spielt auf den späten Saussure der Anagramme an, um ihn gegen den Saussure der Symmetrie des Zeichens zu stellen.
247
12. VORLESUNG 149
das Ding als Kriterium der absoluten Trennung eintrat. Es ist aber nicht das Ding, sondern es sind die Techniken der Realisierung, die die Unterscheidungen zwischen den verschiedenen medialen Praktiken ermöglichen. Erst die dialektische Bewegung zeichnet nun die Differentiation, d.h. den realen Aufschub und die Unmöglichkeit bzw. Illusion eines Strukturdenkens ab, das ein Herrschaftsdenken über die Zeit ist. Sartre fragt nach dem Sinn dieser unendlichen Differentiationsbewegung der Produktion und nach den konsumatorischen Synthesen – das ist etwas anderes, als nach der Zuordnung von Bedeutendem und Bedeutendes zu fragen. Er bezieht nämlich die generative (gesellschaftliche und historische) Entwicklung mit ein. Der Sinn ist eine approximierende Produktion, eine Schöpfung aus einer dialektischen Bewegung, die sich selbst negiert, indem sie in Bedeutung kon-sumiert. „Konsum“ ist demnach ein anderer Begriff für „Synthese“. Der Sinn ist weder der Kontiguität eines Mediums, noch einem ewigen Hin und Her unterworfen, da die physikalische Zeit ihn nicht tangiert: Er ist eine Verzeitlichung als Präsentifikation.248 Und da die Verzeitlichung eine qualitative Zeit ist, wird aus der Dialektik eine Ökonomie. Auf diese, und nicht auf die orthodox marxistisch analysierte Klassenprogression bezieht Sartre sich. Er stellt fest: Wir definieren die existentialistische Approximationsmethode als eine regressiv-progressive und analytisch-synthetische Methode; sie ist gleichzeitig ein bereicherndes Hin-und-Her zwischen dem Objekt (das die ganze Epoche als systematisch gegliederte Bedeutungsmanigfaltigkeit birgt) und der Epoche (die das Objekt in seiner Totalisierung enthält).249
Der Unterschied zu den Strukturalisten ist bei Sartre deutlich festzustellen: Er denkt aus der Präsenz der praktischen Existenz heraus und setzt die Geschichte des Subjekts als eines kontinuierlichen Mediums nicht voraus. Der Unterschied zwischen Sartre und denjenigen Hermeneutikern, die im hermeneutischen Zirkel der unendlichen Auslegung sich verfangen, besteht darin, dass Sartre die Totalisierung des Sinns vom Widerspruch in der Gesellschaft abhängig macht. Dieser Widerspruch kann manifest sein, indem er demjenigen Opfer abfordert, der die Dinge und Zeichen gegen ihre Verweisungsvorschrift gebraucht; der Widerspruch kann dabei auch subtil sein, indem er in die Totalisierungsbewegung des Sinns selbst verlagert wird. Dann ist der Sinn widersprüchlich oder mehrdeutig, kurz: er inszeniert sich als Widerspruch, um die Totalisierungsbewegung der Dialektik selbst anzuzeigen. Das kommt z.B. in der dritten Negation (der Ironie, dem Spiel, dem Simulakrum auf der Ebene des Zeichens der Zeichen) zum Ausdruck. Zuletzt kann der Widerspruch im Verhältnis zwischen der Tauschordnung des Zeichens und der Dinge zur Gabenordnung des Opfers bestehen.
248 Gumbrecht, Diesseits der Hermeneutik, a.a.O., S.115. Präsentifikation vergangener Welten wäre nachgerade eine negative Utopie, die von der unausgeschöpften Möglichkeit her denkt, nicht von einer ankommenden Zukunft. 249 Sartre, Marxismus und Existentialismus, a.a.O., S.118f. Es ist gleichgültig, ob man von der regressiven oder der progressiven Bewegung ausgeht, da es sich um eine endlose Oszillation, ein Hin und Her handelt.
13. VORLESUNG Gadamers philosophiehistorische Ableitungen – Hermeneutik ist Methodik, nicht Theorie – Das Symptom ist Produktion eines sich selbst aufhebenden Produkts, Dings, das kein Ding sein will – Kunst ist Unding, sich selbst aufhebendes Spiel – Der Künstler erschafft Möglichkeiten, nicht Dinge – Das Spiel der Kunst ist von ephemerer und transzendierter Dauer – Erst ein Möglichkeitshorizont macht Auslegung notwendig
Es war der im deutschsprachigen Raum wirkungsmächtigste und zugleich problematischste Hermeneutiker, Hans-Georg Gadamer, der just 1960, als Sartres Kritik der dialektischen Vernunft erscheint und Roland Barthes an seinen kritischen Essays arbeitet, in Wahrheit und Methode 250 ebenfalls von einer hermeneutischen „Hinund Herbewegung“ spricht. Der Vermittlungsfortschritt Sartres zwischen Individualität und Allgemeinheit wird von Gadamer gegen die „instrumentalistische Sprachentwertung der Neuzeit“251 gewendet und ist in seiner auf Ästhetik bezogenen Darstellung traditionell. Wahrheit und Methode will noch im herkömmlichen Sinne zwischen aufgeklärten Individuen insbesondere in der Kunstanschauung vermitteln. Sprache wird als Vernunftebene entworfen, „in der sich Ich und Welt zusammenschließen oder besser: in ihrer ursprünglichen Zusammengehörigkeit darstellen.“252 Mit Gadamer kommt ein Protagonist der hermeneutischen Tradition der Frage nach dem Ideal des Verstehens – der Kunst des Verstehens – zu Wort, der die Begriffe „Ich“ und „Welt“ nicht in die Befragung mit einbezieht, wie es beispielsweise Lacan aus psychoanalytischer und Sartre aus soziologischer und politischer Sicht getan haben. Gadamer nimmt Sartre im Übrigen ebenso wenig zur Kenntnis wie Saussure, Pierce oder die Tradition der Strukturalisten. Im späteren Nachwort zieht er sich auf einen an Platon und den christlichen Trinitätsgedanken angelehnten Begriff von Sprache und Verstehen zurück. Er interessiert sich nicht für die Möglichkeit einer Beziehung zur Welt, die sich seit der Antike technologisch verändert hat, die Sartre als Praxis aber akzeptiert und auf Differentialität, Produktion (Hin) und Widerstand (Her) aufbaut, ohne dass die seit jeher etablierte instrumentalistische Sprachgabe die soziale kompensiert hätte. So ist die Unterscheidung zwischen künstlicher und natürlicher Sprache auch eher auf die Konstitution eines Problemfeldes aus, das auf Rückbesinnung zielt. Gadamer sieht die künstliche Sprache als Praktik, die „nur noch als Anwendung der Wissenschaft“ fungiert. „Das aber ist eine ‚Praxis‘, die keiner Rechenschaftsgabe bedürftig ist. So hat der Begriff der Technik den der Praxis, anders gesagt: die Kompetenz des Experten hat die politische Vernunft an den Rand gedrängt.“253 Doch eine gerade deswegen politisch-ökonomische Analyse beispiels250 Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen 1960. Ich zitiere nach der vierten Auflage von 1975. 251 Ebd., S.381. 252 Ebd., S.449. 253 Ebd., S.518.
152 13. VORLESUNG
weise des Zeichens als einer Warenform (Baudrillard) oder des Verstehens als Besitz (so wie Sartre, Kristeva und auch Foucault sie anstrengen) fehlt völlig – ebenso die Ableitung des Telos einer Vernunftgemeinschaft. Gadamer interessiert sich letztlich nur für das Phantasma eines gemeinschaftlichen Selbst, in dem die Kunst des Verstehens als Herrschaft und Beherrschung der Sprache und ihrer Vernunft selbstlos aufgefasst wird, mit einem zuweilen abenteuerlichen Rückfall in die von Saussure ausgehebelte Äquivalenztheorie. „Wir müssen vielmehr die innere Durchwebtheit alles Verstehens durch Begriffliches erkennen und jede Theorie zurückweisen, die die innige Einheit von Wort und Sache nicht wahrhaben will.“254 So begeht Gadamer den Fehler, die strukturale Analyse „innerer Durchwebtheit“ mit Nebelkerzen einer Auffassung zu egalisieren, die der zunehmenden Differenzierung und den problematischen und geglückten Totalisierungen der „technischen Sprachen“, zu denen Schrift per se gehört, in ihrer reästhetisierten Erscheinung (Design) nicht gerecht zu werden vermag. Den eigentlich neuen technischen Aspekt – den der Echtzeitvermittlung und des Unterlaufens der Verzeitlichung der Sinne – indifferenziert er auf den Begriff der Instrumentalität. Hier aber, zwischen den sinnlichen Vollzügen und den schlicht die Sinne übersteigenden technischen Kompetenzen strategischer Prospektion, wäre das Verstehen als nicht aufzuhebende Differenz von Individualität zu klären und das Zeichen als „Abstraktion des Verweisens“255 und als dessen gesellschaftliche und politische Ideologisierung zu verorten. Es genügt nicht, Sprache im Sinne einer Verständigung von Partnern als gemeinschaftsstiftend anzuerkennen und es dann zu beklagen, wenn sie genau dies unter informationellen Gründen auch praktischerweise an den Operationen der Technik entlang tun. Foucaults kritischer Anspruch einer Diskursivität und der Befreiung von solchen Körpertechniken (und einem sokratischen Symposionsideal der herrschaftsfreien Kommunikation gleichbeseelter Subjekte) lassen die Ausführungen Gadamers, die in philosophiehistorischen Ableitungen außerordentlich klug und auch differenzierter sind als die der Strukturalisten, wie aus einem anderen Jahrhundert erscheinen – so übrigens auch Gadamers eigene Einschätzung seines philosophischen Ansatzes in seinem späteren Nachwort.256 Aber wir sind im Jahre 1960; die Kunst ist entgrenzt, Foucault schreibt gerade an Wahnsinn und Gesellschaft und die poststrukturalistischen Semiotiker bemühen sich, ein facettenreiches Bild von den Vorgängen einer „hermeneutischen Situation“ (so Gadamers Begriff ) pragmatisch zu entfalten, indem sie das Primat der sprachlichen Verweisung durch das der Tauschoperationen universalisieren, um die multimedialen Akte der Globalisierung der technischen Umwelt wenigstens gebrauchsfähig zu halten, da ihr Sinn in einer „geschichtslosen“ Präsenz 254
Ebd., S.381. Ebd., S.390. 256 Ebd., S.513: „Als ich Ende 1959 das vorliegende Buch beendete, war ich mir darüber sehr unsicher, ob es nicht ‚zu spät‘ käme, d.h. ob die Bilanz traditionsgeschichtlichen Denkens, die in ihm gezogen wurde, nicht schon beinahe überflüssig sei. Zeichen einer neuen Welle technologischer Geschichtsfeindlichkeit mehrten sich. Ihr entsprach die steigende Rezeption der angelsächsischen Wissenschaftstheorie und der analytischen Philosophie und schließlich verhieß auch der neue Aufschwung, den die Sozialwissenschaften, darunter vor allem die Sozialpsychologie und die Soziolinguistik, nahmen, der humanistischen Tradition der romantischen Geisteswissenschaften keine Zukunft.“ 255
13. VORLESUNG 153
schon als „total vermittelt“257 gilt, und also zwischen dem Warenwert – der Inszenierung – und dem Gebrauchswert – der (hermeneutischen) Situation – nicht mehr unterschieden werden kann. Im Übrigen gilt für den Poststrukturalismus auch eine eindeutige Reserve gegenüber den politisch-soziologischen Untersuchungen Sartres, seinem Primat der Individualität und dem prekären Freiheitsbegriff von Das Sein und das Nichts, zu dem er selbst deutlich auf Distanz geht. Der Übervater Sartre, man die Absicht hat, sich zu emanzipieren, passt nicht mehr in das politische Klima dieser orthodox linksdominierten 1960er Jahre. Das lässt wiederum Schlüsse auf die ideologische Sättigung des semiotischen Engagements zu, das vor allem durch Kristeva aufgeklärt wurde. Der Streit zwischen hermeneutischer und strukturalistischer Bedeutungsproduktion, der wegen Ignoranz aller drei Parteien eigentlich nicht stattgefunden hat, gilt inzwischen als beigelegt und überholt. Die Verluste sind auf allen Seiten durch medien- und sozialwissenschaftliche sowie durch pragmatische Theoriemodelle aufgesogen worden, die sich ohnehin mehr als Konjunkturbarometer, denn als Wahrheitsfestungen verstehen. Diskursaktivitäten finden sich vor allem dort, wo das Verstehen entweder im Einverständnis versiegt oder weitere Zeichenproduktion itteriert und Bücher über Bücher produziert werden: „Diese Verschiebung ist die Möglichkeitsbedingung von Interpretation“258, so Jochen Hörisch über eine inzwischen deutlich erkaltete Wut des Verstehens. Wie sieht es mit den tatsächlichen Synthesen, den Produkten aus? Sie fallen aus dem Status ihrer Bedeutungsinszenierung in die Praxis des Gebrauchs: Sie werden allgegenwärtiges, konsumatorisches Wissen. Im Sprachdurchgang, das diagnostiziert Gadamer richtig, wird Konsumation und Produktion synchronisiert. Nur spricht Gadamer nicht von „Produktion“, sondern, im Kontext von Kunst und Theologie, von „Schöpfung“259, nennt das als reproduzierbar inszenierte Kunstwerk („Jede Aufführung ist Auslegung“260) dann „schöpferisch“, wenn es Sinn generiert. Die Wut des Verstehens generiert daraus wieder weitere Differenzen: Interpretation ist Produktion von Sinn. Dieser Sinn, auch der philosophischen Ableitungen, ist der objektive einer Warenökonomie, die sowohl das Kunstwerk als auch die Aufführung adelt, da diese sich als Szenifikationen von Praxis abheben und ihre Verdinglichung zurücknehmen können. Solche Möglichkeitspositionen muss man aber nicht „erhaben“ nennen, man kann sie auch als Simulationen bezeichnen. Eine Sonderstellung der „Kunst“ und der „Kunst der Auslegung“ – noch dazu jenseits der Ökonomie des Sinns – ist selbst im heutigen Verständnis von Kunst als Intervention antiquiert. Die Analysen von Barthes zu den Alltagsmythen und die Ecos bezüglich Architektur und Film beweisen die Umbruchszeit von philosophischem Denken in kultur- und medienwissenschaftliche Etikettierung, wo vordem noch autonomer Geist Folianten „durchwebte“. Wo „das Wort“ als „reines Geschehen“261 betrachtet wird, also als „menschlicher Geist“ (oder „Gespenst“, wie Kittler sagen würde), unterstellt 257
Ebd., S.535. Hörisch, Wut des Verstehens, a.a.O., S.26. 259 Gadamer, Wahrheit und Methode, a.a.O., S.411. 260 Ebd., S.378. 261 Ebd., S.396. 258
154 13. VORLESUNG
Gadamer es einem griechischen Gedanken des Logos, der eben nicht schöpferisch ist, da dieser der Einheit der Sprache nur in einer undialektischen Äquivalenz, der der Weisheit (adäquatio), gerecht wird. Dass sich philosophische Promotionen heute vermehrt an Filmthemen abarbeiten, zeigt, wie der Einfluss der semiotischen Instrumente der Differenzierung mit der hermeneutischen Identitätssuche produktiv oszilliert.262 Es ist kein Fauxpas, dass Gadamer immer noch an Schleiermacher und vor allem an Humboldt als „dem Schöpfer der modernen Sprachphilosophie“263 festhält, um die Gebrechen der instrumentellen Vernunft und indirekt den historischen Mangel der Strukturalisten kritisieren zu können. Im historischen Rückgang sind die Gadamer’schen Analysen am fruchtbarsten und unterscheiden sich wesentlich von denen, die Foucault in seiner Diskursanalyse am Topos der Ähnlichkeit probiert. Dagegen fällt mit der Aufgabe der Initiativen Sartres auch die Problematik des Selbstbewusstseins fort – jener fiktionalisierten Identität als imaginäres Produkt, das mit den Produkten der „Welt da draußen“ – wie es bei Sartre vielfach heißt – homolog ist. Diese systematische Umbesetzung der formalen Widersprüche der Semiotik macht den Unterschied zwischen einer Theorie des Zeichens als Grundlage formaler Wissenschaft und einer philosophisch ableitenden Geschichtsschreibung prägnant. So wählt Sartre für seine Hermeneutik den Begriff Methodik, und nicht den der Theorie. Analog dazu präferiert auch Freud für die Psychoanalyse den Begriff „Methode“. Die Methode legitimiert sich von der Praxis her, die Theorie von der Logik. Dass Sartre auch eine schlüssige Zeittheorie seiner Methode liefert, hebt sein Konzept heraus. Denn gerade die Zeitbegriffe sind es, die der aktuellen, und nicht mehr nur einer historischen, etymologischen, ethnologischen und anthropologischen Entwicklung, also den szenischen Dauern, neue Beachtung entgegengebracht haben. Szenografie könnte in diesem Sinne auch eine Methode genannt werden, welche die Kurzfristigkeit der konventionalisierten Dauern artifiziell stabilisiert oder, wenn man es drastischer sagen will, technisch formiert – sofern man denn die Technik der Inszenierungen als Sprache versteht, mit der Ereigniszeit ökonomisch umzugehen. Kommen wir jetzt zum Gewinn der Kritik der Gadamer’schen Hermeneutik. Wie Gadamer das Verhältnis des Subjekts zur Welt denkt, wird ersichtlich, wenn man sich die Ausgangslage ansieht, die im existenziellen Sinne das Verstehen betrifft. Sie wird durch Heideggers in Sein und Zeit delektierten Zeitbegriff Kants deutlich. Zeit wird nicht mehr im physikalischen Sinne oder im Sinne des Fortschritts aber auch nicht in dem der Überwindung der Klassengegensätze behandelt, sondern als Verstehen selbst – mithin als Identitäts- und Differenzverhältnis, nicht im dialektischen, sondern im ökonomischen Sinne. 262 Spätestens seit Manfred Franks in Was ist Neostrukturalismus? geäußerten kritischen Einwürfen an die Ignoranz der Parteien scheint die Frontenbildung doch allzu künstlich. Ebenso äußert sich Dosse in seiner Geschichte des Strukturalismus. Es geht nicht mehr um Abspaltung der instrumentellen Bezüge, sondern darum, die Hintergehbarkeit der Sinne in der Semiose als immer schon vollzogen in einer Ökonomie dialektischer und analytischer Vernunft zu akzeptieren. 263 Gadamer, Wahrheit und Methode, a.a.O., S.415.
13. VORLESUNG 155
Statt den methodischen Sinn der existenzialen Analytik des Daseins festzuhalten, behandelt man diese existenziale, geschichtliche Zeitlichkeit des durch Sorge, Vorlaufen zum Tode, d.h. radikale Endlichkeit bestimmten Daseins als eine unter anderen Möglichkeiten des Existenzverständnisses und vergißt darüber, daß es die Seinsweise des Verstehens selbst ist, die hier als Zeitlichkeit enthüllt wird.264
Um es einfacher zu sagen – und nicht wiederum die Heidegger’sche Intention zu zitieren – Gadamer betrachtet Verstehen als einen kontinuierlichen, niemals abschließbaren Vorgang, analog der Rezeption eines Kunstwerks. Die nie zustande kommende Ichidentität, die Zeit und das Verstehen sind drei Manifestationen ein und desselben Vorgangs. Was darin unterschlagen wird, ist der Faktor der Produktion: Denn Identitätssuche (Wunsch des Verstehens) setzt Differenz voraus. Diese muss aber schon verstanden sein, und das ist sie auch – aber nicht im Selbst, sondern in den Dingen, Gestellen (Heidegger), Sachen und Institutionen, d.h. in den gesellschaftlichen Produkten. Deren Sein als relative Dauer, als Eigentumsform, steht außer Frage, insbesondere dann, wenn es sich um ein angeblich schnelllebiges Geschäft der Medien handelt. Statt sich auf diese Dingidentität zu stützen – auch instrumentell und sprachlich –, also auf die Qualität der Zeichen, wählt Gadamer für die Medialisierung des Verstehens einen dritten Akt der Negation für den Sartre – wie wir zeigen konnten – eigentlich das Spiel als ironische Form der Situativität der Freiheit reserviert hatte. Nicht in der Praxis, sondern in deren Aufhebung als Fest, Kunstwerk, Theater insbesondere im Zuschauen gewährt Gadamer die Evidenz einer Identität respektive szenischen Reflexion des Selbst mit sich selbst. Das wird an der Hinzuziehung des griechischen theoria-Begriffs festgemacht: Theoria ist aber nicht primär als ein Verhalten der Subjektivität zu denken, als eine Selbstbestimmung des Subjekts, sondern von dem her, was es anschaut. Theoria ist wirkliche Teilnahme, kein Tun, sondern ein Erleiden (Pathos), nämlich das hingerissene Eingenommensein vom Anblick.265
Das, was den Anblick über den Augenblick erhebt, macht den Kunstcharakter aus, nämlich „einen Anspruch auf Dauer und die Dauer eines Anspruches.“266 Das selbst diese Dauer unter dem Modellbegriff der Theorie im historischen Sinne begrenzt ist, kann jedoch an der Art der Kunstanschauung selbst problematisiert werden, so wie das Benjamin im Kunstwerk-Aufsatz markiert hat. Es ist nicht nur die Kunst, die diesen Anspruch erhebt und die das Moment der Identität als „Verstehen“ im Sinne einer Einfühlung erlaubt, sondern jede Szenifikation, d.h. die produktive Bewegung der Verdinglichung in ihrer Negation: dass das Produkt im Verstehen des Zeichenhaften steckenbleibt (sich als Schein noch nicht verdinglicht) und deshalb in 264
Ebd., S.116.
265 Ebd., S.118. Vergleiche dazu Friedrich A. Kittler: Pathos und Ethos. Eine aristotelische Betrachtung.
In: Ders.: Die Wahrheit der technischen Welt. Essays zur Genealogie der Gegenwart. Frankfurt am Main 2013. S.391-395, hier S.395. Kittler zielt auf die Luhmann’sche Unterscheidung von Erleben und Handeln. 266 Ebd., S.120.
156 13. VORLESUNG
der Bedeutung kontingentiert werden muss. Die Bedeutungskonstitution erscheint hier als ökonomischer Zwang (oder „Wut“). Das Problem ist die wechselseitige Identifizierung von Kunst und Selbstsein im Modus der Reflexion sinnlicher Vollzüge. Solche wechselseitige Stabilisierung des Scheins bleibt positiv dem Symptom vorbehalten. Im Symptom invertiert die „Hin- und Herdirection“ (Schleiermacher) des Verstehens als Identität in einem paralytischen Wiederholungszwang, im Versuch, die Geschichtlichkeit, also die notwendigen Kontingenzen aufzuheben, was auf der gesellschaftlichen Ebene den Konventionen, Festen und Ritualen sowie der Kunst entspricht.267 Das Symptom ist die Produktion eines sich selbst aufhebenden Produkts; ein Ding, das kein Ding sein will; ein Unding. Als gesellschaftliche Erscheinung ist es die Kunst, die das Sein der Dinge und die Funktion der allgemeinen Bedeutung transzendiert. So wird semiotisch das Symptom auch als ein autologes Zeichen der Selbstverweisung verstanden268, das zu keiner produktiven Überschreitung kommt, ein Produkt, das am Körper haften bleibt; der andere Ort der Sprache. Nun ist gerade der Anspruch auf Ewigkeit im Gegensatz zur Dauer der Dinge gesetzt – so die signifikante Eigenschaft des Symptoms der Kunstproduktion. Kunstproduktion unterbricht das Verhältnis von Produktion und Konsumation, verstrickt sich aber in der Rücksicht auf Darstellung umso mehr in das Marktgeschehen. Die Kunst ist letztlich der Verweis auf ein Objekt/Werk gesellschaftlicher Produktion, das seinen Wert darin hat, szenisch transzendiert zu sein. Für Gadamer bleibt die Kunst, und eben auch die adäquat kunstmäßige Auslegung, allein im Horizont der Möglichkeit der Interpretation. Nicht nur von Kunst, sondern von der alltäglichen Praxis des Verstehens sei auszugehen, so Sartre. Barthes hatte ja eindrucksvoll darauf aufmerksam gemacht, dass die Kunst einem Mythos angehört. Die Pop-Art der 1960er Jahre hat ja gerade auf diese Phänomenalität der Marktkunst ironisch geantwortet, und die ephemere Produktion von performativer Kunst, von Interventionen und Szenografien auf Zeit, hat eine ganze Kulturbranche hervorgebracht. Die Praxis dauert nicht, so Gadamer.269 Es ist gerade das „Unbewusste“ der Evidenz der Praxis, die normativ und konventionalisiert dauert und die Fiktion der Identität eines Selbst erfindet, und nicht die Kunst, die bei Gadamer aus der Tradition des Spiels270 abgeleitet wird – aus jenem Topos, an dem vorgeblich die Produktion auf sich selbst zurückgebogen wird: „Die Bewegung, die Spiel ist, hat kein Ziel, in dem sie endet, sondern erneuert sich in beständiger Wiederholung. 267 Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, a.a.O., S.93: „Die Kunst kann ihre Regeln nur aus einer positiven Formel entwickeln und diese ist das ‚geschichtliche und divinatorische (profetische) objektive und subjektive Nachkonstruieren der gegebenen Rede.‘“ Schleiermacher unterteilt in historische, grammatische und psychologische Auslegung, wobei letztere das Motiv des Schreibenden betrifft. 268 Zur wechselvollen Definition des Begriffs „Symptom“ siehe Nöth, Handbuch der Semiotik, a.a.O., S.189f. So wird das Symptom als ein Klasse von Indices verstanden, das subjektiv, zwanghaft und partikular gegenüber dem Gesamtbild des Zeichens Krankheit ist, das der Arzt entwirft. Siehe auch Roland Barthes: Semiologie und Medizin. In: Das semiologische Abenteuer, a.a.O., S.210-222, hier S.213. Barthes führt aus, dass ein wesentlicher Aspekt des Symptoms das Vermögen ist, die Zukunft (einer Krankheit) anzuzeigen. 269 Hier wird noch im Benjamin’schen Sinne die Tiefe der Betrachtung, nicht ihre Differentialität und Kombinatorik in den maschinellen Elementen des Apparats beobachtet. 270 Gadamer, Wahrheit und Methode, a.a.O., S.97ff.
13. VORLESUNG 157
Die Bewegung des Hin und Her ist für die Wesensbestimmung des Spiels offenbar so zentral, daß es gleichgültig ist, wer oder was diese Bewegung ausführt. Die Spielbewegung ist gleichsam ohne Substrat. Es ist das Spiel, das gespielt wird oder sich abspielt – es ist kein Subjekt dabei festgehalten, das da spielt.“271 Handelt es sich hier wirklich um ein Spiel mit Zeichen oder vielmehr um eine Simulation der inneren traumatischen, primären Produktion? Wenn nun das Spiel ein existenzielles ist, warum sollte man es für die mechanisierte und reproduzierende Arbeit ausnehmen? Und an welcher Stelle, so kann man die Strukturalisten fragen hören, sollte dann der Einsatz eines (positiven) Subjekts wieder gerechtfertigt sein? Unsere Prämisse der Zweiseitenform hat doch angenommen, dass es diese Trennung der Sphären (wenn natürlich auch nicht der Praktiken) nicht gibt. Spiel, Fest, Kunst sind Inszenierungsweisen von Dauern. Dadurch unterscheiden sie sich nicht von den Tätigkeiten des Alltags. Auch hier spielt Gadamer mit einem Indifferenzierungsprogramm, indem er dem Kunstwerk (wie dem Wort) die Gleichzeitigkeit von Dauer und Progredienz unterstellt. Simultaneität im Spiel meint, ausgehend von Kierkegaard, „Vermittlung als eine totale“.272 „Kunstmäßige Beherrschung “273 des Verstehens übt so in den Schein der Identität ein, die nicht mehr produktiv sein will, sondern, so die Psychoanalyse, homosexuell versiegt. Wir sehen, wo das Problem liegt: Der Künstler ist kreativ, Kreative aber sind Produzenten, in der Form der Veranlassung von Verweisung, Intendanz – sie erschaffen Möglichkeiten, nicht Dinge. Exklusivität von Kunstproduktion und Ubiquität des Spiels, das passt nicht zusammen. Mit „Kunst“ kann jetzt nur jener Bereich gemeint sein, den wir als szenische Verzeitlichung gekennzeichnet haben. Damit kommt aber eine Kritik der Zeit ins Spiel, die zugleich die Zeit der Subjektivität wie jene des Zeichens umgreift. Die theoria muss nicht nur eine Beobachtung, sie muss zugleich eine Unterscheidung sein. Dass die Identitätsvollzüge nicht opferlos, sondern methodisch an Opferminimierung (Ökonomie) orientiert sind, kann aus der Produktion selbst abgeleitet werden, die immer eine Art von Ordnung, also differentielle Systemstabilisierung ist. Vergessen wir nicht, dass es nicht um Inszenierung als Kunstform, sondern um die Inszenierung der Situativität als eines Produkts geht, das für eine gewisse Dauer seine eigene Konventionen zur Vorstellung im Anderen intendiert – und zwar nicht vorweg als Theorie, sondern als institutionelle Gestalt: als Werbung, Instrument, Gerät, Theater, Fernsehen, Buch, etc. Die Identität besteht hier in der Elementarität des Dings selbst, vom Bit bis zur Industriemaschine, d.h in deren Totalisierung von Differenz, die durch das Design praktifiziert wird, also durch die Verdeckung des opferreichen Produktionskörpers zu Gunsten weniger sinnlich erfahrbarer und decodierbarer Zeichen (Piktogramme, Ikons, Schriftzeichen etc.). Dieser Elementcharakter der Dinge ist als Ware zählbar und zahlbar ausgewiesen, auch als Ware Kunst. Im Grunde kann man sagen, die Dinge haben sich schon vor dem Gebrauch verkonsumiert, sind schon ihre Synthese mit den Körpern als 271
Ebd., S.99. Ebd., S.121. 273 Ebd., S.361. 272
158 13. VORLESUNG
Zeichen eingegangen. Designgegenstände vermitteln nicht nur Funktionen, sie schaffen gesellschaftlich relevante, nämlich tausch- und vergleichbare Sinnopponenten. Sartre unterschlägt diesen Sachverhalt nicht. Baudrillard macht ihn geradezu zum Kernbestand seiner Analysen. Wenn Gadamer das im Hinblick auf einen bourgeoisen Kunstbegriff machen zu müssen glaubt, so kann er das nur unter Ausschluss der Diskurspositionen, die einem Produkt als Kunstwerk einen gewissen Zeichenwert zuweisen, der immer mit der Dauer der Beziehung der semiotischen Relate zusammenhängt. Wenn nämlich Spiel und Kunst ihre intrinsische Produktion als Hin und Her, als „Eigenproduktion“ oder „Selbsthervorbringung“ (in der ganzen Ambivalenz dieses Wortes) behaupten, fallen die Relate auseinander, sobald die Inszenierung, d.h. die Szenifikation sie nicht mehr zu faszinieren erlaubt. Von der Kunst zur Mode, von der Mode zum Ramsch, vom Ramsch zur Antiquität – es scheint ein Wesenszug des Spiels der Kunst zu sein, ihre Dauer eben nicht in der Verdinglichung, sondern in der ökonomischen Wertkonvention zu haben – mit allen Folgen für die Denkmalgeschichte und die Restaurierungsbemühungen um angeblich ewige Werke. Hier zeigt sich umfänglich die polare Differenz zwischen einer aus singulären Produkten konstituierten „einmaligen“ Kunstform und einer massenweise reproduzierten Designform und ihrer Wertgesetze.274 Die einmalige Präsenz, das Ereignis steigt zum höchsten Wert auf. In dieser Hinsicht ist die theoretische Ableitung von Kunst und Spiel zwar auf den Begriff der Beobachtung, genauer: den der Selbstbeobachtung zu reduzieren. Doch muss man daraus eben die logischen Konsquenzen ziehen und das Paradoxon sowohl der Reflexionstheorie als auch der Bewusstseinstheorie wenn schon nicht lösen, dann doch wenigstens in ihrer Unlösbarkeit operativ entfalten. Es wäre aber im Rahmen dieser Darstellung völlig verfehlt, diesen Entwicklungsschritt einer Universalisierung der Semiotik Gadamers konsistenten philosophischen Untersuchungen anzulasten. Bei ihm zeigen sich jedoch die Probleme in einiger Konsequenz. Wichtiger ist es, Gadamers Beziehung auf die Substratlosigkeit und den Zeichen- d.h. Sprachcharakter – nicht im Allgemeinen, sondern eben wiederum in Beziehung auf die Kunst (in aller bürgerlichen Tradition) – aufzunehmen. In der Tat gibt es in Wahrheit und Methode einen umfassenden Teil unter dem Titel „Ontologische Wendung der Hermeneutik am Leitfaden der Sprache“, der sich unter anderem der „Sprache als Medium der hermeneutischen Erfahrung“ widmet. Uns interessiert Gadamers Zeichenbegriff als eine mögliche Alternative zu Sartres Auffassung von Situativität, die Sartre konzeptionell auf der Ebene einer durchaus konventionellen Praxis szenifiziert hat, als Theater der Situation.275 Erinnern wir uns: Sartre wie Gadamer gehen von Heideggers Präsenzbegriff aus, der den des Bewusstseins ersetzen sollte. „Dasein“, „Existenz“ und „Präsenz“ können für unseren Zusammenhang synonym als Grenzmembrane des Tauschs verwenden. Sie bezeichnen die Fiktion einer Grenze der Vermittlung von Signifikant und Signifikat ebenso wie eine 274 Aus Gründen der Akzeptanz neuer (serieller) Produktionstechniken entsteht zu Beginn der 1960er Jahre die Pop-Art als Kunstbewegung, die die Konvertierbarkeit von Massenformen und Kunstformen unter dem Signum des Zeichens ausstellt. 275 Ich bin darauf ansatzweise eingegangen in Bohn, Szenische Hermeneutik, a.a.O., S.291ff.
13. VORLESUNG 159
gedachte Evidenz, der Indifferenz der Zeichenrelate, die die strukturale Semiotik für unmöglich erklärt hat. Wenn es keine Identität gibt, gibt es auch nicht „das Zeichen“. Weder gibt es Vermittler noch Vermittlung; es gibt nur Verweisung, also die ununterbrochene Unruhe/Arbeit der Existenz. Dennoch gibt es den Schein von „Identität“ auf Seiten des „Individuums“ als des „ungeteilten Einen“, auf Grund einer homologen Beziehung des Menschen mit den Dingen276 als Objektivationen und Realien (Waren, Geräte, Medien, Instrumente etc.) menschlicher Produktion. Was steht nun zur Kritik an: dass es Präsenz (Bewusstsein) nicht mehr gibt oder dass es nur noch Präsenz gibt – dass alle unsere Handlungen mehr oder weniger bewusstlos und evident der Logik möglichst störungsfreier und interpretationsresistenter (also militanter) Maschinengewalt unterworfen sind? Und trotzdem gibt es Skandale, Empörungen und Krisen – und wenn es sie nicht mehr gibt, müssen sie künstlich inszeniert werden. Ein gutes Zeichen! Ich schließe mich nicht der Meinung Baudrillards an, dass die Welt im Zeichen paranoisch die Simulation ihrer selbst ist. Von welchem Standpunkt aus wollte man das behaupten? Vom theoretischen? Doch Tendenzen und Verschiebungen sind auszumachen, unter anderem im Symptom der Semiologie selbst. Eine Welt, die aus Gleichzeitigkeiten besteht, muss gleichzeitig alle historischen Möglichkeiten beinhalten, allerdings nicht notwendigerweise „gleichwertig“ nach demokratischen Gesichtspunkten. Schon bei Gadamer verliert das Zeichen seine Neutralität und Unschuld. Gadamer annonciert das Zeichen als ein Negat und verweist auf seine ökonomisch relevante Substanz: die Inadäquatheit. Am Zeichen interessiert allein die Reduktion auf situative Invarianz der Verweisung. Im Wesen des Zeichens liegt, daß es in seiner Verwendungsfunktion sein Sein hat, und das so, daß seine Eignung allein darin liegt, verweisend zu sein. Es muß sich daher in dieser seiner Funktion von der Umgebung, in der es angetroffen und als Zeichen genommen werden soll, abheben, um eben damit sein eigenes Dingsein aufzuheben und in seiner Bedeutung aufzugehen (zu verschwinden): Es ist die Abstraktion des Verweisens selbst.277
Das Zeichen erschöpft sich im Extremfall in einer „Zuordnungsfunktion“. Gadamer ist an einer Darstellung der Ordnung der Zeichen untereinander jedoch nicht interessiert und stellt auch nicht die Frage nach der Substitution oder, sagen wir es mit Hegel, der „Knechtschaft“ der Umwelt, des Kontextes, der Situation. Mehr gibt es zum Zeichen in Wahrheit und Methode nicht zu erfahren; es substituiert sich quasi im hermeneutischen Kontext eines Sinnes, der als kleinste Einheit den Text und den Autor, das Werk referiert. Eine andere Metapher Gadamers ist in diesem Zusammenhang aufschlussreich: Er spricht vom „Horizont“278 der „hermeneutischen Situation“, d.h. von dem, was wir mit Benjamins „Nähe und Ferne“, 276
Jean-Paul Sartre: Der Mensch und die Dinge. In: Ders.: Der Mensch und die Dinge. Aufsätze zur Literatur 1938-1946. Schriften zur Literatur Bd.1. Reinbek 1968, S.107-141, hier S.107. Die Verhältnisbestimmung läuft über das Wort, mit dem Francis Ponge die Dinge benennt. Sartre nennt das synthetisierende Resultat der Benennung eine Sache. Diese wichtige Unterscheidung wird durch den Umstand erschwert, dass im Französischen beide Begriff mit „chose“ benannt werden. 277 Gadamer, Wahrheit und Methode, a.a.O., S.390. 278 Ebd., S.356.
160 13. VORLESUNG
Verwandtschaft und Fremdheit in Verbindung brachten. Da sich die Signifikanten in der Struktur der Zeichen wechselseitig befruchten und Sinn produzieren, entspricht die Metapher des „Horizonts“ dem unentdeckten Land: Land der Struktur oder, wenn man Blumenbergs Bild von der Seefahrt aufnehmen will, dem Unternehmen der Interpretation dem Schiff das als Insel inmitten des Ozeans der Möglichkeiten segelt.279 Als ein solches Schiff behauptet sich topologisch der Begriff des Subjekts: „Wir hatten in der Analyse des hermeneutischen Prozesses die Gewinnung des Auslegungshorizontes als eine Horizontverschmelzung erkannt.“ Dieser „Vollzug ist nichts als die Konkretion des Sinnes selbst.“280 Wenn man in dieser Überlegung den Sinn nicht als Synthese von Bedeutung, sondern als die Rückführung in den Bereich der Sinnlichkeit versteht, dann weiß man, was mit „Inszenierung“ bzw. „Szenifikation des Warenkörpers“ und was als Funktion des „Werks“ gemeint ist. Das Kunstwerk macht übergreifend sichtbar, was durch die informationellen Techniken unsichtbar geworden ist: den Möglichkeitshorizont, der Auslegung notwendig macht. Es ist ars im doppelten Sinn: Technik und Werk. Ich bin mit Jochen Hörisch der Meinung, dass eine Rückübersetzung des Sinns in die bedeutsamen Codes nur durch diese Sprachen selbst, d.h. ihre sinnliche Medialisierung geleistet werden kann.281 Man kann die Sinnenverschiebung als Täuschung, Verführung, Blendung etc. beklagen. Die Notwendigkeit der Indifferenzierungslehre und der „Verunbewusstungen“ oder „Inkorporierungen“ ist für moderne Gesellschaften nicht zu bestreiten, ebenso wenig deren professionelle Instrumentalisierungsanleitung. Von Reklame, Design und Kunst kann als szenischer Renormierung, d.h. einer zweiten, „synthetischen“ Synthese – jene der Sinne – gesprochen werden. Es ist der wechselseitige Agon, der Widerstreit zwischen differentieller Produktion und konsumativen Synthesen, der das Produkt „Arbeit“ für den Menschen sinnvoller erscheinen lässt als das Spiel. Heideggers Annahme, Philosophie würde in Kybernetik aufgehen282, stimmt so nicht. Es wird mehr Wert auf Reklame gelegt als auf deren Analyse – und die Analyse durch die Wirtschaftswissenschaften geschieht nicht zum Spiel, sondern zur Optimierung der Konsumprämie – oft genug, so beklagt Gadamer, in bloßen „Handlungszusammenhängen.“283 Dass nur die Kunst sich davon ausnehmen kann, macht dann wirklich einen Tatbestand des „Verblendungszusammenhang der Kulturindustrie“ aus. Denn seit Adornos Einsprüchen ist sie längst aus dem Werk in die ephemere Präsenzproduktion gewandert. Sie ist weniger ein ästhetisches, als ein soziales Phänomen geworden. Nicht mehr Ästhetiken bestimmen die Debatte um die Zeichensetzung und Verweisungspotenz, sondern die Soziologien. 279 Hans Blumenberg: Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher. Frankfurt am Main 1979. Die Metapher ist die einer ökologischen, opferlosen Produktion: Aus den Resten des untergehenden Schiffes auf hoher See wird ein neues gebaut. 280 Gadamer, Wahrheit und Methode, a.a.O., S.375. 281 Jochen Hörisch: Der Sinn und die Sinne. Eine Geschichte der Medien. Frankfurt am Main 2001, S.14: „Die leitende These der vorliegenden Mediengeschichte lautet: Die im Bann von Stimme und Schrift stehende frühe Mediengeschichte ist sinnzentriert, die neuere Medientechnik fokussiert hingegen unsere Aufmerksamkeit immer stärker auf die Sinne.“ 282 So das vielfach zitierte SPIEGEL-Interview mit Rudolf Augstein, geführt im September 1966, veröffentlicht nach Heideggers Tod am 31. Mai 1976. 283 Gadamer, Wahrheit und Methode, a.a.O., S.540.
14. VORLESUNG Sartre versteht unter „Existenz“ einen Prozess der progressiv-regressiven und der analytisch-synthetischen Perioden – Verstehen ist Arbeit – Sartre überschreitet die Dialektik ökonomisch, indem er den Austausch, nicht den Besitz zur gesellschaftlich weiterführenden Form erhebt – Sartres Mittelstellung zwischen einer klassischen Hermeneutik und einer strukturalen Informationstheorie – Die Verzeitlichung erlaubt, die Synthese der Widersprüche als Widerspruch zu erkennen – Die Antinomien zeigen sich in der szenischen Form der Geschichte – Das Erlebnis dominiert Besitz – Die Bedeutung des Menschen für den Menschen ist dialektisch als Widerspruch gegeben
Wir kehren von Gadamer zu Sartre zurück und beginnen mit dem ökonomisch ausgelegten „Hin und Her“ der Sinnbestimmung. Als „existenzielle Bewegung“ versteht Sartre ein „dauerndes Ungleichgewicht“, eine Auffassung, die die von der trägen Ruhe ausgehende „mechanistische Philosophie“ mit dem Vorwurf der „Irrationalität“284 verurteilt. Sartre versteht unter Existenz einen Prozess der progressiv-regressiven und der analytisch-synthetischen Perioden, die niemals „verschmelzen“ können, solange es Verzeitlichung als Bewusstsein (und Bedeutung) gibt. Sein Diskurs begegnet diesem Begehren nach Ruhe und Aufhebung des Agon mit großer Skepsis. „Verstehen“ ist zunächst nichts anderes als Arbeit, die nichts Irrationales an sich hat, auch wenn ihre Produkte sich nur in Szenen verdinglichen. Der Gegenentwurf zum klassischen Modell der hermeneutischen Bedeutungszuordnung, des in sich ruhenden Wissens, und zu einer naturwissenschaftlichen Anbiederung (oder informationsdominierten, instrumentalistischen Gefahr) ist evident. Sartre überschreitet die Dialektik ökonomisch, indem er den Austausch, nicht den Besitz zur gesellschaftlich weiterführenden Form erhebt und das erklärende Wissen gegen das bedeutende Verstehen setzt. Der politische Hintergrund ist unübersehbar. Der Vorwurf der Irrationalität wendet sich gegen die, die ihn instrumentalisieren. Dieser Vorwurf kann wirklich nur von einer mechanistischen Philosophie ausgehen: diejenigen, die ihn gegen uns erheben, wollen die Praxis, das Erzeugen, die Erfindung auf die Reproduktion der Elementargegebenheiten unseres Lebens zurückführen, sie wollen das Werk, die Handlung, den Akt oder die Haltung durch die sie bedingenden Faktoren erklären; ihr Erklärungsdrang zeigt unverhohlen den Willen, das Komplexe dem Einfachen anzugleichen, die Spezifität der Strukturen zu leugnen und die Veränderung auf Identität zurückzuführen. Das aber wäre ein Rückfall in den wissenschaftlichen Determinismus. Die dialektische Methode dagegen lehnt es ab zurückzuführen; sie verfährt umgekehrt: sie überschreitet und bewahrt zugleich; aber die Glieder des aufgehobenen Widerspruchs können weder die Aufhebung selbst noch die nachträgliche Synthese rechtfertigen: ganz im Gegenteil, sie selbst erhellt sie und ermöglicht es allererst, sie zu verstehen.285
Wir lesen in aller Deutlichkeit, dass Sartres Kritik in weiten Bereichen die Frontstellung der Dilthey’schen Polarität von erklärender und verstehender Wissen284 285
Sartre, Marxismus und Existentialismus, a.a.O., S.120. Ebd., S.120f.
162 14. VORLESUNG
schaft übernimmt; er wendet sie aber dialektisch und im Einzelfall ökonomisch. Das macht auch den Unterschied zu Gadamer aus, der hier nur eine Konfrontation sieht: Front gemacht werden soll ihm zufolge gegen den wissenschaftlichen Formalismus einer auf Elementartheorien aufbauenden erklärenden Praxis, womit auch der Strukturalismus gemeint sein kann. Dieser geht zumindest von der Synthese einer Elementarität des Signifikanten aus. Praxis ist im zeitlichen Sinne zunächst situativ und individuell, nicht aber elementar. Erst die technische Reproduktion normiert den Zustand der Dinge auf Zeichen hin. Es ist aber auffällig, dass die Semiotiken sich auf die Alltagsmythen, die Reklame sowie auf die Konsumwelt beziehen, nicht aber, wie noch bei Gadamer, auf die vorgeblich ewigen Werte „bürgerlicher“ Kunst. Sartres Mittelstellung zwischen einer klassischen Hermeneutik und einer strukturalen Informationstheorie versteht sich, wie schon betont, als Entwurf einer Theorie der Praxis. Sie konstituiert eine Methode, die sich im umfänglichen Teil ihrer Analyse auf Literatur und Geschichte (die der Französischen Revolution)286 bezieht. Die philosophische Arbeit ist ein reversibles Verstehen und Befragen der eigenen Entwurfsposition. Da die Philosophie sich innerhalb dieses Prozesses, der sie ist, „hin- und herbewegt“, muss sie, um ihn zu verstehen, einen Widerspruch inszenieren. Da es aber ein notwendiger Prozess ist, der sich nicht beruhigen kann und darf, rechtfertigen sich nur solche Widersprüche, die Antinomien und Paradoxien enthalten – deren Synthesen einen Aufschub, aber keine Aufhebung zulassen; also grundsätzlich nicht in Identität aufgehoben werden können. Die Zeit, genauer: die Verzeitlichung, erlaubt die Synthese der Widersprüche als Widerspruch ihrer Endlichkeit und Unruhe, als Geschichte und als Symptom (Syndrom). Die Inszenierung als Widerstand 287 – das ist die letzte kritische Öffnung des Zeichens zu einem nichtformalistischen System der Verweisungen. Das Problem lautet nun: Gibt es eine Differenz, die als Präsenz oder Evidenz auf sich selbst verweist – was die Systemtheoretiker später als „autopoietisch“ beschreiben –, oder ist das nur eine Beobachtungsweise, die das Subjekt zu einem Element unter Elementen macht? Haben wir es hier gleichsam mit sich anziehenden und abstoßenden Kräften – mit einem „Lebensmagnetismus“288 zu tun? Man müsste dann annehmen, dass unsere Welt notwendigerweise auf Realisierung von Fiktionen aufgebaut ist. Wo ist der Inversionspunkt? Er geschieht ganz einfach als Praxis der Kommunikation, oder allgemeiner, des Tauschs in gesellschaftliche Synthesen: in Gemeinschaften von Art einer Gruppe, Partei, Klasse, Sprachgemeinschaft etc. Philosophie, die dies zeigt und vollzieht, kann nicht auf einen positivistischen Algorithmus (Kybernetik) reduziert werden; sie ist denkende Narration im nietzscheanischen Sinn, denn mit der 286 Sartre, Kritik der dialektischen Vernunft, a.a.O., S.369ff. Sartre kommt es darauf an, die Bedingungen der kollektiven Überschreitung im revolutionärem Moment festzuhalten. Dosse hat in der Geschichte des Strukturalismus (Bd.2) analog dazu den Mai 1968 als eben jenen Zeitpunkt festgehalten, an dem der Strukturalismus, seines Höhepunkts an Wirkung eingedenk, mit Eintritt in die reale Wirksamkeit (Eroberung der Lehrstühle) auf die andere Seite des Widerstandes übertritt und somit seine suggestiv dogmatische Wirkung verliert und spätestens zur Schließung der Reformuniversität von Vincennes 1980 sich in Fachdisziplinen zerstreut. 287 Bohn, Inszenierung als Widerstand, a.a.O. Bei Klee produziert sich das Symptom als Sklerodermie, d.h. die palimpsestartige Verhärtung der Haut, ihre Alterung und zugleich die Abweisung, Spuren der Zeit aufzunehmen. 288 Bohn, Technikträume und Traumtechniken, a.a.O., S.147.
14. VORLESUNG 163
Gemeinschaft erzeugt sie auch die Dissidenten, die Abweichler und die Reformisten; sie wird Politik. Der Hauptwiderspruch besteht nun darin, dass die Ökonomie Produkte (Waren) auswirft, die Politik hingegen nur Vergemeinschaftung und, vermöge der unauflöslichen Antinomien, Geschichte. Möglicherweise ist nun die Inszenierung eines Widerstandes (das Fragen der Philosophie) das anökonomische Moment innerhalb des Prozesses des Verstehens, in dem die Bedeutung als dreifache Negation in Frage steht. Wir sind vorweg von der grundsätzlichen Ironisierung des Spiels, des Theaters, der Selbstrepräsentation im Allgemeinen als einer Infragestellung ausgegangen, die in der Romantik schon in Kritik umschlug. Unzweifelhaft dient ein Stuhl im Theater dem Sitzen. Er verfügt über den menschlichen Körper. Aber darüber hinaus bedeutet er den Thron des Königs Lear, der über seine Untertanen herrscht. Vermöge dieser Verschiebung von Besitz, Besessenheit und Verfügung ist die theatrale Bedeutung eine Kritik, in der der Stuhl die metaphorische Bewegung andeutet und zugleich in ihrer Widersprüchlichkeit zeigt. Der Stuhl wird somit zu einem produktiven Zeichen. Der gleiche Stuhl hat im Inventar des Theaters bloß eine Nummer. Setzen wir also fest: Die Szene ist der Ort, an dem der Widerstand mit den Dingen zum Ausdruck kommt und in Frage gestellt wird. „Eine Szene machen“, heißt aus der Routine in die Dramatik des Lebens einzutreten. Sie ist nicht etwas Fiktives, Abseitiges außerhalb der ökonomischen Gebrauchszwänge. Wir fragen jetzt danach, wie Sartre sich diese stets im „Grundwiderspruch“ befindende Wirklichkeit denkt, die sich zu einer synthetischen Praxis formt und als geordnete Praxis an Bedeutung gewinnt – warum demnach die Praxis nicht irrational funktioniert oder mit dem Zufall verlaufender Zeit gleichgesetzt werden kann. Warum also ist Politik möglich? Ist es nicht einfach so, dass die Dinge diesen Widerspruch, den sie zu beheben vorgeben, sind? Sartre bezieht sich auf sie als eine Synthese von Qualitäten, die einen Konsumenten vor die Wahl stellt, den normativen Gebrauch zu vollziehen, ihn zu subvertieren, zu ironisieren oder travestisch bis hinein in die Neurosen zu alterieren. Sartre „will [...] all diese Faktoren im einzelnen erklären, ihre Einzigartigkeit (d.h. den einzigartigen Aspekt, unter dem sich in diesem Fall die Allgemeinheit darstellt) erschließen und verstehen, wie sie erlebt worden sind.“289 Eine Wahl haben heißt: im Widerspruch der Möglichkeit die Wirklichkeit zum Widerspruch überschreiten. Denn die Praxis, das kennzeichnet ihre ökonomische Verfassung, kann die Wahl allein als relative Freiheit über den Affekt zulassen. Im Konsum der Zeichen können wir zwischen Affekten wie unter Farben ein- und desselben Modells wählen. Wir wählen und bestimmen dabei unsere personale Stellung innerhalb der Gesellschaft. Baudrillard spricht von einer „industriellen Produktion der Differenzen“ 290: „Es ist die monopolistische industrielle Konzentration, die, während sie die realen Unterschiede zwischen den Menschen abschafft und die Personen, die Produkte homogenisiert, gleichzeitig die Herrschaft der Differenzierung 289 290
Sartre, Marxismus und Existentialismus, a.a.O., S.121. Baudrillard, Die Konsumgesellschaft, a.a.O., S.129.
164 14. VORLESUNG
inthronisiert.“291 Baudrillard hat früher als andere gesehen, dass in der sich etablierenden Konsumgesellschaft der 1950er Jahre die Dinge ihre produktive Funktion an den Signifikanten abgeben, und zwar unter der Simulation, ihr Konsum selbst simuliere Produktion, die ihrerseits aber wegen ihres Opfervorgangs aus den gesellschaftlichen Wahrnehmungen ausgeblendet werden solle. Wir sind unentwegt aufgefordert, unser Leben und die materiellen Güter produktiv zu arrangieren, um ihnen eine Bedeutung innerhalb der Gesellschaft und einen Sinn für uns innerhalb der Gesellschaft, der Konsumgesellschaft, zu erschaffen. Ein Regisseur darf sich schon derjenige nennen, der sich an der Bedienungsweise und den Applikationen seiner Apparaturen zu schaffen macht. Das erlaubt es, das Nichtfunktionieren in den Vordergrund zu stellen, sondern den medial operierenden kommunikativen Akt als eine Art der gesellschaftlichen Daseinsberechtigung anzuerkennen. Denn die Zeichen, nicht die Dinge bestimmen meine Stellung in der Gesellschaft. Baudrillard sieht in der egalitären Wirkung des Zeichens sowie in der beliebigen Differenzierung und zugleich Vereinzelung des Subjekts sehr früh eine Strategie der Verabschiedung vom Modell des Klassenkampfes und der noch bei Sartre vorherrschenden Gruppenbildungsphänomene. Nicht mehr die Klasse, sondern die gesellschaftliche Teilnahme an den fluiden Zeichenwelten ist der Ausweis produktiver Existenz. „Journalisten und Werbefachleute sind Techniker des Mythos: Sie inszenieren das Objekt oder das Ereignis und erfinden seinen Sinn, ‚sie liefern es umgedeutet ab‘ – im Grenzfall konstruieren sie es ganz einfach.“292 Das Erlebnis dominiert zunehmend den einfachen Besitz. Sich in diesem Sinn in die Gemeinschaft einzureihen heißt, „die Kategorien des Mythos anwenden: Dieser aber ist weder wahr noch falsch, und die Frage stellt sich nicht, ob man daran glaubt oder nicht.“293 Der Mythos, so zeigt uns Barthes, ist dem Zeichen, also der möglichen Gebrauchs- und Handlungsvorschrift, inhärent als dessen undialektische „Rede“.294 Er ist die zeitliche Form der Antinomien. Das politische Ereignis, von dem noch Sartre fasziniert ist, wird zu einer Auseinandersetzung mit dem Mehrwert der Kapital- und der Konsuminteressen – von Baudrillard aber immer so verstanden, dass die Konsumgesellschaft nur eine mögliche Form der Vergesellschaftung darstellt, die sich durch das Moment der simulativen Wahl über die „Existenz-“ oder „Bedürfnisgesellschaft“ erhebt. Den Rückgang auf sogenannte symbolische, d.h. magische Gesellschaften, die das Opfer und die Verausgabung praktizieren, hält er offen. In einer Antwort auf Baudrillard hat Gerd Bergfleth doch zumindest die Perspektiven geradebiegen wollen, indem er die Einführung des Opfertodes durch den Terrorismus (der 1970er Jahre) doch einmal mit den Verkehrsopfern in Relation zu setzen empfahl.295 Jede Ausschließlichkeitsaussage 291
Ebd. Ebd., S.186f. 293 Ebd., S.186. 294 Barthes, Mythen des Alltags, a.a.O., S.251. 295 Das empfiehlt Gerd Bergfleth in seinem Nachwort Baudrillard und die Todesrevolte. In: Jean Baudrillard: Der Symbolischer Tausch und Tod, a.a.O., S.381. Bergfleth kritisiert die bei Baudrillard eingelagerte Ansicht über das „Heilige“ des Opfertodes angesichts des Terrors (damals die RAF und Brigade Rosso). Richtig ist, dass der Tod aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird als das, was sich 292
14. VORLESUNG 165
der nur noch „simulativen“ Welterfahrung wird hier relativiert. Erst also wenn die Bedürfnisse befriedigt sind, regieren die Simulationen; erst wenn die Praxis funktioniert, simulieren die Szenen die Überschreitung. Geschichte und Prophetie müssen sich erst als durch die Historie hindurch konstituiert erweisen. Die Erkenntnisse der Widersprüche als Widersprüche erfüllen sich in ihrer Verzeitlichung als verstehbar. Anders gesagt: Die Historie ist jeweils die Darstellung der Wahl und der Tendenz gewisser nie zur Ruhe kommender Widersprüche. In diesem Sinne schreiben wir unsere kleine Problemgeschichte der semiologischen Bewegung des 20. Jahrhundert und geben Antwort auf die Frage, „Warum sich heute noch mit Semiologie auseinandersetzen?“ Kommen wir auf die Position Sartres zurück. Sie versucht, innerhalb der Logik des Zeichens den Wunsch nach Widerspruchslosigkeit als einen dauernden Widerspruch – als den der Praxis – festzustellen. Wenn es eine „Wahl“ gibt, dann manifestiert sie den Ort des individuellen Spielraums, den das Zeichen notwendigerweise eröffnet, auch wenn diese auf das Feld der Simulakren, der Suggestionen und der Fiktionen ausweicht. „Was wir Freiheit nennen, ist die Unzurückführbarkeit der Ordnung der Kultur auf die der Natur.“296 Sartre thematisiert in einer Überschrift seines Essays Marxismus und Existentialismus die beiden Epochen „Entwurf und Wahl als Bedingungen von Sinn und Wert“. Die terminologische Verschiebung von semiologischer auf existentialistische Bestimmung bedeutet die Repolitisierung topologisch gedachter Signifikantenordnungen in eine sich dadurch konstituierende (historisierende) existentiale Zeitlogik: Der Mensch ist für sich selbst und für die anderen ein bedeutendes Wesen, weil man niemals auch nur die geringste seiner Gesten verstehen kann, ohne die reine Gegenwart zu überschreiten und sie durch die Zukunft zu erklären. Er ist außerdem ein Schöpfer von Zeichen, und zwar in dem Maße, in dem er immer sich-vorweg ist, indem er bestimmte Objekte benützt, um andere abwesende oder zukünftige Objekte zu bezeichnen.297
An zitierter Stelle bezieht sich Sartre auf die „deutschen Psychiater und Historiker“ und ihre hermeneutische Explikation von „Verstehen“ (vor allem Dilthey und die von Sartre in den 1930er Jahren rezipierten Gestalttheoretiker). Jedoch setzt er sich sogleich von der Tradition des Schöpfertums im romantischen Sinne dem Tausch verweigert. Folgerichtig wird er vom Terrorismus als das Andere der Gesellschaft in sie implementiert, als das was sie nicht in den Tausch absorbieren kann. Es ist so gerade dem System der Fürsorge unterstellt, Tote im Straßenverkehr zu vermeiden, deren Zahl höher ist als die der durch Terrorismus getöteten. Andererseits kann auch der Terrorist nicht aus seiner Position Gewinn schlagen: „Der Terrorist gibt nicht seinen Tod, sondern er verkauft ihn, und er verkauft ihn so teuer wie möglich. Der Todeskalkül bedeutet, daß er zurückfällt auf die Ebene der Politik, ja der Ökonomie, und das selbst dann, wenn er nicht um sein Überleben feilscht.“ (S.394) Muss man angesichts der Moden des Terrors heute nicht sagen, dass er ihn unter Wert verkauft, nämlich gegen das zunehmende Desinteresse, das mit der inflationären Blindheit des Terrors einhergeht? Tatsächlich ist es nicht der Tod, der in den Medien erscheint, sondern die unerwartete Plötzlichkeit des medialen Schwarmverhaltens, dieser semiotischen Progrome, die die Angst schürt – wiederum dialektisch natürlich zur Legitimation der Fürsorgegesellschaft und der Geheimdienste. 296 Sartre, Marxismus und Existentialismus, a.a.O., S.121. 297 Ebd.
166 14. VORLESUNG
ab, indem er diese „Erkenntnisweise“ als „dialektische Bewegung“298 auslegt. Die Bedeutung des Menschen für den Menschen ist dialektisch als Widerspruch gegeben, auf „Grund der faktischen Situation“. Die individuierte Situation bildet die Grundlage für die Bedeutung der Bedeutsamkeit. Diese Situativität wird aber für die Menschen in ihrer Alltäglichkeit nur bedeutsam, wenn sie ihnen als eine Szene erscheint, die ihnen die Wahl und die Kritik erlaubt – kurzum also die Interpretation des eigenen Seins aus den Tendenzen der Geschichte heraushebt. „Verstehen“ meint in dieser Hinsicht den progressiven und regressiven Sprung als Zeitinversion dauern lassen: Die Vergegenwärtigung wird so zu einem sinnlichen Moment. Sartre tauscht also das Element des Signifikanten, das als sprachliche oder textliche Elementarität gedacht ist, durch den Moment der Quasistillstellung der Periode der Zeit aus. Aber diese Stillstellung ist nicht mit der mechanistischen Ruhe zu verwechseln; sie ist in Wirklichkeit die Synthese der Zeiteinheit, die weder Gadamer noch die Strukturalisten als synthetische Präsenz zu denken vermögen. Es ist klar, dass Sartre die Wende Einsteins gegenüber Newton nachvollzieht: Raum und Zeit sind keine distinkten Synthesen, sondern der praktische Effekt des sich renormierenden Verstehens. Der Wahnsinn, das Spiel und der Terror zeigen, dass andere Normierungen und Widerstandsbildungen gleichwertig möglich sind, dass aber ihre Dauer kometenhaft, prekär und nicht ökonomisch ist. Wenn für Einstein nur noch die Konstante der Lichtgeschwindigkeit als Medium bleibt – ein Medium, das lediglich die elektromagnetischen Wechselwirkungen anzeigt –, so bleibt für Sartre die Bewegung des Individuums ausschlaggebend: „Es ist die Bewegung, die versteht, was sie weiß“299, welche, um Sartre zu persiflieren, die Kultur auf die Kultur zurückführt. Das ist aber eine ganz andere, analytische Voraussetzung, als die, von der Gadamer ausgeht, dass aller „bestimmender Grund“ die „Endlichkeit unserer geschichtlichen Erfahrung“ 300 ist. Hier verrät die Setzung von Grund und Telos letztlich nichts von der oszillierenden Kraft des Individuellen mit dem Allgemeinen. Sartre meint nicht die Lebensspanne oder Lebenskraft (élan vital; Bergson), sondern die Arbeit des Lebendigen. Er folgt damit jener Spur, die der späte Freud als Todestrieb bezeichnet hat. Hier handelt es sich nicht um eine Todessehnsucht, die einer Abwehr entgegengestellt wird, sondern um eine Balance zwischen der Überwindung des Todes durch Dinglichkeit und die Abwehr des toten Dings in der Flucht zur Sprache. Das Prekäre ist sozusagen der Tod der Mitte, der Erkaltung, oder, wie Baudrillard sagt, der Eintritt des Kapitalismus ins Paradies bourgeoiser Gerechtigkeit. Ichbildung und Anderenabhängigkeit bedingen aneinander nach Grundsätzen des praktischen Verstehens, d.h., indem man die Dinge nicht genauer nimmt, als sie in ihrem sinnlichen Erscheinen sind; sie nicht militant polarisiert oder vermittelnd egalisiert. So ist jeder Akt des Verstehens notwendig ambivalent und offen für Anschlussoptionen. Nicht seine Identität, sondern das Spiel seiner Differenz bildet den Kern der Wahl: Denn 298
Ebd., S.122.
299 Ebd., S.137. Physiologisch wird hier auf ein Körpergedächtnis und die von Foucault analysierten
Körpertechniken angesprochen. 300 Gadamer, Hermeneutik und Kritik, a.a.O., S.433.
14. VORLESUNG 167
die Wahl verfehlt ihr Ziel immer, insofern weder „Ich“ noch der Andere in der Lage sind, Autonomie zu erreichen. So ist das Verstehen nichts anderes als mein eigentliches Leben, d.h. die totalisierende Bewegung, die meinen Nächsten, mich selbst und die Umgebung in der synthetischen Einheit einer im Vollzug stehenden Objektivierung zusammenfaßt. Genau deshalb, weil wir Ent-wurf sind, kann das Verstehen ganz und gar regressiv sein.301
Mithin besteht auch kein Anlass, den Strukturalismus gegen die Hermeneutik ideologisch auszuspielen, nur weil sie sich beide von unterschiedlichen Opponenten aus den Polen annähern; denn die Zeichen verweisen naturgemäß auf beide Richtungen als mögliches Ziel einer Szene, die zur Entscheidung, zur Wahl oder zur Deutung drängt. So hat jedes Zeichen stets zwei Verweisungsrichtungen: Die eine nimmt den Signifikanten als die Sache selbst, die andere nimmt ihn als Herausforderung einer ihn bedingenden Andersheit; das Rot der Ampel zwingt mich zum Stehenbleiben, weil ich in diesem Rot die Herrschaft des Anderen anerkenne, der Ein-Anderer-für-mich ist. Sartre sieht zu Recht hinter dem Zeichen ein menschliches Bedürfnis und einen nicht zu behebenden Mangel. „Weil wir Menschen sind und in der Welt der Menschen, der Arbeit und der Konflikte leben, sind alle uns umgebenden Objekte Zeichen. Sie zeigen von sich aus selbst die Art ihres Gebrauchs an und verhüllen kaum den eigentlichen Entwurf derer, die sie so für uns geschaffen haben und die sich durch sie an uns wenden.“302 Gerade dadurch aber, dass die Verweisungen Ziele, Strategien, Prophezeiungen und Androhungen entwerfen und wir diese Entwürfe realisieren, kann es sein, dass eine „Finte“303, eine „Verführung“, die Szenifikation, also das Verstehen in eine Richtung drängt, die Mittel und Ziel vertauscht, die also, wie es Baudrillard analysiert hat, die Zeichen dazu anhält, nicht den Gebrauch der Ware und ihre Funktion, sondern ihre soziale Stellung, die durch ihren Besitz erworben wird, anzuzeigen. Es sind nun weder die Ware noch das Zeichen, sondern der „Tauschrhythmus“304 als kommunikativer Prozess, der den gesellschaftlichen Wert hierarchisiert, stabilisiert und akkumuliert. „Das Verstehen beharrt und hält die Auseinandersetzung in Gang.“305 Kommunikation wird um der Kommunikation willen erzeugt, Arbeit um der Arbeit willen. Das Subjekt und der Andere zerfallen. Ihr Agon muss deswegen in medialen Arenen artifiziell inszeniert werden. Angesichts dieses sich durch die gesellschaftlich-technischen Möglichkeiten verändernden Entwurfsgeschehen modifiziert sich auch eine Theorie des Zeichens. Von „Bedeutung“ im festschreibenden Sinne wird nicht gesprochen – nicht, weil es Bedeutungen nicht mehr gäbe, sondern weil die Selbstorganisation der Struktur eine vermeintliche Autonomisierung der Organisation der Zeichen durch Zeichen 301
Sartre, Marxismus und Existentialismus, a.a.O., S.123. Ebd., S.124. 303 Ebd., S.126. 304 Baudrillard, Die Konsumgesellschaft, a.a.O., S.232. 305 Sartre, Marxismus und Existentialismus, a.a.O., S.135. 302
168 14. VORLESUNG
bzw. direkter, der Gesellschaften durch Gesellschaften: kommunikativ in Austausch bringt. Die etymologisch orientierte Linguistik ist zu einem langperiodischen Spezialfall kurzperiodisierter Medieninterventionen geworden, deren Aufarbeitung dringlicher ist. Dieses Herstellen von artifiziellen Verweisungsfunktionen, die zu einer „entfremdende(n) Objektivierung der Ziele“ und zu „Kontrafinalitäten“ führt – also zu dem, was man ganz neutral „Anpassungsdruck“ nennen könnte –, verlangt nach kurzfristigen Inszenierungsmoden, in der die Konvention von gestern schon morgen den Gebrauchsstreik der Dinge bewirkt. Hier wirkt die Konventionalität durch Produktion in einer Situation nicht mehr bedeutungstragend, sondern prozessierend. Der Prozess und die Dauer können unterschiedliche Strategien verfolgen: die der Wahl oder die der Reproduktion. In diesem Sinne bestimmen Institutionen306 den Rhythmus von Bedeutungen, die nicht verstanden zu werden brauchen. Sie werden reproduziert. Aber die Individuen stören unentwegt diese Prozessivität, gerade wenn sie mit ihr nicht mehr Schritt halten, indem sie sich ihrer sinnlichen Dimension durch die Kraft einer reichhaltigen Palette von spontan auftretenden Symptomen entziehen. Es geht Sartre nicht darum, die Bedeutungen auf ihren „wahren“ Grund zurückzuführen, ihren Schöpfer zu benennen und die Ursache und Wirkung zu definieren, sondern darum, die Momente der Inversion der Saussure’schen Semiose zu stärken, die den praktischen Wert seines Entwurfs anregen – nämlich die jederzeitige pathische, apathische, pathologische und emphatische Instabilität und Invertibilität der semiotischen Triade: „Der Konflikt Hegel-Kierkegaard findet seine Lösung in der Tatsache, daß der Mensch nicht entweder bedeutet oder bedeutend ist, sondern zugleich [...] bedeutet-bedeutend und bedeutend-bedeutet ist.“307 Dieser Konflikt inszeniert sich als die Geschichte. Hier wollen wir mit der Analyse abbrechen. Sie führt zu einem konkreten Ergebnis: Weder der topologische noch der rein chronologische (historische) Modus der Theorie des Zeichens kann in einer objektiven Ordnung dargestellt werden. Statt einer Ordnung ist ein lebendiger ökonomischer Prozess darzustellen: Die Strukturtheorie soll Systemtheorie werden, in der kein Feld sich vom anderen wirklich separieren kann oder eine Außenperspektive Objektivität simuliert. Beobachtungen, Entwürfe, Theorien sind Teil des Systems, das sie beobachten. Die Frage nach der Autonomie eines Subjekts betrifft nur noch den gesellschaftlichen Status, den es als Person einnehmen kann. Die Beziehungen der Relate sind nur insofern stabil, als sie einer variablen Praxis genügen und sich unendlich differenzieren. Dieser Differenzierung entspricht eine waffentechnische Verdichtung. Die Verweisung des Verstehens ist ein Prozess, dessen Ziele ambivalent sind. Sie werden erreicht, indem sie überschritten werden. Nur aufgrund dieser lebendigen Ambivalenz können einerseits die Ordnungen, andererseits die Individualitäten für einen Austausch sorgen, der sich in einer Praxis erhält, die dennoch in Perioden zu dauern und somit Bedeutungen sinnvoll zu generieren vermag. Aber es sind die konkreten Menschenkörper in ihrer leiblichen Dynamik, die das vermögen, und nicht die Götter oder die Maschinen, die aneinander die 306 307
Ebd., S.136. Ebd., S.132.
14. VORLESUNG 169
Regeln vorgeben, damit Überschreitungen produktiv werden. Die Menschen erzeugen so ihren eigenen Widerstand, von dem aus sie die Überschreitungen verifizieren und auf die Praxis zurückwenden, und von dem aus die technisch-wissenschaftliche Praxis die sinnlichen Überschreitungen zur Figuration einer Sinnlichkeit anbieten, indem sie sich selbst inszenieren. An diesem Punkt setzt die Weiterführung der Thesen Sartres an: „Was ist der Mensch und durch welche Ordnungen konstituiert er sich?“, fragt Foucault, was ist das menschliche Maß seiner Verzeitlichung, im Reflex dessen, was da draußen schon an Übermenschlichem geschieht?
15. VORLESUNG Das Symptom zeigt, dass es etwas gibt, was sich nicht zeigen lässt – Symptom ist positive Negation von Präsenz – Angst ist keine Sache des Individuums; alle Kultur zeigt die Verschiebung von Angst in Sorge – Das Symptom steht in Beziehung zum Zeichen der Praxis, es ist aufgehobene Präsenz für eine andere Präsenz: Inszenierung – Das Symptom ist Widerstand gegenüber den Normen der Praxis – Das Symptom zeigt eine Krise der Motivation in der physikalischen Welt kausaler Technik
Unsere Analyse bleibt nicht vollständig, solange wir nicht auf die wirkliche Subversion der dienenden Funktion der Ding- und Warenzeichen hingewiesen haben: sie am Körper selbst in Besitz zu nehmen, also die Autonomie herauszufordern. Diese Subversion ist die Involution des Zeichens als Symptom, einer pseudoorganischen Selbstverdinglichung, die man als „natürliche“ Reaktion des Körpers auf eine krisenhafte Umwelt missversteht, statt sie als eine sich nicht vom Körper ablösende „Kreation“ zu begreifen, eine Selbstautonomisierung von Produktion respektive Bewusstsein. Das Symptom, so wie es hier verstanden wird, artikuliert einen Widerstand, der in der widerstandslosen Praxis das Opfer der Produktion darstellt und zugleich aufheben will. Das ist seine Funktion: zu zeigen, dass es etwas gibt, was sich nicht zeigen lässt, was in paradoxer Weise eine Verweisung ohne Zeichen sein will. Eine erste Unterscheidung wird man zwischen Handlungssymptomen und Zeichensymptomen machen können: Erstere sind im Allgemeinen als histrionische oder neurotische Szenen oder Handlungen zu verstehen, die durch Zwang und Wiederholung die Verdinglichung durch Selbstdarstellung aufheben wollen; zweitere sind Zeichen die auf sich selbst als Verdinglichung verweisen: Hautaffektionen, Allergien und andere Formen der Selbst-Selbstdarstellung. Eine dritte Gruppe kennzeichnet die Angstsymptome: solche, die die prekäre Instabilität der mediierten Differentialitäten des Produktionswesens (Hochtechnologie, Militaria, Simulakren) anzeigen und den Grund haben, Gefahren der Rissigkeit der Signifikantenkette zu prognostizieren und ein mögliches Ende der „Anschlussoptionen“ vorwegzunehmen. Phobien halten sich vor allem in topografischen Bezügen auch als Angst vor Selbstverdinglichung und Orientierungs- oder Weltauflösung: Höhenangst, Agoraphobie, Platzangst. Die Ängste nehmen das vorweg, wovor sie sich fürchten. Sie kehren die strategische Komponente des Zeichens um und spielen mit der sich selbst erfüllenden Prophetie. In den Augen der Phobiker wird erkannt, dass die Dinge aus Angst vor Vergänglichkeit gemacht sind. Zunächst ist das Symptom nur eines von vielen Zeichenverweisungen, dessen autosymbolische Funktion, die Selbstverweisung, anzeigt, dass es zwischen den Produkten der Umwelt und den Produktionen am Körper nur den Unterschied der Ablösungsvalenz gibt – dass sie also selbstkonsumatorischen Charakter haben, ansonsten aber völlig homolog oder strukturäquivalent zur Dingproduktion sind. Den Symptomen entsprechen gewisse Potlach- und Kriegsformen, Formen der
172 15. VORLESUNG
Verausgabung.308 Die Problematik dieses Selbstbezugs ist uns schon im Begriff der Präsenz erschienen, der ja „Individualität im Außenbezug“ meint. Die Hartnäckigkeit des Symptoms zeigt an, dass es sich beim Symptom um eine positive Negation von Präsenz handelt, das, was sich in der Dauer nicht halten können soll. Das kann man an den vielen Inszenierungs-, Wiederholungs- und Zwangsformen ablesen. Langzeitlich ist ihre Struktur, wie die der Gesellschaft, einer „Pathoplastizität“ (einem historisch/histrionischen Effekt) unterworfen, die insbesondere an der diskursiv gut belegten Hysterie und ihrer wechselnden Nomenklatur ablesbar ist – nicht erst seit Freud.309 Die Ablösung des Symptoms vom Körper geschieht traditionell nicht auf aufklärendem, interpretierendem Wege über die Veränderung der Umwelt, sondern durch eine im weitesten Sinne Umorganisation der Signifikanten oder Umorientierung der Handlungsschematisierung, also durch eine Verwandlung der Verdinglichungszwänge in solche der Zeichenverweisung. Die Symptome sollen als Zeichen in Bewegung gebracht werden, sie sollen „praktifiziert“ werden. Dass zu ihrer Auflösung therapeutisch beide Analysen (die des Zeichens und der Handlungen) geeignet sind, zeigt, dass das Symptom von vornherein ein Sache sowohl der Semiotiken als auch der Handlungstheorien sein kann, deren Elementarereignis oder „Urszene“310 in der Synchronie von symbolischer und funktionaler Beziehung besteht. Es geht also um eine Verzeitlichung der paradoxalen Selbststruktur in der Szenifikation. Die Urszene ist nicht exklusiv erste, traumatische Szene, sondern sie bezeichnet den Augenblick des Einfalls der Reflexion in die scheinbare Autonomie, also des Gewahrwerdens der Unlösbarkeit signifikanter Ordnung auf Identität hin – eine Art hermeneutisch-homosexuelle Entzauberung –, dem der Abfall vom Glauben an eine taxonomische Ordnung der Dinge und somit phobische Selbstaufklärung folgt, die sonst durch die Praxis der Koordination von Produktion und Konsumation als Vergesellschaftung verdeckt wird. Das heißt aber von vornherein: Die Urszene ist das Urtrauma, das jedem als Möglichkeit der Reflexion bewusst wird. Angst ist immer Angst vor der Aufdeckung der Unmöglichkeit reiner, opferloser Dingproduktion wie zugleich die Angst vor dem militanten Durchmarsch der Produktion in den sofortigen Konsum. Diese beiden Richtungen der Angst, ihre 308 Baudrillard, Die Konsumgesellschaft, a.a.O., S.41: „Sie kaufen das Teil für das Ganze. Und der Exzess dieses sich ständig wiederholenden metonymischen Diskurses der konsumierbaren Materie, der Ware, wird auf dem Wege einer großen kollektiven Metapher wieder zum Bildnis der Gabe – zum Bildnis der unerschöpflichen und spektakulären Verschwendung des Festes. Jenseits des Aufstapelns, das die rudimentärste, aber auch die prägnanteste Form des Überflusses ist, organisieren sich die Objekte als Sortiment oder Sammlung.“ 309 Vgl. Elaine Showalter: Hystorien. Hysterische Epidemien im Zeitalter der Medien. Berlin 1997, S.17: „Hysterie ist eine ‚Protosprache‘, und ihre Symptome sind ‚ein Code, in dem ein Patient eine Nachricht übermittelt, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht verbalisiert werden kann.‘“ (Zitation: Robert M. Woolsey: Hysteria 1875 to 1975. Diseases of the Nervous System 37 (Juli 1976), S.379.) 310 Die Urszene ist eine Urspaltung, die sich unmittelbar auf das Erwachen der Reflexion, also der Individuation bezieht. Jean Laplanche/Jean-Bertrand Pontalis: Urphantasie. Phantasien über den Ursprung, Ursprünge der Phantasie. Frankfurt am Main 1992, S.42: „Urphantasien: In der Urszene wird der Ursprung des Individuums bildlich dargestellt; in der Verführungsszene ist es der Ursprung, das Auftauchen der Sexualität; in den Kastrationsphantasien ist es der Ursprung des Geschlechterunterschieds. Man findet also in ihrem Thema auf doppelte Weise bezeichnet [signifié] den Status der Urphantasien als etwas bereits vorhandenes [déjà-là] wieder.“
15. VORLESUNG 173
schizoide Ambivalenz, werden in der Praxis durch moderierende Funktionen der Zeichen, des Designs, der Medien, der serialisierten Warenformen getrennt. So macht es den Anschein, dass die Angst eine Sache des Individuums ist. Alle Kultur zeigt aber, dass sie einer Verdeckung der Angst als Sorge um die Befriedigung der Bedürfnisse dem Individuum vorausgeht – die wirkliche Entdeckung der existentiellen Problematik, moderiert als „Sorge“. Von Heidegger aufgegriffen, von Sartre im Entwurf positiv gewendet, von Baudrillard als „Fürsorge“ dämonisiert, enthält die Sorge in sich die Möglichkeit sowohl zum Verschluss oder Symptomabschluss (depressive und phobische Organisation) als auch zur produktiven Veränderung der Welt (bis zur Hysterie und Manie), um die Körperabwehr als Selbstdistanzierung des drohenden Kollapses von Produktion und Konsumation, als katatone Dauerpräsenz zu verhindern. Die biografische und historiografische Suche nach dem Umsatz des körperlichen Symptoms sollte an der Aktualität und Zurichtung von Präsenz ansetzen – umso mehr, als die Konsumgesellschaft dem präsentischen Tauschakt, und nicht dem Wert des Besitzes zunehmend Bedeutung unterstellt. Therapeutisches Agieren am körperlichen Symptom mit Leidensdruck, also Opferaufzehrung, liegt unserer Kultur immer schon zu Grunde. Gelungene Symptomabwehr behauptet sich als funktionierende Praxis mit Arbeit und Widerstand. Manfred Frank betont die Verirrung, die das Symptom als missbrauchtes Zeichen darstellt, also die positive Seite der Opferperspektive: Es ist grundsätzlich das Individuum, durch dessen Intervention die Struktur (bzw. die von ihr in ihrer Selbstidentität gesicherten Zeichen) am Zusammenfallen mit sich verhindert. Mit sich zusammenfallen hieße: präsent sein. Nun kann eine Struktur oder ein Zeichen niemals mit sich selbst zusammenfallen, weil erstens der Gedanke der Unterschiedenheit der Zeichen den der Zeit und zweitens jeder Zeichengebrauch den der (unkontrollierbaren nichtidentischen) Wiederholbarkeit voraussetzt.311
Frank spricht aus, was wir in der Analyse des Sartre’schen Existentialismus als Unhintergehbarkeit der Individualität, d.h. der Praxis herausgearbeitet haben und von der aus das körperliche Symptom als Homologie durch die Gebrauchssperre bzw. Opferdeklamation zu unterscheiden ist. Das Symptom verhindert die Verdeckung der „Rücksicht auf Darstellbarkeit“. Da es in der Produktion stets systematisches und symptomatisches Opfer gibt, kann das Zeichen tatsächlich „niemals mit sich selbst zusammenfallen“. Das ist auch mit dem Selbstbezug des Symptoms gemeint: Leiden, Schmerz, Widerstand sind Ausdruck dieser unmöglichen Möglichkeit, die in der antinomischen Struktur des Zeichens als Einheit und als Differenz markiert ist. In dieser Hinsicht verstehen wir die Argumentation der Selbstbezüglichkeit des Symptoms als ein Körperzeichen, als Inszenierung einer Szene für Andere, die auf eine situative Urszene umzudeuten ist, also auf die in sich traumatische Wirklichkeit. Denn wenn das Symptom die Struktur des Zeichens ernst nimmt, kann es nur in einer Beziehung zum Zeichen der Praxis stehen. Also ist es aufgehobene Präsenz für 311
Manfred Frank: Ansichten der Subjektivität. Frankfurt am Main 2012, S.68f.
174 15. VORLESUNG
eine andere Präsenz: Inszenierung, Darstellung für Andere. In der Regel wendet sich der Symptomatiker an den Arzt, den Heiler, den Schamanen, der in der Gesellschaft eine besondere seherische Funktion besitzt, die auch den Hermeneutiker auszeichnet. Wir müssen dem Symptom demnach eine Art Aufklärungskompetenz innerer Widerständigkeit in äußerer Differenz zusprechen: Krankheit, Angst, Schmerz – Begehren, Lust, Wunsch. Dabei handelt es sich letztlich also um das, was in der äußeren Praxis beständig verschoben und aufgehoben wird: aufgehoben und gehortet in den Sach- und Dingbezügen. Für das Individuum ist Selbstverdinglichung eine pathische Möglichkeit, vor dem Opfer der Ablösung, der Produktion zurückzuweichen, worauf sie sich militant im Organischen verdichtet: Das Symptom ist der Ausweis eines individuellen Widerstands gegenüber den Normen der Praxis. Frank übersetzt: „Denn Individualität ist eine Instanz, und sie scheint die einzige zu sein, die der rigorosen Idealisierung des Zeichensinns als eines instantanen und identischen Widerstand entgegenbringt.“312 Ihr Widerstand bezüglich Binnenmemorialität geschieht gelingend als (Ver)Äußerung. Sozialisierung und Kultivierung gelingt über Körperanpassung der Dinge und Verleiblichung in Situationen. Wenn solche gelingende Veräußerungen als Bedeutung reflektiert werden, Dinge bedeutsam sind, können sie dies nur über den Moment der Verinnerlichung (Inversion) als Gedächtnis. Gelingt die Bedeutungsbildung nicht mehr, isolieren sich die Dinge in der Evidenz und reagiert das Individuum nur noch affektiv und situativ, dann tritt das Symptom als Differenz des Widerstands am Körper auf. Symptom ist also eine Verdinglichung im/am Körper, die zwischen Anamnese und Amnesie, zwischen Erinnerung und affektiver Verdrängung hängen bleibt; eine unvermittelbare Mitte. Da aber der sprachliche und der dingliche Zusammenhang zwei Seiten derselben Produktivkraft sind, signifizierend und verdinglichend, kann man mit einer sprachlichen Therapie im Sinne Freuds und Lacans intervenieren. Aber diese Sprechtherapie darf nicht Exklusivität beanspruchen. Sartres Hinweis auf die „Psychoanalyse der Dinge“ zeigt, wo der Weg praktischerweise auf Seiten der gesellschaftlichen Produktion entlangführt: Eine Psychoanalyse der Sachen als verhaltenstherapeutische Anmaßung kann, wo sie über ihr Telos der Arbeit sich vergewissert, entweder eine Neurose als Symptom professionalisieren, d.h. sie produktiv umwenden, oder, was im Regelfall Programm ist, diese in einen gelungenen Umgang mit den Dingen einüben, d.h. die Wiedereingliederung in die Gesellschaft vornehmen; in eben jene Gesellschaft, die das Symptom als Opferent-deckung und als Opferverdeckung zugleich hervorbringt, im Konsum der Zeichen und Dinge.313 312 Ebd., S.72. Übrigens geht auch Frank in der Darstellung des Individuums – wenn auch nur am Rande – von einem nichtpathologischen Symptombegriff aus. 313 Der Unterschied in der Zuordnung des „Unbewussten“ zwischen Sartre und Lacan ist signifikant: Während Sartre die Praxis der Serialität ökonomischerweise als Unbewusstes auf der Ebene der Wahrnehmung bezeichnet, d.h. auf signifikante Gebrauchshandlungen abzielt (in dieser Weise werden eben auch Zeichen produziert), zielt Lacan auf den Produktionsakt des Sprechens (des gesprochen Werdens des Subjektum): „Unbewusstes gibt es nur beim sprechenden Sein.“ Jacques Lacan: Television. In: Ders.: Radiophonie. Television. Weinheim 1980, S.62. Womit wir wieder bei der Frage der Kulturdefinition von Sprache wären.
15. VORLESUNG 175
Nun ist die Diagnose der zunehmenden Isolierung und Brüchigkeit der Signifikanten in einer Präsenzgesellschaft vom Problem der Isolierung überschattet, eher also von den Ängsten als von den Hysterien. Es gilt zunehmend nicht mehr die Ordnung, sondern die narrative Kontinuität der Zeichenbezüge zu organisieren, d.h. eine Simulation der Ableitungen zu inszenieren. Im industriellen Maßstab machten das unter anderem die Mythen, im privativen die Psychoanalyseformen. Präsenzgesellschaften ist nicht vorzuwerfen, dass sie nicht gerade diese szenografische Arbeit würdigen und professionalisieren; doch ihr Wert wird negiert, wo er im Spektakel der Unterhaltung selbst verdinglicht, d.h., wie Barthes gesagt hat, zur Form erstarrt. Die Übersetzungskraft der Inszenierungen ableitbarer Narrationen, Mythen und Funktionsgliederungen gerät selbst immer stärker unter Differenzierungsdruck – bis zu jener Situation, die Woody Allen in seinen Filmen persifliert: Jedem zweiten Einwohner von New York wird mindestens ein Psychiater zur Seite stehen, sodass zwischen der Welt der Arbeit und der Welt der Heilung keinerlei Abnormität unbeachtet bleibt. Die autologe Gegenform dieser Fiktion ist die derzeitige Polarisierung der Weltzeit in Produktion und Freizeit, die aber längst schon in die minimalisierten Perioden der Dauerkommunikation indifferenziert. Gegenteilige Inszenierungen hat etwa Jean-Luc Godard propagiert: Er kritisiert, dass die Welt der industriellen Produktion die Zeichen gnadenlos vom Sinn abtrennt, also längere Perioden arbeitsund freizeittechnisch auf ein Mindestmaß sequentiert. Die Szenen werden systematisch umcodiert: Nicht mehr „Anfang, Mitte und Ende“, sondern der permanente affektive und staccatoartige Schock prägt eine Gegenwartsgesellschaft, die ihre Praktiken in 30-Sekunden-Epen verhökert. Godard hat in den 1960er Jahren daraufhin verlangt, den Chock auch auf der semantischen Ebene des Films einzuführen: Eine Szene besteht aus Anfang, Mitte und Ende: warum nicht auch aus Mitte, Ende und Anfang? Die Krise ist die der Reflexion, also der Urszene: Einerseits wollen Präsenzgesellschaften weder Entwurf noch Gedächtnis anerkennen, andererseits wolen Reflexionsgesellschaften unentwegt sich mit der Frage auseinandersetzen, ob es denn angesichts der Geschichte so etwas wie Präsenz überhaupt gibt. Nun sind Gesellschaften keine Subjekte, sondern Systeme, Synthesen, und tragen von daher Symptomcharakter: Sie verinnerlichen, involutieren, ohne Innerlichkeit als bedeutsam manifestieren zu können. Die Verinnerlichung wird zu einem gegenwendigen Konzept der einschließenden Ausschließung. Aus dieser Warte beschreiben die Systemtheorien nicht mehr ideologische, sondern symptomatische Reflexe über gesellschaftliche Zustände. Darin liegt aber gerade die Relevanz ihres Objektivitätsanspruchs. Denn die Symptomatik kann sich nicht gegen sich selbst wenden, sie kann nicht in die göttliche Drittenpositionen eintreten – wenigstens nicht um den Preis der Psychose. Beobachter, Welt und Umwelt bildet die Triade, die auch das Modell von Peirce schon im Blick hat. Wir können jetzt das Symptom des Übergangs oder der Übersetzung der Semiologie im Kontext der Systemtheorie auf die Reflexionsgattung „Theorie“ allgemein anwenden. Es ist dabei nicht richtig, dass es keine großen Erzählungen mehr gibt
176 15. VORLESUNG
und so die Gesellschaft zur Affektuierung von Wissen als Identitäts- oder Evidenzbildung verdammt ist. Baudrillard behauptet mit seinem Simulationsansatz das genaue Gegenteil: Weil es nur noch serialisierte, digitale Partikel sind, die die Produktion bestimmen, werden die Erzählungen, die sie zusammenschweißen, immer mächtiger. Es sind gerade nicht mehr die Zeichen, sondern die Formen mythischer, narrativer, d.h. inszenatorischer und szenografischer Dauer – Theoriefiktionen –, die als eigene Warenformen der Sehnsucht nach prospektivem Handeln Rechnung tragen. Politische Handlungen dagegen werden unideologisch auf das Feld der Ressourcen, der Kompetenzen und der Umsetzbarkeit einer störungsfreien Tauschordnung verschoben, also auf das der bürokratischen Pragmatik mit ihren Sonderinteressen: der diplomatischen Verzögerung des affektiven Tauschs. Dass kleinere Opfer Sinn machen, um größere zu vermeiden, und diese zu exportieren, ist Teil des Geschäfts. Dieser Widerspruch der Opferzusammenhänge ist zunächst einmal zu diagnostizieren, und zwar im Sinne einer Selbstverweisung des Zeichens als Symptom. Der Histrionisierung der Körper entspricht die Histrionisierung des Zeichentauschs. Histrionisierung ist dabei ein schlechter Begriff für „Datenverkehr“. Offensichtlich sind psychische Symptome Entsprechungen der medialen Technisierungen, geradezu deren bedeutungsintensivierende Überbietungsformen. Es besteht kein Ursachenverhältnis, sondern eines der inversen Organdeformation. Insbesondere die Außenhülle des Körpers wird als Aufzeichnungsfläche genutzt. Schmerz und Irritationen sind die Fremdverweisungen dieser Selbstverweisungen. Die Bezugnahme auf die Sonderform des Symptoms als Zeichen ist für die Darstellung der Krise der Semiotik zwischen Strukturalismus, Hermeneutik und Handlungstheorie schon bei Roland Barthes deutlich abzulesen. Er war sicher der populärste Semiotiker, der die Semiologie weder zur klassenkämpferischen Propaganda noch zur genauso klassenbewussten Identitätsbehauptung anwandte, sondern historisch zwischen einer kybernetisch orientierten Bedeutungsoptimierung und einer inszenatorisch inspirierten Bedeutungsumwertung differenzierte und sich dafür entschied, die mythischen, reichen Formen der Bedeutungsökonomie in ihrer populären Selbstverweisung zu analysieren, während beispielsweise Eco und die Informationstheoretiker strenger und verbindlicher auf die Fragen antworten wollten, wie ein Zeichen sachgerecht und eindeutig seine Bedeutung ohne Opfer vertritt. Das Symptom zeigt aber, dass es auch immer anderes, unlogisches Verhalten gibt als das von den Inszenatoren beabsichtigte. Es reicht nicht aus, die Stringenz der Narration auf Kausalität und Vernunft zu reduzieren, wenn das Individuum auf Selbstopfer und Widerstand aus ist. Wenn man das Subjekt auf subtile Weise aus der Produktion entfernt, weil es den logischen Ansprüchen und den sinnlichen Geschwindigkeiten nicht genügt, braucht man eine eigene Professionalität, es wieder in sie einzuführen: die der Inszenierung – hysterisch, historisch, mythisch. Existenzphilosophie bei Sartre und Lacan sind Semiotiken des Leibes, der sinnlichen Verkörperung. „Sinnliche Verkörperung“ hat mit einem Prozess der Selbstabstoßung zu tun. Die Selbstabstoßung erfolgt über einen komplexen Prozess der Assimilation des Widerstandes, wie ihn Winnicott anhand der Übergangsobjekte präzisiert hat. Es geht um eine positive In-Distanz-Haltung des Abgelösten zunächst
15. VORLESUNG 177
als Instrumentalisierung und Besitz, auch des eigenen Körpers. Auf diesem Aushaltenkönnen der Distanzen und Präsenzen beruht die präsemiotische Form der Übergangsobjekte. Reflexion steht erst am Ende einer Kette von Objektivierungen des Anderen, dessen erstes, sich noch nicht ablösendes Moment das „Soma“ ist. Frank erklärt: Nötig war dazu lediglich, dass eines der Momente im Bewusstsein aus dem Zustand der Virtualität in den der Wirklichkeit übertrat und das andere Moment dann nicht mehr nur noetisch, sondern real von sich ausschloss. Bei Sartre geschieht das durch Intervention der Realität meines Leibes, ohne den „mein Für-sich-Sein in der Nichtunterschiedenheit von Vergangenheit und Zukunft sich vernichten würde.“314
Infolge dieser Argumentation ist das Bewusstsein als (virtuelle Präsenz) vom Bewusstsein meiner selbst zu trennen, das das Bewusstsein von Zeitlichkeit ist und auf die differenziellen Bezüge der Welt hin orientiert ist. D.h., Selbstbewusstsein ist ein Teil der Welt, der nicht hinreicht, Bewusstsein zu erklären. Nun verweist aber gerade das körperliche Symptom als Soma auf die Quasigeistexistenz, nämlich Ubiquität der Präsenz von Medien (aller Medien, also aller symbolisch codierten Ordnungssysteme). Es gibt nämlich Objekte, die sich im Übergang zwischen sinnlicher und manifester Erscheinung halten können. Solche Objekte sind Zeichen. Wäre das nicht so, würde man in die Falle einer rückständigen Trennung von Körper und Geist mit den entsprechenden unlösbaren Vermittlungsproblemen fallen. Das kann nun weder einer Hermeneutik, einer strukturalen noch einer analytischen Philosophie passen. Jeder, der die Zeitbezogenheit eines Computer kennt, der in Bits und Bytes elektromagnetischer Wellen takten muss, versteht, dass die Rechenapparate nur innerhalb einer enormen Bandbreite und unterhalb der sinnlichen Schwelle nichts anders tun, als fünf gerade sein zu lassen; dass sie also niemals mit unendlichen Zahlen, aber mit exakten Regeln und Wertfestlegungen arbeiten; dass sie Individualität, also unendliche Indifferenzierung ab einem bestimmten Integralwert einfach abkappen. Genau aus diesen Gründen der künstlichen Abkappung oder Trennung sollte man das Zeichen als Symptomwert immer schon als positiven Opfervorgang verstehen, d.h. von seiner Wertfestsetzung in Bezug auf die Synthesen des Leibs: Es genügt die Täuschung eines naturalistischen Filmbildes in 24 Bildern pro Sekunde festzulegen, obgleich man, wie Zeitlupenkameras das heute leisten, auch einige hundert in der Sekunde aufnehmen und abspielen könnte. Hier erfolgt die Festlegung der technischen Inszenierung nach der Maßgabe der Leiblichkeit des Auges. Aus diesen Kalibrierungsgründen, die man motiviert, also „sinnhaft“ nennen kann, sind Zeichen [...] keine Naturgegebenheiten, ihr Sinn gründet in Deutungsprozessen, die letztinstanzlich immer individuell, mithin ohne feste Identität, mithin veränderbar sein werden. So lehrte es nicht nur Peirce, so sahen es z.B. auch Schleiermacher und Humboldt, Saussure und Sartre. Löst aber ein Phänomen Wirkungen erst aus unter der Bedingung, dass Individuen es als dieses oder jenes deuten, dann bewegt sich im Zirkel, wer die Wahl nachträglich als durchs Phänomen determiniert ausgeben möchte. [...] Man nennt solche auf vorgängi314 Frank, Ansichten der Subjektivität, a.a.O., S.238 (Zitation: Jean-Paul Sartre: L’être et le néant. Paris 1943, S.392).
178 15. VORLESUNG
ger Phänomen-Interpretation beruhenden Wirkungen motiviert, im Gegensatz zu Kausationen, die in der physischen Welt deutungsfrei und zielblind sich vollziehen.315
Das Symptom zeigt somit unter den Bedingungen der Ökonomie und der Kultur eine Krise der Motivation „in der physikalischen Welt“ kausaler Technik. Das Symptom ist auf jeden Fall die Markierung einer Individualität, die das Schema der Ablösung, der Einbehaltung und der Distanzen für sich in Bezug auf sich organisiert. Das, was die Geschichtlichkeit des „Menschen“ ausmacht, ist in der Umorganisation der Geschwindigkeit des Sehens durch die Gewohnheit der Interfacewahrnehmung genau so zu diagnostizieren, wie Saussure die Veränderungen der Konsonanten in der indogermanischen Grammatik untersucht. Statt Angst mit den Mitteln der Praktiken des Normalverhaltens zu entdecken, wie in resozialisierenden Therapien Mode, kann sie in der Ingenieurskunst als Prüftechnik produktiv werden. Schon in mittelhohen Bürotürmen müssen Architekten durch Reinszenierung des Abgründigen dafür sorgen, dass den Büroangestellten nicht buchstäblich der Boden unter den Füßen entzogen und der Horizont verstellt wird. Höhenangst und Büroarbeit sind ebensowenig kompatibel wie Klaustrophobie und U-Bahnfahren. Aufgrund dieser räumlich/zeitlichen Bezogenheit auf die Distanz einer vertikalen und einer horizontalen Ordnung integriert man die Individualitäten und Situativitäten der sprachlichen Erscheinungen mit einer Semiotik der gebauten Struktur. Wenn die Semiotik eine Landkarte der Zeichenverwendungen und -arten entwirft, versucht sie Ordnung in den Situativitäten der Praxis zu entziffern.
315
Ebd., S.321.
16. VORLESUNG Urszene als Reflexion meint: Distanzierung, Spiegelung und Erkennen des Spiegels – Inversion und Involution als Gegenbegriffe zu Reflexion – Zeichen/Bedeutung und System/Bewusstsein sind eine Zweiseitenform – Die Inszenierung produziert Beobachtungen und Beobachter – Mache eine Unterscheidung! – Die Unterscheidung „Selbstreferenz/Fremdreferenz“ und die Unterscheidung „Bezeichnung/Unterscheidung“ – Beobachtung der eigenen Beobachtung ist eine Wertform, die zur Objektform nicht symmetrisch ist
Urszene als Reflexion kann dreierlei meinen: Distanzierung, Spiegelung und Erkennen des Spiegels. Für den Vorgang der Reflexion hat die Philosophietradition drei Begriffe reserviert: erstens: Die Distanz (zu sich) wird als Bewusstsein aufgefasst; zweitens: Bewusstsein ist stets Bewusstsein-von-etwas, d.h. Bewusstsein ist, nach Husserl, nur intentional gegeben; drittens: Es gibt kein leeres Bewusstsein, so wie es keinen leeren Spiegel gibt. Der Gegenstand als ein gespiegelter ist dessen Wert, gemäß der Auffassung, dass wir keine Gegenstände, sondern deren Qualitäten erfassen, und zwar als Wert- oder Signifikationsrelation.316 Der Wert ist stets produzierter Wert. Das Erfassen entspricht einer Wahrnehmung, die sich nachträglich (reflexiv!) als Beobachtung der beiden Opponenten der Relation des Bedeutens als Drittes erkennen muss. Die Distanzbildung der Reflexion kann zeitlich als Aufschub erfasst werden. Aufschub meint Nichtidentität des Bedeutenden, sondern Identität des Bedeutens. Ein jedes Subjekt ist beständig im Zustand des sich selbst einholenden Werdens (progressiv-regressiv). D.h., das Erfasste muss im Kontext als räumliche und zeitliche Ordnung platziert, d.h. begriffen werden. Das Begreifen (oder die Signifikation) erfasst die Unterscheidung „Wahrnehmen“ (Signifikant) und „Erkennen“ (Signifikat), indem es sich selbst als identisch setzt. Aus diesem Reflexionskonzept der Philosophie, das mit einer Theorie der Semiotik kombiniert werden kann, hat die Systemtheorie eine eigenständige Form der Konzeption der Semiose entwickelt, in der die Frage nach der Subjektivität – nach dem, was objektiv diesem Prozess der Identitätsbildung substituiert ist – nicht reflexiv, sondern inversiv gestellt wird. Wir haben als Gegenbegriffe die der Inversion und Involution eingeführt, unter der Grundannahme, dass alle Beziehungen in der Gesellschaft und unter den Individuen homolog sind, dass es also kein „Außen“ der Beobachtung gibt. Alle Beobachter sind Teil der Welt, die sie beobachten, von der sie sich aber unterscheiden, indem sie einen Unterschied setzen. Alle aufgeführten Zeichentheorien müssen die paradoxalen Prozessualität des Zeichens anerkennen, wenn sie nicht dogmatisch sein wollen. 316 Barthes, Elemente der Semiologie, a.a.O., S.46: „Zum Schluß gilt es nun, dem Zeichen nicht mehr durch seine ‚Komposition‘, sondern durch seine ‚Umgebung‘ beizukommen: dies ist das Problem des ‚Werts‘. [...] Der Wert steht in enger Beziehung zum Begriff der Sprache [langue] (im Gegensatz zum Sprechen [parole]); er führt dazu, die Linguistik zu entpsychologisieren und sie der Ökonomie anzunähern; er nimmt also in der strukturalen Linguistik eine zentrale Stelle ein.“
180 16. VORLESUNG
Das Zeichen muss a. die Unterscheidung Bezeichnung als Unterscheidung und, b. die Unterscheidung Selbstreferenz/Fremdreferenz veranlassen können, sonst kommt es entweder zur Identität (Paralyse) oder zur unendlichen Reflexion der Hin- und Herverweisung (Neurose): wie sollte ich vor dem Spiegel stehen, mich als mich identifizieren können, wenn ich mich nicht schon vorher durch Andere erkannt hätte, die wiederum sich selbst, aber nur über Andere erkennen, die sich ihrerseits nicht selbst erkennen usw. Entsprechend ist der Signifikant nur in seiner Beziehung mit allen anderen Signifikanten stabilisiert. Es gilt also nicht, das Spiel zu erkennen, sondern es im Rhythmus der „menschlichen“ Abständigkeiten/Extensionen zu prozedieren. Hier hatten wir zwischen Symptom und Ding unterschieden. Die Zeichenexplikation der Systemtheorie, die wir besprechen wollen, leiten wir in der Version von Niklas Luhmann ab, der sich dezidiert zum Verhältnis von Zeichen und System geäußert hat. Zeichen, System sowie Bewusstsein sind jeweils eine Form mit zwei Seiten mit paradoxen, aber alltäglichen Eigenschaften wie ein Blatt Papier oder eine Münze, die man niemals gleichzeitig von beiden Seiten beobachten kann. Durch Zeit oder unterscheidendes Prozessieren lässt sich die Paradoxie szenifizieren. Das Opferprogramm und der Produktionsgewinn der Beobachtung laufen also über eine Logik der Verzeitlichung/Entzerrung von Simultaneität, d.h. erhöhtem „Zeitverbrauch“. Diese Logik eröffnet dem System ökonomische und produktive Operationen, denn es läuft nicht in der Zeit, sondern als Zeit. Weil Zeit die Lebendigkeit des Subjekts ausmacht, lässt die Systemtheorie das Subjekt schließlich ganz in die Operatoren der Beobachtung, d.h. des sinnlichen Konsums und seiner divinatorischen Unterscheidungen aufgehen. Dennoch geht Subjektivität in der Systemtheorie nicht einfach in einem endlosen maschinenhaften Beziehungsgeflecht der Struktur auf. Sie ist als Operator die Zeit, die es braucht, um jeweils die andere Seite der Unterscheidung einzunehmen und damit die paradoxale Starre (Identität/ Inzest) aufzuschieben und an die Choreografie von Form und Unterscheidung zu binden. Das Subjekt ist aufmerksam für Anderes und es beobachtet den Umschlag von Quantität in Qualität, den wir für die Periodisierung einer Situation in Szenifikationen identifiziert haben. Dies gilt insbesondere für die Analyse der Systemtheorien. Auch Luhmann versteht darunter einen individuellen Akt wertsetzender Freiheit. Die Szene war uns ja als etwas vorgestellt worden, was relativ den Aufschub selbst aufschiebt/aufhebt und dadurch eine Asynchronie als befreite Zeit erwirkt. Die Unterscheidung zwischen Aufschub und Setzung gilt als Argument für die Aufnahme der systemtheoretischen Kompetenz einer Zeichentheorie. Sie liefert uns Hinweise über die Bestimmung dessen, was Sartre als „Praxisfeld“ bezeichnet. Praxis ist eine Bestimmung von Wahrnehmung (Situativität, Bewusstheit), die als Erkennen Aufmerksamkeit/Distanz verlangt. Jetzt begegnen uns zwei Auffassungen von Bewusstsein, die im 19. Jahrhundert schon Franz Brentano unterschieden hat: Aufmerksamkeit hat vom Typ, von der Kategorie der Einstellung her mit „innerem Bewusstsein“ nichts zu tun. Darum zieht Brentano eine scharfe terminologische Trennlinie zwischen „Wahrnehmen“ und „Beobachten“. Wahrnehmen können wir unaufmerksam, beobachten nur aufmerksam.317 317
Manfred Frank: Präreflexives Selbstbewusstsein. Vier Vorlesungen. Stuttgart 2015, S.56.
16. VORLESUNG 181
Unterscheiden wir die Praxis als Wahrnehmungsfeld der Serialisierungen (oder Automatisierung oder Affekte) vom aufmerksamen als bewusstem, d.h. bedeutendem Gebrauch (als Semiose), liefert uns das Hinweise auf die Formen inszenierter Beobachtung, also auf solche Unterscheidungen, die unter der ausdrücklichen Aufforderung nicht die Sache selbst, sondern deren Präsenz und Präsentation, also deren Bewusstheit aufzunehmen. Nun erscheint uns dieses Bewusstsein nicht mehr als reflexiv, sondern als eine Art doppelter, inversiver, „ironisierter“ Zeit: Wir sind Beobachter, aber auch gleichzeitig Beobachter von Beobachtungen – man denke nur einmal an die Logenarchitektur und das Entrée in einem Opernhaus. Hier werden Beobachtungen nicht nur gemacht, sondern auch ihre Präsentation inszeniert – nicht nur visuell, sondern auch in den Pausengesprächen und Kritiken der Aufführung. Die Inszenierung ist eine Produktion, die als „bewusst“ inszeniert, beobachtet und konsumiert werden kann, die eine Fremdreferenz in der Beobachtungsperspektive einschließt und fallweise auch wieder ausschließt.318 Nicht alles, was für einen Anderen gemacht ist, ist deswegen gleich „inszeniert“. Wenn es aber für einen Anderen im Sinne des Für-einen-Anderen-als-für-einen-Anderen gemacht ist, falls also der Ironisierungs-, Verführungs- oder Entfremdungsaspekt319 hinzutritt, können wir von „Inszenierung“ sprechen. Ich muss also jeweils mitreflektieren, dass eine andere Perspektive eingenommen wird, als die der alltäglichen, praktischen Wahrnehmung. Architekturgeschichtliches Vorbild ist der point de vue. Eine inszenierte Ereignisform muss zeigen lassen, dass es auch eine andere Perspektive gibt, als die von der Intendanz intendierte. Deswegen werden Praxis, Bewusstsein und Sinn (die „Produkte“ einer zeitlichen Perspektivierung) bei Sartre zusammengedacht. Jede Beobachtung entlässt immer zwei gleichwertige Glieder: das Beobachtete und das von der Beobachtung Ausgeschlossene. In der seriellen Praxis bleibt es bei zeitperspektivisch serialisierten Glieder. In der Praxis ist das Zeichen der Reflex der Bedeutung, und nicht der Veranlasser einer Produktion, die die Bedeutung erst erschafft und verortet. Bewusstsein von sich selbst haben, also Selbstbewusstsein, ist dagegen keiner Referenz und keiner Reflexion verpflichtet, die sich aufschieben lässt. Als „präreflexives Bewusstsein“, eine Begriffsbildung Sartres320, ist es für sich selbst ganz durchsichtig. Nur, was selbst Nichts (néant; relativ Nichtseiendes) ist, kann die Welt als Etwas in sich aufnehmen. Diese aus der Sprach- und Bewusstseinstheorie der Frühromantiker sich ableitende Idee des Selbstbewusstseins ist Indiz der Relationalität von Verweisungen. Transzendenz, Durchsichtigkeit und Flüchtigkeit sind die konkreten „Eigenschaften“ des Bewusstseins, der Selbstpräsenz. Der néant kann nicht dauern. Er ist zeitlos. Wir erkennen also in der Problematik der Darstellung 318 Man kann sich das an dem Unterschied der deiktischen Reklame (Neu! Jetzt kaufen!) gegenüber der inszenierenden Form der Werbung verdeutlichen: „Wollten Sie nicht schon immer eine behagliches Heim haben? Dann wird ihnen XY ihre Wünsche erfüllen.“ Die inszenierende Werbung bezieht also nicht nur die Umwelt des Produkts mit ein, sie verspricht deren Erfüllung als Regression auf die Ebene der Wahrnehmung oder des Wissens. 319 Die Beobachtung schließt ein, dass ich ein Anderer bin, als das Beobachtete. Es handelt sich also um seine Selbstszenifizierung. 320 Frank geht in Präreflexives Selbstbewusstsein (a.a.O., S.53ff.) den frühromantischen Spuren dieser Begriffsbildung nach.
182 16. VORLESUNG
des Bewusstseinsphänomens die des Zeichens wieder: Das Zeichen ist ein Selbst für Anderes. Seine Referenz ergibt sich durch das, was es nicht ist, durch eine Struktur der Unterscheidung. Bewusstsein und Bedeutung sind von der Form her identisch, doch wir deuten sie in der Regel unterschiedlich. Bedeutungen werden topologisch, Aufmerksamkeits- oder Erkenntnisvollzüge dagegen zeitlich interpretiert. Die Frage bleibt offen, in welcher Weise uns das Werturteil der Unterscheidung „Wahrnehmung/Bewusstsein“ selbst nicht bewusst zufällt, ohne dass wir auf den Regress der schwarzen Romantik verfallen, also im Unendlichen die Beobachtung der Beobachtung usw. beobachten. Sartre hat diesen Regress umgekehrt, indem er die unendlichen Differenzen sich in der Praxis synthetisieren lässt. Offensichtlich handelt es sich hier aber auch um ein Drama gesellschaftlicher Konstitution, das auch anders gewichtet werden kann als unter dem Ethos der Erweckung des Bewusstseins aus dem gegenwärtigen „Verblendungszusammenhang“. Aus dieser progressiven Perspektive lohnt sich ein Vergleich zwischen der Unterscheidungslogik der Systemtheorie und der Sinnperspektive Sartres. Auf Vereinfachung bedacht, werden wir das präreflexive Bewusstsein als Wahrnehmung bezeichnen, die Wahrnehmung des Spiegels oder der Inszenierung als Inszenierung selbst dagegen Erkennen nennen. Das Erkennen ist eine Wahrnehmung, die sich radikal von der Gegenstandswahrnehmung durch die „Wahrnehmung von Beobachtung“ als synthetisierendem Wert unterscheidet. Denn die Beobachtung ist selbst kein Gegenstand, sondern nur der Unterschied der Unterscheidung. Hier betreten wir ein neues Gebiet. Zunächst beschäftigt uns die Frage, was unter systemtheoretischen Gesichtspunkten als Zeichen zu verstehen ist? Wir fragen dabei nach der Theorieinszenierung der Semiotik der Systemtheorie, und nicht nach dem, was man mit Systemtheorie sinnvollerweise an gesellschaftlichen Prozessen verstehen kann. Alle Bestimmungen der Systemtheorie erfolgen aus einer sozialen Praxis heraus. Es gibt keine Ursprungsbestimmungen und keine Zielvorgaben, sondern nur ein stabiles/instabiles Prozessieren des Systems – ein wenig so, wie man auf einer schnurgeraden Straße durch minimale Lenkbewegungen die Unebenheiten der Strecke ausgleicht. Es ist nicht möglich, die Straße bzw. die Paradoxie der Zwei-SeitenForm durch dreidimensionale Bewegungen zu vermeiden. Die dritte Dimension würde sich wieder aufspalten. Abstrakt gesagt: Sowohl ein absolutes Identitäts- als auch ein Differenzbegehren würden unweigerlich den Unfall herbeiführen. Im Ausgang von Luhmanns Zeichenbegriff hat Elena Esposito321 folgende doppelte Unterscheidung gemacht, indem sie von Spencer Browns Formenkalkül „Mache eine Unterscheidung!“ ausgeht. Die Kritik an diesem Formenkalkül hat darauf hingewiesen, dass die Beobachterperspektive nicht klar ist. „Unterscheiden“ meint nämlich immer, von irgendeinem Standpunkt einer (negativen) Identität aus zu unterscheiden. Wir haben eben mit Sartre diese Identität als „Praxis“ benannt und die Art der Bezugnahme auf Welt als „Wahrnehmung“ klassifiziert. Wahrnehmung ist aber, so Brentano keine Beobachtung. Im Gegensatz zu Spencer Brown setzt Sar321 Elena Esposito: Die Zwei-Seiten-Formen in der Sprache. In: Dirk Baecker (Hg.): Probleme der Form. Frankfurt am Main 1993, S.88-119.
16. VORLESUNG 183
tre die Praxis ausdrücklich als zielvermittelt322, und nicht als entscheidungsoffen ein, (sie ist „motiviert“, sagt Frank). Für Sartre erfüllt die Praxis einen vorgeschriebenen, konventionalisierten memorierten Gebrauchszweck – nur so kann sie, was sie soll, nämlich „ohne Aufmerksamkeit“, ohne verweisenden Bezug „automatisch“ funktionieren. Der Sinn der Praxis ist also ihr festgelegter Ent- und Unterscheidungsvollzug. Wir kennen all diese täglichen Reproduktionen, die schließlich dazu führen, dass aus individuellen Handlungen soziale Zeichen- und Kommunikationsbezüge stabilisiert werden, die es uns erlauben, mehrere Handlungen auch parallel auszuführen. Elena Esposito führt aus: Man scheint zu unterstellen, daß ihm [Spencer Brown; R.B.] die in seiner Konstruktion implizierte Zirkularität nicht völlig bewußt ist und er „vergessen“ hat sich selbst und seine Beobachtungsperspektive einzuschließen. Um das zu tun [...] muß der calculus of indications in einen calculus of selfreverence umgewandelt werden, indem der Operator selbst die Verweisung auf sich impliziert. Das Zeichen der Unterscheidung (¬) wird dann zum Zeichen des Uroborus ( ), und signalisiert durch den Bezug auf sich selbst das Bewußtsein des Bezugs auf ein Anderes: Neben der Unterscheidung (der Form) kommt also die Unterscheidung der Unterscheidung (die Form der Form) ins Spiel, die selbst eine ZweiSeiten-Form ist und immer die Verweisung auf das Nicht-Unterschiedene mit sich bringt. Es handelt sich (in Luhmanns Worten) um die Verweisung auf die Außenseite der Form.323
Die weitere Argumentation Espositos kann man abkürzen, indem man feststellt, dass es sich einerseits bei jeder Unterscheidung um eine „gleichzeitige“ Unterscheidung von Handlung und Festlegung gemäß der Binnenbeziehung des Zeichens (Signifikant|Signifikat) handelt, andererseits aber um die strukturale Einbeziehung eines Beziehungsfeldes, das diese Binnenunterscheidung nur im Verhältnis auf die mögliche anschließende Bedeutungskette treffen kann. So ist der Satz „Die Bank ist geöffnet!“ handlungsweisend, wenn man ihn auf ein Finanzinstitut, und nicht auf eine Parkbank bezieht. Jede Wertentscheidung als Unterscheidung verlangt also nach einer zweiseitigen „doppelten“ Formunterscheidung. Mit Esposito „werden [wir] von dieser letzten Unterscheidung als Unterscheidung Selbstreferenz/Fremdreferenz (S/F) sprechen, welche von der die Operation leitenden Unterscheidung Bezeichnung/Unterscheidung (i/d) unterschieden wird.“324 Unterscheidungen fallen dabei unter Fremdreferenzen, während Bezeichnungen als Selbstreferenzen festgelegt sind. Der produktive Aspekt dieser Unterscheidung der Unterscheidung liegt darin, dass sie nicht symmetrisch ist und der einfachen horizontalen und vertikalen Gliederung einer Struktur nicht entspricht. „Das Ding vom Ding oder den Namen vom Namen zu unterscheiden ist etwas anderes, als den Namen vom Ding zu unterscheiden.“325 Das Crossover der letztgenannten 322 Sartre, Marxismus und Existentialismus, a.a.O., S.76: „Damit kommen wir zur Bestimmung einer
simultanen Doppelrelation; mit Bezug auf das Gegebene ist die Praxis Negativität: aber es handelt sich immer um die Negation einer Negation; mit Bezug auf das intendierte Objekt ist sie Positivität: aber diese Positivität führt geradewegs zum ‚Nichtseienden‘, zu dem, was noch nicht ist.“ 323 Esposito, Die Zwei-Seiten-Formen in der Sprache, a.a.O., S.89. 324 Ebd., S.91. 325 Ebd., S.92.
184 16. VORLESUNG
Unterscheidung kann nämlich in keinem Negationsverhältnis aufgehen. Es ist sozusagen syndromisch und sorgt für das produktive, auf ein Außen der Struktur verweisendes Moment: einen Referenten. Der Witz ist, dass jetzt der „Inhalt“ oder der Sinn eines Satzes die ständige zum Wert hin geöffnete Lücke/Durchbruch des Systems annonciert und seine Selbstabschließung verhindert, weil die Referenz eben nicht im Verhältnis von Position und Negation operiert. Die Merkmale einer Seite beeinflussen die Merkmale der anderen Seite nicht (das Wort „Feuer“ brennt nicht). Sie funktionieren auch anders. Während der Gebrauch von Unterscheidung i/d durch Negationen verläuft – also zwei gleiche und gegenübergestellte Seiten trennt –, negiert die Selbstreferenz die Fremdreferenz nicht (und umgekehrt): Das Ding ist nicht die Negation seines Namens, es ist nur sein Referent. Und das Verhältnis zwischen Selbst- und Fremdreferenz ist nicht symmetrisch: Die Unterscheidung wird immer innerhalb eines Systems getroffen.326
Esposito verknüpft die Beobachtung eines Systems mit der „Autonomie, der Ausdifferenzierung des Systems in einer Umwelt (Unterscheidung S/F), auf der anderen Seite mit der Anschlussfähigkeit der Operation des Systems (Unterscheidung i/d)“327, die zugleich die Unabhängigkeit des Beobachters als Beobachter ermöglicht. In dieser Hinsicht ist das Selbstbewusstseinsproblem auch kein logisches, sondern eines, das der Asymmetrie entspringt, die den Spiegel nicht zu den Gegenständen rechnet, die in ihm gespiegelt werden können. Parallel gegeneinander gestellte Spiegel sind blind; blinde Spiegel verschwinden nicht, sie werden zu Dingen. Die Dinge im Spiegel heben die Wahrnehmung (nicht das Erkennen!) des Spiegels auf und setzen eine Referenz als Umwelt. Der Spiegel ist also ein Gegenstand mit der Funktion eines Crossovers; er ist der Referent der Unterscheidung Selbst-/Fremdreferenz. Selbstbewusstsein ist demnach der nicht negierbare Wert dieser Unterscheidung: Wert ist stets auf Umwelt oder Gesellschaft hin idealisiert gedacht. Dies drängt „Sartres These“ zu einer Aufhebung der Subjekt-Objekt-Spaltung im Präreflexiven in die wunderbar paradoxe Wendung [...], die Selbstspaltung sei gerade die dem Bewusstsein eigentümliche Einheit, da ‚Identität‘ nur den Gegenständen-an-sich zukomme. Nach ihnen strebe das Bewusstsein, ohne darüber aufhören zu wollen, bewusst zu sein. Das ist die Sehnsucht nach dem „Wert“, dem An-sich-Für-sich-Sein, der unerreichbaren Hegel’schen Idee, an der die menschliche Sehnsucht zerschellt und sich zugrunde richtet.328
Wir sehen, wie aus existenzieller und aus systemischer Perspektive der Gegenstand aufgelöst wird: einmal in der positiven „paradoxalen“ Bezeichnung eines präreflexiven Selbstbewusstseins, das die Praxis der menschlichen Handlungen als kontinuierlichen Weltbezug wahrnimmt, und einmal negativ, als Unterscheidung von Welt und Umwelt. Operationen sind immer an ein Prozessieren der Zeit gebunden: Sie entzerren die Synchronitäten der Form in Diachronitäten von Referenzen. Erst durch solche Theoriemodelle kommt man aus dem Dilemma der struktura326
Ebd., S.94. Ebd. Wir haben es, wie in der kantischen Analogie, mit einer doppelten Relation zu tun, deren Relate aber nicht reversibel sind. 328 Frank, Präreflexives Selbstbewusstsein, a.a.O., S.94. 327
16. VORLESUNG 185
len Semiotik heraus, eine generative Produktivität zufällig im darwinistischen Sinne konzedieren zu müssen. Um den Umwertungsprozess weiter zu verdeutlichen, möchte ich auf die Form des Zeichens bei Luhmann eingehen. Es geht mir darum, die Unterscheidung Situation/Szenifikation für eine Präsenzgesellschaft – die damit natürlich noch keine gedächtnislose Gesellschaft sein muss – unterscheiden zu können, wobei das Paradigma der Reflexion die beiden von Sartre bestimmten individuellen Positionen „Wahrnehmen“ und „Erkennen“, denen er die sozialen Sphären „Praxis“ und „Politik“ zuordnet, unterscheidet. Grundsätzlich geht es in diesen Begriffspaaren darum, die Innerlichkeit von der Äußerlichkeit durch eine Membran zu trennen, die als „Selbstbewusstsein“ ein negativer Referent ist. Ein Subjekt kann nicht nicht unterscheiden, aber es kann selbst ein Nicht-Unterschiedenes sein (Praxis), wenn man die Instanz des Subjekts aufgibt und sie in das System integriert. Das heißt dann, gemäß unserer Grundannahme, Innerlichkeit (Vorstellung, Involution) als Inversion von Äußerlichkeit (im Sinne der Zweiseitenform) zu betrachten. In Wahrheit jedoch gibt es nur ein homologes Innen|Außen. Sartre begründet seine Veräußerlichung des Inneren mit Akzeptanz einer These von Lévi-Strauss, der Homologie der Welt: Die Substanz (Materie) und die Wertform (Eigenschaften bzw. Verweisungsform) unterscheiden sich nur in der Willkürlichkeit der Synthesen. Wir haben ja bereits gezeigt, dass die erkennende Vermittlung beider im Ding (respektive, nach Marx, in der Warenform) durch einen Operationsvorgang abgedeckt wird, den Sartre „Verstehen“ nennt und der sich in einer progressiv-regressiven Methode veranschaulichen lässt. Denn weder sind die Dinge im Zeichenbezug Identitäten, noch sind es Subjekte. Nun lässt sich weiter vermuten, dass so etwas wie „Selbstbewusstsein“ oder „Beobachtung der eigenen Beobachtung“ mit der Unterscheidung „Fremdreflexion/ Selbstreflexion“ zusammenhängt, von der Esposito sagt, dass sie keine Negationsform (echte Reflexion), sondern eine Wertform darstellte, dass sie asymmetrisch sei und somit tatsächlich nicht gänzlich transparent für sich selbst.„Das Ding ist nicht die Negation seines Namens, es ist nur sein Referent.“329
329
Esposito, Die Zwei-Seiten-Formen in der Sprache, a.a.O., S.94.
17. VORLESUNG Spiel ist motiviert, Praxis zielgerichtet – Vom Ding zur Freiheit des Zeichens – Applikationen des Designs: Funktionalität renaturieren und humanisieren – Zukunft als Folge von Unterscheidungshandlungen – Vom Zeichen der Freiheit zur Freiheit der Zeichen – Periode der Beobachtung ist nicht mehr die Historie, sondern die Szene; die zur Abschließung drängende Eröffnung als System – Gebrauch ersetzt Herkunft – Sinn als Katharsis der Verzeitlichung
In Präsenzgesellschaften scheint sich eine Allianz zwischen dem Spiel und der szenischen Umarbeitung von Praxis anzubahnen, in deren Folge die Praxis des konventionalisierten Umgangs mit Sprachen und Dingen entmilitarisiert und entpolitisiert wird. Vermutlich ist der Schein dieses Effekts einer Substitution oder Sublimierung zu verdanken, wie er etwa auch nach dem Höhepunkt des Mai 68 zu beobachten war. Dirk Baecker hat jedoch in systemtheoretischer Rücksicht die Universalität des Spiels gedacht: Es gibt eine soziale Praxis, die auf ihre Weise dem zu entsprechen scheint, was Spencer Brown unter dem Titel des „re-entry“ untersucht: das Spiel. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen: Vermutlich ist das Spiel nicht nur eine soziale Praxis unter anderen, sondern die soziale Praxis schlechthin, die in allen anderen sozialen Praktiken vorausgesetzt werden können muß. Andere soziale Praktiken kommen zustande, indem bestimmte Eigenschaften des Spiels gestrichen werden. Das Spiel ist das soziale Phänomen schlechthin.330
Die Praxis des Spiels unterscheidet sich in ihrer Ziellosigkeit (play, nicht game!) von der Praxis, von der Sartre als gesellschaftlichem Zweck der Freiheit spricht. Das Spiel ist motiviert, die Praxis zielgerichtet. Beim Spiel haben wir es mit einem Verlust an Individualität zu tun: Etwa im Rollenspiel oder im Kinderspiel kommt diese Verlusterfahrung als Überschreitung zum Ausdruck. Einen ähnlichen Effekt des Versuchs der Austauschbarkeit der Subjektivität als Selbstbestimmungsform beherrscht auch die Semiose nach Saussure. Der Strukturalismus radikalisiert diese Form der Referenz und hebt ganz auf die Beziehung der Zeichen untereinander ab. Das Subjekt fungiert als „leeres Feld“, aufgrund dessen die Zeichen ihre Beweglichkeit (Verdichtung/Metapher und Verschiebung/Metonymie) anzeigen und für sich selbst (individuell) darstellbar und beobachtbar werden. Wie löst nun die Systemtheorie das Problem der Individualität, und wie hält sie es mit dem Freiheitsbegriff, den die Strukturalisten und die Poststrukturalisten an Sartres Auslegung so vehement kritisiert haben? Was ist in den Ausführungen Baeckers unter dem „Spiel als Form“ als „re-entry“ zu verstehen? Baecker bestimmt: „Im Spiel konstituiert sich Sozialität als Reflexion auf sich selbst als das andere ihrer selbst. Im Spiel wird Sozialität als sie selbst erfahren, nämlich als kontingent, was soviel 330 Dirk Baecker: Das Spiel mit der Form. In: Ders.: Probleme der Form. Frankfurt am Main 1993. S.148-158, hier S.152.
188 17. VORLESUNG
heißt wie: weder nötig noch unmöglich, oder anders: gegeben, aber wandelbar.“331 In dieser Präzisierung schwingt mit, dass es sich beim Spiel um die Problematisierung eines „Aktionsrahmens“332 handelt, der nicht überschritten werden darf („crossing“), aber als Widerstand bezeichnet, bespielt werden muss („marker“). Wir stehen aber wieder vor der Frage, ob der Spiegel die Reflexion erzeugt, oder ob in der Inversion erst ein Reflex erzeugt wird – also der Spiegel erst als eine Verdinglichung in Folge der Tauschbarkeit von Subjektivität erscheint, wobei wir eben voraussetzen müssen, dass es Dinge immer schon gibt. Systemisch gesprochen, wird die Außengrenze der Periode des Spiels zur Innengrenze mit der Maßgabe, dass alle sich an das Spiel der Verschiebung halten ohne es zu überschreiten. Die Möglichkeit der Überschreitung sichert aber den Grund der Individualität als die andere Seite des Rahmens. Diese wird nicht mehr an die Form der Selbst- und Fremdreflexion gebunden, sondern an eine Freiheit, die das Zeichen (bzw. die Rahmung oder Referenz) selbst ermöglicht, nämlich den Austritt aus dem Spiel und somit die Individualisierung. Individualität wird zur Überschreitung einer selbstgewählten Grenze. Dazu muss man Gesellschaft als eine Möglichkeitsform auffassen und sehen, dass es in der Praxis immer auch anders geht: Dies ist die Bedingung der Freiheit. Mit dieser Überlegung wird dominant, dass das Spiel in erster Linie auch eine Umwertung der praktischen Dinge, ihre Sabotage, ihre Travestie, ihre Intervention betreibt, also all das, was Kunst und Theater als szenische Initiativen beschreiben, wofür aber der pathologische Fall die serielle Praxis angreift. Dass die Neurotiker ein Theater der Dinge und Situationen entfalten, ist eine gängige Metapher. Geschichtlich erwiesen ist, dass das griechische Theater sich aus dem dionysischen Rausch zum Fest und Festspiel entwickelt hat und schließlich im Karneval die Unerbittlichkeit selbst der Zeit sabotiert. Während aber die Sabotage von Krieg und Terror gerade auf den unbedingten Wert der Bedeutungen verweist, die phantasmatisch die Umwertung der Praxis verlangen, greift der Spieler die Phantasmatik an. Es geht ihm nicht um Realisierung, sondern um die Befreiung seiner eigenen Möglichkeiten. Das ist der Argumentationsschritt, den wir benötigen, um in Luhmanns Fragestellung Zeichen der Freiheit – oder Freiheit der Zeichen? eintreten können. Wir fragen nicht nach der Gewissheit des Selbstbewusstsein sondern nach der Freiheit seiner Variabilität. Luhmann betrachtet das Zeichen als eine Form der Kontingenzbewältigung. Seine Ausführungen, anlässlich künstlerischer Produktion gemacht, abstrahieren aber schnell. „Arrangieren von Zeichen“ scheint ihm die allgemeine Bestimmung von „inszenieren“ zu sein: „Ganz allgemein kann man zwar davon ausgehen, dass sowohl in der Eigenart von Kunst als auch im Arrangieren von Zeichen etwas Artifizielles, etwas Kontingentes vorliegt, das zwar sein kann, aber nicht sein muss.“333 Das einschränkende „zwar“ veranlasst Luhmann zur Frage, ob die Kunst bzw. das 331
Ebd., S.154. Ebd., S.156 (nach Gregory Bateson: Geist und Natur). 333 Niklas Luhmann: Zeichen der Freiheit – oder Freiheit der Zeichen? In: Gerhard Johann Lischka (Hg.): Zeichen der Freiheit. Bern 1992, S.54-77, hier S.56. 332
17. VORLESUNG 189
Arrangement – oder wie es in der Renaissance hieß: das Disegnio – geschichtlich unter dem Aspekt der Freiheit betrachtet werden kann. Die Darstellung überfliegt hier den entscheidenden Punkt: Wie man vom Ding zum Zeichen kommt, das genau geht ja nur, wenn man die spielerische Wertordnung, wie sie Baecker formuliert, generell unterlegt. Einfach gesagt: Ein Stein ist zunächst für alles Mögliche zu gebrauchen, bevor man seine spezifische Funktion herausdifferenziert. Unter diesem Gesichtspunkt ist die (moderne) Kunst immer eine Art Revision des Dings im Werk. Kann nach Luhmann „alles zum Thema der Kunst werden“ oder geht es auch um Aspekte der Anerkennung, also um eine Bedingung der Inszenierung-füreinen-Anderen, eine implizite Fremdreflexion, gar um die Unterscheidung Selbst-/ Fremdreflexion als eine Bedingung der Freiheit? Will der Künstler jemand anderen durch Entfremdung oder Überschreitung einer Konvention von sich selbst befreien? Es liegt in unserem (und Luhmanns) Interesse, wenn wir im Folgenden den engeren Terminus „Kunst“ durch den der „Inszenierung“ ersetzen und somit den Zeichenbegriff und den der Handlungsverweisungen generalisieren – zumal Luhmann die Einschränkung von Zeichenspiel auf Kunst deutlich nicht behagt.334 Den Begriff der Freiheit bindet Luhmann zunächst an die gesellschaftlichen Umwälzungen des 19. Jahrhunderts, in der die Ablösung von Familie und Haushaltung, Kirche etc. als Autonomisierung begriffen wird, deren problematische Seite dann die Frage der Neubewertung moralischer Handlungen aufwirft, sofern diese nicht rein subsistenzökonomisch fundiert werden: „In der neuen Gesellschaft kann nicht mehr vorausgesagt werden, wozu menschliches Handeln gut ist. Wer will das im Voraus bestimmen.“335 Autonomie, Autarkie, Selbstbewusstsein sind als sozialhistorische oder kulturelle Begriffe, und nicht als philosophische zu verstehen. Die Argumente der Fundierung einer Systemtheorie beziehen sich auf eine geschichtliche Entwicklung, in der die Deutungen der Systemtheorie aus der Gesellschaft als Zeitdiagnostik und -prognostik entwickelt werden. Die Vehemenz, mit der im 19. Jahrhundert auf solche Neubegründungen mit politischen und sozialen Gemeinschaften (Vereine, Parteien, soziale Organisationen) referiert wurde (und immer noch wird), spricht im Wortsinne Bände. Luhmann stellt die Umstellung der Autorisierung von Gesellschaft „von Herkunft auf Zukunft“336, von Bindungslosigkeit zur Freiheit heraus. Allerdings ändert sich die Semantisierung. Während „Freiheit“ noch bis Mitte des 20. Jahrhundert eher an die Möglichkeit einer neuen Vergemeinschaftung und eine Kette von Wertsetzungen und Ideologien gebunden war, die im Verhältnis von Ordnung und Freiheit sich arrangierten, sind die Zeichen für eine Dauer solcher Ordnung, die die der Herkunft und der historischen Repräsentation ersetzt, selbst in den Epochenbegriffen der Kunst/des Designs ebensowenig von Dauer wie in solchen des Besitzes. Ableitungen sind eher an technische Vollzüge geknüpft, denen aus der Zukunft eine zeichendominierte „Gebrauchsanweisung“, eine Handlungstheorie, 334 Luhmann ist aufgefordert worden, über eine Kunstausstellung zu sprechen, spricht aber nicht im kunstwissenschaftlichen, sondern soziologischen Diskurs, da er Kunst als eine unter vielen sozialen Praktiken auffasst. 335 Luhmann: Zeichen der Freiheit – oder Freiheit der Zeichen?, a.a.O, S.59. 336 Ebd.
190 17. VORLESUNG
ein „Entwurf“ – wie Sartre sagt – zukommt. Die Theoretisierung und Technisierung der Entwürfe ersetzt die Lehren von Moral und Ethik. In einem dritten Schritt zur Freiheit werden auch die Ideologien verworfen. Es bleiben nur noch die bedeutungslosen Techniken zur Handreichung des Funktionierens von Welt in Umwelt – und die Applikationen des Designs, die Funktionalität renaturieren und humanisieren. „Was sich geändert hat, ist nur der Zeithorizont der heute realen Gesellschaft. Wir sehen unsere Zukunft nicht mehr unter dem Zeichen der Freiheit, sondern vielleicht eher unter der Doppelbegrifflichkeit von Ökologie und Technik.“337 Die Herkunftsgründe werden zu präsentischen Normierungsgründen; die Konventionalisierung der Form als Gesellschaft kann sich auf die Stabilisierung von Gegenwart konzentrieren und verweist die Entwurfstechniken auf professionelle Bereiche: Szenograf, Autor, Künstler, Designer, Ingenieur – solche Bereiche, deren Selbstautonomierung sich der Gründe genialisch/kreativ oder methodisch/technisch entziehen, die also unmittelbar, perspektivlos, aus sich selbst schöpfend erscheinen. Bezüglich der Konventionalisierung des Gebrauchs in Ökologie und Technik gilt: „In unserer Gegenwart erscheint die Zukunft nicht als approximativ anzustrebende Wertidee, die alle guten, alle vernünftigen Menschen überzeugt, ja nicht einmal mehr als ein irgendwie menschenwürdiger Fortschritt, sondern als Risiko der jetzt zu treffenden Entscheidungen.“338 Im Moment dieser Vergegenwärtigung operiert die Systemtheorie mit der Denkfigur der Autopoiesis: Die Besonderheit der modernen Gesellschaft besteht darin, Funktionssysteme zu eigendynamischer Reproduktion oder, wie man auch sagen kann, zu eigener Autopoiesis freizusetzen und die gesellschaftliche Evolution gleichsam führungslos dem zu überlassen, was sich daraus ergibt.339
Zukunft kommt nicht mehr als göttliche Gabe entgegen, sondern ist die Folge unserer Unterscheidungshandlungen. Die Selbstreflexion dieser Beobachtungsweise der Bindungsüberschreitung, also der Individualisierung als Selbstverantwortung setzt auch für die Entwürfe der Systemtheorie eine historische Dynamik voraus. Eigentlich bezieht sich Luhmann aber auf den Gebrauch von Zeichen und dem Systemgewinn einer führungslosen Selbststabilisierung. Systemtheorie beobachtet Prozesse, nicht moralische Entscheidungen. Gerade weil dies führungslos gedacht wird, bedarf es einer „Rahmung“ – institutionell oder autoritativ als Intendanz – die Orte der Problematisierung von fehlender Führung führt, spielerische Produktionen die Simulationen ohne Ursprung zulässt. Man muss sich vergegenwärtigen, dass das Bezugssystem für Luhmann „Gesellschaften“ sind: Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Recht, Politik; nicht Individuen; allenfalls Repräsentanten. Gesellschaften sind als Systeme aus dem Praxisfeld der Situation herausgehoben, erschaffen sich durch Verfahren ihre eigenen Reproduktionsformen. Kann man nun diese historische Einschätzung der Bindungs337
Ebd., S.61. Ebd. 339 Ebd., S.62f. 338
17. VORLESUNG 191
losigkeit chronometrisch miniaturisieren und auf den Signfikationsprozess selbst anwenden? Baudrillard hat das in seiner Konsumkritik mit der Verknüpfung von Zeichentausch, der sich auf den Warentausch aufpfropft, und dem Wert einer Personist, in der Gesellschaft als Orientierungsgröße bestimmt ist, getan. Der Zeichenumsatz und nicht der Besitz bestimmt in der Konsumgesellschaft die Hierarchie, also das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft und somit reziprok die Art der Überschreitung. Autoritär ist der Austritt aus dieser Gesellschaft gar nicht möglich, weil sie jedes Außen sofort als einen besonderer Wert kolonialisiert. Konkreter gefragt: Ist eine strukturale Semiologie noch die richtige Antwort auf die Frage nach dem Umgang und der Stabilisierung der Zeichen als Repräsentation gesellschaftlicher Konvention bzw. Fluidität in einer Medien-, einer postmedialen Gesellschaft? Oder anders formuliert: Bestimmt noch die gesellschaftliche Bezugnahme auf Wertsysteme (Dinge, Waren, Geld, Status, Wissen, Zeichen) das Theoriedesign einer Semiotik als allgemeines Ordnungssystem? Oder ist es diejenige Beobachtungsselektion, die meint, die Medienpartikel bestimmt die Reziprozität der Gesellschaft, und nicht mehr Territorialität, Bodenschätze, Ausbildung etc., weil dies hinreichend integrierte Faktoren, also professionalisierte Bereiche tradierter Wertschöpfung seien, die nicht überschritten werden könnten? Wir haben es schon gesagt: Es sind genau diese Phantasmen der medialen Ordnung und der Codes, die im Spiel der Freiheit grundsätzlich niemals eindeutig zu erfüllen sind, sondern dazu serialisierende Reproduktionssysteme benötigen. Ist also problematisch, dass sich der Integration in die Funktionssysteme nichts mehr widersetzt, dass also die Überschreitung stets mit der Pathologisierung einhergeht? Wenn dem so wäre, ist der Neurotiker, der Phobiker, der Bourn-out-Leidende derjenige, der uns paradox, nämlich zwanghaft auf diese Freiheit aufmerksam macht. Luhmann bejaht den zweiten Fall. Deswegen fordert er, stets die Selektivität des Beobachterstandpunktes als Autopoiesis in die Selbstregulation mit einzubeziehen. Dieses re-entry haben wir als operatives Verfahren schon bei der Bestimmung von Mandelbrotmengen, also der Kalibrierung und Fokussierung der Beobachtung als quasinatürliches bewertet. Auch das Spiel nimmt sich nach Baecker grundsätzlich die Freiheit, auf sich selbst oder anderes zu referieren. Die Überschreitung ist nicht mehr nur der große theoretische, ideologische, revolutionäre Entwurf, mit dem noch Sartre sympathisiert und den die 68er-Generation feiert, sondern sie ist gerade in der kleinsten Währung zu Hause, die zur Verfügung steht: die der Individualität eines jeden Aktes, der Beobachtung der Unterscheidung und dann natürlich der Folgen dieser Unterscheidung, die sie auslöst, also die szenische Entfaltung von Präsenz. Luhmann bestimmt folgende Stadien der Geltung des Werts des Zeichens in einer Zeit dramatischer Wertsystemveränderungen: Soziologisch gesehen wird es kein Zufall sein, dass man in der Theorie der Zeichen, in der Semiologie, Entwicklungen erkennen kann, die auf dieses Problem zu reagieren scheinen. Die Lehre von den Zeichen scheint eine Form zu suchen, in der sie überleben kann in einer Gesellschaft, die das, was die Zeichen bezeichnen, in Frage stellt oder zumindest, könnte man sagen, „perspektiviert“.340 340
Ebd., S.63.
192 17. VORLESUNG
Auch bei Luhmann wird Semiotik nicht als kybernetische Wissenschaft, sondern als ideologische Reaktion und historische Verfassung charakterisiert, die sie vom Drang nach naturwissenschaftlichen Objektivität dispensieren. Denn in den gegenwärtigen Simultanprozessen der Gesellschaft gehen ja die Veränderungen nicht nur im historischen Maßstab mit ein, ja, sie werden so schnell integriert, dass es Mühe macht, sie analytisch im semiotischen Akt wieder zu dissoziieren. Als Simulation dieser Vermählung von Genauigkeit und Deutung dient der Soziologie die Statistik. Sie integriert Individualität als Krise. Es ist ein veralteter Gedanke geisteswissenschaftlicher Forschung, dass sie sich – als Kultur- und Medienwissenschaften renoviert – stets der Geschichtlichkeit ihrer Praktiken in langen Perioden erinnert und die Archive schafft, die Gesellschaften integrieren und absorbieren müssen, damit ihr individuelles Prozedieren Sinn ergibt. Lyotards Rede vom Ende der großen Erzählungen ist auch deshalb zumindest verzerrend, weil er die unendliche Zahl der kleinen Szenen übersieht, die „den Menschen“ verändern. Luhmann weitet die Darstellungsperspektive auf alle Wertsysteme aus, betont aber, dass auch die systemtheoretische Perspektive nur ein formales Rüstzeug für die Semiotik, nicht aber für die Semantik von gesellschaftlichen Wert- bzw. Kommunikationsystemen haben kann. Mindestens kann die aber feststellen, dass es verschiedene Epochen der Theoretisierung gibt, die auf solche gesellschaftlichen Normverschiebungen reagieren wie die einer sich zunehmend artikularisierenden „Präsenzgesellschaft“, die ihre Synchronitäten in Echtzeit integrieren und reintegrieren kann. Theorien spiegeln in diesem Sinne Erwartungshaltungen eines prospektiven Wissens zukünftiger Reintegration wieder. Die weiterführende Frage an die Systemtheorie wäre, ob unter Autopoiesis eine sukzessierende Verschiebung/Verdichtung, und nicht eine „Sichselbsthervorbringung“ deus ex machina verstanden wird. Die Epochen der semiotischen Theorie werden von Luhmann in bekannter Weise wie folgt beschrieben: Zunächst kommt es im 19. Jahrhundert zu einer Wiederaufnahme des Symbolbegriffs. Ein Zeichen ist ein Symbol, wenn es sich selbst als Zeichen bezeichnet; wenn es sich für selbstreferentiellen Gebrauch zur Verfügung hält. In einem zweiten Schritt, der durch die Verbindung von Semiologie und Sprachtheorie in der de Saussureschen Linguistik eingeleitet wird, kommt es zu einer Problematisierung der Referenz. Das Zeichen bestimmt sich durch seinen Unterschied von anderen Zeichen, durch eine Differenz, und zieht daraus genügend Bestimmtheit, um in kommunikative Operationen fungieren zu können, auch wenn das Bezeichnete unerreichbar bleibt bzw. an der Kommunikation nicht teilnehmen kann. Das Bezeichnete kann willkürlich bezeichnet werden – das berühmte und berüchtigte l’arbitraire du signe de Saussures.341
Das Bezeichnete, so Luhmann weiter, „kann in den späteren Entwicklungen der Semiologie dann auch schlicht weggelassen werden, indem man sich nur noch für die Differenz der Zeichen oder nur noch für ihre Körperlichkeit interessiert. Wir finden uns hier auf dem Weg, den Roland Barthes mit aller Konsequenz beschritten hat.“342 Dass Zeichen nur noch auf Zeichen referieren, stärkt entsprechend auch 341 342
Ebd. Ebd., S.64.
17. VORLESUNG 193
die Thesen Baudrillards, der von einem inszenatorischen Simulakrum ausgeht, also das Verhältnis von Vorbild (Entwurf ) und Nachbild (Realisierung) umkehrt: Der Entwurf selbst wird zur Realität bzw. er zeigt als Szene, wie die Freiheit der Möglichkeit schon durch deren Durchspielung (Tausch) als konventionalisiert, d.h. realisiert gilt. Die Realisierung gilt hier den Phantasmen der Geltung, des sozialen Aufstiegs, der Macht etc., und nicht des Besitzes und der Verdinglichung. Der Entwurf hat hier vollständig seine individualisierende Kraft eingebüßt. Zu einer tatsächlichen Verdinglichung im historischen Zeitraum kommt es auch deswegen nicht, weil die Sphäre der Invention, der Produktion und der Designation im Warenkörper völlig verdeckt sind: Waren sind qua Definition erst durch ihren Tauschwert präsent und verschwinden sofort vom Markt, wenn sie in Gebrauch sind. Die Präsenzgesellschaft braucht, wie der späte Barock, nur noch Attrappen aus Gips, Kleister und virtuellen Optiken, also infantiles Spielzeug, um auf ein (verlorenes) Jenseits im Diesseits der Zeichendifferenzen zu verweisen, die alle simultan gegenwärtig sind. Bedeutung und Zeichen fallen allegorisch zusammen. Die Differenzierungen fallen sämtlich in den Produktions- und Opferbereich jenseits sinnlicher Erfahrungen, sofern diese nicht durch Interfaces zum Konsum synthetisiert sind. Diesem Opferbereich der Produktionsmittel (Rohstoffe) genügt dann eine Integration in Umwelt als Ökologiedesign. An dieser Stelle kann man die Frage aufwerfen, ob Luhmann mit der Darstellung dieser Stadien der Semiotiken nur eine historische Veränderung anzeigt oder aber eine zunehmende, nicht weiter steigerungsfähige Universalisierung im Sinn hat. Er fragt: „Vollziehen wir, als Antwort auf die mehr und mehr erkennbar werdende Moderne, einen Übergang von Zeichen der Freiheit zur Freiheit der Zeichen?“343 Luhmann entkoppelt den Zeichenbegriff vom Selektionsbegriff, um deutlich zu machen, dass weder die historische noch die universalisierende Perspektive einen Zugriff auf die „Autonomie der Funktionssysteme“ beinhalten kann. Man kann nur noch eine Steuerung der Möglichkeiten und der Wahrscheinlichkeiten von Zukunft prospektieren, indem man die jeweiligen Werte der Gegenwart bestimmt – also beobachtet, was geschieht. Die Periode dieser Beobachtung ist nicht mehr die Historie, sondern die Szene, also die zur Abschließung drängende Eröffnung, die formal ein System darstellt. Damit reagiert die Systemtheorie in der Tat schon auf eine Präsenzgesellschaft, die wie ein führerloser Tanker auf den Weltmeeren treibt: Fluiditäten, die nur durch eine Membran der Realität (dem System) vor dem Emulgieren gehindert werden. „Mit dem Gebrauch von Zeichen verweisen die Funktionssysteme auf sich selber – auf ihren Gebrauch ihrer Zeichen.“344 Gebrauch ersetzt Herkunft. Demokratie ersetzt Repräsentation, so hat es Barthes in Bezug auf Saussure gesagt.345 Folglich geht es in der Systemtheorie, in Bezug auf den konventionellen Zeichenbegriff, um eine Verfeinerung „der Semiologie in eine allgemeine Theorie des Beobachtens“346, nicht um eine Theorie der Bedeutungen bzw. des Sinns. Letzterer ergibt sich aus der 343
Ebd. Ebd. 345 Barthes, Saussure, das Zeichen und die Demokratie, a.a.O. 346 Luhmann, Zeichen der Freiheit – oder Freiheit der Zeichen?, a.a.O., S.65. 344
194 17. VORLESUNG
Periodizität, genauer aus der Verzeitlichung, die das Beobachten registriert. Denn die Sätze „Mache eine Unterscheidung“ und „Mache eine Beobachtung“ unterscheiden sich ja gerade durch einen Akt der Präsentifikation und durch einen der Szenifikation, d.h. der Verzeitlichung. Die Beobachtung eines Systems kann nicht augenblicklich erfolgen. Behauptet sie dies, so kristallisiert das System zur Struktur unter dem Satz „Beobachte eine Unterscheidung“; das ist genau die Prämisse der Beobachtung eines strukturalen Feldes in anthropologischer Perspektive, also ohne prozessierende Variation, die zugleich Zeit braucht: Es ist folglich gar nicht möglich, eine Struktur situativ zu beobachten ohne nicht zugleich ihre Kalibrierung auf ein System, d.h. eine Zweiseitenform anzugeben. Von dieser Stabilität konnten Lévi-Strauss und der frühe Saussure der Linguistik aber noch ausgehen, weil sie die Dynamik der geschichtlichen Perioden, nicht aber die Dynamik intentionaler Akte erfassen konnten oder wollten. Nur erweist sich die anthropologische oder historische Perspektive im Hinblick auf die Probleme der heutigen, medientechnisch prozedieren Gesellschaft als zu groß gewählt. Es besteht kein topologischer Methodenunterschied, sondern ein periodischer. Versichern wir uns noch einmal des initialen (historischen) Ausgangspunktes um das Jahr 1900: Anlass für die Diskurseröffnung ist die Saussure’sche Unterscheidung/Bezeichnung von Signifikant|Signifikat, die als Relation (Form) mit zwei Relaten (Seiten) bestimmt wird, deren dritter Aspekt Peirce als Referenz (Referens) bestimmt hat und für den Saussure die markante barre (Linie) der Substitution indiziert hatte. Dieser „Balken“ ist kein eigentlich drittes Element, sondern die „Zwei-Seiten-Form ist das Zeichen, sie ist das ominöse ‚dritte‘ der triadischen Semiologie“347, die Unterscheidung. Sie entspricht formal der Durchsichtigkeit des operierenden Subjekts und der Undurchsichtigkeit der Gleichwahrscheinlichkeit der Individualität348, das Frank mit Sartre als „Selbstbewusstsein“ analysiert hat. Sie markiert eine präreflexive Verweisung, die den Wert hat, weder Identität noch Differenz zu sein, sondern der Operator als Zeit selbst. Das Selbstbewusstsein, dies entspricht der ursprünglichen Intention Heideggers, ist ein zeitliches Gegenwärtigsein (Dasein), das sich seiner Gegenwärtigkeit dadurch bewusst ist, dass es nicht gegenwärtig (präsent) sein kann, sondern in einem Vor- und Zurück, in einem Hin und Her als asymmetrisches „Nichts“ (néant) erscheint. Deswegen hatten wir mit Sartre gesagt, dass die situative Präsenz, die sich von der umfänglichen Zeitfolge (Mythos, Geschichte, Kausalität, Szene) emanzipiert und alles „Zuhandene“ gegenwärtig gleichzeitig verfügbar hält (wenn auch nur potentiell in Speichern der kulturellen Gedächtnisse oder aber in der Praxis eines elektrifizierten Heims) nicht mehr als historisches Bewusstsein, sondern als individuelles in einer Szene begegnet. Das „Ich“ wird als personale Größe frei, insofern diese in den gesellschaftlichen, synchronischen Konventionen der Zeichen agiert: Es ist Herr seiner Folgen. Und auch wenn es die Konventionen überschreitet, sorgen therapeutische, polizeiliche 347
Ebd., S.65.
348 Man könnte den Quanteneffekt als Beispiel anbringen: Ob Welle oder Teilchen: Die fremd- oder
selbstreferentielle Bedeutung ist nur als Effekt einer beobachtenden Unterscheidungshandlung zu bestimmen.
17. VORLESUNG 195
oder künstlerische Systeme für Begleitung, weil die möglichen Überschreitungen im Systemverhalten schon projektiv antizipiert sind. Der pragmatische Aspekt, der als drittes „Element“ des Zeichens angezeigt ist, verdeckt denn auch mehr die Operation, die die Zweiseitenform veranlasst. In diesem Veranlassen steckt die „eigentümliche Asymmetrie“ des Zeichens als Form.349 Sie ist, wie wir schon erfahren haben, dem nichtnegierbaren Wertverhältnis von Selbst- und Fremdreflexion geschuldet. Das Wort „Öl“ kann sich nicht selbst einölen. Die Zeichen untereinander und die Dinge untereinander bilden jeweils ein Wertverhältnis, das im Gebrauch sein „Crossing“ erfährt und so die Beobachterperspektive zu weiteren Unterscheidungen veranlasst – oder eben nicht. Der Beobachter kann nicht entscheiden, sich nicht zu entscheiden oder nicht zu beobachten. Er kann aber entscheiden, nicht sich selbst, sondern „Fremdes“ zu beobachten. Daraus kann, muss aber nicht ein Regress erfolgen. Genau hierin liegt nämlich die Freiheit, wenn man den Beobachter nicht als selbstbewusstes Subjekt transzendentaler Prägung bezeichnen will, das sich einem Telos unterwirft (sub-jektiert). Der Telos ist allein in der situierten Praxis Garant einer stabilen Dynamik des Aufschubs vom Tod und der Flucht in denselben. In der Unterscheidung/Bezeichnung wird nämlich stets ein Produktionsverhältnis als Endlichkeit, als Synthese wirksam, die letztlich das Ding als Produkt externalisiert und den Wert als Substanz ausweist. Für die Kunst gilt Gleiches in aufgeschlossener Form. „Jeder Schritt, der etwas festlegt, schafft zugleich auf der anderen Seite etwas noch zu bestimmendes, einen noch auszufüllenden unmarkierten Raum“350 – den ein Beobachter im Hinblick auf Fremdreferenz überschreiten kann: Der unmarkierte Raum, das ist die Zeit der Unterscheidung als Präsenz oder die Zeit der Dauer als Beobachtung. Luhmann nennt die Choreografien der zeitlichen oder räumlichen Dauer „Programmierung“. Inszenierungen sind Einheiten, in denen ein wie auch immer szenografisches Programm abläuft. Szenografie wird im weitesten Sinne als „Codierung“ und somit als „Produktion von Gegenwart“ verstanden. „Das Kunstwerk spezifiziert sich mit Hilfe einer Differenz von Codierung und Programmierung – ganz ähnlich, wie dies auch für andere Funktionssysteme gilt, für die Wissenschaft, für die Wirtschaft, für die Politik, für das Recht.“351 Weil Anfang und Ende als Rahmung frei gesetzt sind, können sich dazwischen Möglichkeiten eröffnen, die sonst verschlossen sind. Insbesondere die Schranke des Anfangs „Draw a distinction“352 ist von der Systemtheorie immer wieder problematisiert worden; das Ende allerdings weniger. Das hat mit einer durchgängigen Körpervergessenheit aller Beschreibungssysteme zu tun. Es ist schlicht Müdigkeit oder Unaufmerksamkeit, die jedes System mehr oder weniger von selbst in die Situativität der Entscheidungsletargie zurückwirft. Wenn aber die Aufmerksamkeit schwindet, naht der Rückfall in eine Präsenz ohne Index der Selbstpräsenz, die einen neuen Anfang aktiv protegieren kann; ein Rückfall in die das Subjekt a priori konstituierende Gruppe der Anderen. 349
Luhmann, Zeichen der Freiheit – oder Freiheit der Zeichen?, a.a.O., S.66. Ebd., S.69. 351 Ebd. 352 Ebd., S.71. 350
196 17. VORLESUNG
Auch das Prozessieren der Kunst in Werk und Aufführung, im Museum und Schauspiel lebt nicht von einer synchronen Performanz als „Unmittelbarkeit“. „Diese Mystifikation der Unmittelbarkeit, sei es Inspiration, sei es des Genusses, war wohl nur das letzte Bollwerk gegen die Zumutung, sich Zeit zu nehmen.“353 Reflexionszeit ist einerseits das Stiefkind der Präsenzgesellschaft, andererseits dessen gesellschaftliche Nobilitierung. Der heute die Moderne auszeichnende Extremismus der Zeitfugen ist das wirklich Neue. Die rasende Geschwindigkeit der Produktion wird zum Stillstand, wie Virilio vielfach belegt hat. Die Echtzeit ist eine Grenze, die nicht überschritten werden kann. Wenn sich dagegen eine Inszenierung des leiblichen Lebens im „Maß des Menschen“ durchsetzen will, geht das wohl nicht mehr ohne körperliche Symptome, die sich am Ende der Periode als deren Endlosigkeit ausweisen: Erschöpfungssyndrome als Endzeitinszenierungen und Angstsymptome und Depressionen als Imperative des Überbietungswillens von Präsenz. Hier hat man es mit gesellschaftlichen Symptomen zu tun, die in privatistischer Eigenmächtigkeit darauf hinweisen, was die Zeichen der Zeichen mit der Zeit machen. Solches Überbietungsverhalten muss als Widerstand gegen eine rastlose Zeit begriffen werden, die sich zugleich selbst sanktioniert. Benjamin und Virilio haben vom „Stillstand in Bewegung“ bzw. vom „rasenden Stillstand“ gesprochen. In einem sehr allgemeinen Sinne kann man mithin die moderne Gesellschaft dadurch charakterisieren, dass sie Freiheit und Beschränkung nicht als Widerspruch fasst, sondern als ein Problem, das durch Verzeitlichung der Differenz gelöst werden kann; aber das in jedem Funktionssystem auf jeweils andere, systemspezifische Weise.354
Sinn als Katharsis der Verzeitlichung hat nicht Konjunktur. Ausgerechnet die sprachlichen Zeichen (und die der Schrift) zeichnen sich in temporaler Hinsicht durch eine große Invarianz im Tempo und den Perioden aus. Sicher waren sie deshalb anfangs für eine Theorie des Zeichens von besonderem Interesse und sind mit besonderer Aufmerksamkeit auf strukturale Bedingungen hin bedacht worden. Bezüglich der theoretischen Entwürfe zum Zeichenbegriff ist ein Ende noch nicht absehbar, immerhin aber die Relevanz erkannt, beständig auf sie als besondere Systeme der Zeit des Menschlichen und der Zeitlichkeit des Menschen zurückzukommen.
353 354
Ebd., S.72. Ebd., S.74.
LITERATUR
Adorno, Theodor W.: Der Essay als Form. In: Ders.: Noten zur Literatur I. Frankfurt am Main 1969, S.9-49. Bachelard, Gaston: Der neue wissenschaftliche Geist. Frankfurt am Main 1988. Baecker, Dirk: Das Spiel mit der Form. In: Ders. (Hg.): Probleme der Form. Frankfurt am Main 1993, S.148-158. Barthes, Roland: Elemente der Semiologie. Frankfurt am Main 1981. Barthes, Roland: Die Lust am Text. Frankfurt am Main 1982. Barthes, Roland: Claude Lévi-Strauss. In: Ders.: Das semiologische Abenteuer. Frankfurt am Main 1988, S.168-180. Barthes, Roland: Das semiologische Abenteuer. Frankfurt am Main 1988. Barthes, Roland: Einführung in die strukturale Analyse von Erzählungen. In: Ders.: Das semiologische Abenteuer. Frankfurt am Main 1988, S.102-143. Barthes, Roland: Saussure, das Zeichen und die Demokratie. In: Ders.: Das semiologische Abenteuer. Frankfurt am Main 1988, S.159-164. Barthes, Roland: Semantik des Objekts. In: Ders.: Das semiologische Abenteuer. Frankfurt am Main 1988, S.187-198. Barthes, Roland: Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn. Kritische Essays Bd.III. Frankfurt am Main 1990. Barthes, Roland: Mythen des Alltags. Frankfurt am Main 2015. Baudrillard, Jean: Agonie des Realen. Berlin 1978. Baudrillard, Jean: Der Andere selbst. Habilitation. Wien 1987 Baudrillard, Jean: Das System der Dinge. Über unser Verhältnis zu den alltäglichen Gegenständen. Frankfurt am Main 1991. Baudrillard, Jean: Der symbolische Tausch und der Tod. München 1991. Baudrillard, Jean: Von der Verführung. München 1992. Baudrillard, Jean: Die Illusion des Endes oder Der Streik der Ereignisse. Berlin 1994. Baudrillard, Jean: Die Konsumgesellschaft. Ihre Mythen, ihre Strukturen. Heidelberg 2015. Benjamin, Walter: Metaphysisch-geschichtsphilosophische Studien. Erfahrung und Armut. In: Ders.: GS Bd.II. Frankfurt am Main 1980. Bergfleth, Gerd: Baudrillard und die Todesrevolte. In: Jean Baudrillard: Der symbolischer Tausch und Tod. München 1991, S.363-430. Blumenberg, Hans: Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher. Frankfurt am Main 1979. Blumenberg, Hans: Theorie der Unbegrifflichkeit. Frankfurt am Main 2007.
198 LITERATUR
Bohn, Ralf: Technikträume und Traumtechniken. Die Kultur der Übertragung und die Konjunktur des elektrischen Mediums. Würzburg 2004. Bohn, Ralf: Zahl, Zeichen, Zeit ... Die Geburt des Designs aus dem Geist der Mathematik. In: Christoph Weismüller (Hg.): Fragen nach der Mathematik. Düsseldorf 2007, S.26-67. Bohn, Ralf: Inszenierung des Widerstands. Bildkörper und Körperbild bei Paul Klee. Szenografie & Szenologie Bd.2. Bielefeld 2009. Bohn, Ralf: Szenische Hermeneutik. Verstehen, was sich nicht erklären lässt. Szenografie & Szenologie Bd.12. Bielefeld 2015. Campbell, Joseph: Der Heros in tausend Gestalten. Frankfurt am Main 1999. Christians, Heiko: Crux Scenica. Eine Kulturgeschichte der Szene von Aischylos bis YouTube. Bielefeld 2016. Dauthendey, Max: Des Teufels Künste (Leipziger Stadtanzeiger). In: Wolfgang Kemp (Hg.): Theorie der Fotografie Bd.I 1839-1912. München 1999, S.68-70. Debord, Guy: Die Gesellschaft des Spektakels. Berlin 1996. Deleuze, Gilles: Was ist Strukturalismus? Berlin 1992. Deleuze, Gilles: Die Falte. Leibniz und der Barock. Frankfurt am Main 2000. Derrida, Jacques: Die différance. In: Ders.: Randgänge der Philosophie. Frankfurt am Main 1976, S.6-37. Derrida, Jacques: Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen. In: Ders.: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt am Main 1976, S.422-443. Derrida, Jacques: Finis hominis. In: Ders.: Randgänge der Philosophie. Frankfurt am Main 1976, S.88-123. Derrida, Jacques: Freud und der Schauplatz der Schrift. In: Ders.: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt am Main 1976, S.302-352. Derrida, Jacques: Signatur Ereignis Kontext. In: Ders.: Randgänge der Philosophie. Frankfurt am Main 1976, S.124-155. Derrida, Jacques: Falschgeld. Zeit Geben 1. München 1993. Descombes, Vincent: Das Selbe und das Andere. Fünfundvierzig Jahre Philosophie in Frankreich 1933-1978. Frankfurt am Main 1981. Dosse, François: Geschichte des Strukturalismus Bd.1. Das Feld des Zeichens 19451966. Hamburg 1997. Dosse, François: Geschichte des Strukturalismus Bd.2. Das Zeichen der Zeit 19671991. Hamburg 1997. Eco, Umberto: Einführung in die Semiotik. München 1972. Eco, Umberto: Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen. München 1987. Ellenberger, Henry F.: Die Entdeckung des Unbewußten. Geschichte und Entwicklung der dynamischen Psychiatrie von den Anfängen bis zu Janet, Freud, Adler und Jung. Bern 1996.
LITERATUR 199
Esposito, Elena: Die Zwei-Seiten-Formen in der Sprache. In: Dirk Baecker (Hg.): Probleme der Form. Frankfurt am Main 1993, S.88-119. Field, Syd: Das Handbuch zum Drehbuch. Übungen und Anleitungen zu einem guten Drehbuch. Frankfurt am Main 1998. Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit. Frankfurt am Main 1983. Foucault, Michel: Technologien des Selbst. In: Ders.: Ästhetik der Existenz. Schriften zur Lebenskunst. Frankfurt am Main 2007, S.287-318. Frank, Manfred: Das individuelle Allgemeine. Textstrukturierung und -interpretation nach Schleiermacher. Frankfurt am Main 1977. Frank, Manfred: Was ist Neostrukturalismus? Frankfurt am Main 1983. Frank, Manfred: Ansichten der Subjektivität. Frankfurt am Main 2012. Frank, Manfred: Präreflexives Selbstbewusstsein. Vier Vorlesungen. Stuttgart 2015. Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips. In: Ders.: Das Ich und das Es und andere metapsychologische Schriften. Frankfurt am Main 1982, S.121-170. Freud, Sigmund: Die Traumdeutung. Frankfurt am Main 1984. Freud, Sigmund: Der Realitätsverlust bei Neurose und Psychose. In: Ders.: Schriften zur Krankheitslehre der Psychoanalyse. Frankfurt am Main 1991, S.271-280. Fülscher, Bernadette: Gebaute Bilder – künstliche Welten. Szenografie und Inszenierung an der Expo.02. Baden 2009. Gadamer, Hans-Georg: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen 1975. Giesecke, Michael: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Frankfurt am Main 2006. Göttert, Karl-Heinz: Geschichte der Stimme. München 1998. Greimas, Algirdas J.: Der wissenschaftliche Diskurs in den Sozialwissenschaften. In: Peter V. Zima (Hg.): Textsemiotik als Ideologiekritik. Frankfurt am Main 1977, S.77-114. Gumbrecht, Hans Ulrich: Diesseits der Hermeneutik. Eine Produktion von Präsenz. Frankfurt am Main 2004. Gumbrecht, Hans Ulrich: Präsenz. Frankfurt am Main 2012. Hegel, G.W.F.: Phänomenologie des Geistes. Frankfurt am Main 1980. Heidegger, Martin: Kant und das Problem der Metaphysik. Frankfurt am Main 1973. Heidegger, Martin: Anmerkungen zu Karl Jaspers „Psychologie der Weltanschauungen“ (1919/21). In: Ders.: Wegmarken. Frankfurt am Main 1976, S.1-44. Heidegger, Martin: Sein und Zeit. Tübingen 1979. Hemmings, F. W.: Emile Zola. Chronist und Ankläger seiner Zeit. München 1979. Henkel, Arthur/Schöne, Albrecht (Hg.): Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Stuttgart 1996.
200 LITERATUR
Herder, Johann Gottfried: Abhandlung über den Ursprung der Sprache. Stuttgart 1981. Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung. Frankfurt am Main 1979. Hörisch, Jochen: Kopf oder Zahl. Die Poesie des Geldes. Frankfurt am Main 1996. Hörisch, Jochen: Die Wut des Verstehens. Frankfurt am Main 1998. Hörisch, Jochen: Der Sinn und die Sinne. Eine Geschichte der Medien. Frankfurt am Main 2001. Hörisch, Jochen: Es gibt (k)ein richtiges Leben im falschen. Frankfurt am Main 2003. Husserl, Edmund: Logische Untersuchungen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis II/1. Tübingen 1980. Jäger, Ludwig: Linearität und Zeichensynthesis. In: Fugen: deutsch-französisches Jahrbuch für Text-Analytik 1980. Hgg. von Manfred Frank, Friedrich A. Kittler, Samuel Weber. Olten 1980, S.187-212. Jäger, Ludwig: Ferdinand de Saussure zur Einführung. Hamburg 2010. Kierkegaard, Sören: Die Krankheit zum Tode. Frankfurt am Main 1984. Kierkegaard, Sören: Die Wiederholung. Die Krise und eine Krise im Leben der Schauspielerin. Frankfurt am Main 1984. Kittler, Friedrich A.: Optische Medien. Berliner Vorlesungen 1999. Berlin 2002. Kittler, Friedrich A.: Rockmusik – ein Missbrauch von Heeresgerät. In: Ders.: Short Cuts Bd. 6. Frankfurt am Main 2002, S.7-29. Kittler, Friedrich A.: Die künstliche Intelligenz des Weltkriegs: Alan Turing. In: Ders: Die Wahrheit der technischen Welt. Essays zur Genealogie der Gegenwart. Frankfurt am Main 2013, S.232-252. Kittler, Friedrich A.: Pathos und Ethos. Eine aristotelische Betrachtung. In: Ders.: Die Wahrheit der technischen Welt. Essays zur Genealogie der Gegenwart. Frankfurt am Main 2013, S.391-395. Kraeutler, Hadwig: „Es war nicht üblich, Daten und ‚Botschaften‘ in Erlebnisräumen umzusetzen ...“. Zur Aktualität von Otto Neuraths Museums- und Ausstellungsarbeit. In: Tabellen, Kurven, Piktogramme. Techniken der Visualisierung in den Sozialwissenschaften. Mitteilungen des Instituts für Wissenschaft und Kunst 1-2/2009. Wien 2009. Kristeva, Julia: Der geschlossene Text. In: Peter V. Zima (Hg.): Textsemiotik als Ideologiekritik. Frankfurt am Main 1977, S.194-229. Kristeva, Julia: Semiologie als Ideologiewissenschaft. In: Peter V. Zima (Hg.): Textsemiotik als Ideologiekritik. Frankfurt am Main 1977, S.65-76. Kristeva, Julia: Semiologie – kritische Wissenschaft und/oder Wissenschaftskritik. In: Peter V. Zima (Hg.): Textsemiotik als Ideologiekritik. Frankfurt am Main 1977, S.35-53. Kristeva, Julia: Die Revolution der poetischen Sprache. Frankfurt am Main 1978. Lacan, Jacques: Das Drängen des Buchstabens im Unbewussten oder die Vernunft seit Freud. Schriften II. Olten 1975, S.15-55. Lacan, Jacques: Television. In: Ders.: Radiophonie. Television. Weinheim 1980.
LITERATUR 201
Laplanche, Jean: Die unvollendete kopernikanische Revolution in der Psychoanalyse. Frankfurt am Main 1996. Laplanche, Jean/Pontalis, Jean-Bertrand: Urphantasie. Phantasien über den Ursprung, Ursprünge der Phantasie. Frankfurt am Main 1992. Lauster, Jörg: Die Verzauberung der Welt. Eine Kulturgeschichte des Christentums. München 2015. Leroi-Gourhan, André: Hand und Wort. Die Evolution von Technik, Sprache und Kunst. Frankfurt am Main 1988. Lévi-Strauss, Claude: Das wilde Denken. Frankfurt am Main 1973. Lorenzer, Alfred: Sprache, Lebenspraxis und szenisches Verstehen in der psychoanalytischen Therapie. In: Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen 37. 1983. Luhmann, Niklas: Zeichen der Freiheit – oder Freiheit der Zeichen? In: Gerhard Johann Lischka (Hg.): Zeichen der Freiheit. Bern 1992, S.54-77. Luhmann, Niklas: Handlungstheorie und Systemtheorie. In: Ders.: Soziologische Aufklärung 3. Soziale Systeme, Gesellschaft, Organisation. Wiesbaden 2005, S.58-91. Mandelbrot, Benoît B.: Die fraktale Geometrie der Natur. Basel 1991. Mauss, Marcel: Die Gabe. In: Ders.: Soziologie und Anthropologie Bd.2. Frankfurt am Main 1989. Merleau-Ponty, Maurice: Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin 1966. Musil, Robert: Tagebücher. Reinbek 1976. Musil, Robert: Der Mann ohne Eigenschaften. GS Bd.2. Reinbek 1978. Nöth, Winfried: Handbuch der Semiotik. Stuttgart/Weimar 2000. Panofsky, Erwin: Ikonographie und Ikonologie. In: Ekkehard Kaemmerling (Hg.): Ikonographie und Ikonologie. Theorien, Entwicklung, Probleme. Bildende Kunst als Zeichensystem Bd.1. Köln 1979, S.207-225. Peirce, Charles Sanders: Semiotische Schriften 2 (1903-1906). Frankfurt am Main 1990. Peirce, Charles Sanders: Semiotische Schriften 3 (1906-1913). Essays über Bedeutung 1909-1910. Frankfurt am Main 1993. Posner, Roland/Robering, Klaus/Seboek, Thomas A. (Hg.): Semiotik. Semiotics. Ei Handbuch zu den Zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur. 3 Bände, Berlin 1997-2003. Rang, Florens Christian: Historische Psychologie des Karnevals. Berlin 1983. Raulet, Gérard: Natur und Ornament. Zur Erzeugung von Heimat. Darmstadt 1987. Reck, Hans Ulrich: Pier Paolo Pasolini. München 2010. Reck, Hans Ulrich: Traum. Enzyklopädie. München 2010. Sartre, Jean-Paul: Der Mensch und die Dinge. In: Ders.: Der Mensch und die Dinge. Aufsätze zur Literatur 1938-1946. Schriften zur Literatur Bd.1. Reinbek 1968, S.107-141. Sartre, Jean-Paul: Das Imaginäre. Phänomenologische Psychologie der Einbildungskraft. Reinbek 1971.
202 LITERATUR
Sartre, Jean-Paul: Marxismus und Existentialismus. Versuch einer Methodik. Reinbek 1971. Sartre, Jean-Paul: Kritik der dialektischen Vernunft. Theorie der gesellschaftlichen Praxis. Reinbek 1980. Saussure, Ferdinand de: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft [Cours de linguistique générale; *1916]. Hg. von Charles Bally/Albert Sechehaye. Berlin 1967. Schleiermacher, F.D.E.: Hermeneutik und Kritik. Frankfurt am Main 1977. Showalter, Elaine: Hystorien. Hysterische Epidemien im Zeitalter der Medien. Berlin 1997. Sohn-Rethel, Alfred: Das Geld, die bare Münze des Apriori. Berlin 1990. Stetter, Christian: Zum Verhältnis von Sprachsystem und Sprachgeschichte. In: Fugen: deutsch-französisches Jahrbuch für Text-Analytik 1980. Hgg. von Manfred Frank, Friedrich A. Kittler, Samuel Weber. Olten 1980, S.233-246. Tabaˇcki, Nebojša: Kinetische Bühnen. Sean Kennedy und Josef Svoboda – Szenografen als Wiedererfinder des Theaters. Szenografie & Szenologie Bd.10. Bielefeld 2014. Theunissen, Dieter: Der Begriff der Verzweiflung. Korrekturen an Kierkegaard. Frankfurt am Main 1993. Weber, Samuel: Das linke Zeichen. Zur Semiologie Saussures und Peirces. In: Fugen: deutsch-französisches Jahrbuch für Text-Analytik 1980. Hgg. von Manfred Frank, Friedrich A. Kittler, Samuel Weber. Olten 1980, S.43-63. Weismüller, Christoph: Zwischen analytischer und dialektischer Vernunft. Eine Metakritik zu Jean-Paul Sartres Kritik der dialektischen Vernunft. Würzburg 2004. Wilharm, Heiner: Magische Effekte oder Vom Verschwinden der Endlichkeit. Zur Ökonomie und Logik von Inszenierung und Szenifikation. In: Ralf Bohn/Heiner Wilharm (Hg.): Inszenierung und Effekte. Die Magie der Szenografie. Szenografie & Szenologie Bd.7. Bielefeld 2013. Wilharm, Heiner: Die Ordnung der Inszenierung. Szenografie & Szenologie Bd.8. Bielefeld 2015. Winnicott, D. W.: Von der Kinderheilkunde zur Psychoanalyse. Aus den „Collected Papers“. München 1976. Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Untersuchungen. Frankfurt am Main 1980. Zima, Peter V.: Diskurs als Ideologie. In: Ders. (Hg.): Textsemiotik als Ideologiekritik. Frankfurt am Main 1977, S.7-32. Žižek, Slavoj u.a.: Ein Triumph des Blicks über das Auge. Psychoanalyse bei Hitchcock. Wien 1998.
Szenografie & Szenologie Pamela C. Scorzin Scenographic Fashion Design – Zur Inszenierung von Mode und Marken Februar 2016, 272 Seiten, kart., zahlr. z.T. farb. Abb., 34,99 €, ISBN 978-3-8376-3413-6
Ralf Bohn, Heiner Wilharm (Hg.) Inszenierung und Politik Szenografie im sozialen Feld 2015, 346 Seiten, kart., zahlr. Abb., 34,99 €, ISBN 978-3-8376-3105-0
Ralf Bohn Szenische Hermeneutik Verstehen, was sich nicht erklären lässt 2015, 486 Seiten, kart., 39,99 €, ISBN 978-3-8376-3151-7
Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.transcript-verlag.de
Szenografie & Szenologie Heiner Wilharm Die Ordnung der Inszenierung 2015, 682 Seiten, kart., zahlr. z.T. farb. Abb., 39,99 €, ISBN 978-3-8376-2665-0
Christine Schranz Von der Dampf- zur Nebelmaschine Szenografische Strategien zur Vergegenwärtigung von Industriegeschichte am Beispiel der Ruhrtriennale 2013, 214 Seiten, kart., zahlr. z.T. farb. Abb., 29,99 €, ISBN 978-3-8376-2693-3
Ralf Bohn Inszenierung als Widerstand Bildkörper und Körperbild bei Paul Klee 2009, 282 Seiten, kart., zahlr. Abb., 33,80 €, ISBN 978-3-8376-1262-2
Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.transcript-verlag.de






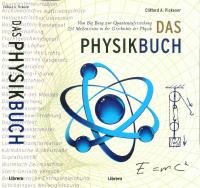
![Der selbstständig tätige Globalzedent in der Insolvenz: vom Eröffnungsantrag bis zur Restschuldbefreiung [2 ed.]
9783814559094](https://dokumen.pub/img/200x200/der-selbststndig-ttige-globalzedent-in-der-insolvenz-vom-erffnungsantrag-bis-zur-restschuldbefreiung-2nbsped-9783814559094-f-1952483.jpg)
![Der selbstständig tätige Globalzedent in der Insolvenz: vom Eröffnungsantrag bis zur Restschuldbefreiung [2 ed.]
9783814559094](https://dokumen.pub/img/200x200/der-selbststndig-ttige-globalzedent-in-der-insolvenz-vom-erffnungsantrag-bis-zur-restschuldbefreiung-2nbsped-9783814559094.jpg)

